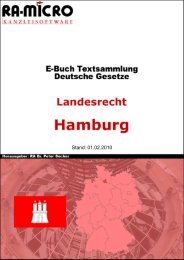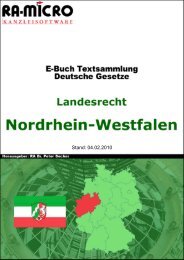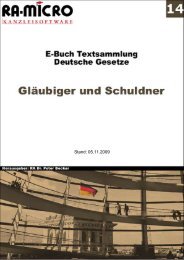RA-MICRO E-Gesetze: Bayerisches Landesrecht / Stand 09.02.10
RA-MICRO E-Gesetze: Bayerisches Landesrecht / Stand 09.02.10
RA-MICRO E-Gesetze: Bayerisches Landesrecht / Stand 09.02.10
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Stand</strong>: 09.02.2010
Inhaltsverzeichnis<br />
Allgemeiner Teil<br />
Konzept, Kontakt und Support<br />
Deutsche <strong>Gesetze</strong><br />
Bay AbfG Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von<br />
Abfällen in Bayern<br />
Bay AGBGB Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer<br />
<strong>Gesetze</strong><br />
Bay AGVwGO Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung<br />
Bay BauVorlV Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen<br />
Bay BekV Verordnung über die amtliche Bekanntmachung gemeindlicher<br />
Satzungen und von Rechtsvorschriften der Verwaltungsgemeinschaften<br />
Bay BezO Bezirksordnung für den Freistaat Bayern<br />
Bay BG <strong>Bayerisches</strong> Beamtengesetz<br />
Bay BO Bayerische Bauordnung<br />
Bay DSchG Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler<br />
Bay DSG <strong>Bayerisches</strong> Datenschutzgesetz<br />
Bay EUG <strong>Bayerisches</strong> Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen<br />
Bay GastV Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes<br />
Bay GefHundeV Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und<br />
Gefährlichkeit<br />
Bay GLKrWG Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der<br />
Kreistage und der Landräte<br />
Bay GO Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern<br />
Bay GrKrV Verordnung über Aufgaben der Großen Kreisstädte
Bay ImSchG <strong>Bayerisches</strong> Immissionsschutzgesetz<br />
Bay JG <strong>Bayerisches</strong> Jagdgesetz<br />
Bay KAG Kommunalabgabengesetz<br />
Bay KG Kostengesetz<br />
Bay KommZG Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit<br />
Bay KSG <strong>Bayerisches</strong> Katastrophenschutzgesetz<br />
Bay KWBG Gesetz über kommunale Wahlbeamte<br />
Bay LbV Verordnung über die Laufbahnen der bayerischen Beamtinnen und<br />
Beamten<br />
Bay LKrO Landkreisordnung für den Freistaat Bayern<br />
Bay LSchlV Ladenschlussverordnung<br />
Bay LStVG Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf<br />
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br />
Bay LWG Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid<br />
Bay MeldeG Gesetz über das Meldewesen<br />
Bay MG Gesetz über die Entwicklung, Förderung und Veranstaltung privater<br />
Rundfunkangebote und anderer Telemedien in Bayern<br />
Bay NatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft<br />
und die Erholung in der freien Natur<br />
Bay PAG Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen<br />
Staatlichen Polizei<br />
Bay POG Gesetz über die Organisation der Bayerischen Staatlichen Polizei<br />
Bay PrG <strong>Bayerisches</strong> Pressegesetz<br />
Bay SchlG <strong>Bayerisches</strong> Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen<br />
Streitschlichtung in Zivilsachen und zur Änderung<br />
gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften<br />
Bay StrWG <strong>Bayerisches</strong> Straßen- und Wegegesetz
Bay Verfassung Verfassung des Freistaates Bayern<br />
Bay VfGHG Gesetz über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof<br />
Bay VGemO Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat Bayern<br />
Bay VwVfG <strong>Bayerisches</strong> Verwaltungsverfahrensgesetz<br />
Bay VwZVG <strong>Bayerisches</strong> Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz<br />
Bay ZuVOWiG Verordnung über Zuständigkeiten im<br />
Ordnungswidrigkeitenrecht
Konzept, Kontakt und Support<br />
Die <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> E-Buch Textsammlung Deutsche <strong>Gesetze</strong> wird von der<br />
<strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> Software GmbH veröffentlicht.<br />
<strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> ist der deutsche Marktführer für Anwalts-EDV. Über 12.000<br />
Anwaltskanzleien mit etwa 56.000 Arbeitsplätzen arbeiten bereits mit <strong>RA</strong>-<br />
<strong>MICRO</strong>, jährlich kommen ca. 800 Kanzleien hinzu. Mit <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong><br />
ausgestattete Anwaltskanzleien arbeiten auf modernster Organisationsbasis<br />
und können so ihren Mandanten optimalen Service bieten.<br />
Mit der <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> E-Buch Textsammlung Deutsche <strong>Gesetze</strong> bietet <strong>RA</strong>-<br />
<strong>MICRO</strong> seinen anwaltlichen Kunden das derzeit aktuellste Werkzeug für die<br />
optimale <strong>Gesetze</strong>snutzung in Deutschland. Mit der ra e suite können die<br />
einzelnen Bände der E-<strong>Gesetze</strong> im Format *.PDF stets aktuell heruntergeladen<br />
werden.<br />
Herausgeber der <strong>Gesetze</strong> ist, soweit in den einzelnen Bänden nichts<br />
Abweichendes angegeben ist, Rechtsanwalt Dr. Peter Becker, Berlin. Die <strong>RA</strong>-<br />
<strong>MICRO</strong> E-Buch Textsammlung wird bearbeitet von der juristischen<br />
Redaktion der <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> Software GmbH in Kooperation mit der<br />
<strong>Gesetze</strong>sredaktion des Boorberg Verlags.<br />
Die <strong>Gesetze</strong> werden umgehend nach Inkrafttreten einer Änderung aktualisiert,<br />
in der Regel spätestens innerhalb von 14 Tagen. Werden neue <strong>Gesetze</strong> in die<br />
Textsammlung aufgenommen, werden diese nach Möglichkeit am Tage ihres<br />
Inkrafttretens in dem jeweiligen E-Buch-Band veröffentlicht.<br />
Die E-Buch Textsammlung wird laufend erweitert. Derzeit sind rund 750<br />
Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen sowie europarechtliche Normen<br />
im Angebot.<br />
Wir empfehlen, die <strong>Gesetze</strong> regelmäßig - mindestens einmal monatlich<br />
- zu aktualisieren.<br />
Kontakt:<br />
<strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> Software GmbH<br />
Heinrich-Hertz-Straße 1c, 14532 Europarc Dreilinden<br />
www.ra-micro.de<br />
support@ra-micro.de<br />
Technischen Support zur <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> E-Buch Textsammlung Deutsche<br />
<strong>Gesetze</strong> erhalten Sie telefonisch unter 030 43598790 oder bei support@ramicro.de.<br />
Die <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> Software GmbH, der Herausgeber und die Redaktion sind<br />
bemüht, die <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> E-Buch Textsammlung Deutsche <strong>Gesetze</strong> stets in<br />
aktueller und inhaltlich korrekter Form anzubieten. Dennoch ist das Auftreten<br />
von Fehlern nicht völlig auszuschließen. <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong> übernimmt keinerlei<br />
Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten<br />
E-Bücher. Haftungsansprüche gegen <strong>RA</strong>-<strong>MICRO</strong>, welche sich auf Schäden
materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung der<br />
dargebotenen E-Bücher verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Gesetz zur Vermeidung, Verwertung<br />
und sonstigen Entsorgung von Abfällen<br />
in Bayern (Bay AbfG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 1996 (GVBl. S. 396, ber. S. 449), geändert<br />
durch <strong>Gesetze</strong> vom 23. Februar 1999 (GVBl. S. 36), vom 16. Dezember 1999 (GVBl. S. 521), vom<br />
24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 25. Mai 2003 (GVBl. S. 325), vom 5. April 2006 (GVBl. S. 178)<br />
(FN BayRS 2129-2-1-UG)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Ziele der Abfallwirtschaft, Pflichten der öffentlichen Hand<br />
Artikel 1 Ziele der Abfallwirtschaft<br />
Artikel 2 Pflichten der öffentlichen Hand<br />
ZWEITER TEIL Träger der Abfallentsorgung<br />
Artikel 3 Entsorgungspflichtige Körperschaften<br />
Artikel 4 Mindestausstattung mit Entsorgungseinrichtungen und -anlagen<br />
Artikel 5 Mitwirkung kreisangehöriger Gemeinden<br />
Artikel 6 Verbot der Wegnahme getrennt bereitgestellter Abfälle<br />
Artikel 7 Satzungen zur Regelung der kommunalen Abfallentsorgung<br />
Artikel 8 Zusammenschlüsse<br />
Artikel 9 Besondere Einrichtungen<br />
Artikel 10 Entsorgung von Sonderabfällen<br />
DRITTER TEIL Abfallwirtschaftsplan, Abfallbilanz und<br />
Abfallwirtschaftskonzept<br />
Artikel 11 Abfallwirtschaftsplan<br />
Artikel 12 Abfallbilanz<br />
Artikel 13 Abfallwirtschaftskonzept der entsorgungspflichtigen Körperschaft<br />
VIERTER TEIL Abfallbeseitigungsanlagen
ABSCHNITT I Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren<br />
Artikel 14 Veränderungssperre<br />
Artikel 15bis 19<br />
ABSCHNITT II Beseitigung und Stillegung von Deponien<br />
Artikel 20 Baueinstellung, Beseitigungsanordnung, Betriebsuntersagung<br />
Artikel 21 Pflichten des Inhabers untersagter Deponien<br />
Artikel 22 Stillgelegte Deponien<br />
FÜNFTER TEIL Finanzielle Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen<br />
Artikel 23 Gewährung von Finanzierungshilfen<br />
Artikel 24 Finanzielle Förderung durch die Kommunen<br />
Artikel 25 Übergangsregelung<br />
SECHSTER TEIL<br />
Artikel 26bis 28<br />
SIEBTER TEIL Sachliche Zuständigkeit, Anordnungen für den Einzelfall,<br />
Aufsicht<br />
Artikel 29 Sachliche Zuständigkeit<br />
Artikel 30 Anordnungen für den Einzelfall<br />
Artikel 31 Beseitigung verbotener Ablagerungen<br />
Artikel 32 Aufsicht und Überwachung<br />
ACHTER TEIL Ordnungswidrigkeiten<br />
Artikel 33 Ordnungswidrigkeiten<br />
NEUNTER TEIL Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
Artikel 34
Artikel 35 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
ERSTER TEIL Ziele der Abfallwirtschaft, Pflichten der öffentlichen Hand<br />
Bay AbfG Artikel 1 Ziele der Abfallwirtschaft<br />
(1) 1 Ziele der Abfallwirtschaft sind,<br />
1. den Anfall von Abfällen so gering wie möglich zu halten<br />
(Abfallvermeidung),<br />
2. Schadstoffe in Abfällen soweit wie möglich zu vermeiden oder zu<br />
verringern (Schadstoffminimierung),<br />
3. angefallene Abfälle, insbesondere Glas, Papier, Metall, Kunststoff,<br />
Bauschutt und kompostierbare Stoffe, weitestgehend in den Stoffkreislauf<br />
zurückzuführen (stoffliche Abfallverwertung),<br />
4. nicht verwertbare Abfälle so zu behandeln, daß sie umweltverträglich<br />
verwertet oder abgelagert werden können (Abfallbehandlung); die<br />
thermische Behandlung ist nur für solche Abfälle zulässig, für die die<br />
Maßnahmen nach Nummern 1 bis 3 ausgeschöpft werden,<br />
5. nicht verwertbare oder nicht weiter zu behandelnde Abfälle<br />
umweltverträglich abzulagern (Abfallablagerung).<br />
2<br />
Die Ziele sind nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes<br />
(KrW-/AbfG) so zu verwirklichen, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht<br />
beeinträchtigt wird, insbesondere nicht durch eine Gefährdung der<br />
menschlichen Gesundheit und der Umwelt.<br />
(2) Jede einzelne Person soll durch ihr Verhalten dazu beitragen, daß die Ziele<br />
der Abfallwirtschaft erreicht werden.<br />
(3) Zur Erreichung der Ziele der Abfallwirtschaft wirkt der Freistaat Bayern im<br />
Rahmen seiner Zuständigkeit insbesondere hin auf<br />
1. das abfallarme und die Verwertung begünstigende Herstellen, Be- und<br />
Verarbeiten und Inverkehrbringen von Erzeugnissen,<br />
2. die Erhöhung der Gebrauchsdauer und Haltbarkeit von Erzeugnissen,<br />
3. die Steigerung der Wiederverwendung von Erzeugnissen,<br />
4. die Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur Verwertung von<br />
Abfällen,<br />
5. die Verminderung des Schadstoffgehalts von Abfällen.<br />
Bay AbfG Artikel 2 Pflichten der öffentlichen Hand<br />
(1) 1 Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und die sonstigen juristischen<br />
Personen des öffentlichen Rechts haben vorbildhaft dazu beizutragen, daß<br />
die Ziele des Art. 1 Abs. 1 erreicht werden. 2 Dazu sind finanzielle<br />
Mehrbelastungen und Minderungen der Gebrauchstauglichkeit in<br />
angemessenem Umfang hinzunehmen.<br />
(2) Die in Absatz 1 genannten juristischen Personen sind insbesondere<br />
verpflichtet,<br />
1. bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen und bei ihrem sonstigen<br />
Handeln, vor allem im Beschaffungs- und Auftragswesen und bei<br />
Bauvorhaben, möglichst Erzeugnisse zu berücksichtigen, die sich durch<br />
Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder<br />
Verwertbarkeit auszeichnen, im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu<br />
weniger oder zu entsorgungsfreundlicheren Abfällen führen und aus
Abfällen hergestellt worden sind,<br />
2. Dritte zu einer Handhabung entsprechend Nummer 1 zu verpflichten,<br />
wenn sie diesen ihre Einrichtungen oder Grundstücke zur Verfügung<br />
stellen oder Zuwendungen bewilligen.<br />
(3) Die in Absatz 1 genannten juristischen Personen wirken im Rahmen ihrer<br />
Möglichkeiten darauf hin, daß Gesellschaften des privaten Rechts, an<br />
denen sie beteiligt sind, die Verpflichtungen des Absatz 2 beachten.<br />
ZWEITER TEIL Träger der Abfallentsorgung<br />
Bay AbfG Artikel 3 Entsorgungspflichtige Körperschaften<br />
(1) 1 Die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden sind für die in ihrem<br />
Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinn<br />
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (entsorgungspflichtige<br />
Körperschaften). 2 Sie erfüllen die sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und<br />
Abfallgesetz und aus diesem Gesetz ergebenden Aufgaben als<br />
Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis.<br />
(2) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften können mit Zustimmung der<br />
zuständigen Behörde durch Satzung oder Anordnung für den Einzelfall<br />
Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung ausschließen, soweit diese<br />
der Rücknahmepflicht aufgrund einer nach § 24 KrW-/AbfG erlassenen<br />
Rechtsverordnung unterliegen und entsprechende<br />
Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen. 2 Satz 1 gilt<br />
auch für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als<br />
privaten Haushaltungen, soweit diese nach Art, Menge oder<br />
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen<br />
beseitigt werden können.<br />
(3) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften haben Abfälle aus<br />
Haushaltungen, die wegen ihres Schadstoffgehalts zur Wahrung des Wohls<br />
der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen, getrennt von<br />
den sonstigen Abfällen einzusammeln, zu befördern, zu behandeln, zu<br />
lagern oder abzulagern. 2 Dies gilt auch für haushaltsübliche Kleinmengen<br />
vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit<br />
sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden können.<br />
(4) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften wirken in ihrem<br />
Zuständigkeitsbereich darauf hin, daß möglichst wenig Abfall entsteht.<br />
2<br />
Insbesondere beraten sie die Abfallbesitzer über die Möglichkeiten zur<br />
Vermeidung und Verwertung von Abfällen. 3 Sie bestellen Fachkräfte zur<br />
Beratung der Abfallbesitzer.<br />
(5) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften haben Anlagen zur Verwertung<br />
und zur Beseitigung von Abfällen nach dem <strong>Stand</strong> der Technik zu<br />
errichten, zu betreiben und entsprechend zu überwachen.<br />
Bay AbfG Artikel 4 Mindestausstattung mit Entsorgungseinrichtungen<br />
und -anlagen<br />
(1) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften haben Systeme zur stofflichen<br />
Verwertung einzuführen, die mindestens Wertstoffhöfe sowie, soweit nicht<br />
gesonderte Holsysteme eingeführt sind oder werden, Bringsysteme<br />
wenigstens für Glas, Papier und Metall umfassen. 2 Die Verpflichtung
esteht nicht, soweit entsprechende privatwirtschaftliche<br />
Erfassungssysteme tatsächlich eingerichtet sind.<br />
(2) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften haben Anlagen zu errichten<br />
und zu betreiben, in denen die nach Ausschöpfung der Möglichkeiten nach<br />
Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 verbleibenden Abfälle so behandelt<br />
werden, daß sie verwertet oder nach Maßgabe der Zuordnungswerte für<br />
Deponien nach § 3 in Verbindung mit Anhang 1 der<br />
Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) oder nach § 4 in Verbindung mit<br />
Anhang 2 AbfAblV weitgehend mineralisiert und stabilisiert abgelagert<br />
werden können.<br />
(3) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften haben mindestens eine<br />
Deponie der Deponieklasse II nach § 2 Nr. 9 in Verbindung mit Anhang 1<br />
oder Anhang 2 AbfAblV mit einer ausreichenden verfügbaren<br />
Nutzungsdauer zu errichten und zu betreiben.<br />
Bay AbfG Artikel 5 Mitwirkung kreisangehöriger Gemeinden<br />
(1) 1 Die Landkreise können durch Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der<br />
Abfallentsorgung den kreisangehörigen Gemeinden oder deren<br />
Zusammenschlüssen mit deren Zustimmung übertragen, wenn eine<br />
ordnungsgemäße Abfallentsorgung gewährleistet ist und die Festlegungen<br />
des Abfallwirtschaftsplans nicht entgegenstehen. 2 Das Einsammeln,<br />
Befördern und Kompostieren pflanzlicher Abfälle allein oder zusammen mit<br />
organischen Bestandteilen von Abfällen aus Haushaltungen kann der<br />
Landkreis im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden oder ihren<br />
Zusammenschlüssen übertragen; auf Antrag kreisangehöriger Gemeinden<br />
oder ihrer Zusammenschlüsse soll der Landkreis diese Aufgaben<br />
übertragen. 3 In den Fällen der Sätze 1 und 2 nehmen die<br />
kreisangehörigen Gemeinden die Rechte und Pflichten der<br />
entsorgungspflichtigen Körperschaften wahr.<br />
(2) 1 Die kreisangehörigen Gemeinden unterstützen den Landkreis bei der<br />
Durchführung von Verwertungsmaßnahmen auf ihrem Gebiet. 2 Sie stellen<br />
insbesondere Grundstücke, Einrichtungen und Personal zur Erfassung von<br />
stofflich verwertbaren Abfällen bereit. 3 Vor der Festlegung solcher<br />
Maßnahmen hat der Landkreis den kreisangehörigen Gemeinden<br />
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4 Die Kosten für die Leistungen<br />
der kreisangehörigen Gemeinden nach den Sätzen 1 und 2 trägt der<br />
Landkreis.<br />
Bay AbfG Artikel 6 Verbot der Wegnahme getrennt bereitgestellter<br />
Abfälle<br />
Abfälle, die der überlassungspflichtige Besitzer in Erfüllung einer<br />
satzungsrechtlichen Verpflichtung oder einer entsprechenden Empfehlung<br />
getrennt von den sonstigen Abfällen zum Einsammeln durch die<br />
entsorgungspflichtige Körperschaft oder deren Beauftragten bereitgestellt hat,<br />
dürfen Dritte nicht an sich nehmen.
Bay AbfG Artikel 7 Satzungen zur Regelung der kommunalen<br />
Abfallentsorgung<br />
(1) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften regeln durch Satzung den<br />
Anschlußzwang (Art. 18 der Landkreisordnung, Art. 24 der<br />
Gemeindeordnung) und die Überlassungspflicht (§ 13 KrW-/AbfG). 2 Sie<br />
können insbesondere bestimmen, in welcher Art, in welcher Weise, an<br />
welchem Ort und zu welcher Zeit ihnen die Abfälle zu überlassen sind.<br />
3<br />
Die Besitzer von Abfällen sind zur getrennten Überlassung zu<br />
verpflichten, soweit die Pflicht der entsorgungspflichtigen Körperschaften<br />
zur stofflichen Verwertung reicht, die getrennte Erfassung der Abfälle der<br />
Nutzung von Verwertungsmöglichkeiten oder der ordnungsgemäßen<br />
Entsorgung sonst förderlich ist oder in einer Rechtsverordnung nach § 24<br />
KrW-/AbfG vorgeschrieben ist. 4 In den Fällen des Satzes 3 kann auch<br />
verlangt werden, Abfälle an zentralen Sammelstellen zu überlassen,<br />
soweit das Einsammeln am Anfallort nur mit erheblichem Aufwand möglich<br />
und das Verbringen zur Sammelstelle den Besitzern zumutbar ist.<br />
(2) 1 Die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden erheben für die<br />
Entsorgung der Abfälle Gebühren. 2 In den Fällen des Art. 5 Abs. 1 Sätze 1<br />
und 2 werden die Gebühren von den kreisangehörigen Gemeinden oder<br />
ihren Zusammenschlüssen erhoben, soweit Abfälle ihnen überlassen oder<br />
von ihnen ohne Überlassung eingesammelt werden. 3 Soweit für<br />
bestimmte Abfälle nur einzelne Maßnahmen der Entsorgung übertragen<br />
werden, bemißt die für das Einsammeln zuständige Körperschaft die<br />
Gebühren so, daß hierin auch die Entgelte eingeschlossen sind, die der<br />
anderen Körperschaft für die Durchführung der ihr obliegenden<br />
Maßnahmen zustehen.<br />
(3) Zur Deckung des Investitionsaufwands für ihre öffentlichen<br />
Entsorgungseinrichtungen können die entsorgungspflichtigen<br />
Körperschaften auch Beiträge erheben.<br />
(4) 1 Soweit die Entsorgung der Abfälle einzelner Besitzer nach Art oder<br />
Menge besondere Anlagen, Einrichtungen oder sonstige Aufwendungen<br />
erfordert, können wegen der daraus entstehenden Mehrkosten von den<br />
Besitzern besondere Gebühren und Beiträge erhoben werden. 2 Für diese<br />
Gebühren und Beiträge kann eine angemessene Sicherheitsleistung<br />
verlangt werden.<br />
(5) Für die Gebühren- und Beitragserhebung gelten Art. 2 Abs. 1 und 2,<br />
Art. 5, 8 und 12 bis 17 des Kommunalabgabengesetzes mit der Maßgabe<br />
entsprechend, daß<br />
1. Beiträge auch von Gewerbetreibenden erhoben werden können,<br />
1 a. durch die erhobenen Gebühren und Beiträge alle Kosten für die<br />
Abfallablagerung (Kosten für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie<br />
oder einer vom Anwendungsbereich der Richtlinie 1999/31/EG des Rates<br />
vom 26. April 1999 über Abfalldeponien, ABl EG Nr. L 182 S. 1, erfassten<br />
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage einschließlich<br />
der Kosten einer zu leistenden Sicherheit oder eines zu erbringenden<br />
gleichwertigen Sicherungsmittels, sowie die geschätzten Kosten für die<br />
Stilllegung und die Nachsorge für einen Zeitraum von mindestens<br />
30 Jahren) abgedeckt werden müssen,<br />
2. zu den ansatzfähigen Kosten auch die durch Rückstellungen nicht
gedeckten Aufwendungen für notwendige Vorkehrungen an den nach dem<br />
10. Juni 1972 stillgelegten Abfallbeseitigungsanlagen sowie die<br />
Aufwendungen für Maßnahmen nach Art. 3 Abs. 4, Art. 5 Abs. 2 und<br />
Art. 24 gehören,<br />
3. zu den ansatzfähigen Kosten auch die in ordnungsgemäßer<br />
Wahrnehmung der Pflichtaufgabe nach Art. 3 Abs. 1 entstandenen<br />
Aufwendungen für Planung und Entwicklung nicht verwirklichter Vorhaben<br />
gehören,<br />
4. zu den ansatzfähigen Kosten auch die in ordnungsgemäßer<br />
Wahrnehmung der Pflichtaufgabe nach Art. 3 Abs. 1 entstandenen<br />
Aufwendungen für Maßnahmen zur Beseitigung unerlaubter<br />
Abfallablagerungen gehören, soweit ein Pflichtiger nicht in Anspruch<br />
genommen werden kann,<br />
5. im Rahmen des Äquivalenz- und des Kostendeckungsprinzips<br />
entsprechend den Abfallmengen progressiv gestaffelte Gebühren erhoben<br />
werden können, um Anreize zur Vermeidung von Abfällen zu schaffen,<br />
6. auf Grund einer entsprechenden Bestimmung in der Satzung der<br />
entsorgungspflichtigen Körperschaft die Ermittlung der<br />
Berechnungsgrundlagen, die Gebühren- oder Beitragsabrechnung, die<br />
Ausfertigung und Versendung der Bescheide sowie die Entgegennahme<br />
der zu entrichtenden Gebühren oder Beiträge von einem damit<br />
beauftragten zuverlässigen Dritten wahrgenommen werden können.<br />
Bay AbfG Artikel 8 Zusammenschlüsse<br />
(1) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften können zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben, auch mit sonst nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br />
oder diesem Gesetz zur Abfallentsorgung Verpflichteten, nach Maßgabe<br />
des <strong>Gesetze</strong>s über die kommunale Zusammenarbeit zusammenwirken,<br />
insbesondere sich zu Zweckverbänden zusammenschließen.<br />
2<br />
Entsorgungspflichtige Körperschaften können auch zu Zweckverbänden<br />
zusammengeschlossen werden, sofern dies aus zwingenden Gründen des<br />
öffentlichen Wohls geboten ist, insbesondere wenn dadurch<br />
1. die Erfüllung der Entsorgungspflicht durch die Verpflichteten erst<br />
möglich wird,<br />
2. die Entsorgung insgesamt wesentlich wirtschaftlicher gestaltet werden<br />
kann.<br />
(2) 1 Entsorgungspflichtige Körperschaften können sich zur Erfüllung ihrer<br />
Verpflichtungen auch an Gesellschaften des privaten Rechts beteiligen.<br />
2<br />
Art. 91 der Gemeindeordnung, Art. 79 der Landkreisordnung und Art. 40<br />
des <strong>Gesetze</strong>s über die kommunale Zusammenarbeit bleiben unberührt.<br />
Bay AbfG Artikel 9 Besondere Einrichtungen<br />
(1) Der Freistaat Bayern kann unter Heranziehung der Entsorgungspflichtigen<br />
besondere Einrichtungen zur Beseitigung von Abfällen, die wegen ihrer<br />
Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen<br />
anfallenden Abfällen beseitigt werden können, schaffen, übernehmen oder<br />
sich an derartigen Einrichtungen selbst beteiligen.<br />
(2) Entsprechendes gilt für Einrichtungen, die die Verwertung, insbesondere<br />
die Vermarktung der gewonnenen Produkte betreiben oder unterstützen.
Bay AbfG Artikel 10 Entsorgung von Sonderabfällen<br />
(1) 1 Die Besitzer besonders überwachungsbedürftiger Abfälle zur Beseitigung<br />
im Sinn des § 41 Abs. 1 KrW-/AbfG, die gemäß Art. 3 Abs. 2 von der<br />
Entsorgung ausgeschlossen sind (Sonderabfälle), haben sich zur Erfüllung<br />
ihrer Entsorgungspflicht der Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll<br />
in Bayern mbH oder der SEF-Sonderabfall-Entsorgung Franken GmbH zu<br />
bedienen. 2 Der Umfang der Überlassungspflicht nach Satz 1 sowie die Art<br />
und Weise ihrer Erfüllung bestimmen sich nach dem Abfallwirtschaftsplan.<br />
(2) Die Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll in Bayern mbH und die<br />
SEF-Sonderabfall-Entsorgung Franken GmbH haben regionale<br />
Sammelstellen zur dezentralen Erfassung von Sondermüll zu errichten.<br />
DRITTER TEIL Abfallwirtschaftsplan, Abfallbilanz und<br />
Abfallwirtschaftskonzept<br />
Bay AbfG Artikel 11 Abfallwirtschaftsplan<br />
(1) 1 Die Staatsregierung stellt nach Anhörung der entsorgungspflichtigen<br />
Körperschaften, der sonstigen Entsorgungsträger oder ihrer Verbände und<br />
der berührten Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 29<br />
Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände mit Zustimmung des<br />
Landtags einen Abfallwirtschaftsplan als Rechtsverordnung auf. 2 Im<br />
Abfallwirtschaftsplan sind über die Festlegungen nach § 29 Abs. 1 bis 6<br />
KrW-/AbfG hinaus Festlegungen über Maßnahmen zur Abfallvermeidung,<br />
zur Abfallverwertung einschließlich Verwertungsquoten und zur getrennten<br />
Entsorgung schadstoffhaltiger Abfälle zu treffen. 3 Der<br />
Abfallwirtschaftsplan soll eine Verteilung der Abfallbeseitigungsanlagen<br />
entsprechend den anfallenden Abfallmengen vorgeben, die eine<br />
angemessene arbeitsteilige Mitwirkung aller entsorgungspflichtigen<br />
Körperschaften sicherstellt. 4 Die Möglichkeiten der kommunalen<br />
Zusammenarbeit sollen insbesondere im Interesse der<br />
Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. 5 Der Abfallwirtschaftsplan<br />
kann in sachlichen und räumlichen Teilabschnitten aufgestellt werden.<br />
6<br />
Die Vorschriften des <strong>Gesetze</strong>s über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu<br />
Notwendigkeit und Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung für<br />
Pläne und Programme bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen kann<br />
auf Antrag einer entsorgungspflichtigen Körperschaft oder eines sonstigen<br />
Entsorgungsträgers Ausnahmen von den Festlegungen des<br />
Abfallwirtschaftsplans zulassen, wenn die Ziele des Kreislaufwirtschaftsund<br />
Abfallgesetzes, dieses <strong>Gesetze</strong>s und des Abfallwirtschaftsplans nicht<br />
beeinträchtigt werden und sonstige Belange des Gemeinwohls nicht<br />
entgegenstehen. 2 Werden die Belange anderer entsorgungspflichtiger<br />
Körperschaften oder anderer sonstiger Entsorgungsträger berührt, sind<br />
diese vor der Entscheidung zu hören.<br />
Bay AbfG Artikel 12 Abfallbilanz<br />
(1) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften erstellen bis zum 31. März<br />
jeweils für das abgelaufene Jahr eine Bilanz über Art, Herkunft und Menge<br />
der angefallenen Abfälle sowie deren Verwertung und sonstige
Entsorgung. 2 Soweit Abfälle nicht verwertet wurden, ist dies zu<br />
begründen. 3 Mit der Bilanz nach Satz 1 erstellen die<br />
entsorgungspflichtigen Körperschaften eine Übersicht über die Kosten für<br />
die Abfallablagerung nach Art. 7 Abs. 5 Nr. 1 a und die dafür erhobenen<br />
Gebühren und Beiträge.<br />
(2) Die Abfallbilanz und die Übersicht nach Abs. 1 Satz 3 sind der zuständigen<br />
Behörde vorzulegen.<br />
Bay AbfG Artikel 13 Abfallwirtschaftskonzept der<br />
entsorgungspflichtigen Körperschaft<br />
(1) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften stellen in einem<br />
Abfallwirtschaftskonzept die beabsichtigten Maßnahmen zur Vermeidung,<br />
zur Verwertung und zur Beseitigung der in ihrem Bereich anfallenden und<br />
ihnen zu überlassenden Abfälle jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren<br />
im voraus dar. 2 Die Betroffenen und berührte Verbände sind vor der<br />
erstmaligen Erstellung und bei Fortschreibungen mit wesentlichen<br />
Änderungen zu hören. 3 Die Vorschriften des <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung zu Notwendigkeit und Durchführung einer<br />
Strategischen Umweltprüfung für Pläne und Programme bleiben<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Das Abfallwirtschaftskonzept ist erstmals bis zum 31. Dezember 1997 zu<br />
erstellen. 2 Es ist alle fünf Jahre oder bei wesentlichen Änderungen<br />
fortzuschreiben und der zuständigen Behörde vorzulegen.<br />
VIERTER TEIL Abfallbeseitigungsanlagen<br />
ABSCHNITT I Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren<br />
Bay AbfG Artikel 14 Veränderungssperre<br />
(1) 1 Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder<br />
vom Beginn der Auslegung im immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsverfahren an dürfen bis zum Abschluß des Verfahrens auf<br />
den vom Vorhaben betroffenen Flächen wesentlich wertsteigernde oder<br />
die Errichtung der geplanten Abfallbeseitigungsanlage erheblich<br />
erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden.<br />
2<br />
Veränderungen, die auf rechtlich zulässige Weise vorher begonnen<br />
wurden, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher<br />
rechtmäßig ausgeübten Nutzung werden hiervon nicht berührt.<br />
(2) 1 Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so können die<br />
Eigentümer und die sonst zur Nutzung Berechtigten für danach<br />
entstehende Vermögensnachteile vom Träger der Abfallbeseitigungsanlage<br />
nach den Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
entschädigungspflichtige Enteignung Entschädigung in Geld verlangen.<br />
2<br />
Der Eigentümer einer vom Vorhaben betroffenen Fläche kann vom<br />
Träger der Abfallbeseitigungsanlage ferner verlangen, daß dieser die<br />
Fläche zu Eigentum übernimmt, wenn es dem Eigentümer wegen der<br />
Veränderungssperre wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, die Fläche in<br />
der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. 3 Kommt eine
Einigung über die Übernahme nicht zustande, kann der Eigentümer das<br />
Enteignungsverfahren beantragen; im übrigen gelten die Vorschriften des<br />
Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige Enteignung<br />
sinngemäß.<br />
(3) 1 Zur Sicherung der Planung neuer oder der geplanten Erweiterung<br />
bestehender Abfallbeseitigungsanlagen kann die zuständige Behörde<br />
Planungsgebiete festlegen. 2 Für diese gilt Absatz 1 entsprechend. 3 Die<br />
Festlegung ist auf höchstens zwei Jahre zu befristen. 4 Sie tritt mit Beginn<br />
der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder der Auslegung<br />
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren außer Kraft.<br />
5<br />
Ihre Dauer ist auf die Vierjahresfrist nach Absatz 2 anzurechnen.<br />
(4) 1 Die Festlegung eines Planungsgebiets ist in den Gemeinden, deren<br />
Gebiet betroffen wird, auf ortsübliche Weise bekanntzumachen. 2 Mit der<br />
Bekanntmachung tritt die Festlegung in Kraft. 3 Planungsgebiete sind in<br />
Karten einzutragen, die in den Gemeinden während der Geltungsdauer der<br />
Festlegung zur Einsicht auszulegen sind.<br />
(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen von der<br />
Veränderungssperre nach den Absätzen 1 und 3 zulassen, wenn keine<br />
überwiegenden öffentlichen Belange entgegenstehen und die Einhaltung<br />
der Veränderungssperre zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte<br />
führen würde.<br />
Bay AbfG Artikel 15bis 19 (weggefallen)<br />
ABSCHNITT II Beseitigung und Stillegung von Deponien<br />
Bay AbfG Artikel 20 Baueinstellung, Beseitigungsanordnung,<br />
Betriebsuntersagung<br />
1 Wird eine Deponie ohne den erforderlichen Planfeststellungsbeschluß, ohne<br />
die erforderliche Genehmigung oder entgegen den darin enthaltenen<br />
Festsetzungen errichtet, betrieben oder geändert, so kann die zuständige<br />
Behörde die Einstellung der Bauarbeiten oder die teilweise oder vollständige<br />
Beseitigung anordnen oder den Betrieb untersagen. 2 Eine<br />
Beseitigungsanordnung darf nur erlassen werden, wenn nicht auf andere Weise<br />
ein rechtmäßiger Zustand hergestellt werden kann. 3 Anordnungen nach Satz 1<br />
gelten auch gegenüber den Rechtsnachfolgern. 4 Die zuständige Behörde kann<br />
verlangen, daß ein Antrag auf Durchführung eines Planfeststellungs- oder<br />
Genehmigungsverfahrens gestellt wird.<br />
Bay AbfG Artikel 21 Pflichten des Inhabers untersagter Deponien<br />
(1) Wird der Betrieb einer Deponie nach § 35 Abs. 1 KrW-/AbfG oder nach<br />
Art. 20 Satz 1 untersagt, so ist deren Inhaber verpflichtet, die<br />
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um eine Beeinträchtigung des<br />
Wohls der Allgemeinheit zu verhüten oder zu unterbinden, insbesondere<br />
um die mit der Deponie verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft<br />
auszugleichen.<br />
(2) Um die Erfüllung dieser Verpflichtung sicherzustellen, trifft die zuständige<br />
Behörde die erforderlichen Anordnungen.
Bay AbfG Artikel 22 Stillgelegte Deponien<br />
(1) 1 Die ehemaligen Betreiber von Deponien, die vor dem 11. Juni 1972<br />
stillgelegt worden sind, haben das Gelände, das für die Abfallentsorgung<br />
verwendet worden ist, auf ihre Kosten zu rekultivieren. 2 Die zuständige<br />
Behörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 3 Sind Anordnungen gegen<br />
den ehemaligen Betreiber nicht möglich oder nicht erfolgversprechend,<br />
sollen sie gegen den Grundeigentümer gerichtet werden.<br />
(2) Die Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten haben die<br />
Durchführung der nach Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen zu dulden.<br />
FÜNFTER TEIL Finanzielle Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen<br />
Bay AbfG Artikel 23 Gewährung von Finanzierungshilfen<br />
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschafts- und<br />
Abfallgesetz und nach diesem Gesetz können Finanzierungshilfen nach<br />
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 gewährt werden.<br />
(2) 1 Vorhaben, die den Zielen des Art. 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 entsprechen,<br />
dürfen nur noch für einen Zeitraum bis zu fünf Jahren nach Inkrafttreten<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s, danach nur als Mustervorhaben gefördert werden. 2 In<br />
Ausnahmefällen können auch Maßnahmen gefördert werden, die der<br />
Erforschung oder Erprobung neuer Technologien für die Behandlung oder<br />
Ablagerung von Abfällen dienen.<br />
(3) Die Finanzierungshilfen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden<br />
Haushaltsmittel und nach Maßgabe der Dringlichkeit des Vorhabens<br />
gewährt.<br />
(4) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen erläßt im<br />
Einvernehmen mit den Staatsministerien der Finanzen und des Innern die<br />
zur Durchführung der Finanzierung erforderlichen<br />
Verwaltungsvorschriften.<br />
Bay AbfG Artikel 24 Finanzielle Förderung durch die Kommunen<br />
Die entsorgungspflichtigen Körperschaften sollen im Rahmen der zur<br />
Verfügung stehenden Haushaltsmittel private Maßnahmen zur<br />
Abfallvermeidung, Schadstoffminimierung und Abfallverwertung unterstützen.<br />
Bay AbfG Artikel 25 Übergangsregelung<br />
1 Anlagen zur Behandlung oder Ablagerung von Abfällen, für die vor dem 1. Juli<br />
1990 eine Förderung bewilligt, konkret in Aussicht gestellt oder einer<br />
Ausnahme vom haushaltsrechtlichen Verbot des vorzeitigen Vorhabensbeginns<br />
zugestimmt worden war, können nach Maßgabe des Art. 23 Abs. 3 und 4<br />
gefördert werden. 2 Dies gilt nicht, wenn die Errichtung oder Inbetriebnahme<br />
der in Satz 1 genannten Anlagen unterbleibt oder sich aus Gründen, die der<br />
Betreiber zu vertreten hat, verzögert.
SECHSTER TEIL<br />
Bay AbfG Artikel 26bis 28 (weggefallen)<br />
SIEBTER TEIL Sachliche Zuständigkeit, Anordnungen für den Einzelfall,<br />
Aufsicht<br />
Bay AbfG Artikel 29 Sachliche Zuständigkeit<br />
(1) Zuständige Behörde im Sinn der Verordnungen der Europäischen<br />
Gemeinschaften im Bereich der Abfallwirtschaft, im Sinn des<br />
Abfallverbringungsgesetzes, des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes,<br />
des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes, dieses <strong>Gesetze</strong>s und der auf<br />
Grund der genannten Vorschriften erlassenen Rechtsverordnungen sowie<br />
Anhörungsbehörde im Sinn des § 73 des Verwaltungsverfahrensgesetzes<br />
ist die Regierung, soweit nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen wird<br />
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Zuständigkeiten abweichend von<br />
Absatz 1 festzulegen.<br />
Bay AbfG Artikel 30 Anordnungen für den Einzelfall<br />
Die zuständige Behörde kann zur Verhütung oder Unterbindung von Verstößen<br />
gegen Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften im Bereich der<br />
Abfallwirtschaft, das Abfallverbringungsgesetz, das Kreislaufwirtschafts- und<br />
Abfallgesetz, das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, dieses Gesetz oder die<br />
auf Grund der genannten Vorschriften erlassenen Rechtsvorschriften<br />
Anordnungen für den Einzelfall treffen, soweit eine solche Befugnis nicht in<br />
anderen abfallrechtlichen Vorschriften enthalten ist.<br />
Bay AbfG Artikel 31 Beseitigung verbotener Ablagerungen<br />
(1) Wer in unzulässiger Weise Abfälle behandelt, lagert oder ablagert, ist zur<br />
Beseitigung des rechtswidrigen Zustands verpflichtet.<br />
(2) 1 Die zuständige Behörde kann die erforderlichen Anordnungen erlassen.<br />
2<br />
Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem<br />
Aufwand möglich oder nicht erfolgversprechend, so hat die zuständige<br />
Behörde den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen zu<br />
beseitigen oder beseitigen zu lassen.<br />
Bay AbfG Artikel 32 Aufsicht und Überwachung<br />
(1) 1 Oberste Aufsichtsbehörde über den Vollzug der Verordnungen der<br />
Europäischen Gemeinschaften im Bereich der Abfallwirtschaft, des<br />
Abfallverbringungsgesetzes, des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes<br />
und dieses <strong>Gesetze</strong>s ist das Staatsministerium für Landesentwicklung und<br />
Umweltfragen; es ist auch zuständig für die sonstigen in den genannten<br />
Rechtsvorschriften den obersten Landesbehörden übertragenen Aufgaben.<br />
2<br />
Die Vorschriften über die Kommunalaufsicht und das Bergwesen bleiben<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen hat die<br />
bei der Überwachung von Abfallbeseitigungsanlagen erfaßten<br />
Umwelteinwirkungen zu bewerten und die Öffentlichkeit über die
Ergebnisse zu unterrichten. 2 Das Staatsministerium für<br />
Landesentwicklung und Umweltfragen kann sich zur Durchführung der<br />
Aufgaben nach Satz 1 anderer Behörden und sonstiger Dritter bedienen.<br />
ACHTER TEIL Ordnungswidrigkeiten<br />
Bay AbfG Artikel 33 Ordnungswidrigkeiten<br />
Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, soweit die Tat<br />
nicht nach anderen Vorschriften mit Geldbuße mit mindestens gleicher Höhe<br />
bedroht ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. getrennt bereitgestellte Abfälle entgegen dem Verbot des Art. 6 an sich<br />
nimmt,<br />
2. entgegen den Verboten des Art. 14 Abs. 1 oder 3 Veränderungen vornimmt,<br />
3. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 20 Satz 1, Art. 21 Abs. 2, Art. 22<br />
Abs. 1 Satz 2 oder 3 oder Art. 31 Abs. 2 zuwiderhandelt.<br />
NEUNTER TEIL Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
Bay AbfG Artikel 34 (weggefallen)<br />
Bay AbfG Artikel 35 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der ursprünglichen<br />
Fassung vom 27. Februar 1991 (GVBl S. 64). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren<br />
Änderungen ergibt sich aus dem Änderungsgesetz.<br />
1 Dieses Gesetz tritt am 1. März 1991 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt das Gesetz zur<br />
Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen in Bayern<br />
(<strong>Bayerisches</strong> Abfallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) vom 28. Juni 1990 (GVBl<br />
S. 213, BayRS 2129-2-1-U), ausgenommen Art. 27, außer Kraft.
Gesetz zur Ausführung des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer<br />
<strong>Gesetze</strong> (Bay AGBGB)<br />
(BayRS 400-1-J)geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 11. Juli 1998 GVBl. S. 414 , vom 24. Dezember 2002<br />
GVBl. S. 975, ber. 2003 S. 52, vom 7. August 2003 GVBl. S. 497<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
ERSTER ABSCHNITT Vereine<br />
Artikel 1 Entziehung der Rechtsfähigkeit<br />
Artikel 2 Vereine, deren Rechtsfähigkeit auf Verleihung beruht<br />
Artikel 3 Altrechtliche anerkannte Vereine<br />
Artikel 4 Sonstige altrechtliche Vereinigungen<br />
ZWEITER ABSCHNITT Bierlieferungsvertrag<br />
Artikel 5 Vertragsinhalt<br />
Artikel 6 Bestellung einer Sicherungshypothek<br />
DRITTER ABSCHNITT Leibgedingsvertrag<br />
Artikel 7 Anzuwendende Vorschriften<br />
Artikel 8 Ort der Leistung<br />
Artikel 9 Art der Leistung<br />
Artikel 10 Zeit der Leistung<br />
Artikel 11 Grundstückslasten<br />
Artikel 12 Wohnungsrecht<br />
Artikel 13 Aufnahme anderer Personen<br />
Artikel 14 Verpflegung
Artikel 15 Beerdigungskosten<br />
Artikel 16 Dingliche Sicherung<br />
Artikel 17 Leistungsstörungen<br />
Artikel 18 Geldrente<br />
Artikel 19 Störung der Beziehungen durch den Berechtigten<br />
Artikel 20 Störung der Beziehungen durch den Verpflichteten<br />
Artikel 21 Veräußerung des Grundstücks<br />
Artikel 22 Mehrere Berechtigte<br />
Artikel 23 Ersatz von Verwendungen<br />
VIERTER ABSCHNITT Schuldverschreibungen des Freistaates Bayern und<br />
anderer ihm angehörender juristischer Personen des öffentlichen Rechts<br />
Artikel 24 Antragsberechtigung<br />
Artikel 25 Antragsvoraussetzungen<br />
Artikel 26 Legitimationswirkung<br />
Artikel 27 Wirksamkeit der Übertragung<br />
Artikel 28 Entsprechende Anwendung von Vorschriften, Aufgebot<br />
FÜNFTER ABSCHNITT Inhaberpapiere<br />
Artikel 29 Bekanntmachung des Verlustes<br />
Artikel 30 Hinterlegung von Schuldverschreibungen<br />
SECHSTER ABSCHNITT Öffentliche Sparkassen<br />
Artikel 31 Spareinlagen<br />
Artikel 32 Legitimationswirkung der Sparurkunde<br />
Artikel 33 Kraftloserklärung einer Sparurkunde
Artikel 34 Inhalt des Antrags, Glaubhaftmachung<br />
Artikel 35 Anordnung des Aufgebots<br />
Artikel 36 Inhalt des Aufgebots, Anmeldungsfrist<br />
Artikel 37 Bekanntmachung des Aufgebots<br />
Artikel 38 Anmeldung der Rechte<br />
Artikel 39 Kraftloserklärung<br />
Artikel 40 Ausstellung einer neuen Urkunde<br />
Artikel 41 Rechtsbehelfe<br />
Artikel 42 Kosten<br />
SIEBTER ABSCHNITT Nachbarrecht<br />
Artikel 43 Fensterrecht<br />
Artikel 44 Balkone und ähnliche Anlagen<br />
Artikel 45 Besondere Vorschriften für Fenster, Balkone und ähnliche Anlagen<br />
Artikel 46 Erhöhung einer Kommunmauer<br />
Artikel 47 Grenzabstand von Pflanzen<br />
Artikel 48 Grenzabstand bei landwirtschaftlichen Grundstücken<br />
Artikel 49 Messung des Grenzabstands<br />
Artikel 50 Ausnahmen vom Grenzabstand<br />
Artikel 51 Ältere Gewächse und Waldungen<br />
Artikel 52 Verjährung der nachbarrechtlichen Ansprüche<br />
Artikel 53 Erlöschen von Anwenderechten<br />
Artikel 54 Ausschluß von privatrechtlichen Ansprüchen bei<br />
Verkehrsunternehmen
ACHTER ABSCHNITT Buchungsfreie Grundstücke und altrechtliche<br />
Grunddienstbarkeiten<br />
Artikel 55 Übertragung des Eigentums an buchungsfreien Grundstücken<br />
Artikel 56 Dienstbarkeiten an buchungsfreien Grundstücken<br />
Artikel 57 Aufhebung und Erlöschen altrechtlicher Grunddienstbarkeiten<br />
Artikel 58 Ausschluß des Berechtigten bei altrechtlichen<br />
Grunddienstbarkeiten<br />
Artikel 59 Aufgebotsverfahren<br />
Artikel 60 Erneutes Aufgebotsverfahren<br />
NEUNTER ABSCHNITT Sonstige sachenrechtliche Vorschriften<br />
Artikel 61 Fundbehörden und fundrechtliches Verfahren<br />
Artikel 62 Stockwerkseigentum<br />
Artikel 63 Ablösung einer Reallast<br />
Artikel 64 Ablösungssumme bei subjektiv-dinglichen Rechten<br />
Artikel 65 Bekanntmachung der Satzung einer Kreditanstalt<br />
Artikel 66 Lösungsanspruch der öffentlichen Pfandleihanstalten<br />
ZEHNTER ABSCHNITT Familien- und erbrechtliche Vorschriften, Vollziehung<br />
von Auflagen<br />
Artikel 67 Anlegung von Mündelgeld<br />
Artikel 68 Festsetzung des Ertragswerts eines Landguts<br />
Artikel 69 Vollziehung von Auflagen<br />
ELFTER ABSCHNITT Öffentlich-rechtliche Ansprüche<br />
Artikel 70 Haftung des Grundstücks<br />
Artikel 71 Erlöschen
ZWEITER TEIL Ausführung handelsrechtlicher Vorschriften<br />
Artikel 72 Benachbarte Gemeinden<br />
Artikel 73<br />
Artikel 74 Auflösung von Genossenschaften und Gesellschaften mit<br />
beschränkter Haftung<br />
DRITTER TEIL Übergangs-, Änderungs- und Schlußvorschriften<br />
Artikel 75 Verweisungen in anderen Vorschriften<br />
Artikel 76<br />
Artikel 77 Sonstige Übergangsvorschriften<br />
Artikel 77 a Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Änderung des <strong>Gesetze</strong>s zur<br />
Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer <strong>Gesetze</strong> sowie zur<br />
Änderung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 24. Dezember 2002<br />
Artikel 78 Aufrechterhaltung eingetretener Rechtswirkungen<br />
Artikel 79<br />
Artikel 80 Inkrafttreten<br />
ERSTER TEIL Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
ERSTER ABSCHNITT Vereine<br />
Bay AGBGB Artikel 1 Entziehung der Rechtsfähigkeit<br />
Für die Entziehung der Rechtsfähigkeit eines eingetragenen Vereins nach § 43<br />
Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist die Kreisverwaltungsbehörde<br />
zuständig.<br />
Bay AGBGB Artikel 2 Vereine, deren Rechtsfähigkeit auf Verleihung<br />
beruht<br />
(1) Für die Verleihung der Rechtsfähigkeit nach § 22 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs an einen Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen<br />
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, ist die Regierung von Schwaben zuständig,<br />
soweit nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) Die Genehmigung der Änderung der Satzung nach § 33 Abs. 2 des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs erteilt bei Vereinen nach Absatz 1 die für die<br />
Verleihung der Rechtsfähigkeit zuständige Behörde. Bei<br />
Schützengesellschaften, der königlich privilegierten Künstlergemeinschaft
von 1868, dem Künstlerunterstützungsverein München und dem<br />
Heilstättenverein Lenzheim erteilt sie die Regierung von Schwaben. Im<br />
Übrigen erteilt sie das für den Tätigkeitsbereich des Vereins zuständige<br />
Staatsministerium; es kann die Verwaltungszuständigkeit durch<br />
Rechtsverordnung auf die Regierung von Schwaben übertragen.<br />
(3) Für die Entziehung der Rechtsfähigkeit nach § 43 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs ist die Kreisverwaltungsbehörde zuständig.<br />
Bay AGBGB Artikel 3 Altrechtliche anerkannte Vereine<br />
Vereine, die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf<br />
Grund des <strong>Gesetze</strong>s vom 29. April 1869, die privatrechtliche Stellung von<br />
Vereinen betreffend (Gesetzblatt für das Königreich Bayern Spalte 1197.), bestanden<br />
haben, gelten von diesem Zeitpunkt an als eingetragene Vereine.<br />
Bay AGBGB Artikel 4 Sonstige altrechtliche Vereinigungen<br />
(1) Eine privatrechtliche Vereinigung, der vor dem Inkrafttreten des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs Rechtsfähigkeit verliehen worden ist und deren<br />
Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, wird<br />
auf Antrag in das Vereinsregister eingetragen, wenn sie mindestens drei<br />
Mitglieder hat und ihre Satzung den Vorschriften des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs über eingetragene Vereine entspricht.<br />
(2) Eine Eintragung nach Absatz 1 ist auch zulässig, wenn nicht mehr<br />
aufgeklärt werden kann, ob und wodurch die Vereinigung vor dem<br />
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Rechtsfähigkeit erlangt<br />
hat, sofern sie seither im Rechtsverkehr als rechtsfähige Vereinigung<br />
aufgetreten ist.<br />
(3) Mit der Eintragung wird die Vereinigung ein eingetragener Verein im Sinn<br />
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Sie ist berechtigt, ihre frühere Bezeichnung<br />
einschließlich eines Hinweises auf eine frühere staatliche Privilegierung mit<br />
dem Zusatz “e. V.” fortzuführen.<br />
(4) Eine öffentlich-rechtliche Vereinigung, der vor Inkrafttreten des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs Rechtsfähigkeit verliehen worden ist und deren<br />
Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, wird<br />
auf Antrag als Verein des bürgerlichen Rechts in das Vereinsregister<br />
eingetragen. Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die Eintragung bedarf<br />
der Zustimmung der Kreisverwaltungsbehörde. Die Zustimmung kann<br />
versagt werden, wenn öffentliche Interessen gefährdet würden.<br />
ZWEITER ABSCHNITT Bierlieferungsvertrag<br />
Bay AGBGB Artikel 5 Vertragsinhalt<br />
(1) Wird zwischen einem Brauer und einem Wirt ein Vertrag über die<br />
Lieferung von Bier ohne Bestimmung der Menge des zu liefernden Biers<br />
geschlossen, so gilt, soweit nichts anderes vereinbart wird, als<br />
Gegenstand des Vertrags der gesamte Bedarf an Bier, der sich in dem<br />
Gewerbebetrieb des Wirts während der Dauer des Vertragsverhältnisses<br />
ergibt. Der Wirt ist verpflichtet, den Bedarf ausschließlich von dem Brauer<br />
zu beziehen, der Brauer hat dem Wirt die jeweils verlangten Mengen zu
liefern. Ist die Dauer des Vertragsverhältnisses nicht bestimmt, so kann es<br />
von jedem Teil unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum<br />
30. September jeden Jahres gekündigt werden.<br />
(2) Geht das Geschäft des einen oder des anderen Teils durch Rechtsgeschäft<br />
unter Lebenden auf einen Dritten über, so hat der bisherige Inhaber dafür<br />
einzustehen, daß der neue Inhaber in den Vertrag eintritt.<br />
Bay AGBGB Artikel 6 Bestellung einer Sicherungshypothek<br />
(1) Ist bei dem Bestehen eines Vertragsverhältnisses der in Art. 5 Abs. 1<br />
bezeichneten Art der Wirt Eigentümer des Grundstücks, auf dem er sein<br />
Geschäft betreibt, so kann der Brauer verlangen, daß ihm für den<br />
gestundeten oder rückständigen Kaufpreis des gelieferten Biers eine<br />
Sicherungshypothek an dem Grundstück bestellt wird.<br />
(2) Hat der Wirt noch andere Grundstücke, die mit dem seinem<br />
Geschäftsbetrieb dienenden Grundstück gemeinschaftlich bewirtschaftet<br />
werden, so kann der Brauer die Erstreckung der Sicherungshypothek auf<br />
diese Grundstücke verlangen, soweit sie erforderlich ist, damit der Betrag<br />
des Kaufpreises durch den Wert der Grundstücke doppelt gedeckt wird.<br />
Der Wert wird unter Abzug der Belastungen berechnet, die der<br />
Sicherungshypothek im Rang vorgehen.<br />
DRITTER ABSCHNITT Leibgedingsvertrag<br />
Bay AGBGB Artikel 7 Anzuwendende Vorschriften<br />
Steht mit der Überlassung eines Grundstücks ein Leibgedingsvertrag<br />
(Leibzuchts-, Altenteils- oder Auszugsvertrag) in Verbindung, so gelten für das<br />
sich aus dem Vertrag ergebende Schuldverhältnis, soweit nicht besondere<br />
Vereinbarungen getroffen sind, neben den Vorschriften des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs über die Leibrente die besonderen Vorschriften der Art. 8 bis 23.<br />
Bay AGBGB Artikel 8 Ort der Leistung<br />
Die dem Berechtigten zustehenden Leistungen sind auf dem überlassenen<br />
Grundstück zu bewirken. Ist dem Berechtigten auf dem Grundstück eine<br />
abgesonderte Wohnung zu gewähren, so ist die Leistung in der Wohnung zu<br />
erbringen.<br />
Bay AGBGB Artikel 9 Art der Leistung<br />
Hat der Verpflichtete dem Berechtigten Erzeugnisse der Art zu liefern, wie sie<br />
auf dem Grundstück gewonnen werden, so kann der Berechtigte nur<br />
Erzeugnisse verlangen, die der mittleren Art und Güte der auf dem Grundstück<br />
bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung gewonnenen Erzeugnisse entsprechen.<br />
Bay AGBGB Artikel 10 Zeit der Leistung<br />
Hat der Verpflichtete dem Berechtigten Erzeugnisse der landwirtschaftlichen<br />
Bodennutzung als Jahresvorrat zu liefern, so ist zu der Zeit zu liefern, zu der<br />
die Erzeugnisse nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft gewonnen<br />
und, soweit der Lieferung eine Bearbeitung voranzugehen hat, bearbeitet sind.
Bay AGBGB Artikel 11 Grundstückslasten<br />
Darf der Berechtigte einen Teil des Grundstücks, insbesondere ein darauf<br />
befindliches Gebäude, benutzen, so hat der Verpflichtete die auf diesen Teil<br />
des Grundstücks treffenden Lasten zu tragen.<br />
Bay AGBGB Artikel 12 Wohnungsrecht<br />
(1) Ist dem Berechtigten auf dem Grundstück eine abgesonderte Wohnung zu<br />
gewähren, so hat der Verpflichtete die Wohnung dem Berechtigten in<br />
einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand zu<br />
überlassen und sie während der Dauer seiner Verpflichtung in diesem<br />
Zustand zu erhalten.<br />
(2) Wird das Gebäude durch Zufall zerstört, so hat der Verpflichtete die<br />
Wohnung wiederherzustellen. Hat der Zufall eine so wesentliche<br />
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Verpflichteten zur Folge,<br />
daß ihm die Wiederherstellung nicht zugemutet werden kann, so hat er<br />
dem Berechtigten Wohnung zu gewähren, wie es den Umständen nach der<br />
Billigkeit entspricht. Das gleiche gilt, wenn das Gebäude<br />
wiederherzustellen ist, für die zur Wiederherstellung erforderliche Zeit.<br />
(3) Der Verpflichtete hat auf Verlangen des Berechtigten das Gebäude gegen<br />
Brandschaden zu versichern.<br />
Bay AGBGB Artikel 13 Aufnahme anderer Personen<br />
(1) Ist dem Berechtigten eine abgesonderte Wohnung zu gewähren, so ist er<br />
befugt, seine Familie sowie die zur angemessenen Bedienung und zur<br />
Pflege erforderlichen Personen in die Wohnung aufzunehmen.<br />
(2) Hat der Verpflichtete dem Berechtigten die Mitbenutzung seiner Wohnung<br />
zu gestatten, so erstreckt sich die Befugnis des Berechtigten zur<br />
Aufnahme seiner Familie nicht auf Personen, die durch eine erst nach<br />
Abschluß des Leibgedingsvertrags eingegangene Ehe oder durch eine nach<br />
diesem Zeitpunkt ausgesprochene Ehelicherklärung oder Annahme als<br />
Kind Familienangehörige geworden sind, und nicht auf Kinder, die aus<br />
dem Hausstand des Berechtigten ausgeschieden waren.<br />
Bay AGBGB Artikel 14 Verpflegung<br />
Ist die Verpflegung des Berechtigten ohne nähere Bestimmung vereinbart, so<br />
hat der Verpflichtete dem Berechtigten den gesamten Lebensbedarf in<br />
angemessener und ortsüblicher Weise zu gewähren; die Kosten der ärztlichen<br />
Behandlung und der Heilmittel hat der Berechtigte zu tragen.<br />
Bay AGBGB Artikel 15 Beerdigungskosten<br />
Im Fall des Todes des Berechtigten hat der Verpflichtete die Kosten der<br />
angemessenen Beerdigung zu tragen, soweit die Bezahlung nicht von dem<br />
Erben zu erlangen ist.<br />
Bay AGBGB Artikel 16 Dingliche Sicherung<br />
Der Berechtigte kann die Bestellung einer seinen Rechten aus dem Vertrag<br />
entsprechenden persönlichen Dienstbarkeit oder Reallast an dem Grundstück
verlangen. Die Rechte sind mit dem Rang unmittelbar hinter den zur Zeit der<br />
Überlassung des Grundstücks bestehenden Belastungen zu bestellen.<br />
Bay AGBGB Artikel 17 Leistungsstörungen<br />
Erbringt der Verpflichtete eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß,<br />
verletzt er eine Pflicht nach § 241 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder<br />
braucht er nach § 275 Abs. 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht zu<br />
leisten, so steht dem Berechtigten nicht das Recht zu, nach §§ 323, 324, 326<br />
Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von dem Vertrag zurückzutreten oder<br />
nach § 527 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Herausgabe des Grundstücks zu<br />
fordern.<br />
Bay AGBGB Artikel 18 Geldrente<br />
Muß der Berechtigte aus besonderen Gründen das Grundstück auf Dauer<br />
verlassen, so hat der Verpflichtete ihm für die Befreiung von der Pflicht zur<br />
Gewährung der Wohnung und zu Dienstleistungen eine Geldrente zu zahlen,<br />
die dem Wert der Befreiung nach billigem Ermessen entspricht. Für andere<br />
Leistungen, die für den Berechtigten wegen seiner Abwesenheit von dem<br />
Grundstück ohne Interesse sind, hat der Verpflichtete den Wert zu vergüten,<br />
den sie für den Berechtigten auf dem Grundstück haben.<br />
Bay AGBGB Artikel 19 Störung der Beziehungen durch den<br />
Berechtigten<br />
Veranlaßt der Berechtigte durch sein Verhalten eine solche Störung der<br />
persönlichen Beziehungen zu dem Verpflichteten, daß diesem nicht mehr<br />
zugemutet werden kann, ihm das Wohnen auf dem Grundstück zu gestatten,<br />
so kann der Verpflichtete ihm die Wohnung unter Gewährung einer<br />
angemessenen Räumungsfrist kündigen. Macht er von dieser Befugnis<br />
Gebrauch, so gilt Art. 18 entsprechend.<br />
Bay AGBGB Artikel 20 Störung der Beziehungen durch den<br />
Verpflichteten<br />
Veranlaßt der Verpflichtete durch sein Verhalten eine solche Störung der<br />
persönlichen Beziehungen zu dem Berechtigten, daß diesem nicht zugemutet<br />
werden kann, die Wohnung auf dem Grundstück zu behalten, so hat er dem<br />
Berechtigten, falls dieser die Wohnung auf dem Grundstück aufgibt, den für die<br />
Beschaffung einer anderen angemessenen Wohnung erforderlichen Aufwand zu<br />
ersetzen. Ferner hat er dem Berechtigten den Schaden zu ersetzen, der daraus<br />
entsteht, daß dieser andere ihm zustehende Leistungen nicht auf dem<br />
Grundstück in Empfang nehmen kann.<br />
Bay AGBGB Artikel 21 Veräußerung des Grundstücks<br />
(1) Wird das Grundstück veräußert, so stehen dem Berechtigten die in Art. 20<br />
bestimmten Rechte zu. Er verliert diese Rechte, wenn er das Grundstück<br />
nicht binnen eines Jahres räumt, nachdem er von dem Übergang des<br />
Eigentums Kenntnis erlangt. Sie stehen ihm nicht zu, wenn das<br />
Grundstück mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen<br />
Erben des Verpflichteten veräußert wird.
(2) Die nach den Art. 19 und 20 sich aus einer Störung der persönlichen<br />
Beziehungen zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten<br />
ergebenden Rechte treten im Fall der Veräußerung des Grundstücks ein,<br />
wenn die persönlichen Beziehungen zwischen dem Berechtigten und dem<br />
Erwerber von dem einen oder dem anderen in der dort angegebenen<br />
Weise gestört werden.<br />
Bay AGBGB Artikel 22 Mehrere Berechtigte<br />
(1) Ist ein Leibgeding für Ehegatten vereinbart, so kann, wenn der eine<br />
Ehegatte stirbt, der andere Ehegatte das volle Leibgeding mit Ausnahme<br />
der Leistungen verlangen, die unmittelbar für den besonderen Bedarf des<br />
verstorbenen Ehegatten bestimmt waren.<br />
(2) In anderen Fällen eines für mehrere Berechtigte vereinbarten Leibgedings<br />
wird der Verpflichtete durch den Tod eines der Berechtigten zu dem<br />
Kopfteil des Verstorbenen von seiner Verpflichtung frei, soweit die<br />
geschuldeten Leistungen zum Zweck des Gebrauchs oder Verbrauchs<br />
unter den Berechtigten geteilt werden mußten.<br />
Bay AGBGB Artikel 23 Ersatz von Verwendungen<br />
Bei der Beendigung des Rechtsverhältnisses hat der Verpflichtete, wenn er<br />
dem Berechtigten die Benutzung eines Teils des Grundstücks zu gewähren<br />
hatte, die Kosten, die der Berechtigte auf die noch nicht getrennten, jedoch<br />
nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft vor dem Ende des<br />
Nutzungsjahres zu trennenden Früchte verwendet hat, zu ersetzen, soweit sie<br />
einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen und den Wert dieser Früchte<br />
nicht übersteigen. Hatte der Verpflichtete den Teil des Grundstücks für den<br />
Berechtigten zu bestellen, so bleiben die von ihm geleisteten<br />
Bestellungsarbeiten außer Ansatz.<br />
VIERTER ABSCHNITT Schuldverschreibungen des Freistaates<br />
Bayern und anderer ihm angehörender juristischer Personen des<br />
öffentlichen Rechts<br />
Bay AGBGB Artikel 24 Antragsberechtigung<br />
(1) Zu der Stellung von Anträgen, die eine Verfügung über eine auf den<br />
Namen des Gläubigers umgeschriebene Schuldverschreibung des<br />
Freistaates Bayern sowie der ihm angehörenden Körperschaften,<br />
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts enthalten, sowie zum<br />
Empfang der in einer solchen Schuldverschreibung versprochenen Zahlung<br />
sind nur der Gläubiger, auf dessen Namen die Schuldverschreibung<br />
umgeschrieben ist, seine gesetzlichen Vertreter und Bevollmächtigten, der<br />
Insolvenz- oder Konkursverwalter und der Testamentsvollstrecker sowie<br />
diejenigen Personen berechtigt, welche die Schuldverschreibung von<br />
Todes wegen oder im Weg der Auseinandersetzung eines Nachlasses oder<br />
des Gesamtguts einer Gütergemeinschaft erworben haben.<br />
(2) Ist die Schuldverschreibung zum Zweck der Zwangsvollstreckung<br />
gepfändet, so kann der Gläubiger, zu dessen Gunsten die Pfändung<br />
erwirkt ist, die Löschung der Umschreibung beantragen.
Bay AGBGB Artikel 25 Antragsvoraussetzungen<br />
(1) Der Antragsteller muß sich im Besitz der Schuldverschreibung befinden.<br />
(2) Der Antrag muß öffentlich beurkundet oder öffentlich beglaubigt sein.<br />
Anträge einer öffentlichen Behörde bedürfen einer besonderen<br />
Beglaubigung nicht.<br />
(3) Für eine Vollmacht oder eine sonstige Vertretungs- oder<br />
Verwaltungsbefugnis ist derselbe Nachweis erforderlich wie bei der<br />
Bewilligung einer Eintragung in das Grundbuch. Zum Nachweis des<br />
Erwerbs von Todes wegen ist ein Zeugnis des Nachlaßgerichts erforderlich.<br />
Bei dem Erwerb im Weg der Auseinandersetzung genügt ein Zeugnis des<br />
zuständigen Gerichts oder Notars.<br />
(4) Ist seit der Umschreibung eine Änderung in der Person des Gläubigers<br />
(Änderung des Namens oder des Wohnorts) eingetreten, so kann verlangt<br />
werden, daß die Identität durch eine öffentliche Urkunde nachgewiesen<br />
wird.<br />
(5) Diese Vorschriften gelten auch für die Quittung über den Empfang der<br />
Zahlung.<br />
Bay AGBGB Artikel 26 Legitimationswirkung<br />
Ist das Verfügungsrecht des Antragstellers oder des Empfängers der Zahlung<br />
in der in Art. 25 bestimmten Weise nachgewiesen, so ist der Aussteller ohne<br />
weitere Prüfung zu der Annahme berechtigt, daß der Antragsteller oder der<br />
Empfänger der Zahlung über die Schuldverschreibung rechtswirksam verfügen<br />
kann.<br />
Bay AGBGB Artikel 27 Wirksamkeit der Übertragung<br />
Die Übertragung einer Schuldverschreibung der in Art. 24 Abs. 1 bezeichneten<br />
Art wird dem Aussteller gegenüber erst mit der Umschreibung wirksam.<br />
Bay AGBGB Artikel 28 Entsprechende Anwendung von Vorschriften,<br />
Aufgebot<br />
(1) Die Vorschriften der §§ 798 bis 803, 805 des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
gelten auch für Schuldverschreibungen der in Art. 24 Abs. 1 bezeichneten<br />
Art.<br />
(2) Auf das Aufgebotsverfahren zum Zweck der Kraftloserklärung einer<br />
solchen Schuldverschreibung sind die Vorschriften der §§ 1010 bis 1014<br />
der Zivilprozeßordnung nicht anzuwenden.<br />
FÜNFTER ABSCHNITT Inhaberpapiere<br />
Bay AGBGB Artikel 29 Bekanntmachung des Verlustes<br />
(1) Die Kreisverwaltungsbehörden haben auf Antrag desjenigen, dem ein<br />
Inhaberpapier gestohlen worden, verlorengegangen oder sonst abhanden<br />
gekommen ist, den Verlust im Bundesanzeiger bekanntzumachen, wenn<br />
der Verlust glaubhaft gemacht wird. Der Antragsteller hat die Kosten<br />
vorzuschießen.
(2) Bei dem Verlust von Banknoten und anderen auf Sicht zahlbaren<br />
unverzinslichen Inhaberpapieren kann die Bekanntmachung nicht verlangt<br />
werden; für abhanden gekommene Zins-, Renten- oder<br />
Gewinnanteilscheine kann sie nur verlangt werden, wenn die Scheine<br />
später als in dem nächsten auf die Bekanntmachung folgenden<br />
Einlösungstermin fällig werden.<br />
Bay AGBGB Artikel 30 Hinterlegung von Schuldverschreibungen<br />
Gläubiger, die nach § 4 Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s betreffend die gemeinsamen<br />
Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen vom 4. Dezember 1899<br />
(BGBl. III 4134-1) bei dem Amtsgericht den Antrag stellen, sie zur Berufung<br />
einer Versammlung der Gläubiger zu ermächtigen, und Gläubiger, die in einer<br />
Versammlung der Gläubiger ihr Stimmrecht ausüben wollen (§ 10 Abs. 2 des<br />
<strong>Gesetze</strong>s), können ihre Schuldverschreibungen außer bei der Deutschen<br />
Bundesbank oder bei einem Notar auch bei der Bayerischen Landesbank<br />
Girozentrale hinterlegen.<br />
SECHSTER ABSCHNITT Öffentliche Sparkassen<br />
Bay AGBGB Artikel 31 Spareinlagen<br />
Bei einer öffentlichen Sparkasse können Minderjährige und andere in der<br />
Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen ohne Einwilligung des gesetzlichen<br />
Vertreters Spareinlagen machen.<br />
Bay AGBGB Artikel 32 Legitimationswirkung der Sparurkunde<br />
Ist eine öffentliche Sparkasse nach ihrer Satzung bei der Zahlung eines<br />
Guthabens an den Inhaber der Sparurkunde nicht verpflichtet, die<br />
Berechtigung des Inhabers zu prüfen, so ist sie, sofern nicht in der Urkunde<br />
eine abweichende Bestimmung getroffen ist, ohne weitere Prüfung zu der<br />
Annahme berechtigt, daß der Inhaber das Guthaben rechtswirksam kündigen<br />
und einziehen kann.<br />
Bay AGBGB Artikel 33 Kraftloserklärung einer Sparurkunde<br />
Die Kraftloserklärung einer abhanden gekommenen oder vernichteten<br />
Sparurkunde einer öffentlichen Sparkasse kann auch bei der Sparkasse<br />
beantragt werden. Für das bei der Kraftloserklärung zu beachtende Verfahren<br />
gelten die Vorschriften der Art. 34 bis 42.<br />
Bay AGBGB Artikel 34 Inhalt des Antrags, Glaubhaftmachung<br />
Der Antragsteller hat den Verlust der Urkunde und die Tatsachen, von denen<br />
seine Berechtigung abhängt, glaubhaft zu machen. Über die Wahrheit seiner<br />
Angaben kann ihm eine Versicherung an Eides Statt abgenommen werden.<br />
Bay AGBGB Artikel 35 Anordnung des Aufgebots<br />
Die Sparkasse erläßt ein Aufgebot und ordnet, wenn die Urkunde abhanden<br />
gekommen ist, die Sperre des Guthabens an.
Bay AGBGB Artikel 36 Inhalt des Aufgebots, Anmeldungsfrist<br />
(1) Das Aufgebot hat zu enthalten:<br />
1. die Bezeichnung des Antragstellers und der Urkunde;<br />
2. die Aufforderung an den Inhaber der Urkunde, binnen drei Monaten<br />
seine Rechte unter Vorlegung der Urkunde anzumelden, widrigenfalls die<br />
Urkunde für kraftlos erklärt werde.<br />
(2) Die Bezeichnung der Urkunde soll die Angabe enthalten, für wen die<br />
Urkunde bei der ersten Einzahlung ausgestellt worden ist.<br />
Bay AGBGB Artikel 37 Bekanntmachung des Aufgebots<br />
(1) Das Aufgebot ist durch Aushang bei der Sparkasse und durch einmalige<br />
Einrückung eines Auszugs in das für die Bekanntmachungen der<br />
Sparkasse bestimmte Blatt zu veröffentlichen.<br />
(2) Die Sparkasse kann die einmalige Einrückung in ein weiteres Blatt oder die<br />
einmalige Wiederholung der Einrückung in das in Absatz 1 bestimmte Blatt<br />
anordnen.<br />
Bay AGBGB Artikel 38 Anmeldung der Rechte<br />
(1) Meldet der Inhaber der Urkunde seine Rechte unter Vorlegung der<br />
Urkunde an, so hat die Sparkasse den Antragsteller hiervon zu<br />
benachrichtigen und ihm die Einsicht der Urkunde innerhalb einer zu<br />
bestimmenden Frist zu gestatten. Auf Antrag des Inhabers der Urkunde ist<br />
zu deren Vorlegung ein Termin zu bestimmen.<br />
(2) Die Sperre des Guthabens darf erst aufgehoben werden, nachdem dem<br />
Antragsteller die Einsicht nach Maßgabe des Absatzes 1 gestattet worden<br />
ist.<br />
Bay AGBGB Artikel 39 Kraftloserklärung<br />
(1) Wird die Urkunde nicht vorgelegt, so ist sie durch die Sparkasse für<br />
kraftlos zu erklären. Vor der Kraftloserklärung kann dem Antragsteller<br />
über die Wahrheit einer von ihm aufgestellten Behauptung eine<br />
Versicherung an Eides Statt abgenommen werden.<br />
(2) Die Kraftloserklärung ist durch Aushang bei der Sparkasse und durch<br />
einmalige Einrückung des wesentlichen Inhalts in das in Art. 37 Abs. 1<br />
bezeichnete Blatt zu veröffentlichen.<br />
Bay AGBGB Artikel 40 Ausstellung einer neuen Urkunde<br />
An Stelle der für kraftlos erklärten Urkunde erhält der Antragsteller eine neue<br />
Urkunde.<br />
Bay AGBGB Artikel 41 Rechtsbehelfe<br />
(1) Die Kraftloserklärung kann nur durch Klage nach Maßgabe der §§ 957,<br />
958 der Zivilprozeßordnung angefochten werden. Zuständig ist das<br />
Landgericht, in dessen Bezirk die Sparkasse ihren Sitz hat.<br />
(2) Das auf die Anfechtungsklage ergangene Urteil ist, soweit es die<br />
Kraftloserklärung aufhebt, nach Eintritt der Rechtskraft in der in Art. 39
Abs. 2 für die Kraftloserklärung vorgeschriebenen Weise zu<br />
veröffentlichen.<br />
Bay AGBGB Artikel 42 Kosten<br />
Das Aufgebotsverfahren ist gebührenfrei. Die Auslagen hat der Antragsteller zu<br />
tragen.<br />
SIEBTER ABSCHNITT Nachbarrecht<br />
Bay AGBGB Artikel 43 Fensterrecht<br />
(1) Sind Fenster weniger als 0,60 m von der Grenze eines<br />
Nachbargrundstücks entfernt, auf dem Gebäude errichtet sind oder das als<br />
Hofraum oder Hausgarten dient, so müssen sie auf Verlangen des<br />
Eigentümers dieses Grundstücks so eingerichtet werden, daß bis zur Höhe<br />
von 1,80 m über dem hinter ihnen befindlichen Boden weder das Öffnen<br />
noch das Durchblicken möglich ist. Die Entfernung wird von dem Fuß der<br />
Wand, in der sich das Fenster befindet, unterhalb der zunächst an der<br />
Grenze befindlichen Außenkante der Fensteröffnung ab gemessen.<br />
(2) Den Fenstern stehen Lichtöffnungen jeder Art gleich.<br />
Bay AGBGB Artikel 44 Balkone und ähnliche Anlagen<br />
Balkone, Erker, Galerien und ähnliche Anlagen, die weniger als 0,60 m von der<br />
Grenze eines Nachbargrundstücks abstehen, auf dem Gebäude errichtet sind<br />
oder das als Hofraum oder Hausgarten dient, müssen auf der dem<br />
Nachbargrundstück zugekehrten Seite auf Verlangen des Nachbarn mit einem<br />
der Vorschrift des Art. 43 entsprechenden Abschluß versehen werden. Der<br />
Abstand wird bei vorspringenden Anlagen von dem zunächst an der Grenze<br />
befindlichen Vorsprung ab, bei anderen Anlagen nach Art. 43 Abs. 1 Satz 2<br />
gemessen.<br />
Bay AGBGB Artikel 45 Besondere Vorschriften für Fenster, Balkone und<br />
ähnliche Anlagen<br />
(1) Art. 43 und 44 gelten auch zugunsten von Grundstücken, die einer<br />
öffentlichen Eisenbahnanlage dienen. Die Fenster und andere<br />
Lichtöffnungen sowie der Abschluß der in Art. 44 bezeichneten Anlagen<br />
dürfen jedoch so eingerichtet werden, daß sie das Durchblicken gestatten.<br />
(2) Für die zur Zeit des Inkrafttretens dieses <strong>Gesetze</strong>s bestehenden,<br />
begonnenen oder baurechtlich genehmigten Anlagen der in Art. 43 und 44<br />
bezeichneten Art sind die vor diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften<br />
weiterhin anzuwenden, soweit sie eine geringere Beschränkung festgelegt<br />
haben als die Art. 43 und 44 sowie Absatz 1.<br />
Bay AGBGB Artikel 46 Erhöhung einer Kommunmauer<br />
(1) Werden zwei Grundstücke durch eine Mauer geschieden, zu deren<br />
Benutzung die Eigentümer der Grundstücke gemeinschaftlich berechtigt<br />
sind, so kann der Eigentümer des einen Grundstücks dem Eigentümer des<br />
anderen Grundstücks nicht verbieten, die Mauer ihrer ganzen Dicke nach
zu erhöhen, wenn ihm nachgewiesen wird, daß durch die Erhöhung die<br />
Mauer nicht gefährdet wird.<br />
(2) Der Eigentümer des Grundstücks, von dem aus die Erhöhung erfolgt ist,<br />
kann dem Eigentümer des anderen Grundstücks die Benutzung des<br />
Aufbaus verbieten, bis ihm für die Hälfte oder, wenn nur ein Teil des<br />
Aufbaus benutzt werden soll, für den entsprechenden Teil der Baukosten<br />
Ersatz geleistet wird. Ist der Bauwert geringer als der Betrag der<br />
Baukosten, so bestimmt sich der zu ersetzende Betrag nach dem Bauwert.<br />
Die Ersatzleistung kann auch durch Hinterlegung oder durch Aufrechnung<br />
erfolgen. Solange die Befugnis nach Satz 1 besteht, hat der Berechtigte<br />
den Mehraufwand zu tragen, den die Unterhaltung der Mauer infolge der<br />
Erhöhung verursacht.<br />
(3) Wird die Mauer zum Zweck der Erhöhung verstärkt, so ist die Verstärkung<br />
auf dem Grundstück anzubringen, dessen Eigentümer die Erhöhung<br />
unternimmt. Der nach Absatz 2 von dem Eigentümer des anderen<br />
Grundstücks zu ersetzende Betrag erhöht sich um den entsprechenden<br />
Teil des Werts der zu der Verstärkung verwendeten Grundfläche. Verlangt<br />
der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Verstärkung angebracht<br />
worden ist, die Ersatzleistung, so ist er verpflichtet, dem Eigentümer des<br />
anderen Grundstücks das Eigentum an der zu der Mauer verwendeten<br />
Grundfläche seines Grundstücks soweit zu übertragen, daß die neue<br />
Grenzlinie durch die Mitte der verstärkten Mauer geht; die Vorschriften<br />
über den Kauf sind anzuwenden.<br />
(4) Die Befugnis nach Absatz 2 Satz 1 erlischt durch Verzicht des<br />
Berechtigten. Der Verzicht ist gegenüber dem Eigentümer des<br />
Nachbargrundstücks zu erklären. Ist das Grundstück des Berechtigten mit<br />
dem Recht eines Dritten belastet, so gilt § 876 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs entsprechend. Im Fall der Belastung mit einer Reallast, einer<br />
Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld ist der Verzicht dem<br />
Dritten gegenüber wirksam, wenn er erklärt wurde, bevor das Grundstück<br />
zugunsten des Dritten in Beschlag genommen worden ist.<br />
Bay AGBGB Artikel 47 Grenzabstand von Pflanzen<br />
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem<br />
Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder<br />
Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie<br />
über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der<br />
Grenze seines Grundstücks gehalten werden.<br />
(2) Zugunsten eines Waldgrundstücks kann nur die Einhaltung eines Abstands<br />
von 0,50 m verlangt werden. Das gleiche gilt, wenn Wein oder Hopfen auf<br />
einem Grundstück angebaut wird, in dessen Lage dieser Anbau nach den<br />
örtlichen Verhältnissen üblich ist.<br />
Bay AGBGB Artikel 48 Grenzabstand bei landwirtschaftlichen<br />
Grundstücken<br />
(1) Gegenüber einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück, dessen<br />
wirtschaftliche Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts<br />
erheblich beeinträchtigt werden würde, ist mit Bäumen von mehr als 2 m<br />
Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten.
(2) Die Einhaltung des in Absatz 1 bestimmten Abstands kann nur verlangt<br />
werden, wenn das Grundstück die bezeichnete wirtschaftliche Bestimmung<br />
schon zu der Zeit gehabt hat, zu der die Bäume die Höhe von 2 m<br />
überschritten haben.<br />
Bay AGBGB Artikel 49 Messung des Grenzabstands<br />
Der Abstand nach Art. 47 und 48 wird von der Mitte des Stammes an der<br />
Stelle, an der dieser aus dem Boden hervortritt, bei Sträuchern und Hecken<br />
von der Mitte der zunächst an der Grenze befindlichen Triebe, bei<br />
Hopfenstöcken von der Hopfenstange oder dem Steigdraht ab gemessen.<br />
Bay AGBGB Artikel 50 Ausnahmen vom Grenzabstand<br />
(1) Art. 47 und 48 sind nicht auf Gewächse anzuwenden, die sich hinter einer<br />
Mauer oder einer sonstigen dichten Einfriedung befinden und diese nicht<br />
oder nicht erheblich überragen. Sie gelten ferner nicht für Bepflanzungen,<br />
die längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Platz<br />
gehalten werden, sowie für Bepflanzungen, die zum Uferschutz, zum<br />
Schutz von Abhängen oder Böschungen oder zum Schutz einer Eisenbahn<br />
dienen.<br />
(2) Art. 48 Abs. 1 gilt auch nicht für Stein- und Kernobstbäume sowie Bäume,<br />
die sich in einem Hofraum oder einem Hausgarten befinden.<br />
(3) Im Fall einer Aufforstung kann die Einhaltung des in Art. 48 Abs. 1<br />
bestimmten Abstands nicht verlangt werden, wenn die Aufforstung nach<br />
der Lage des aufzuforstenden Grundstücks der wirtschaftlichen<br />
Zweckmäßigkeit entspricht. Im übrigen bleiben die besonderen<br />
Vorschriften über den Grenzabstand bei der Erstaufforstung unberührt.<br />
Bay AGBGB Artikel 51 Ältere Gewächse und Waldungen<br />
(1) Für die bereits zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
vorhandenen Bäume, Sträucher und Hecken sind die vor diesem Zeitpunkt<br />
geltenden Vorschriften weiterhin anzuwenden, soweit sie das Halten der<br />
Gewächse in einer geringeren als der nach Art. 47 bis 50 einzuhaltenden<br />
Entfernung von der Grenze des Nachbargrundstücks gestatten.<br />
(2) Bei einem Grundstück, das bereits zur Zeit des Inkrafttretens des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Wald bestanden war, gilt bis zur ersten<br />
Verjüngung des Waldes nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
das gleiche auch für neue Bäume und Sträucher. Auch nach der<br />
Verjüngung ist Art. 48 nicht anzuwenden.<br />
(3) Der Eigentümer eines Waldgrundstücks ist verpflichtet, die Wurzeln eines<br />
Baums oder Strauchs, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen<br />
sind, das bereits zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
mit Wald bestanden war, sowie die von einem solchen Grundstück<br />
herüberragenden Zweige bis zur ersten Verjüngung des Waldes auf dem<br />
Nachbargrundstück nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu<br />
dulden.<br />
(4) Dem Eigentümer eines anderen Grundstücks obliegt die Duldungspflicht<br />
nach Absatz 3 nur gegenüber den herüberragenden Zweigen, soweit diese<br />
mindestens 5 m vom Boden entfernt sind; die Entfernung wird bis zu den
unteren Spitzen der Zweige gemessen. Herüberragende Zweige, die<br />
weniger als 5 m vom Boden entfernt sind, müssen auf der westlichen,<br />
nordwestlichen, südwestlichen und südlichen Seite des mit Wald<br />
bestandenen Grundstücks geduldet werden, wenn durch ihre Beseitigung<br />
der Fortbestand eines zum Schutz des Waldes erforderlichen Baums oder<br />
Strauchs gefährdet oder die Ertragsfähigkeit des Waldbodens infolge des<br />
Eindringens von Wind und Sonne beeinträchtigt werden würde.<br />
Bay AGBGB Artikel 52 Verjährung der nachbarrechtlichen Ansprüche<br />
(1) Die sich aus Art. 43 bis 45 und 46 Abs. 1 ergebenden Ansprüche<br />
unterliegen nicht der Verjährung. Der Anspruch auf Beseitigung eines die<br />
Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 verletzenden Zustands verjährt in fünf<br />
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem<br />
1. der Anspruch entstanden ist, und<br />
2. der Eigentümer des Grundstücks von den den Anspruch begründenden<br />
Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen<br />
müsste.<br />
(2) Sind Ansprüche nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 verjährt und werden die<br />
Gewächse durch neue ersetzt, so kann hinsichtlich der neuen Gewächse<br />
die Einhaltung des in Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 vorgeschriebenen<br />
Abstands verlangt werden.<br />
Bay AGBGB Artikel 53 Erlöschen von Anwenderechten<br />
(1) Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs nach<br />
örtlichem Herkommen bestehende Befugnis, bei der Bestellung<br />
landwirtschaftlicher Grundstücke die Grenze eines Nachbargrundstücks zu<br />
überschreiten (Anwenderecht), erlischt mit dem Ablauf von zehn Jahren<br />
nach der letzten Ausübung oder durch Verzicht.<br />
(2) Die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 203, 204 Abs. 1<br />
Nrn. 1, 4, 6 bis 9, 11 bis 14, Abs. 2 und 3, §§ 205 bis 207, 209 bis 213<br />
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. Ein<br />
Verzicht muß in öffentlich beglaubigter Form abgegeben werden; im<br />
übrigen gelten Art. 46 Abs. 4 Sätze 2 und 3 entsprechend.<br />
Bay AGBGB Artikel 54 Ausschluß von privatrechtlichen Ansprüchen bei<br />
Verkehrsunternehmen<br />
§ 14 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt für Eisenbahn-,<br />
Dampfschiffahrts- und ähnliche Unternehmen, die dem öffentlichen Verkehr<br />
dienen, entsprechend.<br />
ACHTER ABSCHNITT Buchungsfreie Grundstücke und<br />
altrechtliche Grunddienstbarkeiten<br />
Bay AGBGB Artikel 55 Übertragung des Eigentums an buchungsfreien<br />
Grundstücken<br />
(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, das im Grundbuch<br />
nicht eingetragen ist und nach den Vorschriften der Grundbuchordnung<br />
auch nach der Übertragung nicht eingetragen zu werden braucht, ist die
Einigung des Veräußerers und des Erwerbers darüber, daß das Eigentum<br />
übergehen soll, und die öffentliche Beurkundung der Erklärungen der<br />
beiden Teile erforderlich.<br />
(2) Die Übertragung des Eigentums unter einer Bedingung oder einer<br />
Zeitbestimmung ist unwirksam.<br />
Bay AGBGB Artikel 56 Dienstbarkeiten an buchungsfreien<br />
Grundstücken<br />
(1) Zur Begründung einer Dienstbarkeit an einem Grundstück, das im<br />
Grundbuch nicht eingetragen ist und nach den Vorschriften der<br />
Grundbuchordnung nicht eingetragen zu werden braucht, ist die Einigung<br />
des Bestellers und des Erwerbers darüber, daß das Grundstück mit der<br />
Dienstbarkeit belastet werden soll, erforderlich. Die Erklärung des<br />
Bestellers muß in öffentlich beglaubigter Form abgegeben werden.<br />
(2) Zur Aufhebung einer Dienstbarkeit an einem Grundstück der in Absatz 1<br />
bezeichneten Art ist die Erklärung des Berechtigten gegenüber dem<br />
Eigentümer erforderlich, daß er die Dienstbarkeit aufgebe; die Erklärung<br />
muß in öffentlich beglaubigter Form abgegeben werden. § 876 des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.<br />
(3) Eine Dienstbarkeit an einem Grundstück der in Absatz 1 bezeichneten Art<br />
erlischt mit dem Ablauf von zehn Jahren nach der letzten Ausübung. Hat<br />
eine Ausübung nicht stattgefunden, so beginnt die zehnjährige Frist mit<br />
dem Zeitpunkt, von dem an die Ausübung zulässig war. Die für die<br />
Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 203, 204 Abs. 1 Nrn. 1, 4, 6 bis<br />
9, 11 bis 14, Abs. 2 und 3, §§ 205 bis 207, 209 bis 213 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. Der Ablauf der Frist wird<br />
nicht dadurch gehemmt, daß die Dienstbarkeit nur zeitweise ausgeübt<br />
werden kann. Die Frist endet jedoch in diesem Fall nicht, bevor die Zeit,<br />
zu der die Ausübung zulässig war, zum zweiten Mal eingetreten und seit<br />
dem zweiten Eintritt ein Jahr verstrichen ist.<br />
Bay AGBGB Artikel 57 Aufhebung und Erlöschen altrechtlicher<br />
Grunddienstbarkeiten<br />
(1) Für die Aufhebung und das Erlöschen von Grunddienstbarkeiten, die nach<br />
den vor Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs geltenden<br />
Vorschriften entstanden und nicht im Grundbuch eingetragen sind, gelten<br />
Art. 56 Abs. 2 und 3 entsprechend.<br />
(2) Die Grunddienstbarkeit erlischt auch, wenn sie sich mit dem Eigentum an<br />
dem belasteten Grundstück vereinigt.<br />
Bay AGBGB Artikel 58 Ausschluß des Berechtigten bei altrechtlichen<br />
Grunddienstbarkeiten<br />
(1) Ist der Eigentümer über das Bestehen einer Grunddienstbarkeit im<br />
Ungewissen, so kann der Berechtigte mit seinem Recht im Weg des<br />
Aufgebotsverfahrens ausgeschlossen werden.<br />
(2) Das Aufgebot erstreckt sich nicht auf Grunddienstbarkeiten, mit denen das<br />
Halten einer dauernden Anlage verbunden ist, solange die Anlage besteht.
Bay AGBGB Artikel 59 Aufgebotsverfahren<br />
(1) Für das Aufgebotsverfahren gelten die nachfolgenden besonderen<br />
Bestimmungen.<br />
(2) Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk das belastete Grundstück liegt.<br />
Antragsberechtigt ist der Eigentümer des belasteten Grundstücks.<br />
(3) Der Antragsteller hat die ihm bekannten Grunddienstbarkeiten anzugeben<br />
und einen beglaubigten Plan seines Grundstücks vorzulegen, aus dem die<br />
angrenzenden Grundstücke ersichtlich sind.<br />
(4) Das Aufgebot wird öffentlich bekanntgemacht durch Anheften an die<br />
Gerichtstafel, durch einmalige Einrückung in das für die<br />
Bekanntmachungen des Gerichts bestimmte Blatt sowie durch Anheften an<br />
die für amtliche Bekanntmachungen bestimmte Stelle der Gemeinde, in<br />
deren Bezirk das belastete Grundstück liegt. Das Aufgebot soll denjenigen,<br />
die im Grundbuch als Eigentümer der angrenzenden Grundstücke<br />
eingetragen sind, und den Erben eines eingetragenen Eigentümers, sofern<br />
sie dem Gericht bekannt sind, von Amts wegen zugestellt werden. Die<br />
Zustellung kann durch Aufgabe zur Post erfolgen.<br />
(5) Die Aufgebotsfrist muß mindestens drei Monate betragen; sie beginnt mit<br />
der Einrückung in das in Absatz 4 bezeichnete Blatt. In dem Aufgebot ist<br />
den Berechtigten, die sich nicht melden, als Rechtsnachteil anzudrohen,<br />
daß ihre Grunddienstbarkeiten erlöschen, sofern diese nicht dem<br />
Antragsteller bekannt sind.<br />
(6) Eine öffentliche Bekanntmachung des wesentlichen Inhalts des<br />
Ausschlußurteils findet nicht statt.<br />
Bay AGBGB Artikel 60 Erneutes Aufgebotsverfahren<br />
Wird hinsichtlich eines Grundstücks, für das ein Ausschlußurteil ergangen ist,<br />
von einem anderen Antragsberechtigten neuerdings das Aufgebot beantragt,<br />
so gelten die in dem früheren Verfahren von dem Antragsteller angegebenen<br />
oder von dem Berechtigten angemeldeten Grunddienstbarkeiten als dem<br />
Antragsteller bekannt.<br />
NEUNTER ABSCHNITT Sonstige sachenrechtliche Vorschriften<br />
Bay AGBGB Artikel 61 Fundbehörden und fundrechtliches Verfahren<br />
Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Justiz durch Rechtsverordnung die zuständigen<br />
Behörden im Sinn von § 965 Abs. 2 Satz 1, § 966 Abs. 2 Satz 2, §§ 967, 973<br />
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 3, § 974 Satz 1, §§ 975, 976 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs zu bestimmen und das Verfahren der Fundbehörden bei der<br />
Behandlung der Fundsachen näher zu regeln.<br />
Bay AGBGB Artikel 62 Stockwerkseigentum<br />
Das zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende<br />
Stockwerkseigentum gilt als Miteigentum an dem Grundstück mit der<br />
Maßgabe, daß jedem Miteigentümer die ausschließliche und dauernde<br />
Benutzung der Teile des Gebäudes zusteht, die ihm oder seinem
Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs gehörten, und daß er die Kosten für ihre Unterhaltung zu tragen<br />
hat. Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft ist ausgeschlossen. Für die<br />
Benutzungsrechte der Miteigentümer gilt § 1010 Abs. 1 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs entsprechend.<br />
Bay AGBGB Artikel 63 Ablösung einer Reallast<br />
Ist vereinbart, daß der Eigentümer eine Reallast durch Zahlung eines<br />
bestimmten Betrags ablösen kann, gilt § 1202 des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
entsprechend. Haftet der Eigentümer für die während der Dauer seines<br />
Eigentums fällig werdenden Leistungen auch persönlich, so erstreckt sich im<br />
Fall der Kündigung die persönliche Haftung auf die Ablösungssumme.<br />
Bay AGBGB Artikel 64 Ablösungssumme bei subjektiv-dinglichen<br />
Rechten<br />
Bei der Ablösung eines Rechts, das dem jeweiligen Eigentümer eines<br />
Grundstücks zusteht, sind, wenn das Grundstück des Berechtigten mit Rechten<br />
Dritter belastet ist, auf die Ablösungssumme, soweit nicht besondere<br />
Vorschriften bestehen, die im Fall der Enteignung für die Entschädigung<br />
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden.<br />
Bay AGBGB Artikel 65 Bekanntmachung der Satzung einer<br />
Kreditanstalt<br />
Für die Bekanntmachung der Satzung einer Kreditanstalt nach § 1115 Abs. 2<br />
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist das Staatsministerium für Wirtschaft und<br />
Verkehr zuständig. Die Bekanntmachung soll im Staatsanzeiger veröffentlicht<br />
werden.<br />
Bay AGBGB Artikel 66 Lösungsanspruch der öffentlichen<br />
Pfandleihanstalten<br />
Erwirbt eine öffentliche Pfandleihanstalt nach § 935 Abs. 1, § 1207 des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs kein Pfandrecht, so kann sie die Herausgabe der<br />
Sache an den Berechtigten bis zur Bezahlung des auf die Sache gewährten<br />
Darlehens samt Zinsen verweigern. Gleiches gilt, wenn sie ein Pfandrecht nach<br />
§ 935 Abs. 1, § 1208 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur im Rang nach dem<br />
Recht eines Dritten, mit dem die Sache belastet ist, erwirbt. § 1003 des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.<br />
ZEHNTER ABSCHNITT Familien- und erbrechtliche Vorschriften,<br />
Vollziehung von Auflagen<br />
Bay AGBGB Artikel 67 Anlegung von Mündelgeld<br />
Für die Anlegung von Mündelgeld ist eine Hypothek, Grundschuld oder<br />
Rentenschuld nur als sicher anzusehen, wenn sie innerhalb der ersten Hälfte<br />
des Grundstückswerts liegt.
Bay AGBGB Artikel 68 Festsetzung des Ertragswerts eines Landguts<br />
Soweit in Fällen der Erbfolge oder der Aufhebung einer fortgesetzten<br />
Gütergemeinschaft der Ertragswert eines Landguts festzusetzen ist, gilt als<br />
solcher, vorbehaltlich der Berücksichtigung besonderer Umstände, der<br />
achtzehnfache Betrag des jährlichen Reinertrags. Dieser ist nach<br />
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln.<br />
Bay AGBGB Artikel 69 Vollziehung von Auflagen<br />
In den Fällen des § 525 Abs. 2 und des § 2194 Satz 2 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs ist für die Geltendmachung des Anspruchs auf die im öffentlichen<br />
Interesse liegende Vollziehung einer Auflage die Behörde zuständig, zu deren<br />
Wirkungskreis die Wahrung des Interesses gehört. Bezweckt die Auflage die<br />
Förderung von Interessen, die zum Wirkungskreis einer Körperschaft, Stiftung<br />
oder Anstalt des öffentlichen Rechts gehören, so ist diese zuständig.<br />
ELFTER ABSCHNITT Öffentlich-rechtliche Ansprüche<br />
Bay AGBGB Artikel 70 Haftung des Grundstücks<br />
(1) Für öffentliche Lasten eines Grundstücks haftet das Grundstück.<br />
(2) Die Haftung des Grundstücks für fällige wiederkehrende Leistungen<br />
erlischt mit dem Ablauf von zwei, für fällige einmalige Leistungen mit dem<br />
Ablauf von vier Jahren nach dem Eintritt des Zeitpunkts, von dem an die<br />
Leistung gefordert werden kann, sofern das Grundstück nicht vorher<br />
beschlagnahmt worden ist. Das Grundstück haftet jedoch nicht über den<br />
Zeitpunkt hinaus, in dem die persönliche Schuld erlischt.<br />
Bay AGBGB Artikel 71 Erlöschen<br />
(1) Die auf eine Geldzahlung gerichteten öffentlich-rechtlichen Ansprüche<br />
1. des Freistaates Bayern, einer bayerischen Gemeinde oder eines<br />
bayerischen Gemeindeverbands,<br />
2. gegen den Freistaat Bayern, eine bayerische Gemeinde oder einen<br />
bayerischen Gemeindeverband<br />
erlöschen, soweit nicht anderes bestimmt ist, in drei Jahren. Die Frist<br />
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Berechtigte von den den<br />
Anspruch begründenden Umständen und der Person des Verpflichteten<br />
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, jedoch<br />
nicht vor dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.<br />
Soweit der Freistaat Bayern, eine bayerische Gemeinde oder ein<br />
bayerischer Gemeindeverband berechtigt ist, ist die Kenntnis der<br />
zuständigen Behörde erforderlich. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis erlischt<br />
der Anspruch in 10 Jahren von seiner Entstehung an.<br />
(2) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Hemmung, die<br />
Ablaufhemmung sowie über die Geltendmachung von Sicherheiten sind<br />
entsprechend anzuwenden; Art. 53 des Bayerischen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt.<br />
(3) Das zur Befriedigung eines erloschenen Anspruchs Geleistete kann nicht<br />
zurückgefordert werden, auch wenn die Leistung in Unkenntnis des<br />
Erlöschens bewirkt worden ist. Das gleiche gilt von einem
vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des<br />
Verpflichteten.<br />
(4) Das Erlöschen schließt die Aufrechnung nicht aus, wenn der erloschene<br />
Anspruch zu der Zeit, zu der er gegen einen anderen Anspruch<br />
aufgerechnet werden konnte, noch nicht erloschen war.<br />
ZWEITER TEIL Ausführung handelsrechtlicher Vorschriften<br />
Bay AGBGB Artikel 72 Benachbarte Gemeinden<br />
Für die in § 30 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs vorgesehene Bestimmung, daß<br />
benachbarte Orte oder Gemeinden als ein Ort oder als eine Gemeinde im Sinn<br />
der Vorschriften des § 30 des Handelsgesetzbuchs anzusehen sind, ist das<br />
Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr zuständig.<br />
Bay AGBGB Artikel 73 (weggefallen)<br />
Bay AGBGB Artikel 74 Auflösung von Genossenschaften und<br />
Gesellschaften mit beschränkter Haftung<br />
Für die Auflösung einer Genossenschaft nach § 81 des <strong>Gesetze</strong>s betreffend die<br />
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und einer Gesellschaft nach § 62<br />
des <strong>Gesetze</strong>s betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist die<br />
Kreisverwaltungsbehörde zuständig.<br />
DRITTER TEIL Übergangs-, Änderungs- und Schlußvorschriften<br />
Bay AGBGB Artikel 75 Verweisungen in anderen Vorschriften<br />
Soweit in anderen Vorschriften des <strong>Landesrecht</strong>s auf Vorschriften verwiesen<br />
wird, die durch dieses Gesetz geändert oder ersetzt werden, treten an deren<br />
Stelle die geänderten oder ersetzenden Vorschriften.<br />
Bay AGBGB Artikel 76 (weggefallen)<br />
Bay AGBGB Artikel 77 Sonstige Übergangsvorschriften<br />
(1) Rechtssätze aus der Zeit vor Erlaß der Verfassungsurkunde vom 26. Mai<br />
1818 bleiben nur insoweit in Geltung, als sie in Art. 74, 80 Abs. 2,<br />
Art. 132 und 133 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch<br />
vorbehalten sind.<br />
(2) Eine zu der Zeit, zu der das Grundbuch als angelegt anzusehen ist,<br />
bestehende Hypothek, die zur Sicherung künftiger Ansprüche auf Zinsen,<br />
Kosten und andere Nebenleistungen neben der Hypothek für die<br />
Hauptforderung bestellt worden ist, erlischt, wenn sie sich mit dem<br />
Eigentum in einer Person vereinigt.<br />
(3) weggefallen<br />
(4) Für Güterstände und fortgesetzte Gütergemeinschaften, die auf das vor<br />
dem 1. Januar 1900 geltende Recht zurückgehen, bleiben die bisherigen<br />
<strong>Gesetze</strong> maßgebend. Dies gilt auch, soweit diese <strong>Gesetze</strong> für einen<br />
Güterstand oder eine fortgesetzte Gütergemeinschaft besondere<br />
erbrechtliche Regelungen vorsehen.
(5) Eine Geldanlage, die nach dem in den vormals coburgischen Landesteilen<br />
geltenden Recht als mündelsicher anzusehen war, ist auch nach dem<br />
Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s bis zu einer Änderung der Anlage als<br />
mündelsicher anzusehen. Die teilweise Rückzahlung eines Darlehens gilt<br />
nicht als Änderung der Anlage im Sinn dieser Bestimmung.<br />
(6) Wenn die Satzungen einer öffentlichen Anstalt vorsehen, daß dieser beim<br />
Eintritt des Erbfalls das Recht an den eingebrachten Sachen von Personen<br />
zufällt, die bis zu ihrem Tod unentgeltlich in der Anstalt verpflegt worden<br />
sind, sind die Art. 101 und 102 des Ausführungsgesetzes zum<br />
Bürgerlichen Gesetzbuch vom 9. Juni 1899 (BayBS III S. 89, zuletzt geändert<br />
durch Gesetz vom 23. Juni 1981 (GVBl S. 188).) noch insoweit anzuwenden, als die<br />
Personen vor dem Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s von der Anstalt<br />
aufgenommen worden sind.<br />
Bay AGBGB Artikel 77 a Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Änderung<br />
des <strong>Gesetze</strong>s zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und<br />
anderer <strong>Gesetze</strong> sowie zur Änderung weiterer landesrechtlicher<br />
Vorschriften vom 24. Dezember 2002<br />
Art. 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch ist mit der<br />
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle des 1. Januar 2002 der<br />
1. Januar 2003 und an die Stelle des 31. Dezember 2001 der 31. Dezember<br />
2002 tritt.<br />
Bay AGBGB Artikel 78 Aufrechterhaltung eingetretener<br />
Rechtswirkungen<br />
Die Aufhebung oder Änderung von Rechtsvorschriften durch dieses Gesetz läßt<br />
die eingetretenen Rechtswirkungen unberührt.<br />
Bay AGBGB Artikel 79 (Änderungsbestimmung)<br />
Bay AGBGB Artikel 80 Inkrafttreten<br />
(1) Art. 79 dieses <strong>Gesetze</strong>s tritt am 1. September 1982 in Kraft. Im übrigen<br />
tritt dieses Gesetz am 1. Januar 1983 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. September 1982 (GVBl S. 803).<br />
(2) gegenstandslos
Gesetz zur Ausführung der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung (Bay<br />
AGVwGO)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1992 (GVBl. S. 162), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 23. Juni 1993 (GVBl. S. 408), vom 12. April 1994 (GVBl. S. 210), vom 26. Juli 1997 (GVBl.<br />
S. 311), vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 542), vom 28. März 2000 (GVBl. S. 136), vom 23.<br />
November 2001 (GVBl. S. 734), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 929), vom 24. Juni 2004 (GVBl.<br />
S. 229), vom 27. Dezember 2004 (GVBl. S. 521), vom 27. Dezember 2004 (GVBl. S. 541), vom 24.<br />
Dezember 2005 (GVBl. S. 665), vom 23. Juni 2006 (GVBl. S. 330), vom 22. Juni 2007 (GVBl.<br />
S. 390), vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 958) (FN BayRS 34-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Art. 1 (Zu §§ 2, 3 Abs. 1, § 184 VwGO)<br />
Art. 2 (Zu § 3 Abs. 1, § 187 Abs. 1 und 2 VwGO)<br />
Art. 3<br />
Art. 4 (Zu § 38 VwGO)<br />
Art. 5 (Zu § 9 Abs. 3, § 47 VwGO)<br />
Art. 6 (Zu § 48 Abs. 1 Satz 3 VwGO)<br />
Art. 7 (Zu § 12 Abs. 3 VwGO)<br />
Art. 8<br />
Art. 9<br />
Art. 10 (Zu § 13 Satz 2 VwGO)<br />
Art. 11 (Zu § 26 Abs. 2 VwGO)<br />
Art. 12 (Zu § 187 Abs. 1 VwGO)<br />
Art. 13 (Zu § 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO)<br />
Art. 14<br />
Art. 15 (Zu § 68 VwGO)<br />
Art. 16 (Zu § 36 Abs. 1 Satz 2 VwGO)
Art. 17<br />
Art. 18<br />
Bay AGVwGO Art. 1 (Zu §§ 2, 3 Abs. 1, § 184 VwGO)<br />
(1) 1 Das Oberverwaltungsgericht für den Freistaat Bayern führt die<br />
Bezeichnung “Bayerischer Verwaltungsgerichtshof”. 2 Der<br />
Verwaltungsgerichtshof hat seinen Sitz in München. 3 In Ansbach werden<br />
vier auswärtige Senate des Verwaltungsgerichtshofs errichtet.<br />
(2) Die bayerischen Verwaltungsgerichte haben ihren Sitz<br />
1. in München für den Regierungsbezirk Oberbayern,<br />
2. in Regensburg für die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz,<br />
3. in Bayreuth für den Regierungsbezirk Oberfranken,<br />
4. in Ansbach für den Regierungsbezirk Mittelfranken,<br />
5. in Würzburg für den Regierungsbezirk Unterfranken,<br />
6. in Augsburg für den Regierungsbezirk Schwaben.<br />
Bay AGVwGO Art. 2 (Zu § 3 Abs. 1, § 187 Abs. 1 und 2 VwGO)<br />
(1) 1 Die beim Verwaltungsgericht München für<br />
Personalvertretungsangelegenheiten des Bundes und für das bayerische<br />
Personalvertretungsrecht bestehenden Fachkammern sind für die<br />
Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben, die beim<br />
Verwaltungsgericht Ansbach gebildeten Fachkammern für die<br />
Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken und<br />
Unterfranken zuständig. 2 Für die Besetzung und das Verfahren der<br />
Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in<br />
Personalvertretungsangelegenheiten nach dem Bayerischen<br />
Personalvertretungsgesetz gelten dessen Vorschriften.<br />
(2) 1 Die Vorschriften des Bayerischen Disziplinargesetzes über die Bildung<br />
von Spruchkörpern für Disziplinarsachen bleiben unberührt. 2 Für die<br />
Besetzung und das Verfahren der Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit<br />
in Disziplinarsachen gelten die Vorschriften des Bayerischen<br />
Disziplinargesetzes.<br />
Bay AGVwGO Art. 3<br />
1 Die Staatsregierung ernennt den Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs.<br />
2 Die übrigen Richter des Verwaltungsgerichtshofs und die Richter der<br />
Verwaltungsgerichte werden vom Staatsminister des Innern ernannt.<br />
Bay AGVwGO Art. 4 (Zu § 38 VwGO)<br />
Der Staatsminister des Innern übt die Dienstaufsicht über den Präsidenten des<br />
Verwaltungsgerichtshofs aus.<br />
Bay AGVwGO Art. 5 (Zu § 9 Abs. 3, § 47 VwGO)<br />
1 Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auf<br />
Antrag über die Gültigkeit von Rechtsvorschriften, die im Rang unter dem<br />
Landesgesetz stehen. 2 Über Satzungen nach Art. 6 Abs. 7 und Art. 81 Abs. 1<br />
der Bayerischen Bauordnung entscheidet der Verwaltungsgerichtshof nur,
wenn<br />
1. der Antrag von einer Behörde gestellt wird und<br />
2. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat.<br />
Bay AGVwGO Art. 6 (Zu § 48 Abs. 1 Satz 3 VwGO)<br />
Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet im ersten Rechtszug über<br />
Streitigkeiten, die Besitzeinweisungen in den Fällen des § 48 Abs. 1 Satz 1<br />
VwGO betreffen.<br />
Bay AGVwGO Art. 7 (Zu § 12 Abs. 3 VwGO)<br />
1 Der Große Senat beim Verwaltungsgerichtshof besteht aus dem Präsidenten<br />
und sechs Richtern. 2 Bei einer Verhinderung des Präsidenten tritt sein<br />
Stellvertreter an seine Stelle. 3 Ruft der erkennende Senat den Großen Senat<br />
an, weil er in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats<br />
oder des Großen Senats abweichen will, so entsendet jeder beteiligte Senat<br />
einen abstimmungsberechtigten Richter zu den Sitzungen des Großen Senats.<br />
4 Wird der Große Senat zur Klärung einer grundsätzlichen Rechtsfrage<br />
angerufen, so entsendet der erkennende Senat einen<br />
abstimmungsberechtigten Richter zu den Sitzungen des Großen Senats.<br />
Bay AGVwGO Art. 8<br />
1 Der Verwaltungsgerichtshof hat seine Entscheidungen zu veröffentlichen,<br />
soweit sie grundsätzliche Bedeutung haben. 2 Die Auswahl trifft das Präsidium.<br />
Bay AGVwGO Art. 9<br />
(1) 1 Der Verwaltungsgerichtshof gibt sich eine Geschäftsordnung, die das<br />
Präsidium beschließt. 2 Sie bedarf der Genehmigung des Staatsministers<br />
des Innern.<br />
(2) 1 Der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs erläßt für jedes<br />
Verwaltungsgericht eine Geschäftsordnung. 2 Das Präsidium des<br />
Verwaltungsgerichts ist vorher gutachtlich zu hören.<br />
Bay AGVwGO Art. 10 (Zu § 13 Satz 2 VwGO)<br />
(1) Urkundsbeamte der Geschäftsstelle sind die Beamten des gehobenen und<br />
mittleren Dienstes beim Verwaltungsgerichtshof und bei den<br />
Verwaltungsgerichten.<br />
(2) Als stellvertretende Urkundsbeamte können bei Bedarf bestellt werden die<br />
Beamten auf Widerruf des gehobenen und mittleren Dienstes, die<br />
nichtbeamteten Kräfte und in Ausnahmefällen, insbesondere während<br />
ihrer Ausbildung für den Aufstieg in den mittleren Dienst, Beamte des<br />
einfachen Dienstes beim Verwaltungsgerichtshof und bei den<br />
Verwaltungsgerichten.<br />
(3) 1 Die stellvertretenden Urkundsbeamten werden vom Präsidenten des<br />
Gerichts bestellt. 2 Die Bestellung ist schriftlich vorzunehmen; sie kann auf<br />
einzelne Arten von Geschäften oder zeitlich beschränkt werden. 3 Sie ist<br />
jederzeit widerruflich und gilt nur für die Dauer der Verwendung bei dem<br />
Gericht, dessen Präsident die Bestellung verfügt hat.
Bay AGVwGO Art. 11 (Zu § 26 Abs. 2 VwGO)<br />
(1) 1 Die Vertrauensleute und ihre Vertreter werden vom Bezirkstag, mit<br />
seiner Ermächtigung vom Bezirksausschuß gewählt. 2 Art. 42 Abs. 3 der<br />
Bezirksordnung ist anzuwenden.<br />
(2) Für den beim Verwaltungsgericht Regensburg zu bestellenden Ausschuß<br />
zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter wählt der Bezirkstag<br />
Niederbayern je vier, der Bezirkstag Oberpfalz je drei Vertrauensleute und<br />
Vertreter.<br />
(3) 1 Die Vertrauensleute und ihre Vertreter werden auf vier Jahre gewählt.<br />
2<br />
Die §§ 23 und 24 Abs. 1 und 2 VwGO gelten entsprechend; über die<br />
Befreiung von der Übernahme oder der weiteren Ausübung des Amts und<br />
über die Entbindung von diesem Amt entscheidet der Bezirkstag, mit<br />
seiner Ermächtigung der Bezirksausschuß.<br />
Bay AGVwGO Art. 12 (Zu § 187 Abs. 1 VwGO)<br />
(1) Die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind als Schiedsgerichte<br />
zuständig für Vermögensauseinandersetzungen öffentlich-rechtlicher<br />
Verbände, soweit das in besonderen <strong>Gesetze</strong>n bestimmt ist.<br />
(2) 1 Für die Besetzung der Schiedsgerichte und für das Verfahren gelten die<br />
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung, für das Verfahren jedoch<br />
nur, soweit in besonderen <strong>Gesetze</strong>n nicht anderes bestimmt ist. 2 Die<br />
Schiedsgerichte entscheiden unter Würdigung der Rechts- und Sachlage<br />
nach billigem Ermessen.<br />
Bay AGVwGO Art. 13 (Zu § 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO)<br />
Soweit öffentlich-rechtliche Streitigkeiten bisher einem anderen Gericht<br />
zugewiesen sind, hat es dabei sein Bewenden.<br />
Bay AGVwGO Art. 14<br />
(1) Soweit nicht anderes bestimmt wird, tritt der Widerspruch an die Stelle<br />
aller förmlichen Rechtsbehelfe, die das <strong>Landesrecht</strong> für das<br />
Verwaltungsverfahren einräumt.<br />
(2) Unberührt bleiben die Rechtsbehelfe nach dem Bayerischen<br />
Disziplinargesetz.<br />
(3) Unberührt bleiben die Rechtsbehelfe nach dem Landeswahlgesetz, dem<br />
Bezirkswahlgesetz und dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz, soweit<br />
sie nicht Voraussetzung der verwaltungsgerichtlichen Klage sind.<br />
Bay AGVwGO Art. 15 (Zu § 68 VwGO)<br />
(1) 1 Gegen einen nur an ihn gerichteten Verwaltungsakt kann der Betroffene<br />
1. im Bereich des Kommunalabgabenrechts,<br />
2. im Bereich des Landwirtschaftsrechts einschließlich des Rechts<br />
landwirtschaftlicher Subventionen sowie im Bereich des Rechts forstlicher<br />
Subventionen und jagdrechtlicher Abschussplanverfahren,<br />
3. im Bereich des Schulrechts einschließlich des Rechts der<br />
Schulfinanzierung und Schülerbeförderung,<br />
4. in den Bereichen des Ausbildungs- und Studienförderungsrechts, des<br />
Heimrechts, des Kinder- und Jugendhilferechts, der Kinder-, Jugend- und
Familienförderung, des Kriegsopferfürsorgerechts, des<br />
Schwerbehindertenrechts, des Unterhaltsvorschussrechts, des<br />
Wohngeldrechts, des Rundfunkgebührenrechts und im Rahmen der<br />
Förderungen nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF-Förderung), soweit<br />
jeweils der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist,<br />
5. in Angelegenheiten der Beamten mit Ausnahme des Disziplinarrechts,<br />
6. bei personenbezogenen Prüfungsentscheidungen<br />
entweder Widerspruch einlegen oder unmittelbar Klage erheben; in den<br />
Angelegenheiten der Nr. 5 gilt Entsprechendes für Leistungs- und<br />
Feststellungsklagen. 2 Richtet sich der Verwaltungsakt in diesen Bereichen<br />
an mehrere Betroffene, kann jeder von ihnen unmittelbar Klage erheben,<br />
wenn alle Betroffenen zustimmen. 3 Wird unmittelbar Klage erhoben,<br />
bedarf es keiner Durchführung eines Vorverfahrens nach § 68 VwGO.<br />
(2) Soweit in Abs. 1 nichts Abweichendes geregelt ist, entfällt das<br />
Vorverfahren nach § 68 VwGO.<br />
(3) 1 Die Abs. 1 und 2 gelten nur für Verfahren der Behörden des Freistaates<br />
Bayern, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen der<br />
Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des<br />
öffentlichen Rechts. 2 § 68 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 VwGO sowie<br />
sonstige abweichende Regelungen in anderen <strong>Gesetze</strong>n und<br />
Rechtsverordnungen bleiben unberührt.<br />
Bay AGVwGO Art. 16 (Zu § 36 Abs. 1 Satz 2 VwGO)<br />
1 Vertretungsbehörde des Freistaates Bayern vor den Gerichten der<br />
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in den Fällen des § 45 VwGO die<br />
Ausgangsbehörde und in den übrigen Fällen die Landesanwaltschaft Bayern,<br />
soweit die Vertretung nicht auf eine andere Behörde oder Stelle übertragen ist.<br />
2 Das Nähere regelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 3 Die<br />
Regelungen der Verordnung über die gerichtliche Vertretung des Freistaates<br />
Bayern (Vertretungsverordnung – VertrV) in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 4. Oktober 1995 (GVBl S. 733, BayRS 600-1-F), zuletzt geändert durch<br />
§ 2 der Verordnung vom 9. Januar 2007 (GVBl. S. 12), bleiben unberührt.<br />
Bay AGVwGO Art. 17<br />
1 Die Staatsregierung erläßt die zur Ausführung dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlichen<br />
Rechtsvorschriften. 2 Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s erläßt das Staatsministerium des Innern, soweit erforderlich im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.<br />
Bay AGVwGO Art. 18<br />
1 Dieses Gesetz ist dringlich. 2 Es tritt am 1. Dezember 1960 in Kraft. 3 Die<br />
Art. 1, 5 bis 8, 10 und 11 des <strong>Gesetze</strong>s treten am 1. April 1960 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der ursprünglichen<br />
Fassung vom 28. November 1960 (GVBl S. 266). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren<br />
Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.
Verordnung über Bauvorlagen und<br />
bauaufsichtliche Anzeigen (Bay<br />
BauVorlV)<br />
vom 10. November 2007 (GVBl. S. 792), geändert durch Verordnungen vom 8. Juli 2009 (GVBl.<br />
S. 332), vom 22. Oktober 2009 (GVBl. S. 542) (FN BayRS 2132-1-2-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Erster Teil Allgemeines [§§ 1 - 2 ]<br />
Zweiter Teil Vorzulegende Bauvorlagen [§§ 3 - 6 ]<br />
Dritter Teil Inhalt der Bauvorlagen [§§ 7 - 13 ]<br />
Vierter Teil Abgrabungsplan [§ 14 ]<br />
Fünfter Teil Bauzustandsanzeigen [§§ 15 - 16 ]<br />
Sechster Teil Inkrafttreten, Außerkrafttreten [§ 17 ]<br />
Anlage 1<br />
Anlage 2<br />
Auf Grund von Art. 80 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588, BayRS<br />
2132–1–I) und Art. 7 Abs. 2 des Bayerischen Abgrabungsgesetzes (BayAbgrG)<br />
vom 27. Dezember 1999 (GVBl S. 532, 535, BayRS 2132–2–I) erlässt das<br />
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:<br />
[§§ 1 - 2] Erster Teil Allgemeines<br />
Bay BauVorlV § 1 Begriff, Beschaffenheit<br />
(1) 1 Bauvorlagen sind die einzureichenden Unterlagen, die für die Beurteilung<br />
des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags (Art. 64 Abs. 2<br />
Satz 1 BayBO), für die Anzeige der beabsichtigten Beseitigung (Art. 57<br />
Abs. 5 Satz 2 BayBO) oder für die Genehmigungsfreistellung (Art. 58<br />
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO) erforderlich sind. 2 Bautechnische<br />
Nachweise gelten auch dann als Bauvorlagen im Sinn dieser Verordnung,<br />
wenn sie der Bauaufsichtsbehörde nicht vorzulegen sind.<br />
(2) 1 Bauvorlagen müssen aus alterungsbeständigem Papier oder<br />
gleichwertigem Material lichtbeständig hergestellt sein und dem Format<br />
DIN A 4 entsprechen oder auf diese Größe gefaltet sein. 2 Art. 3 a des<br />
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) bleibt unberührt.<br />
(3) Hat das Staatsministerium des Innern Vordrucke öffentlich bekannt<br />
gemacht, sind diese zu verwenden.<br />
(4) Die Bauaufsichtsbehörde darf ein Modell oder weitere Nachweise<br />
verlangen, wenn dies zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist.
(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Bauvorlagen nach dem Zweiten Teil und<br />
einzelne Angaben in den Bauvorlagen sowie auf bautechnische Nachweise<br />
einschließlich deren Prüfung und deren Bescheinigung durch<br />
Prüfsachverständige verzichten, soweit diese zur Beurteilung der<br />
Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens nicht erforderlich sind.<br />
Bay BauVorlV § 2 Anzahl<br />
1 Bauvorlagen sind dreifach, ist die Gemeinde zugleich Bauaufsichtsbehörde,<br />
zweifach einzureichen. 2 Die Bauaufsichtsbehörde kann Mehrfertigungen<br />
verlangen, soweit dies zur Beteiligung von Stellen nach Art. 65 Abs. 1 Satz 1<br />
Halbsatz 1 BayBO (Sternverfahren) erforderlich ist; die Mehrfertigungen<br />
müssen nicht nach Art. 51 Abs. 2 Satz 2, Art. 64 Abs. 4 Sätze 1 und 2 BayBO<br />
unterschrieben sein. 3 Im Fall der Errichtung, Änderung oder<br />
Nutzungsänderung einer baulichen Anlage mit Arbeitsstätten mit einem<br />
höheren Gefährdungspotential ist eine weitere Ausfertigung vorzulegen, die die<br />
Bauaufsichtsbehörde an das Gewerbeaufsichtsamt der zuständigen Regierung<br />
weiterleitet; ein höheres Gefährdungspotential liegt in der Regel nicht vor bei<br />
1. Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen,<br />
2. Gesundheitseinrichtungen, ausgenommen Krankenhäuser,<br />
3. Heimen und sonstigen Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege von<br />
Personen sowie Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte und alte Menschen,<br />
ausgenommen Werkstätten für Menschen mit Behinderung,<br />
4. Gast- und Beherbergungsstätten und Lagereinrichtungen mit voraussichtlich<br />
weniger als 20 Beschäftigten,<br />
5. Büro- und Verwaltungsgebäuden,<br />
6. Anlagen des Dienstleistungs- sowie des Verlags- und Mediengewerbes,<br />
ausgenommen Anlagen des Druckgewerbes,<br />
7. Anlagen des Bau- und Elektroinstallationsgewerbes,<br />
8. Verkaufsstätten mit einer Fläche von weniger als 2 000 m 2 ,<br />
9. Anlagen der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei,<br />
10. Anlagen von Verkehrsbetrieben, ausgenommen Anlagen zum<br />
Güterumschlag,<br />
11. Anlagen von Versorgungsbetrieben, ausgenommen Anlagen zum<br />
Güterumschlag.<br />
[§§ 3 - 6] Zweiter Teil Vorzulegende Bauvorlagen<br />
Bay BauVorlV § 3 Bauliche Anlagen<br />
Vorzulegen sind:<br />
1. ein aktueller Auszug aus dem Katasterwerk und, soweit es sich nicht um<br />
Änderungen baulicher Anlagen handelt, bei denen Außenwände und Dächer<br />
sowie die Nutzung nicht verändert werden, der Lageplan (§ 7),<br />
2. die Bauzeichnungen (§ 8),<br />
3. die Baubeschreibung (§ 9),<br />
4. bei Sonderbauten der Nachweis der <strong>Stand</strong>sicherheit (§ 10), soweit er<br />
bauaufsichtlich geprüft wird, andernfalls die Erklärung des Tragwerksplaners<br />
nach Maßgabe des Kriterienkatalogs der Anlage 2,<br />
5. der Nachweis des Brandschutzes (§ 11), soweit er bauaufsichtlich geprüft<br />
wird und nicht bereits in den übrigen Bauvorlagen enthalten ist,<br />
6. die erforderlichen Angaben über die gesicherte Erschließung hinsichtlich der
Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Entsorgung von Abwasser und<br />
der verkehrsmäßigen Erschließung, soweit das Bauvorhaben nicht an eine<br />
öffentliche Wasser- oder Energieversorgung oder eine öffentliche<br />
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden kann oder nicht in<br />
ausreichender Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt,<br />
7. bei Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der<br />
Festsetzungen darüber enthält, eine Berechnung des zulässigen, des<br />
vorhandenen und des geplanten Maßes der baulichen Nutzung,<br />
8. soweit erforderlich, die Erklärung der Übernahme einer Abstandsfläche nach<br />
Art. 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 BayBO,<br />
9. erforderliche Abweichungsanträge (Art. 63 BayBO).<br />
Bay BauVorlV § 4 Werbeanlagen<br />
(1) Vorzulegen sind:<br />
1. ein aktueller Auszug aus dem Katasterwerk mit Einzeichnung des<br />
<strong>Stand</strong>orts,<br />
2. eine Zeichnung (Abs. 2) und Beschreibung (Abs. 3) oder eine andere<br />
geeignete Darstellung der Werbeanlage, wie ein farbiges Lichtbild oder<br />
eine farbige Lichtbildmontage,<br />
3. bei Sonderbauten der Nachweis der <strong>Stand</strong>sicherheit (§ 10), soweit er<br />
bauaufsichtlich geprüft wird, andernfalls die Erklärung des<br />
Tragwerkplaners nach Maßgabe des Kriterienkatalogs der Anlage 2.<br />
(2) Die Zeichnung muss die Darstellung der Werbeanlage und ihre Maße, auch<br />
bezogen auf den <strong>Stand</strong>ort und auf Anlagen, an denen die Werbeanlage<br />
angebracht oder in deren Nähe sie aufgestellt werden soll, sowie Angaben<br />
über die Farbgestaltung enthalten.<br />
(3) In der Beschreibung sind die Art und die Beschaffenheit der Werbeanlage,<br />
sowie, soweit erforderlich, die Abstände zu öffentlichen Verkehrsflächen<br />
sowie zu benachbarten Signalanlagen und Verkehrszeichen anzugeben.<br />
Bay BauVorlV § 5 Vorbescheid<br />
Vorzulegen sind diejenigen Bauvorlagen, die zur Beurteilung der durch den<br />
Vorbescheid zu entscheidenden Fragen des Bauvorhabens erforderlich sind.<br />
Bay BauVorlV § 6 Beseitigung von Anlagen<br />
Vorzulegen sind:<br />
1. ein Lageplan, der die Lage der zu beseitigenden Anlagen unter Bezeichnung<br />
des Grundstücks nach Katasterwerk sowie nach Straße und Hausnummer<br />
darstellt (§ 7),<br />
2. in den Fällen des Art. 57 Abs. 5 Satz 3 BayBO die Bestätigung des<br />
Tragwerksplaners,<br />
3. in den Fällen des Art. 57 Abs. 5 Satz 4 BayBO die Bescheinigung des<br />
Prüfsachverständigen.<br />
[§§ 7 - 13] Dritter Teil Inhalt der Bauvorlagen<br />
Bay BauVorlV § 7 Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan<br />
(1) 1 Der Auszug aus dem Katasterwerk (Ausschnitt aus der Flurkarte) muss<br />
das Baugrundstück und die benachbarten Grundstücke im Umkreis von
mindestens 50 m darstellen. 2 Das Baugrundstück ist zu kennzeichnen.<br />
3<br />
Der Auszug ist mit dem Namen des Bauherrn, der Bezeichnung des<br />
Bauvorhabens und dem Datum des dazugehörigen Bauantrags oder der<br />
Unterlagen nach Art. 58 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO zu beschriften.<br />
(2) 1 Der Lageplan ist auf der Grundlage des Auszugs aus dem Katasterwerk<br />
zu erstellen. 2 Dabei ist ein Maßstab nicht kleiner als 1 : 1 000 zu<br />
verwenden. 3 Ein größerer Maßstab ist zu wählen, wenn es für die<br />
Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist. 4 Der Auszug muss jeweils<br />
von der katasterführenden Behörde (Art. 12 Abs. 4 des Vermessungs- und<br />
Katastergesetzes – VermKatG) beglaubigt oder durch ein automatisiertes<br />
Abrufverfahren gemäß Art. 11 Abs. 2 VermKatG zum Zweck der<br />
Bauvorlage abgerufen worden sein.<br />
(3) Der Lageplan muss, soweit dies zur Beurteilung des Bauvorhabens<br />
erforderlich ist, enthalten:<br />
1. den Maßstab und die Nordrichtung,<br />
2. die katastermäßigen Flächen, Flurstücksnummern und die<br />
Flurstücksgrenzen des Baugrundstücks und der benachbarten<br />
Grundstücke,<br />
3. die im Grundbuch geführte Bezeichnung des Baugrundstücks und der<br />
benachbarten Grundstücke mit den jeweiligen Eigentümerangaben,<br />
4. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und den<br />
benachbarten Grundstücken mit Angabe ihrer Nutzung, First- und<br />
Außenwandhöhe, Dachform und der Art der Außenwände und der<br />
Bedachung,<br />
5. Baudenkmäler einschließlich Ensembles sowie geschützte Teile von<br />
Natur und Landschaft auf dem Baugrundstück und auf den<br />
Nachbargrundstücken,<br />
6. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas,<br />
Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserentsorgung oder der<br />
Telekommunikation und Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen<br />
dienen, sowie deren Abstände zu der geplanten baulichen Anlage,<br />
7. die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der Breite,<br />
der Straßenklasse und der Höhenlage mit Bezug auf das<br />
Höhenbezugssystem,<br />
8. Hydranten und andere Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr,<br />
9. die Festsetzungen eines Bebauungsplans für das Baugrundstück über<br />
die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen,<br />
10. die geplante bauliche Anlage unter Angabe der Außenmaße, der<br />
Dachform und der Höhenlage des Erdgeschossfußbodens zur Straße,<br />
11. die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks und der Eckpunkte<br />
der geplanten baulichen Anlage mit Bezug auf das Höhenbezugssystem,<br />
12. die Aufteilung der nicht überbauten Flächen unter Angabe der Lage<br />
und Breite der Zu- und Abfahrten, der Anzahl, Lage und Größe der<br />
Kinderspielplätze, der Stellplätze und der Flächen für die Feuerwehr,<br />
13. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen baulichen<br />
Anlagen auf dem Baugrundstück und auf den benachbarten Grundstücken,<br />
zu den Nachbargrenzen sowie die Abstandsflächen der geplanten<br />
baulichen Anlagen und der bestehenden Anlagen auf dem Baugrundstück<br />
und den Nachbargrundstücken,<br />
14. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu oberirdischen
Gewässern,<br />
15. geschützten Baumbestand.<br />
(4) Der Inhalt des Lageplans nach Abs. 3 ist auf besonderen Blättern in<br />
geeignetem Maßstab darzustellen, wenn der Lageplan sonst<br />
unübersichtlich würde.<br />
(5) 1 Im Lageplan sind die Zeichen und Farben der Anlage 1 zu verwenden;<br />
im Übrigen ist die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom<br />
18. Dezember 1990 (BGBl 1991 I S. 58) entsprechend anzuwenden.<br />
2 Sonstige Darstellungen sind zu erläutern.<br />
Bay BauVorlV § 8 Bauzeichnungen<br />
(1) 1 Für die Bauzeichnungen ist ein Maßstab von 1 : 100 zu verwenden. 2 Ein<br />
größerer Maßstab ist zu wählen, wenn er zur Darstellung der<br />
erforderlichen Eintragung notwendig ist; ein kleinerer Maßstab kann<br />
gewählt werden, wenn er dafür ausreicht.<br />
(2) In den Bauzeichnungen sind darzustellen:<br />
1. die Grundrisse aller Geschosse mit Angabe der vorgesehenen Nutzung<br />
der Räume und mit Einzeichnung der<br />
a) Treppen,<br />
b) lichten Durchgangsmaße der Türen sowie deren Art, Anordnung und<br />
Aufschlagrichtung an und in Rettungswegen,<br />
c) Abgasanlagen,<br />
d) Räume für die Aufstellung von Feuerstätten unter Angabe der<br />
Nennleistung sowie der Räume für die Brennstofflagerung unter Angabe<br />
der vorgesehenen Art und Menge des Brennstoffes,<br />
e) Aufzugsschächte, Aufzüge und der nutzbaren Grundflächen der<br />
Fahrkörbe von Personenaufzügen,<br />
f) Installationsschächte, -kanäle und Lüftungsleitungen, soweit sie<br />
raumabschließende Bauteile durchdringen,<br />
g) Räume für die Aufstellung von Lüftungsanlagen;<br />
2. die Schnitte, aus denen folgende Punkte ersichtlich sind:<br />
a) die Gründung der geplanten baulichen Anlage und, soweit erforderlich,<br />
die Gründungen anderer baulicher Anlagen,<br />
b) der Anschnitt der vorhandenen und der geplanten Geländeoberfläche,<br />
c) die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens mit Bezug auf das<br />
Höhenbezugssystem,<br />
d) die Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in<br />
dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der geplanten<br />
Geländeoberfläche,<br />
e) die lichten Raumhöhen,<br />
f) der Verlauf der Treppen und Rampen mit ihrem Steigungsverhältnis,<br />
g) die Wandhöhe im Sinn des Art. 6 Abs. 4 BayBO,<br />
h) die Dachhöhen und Dachneigungen,<br />
3. die Ansichten der geplanten baulichen Anlage mit dem Anschluss an<br />
Nachbargebäude unter Angabe von Baustoffen und Farben, der<br />
vorhandenen und geplanten Geländeoberfläche sowie des Straßengefälles.<br />
(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben:<br />
1. der Maßstab und die Maße,
2. die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten,<br />
3. die Rohbaumaße der Fensteröffnungen in Aufenthaltsräumen,<br />
4. bei Änderung baulicher Anlagen die zu beseitigenden und die geplanten<br />
Bauteile.<br />
(4) In den Bauzeichnungen sind die Zeichen und Farben der Anlage 1 zu<br />
verwenden.<br />
Bay BauVorlV § 9 Baubeschreibung<br />
1 In der Baubeschreibung sind das Bauvorhaben und seine Nutzung zu<br />
erläutern, soweit dies zur Beurteilung erforderlich ist und die notwendigen<br />
Angaben nicht im Lageplan und den Bauzeichnungen enthalten sind. 2 Die<br />
Gebäudeklasse und die Höhe im Sinn des Art. 2 Abs. 3 Satz 2 BayBO sind<br />
anzugeben. 3 Die Baukosten der baulichen Anlagen einschließlich der<br />
dazugehörenden Wasserversorgungsanlagen auf dem Baugrundstück sind<br />
anzugeben.<br />
Bay BauVorlV § 10 <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweis<br />
(1) Für den Nachweis der <strong>Stand</strong>sicherheit tragender Bauteile einschließlich<br />
ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sind eine<br />
Darstellung des gesamten statischen Systems sowie die erforderlichen<br />
Konstruktionszeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen<br />
vorzulegen.<br />
(2) 1 Die statischen Berechnungen müssen die <strong>Stand</strong>sicherheit der baulichen<br />
Anlagen und ihrer Teile nachweisen. 2 Die Beschaffenheit des Baugrunds<br />
und seine Tragfähigkeit sind anzugeben. 3 Soweit erforderlich, ist<br />
nachzuweisen, dass die <strong>Stand</strong>sicherheit anderer baulicher Anlagen und die<br />
Tragfähigkeit des Baugrunds der Nachbargrundstücke nicht gefährdet<br />
werden.<br />
(3) Die <strong>Stand</strong>sicherheit kann auf andere Weise als durch statische<br />
Berechnungen nachgewiesen werden, wenn hierdurch die Anforderungen<br />
an einen <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweis in gleichem Maße erfüllt werden.<br />
Bay BauVorlV § 11 Brandschutznachweis<br />
(1) Für den Nachweis des Brandschutzes sind im Lageplan, in den<br />
Bauzeichnungen und in der Baubeschreibung, soweit erforderlich,<br />
anzugeben:<br />
1. das Brandverhalten der Baustoffe (Baustoffklasse) und die<br />
Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile (Feuerwiderstandsklasse)<br />
entsprechend den Benennungen nach Art. 24 BayBO oder entsprechend<br />
den Klassifizierungen nach den Anlagen zur Bauregelliste A Teil 1,<br />
2. die Bauteile, Einrichtungen und Vorkehrungen, an die Anforderungen<br />
hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden, wie Brandwände und<br />
Decken, Trennwände, Unterdecken, Installationsschächte und -kanäle,<br />
Lüftungsanlagen, Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutztüren,<br />
Öffnungen zur Rauchableitung, einschließlich der Fenster nach Art. 33<br />
Abs. 8 Satz 2 BayBO,<br />
3. die Nutzungseinheiten, die Brand- und Rauchabschnitte,<br />
4. die aus Gründen des Brandschutzes erforderlichen Abstände innerhalb<br />
und außerhalb des Gebäudes,
5. der erste und zweite Rettungsweg nach Art. 31 BayBO, insbesondere<br />
notwendige Treppenräume, Ausgänge, notwendige Flure, mit<br />
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stellen einschließlich der<br />
Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 BayBO dienen,<br />
unter Angabe der lichten Maße und Brüstungshöhen,<br />
6. die Flächen für die Feuerwehr, Zu- und Durchgänge, Zu- und<br />
Durchfahrten, Bewegungsflächen und die Aufstellflächen für<br />
Hubrettungsfahrzeuge,<br />
7. die Löschwasserversorgung.<br />
(2) 1 Bei Sonderbauten, Mittel- und Großgaragen müssen, soweit es für die<br />
Beurteilung erforderlich ist, zusätzlich Angaben gemacht werden<br />
insbesondere über:<br />
1. brandschutzrelevante Einzelheiten der Nutzung, insbesondere auch die<br />
Anzahl und Art der die bauliche Anlage nutzenden Personen sowie<br />
Explosions- oder erhöhte Brandgefahren, Brandlasten, Gefahrstoffe und<br />
Risikoanalysen,<br />
2. Rettungswegbreiten und -längen, Einzelheiten der Rettungswegführung<br />
und -ausbildung einschließlich Sicherheitsbeleuchtung und -<br />
kennzeichnung,<br />
3. technische Anlagen und Einrichtungen zum Brandschutz, wie<br />
Branderkennung, Brandmeldung, Alarmierung, Brandbekämpfung,<br />
Rauchableitung, Rauchfreihaltung,<br />
4. die Sicherheitsstromversorgung,<br />
5. die Bemessung der Löschwasserversorgung, Einrichtungen zur<br />
Löschwasserentnahme sowie die Löschwasserrückhaltung,<br />
6. betriebliche und organisatorische Maßnahmen zur Brandverhütung,<br />
Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren wie<br />
Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, Werkfeuerwehr, Bestellung von<br />
Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräften.<br />
2<br />
Anzugeben ist auch, weshalb es der Einhaltung von Vorschriften wegen<br />
der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder<br />
wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf (Art. 54 Abs. 3 Satz 2<br />
BayBO). 3 Der Brandschutznachweis kann auch gesondert in Form eines<br />
objektbezogenen Brandschutzkonzepts dargestellt werden.<br />
Bay BauVorlV § 12 Nachweise für Wärme-, Schall-,<br />
Erschütterungsschutz<br />
Die Berechnungen müssen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften<br />
geforderten Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz nachweisen.<br />
Bay BauVorlV § 13 Übereinstimmungsgebot<br />
Die Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, Berechnungen und<br />
Konstruktionszeichnungen sowie sonstige Zeichnungen und Beschreibungen,<br />
die den bautechnischen Nachweisen zugrunde liegen, müssen miteinander<br />
übereinstimmen und gleiche Positionsangaben haben.
[§ 14] Vierter Teil Abgrabungsplan<br />
Bay BauVorlV § 14 Abgrabungsplan<br />
1 Für den Abgrabungsplan (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BayAbgrG) gelten die<br />
Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils entsprechend. 2 In den Fällen des<br />
Art. 8 BayAbgrG bleiben weitergehende Anforderungen nach Abschnitt III des<br />
Fünften Teils BayVwVfG unberührt.<br />
[§§ 15 - 16] Fünfter Teil Bauzustandsanzeigen<br />
Bay BauVorlV § 15 Baubeginnsanzeige<br />
(1) 1 Soweit bautechnische Nachweise nicht bauaufsichtlich geprüft und nicht<br />
durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden, ist eine Erklärung<br />
des jeweiligen Nachweiserstellers nach Art. 62 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2<br />
BayBO über die Erstellung des bautechnischen Nachweises spätestens mit<br />
der Baubeginnsanzeige (Art. 68 Abs. 7, Art. 58 Abs. 5 Satz 2 BayBO)<br />
vorzulegen. 2 Wird das Bauvorhaben abschnittsweise ausgeführt, muss die<br />
Erklärung spätestens bei Beginn der Ausführung des jeweiligen<br />
Bauabschnitts vorliegen.<br />
(2) Für die nach Art. 68 Abs. 5 Nr. 2 BayBO vorzulegenden Bescheinigungen<br />
nach Art. 62 Abs. 3 BayBO gilt Abs. 1 Satz 2 entsprechend.<br />
(3) Muss der <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweis bei Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3<br />
Satz 1 Nr. 2 BayBO nicht bauaufsichtlich geprüft und nicht durch einen<br />
Prüfsachverständigen bescheinigt werden, ist spätestens mit der<br />
Baubeginnsanzeige eine Erklärung des Tragwerksplaners hierüber nach<br />
Maßgabe des Kriterienkatalogs der Anlage 2 vorzulegen.<br />
Bay BauVorlV § 16 Anzeige der beabsichtigten Nutzungsaufnahme<br />
Sind bei einem Bauvorhaben wiederkehrende bauaufsichtliche Prüfungen durch<br />
Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 oder 5 BayBO oder im<br />
Einzelfall vorgeschrieben, ist mit der Anzeige nach Art. 78 Abs. 2 Satz 1 BayBO<br />
über die in Art. 78 Abs. 2 Satz 2 BayBO genannten Bescheinigungen und<br />
Bestätigungen hinaus der Brandschutznachweis (§ 11) vorzulegen, soweit er<br />
nicht bauaufsichtlich geprüft ist.<br />
[§ 17] Sechster Teil Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
Bay BauVorlV § 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 2 Mit Ablauf des<br />
31. Dezember 2007 tritt die Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) vom<br />
8. Dezember 1997 (GVBl S. 822, ber. 1998 S. 271, BayRS 2132–1–2–I),<br />
zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Januar 2007 (GVBl S. 58), außer<br />
Kraft.
Anlage 1<br />
Zeichen und Farben für Bauvorlagen (zu § 7 Abs. 5 und § 8 Abs. 4)<br />
1.Grenzen des Grundstücks<br />
2.vorhandene bauliche Anlagen oder<br />
Bauteile<br />
3.geplante bauliche Anlagen oder Bauteile<br />
4.zu beseitigende bauliche Anlagen oder Bauteile<br />
5.Flächen, auf denen Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 2<br />
Satz 3 BayBO übernommen sind<br />
Zeichen: Farbe:<br />
Violett<br />
Grau<br />
Rot<br />
Gelb<br />
Braun
Anlage 2<br />
Kriterienkatalog nach § 15 Abs. 3<br />
Sind die nachfolgenden Kriterien ausnahmslos erfüllt, ist eine Prüfung des<br />
<strong>Stand</strong>sicherheitsnachweises nicht erforderlich:<br />
1. Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche<br />
Flachgründung entsprechend DIN 1054. Ausgenommen sind Gründungen auf<br />
setzungsempfindlichem Baugrund.<br />
2. Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen<br />
Gründungssohle und Erdoberfläche maximal 4 m. Einwirkungen aus<br />
Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.<br />
3. Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden<br />
nicht beeinträchtigt. Nachzuweisende Unterfangungen oder<br />
Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.<br />
4. Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den<br />
Fundamenten unversetzt durch. Ein rechnerischer Nachweis der<br />
Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.<br />
5. Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig<br />
verteilte Lasten (kN/m 2 ) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m)<br />
bemessen werden. Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung<br />
erhalten keine Einzellasten.<br />
6. Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können<br />
mit einfachen Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt<br />
werden. Räumliche Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen<br />
werden. Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und<br />
Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.<br />
7. Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.<br />
Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.<br />
8. Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und<br />
geschweißte Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.
Verordnung über die amtliche<br />
Bekanntmachung gemeindlicher<br />
Satzungen und von Rechtsvorschriften<br />
der Verwaltungsgemeinschaften (Bay<br />
BekV)<br />
vom 19. Januar 1983 GVBl. S. 14 (FN BayRS 2020-1-1-2-I)<br />
Auf Grund des Art. 123 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) und des<br />
Art. 10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in Verbindung<br />
mit Art. 27 Abs. 1 Satz 1 des <strong>Gesetze</strong>s über die kommunale Zusammenarbeit<br />
(KommZG) erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende<br />
Verordnung:<br />
Bay BekV § 1 Regelung der amtlichen Bekanntmachung<br />
(1) 1 Gemeinden, die kein Amtsblatt im Sinn des Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO<br />
haben, müssen in der Geschäftsordnung oder durch Beschluß des<br />
Gemeinderats die Art der Bekanntmachung und das Amtsblatt oder<br />
regelmäßig erscheinende Druckwerk oder den Ort, an dem die Amtstafel<br />
(Gemeindetafel) aufgestellt ist, oder die Tageszeitung im Sinn des Art. 26<br />
Abs. 2 Satz 2 GO bestimmen. 2 Eine andere als die bestimmte Art der<br />
Bekanntmachung darf nur gewählt werden, wenn im Einzelfall ein<br />
wichtiger Grund es erfordert; in diesem Fall ist auf die Satzung und die Art<br />
ihrer Bekanntmachung an der Stelle hinzuweisen, an der die Satzungen<br />
sonst abzudrucken sind oder ihre Niederlegung bekanntzugeben ist.<br />
(2) 1 Gemeinden, die ihre Satzungen nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 GO<br />
durch Niederlegung und Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag<br />
amtlich bekanntmachen, müssen in der Gemeinde eine Amtstafel<br />
(Gemeindetafel) unterhalten und dort die Anschläge anheften, mit denen<br />
die Niederlegung bekanntgegeben wird. 2 Die Gemeinden sollen weitere<br />
Gemeindetafeln in größeren, siedlungsmäßig selbständigen<br />
Gemeindeteilen unterhalten und die Anschläge auch an diesen<br />
Gemeindetafeln anheften. 3 Die Anschläge sollen 14 Tage angeheftet<br />
bleiben.<br />
(3) 1 Für die amtliche Bekanntmachung von Rechtsvorschriften der<br />
Verwaltungsgemeinschaften gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.<br />
2<br />
Verwaltungsgemeinschaften, die ihre Rechtsvorschriften nach Art. 10<br />
Abs. 1 Satz 3 VGemO durch Niederlegung und Bekanntgabe der<br />
Niederlegung durch Anschlag amtlich bekanntmachen, müssen am Sitz<br />
der Verwaltungsgemeinschaft eine Amtstafel unterhalten; der Anschlag<br />
soll auch an den Gemeindetafeln der Mitgliedsgemeinden angeheftet<br />
werden.
Bay BekV § 2 Tag der amtlichen Bekanntmachung<br />
1 Wird eine gemeindliche Satzung oder eine Rechtsvorschrift einer<br />
Verwaltungsgemeinschaft durch Abdruck in einem Amtsblatt oder in einem<br />
anderen regelmäßig erscheinenden Druckwerk amtlich bekanntgemacht, so ist<br />
sein Ausgabetag der Tag der amtlichen Bekanntmachung. 2 Wird eine solche<br />
Vorschrift nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 GO oder Art. 10 Abs. 1 Satz 3<br />
VGemO amtlich bekanntgemacht, so ist Tag der amtlichen Bekanntmachung<br />
der Tag, an dem die Niederlegung durch Anschlag bekanntgegeben wird, oder<br />
der Ausgabetag der Tageszeitung; der Anschlag darf erst angebracht oder die<br />
Mitteilung in der Tageszeitung erst bekanntgegeben werden, wenn die<br />
Niederlegung erfolgt ist.<br />
Bay BekV § 3 Bekanntmachungsvermerk; Mitteilungspflicht<br />
1 Auf gemeindlichen Satzungen oder Rechtsvorschriften einer<br />
Verwaltungsgemeinschaft, die nicht in einem Amtsblatt amtlich<br />
bekanntgemacht worden sind, sollen die Art und der Tag ihrer amtlichen<br />
Bekanntmachung vermerkt werden. 2 Die Vorschriften sind mit<br />
Bekanntmachungsvermerk in beglaubigter Abschrift oder Ablichtung in<br />
doppelter Fertigung der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden, bewehrte<br />
Satzungen außerdem dem Amtsgericht, zu dessen Bezirk die Gemeinde oder<br />
Verwaltungsgemeinschaft gehört, und der örtlich zuständigen<br />
Polizeidienststelle.<br />
Bay BekV § 4 Sammlung der Vorschriften<br />
1 Die Vorschriften sind zu sammeln und für die Dauer ihrer Gültigkeit zur<br />
Einsicht bereitzuhalten; auf Verlangen sind Abschriften oder Ablichtungen zu<br />
erteilen. 2 Das gilt auch für Vorschriften, die vor dem Inkrafttreten dieser<br />
Verordnung erlassen worden sind.<br />
Bay BekV § 5 Inkrafttreten<br />
1 Diese Verordnung tritt am 1. April 1983 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die<br />
Verordnung über die amtliche Bekanntmachung gemeindlicher Satzungen<br />
(Bekanntmachungsverordnung – BekV) vom 3. März 1959 (GVBl S. 121) außer<br />
Kraft.
Bezirksordnung für den Freistaat<br />
Bayern (Bay BezO)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 850), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 542), vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 24. Dezember<br />
2002 (GVBl. S. 962), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 979), vom 7. August 2003 (GVBl. S. 497),<br />
vom 26. Juli 2004 (GVBl. S. 272), vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 659), vom 26. Juli 2006<br />
(GVBl. S. 405), vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 975), vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 461), vom 27.<br />
Juli 2009 (GVBl. S. 400) (FN BayRS 2020-4-2-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Wesen und Aufgaben des Bezirks<br />
1. ABSCHNITT Begriff, Benennung und Hoheitszeichen<br />
Art. 1 Begriff<br />
Art. 2 Name; Sitz der Bezirksverwaltung<br />
Art. 3 Wappen und Fahnen; Dienstsiegel<br />
2. ABSCHNITT Wirkungskreis<br />
Art. 4 Wirkungskreis im allgemeinen<br />
Art. 5 Eigene Angelegenheiten<br />
Art. 6 Übertragene Angelegenheiten<br />
3. ABSCHNITT Bezirksgebiet<br />
Art. 7 Gebietsumfang<br />
Art. 8 Änderungen und Zuständigkeit<br />
Art. 9 Folgen der Änderungen<br />
Art. 10 Gebühren<br />
4. ABSCHNITT Bezirksangehörige<br />
Art. 11 Bezirkseinwohner und Bezirksbürger<br />
Art. 12 Wahlrecht
Art. 13 Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
Art. 14 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht<br />
Art. 14 a Entschädigung<br />
Art. 15 Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der Bezirkslasten<br />
5. ABSCHNITT Bezirkshoheit<br />
Art. 16 Umfang der Bezirkshoheit<br />
Art. 17 Bezirksrecht<br />
Art. 18 Inhalt von Satzungen<br />
Art. 19 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung<br />
Art. 20 Verwaltungsverfügungen; Zwangsmaßnahmen<br />
ZWEITER TEIL Verfassung und Verwaltung des Bezirks<br />
1. ABSCHNITT Bezirksorgane und ihre Hilfskräfte<br />
Art. 21 Hauptorgane<br />
Art. 22 Rechtsstellung; Aufgaben des Bezirkstags<br />
Art. 23 Zusammensetzung des Bezirkstags<br />
Art. 24 Einberufung des Bezirkstags<br />
Art. 25 Aufgaben des Bezirksausschusses<br />
Art. 26 Zusammensetzung<br />
Art. 27 Einberufung<br />
Art. 28 Weitere Ausschüsse<br />
Art. 29 Dem Bezirkstag vorbehaltene Angelegenheiten<br />
Art. 30 Wahl und Rechtsstellung des Bezirkstagspräsidenten und seines<br />
Stellvertreters
Art. 31 Weitere Stellvertreter; Übertragung von Befugnissen<br />
Art. 32 Vorsitz im Bezirkstag; Vollzug der Beschlüsse<br />
Art. 33 Zuständigkeit des Bezirkstagspräsidenten<br />
Art. 33 a Vertretung des Bezirks nach außen; Verpflichtungsgeschäfte<br />
Art. 34 Bezirksbedienstete<br />
2.ABSCHNITT Regierung und Bezirk<br />
Art. 35 Verwaltungsverbund<br />
Art. 35 a Bereitstellung von Bediensteten und Einrichtungen<br />
Art. 35 b Erledigung von Bezirksaufgaben durch die Regierung<br />
Art. 36 Regierungspräsident und Bezirkstag<br />
3. ABSCHNITT Geschäftsgang<br />
Art. 37 Geschäftsordnung<br />
Art. 38 Sitzungszwang; Beschlußfähigkeit<br />
Art. 39 Teilnahmepflicht; Ordnungsgeld gegen Säumige<br />
Art. 40 Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung<br />
Art. 41 Einschränkung des Vertretungsrechts<br />
Art. 42 Form der Beschlußfassung; Wahlen<br />
Art. 43 Öffentlichkeit<br />
Art. 44 Handhabung der Ordnung<br />
Art. 45 Niederschrift<br />
Art. 46 Geschäftsgang der Ausschüsse<br />
4. ABSCHNITT Verwaltungsgrundsätze und Verwaltungsaufgaben<br />
Art. 47 Gesetzmäßigkeit; Unparteilichkeit
Art. 47 a Geheimhaltung<br />
Art. 48 Aufgaben des eigenen Wirkungskreises; Pflichtaufgaben<br />
Art. 49 Übernahme von Kreisaufgaben<br />
Art. 50 Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br />
Artikel 51<br />
Art. 52 Zuständigkeit für den <strong>Gesetze</strong>svollzug<br />
DRITTER TEIL Bezirkswirtschaft<br />
1. ABSCHNITT Haushaltswirtschaft<br />
Art. 53 Allgemeine Haushaltsgrundsätze<br />
Art. 54 Grundsätze der Einnahmebeschaffung<br />
Art. 55 Haushaltssatzung<br />
Art. 56 Haushaltsplan<br />
Art. 57 Erlaß der Haushaltssatzung<br />
Art. 58 Planabweichungen<br />
Art. 59 Verpflichtungsermächtigungen<br />
Art. 60 Nachtragshaushaltssatzungen<br />
Art. 61 Vorläufige Haushaltsführung<br />
Art. 62 Mittelfristige Finanzplanung<br />
2. ABSCHNITT Kreditwesen<br />
Art. 63 Kredite<br />
Art. 64 Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten<br />
Art. 65 Kassenkredite<br />
3. ABSCHNITT Vermögenswirtschaft
Art. 66 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze<br />
Art. 67 Veräußerung von Vermögen<br />
Art. 68 Rücklagen, Rückstellungen<br />
Art. 69 Zwangsvollstreckung in Bezirksvermögen wegen einer Geldforderung<br />
Art. 70 Begriff; Verwaltung<br />
Art. 71 Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebung der<br />
Zweckbestimmung<br />
4. ABSCHNITT Unternehmen des Bezirks<br />
Art. 72 Rechtsformen<br />
Art. 73 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen<br />
Art. 74 Eigenbetriebe<br />
Art. 75 Selbständige Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts<br />
Art. 76 Organe des Kommunalunternehmens, Personal<br />
Art. 77 Sonstige Vorschriften für Kommunalunternehmen<br />
Art. 78 Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 79 Vertretung des Bezirks in Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 80 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 81 Grundsätze für die Führung von Unternehmen des Bezirks<br />
Art. 81 a Anzeigepflichten<br />
5. ABSCHNITT Kassen- und Rechnungswesen<br />
Art. 82 Kassengeschäfte des Bezirks<br />
Art. 83 Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften<br />
Art. 84 Rechnungslegung, Jahresabschluss
Art. 84 a Konsolidierter Jahresabschluss<br />
6. ABSCHNITT Prüfungswesen<br />
Art. 85 Örtliche Prüfungen<br />
Art. 86 Rechnungsprüfungsamt<br />
Art. 87 Überörtliche Prüfungen<br />
Art. 88 Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfung<br />
Art. 89 Abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen<br />
VIERTER TEIL Staatliche Aufsicht und Rechtsmittel<br />
1. ABSCHNITT Rechtsaufsicht und Fachaufsicht<br />
Art. 90 Sinn der staatlichen Aufsicht<br />
Art. 91 Inhalt und Grenzen der Aufsicht<br />
Art. 92 Rechtsaufsichtsbehörde<br />
Art. 93 Informationsrecht der Rechtsaufsichtsbehörde<br />
Art. 94 Beanstandungsrecht<br />
Art. 95 Recht der Ersatzvornahme<br />
Art. 96 Bestellung eines Beauftragten<br />
Art. 97 Fachaufsichtsbehörde<br />
Art. 98 Befugnisse der Fachaufsicht<br />
Art. 99 Genehmigungsbehörde<br />
Art. 99 a Ausnahmegenehmigungen<br />
2. ABSCHNITT Rechtsmittel<br />
Art. 100 Erlaß des Widerspruchsbescheids (§ 73 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung)
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Artikel 101<br />
Art. 102 Inkrafttreten<br />
Art. 103 Ausführungsvorschriften<br />
Art. 104 Einschränkung von Grundrechten<br />
ERSTER TEIL Wesen und Aufgaben des Bezirks<br />
1. ABSCHNITT Begriff, Benennung und Hoheitszeichen<br />
Bay BezO Art. 1 Begriff<br />
Die Bezirke sind Gebietskörperschaften mit dem Recht, überörtliche<br />
Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der<br />
Landkreise und kreisfreien Gemeinden hinausgehen und deren Bedeutung über<br />
das Gebiet des Bezirks nicht hinausreicht, im Rahmen der <strong>Gesetze</strong> selbst zu<br />
ordnen und zu verwalten.<br />
Bay BezO Art. 2 Name; Sitz der Bezirksverwaltung<br />
Der Name der Bezirke und der Sitz der Bezirksverwaltung werden durch Gesetz<br />
bestimmt.<br />
Bay BezO Art. 3 Wappen und Fahnen; Dienstsiegel<br />
(1) 1 Die Bezirke können ihre geschichtlichen Wappen und Fahnen führen.<br />
2<br />
Sie sind verpflichtet, sich bei der Änderung bestehender und der<br />
Annahme neuer Wappen und Fahnen von der Generaldirektion der<br />
Staatlichen Archive Bayerns beraten zu lassen und, soweit sie deren<br />
Stellungnahme nicht folgen wollen, den Entwurf der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.<br />
(2) 1 Bezirke mit eigenem Wappen führen dieses in ihrem Dienstsiegel. 2 Die<br />
übrigen Bezirke führen in ihrem Dienstsiegel das große Staatswappen.<br />
(3) Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen des Bezirks nur mit dessen<br />
Genehmigung verwendet werden.<br />
2. ABSCHNITT Wirkungskreis<br />
Bay BezO Art. 4 Wirkungskreis im allgemeinen<br />
(1) Den Bezirken steht die Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu, die sich auf das<br />
Gebiet des Bezirks beschränken und über die Zuständigkeit oder das<br />
Leistungsvermögen der Landkreise und kreisfreien Gemeinden<br />
hinausgehen.<br />
(2) Die Aufgaben der Bezirke sind eigene oder übertragene Angelegenheiten.
Bay BezO Art. 5 Eigene Angelegenheiten<br />
(1) Der eigene Wirkungskreis der Bezirke umfaßt die Angelegenheiten der<br />
durch das Gebiet des Bezirks begrenzten überörtlichen Gemeinschaft.<br />
(2) 1 In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises handeln die Bezirke<br />
nach eigenem Ermessen. 2 Sie sind nur an die gesetzlichen Vorschriften<br />
gebunden.<br />
Bay BezO Art. 6 Übertragene Angelegenheiten<br />
(1) Der übertragene Wirkungskreis der Bezirke umfaßt alle Angelegenheiten,<br />
die das Gesetz den Bezirken zur Besorgung im Auftrag des Staates<br />
zuweist.<br />
(2) Für die Erledigung übertragener Angelegenheiten können die zuständigen<br />
Staatsbehörden den Bezirken Weisungen erteilen.<br />
(3) 1 Den Bezirken können Angelegenheiten auch zur selbständigen Besorgung<br />
übertragen werden. 2 Art. 5 Abs. 2 ist hierbei sinngemäß anzuwenden.<br />
(4) Bei der Zuweisung von Angelegenheiten sind gleichzeitig die notwendigen<br />
Mittel zur Verfügung zu stellen.<br />
3. ABSCHNITT Bezirksgebiet<br />
Bay BezO Art. 7 Gebietsumfang<br />
Die Gesamtfläche der dem Bezirk zugeteilten Landkreise und kreisfreien<br />
Gemeinden bildet das Bezirksgebiet.<br />
Bay BezO Art. 8 Änderungen und Zuständigkeit<br />
(1) Regierungsbezirke können nur aus Gründen des öffentlichen Wohls in<br />
ihrem Gebietsumfang geändert werden.<br />
(2) 1 Wird mindestens ein ganzer Landkreis oder mindestens eine ganze<br />
kreisfreie Gemeinde umgegliedert, erfolgt die Änderung durch Gesetz.<br />
2<br />
Vor der Änderung sind außer den Landkreisen bzw. Gemeinden des<br />
Änderungsgebiets die beteiligten Bezirkstage zu hören. 3 Den<br />
Bezirksbürgern, deren Bezirkszugehörigkeit wechselt, soll Gelegenheit<br />
gegeben werden, zu der Änderung in geheimer Abstimmung Stellung zu<br />
nehmen.<br />
(3) Sonstige Änderungen werden im Verfahren nach Art. 8 Abs. 2 bis 4 der<br />
Landkreisordnung (LKrO) miterledigt, wobei zusätzlich die beteiligten<br />
Bezirke zu hören sind.<br />
Bay BezO Art. 9 Folgen der Änderungen<br />
(1) 1 Das Recht des aufnehmenden Bezirks erstreckt sich auf das<br />
aufgenommene Gebiet, wenn nicht in der Vorschrift über die<br />
Gebietsänderung etwas Abweichendes bestimmt ist. 2 Entsprechendes gilt<br />
für das Recht der durch die Änderung betroffenen Landkreise und<br />
Gemeinden.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium des Innern regelt die für den Bezirk mit der<br />
Änderung zusammenhängenden weiteren Rechts- und Verwaltungsfragen.
2<br />
Es kann insbesondere eine Neuwahl oder Ergänzung des Bezirkstags für<br />
den Rest der Wahlzeit anordnen. 3 Das Staatsministerium des Innern trifft<br />
auch entsprechende Regelungen für die durch die Änderung betroffenen<br />
Landkreise und Gemeinden oder beauftragt damit die Regierungen oder<br />
für kreisangehörige Gemeinden die Landratsämter.<br />
(3) 1 Die vermögensrechtlichen Verhältnisse werden durch Übereinkunft der<br />
beteiligten Bezirke geregelt. 2 Der Übereinkunft kommt in dem in ihr<br />
bestimmten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Rechtswirksamkeit der<br />
Änderung, unmittelbar rechtsbegründende Wirkung zu. 3 Kommt eine<br />
Übereinkunft nicht zustande, so entscheiden das Verwaltungsgericht und<br />
in der Berufungsinstanz der Verwaltungsgerichtshof als Schiedsgerichte.<br />
(4) Soweit der Aufenthalt Voraussetzung für Rechte und Pflichten ist, gilt der<br />
vor der Änderung liegende Aufenthalt in dem Änderungsgebiet als<br />
Aufenthalt im neuen Bezirk.<br />
Bay BezO Art. 10 Gebühren<br />
Für Änderungen nach Art. 8 und Rechtshandlungen, die aus Anlaß solcher<br />
Änderungen erforderlich sind, werden landesrechtlich geregelte Abgaben nicht<br />
erhoben.<br />
4. ABSCHNITT Bezirksangehörige<br />
Bay BezO Art. 11 Bezirkseinwohner und Bezirksbürger<br />
(1) 1 Bezirksangehörige sind alle Bezirkseinwohner. 2 Sie haben gegenüber<br />
dem Bezirk die gleichen Rechte und Pflichten. 3 Ausnahmen bedürfen eines<br />
besonderen Rechtstitels.<br />
(2) Bezirksbürger sind alle Bezirksangehörigen, die das Wahlrecht für die<br />
Bezirkswahlen besitzen.<br />
Bay BezO Art. 12 Wahlrecht<br />
Die Bezirksbürger wählen den Bezirkstag.<br />
Bay BezO Art. 13 Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
(1) 1 Die Bezirksbürger sind zur Übernahme von Ehrenämtern des Bezirks<br />
verpflichtet. 2 Sie können nur aus wichtigem Grund die Übernahme von<br />
Ehrenämtern ablehnen oder ein Ehrenamt niederlegen. 3 Als wichtiger<br />
Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der Verpflichtete die Tätigkeit<br />
nicht ordnungsgemäß ausüben kann. 4 Wer ohne wichtigen Grund die<br />
Übernahme eines Ehrenamts ablehnt oder ein Ehrenamt niederlegt, kann<br />
mit Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro belegt werden.<br />
(2) 1 Ehrenamtlich tätige Personen können von der Stelle, die sie berufen hat,<br />
abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2 Ein solcher liegt<br />
auch dann vor, wenn die ehrenamtlich tätige Person ihre Pflichten gröblich<br />
verletzt oder sich als unwürdig erwiesen hat.<br />
(3) Die besonderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.
Bay BezO Art. 14 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht<br />
(1) Ehrenamtlich tätige Bezirksbürger sind verpflichtet, ihre Obliegenheiten<br />
gewissenhaft wahrzunehmen.<br />
(2) 1 Sie haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit<br />
bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren; das<br />
gilt nicht für Mitteilungen im amtlichen Verkehr oder über Tatsachen, die<br />
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung<br />
bedürfen. 2 Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheimzuhaltenden<br />
Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. 3 Sie haben auf Verlangen des<br />
Bezirkstags amtliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen<br />
und Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge herauszugeben,<br />
auch soweit es sich um Wiedergaben handelt. 4 Diese Verpflichtungen<br />
bestehen auch nach Beendigung des Ehrenamts fort. 5 Die<br />
Herausgabepflicht trifft auch die Hinterbliebenen und Erben.<br />
(3) 1 Ehrenamtlich tätige Bezirksbürger dürfen ohne Genehmigung über<br />
Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu bewahren haben,<br />
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen<br />
abgeben. 2 Die Genehmigung erteilt der Bezirkstagspräsident. 3 Über die<br />
Versagung der Genehmigung, als Zeuge auszusagen, entscheidet die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde; im übrigen gelten Art. 84 Abs. 3 und 4 des<br />
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.<br />
(4) 1 Wer den Verpflichtungen der Absätze 1, 2 oder 3 Satz 1 schuldhaft<br />
zuwiderhandelt, kann im Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu<br />
zweihundertfünfzig Euro, bei unbefugter Offenbarung personenbezogener<br />
Daten bis zu fünfhundert Euro, belegt werden; die Verantwortlichkeit nach<br />
anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. 2 Die Haftung<br />
gegenüber dem Bezirk richtet sich nach den für den<br />
Bezirkstagspräsidenten geltenden Vorschriften und tritt nur ein, wenn<br />
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last liegt. 3 Der Bezirk stellt die<br />
Verantwortlichen von der Haftung frei, wenn sie von Dritten unmittelbar in<br />
Anspruch genommen werden und der Schaden weder vorsätzlich noch<br />
grob fahrlässig verursacht worden ist.<br />
Bay BezO Art. 14 a Entschädigung<br />
(1) 1 Ehrenamtlich tätige Bezirksbürger haben Anspruch auf angemessene<br />
Entschädigung. 2 Das Nähere wird durch Satzung bestimmt. 3 Auf die<br />
Entschädigung kann nicht verzichtet werden. 4 Der Anspruch ist nicht<br />
übertragbar.<br />
(2) Ehrenamtlich tätige Bezirksbürger erhalten ferner für die nach Maßgabe<br />
näherer Bestimmung in der Satzung zur Wahrnehmung des Ehrenamts<br />
notwendige Teilnahme an Sitzungen, Besprechungen oder anderen<br />
Veranstaltungen folgende Ersatzleistungen:<br />
1. Angestellten und Arbeitern wird der ihnen entstandene nachgewiesene<br />
Verdienstausfall ersetzt.<br />
2. Selbständig Tätige können für die ihnen entstandene Zeitversäumnis<br />
eine Verdienstausfallentschädigung erhalten. Die Entschädigung wird auf<br />
der Grundlage eines satzungsmäßig festgelegten Pauschalsatzes gewährt.<br />
Wegezeiten können in angemessenem Umfang berücksichtigt werden.
3. Personen, die keine Ersatzansprüche nach Nummern 1 und 2 haben,<br />
denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht,<br />
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die<br />
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, können eine<br />
Entschädigung erhalten. Die Entschädigung wird auf der Grundlage eines<br />
satzungsmäßig festgelegten Pauschalsatzes gewährt. Der Pauschalsatz<br />
darf nicht höher sein als der Pauschalsatz nach Nummer 2. Wegezeiten<br />
können in angemessenem Umfang berücksichtigt werden.<br />
(3) Für den Bezirkstagspräsidenten und seinen gewählten Stellvertreter gelten<br />
die besonderen gesetzlichen Vorschriften.<br />
(4) 1 Vergütungen für Tätigkeiten, die ehrenamtlich tätige Bezirksbürger kraft<br />
Amtes oder auf Vorschlag oder Veranlassung des Bezirks in einem<br />
Aufsichtsrat, Vorstand oder sonstigen Organ oder Gremium eines<br />
privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmens<br />
wahrnehmen, sind an den Bezirk abzuführen, soweit sie insgesamt einen<br />
Betrag von 4 908 Euro im Kalenderjahr übersteigen. 2 Vom Bezirk<br />
veranlasst sind auch Tätigkeiten, die von einem Unternehmen, an dem er<br />
unmittelbar oder mittelbar ganz oder mehrheitlich beteiligt ist, einem<br />
ehrenamtlich tätigen Bezirksbürger übertragen werden. 3 Der Betrag<br />
verdoppelt sich für Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eines<br />
vergleichbaren Organs der in Satz 1 genannten Unternehmen und erhöht<br />
sich für deren Stellvertreter um 50. v. H. 4 Bei der Festsetzung des<br />
abzuführenden Betrags sind von den Vergütungen Aufwendungen<br />
abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich<br />
entstanden sind. 5 Die Ablieferungsregelungen nach dem<br />
beamtenrechtlichen Nebentätigkeitsrecht finden keine Anwendung.<br />
Bay BezO Art. 15 Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der<br />
Bezirkslasten<br />
(1) Alle Bezirksangehörigen sind nach den bestehenden allgemeinen<br />
Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen des Bezirks zu<br />
benutzen, und verpflichtet, die Bezirkslasten zu tragen.<br />
(2) 1 Mehrere technisch selbständige Anlagen des Bezirks, die demselben<br />
Zweck dienen, können eine Einrichtung oder einzelne rechtlich<br />
selbständige Einrichtungen bilden. 2 Der Bezirk entscheidet das durch<br />
Satzung; trifft er keine Regelung, liegt nur eine Einrichtung vor.<br />
(3) Auswärts wohnende Personen haben für ihren Grundbesitz oder ihre<br />
gewerblichen Niederlassungen im Bezirksgebiet gegenüber dem Bezirk die<br />
gleichen Rechte und Pflichten wie im Bezirk wohnende Grundbesitzer und<br />
Gewerbetreibende.<br />
(4) Die Vorschriften in den Absätzen 1 und 3 finden auf juristische Personen<br />
und Personenvereinigungen mit Sitz oder Niederlassung im Bezirksgebiet<br />
entsprechende Anwendung.<br />
(5) Die Benutzung der öffentlichen, dem Gemeingebrauch dienenden<br />
Einrichtungen des Bezirks steht nach Maßgabe der bestehenden<br />
Vorschriften jedermann zu.
5. ABSCHNITT Bezirkshoheit<br />
Bay BezO Art. 16 Umfang der Bezirkshoheit<br />
(1) Die Hoheitsgewalt des Bezirks umfaßt das Bezirksgebiet und seine<br />
gesamte Bevölkerung (Bezirkshoheit).<br />
(2) Die Bezirke können zur Aufbringung der für ihre Aufgaben nötigen Mittel<br />
im Rahmen der <strong>Gesetze</strong> Abgaben erheben.<br />
Bay BezO Art. 17 Bezirksrecht<br />
1 Die Bezirke können zur Regelung ihrer Angelegenheiten Satzungen erlassen.<br />
2 Satzungen zur Regelung übertragener Angelegenheiten, bewehrte Satzungen<br />
und Verordnungen sind nur in den gesetzlich bestimmten Fällen zulässig. 3 In<br />
solchen Satzungen und in Verordnungen soll ihre besondere Rechtsgrundlage<br />
angegeben werden.<br />
Bay BezO Art. 18 Inhalt von Satzungen<br />
(1) 1 In den Satzungen können die Bezirke insbesondere die Benutzung ihres<br />
Eigentums und ihrer öffentlichen Einrichtungen regeln. 2 In diesen<br />
Satzungen können Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeit mit<br />
Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro bedroht werden (bewehrte<br />
Satzungen).<br />
(2) In Satzungen nach Absatz 1 und in Satzungen, die auf Grund anderer<br />
<strong>Gesetze</strong>, die auf diesen Artikel verweisen, erlassen werden, kann<br />
bestimmt werden, daß die von dem Bezirk mit dem Vollzug dieser Satzung<br />
beauftragten Personen berechtigt sind, zur Überwachung der Pflichten, die<br />
sich nach diesen Satzungen und <strong>Gesetze</strong>n ergeben, zu angemessener<br />
Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen<br />
und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten.<br />
Bay BezO Art. 19 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung<br />
(1) 1 Satzungen treten eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2 In<br />
der Satzung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt werden, in bewehrten<br />
Satzungen und anderen Satzungen, die nicht mit rückwirkender Kraft<br />
erlassen werden dürfen, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung<br />
folgende Tag.<br />
(2) Satzungen sind auszufertigen und im Amtsblatt des Bezirks oder der<br />
Regierung, sonst im Staatsanzeiger bekanntzumachen.<br />
Bay BezO Art. 20 Verwaltungsverfügungen; Zwangsmaßnahmen<br />
(1) Die Bezirke können im eigenen und übertragenen Wirkungskreis die zur<br />
Durchführung von <strong>Gesetze</strong>n, Rechtsverordnungen und Satzungen<br />
notwendigen Einzelverfügungen erlassen und unter Anwendung der<br />
gesetzlichen Zwangsmittel vollziehen.<br />
(2) 1 Verwaltungsakte, Ladungen oder sonstige Mitteilungen, die auf Grund<br />
von Rechtsvorschriften außerhalb dieses <strong>Gesetze</strong>s amtlich, öffentlich oder<br />
ortsüblich bekanntzumachen sind, hat der Bezirk wie seine Satzungen<br />
bekanntzumachen. 2 Sind Pläne, Karten oder sonstige Nachweise<br />
Bestandteil einer Mitteilung nach Satz 1, so kann die Bekanntmachung
unbeschadet anderer Vorschriften auch dadurch bewirkt werden, daß die<br />
Mitteilung mit den Nachweisen auf die Dauer von zwei Wochen in der<br />
Verwaltung des Bezirks oder in der Regierung ausgelegt wird; der<br />
Gegenstand der Mitteilung sowie Ort und Zeit der Bekanntmachung sind<br />
mindestens eine Woche vorher nach Satz 1 bekanntzumachen.<br />
(3) Geldbußen und Verwarnungsgelder, die auf Grund bewehrter Satzungen<br />
und Verordnungen festgesetzt werden, fließen dem Bezirk zu.<br />
ZWEITER TEIL Verfassung und Verwaltung des Bezirks<br />
1. ABSCHNITT Bezirksorgane und ihre Hilfskräfte<br />
Bay BezO Art. 21 Hauptorgane<br />
Der Bezirk wird durch den Bezirkstag verwaltet, soweit nicht vom Bezirkstag<br />
bestellte Ausschüsse (Art. 25 und 28) über Bezirksangelegenheiten<br />
beschließen, der Bezirkstagspräsident selbständig entscheidet (Art. 33 Abs. 1<br />
und 2) oder die Regierung gemäß Art. 35 b tätig wird.<br />
a) Der Bezirkstag<br />
Bay BezO Art. 22 Rechtsstellung; Aufgaben des Bezirkstags<br />
(1) 1 Der Bezirkstag ist die Vertretung der Bezirksbürger. 2 Er entscheidet im<br />
Rahmen des Art. 21 über die Angelegenheiten der Bezirksverwaltung.<br />
(2) 1 Der Bezirkstag überwacht die gesamte Bezirksverwaltung, insbesondere<br />
auch die Ausführung seiner Beschlüsse. 2 Er kann hierfür Richtlinien<br />
aufstellen.<br />
Bay BezO Art. 23 Zusammensetzung des Bezirkstags<br />
(1) 1 Der Bezirkstag besteht aus den Bezirkstagsmitgliedern (Bezirksräten).<br />
2<br />
Sie sind ehrenamtlich tätig.<br />
(2) In den Bezirkstag sind so viele Bezirksräte zu wählen, als<br />
Landtagsabgeordnete nach dem Landeswahlgesetz auf den Bezirk treffen.<br />
(3) Das Nähere regelt das Bezirkswahlgesetz.<br />
(4) 1 Bezirksräte können nicht sein<br />
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte des Bezirks,<br />
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen<br />
oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an<br />
denen der Bezirk mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine Beteiligung am<br />
Stimmrecht genügt,<br />
3. Beamte und Angestellte der Regierung, die unmittelbar mit Aufgaben<br />
des Bezirks befaßt sind (Art. 35 a und 35 b),<br />
4. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar<br />
mit Aufgaben der Rechtsaufsicht befaßt sind.<br />
2<br />
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Beamte während der Dauer des<br />
Ehrenamts ohne Dienstbezüge beurlaubt ist oder wenn seine Rechte und<br />
Pflichten aus dem Dienstverhältnis wegen der Wahl in eine gesetzgebende<br />
Körperschaft ruhen; dies gilt für Angestellte entsprechend.
Bay BezO Art. 24 Einberufung des Bezirkstags<br />
(1) Der Bezirkstag wird erstmals spätestens am 26. Tag nach der Wahl durch<br />
den Regierungspräsidenten, zu den weiteren Sitzungen durch den<br />
Bezirkstagspräsidenten einberufen.<br />
(2) 1 In dringenden Fällen kann der Bezirkstag zu außerordentlichen Sitzungen<br />
einberufen werden. 2 Er ist einzuberufen, wenn es der Bezirksausschuß<br />
oder ein Drittel der Bezirksräte unter Bezeichnung des<br />
Verhandlungsgegenstands schriftlich beantragt.<br />
(3) 1 Alle Bezirksräte sind alsbald nach ihrer Berufung in feierlicher Form zu<br />
vereidigen. 2 Die Eidesformel lautet:“Ich schwöre Treue dem Grundgesetz<br />
für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates<br />
Bayern. Ich schwöre, den <strong>Gesetze</strong>n gehorsam zu sein und meine<br />
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der<br />
Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr<br />
mir Gott helfe.” 3 Der Eid kann auch ohne die Worte “so wahr mir Gott<br />
helfe” geleistet werden. 4 Erklärt ein Bezirksrat, daß er aus Glaubens- oder<br />
Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat er an Stelle der Worte<br />
“ich schwöre" die Worte “ich gelobe” zu sprechen oder das Gelöbnis mit<br />
einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung<br />
seiner Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden, gleichwertigen<br />
Beteuerungsformel einzuleiten. 5 Den Eid nimmt der Bezirkstagspräsident<br />
ab. 6 Die Eidesleistung entfällt für die Bezirksräte, die im Anschluß an ihre<br />
Amtszeit wieder zum Bezirksrat des gleichen Bezirks gewählt wurden.<br />
b) Der Bezirksausschuß und die weiteren Ausschüsse<br />
Bay BezO Art. 25 Aufgaben des Bezirksausschusses<br />
1 Der Bezirksausschuß ist ein vom Bezirkstag bestellter ständiger Ausschuß.<br />
2 Er bereitet die Verhandlungen des Bezirkstags vor und beschließt über die<br />
ihm vom Bezirkstag übertragenen Angelegenheiten. 3 In der Geschäftsordnung<br />
(Art. 37) kann bestimmt werden, dass der Bezirkstag Empfehlungen der<br />
Fachausschüsse auch ohne Vorbereitung durch den Bezirksausschuss<br />
behandeln kann.<br />
Bay BezO Art. 26 Zusammensetzung<br />
(1) 1 Der Bezirksausschuß besteht aus dem Bezirkstagspräsidenten und<br />
weiteren Bezirksräten. 2 Die Zahl der weiteren Bezirksräte beträgt in<br />
Bezirken<br />
mit bis zu 2 Millionen Einwohnern 8,<br />
mit mehr als 2 Millionen Einwohnern 12.<br />
(2) 1 Die weiteren Bezirksräte des Bezirksausschusses werden vom Bezirkstag<br />
für die Dauer der Wahlzeit aus seiner Mitte bestellt. 2 Hierbei hat der<br />
Bezirkstag dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und<br />
Wählergruppen Rechnung zu tragen. 3 Haben dabei mehrere Parteien oder<br />
Wählergruppen gleichen Anspruch auf einen Sitz, so ist statt eines<br />
Losentscheids auch der Rückgriff auf die Zahl der bei der Wahl auf diese<br />
Parteien oder Wählergruppen abgegebenen Stimmen zulässig. 4 Die<br />
Bestellung anderer als der von den Parteien oder Wählergruppen<br />
vorgeschlagenen Personen ist nicht zulässig. 5 Bezirksräte können sich zur
Entsendung gemeinsamer Vertreter in den Bezirksausschuß<br />
zusammenschließen.<br />
(3) 1 Während der Wahlzeit im Bezirkstag eintretende Änderungen des<br />
Stärkeverhältnisses der Parteien und Wählergruppen sind auszugleichen.<br />
2<br />
Scheidet ein Mitglied aus der von ihm vertretenen Partei oder<br />
Wählergruppe aus, so verliert es seinen Sitz im Bezirksausschuß. 3 Der<br />
Sitz ist auf Vorschlag der Partei oder Wählergruppe neu zu besetzen.<br />
Bay BezO Art. 27 Einberufung<br />
1 Der Bezirksausschuß wird vom Bezirkstagspräsidenten nach Bedarf<br />
einberufen. 2 Er muß einberufen werden, wenn es die Hälfte der Mitglieder<br />
unter Angabe des Beratungsgegenstands schriftlich beantragt.<br />
Bay BezO Art. 28 Weitere Ausschüsse<br />
(1) 1 Der Bezirkstag kann im Bedarfsfall weitere vorberatende und<br />
beschließende Ausschüsse bilden. 2 Die Zusammensetzung der Ausschüsse<br />
regelt der Bezirkstag in der Geschäftsordnung (Art. 37). 3 Art. 26 Abs. 2<br />
und 3 und Art. 27 gelten entsprechend.<br />
(2) 1 Den Vorsitz in den weiteren Ausschüssen führt der Bezirkstagspräsident.<br />
2<br />
Mit seiner Zustimmung kann sein gewählter Stellvertreter, mit<br />
Zustimmung des Bezirkstagspräsidenten und seines gewählten<br />
Stellvertreters auch ein vom Bezirkstag bestimmter Bezirksrat den Vorsitz<br />
führen.<br />
(3) Weitere Ausschüsse können vom Bezirkstag jederzeit aufgelöst werden.<br />
Bay BezO Art. 29 Dem Bezirkstag vorbehaltene Angelegenheiten<br />
Der Bezirkstag kann dem Bezirksauschuß und weiteren beschließenden<br />
Ausschüssen folgende Angelegenheiten nicht übertragen:<br />
1. den Erlaß, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und<br />
Verordnungen des Bezirks,<br />
2. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und Gebühren,<br />
3. die Festsetzung der Entschädigung für ehrenamtlich tätige Bezirksbürger<br />
(Art. 14 a),<br />
4. die Beschlußfassung in beamtenrechtlichen Angelegenheiten des<br />
Bezirkstagspräsidenten und seines gewählten Stellvertreters, soweit nicht das<br />
Gesetz über kommunale Wahlbeamte etwas anderes bestimmt,<br />
5. die Beschlußfassung über die Haushaltssatzung, über die<br />
Nachtragshaushaltssatzungen sowie die Beschlußfassung über die Aufnahme<br />
von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung (Art. 57,<br />
60 und 61 Abs. 2),<br />
6. die Beschlußfassung über den Finanzplan (Art. 62),<br />
7. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen<br />
sowie die Beschlußfassung über die Entlastung (Art. 84 Abs. 4),<br />
8. die Entscheidungen über Unternehmen des Bezirks im Sinn von Art. 81 a,<br />
9. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Bezirkstag im übrigen vorbehaltenen<br />
Angelegenheiten (Art. 74),<br />
10. die Bestellung und die Abberufung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts
sowie seines Stellvertreters,<br />
11. die Beschlußfassung über Änderungen von bewohntem Bezirksgebiet.<br />
c) Der Bezirkstagspräsident<br />
Bay BezO Art. 30 Wahl und Rechtsstellung des Bezirkstagspräsidenten<br />
und seines Stellvertreters<br />
(1) 1 Der Bezirkstagspräsident und sein Stellvertreter werden vom Bezirkstag<br />
in seiner ersten Sitzung aus der Mitte des Bezirkstags gewählt. 2 Wählbar<br />
ist, wer am Tag der Wahl das 21. Lebensjahr vollendet hat. 3 Für die Wahl<br />
gilt Art. 42 Abs. 3. 4 Art. 39 Abs. 2 Satz 1 des Gemeinde- und<br />
Landkreiswahlgesetzes gilt entsprechend.<br />
(2) 1 Der Bezirkstagspräsident und sein gewählter Stellvertreter sind<br />
Ehrenbeamte des Bezirks. 2 Das Nähere über das Beamtenverhältnis des<br />
Bezirkstagspräsidenten und seines gewählten Stellvertreters bestimmt das<br />
Gesetz über kommunale Wahlbeamte.<br />
(3) 1 Endet das Beamtenverhältnis des Bezirkstagspräsidenten oder seines<br />
gewählten Stellvertreters während der Wahlzeit des Bezirkstags, so findet<br />
innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl für den Rest der Wahlzeit statt.<br />
2 Beträgt der Rest der Wahlzeit weniger als sechs Monate, so findet eine<br />
Neuwahl nur statt, wenn das Beamtenverhältnis des<br />
Bezirkstagspräsidenten und seines gewählten Stellvertreters geendet hat.<br />
Bay BezO Art. 31 Weitere Stellvertreter; Übertragung von Befugnissen<br />
(1) Die weitere Stellvertretung des Bezirkstagspräsidenten regelt der<br />
Bezirkstag durch Beschluß.<br />
(2) Der Bezirkstagspräsident kann im Rahmen der Geschäftsverteilung<br />
(Art. 37 Abs. 3) einzelne seiner Befugnisse dem gewählten Stellvertreter,<br />
nach dessen Anhörung auch einem Bezirksrat und in Angelegenheiten der<br />
laufenden Verwaltung dem leitenden Verwaltungsbeamten, dem leitenden<br />
Beamten der Sozialhilfeverwaltung oder anderen beim Bezirk tätigen<br />
Bediensteten übertragen; eine darüber hinausgehende Übertragung auf<br />
einen Bediensteten bedarf zusätzlich der Zustimmung des Bezirkstags.<br />
Bay BezO Art. 32 Vorsitz im Bezirkstag; Vollzug der Beschlüsse<br />
1 Der Bezirkstagspräsident führt den Vorsitz im Bezirkstag und im<br />
Bezirksausschuß. 2 Er vollzieht die Beschlüsse des Bezirkstags und seiner<br />
Ausschüsse. 3 Soweit er persönlich beteiligt ist, handelt sein Vertreter.<br />
Bay BezO Art. 33 Zuständigkeit des Bezirkstagspräsidenten<br />
(1) 1 Der Bezirkstagspräsident erledigt in eigener Zuständigkeit<br />
1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Bezirk keine grundsätzliche<br />
Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen,<br />
2. die Angelegenheiten des Bezirks, die im Interesse der Sicherheit der<br />
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheimzuhalten sind.<br />
2 Für die laufenden Angelegenheiten nach Satz 1 Nr. 1, die nicht unter<br />
Nummer 2 fallen, kann der Bezirkstag Richtlinien aufstellen.
(2) 1 Der Bezirkstag kann dem Bezirkstagspräsidenten durch die<br />
Geschäftsordnung weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung<br />
übertragen. 2 Das gilt nicht für Angelegenheiten, die nach Art. 29 nicht auf<br />
beschließende Ausschüsse übertragen werden können. 3 Der Bezirkstag<br />
kann dem Bezirkstagspräsidenten übertragene Angelegenheiten im<br />
Einzelfall nicht wieder an sich ziehen; das Recht des Bezirkstags, die<br />
Übertragung allgemein zu widerrufen, bleibt unberührt.<br />
(3) 1 Der Bezirkstagspräsident ist befugt, an Stelle des Bezirkstags oder seiner<br />
Ausschüsse dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare<br />
Geschäfte zu besorgen. 2 Hiervon hat er dem Bezirkstag oder den<br />
Ausschüssen in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.<br />
(4) Der Bezirkstagspräsident kann den Bezirksbediensteten und den gemäß<br />
Art. 35 a Abs. 1 dem Bezirk zur Verfügung gestellten staatlichen<br />
Bediensteten allgemein und im Einzelfall sachliche Weisungen erteilen.<br />
Bay BezO Art. 33 a Vertretung des Bezirks nach außen;<br />
Verpflichtungsgeschäfte<br />
(1) Der Bezirkstagspräsident vertritt den Bezirk nach außen.<br />
(2) 1 Erklärungen, durch welche der Bezirk verpflichtet werden soll, bedürfen<br />
der Schriftform oder müssen in elektronischer Form mit einer dauerhaft<br />
überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein; das<br />
gilt nicht für ständig wiederkehrende Geschäfte des täglichen Lebens, die<br />
finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. 2 Die Erklärungen sind durch<br />
den Bezirkstagspräsidenten oder seinen Stellvertreter unter Angabe der<br />
Amtsbezeichnung zu unterzeichnen. 3 Sie können aufgrund einer den<br />
vorstehenden Erfordernissen entsprechenden Vollmacht auch durch<br />
Bedienstete, die beim Bezirk tätig sind, unterzeichnet werden.<br />
d) Bezirksbedienstete<br />
Bay BezO Art. 34 Bezirksbedienstete<br />
(1) 1 Der Bezirkstag ist zuständig,<br />
1. die Beamten des Bezirks zu ernennen, zu befördern, zu einem anderen<br />
Dienstherrn abzuordnen oder zu versetzen, in den Ruhestand zu versetzen<br />
und zu entlassen,<br />
2. die Angestellten des Bezirks einzustellen, höherzugruppieren und zu<br />
entlassen.<br />
2<br />
Der Bezirkstag kann diese Befugnisse dem Bezirksausschuß oder einem<br />
weiteren beschließenden Ausschuß übertragen.<br />
(2) 1 Die Arbeiter des Bezirks werden durch den Bezirkstagspräsidenten<br />
eingestellt, höhergruppiert und entlassen. 2 Befugnisse nach Abs. 1 Satz 1<br />
kann der Bezirkstag auf den Bezirkstagspräsidenten übertragen für<br />
1. Beamte des einfachen, des mittleren und des gehobenen Dienstes und<br />
für Beamte der ersten beiden Ämter des höheren Dienstes,<br />
2. Angestellte, deren Vergütung mit der Besoldung der in Nr. 1 genannten<br />
Beamten vergleichbar ist.<br />
3<br />
Ein solcher Beschluß bedarf der Mehrheit der stimmberechtigten<br />
Mitglieder des Bezirkstags; falls der Beschluß nicht mit dieser Mehrheit
wieder aufgehoben wird, gilt er bis zum Ende der Wahlzeit des<br />
Bezirkstags. 4 Art. 31 Abs. 2 findet Anwendung.<br />
(3) 1 Die Dienstaufsicht über die Bezirksbediensteten führt der<br />
Bezirkstagspräsident. 2 Er ist Dienstvorgesetzter der Bezirksbeamten.<br />
(4) 1 Bezirksbedienstete müssen die für eine vergleichbare Tätigkeit im<br />
Staatsdienst erforderliche Vorbildung nachweisen. 2 Zu ärztlichen<br />
Direktoren der Nervenkrankenhäuser der Bezirke und zu deren<br />
Stellvertretern können nur Nervenärzte bestellt werden, die eine<br />
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens drei Jahren an einem<br />
Nervenkrankenhaus ausgeübt haben und besondere Kenntnisse für die<br />
Leitung eines Nervenkrankenhauses besitzen.<br />
(5) Die Arbeitsbedingungen und Vergütungen (Gehälter und Löhne) der<br />
Angestellten und Arbeiter müssen angemessen sein.<br />
(6) 1 Der Stellenplan (Art. 56 Abs. 2 Satz 2) ist einzuhalten. 2 Abweichungen<br />
sind nur im Rahmen des Art. 60 Abs. 3 Nr. 2 zulässig.<br />
2.ABSCHNITT Regierung und Bezirk<br />
Bay BezO Art. 35 Verwaltungsverbund<br />
1 Die Verwaltung des Bezirks wird im organisatorischen und nach Maßgabe der<br />
Art. 35 a und 35 b im personellen und sächlichen Verwaltungsverbund mit der<br />
Regierung geführt. 2 Die Einzelheiten werden durch ergänzende Vereinbarung<br />
zwischen Bezirk und Regierung geregelt.<br />
Bay BezO Art. 35 a Bereitstellung von Bediensteten und Einrichtungen<br />
(1) 1 Die Regierung stellt dem Bezirk die leitenden Verwaltungsbeamten der<br />
Hauptverwaltung und der Sozialhilfeverwaltung sowie für weitere zentrale<br />
Verwaltungsaufgaben staatliche Dienstkräfte nach Maßgabe des<br />
Staatshaushalts zur Verfügung. 2 Der leitende Verwaltungsbeamte und der<br />
leitende Beamte der Sozialhilfeverwaltung werden im Einvernehmen mit<br />
dem Bezirkstagspräsidenten bestellt.<br />
(2) Soweit der Bezirk seine Verwaltungsaufgaben nicht mit eigenen<br />
Verwaltungseinrichtungen erledigt, stellt ihm die Regierung ihre<br />
Einrichtungen nach Maßgabe des Staatshaushalts zur Verfügung.<br />
(3) Der Bezirk und die Regierung leisten sich in Fachfragen zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben gegenseitig gutachtliche Hilfe.<br />
(4) 1 Für Amtspflichtverletzungen der für den Bezirk tätigen<br />
Staatsbediensteten haftet der Bezirk. 2 Für Amtspflichtverletzungen der für<br />
die Regierung tätigen Bezirksbediensteten haftet der Freistaat Bayern.<br />
Bay BezO Art. 35 b Erledigung von Bezirksaufgaben durch die<br />
Regierung<br />
(1) 1 Der Bezirkstag kann durch Beschluß im Benehmen mit der Regierung die<br />
Erfüllung von Verwaltungsaufgaben auf die Regierung übertragen. 2 Die<br />
Übertragung ist gemäß Art. 19 Abs. 2 bekanntzumachen.<br />
(2) 1 Bei der Erfüllung dieser Verwaltungsaufgaben obliegt der Regierung die<br />
verwaltungsmäßige Vorbereitung und der verwaltungsmäßige Vollzug der
Beschlüsse des Bezirkstags, seiner Ausschüsse und der Entscheidungen<br />
des Bezirkstagspräsidenten nach Art. 33 Abs. 2. 2 Die Regierung erledigt in<br />
diesem Bereich ferner die laufenden Verwaltungsangelegenheiten, die für<br />
den Bezirk keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen<br />
Verpflichtungen erwarten lassen. 3 Hierfür kann der Bezirkstag Richtlinien<br />
aufstellen.<br />
(3) 1 Die Regierung vertritt insoweit den Bezirk nach außen, soweit sich nicht<br />
der Bezirkstagspräsident in Angelegenheiten, die nicht zu den laufenden<br />
Verwaltungsangelegenheiten nach Absatz 2 gehören, die Vertretung<br />
vorbehält. 2 Art. 33 a Abs. 2 gilt entsprechend.<br />
Bay BezO Art. 36 Regierungspräsident und Bezirkstag<br />
(1) Der Regierungspräsident wird im Benehmen mit dem Bezirkstag von der<br />
Staatsregierung ernannt.<br />
(2) 1 Der Regierungspräsident und sein Stellvertreter haben zu allen Sitzungen<br />
des Bezirkstags und seiner Ausschüsse Zutritt. 2 Zu den Sitzungen der<br />
Ausschüsse können sie Beauftragte entsenden.<br />
(3) Der Bezirkstag und seine Ausschüsse können das Erscheinen des<br />
Regierungspräsidenten verlangen.<br />
3. ABSCHNITT Geschäftsgang<br />
Bay BezO Art. 37 Geschäftsordnung<br />
(1) Der Bezirkstag gibt sich eine Geschäftsordnung.<br />
(2) Die Geschäftsordnung muß Bestimmungen über die Frist und Form der<br />
Einladungen zu den Sitzungen sowie über den Geschäftsgang des<br />
Bezirkstags, des Bezirksausschusses und der weiteren Ausschüsse<br />
enthalten.<br />
(3) Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet und verteilt der<br />
Bezirkstagspräsident die Geschäfte.<br />
(4) Der Regierungspräsident muß zu allen Sitzungen des Bezirkstags und<br />
seiner Ausschüsse eingeladen werden.<br />
Bay BezO Art. 38 Sitzungszwang; Beschlußfähigkeit<br />
(1) 1 Der Bezirkstag beschließt in Sitzungen. 2 Er ist beschlußfähig, wenn<br />
sämtliche Bezirksräte ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der<br />
Bezirksräte anwesend und stimmberechtigt ist.<br />
(2) 1 Wird der Bezirkstag infolge vorausgegangener Beschlußunfähigkeit zum<br />
zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand<br />
zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen<br />
beschlußfähig. 2 Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung<br />
hingewiesen werden.<br />
Bay BezO Art. 39 Teilnahmepflicht; Ordnungsgeld gegen Säumige<br />
(1) 1 Die Bezirksräte sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen<br />
teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen.<br />
2 Kein Bezirksrat darf sich der Stimme enthalten.
(2) Gegen Bezirksräte, die sich diesen Verpflichtungen ohne genügende<br />
Entschuldigung entziehen, kann der Bezirkstag Ordnungsgeld bis zu<br />
zweihundertfünfzig Euro im Einzelfall verhängen.<br />
(3) Ordnungsgeld wird als Einnahme des Bezirks behandelt.<br />
Bay BezO Art. 40 Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung<br />
(1) 1 Ein Bezirksrat kann an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen,<br />
wenn der Beschluß ihm selbst, seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner,<br />
einem Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer<br />
von ihm kraft <strong>Gesetze</strong>s oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder<br />
juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen<br />
kann. 2 Gleiches gilt, wenn ein Bezirksrat in anderer als öffentlicher<br />
Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat.<br />
(2) Absatz 1 gilt nicht<br />
1. für Wahlen,<br />
2. für Beschlüsse, mit denen der Bezirkstag eine Person zum Mitglied<br />
eines Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des<br />
Bezirks in eine andere Einrichtung entsendet, dafür vorschlägt oder daraus<br />
abberuft.<br />
(3) Ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, entscheidet der<br />
Bezirkstag.<br />
(4) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen<br />
Bezirksrats hat die Ungültigkeit des Beschlusses nur zur Folge, wenn sie<br />
für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.<br />
Bay BezO Art. 41 Einschränkung des Vertretungsrechts<br />
Mitglieder des Bezirkstags dürfen Ansprüche Dritter gegen den Bezirk nur als<br />
gesetzliche Vertreter geltend machen.<br />
Bay BezO Art. 42 Form der Beschlußfassung; Wahlen<br />
(1) 1 Beschlüsse des Bezirkstags werden in offener Abstimmung mit Mehrheit<br />
der Abstimmenden gefaßt. 2 Bei Stimmengleichheit ist der Antrag<br />
abgelehnt.<br />
(2) 1 Kein Bezirksrat darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung<br />
gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bezirkstags<br />
zur Verantwortung gezogen werden. 2 Die Haftung gegenüber dem Bezirk<br />
ist nicht ausgeschlossen, wenn das Abstimmungsverhalten eine<br />
vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. 3 Die Verantwortlichkeit nach<br />
bundesrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt.<br />
(3) 1 Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. 2 Sie sind nur<br />
gültig, wenn sämtliche Bezirksräte unter Angabe des Gegenstands geladen<br />
sind und die Mehrheit von ihnen anwesend und stimmberechtigt ist.<br />
3<br />
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen<br />
erhält. 4 Neinstimmen und leere Stimmzettel sind ungültig. 5 Ist<br />
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu<br />
wiederholen. 6 Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und<br />
erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen<br />
Stimmen, so tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten
Stimmenzahlen ein. 7 Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet<br />
das Los.<br />
(4) Absatz 3 gilt für alle Entscheidungen des Bezirkstags, die in diesem Gesetz<br />
oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden.<br />
Bay BezO Art. 43 Öffentlichkeit<br />
(1) Zeitpunkt und Ort der Sitzungen des Bezirkstags sind unter Angabe der<br />
Tagesordnung spätestens eine Woche vor der Sitzung öffentlich<br />
bekanntzumachen.<br />
(2) 1 Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der<br />
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen.<br />
2<br />
Durch die Geschäftsordnung kann festgelegt werden, daß bestimmte<br />
Angelegenheiten grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung behandelt<br />
werden. 3 Über den Ausschluß der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher<br />
Sitzung beraten und entschieden. 4 Der Beschluß erfordert eine Mehrheit<br />
von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Bezirksräte.<br />
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit<br />
bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen<br />
sind.<br />
Bay BezO Art. 44 Handhabung der Ordnung<br />
(1) 1 Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. 2 Er<br />
ist berechtigt, Zuhörer, welche die Ordnung stören, entfernen zu lassen.<br />
3<br />
Er kann mit Zustimmung des Bezirkstags Bezirksräte, welche die<br />
Ordnung fortgesetzt erheblich stören, von der Sitzung ausschließen.<br />
(2) Wird durch einen bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenen<br />
Bezirksrat die Ordnung innerhalb von zwei Monaten neuerdings erheblich<br />
gestört, so kann ihm der Bezirkstag für zwei weitere Sitzungen die<br />
Teilnahme untersagen.<br />
Bay BezO Art. 45 Niederschrift<br />
(1) 1 Die Verhandlungen des Bezirkstags sind niederzuschreiben. 2 Die<br />
Niederschrift muß Tag und Ort der Sitzung, die anwesenden Bezirksräte,<br />
die behandelten Gegenstände, die Beschlüsse und das<br />
Abstimmungsergebnis ersehen lassen. 3 Jedes Mitglied kann verlangen,<br />
daß in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat.<br />
(2) 1 Die Bezirksräte können jederzeit die Niederschrift einsehen und sich<br />
Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse erteilen lassen.<br />
2<br />
Die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen steht allen<br />
Bezirksbürgern frei.<br />
Bay BezO Art. 46 Geschäftsgang der Ausschüsse<br />
(1) Den Geschäftsgang der vorberatenden Ausschüsse regelt der Bezirkstag.<br />
(2) Auf den Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse finden die<br />
Vorschriften der Art. 38 bis 45 entsprechende Anwendung.
4. ABSCHNITT Verwaltungsgrundsätze und Verwaltungsaufgaben<br />
Bay BezO Art. 47 Gesetzmäßigkeit; Unparteilichkeit<br />
1 Die Verwaltungstätigkeit des Bezirks muß mit der Verfassung und den<br />
<strong>Gesetze</strong>n im Einklang stehen. 2 Sie darf nur von sachlichen Gesichtspunkten<br />
geleitet sein.<br />
Bay BezO Art. 47 a Geheimhaltung<br />
(1) 1 Alle Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer<br />
wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten<br />
nicht bekannt werden dürfen, sind von den Bezirken geheimzuhalten. 2 Die<br />
in anderen Rechtsvorschriften geregelte Verpflichtung zur<br />
Verschwiegenheit bleibt unberührt.<br />
(2) 1 Zur Geheimhaltung der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten<br />
haben die Bezirke die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 2 Sie haben<br />
insoweit auch die für die Behörden des Freistaates Bayern geltenden<br />
Verwaltungsvorschriften zu beachten. 3 Das Staatsministerium des Innern<br />
kann hierzu Richtlinien aufstellen und Weisungen erteilen, die nicht der<br />
Einschränkung nach Art. 91 Abs. 2 Satz 2 unterliegen.<br />
(3) 1 Der Bezirkstagspräsident ist zu Beginn seiner Amtszeit durch die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde schriftlich besonders zu verpflichten, die in<br />
Absatz 1 Satz 1 genannten Angelegenheiten geheimzuhalten und die<br />
hierfür geltenden Vorschriften zu beachten. 2 In gleicher Weise hat der<br />
Bezirkstagspräsident seinen Stellvertreter zu verpflichten.<br />
3<br />
Bezirksbedienstete hat er zu verpflichten, bevor sie mit den in Absatz 1<br />
Satz 1 genannten Angelegenheiten befaßt werden. 4 Art. 3 a des<br />
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.<br />
Bay BezO Art. 48 Aufgaben des eigenen Wirkungskreises;<br />
Pflichtaufgaben<br />
(1) Im eigenen Wirkungskreis sollen die Bezirke in den Grenzen ihrer<br />
Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das<br />
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den<br />
Verhältnissen des Bezirks erforderlich sind; hierbei sind die Belange des<br />
Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigen.<br />
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 sind die Bezirke unbeschadet bestehender<br />
Verbindlichkeiten Dritter verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen<br />
Vorschriften die erforderlichen Maßnahmen auf den Gebieten der<br />
Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Kriegsopferfürsorge, des<br />
Gesundheitswesens, des Sonderschulwesens, des Wasserbaus, der<br />
Denkmalpflege und der Heimatpflege zu treffen oder die nötigen<br />
Leistungen für solche Maßnahmen zu erbringen.<br />
(3) Die Bezirke sind unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter in den<br />
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, die erforderlichen<br />
stationären und teilstationären Einrichtungen<br />
1. für Psychiatrie und Neurologie, für Suchtkranke sowie für wesentlich<br />
Sehbehinderte, Hörbehinderte und Sprachbehinderte zu errichten, zu<br />
unterhalten und zu betreiben,
2. für die Eingliederung Behinderter bereitzustellen, zu unterhalten oder<br />
zu fördern, soweit sie als zentrale Einrichtungen für das gesamte oder<br />
überwiegende Bezirksgebiet geboten sind und freie Träger hierfür nicht<br />
tätig werden.<br />
Bay BezO Art. 49 Übernahme von Kreisaufgaben<br />
(1) Auf Antrag von Landkreisen und kreisfreien Gemeinden können die<br />
Bezirke deren Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Art. 52 LKrO, Art. 7<br />
Abs. 1 GO) übernehmen, wenn und solange diese das Leistungsvermögen<br />
der beteiligten Landkreise und kreisfreien Gemeinden übersteigen.<br />
(2) Der Beschluß bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen<br />
Mitgliederzahl des Bezirkstags.<br />
Bay BezO Art. 50 Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br />
Im übertragenen Wirkungskreis haben die Bezirke die staatlichen<br />
Verwaltungsaufgaben zu erfüllen, die ihnen durch Gesetz zugewiesen sind.<br />
Bay BezO Artikel 51 (weggefallen)<br />
Bay BezO Art. 52 Zuständigkeit für den <strong>Gesetze</strong>svollzug<br />
(1) Der Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im übertragenen<br />
Wirkungskreis und die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und<br />
Weisungen der Staatsbehörden obliegen dem Bezirkstag oder dem<br />
Bezirksausschuß, in den Fällen des Art. 33 Abs. 1, 2 und 3 dem<br />
Bezirkstagspräsidenten.<br />
(2) 1 Hält der Bezirkstagspräsident Entscheidungen des Bezirkstags oder<br />
seiner Ausschüsse für rechtswidrig, so hat er sie zu beanstanden, ihren<br />
Vollzug auszusetzen und, soweit erforderlich, die Entscheidung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde herbeizuführen. 2 Diese Befugnisse stehen dem<br />
Regierungspräsidenten zu, soweit die Regierung Verwaltungsaufgaben des<br />
Bezirks nach Art. 35 b erledigt.<br />
DRITTER TEIL Bezirkswirtschaft<br />
1. ABSCHNITT Haushaltswirtschaft<br />
Bay BezO Art. 53 Allgemeine Haushaltsgrundsätze<br />
(1) 1 Der Bezirk hat seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, daß<br />
die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. 2 Die dauernde<br />
Leistungsfähigkeit des Bezirks ist sicherzustellen, eine Überschuldung ist<br />
zu vermeiden. 3 Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen<br />
Gleichgewichts und dem § 51 a des Haushaltsgrundsätzegesetzes<br />
Rechnung zu tragen, insbesondere der Verantwortung zur Einhaltung der<br />
Bestimmungen in Art. 104 des Vertrages zur Gründung der Europäischen<br />
Gemeinschaft und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes<br />
nachzukommen.<br />
(2) 1 Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu<br />
führen. 2 Aufgaben sollen in geeigneten Fällen daraufhin untersucht
werden, ob und in welchem Umfang sie durch nichtkommunale Stellen,<br />
insbesondere durch private Dritte oder unter Heranziehung Dritter,<br />
mindestens ebenso gut erledigt werden können.<br />
(3) 1 Bei der Führung der Haushaltswirtschaft hat der Bezirk finanzielle Risiken<br />
zu minimieren. 2 Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn besondere Umstände,<br />
vor allem ein grobes Missverhältnis bei der Risikoverteilung zu Lasten des<br />
Bezirks, die Gefahr eines erheblichen Vermögensschadens begründen.<br />
(4) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten<br />
kommunalen Buchführung oder nach den Grundsätzen der Kameralistik zu<br />
führen.<br />
Bay BezO Art. 54 Grundsätze der Einnahmebeschaffung<br />
(1) Der Bezirk erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.<br />
(2) Er hat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen<br />
1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von<br />
ihm erbrachten Leistungen,<br />
2. im übrigen durch die Bezirksumlage<br />
zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.<br />
(3) Der Bezirk darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung<br />
nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.<br />
Bay BezO Art. 55 Haushaltssatzung<br />
(1) 1 Der Bezirk hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu<br />
erlassen. 2 Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei<br />
Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.<br />
(2) 1 Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung<br />
1. des Haushaltsplans unter Angabe<br />
a) des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres<br />
sowie des sich daraus ergebenden Saldos des Ergebnishaushalts, des<br />
Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der<br />
Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres sowie des sich daraus<br />
ergebenden Saldos des Finanzhaushalts bei Haushaltswirtschaft nach den<br />
Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
b) des Gesamtbetrags der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres<br />
bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik,<br />
2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für<br />
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
(Kreditermächtigungen),<br />
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen<br />
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen<br />
beziehungsweise Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten<br />
(Verpflichtungsermächtigungen),<br />
4. der Bezirksumlage (Umlagesoll und Umlagesätze),<br />
5. des Höchstbetrags der Kassenkredite.<br />
2<br />
Die Angaben nach Satz 1 Nrn. 2, 3 und 5 sind getrennt für das<br />
Haushaltswesen des Bezirks und die Wirtschaftsführung von
Eigenbetrieben zu machen. 3 Die Haushaltssatzung kann weitere<br />
Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Einzahlungen sowie<br />
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise auf die Einnahmen<br />
und Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.<br />
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt<br />
für das Haushaltsjahr.<br />
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch<br />
Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.<br />
Bay BezO Art. 56 Haushaltsplan<br />
(1) 1 Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der<br />
Aufgaben des Bezirks voraussichtlich<br />
1. anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden<br />
Aufwendungen sowie zu leistenden Auszahlungen bei Haushaltswirtschaft<br />
nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
2. zu erwartenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben bei<br />
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik,<br />
3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.<br />
2<br />
Die Vorschriften über die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge<br />
und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen, Ausgaben und<br />
Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe des Landkreises bleiben<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Der Haushaltsplan ist bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
doppelten kommunalen Buchführung in einen Ergebnishaushalt und einen<br />
Finanzhaushalt, bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt<br />
zu gliedern. 2 Der Stellenplan für die Beamten und Angestellten des<br />
Bezirks ist Teil des Haushaltsplans.<br />
(3) 1 Der Haushaltsplan muß ausgeglichen sein. 2 Er ist Grundlage für die<br />
Haushaltswirtschaft des Bezirks und nach Maßgabe dieses <strong>Gesetze</strong>s und<br />
der auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen Vorschriften für die<br />
Haushaltsführung verbindlich. 3 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter<br />
werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.<br />
Bay BezO Art. 57 Erlaß der Haushaltssatzung<br />
(1) Der Bezirkstag beschließt über die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen<br />
in öffentlicher Sitzung.<br />
(2) Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor<br />
Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.<br />
(3) 1 Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Bestandteilen sind<br />
sogleich nach der Genehmigung amtlich bekanntzumachen.<br />
2<br />
Haushaltssatzungen ohne solche Bestandteile sind frühestens einen<br />
Monat nach der Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde amtlich<br />
bekanntzumachen, sofern nicht die Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung<br />
beanstandet. 3 Gleichzeitig ist der Haushaltsplan eine Woche lang<br />
öffentlich aufzulegen; darauf ist in der amtlichen Bekanntmachung der<br />
Haushaltssatzung hinzuweisen.
Bay BezO Art. 58 Planabweichungen<br />
(1) 1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen<br />
beziehungsweise Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind<br />
und die Deckung gewährleistet ist. 2 Sind sie erheblich, sind sie vom<br />
Bezirkstag zu beschließen.<br />
(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die im<br />
Haushaltsplan nicht vorgesehene Verpflichtungen zu Leistungen des<br />
Bezirks entstehen können.<br />
(3) Art. 60 Abs. 2 bleibt unberührt.<br />
(4) 1 Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind<br />
überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise<br />
Ausgaben in nicht erheblichem Umfang auch dann zulässig, wenn ihre<br />
Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlaß einer<br />
Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden<br />
Jahr gewährleistet ist. 2 Hierüber entscheidet der Bezirkstag.<br />
(5) Der Bezirkstag kann Richtlinien über die Abgrenzungen aufstellen.<br />
Bay BezO Art. 59 Verpflichtungsermächtigungen<br />
(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen beziehungsweise<br />
Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in<br />
künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen werden,<br />
wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.<br />
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem<br />
Haushaltsjahr folgenden drei Jahre vorgesehen werden, in Ausnahmefällen<br />
bis zum Abschluß einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie<br />
der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.<br />
(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des<br />
Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende<br />
Haushaltsjahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum<br />
Erlaß dieser Haushaltssatzung.<br />
(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen<br />
der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren<br />
Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.<br />
(5) 1 Verpflichtungen im Sinn des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder<br />
außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis<br />
besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der<br />
Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. 2 Art. 58 Abs. 1<br />
Satz 2 gilt entsprechend.<br />
Bay BezO Art. 60 Nachtragshaushaltssatzungen<br />
(1) 1 Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres<br />
durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 2 Für die<br />
Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die<br />
Haushaltssatzung entsprechend.<br />
(2) Der Bezirk hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,<br />
wenn<br />
1. sich zeigt, daß trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der<br />
Haushaltssatzung erreicht werden kann,<br />
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen und<br />
Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben in einem im Verhältnis zu den<br />
Gesamtaufwendungen und -auszahlungen beziehungsweise<br />
Gesamtausgaben des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet<br />
werden müssen,<br />
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts beziehungsweise Ausgaben des<br />
Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,<br />
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder in eine höhere<br />
Vergütungsgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die<br />
entsprechenden Stellen nicht enthält.<br />
(3) Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf<br />
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und<br />
Baumaßnahmen, soweit die Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben<br />
nicht erheblich und unabweisbar sind,<br />
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer<br />
Personalausgaben, die auf Grund des Beamten- oder Tarifrechts oder für<br />
die Erfüllung neuer Aufgaben notwendig werden.<br />
Bay BezO Art. 61 Vorläufige Haushaltsführung<br />
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht<br />
bekanntgemacht, so darf der Bezirk<br />
1. finanzielle Leistungen erbringen, zu dener er rechtlich verpflichtet ist<br />
oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar<br />
sind; er darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen<br />
des Finanzhaushalts beziehungsweise des Vermögenshaushalts, für die im<br />
Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen,<br />
2. Kredite umschulden,<br />
3. Kassenkredite bis zu dem zuletzt in einer Haushaltssatzung<br />
festgesetzten Höchstbetrag oder, wenn besondere Umstände im Einzelfall<br />
eine Erhöhung rechtfertigen, auch darüber hinaus aufnehmen.<br />
(2) 1 Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der<br />
Beschaffungen und der sonstigen Leistungen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus,<br />
darf der Bezirk Kredite für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel des<br />
durchschnittlichen Betrags der für die vier Vorjahre festgesetzten Kredite<br />
aufnehmen. 2 Eine angemessene Erhöhung dieser Kreditaufnahme ist<br />
zulässig, wenn besondere Umstände im Einzelfall die Erhöhung<br />
rechtfertigen.<br />
(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das<br />
neue Jahr erlassen ist.<br />
(4) 1 Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 und Abs. 2 bedürfen der<br />
Genehmigung. 2 Der Bezirk hat im Antrag darzulegen, wie und bis wann er<br />
den Erlass einer Haushaltssatzung sicherstellen kann. 3 Die Genehmigung<br />
darf den Zielen der Wiederherstellung einer geordneten<br />
Haushaltswirtschaft und der dauernden Leistungsfähigkeit nicht<br />
widersprechen; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.
Bay BezO Art. 62 Mittelfristige Finanzplanung<br />
(1) 1 Der Bezirk hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung<br />
zugrundezulegen. 2 Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das<br />
laufende Haushaltsjahr.<br />
(2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm<br />
aufzustellen.<br />
(3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen<br />
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben und die<br />
Deckungsmöglichkeiten darzustellen.<br />
(4) Der Finanzplan ist dem Bezirkstag spätestens mit dem Entwurf der<br />
Haushaltssatzung vorzulegen.<br />
(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der<br />
Entwicklung anzupassen und fortzuführen.<br />
2. ABSCHNITT Kreditwesen<br />
Bay BezO Art. 63 Kredite<br />
(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des Art. 54 Abs. 3 nur im<br />
Finanzhaushalt beziehungsweise im Vermögenshaushalt und nur für<br />
Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und zur<br />
Umschuldung aufgenommen werden.<br />
(2) 1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen<br />
und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der<br />
Haushaltssatzung der Genehmigung (Gesamtgenehmigung). 2 Die<br />
Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten<br />
Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter<br />
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 3 Sie ist in der Regel zu<br />
versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden<br />
Leistungsfähigkeit des Bezirks nicht im Einklang stehen.<br />
(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste<br />
Jahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlaß dieser<br />
Haushaltssatzung.<br />
(4) 1 Die Aufnahme der einzelnen Kredite bedarf der Genehmigung<br />
(Einzelgenehmigung), sobald die Kreditaufnahmen für die Bezirke nach<br />
§ 19 des <strong>Gesetze</strong>s zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der<br />
Wirtschaft beschränkt worden sind. 2 Die Einzelgenehmigung kann nach<br />
Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden.<br />
(5) 1 Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit den<br />
Staatsministerien der Finanzen und für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr<br />
und Technologie durch Rechtsverordnung die Aufnahme von Krediten von<br />
der Genehmigung (Einzelgenehmigung) abhängig machen, wenn der<br />
Konjunkturrat für die öffentliche Hand nach § 18 Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s zur<br />
Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft eine<br />
Beschränkung der Kreditaufnahme durch die Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände empfohlen hat. 2 Die Genehmigung ist zu versagen,<br />
wenn dies zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts geboten ist oder wenn die Kreditbedingungen wirtschaftlich<br />
nicht vertretbar sind. 3 Solche Rechtsverordnungen sind auf längstens ein<br />
Jahr zu befristen.<br />
(6) 1 Der Bezirk darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen.<br />
2 Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die<br />
Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.<br />
Bay BezO Art. 64 Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten<br />
(1) Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich<br />
gleichkommen, bedarf der Genehmigung.<br />
(2) 1 Der Bezirk darf Bürgschaften, Gewährverträge und Verpflichtungen aus<br />
verwandten Rechtsgeschäften, die ein Einstehen für fremde Schuld oder<br />
für den Eintritt oder Nichteintritt bestimmter Umstände zum Gegenstand<br />
haben, nur zur Erfüllung seiner Aufgaben übernehmen. 2 Die<br />
Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung, wenn sie nicht im Rahmen<br />
der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.<br />
(3) Der Bezirk bedarf zur Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter der<br />
Genehmigung.<br />
(4) 1 Für die Genehmigung gelten Art. 63 Abs. 2 Sätze 2 und 3, im Fall der<br />
vorläufigen Haushaltsführung Art. 61 Abs. 4 Sätze 2 und 3 entsprechend.<br />
2<br />
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn das Rechtsgeschäft nicht eine<br />
Investition zum Gegenstand hat, sondern auf die Erzielung wirtschaftlicher<br />
Vorteile dadurch gerichtet ist, dass der Bezirk einem Dritten inländische<br />
steuerliche Vorteile verschafft.<br />
(5) Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung Rechtsgeschäfte<br />
von der Genehmigung freistellen,<br />
1. die die Bezirke zur Erfüllung bestimmter Aufgaben eingehen oder<br />
2. die für die Bezirke keine besondere Belastung bedeuten oder<br />
3. die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren.<br />
Bay BezO Art. 65 Kassenkredite<br />
(1) Zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen beziehungsweise<br />
Ausgaben kann der Bezirk Kassenkredite bis zu dem in der<br />
Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die<br />
Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.<br />
(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag soll für die<br />
Haushaltswirtschaft ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten<br />
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beziehungsweise ein<br />
Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen und für<br />
den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge<br />
nicht übersteigen.
3. ABSCHNITT Vermögenswirtschaft<br />
a) Allgemeines<br />
Bay BezO Art. 66 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze<br />
(1) Der Bezirk soll Vermögensgegenstände nur erwerben, wenn das zur<br />
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.<br />
(2) 1 Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten<br />
und ordnungsgemäß nachzuweisen. 2 Bei Geldanlagen ist auf eine<br />
ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag<br />
bringen.<br />
(3) 1 Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder<br />
Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.<br />
2<br />
Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen<br />
nur in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung<br />
notwendig ist.<br />
Bay BezO Art. 67 Veräußerung von Vermögen<br />
(1) 1 Der Bezirk darf Vermögensgegenstände, die er zur Erfüllung seiner<br />
Aufgaben nicht braucht, veräußern. 2 Vermögensgegenstände dürfen in<br />
der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.<br />
(2) 1 Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands gilt<br />
Absatz 1 entsprechend. 2 Ausnahmen sind insbesondere zulässig bei der<br />
Vermietung von Gebäuden zur Sicherung preiswerten Wohnens und zur<br />
Sicherung der Existenz kleiner und ertragsschwacher Gewerbebetriebe.<br />
(3) 1 Die Verschenkung und die unentgeltliche Überlassung von<br />
Bezirksvermögen sind unzulässig (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung).<br />
2<br />
Die Veräußerung oder Überlassung von Bezirksvermögen in Erfüllung von<br />
Bezirksaufgaben oder herkömmlicher Anstandspflichten fällt nicht unter<br />
dieses Verbot.<br />
(4) Bezirksvermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Bezirks<br />
und nur dann in Stiftungsvermögen eingebracht werden, wenn der mit der<br />
Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann.<br />
Bay BezO Art. 68 Rücklagen, Rückstellungen<br />
(1) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten<br />
kommunalen Buchführung hat der Bezirk seine stetige Zahlungsfähigkeit<br />
sicherzustellen. 2 Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen<br />
zuzuführen, soweit nicht Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind.<br />
(2) Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen<br />
Buchführung sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unterlassene<br />
Aufwendungen für Instandhaltung Rückstellungen zu bilden.<br />
(3) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik hat der<br />
Bezirk für Zwecke des Vermögenshaushalts und zur Sicherung der<br />
Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden.<br />
2<br />
Rücklagen für andere Zwecke sind zulässig.
Bay BezO Art. 69 Zwangsvollstreckung in Bezirksvermögen wegen<br />
einer Geldforderung<br />
(1) 1 Der Gläubiger einer bürgerlich-rechtlichen Geldforderung gegen den<br />
Bezirk muß, soweit er nicht dingliche Rechte verfolgt, vor der Einleitung<br />
der Zwangsvollstreckung wegen dieser Forderung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde eine beglaubigte Abschrift des vollstreckbaren<br />
Titels zustellen. 2 Die Zwangsvollstreckung darf erst einen Monat nach der<br />
Zustellung an die Rechtsaufsichtsbehörde beginnen.<br />
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für öffentlich-rechtliche Geldforderungen,<br />
soweit nicht Sondervorschriften bestehen.<br />
(3) Über das Vermögen des Bezirks findet ein Insolvenz- oder gerichtliches<br />
Vergleichsverfahren nicht statt.<br />
b) Vom Bezirk verwaltete nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen<br />
Bay BezO Art. 70 Begriff; Verwaltung<br />
(1) Vermögenswerte, die der Bezirk von Dritten unter der Auflage<br />
entgegennimmt, sie zu einem bestimmten öffentlichen Zweck zu<br />
verwenden, ohne daß eine rechtsfähige Stiftung entsteht, sind ihrer<br />
Zweckbestimmung gemäß nach den für das Bezirksvermögen geltenden<br />
Vorschriften zu verwalten.<br />
(2) 1 Die Vermögenswerte sind in ihrem Bestand ungeschmälert zu erhalten.<br />
2<br />
Sie sind vom übrigen Bezirksvermögen getrennt zu verwalten und so<br />
anzulegen, daß sie für ihren Verwendungszweck verfügbar sind.<br />
(3) 1 Der Ertrag darf nur für den Stiftungszweck verwendet werden. 2 Ist eine<br />
Minderung eingetreten, so sollen die Vermögensgegenstände aus dem<br />
Ertrag wieder ergänzt werden.<br />
Bay BezO Art. 71 Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebung der<br />
Zweckbestimmung<br />
1 Soweit eine Änderung des Verwendungszwecks oder die Aufhebung der<br />
Zweckbestimmung zulässig ist, beschließt hierüber der Bezirkstag. 2 Der<br />
Beschluß bedarf der Genehmigung.<br />
4. ABSCHNITT Unternehmen des Bezirks<br />
Bay BezO Art. 72 Rechtsformen<br />
Der Bezirk kann Unternehmen außerhalb seiner allgemeinen Verwaltung in<br />
folgenden Rechtsformen betreiben:<br />
1. als Eigenbetrieb,<br />
2. als selbständiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts,<br />
3. in den Rechtsformen des Privatrechts.<br />
Bay BezO Art. 73 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und<br />
Beteiligungen<br />
(1) 1 Der Bezirk darf ein Unternehmen im Sinn von Art. 72 nur errichten,<br />
übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn
1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert, insbesondere wenn<br />
der Bezirk mit ihm gesetzliche Verpflichtungen oder seine Aufgaben<br />
gemäß Art. 48 erfüllen will,<br />
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen<br />
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Bezirks und zum voraussichtlichen<br />
Bedarf steht,<br />
3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für die<br />
Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Verwaltung geeignet sind,<br />
4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der<br />
Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird<br />
oder erfüllt werden kann.<br />
2<br />
Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen der Bezirk oder seine<br />
Unternehmen an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben<br />
teilnehmen, um Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen<br />
Zweck. 3 Soweit Unternehmen entgegen Satz 2 vor dem 1. September<br />
1998 errichtet oder übernommen wurden, dürfen sie weitergeführt, jedoch<br />
nicht erweitert werden.<br />
(2) Der Bezirk darf mit seinen Unternehmen außerhalb des Bezirksgebiets nur<br />
tätig werden, wenn dafür die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen<br />
und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen<br />
Gebietskörperschaften gewahrt sind.<br />
(3) 1 Für die Beteiligung des Bezirks an einem Unternehmen gilt Absatz 1<br />
entsprechend. 2 Absatz 2 gilt entsprechend, wenn sich der Bezirk an einem<br />
auch außerhalb seines Gebiets tätigen Unternehmen in einem Ausmaß<br />
beteiligt, das den auf das Bezirksgebiet entfallenden Anteil an den<br />
Leistungen des Unternehmens erheblich übersteigt.<br />
(4) Bankunternehmen darf der Bezirk weder errichten noch sich an ihnen<br />
beteiligen.<br />
Bay BezO Art. 74 Eigenbetriebe<br />
(1) Eigenbetriebe sind Unternehmen des Bezirks, die außerhalb der<br />
allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene<br />
Rechtspersönlichkeit geführt werden.<br />
(2) Für Eigenbetriebe bestellt der Bezirkstag eine Werkleitung und einen<br />
Werkausschuß.<br />
(3) 1 Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs. 2 Sie ist<br />
insoweit zur Vertretung nach außen befugt; der Bezirkstag kann ihr mit<br />
Zustimmung des Bezirkstagspräsidenten weitere Vertretungsbefugnisse<br />
übertragen. 3 Die Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im<br />
Eigenbetrieb und führt die Dienstaufsicht über sie und die im Eigenbetrieb<br />
tätigen Angestellten und Arbeiter. 4 Der Bezirkstag kann mit Zustimmung<br />
des Bezirkstagspräsidenten der Werkleitung für Beamte, Angestellte und<br />
Arbeiter im Eigenbetrieb personalrechtliche Befugnisse in entsprechender<br />
Anwendung von Art. 34 Abs. 2 übertragen.<br />
(4) 1 Im übrigen beschließt über die Angelegenheiten des Eigenbetriebs der<br />
Werkausschuß, soweit nicht der Bezirkstag sich die Entscheidung<br />
allgemein vorbehält oder im Einzelfall an sich zieht. 2 Der Werkausschuß<br />
ist ein beschließender Ausschuß im Sinn der Art. 28 und 46. 3 Im Fall des
Art. 34 Abs. 1 Satz 2 sollen Befugnisse gegenüber Beamten, Angestellten<br />
und Arbeitern im Eigenbetrieb auf den Werkausschuß übertragen werden.<br />
(5) 1 Die Art. 53, 54, 59, 61 bis 64, 65 Abs. 1, Art. 66, 67, 69, 82 Abs. 4 und<br />
Art. 83 gelten entsprechend. 2 Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften<br />
werden die Angelegenheiten des Eigenbetriebs durch eine Betriebssatzung<br />
geregelt.<br />
(6) 1 Der Bezirk kann Einrichtungen innerhalb der allgemeinen Verwaltung<br />
(Regiebetriebe) ganz oder teilweise nach den Vorschriften über die<br />
Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe führen, wenn die Abweichung von<br />
den allgemeinen kommunalwirtschaftlichen Vorschriften nach Art und<br />
Umfang der Einrichtung zweckmäßig ist. 2 Hierbei können auch<br />
Regelungen getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetriebe<br />
geltenden Vorschriften abweichen.<br />
Bay BezO Art. 75 Selbständige Kommunalunternehmen des<br />
öffentlichen Rechts<br />
(1) 1 Der Bezirk kann selbständige Unternehmen in der Rechtsform einer<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) errichten oder<br />
bestehende Regie- oder Eigenbetriebe im Weg der Gesamtrechtsnachfolge<br />
in Kommunalunternehmen umwandeln. 2 Das Kommunalunternehmen<br />
kann sich nach Maßgabe der Unternehmenssatzung und in entsprechender<br />
Anwendung der für den Bezirk geltenden Vorschriften an anderen<br />
Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient.<br />
(2) 1 Der Bezirk kann dem Kommunalunternehmen einzelne oder alle mit<br />
einem bestimmten Zweck zusammenhängende Aufgaben ganz oder<br />
teilweise übertragen. 2 Er kann ihm auch das Recht einräumen, an seiner<br />
Stelle Satzungen und, soweit <strong>Landesrecht</strong> zu deren Erlaß ermächtigt, auch<br />
Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen; Art. 19<br />
gilt sinngemäß.<br />
(2a) 1 Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem<br />
ausschließlich der Bezirk beteiligt ist, kann durch Formwechsel in ein<br />
Kommunalunternehmen umgewandelt werden. 2 Die Umwandlung ist nur<br />
zulässig, wenn keine Sonderrechte im Sinn des § 23 des<br />
Umwandlungsgesetzes (UmwG) und keine Rechte Dritter an den Anteilen<br />
des Bezirks bestehen. 3 Der Formwechsel setzt den Erlass der<br />
Unternehmenssatzung durch den Bezirk und einen sich darauf<br />
beziehenden Umwandlungsbeschluss der formwechselnden Gesellschaft<br />
voraus. 4 Die §§ 193 bis 195, 197 bis 199, 200 Abs. 1 und § 201 UmwG<br />
sind entsprechend anzuwenden. 5 Die Anmeldung zum Handelsregister<br />
entsprechend § 198 UmwG erfolgt durch das vertretungsberechtigte<br />
Organ der Kapitalgesellschaft. 6 Abweichend von Abs. 3 Satz 4 wird die<br />
Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Kommunalunternehmen mit<br />
dessen Eintragung oder, wenn es nicht eingetragen wird, mit der<br />
Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister wirksam; § 202 Abs. 1<br />
und Abs. 3 UmwG ist entsprechend anzuwenden. 7 Ist bei der<br />
Kapitalgesellschaft ein Betriebsrat eingerichtet, bleibt dieser nach dem<br />
Wirksamwerden der Umwandlung als Personalrat des<br />
Kommunalunternehmens bis zu den nächsten regelmäßigen<br />
Personalratswahlen bestehen.
(3) 1 Der Bezirk regelt die Rechtsverhältnisse des Kommunalunternehmens<br />
durch eine Unternehmenssatzung. 2 Die Unternehmenssatzung muß<br />
Bestimmungen über den Namen und die Aufgaben des Unternehmens, die<br />
Anzahl der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats und die<br />
Höhe des Stammkapitals enthalten. 3 Der Bezirk hat die<br />
Unternehmenssatzung und deren Änderungen gemäß Art. 19 Abs. 2<br />
bekanntzumachen. 4 Das Kommunalunternehmen entsteht am Tag nach<br />
der Bekanntmachung, wenn nicht in der Unternehmenssatzung ein<br />
späterer Zeitpunkt bestimmt ist.<br />
(4) Der Bezirk haftet für die Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens<br />
unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus dessen Vermögen zu<br />
erlangen ist (Gewährträgerschaft).<br />
Bay BezO Art. 76 Organe des Kommunalunternehmens, Personal<br />
(1) 1 Das Kommunalunternehmen wird von einem Vorstand in eigener<br />
Verantwortung geleitet, soweit nicht gesetzlich oder durch die<br />
Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. 2 Der Vorstand vertritt<br />
das Kommunalunternehmen nach außen. 3 Der Bezirk hat darauf<br />
hinzuwirken, daß jedes Vorstandsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die<br />
ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9<br />
Buchst. a des Handelsgesetzbuchs dem Bezirk jährlich zur<br />
Veröffentlichung mitzuteilen.<br />
(2) 1 Die Geschäftsführung des Vorstands wird von einem Verwaltungsrat<br />
überwacht. 2 Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf höchstens fünf<br />
Jahre; eine erneute Bestellung ist zulässig. 3 Er entscheidet außerdem<br />
über<br />
1. den Erlaß von Satzungen und Verordnungen gemäß Art. 75 Abs. 2<br />
Satz 2,<br />
2. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,<br />
3. die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die<br />
Leistungsnehmer,<br />
4. die Beteiligung des Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen,<br />
5. die Bestellung des Abschlußprüfers,<br />
6. die Ergebnisverwendung.<br />
4<br />
Im Fall des Satzes 3 Nr. 1 unterliegen die Mitglieder des Verwaltungsrats<br />
den Weisungen des Bezirkstags. 5 Die Unternehmenssatzung kann<br />
vorsehen, daß der Bezirkstag den Mitgliedern des Verwaltungsrats auch in<br />
bestimmten anderen Fällen Weisungen erteilen kann. 6 Die Abstimmung<br />
entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit des Beschlusses des<br />
Verwaltungsrats nicht. 7 Für den Ausschluss wegen persönlicher<br />
Beteiligung gilt Art. 40 entsprechend.<br />
(3) 1 Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und den<br />
übrigen Mitgliedern. 2 Den Vorsitz führt der Bezirkstagspräsident; mit<br />
seiner Zustimmung kann der Bezirkstag eine andere Person zum<br />
vorsitzenden Mitglied bestellen. 3 Das vorsitzende Mitglied nach Satz 2<br />
Halbsatz 2 und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom<br />
Bezirkstag für fünf Jahre bestellt. 4 Die Amtszeit von Mitgliedern des<br />
Verwaltungsrats, die dem Bezirkstag angehören, endet mit dem Ende der<br />
Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Bezirkstag. 5 Die
Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der<br />
neuen Mitglieder weiter aus. 6 Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht<br />
sein:<br />
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte des<br />
Kommunalunternehmens,<br />
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen<br />
oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an<br />
denen das Kommunalunternehmen mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine<br />
Beteiligung am Stimmrecht genügt,<br />
3. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar<br />
mit Aufgaben der Aufsicht über das Kommunalunternehmen befaßt sind.<br />
(4) 1 Das Kommunalunternehmen hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu<br />
sein, wenn es auf Grund einer Aufgabenübertragung nach Art. 75 Abs. 2<br />
hoheitliche Befugnisse ausübt. 2 Wird es aufgelöst, hat der Bezirk die<br />
Beamten und Versorgungsempfänger zu übernehmen. 3 Wird das<br />
Unternehmensvermögen ganz oder teilweise auf andere juristische<br />
Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übertragen, so<br />
gelten für die Übernahme und die Rechtsstellung der Beamten und<br />
Versorgungsempfänger des Kommunalunternehmens Art. 51 bis 54 und<br />
69 des Bayerischen Beamtengesetzes, bei länderübergreifendem<br />
Vermögensübergang §§ 16 bis 19 des Beamtenstatusgesetzes.<br />
(5) 1 Beamten in einem Regie- oder Eigenbetrieb, der nach Art. 75 Abs. 1<br />
Satz 1 ganz oder teilweise in ein Kommunalunternehmen umgewandelt<br />
wird, kann im dienstlichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer<br />
Zustimmung eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit bei dem<br />
Kommunalunternehmen zugewiesen werden. 2 Die Zuweisung bedarf nicht<br />
der Zustimmung des Beamten, wenn dringende öffentliche Interessen sie<br />
erfordern. 3 Die Rechtsstellung des Beamten bleibt unberührt. 4 Über die<br />
Zuweisung entscheidet die oberste Dienstbehörde.<br />
Bay BezO Art. 77 Sonstige Vorschriften für Kommunalunternehmen<br />
(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht werden nach den für große<br />
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs<br />
aufgestellt und geprüft, sofern nicht weitergehende gesetzliche<br />
Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.<br />
(2) Die Organe der Rechnungsprüfung des Bezirks haben das Recht, sich zur<br />
Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach Art. 88 Abs. 4 Sätze 2 und 3<br />
auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb,<br />
die Bücher und Schriften des Kommunalunternehmens einzusehen.<br />
(3) Die Art. 3 Abs. 2, Art. 53, 54, 61, 62, 66, 67, 69 und 83 und die<br />
Vorschriften des Vierten Teils über die staatliche Aufsicht und die<br />
Rechtsmittel sind sinngemäß anzuwenden.<br />
(4) Das Unternehmen ist zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in<br />
demselben Umfang berechtigt wie der Bezirk, wenn es auf Grund einer<br />
Aufgabenübertragung nach Art. 75 Abs. 2 hoheitliche Befugnisse ausübt<br />
und bei der Aufgabenübertragung nichts Abweichendes geregelt wird.
Bay BezO Art. 78 Unternehmen in Privatrechtsform<br />
(1) 1 Unternehmen des Bezirks in Privatrechtsform und Beteiligungen des<br />
Bezirks an Unternehmen in Privatrechtsform sind nur zulässig, wenn<br />
1. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sichergestellt ist, daß das<br />
Unternehmen den öffentlichen Zweck gemäß Art. 73 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1<br />
erfüllt,<br />
2. der Bezirk angemessenen Einfluß im Aufsichtsrat oder in einem<br />
entsprechenden Gremium erhält,<br />
3. die Haftung des Bezirks auf einen bestimmten, seiner<br />
Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird; die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde kann von der Haftungsbegrenzung befreien.<br />
2<br />
Zur Sicherstellung des öffentlichen Zwecks von Gesellschaften mit<br />
beschränkter Haftung soll im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung<br />
bestimmt werden, daß die Gesellschafterversammlung auch über den<br />
Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen und<br />
über den Abschluß und die Änderung von Unternehmensverträgen<br />
beschließt. 3 In der Satzung von Aktiengesellschaften soll bestimmt<br />
werden, daß zum Erwerb und zur Veräußerung von Unternehmen und<br />
Beteiligungen die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig ist.<br />
(2) Der Bezirk darf dem Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen durch<br />
Unternehmen in Privatrechtsform, an denen er unmittelbar oder mittelbar<br />
beteiligt ist, nur unter entsprechender Anwendung der für ihn selbst<br />
geltenden Vorschriften zustimmen.<br />
Bay BezO Art. 79 Vertretung des Bezirks in Unternehmen in<br />
Privatrechtsform<br />
(1) 1 Der Bezirkstagspräsident vertritt den Bezirk in der<br />
Gesellschafterversammlung oder einem entsprechenden Organ. 2 Mit<br />
Zustimmung des Bezirkstagspräsidenten und seines gewählten<br />
Stellvertreters kann der Bezirkstag eine andere Person zur Vertretung<br />
widerruflich bestellen.<br />
(2) 1 Der Bezirk soll bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder der<br />
Satzung darauf hinwirken, daß ihm das Recht eingeräumt wird, Mitglieder<br />
in einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu entsenden,<br />
soweit das zur Sicherung eines angemessenen Einflusses notwendig ist.<br />
2<br />
Vorbehaltlich entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften haben<br />
Personen, die vom Bezirk entsandt oder auf seine Veranlassung gewählt<br />
worden sind, den Bezirk über alle wichtigen Angelegenheiten möglichst<br />
frühzeitig zu unterrichten und ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen.<br />
3<br />
Soweit zulässig, soll sich der Bezirk ihnen gegenüber Weisungsrechte im<br />
Gesellschaftsvertrag oder der Satzung vorbehalten.<br />
(3) 1 Wird die Person, die den Bezirk vertritt oder werden die in Absatz 2<br />
genannten Personen aus ihrer Tätigkeit haftbar gemacht, stellt der Bezirk<br />
sie von der Haftung frei. 2 Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann der<br />
Bezirk Rückgriff nehmen, es sei denn, das schädigende Verhalten beruhte<br />
auf seiner Weisung. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Personen,<br />
die auf Veranlassung des Bezirks als nebenamtliche Mitglieder des<br />
geschäftsführenden Unternehmensorgans bestellt sind.
Bay BezO Art. 80 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in<br />
Privatrechtsform<br />
(1) 1 Gehören dem Bezirk Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 des<br />
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) bezeichneten Umfang, so hat er<br />
1. darauf hinzuwirken, daß in sinngemäßer Anwendung der für<br />
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein<br />
Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige<br />
Finanzplanung zugrundegelegt wird,<br />
2. dafür Sorge zu tragen, daß der Jahresabschluß und der Lagebericht<br />
nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des<br />
Handelsgesetzbuchs aufgestellt und geprüft werden, sofern nicht<br />
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche<br />
Vorschriften entgegenstehen,<br />
3. die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG auszuüben,<br />
4. darauf hinzuwirken, daß ihm und dem Bayerischen Kommunalen<br />
Prüfungsverband die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt<br />
werden,<br />
5. darauf hinzuwirken, daß jedes Mitglied des geschäftsführenden<br />
Unternehmensorgans vertraglich verpflichtet wird, die ihm im<br />
Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9<br />
Buchst. a des Handelsgesetzbuchs dem Bezirk jährlich zur<br />
Veröffentlichung entsprechend Absatz 3 Satz 2 mitzuteilen.<br />
2<br />
Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.<br />
(2) 1 Ist eine Beteiligung des Bezirks an einem Unternehmen keine<br />
Mehrheitsbeteiligung im Sinn des § 53 HGrG, so soll der Bezirk, soweit<br />
sein Interesse das erfordert, darauf hinwirken, daß in der Satzung oder im<br />
Gesellschaftsvertrag dem Bezirk die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG und<br />
dem Bezirk und dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband die<br />
Befugnisse nach § 54 HGrG eingeräumt werden. 2 Bei mittelbaren<br />
Beteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der<br />
Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der der Bezirk allein<br />
oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften oder deren<br />
Zusammenschlüssen mit Mehrheit im Sinn des § 53 HGrG beteiligt ist.<br />
(3) 1 Der Bezirk hat jährlich einen Bericht über seine Beteiligungen an<br />
Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihm<br />
mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört.<br />
2<br />
Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des<br />
öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung<br />
der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des<br />
geschäftsführenden Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5, die<br />
Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. 3 Haben die Mitglieder des<br />
geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis mit der<br />
Veröffentlichung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, sind ihre Gesamtbezüge<br />
so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften<br />
des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluß<br />
aufgenommen werden. 4 Der Bericht ist dem Bezirkstag vorzulegen. 5 Der<br />
Bezirk weist ortsüblich darauf hin, daß jeder Einsicht in den Bericht<br />
nehmen kann.
Bay BezO Art. 81 Grundsätze für die Führung von Unternehmen des<br />
Bezirks<br />
(1) 1 Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen sind unter Beachtung<br />
betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit so zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt wird.<br />
2<br />
Entsprechendes gilt für die Steuerung und Überwachung von<br />
Unternehmen in Privatrechtsform, an denen der Bezirk mit mehr als<br />
50 v. H. beteiligt ist; bei einer geringeren Beteiligung soll der Bezirk<br />
darauf hinwirken.<br />
(2) Unternehmen des Bezirks dürfen keine wesentliche Schädigung und keine<br />
Aufsaugung selbständiger Betriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel,<br />
Gewerbe und Industrie bewirken.<br />
Bay BezO Art. 81 a Anzeigepflichten<br />
(1) 1 Entscheidungen des Bezirks über<br />
1. die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung sowie die<br />
Änderung der Rechtsform oder der Aufgaben von Unternehmen des<br />
Bezirks,<br />
2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des Bezirks an<br />
Unternehmen,<br />
3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung von Unternehmen oder<br />
Beteiligungen des Bezirks,<br />
4. die Auflösung von Kommunalunternehmen<br />
sind der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig, mindestens aber sechs<br />
Wochen vor ihrem Vollzug, vorzulegen. 2 In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2<br />
und 3 besteht keine Anzeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als<br />
den zwanzigsten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft. 3 Aus der<br />
Vorlage muß zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt<br />
sind. 4 Die Unternehmenssatzung von Kommunalunternehmen ist der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde stets vorzulegen.<br />
(2) Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 und die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für<br />
Entscheidungen des Verwaltungsrats eines Kommunalunternehmens.<br />
5. ABSCHNITT Kassen- und Rechnungswesen<br />
Bay BezO Art. 82 Kassengeschäfte des Bezirks<br />
(1) 1 Die Kassengeschäfte des Bezirks führt die Staatsoberkasse unentgeltlich<br />
nach den Weisungen des Bezirks, in den Fällen des Art. 35 b nach den<br />
Weisungen der Regierung. 2 Die Staatsoberkasse unterliegt auch insoweit<br />
der staatlichen Kassenaufsicht. 3 Sonderkassen der Einrichtungen und<br />
rechtsfähigen Stiftungen sind zulässig. 4 Der Bezirk muß eine Sonderkasse<br />
errichten, wenn und soweit die Rechnung nach den Regeln der<br />
kaufmännischen doppelten Buchführung gelegt wird.<br />
(2) 1 Abweichend von Absatz 1 kann der Bezirk Kassengeschäfte selbst<br />
erledigen und eine Bezirkskasse errichten. 2 Die Entscheidung, eine<br />
Bezirkskasse zu errichten, ist rechtzeitig der Staatsoberkasse mitzuteilen.<br />
3<br />
Der Bezirk und die Staatsoberkasse vereinbaren die Einzelheiten des<br />
Übergangs der Kassengeschäfte.
(3) Wird eine Bezirkskasse errichtet, so gilt folgendes:<br />
1. Die Bezirkskasse erledigt alle Kassengeschäfte des Bezirks. Die<br />
Buchführung kann von den übrigen Kassengeschäften abgetrennt werden.<br />
2. Der Bezirk hat einen Kassenverwalter und einen Stellvertreter zu<br />
bestellen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn der Bezirk seine<br />
Kassengeschäfte durch eine Stelle außerhalb der Bezirksverwaltung<br />
besorgen läßt. Die Anordnungsbefugten, der Leiter und die Prüfer des<br />
Rechnungsprüfungsamts können nicht gleichzeitig die Aufgaben eines<br />
Kassenverwalters oder seines Stellvertreters wahrnehmen.<br />
3. Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen weder miteinander<br />
noch mit den Anordnungsbefugten, dem Leiter und den Prüfern des<br />
Rechnungsprüfungsamts durch ein Angehörigenverhältnis im Sinn des<br />
Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes verbunden<br />
sein.<br />
(4) 1 Sonderkassen sollen mit der Bezirkskasse verbunden werden. 2 Ist eine<br />
Sonderkasse nicht mit der Bezirkskasse verbunden, gelten für den<br />
Verwalter der Sonderkasse und dessen Stellvertreter Absatz 3 Nrn. 2 und<br />
3 entsprechend.<br />
Bay BezO Art. 83 Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften<br />
Der Bezirk kann das Ermitteln von Ansprüchen und von<br />
Zahlungsverpflichtungen, das Vorbereiten der entsprechenden<br />
Kassenanordnungen, die Kassengeschäfte und das Rechnungswesen ganz oder<br />
zum Teil von einer Stelle außerhalb der Bezirksverwaltung besorgen lassen,<br />
wenn die ordnungsgemäße und sichere Erledigung und die Prüfung nach den<br />
für den Bezirk geltenden Vorschriften gewährleistet sind.<br />
Bay BezO Art. 84 Rechnungslegung, Jahresabschluss<br />
(1) 1 Im Jahresabschluss beziehungsweise in der Jahresrechnung ist das<br />
Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des <strong>Stand</strong>s des Vermögens<br />
und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres<br />
nachzuweisen. 2 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
doppelten kommunalen Buchführung besteht der Jahresabschluss aus der<br />
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz)<br />
und dem Anhang. 3 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
Kameralistik besteht die Jahresrechnung aus dem kassenmäßigen<br />
Abschluss und der Haushaltsrechnung. 4 Der Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht<br />
zu erläutern.<br />
(2) Der Jahresabschluss beziehungsweise die Jahresrechnung ist innerhalb<br />
von sechs Monaten, der konsolidierte Jahresabschluss (Art. 84 a)<br />
innerhalb von zehn Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres<br />
aufzustellen und sodann dem Kreisausschuss vorzulegen.<br />
(3) 1 Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der<br />
Jahresabschlüsse (Art. 85) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt<br />
der Bezirkstag alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das<br />
Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres den Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und<br />
beschließt über die Entlastung. 2 Ist ein konsolidierter Jahresabschluss
aufzustellen (Art. 84 a), tritt an die Stelle des 30. Juni der 31. Dezember<br />
des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres. 3 Verweigert<br />
der Bezirkstag die Entlastung oder spricht er sie mit Einschränkungen aus,<br />
hat er die dafür maßgebenden Gründe anzugeben.<br />
(4) Die Bezirksräte können jederzeit die Berichte über die Prüfungen<br />
einsehen.<br />
Bay BezO Art. 84 a Konsolidierter Jahresabschluss<br />
(1) Mit dem Jahresabschluss des Bezirks sind die Jahresabschlüsse<br />
1. der außerhalb der allgemeinen Verwaltung geführten Sondervermögen<br />
ohne eigene Rechtspersönlichkeit,<br />
2. der rechtlich selbstständigen Organisationseinheiten und<br />
Vermögensmassen mit Nennkapital oder variablen Kapitalanteilen,<br />
3. der Zweckverbände mit kaufmännischer Rechnungslegung und der<br />
gemeinsamen Kommunalunternehmen und<br />
4. der von dem Landkreis verwalteten kommunalen Stiftungen mit<br />
kaufmännischem Rechnungswesen<br />
zu konsolidieren.<br />
(2) 1 Aufgabenträger nach Abs. 1 sind entsprechend den §§ 300 bis 309 des<br />
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren (Vollkonsolidierung), wenn bei dem<br />
Bezirk die dem § 290 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs<br />
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. 2 Andere Aufgabenträger als<br />
nach Satz 1 sind entsprechend den §§ 311 und 312 des<br />
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren, es sei denn, sie sind für die<br />
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes<br />
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung.<br />
3<br />
Aufgabenträger nach Abs. 1 Nr. 3 können auch entsprechend § 310 des<br />
Handelsgesetzbuchs anteilsmäßig konsolidiert werden. 4 Für den Anteil an<br />
einem Zweckverband ist der Umlageschlüssel maßgebend.<br />
(3) Der konsolidierte Jahresabschluss ist durch eine Kapitalflussrechnung zu<br />
ergänzen und durch einen Konsolidierungsbericht zu erläutern.<br />
(4) Der Bezirk hat bei den in Abs. 1 genannten Aufgabenträgern,<br />
Organisationseinheiten und Vermögensmassen darauf hinzuwirken, dass<br />
ihm das Recht eingeräumt wird, von diesen alle Informationen und<br />
Unterlagen zu erhalten, die er für die Konsolidierung der Jahresabschlüsse<br />
für erforderlich hält.<br />
6. ABSCHNITT Prüfungswesen<br />
Bay BezO Art. 85 Örtliche Prüfungen<br />
(1) 1 Der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung sowie die Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen werden von einem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft<br />
(örtliche Rechnungsprüfung). 2 Über die Beratungen sind Niederschriften<br />
aufzunehmen.<br />
(2) Der Bezirkstag bildet aus seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuß<br />
mit mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern und bestimmt ein
Ausschußmitglied zum Vorsitzenden; Art. 28 Abs. 2 findet keine<br />
Anwendung.<br />
(3) 1 Zur Prüfung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten<br />
Jahresabschlusses sowie der Jahresrechnung können Sachverständige<br />
zugezogen werden. 2 Das Rechnungsprüfungsamt ist umfassend als<br />
Sachverständiger heranzuziehen.<br />
(4) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse ist<br />
innerhalb von zwölf Monaten, die des konsolidierten Jahresabschlusses<br />
innerhalb von 18 Monaten nach Abschluß des Haushaltsjahres<br />
durchzuführen.<br />
(5) 1 Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem Bezirkstagspräsidenten. 2 Er<br />
bedient sich des Rechnungsprüfungsamts.<br />
Bay BezO Art. 86 Rechnungsprüfungsamt<br />
(1) Bezirke müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrichten.<br />
(2) 1 Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der örtlichen Rechnungsprüfung dem<br />
Bezirkstag und bei den örtlichen Kassenprüfungen dem<br />
Bezirkstagspräsidenten unmittelbar verantwortlich. 2 Der Bezirkstag und<br />
der Bezirkstagspräsident können besondere Aufträge zur Prüfung der<br />
Verwaltung erteilen. 3 Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der<br />
Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz<br />
unterworfen. 4 Im übrigen bleiben die Befugnisse des<br />
Bezirkstagspräsidenten unberührt, dem das Rechnungsprüfungsamt<br />
unmittelbar untersteht.<br />
(3) 1 Der Bezirkstag bestellt den Leiter, seinen Stellvertreter und die Prüfer<br />
des Rechnungsprüfungsamts und beruft sie ab. 2 Der Bezirkstag kann den<br />
Leiter des Rechnungsprüfungsamts und seinen Stellvertreter gegen ihren<br />
Willen nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der<br />
Mitglieder des Bezirkstags abberufen, wenn sie ihre Aufgabe nicht<br />
ordnungsgemäß erfüllen. 3 Die Abberufung von Prüfern des<br />
Rechnungsprüfungsamts gegen ihren Willen bedarf einer Mehrheit von<br />
zwei Dritteln der stimmberechtigten Bezirksräte.<br />
(4) 1 Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts muß Beamter auf Lebenszeit<br />
sein. 2 Er muß mindestens die Befähigung für den gehobenen<br />
nichttechnischen Verwaltungsdienst und die für sein Amt erforderliche<br />
Erfahrung und Eignung besitzen.<br />
(5) 1 Der Leiter, sein Stellvertreter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts<br />
dürfen eine andere Stellung in dem Bezirk nur innehaben, wenn das mit<br />
ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 2 Sie dürfen Zahlungen für den<br />
Bezirk weder anordnen noch ausführen. 3 Für den Leiter des<br />
Rechnungsprüfungsamts und seinen Stellvertreter gilt außerdem Art. 82<br />
Abs. 3 Nr. 3 entsprechend.<br />
Bay BezO Art. 87 Überörtliche Prüfungen<br />
(1) 1 Die überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfungen werden vom<br />
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (überörtliches Prüfungsorgan)<br />
durchgeführt. 2 Die überörtlichen Kassenprüfungen erstrecken sich nicht<br />
auf die von der Staatsoberkasse zu erledigenden Kassengeschäfte.
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung findet alsbald nach der Feststellung<br />
des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses<br />
beziehungsweise der Jahresrechnung sowie der Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen statt.<br />
Bay BezO Art. 88 Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfung<br />
(1) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die<br />
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere<br />
darauf, ob<br />
1. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten worden sind,<br />
2. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen<br />
beziehungsweise die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind<br />
sowie der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung sowie die Vermögensnachweise<br />
ordnungsgemäß aufgestellt sind,<br />
3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,<br />
4. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf<br />
andere Weise wirksamer erfüllt werden können.<br />
(2) 1 Die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser einschließlich der<br />
Jahresabschlüsse unterliegen der Rechnungsprüfung. 2 Absatz 1 gilt<br />
entsprechend.<br />
(3) 1 Die Rechnungsprüfung umfaßt auch die Wirtschaftsführung der<br />
Eigenbetriebe unter entsprechender Anwendung des Absatzes 1. 2 Dabei<br />
ist auf das Ergebnis der Abschlußprüfung (Art. 89) mit abzustellen.<br />
(4) 1 Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird die Betätigung des Bezirks bei<br />
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der<br />
Bezirk unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung<br />
kaufmännischer Grundsätze mitgeprüft. 2 Entsprechendes gilt bei Erwerbsund<br />
Wirtschaftsgenossenschaften, in denen der Bezirk Mitglied ist, sowie<br />
bei Kommunalunternehmen. 3 Die Rechnungsprüfung umfaßt ferner die<br />
Buch-, Betriebs- und sonstigen Prüfungen, die sich der Bezirk bei der<br />
Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat.<br />
(5) Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsmäßige Erledigung der<br />
Kassengeschäfte, die ordnungsmäßige Einrichtung der Kassen und das<br />
Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft.<br />
(6) 1 Die Organe der Rechnungsprüfung des Bezirks und das überörtliche<br />
Prüfungsorgan können verlangen, dass ihnen oder ihren beauftragten<br />
Prüfern Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben für erforderlich<br />
halten, vorgelegt oder innerhalb einer bestimmten Frist übersandt werden.<br />
2 3<br />
Auskünfte sind ihnen oder ihren beauftragten Prüfern zu erteilen. Die<br />
Auskunftspflicht nach den Sätzen 1 und 2 besteht auch, soweit hierfür in<br />
anderen Bestimmungen eine besondere Rechtsvorschrift gefordert wird,<br />
und umfasst auch elektronisch gespeicherte Daten sowie deren<br />
automatisierten Abruf.
Bay BezO Art. 89 Abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und<br />
Kommunalunternehmen<br />
(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht eines Eigenbetriebs und eines<br />
Kommunalunternehmens sollen spätestens innerhalb von neun Monaten<br />
nach Schluß des Wirtschaftsjahres durch einen sachverständigen Prüfer<br />
(Abschlußprüfer) geprüft sein.<br />
(2) Die Abschlußprüfung wird vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband<br />
oder von einem Wirtschaftsprüfer oder von einer<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt.<br />
(3) 1 Die Abschlußprüfung erstreckt sich auf die Vollständigkeit und<br />
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der<br />
Buchführung und des Lageberichts. 2 Dabei werden auch geprüft<br />
1. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,<br />
2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität<br />
und Rentabilität,<br />
3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn<br />
diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von<br />
Bedeutung waren,<br />
4. die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen<br />
Jahresfehlbetrags.<br />
VIERTER TEIL Staatliche Aufsicht und Rechtsmittel<br />
1. ABSCHNITT Rechtsaufsicht und Fachaufsicht<br />
Bay BezO Art. 90 Sinn der staatlichen Aufsicht<br />
Die Aufsichtsbehörden sollen die Bezirke bei der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
verständnisvoll beraten, fördern und schützen sowie die Entschlußkraft und die<br />
Selbstverantwortung der Bezirksorgane stärken.<br />
Bay BezO Art. 91 Inhalt und Grenzen der Aufsicht<br />
(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Art. 5) beschränkt<br />
sich die staatliche Aufsicht darauf, die Erfüllung der gesetzlich<br />
festgelegten und übernommenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben und<br />
Verpflichtungen der Bezirke und die Gesetzmäßigkeit ihrer<br />
Verwaltungstätigkeit zu überwachen (Rechtsaufsicht).<br />
(2) 1 In den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises (Art. 6)<br />
erstreckt sich die staatliche Aufsicht auch auf die Handhabung des<br />
Verwaltungsermessens der Bezirke (Fachaufsicht). 2 Eingriffe in das<br />
Verwaltungsermessen sind auf die Fälle zu beschränken, in denen<br />
1. das Gemeinwohl oder öffentlich-rechtliche Ansprüche einzelner eine<br />
Weisung oder Entscheidung erfordern oder<br />
2. die Bundesregierung nach Art. 84 Abs. 5 oder Art. 85 Abs. 3 des<br />
Grundgesetzes eine Weisung erteilt.<br />
Bay BezO Art. 92 Rechtsaufsichtsbehörde<br />
Die Rechtsaufsicht über die Bezirke obliegt dem Staatsministerium des Innern.
Bay BezO Art. 93 Informationsrecht der Rechtsaufsichtsbehörde<br />
1 Die Rechtsaufsichtsbehörde ist befugt, sich jederzeit über alle<br />
Angelegenheiten des Bezirks zu unterrichten. 2 Sie kann insbesondere<br />
Anstalten und Einrichtungen des Bezirks besichtigen, die Geschäfts- und<br />
Kassenführung prüfen sowie Berichte und Akten einfordern.<br />
Bay BezO Art. 94 Beanstandungsrecht<br />
1 Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechtswidrige Beschlüsse und Verfügungen<br />
des Bezirks beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung verlangen. 2 Bei<br />
Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben oder Verpflichtungen kann die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde den Bezirk zur Durchführung der notwendigen<br />
Maßnahmen auffordern.<br />
Bay BezO Art. 95 Recht der Ersatzvornahme<br />
1 Kommt der Bezirk binnen einer ihm gesetzten angemessenen Frist den<br />
Anordnungen der Rechtsaufsichtsbehörde nicht nach, so kann diese die<br />
notwendigen Maßnahmen an Stelle des Bezirks verfügen und vollziehen. 2 Die<br />
Kosten trägt der Bezirk.<br />
Bay BezO Art. 96 Bestellung eines Beauftragten<br />
(1) Ist der geordnete Gang der Verwaltung durch Beschlußunfähigkeit des<br />
Bezirkstags oder durch seine Weigerung, gesetzmäßige Anordnungen der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde auszuführen, ernstlich behindert, so kann die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde den Bezirkstagspräsidenten ermächtigen, bis zur<br />
Behebung des gesetzwidrigen Zustands für den Bezirk zu handeln.<br />
(2) 1 Weigert sich der Bezirkstagspräsident oder ist er aus tatsächlichen oder<br />
rechtlichen Gründen verhindert, die Aufgaben nach Absatz 1<br />
wahrzunehmen, so beauftragt die Rechtsaufsichtsbehörde den gewählten<br />
Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten, für den Bezirk zu handeln,<br />
solange es erforderlich ist. 2 Ist kein gewählter Stellvertreter des<br />
Bezirkstagspräsidenten vorhanden oder ist auch er verhindert oder nicht<br />
handlungswillig, so handelt die Rechtsaufsichtsbehörde für den Bezirk; sie<br />
kann die Regierung damit beauftragen.<br />
(3) Die Staatsregierung kann ferner, wenn sich der gesetzwidrige Zustand<br />
anders nicht beheben lässt, den Bezirkstag auflösen und dessen Neuwahl<br />
anordnen.<br />
Bay BezO Art. 97 Fachaufsichtsbehörde<br />
1 Die Zuständigkeit zur Führung der Fachaufsicht auf den einzelnen Gebieten<br />
des übertragenen Wirkungskreises bestimmt sich nach den hierfür geltenden<br />
besonderen Vorschriften. 2 Soweit solche besonderen Vorschriften nicht<br />
bestehen, obliegt den Rechtsaufsichtsbehörden auch die Führung der<br />
Fachaufsicht.<br />
Bay BezO Art. 98 Befugnisse der Fachaufsicht<br />
(1) 1 Die Fachaufsichtsbehörden können sich über Angelegenheiten des<br />
übertragenen Wirkungskreises in gleicher Weise wie die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde unterrichten (Art. 93). 2 Sie können ferner dem
Bezirk für die Behandlung übertragener Angelegenheiten unter Beachtung<br />
des Art. 91 Abs. 2 Satz 2 Weisungen erteilen. 3 Zu weitergehenden<br />
Eingriffen in die Bezirksverwaltung sind die Fachaufsichtsbehörden nicht<br />
befugt.<br />
(2) 1 Die Rechtsaufsichtsbehörde ist verpflichtet, die Fachaufsichtsbehörden<br />
bei der Durchführung ihrer gesetzlichen Aufgaben nötigenfalls unter<br />
Anwendung der in den Art. 95 und 96 festgelegten Befugnisse zu<br />
unterstützen. 2 Bei der Ersatzvornahme tritt die Weisung der<br />
Fachaufsichtsbehörde an die Stelle der Anordnung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde.<br />
Bay BezO Art. 99 Genehmigungsbehörde<br />
(1) Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Genehmigungen erteilt, soweit<br />
nichts anderes bestimmt ist, die Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 92).<br />
(2) Genehmigungspflichtige Beschlüsse sowie genehmigungspflichtige<br />
Geschäfte des bürgerlichen Rechts erlangen Rechtswirksamkeit erst mit<br />
der Erteilung der nach diesem Gesetz erforderlichen Genehmigung.<br />
Bay BezO Art. 99 a Ausnahmegenehmigungen<br />
1 Das Staatsministerium des Innern kann im Interesse der Weiterentwicklung<br />
der kommunalen Selbstverwaltung zur Erprobung neuer Modelle der Steuerung<br />
und des Haushalts- und Rechnungswesens, der Verfahrensvereinfachung und<br />
der Verwaltungsführung auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen von Regelungen<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s und der nach Art. 103 erlassenen Vorschriften genehmigen.<br />
2 Die Genehmigung ist zu befristen. 3 Bedingungen und Auflagen sind<br />
insbesondere zulässig, um die Vergleichbarkeit des Kommunalrechtsvollzugs<br />
auch im Rahmen einer Erprobung möglichst zu wahren und die Ergebnisse der<br />
Erprobung für Gemeinden, für Landkreise und für andere Bezirke nutzbar zu<br />
machen.<br />
2. ABSCHNITT Rechtsmittel<br />
Bay BezO Art. 100 Erlaß des Widerspruchsbescheids (§ 73 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung)<br />
Den Widerspruchsbescheid erläßt in Angelegenheiten des eigenen und des<br />
übertragenen Wirkungskreises der Bezirk.<br />
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay BezO Artikel 101 (weggefallen)<br />
Bay BezO Art. 102 Inkrafttreten<br />
(1) Art. 101 dieses <strong>Gesetze</strong>s tritt am 1. Juni 1953, die übrigen Bestimmungen<br />
treten am 1. Dezember 1954 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ursprünglichen Fassung vom 27. Juli 1953 (GVBl S. 107). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der<br />
späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(2) gegenstandslos
Bay BezO Art. 103 Ausführungsvorschriften<br />
(1) 1 Das Staatsministerium des Innern erläßt die zum Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
erforderlichen Ausführungsvorschriften. 2 Es wird insbesondere ermächtigt,<br />
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch<br />
Rechtsverordnungen zu regeln:<br />
1. den Inhalt und die Gestaltung des Haushaltsplans einschließlich des<br />
Stellenplans, der mittelfristigen Finanzplanung und des<br />
Investitionsprogramms, ferner die Veranschlagung von Einzahlungen,<br />
Auszahlungen, Erträgen und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen,<br />
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einen vom Haushaltsjahr<br />
abweichenden Wirtschaftszeitraum,<br />
2. die Ausführung des Haushaltsplans, die Anordnung von Zahlungen, die<br />
Haushaltsüberwachung, die Stundung, die Niederschlagung und den Erlaß<br />
von Ansprüchen und die Behandlung von Kleinbeträgen,<br />
3. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen und die Vergabe von<br />
Aufträgen,<br />
4. die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme und Verwendung von<br />
Rücklagen und deren Mindesthöhe,<br />
5. die Bildung und Auflösung von Rückstellungen,<br />
6. die Geldanlagen und ihre Sicherung,<br />
7. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und die Abschreibung der<br />
Vermögensgegenstände; dabei kann die Bewertung und Abschreibung auf<br />
einzelne Bereiche beschränkt werden,<br />
8. die Aufstellung der Eröffnungsbilanz auch unter Abweichung von Art. 66<br />
Abs. 3 und der folgenden Bilanzen,<br />
9. die Kassenanordnungen, die Aufgaben und die Organisation der Kassen,<br />
die vom Bezirk eingerichtet sind, den Zahlungsverkehr, die Verwaltung<br />
der Kassenmittel, der Wertgegenstände und anderer Gegenstände, die<br />
Buchführung sowie die Möglichkeit, daß die Buchführung und die<br />
Verwahrung von Wertgegenständen von den Kassengeschäften abgetrennt<br />
werden können,<br />
10. den Inhalt und die Gestaltung der Jahresrechnung und die Abwicklung<br />
der Vorjahresergebnisse,<br />
11. den Inhalt und die Gestaltung des Jahresabschlusses und des<br />
konsolidierten Jahresabschlusses; dabei können auch Ausnahmen von der<br />
und Übergangsfristen für die Konsolidierungspflicht vorgesehen werden,<br />
12. den Inhalt und die Gestaltung des Rechenschaftsberichts zur<br />
Jahresrechnung beziehungsweise zum Jahresabschluss, des Anhangs zum<br />
Jahresabschluss sowie des Konsolidierungsberichts zum konsolidierten<br />
Jahresabschluss,<br />
13. den Aufbau und die Verwaltung, die Wirtschaftsführung, das<br />
Rechnungswesen und die Prüfung der Eigenbetriebe,<br />
14. die Prüfung der Jahresrechnungen, der Jahresabschlüsse und der<br />
konsolidierten Jahresabschlüsse, die Prüfung der Kassen, die vom Bezirk<br />
eingerichtet sind, die Abschlußprüfung und die Freistellung von der<br />
Abschlußprüfung, die Prüfung von Verfahren der automatisierten<br />
Datenverarbeitung im Bereich des Finanzwesens der Bezirke, die Rechte<br />
und Pflichten der Prüfer, die über Prüfungen zu erstellenden Berichte und<br />
deren weitere Behandlung,<br />
15. das Verfahren bei der Errichtung der Kommunalunternehmen sowie
der Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Kommunalunternehmen und<br />
den Aufbau, die Verwaltung, die Wirtschaftsführung sowie das Rechnungsund<br />
Prüfungswesen der Kommunalunternehmen.<br />
3<br />
Das Staatsministerium des Innern wird weiter ermächtigt, im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,<br />
Familie, Frauen und Gesundheit und mit dem Staatsministerium der<br />
Finanzen die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser und der<br />
Pflegeeinrichtungen der Bezirke durch Rechtsverordnung zu regeln.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium des Innern erläßt die erforderlichen<br />
Verwaltungsvorschriften und gibt Muster, insbesondere für<br />
1. die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung,<br />
2. die Darstellung des Haushaltsplans und des mittelfristigen Finanzplans<br />
insbesondere<br />
a) die Konten und Produkte bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen<br />
der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
b) die Gliederung und die Gruppierung bei Haushaltswirtschaft nach den<br />
Grundsätzen der Kameralistik,<br />
3. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen, des mittelfristigen<br />
Finanzplans und des Investitionsprogramms,<br />
4. die Gliederung und die Form des Jahresabschlusses und des<br />
konsolidierten Jahresabschlusses,<br />
5. die Darstellung und die Form der Vermögensnachweise,<br />
6. die Kassenanordnungen, die Buchführung, die Jahresrechnung und ihre<br />
Anlagen,<br />
7. die Gliederung und die Form des Wirtschaftsplans und seiner Anlagen,<br />
des mittelfristigen Finanzplans und des Investitionsprogramms, des<br />
Jahresabschlusses, der Anlagenachweise und der Erfolgsübersicht für<br />
Eigenbetriebe und für Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen,<br />
im Allgemeinen Ministerialblatt bekannt. 2 Es kann solche Muster für<br />
verbindlich erklären. 3 Die Zuordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle zu<br />
den Darstellungen gemäß Satz 1 Nrn. 2 bis 5 kann durch<br />
Verwaltungsvorschrift in gleicher Weise verbindlich festgelegt werden.<br />
4<br />
Die Verwaltungsvorschriften zur Darstellung des Haushaltsplans und des<br />
mittelfristigen Finanzplans sind im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen zu erlassen.<br />
Bay BezO Art. 104 Einschränkung von Grundrechten<br />
Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s können die Grundrechte auf Freiheit der Person und<br />
der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2,<br />
Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 102 und 106 Abs. 3 der Verfassung).
<strong>Bayerisches</strong> Beamtengesetz (Bay BG)<br />
vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500), geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 348), vom<br />
8. Dezember 2009 (GVBl. S. 605) (FN BayRS 2030-1-1-F)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Teil 1 Allgemeine Bestimmungen<br />
Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen und Zuständigkeiten<br />
Abschnitt 2 Beschwerdeweg und Rechtsschutz<br />
Abschnitt 3 Leistungserfüllung<br />
Abschnitt 4 Verfahren bei Erlass allgemeiner beamtenrechtIicher Regelungen<br />
Teil 2 Beamtenverhältnis<br />
Abschnitt 1 Ernennungen<br />
Abschnitt 2 Begründung des Beamtenverhältnisses<br />
Abschnitt 3 Laufbahnen<br />
Abschnitt 4 Führungspositionen auf Zeit und auf Probe<br />
Abschnitt 5 Abordnung und Versetzung innerhalb des Geltungsbereichs dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s<br />
Abschnitt 6 Rechtsstellung der Beamten, Beamtinnen, Versorgungsempfänger<br />
und Versorgungsempfängerinnen bei Auflösung oder Umbildung von Behörden<br />
oder Körperschaften<br />
Teil 3 Beendigung des Beamtenverhältnisses<br />
Abschnitt 1 Entlassung<br />
Abschnitt 2 Verlust der Beamtenrechte<br />
Abschnitt 3 Ruhestand<br />
Abschnitt 4 Dienstzeugnis<br />
Teil 4 Rechtliche Stellung der Beamten und Beamtinnen<br />
Abschnitt 1 Allgemeines<br />
Abschnitt 2 Folgen der Nichterfüllung von Pflichten<br />
Abschnitt 3 Beschränkung der Vornahme von Amtshandlungen
Abschnitt 4 Erteilung von Auskünften<br />
Abschnitt 5 Nebentätigkeiten und Tätigkeiten von Ruhestandsbeamten und<br />
Ruhestandsbeamtinnen sowie früheren Beamten und Beamtinnen mit<br />
Versorgungsbezügen<br />
Abschnitt 6 Arbeitszeit, Teilzeit und Beurlaubung<br />
Abschnitt 7 Besondere Fürsorgepflichten<br />
Abschnitt 8 Personalakten<br />
Teil 5 Landespersonalausschuss<br />
Teil 6 Besondere Beamtengruppen<br />
Abschnitt 1 Beamte und Beamtinnen des Landtags<br />
Abschnitt 2 Beamtenverhältnis auf Zeit<br />
Abschnitt 3 Beamte und Beamtinnen der Polizei, der Justizvollzugsanstalten,<br />
des Landesamts für Verfassungsschutz, der Feuerwehren und Notariatsbeamte<br />
und Notariatsbeamtinnen<br />
Abschnitt 4 Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen<br />
Teil 7 Besondere Vorschriften für die unter der Aufsicht des Staates stehenden<br />
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts<br />
Teil 8 Dienstherrnwechsel<br />
Teil 9 Übergangsregelungen und Schlussvorschriften<br />
Bay BG Art. 1 Geltungsbereich<br />
(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes bestimmt, für die Beamten<br />
und Beamtinnen des Staates, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und<br />
der sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften,<br />
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.<br />
(2) Es gilt nicht für die Beamten und Beamtinnen der öffentlich-rechtlichen<br />
Religionsgesellschaften und ihrer Verbände.<br />
(3) Die Rechtsverhältnisse der kommunalen Wahlbeamten (Bürgermeister,<br />
Landräte und ihre gewählten Stellvertreter, Bezirkstagspräsidenten und<br />
ihre gewählten Stellvertreter sowie berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder)<br />
werden durch besonderes Gesetz geregelt.
Teil 1 Allgemeine Bestimmungen<br />
Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen und Zuständigkeiten<br />
Bay BG Art. 2 Oberste Dienstbehörde<br />
1 Oberste Dienstbehörde ist die oberste Behörde des Dienstherrn in dem<br />
Dienstbereich, in dem der Beamte oder die Beamtin ein Amt bekleidet. 2 Als<br />
oberste Dienstbehörde von Ruhestandsbeamten, Ruhestandsbeamtinnen,<br />
sonstigen Versorgungsberechtigten oder früheren Beamten und Beamtinnen<br />
gilt die Behörde, die zuletzt oberste Dienstbehörde der Beamten und<br />
Beamtinnen war.<br />
Bay BG Art. 3 Dienstvorgesetzte, Vorgesetzte<br />
1 Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für beamtenrechtliche Entscheidungen<br />
über die persönlichen Angelegenheiten der ihnen nachgeordneten Beamten<br />
und Beamtinnen zuständig sind. 2 Vorgesetzte sind diejenigen, die Beamten<br />
und Beamtinnen für ihre dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen können.<br />
Bay BG Art. 4 Angehörige<br />
Angehörige im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind die in Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) aufgeführten Personen.<br />
Bay BG Art. 5 Leistungen<br />
(1) Leistungen des Dienstherrn sind Besoldung, Versorgung und sonstige<br />
Leistungen.<br />
(2) Sonstige Leistungen sind Kostenerstattungen und Fürsorgeleistungen,<br />
soweit sie nicht zur Besoldung oder Versorgung gehören.<br />
Bay BG Art. 6 Zuständigkeiten nach dem Beamtenstatusgesetz<br />
(1) Ausnahmen von dem Erfordernis einer bestimmten Staatsangehörigkeit<br />
nach § 7 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) lässt bei<br />
Beamten und Beamtinnen des Staates die oberste Dienstbehörde, im<br />
Übrigen die oberste Aufsichtsbehörde zu.<br />
(2) Für Abordnungen und Versetzungen nach §§ 14 und 15 BeamtStG gelten<br />
Art. 49 Abs. 2 und 3 entsprechend.<br />
(3) 1 Die Genehmigung gemäß § 37 Abs. 3 BeamtStG, vor Gericht oder<br />
außergerichtlich auszusagen oder Erklärungen abzugeben, erteilt der oder<br />
die Dienstvorgesetzte oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, der<br />
oder die letzte Dienstvorgesetzte. 2 Hat sich der Vorgang, den die<br />
Äußerung betrifft, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, so darf die<br />
Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden. 3 Über die<br />
Versagung der Aussagegenehmigung nach § 37 Abs. 4 BeamtStG<br />
entscheidet die oberste Dienstbehörde; für die Beamten und Beamtinnen<br />
der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen unter der<br />
Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen<br />
des öffentlichen Rechts tritt an die Stelle der obersten Dienstbehörde die<br />
oberste Aufsichtsbehörde oder die von ihr durch Rechtsverordnung<br />
bestimmte Behörde. 4 Für Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen kann das
Staatsministerium des Innern die Ausübung der Befugnis nach Satz 1<br />
durch Rechtsverordnung auf unmittelbar nachgeordnete Behörden<br />
übertragen. 5 Zuständig für die Entscheidung über die Herausgabe von<br />
Unterlagen nach § 37 Abs. 6 BeamtStG ist der oder die Dienstvorgesetzte<br />
oder der oder die letzte Dienstvorgesetzte.<br />
(4) 1 Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde kann<br />
Beamten und Beamtinnen aus zwingenden dienstlichen Gründen die<br />
Führung der Dienstgeschäfte nach § 39 BeamtStG verbieten. 2 Der Beamte<br />
oder die Beamtin soll vor Erlass des Verbots gehört werden.<br />
(5) 1 Ausnahmen von dem Verbot der Annahme von Belohnungen,<br />
Geschenken und sonstigen Vorteilen nach § 42 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG<br />
bedürfen der Zustimmung der obersten oder der letzten obersten<br />
Dienstbehörde. 2 Die Befugnis zur Zustimmung kann auf andere Behörden<br />
übertragen werden.<br />
(6) Übermittlungen bei Strafverfahren nach § 49 BeamtStG sind an die jeweils<br />
zuständigen Dienstvorgesetzten oder ihre Vertreter im Amt zu richten und<br />
als “Vertrauliche Personalsache” zu kennzeichnen.<br />
Abschnitt 2 Beschwerdeweg und Rechtsschutz<br />
Bay BG Art. 7 Antrags- und Beschwerderecht<br />
(1) 1 Beamte und Beamtinnen können Anträge stellen und Beschwerden<br />
vorbringen; hierbei ist der Dienstweg einzuhalten. 2 Der Beschwerdeweg<br />
bis zur obersten Dienstbehörde steht offen.<br />
(2) Richten sich Beschwerden gegen unmittelbare Vorgesetzte (Art. 3 Satz 2),<br />
so können sie bei den nächsthöheren Vorgesetzten unmittelbar eingereicht<br />
werden.<br />
Bay BG Art. 8 Aufschiebende Wirkung<br />
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Abordnung oder Versetzung haben<br />
keine aufschiebende Wirkung.<br />
Bay BG Art. 9 Vertretung des Dienstherrn<br />
(1) Soweit durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung nichts anderes<br />
bestimmt ist, wird der Dienstherr bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis<br />
durch die oberste Dienstbehörde vertreten, welcher der Beamte oder die<br />
Beamtin untersteht oder bei Beendigung des Beamtenverhältnisses<br />
unterstanden hat; bei Streitigkeiten, die ihren Rechtsgrund in Art. 145<br />
oder den §§ 53 bis 59 und 61 des Beamtenversorgungsgesetzes<br />
(BeamtVG) haben, wird der Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde<br />
vertreten, deren sachlicher Weisung die Regelungsbehörde untersteht.<br />
(2) Besteht die oberste Dienstbehörde nicht mehr und ist eine andere<br />
Dienstbehörde nicht bestimmt, so tritt an ihre Stelle bei Beamten und<br />
Beamtinnen des Staates das Staatsministerium der Finanzen, im Übrigen<br />
die frühere oberste Aufsichtsbehörde.
(3) Die Staatsregierung kann für den staatlichen Bereich durch<br />
Rechtsverordnung die den obersten Dienstbehörden zustehende<br />
Vertretungsbefugnis anderen Behörden übertragen.<br />
Bay BG Art. 10 Zustellung von Entscheidungen<br />
1 Verfügungen und Entscheidungen, die den Beamten und Beamtinnen oder<br />
den Versorgungsberechtigten nach den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
bekanntzugeben sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf<br />
gesetzt wird oder Rechte der Beamten und Beamtinnen oder<br />
Versorgungsberechtigten berührt werden. 2 Soweit gesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist, richtet sich die Zustellung nach den Vorschriften des Bayerischen<br />
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.<br />
Abschnitt 3 Leistungserfüllung<br />
Bay BG Art. 11 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung<br />
(1) Ist bundesgesetzlich nichts anderes bestimmt, können Ansprüche auf<br />
sonstige Leistungen (Art. 5 Abs. 2) nur insoweit abgetreten oder<br />
verpfändet werden, als sie der Pfändung unterliegen.<br />
(2) Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht<br />
gegenüber Ansprüchen auf sonstige Leistungen (Art. 5 Abs. 2) nur<br />
insoweit geltend machen, als sie pfändbar sind; diese Einschränkung gilt<br />
nicht, soweit gegen den Empfänger oder die Empfängerin ein Anspruch<br />
auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.<br />
Bay BG Art. 12 Verjährung<br />
1 2<br />
Ansprüche aus dem Beamtenverhältnis verjähren in drei Jahren. Im Übrigen<br />
sind die §§ 194 bis 218 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend<br />
anzuwenden, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.<br />
3<br />
Abweichende besoldungs-, versorgungs-, und beihilferechtliche Vorschriften<br />
zur Verjährung bleiben unberührt.<br />
Bay BG Art. 13 Rückforderung<br />
Für die Rückforderung von sonstigen Leistungen (Art. 5 Abs. 2) gilt § 12 Abs. 2<br />
des Bundesbesoldungsgesetzes in Verbindung mit Art. 13 des Bayerischen<br />
Besoldungsgesetzes entsprechend.<br />
Bay BG Art. 14 Übergang von Ansprüchen<br />
1 Werden Beamte, Beamtinnen oder Versorgungsberechtigte oder ihre<br />
Angehörigen körperlich verletzt oder getötet, so geht ein gesetzlicher<br />
Schadensersatzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverletzung<br />
oder der Tötung gegen Dritte zusteht, insoweit auf den Dienstherrn über, als<br />
dieser während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der<br />
Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur<br />
Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. 2 Ist eine Versorgungskasse zur<br />
Gewährung der Versorgung verpflichtet, so geht der Anspruch auf sie über.<br />
3 Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil von Verletzten oder<br />
Hinterbliebenen geltend gemacht werden. 4 Steht Beihilfeberechtigten gegen
einen Leistungserbringer oder eine Leistungserbringerin ein Anspruch auf<br />
Rückerstattung oder Schadensersatz auf Grund einer unrichtigen Abrechnung<br />
zu, kann der Dienstherr des oder der Beihilfeberechtigten durch schriftliche<br />
Anzeige gegenüber dem Leistungserbringer, der Leistungserbringerin oder<br />
dessen beziehungsweise deren Abrechnungsstelle bewirken, dass der Anspruch<br />
insoweit auf den Dienstherrn übergeht, als dieser auf Antrag des oder der<br />
Beihilfeberechtigten zu hohe Beihilfeleistungen an den Beihilfeberechtigten<br />
oder die Beihilfeberechtigte erbracht hat. 5 Für den Freistaat Bayern regelt die<br />
Zuständigkeit für die Überleitung nach Satz 4 das Staatsministerium der<br />
Finanzen durch Rechtsverordnung.<br />
Abschnitt 4 Verfahren bei Erlass allgemeiner beamtenrechtIicher<br />
Regelungen<br />
Bay BG Art. 15 Zuständigkeit zum Erlass von Verwaltungsvorschriften<br />
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, erlässt die zu seiner<br />
Durchführung erforderlichen Verwaltungsvorschriften das Staatsministerium<br />
der Finanzen im Benehmen mit den jeweils beteiligten Staatsministerien;<br />
Verwaltungsvorschriften, die nur den Geschäftsbereich eines<br />
Staatsministeriums betreffen, erlässt dieses Staatsministerium im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.<br />
Bay BG Art. 16 Beteiligung der Spitzenorganisationen<br />
(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der beamtenrechtlichen<br />
Verhältnisse durch die obersten Landesbehörden wirken die<br />
Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und<br />
Berufsverbände nach Maßgabe der folgenden Absätze in einer laufenden,<br />
umfassenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit.<br />
(2) 1 Die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und<br />
Berufsverbände und das Staatsministerium der Finanzen kommen<br />
regelmäßig, mindestens jedoch zweimal im Jahr, zu Gesprächen über<br />
allgemeine Regelungen beamtenrechtlicher Verhältnisse zusammen.<br />
2<br />
Darüber hinaus können beide Seiten aus besonderem Anlass innerhalb<br />
einer Frist von einem Monat ein Gespräch verlangen.<br />
(3) 1 Die Entwürfe allgemeiner beamtenrechtlicher Regelungen werden den<br />
Spitzenorganisationen mit einer angemessenen Frist zur Stellungnahme<br />
zugeleitet. 2 Die Stellungnahmen sollen mit dem Ziel der Einigung erörtert<br />
werden. 3 Die Spitzenorganisationen können in den Erörterungen<br />
verlangen, dass ihre Vorschläge, die in <strong>Gesetze</strong>ntwürfen keine<br />
Berücksichtigung finden, mit Begründung und einer Stellungnahme der<br />
Staatsregierung dem Landtag mitgeteilt werden.<br />
Bay BG Art. 17 Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände<br />
Bei der Vorbereitung gesetzlicher Regelungen der beamtenrechtlichen<br />
Verhältnisse durch die obersten Landesbehörden sind die kommunalen<br />
Spitzenverbände zu beteiligen, wenn die Rechtsverhältnisse der Beamten und<br />
Beamtinnen im kommunalen Bereich berührt werden.
Teil 2 Beamtenverhältnis<br />
Abschnitt 1 Ernennungen<br />
Bay BG Art. 18 Ernennungszuständigkeit und Wirksamwerden von<br />
Ernennungen<br />
(1) 1 Die Staatsregierung ernennt die Beamten und Beamtinnen der<br />
Staatskanzlei und der Staatsministerien von der Besoldungsgruppe A 16<br />
an und die in der Besoldungsordnung B aufgeführten Vorstände der den<br />
Staatsministerien unmittelbar nachgeordneten Behörden. 2 Die übrigen<br />
Beamten und Beamtinnen des Staates werden durch die jeweils<br />
zuständigen Mitglieder der Staatsregierung ernannt; diese können die<br />
Ausübung dieser Befugnisse durch Rechtsverordnung auf andere Behörden<br />
übertragen.<br />
(2) Die Beamten und Beamtinnen der Gemeinden, der Gemeindeverbände<br />
und der sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden<br />
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden<br />
von den nach Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung hierfür zuständigen<br />
Stellen ernannt.<br />
(3) Die Ernennung wird mit dem Tag der Aushändigung der<br />
Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein<br />
späterer Tag bestimmt ist.<br />
Bay BG Art. 19 Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe<br />
Einer Ernennung bedarf es – neben den in § 8 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BeamtStG<br />
geregelten Fällen – zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer<br />
Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe.<br />
Bay BG Art. 20 Stellenausschreibungen<br />
Bewerber und Bewerberinnen sind durch Stellenausschreibung zu ermitteln,<br />
wenn es im besonderen dienstlichen Interesse liegt.<br />
Bay BG Art. 21 Verfahren und Rechtsfolgen bei nichtiger oder<br />
rücknehmbarer Ernennung<br />
(1) 1 Ist eine Ernennung nichtig, hat der oder die Dienstvorgesetzte dem oder<br />
der Ernannten die weitere Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten.<br />
2<br />
Das Verbot ist erst dann auszusprechen, wenn die sachlich zuständigen<br />
Stellen es abgelehnt haben, die Ernennung zu bestätigen oder eine<br />
Ausnahme nachträglich zuzulassen (§ 11 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BeamtStG).<br />
(2) 1 Die Rücknahme einer Ernennung (§ 12 BeamtStG) wird von der obersten<br />
Dienstbehörde erklärt; die Erklärung ist dem Beamten, der Beamtin oder<br />
seinen oder ihren versorgungsberechtigten Hinterbliebenen zuzustellen.<br />
2<br />
Die Ernennung kann in den Fällen des § 12 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BeamtStG<br />
nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten, in den Fällen des § 12 Abs. 1<br />
Nr. 4 BeamtStG nur innerhalb einer Frist von einem Jahr<br />
zurückgenommen werden, nachdem die oberste Dienstbehörde, bei den<br />
Gemeinden, den Gemeindeverbänden und den sonstigen unter der<br />
Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts die in beamtenrechtlichen Angelegenheiten zur<br />
Vertretung nach außen berechtigte Stelle von der Ernennung und dem<br />
Rücknahmegrund Kenntnis erlangt hat.<br />
(3) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen worden, so sind<br />
die bis zu dem Verbot nach Abs. 1 oder bis zu der Rücknahme nach Abs. 2<br />
vorgenommenen Amtshandlungen des oder der Ernannten in gleicher<br />
Weise gültig, wie wenn sie ein Beamter oder eine Beamtin ausgeführt<br />
hätte.<br />
(4) Die Leistungen des Dienstherrn können belassen werden.<br />
Abschnitt 2 Begründung des Beamtenverhältnisses<br />
Bay BG Art. 22 Allgemeine laufbahnrechtliche Voraussetzungen für die<br />
Berufung in das Beamtenverhältnis<br />
(1) In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer die für seine oder<br />
ihre Laufbahn vorgeschriebene oder – mangels solcher Vorschriften –<br />
übliche Vorbildung besitzt (Laufbahnbewerber und<br />
Laufbahnbewerberinnen).<br />
(2) 1 In das Beamtenverhältnis kann auch berufen werden, wer die<br />
erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung innerhalb<br />
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes erworben hat (andere Bewerber<br />
und Bewerberinnen). 2 Dies gilt nicht für die Wahrnehmung solcher<br />
Aufgaben, für die eine bestimmte Vorbildung oder Ausbildung durch<br />
besondere Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist oder die ihrer Eigenart nach<br />
eine besondere laufbahnmäßige Vorbildung und Fachausbildung zwingend<br />
erfordern. 3 Die Berufung anderer Bewerber und Bewerberinnen bedarf der<br />
Zustimmung des Landespersonalausschusses.<br />
Bay BG Art. 23 Altersgrenze für die Berufung<br />
(1) 1 In das Beamtenverhältnis darf nicht berufen werden, wer bereits das<br />
45. Lebensjahr vollendet hat. 2 Ausnahmen kann die oberste<br />
Dienstbehörde mit Zustimmung des Landespersonalausschusses, bei<br />
Beamten und Beamtinnen des Staates außerdem im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium der Finanzen zulassen.<br />
(2) Abs. 1 gilt nicht für Beamte und Beamtinnen auf Zeit.<br />
Bay BG Art. 24 Erlöschen des privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses<br />
zum Dienstherrn<br />
Mit der Begründung des Beamtenverhältnisses erlischt ein privatrechtliches<br />
Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn.<br />
Bay BG Art. 25 Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit<br />
1 Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein<br />
solches auf Lebenszeit umzuwandeln, wenn der Beamte oder die Beamtin die<br />
beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt. 2 Zeiten einer Beurlaubung<br />
ohne Dienstbezüge gelten nicht als Probezeit.
Abschnitt 3 Laufbahnen<br />
Unterabschnitt 1 Allgemeines<br />
Bay BG Art. 26 Laufbahnvorschriften, Zulassungs- und<br />
Ausbildungsordnungen<br />
(1) 1 Die Staatsregierung erlässt nach Anhörung des<br />
Landespersonalausschusses unter Berücksichtigung der Erfordernisse der<br />
einzelnen Verwaltungen durch Rechtsverordnung allgemeine Vorschriften<br />
über die Laufbahnen der Beamten und Beamtinnen nach den Grundsätzen<br />
der Art. 27 bis 44. 2 Dabei können auch Regelungen zur Berücksichtigung<br />
von Erziehungszeiten bei der Dienstzeitberechnung getroffen werden.<br />
(2) Die Staatsministerien können im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen und dem Landespersonalausschuss<br />
Vorschriften über die Zulassung zu einer Laufbahn und die Ausbildung<br />
erlassen.<br />
Bay BG Art. 27 Begriff und Einteilung der Laufbahnen, Zulassung zum<br />
Vorbereitungsdienst, Befähigung für entsprechende Laufbahnen<br />
(1) Eine Laufbahn umfasst alle Ämter derselben Fachrichtung, die eine gleiche<br />
Vorbildung und Ausbildung voraussetzen; zur Laufbahn gehören auch<br />
Vorbereitungsdienst und Probezeit.<br />
(2) 1 Die Laufbahnen gehören zu den Laufbahngruppen des einfachen, des<br />
mittleren, des gehobenen oder des höheren Dienstes; die Zugehörigkeit<br />
bestimmt sich nach dem Eingangsamt. 2 Die Laufbahnvorschriften können<br />
von Satz 1 abweichen, wenn es die besonderen Verhältnisse der Laufbahn<br />
erfordern.<br />
(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst einer Laufbahn darf nicht deshalb<br />
abgelehnt werden, weil die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung<br />
im Bereich eines anderen Dienstherrn erworben wurde.<br />
(4) 1 Die Laufbahnbefähigung für entsprechende Laufbahnen besitzt auch, wer<br />
die Befähigung als Laufbahnbewerber oder Laufbahnbewerberin bei einem<br />
anderen Dienstherrn erworben hat. 2 Welcher Laufbahn die Befähigung<br />
entspricht, entscheidet die oberste Dienstbehörde. 3 Bei Erwerb der<br />
Befähigung bei einem nicht diesem Gesetz unterliegenden Dienstherrn ist<br />
das Einvernehmen des Landespersonalausschusses erforderlich.<br />
Bay BG Art. 28 Einstellung, Beförderung und Aufstieg<br />
(1) Die Einstellung ist nur in dem Eingangsamt der Laufbahn zulässig, sofern<br />
nicht der Landespersonalausschuss eine Ausnahme zulässt.<br />
(2) 1 Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen sind, dürfen nicht übersprungen<br />
werden. 2 Eine Beförderung darf nicht erfolgen<br />
1. während der Probezeit,<br />
2. vor Ablauf eines Jahres nach Begründung eines Beamtenverhältnisses<br />
auf Lebenszeit,<br />
3. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung,<br />
4. vor Ablauf einer Erprobungszeit von drei Monaten auf einem<br />
höherbewerteten Dienstposten.
3<br />
Ausnahmen von Satz 2 Nrn. 1 und 2 sind zulässig zum Ausgleich<br />
beruflicher Verzögerungen, die durch die Geburt oder die tatsächliche<br />
Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren eintreten würden.<br />
4<br />
Ausnahmen von Satz 2 Nrn. 1 und 2 sind auch zulässig, soweit ein<br />
Bundesgesetz die Vornahme eines Nachteilsausgleichs anordnet. 5 Der<br />
Landespersonalausschuss kann sonstige Ausnahmen von den Sätzen 1<br />
und 2 zulassen.<br />
(3) 1 Der Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn derselben Fachrichtung ist<br />
auch ohne Erfüllung der Eingangsvoraussetzungen für diese Laufbahn<br />
möglich. 2 Für den Aufstieg soll die Ablegung einer Prüfung verlangt<br />
werden. 3 Das Nähere regeln die Laufbahnvorschriften.<br />
Unterabschnitt 2 Laufbahnbewerber und Laufbahnbewerberinnen<br />
Bay BG Art. 29 Einstellungsprüfung, besonderes Auswahlverfahren,<br />
Laufbahnprüfung<br />
1 Laufbahnbewerber und Laufbahnbewerberinnen haben eine<br />
Einstellungsprüfung und nach dem vorgeschriebenen Vorbereitungsdienst eine<br />
Laufbahnprüfung abzulegen, soweit sich aus den Art. 31 bis 38 nichts anderes<br />
ergibt. 2 Für Laufbahnbewerber und Laufbahnbewerberinnen des mittleren und<br />
des gehobenen nichttechnischen Dienstes kann an die Stelle der<br />
Einstellungsprüfung jeweils ein besonderes Auswahlverfahren treten, das eine<br />
angemessene Berücksichtigung schulischer Leistungen vorsieht. 3 In den<br />
Laufbahnen des einfachen Dienstes entfällt eine Einstellungs- und<br />
Laufbahnprüfung.<br />
Bay BG Art. 30 Bewerber und Bewerberinnen aus Mitgliedstaaten der<br />
Europäischen Union<br />
(1) 1 Die Laufbahnbefähigung kann auch auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG<br />
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über<br />
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl EU Nr. L 255 S. 22, 2007<br />
Nr. L 271 S. 18) erworben werden. 2 Das Nähere regelt das<br />
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung.<br />
(2) Die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist<br />
Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn.<br />
Bay BG Art. 31 Einfacher Dienst<br />
Für die Laufbahnen des einfachen Dienstes sind zu fordern<br />
1. mindestens der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule oder ein nach<br />
Anhörung des Landespersonalausschusses vom Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannter Bildungsstand,<br />
2. ein Vorbereitungsdienst von höchstens einem Jahr.<br />
Bay BG Art. 32 Mittlerer Dienst<br />
(1) Für die Laufbahnen des mittleren Dienstes sind zu fordern<br />
1. der mittlere Schulabschluss, der qualifizierende Hauptschulabschluss<br />
oder ein nach Anhörung des Landespersonalausschusses vom<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannter<br />
Bildungsstand,
2. ein Vorbereitungsdienst von zwei Jahren,<br />
3. das Bestehen der Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst.<br />
(2) 1 Der Vorbereitungsdienst vermittelt die berufliche Grundbildung sowie die<br />
fachlichen Kenntnisse, Methoden und praktischen Fähigkeiten, die zur<br />
Erfüllung der Aufgaben in einer Laufbahn des mittleren Dienstes benötigt<br />
werden. 2 Der Vorbereitungsdienst besteht aus einer fachtheoretischen<br />
Ausbildung und aus einer praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz; die<br />
fachtheoretische Ausbildung beträgt in der Regel sechs Monate.<br />
(3) 1 Abweichend von Abs. 1 Nr. 1 können für einzelne Laufbahnen in den<br />
Laufbahnvorschriften auch Bewerber und Bewerberinnen zugelassen<br />
werden, die den Hauptschulabschluss oder einen nach Anhörung des<br />
Landespersonalausschusses vom Staatsministerium für Unterricht und<br />
Kultus als gleichwertig anerkannten Bildungsstand und eine<br />
abgeschlossene förderliche Berufsausbildung nachweisen. 2 In Laufbahnen,<br />
deren Zugang nicht durch Laufbahnvorschriften geregelt ist, bedarf die<br />
Zulassung einer Ausnahme nach Satz 1 der Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses.<br />
Bay BG Art. 33 Gehobener Dienst<br />
(1) Für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes sind zu fordern<br />
1. die Fachhochschulreife, eine andere Hochschulreife oder ein nach<br />
Anhörung des Landespersonalausschusses vom Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannter Bildungsstand,<br />
2. ein Vorbereitungsdienst von drei Jahren,<br />
3. das Bestehen der Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst.<br />
(2) 1 Der Vorbereitungsdienst vermittelt in einem Studiengang einer<br />
Fachhochschule oder in einem gleichstehenden Studiengang die<br />
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden sowie die<br />
berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der<br />
Aufgaben der Laufbahn erforderlich sind. 2 Der Vorbereitungsdienst<br />
besteht aus Fachstudien von mindestens achtzehnmonatiger Dauer und<br />
berufspraktischen Studienzeiten. 3 Die berufspraktischen Studienzeiten<br />
umfassen die Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunktbereichen der<br />
Laufbahnaufgaben; der Anteil der praktischen Ausbildung darf eine Dauer<br />
von einem Jahr nicht unterschreiten.<br />
(3) 1 Der Vorbereitungsdienst kann auf eine Ausbildung in fachbezogenen<br />
Schwerpunktbereichen der Laufbahnaufgaben beschränkt werden, wenn<br />
der Erwerb der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden, die zur<br />
Erfüllung der Aufgaben in der Laufbahn erforderlich sind, durch eine<br />
insoweit durch die oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses als geeignet anerkannte Prüfung als<br />
Abschluss eines Studiengangs mindestens an einer Fachhochschule<br />
nachgewiesen worden ist. 2 Anrechenbar sind Studienzeiten von der<br />
Zeitdauer, um die nach Satz 1 der Vorbereitungsdienst gekürzt ist.<br />
3<br />
Gegenstand der Laufbahnprüfung sind Ausbildungsinhalte des<br />
berufspraktischen Vorbereitungsdienstes.<br />
(4) 1 Das Fachstudium des gehobenen nichttechnischen Dienstes findet an der<br />
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege statt. 2 Das<br />
Nähere wird durch Gesetz geregelt.
(5) 1 Für die Laufbahnen der Fachlehrer und Fachlehrerinnen und der<br />
Förderlehrer und Förderlehrerinnen kann in den Laufbahnvorschriften von<br />
Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 2 abgewichen werden. 2 Zu diesen<br />
Laufbahnen kann zugelassen werden, wer den Abschluss einer Realschule<br />
oder einen nach Anhörung des Landespersonalausschusses vom<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannten<br />
Bildungsstand besitzt.<br />
Bay BG Art. 34 Höherer Dienst<br />
(1) Für die Laufbahnen des höheren Dienstes sind zu fordern<br />
1. eine erste Staatsprüfung, ein Diplom- oder Magisterabschluss oder eine<br />
vergleichbare Qualifikation an einer Universität oder Kunsthochschule oder<br />
ein Masterabschluss,<br />
2. ein Vorbereitungsdienst von mindestens zwei Jahren,<br />
3. das Bestehen einer Laufbahnprüfung für den höheren Dienst oder einer<br />
die Befähigung für die Laufbahn vermittelnden zweiten Staatsprüfung.<br />
(2) Auf die Ausbildung für die Laufbahn des höheren allgemeinen<br />
Verwaltungsdienstes nach Abs. 1 kann nach Maßgabe des § 5 c des<br />
Deutschen Richtergesetzes eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für<br />
den gehobenen Justizdienst oder für den gehobenen nichttechnischen<br />
Verwaltungsdienst angerechnet werden.<br />
Bay BG Art. 35 Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen<br />
(1) 1 Bewerber und Bewerberinnen für die Laufbahnen des einfachen und des<br />
mittleren Dienstes können vor dem Vorbereitungsdienst in einem<br />
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigt werden. 2 Das<br />
Ausbildungsverhältnis wird nach dem Bestehen einer vorgeschriebenen<br />
Einstellungsprüfung durch die Einberufung als Dienstanfänger oder<br />
Dienstanfängerin begründet und endet<br />
1. mit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf,<br />
2. durch Entlassung.<br />
(2) Die für Beamte und Beamtinnen im Vorbereitungsdienst maßgebenden<br />
Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s über die Entlassungsfristen (Art. 56 Abs. 5),<br />
die für sie maßgebenden Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes<br />
über die Unfallfürsorge sowie Art. 14 gelten entsprechend.<br />
(3) Das Nähere regeln die Laufbahnvorschriften.<br />
Bay BG Art. 36 Erforderliche Fachbildung, Anrechnung förderlicher<br />
Tätigkeiten<br />
(1) Die für eine Laufbahn erforderliche technische oder sonstige Fachbildung<br />
ist neben der allgemeinen Vorbildung (Art. 29 bis 34) nachzuweisen.<br />
(2) Für Laufbahnen besonderer Fachrichtungen können mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses eine abweichende Dauer des<br />
Vorbereitungsdienstes bestimmt oder an Stelle des Vorbereitungsdienstes<br />
und der Prüfungen andere gleichwertige Befähigungsvoraussetzungen<br />
vorgeschrieben werden, wenn es die besonderen Verhältnisse der<br />
Laufbahn erfordern.
(3) Die Laufbahnvorschriften können bestimmen, ob und inwieweit eine für<br />
die Ausbildung förderliche Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des<br />
öffentlichen Dienstes auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wird.<br />
Bay BG Art. 37 Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe<br />
Wer die vorgeschriebene Laufbahnprüfung für eine Laufbahn bestanden hat,<br />
kann bei Vorliegen der sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen in das<br />
Beamtenverhältnis auf Probe berufen werden.<br />
Bay BG Art. 38 Art und Dauer des Probedienstes<br />
(1) Die Art des Probedienstes und die Dauer der Probezeit sind nach den<br />
Erfordernissen in den einzelnen Laufbahnen festzusetzen.<br />
(2) Die Laufbahnvorschriften können bestimmen, dass die Probezeit bei<br />
erheblich über dem Durchschnitt liegenden Leistungen abgekürzt werden<br />
kann.<br />
(3) 1 Die Laufbahnvorschriften bestimmen, inwieweit Dienstzeiten im<br />
öffentlichen Dienst auf die Probezeit anzurechnen sind. 2 Sie können ferner<br />
bestimmen, dass auch Zeiten einer Tätigkeit außerhalb des öffentlichen<br />
Dienstes nach Erwerb der Laufbahnbefähigung, die nach Art und<br />
Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt der betreffenden<br />
Laufbahn entsprechen, angerechnet werden können.<br />
Unterabschnitt 3 Andere Bewerber und Bewerberinnen<br />
Bay BG Art. 39 Voraussetzungen für die Berücksichtigung<br />
(1) Andere als Laufbahnbewerber und Laufbahnbewerberinnen (Art. 22 Abs. 2<br />
Satz 1) können berücksichtigt werden, wenn keine geeigneten<br />
Laufbahnbewerber oder Laufbahnbewerberinnen zur Verfügung stehen<br />
und ein besonderes dienstliches Interesse an der Gewinnung besteht.<br />
(2) Die Befähigung für die Laufbahn, in der sie verwendet werden sollen, ist<br />
durch den Landespersonalausschuss festzustellen.<br />
Bay BG Art. 40 Art und Dauer des Probedienstes für andere Bewerber<br />
und Bewerberinnen<br />
(1) 1 Die Art des Probedienstes und die Dauer der Probezeit sind nach den<br />
Erfordernissen in den einzelnen Laufbahnen festzusetzen. 2 Die Probezeit<br />
muss mindestens drei Jahre betragen und darf fünf Jahre nicht<br />
übersteigen.<br />
(2) 1 Die Laufbahnvorschriften bestimmen, inwieweit Dienstzeiten im<br />
öffentlichen Dienst auf die Probezeit angerechnet werden können, wenn<br />
die Tätigkeit nach ihrer Art und Bedeutung mindestens der in einem Amt<br />
der betreffenden Laufbahn entsprochen hat. 2 Sie können ferner<br />
bestimmen, dass die Probezeit in Ausnahmefällen durch den<br />
Landespersonalausschuss abgekürzt werden kann.
Unterabschnitt 4 Prüfungen<br />
Bay BG Art. 41 Arten der Prüfungen, Prüfungsgrundsätze,<br />
Prüfungsordnungen, besonderes Auswahlverfahren<br />
(1) Die Prüfungen sind Einstellungs-, Zwischen-, Laufbahn- oder<br />
Aufstiegsprüfungen.<br />
(2) 1 Die Prüfungen haben Wettbewerbscharakter und müssen so angelegt<br />
sein, dass sie die Eignung der Prüflinge für die angestrebte Laufbahn oder<br />
das angestrebte Amt ermitteln. 2 Die Grundsätze des Prüfungsverfahrens<br />
regelt eine von der Staatsregierung im Benehmen mit dem<br />
Landespersonalausschuss zu erlassende allgemeine Prüfungsordnung; die<br />
weiteren Prüfungsbestimmungen erlassen die Staatsministerien im<br />
Einvernehmen mit dem Landespersonalausschuss.<br />
(3) 1 Das besondere Auswahlverfahren (Art. 29 Satz 2) regelt die<br />
Staatsregierung im Benehmen mit dem Landespersonalausschuss durch<br />
Rechtsverordnung. 2 Darin ist eine schriftliche Prüfung vorzusehen und zu<br />
regeln, in welcher Weise die in bestimmten Fächern erzielten schulischen<br />
Leistungen berücksichtigt werden. 3 Wenn vergleichbare Leistungen nicht<br />
in ausreichendem Maß vorliegen, können zusätzliche Prüfungsleistungen<br />
gefordert werden. 4 Soweit es die besonderen Verhältnisse einzelner<br />
Laufbahnen erfordern, können die Staatsministerien im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium der Finanzen und dem Landespersonalausschuss<br />
durch Rechtsverordnung ergänzende oder abweichende Regelungen<br />
treffen.<br />
Bay BG Art. 42 Zulassung zu den Prüfungen<br />
Zu den Prüfungen sind alle Personen zuzulassen, die die hierfür festgelegten<br />
Voraussetzungen erfüllen und nach den geltenden Rechtsvorschriften zum<br />
Beamten oder zur Beamtin in der Laufbahn, für die die Prüfung abgehalten<br />
werden soll, ernannt werden können.<br />
Bay BG Art. 43 Bekanntmachung von Prüfungen<br />
(1) Die Prüfungen sind rechtzeitig bekanntzumachen.<br />
(2) Das Nähere regeln die Prüfungsbestimmungen.<br />
Unterabschnitt 5 Dienstliche Beurteilung<br />
Bay BG Art. 44 Dienstliche Beurteilung<br />
1 Die allgemeinen Vorschriften über die dienstliche Beurteilung der Beamten<br />
und Beamtinnen erlässt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 2 Jede<br />
dienstliche Beurteilung ist zu eröffnen.<br />
Abschnitt 4 Führungspositionen auf Zeit und auf Probe<br />
Bay BG Art. 45 Ämter mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf<br />
Zeit<br />
(1) 1 Die Ämter<br />
1. der Amtschefs und Amtschefinnen, der Bereichsleiter und
Bereichsleiterinnen sowie der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen in<br />
den obersten Landesbehörden,<br />
2. der Leiter und Leiterinnen sowie der stellvertretenden Leiter und<br />
Leiterinnen von Behörden, soweit sie in der Besoldungsordnung B<br />
eingestuft sind, und<br />
3. der Leiter und Leiterinnen von Organisationseinheiten von Behörden,<br />
soweit sie mindestens in der Besoldungsgruppe B 4 eingestuft sind,<br />
werden zunächst im Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen; Art. 46 findet<br />
keine Anwendung. 2 Die Dauer der Amtsperiode beträgt fünf Jahre.<br />
3<br />
Zeiten, in denen dem Beamten oder der Beamtin die leitende oder eine<br />
vergleichbare Funktion bereits übertragen worden ist, werden bei der<br />
Festlegung der Dauer der Amtsperiode angerechnet. 4 Zeiten in einer<br />
vergleichbar oder höher bewerteten Funktion, welche der Beamte oder die<br />
Beamtin unmittelbar vor der Übertragung eines Amtes in leitender<br />
Funktion wahrgenommen hat, werden auf die Dauer der Amtsperiode<br />
angerechnet. 5 Beamte und Beamtinnen können vor der Übertragung im<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit auf die Anrechnung verzichten. 6 Mit Ablauf der<br />
Amtsperiode ist dem Beamten oder der Beamtin das Amt mit leitender<br />
Funktion auf Lebenszeit zu übertragen, wenn der Beamte oder die<br />
Beamtin im Rahmen der bisherigen Amtsführung den Anforderungen des<br />
Amtes in vollem Umfang gerecht geworden ist. 7 Eine weitere Übertragung<br />
des Amtes auf Zeit ist nicht zulässig.<br />
(2) Abweichend von Abs. 1 wird das Amt sogleich im Beamtenverhältnis auf<br />
Lebenszeit übertragen, wenn der Beamte oder die Beamtin<br />
1. bereits ein Amt mit mindestens demselben Endgrundgehalt im<br />
Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit innehat oder innehatte<br />
oder<br />
2. innerhalb von fünf Jahren nach der Übertragung des Amtes die<br />
gesetzliche Altersgrenze erreicht.<br />
(3) Abs. 1 gilt nicht für die Ämter der Mitglieder des Obersten Rechnungshofs<br />
sowie für die Ämter, die auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften im<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen werden.<br />
(4) Die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen unter der Aufsicht des<br />
Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des<br />
öffentlichen Rechts können für ihre Beamten und Beamtinnen durch<br />
Satzung oder Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums weitere<br />
Ämter der Besoldungsordnung B festlegen, die zunächst im<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit vergeben werden.<br />
(5) 1 In ein Amt mit leitender Funktion nach den Abs. 1 und 4 darf nur berufen<br />
werden, wer sich in einem Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit<br />
befindet und in dieses Amt auch als Beamter oder Beamtin auf Lebenszeit<br />
berufen werden könnte. 2 Die Staatsregierung oder das Präsidium des<br />
Landtags können im Rahmen ihrer Ernennungskompetenz Ausnahmen von<br />
Satz 1 zulassen; die Zuständigkeit des Landespersonalausschusses ist<br />
dabei zu wahren. 3 Richter und Richterinnen dürfen in ein Amt nach Abs. 1<br />
nur berufen werden, wenn sie zugleich zustimmen, bei Wiederaufleben<br />
des Richterverhältnisses auf Lebenszeit auch in einem anderen Richteramt<br />
desselben Gerichtszweigs mit mindestens demselben Endgrundgehalt<br />
verwendet zu werden.
(6) 1 Vom Tag der Ernennung an ruhen für die Dauer des<br />
Zeitbeamtenverhältnisses die Rechte und Pflichten aus dem Amt, das dem<br />
Beamten oder der Beamtin zuletzt im Beamten- oder Richterverhältnis auf<br />
Lebenszeit übertragen worden ist; das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit<br />
oder das Richterverhältnis auf Lebenszeit besteht fort. 2 Dienstvergehen,<br />
die mit Bezug auf das Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit<br />
oder das Beamtenverhältnis auf Zeit begangen worden sind, werden so<br />
verfolgt, als stünde der Beamte oder die Beamtin nur im Beamten- oder<br />
Richterverhältnis auf Lebenszeit.<br />
(7) Wird der Beamte oder die Beamtin in ein anderes Amt mit leitender<br />
Funktion nach Abs. 1 Satz 1 versetzt oder umgesetzt, das in derselben<br />
oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe eingestuft ist wie das ihm oder<br />
ihr zuletzt übertragene Amt mit leitender Funktion, so läuft die Amtszeit<br />
weiter.<br />
(8) Vor der Übertragung eines anderen, einer höheren Besoldungsgruppe<br />
angehörenden Amtes mit leitender Funktion aus einem Beamtenverhältnis<br />
auf Zeit heraus ist dem Beamten oder der Beamtin das bisher auf Zeit<br />
übertragene Amt auf Lebenszeit zu übertragen.<br />
(9) Der Beamte oder die Beamtin ist außer in den in diesem Gesetz oder im<br />
Beamtenstatusgesetz bestimmten Fällen<br />
1. mit Ablauf der Amtszeit,<br />
2. mit der Versetzung zu einem anderen Dienstherrn,<br />
3. mit Verhängung einer Disziplinarmaßnahme, die über Verweis oder<br />
Geldbuße hinausgeht,<br />
4. mit Beendigung des Beamten- oder Richterverhältnisses auf Lebenszeit<br />
aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen.<br />
(10) 1 Mit der Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit endet der<br />
Anspruch auf Besoldung aus diesem Amt. 2 Weitergehende<br />
besoldungsrechtliche Ansprüche bestehen nicht. 3 Der Beamte oder die<br />
Beamtin darf während der Amtszeit nur die Amtsbezeichnung des<br />
übertragenen Amtes mit leitender Funktion führen; Art. 76 Abs. 4 Satz 2<br />
findet keine entsprechende Anwendung.<br />
(11) Beamte und Beamtinnen auf Zeit treten mit dem Erreichen der<br />
Altersgrenze in den Ruhestand.<br />
(12) Dienstunfähige Beamte und Beamtinnen sind aus dem Beamtenverhältnis<br />
auf Zeit in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie<br />
1. eine Amtsperiode von mindestens zwei Jahren zurückgelegt haben und<br />
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 BeamtVG erfüllen oder<br />
2. infolge eines Dienstunfalls dienstunfähig geworden sind.<br />
(13) Art. 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 findet keine Anwendung.<br />
(14) Ist der Beamte oder die Beamtin auf Zeit während seiner oder ihrer<br />
Amtszeit wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten, berechnen<br />
sich die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf<br />
Zeit.
Bay BG Art. 46 Ämter mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf<br />
Probe<br />
(1) 1 Für die Beamten und Beamtinnen des Freistaates Bayern legt die<br />
Staatsregierung durch Rechtsverordnung die mindestens der<br />
Besoldungsgruppe A 15 angehörenden Ämter der Leiter und Leiterinnen<br />
von Behörden oder Teilen von Behörden fest, die zunächst im<br />
Beamtenverhältnis auf Probe vergeben werden. 2 Die Gemeinden,<br />
Gemeindeverbände und sonstigen unter der Aufsicht des Staates<br />
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen<br />
Rechts können für ihre Beamten und Beamtinnen durch Satzung oder<br />
Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums die der<br />
Besoldungsordnung B angehörenden Ämter mit leitender Funktion sowie<br />
die Ämter der Leiter und Leiterinnen von Behörden oder Teilen von<br />
Behörden bestimmen, die zunächst auf Probe vergeben werden. 3 Die<br />
regelmäßige Probezeit beträgt zwei Jahre; Art. 25 Satz 2 gilt<br />
entsprechend. 4 Eine Verkürzung der Probezeit kann zugelassen werden;<br />
die Mindestprobezeit beträgt ein Jahr. 5 Zeiten, in denen dem Beamten<br />
oder der Beamtin die leitende oder eine vergleichbare Funktion nach den<br />
Sätzen 1 und 2 bereits übertragen worden ist, werden auf die Probezeit<br />
angerechnet. 6 Zeiten in einer vergleichbar oder höher bewerteten<br />
Funktion, welche der Beamte oder die Beamtin unmittelbar vor der<br />
Übertragung eines Amtes in leitender Funktion wahrgenommen hat,<br />
werden auf die Dauer der Amtsperiode angerechnet. 7 Eine Verlängerung<br />
der Probezeit ist nicht zulässig. 8 Art. 46 findet keine Anwendung auf<br />
Ämter, die gemäß Art. 45 im Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen<br />
werden.<br />
(2) Art. 45 Abs. 5 Sätze 1 und 2, Abs. 6 bis 8 und 13 gelten entsprechend.<br />
(3) 1 Mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit ist dem Beamten oder der<br />
Beamtin das Amt nach Abs. 1 im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu<br />
übertragen; eine erneute Berufung des Beamten oder der Beamtin in ein<br />
Beamtenverhältnis auf Probe zur Übertragung dieses Amtes innerhalb<br />
eines Jahres ist nicht zulässig. 2 Art. 45 Abs. 10 gilt entsprechend.<br />
Abschnitt 5 Abordnung und Versetzung innerhalb des<br />
Geltungsbereichs dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
Bay BG Art. 47 Abordnung<br />
(1) Beamte und Beamtinnen können, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht,<br />
vorübergehend ganz oder teilweise zu einer ihrem Amt entsprechenden<br />
Tätigkeit an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.<br />
(2) 1 Aus dienstlichen Gründen können Beamte und Beamtinnen<br />
vorübergehend ganz oder teilweise auch zu einer nicht ihrem Amt<br />
entsprechenden Tätigkeit abgeordnet werden, wenn ihnen die<br />
Wahrnehmung der neuen Tätigkeit auf Grund ihrer Vorbildung oder<br />
Berufsausbildung zuzumuten ist. 2 Dabei ist auch die Abordnung zu einer<br />
Tätigkeit, die nicht einem Amt mit demselben Endgrundgehalt entspricht,<br />
zulässig. 3 Die Abordnung nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der
Zustimmung des Beamten oder der Beamtin, wenn sie die Dauer von zwei<br />
Jahren übersteigt.<br />
(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf der Zustimmung des<br />
Beamten oder der Beamtin, wenn die neue Tätigkeit nicht einem Amt mit<br />
(mindestens) demselben Endgrundgehalt derselben, einer<br />
entsprechenden, gleichwertigen oder anderen Laufbahn entspricht oder<br />
die Abordnung die Dauer von fünf Jahren übersteigt.<br />
(4) Werden Beamte oder Beamtinnen zu einem anderen Dienstherrn<br />
abgeordnet, so sind auf sie für die Dauer der Abordnung die für den<br />
Bereich dieses Dienstherrn geltenden Vorschriften über die Pflichten und<br />
Rechte mit Ausnahme der Regelungen über Diensteid, Amtsbezeichnung,<br />
Besoldung und Versorgung entsprechend anzuwenden.<br />
(5) Zur Zahlung der dem Beamten oder der Beamtin zustehenden Leistungen<br />
ist auch der Dienstherr verpflichtet, zu dem der Beamte oder die Beamtin<br />
abgeordnet ist.<br />
Bay BG Art. 48 Versetzung<br />
(1) 1 Beamte und Beamtinnen können in ein anderes Amt einer Laufbahn, für<br />
die sie die Befähigung besitzen, versetzt werden, wenn sie es beantragen<br />
oder ein dienstliches Bedürfnis besteht. 2 Eine Versetzung bedarf nicht<br />
ihrer Zustimmung, wenn das neue Amt zum Bereich desselben<br />
Dienstherrn gehört, derselben Laufbahn angehört wie das bisherige Amt<br />
und mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist;<br />
Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehalts.<br />
(2) 1 Aus dienstlichen Gründen können Beamte und Beamtinnen ohne ihre<br />
Zustimmung in ein Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer<br />
gleichwertigen oder anderen Laufbahn, auch im Bereich eines anderen<br />
Dienstherrn, versetzt werden; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als<br />
Bestandteile des Grundgehalts. 2 Bei der Auflösung oder einer<br />
wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer Behörde<br />
oder der Verschmelzung von Behörden können Beamte und Beamtinnen,<br />
deren Aufgabengebiet davon berührt ist, auch ohne ihre Zustimmung in<br />
ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn mit<br />
geringerem Endgrundgehalt im Bereich desselben Dienstherrn versetzt<br />
werden, wenn eine ihrem bisherigen Amt entsprechende Verwendung<br />
nicht möglich ist; das Endgrundgehalt muss mindestens dem des Amtes<br />
entsprechen, das die Beamten oder Beamtinnen vor dem bisherigen Amt<br />
innehatten.<br />
(3) Besitzen Beamte und Beamtinnen nicht die Befähigung für die andere<br />
Laufbahn, haben sie an geeigneten Maßnahmen für den Erwerb der neuen<br />
Befähigung teilzunehmen.<br />
(4) Werden Beamte und Beamtinnen in ein Amt eines anderen Dienstherrn<br />
versetzt, wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn<br />
fortgesetzt.<br />
Bay BG Art. 49 Zuständigkeit für Abordnung und Versetzung<br />
(1) 1 Die Abordnung oder Versetzung ordnet die abgebende Stelle an, bei<br />
Abordnung oder Versetzung zu einer anderen obersten Dienstbehörde
oder einem anderen Dienstherrn im Einvernehmen mit der aufnehmenden<br />
Stelle. 2 Das Einvernehmen ist schriftlich zu erklären. 3 In der Verfügung<br />
ist auszudrücken, dass das Einvernehmen vorliegt.<br />
(2) Abgebende oder aufnehmende Stelle ist die für die Ernennung zuständige<br />
Behörde.<br />
(3) Die oberste Dienstbehörde kann die Befugnis zur Abordnung oder<br />
Versetzung auf Behörden übertragen, die nicht für die Ernennung<br />
zuständig sind.<br />
Abschnitt 6 Rechtsstellung der Beamten, Beamtinnen,<br />
Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen bei<br />
Auflösung oder Umbildung von Behörden oder Körperschaften<br />
Bay BG Art. 50 Auflösung oder Umbildung von Behörden<br />
Wird eine Behörde oder eine Organisationseinheit einer Behörde einer anderen<br />
Behörde angeschlossen oder gehen deren Aufgaben auf eine andere Behörde<br />
über, so werden im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Organisationsänderung<br />
die davon betroffenen Beamten und Beamtinnen, sofern sie nicht nach Art. 48<br />
Abs. 2 Satz 2 versetzt oder nach Art. 68 in den einstweiligen Ruhestand<br />
versetzt werden, bei der aufnehmenden Behörde in ihrem bisherigen Amt<br />
übernommen; laufbahnrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.<br />
Bay BG Art. 51 Auflösung oder Umbildung einer Körperschaft<br />
(1) Beamte und Beamtinnen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts<br />
mit Dienstherrnfähigkeit (Körperschaft), die vollständig in eine andere<br />
Körperschaft eingegliedert wird, treten mit der Umbildung kraft <strong>Gesetze</strong>s<br />
in den Dienst der aufnehmenden Körperschaft über.<br />
(2) 1 Die Beamten und Beamtinnen einer Körperschaft, die vollständig in<br />
mehrere andere Körperschaften eingegliedert wird, sind anteilig in den<br />
Dienst der aufnehmenden Körperschaften zu übernehmen. 2 Die<br />
beteiligten Körperschaften haben innerhalb einer Frist von sechs Monaten<br />
nach dem Zeitpunkt, in dem die Umbildung vollzogen ist, im<br />
Einvernehmen miteinander zu bestimmen, von welchen Körperschaften<br />
die einzelnen Beamten und Beamtinnen zu übernehmen sind. 3 Solange<br />
ein Beamter oder eine Beamtin nicht übernommen ist, haften alle<br />
aufnehmenden Körperschaften für die ihm oder ihr zustehenden Bezüge<br />
als Gesamtschuldner.<br />
(3) 1 Die Beamten und Beamtinnen einer Körperschaft, die teilweise in eine<br />
andere Körperschaft oder mehrere andere Körperschaften eingegliedert<br />
wird, sind zu einem verhältnismäßigen Teil, bei mehreren Körperschaften<br />
anteilig, in den Dienst der aufnehmenden Körperschaften zu übernehmen.<br />
2<br />
Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.<br />
(4) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine Körperschaft mit einer<br />
anderen Körperschaft oder mehreren anderen Körperschaften zu einer<br />
neuen Körperschaft zusammengeschlossen wird, wenn Teile von<br />
Körperschaften zu einem neuen Teil oder mehreren neuen Teilen einer<br />
Körperschaft zusammengeschlossen werden, wenn aus einer Körperschaft
oder aus Teilen einer Körperschaft eine neue Körperschaft gebildet wird<br />
oder mehrere neue Körperschaften gebildet werden, oder wenn Aufgaben<br />
einer Körperschaft vollständig oder teilweise auf eine andere Körperschaft<br />
oder mehrere andere Körperschaften übergehen.<br />
Bay BG Art. 52 Rechtsfolgen der Umbildung<br />
(1) Tritt ein Beamter oder eine Beamtin auf Grund des Art. 51 Abs. 1 kraft<br />
<strong>Gesetze</strong>s in den Dienst einer anderen Körperschaft über oder wird er oder<br />
sie auf Grund des Art. 51 Abs. 2 oder 3 von einer anderen Körperschaft<br />
übernommen, wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn<br />
fortgesetzt.<br />
(2) Im Fall des Art. 51 Abs. 1 ist dem Beamten oder der Beamtin von der<br />
aufnehmenden oder neuen Körperschaft die Fortsetzung des<br />
Beamtenverhältnisses schriftlich zu bestätigen.<br />
(3) 1 In den Fällen des Art. 51 Abs. 2 und 3 wird die Übernahme von der<br />
Körperschaft verfügt, in deren Dienst der Beamte oder die Beamtin treten<br />
soll. 2 Die Verfügung wird mit der Zustellung an den Beamten oder die<br />
Beamtin wirksam. 3 Der Beamte oder die Beamtin ist verpflichtet, der<br />
Übernahmeverfügung Folge zu leisten. 4 Wird diese Verpflichtung nicht<br />
erfüllt, so ist er oder sie zu entlassen.<br />
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend in den Fällen des Art. 51 Abs. 4.<br />
Bay BG Art. 53 Rechtsstellung der Beamten und Beamtinnen<br />
1 Nach Art. 51 in den Dienst einer anderen Körperschaft kraft <strong>Gesetze</strong>s<br />
übergetretenen oder von ihr übernommenen Beamten und Beamtinnen soll ein<br />
ihrem bisherigen Amt nach Bedeutung und Inhalt ohne Rücksicht auf<br />
Dienststellung und Dienstalter gleichzubewertendes Amt übertragen werden.<br />
2 Wenn eine dem bisherigen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich ist,<br />
kann ihnen auch ein anderes Amt mit geringerem Endgrundgehalt übertragen<br />
werden. 3 Das Endgrundgehalt muss mindestens dem des Amtes entsprechen,<br />
das der Beamte oder die Beamtin vor dem bisherigen Amt innehatte. 4 In<br />
diesen Fällen darf der Beamte oder die Beamtin neben der neuen<br />
Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit dem Zusatz “außer Dienst”<br />
(“a. D.”) führen.<br />
Bay BG Art. 54 Rechtsstellung der Versorgungsempfänger und<br />
Versorgungsempfängerinnen<br />
(1) Die Vorschriften des Art. 51 Abs. 1 und 2 und des Art. 52 gelten<br />
entsprechend für die im Zeitpunkt der Umbildung bei der abgebenden<br />
Körperschaft vorhandenen Versorgungsempfänger und<br />
Versorgungsempfängerinnen.<br />
(2) In den Fällen des Art. 51 Abs. 3 bleiben die Ansprüche der im Zeitpunkt<br />
der Umbildung vorhandenen Versorgungsempfänger und<br />
Versorgungsempfängerinnen gegenüber der abgebenden Körperschaft<br />
bestehen.<br />
(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen des Art. 51 Abs. 4.
Teil 3 Beendigung des Beamtenverhältnisses<br />
Abschnitt 1 Entlassung<br />
Bay BG Art. 55 Entlassung kraft <strong>Gesetze</strong>s<br />
1 Beamte und Beamtinnen auf Widerruf sind neben den in § 22 Abs. 4<br />
BeamtStG geregelten Fällen entlassen, wenn die Laufbahnprüfung nicht binnen<br />
einer angemessenen Frist nach Beendigung des vorgeschriebenen<br />
Vorbereitungsdienstes nach näherer Maßgabe der Laufbahnvorschriften<br />
abgelegt worden ist. 2 Die Laufbahnvorschriften können für einzelne<br />
Laufbahnen vorsehen, dass das Beamtenverhältnis trotz Vorliegens der<br />
Voraussetzungen nach Satz 1 oder § 22 Abs. 4 BeamtStG fortgesetzt wird.<br />
Bay BG Art. 56 Zuständigkeiten und Verfahren<br />
(1) 1 Die für die Ernennung zuständige Behörde entscheidet darüber, ob die<br />
Voraussetzungen für eine Entlassung kraft <strong>Gesetze</strong>s vorliegen; sie stellt<br />
den Tag der Beendigung des Beamtenverhältnisses fest. 2 Im Fall des § 22<br />
Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG tritt an die Stelle der für die Ernennung<br />
zuständigen Behörde die oberste Dienstbehörde, für die Beamten und<br />
Beamtinnen der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen<br />
unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und<br />
Stiftungen des öffentlichen Rechts die oberste Aufsichtsbehörde.<br />
(2) Im Fall einer Entlassung durch Verwaltungsakt (Entlassungsverfügung)<br />
wird die Entlassung von der Stelle verfügt, die für die Ernennung<br />
zuständig wäre, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.<br />
(3) Die Entlassungsverfügung ist unter Angabe des Grundes und des<br />
Zeitpunkts der Entlassung zuzustellen.<br />
(4) 1 Die Entlassung wird wirksam<br />
1. im Fall des § 23 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG mit der Zustellung der<br />
Entlassungsverfügung,<br />
2. in den Fällen des § 23 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4, Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1<br />
BeamtStG mit dem in der Entlassungsverfügung bezeichneten Zeitpunkt,<br />
3. im Übrigen mit dem Ende des Monats, der auf den Monat folgt, in dem<br />
die Entlassungsverfügung zugestellt worden ist.<br />
2<br />
Die Entlassung von Beamten und Beamtinnen auf Zeit nach Art. 122<br />
Abs. 3 Satz 2 wird mit Ablauf des letzten Tages der Amtszeit wirksam.<br />
(5) 1 Bei Entlassungen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nrn. 2 und 3 sowie<br />
Abs. 4 BeamtStG sind folgende Fristen einzuhalten:<br />
bei einer Beschäftigungszeit<br />
bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss,<br />
von mehr als drei Monaten sechs Wochen zum Schluss eines<br />
Kalendervierteljahres.<br />
2<br />
Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit im<br />
Beamtenverhältnis.
Bay BG Art. 57 Entlassung auf eigenen Antrag<br />
(1) 1 Beamte und Beamtinnen können jederzeit gegenüber ihren<br />
Dienstvorgesetzten ihre Entlassung verlangen. 2 Die Erklärung kann,<br />
solange die Entlassungsverfügung noch nicht zugegangen ist, innerhalb<br />
zweier Wochen nach Zugang bei dem oder der Dienstvorgesetzten<br />
schriftlich zurückgenommen werden, mit Zustimmung der<br />
Entlassungsbehörde auch nach Ablauf dieser Frist.<br />
(2) 1 Die Entlassung ist zum beantragten Zeitpunkt auszusprechen. 2 Sie kann<br />
so lange hinausgeschoben werden, bis die Amtsgeschäfte des Beamten<br />
oder der Beamtin ordnungsgemäß erledigt sind, längstens jedoch drei<br />
Monate; bei Lehrkräften an öffentlichen Schulen kann sie bis zum Schluss<br />
des laufenden Schulhalbjahres hinausgeschoben werden.<br />
Bay BG Art. 58 Rechtsfolgen der Entlassung<br />
1 Nach der Entlassung haben frühere Beamte und Beamtinnen keinen Anspruch<br />
auf Leistungen des Dienstherrn, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.<br />
2 Sie dürfen die Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt<br />
verliehenen Titel nur führen, wenn ihnen die Erlaubnis nach Art. 76 Abs. 5<br />
erteilt ist.<br />
Abschnitt 2 Verlust der Beamtenrechte<br />
Bay BG Art. 59 Rechtsfolgen des Verlustes der Beamtenrechte<br />
1 Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 Abs. 1 BeamtStG, so entstehen keine<br />
Ansprüche auf Leistungen des Dienstherrn, soweit gesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist. 2 Beamte und Beamtinnen dürfen die Amtsbezeichnung und die<br />
im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel nicht führen.<br />
Bay BG Art. 60 Wiederaufnahmeverfahren<br />
(1) 1 Im Fall des § 24 Abs. 2 BeamtStG entsteht ein Anspruch auf<br />
Übertragung eines Amtes derselben oder einer mindestens gleichwertigen<br />
Laufbahn und mit mindestens demselben Endgrundgehalt wie das<br />
bisherige Amt, sofern die Altersgrenze noch nicht erreicht ist und noch<br />
Dienstfähigkeit besteht. 2 Bis zur Übertragung des neuen Amtes stehen die<br />
Leistungen des Dienstherrn zu, die aus dem bisherigen Amt zugestanden<br />
hätten.<br />
(2) Wird auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten<br />
Sachverhalts ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus<br />
dem Beamtenverhältnis eingeleitet, so gehen die nach Abs. 1 zustehenden<br />
Ansprüche unter, wenn auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis<br />
erkannt wird; bis zum rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens<br />
können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.<br />
(3) Rechtfertigt der im Wiederaufnahmeverfahren festgestellte Sachverhalt<br />
die Einleitung eines Disziplinarverfahrens mit dem Ziel der Entfernung aus<br />
dem Beamtenverhältnis nicht, wird aber auf Grund eines rechtskräftigen<br />
Strafurteils, das nach der früheren Entscheidung ergangen ist, ein<br />
Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem<br />
Beamtenverhältnis eingeleitet, so gilt Abs. 2 entsprechend; es werden
jedoch in diesem Fall die Leistungen des Dienstherrn nachgezahlt, die dem<br />
Beamten oder der Beamtin bis zur Rechtskraft des Strafurteils aus dem<br />
bisherigen Amt zugestanden hätten.<br />
(4) Abs. 2 und 3 gelten entsprechend in Fällen der Entlassung von Beamten<br />
und Beamtinnen auf Probe oder auf Widerruf wegen eines Verhaltens der<br />
in § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG bezeichneten Art.<br />
(5) Auf die nach den Abs. 1 und 3 zustehenden Leistungen des Dienstherrn<br />
wird ein anderes Arbeitseinkommen oder ein Unterhaltsbeitrag<br />
angerechnet; Beamte und Beamtinnen sind zur Auskunft über dieses<br />
Einkommen verpflichtet.<br />
Bay BG Art. 61 Gnadenerweis<br />
(1) Dem Ministerpräsidenten steht hinsichtlich des Verlustes der<br />
Beamtenrechte das Gnadenrecht zu.<br />
(2) Wird im Gnadenweg der Verlust der Beamtenrechte in vollem Umfang<br />
beseitigt, so gilt von diesem Zeitpunkt ab Art. 60 entsprechend.<br />
(3) Auf Unterhaltsbeiträge, die im Gnadenweg bewilligt werden, finden Art. 74<br />
Abs. 3 und 4 des Bayerischen Disziplinargesetzes (BayDG) entsprechende<br />
Anwendung, soweit die Gnadenentscheidung nichts anderes bestimmt.<br />
Abschnitt 3 Ruhestand<br />
Unterabschnitt 1 Ruhestandseintritt<br />
Bay BG Art. 62 Altersgrenze für den gesetzlichen Ruhestandseintritt<br />
1 Altersgrenze für den gesetzlichen Ruhestandseintritt ist das Ende des Monats,<br />
in dem Beamte und Beamtinnen das 65. Lebensjahr vollenden. 2 Abweichend<br />
von Satz 1 ist Altersgrenze für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen das Ende des<br />
Schuljahres, das dem Schuljahr vorangeht, in dem sie das 65. Lebensjahr<br />
vollenden. 3 Für einzelne Beamtengruppen kann gesetzlich eine andere<br />
Altersgrenze bestimmt werden, wenn die Eigenart der Amtsaufgaben es<br />
erfordert.<br />
Bay BG Art. 63 Hinausschieben des Ruhestandseintritts<br />
(1) 1 Wenn zwingende dienstliche Rücksichten im Einzelfall die Fortführung der<br />
Dienstgeschäfte durch einen bestimmten Beamten oder eine bestimmte<br />
Beamtin erfordern, kann der Eintritt in den Ruhestand über die gesetzlich<br />
festgesetzte Altersgrenze für eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr<br />
nicht übersteigen darf, hinausgeschoben werden, höchstens jedoch bis zur<br />
Vollendung des 68. Lebensjahres und um nicht mehr als insgesamt fünf<br />
Jahre. 2 Die Entscheidung trifft bei den Beamten und Beamtinnen der<br />
Staatskanzlei und der Staatsministerien von der Besoldungsgruppe A 16<br />
an und den in der Besoldungsordnung B aufgeführten Vorständen der den<br />
Staatsministerien unmittelbar nachgeordneten Behörden die<br />
Staatsregierung, bei den übrigen Beamten und Beamtinnen die oberste<br />
Dienstbehörde mit Zustimmung des Landespersonalausschusses.<br />
(2) 1 Wenn die Fortführung der Dienstgeschäfte im dienstlichen Interesse<br />
liegt, kann der Eintritt in den Ruhestand auf Antrag über die gesetzlich
festgesetzte Altersgrenze für eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr<br />
nicht übersteigen darf, hinausgeschoben werden, höchstens jedoch bis zur<br />
Vollendung des 68. Lebensjahres und bei sonst gesetzlich festgesetzten<br />
Altersgrenzen um nicht mehr als insgesamt fünf Jahre; der Antrag soll<br />
spätestens sechs Monate vor Erreichen der gesetzlich festgelegten<br />
Altersgrenze gestellt werden. 2 Die Entscheidung trifft die Behörde, die für<br />
die Ruhestandsversetzung zuständig ist.<br />
Unterabschnitt 2 Ruhestandsversetzung<br />
Bay BG Art. 64 Ruhestandsversetzung auf Antrag<br />
Ein Beamter oder eine Beamtin auf Lebenszeit kann auf Antrag in den<br />
Ruhestand versetzt werden, wenn er oder sie<br />
1. das 64. Lebensjahr vollendet hat und nicht Altersteilzeit im Blockmodell<br />
(Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) in Anspruch nimmt, soweit nicht besonders<br />
schwerwiegende Gründe eine Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der<br />
gesetzlichen Altersgrenze rechtfertigen, oder<br />
2. schwerbehindert im Sinn des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches<br />
Sozialgesetzbuch (SGB IX) ist und mindestens das 60. Lebensjahr vollendet<br />
hat.<br />
Bay BG Art. 65 Verfahren bei Ruhestandsversetzungen wegen<br />
Dienstunfähigkeit<br />
(1) Als dienstunfähig nach § 26 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG können Beamte und<br />
Beamtinnen auch dann angesehen werden, wenn sie infolge einer<br />
Erkrankung innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen<br />
Dienst geleistet haben und keine Aussicht besteht, dass sie innerhalb von<br />
weiteren sechs Monaten wieder voll dienstfähig werden.<br />
(2) 1 Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit, so ist der Beamte oder die<br />
Beamtin verpflichtet, sich nach Weisung des oder der Dienstvorgesetzten<br />
ärztlich untersuchen und, falls ein Amtsarzt oder eine Amtsärztin dies für<br />
erforderlich hält, beobachten zu lassen. 2 Wer sich trotz wiederholter<br />
schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden Grund der Verpflichtung,<br />
sich nach Weisung des oder der Dienstvorgesetzten untersuchen oder<br />
beobachten zu lassen entzieht, kann so behandelt werden, wie wenn die<br />
Dienstunfähigkeit amtsärztlich festgestellt worden wäre.<br />
(3) 1 Wird in den Fällen des § 26 Abs. 1 BeamtStG ein Antrag auf Versetzung<br />
in den Ruhestand gestellt, so wird die Dienstunfähigkeit dadurch<br />
festgestellt, dass der unmittelbare Dienstvorgesetzte oder die<br />
unmittelbare Dienstvorgesetzte auf Grund eines amtsärztlichen<br />
Gutachtens über den Gesundheitszustand erklärt, er oder sie halte den<br />
Beamten oder die Beamtin nach pflichtgemäßem Ermessen für dauernd<br />
unfähig, die Dienstpflichten zu erfüllen. 2 Die über die Versetzung in den<br />
Ruhestand entscheidende Behörde ist an die Erklärung des oder der<br />
unmittelbaren Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie kann andere<br />
Beweise erheben.<br />
(4) Wird nach der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit die<br />
Dienstfähigkeit wiederhergestellt und beantragt der Ruhestandsbeamte<br />
oder die Ruhestandsbeamtin vor Ablauf von fünf Jahren seit der
Versetzung in den Ruhestand eine erneute Berufung in das<br />
Beamtenverhältnis, ist diesem Antrag zu entsprechen, falls nicht<br />
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.<br />
Bay BG Art. 66 Zwangspensionierungsverfahren<br />
(1) Hält der oder die Dienstvorgesetzte den Beamten oder die Beamtin für<br />
dienstunfähig und beantragt dieser oder diese die Versetzung in den<br />
Ruhestand nicht, so teilt der oder die Dienstvorgesetzte dem Beamten,<br />
der Beamtin, dessen oder deren Vertreter oder Vertreterin schriftlich mit,<br />
dass die Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt sei; dabei sind die<br />
Gründe für die Versetzung in den Ruhestand anzugeben.<br />
(2) 1 Gegen die Versetzung in den Ruhestand können innerhalb eines Monats<br />
Einwendungen erhoben werden. 2 Danach entscheidet die für die<br />
Versetzung in den Ruhestand zuständige Behörde. 3 Mit dem Ende des<br />
Monats, in dem die Entscheidung über die Versetzung in den Ruhestand<br />
zugestellt wird, ist bis zu deren Unanfechtbarkeit die das Ruhegehalt<br />
zuzüglich des Unterschiedsbetrags nach § 50 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG<br />
übersteigende Besoldung mit Ausnahme der vermögenswirksamen<br />
Leistungen einzubehalten. 4 Wird die Versetzung in den Ruhestand<br />
unanfechtbar aufgehoben, sind die einbehaltenen Dienstbezüge<br />
nachzuzahlen.<br />
Bay BG Art. 67 Mitteilung aus Untersuchungsbefunden<br />
(1) Wird in den Fällen des Art. 65 eine (amts-)ärztliche Untersuchung<br />
durchgeführt, teilt der Arzt oder die Ärztin im Einzelfall auf Anforderung<br />
der Behörde die tragenden Feststellungen und Gründe des Gutachtens und<br />
die in Frage kommenden Maßnahmen zur Wiederherstellung der<br />
Dienstfähigkeit mit, soweit deren Kenntnis für die Behörde unter<br />
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu<br />
treffende Entscheidung erforderlich ist.<br />
(2) 1 Die ärztliche Mitteilung über die Untersuchungsbefunde nach Abs. 1 ist in<br />
einem gesonderten, verschlossenen und versiegelten Umschlag zu<br />
übersenden. 2 Die an die Behörde übermittelten Daten dürfen nur für die<br />
nach § 26 BeamtStG zu treffende Entscheidung verarbeitet oder genutzt<br />
werden. 3 Die Mitteilung ist verschlossen zur Personalakte zu nehmen.<br />
(3) 1 Die Behörde hat vor der Untersuchung auf den Zweck der Untersuchung<br />
und auf die ärztliche Befugnis zur Übermittlung der Untersuchungsbefunde<br />
nach Abs. 1 an die Behörde hinzuweisen. 2 Der Arzt oder die Ärztin<br />
übermittelt dem Beamten oder der Beamtin oder, soweit dem ärztliche<br />
Gründe entgegenstehen, dem Vertreter oder der Vertreterin eine<br />
Ablichtung der auf Grund dieser Vorschrift an die Behörde erteilten<br />
Auskünfte.<br />
Unterabschnitt 3 Einstweiliger Ruhestand<br />
Bay BG Art. 68 Auflösung oder Umbildung von Behörden<br />
1 Bei der Auflösung einer Behörde oder bei einer auf Landesgesetz oder -<br />
verordnung beruhenden wesentlichen Änderung des Aufbaus oder<br />
Verschmelzung einer Behörde mit einer anderen Behörde kann ein Beamter
oder eine Beamtin, dessen oder deren Aufgabengebiet von der Auflösung oder<br />
Umbildung berührt wird, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden,<br />
wenn eine Versetzung nach Art. 48 nicht möglich ist. 2 Die Versetzung in den<br />
einstweiligen Ruhestand ist nur dann zulässig, wenn aus Anlass der Auflösung<br />
oder Umbildung Planstellen eingespart werden. 3 Freie Planstellen im Bereich<br />
desselben Dienstherrn sollen den in den einstweiligen Ruhestand versetzten<br />
Beamten und Beamtinnen vorbehalten werden, die für diese Stellen geeignet<br />
sind.<br />
Bay BG Art. 69 Auflösung oder Umbildung von Körperschaften<br />
(1) 1 Bei der Auflösung oder Umbildung einer Körperschaft (Art. 51) kann die<br />
aufnehmende oder neue Körperschaft, wenn die Zahl der bei ihr nach der<br />
Umbildung vorhandenen Beamten oder Beamtinnen den tatsächlichen<br />
Bedarf übersteigt, innerhalb einer Frist von sechs Monaten Beamte oder<br />
Beamtinnen auf Lebenszeit oder auf Zeit, deren Aufgabengebiet von der<br />
Umbildung berührt wurde, in den einstweiligen Ruhestand versetzen. 2 Die<br />
Frist des Satzes 1 beginnt im Fall des Art. 51 Abs. 1 mit dem Übertritt, in<br />
den Fällen des Art. 51 Abs. 2 und 3 mit der Bestimmung derjenigen<br />
Beamten oder Beamtinnen, zu deren Übernahme die Körperschaft<br />
verpflichtet ist; Entsprechendes gilt in den Fällen des Art. 51 Abs. 4.<br />
3 4<br />
Art. 68 Satz 3 gilt entsprechend. Bei Beamten oder Beamtinnen auf<br />
Zeit, die nach Satz 1 in den einstweiligen Ruhestand versetzt sind, endet<br />
der einstweilige Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit; sie gelten in diesem<br />
Zeitpunkt als dauernd in den Ruhestand versetzt, wenn sie bei Verbleiben<br />
im Amt mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand getreten wären.<br />
(2) In den Fällen einer landesübergreifenden Körperschaftsumbildung nach<br />
§ 18 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG beträgt die Frist sechs Monate; Abs. 1<br />
Satz 2 gilt in diesen Fällen entsprechend.<br />
Bay BG Art. 70 Beginn des einstweiligen Ruhestands<br />
1 Der einstweilige Ruhestand beginnt, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich ein<br />
späterer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in dem die Verfügung<br />
über die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand zugestellt wird, spätestens<br />
jedoch mit dem Ende der drei Monate, die auf den Monat der Zustellung<br />
folgen. 2 Die Verfügung kann bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestands<br />
zurückgenommen werden.<br />
Unterabschnitt 4 Gemeinsame Vorschriften<br />
Bay BG Art. 71 Zuständigkeit für Ruhestandsversetzung, Beginn des<br />
Ruhestands<br />
(1) 1 Die Versetzung in den Ruhestand sowie die Entscheidung über das<br />
Vorliegen begrenzter Dienstfähigkeit im Sinn des § 27 Abs. 1 BeamtStG<br />
wird, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, von der Behörde<br />
verfügt, die für die Ernennung zuständig wäre. 2 Die Verfügung ist<br />
zuzustellen; sie kann bis zum Beginn des Ruhestands zurückgenommen<br />
werden.
(2) Die Ruhestandsversetzung nach § 28 Abs. 2 BeamtStG bedarf der<br />
Zustimmung der obersten Dienstbehörde sowie bei Beamten und<br />
Beamtinnen des Staates der des Staatsministeriums der Finanzen.<br />
(3) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen des § 30 Abs. 4<br />
BeamtStG sowie der Art. 62, 64, 70 und 123 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 und<br />
Abs. 3 mit dem Ende des Monats, in dem die Verfügung über die<br />
Versetzung in den Ruhestand zugestellt worden ist, sofern nicht auf<br />
Antrag oder mit schriftlicher Zustimmung des Beamten oder der Beamtin<br />
ein früherer Zeitpunkt festgesetzt wird.<br />
Abschnitt 4 Dienstzeugnis<br />
Bay BG Art. 72 Dienstzeugnis<br />
1 Nach Beendigung des Beamtenverhältnisses wird auf Antrag von dem oder<br />
der letzten Dienstvorgesetzten ein Dienstzeugnis über Art und Dauer der<br />
bekleideten Ämter erteilt. 2 Das Dienstzeugnis muss auf Verlangen auch über<br />
die ausgeübte Tätigkeit, die Führung und die Leistungen Auskunft geben.<br />
Teil 4 Rechtliche Stellung der Beamten und Beamtinnen<br />
Abschnitt 1 Allgemeines<br />
Bay BG Art. 73 Eid und Gelöbnis<br />
(1) Der Diensteid nach § 38 BeamtStG hat folgenden Wortlaut:<br />
“Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland<br />
und der Verfassung des Freistaates Bayern, Gehorsam den <strong>Gesetze</strong>n und<br />
gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.”<br />
(2) 1 Der Eid kann auch ohne die Worte “so wahr mir Gott helfe” geleistet<br />
werden. 2 Erklärt ein Beamter oder eine Beamtin, dass aus Glaubens- oder<br />
Gewissensgründen kein Eid geleistet werden könne, so sind an Stelle der<br />
Worte “ich schwöre” die Worte “ich gelobe” zu sprechen oder es ist das<br />
Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis der Religionsgemeinschaft oder der<br />
Überzeugung der Weltanschauungsgemeinschaft des Beamten oder der<br />
Beamtin entsprechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten.<br />
(3) 1 In den Fällen des § 38 Abs. 3 BeamtStG kann von einer Eidesleistung<br />
abgesehen werden. 2 An die Stelle des Eides tritt dann ein Gelöbnis mit<br />
folgendem Wortlaut:<br />
“Ich gelobe, meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.”<br />
Bay BG Art. 74 Residenzpflicht<br />
(1) Der Beamte oder die Beamtin hat eine Wohnung so zu nehmen, dass die<br />
ordnungsmäßige Wahrnehmung der Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt<br />
wird.<br />
(2) Der oder die Dienstvorgesetzte kann den Beamten oder die Beamtin<br />
anweisen, die Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung von der<br />
Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen, wenn die<br />
dienstlichen Verhältnisse es erfordern.
(3) Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, kann der<br />
Beamte oder die Beamtin angewiesen werden, sich während der<br />
dienstfreien Zeit erreichbar in Nähe des Dienstorts aufzuhalten.<br />
Bay BG Art. 75 Pflicht zum Tragen von Dienstkleidung<br />
Beamte und Beamtinnen sind verpflichtet, nach näherer Bestimmung der<br />
obersten Dienstbehörde Dienstkleidung zu tragen, wenn es das Amt erfordert.<br />
Bay BG Art. 76 Amtsbezeichnung<br />
(1) Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein Amt verwendet wird, das<br />
eine bestimmte Befähigung voraussetzt und einen bestimmten<br />
Aufgabenkreis umfasst, darf nur Beamten und Beamtinnen verliehen<br />
werden, die ein solches Amt bekleiden.<br />
(2) Die Staatsregierung setzt die Amtsbezeichnungen fest, soweit gesetzlich<br />
nichts anderes bestimmt ist oder sie die Ausübung dieses Rechts nicht<br />
anderen Stellen überträgt.<br />
(3) 1 Beamte und Beamtinnen führen im Dienst die Amtsbezeichnung des<br />
ihnen übertragenen Amtes; sie dürfen sie auch außerhalb des Dienstes<br />
führen. 2 Nach dem Übertritt in ein anderes Amt darf die bisherige<br />
Amtsbezeichnung nicht mehr geführt werden; in den Fällen der<br />
Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrundgehalt gelten Abs. 4<br />
Sätze 2 und 3 entsprechend.<br />
(4) 1 Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeamtinnen dürfen die ihnen bei der<br />
Versetzung in den Ruhestand zustehende Amtsbezeichnung mit dem<br />
Zusatz “außer Dienst (a. D.)” und die im Zusammenhang mit dem Amt<br />
verliehenen Titel weiterführen. 2 Wird ihnen ein neues Amt übertragen, so<br />
erhalten sie die Amtsbezeichnung des neuen Amtes; gehört dieses Amt<br />
nicht einer Besoldungsgruppe mit mindestens demselben Endgrundgehalt<br />
an wie das bisherige Amt, so darf neben der neuen Amtsbezeichnung die<br />
des früheren Amtes mit dem Zusatz “außer Dienst (a. D.)” geführt<br />
werden. 3 Ändert sich die Bezeichnung des früheren Amtes, so darf die<br />
geänderte Amtsbezeichnung geführt werden.<br />
(5) 1 Entlassenen Beamten und Beamtinnen kann die oberste Dienstbehörde<br />
die Erlaubnis erteilen, die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz “außer Dienst<br />
(a. D.)” sowie die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu<br />
führen. 2 Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn der frühere<br />
Beamte oder die frühere Beamtin sich ihrer als nicht würdig erweist.<br />
Abschnitt 2 Folgen der Nichterfüllung von Pflichten<br />
Bay BG Art. 77 Dienstvergehen von Ruhestandsbeamten und<br />
Ruhestandsbeamtinnen<br />
Bei Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen oder früheren Beamten<br />
und Beamtinnen mit Versorgungsbezügen gilt es über § 47 BeamtStG hinaus<br />
als Dienstvergehen, wenn sie<br />
1. an Bestrebungen teilnehmen, die darauf abzielen, den Bestand oder die<br />
Sicherheit des Freistaates Bayern zu beeinträchtigen,<br />
2. entgegen § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 3 Satz 1 BeamtStG schuldhaft einer
erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis oder den Verpflichtungen nach<br />
§ 29 Abs. 4 und 5 BeamtStG nicht nachkommen,<br />
3. einer Untersagung nach § 41 Satz 2 BeamtStG zuwiderhandeln oder<br />
4. im Zusammenhang mit dem Bezug von Leistungen des Dienstherrn falsche<br />
oder pflichtwidrig unvollständige Angaben machen.<br />
Bay BG Art. 78 Verjährung der Schadensersatzpflicht und gesetzlicher<br />
Forderungsübergang<br />
(1) 1 Ansprüche nach § 48 BeamtStG verjähren in drei Jahren von dem<br />
Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von dem Schaden und der Person des<br />
oder der Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese<br />
Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. 2 Hat der<br />
Dienstherr einem Dritten Schadensersatz geleistet, so tritt an die Stelle<br />
des Zeitpunkts, in dem der Dienstherr von dem Schaden Kenntnis erlangt,<br />
der Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber<br />
vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig<br />
festgestellt wird.<br />
(2) Leistet der Beamte oder die Beamtin dem Dienstherrn Ersatz und hat<br />
dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht der<br />
Ersatzanspruch auf den Beamten oder die Beamtin über.<br />
Abschnitt 3 Beschränkung der Vornahme von Amtshandlungen<br />
Bay BG Art. 79 Befreiung von Amtshandlungen<br />
(1) Beamte und Beamtinnen sind von Amtshandlungen zu befreien, die sich<br />
gegen sie selbst oder Angehörige richten würden.<br />
(2) Gesetzliche Vorschriften, insbesondere Art. 20 BayVwVfG, nach denen<br />
Beamte und Beamtinnen von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen<br />
sind, bleiben unberührt.<br />
Abschnitt 4 Erteilung von Auskünften<br />
Bay BG Art. 80 Auskünfte an die Medien<br />
Auskünfte an die Medien erteilt die Leitung der Behörde oder die von ihr<br />
bestimmte Person.<br />
Abschnitt 5 Nebentätigkeiten und Tätigkeiten von<br />
Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen sowie früheren<br />
Beamten und Beamtinnen mit Versorgungsbezügen<br />
Bay BG Art. 81 Nebentätigkeit auf Verlangen des Dienstherrn,<br />
Genehmigungspflicht<br />
(1) Beamte und Beamtinnen sind verpflichtet, auf schriftliches Verlangen ihres<br />
Dienstherrn eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung) im<br />
öffentlichen Dienst zu übernehmen, sofern diese Tätigkeit ihrer Vorbildung
oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch<br />
nimmt.<br />
(2) 1 Beamte und Beamtinnen bedürfen zur Übernahme jeder anderen<br />
Nebentätigkeit der vorherigen Genehmigung, soweit die Nebentätigkeit<br />
nicht nach Art. 82 Abs. 1 genehmigungsfrei ist. 2 Als Nebentätigkeit gilt<br />
nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie die unentgeltliche<br />
Führung der Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft für Angehörige;<br />
ihre Übernahme ist vor Aufnahme dem oder der unmittelbaren<br />
Dienstvorgesetzten schriftlich anzuzeigen.<br />
(3) 1 Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die<br />
Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. 2 Ein solcher<br />
Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit<br />
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten oder der Beamtin so<br />
stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der<br />
dienstlichen Pflichten behindert werden kann,<br />
2. den Beamten oder die Beamtin in einen Widerstreit mit dienstlichen<br />
Pflichten bringen kann,<br />
3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der<br />
Beamte oder die Beamtin angehört, tätig wird oder tätig werden kann,<br />
4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten oder der<br />
Beamtin beeinflussen kann,<br />
5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen<br />
Verwendbarkeit des Beamten oder der Beamtin führen kann,<br />
6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann.<br />
3<br />
Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn<br />
die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in<br />
der Woche acht Stunden überschreitet. 4 Das Vorliegen eines<br />
Versagungsgrundes nach Satz 3 ist besonders zu prüfen, wenn abzusehen<br />
ist, dass die Entgelte und geldwerten Vorteile aus<br />
genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten im Kalenderjahr 30 v. H. der<br />
jährlichen Dienstbezüge des Beamten oder der Beamtin bei<br />
Vollzeitbeschäftigung überschreiten werden; das Ergebnis der Prüfung ist<br />
aktenkundig zu machen. 5 Die Genehmigung ist auf längstens fünf Jahre<br />
zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden.<br />
6<br />
Beamte und Beamtinnen können verpflichtet werden, nach Ablauf eines<br />
jeden Kalenderjahres ihren Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über alle<br />
im Kalenderjahr ausgeübten genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten<br />
und die dafür erhaltenen Entgelte und geldwerten Vorteile vorzulegen.<br />
7<br />
Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung<br />
der Genehmigung, so ist diese zu widerrufen.<br />
(4) 1 Nebentätigkeiten, die nicht auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung<br />
des Dienstherrn übernommen wurden oder bei denen der oder die<br />
Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse an der Übernahme der<br />
Nebentätigkeit nicht anerkannt hat, dürfen nur außerhalb der Arbeitszeit<br />
ausgeübt werden. 2 Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten<br />
Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn<br />
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit<br />
nachgeleistet wird.
(5) 1 Beamte und Beamtinnen dürfen bei der Ausübung von Nebentätigkeiten<br />
Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen<br />
eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit vorheriger<br />
Genehmigung und gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in<br />
Anspruch nehmen. 2 Das Entgelt hat sich nach den dem Dienstherrn<br />
entstehenden Kosten zu richten und muss den besonderen Vorteil<br />
berücksichtigen, der dem Beamten oder der Beamtin durch die<br />
Inanspruchnahme entsteht. 3 Der Beamte oder die Beamtin ist<br />
verpflichtet, soweit bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen,<br />
Personal oder Material des Dienstherrn in Anspruch genommen werden,<br />
auf Verlangen über Art und Umfang der Nebentätigkeiten, die hierdurch<br />
erzielte Vergütung sowie über Art und Umfang der Inanspruchnahme<br />
Auskunft zu geben. 4 Die Vergütung sowie Art und Umfang der<br />
Inanspruchnahme können geschätzt werden, wenn hierüber keine<br />
Auskunft gegeben wird oder über entsprechende Angaben keine<br />
ausreichende Aufklärung gegeben werden kann oder Aufzeichnungen nicht<br />
vorgelegt werden, die nach beamtenrechtlichen Rechtsvorschriften zu<br />
führen sind.<br />
(6) 1 Die Entscheidungen nach den Abs. 1 bis 5 trifft, soweit nichts anderes<br />
bestimmt ist, die oberste Dienstbehörde. 2 Sie kann ihre Befugnisse durch<br />
Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.<br />
(7) 1 Anträge auf Erteilung einer Genehmigung (Abs. 2) oder auf Zulassung<br />
einer Ausnahme (Abs. 4 Satz 2) und Entscheidungen über diese Anträge<br />
bedürfen der Schriftform. 2 Von den Beamten und Beamtinnen sind die für<br />
die Entscheidung erforderlichen Nachweise über Art und Umfang der<br />
Nebentätigkeit zu führen. 3 Das dienstliche Interesse (Abs. 4 Satz 1) ist<br />
aktenkundig zu machen.<br />
Bay BG Art. 82 Genehmigungsfreie Nebentätigkeit<br />
(1) 1 Nicht genehmigungspflichtig ist<br />
1. eine Nebentätigkeit, die auf Vorschlag oder Veranlassung des<br />
Dienstherrn übernommen wird,<br />
2. eine unentgeltliche Nebentätigkeit mit Ausnahme<br />
a) der Übernahme eines Nebenamtes, einer in Art. 81 Abs. 2 Satz 2<br />
Halbsatz 1 nicht genannten Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft<br />
sowie einer Testamentsvollstreckung,<br />
b) der Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, der Ausübung eines freien<br />
Berufs oder der Mitarbeit bei einer dieser Tätigkeiten,<br />
c) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens, sofern es sich bei dem<br />
Unternehmen nicht um eine Genossenschaft handelt, sowie der<br />
Übernahme einer Treuhänderschaft,<br />
3. die Verwaltung eigenen oder der eigenen Nutznießung unterliegenden<br />
Vermögens,<br />
4. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische Tätigkeit oder<br />
Vortragstätigkeit,<br />
5. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende<br />
selbstständige Gutachtertätigkeit von Professoren und Professorinnen an<br />
staatlichen Hochschulen sowie von Beamten und Beamtinnen an<br />
wissenschaftlichen Instituten und Anstalten,
6. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder<br />
Berufsverbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten und<br />
Beamtinnen.<br />
2<br />
Die Unentgeltlichkeit einer Nebentätigkeit nach Satz 1 Nr. 2 wird durch<br />
die Gewährung einer angemessenen Aufwandsentschädigung oder einer<br />
Gegenleistung von geringem Wert nicht ausgeschlossen.<br />
(2) 1 Liegen Anhaltspunkte für eine Verletzung von Dienstpflichten vor,<br />
können Dienstvorgesetzte verlangen, dass Beamte und Beamtinnen über<br />
Art und Umfang nicht genehmigungspflichtiger Nebentätigkeiten und die<br />
hieraus erzielten Vergütungen schriftlich Auskunft erteilen und die<br />
erforderlichen Nachweise führen. 2 Eine nicht genehmigungspflichtige<br />
Nebentätigkeit ist von den Dienstvorgesetzten ganz oder teilweise zu<br />
untersagen, wenn bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt<br />
werden.<br />
(3) Art. 81 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend.<br />
Bay BG Art. 83 Rückgriffshaftung des Dienstherrn<br />
1 Werden Beamte und Beamtinnen aus ihrer Tätigkeit im Vorstand,<br />
Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Gesellschaft,<br />
Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen<br />
Unternehmens, die sie auf schriftliches Verlangen, Vorschlag oder<br />
Veranlassung des Dienstherrn übernommen haben, haftbar gemacht, so<br />
besteht gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen<br />
Schadens. 2 Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt<br />
worden, so ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn der Beamte oder<br />
die Beamtin auf schriftliches Verlangen eines oder einer Vorgesetzten<br />
gehandelt hat.<br />
Bay BG Art. 84 Beendigung der Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst<br />
Endet das Beamtenverhältnis, so enden, wenn im Einzelfall nichts anderes<br />
bestimmt wird, auch die Nebenämter und Nebenbeschäftigungen, die im<br />
Zusammenhang mit dem Hauptamt übertragen worden sind oder die auf<br />
schriftliches Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn<br />
übernommen worden sind.<br />
Bay BG Art. 85 Ausführungsverordnung<br />
(1) 1 Die zur Ausführung der Art. 81 bis 84 notwendigen Vorschriften über die<br />
Nebentätigkeit erlässt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 2 In<br />
ihr kann auch bestimmt werden,<br />
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinn dieser Vorschriften<br />
anzusehen sind oder ihm gleichstehen,<br />
2. ob und inwieweit für eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf<br />
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommene<br />
Nebentätigkeit eine Vergütung gezahlt wird oder eine erhaltene Vergütung<br />
abzuführen ist und diese Vergütung geschätzt werden kann, wenn<br />
hierüber keine Auskunft gegeben wird oder über entsprechende Angaben<br />
keine ausreichende Aufklärung gegeben werden kann oder<br />
Aufzeichnungen nicht vorgelegt werden, die nach beamtenrechtlichen<br />
Rechtsvorschriften zu führen sind,
3. inwieweit Auskunft über eine Vergütung aus einer<br />
genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit zu erteilen ist,<br />
4. unter welchen Voraussetzungen bei der Ausübung von Nebentätigkeiten<br />
Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn in Anspruch<br />
genommen werden dürfen und welches Entgelt hierfür zu entrichten ist,<br />
5. das Nähere hinsichtlich der Auskunftspflicht nach Art. 81 Abs. 3 Satz 6<br />
und Abs. 5 Satz 3, Art. 82 Abs. 2 und 3, der Schätzung nach Art. 81<br />
Abs. 5 Satz 4, Art. 82 Abs. 3 sowie der Unentgeltlichkeit nach Art. 82<br />
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2.<br />
(2) 1 Im staatlichen Bereich kann das zuständige Staatsministerium in<br />
Ergänzung einer Rechtsverordnung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 die Höhe der<br />
Vergütung für eine Nebentätigkeit durch Verwaltungsvorschriften regeln.<br />
2<br />
Wird eine Verwaltungsvorschrift nicht erlassen, ist die Höhe der<br />
Vergütung vom zuständigen Staatsministerium durch Einzelentscheidung<br />
zu bestimmen. 3 Verwaltungsvorschriften und Einzelentscheidungen<br />
bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen.<br />
Bay BG Art. 86 Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit von<br />
Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen sowie früheren<br />
Beamten und Beamtinnen mit Versorgungsbezügen<br />
(1) 1 Der Zeitraum, in dem die Pflicht der Anzeige einer Erwerbstätigkeit oder<br />
sonstigen Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes im Sinn des<br />
§ 41 Satz 1 BeamtStG besteht, beträgt fünf Jahre vor Beendigung des<br />
Beamtenverhältnisses. 2 Die Tätigkeit gemäß § 41 Satz 1 BeamtStG ist der<br />
letzten obersten Dienstbehörde gegenüber anzuzeigen. 3 Die<br />
Anzeigepflicht endet nach<br />
1. drei Jahren, wenn das Beamtenverhältnis mit dem Erreichen der in<br />
Art. 62 genannten gesetzlichen Altersgrenze, oder zu einem späteren<br />
Zeitpunkt beendet worden ist,<br />
2. fünf Jahren, spätestens jedoch bei Vollendung des 68. Lebensjahres,<br />
wenn das Beamtenverhältnis zu einem früheren Zeitpunkt beendet worden<br />
ist.<br />
(2) 1 Die Untersagung wird durch die letzte oberste Dienstbehörde<br />
ausgesprochen. 2 Sie endet mit Ablauf des Zeitraums, für den eine<br />
Anzeigepflicht nach Abs. 1 besteht, spätestens mit Ablauf des in § 41<br />
Satz 3 BeamtStG genannten Zeitpunkts. 3 Die oberste Dienstbehörde kann<br />
ihre Befugnisse durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.<br />
Abschnitt 6 Arbeitszeit, Teilzeit und Beurlaubung<br />
Bay BG Art. 87 Regelung der Arbeitszeit, Mehrarbeit<br />
(1) Die Staatsregierung regelt die Arbeitszeit durch Rechtsverordnung.<br />
(2) 1 Beamte und Beamtinnen sind verpflichtet, ohne Entschädigung über die<br />
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn<br />
zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit<br />
auf Ausnahmefälle beschränkt. 2 Werden sie durch dienstlich angeordnete<br />
oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die<br />
regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, ist innerhalb eines Jahres für
die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit<br />
entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. 3 Ist die Dienstbefreiung aus<br />
zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle<br />
Beamte und Beamtinnen in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden<br />
Gehältern eine Vergütung erhalten.<br />
(3) 1 Zur Bewältigung eines länger andauernden, aber vorübergehenden<br />
Personalbedarfs kann eine ungleichmäßige Verteilung der regelmäßigen<br />
Arbeitszeit festgelegt werden. 2 Hierbei soll die Arbeitszeit zehn Stunden<br />
am Tag und im Jahresdurchschnitt 48 Stunden in der Woche nicht<br />
überschreiten. 3 Die ungleichmäßige Verteilung der regelmäßigen<br />
Arbeitszeit soll einen Zeitraum von zehn Jahren nicht übersteigen. 4 Die<br />
Arbeitszeiterhöhung ist durch eine Minderung der Arbeitszeit vollständig<br />
auszugleichen; die Minderung der Arbeitszeit muss sich nicht unmittelbar<br />
an den Zeitraum der Arbeitszeiterhöhung anschließen. 5 Der Ausgleich<br />
kann auch durch eine volle Freistellung vom Dienst vorgenommen werden.<br />
6<br />
Für teilzeitbeschäftigte Beamte und Beamtinnen gilt Art. 88 Abs. 5<br />
entsprechend.<br />
(4) 1 Vollzeitbeschäftigten Beamten und Beamtinnen kann auf Antrag eine<br />
längerfristige ungleichmäßige Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit<br />
bewilligt werden, wenn zwingende dienstliche Belange nicht<br />
entgegenstehen. 2 Abs. 3 Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend.<br />
(5) 1 Werden Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vor dem 31. Juli 2011 durch<br />
eine dienstlich angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als drei<br />
Unterrichtsstunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus<br />
beansprucht, ist ihnen abweichend von Abs. 2 Sätze 2 und 3 innerhalb<br />
von drei Monaten für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus<br />
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren, wenn<br />
sie Fächer unterrichten, in denen ein außergewöhnlicher Bewerbermangel<br />
besteht. 2 Ist die Dienstbefreiung nach Satz 1 aus zwingenden dienstlichen<br />
Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle Lehrkräfte in<br />
Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern eine Vergütung erhalten.<br />
3<br />
Der Vorrang der Gewährung von Dienstbefreiung entfällt, wenn die<br />
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in den Fächern Mathematik und<br />
Informatik sowie in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern an<br />
Gymnasien, Realschulen und an beruflichen Schulen es zwingend erfordert<br />
und das Staatsministerium der Finanzen zustimmt. 4 Ausgaben nach den<br />
Sätzen 2 und 3 sind im Einzelplan gegen zu finanzieren durch gezielte<br />
Sperre freier und besetzbarer Stellen oder bei den übrigen<br />
Personalausgabemitteln.<br />
Bay BG Art. 88 Antragsteilzeit<br />
(1) Beamten und Beamtinnen mit Dienstbezügen soll auf Antrag die<br />
Arbeitszeit bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und bis zur<br />
jeweils beantragten Dauer ermäßigt werden, soweit dienstliche Belange<br />
nicht entgegenstehen.<br />
(2) 1 Dem Antrag nach Abs. 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte<br />
oder die Beamtin sich verpflichtet, während des Bewilligungszeitraums<br />
außerhalb des Beamtenverhältnisses berufliche Verpflichtungen nur in<br />
dem Umfang einzugehen, in dem nach Art. 81 ff. den vollzeitbeschäftigten
Beamten und Beamtinnen die Ausübung von Nebentätigkeiten gestattet<br />
ist. 2 Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit dies mit dem<br />
Beamtenverhältnis vereinbar ist. 3 Wird die Verpflichtung nach Satz 1<br />
schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden.<br />
(3) 1 Die zuständige Dienstbehörde kann auch nachträglich die Dauer der<br />
Teilzeitbeschäftigung beschränken oder den Umfang der zu leistenden<br />
Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende dienstliche Belange dies erfordern.<br />
2<br />
Sie soll eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den<br />
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zulassen, wenn die<br />
Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht zumutbar ist und<br />
dienstliche Belange nicht entgegenstehen.<br />
(4) 1 Wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, kann die<br />
Bewilligung der Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 1 in der Weise zugelassen<br />
werden, dass zunächst während eines Teils des Bewilligungszeitraums die<br />
Arbeitszeit bis zur regelmäßigen Arbeitszeit erhöht und diese<br />
Arbeitszeiterhöhung während des unmittelbar daran anschließenden Teils<br />
des Bewilligungszeitraums durch eine entsprechende Ermäßigung der<br />
Arbeitszeit oder durch eine ununterbrochene volle Freistellung vom Dienst<br />
ausgeglichen wird. 2 Der gesamte Bewilligungszeitraum darf höchstens<br />
sieben Jahre betragen.<br />
(5) 1 Treten während des Bewilligungszeitraums einer Teilzeitbeschäftigung<br />
nach Abs. 4 Umstände ein, welche die vorgesehene Abwicklung der vollen<br />
oder teilweisen Freistellung unmöglich machen, ist ein Widerruf<br />
abweichend von Art. 49 BayVwVfG auch mit Wirkung für die<br />
Vergangenheit in folgenden Fällen zulässig:<br />
1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses,<br />
2. beim Dienstherrnwechsel,<br />
3. bei Gewährung von Urlaub nach Art. 90 Abs. 1 Nr. 2 oder<br />
4. in besonderen Härtefällen, wenn dem Beamten oder der Beamtin die<br />
Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten ist.<br />
2<br />
Der Widerruf darf nur mit Wirkung für den gesamten<br />
Bewilligungszeitraum und nur in dem Umfang erfolgen, der der<br />
tatsächlichen Arbeitszeit entspricht.<br />
(6) 1 Wird langfristig Urlaub nach einer anderen als der in Abs. 5 Satz 1 Nr. 3<br />
genannten Vorschrift bewilligt, verlängert sich der Bewilligungszeitraum<br />
um die Dauer der Beurlaubung. 2 Auf Antrag oder aus dienstlichen<br />
Gründen kann die Bewilligung widerrufen werden.<br />
Bay BG Art. 89 Familienpolitische Teilzeit und Beurlaubung<br />
(1) Beamten und Beamtinnen mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn<br />
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen,<br />
1. zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege von mindestens einem Kind<br />
unter 18 Jahren oder einem oder einer nach ärztlichem Gutachten<br />
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen Teilzeitbeschäftigung in einem<br />
Umfang von mindestens durchschnittlich wöchentlich acht Stunden oder<br />
Urlaub ohne Dienstbezüge,<br />
2. während der Elternzeit Teilzeitbeschäftigung auch mit weniger als<br />
wöchentlich acht Stunden<br />
zu gewähren.
(2) 1 Der Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung soll spätestens sechs<br />
Monate vor Ablauf der Genehmigung einer Beurlaubung gestellt werden.<br />
2 3<br />
Art. 88 Abs. 3 gilt entsprechend. Die zuständige Dienstbehörde kann<br />
eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn die Fortsetzung des<br />
Urlaubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht<br />
entgegenstehen.<br />
(3) 1 Während einer Freistellung vom Dienst nach Abs. 1 dürfen nur solche<br />
Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht<br />
zuwiderlaufen. 2 Die Vorschriften der Art. 81 bis 85 bleiben unberührt.<br />
(4) 1 Während der Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Abs. 1<br />
besteht ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in<br />
entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Beamte und<br />
Beamtinnen mit Dienstbezügen. 2 Dies gilt nicht, wenn Beamte oder<br />
Beamtinnen berücksichtigungsfähige Angehörige von Beihilfeberechtigten<br />
werden oder Anspruch auf Familienhilfe nach § 10 des Fünften Buches<br />
Sozialgesetzbuch (SGB V) haben.<br />
Bay BG Art. 90 Arbeitsmarktpolitische Beurlaubung<br />
(1) Beamten und Beamtinnen mit Dienstbezügen nach Ablauf der Probezeit<br />
kann in einer Arbeitsmarktsituation, in der ein außergewöhnlicher<br />
Bewerbungsüberhang besteht und deshalb ein dringendes öffentliches<br />
Interesse daran gegeben ist, verstärkt Personen im öffentlichen Dienst zu<br />
beschäftigen,<br />
1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt<br />
sechs Jahren, mindestens von einem Jahr,<br />
2. unbeschadet Nr. 1 nach Vollendung des 50. Lebensjahres auf Antrag,<br />
der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss,<br />
Urlaub ohne Dienstbezüge<br />
bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen.<br />
(2) 1 Dem Antrag nach Abs. 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte<br />
oder die Beamtin erklärt, während der Dauer des Bewilligungszeitraums<br />
auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und<br />
entgeltliche Tätigkeiten nach Art. 82 Abs. 1 Nrn. 4 bis 6 nur in dem<br />
Umfang auszuüben, wie sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung<br />
dienstlicher Pflichten ausgeübt werden könnten. 2 Wird diese Verpflichtung<br />
schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. 3 Die<br />
zuständige Dienstbehörde darf trotz der Erklärung nach Satz 1<br />
Nebentätigkeiten genehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des<br />
Urlaubs nicht zuwiderlaufen. 4 Art. 89 Abs. 2 Sätze 1 und 3 gelten<br />
entsprechend.<br />
Bay BG Art. 91 Altersteilzeit<br />
(1) 1 Beamten und Beamtinnen mit Dienstbezügen, die das 60. Lebensjahr<br />
vollendet haben, kann auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des<br />
Ruhestands erstrecken muss, eine Teilzeitbeschäftigung mit 60 v. H. der<br />
in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich<br />
geleisteten Arbeitszeit bewilligt werden, wenn dringende dienstliche<br />
Belange nicht entgegenstehen; bei schwerbehinderten Beamten und<br />
Beamtinnen im Sinn des § 2 Abs. 2 SGB IX tritt an die Stelle des 60. das
58. Lebensjahr. 2 Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen gilt als<br />
Altersgrenze der Beginn des Schuljahres, in dem diese das nach Satz 1<br />
maßgebliche Lebensjahr vollenden. 3 Bei Altersteilzeit im Blockmodell<br />
(Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) gilt als Beginn des Ruhestands der Zeitpunkt, der für<br />
den Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der gesetzlichen<br />
Altersgrenze oder nach Art. 64 Nr. 2 maßgebend ist, soweit nicht<br />
besonders schwerwiegende Gründe im Sinn des Art. 64 Nr. 1 vorliegen.<br />
4<br />
Altersteilzeit nach Satz 1 muss einen Mindestbewilligungszeitraum von<br />
einem Jahr umfassen.<br />
(2) 1 Entsprechend den dienstlichen Erfordernissen kann die während der<br />
Gesamtdauer der Altersteilzeit zu leistende Arbeit so eingebracht werden,<br />
dass sie<br />
1. während des gesamten Bewilligungszeitraums durchgehend im nach<br />
Abs. 1 Satz 1 festgesetzten Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder<br />
2. zunächst im Umfang der in den letzten fünf Jahren vor Beginn der<br />
Altersteilzeit durchschnittlich festgesetzten Arbeitszeit oder im Umfang der<br />
vor Beginn der Altersteilzeit zuletzt festgesetzten Arbeitszeit geleistet wird<br />
und der Beamte oder die Beamtin anschließend vollständig vom Dienst<br />
freigestellt wird (Blockmodell).<br />
2 3<br />
Art. 88 Abs. 2 gilt entsprechend. Treten während des<br />
Bewilligungszeitraums einer nach Satz 1 Nr. 2 im Blockmodell bewilligten<br />
Altersteilzeit Umstände ein, welche die vorgesehene Abwicklung der<br />
Freistellung vom Dienst unmöglich machen, so ist die gewährte<br />
Altersteilzeit abweichend von Art. 49 BayVwVfG mit Wirkung für die<br />
Vergangenheit in folgenden Fällen zu widerrufen:<br />
1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses,<br />
2. beim Dienstherrnwechsel,<br />
3. bei Gewährung von Urlaub nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 oder Art. 90 Abs. 1<br />
Nr. 2 oder<br />
4. in besonderen Härtefällen, wenn dem Beamten oder der Beamtin die<br />
Fortsetzung der Altersteilzeit nicht mehr zuzumuten ist.<br />
4<br />
Ein Widerruf erfolgt nicht, soweit Zeiten aus der Ansparphase durch eine<br />
gewährte Freistellung bereits ausgeglichen wurden; dabei gelten die<br />
unmittelbar vor dem Eintritt in die Freistellungsphase liegenden<br />
Ansparzeiten als durch die Freistellung ausgeglichen. 5 Gleichzeitig mit<br />
dem Widerruf wird der Arbeitszeitstatus entsprechend des in der<br />
Ansparphase geleisteten und nicht durch Freistellung ausgeglichenen<br />
Arbeitszeitumfangs festgesetzt. 6 Soweit bei der Festsetzung der<br />
wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung von Lehrkräften an öffentlichen<br />
Schulen Rundungen vorzunehmen sind, um eine in vollen Stunden<br />
bemessene Unterrichtsverpflichtung zu erreichen, sollen die entstandenen<br />
Rundungsdifferenzen im Lauf des Bewilligungszeitraums durch eine<br />
entsprechende Reduzierung oder Erhöhung der wöchentlichen<br />
Unterrichtsverpflichtung ausgeglichen werden.<br />
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Amtschefs und Amtschefinnen,<br />
Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen sowie vergleichbare<br />
Funktionsinhaber und Funktionsinhaberinnen bei staatlichen obersten<br />
Dienstbehörden sowie für die Leiter und Leiterinnen von staatlichen<br />
Behörden, deren Ämter nach Art. 45 im Beamtenverhältnis auf Zeit
vergeben werden oder die mindestens in der Besoldungsgruppe R 3<br />
eingestuft sind.<br />
(4) 1 In Bereichen, in denen wegen grundlegender<br />
Verwaltungsreformmaßnahmen in wesentlichem Umfang (Plan-)Stellen<br />
abgebaut werden, gilt abweichend von Abs. 1 als Altersgrenze das<br />
vollendete 55. Lebensjahr, sofern die betroffene Planstelle oder eine<br />
(Plan-)Stelle derselben Laufbahngruppe sukzessive, entsprechend ihres<br />
Freiwerdens, vollständig gesperrt und in den nachfolgenden<br />
Haushaltsplänen eingezogen wird. 2 Abs. 3 findet in diesen<br />
Verwaltungsbereichen keine Anwendung. 3 Die Staatsregierung wird für<br />
den staatlichen Bereich ermächtigt, die Bereiche im Sinn des Satzes 1<br />
sowie nähere Bestimmungen zum Vollzug der Einsparungen durch<br />
Rechtsverordnung festzulegen. 4 Die Gemeinden, Gemeindeverbände und<br />
sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften,<br />
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können innerhalb ihres<br />
Zuständigkeitsbereichs die Bereiche im Sinn des Satzes 1 sowie nähere<br />
Bestimmungen zum Vollzug der Einsparungen festlegen.<br />
Bay BG Art. 92 Zeitliche Höchstgrenzen, Zuständigkeit, Hinweispflicht<br />
(1) 1 Die Dauer von Beurlaubungen nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1, Art. 90 Abs. 1<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s oder Art. 8, 8 b des Bayerischen Richtergesetzes darf<br />
insgesamt 15 Jahre nicht überschreiten. 2 Bei Beamten und Beamtinnen<br />
im Schul- oder Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum einer<br />
Beurlaubung nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 oder Art. 90 Abs. 1 Nr. 1 auch beim<br />
Wegfall der tatbestandlichen Voraussetzungen bis zum Ende des<br />
laufenden Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden. 3 In den<br />
Fällen des Art. 90 Abs. 1 Nr. 2 findet Satz 1 keine Anwendung, wenn eine<br />
Rückkehr zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nicht zumutbar ist.<br />
(2) 1 Die Entscheidungen nach Art. 88 bis 91 trifft die oberste Dienstbehörde;<br />
sie kann ihre Befugnisse durch Rechtsverordnung auf andere Behörden<br />
übertragen. 2 Für Beamte und Beamtinnen, für deren Ernennung nach<br />
Art. 18 Abs. 1 Satz 1 die Staatsregierung zuständig ist, trifft die<br />
Entscheidung nach Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 die Staatsregierung.<br />
(3) Bei der Beantragung einer Freistellung nach Art. 88 bis 91 ist durch die<br />
zuständige Dienststelle auf die rechtlichen Folgen der Freistellung<br />
hinzuweisen.<br />
Bay BG Art. 93 Erholungs- und Sonderurlaub<br />
(1) Die Staatsregierung regelt die Erteilung und Dauer des Erholungsurlaubs<br />
durch Rechtsverordnung.<br />
(2) Die Staatsregierung regelt ferner die Bewilligung von Urlaub aus anderen<br />
Anlässen und bestimmt, ob und inwieweit die Leistungen des Dienstherrn<br />
während dieser Zeit zu belassen sind.<br />
(3) Hinsichtlich der Wahl des Urlaubsorts (Abs. 1 und 2) können<br />
Beschränkungen auferlegt werden, wenn es die öffentliche Sicherheit<br />
zwingend erfordert.<br />
(4) 1 Der zu einer Tätigkeit als Mitglied einer kommunalen Vertretung<br />
notwendige Urlaub ist zu gewähren, soweit es sich um die Teilnahme an
Sitzungen handelt, in denen der Beamte oder die Beamtin Sitz und<br />
Stimme hat. 2 Die Leistungen des Dienstherrn werden während des<br />
Urlaubs belassen.<br />
(5) Die Gewährung von Wahlvorbereitungsurlaub für Beamte und<br />
Beamtinnen, die sich um einen Sitz im Deutschen Bundestag, im<br />
Bayerischen Landtag oder in der gesetzgebenden Körperschaft eines<br />
anderen Landes bewerben, richtet sich nach Art. 28 des Bayerischen<br />
Abgeordnetengesetzes.<br />
Bay BG Art. 94 Rechtsfolgen der Wahl in das Parlament eines anderen<br />
Landes<br />
(1) Für Beamte und Beamtinnen, die in gesetzgebende Körperschaften<br />
anderer Länder gewählt worden sind und deren Amt kraft <strong>Gesetze</strong>s mit<br />
dem Mandat unvereinbar ist, gelten die für die in den Bayerischen Landtag<br />
gewählten Beamten und Beamtinnen maßgebenden Vorschriften in den<br />
Art. 16 Abs. 3, Art. 30 bis 34, 35 Abs. 1 bis 3 des Bayerischen<br />
Abgeordnetengesetzes entsprechend.<br />
(2) 1 Beamten und Beamtinnen, die in gesetzgebende Körperschaften anderer<br />
Länder gewählt worden sind und deren Rechte und Pflichten aus dem<br />
Dienstverhältnis nicht nach Abs. 1 ruhen, ist zur Ausübung des Mandats<br />
auf Antrag<br />
1. die Arbeitszeit bis auf 30 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit zu<br />
ermäßigen oder<br />
2. ein Urlaub ohne Besoldung zu gewähren.<br />
2<br />
Der Antrag soll jeweils für einen Zeitraum von mindestens sechs<br />
Monaten gestellt werden. 3 Art. 16 Abs. 3 des Bayerischen<br />
Abgeordnetengesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 4 Auf Beamte und<br />
Beamtinnen, denen nach Satz 1 Nr. 2 Urlaub ohne Besoldung gewährt<br />
wird, ist Art. 32 Abs. 1, 3 und 4 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes<br />
sinngemäß anzuwenden.<br />
Bay BG Art. 95 Fernbleiben vom Dienst<br />
(1) 1 Beamte und Beamtinnen dürfen dem Dienst nicht ohne Genehmigung<br />
ihrer Dienstvorgesetzten fernbleiben. 2 Dienstunfähigkeit wegen Krankheit<br />
ist auf Verlangen nachzuweisen. 3 Wollen Beamte und Beamtinnen<br />
während einer Krankheit ihren Wohnort verlassen, so haben sie dies<br />
vorher ihren Dienstvorgesetzten anzuzeigen und ihren Aufenthaltsort<br />
anzugeben.<br />
(2) Verliert der Beamte oder die Beamtin wegen unentschuldigten<br />
Fernbleibens vom Dienst nach dem Bundesbesoldungsgesetz den<br />
Anspruch auf Bezüge, so wird dadurch eine disziplinarische Verfolgung<br />
nicht ausgeschlossen.<br />
(3) 1 In allen übrigen Fällen, in denen der Beamte oder die Beamtin außer<br />
Dienst gestellt worden ist, können ein anderes Einkommen oder ein<br />
beamtenrechtlicher Unterhaltsbeitrag, die infolge der unterbliebenen<br />
Dienstleistung für diesen Zeitraum erzielt werden konnten, auf die<br />
Leistungen des Dienstherrn angerechnet werden, wenn die<br />
Nichtanrechnung zu einem ungerechtfertigten Vorteil führen würde. 2 Der<br />
Beamte oder die Beamtin ist zur Auskunft verpflichtet. 3 In den Fällen
einer vorläufigen Dienstenthebung auf Grund eines Disziplinarverfahrens<br />
finden die besonderen Vorschriften des Disziplinarrechts Anwendung.<br />
Abschnitt 7 Besondere Fürsorgepflichten<br />
Bay BG Art. 96 Beihilfe in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen<br />
Fällen<br />
(1) Beamte und Beamtinnen, Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeamtinnen,<br />
deren versorgungsberechtigte Hinterbliebene, Dienstanfänger und<br />
Dienstanfängerinnen sowie frühere Beamte und Beamtinnen, die wegen<br />
Dienstunfähigkeit oder Erreichen der Altersgrenze entlassen sind, erhalten<br />
für sich, den Ehegatten, soweit dessen Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2<br />
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes) im zweiten Kalenderjahr vor der<br />
Stellung des Beihilfeantrags 18 000 € nicht übersteigt, und die im<br />
Familienzuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz<br />
berücksichtigungsfähigen Kinder Beihilfen als Ergänzung der aus den<br />
laufenden Bezügen zu bestreitenden Eigenvorsorge, solange ihnen<br />
laufende Besoldungs- und Versorgungsbezüge zustehen.<br />
(2) 1 Beihilfeleistungen werden zu den nachgewiesenen medizinisch<br />
notwendigen und angemessenen Aufwendungen in Krankheits-, Geburtsund<br />
Pflegefällen und zur Gesundheitsvorsorge gewährt. 2 Beihilfen dürfen<br />
nur gewährt werden, soweit die Beihilfe und Leistungen Dritter aus<br />
demselben Anlass die dem Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen<br />
nicht überschreiten. 3 Sind die finanziellen Folgen von Krankheit, Geburt,<br />
Pflege und Gesundheitsvorsorge durch Leistungen aus anderen<br />
Sicherungssystemen dem Grunde nach abgesichert, erfolgt keine<br />
zusätzliche Gewährung von Beihilfeleistungen; Sachleistungen sind<br />
vorrangig in Anspruch zu nehmen. 4 Soweit nur Zuschüsse zustehen, sind<br />
diese anzurechnen. 5 Der Anspruch auf Beihilfeleistungen ist bei<br />
Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung beschränkt auf<br />
Leistungen für Zahnersatz, für Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen und<br />
auf Wahlleistungen im Krankenhaus. 6 Aufwendungen für den Besuch<br />
schulischer oder vorschulischer Einrichtungen und berufsfördernde<br />
Maßnahmen sowie Aufwendungen für einen Schwangerschaftsabbruch,<br />
sofern nicht die Voraussetzungen des § 218 a Abs. 2 oder 3 des<br />
Strafgesetzbuchs vorliegen, sind von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen.<br />
7<br />
Bei Inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankenhaus sind nach<br />
Anwendung der persönlichen Bemessungssätze folgende<br />
Eigenbeteiligungen abzuziehen:<br />
1. wahlärztliche Leistungen:<br />
25 € pro Aufenthaltstag im Krankenhaus,<br />
2. Wahlleistung Zweibett-Zimmer:<br />
7,50 € pro Aufenthaltstag im Krankenhaus,<br />
höchstens für 30 Tage im Kalenderjahr.<br />
(3) 1 Beihilfen werden als Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen<br />
(Bemessungssatz) oder als Pauschalen gewährt. 2 Der Bemessungssatz<br />
beträgt bei Beamten und Beamtinnen sowie Richtern und Richterinnen
50 v. H., bei Ehegatten sowie bei Versorgungsempfängern und<br />
Versorgungsempfängerinnen 70 v. H., bei Kindern und eigenständig<br />
beihilfeberechtigten Waisen 80 v. H. 3 Sind zwei oder mehr Kinder<br />
berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz eines oder einer<br />
Beihilfeberechtigten 70 v. H.; bei mehreren Beihilfeberechtigten beträgt<br />
der Bemessungssatz nur bei einem von ihnen 70 v. H. 4 In besonderen<br />
Ausnahmefällen kann eine Erhöhung der Bemessungssätze vorgesehen<br />
werden. 5 Die festgesetzte Beihilfe ist um<br />
1. 6 € je Rechnungsbeleg bei ambulanten ärztlichen, zahnärztlichen,<br />
psychotherapeutischen Leistungen sowie bei Leistungen von Heilpraktikern<br />
und Heilpraktikerinnen,<br />
2. 3 € je verordnetem Arzneimittel, Verbandmittel und Medizinprodukt,<br />
jedoch nicht mehr als die tatsächlich gewährte Beihilfe zu mindern<br />
(Eigenbeteiligung). 6 Die Eigenbeteiligung unterbleibt<br />
1. bei Aufwendungen für Waisen, für Beamte und Beamtinnen auf<br />
Widerruf im Vorbereitungsdienst, und für berücksichtigungsfähige Kinder,<br />
2. für Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Angehörige, die<br />
Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sind,<br />
3. bei Pflegemaßnahmen,<br />
4. bei ärztlich veranlassten Folgeuntersuchungen durch andere Fachärzte<br />
und Fachärztinnen, die entsprechend dem jeweiligen Berufsbild selbst<br />
keine therapeutischen Leistungen erbringen,<br />
5. bei anerkannten Vorsorgeleistungen und<br />
6. soweit sie für die Beihilfeberechtigten und ihre<br />
berücksichtigungsfähigen Ehegatten zusammen die Belastungsgrenze<br />
überschreitet.<br />
7<br />
Die Belastungsgrenze beträgt 2 v. H. der Jahresdienst- bzw.<br />
Jahresversorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder<br />
Grundsätzen ohne die kinderbezogenen Anteile im Familienzuschlag sowie<br />
der Jahresrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und einer<br />
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung. 8 Für chronisch<br />
Kranke im Sinn des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beträgt die<br />
Belastungsgrenze 1 v. H., es sei denn, sie haben die wichtigsten<br />
evidenzbasierten Untersuchungen nicht regelmäßig in Anspruch<br />
genommen oder beteiligen sich nicht hinreichend an einer adäquaten<br />
Therapie.<br />
(4) 1 Die obersten Dienstbehörden setzen die Beihilfen fest und ordnen die<br />
Zahlung an. 2 Sie können diese Befugnisse auf andere Dienststellen<br />
übertragen. 3 Die Festsetzung und Anordnung der Beihilfe im staatlichen<br />
Bereich erfolgt durch das Landesamt für Finanzen; die sonstigen<br />
Befugnisse der obersten Dienstbehörden beim Vollzug der<br />
Beihilfevorschriften können auf das Staatsministerium der Finanzen<br />
übertragen werden. 4 Abweichungen von Satz 3 Halbsatz 1 sind durch<br />
Rechtsverordnung der Staatsregierung zu regeln. 5 Die Gemeinden,<br />
Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Staates<br />
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen<br />
Rechts können zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Abs. 1 eine<br />
Versicherung abschließen oder sich der Dienstleistungen von<br />
Versicherungsunternehmen oder sonstiger geeigneter Stellen bedienen<br />
und hierzu die erforderlichen Daten übermitteln; die Zuerkennung der
Eignung setzt voraus, dass die mit der Beihilfebearbeitung betrauten<br />
Personen nach dem Verpflichtungsgesetz zur Wahrung der Daten<br />
verpflichtet werden. 6 Die mit der Beihilfebearbeitung beauftragte Stelle<br />
darf die Daten, die ihr im Rahmen der Beihilfebearbeitung bekannt<br />
werden, nur für diesen Zweck verarbeiten und nutzen. 7 § 50 Satz 3<br />
BeamtStG, Art. 105 Satz 4, Art. 107 und 110 gelten entsprechend.<br />
(5) 1 Das Nähere hinsichtlich des Kreises der beihilfeberechtigten Personen<br />
und der berücksichtigungsfähigen Angehörigen, des Inhalts und Umfangs<br />
der Beihilfen sowie des Verfahrens der Beihilfengewährung regelt das<br />
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung. 2 Insbesondere<br />
können Bestimmungen getroffen werden<br />
1. hinsichtlich des Kreises der beihilfeberechtigten Personen und der<br />
berücksichtigungsfähigen Angehörigen über<br />
a) Konkurrenzregelungen für den Fall des Zusammentreffens mehrerer<br />
inhaltsgleicher Ansprüche auf Beihilfeleistungen in einer Person,<br />
b) die Gewährung von Beihilfeleistungen für Ehegatten bei wechselnder<br />
Einkommenshöhe und bei individuell eingeschränkter Versicherbarkeit des<br />
Kostenrisikos,<br />
c) die Beschränkung oder den Ausschluss der Beihilfen für Ehrenbeamte<br />
und Ehrenbeamtinnen sowie Beamte und Beamtinnen, deren<br />
Dienstverhältnis auf weniger als ein Jahr befristet ist,<br />
2. hinsichtlich des Inhalts und Umfangs der Beihilfen über<br />
a) die Einführung von Höchstgrenzen,<br />
b) die Beschränkung auf bestimmte Indikationen,<br />
c) die Beschränkung oder den Ausschluss für Untersuchungen und<br />
Behandlungen nach wissenschaftlich nicht allgemein anerkannten<br />
Methoden,<br />
d) den Ausschluss für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel zur Behandlung der<br />
erektilen Dysfunktion, Rauchentwöhnung, Abmagerung und Zügelung des<br />
Appetits, Regulierung des Körpergewichts und Verbesserung des<br />
Haarwuchses,<br />
e) die Beschränkung oder den Ausschluss von Beihilfen zu Aufwendungen,<br />
die in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union<br />
erbracht werden,<br />
3. hinsichtlich des Verfahrens der Beihilfengewährung über<br />
a) die elektronische Erfassung und Speicherung von Anträgen und<br />
Belegen,<br />
b) die Verwendung einer elektronischen Gesundheitskarte entsprechend<br />
§ 291 a SGB V, wobei der Zugriff der Beihilfestellen auf Daten über die in<br />
Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten zu beschränken ist,<br />
c) die Beteiligung von Gutachtern und Gutachterinnen, Beratungsärzten<br />
und Beratungsärztinnen sowie sonstigen geeigneten Stellen zur<br />
Überprüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit einzelner geltend<br />
gemachter Aufwendungen einschließlich der Übermittlung der<br />
erforderlichen Daten, wobei personenbezogene Daten nur mit Einwilligung<br />
des oder der Beihilfeberechtigten übermittelt werden dürfen; die<br />
Zuerkennung der Eignung setzt voraus, dass die mit der Bewertung<br />
betrauten Personen nach dem Verpflichtungsgesetz zur Wahrung der<br />
Daten verpflichtet werden,
d) die Durchführung der Regelungen zur Belastungsgrenze (Abs. 3 Sätze 7<br />
und 8).<br />
(6) Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag fortlaufend über den Erlass<br />
und die geplanten Änderungen der Rechtsverordnung nach Abs. 5 Satz 1.<br />
Bay BG Art. 97 Ausgleich für erhöhte Lebenshaltungskosten<br />
(1) 1 Beamten und Beamtinnen sowie Richtern und Richterinnen des<br />
Freistaates Bayern mit dienstlichem Wohnsitz und Hauptwohnsitz (Art. 16<br />
Abs. 2 des Meldegesetzes) im Stadt- und Umlandbereich München wird<br />
zum Ausgleich erhöhter Lebenshaltungskosten eine ergänzende<br />
Fürsorgeleistung gewährt. 2 Der Stadt- und Umlandbereich München ist<br />
das in Anhang 2 der Anlage zur Verordnung über das<br />
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 8. August 2006 (GVBl<br />
S. 471, BayRS 230-1-5-W) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend<br />
definierte Gebiet.<br />
(2) 1 Die ergänzende Fürsorgeleistung setzt sich zusammen aus einem<br />
Grundbetrag oder Anwärtergrundbetrag und einem Kinderzuschlag. 2 Der<br />
Grundbetrag der ergänzenden Fürsorgeleistung beträgt 75 € monatlich.<br />
3<br />
Beamten und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst wird ein<br />
Anwärtergrundbetrag von 37,50 € monatlich gewährt. 4 Für jedes Kind, für<br />
das Beamten und Beamtinnen oder Richtern und Richterinnen Kindergeld<br />
nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz<br />
tatsächlich gezahlt wird, erhöht sich die ergänzende Fürsorgeleistung um<br />
20 € (Kinderzuschlag). 5 § 6 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes ist auf<br />
den Grundbetrag entsprechend anzuwenden.<br />
(3) 1 Der sich aus Abs. 2 ergebende Grundbetrag der ergänzenden<br />
Fürsorgeleistung wird jedoch höchstens in der Höhe gewährt, in der das<br />
Grundgehalt von Beamten und Beamtinnen oder Richtern und<br />
Richterinnen einschließlich Amtszulage und allgemeiner Stellenzulage<br />
hinter 2 722,29 € monatlich (Grenzbetrag) zurückbleibt. 2 Für den<br />
Kinderzuschlag gilt ein Grenzbetrag von 3 816,54 € monatlich<br />
(Kindergrenzbetrag). 3 Erhöhungen des Grundgehalts infolge einer<br />
Leistungsstufe bleiben dabei jeweils unberücksichtigt. 4 § 6 Abs. 1 des<br />
Bundesbesoldungsgesetzes ist auf den Grenzbetrag und den<br />
Kindergrenzbetrag entsprechend anzuwenden. 5 Beamten und Beamtinnen<br />
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst wird die ergänzende Fürsorgeleistung<br />
höchstens in der Höhe gewährt, in der der Anwärtergrundbetrag der<br />
Beamten und Beamtinnen hinter 928,78 € monatlich zurückbleibt<br />
(Anwärtergrenzbetrag). 6 Grenzbetrag und Kindergrenzbetrag nehmen in<br />
prozentualer Höhe und hinsichtlich des Zeitpunkts an den nach dem 1. Juli<br />
2001 stattfindenden linearen Anpassungen des Grundgehalts für ein Amt<br />
der Besoldungsgruppe A 10, der Anwärtergrenzbetrag an entsprechenden<br />
Anpassungen des für Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im<br />
Vorbereitungsdienst für ein Eingangsamt der Besoldungsgruppen A 9 bis<br />
A 11 geltenden Anwärtergrundbetrags teil. 7 Das Staatsministerium der<br />
Finanzen gibt die jeweils geltende Höhe der Grenzbeträge bekannt. 8 Eine<br />
ergänzende Fürsorgeleistung kommt nicht zur Auszahlung, wenn sie im<br />
betreffenden Monat insgesamt einen Betrag von 10 € nicht überschreitet.
(4) 1 Beamte und Beamtinnen oder Richter und Richterinnen haben ihren<br />
dienstlichen Wohnsitz am Sitz der Behörde oder – bei einer räumlichen<br />
Teilung der Behörde – der Dienststelle (Außenstelle, Zweigstelle), der sie<br />
angehören und bei der sie überwiegend tätig sind. 2 Werden Beamte und<br />
Beamtinnen oder Richter und Richterinnen für einen Zeitraum von länger<br />
als vier Wochen zu einer anderen Behörde oder Dienststelle abgeordnet<br />
oder innerhalb ihrer Behörde zu einer anderen Dienststelle umgesetzt, ist<br />
ab Beginn der Abordnung oder Umsetzung der Sitz der neuen Behörde<br />
oder Dienststelle für die Bestimmung des dienstlichen Wohnsitzes<br />
maßgebend. 3 Für Beamte und Beamtinnen oder Richter und Richterinnen,<br />
die an Dienststellen in verschiedenen Orten tätig sind, ohne bei einer<br />
Dienststelle überwiegend beschäftigt zu sein, bestimmt die oberste<br />
Dienstbehörde den dienstlichen Wohnsitz (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 des<br />
Bundesbesoldungsgesetzes). 4 Beamte und Beamtinnen in Ausbildung<br />
haben ihren dienstlichen Wohnsitz im Anwendungsbereich des Abs. 1<br />
1. für die Dauer der Ausbildung, solange diese schwerpunktmäßig bei<br />
Behörden oder Dienststellen im Anwendungsbereich des Abs. 1<br />
durchgeführt wird; eine lediglich vorübergehende lehrgangs- oder sonst<br />
ausbildungsbedingte Abwesenheit von der Behörde oder Dienststelle bleibt<br />
unberücksichtigt;<br />
2. für die Dauer der Zuweisung, wenn sie ausbildungsbedingt für<br />
mindestens vier Wochen einer Behörde oder Dienststelle im<br />
Anwendungsbereich des Abs. 1 zugewiesen werden oder<br />
3. für die Dauer der Teilnahme an einem mindestens vierwöchigen<br />
Lehrgang, wenn dieser Lehrgang bei einer Einrichtung im<br />
Anwendungsbereich des Abs. 1 abgehalten wird.<br />
(5) 1 Die ergänzende Fürsorgeleistung wird je Kalendermonat einmal gewährt<br />
und im Voraus mit den Dienstbezügen gezahlt; § 3 Abs. 4 des<br />
Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend. 2 Ein Sonderzuschlag nach<br />
§ 72 des Bundesbesoldungsgesetzes kann auf die ergänzende<br />
Fürsorgeleistung ganz oder zum Teil angerechnet werden; die näheren<br />
Einzelheiten dazu bestimmt das Staatsministerium der Finanzen durch<br />
Verwaltungsvorschrift.<br />
(6) Die nichtstaatlichen Dienstherren können ihren Beamten und Beamtinnen<br />
mit dienstlichem Wohnsitz und Hauptwohnsitz in dem in Abs. 1 Satz 2<br />
bezeichneten Gebiet eine ergänzende Fürsorgeleistung höchstens in der in<br />
diesem Artikel bestimmten Höhe gewähren.<br />
Bay BG Art. 98 Schadensersatz bei Gewaltakten Dritter und<br />
Sachschadensersatz bei Unfällen<br />
(1) 1 Werden durch Gewaltakte Dritter, die im Hinblick auf das pflichtgemäße<br />
dienstliche Verhalten von Beamten und Beamtinnen begangen werden,<br />
Gegenstände beschädigt oder zerstört, die den Beamten und Beamtinnen,<br />
ihren Familienangehörigen oder mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft<br />
lebenden Personen gehören, oder den Beamten und Beamtinnen sonstige,<br />
nicht unerhebliche Vermögensschäden zugefügt, so kann der Dienstherr<br />
hierfür Ersatz leisten. 2 Gleiches gilt in den Fällen, in denen sich der<br />
Gewaltakt gegen den Dienstherrn als solchen gerichtet hat.
(2) Werden in Ausübung oder infolge des Dienstes Kleidungsstücke oder<br />
sonstige Gegenstände, die üblicherweise oder aus dienstlichem Grund im<br />
Dienst mitgeführt werden, durch einen Unfall beschädigt oder verloren, so<br />
kann der Dienstherr dafür Ersatz leisten, sofern der Beamte oder die<br />
Beamtin den Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht<br />
hat.<br />
(3) 1 Ansprüche auf Ersatzleistungen sind innerhalb von drei Monaten nach<br />
dem Eintritt des Schadens bei der Dienststelle oder der für die<br />
Entscheidung über die Ersatzleistung zuständigen Behörde schriftlich<br />
geltend zu machen. 2 Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde,<br />
bei Beamten und Beamtinnen des Staates die Pensionsbehörde (Art. 144<br />
Abs. 1).<br />
(4) 1 Hat der Dienstherr Ersatz geleistet, so gehen insoweit Ansprüche gegen<br />
Dritte auf ihn über. 2 Der Übergang der Ansprüche kann nicht zum<br />
Nachteil des oder der Geschädigten geltend gemacht werden.<br />
Bay BG Art. 99 Mutterschutz, Elternzeit, Schwerbehinderung,<br />
Arbeitsschutz<br />
(1) 1 Die Staatsregierung regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des<br />
öffentlichen Dienstes entsprechende Anwendung<br />
1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beamtinnen,<br />
2. der Vorschriften des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes über die<br />
Elternzeit auf Beamte und Beamtinnen,<br />
3. der Vorschriften des Neunten Buches Sozialgesetzbuch auf<br />
schwerbehinderte und gleichgestellte Beamte, Beamtinnen, Bewerber und<br />
Bewerberinnen,<br />
4. der auf das Arbeitsschutzgesetz gestützten Rechtsverordnungen auf<br />
Beamte und Beamtinnen.<br />
2<br />
Während einer Elternzeit besteht ein Anspruch auf Leistungen der<br />
Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen<br />
nach Art. 96 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass abweichend von den Vorgaben<br />
der Beihilfevorschriften der Bemessungssatz für Alleinerziehende 70 v. H.<br />
beträgt. 3 Dies gilt nicht, wenn Beamte oder Beamtinnen<br />
berücksichtigungsfähige Angehörige von Beihilfeberechtigten werden oder<br />
Anspruch auf Familienhilfe nach § 10 SGB V haben.<br />
(2) 1 Soweit öffentliche Belange es zwingend erfordern, insbesondere zur<br />
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit,<br />
kann das zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen für bestimmte Tätigkeiten durch<br />
Rechtsverordnung bestimmen, dass Vorschriften des<br />
Arbeitsschutzgesetzes oder hierzu erlassener Rechtsverordnungen des<br />
Bundes ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind. 2 In diesen Fällen ist<br />
sicherzustellen, dass die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der<br />
Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeitsschutzgesetzes auf<br />
andere Weise gewährleistet werden.
Bay BG Art. 100 Jugendarbeitsschutz<br />
(1) Soweit Beamte und Beamtinnen das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet<br />
haben, besteht ein Anspruch auf Jugendarbeitsschutz nach Maßgabe der<br />
folgenden Absätze.<br />
(2) 1 Bei der Festlegung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit, der<br />
Freistellung an Berufsschultagen, der Regelung der Pausen, der<br />
Schichtzeit, der täglichen Freizeit, der Nachtruhe, der Fünf-Tage-Woche<br />
sowie der Samstags-, Sonntags- und Feiertagsruhe ist das besondere<br />
Schutzbedürfnis von Jugendlichen unter 18 Jahren zu berücksichtigen.<br />
2<br />
Die Dauer ihres Erholungsurlaubs ist unter Berücksichtigung ihres Alters<br />
und ihres besonderen Erholungsbedürfnisses zu bemessen. 3 Das Nähere<br />
regelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung.<br />
(3) 1 Beamte und Beamtinnen dürfen vor Vollendung des 18. Lebensjahres<br />
nicht mit Dienstgeschäften beauftragt werden, bei denen Leben,<br />
Gesundheit oder die körperliche oder seelisch-geistige Entwicklung<br />
gefährdet werden. 2 Dies gilt nicht für die Beschäftigung nach Vollendung<br />
des 16. Lebensjahres, soweit dies zur Erreichung des Ausbildungsziels<br />
erforderlich ist und der Schutz der Jugendlichen durch die Aufsicht eines<br />
Fachkundigen sichergestellt ist. 3 Die zuständige Dienstbehörde hat bei der<br />
Errichtung und der Unterhaltung der Dienststellen einschließlich der<br />
Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der Regelung der<br />
Beschäftigung die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum<br />
Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie<br />
zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischgeistigen<br />
Entwicklung zu treffen.<br />
(4) 1 Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in ein Beamtenverhältnis nur berufen<br />
werden, nachdem sie ärztlich untersucht worden sind (Erstuntersuchung).<br />
2<br />
Nach Ablauf eines Jahres seit der Einstellung ist eine erneute ärztliche<br />
Untersuchung durchzuführen (Nachuntersuchung). 3 Die Erstuntersuchung<br />
hat sich auf den Gesundheits- und Entwicklungsstand sowie die<br />
körperliche Beschaffenheit, die Nachuntersuchung außerdem auf die<br />
Auswirkungen der Berufsarbeit auf Gesundheit und Entwicklung zu<br />
erstrecken. 4 Die Kosten der ärztlichen Untersuchungen trägt der<br />
Dienstherr.<br />
(5) Soweit die Eigenart des Polizeivollzugsdienstes und die Belange der<br />
inneren Sicherheit es erfordern, können für jugendliche<br />
Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen durch<br />
Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern im Einvernehmen<br />
mit dem Staatsministerium der Finanzen Ausnahmen von den geltenden<br />
Vorschriften des Jugendarbeitsschutzes bestimmt werden.<br />
Bay BG Art. 101 Jubiläumszuwendung<br />
1 Den Beamten und Beamtinnen soll bei Dienstjubiläen eine<br />
Jubiläumszuwendung gewährt werden. 2 Das Nähere regelt die Staatsregierung<br />
durch Rechtsverordnung.
Abschnitt 8 Personalakten<br />
Bay BG Art. 102 Erhebung personenbezogener Daten<br />
1 Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über Bewerber, Bewerberinnen,<br />
Beamte und Beamtinnen sowie ehemalige Beamte und Beamtinnen nur<br />
erheben, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder<br />
Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer,<br />
personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der<br />
Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine<br />
Rechtsvorschrift dies erlaubt. 2 Fragebogen, mit denen solche<br />
personenbezogenen Daten erhoben werden, bedürfen der Genehmigung durch<br />
die oberste Dienstbehörde.<br />
Bay BG Art. 103 Zugang zur Personalakte<br />
Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäftigte haben, die im Rahmen der<br />
Personalverwaltung mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten<br />
beauftragt sind, und nur soweit dies zu Zwecken der Personalverwaltung oder<br />
der Personalwirtschaft erforderlich ist; dies gilt auch für den Zugang im<br />
automatisierten Abrufverfahren.<br />
Bay BG Art. 104 Gliederung und Gestaltung von Personalakten<br />
(1) 1 Die Personalakte kann nach sachlichen Gesichtspunkten in Grundakte<br />
und Teilakten gegliedert werden. 2 Teilakten können bei der für den<br />
betreffenden Aufgabenbereich zuständigen Behörde geführt werden.<br />
3<br />
Nebenakten (Unterlagen, die sich auch in der Grundakte oder in<br />
Teilakten befinden) dürfen nur geführt werden, wenn die<br />
personalverwaltende Behörde nicht zugleich Beschäftigungsbehörde ist<br />
oder wenn mehrere personalverwaltende Behörden zuständig sind; sie<br />
dürfen nur solche Unterlagen enthalten, deren Kenntnis zur rechtmäßigen<br />
Aufgabenerledigung der betreffenden Behörde erforderlich ist. 4 In der<br />
Grundakte ist ein vollständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten<br />
aufzunehmen.<br />
(2) 1 Nicht Bestandteil der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen, von<br />
der Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken<br />
dienen, insbesondere Prüfungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten.<br />
2<br />
Kindergeldakten können mit Besoldungs- und Versorgungsakten<br />
verbunden geführt werden, wenn diese von der übrigen Personalakte<br />
getrennt sind und von einer von der Personalverwaltung getrennten<br />
Organisationseinheit bearbeitet werden; § 35 des Ersten Buches<br />
Sozialgesetzbuch und die §§ 67 bis 78 des Zehnten Buches<br />
Sozialgesetzbuch bleiben unberührt.<br />
Bay BG Art. 105 Beihilfeunterlagen<br />
1 Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte zu führen. 2 Diese ist von der<br />
übrigen Personalakte getrennt aufzubewahren. 3 Sie soll in einer von der<br />
übrigen Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit bearbeitet<br />
werden; Zugang sollen nur Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben.<br />
4 Die Beihilfeakte darf für andere als für Beihilfezwecke nur verwendet oder<br />
weitergegeben werden, wenn der oder die Beihilfeberechtigte und bei der
Beihilfegewährung berücksichtigte Angehörige im Einzelfall einwilligen, die<br />
Einleitung oder Durchführung eines im Zusammenhang mit einem<br />
Beihilfeantrag stehenden behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens dies<br />
erfordert oder soweit es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,<br />
einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder<br />
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person<br />
erforderlich ist. 5 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Unterlagen über<br />
Heilfürsorge und Heilverfahren.<br />
Bay BG Art. 106 Anhörung<br />
1 Beamte und Beamtinnen sind zu Beschwerden, Behauptungen und<br />
Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können,<br />
vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören, soweit die Anhörung nicht<br />
nach anderen Rechtsvorschriften erfolgt. 2 Ihre Äußerungen sind zur<br />
Personalakte zu nehmen.<br />
Bay BG Art. 107 Einsichtnahme in Personalakten<br />
(1) 1 Beamte und Beamtinnen haben, auch nach Beendigung des<br />
Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige<br />
Personalakte. 2 Feststellungen über den Gesundheitszustand unterliegen<br />
dann nicht der Einsicht, wenn zu befürchten ist, dass der Beamte oder die<br />
Beamtin bei Kenntnis des Befunds weiteren Schaden an der Gesundheit<br />
nimmt.<br />
(2) 1 Beamte und Beamtinnen haben ein Recht auf Einsicht auch in andere<br />
Akten, die personenbezogene Daten über sie enthalten und für ihr<br />
Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit gesetzlich nichts<br />
anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für Sicherheitsakten. 2 Die<br />
Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Betroffenen mit Daten<br />
Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht-personenbezogenen Daten<br />
derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit<br />
unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. 3 In diesem Fall ist dem<br />
Beamten oder der Beamtin Auskunft zu erteilen.<br />
(3) 1 Bevollmächtigten von Beamten und Beamtinnen ist Einsicht zu<br />
gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 2 Dies gilt<br />
auch für Hinterbliebene, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft<br />
gemacht wird, und deren Bevollmächtigte. 3 Für Auskünfte aus der<br />
Personalakte gelten Sätze 1 und 2 entsprechend.<br />
(4) 1 Die personalaktenführende Behörde bestimmt, wo die Einsicht gewährt<br />
wird. 2 Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können Auszüge,<br />
Abschriften, Ablichtungen oder Ausdrucke gefertigt werden; Beamten und<br />
Beamtinnen ist auf Verlangen ein Ausdruck der zu ihrer Person<br />
automatisiert gespeicherten Personalaktendaten zu überlassen.<br />
Bay BG Art. 108 Vorlage von Personalakten und Auskunft aus<br />
Personalakten<br />
(1) 1 Ohne Einwilligung des Beamten oder der Beamtin ist es zulässig, die<br />
Personalakte für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft<br />
der obersten Dienstbehörde oder einer im Rahmen der Dienstaufsicht<br />
weisungsbefugten Behörde vorzulegen. 2 Das Gleiche gilt für Behörden
desselben Geschäftsbereichs, soweit die Vorlage zur Vorbereitung oder<br />
Durchführung einer Personalentscheidung notwendig ist, sowie für<br />
Behörden eines anderen Geschäftsbereichs desselben Dienstherrn, soweit<br />
diese an einer Personalentscheidung mitzuwirken haben, sowie für<br />
Pensionsbehörden. 3 Ärzten und Ärztinnen, die im Auftrag der<br />
personalverwaltenden Behörde oder der Pensionsbehörde ein<br />
medizinisches Gutachten erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne<br />
Einwilligung vorgelegt werden. 4 Für Auskünfte aus der Personalakte<br />
gelten Sätze 1 bis 3 entsprechend. 5 Soweit eine Auskunft ausreicht, ist<br />
von einer Vorlage der Personalakte abzusehen.<br />
(2) 1 Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilligung des Beamten oder der<br />
Beamtin erteilt werden, es sei denn, dass die Abwehr einer erheblichen<br />
Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder der Schutz berechtigter,<br />
höherrangiger Interessen des Dritten die Auskunftserteilung zwingend<br />
erfordert. 2 Inhalt und Empfänger der Auskunft sind dem Beamten oder<br />
der Beamtin schriftlich mitzuteilen.<br />
(3) Ohne Einwilligung des Beamten oder der Beamtin ist es zulässig, den<br />
zuständigen Behörden Auskünfte aus der Personalakte zu erteilen, soweit<br />
es zur Entscheidung über die Verleihung von staatlichen Orden oder<br />
Ehrenzeichen oder von sonstigen staatlichen Ehrungen erforderlich ist.<br />
(4) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen Umfang zu<br />
beschränken.<br />
Bay BG Art. 109 Entfernung von Unterlagen aus Personalakten<br />
(1) 1 Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, auf die<br />
die Tilgungsvorschriften des Disziplinarrechts keine Anwendung finden,<br />
sind,<br />
1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit<br />
Zustimmung des Beamten oder der Beamtin unverzüglich aus der<br />
Personalakte zu entfernen und zu vernichten,<br />
2. falls sie für Beamte und Beamtinnen ungünstig sind oder ihnen<br />
nachteilig werden können, auf Antrag nach zwei Jahren zu entfernen und<br />
zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.<br />
2<br />
Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 beginnt bei neuen Sachverhalten im Sinn<br />
dieser Vorschrift oder bei Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfahrens<br />
erneut. 3 Der Neubeginn der Verjährung tritt nicht ein, wenn sich der neue<br />
Vorwurf als unbegründet oder falsch herausstellt.<br />
(2) 1 Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil einer<br />
Disziplinarakte sind, sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sind<br />
mit Zustimmung des Beamten oder der Beamtin nach drei Jahren zu<br />
entfernen und zu vernichten. 2 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.<br />
Bay BG Art. 110 Aussonderung von Personalakten<br />
(1) 1 Personalakten sind nach ihrem Abschluss von der<br />
personalaktenführenden Behörde fünf Jahre aufzubewahren.<br />
2 Personalakten sind abgeschlossen,<br />
1. wenn der Beamte oder die Beamtin ohne Versorgungsansprüche aus<br />
dem öffentlichen Dienst ausgeschieden ist, mit Erreichen der gesetzlichen<br />
Altersgrenze, in den Fällen des § 25 BeamtStG und des Art. 11 BayDG
jedoch erst, wenn mögliche Versorgungsempfänger und<br />
Versorgungsempfängerinnen nicht mehr vorhanden sind,<br />
2. wenn der Beamte oder die Beamtin verstorben ist, mit Ablauf des<br />
Todesjahres.<br />
(2) 1 Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, Heilverfahren, Unterstützungen,<br />
Erholungsurlaub, Erkrankungen sowie Umzugs- und Reisekosten sind fünf<br />
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbeitung des einzelnen<br />
Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren. 2 Unterlagen, aus denen<br />
die Art der Erkrankung ersichtlich ist, sind unverzüglich zurückzugeben<br />
oder zu vernichten, wenn sie für den Zweck, zu dem sie vorgelegt worden<br />
sind, nicht mehr benötigt werden.<br />
(3) Versorgungsakten sind zehn Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die<br />
letzte Versorgungszahlung geleistet worden ist, aufzubewahren; besteht<br />
die Möglichkeit eines Wiederauflebens des Anspruchs, sind die Akten<br />
30 Jahre aufzubewahren.<br />
(4) Personalakten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet,<br />
sofern sie nicht vom zuständigen öffentlichen Archiv übernommen werden.<br />
(5) 1 Für automatisiert gespeicherte Personalaktendaten gelten Abs. 1 bis 4,<br />
soweit sie nicht in Grund- und Teilakten bereits vorhanden sind. 2 Im<br />
Übrigen sind sie – unbeschadet anderweitiger Vorschriften – zu löschen,<br />
wenn sie für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft nicht<br />
mehr benötigt werden. 3 Elektronisch gespeicherte Beihilfebelege sind<br />
spätestens ein Jahr nach Ablauf des Jahres, in dem die Unterlagen<br />
elektronisch erfasst wurden, zu löschen, sofern sie nicht darüber hinaus<br />
für die Bearbeitung oder auf Grund sonstiger gesetzlicher Vorschriften<br />
benötigt werden.<br />
Bay BG Art. 111 Automatisierte Verarbeitung und Nutzung von<br />
Personalaktendaten<br />
(1) 1 Personalaktendaten dürfen in Dateien nur für Zwecke der<br />
Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft verarbeitet und genutzt<br />
werden. 2 Ihre Übermittlung ist nur nach Maßgabe des Art. 108 zulässig.<br />
3<br />
Ein automatisierter Datenabruf durch andere Behörden ist unzulässig,<br />
soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) Personalaktendaten im Sinn des Art. 105 dürfen automatisiert nur im<br />
Rahmen ihrer Zweckbestimmung und nur von den übrigen<br />
Personaldateien technisch und organisatorisch getrennt verarbeitet und<br />
genutzt werden.<br />
(3) Von den Unterlagen über medizinische oder psychologische<br />
Untersuchungen und Tests dürfen im Rahmen der Personalverwaltung nur<br />
die Ergebnisse automatisiert verarbeitet oder genutzt werden, soweit sie<br />
die Eignung betreffen und ihre Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz des<br />
Beamten oder der Beamtin dient.<br />
(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dürfen nicht ausschließlich auf<br />
Informationen und Erkenntnisse gestützt werden, die unmittelbar durch<br />
automatisierte Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten<br />
gewonnen werden.
(5) 1 Bei erstmaliger Speicherung ist dem oder der Betroffenen die Art der<br />
über ihn oder sie gemäß Abs. 1 gespeicherten Daten mitzuteilen, bei<br />
wesentlichen Änderungen ist er oder sie zu benachrichtigen. 2 Ferner sind<br />
die Verarbeitungs- und Nutzungsformen automatisierter<br />
Personalverwaltungsverfahren zu dokumentieren und einschließlich des<br />
jeweiligen Verwendungszwecks sowie der regelmäßigen Empfänger und<br />
des Inhalts automatisierter Datenübermittlung allgemein bekanntzugeben.<br />
Teil 5 Landespersonalausschuss<br />
Bay BG Art. 112 Errichtung, Unabhängigkeit<br />
1 Zur einheitlichen Durchführung beamtenrechtlicher Vorschriften wird ein<br />
Landespersonalausschuss errichtet. 2 Er übt seine Tätigkeit innerhalb der<br />
gesetzlichen Schranken unabhängig und in eigener Verantwortung aus.<br />
Bay BG Art. 113 Zusammensetzung<br />
(1) 1 Der Landespersonalausschuss besteht aus sieben ordentlichen und<br />
sieben stellvertretenden Mitgliedern. 2 Sämtliche Mitglieder müssen sich in<br />
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf Zeit befinden.<br />
(2) 1 Die Staatsregierung beruft die ordentlichen und die stellvertretenden<br />
Mitglieder auf die Dauer von fünf Jahren; erneute Berufung ist zulässig.<br />
2<br />
Drei ordentliche und drei stellvertretende Mitglieder sind aus einer<br />
staatlichen Verwaltung zu berufen, davon je ein ordentliches und ein<br />
stellvertretendes Mitglied aus dem Staatsministerium des Innern und dem<br />
Staatsministerium der Finanzen. 3 Je zwei ordentliche und zwei<br />
stellvertretende Mitglieder werden auf Vorschlag der kommunalen<br />
Spitzenverbände und der Spitzenorganisationen der zuständigen<br />
Gewerkschaften und Berufsverbände berufen.<br />
(3) Die Staatsregierung bestellt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und<br />
den stellvertretenden Vorsitzenden oder die stellvertretende Vorsitzende<br />
aus dem Kreis der aus einer staatlichen Verwaltung berufenen<br />
ordentlichen Mitglieder.<br />
Bay BG Art. 114 Rechtsstellung der Mitglieder<br />
(1) 1 Die Mitglieder des Landespersonalausschusses sind unabhängig und nur<br />
dem Gesetz unterworfen. 2 Sie scheiden aus ihrem Amt als Mitglied des<br />
Landespersonalausschusses durch Zeitablauf und durch Beendigung des<br />
Beamtenverhältnisses oder der Zugehörigkeit zu einer staatlichen<br />
Verwaltung (Art. 113 Abs. 2 Satz 2) aus; bei Mitgliedern, die aus dem<br />
Staatsministerium des Innern oder dem Staatsministerium der Finanzen<br />
berufen werden, endet die Mitgliedschaft auch bei Wechsel der Behörde.<br />
3<br />
Im Übrigen scheiden sie aus ihrem Amt nur unter den gleichen<br />
Voraussetzungen aus, unter denen Mitglieder eines Disziplinargerichts<br />
wegen rechtskräftiger Verurteilung im Straf- oder Disziplinarverfahren ihr<br />
Amt verlieren. 4 § 39 BeamtStG ist nicht anzuwenden.<br />
(2) Die Mitglieder des Landespersonalausschusses dürfen wegen ihrer<br />
Tätigkeit dienstlich nicht gemaßregelt, nicht benachteiligt und nicht<br />
bevorzugt werden.
(3) Die Mitglieder des Landespersonalausschusses dürfen bei Entscheidungen,<br />
die sie selbst oder Angehörige betreffen, nicht mitwirken.<br />
(4) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Landespersonalausschusses<br />
führt der Staatsminister der Finanzen.<br />
Bay BG Art. 115 Aufgaben<br />
(1) Der Landespersonalausschuss hat außer den ihm in sonstigen Vorschriften<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s eingeräumten Befugnissen die folgenden Aufgaben:<br />
1. bei der Vorbereitung gesetzlicher Regelungen der beamtenrechtlichen<br />
Verhältnisse mitzuwirken,<br />
2. bei der Vorbereitung beamtenrechtlicher Vorschriften über die<br />
Ausbildung, Prüfung und Fortbildung mitzuwirken,<br />
3. die Aufsicht über die Prüfungen zu führen,<br />
4. über den Antrag einer obersten Dienstbehörde auf Anerkennung einer<br />
Prüfung zu beschließen,<br />
5. sich zu Beschwerden von Beamten, Beamtinnen, Bewerbern und<br />
Bewerberinnen in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu<br />
äußern,<br />
6. Vorschläge zur Beseitigung von Mängeln in der Handhabung der<br />
beamtenrechtlichen Vorschriften zu machen.<br />
(2) Die Staatsregierung kann dem Landespersonalausschuss zur einheitlichen<br />
Durchführung beamtenrechtlicher Vorschriften weitere Aufgaben durch<br />
Rechtsverordnung übertragen.<br />
(3) Über die Durchführung seiner Aufgaben hat der Landespersonalausschuss<br />
die Staatsregierung alljährlich zu unterrichten.<br />
Bay BG Art. 116 Geschäftsordnung<br />
Der Landespersonalausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.<br />
Bay BG Art. 117 Sitzungen, Beschlussfähigkeit<br />
(1) 1 Die Sitzungen des Landespersonalausschusses sind nicht öffentlich. 2 Der<br />
Landespersonalausschuss kann Beauftragten beteiligter Verwaltungen und<br />
anderen Personen die Anwesenheit bei der Verhandlung gestatten.<br />
3<br />
Beauftragte beteiligter Verwaltungen sind auf Verlangen zu hören,<br />
ebenso der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin in den Fällen<br />
des Art. 115 Abs. 1 Nr. 5.<br />
(2) Sind der oder die Vorsitzende und der oder die stellvertretende<br />
Vorsitzende verhindert, so leitet an ihrer Stelle das dienstälteste Mitglied<br />
die Verhandlungen.<br />
(3) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens fünf<br />
Mitgliedern erforderlich.<br />
Bay BG Art. 118 Beweiserhebungsrecht, Amts- und Rechtshilfe<br />
(1) Der Landespersonalausschuss kann zur Durchführung seiner Aufgaben in<br />
entsprechender Anwendung der für die Verwaltungsgerichtsbarkeit<br />
geltenden Vorschriften Beweise erheben.<br />
(2) Alle Dienststellen haben dem Landespersonalausschuss unentgeltlich<br />
Amts- und Rechtshilfe zu leisten.
Bay BG Art. 119 Bekanntmachung und Bindungswirkung der<br />
Beschlüsse<br />
(1) 1 Beschlüsse des Landespersonalausschusses sind, soweit sie allgemeine<br />
Bedeutung haben, bekanntzumachen. 2 Näheres regelt die<br />
Geschäftsordnung.<br />
(2) Soweit dem Landespersonalausschuss eine Entscheidungsbefugnis<br />
eingeräumt ist, binden seine Beschlüsse die beteiligten Verwaltungen.<br />
Bay BG Art. 120 Geschäftsstelle<br />
(1) 1 Der Landespersonalausschuss bedient sich zur Vorbereitung der<br />
Verhandlungen und Durchführung seiner Beschlüsse einer Geschäftsstelle,<br />
die beim Staatsministerium der Finanzen eingerichtet wird. 2 Die<br />
Geschäftsstelle führt ferner nach Maßgabe der Prüfungsbestimmungen im<br />
Auftrag des Landespersonalausschusses die Prüfungen (Art. 41) durch,<br />
sofern nicht der Landespersonalausschuss die Durchführung anderen<br />
Stellen überträgt.<br />
(2) 1 Die Staatsregierung bestellt zur Leitung der Geschäftsstelle einen<br />
Generalsekretär oder eine Generalsekretärin. 2 Er oder sie nimmt an den<br />
Verhandlungen des Landespersonalausschusses beratend teil.<br />
Teil 6 Besondere Beamtengruppen<br />
Abschnitt 1 Beamte und Beamtinnen des Landtags<br />
Bay BG Art. 121 Beamte und Beamtinnen des Landtags<br />
(1) 1 Die Beamten und Beamtinnen des Landtags sind Beamte und<br />
Beamtinnen des Staates. 2 Sie werden von dem Präsidenten oder der<br />
Präsidentin des Landtags ernannt. 3 Zur Ernennung des Direktors oder der<br />
Direktorin und der Beamten und Beamtinnen von der<br />
Besoldungsgruppe A 16 an ist die Zustimmung des Präsidiums<br />
erforderlich.<br />
(2) 1 Oberste Dienstbehörde der Beamten und Beamtinnen des Landtags ist<br />
der Präsident oder die Präsidentin des Landtags. 2 Er oder sie übt die<br />
Dienstaufsicht über die Beamten und Beamtinnen des Landtags aus.<br />
(3) 1 § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG ist nicht anzuwenden. 2 Die in Art. 40 Abs. 2<br />
Satz 2 vorgesehene Zuständigkeit des Landespersonalausschusses nimmt<br />
das Präsidium des Landtags wahr.<br />
(4) Abs. 1 bis 3 gelten auch für den Landesbeauftragten oder die<br />
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Beamten und Beamtinnen<br />
der Geschäftsstelle; Art. 29 des Bayerischen Datenschutzgesetzes bleibt<br />
unberührt.
Abschnitt 2 Beamtenverhältnis auf Zeit<br />
Bay BG Art. 122 Beamte und Beamtinnen auf Zeit<br />
(1) 1 Die Fälle und die Voraussetzungen der Berufung in das<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit sind gesetzlich zu bestimmen. 2 Die<br />
Vorschriften über die Laufbahnen, die Prüfungen und die Probezeit sind<br />
nicht anzuwenden.<br />
(2) 1 Ein Beamter oder eine Beamtin auf Zeit ist mit Ablauf der Amtszeit aus<br />
dem Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen, wenn er oder sie nicht erneut<br />
in dasselbe Amt für eine weitere Amtszeit berufen wird und nicht in den<br />
Ruhestand tritt. 2 Wird der Beamte oder die Beamtin auf Zeit im Anschluss<br />
an die Amtszeit erneut in dasselbe Amt für eine weitere Amtszeit berufen,<br />
so gilt das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen.<br />
(3) 1 Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind Beamte und<br />
Beamtinnen auf Zeit nach Ablauf der Amtszeit verpflichtet, das Amt<br />
weiterzuführen, wenn sie unter mindestens gleich günstigen Bedingungen<br />
für wenigstens die gleiche Zeit wieder ernannt werden sollen und das<br />
62. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 2 Beamte und Beamtinnen sind<br />
zu entlassen, wenn sie als Beamte oder Beamtinnen auf Zeit ihrer<br />
Verpflichtung zur Weiterführung ihres Amtes nicht nachkommen.<br />
(4) 1 Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind Beamte oder<br />
Beamtinnen auf Zeit, die aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit in<br />
ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen worden sind und nach Ablauf der<br />
Amtszeit das Amt nicht weiterführen, auf ihren Antrag wieder in das<br />
frühere Dienstverhältnis zu übernehmen, wenn sie die beamtenrechtlichen<br />
Voraussetzungen noch erfüllen. 2 Das zu übertragende Amt muss<br />
derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören und mit<br />
mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden sein wie das Amt, das<br />
sie im Zeitpunkt der Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit<br />
innehatten. 3 Der Antrag auf Übernahme ist innerhalb von drei Monaten<br />
nach Ablauf der Amtszeit zu stellen.<br />
(5) 1 Endet das Beamtenverhältnis auf Zeit nach Abs. 2 Satz 1, erhalten<br />
entlassene Beamte und Beamtinnen auf Zeit von dem Beginn des Monats<br />
an, in dem sie den Antrag nach Abs. 4 gestellt haben, bis zur Übertragung<br />
des neuen Amtes von dem früheren Dienstherrn Bezüge in Höhe des beim<br />
Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erdienten<br />
Ruhegehalts. 2 Die im Beamtenverhältnis auf Zeit verbrachte Dienstzeit<br />
gilt als Dienstzeit im Sinn des Besoldungs- und Versorgungsrechts. 3 Im<br />
Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 49 bis 59, 62 und 90 BeamtVG<br />
sinngemäß; Empfänger und Empfängerinnen der Bezüge gelten insoweit<br />
als Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeamtinnen, die Bezüge gelten als<br />
Ruhegehalt. 4 Neben einem Übergangsgeld, das aus dem<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit gewährt wird, gelten die Bezüge nach Satz 1<br />
als Erwerbsersatzeinkommen im Sinn des § 53 Abs. 7 BeamtVG.<br />
Bay BG Art. 123 Ruhestandseintritt<br />
(1) 1 Beamte und Beamtinnen auf Zeit treten mit Ablauf der Zeit, für die sie<br />
ernannt sind, in den Ruhestand, wenn sie eine Dienstzeit von mindestens<br />
zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt
haben und weder nach Art. 122 Abs. 3 Satz 2 entlassen noch erneut in<br />
dasselbe Amt für eine weitere Amtszeit berufen werden. 2 Mit dem<br />
Erreichen der Altersgrenze treten sie in den Ruhestand, wenn sie eine<br />
Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit<br />
Dienstbezügen zurückgelegt haben oder aus einem Beamtenverhältnis auf<br />
Lebenszeit zu Beamten oder Beamtinnen auf Zeit ernannt worden waren.<br />
(2) 1 Dienstunfähige Beamte und Beamtinnen auf Zeit sind in den Ruhestand<br />
zu versetzen, wenn sie<br />
1. eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem<br />
Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt haben oder<br />
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die sie<br />
sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des<br />
Dienstes zugezogen haben, dienstunfähig geworden sind oder<br />
3. aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu Beamten oder<br />
Beamtinnen auf Zeit ernannt worden waren.<br />
2<br />
Sind Beamte und Beamtinnen auf Zeit aus anderen als den in Satz 1<br />
Nr. 2 genannten Gründen dienstunfähig geworden und haben sie eine<br />
Dienstzeit von weniger als zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit<br />
Dienstbezügen zurückgelegt, so können sie in den Ruhestand versetzt<br />
werden; die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde, bei Beamten<br />
und Beamtinnen des Staates im Einvernehmen mit dem Staatsministerium<br />
der Finanzen. 3 Art. 71 Abs. 3 gilt entsprechend; der Ruhestand beginnt<br />
jedoch spätestens mit dem Ablauf der Amtszeit.<br />
(3) 1 Beamte und Beamtinnen auf Zeit, die in den einstweiligen Ruhestand<br />
versetzt worden sind, gelten mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze<br />
als dauernd im Ruhestand befindlich, wenn sie bei Verbleiben im Amt mit<br />
Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand getreten wären. 2 Sie gelten<br />
mit dem früheren Ablauf der Amtszeit als dauernd im Ruhestand<br />
befindlich, wenn sie bei Verbleiben im Amt in diesem Zeitpunkt eine<br />
Dienstzeit von mindestens zehn Jahren im Beamtenverhältnis mit<br />
Dienstbezügen zurückgelegt hätten oder vor Ablauf der Amtszeit nach<br />
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 in den Ruhestand versetzt worden wären.<br />
Abschnitt 3 Beamte und Beamtinnen der Polizei, der<br />
Justizvollzugsanstalten, des Landesamts für Verfassungsschutz,<br />
der Feuerwehren und Notariatsbeamte und Notariatsbeamtinnen<br />
Bay BG Art. 124 Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen<br />
(1) Für Beamte und Beamtinnen im Vollzugsdienst der Polizei gelten die<br />
allgemeinen beamtenrechtliehen Vorschriften, soweit gesetzlich nichts<br />
anderes bestimmt ist.<br />
(2) 1 Dem Polizeivollzugsdienst gehören alle Beamten und Beamtinnen der<br />
Polizei an, die nicht im Verwaltungsdienst der Polizei eingesetzt sind. 2 Der<br />
Verwaltungsdienst der Polizei besteht aus Beamten und Beamtinnen, die<br />
eine Prüfung für den Verwaltungsdienst abgelegt haben und entsprechend<br />
dieser Prüfung im Verwaltungsdienst der Polizei verwendet werden; er<br />
umfasst die Personal- und Wirtschaftsverwaltung der Polizei. 3 Zum<br />
Bereich nach Satz 2 rechnen auch Ärzte und Ärztinnen, Apotheker und
Apothekerinnen, Seelsorger und Seelsorgerinnen, Lehrkräfte für<br />
Allgemeinbildung, Beamte und Beamtinnen im mittleren, gehobenen und<br />
höheren technischen Polizeiverwaltungsdienst sowie im höheren<br />
kriminaltechnischen Dienst. 4 Für Angelegenheiten der Personalverwaltung<br />
sollen auch Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst verwendet<br />
werden. 5 Im Einzelnen kann das Staatsministerium des Innern im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch<br />
Rechtsverordnung bestimmen, welche Tätigkeiten dem Verwaltungsdienst<br />
und dem höheren kriminaltechnischen Dienst angehören.<br />
Bay BG Art. 125 Status der Beamten und Beamtinnen im<br />
Polizeivollzugsdienst in Ausbildung<br />
Die Polizeivollzugsbeamten und Polizeivollzugsbeamtinnen auf Widerruf im<br />
Vorbereitungsdienst können nach Maßgabe der Verordnung über die<br />
Laufbahnen der Polizeivollzugsbeamten frühestens nach Ablauf eines Jahres<br />
der Ausbildung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf mit Dienstbezügen oder<br />
nach Beendigung einer Grundausbildung in das Beamtenverhältnis auf Probe<br />
berufen werden.<br />
Bay BG Art. 126 Laufbahnvorschriften<br />
Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen und nach Anhörung des<br />
Landespersonalausschusses durch Rechtsverordnung die Laufbahnen der<br />
Polizeivollzugsbeamten und Polizeivollzugsbeamtinnen abweichend von den<br />
Art. 26 bis 38 regeln; hierbei kann die Einheitslaufbahn festgelegt werden.<br />
Bay BG Art. 127 Gemeinschaftsunterkunft<br />
1 Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen der Bereitschaftspolizei<br />
sind während der Ausbildung verpflichtet, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu<br />
wohnen und an einer Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen. 2 Das Gleiche<br />
gilt für die übrigen Polizeivollzugsbeamten und Polizeivollzugsbeamtinnen<br />
während der Teilnahme an Lehrgängen, bei Bereitschaften sowie bei Übungen<br />
und Einsätzen im geschlossenen Verband; die oberste Dienstbehörde, die ihr<br />
unmittelbar nachgeordneten Dienststellen und die Einsatzleitung können<br />
Ausnahmen zulassen.<br />
Bay BG Art. 128 Polizeidienstunfähigkeit<br />
(1) 1 Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen sind dienstunfähig,<br />
wenn sie den besonderen gesundheitlichen Anforderungen für den<br />
Polizeivollzugsdienst nicht mehr genügen und nicht zu erwarten ist, dass<br />
sie ihre volle Verwendungsfähigkeit innerhalb zweier Jahre wiedererlangen<br />
(Polizeidienstunfähigkeit), es sei denn, die auszuübende Funktion erfordert<br />
bei Beamten und Beamtinnen auf Lebenszeit diese besonderen<br />
gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht mehr uneingeschränkt.<br />
2 Die Polizeidienstunfähigkeit und die Erfüllung der Anforderungen nach<br />
Satz 1 Halbsatz 2 werden auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens<br />
festgestellt. 3 Bestehen Zweifel über die Polizeidienstunfähigkeit, ist<br />
Art. 67 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 4 Art. 67 gilt entsprechend. 5 Für
die amtsärztliche Untersuchung der Erfüllung der Anforderungen nach<br />
Satz 1 Halbsatz 2 gelten Sätze 3 und 4 entsprechend.<br />
(2) 1 Wird amtsärztlich festgestellt, dass Polizeivollzugsbeamte oder<br />
Polizeivollzugsbeamtinnen den besonderen gesundheitlichen<br />
Anforderungen auf Dauer nicht mehr uneingeschränkt gerecht werden, so<br />
kann ihnen eine Funktion im Sinn des Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2<br />
zugewiesen werden. 2 Kann eine Funktion im Sinn des Abs. 1 Satz 1<br />
Halbsatz 2 nicht zugewiesen werden, gilt § 27 BeamtStG entsprechend.<br />
3<br />
Dabei kann Beamten oder Beamtinnen unter Beibehaltung ihres Amtes<br />
ohne ihre Zustimmung auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb ihrer<br />
Laufbahngruppe im Bereich desselben Dienstherrn übertragen werden,<br />
wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und die<br />
Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung der bisherigen<br />
Tätigkeit zuzumuten ist. 4 Polizeivollzugsbeamte und<br />
Polizeivollzugsbeamtinnen, die den besonderen gesundheitlichen<br />
Anforderungen nicht mehr uneingeschränkt gerecht werden, müssen auf<br />
Weisung der zuständigen Behörde an geeigneten und zumutbaren<br />
Maßnahmen zur Wiederherstellung ihrer uneingeschränkten<br />
Polizeidienstfähigkeit teilnehmen. 5 Ist ein Vorgehen nach den Sätzen 1 bis<br />
3 nicht möglich oder nicht erfolgversprechend, so ist nach Abs. 3 zu<br />
verfahren.<br />
(3) Ist nach Abs. 1 von Polizeidienstunfähigkeit auszugehen, so finden § 26<br />
Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 und 3 BeamtStG entsprechende Anwendung.<br />
Bay BG Art. 129 Altersgrenze<br />
1 Für Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen auf Lebenszeit gilt<br />
als Altersgrenze das Ende des Monats, in dem sie das 60. Lebensjahr<br />
vollenden. 2 Art. 63 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Eintritt<br />
in den Ruhestand höchstens bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres<br />
hinausgeschoben werden darf.<br />
Bay BG Art. 130 Beamte und Beamtinnen bei den<br />
Justizvollzugsanstalten<br />
Für Beamte und Beamtinnen auf Lebenszeit im Strafvollzugsdienst<br />
(allgemeiner Vollzugs-, Werk- und Krankenpflegedienst) bei den<br />
Justizvollzugsanstalten gilt Art. 129 entsprechend.<br />
Bay BG Art. 131 Beamte und Beamtinnen des Landesamts für<br />
Verfassungsschutz<br />
Für Beamte und Beamtinnen des Landesamts für Verfassungsschutz, die nicht<br />
gemäß einer für den Verwaltungsdienst abgelegten Prüfung in der Personalund<br />
Wirtschaftsverwaltung, in der Registratur oder im Bereich der<br />
elektronischen Datenverarbeitung des Landesamts verwendet werden, gilt<br />
Art. 129 entsprechend.<br />
Bay BG Art. 132 Feuerwehrbeamte und Feuerwehrbeamtinnen<br />
Für die Beamten und Beamtinnen des Einsatzdienstes der Berufs- und<br />
Werkfeuerwehren und des Einsatzdienstes Ständiger Wachen freiwilliger<br />
Feuerwehren gilt Art. 129 entsprechend.
Bay BG Art. 133 Notariatsbeamte und Notariatsbeamtinnen<br />
(1) Das Staatsministerium der Justiz kann die Rechtsverhältnisse der<br />
Notariatsbeamten und Notariatsbeamtinnen durch Rechtsverordnung<br />
näher regeln und hierbei die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften<br />
der besonderen Organisation des Notariatswesens anpassen.<br />
(2) Die Rechtsverordnung kann Bestimmungen enthalten über<br />
1. die Dienstvorgesetzten, die oberste Dienstbehörde und die<br />
Aufsichtsbehörden,<br />
2. den Dienstherrn im Sinn des § 48 BeamtStG,<br />
3. die Einleitung und Durchführung des Disziplinarverfahrens.<br />
Abschnitt 4 Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen<br />
Bay BG Art. 134 Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen<br />
(1) Für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen gelten die Vorschriften dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s und des Beamtenstatusgesetzes mit den sich aus der Natur des<br />
Ehrenbeamtenverhältnisses ergebenden Maßgaben:<br />
1. Nicht anzuwenden sind insbesondere Art. 5, 11, 13, 23, 24, 26 bis 40,<br />
45 Abs. 12, Art. 48, 50, 62 bis 71, 74, 81 Abs. 2 bis 7, Art. 82, 85 bis 87<br />
und 123 Abs. 2 und 3 sowie §§ 15, 22 Abs. 1 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Nrn. 3<br />
und 5, §§ 25 bis 30 und 41 BeamtStG.<br />
2. Das Ehrenbeamtenverhältnis kann für beendet erklärt werden, wenn<br />
der Ehrenbeamte oder die Ehrenbeamtin das 65. Lebensjahr vollendet<br />
hat; es ist für beendet zu erklären, wenn die sonstigen Voraussetzungen<br />
für die Versetzung in den Ruhestand vorliegen.<br />
(2) Die Unfallfürsorge für Ehrenbeamte, Ehrenbeamtinnen und ihre<br />
Hinterbliebenen richtet sich nach § 68 BeamtVG.<br />
Teil 7 Besondere Vorschriften für die unter der Aufsicht des Staates<br />
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen<br />
Rechts<br />
Bay BG Art. 135 Bestimmung von Dienstvorgesetzten oder<br />
Vorgesetzten<br />
Haben Beamte und Beamtinnen keine Dienstvorgesetzten oder Vorgesetzten,<br />
so bestimmt die oberste Aufsichtsbehörde, wer die nach diesem Gesetz auf den<br />
oder die Dienstvorgesetzten oder Vorgesetzten übertragenen Zuständigkeiten<br />
wahrnimmt.<br />
Bay BG Art. 136 Zuständigkeiten bei nichtstaatlichen Dienstherren<br />
Zuständigkeiten, die nach diesem Gesetz oder dem Beamtenstatusgesetz einer<br />
Behörde des Dienstherrn übertragen sind, werden bei den Gemeinden, den<br />
Gemeindeverbänden oder den sonstigen unter der Aufsicht des Staates<br />
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts<br />
von den nach Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung zuständigen Organen<br />
oder Stellen wahrgenommen.
Bay BG Art. 137 Oberste Aufsichtsbehörde<br />
Oberste Aufsichtsbehörde im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist bei den Gemeinden und<br />
den Gemeindeverbänden das Staatsministerium des Innern, bei den sonstigen<br />
unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und<br />
Stiftungen des öffentlichen Rechts dasjenige Staatsministerium, in dessen<br />
Geschäftsbereich die Körperschaftsaufsicht (allgemeine Aufsicht) ausgeübt<br />
wird.<br />
Teil 8 Dienstherrnwechsel<br />
Bay BG Art. 138 Übernahme von Kirchenbeamten und<br />
Kirchenbeamtinnen in ein Beamtenverhältnis im Sinn des Bayerischen<br />
Beamtengesetzes<br />
(1) 1 Ein Dienstherr (§ 2 BeamtStG) kann sich öffentlich-rechtlichen<br />
Religionsgesellschaften und ihren Verbänden gegenüber verpflichten,<br />
Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im kirchlichen Schuldienst in ein<br />
Beamtenverhältnis zu übernehmen, wenn und soweit der Betrieb von<br />
Schulen, an denen Personen dieser Religionsgesellschaften oder ihrer<br />
Verbände beschäftigt sind, eingeschränkt und aus diesem Grund das<br />
Lehrpersonal erheblich vermindert wird. 2 Die Übernahmeverpflichtungen<br />
eines Dienstherrn dürfen insgesamt zwölf v. H. der in der jeweiligen<br />
Lehramtslaufbahn freiwerdenden und wieder besetzbaren Planstellen nicht<br />
übersteigen und müssen mit einer vertraglichen Regelung über die<br />
Verteilung der Versorgungslast gemäß Art. 145 verbunden sein.<br />
3<br />
Übernommen werden dürfen nur Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen,<br />
die im Zeitpunkt der Übernahme die allgemeinen Voraussetzungen zur<br />
Berufung in das Beamtenverhältnis nach § 7 Abs. 1 BeamtStG erfüllen und<br />
entweder die erforderliche Laufbahnbefähigung nach Inkrafttreten einer<br />
Übernahmeverpflichtung nach Satz 1 erworben oder als Lehrkraft bereits<br />
in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf Probe zu einem<br />
Dienstherrn im Sinn des § 2 BeamtStG gestanden haben. 4 Eine<br />
Übernahmeverpflichtung ist ferner nur für Kirchenbeamte und<br />
Kirchenbeamtinnen zulässig, die die wettbewerbsmäßigen Anforderungen<br />
ihres Prüfungsjahrgangs für den unmittelbaren Eintritt in den Staatsdienst<br />
als Beamter oder Beamtin auf Probe erfüllt haben; bei mehrjähriger<br />
Bewährung als hauptberufliche Lehrkraft kann eine<br />
Übernahmeverpflichtung auch dann eingegangen werden, wenn das<br />
Ergebnis der Laufbahnprüfung geringfügig, höchstens um einen halben<br />
Notengrad, hinter den Anforderungen nach Halbsatz 1 zurückbleibt.<br />
(2) Auf Ernennungen zur Übernahme nach Abs. 1 findet Art. 23 Abs. 1 Satz 1<br />
keine Anwendung.<br />
(3) 1 Eine Übernahmeverpflichtung nach Abs. 1 muss mit Wirkung für die<br />
Zukunft kündbar sein. 2 Bei Kündigung einer nach Abs. 1 eingegangenen<br />
Übernahmeverpflichtung bleiben die Übernahmeverpflichtungen für<br />
Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, die im Zeitpunkt der Wirksamkeit<br />
der Kündigung bereits ernannt sind, bestehen.<br />
(4) 1 Auf die Probezeit und die Dienstzeiten des Laufbahnrechts sind<br />
gleichwertige Zeiten des kirchlichen Schuldienstes anzurechnen. 2 Die<br />
Einstellung in einem höheren Amt als dem Eingangsamt ist zulässig,
soweit der Beamte oder die Beamtin in ein Amt übernommen wird, das<br />
der letzten DienststeIlung im Kirchenbeamtenverhältnis gleichwertig ist.<br />
Bay BG Art. 139 Ausbildungskostenerstattung<br />
(1) 1 Wechseln Beamte oder Beamtinnen des mittleren oder gehobenen<br />
Dienstes in der Zeit vom Beginn ihres Vorbereitungsdienstes bis zum<br />
Ablauf von sechs Jahren nach ihrer Berufung in das Beamtenverhältnis auf<br />
Probe in dieselbe, eine entsprechende oder gleichwertige Laufbahn bei<br />
einem Dienstherrn im Geltungsbereich dieses <strong>Gesetze</strong>s, so hat der neue<br />
Dienstherr dem bisherigen Dienstherrn die Ausbildungskosten der<br />
Beamten oder Beamtinnen nach Maßgabe der folgenden Absätze zu<br />
erstatten. 2 Dies gilt auch, wenn der ehemalige Beamte oder die<br />
ehemalige Beamtin beim neuen Dienstherrn in einem<br />
Arbeitnehmerverhältnis mindestens gleichwertig beschäftigt wird. 3 Der<br />
neue Dienstherr hat dem bisherigen Dienstherrn einen Dienstherrnwechsel<br />
im Sinn der Sätze 1 und 2 unverzüglich mitzuteilen. 4 Satz 1 findet keine<br />
Anwendung, wenn der Ausbildungsdienstherr Beamte oder Beamtinnen<br />
nach der Ableistung des Vorbereitungsdienstes aus Gründen, die sie nicht<br />
zu vertreten haben, nicht in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernimmt<br />
und sie deshalb zu einem anderen Dienstherrn wechseln.<br />
(2) 1 Abs. 1 gilt nicht für Beamte und Beamtinnen in Laufbahnen, in denen der<br />
Vorbereitungsdienst allgemeine Ausbildungsstätte nach Art. 12 Abs. 1<br />
Satz 1 des Grundgesetzes ist. 2 Er findet auch keine Anwendung auf<br />
Fachlehrkräfte für gewerblich-technische Berufe, für Hauswirtschaft und<br />
für Schreibtechnik an beruflichen Schulen in Bayern und auf<br />
Polizeivollzugsbeamte, Polizeivollzugsbeamtinnen oder ehemalige<br />
Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen, die nach Art. 128<br />
Abs. 2 in ein Amt einer anderen Laufbahn versetzt werden.<br />
(3) 1 Ein Dienstherrnwechsel im Sinn des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn zwischen<br />
dem Ausscheiden aus dem bisherigen Dienstverhältnis und der<br />
Begründung eines neuen Dienstverhältnisses ein Zeitraum von mehr als<br />
zwei Jahren liegt. 2 Ein mehrfacher Dienstherrnwechsel steht einer<br />
erneuten Anwendung des Abs. 1 nicht entgegen.<br />
(4) 1 Der Erstattungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen:<br />
1. aus einem Grundbetrag als Ausgleich für die angefallene Besoldung bei<br />
Beamten und Beamtinnen<br />
– des mittleren Dienstes in Höhe des 30-fachen,<br />
– des gehobenen Dienstes in Höhe des 45-fachen<br />
des zur Zeit des Beginns des Vorbereitungsdienstes geltenden<br />
monatlichen Anwärtergrundbetrags für einen Anwärter oder eine<br />
Anwärterin vor Vollendung des 26. Lebensjahres,<br />
zuzüglich<br />
2. eines Betrags als Ausgleich für die übrigen Ausbildungskosten in Höhe<br />
von<br />
– 15 v. H. des sich nach Nr. 1 ergebenden Betrags bei Beamten und<br />
Beamtinnen des mittleren Dienstes bzw.<br />
– 30 v. H. des sich nach Nr. 1 ergebenden Betrags bei Beamten und<br />
Beamtinnen des gehobenen Dienstes<br />
abzüglich
3. eines Versorgungsabschlags in Höhe von 30 v. H. auf den sich nach<br />
Nr. 1 ergebenden Betrag.<br />
2<br />
Ein Abzug nach Satz 1 Nr. 3 entfällt, wenn der Dienstherrnwechsel mit<br />
der Rechtsfolge der Versorgungslastverteilung nach Art. 145 durchgeführt<br />
wird sowie in den Fällen des Abs. 1 Satz 2. 3 Hat der Beamte oder die<br />
Beamtin zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels die Laufbahnprüfung<br />
noch nicht abgelegt, so mindert sich der Erstattungsbetrag nach Satz 1<br />
entsprechend dem Verhältnis der beim neuen Dienstherrn noch<br />
abzuleistenden Ausbildungszeit zur regelmäßigen Dauer des<br />
Vorbereitungsdienstes.<br />
(5) 1 Der Erstattungsbetrag mindert sich für jedes volle Jahr, das der Beamte<br />
oder die Beamtin nach der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe<br />
beim bisherigen Dienstherrn Dienst geleistet hat, um ein Sechstel.<br />
2<br />
Rückzahlungen von Anwärterbezügen auf Grund des § 59 Abs. 5 des<br />
Bundesbesoldungsgesetzes sind auf den Erstattungsbetrag anzurechnen.<br />
(6) 1 Bei einem Dienstherrnwechsel von Beamten und Beamtinnen des<br />
Freistaates Bayern zu Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit<br />
weniger als 10 000 Einwohnern ermäßigt sich der Erstattungsbetrag auf<br />
die Hälfte. 2 Maßgebend ist die amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde oder<br />
Verwaltungsgemeinschaft, die vom Landesamt für Statistik und<br />
Datenverarbeitung vor dem Dienstherrnwechsel zuletzt festgestellt worden<br />
ist.<br />
(7) Soweit bei einem Dienstherrnwechsel nach Abs. 6 die Übernahme eines<br />
Beamten oder einer Beamtin des Freistaates Bayern deshalb notwendig<br />
ist, weil von der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft<br />
ausgebildete Anwärter oder Anwärterinnen die Laufbahnprüfung endgültig<br />
nicht bestanden haben, beträgt die Ermäßigung zwei Drittel des<br />
Erstattungsbetrags.<br />
(8) 1 Der Erstattungsbetrag wird vom bisherigen Dienstherrn festgesetzt und<br />
beim neuen Dienstherrn durch schriftlichen Bescheid zur Erstattung<br />
angefordert. 2 Die Berechnungsgrundlagen und die Berechnung des<br />
Erstattungsbetrags sind dem erstattungspflichtigen Dienstherrn<br />
mitzuteilen.<br />
(9) Der Erstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids<br />
fällig, sofern kein späterer Termin festgesetzt wird.<br />
(10) Im Bereich des Freistaates Bayern wird die Erstattung durch die für den<br />
Beamten oder die Beamtin zuletzt zuständige oberste Dienstbehörde oder<br />
die von ihr bestimmte Behörde geleistet.<br />
Bay BG Art. 140 Fortbildungskostenerstattung<br />
(1) 1 Wechseln Beamte oder Beamtinnen innerhalb von zwei Jahren nach<br />
Abschluss einer Fortbildungsveranstaltung zu einem anderen Dienstherrn,<br />
so haben sie dem bisherigen Dienstherrn die Fortbildungskosten nach<br />
Maßgabe der folgenden Absätze zu erstatten. 2 Ein mehrfacher Wechsel<br />
steht einer erneuten Anwendung des Satzes 1 nicht entgegen. 3 Satz 1<br />
findet keine Anwendung, wenn der bisherige Dienstherr den Wechsel<br />
angeordnet hat. 4 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Beamte oder<br />
Beamtinnen ihre Entlassung verlangen.
(2) 1 Der Erstattungsbetrag entspricht den für die Fortbildungsveranstaltung<br />
angefallenen Kosten mit Ausnahme der Reisekosten und des<br />
Trennungsgeldes. 2 Der Erstattungsbetrag mindert sich für jedes volle<br />
Jahr, das der Beamte oder die Beamtin seit Abschluss der<br />
Fortbildungsveranstaltung beim bisherigen Dienstherrn Dienst geleistet<br />
hat, um die Hälfte. 3 Der Erstattungsbetrag wird vom bisherigen<br />
Dienstherrn durch schriftlichen Bescheid zur Erstattung festgesetzt und<br />
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig.<br />
(3) Der Erstattungsbetrag wird nur erhoben, wenn die<br />
Fortbildungsveranstaltung eine Dauer von insgesamt vier Wochen<br />
überschreitet, die Kosten je Fortbildungstag 500 € übersteigen und das<br />
durch die Fortbildung erworbene Fachwissen außerhalb des bisherigen<br />
Tätigkeitsbereichs einsetzbar ist.<br />
(4) Die Entscheidung trifft der oder die unmittelbare Dienstvorgesetzte.<br />
Teil 9 Übergangsregelungen und Schlussvorschriften<br />
Bay BG Art. 141 Übergangsregelung zum Wegfall der Anstellung<br />
(1) 1 Beamten und Beamtinnen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s noch kein Amt innehaben, wird mit Ablauf des 31. März 2009 ein<br />
Amt verliehen. 2 Die für die Ernennung zuständige Behörde stellt die<br />
Amtsverleihung fest.<br />
(2) Auf Beamte und Beamtinnen, denen bis zum Ablauf des 31. März 2009<br />
bereits ein Amt verliehen wurde, ist an Stelle des Art. 28 Abs. 2 Satz 2<br />
Nr. 2 weiterhin Art. 21 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 in der bis zum 31. März 2009<br />
geltenden Fassung anzuwenden.<br />
Bay BG Art. 142 Übergangsregelung zum Antragsruhestand<br />
(1) Für Beamte und Beamtinnen, die sich am 1. Januar 2003 in Altersteilzeit<br />
im Blockmodell (Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) befunden haben, gilt Art. 56<br />
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 in der bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung fort.<br />
(2) Abs. 1 gilt für Beamte und Beamtinnen entsprechend, die am 1. Januar<br />
2003<br />
1. bis zum Beginn des Ruhestands beurlaubt sind oder<br />
2. sich in einem Arbeitszeitmodell mit einer ungleichmäßigen Verteilung<br />
der Arbeitszeit nach Art. 87 Abs. 3 oder in Teilzeitbeschäftigung gemäß<br />
Art. 88 Abs. 4 befinden, sofern<br />
a) der Ausgleich der Arbeitszeiterhöhung durch anschließende volle<br />
Freistellung vom Dienst erfolgt und<br />
b) sich der Zeitraum der Freistellung bis zu einem Zeitpunkt erstreckt, zu<br />
dem der Beamte oder die Beamtin das 63. Lebensjahr bereits vollendet.<br />
Bay BG Art. 142 a Übergangsregelung zur Altersteilzeit<br />
1 Für Beamte und Beamtinnen, die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2010<br />
angetreten haben, gilt Art. 91 in der am 31. Dezember 2009 geltenden<br />
Fassung. 2 Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die das nach Art. 91 Abs. 1<br />
Satz 1 maßgebliche Lebensjahr in der zweiten Hälfte des Schuljahres<br />
2009/2010 vollenden, gilt als Altersgrenze der Beginn des folgenden<br />
Schuljahres. 3 Für diese Lehrkräfte und für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen,
die die gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 91 in der am 31. Dezember<br />
2009 geltenden Fassung erfüllt haben, die aber aus schulorganisatorischen<br />
Gründen Altersteilzeit nicht vor dem 1. August 2010 antreten können, gilt<br />
hinsichtlich des Arbeitszeitumfangs Art. 91 Abs. 1 Satz 1 in der am<br />
31. Dezember 2009 geltenden Fassung.<br />
Bay BG Art. 143 Verteilung der Versorgungslast nach bisherigem Recht<br />
(1) Die Verteilung der Versorgungslast regelt sich nach bisherigem Recht,<br />
wenn Beamte und Beamtinnen im Einverständnis mit ihrem Dienstherrn in<br />
den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen worden sind.<br />
(2) 1 Der Staat trägt die gesetzlichen Versorgungsbezüge für die Beamten und<br />
Beamtinnen der früheren staatlichen Polizeiverwaltungen und ihre<br />
Hinterbliebenen aus den vor Ablauf des 8. Mai 1945 eingetretenen<br />
Versorgungsfällen auch insoweit, als er nach § 82 Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s zur<br />
Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Art. 131 des Grundgesetzes<br />
fallenden Personen nicht zahlungspflichtig ist. 2 Er erstattet den Städten,<br />
die nach § 82 Abs. 1 des <strong>Gesetze</strong>s zur Regelung der Rechtsverhältnisse<br />
der unter Art. 131 des Grundgesetzes fallenden Personen die Aufgaben<br />
der früheren staatlichen Polizeiverwaltungen übernommen haben und<br />
damit Dienstherren der Beamten und Beamtinnen dieser Dienststellen<br />
geworden sind, bei Eintritt des Versorgungsfalls den Anteil an den<br />
Versorgungsbezügen, der dem Verhältnis der bis zum Ablauf des 8. Mai<br />
1945 im planmäßigen Beamtenverhältnis bei der Polizei zurückgelegten<br />
vollen Dienstjahre zu den nach dem 8. Mai 1945 im planmäßigen<br />
Gemeindedienst zurückgelegten vollen Dienstjahren entspricht. 3 Die<br />
Bewilligung von Versorgungsbezügen auf Grund von Kannvorschriften, für<br />
die den Staat eine Erstattungspflicht trifft, bedarf der Zustimmung des<br />
Staatsministeriums der Finanzen.<br />
(3) 1 Der Staat trägt die Versorgung für die unter Kapitel II des <strong>Gesetze</strong>s zu<br />
Art. 131 des Grundgesetzes fallenden früheren Bediensteten des<br />
Reichsnährstands, die am 8. Mai 1945 bei Einrichtungen des<br />
Reichsnährstands in Bayern beschäftigt waren. 2 Das Gleiche gilt für unter<br />
Kapitel II des <strong>Gesetze</strong>s zu Art. 131 des Grundgesetzes fallende<br />
Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen des<br />
Reichsnährstands, die am 8. Mai 1945 von einer Versorgungskasse des<br />
Reichsnährstands in Bayern Versorgungsbezüge erhalten haben.<br />
Bay BG Art. 144 Zuständigkeiten im Vollzug des<br />
Beamtenversorgungsgesetzes<br />
(1) 1 Die Festsetzung und Regelung der Versorgung, die Bestimmung der<br />
Person des Zahlungsempfängers oder der Zahlungsempfängerin, die<br />
Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie die<br />
Bewilligung von Versorgungsbezügen auf Grund von Kannvorschriften<br />
obliegt für die Beamten und Beamtinnen des Staates sowie ihre<br />
Hinterbliebenen der von der Staatsregierung durch Rechtsverordnung<br />
bestimmten Pensionsbehörde. 2 In der Rechtsverordnung kann die<br />
Zuständigkeit von Pensionsbehörden für weitere<br />
Versorgungsangelegenheiten bestimmt werden. 3 Zu den<br />
Versorgungsangelegenheiten in diesem Sinn gehört auch die Erteilung
einer Bescheinigung, dass die Voraussetzungen für die kraft <strong>Gesetze</strong>s<br />
erfolgte Nachversicherung vorliegen. 4 Unberührt bleiben gesetzliche<br />
Vorschriften, die eine ausschließliche Zuständigkeit anderer Behörden<br />
bestimmen.<br />
(2) 1 Entscheidungen gemäß § 49 Abs. 2 Satz 2, § 67 Abs. 3 BeamtVG, ob<br />
Zeiten auf Grund der §§ 10 bis 12, 13 Abs. 2 und § 67 Abs. 2 BeamtVG<br />
als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, trifft die<br />
Einstellungsbehörde. 2 Bei Beamten und Beamtinnen des Staates ergehen<br />
die Entscheidungen im Einvernehmen mit der Pensionsbehörde (Abs. 1),<br />
es sei denn, dass das Staatsministerium der Finanzen selbst<br />
Einstellungsbehörde ist.<br />
(3) Die in § 49 Abs. 3 BeamtVG genannten Befugnisse stehen für die Beamten<br />
und Beamtinnen der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der<br />
sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften,<br />
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und ihre Hinterbliebenen<br />
der obersten Dienstbehörde zu.<br />
(4) 1 Zum Vollzug der Vorschriften über die Unfallfürsorge (§§ 30 bis 46<br />
BeamtVG) sind verletzte Beamte und Beamtinnen verpflichtet, der<br />
Pensionsbehörde die für die Feststellung der Unfallfürsorgeansprüche<br />
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die in diesem Zusammenhang<br />
über sie bei Krankenanstalten, Rehabilitationseinrichtungen,<br />
Versicherungen, Behörden und behandelnden Ärzten und Ärztinnen<br />
geführten Untersuchungsunterlagen auf Verlangen zur Einsichtnahme<br />
vorzulegen. 2 Die Pensionsbehörde kann die Auskünfte und Unterlagen den<br />
mit der Begutachtung beauftragten Ärzten und Ärztinnen bekanntgeben.<br />
(5) Das Staatsministerium der Finanzen kann die zur Durchführung des<br />
Beamtenversorgungsgesetzes erforderlichen allgemeinen<br />
Verwaltungsvorschriften und Richtlinien erlassen, soweit nicht eine<br />
allgemeine Regelung gemäß § 107 BeamtVG getroffen worden ist.<br />
Bay BG Art. 145 Versorgungsausgleich zwischen mehreren<br />
Dienstherren<br />
(1) 1 Werden Beamte und Beamtinnen auf Lebenszeit, auf Probe oder auf Zeit<br />
in ein Amt eines anderen Dienstherrn versetzt (Art. 48 Abs. 2), so tragen<br />
die Dienstherren die späteren Versorgungsbezüge anteilig nach den<br />
Dienstzeiten, die diese Beamten und Beamtinnen bei ihnen im<br />
Beamtenverhältnis abgeleistet haben, soweit diese ruhegehaltfähig sind.<br />
2 Bei der Berechnung der Dienstzeiten werden nur volle Jahre zugrunde<br />
gelegt.<br />
(2) Sind Beamte und Beamtinnen aus Anlass oder nach der Versetzung von<br />
dem neuen Dienstherrn befördert worden, so bemisst sich der Anteil des<br />
früheren Dienstherrn so, wie wenn sie in dem früheren Amt verblieben<br />
wären.<br />
(3) 1 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend bei Wechsel zwischen dem<br />
Beamtenverhältnis und dem Dienstverhältnis des berufsmäßigen<br />
kommunalen Wahlbeamten. 2 Das Gleiche gilt, wenn<br />
dienstordnungsmäßige Angestellte eines Sozialversicherungsträgers mit
dessen Einverständnis in ein Beamtenverhältnis berufen werden und<br />
umgekehrt.<br />
(4) Abs. 1 und 2 gelten ferner entsprechend bei der Übernahme von Beamten<br />
und Beamtinnen auf Lebenszeit, auf Probe oder auf Zeit in den Dienst<br />
einer anderen Körperschaft nach Maßgabe der §§ 16 und 17 BeamtStG<br />
und der Art. 51 und 52, soweit die abgebende Körperschaft bestehen<br />
bleibt.<br />
(5) Die Durchführung regelt das Staatsministerium der Finanzen durch<br />
Rechtsverordnung.<br />
Bay BG Art. 146 (weggefallen)<br />
Bay BG Art. 147 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
(1) 1 Dieses Gesetz tritt am 1. April 2009 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1<br />
treten Art. 45 Abs. 12 Nr. 1 und Abs. 14 mit Wirkung vom 1. April 2007 in<br />
Kraft.<br />
(2) Aufhebung anderer Rechtsvorschriften
Bayerische Bauordnung (Bay BO)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 479), vom 28. Mai 2009 (GVBl. S. 218), vom 27. Juli 2009 (GVBl.<br />
S. 385), vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 630) (FN BayRS 2132-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Erster Teil Allgemeine Vorschriften<br />
Art. 1 Anwendungsbereich<br />
Art. 2 Begriffe<br />
Art. 3 Allgemeine Anforderungen<br />
Zweiter Teil Das Grundstück und seine Bebauung<br />
Art. 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden<br />
Art. 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken<br />
Art. 6 Abstandsflächen, Abstände<br />
Art. 7 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke; Kinderspielplätze<br />
Dritter Teil Bauliche Anlagen<br />
Abschnitt I Baugestaltung<br />
Art. 8 Baugestaltung<br />
Abschnitt II Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung<br />
Art. 9 Baustelle<br />
Art. 10 <strong>Stand</strong>sicherheit<br />
Art. 11 Schutz gegen Einwirkungen<br />
Art. 12 Brandschutz<br />
Art. 13 Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz<br />
Art. 14 Verkehrssicherheit
Abschnitt III Bauprodukte und Bauarten<br />
Art. 15 Bauprodukte<br />
Art. 16 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung<br />
Art. 17 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis<br />
Art. 18 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall<br />
Art. 19 Bauarten<br />
Art. 20 Übereinstimmungsnachweis<br />
Art. 21 Übereinstimmungserklärung des Herstellers<br />
Art. 22 Übereinstimmungszertifikat<br />
Art. 23 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen<br />
Abschnitt IV Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken,<br />
Dächer<br />
Art. 24 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und<br />
Bauteilen<br />
Art. 25 Tragende Wände, Stützen<br />
Art. 26 Außenwände<br />
Art. 27 Trennwände<br />
Art. 28 Brandwände<br />
Art. 29 Decken<br />
Art. 30 Dächer<br />
Abschnitt V Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen<br />
Art. 31 Erster und zweiter Rettungsweg<br />
Art. 32 Treppen<br />
Art. 33 Notwendige Treppenräume, Ausgänge
Art. 34 Notwendige Flure, offene Gänge<br />
Art. 35 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen<br />
Art. 36 Umwehrungen<br />
Abschnitt VI Technische Gebäudeausrüstung<br />
Art. 37 Aufzüge<br />
Art. 38 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle<br />
Art. 39 Lüftungsanlagen<br />
Art. 40 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung,<br />
Brennstoffversorgung<br />
Art. 41 Nicht durch Sammelkanalisation erschlossene Anwesen<br />
Art. 42 Sanitäre Anlagen<br />
Art. 43 Aufbewahrung fester Abfallstoffe<br />
Art. 44 Blitzschutzanlagen<br />
Abschnitt VII Nutzungsbedingte Anforderungen<br />
Art. 45 Aufenthaltsräume<br />
Art. 46 Wohnungen<br />
Art. 47 Stellplätze<br />
Art. 48 Barrierefreies Bauen<br />
Vierter Teil Die am Bau Beteiligten<br />
Art. 49 Grundpflichten<br />
Art. 50 Bauherr<br />
Art. 51 Entwurfsverfasser<br />
Art. 52 Unternehmer
Fünfter Teil Bauaufsichtsbehörden, Verfahren<br />
Abschnitt I Bauaufsichtsbehörden<br />
Art. 53 Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden<br />
Art. 54 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden<br />
Abschnitt II Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit<br />
Art. 55 Grundsatz<br />
Art. 56 Vorrang anderer Gestattungsverfahren<br />
Art. 57 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen<br />
Art. 58 Genehmigungsfreistellung<br />
Abschnitt III Genehmigungsverfahren<br />
Art. 59 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren<br />
Art. 60 Baugenehmigungsverfahren<br />
Art. 61 Bauvorlageberechtigung<br />
Art. 62 Bautechnische Nachweise<br />
Art. 63 Abweichungen<br />
Art. 64 Bauantrag, Bauvorlagen<br />
Art. 65 Behandlung des Bauantrags<br />
Art. 66 Beteiligung des Nachbarn<br />
Art. 67 Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens<br />
Art. 68 Baugenehmigung und Baubeginn<br />
Art. 69 Geltungsdauer der Baugenehmigung und der Teilbaugenehmigung<br />
Art. 70 Teilbaugenehmigung<br />
Art. 71 Vorbescheid
Art. 72 Genehmigung fliegender Bauten<br />
Art. 73 Bauaufsichtliche Zustimmung<br />
Abschnitt IV Bauaufsichtliche Maßnahmen<br />
Art. 74 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte<br />
Art. 75 Einstellung von Arbeiten<br />
Art. 76 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung<br />
Abschnitt V Bauüberwachung<br />
Art. 77 Bauüberwachung<br />
Art. 78 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung<br />
Sechster Teil Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften<br />
Art. 79 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 80 Rechtsverordnungen<br />
Art. 81 Örtliche Bauvorschriften<br />
Siebter Teil Ausführungsbestimmungen zum Baugesetzbuch<br />
Art. 82 Frist zur Nutzungsänderung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude<br />
Achter Teil Übergangs- und Schlussvorschriften<br />
Art. 83 Übergangsvorschriften<br />
Art. 84 Inkrafttreten<br />
Erster Teil Allgemeine Vorschriften<br />
Bay BO Art. 1 Anwendungsbereich<br />
(1) 1 Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen und Bauprodukte. 2 Es gilt<br />
auch für Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die<br />
nach diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
Anforderungen gestellt werden.<br />
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für<br />
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs sowie ihre Nebenanlagen und<br />
Nebenbetriebe, ausgenommen Gebäude an Flugplätzen,
2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen,<br />
3. Rohrleitungsanlagen sowie Leitungen aller Art, ausgenommen in<br />
Gebäuden,<br />
4. Kräne und Krananlagen,<br />
5. Gerüste,<br />
6. Feuerstätten, die nicht der Raumheizung oder der<br />
Brauchwassererwärmung dienen, ausgenommen Gas-Haushalts-<br />
Kochgeräte.<br />
Bay BO Art. 2 Begriffe<br />
(1) 1 Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten<br />
hergestellte Anlagen. 2 Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung<br />
(Werbeanlagen) einschließlich Automaten sind bauliche Anlagen. 3 Als<br />
bauliche Anlagen gelten Anlagen, die nach ihrem Verwendungszweck dazu<br />
bestimmt sind, überwiegend ortsfest benutzt zu werden, sowie<br />
1. Aufschüttungen, soweit sie nicht unmittelbare Folge von Abgrabungen<br />
sind,<br />
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze,<br />
3. Campingplätze und Wochenendplätze,<br />
4. Freizeit- und Vergnügungsparks,<br />
5. Stellplätze für Kraftfahrzeuge.<br />
4<br />
Anlagen sind bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen<br />
im Sinn des Art. 1 Abs. 1 Satz 2.<br />
(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die<br />
von Menschen betreten werden können.<br />
(3) 1 Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt:<br />
1. Gebäudeklasse 1:<br />
a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als<br />
zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m 2 und<br />
b) land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude,<br />
2. Gebäudeklasse 2:<br />
Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei<br />
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m 2 ,<br />
3. Gebäudeklasse 3:<br />
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,<br />
4. Gebäudeklasse 4:<br />
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils<br />
nicht mehr als 400 m 2 ,<br />
5. Gebäudeklasse 5:<br />
sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.<br />
2<br />
Höhe im Sinn des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des<br />
höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist,<br />
über der Geländeoberfläche im Mittel. 3 Bei der Berechnung der Flächen<br />
nach Satz 1 bleiben die Flächen im Kellergeschoss außer Betracht.<br />
(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die<br />
einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:<br />
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Abs. 3 Satz 2 von mehr als<br />
22 m),<br />
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,
3. Gebäude mit mehr als 1 600 m 2 Fläche des Geschosses mit der größten<br />
Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude und Garagen,<br />
4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Fläche<br />
von insgesamt mehr als 800 m 2 haben,<br />
5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen<br />
und einzeln mehr als 400 m 2 haben,<br />
6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für eine Nutzung durch mehr als<br />
100 Personen bestimmt sind,<br />
7. Versammlungsstätten<br />
a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher<br />
fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege<br />
haben,<br />
b) im Freien mit Szenenflächen und Freisportanlagen, deren<br />
Besucherbereich jeweils mehr als 1 000 Besucher fasst und ganz oder<br />
teilweise aus baulichen Anlagen besteht,<br />
8. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden,<br />
Beherbergungsstätten mit mehr als zwölf Betten und Spielhallen mit mehr<br />
als 150 m 2 ,<br />
9. Krankenhäuser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung<br />
oder Pflege von Personen,<br />
10. Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte und alte Menschen,<br />
11. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,<br />
12. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug,<br />
13. Camping- und Wochenendplätze,<br />
14. Freizeit- und Vergnügungsparks,<br />
15. fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen,<br />
sowie Fahrgeschäfte, die keine fliegenden Bauten und nicht verfahrensfrei<br />
sind,<br />
16. Regale mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 7,50 m,<br />
17. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung<br />
von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist,<br />
18. Anlagen und Räume, die in den Nrn. 1 bis 17 nicht aufgeführt und<br />
deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.<br />
(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden<br />
Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind.<br />
(6) Flächen von Gebäuden, Geschossen, Nutzungseinheiten und Räumen sind<br />
als Brutto-Grundfläche zu ermitteln, soweit nichts anderes geregelt ist.<br />
(7) 1 Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im<br />
Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen; im<br />
Übrigen sind sie Kellergeschosse. 2 Hohlräume zwischen der obersten<br />
Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind,<br />
sind keine Geschosse.<br />
(8) 1 Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen<br />
außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche dienen. 2 Garagen sind Gebäude<br />
oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 3 Ausstellungs-,<br />
Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind keine<br />
Stellplätze oder Garagen.<br />
(9) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest benutzte Anlagen, die<br />
dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen.
(10) Bauprodukte sind<br />
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft<br />
in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,<br />
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt<br />
werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighäuser,<br />
Fertiggaragen und Silos.<br />
(11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen<br />
oder Teilen von baulichen Anlagen.<br />
Bay BO Art. 3 Allgemeine Anforderungen<br />
(1) 1 Anlagen sind unter Berücksichtigung der Belange der Baukultur,<br />
insbesondere der anerkannten Regeln der Baukunst, so anzuordnen, zu<br />
errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit<br />
und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, und die natürlichen<br />
Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. 2 Sie müssen bei<br />
ordnungsgemäßer Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des<br />
Satzes 1 ihrem Zweck entsprechend angemessen dauerhaft erfüllen und<br />
ohne Missstände benutzbar sein.<br />
(2) 1 Die vom Staatsministerium des Innern oder der von ihm bestimmten<br />
Stelle durch öffentliche Bekanntmachung als Technische<br />
Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln sind zu beachten.<br />
2<br />
Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die<br />
Fundstelle verwiesen werden. 3 Von den Technischen Baubestimmungen<br />
kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem<br />
Maße die allgemeinen Anforderungen des Abs. 1 erfüllt werden; Art. 15<br />
Abs. 3 und Art. 19 bleiben unberührt. 4 Werden die allgemein anerkannten<br />
Regeln der Baukunst und Technik beachtet, gelten die entsprechenden<br />
bauaufsichtlichen Anforderungen dieses <strong>Gesetze</strong>s und der auf Grund<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen Vorschriften als eingehalten.<br />
(3) Für die Beseitigung von Anlagen, für die Änderung ihrer Nutzung und für<br />
Baugrundstücke gelten Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 entsprechend.<br />
(4) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften eines anderen<br />
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen<br />
Vertragsstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen<br />
Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen entsprechen,<br />
dürfen verwendet oder angewendet werden, wenn das geforderte<br />
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und<br />
Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.<br />
Zweiter Teil Das Grundstück und seine Bebauung<br />
Bay BO Art. 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden<br />
(1) Gebäude dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen errichtet werden:<br />
1. Das Grundstück muss nach Lage, Form, Größe und Beschaffenheit für<br />
die beabsichtigte Bebauung geeignet sein;<br />
2. das Grundstück muss in einer angemessenen Breite an einer<br />
befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen.<br />
(2) Abweichend von Abs. 1 Nr. 2 sind im Geltungsbereich eines<br />
Bebauungsplans im Sinn der §§ 12 und 30 Abs. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) und innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34<br />
BauGB) nicht erforderlich<br />
1. die Befahrbarkeit von Wohnwegen begrenzter Länge, wenn keine<br />
Bedenken wegen des Brandschutzes oder des Rettungsdienstes bestehen,<br />
2. die Widmung von Wohnwegen begrenzter Länge, wenn von dem<br />
Wohnweg nur Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 erschlossen<br />
werden und gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde<br />
rechtlich gesichert ist, dass der Wohnweg sachgerecht unterhalten wird<br />
und allgemein benutzt werden kann.<br />
(3) Im Außenbereich genügt eine befahrbare, gegenüber dem Rechtsträger<br />
der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesicherte Zufahrt zu einem<br />
befahrbaren öffentlichen Weg.<br />
Bay BO Art. 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken<br />
(1) 1 Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein<br />
geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen;<br />
zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg<br />
dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. 2 Zu Gebäuden,<br />
bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten<br />
Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den<br />
Fällen des Satzes 1 an Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder<br />
Durchfahrt zu schaffen. 3 Ist für die Personenrettung der Einsatz von<br />
Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstellund<br />
Bewegungsflächen vorzusehen. 4 Bei Gebäuden, die ganz oder mit<br />
Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind,<br />
sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den<br />
Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen<br />
herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich<br />
sind.<br />
(2) 1 Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen für<br />
Feuerwehreinsatzfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie<br />
sind als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; die<br />
Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche<br />
aus sichtbar sein. 2 Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach Satz 1 nicht<br />
abgestellt werden.<br />
Bay BO Art. 6 Abstandsflächen, Abstände<br />
(1) 1 Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von<br />
oberirdischen Gebäuden freizuhalten. 2 Satz 1 gilt entsprechend für andere<br />
Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber<br />
Gebäuden und Grundstücksgrenzen. 3 Eine Abstandsfläche ist nicht<br />
erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet<br />
werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut<br />
werden muss oder gebaut werden darf.<br />
(2) 1 Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30<br />
Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen. 2 Sie dürfen auch auf<br />
öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu<br />
deren Mitte. 3 Abstandsflächen sowie Abstände im Sinn des Satzes 1<br />
dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn
echtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden,<br />
oder wenn der Nachbar gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich,<br />
aber nicht in elektronischer Form, zustimmt; die Zustimmung des<br />
Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger.<br />
4<br />
Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen<br />
Abstandsflächen nicht angerechnet werden.<br />
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für<br />
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander<br />
stehen,<br />
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei<br />
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen<br />
zulässig sind.<br />
(4) 1 Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird<br />
senkrecht zur Wand gemessen. 2 Wandhöhe ist das Maß von der<br />
Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder<br />
bis zum oberen Abschluss der Wand. 3 Die Höhe von Dächern mit einer<br />
Neigung von mehr als 70 Grad wird voll, von Dächern mit einer Neigung<br />
von mehr als 45 Grad zu einem Drittel hinzugerechnet. 4 Die Höhe der<br />
Giebelflächen im Bereich des Dachs ist bei einer Dachneigung von mehr<br />
als 70 Grad voll, im Übrigen nur zu einem Drittel anzurechnen. 5 Die<br />
Sätze 1 bis 4 gelten für Dachaufbauten entsprechend. 6 Das sich<br />
ergebende Maß ist H.<br />
(5) 1 Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, mindestens 3 m. 2 In<br />
Kerngebieten genügt eine Tiefe von 0,50 H, mindestens 3 m, in Gewerbeund<br />
Industriegebieten eine Tiefe von 0,25 H, mindestens 3 m. 3 Werden<br />
von einer städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach Art. 81<br />
Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen<br />
größerer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 und 2 liegen<br />
müssten, finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung, es sei denn, die<br />
Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an; die ausreichende<br />
Belichtung und Belüftung dürfen nicht beeinträchtigt, die Flächen für<br />
notwendige Nebenanlagen nicht eingeschränkt werden. 4 Satz 3 gilt<br />
entsprechend, wenn sich einheitlich abweichende Abstandsflächentiefen<br />
aus der umgebenden Bebauung im Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB<br />
ergeben.<br />
(6) 1 Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge genügt als Tiefe<br />
der Abstandsflächen die Hälfte der nach Abs. 5 erforderlichen Tiefe,<br />
mindestens jedoch 3 m; das gilt nicht in Kern-, Gewerbe- und<br />
Industriegebieten. 2 Wird ein Gebäude mit einer Außenwand an eine<br />
Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch für eine Außenwand; wird<br />
ein Gebäude mit zwei Außenwänden an Grundstücksgrenzen gebaut, so ist<br />
Satz 1 nicht anzuwenden; Grundstücksgrenzen zu öffentlichen<br />
Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen<br />
bleiben hierbei unberücksichtigt. 3 Aneinandergebaute Gebäude sind wie<br />
ein Gebäude zu behandeln.<br />
(7) Die Gemeinde kann durch Satzung, die auch nach Art. 81 Abs. 2 erlassen<br />
werden kann, abweichend von Abs. 4 Sätze 3 und 4, Abs. 5 Sätze 1 und 2<br />
sowie Abs. 6 für ihr Gemeindegebiet oder Teile ihres Gemeindegebiets
vorsehen, dass<br />
1. nur die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad<br />
zu einem Drittel, bei einer größeren Neigung der Wandhöhe voll<br />
hinzugerechnet wird und<br />
2. die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 H, mindestens 3 m, in Gewerbe- und<br />
Industriegebieten 0,2 H, mindestens 3 m, beträgt.<br />
(8) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht<br />
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und<br />
Dachüberstände,<br />
2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn<br />
sie<br />
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des<br />
jeweiligen Gebäudes, höchstens jedoch insgesamt 5 m in Anspruch<br />
nehmen,<br />
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und<br />
c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt<br />
bleiben,<br />
3. untergeordnete Dachgauben, wenn<br />
a) sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des<br />
jeweiligen Gebäudes, höchstens jedoch insgesamt 5 m, in Anspruch<br />
nehmen und<br />
b) ihre Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 4 m 2 beträgt und eine Höhe<br />
von nicht mehr als 2,5 m aufweist.<br />
(9) 1 In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene<br />
Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder<br />
an das Gebäude angebaut werden, zulässig<br />
1. Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte<br />
Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne<br />
Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu<br />
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, bei einer<br />
Länge der Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus<br />
freistehende Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer<br />
mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht mehr als 50 m 3 Brutto-Rauminhalt<br />
und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 5 m; abweichend von<br />
Abs. 4 bleibt bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Höhe von Dächern<br />
und Giebelflächen unberücksichtigt,<br />
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer<br />
Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m,<br />
3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und<br />
Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.<br />
2<br />
Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den<br />
Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2<br />
darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.<br />
Bay BO Art. 7 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke;<br />
Kinderspielplätze<br />
(1) 1 Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen<br />
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind<br />
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,<br />
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung<br />
der Flächen entgegenstehen. 2 Satz 1 findet keine Anwendung, soweit<br />
Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht<br />
überbauten Flächen treffen.<br />
(2) 1 Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf<br />
dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen<br />
geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck<br />
gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert<br />
sein muss, ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen. 2 Das gilt<br />
nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein<br />
sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder<br />
vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der<br />
Wohnungen nicht erforderlich ist. 3 Bei bestehenden Gebäuden nach<br />
Satz 1 kann die Herstellung von Kinderspielplätzen verlangt werden.<br />
Dritter Teil Bauliche Anlagen<br />
Abschnitt I Baugestaltung<br />
Bay BO Art. 8 Baugestaltung<br />
1 Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen<br />
und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht<br />
verunstaltet wirken. 2 Bauliche Anlagen dürfen das Straßen-, Orts- und<br />
Landschaftsbild nicht verunstalten. 3 Die störende Häufung von Werbeanlagen<br />
ist unzulässig.<br />
Abschnitt II Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung<br />
Bay BO Art. 9 Baustelle<br />
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemäß<br />
errichtet, geändert, beseitigt oder instand gehalten werden können und<br />
dass keine Gefahren, vermeidbaren Nachteile oder vermeidbaren<br />
Belästigungen entstehen.<br />
(2) Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und<br />
Meldeanlagen, Grundwassermessstellen, Vermessungszeichen,<br />
Abmarkungszeichen und Grenzzeichen sind für die Dauer der<br />
Bauausführung zu schützen und, soweit erforderlich, unter den<br />
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugänglich zu halten.<br />
(3) Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat der Bauherr an<br />
der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die<br />
Namen und Anschriften des Bauherrn und des Entwurfsverfassers<br />
enthalten muss, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus<br />
sichtbar anzubringen.
Bay BO Art. 10 <strong>Stand</strong>sicherheit<br />
1 Jede bauliche Anlage muss im Ganzen, in ihren einzelnen Teilen und für sich<br />
allein standsicher sein. 2 Die <strong>Stand</strong>sicherheit muss auch während der<br />
Errichtung und bei der Änderung und der Beseitigung gewährleistet sein. 3 Die<br />
<strong>Stand</strong>sicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des<br />
Baugrunds des Nachbargrundstücks dürfen nicht gefährdet werden.<br />
Bay BO Art. 11 Schutz gegen Einwirkungen<br />
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu<br />
halten, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlinge<br />
sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren<br />
oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.<br />
Bay BO Art. 12 Brandschutz<br />
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu<br />
halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und<br />
Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung<br />
von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.<br />
Bay BO Art. 13 Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz<br />
(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen<br />
entsprechenden Wärmeschutz haben.<br />
(2) 1 Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz<br />
haben. 2 Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen<br />
oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren<br />
oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.<br />
(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in<br />
baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu<br />
dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht<br />
entstehen.<br />
Bay BO Art. 14 Verkehrssicherheit<br />
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten<br />
Flächen bebauter Grundstücke müssen verkehrssicher sein.<br />
(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs darf durch<br />
bauliche Anlagen und deren Nutzung nicht gefährdet werden.<br />
Abschnitt III Bauprodukte und Bauarten<br />
Bay BO Art. 15 Bauprodukte<br />
(1) 1 Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung<br />
baulicher Anlagen nur verwendet werden, wenn sie für den<br />
Verwendungszweck<br />
1. von den nach Abs. 2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder<br />
nicht wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Abs. 3<br />
zulässig sind und wenn sie auf Grund des Übereinstimmungsnachweises<br />
nach Art. 20 das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen oder
2. nach den Vorschriften<br />
a) des Bauproduktengesetzes (BauPG),<br />
b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates zur Angleichung<br />
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über<br />
Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 (ABl EG<br />
Nr. L 40 S. 12), geändert durch Art. 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates<br />
vom 22. Juli 1993 (ABl EG Nr. L 220 S. 1), durch andere Mitgliedstaaten<br />
der Europäischen Union und andere Vertragsstaaten des Abkommens über<br />
den Europäischen Wirtschaftsraum oder<br />
c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäischen Union, soweit<br />
diese die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG<br />
berücksichtigen,<br />
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere das<br />
Zeichen der Europäischen Union (CE-Kennzeichnung) tragen und dieses<br />
Zeichen die nach Abs. 7 Nr. 1 festgelegten Klassen und Leistungsstufen<br />
ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt. 2 Sonstige<br />
Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht<br />
abweichen, dürfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in<br />
der Bauregelliste A bekannt gemacht sind. 3 Sonstige Bauprodukte, die von<br />
allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, bedürfen keines<br />
Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Abs. 3.<br />
(2) 1 Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium des Innern für Bauprodukte, für die nicht nur die<br />
Vorschriften nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der<br />
Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in<br />
diesem Gesetz und in Vorschriften auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s an bauliche<br />
Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. 2 Diese technischen<br />
Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im Sinn des Art. 3 Abs. 2<br />
Satz 1.<br />
(3) 1 Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bauregelliste A nach<br />
Abs. 2 bekannt gemacht worden sind und die von diesen wesentlich<br />
abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik oder<br />
Technische Baubestimmungen nach Art. 3 Abs. 2 nicht gibt (nicht<br />
geregelte Bauprodukte), müssen<br />
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Art. 16),<br />
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (Art. 17) oder<br />
3. eine Zustimmung im Einzelfall (Art. 18)<br />
haben. 2 Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der<br />
Anforderungen dieses <strong>Gesetze</strong>s oder auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s nur eine<br />
untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut für<br />
Bautechnik im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern in<br />
einer Liste C öffentlich bekanntgemacht hat.<br />
(4) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnungen<br />
vorschreiben, dass für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie<br />
Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich<br />
dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und<br />
bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach Maßgabe der Art. 15 bis 18<br />
und 20 bis 23 zu führen sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese<br />
Nachweise verlangen oder zulassen.
(5) 1 Bei Bauprodukten nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, deren Herstellung in<br />
außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit<br />
betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen<br />
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen<br />
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung<br />
des Staatsministeriums des Innern vorgeschrieben werden, dass der<br />
Hersteller über solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt und den<br />
Nachweis hierfür gegenüber einer Prüfstelle nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1<br />
Nr. 6 zu erbringen hat. 2 In der Rechtsverordnung können<br />
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prüfung<br />
nachzuweisende Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der<br />
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.<br />
(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres<br />
besonderen Verwendungszwecks einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei<br />
Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der<br />
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall<br />
oder durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern die<br />
Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle nach<br />
Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 vorgeschrieben werden.<br />
(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium des Innern in der Bauregelliste B<br />
1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in Normen,<br />
Leitlinien oder europäischen technischen Zulassungen nach dem<br />
Bauproduktengesetz oder in anderen Vorschriften zur Umsetzung von<br />
Richtlinien der Europäischen Union enthalten sind, Bauprodukte nach<br />
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen, und<br />
2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von<br />
Richtlinien der Europäischen Union die wesentlichen Anforderungen nach<br />
§ 5 Abs. 1 BauPG nicht berücksichtigen.<br />
Bay BO Art. 16 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung<br />
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allgemeine<br />
bauaufsichtliche Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren<br />
Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 nachgewiesen ist.<br />
(2) 1 Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind<br />
beizufügen. 2 Soweit erforderlich, sind Probestücke vom Antragsteller zur<br />
Verfügung zu stellen oder durch Sachverständige, die das Deutsche<br />
Institut für Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder<br />
Probeausführungen unter Aufsicht der Sachverständigen herzustellen.<br />
3<br />
Art. 65 Abs. 2 gilt entsprechend.<br />
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durchführung der<br />
Prüfung die sachverständige Stelle und für Probeausführungen die<br />
Ausführungsstelle und Ausführungszeit vorschreiben.<br />
(4) 1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und für eine<br />
bestimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. 2 Die Zulassung<br />
kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. 3 Sie kann auf schriftlichen<br />
Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; Art. 69 Abs. 2 gilt<br />
entsprechend.
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.<br />
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihm erteilten<br />
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und<br />
wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt.<br />
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Länder<br />
gelten auch im Freistaat Bayern.<br />
Bay BO Art. 17 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis<br />
(1) 1 Bauprodukte,<br />
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die<br />
Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder<br />
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden,<br />
bedürfen an Stelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur<br />
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. 2 Das Deutsche<br />
Institut für Bautechnik macht dies mit der Angabe der maßgebenden<br />
technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln<br />
der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen<br />
mit dem Staatsministerium des Innern in der Bauregelliste A bekannt.<br />
(2) 1 Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer Prüfstelle<br />
nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 für nicht geregelte Bauprodukte nach<br />
Abs. 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1<br />
nachgewiesen ist. 2 Art. 16 Abs. 2 bis 7 gelten entsprechend.<br />
Bay BO Art. 18 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im<br />
Einzelfall<br />
(1) 1 Mit Zustimmung des Staatsministeriums des Innern dürfen im Einzelfall<br />
1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauproduktengesetz in<br />
Verkehr gebracht werden und gehandelt werden dürfen, dessen<br />
Anforderungen jedoch nicht erfüllen,<br />
2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung von<br />
Richtlinien der Europäischen Union oder auf der Grundlage von<br />
unmittelbar geltendem Recht der Europäischen Union in Verkehr gebracht<br />
und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der nicht berücksichtigten<br />
wesentlichen Anforderungen im Sinn des Art. 15 Abs. 7 Nr. 2,<br />
3. nicht geregelte Bauprodukte<br />
verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1<br />
nachgewiesen ist. 2 Wenn Gefahren im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 nicht<br />
zu erwarten sind, kann das Staatsministerium des Innern im Einzelfall<br />
erklären oder für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass seine<br />
Zustimmung nicht erforderlich ist.<br />
(2) Die Zustimmung nach Abs. 1 für denkmaltypische Bauprodukte, wie<br />
Putze, Mörtel und Stucke, die in Baudenkmälern im Sinn des<br />
Denkmalschutzgesetzes verwendet werden sollen, erteilt die untere<br />
Bauaufsichtsbehörde.<br />
Bay BO Art. 19 Bauarten<br />
(1) 1 Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach Art. 3 Abs. 2<br />
Satz 1 wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln
der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), dürfen bei der<br />
Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur<br />
angewendet werden, wenn für sie<br />
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Art. 16) oder<br />
2. eine Zustimmung im Einzelfall (Art. 18)<br />
erteilt worden ist. 2 An Stelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen<br />
Zulassung genügt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, wenn die<br />
Bauart nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit<br />
baulicher Anlagen dient oder nach allgemein anerkannten Prüfverfahren<br />
beurteilt wird. 3 Das Deutsche Institut für Bautechnik macht diese<br />
Bauarten mit der Angabe der maßgebenden technischen Regeln und,<br />
soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der<br />
Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit dem Staatsministerium<br />
des Innern in der Bauregelliste A bekannt. 4 Art. 15 Abs. 5 und 6 sowie<br />
Art. 16, 17 Abs. 2 und Art. 18 gelten entsprechend. 5 Wenn Gefahren im<br />
Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann das<br />
Staatsministerium des Innern im Einzelfall oder für genau begrenzte Fälle<br />
allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder<br />
eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.<br />
(2) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung<br />
vorschreiben, dass für bestimmte Bauarten, auch soweit sie<br />
Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Abs. 1 ganz<br />
oder teilweise anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies<br />
verlangen oder zulassen.<br />
Bay BO Art. 20 Übereinstimmungsnachweis<br />
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den<br />
technischen Regeln nach Art. 15 Abs. 2, den allgemeinen<br />
bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen<br />
Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als<br />
Übereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.<br />
(2) 1 Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch<br />
1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (Art. 21) oder<br />
2. Übereinstimmungszertifikat (Art. 22).<br />
2<br />
Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat kann in der<br />
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall<br />
oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum<br />
Nachweis einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist.<br />
3<br />
Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der<br />
Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Art. 21 Abs. 1, sofern<br />
nichts anderes bestimmt ist. 4 Das Staatsministerium des Innern kann im<br />
Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne das erforderliche<br />
Übereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass diese<br />
Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Prüfzeugnissen oder<br />
Zustimmungen nach Abs. 1 entsprechen.<br />
(3) Für Bauarten gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend.<br />
(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, dass ein<br />
Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-<br />
Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.<br />
(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf<br />
seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem<br />
Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.<br />
(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus anderen Staaten gelten auch im<br />
Freistaat Bayern.<br />
Bay BO Art. 21 Übereinstimmungserklärung des Herstellers<br />
(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung nur abgeben, wenn<br />
er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von<br />
ihm hergestellte Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der<br />
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen<br />
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall<br />
entspricht.<br />
(2) 1 In den technischen Regeln nach Art. 15 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in<br />
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen<br />
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall<br />
kann eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor Abgabe der<br />
Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben werden, wenn dies zur<br />
Sicherung einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. 2 In diesen<br />
Fällen hat die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es<br />
den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen<br />
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der<br />
Zustimmung im Einzelfall entspricht.<br />
Bay BO Art. 22 Übereinstimmungszertifikat<br />
(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach<br />
Art. 23 zu erteilen, wenn das Bauprodukt<br />
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen<br />
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen<br />
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und<br />
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer<br />
Fremdüberwachung nach Maßgabe des Abs. 2 unterliegt.<br />
(2) 1 Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen nach Art. 23<br />
durchzuführen. 2 Die Fremdüberwachung hat regelmäßig zu überprüfen,<br />
ob das Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der<br />
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen<br />
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall<br />
entspricht.<br />
Bay BO Art. 23 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen<br />
(1) 1 Das Staatsministerium des Innern kann eine natürliche oder juristische<br />
Person als<br />
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse<br />
(Art. 17 Abs. 2),<br />
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der<br />
Übereinstimmung (Art. 21 Abs. 2),
3. Zertifizierungsstelle (Art. 22 Abs. 1),<br />
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (Art. 22 Abs. 2),<br />
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach Art. 15 Abs. 6 oder<br />
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach Art. 15 Abs. 5<br />
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ihrer<br />
Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer<br />
Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür bieten, dass diese<br />
Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend<br />
wahrgenommen werden, und wenn sie über die erforderlichen<br />
Vorrichtungen verfügen. 2 Soweit und solang Stellen im Sinn von Satz 1<br />
von privaten Trägern nicht zur Verfügung stehen, können auch Behörden<br />
entsprechend Satz 1 anerkannt werden, wenn sie ausreichend mit<br />
geeigneten Fachkräften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen<br />
ausgestattet sind.<br />
(2) 1 Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen<br />
anderer Länder gilt auch im Freistaat Bayern. 2 Prüf-, Zertifizierungs- und<br />
Überwachungsergebnisse von Stellen, die nach Art. 16 Abs. 2 der<br />
Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen<br />
Union oder von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den<br />
Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind, stehen den<br />
Ergebnissen der in Abs. 1 genannten Stellen gleich. 3 Dies gilt auch für<br />
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsergebnisse von Stellen anderer<br />
Staaten, wenn sie in einem Art. 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie<br />
entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.<br />
(3) 1 Das Staatsministerium des Innern erkennt auf Antrag eine natürliche<br />
oder juristische Person oder Behörde als Stelle nach Art. 16 Abs. 2 der<br />
Bauproduktenrichtlinie an, wenn in dem in Art. 16 Abs. 2 der<br />
Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, dass<br />
die natürliche oder juristische Person oder Behörde die Voraussetzungen<br />
erfüllt, nach den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der<br />
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens<br />
über den Europäischen Wirtschaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu<br />
überwachen. 2 Dies gilt auch für die Anerkennung von natürlichen oder<br />
juristischen Personen oder Behörden, die nach den Vorschriften eines<br />
anderen Staates zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwachen<br />
beabsichtigen, wenn der erforderliche Nachweis in einem Art. 16 Abs. 2<br />
der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren geführt wird.<br />
Abschnitt IV Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;<br />
Wände, Decken, Dächer<br />
Bay BO Art. 24 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von<br />
Baustoffen und Bauteilen<br />
(1) 1 Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten<br />
unterschieden in<br />
1. nichtbrennbare,<br />
2. schwerentflammbare,<br />
3. normalentflammbare.<br />
2 Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind
(leichtentflammbare Baustoffe), dürfen nicht verwendet werden; das gilt<br />
nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht<br />
leichtentflammbar sind.<br />
(2) 1 Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre<br />
Feuerwiderstandsfähigkeit unterschieden in<br />
1. feuerbeständige,<br />
2. hochfeuerhemmende,<br />
3. feuerhemmende;<br />
die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und<br />
aussteifenden Bauteilen auf deren <strong>Stand</strong>sicherheit im Brandfall, bei<br />
raumabschließenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die<br />
Brandausbreitung. 2 Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten<br />
ihrer Baustoffe unterschieden in<br />
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,<br />
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren<br />
Baustoffen bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich<br />
eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren<br />
Baustoffen haben,<br />
3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren<br />
Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame<br />
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und<br />
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,<br />
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.<br />
3<br />
Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
nichts anderes bestimmt ist, müssen<br />
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den<br />
Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,<br />
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens den<br />
Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3<br />
entsprechen; das gilt nicht für feuerwiderstandsfähige Abschlüsse von<br />
Öffnungen.<br />
Bay BO Art. 25 Tragende Wände, Stützen<br />
(1) 1 Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im Brandfall<br />
ausreichend lang standsicher sein. 2 Sie müssen<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,<br />
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,<br />
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend<br />
sein. 3 Satz 2 gilt<br />
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufenthaltsräume<br />
möglich sind; Art. 27 Abs. 4 bleibt unberührt,<br />
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige<br />
Flure dienen.<br />
(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende Wände und Stützen<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,<br />
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend<br />
sein.
Bay BO Art. 26 Außenwände<br />
(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und Schürzen sind so<br />
auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen<br />
ausreichend lang begrenzt ist.<br />
(2) 1 Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender<br />
Außenwände müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind<br />
aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn sie als raumabschließende<br />
Bauteile feuerhemmend sind. 2 Satz 1 gilt nicht für brennbare<br />
Fensterprofile und Fugendichtungen sowie brennbare Dämmstoffe in<br />
nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Außenwandkonstruktion.<br />
(3) 1 Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen<br />
einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen<br />
schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren<br />
Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt sind.<br />
2<br />
Balkonbekleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus<br />
hochgeführt werden, müssen schwerentflammbar sein.<br />
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder<br />
Lufträumen wie Doppelfassaden sind gegen die Brandausbreitung<br />
besondere Vorkehrungen zu treffen; das gilt für hinterlüftete<br />
Außenwandbekleidungen entsprechend.<br />
(5) Die Abs. 2, 3 und 4 Halbsatz 2 gelten nicht für Gebäude der<br />
Gebäudeklassen 1 bis 3, Abs. 4 Halbsatz 1 nicht für Gebäude der<br />
Gebäudeklassen 1 und 2.<br />
Bay BO Art. 27 Trennwände<br />
(1) Trennwände nach Abs. 2 müssen als raumabschließende Bauteile von<br />
Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend<br />
lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.<br />
(2) Trennwände sind erforderlich<br />
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und<br />
anders genutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,<br />
2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,<br />
3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im<br />
Kellergeschoss.<br />
(3) 1 Trennwände nach Abs. 2 Nrn. 1 und 3 müssen die<br />
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des<br />
Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. 2 Trennwände<br />
nach Abs. 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.<br />
(4) Die Trennwände nach Abs. 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis<br />
unter die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände nur bis<br />
zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil<br />
einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile<br />
feuerhemmend herzustellen.<br />
(5) Öffnungen in Trennwänden nach Abs. 2 sind nur zulässig, wenn sie auf die<br />
für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; sie müssen<br />
feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.
(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und<br />
2.<br />
Bay BO Art. 28 Brandwände<br />
(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Abschluss von<br />
Gebäuden (Gebäudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebäuden<br />
in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lang die<br />
Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern.<br />
(2) Brandwände sind erforderlich<br />
1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Gebäuden ohne<br />
Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m 3 Brutto-<br />
Rauminhalt, wenn diese Abschlusswände an oder mit einem Abstand bis<br />
zu 2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei<br />
denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach<br />
den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden gesichert<br />
ist,<br />
2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in<br />
Abständen von nicht mehr als 40 m,<br />
3. als innere Brandwand zur Unterteilung land- oder forstwirtschaftlich<br />
genutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m 3<br />
Brutto-Rauminhalt,<br />
4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und angebauten<br />
land- oder forstwirtschaftlich genutzten Gebäuden sowie als innere<br />
Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem land- oder forstwirtschaftlich<br />
genutzten Teil eines Gebäudes.<br />
(3) 1 Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer<br />
Beanspruchung feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen<br />
bestehen. 2 An Stelle von Brandwänden nach Satz 1 sind zulässig<br />
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zusätzlicher<br />
mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,<br />
2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wände,<br />
3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschlusswände, die<br />
jeweils von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden<br />
und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch<br />
feuerhemmende Bauteile, und von außen nach innen die<br />
Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben,<br />
4. in den Fällen des Abs. 2 Nr. 4 feuerbeständige Wände, wenn der<br />
umbaute Raum des land- oder forstwirtschaftlich genutzten Gebäudes<br />
oder Gebäudeteils nicht größer als 2 000 m 3 ist.<br />
(4) 1 Brandwände müssen durchgehend und in allen Geschossen und dem<br />
Dachraum übereinander angeordnet sein. 2 Abweichend davon dürfen an<br />
Stelle innerer Brandwände Wände geschossweise versetzt angeordnet<br />
werden, wenn<br />
1. die Wände im Übrigen Abs. 3 Satz 1 entsprechen,<br />
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wänden stehen,<br />
feuerbeständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine<br />
Öffnungen haben,<br />
3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feuerbeständig<br />
sind und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb<br />
oder unterhalb des Versatzes feuerbeständig sind und<br />
5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so<br />
angeordnet oder andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine<br />
Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.<br />
(5) 1 Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der<br />
Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen<br />
Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen<br />
brennbare Teile des Dachs nicht hinweggeführt werden. 2 Bei Gebäuden<br />
der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter die<br />
Dachhaut zu führen. 3 Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit<br />
nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.<br />
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch<br />
eine Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von<br />
der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der<br />
Winkel der inneren Ecke mehr als 120 Grad beträgt oder mindestens eine<br />
Außenwand auf 5 m Länge als öffnungslose feuerbeständige Wand aus<br />
nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist.<br />
(7) 1 Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht<br />
hinweggeführt werden. 2 Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche<br />
Brandausbreitung begünstigen können, wie Doppelfassaden, hinterlüftete<br />
Außenwandbekleidungen oder Außenwandbekleidungen mit brennbaren<br />
Baustoffen, dürfen ohne besondere Vorkehrungen über Brandwände nicht<br />
hinweggeführt werden. 3 Bauteile dürfen in Brandwände nur so weit<br />
eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit nicht beeinträchtigt<br />
wird; für Leitungen, Leitungsschlitze und Kamine gilt dies entsprechend.<br />
(8) 1 Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. 2 Sie sind in inneren<br />
Brandwänden nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche<br />
Zahl und Größe beschränkt sind; die Öffnungen müssen feuerbeständige,<br />
dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.<br />
(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur zulässig,<br />
wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt<br />
sind.<br />
(10) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten im Sinn des<br />
Art. 6 Abs. 8, wenn sie von dem Nachbargebäude oder der Nachbargrenze<br />
einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht,<br />
mindestens jedoch 1 m beträgt.<br />
(11) Die Abs. 4 bis 10 gelten entsprechend auch für Wände, die an Stelle von<br />
Brandwänden zulässig sind.<br />
Bay BO Art. 29 Decken<br />
(1) 1 Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile zwischen<br />
Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und<br />
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein. 2 Sie müssen<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,<br />
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,<br />
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend,<br />
sein. 3 Satz 2 gilt
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthaltsräume<br />
möglich sind; Art. 27 Abs. 4 bleibt unberührt,<br />
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige<br />
Flure dienen.<br />
(2) 1 Im Kellergeschoss müssen Decken<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,<br />
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend<br />
sein. 2 Decken müssen feuerbeständig sein<br />
1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,<br />
ausgenommen in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
2. zwischen dem land- oder forstwirtschaftlich genutzten Teil und dem<br />
Wohnteil eines Gebäudes.<br />
(3) Der Anschluss der Decken an die Außenwand ist so herzustellen, dass er<br />
den Anforderungen aus Abs. 1 Satz 1 genügt.<br />
(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit<br />
vorgeschrieben ist, sind nur zulässig<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als<br />
400 m 2 in nicht mehr als zwei Geschossen,<br />
3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und<br />
Größe beschränkt sind und Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit<br />
der Decke haben.<br />
Bay BO Art. 30 Dächer<br />
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch<br />
Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein<br />
(harte Bedachung).<br />
(2) 1 Bedachungen, die die Anforderungen nach Abs. 1 nicht erfüllen, sind<br />
zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebäude<br />
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m,<br />
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen<br />
Abstand von mindestens 12 m,<br />
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die die<br />
Anforderungen nach Abs. 1 nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens<br />
24 m,<br />
4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthaltsräume und<br />
ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m 3 Brutto-Rauminhalt einen<br />
Abstand von mindestens 5 m<br />
einhalten. 2 Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten müssen, genügt<br />
bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen<br />
1. der Nrn. 1 und 2 ein Abstand von mindestens 9 m,<br />
2. der Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.<br />
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für<br />
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr<br />
als 50 m 3 Brutto-Rauminhalt,<br />
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen;<br />
brennbare Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe in<br />
nichtbrennbaren Profilen sind zulässig,<br />
3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden,
4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren<br />
Baustoffen,<br />
5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die<br />
Eingänge nur zu Wohnungen führen.<br />
(4) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind<br />
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen<br />
nach Abs. 1 und<br />
2. begrünte Bedachungen<br />
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von<br />
außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder<br />
Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.<br />
(5) 1 Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige<br />
Bedachungen, Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und<br />
herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und<br />
Nachbargrundstücke übertragen werden kann. 2 Von Brandwänden und<br />
von Wänden, die an Stelle von Brandwänden zulässig sind, müssen<br />
mindestens 1,25 m entfernt sein<br />
1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn diese<br />
Wände nicht mindestens 0,30 m über die Bedachung geführt sind,<br />
2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen,<br />
wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt<br />
sind.<br />
(6) 1 Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäuden müssen als<br />
raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach<br />
außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile<br />
feuerhemmend sein. 2 Öffnungen in diesen Dachflächen müssen<br />
waagerecht gemessen mindestens 1,25 m von der Brandwand oder der<br />
Wand, die an Stelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein.<br />
(7) 1 Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen oder ohne<br />
Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines Abstands<br />
von 5 m von diesen Wänden als raumabschließende Bauteile für eine<br />
Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich der sie<br />
tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der<br />
Decken des Gebäudeteils haben, an den sie angebaut werden. 2 Das gilt<br />
nicht für Anbauten an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.<br />
(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare<br />
Vorrichtungen anzubringen.<br />
Abschnitt V Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen<br />
Bay BO Art. 31 Erster und zweiter Rettungsweg<br />
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie<br />
Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem<br />
Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins<br />
Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des<br />
Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.<br />
(2) 1 Für Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebener Erde liegen,<br />
muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. 2 Der
zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit<br />
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit<br />
sein. 3 Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung<br />
über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und<br />
Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum).<br />
(3) 1 Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der<br />
Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum<br />
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der<br />
Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr<br />
über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt.<br />
2<br />
Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der<br />
Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung<br />
bestehen.<br />
Bay BO Art. 32 Treppen<br />
(1) 1 Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare<br />
Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe<br />
zugänglich sein (notwendige Treppe). 2 Statt notwendiger Treppen sind<br />
Rampen mit flacher Neigung zulässig.<br />
(2) 1 Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen<br />
unzulässig. 2 In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare<br />
Treppen und Leitern als Zugang zu einem Dachraum ohne<br />
Aufenthaltsraum zulässig.<br />
(3) 1 Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen<br />
Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum<br />
unmittelbar verbunden sein. 2 Das gilt nicht für Treppen<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,<br />
2. nach Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.<br />
(4) 1 Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und aus<br />
nichtbrennbaren Baustoffen,<br />
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,<br />
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder<br />
feuerhemmend<br />
sein. 2 Tragende Teile von Außentreppen nach Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3<br />
für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus nichtbrennbaren<br />
Baustoffen bestehen.<br />
(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppenabsätze notwendiger<br />
Treppen muss für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen.<br />
(6) 1 Treppen müssen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 2 Für<br />
Treppen sind Handläufe auf beiden Seiten und bei großer nutzbarer Breite<br />
auch Zwischenhandläufe vorzusehen,<br />
1. in Gebäuden mit mehr als zwei nicht stufenlos erreichbaren<br />
Wohnungen,<br />
2. im Übrigen, soweit es die Verkehrssicherheit erfordert.
Bay BO Art. 33 Notwendige Treppenräume, Ausgänge<br />
(1) 1 Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus<br />
den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum<br />
liegen (notwendiger Treppenraum). 2 Notwendige Treppenräume müssen<br />
so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen<br />
Treppen im Brandfall ausreichend lang möglich ist. 3 Notwendige Treppen<br />
sind ohne eigenen Treppenraum zulässig<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben<br />
Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m 2 , wenn in jedem<br />
Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,<br />
3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im<br />
Brandfall nicht gefährdet werden kann.<br />
(2) 1 Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie eines Kellergeschosses<br />
muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder<br />
ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein; das gilt nicht für<br />
land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude. 2 Übereinanderliegende<br />
Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge in notwendige<br />
Treppenräume oder ins Freie haben. 3 Sind mehrere notwendige<br />
Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst<br />
entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind.<br />
(3) 1 Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins<br />
Freie haben. 2 Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraums nicht<br />
unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen<br />
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie<br />
1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,<br />
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraums<br />
erfüllen,<br />
3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren<br />
haben und<br />
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen<br />
Fluren, sein.<br />
(4) 1 Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumabschließende<br />
Bauteile<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden haben,<br />
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher<br />
mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und<br />
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend<br />
sein. 2 Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die<br />
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese<br />
Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet<br />
werden können. 3 Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss<br />
als raumabschließendes Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken<br />
des Gebäudes haben; das gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach<br />
ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.<br />
(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Abs. 3 Satz 2<br />
müssen<br />
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus<br />
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus<br />
nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben,<br />
3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens<br />
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.<br />
(6) 1 In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen<br />
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten,<br />
Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und<br />
Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m 2 , ausgenommen Wohnungen,<br />
mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende<br />
Abschlüsse,<br />
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,<br />
3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens vollwandige,<br />
dicht- und selbstschließende Abschlüsse<br />
haben. 2 Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen<br />
lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss<br />
insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.<br />
(7) 1 Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. 2 Innenliegende<br />
notwendige Treppenräume müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach<br />
Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung<br />
haben.<br />
(8) 1 Notwendige Treppenräume müssen belüftet werden können. 2 Sie<br />
müssen in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende<br />
Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m 2 haben, die<br />
geöffnet werden können. 3 Für innenliegende notwendige Treppenräume<br />
und notwendige Treppenräume in Gebäuden mit einer Höhe nach Art. 2<br />
Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m ist an der obersten Stelle eine Öffnung<br />
zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 1 m 2<br />
erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss sowie vom obersten<br />
Treppenabsatz aus geöffnet werden können.<br />
Bay BO Art. 34 Notwendige Flure, offene Gänge<br />
(1) 1 Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus<br />
Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwendige<br />
Treppenräume oder ins Freie führen (notwendige Flure), müssen so<br />
angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall<br />
ausreichend lang möglich ist. 2 Notwendige Flure sind nicht erforderlich<br />
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, ausgenommen in<br />
Kellergeschossen,<br />
3. innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nutzungseinheiten mit<br />
nicht mehr als 200 m 2 ,<br />
4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder<br />
Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m 2 ; das gilt auch für<br />
Teile größerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht größer als<br />
400 m 2 sind, Trennwände nach Art. 27 Abs. 2 Nr. 1 haben und jeder Teil<br />
unabhängig von anderen Teilen Rettungswege nach Art. 31 Abs. 1 hat.<br />
(2) 1 Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für den größten zu<br />
erwartenden Verkehr ausreichen. 2 In den Fluren ist eine Folge von<br />
weniger als drei Stufen unzulässig.
(3) 1 Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare, rauchdichte und<br />
selbstschließende Abschlüsse in Rauchabschnitte zu unterteilen. 2 Die<br />
Rauchabschnitte sollen nicht länger als 30 m sein. 3 Die Abschlüsse sind<br />
bis an die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an die Unterdecke der Flure<br />
geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. 4 Notwendige<br />
Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum<br />
führen, dürfen nicht länger als 15 m sein. 5 Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht<br />
für notwendige Flure, die als offene Gänge vor den Außenwänden<br />
angeordnet sind.<br />
(4) 1 Die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschließende Bauteile<br />
feuerhemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende<br />
Bauteile feuerbeständig sein müssen, feuerbeständig sein. 2 Die Wände<br />
sind bis an die Rohdecke zu führen. 3 Sie dürfen bis an die Unterdecke der<br />
Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein<br />
demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist.<br />
4<br />
Türen in diesen Wänden müssen dicht schließen; Öffnungen zu<br />
Lagerbereichen im Kellergeschoss müssen feuerhemmende, dicht- und<br />
selbstschließende Abschlüsse haben.<br />
(5) 1 Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur einer<br />
Fluchtrichtung, die als offene Gänge vor den Außenwänden angeordnet<br />
sind, gilt Abs. 4 entsprechend. 2 Fenster sind in diesen Außenwänden ab<br />
einer Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig.<br />
(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gängen nach Abs. 5 müssen<br />
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe aus<br />
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,<br />
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus<br />
nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.<br />
Bay BO Art. 35 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen<br />
(1) 1 Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allgemein<br />
zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass<br />
sie leicht erkannt werden können. 2 Weitere Schutzmaßnahmen sind für<br />
größere Glasflächen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit<br />
erfordert.<br />
(2) Eingangstüren von Wohnungen, die über Aufzüge erreichbar sein müssen,<br />
müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.<br />
(3) 1 Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Öffnung ins<br />
Freie haben, um eine Rauchableitung zu ermöglichen. 2 Gemeinsame<br />
Kellerlichtschächte für übereinander liegende Kellergeschosse sind<br />
unzulässig.<br />
(4) 1 Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 dienen, müssen<br />
in der Breite mindestens 0,60 m, in der Höhe mindestens 1 m groß, von<br />
innen zu öffnen und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante<br />
angeordnet sein. 2 Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder<br />
Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt<br />
von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.
Bay BO Art. 36 Umwehrungen<br />
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren<br />
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und<br />
unmittelbar an mehr als 0,50 m tiefer liegende Flächen angrenzen; das<br />
gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht,<br />
2. Dächer, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, sowie<br />
Öffnungen und nicht begehbare Flächen in diesen Dächern und in<br />
begehbaren Decken, soweit sie nicht sicher abgedeckt oder gegen<br />
Betreten gesichert sind,<br />
3. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und<br />
Treppenöffnungen (Treppenaugen); Fenster, die unmittelbar an Treppen<br />
und deren Brüstungen unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen,<br />
sind zu sichern.<br />
(2) 1 Die Umwehrungen müssen ausreichend hoch und fest sein. 2 Ist mit der<br />
Anwesenheit unbeaufsichtigter Kleinkinder auf der zu sichernden Fläche<br />
üblicherweise zu rechnen, müssen Umwehrungen so ausgebildet werden,<br />
dass sie Kleinkindern das Über- oder Durchklettern nicht erleichtern; das<br />
gilt nicht innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 und<br />
innerhalb von Wohnungen.<br />
Abschnitt VI Technische Gebäudeausrüstung<br />
Bay BO Art. 37 Aufzüge<br />
(1) 1 Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben,<br />
um eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu<br />
verhindern. 2 In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen.<br />
3<br />
Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig<br />
1. innerhalb eines notwendigen Treppenraums, ausgenommen in<br />
Hochhäusern,<br />
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken,<br />
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung<br />
stehen dürfen,<br />
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;<br />
sie müssen sicher umkleidet sein.<br />
(2) 1 Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und aus<br />
nichtbrennbaren Baustoffen,<br />
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,<br />
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend<br />
sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen schachtseitig<br />
eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke<br />
haben. 2 Fahrschachttüren und andere Öffnungen in Fahrschachtwänden<br />
mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzustellen, dass die<br />
Anforderungen nach Abs. 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden.<br />
(3) 1 Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung<br />
mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 v. H. der<br />
Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m 2 haben. 2 Die Lage der
Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt<br />
durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird.<br />
(4) 1 Gebäude mit einer Höhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m<br />
müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben. 2 Von diesen Aufzügen<br />
muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und<br />
Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben.<br />
3<br />
Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen in dem Gebäude und von der<br />
öffentlichen Verkehrsfläche aus stufenlos erreichbar sein. 4 Art. 48 Abs. 4<br />
Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend. 5 Haltestellen im obersten Geschoss, im<br />
Erdgeschoss und in den Kellergeschossen sind nicht erforderlich, wenn sie<br />
nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können.<br />
(5) 1 Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare<br />
Grundfläche von mindestens 1,10 m × 2,10 m, zur Aufnahme eines<br />
Rollstuhls von mindestens 1,10 m × 1,40 m haben; Türen müssen eine<br />
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. 2 In einem Aufzug<br />
für Rollstühle und Krankentragen darf der für Rollstühle nicht erforderliche<br />
Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließbare Tür abgesperrt<br />
werden. 3 Vor den Aufzügen muss eine ausreichende Bewegungsfläche<br />
vorhanden sein.<br />
Bay BO Art. 38 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle<br />
(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende Bauteile, für die eine<br />
Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt<br />
werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten<br />
ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; das gilt nicht für Decken<br />
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
2. innerhalb von Wohnungen,<br />
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als<br />
400 m 2 in nicht mehr als zwei Geschossen.<br />
(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach Art. 33 Abs. 3 Satz 2<br />
und in notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine<br />
Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist.<br />
(3) Für Installationsschächte und -kanäle gelten Abs. 1 sowie Art. 39 Abs. 2<br />
Satz 1 und Abs. 3 entsprechend.<br />
Bay BO Art. 39 Lüftungsanlagen<br />
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen<br />
den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht<br />
beeinträchtigen.<br />
(2) 1 Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen<br />
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind<br />
zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und<br />
Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. 2 Lüftungsleitungen dürfen<br />
raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit<br />
vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine Brandausbreitung<br />
ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen<br />
hiergegen getroffen sind.
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in<br />
andere Räume übertragen.<br />
(4) 1 Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die<br />
gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur<br />
Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken<br />
wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. 2 Die<br />
Abluft ist ins Freie zu führen. 3 Nicht zur Lüftungsanlage gehörende<br />
Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.<br />
(5) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht<br />
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
2. innerhalb von Wohnungen,<br />
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als<br />
400 m 2 in nicht mehr als zwei Geschossen.<br />
(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Abs. 1<br />
bis 5 entsprechend.<br />
Bay BO Art. 40 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur<br />
Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung<br />
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen<br />
betriebssicher und brandsicher sein.<br />
(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art<br />
der Feuerstätte und nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und<br />
Nutzung der Räume Gefahren nicht entstehen.<br />
(3) 1 Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Kamine und<br />
Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren<br />
oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. 2 Abgasanlagen sind in<br />
solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstätten des<br />
Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden können. 3 Sie müssen<br />
leicht gereinigt werden können.<br />
(4) 1 Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten<br />
müssen betriebssicher und brandsicher sein. 2 Diese Behälter sowie feste<br />
Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder<br />
unzumutbaren Belästigungen entstehen.<br />
(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren,<br />
Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die<br />
Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Abs. 1 bis 3 entsprechend.<br />
Bay BO Art. 41 Nicht durch Sammelkanalisation erschlossene Anwesen<br />
(1) Die einwandfreie Beseitigung des Abwassers einschließlich des<br />
Fäkalschlamms innerhalb und außerhalb des Grundstücks muss gesichert<br />
sein.<br />
(2) Hausabwässer aus abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen oder<br />
abgelegenen Anwesen, die früher einem landwirtschaftlichen Betrieb<br />
dienten und deren Hausabwässer bereits in Gruben eingeleitet worden<br />
sind, dürfen in Gruben eingeleitet werden, wenn<br />
1. das Abwasser in einer Mehrkammerausfaulgrube vorbehandelt wird und<br />
2. die ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung des geklärten<br />
Abwassers und des Fäkalschlamms gesichert ist.
(3) 1 Für die Einleitung von Hausabwässern aus abgelegenen<br />
landwirtschaftlichen Anwesen in Biogasanlagen gilt Abs. 2 entsprechend.<br />
2 Die Vorbehandlung in einer Mehrkammerausfaulgrube ist nicht<br />
erforderlich, wenn durch den Betrieb der Biogasanlage eine gleichwertige<br />
Hygienisierung sichergestellt ist.<br />
Bay BO Art. 42 Sanitäre Anlagen<br />
Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung<br />
gewährleistet ist.<br />
Bay BO Art. 43 Aufbewahrung fester Abfallstoffe<br />
Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb von Gebäuden vorübergehend aufbewahrt<br />
werden, in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafür<br />
bestimmten Räume<br />
1. Trennwände und Decken als raumabschließende Bauteile mit der<br />
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Wände und<br />
2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden,<br />
dicht- und selbstschließenden Abschlüssen haben,<br />
3. unmittelbar vom Freien entleert werden können und<br />
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.<br />
Bay BO Art. 44 Blitzschutzanlagen<br />
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht<br />
eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen<br />
Blitzschutzanlagen zu versehen.<br />
Abschnitt VII Nutzungsbedingte Anforderungen<br />
Bay BO Art. 45 Aufenthaltsräume<br />
(1) 1 Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m,<br />
im Dachgeschoss über der Hälfte ihrer Nutzfläche 2,20 m haben, wobei<br />
Raumteile mit einer lichten Höhe unter 1,50 m außer Betracht bleiben.<br />
2<br />
Das gilt nicht für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der<br />
Gebäudeklassen 1 und 2.<br />
(2) 1 Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht<br />
belichtet werden können. 2 Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der<br />
Fensteröffnungen von mindestens einem Achtel der Netto-Grundfläche des<br />
Raums einschließlich der Netto-Grundfläche verglaster Vorbauten und<br />
Loggien haben.<br />
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht verbietet,<br />
sowie Verkaufsräume, Schank- und Speisegaststätten, ärztliche<br />
Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk- und ähnliche Räume sind ohne<br />
Fenster zulässig.<br />
Bay BO Art. 46 Wohnungen<br />
(1) 1 Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische haben. 2 Fensterlose<br />
Küchen oder Kochnischen sind zulässig, wenn eine wirksame Lüftung<br />
gewährleistet ist.
(2) Für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind für jede Wohnung ein<br />
ausreichend großer Abstellraum und, soweit die Wohnungen nicht nur zu<br />
ebener Erde liegen, leicht erreichbare und gut zugängliche Abstellräume<br />
für Kinderwagen, Fahrräder und Mobilitätshilfen erforderlich.<br />
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine<br />
Toilette haben.<br />
Bay BO Art. 47 Stellplätze<br />
(1) 1 Werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu<br />
erwarten ist, sind Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe und in<br />
geeigneter Beschaffenheit herzustellen. 2 Bei Änderungen oder<br />
Nutzungsänderungen von Anlagen sind Stellplätze in solcher Zahl und<br />
Größe herzustellen, dass die Stellplätze die durch die Änderung zusätzlich<br />
zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können. 3 Das gilt nicht, wenn<br />
sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter<br />
Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung nach Abs. 3 Nr. 3<br />
erheblich erschwert oder verhindert würde.<br />
(2) 1 Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Abs. 1 Satz 1 legt das<br />
Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung fest. 2 Wird die<br />
Zahl der notwendigen Stellplätze durch eine örtliche Bauvorschrift oder<br />
eine städtebauliche Satzung festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich.<br />
(3) Die Stellplatzpflicht kann erfüllt werden durch<br />
1. Herstellung der notwendigen Stellplätze auf dem Baugrundstück,<br />
2. Herstellung der notwendigen Stellplätze auf einem geeigneten<br />
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks, wenn dessen Benutzung für<br />
diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde<br />
rechtlich gesichert ist, oder<br />
3. Übernahme der Kosten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze<br />
durch den Bauherrn gegenüber der Gemeinde (Ablösungsvertrag).<br />
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung notwendiger<br />
Stellplätze zu verwenden für<br />
1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die<br />
Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen,<br />
2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden<br />
Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen<br />
Personennahverkehrs.<br />
Bay BO Art. 48 Barrierefreies Bauen<br />
(1) 1 In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen<br />
eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein; Abs. 4 Sätze 1 bis 5 sind<br />
anzuwenden. 2 Die Verpflichtung nach Satz 1 kann auch durch barrierefrei<br />
erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. 3 Die<br />
Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, die Küche oder<br />
Kochnische sowie der Raum mit Anschlussmöglichkeit für eine<br />
Waschmaschine müssen<br />
1. in den Wohnungen nach Satz 1 Halbsatz 1,<br />
2. in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und Aufzügen nach Art. 37<br />
Abs. 4 in einem Drittel der Wohnungen
mit dem Rollstuhl zugänglich und barrierefrei nutzbar sein. 4 Art. 32 Abs. 6<br />
Satz 2, Art. 35 Abs. 2 und Art. 37 Abs. 4 bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem<br />
allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit<br />
Behinderung, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei<br />
erreicht und ohne fremde Hilfe in der allgemein üblichen Weise<br />
zweckentsprechend genutzt werden können. 2 Diese Anforderungen gelten<br />
insbesondere für<br />
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,<br />
2. Tageseinrichtungen für Kinder,<br />
3. Sport- und Freizeitstätten,<br />
4. Einrichtungen des Gesundheitswesens,<br />
5. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,<br />
6. Verkaufsstätten,<br />
7. Gaststätten, die keiner gaststättenrechtlichen Erlaubnis bedürfen,<br />
8. Beherbergungsstätten,<br />
9. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.<br />
3<br />
Sie gelten nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die Anforderungen nur<br />
mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden können. 4 Die<br />
Anforderungen an Gaststätten, die einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis<br />
bedürfen, sind im Rahmen des gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahrens<br />
zu beachten.<br />
(3) Für bauliche Anlagen und Einrichtungen, die überwiegend oder<br />
ausschließlich von Menschen mit Behinderung, alten Menschen und<br />
Personen mit Kleinkindern genutzt werden, wie<br />
1. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Menschen mit Behinderung,<br />
2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime<br />
gilt Abs. 2 nicht nur für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden<br />
Teile, sondern für alle Teile, die von diesem Personenkreis genutzt<br />
werden.<br />
(4) 1 Bauliche Anlagen nach Abs. 2 und 3 müssen durch einen Eingang mit<br />
einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m stufenlos<br />
erreichbar sein. 2 Vor Türen muss eine ausreichende Bewegungsfläche<br />
vorhanden sein. 3 Rampen dürfen nicht mehr als 6 v. H. geneigt sein; sie<br />
müssen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und<br />
griffsicheren Handlauf haben. 4 Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist<br />
ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest anzuordnen. 5 Die Podeste<br />
müssen eine Länge von mindestens 1,50 m haben. 6 Treppen müssen an<br />
beiden Seiten griffsichere Handläufe erhalten, die über Treppenabsätze<br />
und Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. 7 Die<br />
Treppen müssen Setzstufen haben. 8 Flure müssen mindestens 1,50 m<br />
breit sein. 9 Ein Toilettenraum muss auch für Benutzer von Rollstühlen<br />
geeignet und erreichbar sein; er ist zu kennzeichnen. 10 Art. 37 Abs. 4 gilt<br />
auch für Gebäude mit einer geringeren Höhe als nach Art. 37 Abs. 4<br />
Satz 1, soweit Geschosse mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein<br />
müssen; es genügt ein Fahrkorb zur Aufnahme eines Rollstuhls.<br />
(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger<br />
Geländeverhältnisse, wegen ungünstiger vorhandener Bebauung oder im<br />
Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung oder alten
Menschen oder bei Anlagen nach Abs. 1 auch wegen des Einbaus eines<br />
sonst nicht erforderlichen Aufzugs nur mit einem unverhältnismäßigen<br />
Mehraufwand erfüllt werden können.<br />
Vierter Teil Die am Bau Beteiligten<br />
Bay BO Art. 49 Grundpflichten<br />
Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Beseitigung von<br />
Anlagen sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen<br />
am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften eingehalten werden.<br />
Bay BO Art. 50 Bauherr<br />
(1) 1 Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines<br />
nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen<br />
geeignete Beteiligte nach Maßgabe der Art. 51 und 52 zu bestellen, soweit<br />
er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften<br />
geeignet ist. 2 Dem Bauherrn obliegen außerdem die nach den öffentlichrechtlichen<br />
Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise.<br />
3<br />
Wechselt der Bauherr, hat der neue Bauherr dies der<br />
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.<br />
(2) 1 Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherr auf, so<br />
kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber ein Vertreter<br />
bestellt wird, der die dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 2 Im Übrigen<br />
finden Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 2 des Bayerischen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) entsprechende Anwendung.<br />
Bay BO Art. 51 Entwurfsverfasser<br />
(1) 1 Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur<br />
Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. 2 Er ist für die<br />
Vollständigkeit und Brauchbarkeit seines Entwurfs verantwortlich. 3 Der<br />
Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung<br />
notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen<br />
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.<br />
(2) 1 Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die<br />
erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er den Bauherrn zu<br />
veranlassen, geeignete Fachplaner heranzuziehen. 2 Diese sind für die von<br />
ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu unterzeichnen haben,<br />
verantwortlich. 3 Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller<br />
Fachplanungen bleibt der Entwurfsverfasser verantwortlich.<br />
Bay BO Art. 52 Unternehmer<br />
(1) 1 Jeder Unternehmer ist für die mit den öffentlich-rechtlichen<br />
Anforderungen übereinstimmende Ausführung der von ihm<br />
übernommenen Arbeiten und insoweit für die ordnungsgemäße<br />
Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. 2 Er hat<br />
die erforderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten
Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle<br />
bereitzuhalten.<br />
(2) Jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde für<br />
Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage in außergewöhnlichem Maße<br />
von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung des Unternehmers oder<br />
von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen<br />
abhängt, nachzuweisen, dass er für diese Arbeiten geeignet ist und über<br />
die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.<br />
Fünfter Teil Bauaufsichtsbehörden, Verfahren<br />
Abschnitt I Bauaufsichtsbehörden<br />
Bay BO Art. 53 Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden<br />
(1) 1 Untere Bauaufsichtsbehörden sind die Kreisverwaltungsbehörden, höhere<br />
Bauaufsichtsbehörden sind die Regierungen, oberste Bauaufsichtsbehörde<br />
ist das Staatsministerium des Innern. 2 Für den Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
sowie anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die Errichtung,<br />
Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie die Nutzung und<br />
Instandhaltung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehörde zuständig,<br />
soweit nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium des Innern überträgt leistungsfähigen<br />
kreisangehörigen Gemeinden auf Antrag durch Rechtsverordnung<br />
1. alle Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde oder<br />
2. Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für<br />
a) Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3,<br />
b) Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3, die neben einer Wohnnutzung<br />
teilweise oder ausschließlich freiberuflich oder gewerblich im Sinn des § 13<br />
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) genutzt werden,<br />
einschließlich ihrer jeweiligen Nebengebäude und Nebenanlagen im<br />
Geltungsbereich von Bebauungsplänen im Sinn der §§ 12, 30 Abs. 1 und 2<br />
BauGB.<br />
2<br />
Das Staatsministerium des Innern kann die Rechtsverordnung nach<br />
Satz 1 auf Antrag der Gemeinde aufheben. 3 Die Rechtsverordnung ist<br />
aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihren Erlass nach Satz 1 und<br />
Abs. 3 Sätze 1 bis 4 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen.<br />
4<br />
Werden Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach Satz 1<br />
übertragen, ist für die Entscheidung über Anträge nach Art. 63 Abs. 2<br />
Satz 2, Art. 64 Abs. 1 Satz 1, Art. 70 Satz 1 und Art. 71 Satz 1 als untere<br />
Bauaufsichtsbehörde diejenige Behörde zuständig, die zum Zeitpunkt des<br />
Eingangs des Antrags bei der Gemeinde zuständig war; das gilt<br />
entsprechend bei der Erhebung einer Gemeinde zur Großen Kreisstadt.<br />
5<br />
Die Aufhebung eines Verwaltungsakts der unteren Bauaufsichtsbehörde<br />
kann nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung<br />
von Vorschriften über die sachliche Zuständigkeit zustande gekommen ist,<br />
wenn diese Verletzung darauf beruht, dass eine sachliche Zuständigkeit<br />
nach Satz 1 Nr. 2 wegen Unwirksamkeit des zugrunde liegenden<br />
Bebauungsplans nicht begründet war; das gilt nicht, wenn zum Zeitpunkt<br />
der Entscheidung der unteren Bauaufsichtsbehörde die Unwirksamkeit des
Bebauungsplans gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) rechtskräftig festgestellt war.<br />
6 Art. 46 BayVwVfG bleibt unberührt.<br />
(3) 1 Die Bauaufsichtsbehörden sind für ihre Aufgaben ausreichend mit<br />
geeigneten Fachkräften zu besetzen. 2 Den unteren Bauaufsichtsbehörden<br />
müssen Beamte mit der Befähigung zum Richteramt oder zum höheren<br />
Verwaltungsdienst und Beamte des höheren bautechnischen<br />
Verwaltungsdienstes der Fachgebiete Hochbau oder Städtebau angehören.<br />
3 An Stelle von Beamten des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes<br />
können auch Beamte des gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes<br />
beschäftigt werden, wenn sie über eine langjährige Berufserfahrung im<br />
Aufgabenbereich des leitenden bautechnischen Mitarbeiters der unteren<br />
Bauaufsichtsbehörde verfügen und sich in diesem Aufgabenbereich<br />
bewährt haben; in begründeten Ausnahmefällen, insbesondere wenn<br />
geeignete Beamte des bautechnischen Verwaltungsdienstes nicht<br />
gewonnen werden können, dürfen an Stelle von Beamten auch<br />
vergleichbar qualifizierte Angestellte beschäftigt werden. 4 In Gemeinden,<br />
denen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Aufgaben der unteren<br />
Bauaufsichtsbehörde übertragen worden sind, genügt es, dass an Stelle<br />
von Beamten des höheren Dienstes im Sinn von Satz 2 Beamte des<br />
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes, im Fall des technischen<br />
Dienstes auch sonstige Bedienstete, beschäftigt werden, die mindestens<br />
einen Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Hochbau, Städtebau oder<br />
konstruktiver Ingenieurbau erworben haben. 5 Das bautechnische Personal<br />
und die notwendigen Hilfskräfte bei den Landratsämtern sind von den<br />
Landkreisen anzustellen.<br />
Bay BO Art. 54 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden<br />
(1) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden sind Staatsaufgaben; für die<br />
Gemeinden sind sie übertragene Aufgaben.<br />
(2) 1 Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung,<br />
Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und<br />
Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlichrechtlichen<br />
Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen<br />
Anordnungen eingehalten werden, soweit nicht andere Behörden<br />
zuständig sind. 2 Sie können in Wahrnehmung dieser Aufgaben die<br />
erforderlichen Maßnahmen treffen; sie sind berechtigt, die Vorlage von<br />
Bescheinigungen von Prüfsachverständigen zu verlangen.<br />
3<br />
Bauaufsichtliche Genehmigungen, Vorbescheide und sonstige<br />
Maßnahmen gelten auch für und gegen die Rechtsnachfolger; das gilt auch<br />
für Personen, die ein Besitzrecht nach Erteilung einer bauaufsichtlichen<br />
Genehmigung, eines Vorbescheids oder nach Erlass einer<br />
bauaufsichtlichen Maßnahme erlangt haben. 4 Die mit dem Vollzug dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s beauftragten Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres Amtes<br />
Grundstücke und Anlagen einschließlich der Wohnungen zu betreten; das<br />
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des<br />
Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) wird insoweit<br />
eingeschränkt.
(3) 1 Soweit die Vorschriften des Zweiten und des Dritten Teils mit Ausnahme<br />
der Art. 8 und 9 und die auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen<br />
Vorschriften nicht ausreichen, um die Anforderungen nach Art. 3 zu<br />
erfüllen, können die Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall weitergehende<br />
Anforderungen stellen, um erhebliche Gefahren abzuwehren, bei<br />
Sonderbauten auch zur Abwehr von Nachteilen; dies gilt nicht für<br />
Sonderbauten, soweit für sie eine Verordnung nach Art. 80 Abs. 1 Nr. 4<br />
erlassen worden ist. 2 Die Anforderungen des Satzes 1 Halbsatz 1 gelten<br />
nicht für Sonderbauten, wenn ihre Erfüllung wegen der besonderen Art<br />
oder Nutzung oder wegen anderer besonderer Anforderungen nicht<br />
erforderlich ist.<br />
(4) Bei bestandsgeschützten baulichen Anlagen können Anforderungen<br />
gestellt werden, wenn das zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben<br />
und Gesundheit notwendig ist.<br />
(5) Werden bestehende bauliche Anlagen wesentlich geändert, so kann<br />
angeordnet werden, dass auch die von der Änderung nicht berührten Teile<br />
dieser baulichen Anlagen mit diesem Gesetz oder den auf Grund dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn das<br />
aus Gründen des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlich und dem Bauherrn<br />
wirtschaftlich zumutbar ist und diese Teile mit den Teilen, die geändert<br />
werden sollen, in einem konstruktiven Zusammenhang stehen oder mit<br />
ihnen unmittelbar verbunden sind.<br />
(6) Bei Modernisierungsvorhaben soll von der Anwendung des Abs. 5<br />
abgesehen werden, wenn sonst die Modernisierung erheblich erschwert<br />
würde.<br />
Abschnitt II Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit<br />
Bay BO Art. 55 Grundsatz<br />
(1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen bedürfen<br />
der Baugenehmigung, soweit in Art. 56 bis 58, 72 und 73 nichts anderes<br />
bestimmt ist.<br />
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58, 72 und 73 Abs. 1 Satz 3<br />
sowie die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach Art. 59, 60,<br />
62 Abs. 4 und Art. 73 Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflichtung zur<br />
Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften<br />
an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen<br />
Eingriffsbefugnisse unberührt.<br />
Bay BO Art. 56 Vorrang anderer Gestattungsverfahren<br />
1 Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung,<br />
Zustimmung und Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen<br />
1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen in oder an<br />
oberirdischen Gewässern und Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder<br />
der Benutzung eines Gewässers dienen oder als solche gelten, ausgenommen<br />
Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping- und Wochenendplätze,<br />
2. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Bayerischen Abgrabungsgesetz<br />
(BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999 (GVBl S. 532, 535, BayRS 2132–2–I)
edürfen,<br />
3. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen für die<br />
öffentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser und für die<br />
öffentliche Verwertung oder Entsorgung von Abwässern, ausgenommen<br />
oberirdische Anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 100 m 3 ,<br />
Gebäude und Überbrückungen,<br />
4. nichtöffentliche Eisenbahnen, nichtöffentliche Seilbahnen und sonstige<br />
Bahnen besonderer Bauart, auf die die Vorschriften über fliegende Bauten<br />
keine Anwendung finden, im Sinn des Bayerischen Eisenbahn- und<br />
Seilbahngesetzes (BayESG),<br />
5. Werbeanlagen, soweit sie einer Zulassung nach Straßenverkehrs- oder nach<br />
Eisenbahnrecht bedürfen,<br />
6. Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)<br />
einer Genehmigung bedürfen,<br />
7. Beschneiungsanlagen nach Art. 59 a des Bayerischen Wassergesetzes<br />
(BayWG),<br />
8. Anlagen, die einer Gestattung nach Gerätesicherheitsrecht bedürfen,<br />
9. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bedürfen,<br />
10. Friedhöfe, die einer Genehmigung nach dem Bestattungsgesetz (BestG)<br />
bedürfen.<br />
2 Für Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren die<br />
Baugenehmigung, die Abweichung oder die Zustimmung einschließt oder die<br />
nach Satz 1 keiner Baugenehmigung, Abweichung oder Zustimmung bedürfen,<br />
nimmt die für den Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschriften zuständige<br />
Behörde die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde wahr. 3 Sie<br />
kann Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständige in entsprechender<br />
Anwendung der Art. 62 Abs. 3 und Art. 77 Abs. 2 sowie der auf Grund des<br />
Art. 80 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung heranziehen; Art. 59 Satz 1,<br />
Art. 60 Satz 1, Art. 62 Abs. 1, 2 und 4 Sätze 2 und 3, Art. 63 Abs. 1 Satz 2<br />
und Art. 77 Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend.<br />
Bay BO Art. 57 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen<br />
(1) Verfahrensfrei sind<br />
1. folgende Gebäude:<br />
a) Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m 3 , außer im<br />
Außenbereich,<br />
b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des Art. 6 Abs. 9<br />
Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m 2 , außer im Außenbereich,<br />
c) freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen, die einem land- oder<br />
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen<br />
Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, § 201 BauGB dienen,<br />
nur eingeschossig und nicht unterkellert sind, höchstens 100 m 2 Brutto-<br />
Grundfläche und höchstens 140 m 2 überdachte Fläche haben und nur zur<br />
Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren<br />
bestimmt sind,<br />
d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht mehr als<br />
1 600 m 2 Fläche, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder<br />
einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1<br />
Nrn. 1 und 2, § 201 BauGB dienen,<br />
e) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Personenverkehr oder der
Schülerbeförderung dienen,<br />
f) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann zugänglich sind und keine<br />
Aufenthaltsräume haben,<br />
g) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m 2 und einer Tiefe<br />
bis zu 3 m,<br />
h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinn des § 1 Abs. 1 des<br />
Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBl I<br />
S. 210), zuletzt geändert durch Art. 11 des <strong>Gesetze</strong>s vom 19. September<br />
2006 (BGBl I S. 2146),<br />
2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:<br />
a) Abgasanlagen in und an Gebäuden sowie freistehende Abgasanlagen<br />
mit einer Höhe bis zu 10 m,<br />
b) sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung,<br />
3. folgende Energiegewinnungsanlagen:<br />
a) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren<br />
- in und an Dach- und Außenwandflächen sowie auf Flachdächern, im<br />
Übrigen mit einer Fläche bis zu einem Drittel der jeweiligen Dach- oder<br />
Außenwandfläche,<br />
- gebäudeunabhängig mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge<br />
bis zu 9 m,<br />
b) Kleinwindkraftanlagen mit einer Höhe bis zu 10 m,<br />
4. folgende Anlagen der Versorgung:<br />
a) Brunnen,<br />
b) Anlagen, die der Telekommunikation, der öffentlichen Versorgung mit<br />
Elektrizität einschließlich Trafostationen, Gas, Öl oder Wärme dienen, mit<br />
einer Höhe bis zu 5 m und einer Fläche bis zu 10 m 2 ,<br />
5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:<br />
a) Antennen einschließlich der Masten mit einer Höhe bis zu 10 m und<br />
zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu<br />
10 m 3 sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen<br />
Anlage errichtet werden, die damit verbundene Änderung der Nutzung<br />
oder der äußeren Gestalt der Anlage,<br />
b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für Leitungen zur<br />
Versorgung mit Elektrizität, für Sirenen und für Fahnen,<br />
c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet werden,<br />
d) Signalhochbauten für die Landesvermessung,<br />
e) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 m,<br />
6. folgende Behälter:<br />
a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem Fassungsvermögen von<br />
weniger als 3 t, für nicht verflüssigte Gase mit einem Rauminhalt bis zu<br />
6 m 3 ,<br />
b) ortsfeste Behälter für brennbare oder wassergefährdende Flüssigkeiten<br />
mit einem Rauminhalt bis zu 10 m 3 ,<br />
c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem Rauminhalt bis zu 50 m 3 ,<br />
d) Gülle- und Jauchebehälter und -gruben mit einem Rauminhalt bis zu<br />
50 m 3 und einer Höhe bis zu 3 m,<br />
e) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 m und Schnitzelgruben,<br />
f) Dungstätten, Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anlagen, ausgenommen<br />
Biomasselager für den Betrieb von Biogasanlagen,<br />
g) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m 3 ,
7. folgende Mauern und Einfriedungen:<br />
a) Mauern einschließlich Stützmauern und Einfriedungen mit einer Höhe<br />
bis zu 2 m, außer im Außenbereich,<br />
b) offene, sockellose Einfriedungen im Außenbereich, soweit sie der<br />
Hoffläche eines landwirtschaftlichen Betriebs, der Weidewirtschaft<br />
einschließlich der Haltung geeigneter Schalenwildarten für Zwecke der<br />
Landwirtschaft, dem Erwerbsgartenbau oder dem Schutz von<br />
Forstkulturen und Wildgehegen zu Jagdzwecken oder dem Schutz<br />
landwirtschaftlicher Kulturen vor Schalenwild sowie der berufsmäßigen<br />
Binnenfischerei dienen,<br />
c) Sichtschutzzäune und Terrassentrennwände zwischen Doppelhäusern<br />
und den Gebäuden von Hausgruppen mit einer Höhe bis zu 2 m und einer<br />
Tiefe bis zu 4 m,<br />
8. private Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Durchlässen mit<br />
einer lichten Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit einem<br />
Durchmesser bis zu 3 m,<br />
9. Aufschüttungen mit einer Höhe bis zu 2 m und einer Fläche bis zu<br />
500 m 2 ,<br />
10. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung:<br />
a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m 3 einschließlich<br />
dazugehöriger temporärer luftgetragener Überdachungen, außer im<br />
Außenbereich,<br />
b) Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutschbahnen mit einer Höhe bis<br />
zu 10 m,<br />
c) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-,<br />
Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm-<br />
und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebäude und Tribünen,<br />
d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, auf<br />
Camping-, Zelt- und Wochenendplätzen,<br />
e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der<br />
zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, ausgenommen<br />
Gebäude und Einfriedungen,<br />
11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:<br />
a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,<br />
b) die Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von<br />
Wohngebäuden,<br />
c) zur Errichtung einzelner Aufenthaltsräume, die zu Wohnzwecken<br />
genutzt werden, im Dachgeschoss überwiegend zu Wohnzwecken<br />
genutzter Gebäude, wenn die Dachkonstruktion und die äußere Gestalt<br />
des Gebäudes nicht in genehmigungspflichtiger Weise verändert werden,<br />
d) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen,<br />
e) Außenwandbekleidungen, ausgenommen bei Hochhäusern,<br />
Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,<br />
auch vor Fertigstellung der Anlage,<br />
12. Maßnahmen zur nachträglichen Wärmedämmung an Außenwänden<br />
und Dächern,<br />
13. folgende Werbeanlagen:<br />
a) Werbeanlagen in Auslagen oder an Schaufenstern, im Übrigen mit einer<br />
Ansichtsfläche bis zu 1 m 2 ,<br />
b) Warenautomaten,
c) Werbeanlagen, die nicht vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar<br />
sind,<br />
d) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vorübergehend<br />
für höchstens zwei Monate angebracht werden, im Außenbereich nur,<br />
soweit sie einem Vorhaben im Sinn des § 35 Abs. 1 BauGB dienen,<br />
e) Zeichen, die auf abseits oder versteckt gelegene Stätten hinweisen<br />
(Hinweiszeichen), außer im Außenbereich,<br />
f) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen<br />
(Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel<br />
zusammengefasst sind,<br />
g) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-,<br />
Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an der Stätte der Leistung,<br />
an und auf Flugplätzen, Sportanlagen, auf abgegrenzten<br />
Versammlungsstätten, Ausstellungs- und Messegeländen, soweit sie nicht<br />
in die freie Landschaft wirken, mit einer Höhe bis zu 10 m,<br />
14. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:<br />
a) Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, Schutzhallen<br />
und Unterkünfte,<br />
b) Toilettenwagen,<br />
c) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz<br />
oder der Unfallhilfe dienen,<br />
d) bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf genehmigtem<br />
Messe- und Ausstellungsgelände errichtet werden, ausgenommen<br />
fliegende Bauten,<br />
e) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten,<br />
Volksfesten und Märkten, ausgenommen fliegende Bauten,<br />
f) Zeltlager, die nach ihrem erkennbaren Zweck gelegentlich, höchstens<br />
für zwei Monate errichtet werden,<br />
15. Fahrgeschäfte mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder betrieben<br />
werden und eine Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s haben,<br />
16. folgende Plätze:<br />
a) Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, die einem land- oder<br />
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen<br />
Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, § 201 BauGB dienen,<br />
b) nicht überdachte Stellplätze und sonstige Lager- und Abstellplätze mit<br />
einer Fläche bis zu 300 m 2 und deren Zufahrten, außer im Außenbereich,<br />
c) Kinderspielplätze im Sinn des Art. 7 Abs. 2 Satz 1,<br />
d) Freischankflächen bis zu 40 m 2 einschließlich einer damit verbundenen<br />
Nutzungsänderung einer Gaststätte oder einer Verkaufsstelle des<br />
Lebensmittelhandwerks,<br />
17. folgende sonstige Anlagen:<br />
a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu 30 m 2 ,<br />
b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,<br />
c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,<br />
d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denkmäler und sonstige<br />
Kunstwerke jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,<br />
e) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen<br />
wie Hauseingangsüberdachungen, Markisen, Rollläden, Terrassen,<br />
Maschinenfundamente, Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände,
Wildfütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und<br />
Teppichstangen.<br />
(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind verfahrensfrei<br />
1. Garagen mit einer Nutzfläche bis zu 100 m 2 sowie überdachte<br />
Stellplätze,<br />
2. Wochenendhäuser sowie Anlagen, die keine Gebäude sind, in durch<br />
Bebauungsplan festgesetzten Wochenendhausgebieten,<br />
3. Anlagen in Dauerkleingärten im Sinn des § 1 Abs. 3 BKleingG,<br />
4. Dachgauben und vergleichbare Dachaufbauten,<br />
5. Mauern und Einfriedungen,<br />
6. Werbeanlagen mit einer Höhe bis zu 10 m,<br />
7. Kinderspiel-, Bolz- und Abenteuerspielplätze,<br />
8. Friedhöfe,<br />
9. Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren<br />
im Geltungsbereich einer städtebaulichen oder einer Satzung nach Art. 81,<br />
die Regelungen über die Zulässigkeit, den <strong>Stand</strong>ort und die Größe der<br />
Anlage enthält, wenn sie den Festsetzungen der Satzung entspricht.<br />
(3) 1 Verfahrensfrei sind luftrechtlich zugelassenen Flugplätzen dienende<br />
Anlagen, ausgenommen Gebäude, die Sonderbauten sind. 2 Für nach<br />
Satz 1 verfahrensfreie Anlagen gelten Art. 61 und 62 entsprechend.<br />
(4) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn<br />
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen<br />
Anforderungen als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen oder<br />
2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Abs. 1 und 2<br />
verfahrensfrei wäre.<br />
(5) 1 Verfahrensfrei ist die Beseitigung von<br />
1. Anlagen nach Abs. 1 bis 3,<br />
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,<br />
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.<br />
2<br />
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens<br />
einen Monat zuvor der Gemeinde und der Bauaufsichtsbehörde<br />
anzuzeigen. 3 Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 2 muss die<br />
<strong>Stand</strong>sicherheit des Gebäudes oder der Gebäude, an die das zu<br />
beseitigende Gebäude angebaut ist, von einem Tragwerksplaner im Sinn<br />
des Art. 62 Abs. 2 Satz 1 erster Spiegelstrich und Satz 3 bestätigt sein.<br />
4<br />
Bei sonstigen nicht freistehenden Gebäuden muss die <strong>Stand</strong>sicherheit<br />
des Gebäudes oder der Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude<br />
angebaut ist, durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt sein;<br />
Halbsatz 1 gilt entsprechend, wenn die Beseitigung eines Gebäudes sich<br />
auf andere Weise auf die <strong>Stand</strong>sicherheit anderer Gebäude auswirken<br />
kann. 5 Sätze 3 und 4 gelten nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude<br />
angebaut ist. 6 Art. 68 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 7 gelten entsprechend.<br />
(6) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.<br />
Bay BO Art. 58 Genehmigungsfreistellung<br />
(1) 1 Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Abs. 2 die<br />
Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen, die keine<br />
Sonderbauten sind. 2 Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschrift im
Sinn des Art. 81 Abs. 2 die Anwendung dieser Vorschrift auf bestimmte<br />
handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben ausschließen.<br />
(2) Nach Abs. 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn<br />
1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn des § 30 Abs. 1<br />
oder der §§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt,<br />
2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Regelungen<br />
örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 nicht widerspricht,<br />
3. die Erschließung im Sinn des Baugesetzbuchs gesichert ist und<br />
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 3 Satz 3 erklärt, dass<br />
das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll<br />
oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB<br />
beantragt.<br />
(3) 1 Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde<br />
einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst<br />
Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der Unterlagen unverzüglich der<br />
unteren Bauaufsichtsbehörde vor. 2 Spätestens mit der Vorlage bei der<br />
Gemeinde benachrichtigt der Bauherr die Eigentümer der benachbarten<br />
Grundstücke von dem Bauvorhaben; Art. 66 Abs. 1 Sätze 2 und 5, Abs. 3<br />
gelten entsprechend. 3 Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach<br />
Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen<br />
werden. 4 Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich<br />
mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie<br />
eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragen wird,<br />
darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von der<br />
Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu<br />
unterrichten. 5 Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens<br />
mehr als vier Jahre, nachdem die Bauausführung nach den Sätzen 3 und 4<br />
zulässig geworden ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.<br />
(4) 1 Die Erklärung der Gemeinde nach Abs. 2 Nr. 4 erste Alternative kann<br />
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen<br />
Voraussetzungen des Abs. 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen<br />
für erforderlich hält. 2 Darauf, dass die Gemeinde von ihrer<br />
Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht kein<br />
Rechtsanspruch. 3 Erklärt die Gemeinde, dass das vereinfachte<br />
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, hat sie dem<br />
Bauherrn die vorgelegten Unterlagen zurückzureichen. 4 Hat der Bauherr<br />
bei der Vorlage der Unterlagen bestimmt, dass seine Vorlage im Fall der<br />
Erklärung nach Abs. 2 Nr. 4 als Bauantrag zu behandeln ist, leitet sie die<br />
Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde<br />
weiter.<br />
(5) 1 Art. 62 bleibt unberührt. 2 Art. 64 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Sätze 1 und 2,<br />
Art. 68 Abs. 5 Nrn. 2 und 3, Abs. 6 und 7 sind entsprechend anzuwenden.<br />
Abschnitt III Genehmigungsverfahren<br />
Bay BO Art. 59 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren<br />
1 Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde<br />
1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der
aulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB und den Regelungen örtlicher<br />
Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1,<br />
2. beantragte Abweichungen im Sinn des Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2<br />
sowie<br />
3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der<br />
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird.<br />
2 Art. 62 bleibt unberührt.<br />
Bay BO Art. 60 Baugenehmigungsverfahren<br />
1 Bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde<br />
1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der<br />
baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB,<br />
2. Anforderungen nach den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s und auf Grund dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s,<br />
3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der<br />
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird.<br />
2 Art. 62 bleibt unberührt.<br />
Bay BO Art. 61 Bauvorlageberechtigung<br />
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von<br />
Gebäuden müssen von einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der<br />
bauvorlageberechtigt ist.<br />
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer<br />
1. die Berufsbezeichnung “Architektin” oder “Architekt”führen darf,<br />
2. in die von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau zu führende Liste<br />
der bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetragen ist; Eintragungen<br />
anderer Länder gelten auch im Freistaat Bayern.<br />
(3) 1 Bauvorlageberechtigt sind ferner die Angehörigen der Fachrichtungen<br />
Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die nach dem<br />
Ingenieurgesetz die Berufsbezeichnung “Ingenieurin” oder “Ingenieur”<br />
führen dürfen, sowie die staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung<br />
Bautechnik und die Handwerksmeister des Maurer- und Betonbauer- sowie<br />
des Zimmererfachs für<br />
1. freistehende oder nur einseitig angebaute oder anbaubare<br />
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 mit nicht mehr als drei<br />
Wohnungen,<br />
2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebäude mit freien Stützweiten<br />
von nicht mehr als 12 m und nicht mehr als 250 m 2 ,<br />
3. land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude,<br />
4. Kleingaragen im Sinn der Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1<br />
Nr. 3,<br />
5. einfache Änderungen von sonstigen Gebäuden.<br />
2<br />
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union<br />
oder eines nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft<br />
gleichgestellten Staates sind im Sinn des Satzes 1 bauvorlageberechtigt,<br />
wenn sie eine vergleichbare Berechtigung besitzen und dafür den staatlich<br />
geprüften Technikern der Fachrichtung Bautechnik oder den
Handwerksmeistern des Maurer- und Betonbauer- sowie des<br />
Zimmererfachs vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten. 3 Abs. 6 bis<br />
8 gelten entsprechend.<br />
(4) Bauvorlageberechtigt ist ferner, wer<br />
1. unter Beschränkung auf sein Fachgebiet Bauvorlagen aufstellt, die<br />
üblicherweise von Fachkräften mit einer anderen Ausbildung als sie die in<br />
Abs. 2 genannten Personen haben, aufgestellt werden,<br />
2. die Befähigung zum höheren oder gehobenen bautechnischen<br />
Verwaltungsdienst besitzt, für seine Tätigkeit für seinen Dienstherrn,<br />
3. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der<br />
Fachrichtung Architektur, Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie<br />
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom<br />
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl<br />
L 255 S. 22, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 des<br />
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008, ABl L 311<br />
S. 1) oder Bauingenieurwesen nachweist, danach mindestens zwei Jahre<br />
auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig<br />
gewesen ist und Bedienstete oder Bediensteter einer juristischen Person<br />
des öffentlichen Rechts ist, für die dienstliche Tätigkeit,<br />
4. die Berufsbezeichnung “Innenarchitektin” oder “Innenarchitekt” führen<br />
darf, für die mit der Berufsaufgabe verbundenen baulichen Änderungen<br />
von Gebäuden,<br />
5. Ingenieurin oder Ingenieur der Fachrichtung Innenausbau ist und eine<br />
praktische Tätigkeit in dieser Fachrichtung von mindestens zwei Jahren<br />
ausgeübt hat, für die Planung von Innenräumen und die damit<br />
verbundenen baulichen Änderungen von Gebäuden; Abs. 3 Sätze 2 und 3<br />
gelten entsprechend,<br />
6. einen Studiengang der Fachrichtung Holzbau und Ausbau, den das<br />
Staatsministerium des Innern als gleichwertig mit einer Ausbildung nach<br />
Abs. 3 einschließlich der Anforderungen auf Grund der Rechtsverordnung<br />
nach Art. 80 Abs. 3 anerkannt hat, erfolgreich abgeschlossen hat, für die<br />
Bauvorhaben nach Abs. 3, sofern sie in Holzbauweise errichtet werden;<br />
Abs. 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.<br />
(5) 1 In die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure nach Abs. 2 Nr. 2 ist<br />
auf Antrag von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau einzutragen, wer<br />
1. auf Grund eines Studiums des Bauingenieurwesens die<br />
Voraussetzungen zur Führung der Berufsbezeichnung “Ingenieur” oder<br />
“Ingenieurin” nach dem Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung<br />
“Ingenieur” und “Ingenieurin” – Ingenieurgesetz – IngG – (BayRS 702–2–<br />
W), zuletzt geändert durch § 1 des <strong>Gesetze</strong>s vom 20. Dezember 2007<br />
(GVBl S. 966), erfüllt oder einen berufsqualifizierenden<br />
Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Hochbau (Art. 49<br />
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG) nachweist und<br />
2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von<br />
Gebäuden praktisch tätig gewesen ist.<br />
2 3<br />
Art. 6 des Baukammerngesetzes (BauKaG) gilt entsprechend. Dem<br />
Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen.<br />
4<br />
Hat die Bayerische Ingenieurekammer-Bau nicht innerhalb der in<br />
Art. 42 a BayVwVfG festgelegten Frist entschieden, gilt der Antrag als<br />
genehmigt.
(6) 1 Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union<br />
oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft<br />
gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, sind<br />
ohne Eintragung in die Liste nach Abs. 2 Nr. 2 bauvorlageberechtigt, wenn<br />
sie<br />
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und<br />
2. dafür dem Abs. 5 Satz 1 Nrn. 1 und 2 vergleichbare Anforderungen<br />
erfüllen mussten.<br />
2<br />
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigter vorher<br />
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau anzuzeigen und dabei<br />
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitgliedstaat der<br />
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen<br />
Gemeinschaft gleichgestellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte<br />
niedergelassen sind und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum<br />
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend,<br />
untersagt ist, und<br />
2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung für die<br />
Tätigkeit als Bauvorlageberechtigter mindestens die Voraussetzungen des<br />
Abs. 6 Satz 1 Nrn. 1 und 2 erfüllen mussten,<br />
vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen. 3 Die Bayerische<br />
Ingenieurekammer-Bau hat auf Antrag des Bauvorlageberechtigten zu<br />
bestätigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das<br />
Tätigwerden als Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in<br />
dem Verzeichnis nach Satz 2 löschen, wenn die Voraussetzungen des<br />
Satzes 1 nicht erfüllt sind.<br />
(7) 1 Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union<br />
oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft<br />
gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne<br />
dass die Voraussetzung für die Vergleichbarkeit im Sinn des Abs. 6 Satz 1<br />
Nr. 2 erfüllt ist, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Bayerische<br />
Ingenieurekammer-Bau bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen des<br />
Abs. 5 Satz 1 Nrn. 1 und 2 tatsächlich erfüllen; sie sind in einem<br />
Verzeichnis zu führen. 2 Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. 3 Abs. 5<br />
Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.<br />
(8) 1 Anzeigen und Bescheinigungen nach den Abs. 6 und 7 sind nicht<br />
erforderlich, wenn bereits in einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist<br />
oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine weitere Eintragung in die von<br />
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau geführten Verzeichnisse erfolgt<br />
nicht. 2 Verfahren nach den Abs. 5 bis 7 können über die einheitliche Stelle<br />
nach den Vorschriften des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes<br />
abgewickelt werden.<br />
(9) 1 Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasser unterschreiben,<br />
wenn sie diese unter der Leitung eines Bauvorlageberechtigten nach den<br />
Abs. 2 bis 4, 6 und 7 aufstellen. 2 Auf den Bauvorlagen ist der Name des<br />
Bauvorlageberechtigten anzugeben.<br />
(10) Für Bauvorlageberechtigte, die weder Mitglied der Bayerischen<br />
Architektenkammer noch der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau sind,<br />
gilt Art. 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BauKaG entsprechend.
Bay BO Art. 62 Bautechnische Nachweise<br />
(1) 1 Die Einhaltung der Anforderungen an die <strong>Stand</strong>sicherheit, den Brand-,<br />
Schall-, Wärme- und Erschütterungsschutz ist nach näherer Maßgabe der<br />
Verordnung auf Grund des Art. 80 Abs. 4 nachzuweisen (bautechnische<br />
Nachweise); das gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, einschließlich<br />
der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der<br />
Rechtsverordnung auf Grund des Art. 80 Abs. 4 anderes bestimmt ist.<br />
2<br />
Die Bauvorlageberechtigung nach Art. 61 Abs. 2, 3 und 4 Nrn. 2 bis 6<br />
schließt die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise<br />
ein, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist. 3 Art. 61<br />
Abs. 10 ist anzuwenden.<br />
(2) 1 Der <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweis muss bei<br />
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,<br />
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,<br />
erstellt sein von<br />
– Personen mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines<br />
Studiums der Fachrichtung Architektur; Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der<br />
Richtlinie 2005/36/EG) oder des Bauingenieurwesens mit einer<br />
mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung; sie<br />
dürfen auch bei anderen Bauvorhaben den <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweis<br />
erstellen,<br />
– im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung von staatlich geprüften<br />
Technikern der Fachrichtung Bautechnik und Handwerksmeistern des<br />
Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs (Art. 61 Abs. 3), wenn<br />
sie mindestens drei Jahre zusammenhängende Berufserfahrung<br />
nachweisen und die durch Rechtsverordnung gemäß Art. 80 Abs. 3 näher<br />
bestimmte Zusatzqualifikation besitzen,<br />
– im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung Bauvorlageberechtigten nach<br />
Art. 61 Abs. 4 Nr. 6.<br />
2<br />
Der Brandschutznachweis muss bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4,<br />
ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinn der<br />
Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, erstellt sein von<br />
1. für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten, die die erforderlichen<br />
Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen haben,<br />
2. Prüfsachverständigen für Brandschutz als Brandschutzplaner; sie dürfen<br />
auch bei anderen Bauvorhaben den Brandschutznachweis erstellen.<br />
3<br />
Tragwerksplaner nach Satz 1 erster Spiegelstrich und Brandschutzplaner<br />
nach Satz 2 Nr. 1 müssen unter Beachtung des Art. 61 Abs. 5 Sätze 3 und<br />
4 in einer von der Bayerischen Architektenkammer oder der Bayerischen<br />
Ingenieurekammer-Bau zu führenden Liste eingetragen sein, für die Art. 6<br />
BauKaG entsprechend gilt; Eintragungen anderer Länder gelten auch im<br />
Freistaat Bayern. 4 Für Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der<br />
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen<br />
Gemeinschaft gleichgestellten Staat zur Erstellung von <strong>Stand</strong>sicherheitsoder<br />
Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gelten Art. 61 Abs. 6<br />
bis 8 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Anzeige bzw. der Antrag<br />
auf Erteilung einer Bescheinigung bei der nach Satz 3 zuständigen Stelle<br />
einzureichen ist.
(3) 1 Bei<br />
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5,<br />
2. wenn dies nach Maßgabe eines in der Rechtsverordnung nach Art. 80<br />
Abs. 4 geregelten Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei<br />
a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,<br />
b) Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen,<br />
c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe<br />
von mehr als 10 m<br />
muss der <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweis bei Sonderbauten durch die<br />
Bauaufsichtsbehörde, einen Prüfingenieur oder ein Prüfamt geprüft, im<br />
Übrigen durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt sein. 2 Das gilt nicht<br />
für<br />
1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,<br />
2. nicht oder nur zum vorübergehenden Aufenthalt einzelner Personen<br />
bestimmte eingeschossige Gebäude mit freien Stützweiten von nicht mehr<br />
als 12 m und nicht mehr als 1 600 m 2 .<br />
3<br />
Bei<br />
1. Sonderbauten,<br />
2. Mittel- und Großgaragen im Sinn der Verordnung nach Art. 80 Abs. 1<br />
Satz 1 Nr. 3,<br />
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5<br />
muss der Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen<br />
bescheinigt sein oder wird bauaufsichtlich geprüft.<br />
(4) 1 Außer in den Fällen des Abs. 3 werden bautechnische Nachweise nicht<br />
geprüft; Art. 63 bleibt unberührt. 2 Werden bautechnische Nachweise<br />
durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt, gelten die entsprechenden<br />
Anforderungen auch in den Fällen des Art. 63 als eingehalten. 3 Einer<br />
Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde, einen Prüfingenieur oder ein<br />
Prüfamt oder einer Bescheinigung durch einen Prüfsachverständigen<br />
bedarf es ferner nicht, soweit für das Bauvorhaben<br />
<strong>Stand</strong>sicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prüfamt allgemein<br />
geprüft sind (Typenprüfung); Typenprüfungen anderer Länder gelten auch<br />
im Freistaat Bayern.<br />
Bay BO Art. 63 Abweichungen<br />
(1) 1 Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s und auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassener Vorschriften zulassen,<br />
wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung<br />
und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen<br />
Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen<br />
des Art. 3 Abs. 1, vereinbar sind; Art. 3 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt.<br />
2<br />
Der Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische<br />
Nachweise durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden.<br />
(2) 1 Die Zulassung von Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1, von Ausnahmen<br />
und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer<br />
sonstigen städtebaulichen Satzung oder von Regelungen der<br />
Baunutzungsverordnung ist gesondert schriftlich zu beantragen; der<br />
Antrag ist zu begründen. 2 Für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen,<br />
sowie für Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren
nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend; bei Bauvorhaben, die<br />
einer Genehmigung bedürfen, ist der Abweichungsantrag mit dem<br />
Bauantrag zu stellen.<br />
(3) 1 Über Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1 von örtlichen Bauvorschriften<br />
sowie über Ausnahmen und Befreiungen nach Abs. 2 Satz 1 entscheidet<br />
bei verfahrensfreien Bauvorhaben die Gemeinde nach Maßgabe der Abs. 1<br />
und 2. 2 Im Übrigen lässt die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von<br />
örtlichen Bauvorschriften im Einvernehmen mit der Gemeinde zu; § 36<br />
Abs. 2 Satz 2 BauGB gilt entsprechend.<br />
Bay BO Art. 64 Bauantrag, Bauvorlagen<br />
(1) 1 Der Bauantrag ist schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 2 Diese legt<br />
ihn, sofern sie nicht selbst zur Entscheidung zuständig ist, mit ihrer<br />
Stellungnahme unverzüglich bei der Bauaufsichtsbehörde vor. 3 Die<br />
Gemeinden können die Ergänzung oder Berichtigung unvollständiger oder<br />
unrichtiger Bauanträge verlangen.<br />
(2) 1 Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und<br />
die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen)<br />
einzureichen. 2 Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen<br />
nachgereicht werden.<br />
(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung des<br />
Bauvorhabens auf die Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter<br />
Weise auf dem Baugrundstück dargestellt wird.<br />
(4) 1 Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag und die<br />
Bauvorlagen zu unterschreiben. 2 Soweit der Eigentümer oder der<br />
Erbbauberechtigte dem Bauvorhaben zugestimmt hat, ist er verpflichtet,<br />
bauaufsichtliche Maßnahmen zu dulden, die aus Nebenbestimmungen der<br />
Baugenehmigung herrühren.<br />
Bay BO Art. 65 Behandlung des Bauantrags<br />
(1) 1 Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag diejenigen Stellen,<br />
1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über den<br />
Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder<br />
2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrags<br />
nicht beurteilt werden kann;<br />
die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die jeweilige Stelle dem<br />
Bauantrag bereits vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens<br />
schriftlich zugestimmt hat. 2 Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der<br />
Zustimmung oder des Einvernehmens einer anderen Körperschaft,<br />
Behörde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht<br />
einen Monat nach Eingang des Ersuchens verweigert wird; von der Frist<br />
nach Halbsatz 1 abweichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben<br />
unberührt. 3 Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht<br />
innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der<br />
Bauaufsichtsbehörde eingehen, es sei denn, die verspätete Stellungnahme<br />
ist für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den Bauantrag von<br />
Bedeutung.
(2) 1 Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel<br />
auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde den Bauherrn zur Behebung der<br />
Mängel innerhalb einer angemessenen Frist auf. 2 Werden die Mängel<br />
innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen.<br />
Bay BO Art. 66 Beteiligung des Nachbarn<br />
(1) 1 Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind vom Bauherrn<br />
oder seinem Beauftragten der Lageplan und die Bauzeichnungen zur<br />
Unterschrift vorzulegen. 2 Die Unterschrift gilt als Zustimmung. 3 Fehlt die<br />
Unterschrift des Eigentümers eines benachbarten Grundstücks, kann ihn<br />
die Gemeinde auf Antrag des Bauherrn von dem Bauantrag<br />
benachrichtigen und ihm eine Frist für seine Äußerung setzen. 4 Hat er die<br />
Unterschrift bereits schriftlich gegenüber der Gemeinde oder der<br />
Bauaufsichtsbehörde verweigert, unterbleibt die Benachrichtigung. 5 Ist<br />
ein zu benachrichtigender Eigentümer nur unter Schwierigkeiten zu<br />
ermitteln oder zu benachrichtigen, so genügt die Benachrichtigung des<br />
unmittelbaren Besitzers. 6 Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird<br />
seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung der<br />
Baugenehmigung zuzustellen.<br />
(2) 1 Der Nachbar ist Beteiligter im Sinn des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG.<br />
2 3<br />
Art. 28 BayVwVfG findet keine Anwendung. Sind an einem<br />
Baugenehmigungsverfahren mindestens zehn Nachbarn im gleichen<br />
Interesse beteiligt, ohne vertreten zu sein, so kann die<br />
Bauaufsichtsbehörde sie auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist<br />
einen Vertreter zu bestellen; Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2<br />
BayVwVfG finden Anwendung. 4 Bei mehr als 20 Beteiligten im Sinn des<br />
Satzes 3 kann die Zustellung nach Abs. 1 Satz 6 durch öffentliche<br />
Bekanntmachung ersetzt werden; die Bekanntmachung hat den<br />
verfügenden Teil der Baugenehmigung, die Rechtsbehelfsbelehrung sowie<br />
einen Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten des<br />
Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden können. 5 Sie ist im<br />
amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde<br />
bekannt zu machen. 6 Die Zustellung gilt mit dem Tag der<br />
Bekanntmachung als bewirkt.<br />
(3) 1 Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des Eigentümers. 2 Ist<br />
Eigentümer des Nachbargrundstücks eine Eigentümergemeinschaft nach<br />
dem Wohnungseigentumsgesetz, so genügt die Vorlage nach Abs. 1<br />
Satz 1 an den Verwalter; seine Unterschrift gilt jedoch nicht als<br />
Zustimmung der einzelnen Wohnungseigentümer. 3 Der Eigentümer des<br />
Nachbargrundstücks nimmt auch die Rechte des Mieters oder Pächters<br />
wahr, die aus deren Eigentumsgrundrecht folgen.<br />
(4) 1 Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres<br />
Betriebs geeignet sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu<br />
gefährden, zu benachteiligen oder zu belästigen, kann die<br />
Bauaufsichtsbehörde auf Antrag des Bauherrn das Vorhaben in ihrem<br />
amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem in örtlichen<br />
Tageszeitungen, die im Bereich des <strong>Stand</strong>orts der Anlage verbreitet sind,<br />
öffentlich bekannt machen; verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach<br />
Halbsatz 1, finden Abs. 1 und 3 keine Anwendung. 2 Mit Ablauf einer Frist
von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle<br />
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben<br />
ausgeschlossen. 3 Die Zustellung der Baugenehmigung nach Abs. 1 Satz 6<br />
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; Abs. 2 Satz 6<br />
sowie Satz 1 gelten entsprechend. 4 In der Bekanntmachung nach Satz 1<br />
ist darauf hinzuweisen,<br />
1. wo und wann Beteiligte im Sinn des Abs. 2 Satz 1 und des Abs. 3 nach<br />
Art. 29 BayVwVfG die Akten des Verfahrens einsehen können,<br />
2. wo und wann Beteiligte im Sinn des Abs. 2 Satz 1 und des Abs. 3<br />
Einwendungen gegen das Vorhaben vorbringen können,<br />
3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 eintreten und<br />
4. dass die Zustellung der Baugenehmigung durch öffentliche<br />
Bekanntmachung ersetzt werden kann.<br />
Bay BO Art. 67 Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens<br />
(1) 1 Hat eine Gemeinde ihr nach Städtebaurecht oder nach Art. 63 Abs. 3<br />
Satz 2 Halbsatz 1 erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt und<br />
besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung, kann das<br />
fehlende Einvernehmen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 ersetzt werden.<br />
2<br />
Ein Rechtsanspruch auf Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens<br />
besteht nicht.<br />
(2) Art. 112 der Gemeindeordnung (GO) findet keine Anwendung.<br />
(3) 1 Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme im Sinn des Art. 113<br />
GO; sie ist insoweit zu begründen. 2 Entfällt die aufschiebende Wirkung<br />
der Anfechtungsklage gegen die Genehmigung nach § 80 Abs. 2 Satz 1<br />
Nr. 3 oder 4 VwGO, hat die Anfechtungsklage auch insoweit keine<br />
aufschiebende Wirkung, als die Genehmigung als Ersatzvornahme gilt.<br />
(4) 1 Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmigung anzuhören. 2 Dabei ist ihr<br />
Gelegenheit zu geben, binnen angemessener Frist erneut über das<br />
gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden.<br />
Bay BO Art. 68 Baugenehmigung und Baubeginn<br />
(1) 1 Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine<br />
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im<br />
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind; die<br />
Bauaufsichtsbehörde darf den Bauantrag auch ablehnen, wenn das<br />
Bauvorhaben gegen sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt.<br />
2<br />
Die durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, beschriebenen<br />
und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür<br />
geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.<br />
(2) 1 Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; Art. 3 a des BayVwVfG<br />
findet keine Anwendung. 2 Sie ist nur insoweit zu begründen, als ohne<br />
Zustimmung des Nachbarn von nachbarschützenden Vorschriften<br />
abgewichen wird oder der Nachbar gegen das Bauvorhaben schriftlich<br />
Einwendungen erhoben hat; Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG bleibt<br />
unberührt. 3 Sie ist mit einer Ausfertigung der mit einem<br />
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen dem Antragsteller<br />
und, wenn diese dem Bauvorhaben nicht zugestimmt hat, der Gemeinde<br />
zuzustellen.
(3) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen oder Bedingungen erteilt, kann<br />
eine Sicherheitsleistung verlangt werden.<br />
(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.<br />
(5) Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen<br />
Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn<br />
1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist sowie<br />
2. die Bescheinigungen nach Art. 62 Abs. 3 und<br />
3. die Baubeginnsanzeige<br />
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.<br />
(6) 1 Vor Baubeginn müssen die Grundfläche der baulichen Anlage abgesteckt<br />
und ihre Höhenlage festgelegt sein. 2 Die Bauaufsichtsbehörde kann<br />
verlangen, dass Absteckung und Höhenlage von ihr abgenommen oder die<br />
Einhaltung der festgelegten Grundfläche und Höhenlage nachgewiesen<br />
wird. 3 Baugenehmigungen, Bauvorlagen, bautechnische Nachweise,<br />
soweit es sich nicht um Bauvorlagen handelt, sowie Bescheinigungen von<br />
Prüfsachverständigen müssen an der Baustelle von Baubeginn an<br />
vorliegen.<br />
(7) Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn genehmigungspflichtiger<br />
Bauvorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer<br />
Unterbrechung von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche<br />
vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen<br />
(Baubeginnsanzeige).<br />
Bay BO Art. 69 Geltungsdauer der Baugenehmigung und der<br />
Teilbaugenehmigung<br />
(1) Sind in ihnen keine anderen Fristen bestimmt, erlöschen die<br />
Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung, wenn innerhalb von vier<br />
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht<br />
begonnen oder die Bauausführung vier Jahre unterbrochen worden ist; die<br />
Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt den Lauf der Frist bis zur<br />
Unanfechtbarkeit der Genehmigung.<br />
(2) 1 Die Frist nach Abs. 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei<br />
Jahre verlängert werden. 2 Sie kann auch rückwirkend verlängert werden,<br />
wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen<br />
ist.<br />
Bay BO Art. 70 Teilbaugenehmigung<br />
1 Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten für die<br />
Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag<br />
schon vor Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden<br />
(Teilbaugenehmigung); eine Teilbaugenehmigung kann auch für die Errichtung<br />
einer baulichen Anlage unter Vorbehalt der künftigen Nutzung erteilt werden,<br />
wenn und soweit die Genehmigungsfähigkeit der baulichen Anlage nicht von<br />
deren künftiger Nutzung abhängt. 2 Art. 67 und 68 gelten entsprechend.<br />
Bay BO Art. 71 Vorbescheid<br />
1 Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen<br />
Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. 2 Der Vorbescheid gilt
drei Jahre, soweit in ihm keine andere Frist bestimmt ist. 3 Die Frist kann auf<br />
schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei Jahre verlängert werden. 4 Art. 64 bis<br />
67, Art. 68 Abs. 1 bis 4 und Art. 69 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend; die<br />
Bauaufsichtsbehörde kann von der Anwendung des Art. 66 absehen, wenn der<br />
Bauherr dies beantragt.<br />
Bay BO Art. 72 Genehmigung fliegender Bauten<br />
(1) 1 Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind,<br />
wiederholt an wechselnden Orten aufgestellt und zerlegt zu werden.<br />
2 Baustelleneinrichtungen gelten nicht als fliegende Bauten.<br />
(2) 1 Fliegende Bauten dürfen nur aufgestellt und in Gebrauch genommen<br />
werden, wenn vor ihrer erstmaligen Aufstellung oder Ingebrauchnahme<br />
eine Ausführungsgenehmigung erteilt worden ist. 2 Die<br />
Ausführungsgenehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die<br />
höchstens fünf Jahre betragen soll; sie kann auf schriftlichen Antrag von<br />
der für die Ausführungsgenehmigung zuständigen Behörde oder der nach<br />
Art. 80 Abs. 5 Nr. 5 bestimmten Stelle jeweils um bis zu fünf Jahre<br />
verlängert werden, wenn das der Inhaber vor Ablauf der Frist schriftlich<br />
beantragt. 3 Die Ausführungsgenehmigung kann vorschreiben, dass der<br />
fliegende Bau vor jeder Inbetriebnahme oder in bestimmten zeitlichen<br />
Abständen jeweils vor einer Inbetriebnahme von einem Sachverständigen<br />
abgenommen wird. 4 Ausführungsgenehmigungen anderer Länder der<br />
Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Freistaat Bayern.<br />
(3) Keiner Ausführungsgenehmigung bedürfen<br />
1. fliegende Bauten bis zu 5 m Höhe, die nicht dazu bestimmt sind, von<br />
Besuchern betreten zu werden,<br />
2. fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder betrieben<br />
werden und eine Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s haben,<br />
3. Bühnen, die fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und<br />
sonstigen Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu<br />
100 m 2 und einer Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m,<br />
4. Zelte, die fliegende Bauten sind, mit bis zu 75 m 2 ,<br />
5. Toilettenwagen.<br />
(4) 1 Für jeden genehmigungspflichtigen fliegenden Bau ist ein Prüfbuch<br />
anzulegen. 2 Wird die Aufstellung oder der Gebrauch des fliegenden Baus<br />
wegen Mängeln untersagt, die eine Versagung der<br />
Ausführungsgenehmigung rechtfertigen würden, ist das Prüfbuch<br />
einzuziehen und der für die Ausführungsgenehmigung zuständigen<br />
Behörde oder Stelle zuzuleiten. 3 In das Prüfbuch sind einzutragen<br />
1. die Erteilung der Ausführungsgenehmigung und deren Verlängerungen<br />
unter Beifügung einer mit einem Genehmigungsvermerk versehenen<br />
Ausfertigung der Bauvorlagen,<br />
2. die Übertragung des fliegenden Baus an Dritte,<br />
3. die Änderung der für die Ausführungsgenehmigung zuständigen<br />
Behörde oder Stelle,<br />
4. Durchführung und Ergebnisse bauaufsichtlicher Überprüfungen und<br />
Abnahmen,<br />
5. die Einziehung des Prüfbuchs nach Satz 2.<br />
4<br />
Umstände, die zu Eintragungen nach Nrn. 2 und 3 führen, hat der
Inhaber der Ausführungsgenehmigung der dafür zuletzt zuständigen<br />
Behörde oder Stelle unverzüglich anzuzeigen.<br />
(5) 1 Die beabsichtigte Aufstellung genehmigungspflichtiger fliegender Bauten<br />
ist der Bauaufsichtsbehörde mindestens eine Woche zuvor unter Vorlage<br />
des Prüfbuchs anzuzeigen, es sei denn, dass dies nach der<br />
Ausführungsgenehmigung nicht erforderlich ist. 2 Genehmigungsbedürftige<br />
fliegende Bauten dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn<br />
1. sie von der Bauaufsichtsbehörde abgenommen worden sind<br />
(Gebrauchsabnahme), es sei denn, dass dies nach der<br />
Ausführungsgenehmigung nicht erforderlich ist oder die<br />
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall darauf verzichtet, und<br />
2. in der Ausführungsgenehmigung vorgeschriebene Abnahmen durch<br />
Sachverständige nach Abs. 2 Satz 3 vorgenommen worden sind.<br />
(6) 1 Auf fliegende Bauten, die der Landesverteidigung oder dem<br />
Katastrophenschutz dienen, finden die Abs. 1 bis 5 und Art. 73 keine<br />
Anwendung. 2 Sie bedürfen auch keiner Baugenehmigung.<br />
Bay BO Art. 73 Bauaufsichtliche Zustimmung<br />
(1) 1 Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Baugenehmigung,<br />
Genehmigungsfreistellung, Anzeige und Bauüberwachung (Art. 57 Abs. 5,<br />
Art. 58, 68, 77 und 78), wenn<br />
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung einer<br />
Baudienststelle des Bundes, eines Landes oder eines Bezirks übertragen<br />
sind und<br />
2. die Baudienststelle mindestens mit einem Bediensteten mit der<br />
Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit<br />
sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend besetzt<br />
ist. 2 Solche Bauvorhaben bedürfen der Zustimmung der Regierung<br />
(Zustimmungsverfahren). 3 Die Zustimmung der Regierung entfällt, wenn<br />
die Gemeinde nicht widerspricht und die Nachbarn dem Bauvorhaben<br />
zustimmen. 4 Keiner Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung oder<br />
Zustimmung bedürfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1<br />
Baumaßnahmen in oder an bestehenden Gebäuden, soweit sie nicht zur<br />
Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer der Genehmigungspflicht<br />
unterliegenden Nutzungsänderung führen.<br />
(2) 1 Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Regierung einzureichen. 2 Die<br />
Regierung prüft<br />
1. die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den Vorschriften über die<br />
Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB und den<br />
Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 sowie<br />
2. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der<br />
Zustimmung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird.<br />
3<br />
Die Regierung entscheidet über Abweichungen von den nach Satz 2 zu<br />
prüfenden sowie sonstigen Vorschriften, soweit sie drittschützend sind;<br />
darüber hinaus bedarf die Zulässigkeit von Ausnahmen, Befreiungen und<br />
Abweichungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung. 4 Die Gemeinde ist<br />
vor Erteilung der Zustimmung zu hören; § 36 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1
BauGB gilt entsprechend. 5 Im Übrigen sind die Vorschriften über das<br />
Genehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.<br />
(3) 1 Die Baudienststelle trägt die Verantwortung dafür, dass die Errichtung,<br />
die Änderung, die Nutzungsänderung und die Beseitigung baulicher<br />
Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen; die<br />
Verantwortung für die Unterhaltung baulicher Anlagen trägt die<br />
Baudienststelle nur, wenn und solang sie der für die Anlage<br />
Verantwortliche ausschließlich ihr überträgt. 2 Die Baudienststelle kann<br />
Sachverständige in entsprechender Anwendung der Art. 62 Abs. 3 und<br />
Art. 77 Abs. 2 sowie der auf Grund des Art. 80 Abs. 2 erlassenen<br />
Rechtsverordnung heranziehen. 3 Die Verantwortung des Unternehmers<br />
(Art. 52) bleibt unberührt.<br />
(4) 1 Bauvorhaben, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der<br />
Bundespolizei oder dem Zivilschutz dienen, sind vor Baubeginn mit<br />
Bauvorlagen in dem erforderlichen Umfang der Regierung zur Kenntnis zu<br />
bringen. 2 Im Übrigen wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht mit.<br />
(5) 1 Für nicht verfahrensfreie Bauvorhaben der Landkreise und Gemeinden<br />
gelten die Abs. 1 Sätze 2 bis 4 sowie die Abs. 2 und 3 entsprechend,<br />
soweit der Landkreis oder die Gemeinde mindestens mit einem<br />
Bediensteten mit der Befähigung zum höheren bautechnischen<br />
Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend<br />
besetzt ist und diesen Bediensteten die Leitung der Entwurfsarbeiten und<br />
die Bauüberwachung übertragen sind. 2 An Stelle der Regierung ist die<br />
untere Bauaufsichtsbehörde zuständig.<br />
Abschnitt IV Bauaufsichtliche Maßnahmen<br />
Bay BO Art. 74 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte<br />
Sind Bauprodukte entgegen Art. 20 mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, kann<br />
die Bauaufsichtsbehörde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und<br />
deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.<br />
Bay BO Art. 75 Einstellung von Arbeiten<br />
(1) 1 Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften<br />
errichtet, geändert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehörde die<br />
Einstellung der Arbeiten anordnen. 2 Das gilt auch dann, wenn<br />
1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des Art. 68<br />
Abs. 5 begonnen wurde oder<br />
2. bei der Ausführung<br />
a) eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von den genehmigten<br />
Bauvorlagen,<br />
b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten<br />
Unterlagen<br />
abgewichen wird,<br />
3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen Art. 15 Abs. 1 keine CE-<br />
Kennzeichnung oder kein Ü-Zeichen tragen,<br />
4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-
Kennzeichnung (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem Ü-Zeichen (Art. 20<br />
Abs. 4) gekennzeichnet sind.<br />
(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer schriftlich oder mündlich<br />
verfügten Einstellung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehörde die<br />
Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte,<br />
Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.<br />
Bay BO Art. 76 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung<br />
1 Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften<br />
errichtet oder geändert, so kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder<br />
vollständige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise<br />
rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. 2 Werden Anlagen im<br />
Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, so kann diese<br />
Nutzung untersagt werden. 3 Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass<br />
ein Bauantrag gestellt wird.<br />
Abschnitt V Bauüberwachung<br />
Bay BO Art. 77 Bauüberwachung<br />
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der<br />
Pflichten der am Bau Beteiligten überprüfen.<br />
(2) 1 Die Bauaufsichtsbehörde sowie nach Maßgabe der Rechtsverordnung<br />
gemäß Art. 80 Abs. 2 der Prüfingenieur, das Prüfamt oder der<br />
Prüfsachverständige überwachen die Bauausführung bei baulichen Anlagen<br />
1. nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1 hinsichtlich des von ihr oder ihm geprüften<br />
oder bescheinigten <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweises,<br />
2. nach Art. 62 Abs. 3 Satz 3 hinsichtlich des von ihr oder ihm geprüften<br />
oder bescheinigten Brandschutznachweises.<br />
2<br />
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie<br />
Mittel- und Großgaragen im Sinn der Verordnung nach Art. 80 Abs. 1<br />
Satz 1 Nr. 3, ist die mit dem Brandschutznachweis übereinstimmende<br />
Bauausführung vom Nachweisersteller oder einem anderen<br />
Nachweisberechtigten im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 2 zu bestätigen.<br />
3<br />
Wird die Bauausführung durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt<br />
oder nach Satz 2 bestätigt, gelten insoweit die jeweiligen<br />
bauaufsichtlichen Anforderungen als eingehalten.<br />
(3) 1 Bei Bauvorhaben im Sinn des Art. 62 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ist der Ersteller<br />
des <strong>Stand</strong>sicherheitsnachweises nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 auch für die<br />
Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen an die <strong>Stand</strong>sicherheit bei<br />
der Bauausführung verantwortlich; benennt der Bauherr der<br />
Bauaufsichtsbehörde einen anderen Tragwerksplaner im Sinn des Art. 62<br />
Abs. 2 Satz 1, ist dieser verantwortlich. 2 Ein verantwortlicher<br />
Tragwerksplaner im Sinn des Satzes 1 ist nicht erforderlich bei land- oder<br />
forstwirtschaftlichen Betriebsgebäuden und gewerblichen Lagergebäuden<br />
mit freien Stützweiten von nicht mehr als 12 m und<br />
1. nicht mehr als 500 m 2 oder<br />
2. nicht mehr als 1 600 m 2 , wenn sie statisch einfach sind.
(4) Im Rahmen der Bauüberwachung können Proben von Bauprodukten,<br />
soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Prüfzwecken<br />
entnommen werden.<br />
(5) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jederzeit Einblick in die<br />
Genehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse,<br />
Übereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die<br />
Prüfungen von Bauprodukten, in die Bautagebücher und andere<br />
vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewähren.<br />
Bay BO Art. 78 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung<br />
(1) 1 Die Bauaufsichtsbehörde, der Prüfingenieur, das Prüfamt oder der<br />
Prüfsachverständige kann verlangen, dass ihm Beginn und Beendigung<br />
bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. 2 Die Bauarbeiten dürfen erst<br />
fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsichtsbehörde, der Prüfingenieur, das<br />
Prüfamt oder der Prüfsachverständige der Fortführung der Bauarbeiten<br />
zugestimmt hat.<br />
(2) 1 Der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht<br />
verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der<br />
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 2 Mit der Anzeige nach Satz 1 sind<br />
vorzulegen<br />
1. bei Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1 eine Bescheinigung des<br />
Prüfsachverständigen über die ordnungsgemäße Bauausführung<br />
hinsichtlich der <strong>Stand</strong>sicherheit,<br />
2. bei Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3 Satz 3 eine Bescheinigung des<br />
Prüfsachverständigen über die ordnungsgemäße Bauausführung<br />
hinsichtlich des Brandschutzes (Art. 77 Abs. 2 Satz 1), soweit kein Fall des<br />
Art. 62 Abs. 3 Satz 3 zweite Alternative vorliegt.<br />
3. in den Fällen des Art. 77 Abs. 2 Satz 2 die jeweilige Bestätigung.<br />
3<br />
Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst,<br />
Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- sowie<br />
Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar<br />
sind, nicht jedoch vor dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt.<br />
(3) Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der<br />
Bezirkskaminkehrermeister die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit<br />
der Abgasanlagen bescheinigt hat; ortsfeste Verbrennungsmotoren und<br />
Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn<br />
er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abführung<br />
von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.<br />
Sechster Teil Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften<br />
Bay BO Art. 79 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) 1 Mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro kann belegt werden, wer<br />
vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. einem Gebot oder Verbot einer Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1<br />
bis 4 oder einer Satzung nach Art. 81 Abs. 1 oder einer vollziehbaren<br />
Anordnung der Bauaufsichtsbehörde auf Grund einer solchen<br />
Rechtsverordnung oder Satzung zuwiderhandelt, sofern die<br />
Rechtsverordnung oder die Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist,<br />
2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehörde<br />
auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s zuwiderhandelt,<br />
3. entgegen Art. 9 Abs. 1 eine Baustelle nicht ordnungsgemäß einrichtet,<br />
entgegen Art. 9 Abs. 2 Verkehrsflächen, Versorgungs-,<br />
Abwasserbeseitigungs- oder Meldeanlagen, Grundwassermessstellen,<br />
Vermessungszeichen, Abmarkungszeichen oder Grenzzeichen nicht schützt<br />
oder zugänglich hält oder entgegen Art. 9 Abs. 3 ein Schild nicht oder<br />
nicht ordnungsgemäß anbringt,<br />
4. Bauprodukte entgegen Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 ohne Ü-Zeichen verwendet,<br />
5. entgegen Art. 19 Abs. 1 Sätze 1 und 2, auch in Verbindung mit einer<br />
Rechtsverordnung nach Art. 19 Abs. 2, Bauarten anwendet,<br />
6. entgegen Art. 20 Abs. 5 ein Ü-Zeichen nicht oder nicht ordnungsgemäß<br />
anbringt,<br />
7. als Verfügungsberechtigter entgegen Art. 5 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2<br />
Zu- oder Durchfahrten, Aufstellflächen oder Bewegungsflächen nicht frei<br />
hält,<br />
8. entgegen Art. 55 Abs. 1, Art. 63 Abs. 1 Satz 1 oder Art. 70 bauliche<br />
Anlagen errichtet, ändert oder benutzt oder entgegen Art. 57 Abs. 5<br />
Satz 2 eine Beseitigung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,<br />
9. entgegen Art. 58 Abs. 3 Sätze 3 und 4, auch in Verbindung mit Satz 5,<br />
mit der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt,<br />
10. entgegen Art. 72 Abs. 2 Satz 1 fliegende Bauten aufstellt oder einer<br />
nach Art. 72 Abs. 2 Satz 3 mit einer Ausführungsgenehmigung<br />
verbundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt oder entgegen Art. 72<br />
Abs. 5 Satz 1 die Aufstellung eines fliegenden Baus nicht oder nicht<br />
rechtzeitig anzeigt oder entgegen Art. 72 Abs. 5 Satz 2 einen fliegenden<br />
Bau in Gebrauch nimmt,<br />
11. entgegen Art. 68 Abs. 5, auch in Verbindung mit Art. 57 Abs. 5 Satz 6,<br />
mit der Bauausführung, der Ausführung eines Bauabschnitts oder der<br />
Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen Art. 78 Abs. 1 Bauarbeiten<br />
fortsetzt, entgegen Art. 78 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 die<br />
Aufnahme der Nutzung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht richtig anzeigt<br />
oder entgegen Art. 78 Abs. 3 Feuerstätten, Verbrennungsmotoren oder<br />
Blockheizkraftwerke in Betrieb nimmt,<br />
12. entgegen Art. 68 Abs. 7 den Ausführungsbeginn oder die<br />
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt,<br />
13. entgegen Art. 50 Abs. 1 Satz 1 keine geeigneten Beteiligten bestellt<br />
oder entgegen Art. 50 Abs. 1 Satz 3 eine Mitteilung nicht oder nicht<br />
rechtzeitig erstattet oder entgegen Art. 52 Abs. 1 Satz 2 einen Nachweis<br />
nicht erbringt oder nicht bereithält.<br />
2<br />
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nrn. 9 bis 11 begangen worden,<br />
können Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht,<br />
eingezogen werden; § 23 des <strong>Gesetze</strong>s über Ordnungswidrigkeiten<br />
(OWiG) ist anzuwenden.<br />
(2) Mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro belegt werden kann<br />
ferner, wer<br />
1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen<br />
vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu<br />
erwirken oder zu verhindern,
2. vorsätzlich unrichtige Angaben in dem Kriterienkatalog nach Art. 62<br />
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 macht,<br />
3. ohne dazu berechtigt zu sein, bautechnische Nachweise im Sinn des<br />
Art. 57 Abs. 5 Satz 3, des Art. 62 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 oder des<br />
Art. 78 Abs. 2 Satz 2 erstellt, bescheinigt oder bestätigt,<br />
4. als Prüfsachverständiger unrichtige Bescheinigungen über die<br />
Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen ausstellt.<br />
Bay BO Art. 80 Rechtsverordnungen<br />
(1) 1 Zur Verwirklichung der in Art. 3 Abs. 1 bezeichneten Anforderungen wird<br />
das Staatsministerium des Innern ermächtigt, durch Rechtsverordnung<br />
Vorschriften zu erlassen über<br />
1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der Art. 4 bis 46,<br />
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (Art. 40),<br />
3. Anforderungen an Garagen (Art. 2 Abs. 8),<br />
4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der<br />
besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlagen für Errichtung,<br />
Änderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben (Art. 2 Abs. 4),<br />
sowie über die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende<br />
bauliche Anlagen dieser Art,<br />
5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung von Anlagen, die zur Verhütung<br />
erheblicher Gefahren oder Nachteile ständig ordnungsgemäß unterhalten<br />
werden müssen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht auf<br />
bestehende Anlagen,<br />
6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch<br />
schwieriger baulicher Anlagen und Einrichtungen wie Bühnenbetriebe und<br />
technisch schwierige fliegende Bauten einschließlich des Nachweises der<br />
Befähigung dieser Personen.<br />
2<br />
In diesen Rechtsverordnungen kann wegen der technischen<br />
Anforderungen auf Bekanntmachungen besonders sachverständiger<br />
Stellen mit Angabe der Fundstelle verwiesen werden.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über<br />
1. Prüfingenieure und Prüfämter, denen bauaufsichtliche Prüfaufgaben<br />
einschließlich der Bauüberwachung und der Bauzustandsbesichtigung<br />
übertragen werden, sowie<br />
2. Prüfsachverständige, die im Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen<br />
nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung<br />
bauordnungsrechtlicher Anforderungen prüfen und bescheinigen.<br />
2<br />
Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,<br />
1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prüfingenieure,<br />
Prüfämter und Prüfsachverständige tätig werden,<br />
2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,<br />
3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung einschließlich der<br />
Festlegung einer Altersgrenze,<br />
4. die Aufgabenerledigung,<br />
5. die Vergütung.<br />
3<br />
Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung ferner<br />
1. den Leitern und stellvertretenden Leitern von Prüfämtern die Stellung<br />
eines Prüfsachverständigen nach Satz 1 Nr. 2 zuweisen,
2. soweit für bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen<br />
Prüfsachverständige nach Satz 1 Nr. 2 noch nicht in ausreichendem<br />
Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die von solchen<br />
Prüfsachverständigen zu prüfenden und zu bescheinigenden<br />
bauordnungsrechtlichen Anforderungen bauaufsichtlich geprüft werden<br />
können,<br />
3. soweit Tragwerksplaner nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 oder<br />
Brandschutzplaner nach Art. 62 Abs. 2 Satz 3 noch nicht in ausreichendem<br />
Umfang eingetragen sind, anordnen, dass die <strong>Stand</strong>sicherheits- oder<br />
Brandschutznachweise bauaufsichtlich geprüft werden und die<br />
Bauausführung bauaufsichtlich überwacht wird.<br />
(3) 1 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung Vorschriften für eine Zusatzqualifikation im Sinn des<br />
Art. 62 Abs. 2 Satz 1 zu erlassen, die bezogen auf die Bauvorhaben nach<br />
Art. 61 Abs. 3 Satz 1 ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten<br />
hinsichtlich <strong>Stand</strong>sicherheit, Schall-, Wärme- und baulichen Brandschutz<br />
sicherstellen. 2 Dabei können insbesondere geregelt werden<br />
1. die Notwendigkeit einer staatlichen Anerkennung, die die erfolgreiche<br />
Ablegung der Prüfung voraussetzt,<br />
2. die Voraussetzungen, die Inhalte und das Verfahren für diese Prüfung,<br />
3. das Verfahren sowie die Voraussetzungen der Anerkennung, ihren<br />
Widerruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen,<br />
4. Weiter- und Fortbildungserfordernisse sowie<br />
5. die Maßnahmen bei Pflichtverletzungen.<br />
(4) 1 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über<br />
1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich<br />
der Vorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen<br />
nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach<br />
Art. 58,<br />
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und<br />
Bestätigungen, auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben,<br />
3. das Verfahren im Einzelnen.<br />
2<br />
Es kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche<br />
Anforderungen und Verfahren festlegen.<br />
(5) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung<br />
1. die Zuständigkeit für die Zustimmung und den Verzicht auf<br />
Zustimmung im Einzelfall (Art. 18) auf ihm unmittelbar nachgeordnete<br />
Behörden zu übertragen,<br />
2. die Zuständigkeit für die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und<br />
Überwachungsstellen (Art. 23 Abs. 1 und 3) auf das Deutsche Institut für<br />
Bautechnik zu übertragen,<br />
3. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusätzliche Angaben<br />
zu verlangen,<br />
4. das Anerkennungsverfahren nach Art. 23 Abs. 1, die Voraussetzungen<br />
für die Anerkennung, ihre Rücknahme, ihren Widerruf und ihr Erlöschen zu<br />
regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine<br />
ausreichende Haftpflichtversicherung zu fordern,
5. zu bestimmen, dass Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten<br />
nur durch bestimmte Bauaufsichtsbehörden oder durch von ihm<br />
bestimmte Stellen erteilt werden, und die Vergütung dieser Stellen regeln.<br />
(6) 1 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Anforderungen der auf Grund<br />
des § 14 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) und des<br />
§ 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen<br />
Rechtsverordnungen entsprechend für Anlagen gelten, die weder<br />
gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren<br />
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. 2 Es kann<br />
auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar<br />
erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und<br />
Gebühren regeln. 3 Dabei kann es auch vorschreiben, dass danach zu<br />
erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung einschließlich der zugehörigen<br />
Abweichungen einschließen und dass § 15 Abs. 2 GPSG insoweit<br />
Anwendung findet.<br />
(7) 1 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung die zuständigen Behörden zur Durchführung<br />
1. des Baugesetzbuchs,<br />
2. des § 6 b Abs. 9 des Einkommensteuergesetzes,<br />
3. des Bauproduktengesetzes<br />
in den jeweils geltenden Fassungen zu bestimmen, soweit nicht durch<br />
Bundesgesetz oder Landesgesetz etwas anderes vorgeschrieben ist. 2 Die<br />
Zuständigkeit zur Durchführung des Bauproduktengesetzes kann auch auf<br />
das Deutsche Institut für Bautechnik übertragen werden.<br />
Bay BO Art. 81 Örtliche Bauvorschriften<br />
(1) Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen Wirkungskreis örtliche<br />
Bauvorschriften erlassen<br />
1. über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher<br />
Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern,<br />
2. über das Verbot der Errichtung von Werbeanlagen aus<br />
ortsgestalterischen Gründen,<br />
3. über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung<br />
von Kinderspielplätzen (Art. 7 Abs. 2),<br />
4. über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge<br />
und der Abstellplätze für Fahrräder, einschließlich des Mehrbedarfs bei<br />
Änderungen und Nutzungsänderungen der Anlagen sowie die Ablösung der<br />
Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art der<br />
Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann,<br />
5. über die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter und der<br />
unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie über die<br />
Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen; dabei kann<br />
bestimmt werden, dass Vorgärten nicht als Arbeitsflächen oder<br />
Lagerflächen benutzt werden dürfen,<br />
6. über von Art. 6 abweichende Maße der Abstandsflächentiefe, soweit<br />
dies zur Gestaltung des Ortsbildes oder zur Verwirklichung der<br />
Festsetzungen einer städtebaulichen Satzung erforderlich ist oder der<br />
Verbesserung der Wohnqualität dient und eine ausreichende Belichtung
sowie der Brandschutz gewährleistet sind,<br />
7. in Gebieten, in denen es für das Straßen- und Ortsbild oder für den<br />
Lärmschutz oder die Luftreinhaltung bedeutsam oder erforderlich ist,<br />
darüber, dass auf den nicht überbaubaren Flächen der bebauten<br />
Grundstücke Bäume nicht beseitigt oder beschädigt werden dürfen, und<br />
dass die Flächen nicht unterbaut werden dürfen.<br />
(2) 1 Örtliche Bauvorschriften können auch durch Bebauungsplan oder, soweit<br />
das Baugesetzbuch dies vorsieht, durch andere Satzungen nach den<br />
Vorschriften des Baugesetzbuchs erlassen werden. 2 In diesen Fällen sind,<br />
soweit das Baugesetzbuch kein abweichendes Verfahren regelt, die<br />
Vorschriften des Ersten und des Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des<br />
Ersten Abschnitts des Zweiten Teils des Ersten Kapitels, die §§ 30, 31, 33,<br />
36, 214 und 215 BauGB entsprechend anzuwenden.<br />
(3) 1 Anforderungen nach den Abs. 1 und 2 können in der Satzung auch<br />
zeichnerisch gestellt werden. 2 Die zeichnerischen Darstellungen können<br />
auch dadurch bekannt gemacht werden, dass sie bei der erlassenden<br />
Behörde zur Einsicht ausgelegt werden. 3 Hierauf ist in der Satzung<br />
hinzuweisen.<br />
Siebter Teil Ausführungsbestimmungen zum Baugesetzbuch<br />
Bay BO Art. 82 Frist zur Nutzungsänderung ehemaliger<br />
landwirtschaftlicher Gebäude<br />
Die Frist nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c BauGB ist nicht anzuwenden.<br />
Achter Teil Übergangs- und Schlussvorschriften<br />
Bay BO Art. 83 Übergangsvorschriften<br />
(1) Auf Baugenehmigungsverfahren, die nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 in der bis<br />
zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung eingeleitet wurden, sind die<br />
Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden<br />
Fassung anzuwenden, wenn der Bauherr nicht gegenüber der Gemeinde<br />
oder gegenüber der Bauaufsichtsbehörde erklärt, dass die Vorschriften<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung Anwendung<br />
finden sollen.<br />
(2) Auf Bauvorhaben, für die der Bauherr bis zum 31. Dezember 2007 die<br />
erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde eingereicht hat, ist Art. 64 in<br />
der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung anzuwenden.<br />
(3) Als Tragwerksplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 in der<br />
ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung gelten die im Sinn des Art. 68<br />
Abs. 7 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung<br />
Nachweisberechtigten.<br />
(4) Als Brandschutzplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 3 in der ab<br />
1. Januar 2008 geltenden Fassung gelten die im Sinn des Art. 68 Abs. 7<br />
Satz 3 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung<br />
Nachweisberechtigten sowie die auf der Grundlage der Verordnung nach<br />
Art. 90 Abs. 9 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung<br />
anerkannten verantwortlichen Sachverständigen für vorbeugenden<br />
Brandschutz.
(5) Auf Baugenehmigungsverfahren, die bis zum 31. Dezember 2007<br />
eingeleitet wurden, findet Art. 73 Abs. 5 in der ab 1. Januar 2008<br />
geltenden Fassung Anwendung, wenn der Landkreis oder die Gemeinde<br />
dies gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich beantragt.<br />
(6) Art. 53 Abs. 1 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden<br />
Fassung findet keine Anwendung im Geltungsbereich von Satzungen, die<br />
auf Grund von Art. 91 Abs. 2 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 2007<br />
geltenden Fassung erlassen worden sind.<br />
(7) Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses<br />
auf <strong>Landesrecht</strong> verweist, gilt insoweit Art. 2 Abs. 5 in der bis zum<br />
31. Dezember 2007 geltenden Fassung fort.<br />
Bay BO Art. 84 Inkrafttreten<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der ursprünglichen<br />
Fassung vom 1. August 1962 (GVBl S. 179, ber. S. 250). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der<br />
späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1962 in Kraft. 2 Die Vorschriften über die<br />
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und von örtlichen<br />
Bauvorschriften treten jedoch bereits am 1. August 1962 in Kraft.
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der<br />
Denkmäler (Bay DSchG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 12. April 1994 (GVBl. S. 210), vom 23. Juli 1994 (GVBl. S. 622), vom<br />
16. Dezember 1999 (GVBl. S. 521), vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 532), vom 24. April 2001<br />
(GVBl. S. 140), vom 9. Juli 2003 (GVBl. S. 419), vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 475), vom 20.<br />
Dezember 2007 (GVBl. S. 958), vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 385)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
I. Anwendungsbereich<br />
Art. 1 Begriffsbestimmungen<br />
Art. 2 Denkmalliste<br />
Art. 3 Geltung<br />
II. Baudenkmäler<br />
Art. 4 Erhaltung von Baudenkmälern<br />
Art. 5 Nutzung von Baudenkmälern<br />
Art. 6 Maßnahmen an Baudenkmälern<br />
III. Bodendenkmäler<br />
Art. 7 Ausgraben von Bodendenkmälern<br />
Art. 8 Auffinden von Bodendenkmälern<br />
Art. 9 Auswertung von Funden<br />
IV. Eingetragene bewegliche Denkmäler<br />
Art. 10 Erlaubnispflicht<br />
V. Verfahrensbestimmungen<br />
Art. 11 Denkmalschutzbehörden<br />
Art. 12 Landesamt für Denkmalpflege<br />
Art. 13 Heimatpfleger<br />
Art. 14 Landesdenkmalrat<br />
Art. 15 Erlaubnisverfahren und Wiederherstellung
Art. 16 Betretungs- und Auskunftsrecht<br />
Art. 17 Kostenfreiheit<br />
VI. Enteignung<br />
Art. 18 Zulässigkeit der Enteignung<br />
Art. 19 Vorkaufsrecht<br />
Art. 20 Enteignende Maßnahmen<br />
Art. 21 Tragung des Entschädigungsaufwands<br />
VII. Finanzierung<br />
Art. 22 Leistungen<br />
VIII. Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 23<br />
IX. Allgemeine Bestimmungen und Schlußbestimmungen<br />
Art. 24 Grundrechtseinschränkung<br />
Art. 25 Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke<br />
Art. 26 Kirchliche Denkmäler<br />
Art. 27<br />
Art. 28 Inkrafttreten<br />
I. Anwendungsbereich<br />
Bay DSchG Art. 1 Begriffsbestimmungen<br />
(1) Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus<br />
vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen,<br />
künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen<br />
Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.<br />
(2) 1 Baudenkmäler sind bauliche Anlagen oder Teile davon aus vergangener<br />
Zeit, soweit sie nicht unter Absatz 4 fallen, einschließlich dafür bestimmter<br />
historischer Ausstattungsstücke und mit der in Absatz 1 bezeichneten<br />
Bedeutung. 2 Auch bewegliche Sachen können historische<br />
Ausstattungsstücke sein, wenn sie integrale Bestandteile einer<br />
historischen Raumkonzeption oder einer ihr gleichzusetzenden historisch<br />
abgeschlossenen Neuausstattung oder Umgestaltung sind.
3 Gartenanlagen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, gelten<br />
als Baudenkmäler.<br />
(3) Zu den Baudenkmälern kann auch eine Mehrheit von baulichen Anlagen<br />
(Ensemble) gehören, und zwar auch dann, wenn nicht jede einzelne<br />
dazugehörige bauliche Anlage die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt,<br />
das Orts-, Platz- oder Straßenbild aber insgesamt erhaltenswürdig ist.<br />
(4) Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich<br />
im Boden befinden oder befanden und in der Regel aus vor- oder<br />
frühgeschichtlicher Zeit stammen.<br />
Bay DSchG Art. 2 Denkmalliste<br />
(1) 1 Die Baudenkmäler und die Bodendenkmäler sollen nachrichtlich in ein<br />
Verzeichnis (Denkmalliste) aufgenommen werden. 2 Die Eintragung erfolgt<br />
durch das Landesamt für Denkmalpflege von Amts wegen im Benehmen<br />
mit der Gemeinde. 3 Der Berechtigte und der zuständige Heimatpfleger<br />
können die Eintragung anregen. 4 Die Eintragung ist im Bebauungsplan<br />
kenntlich zu machen. 5 Die Liste kann von jedermann eingesehen werden.<br />
(2) Auf Antrag des Berechtigten und in besonders wichtigen Fällen können<br />
bewegliche Denkmäler, soweit sie nicht nach Absatz 1 eingetragen sind, in<br />
das Verzeichnis eingetragen werden.<br />
Bay DSchG Art. 3 Geltung<br />
(1) Die Schutzbestimmungen dieses <strong>Gesetze</strong>s gelten für Baudenkmäler, für<br />
Bodendenkmäler und für die eingetragenen beweglichen Denkmäler.<br />
(2) Die Gemeinden nehmen bei ihrer Tätigkeit, vor allem im Rahmen der<br />
Bauleitplanung, auf die Belange des Denkmalschutzes und der<br />
Denkmalpflege, insbesondere auf die Erhaltung von Ensembles,<br />
angemessen Rücksicht.<br />
II. Baudenkmäler<br />
Bay DSchG Art. 4 Erhaltung von Baudenkmälern<br />
(1) 1 Die Eigentümer und die sonst dinglich Verfügungsberechtigten von<br />
Baudenkmälern haben ihre Baudenkmäler instandzuhalten,<br />
instandzusetzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu<br />
schützen, soweit ihnen das zuzumuten ist. 2 Ist der Eigentümer oder der<br />
sonst dinglich Verfügungsberechtigte nicht der unmittelbare Besitzer, so<br />
gilt Satz 1 auch für den unmittelbaren Besitzer, soweit dieser die<br />
Möglichkeit hat, entsprechend zu verfahren.<br />
(2) 1 Die in Absatz 1 genannten Personen können verpflichtet werden,<br />
bestimmte Erhaltungsmaßnahmen ganz oder zum Teil durchzuführen,<br />
soweit ihnen das insbesondere unter Berücksichtigung ihrer sonstigen<br />
Aufgaben und Verpflichtungen zumutbar ist; soweit sie die Maßnahmen<br />
nicht selbst durchzuführen haben, können sie zur Duldung der<br />
Maßnahmen verpflichtet werden. 2 Entscheidungen, durch die der Bund<br />
oder die Länder verpflichtet werden sollen, bedürfen der vorherigen<br />
Zustimmung der Obersten Denkmalschutzbehörde.
(3) 1 Macht der Zustand eines Baudenkmals Maßnahmen zu seiner<br />
Instandhaltung, Instandsetzung oder zu seinem Schutz erforderlich, ohne<br />
daß eine vollstreckbare Entscheidung nach Absatz 2 vorliegt, so kann die<br />
zuständige Denkmalschutzbehörde die Maßnahmen durchführen oder<br />
durchführen lassen. 2 Die dinglich und obligatorisch Berechtigten können<br />
zur Duldung der Maßnahmen verpflichtet werden. 3 Die Kosten der<br />
Maßnahmen tragen die in Absatz 1 genannten Personen, soweit sie nach<br />
Absatz 2 zur Durchführung der Maßnahmen verpflichtet wurden oder<br />
hätten verpflichtet werden können, im übrigen der Entschädigungsfonds<br />
(Art. 21 Abs. 2).<br />
(4) Handlungen, die ein Baudenkmal schädigen oder gefährden, können<br />
untersagt werden.<br />
Bay DSchG Art. 5 Nutzung von Baudenkmälern<br />
1 Baudenkmäler sollen möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen<br />
Zweckbestimmung genutzt werden. 2 Werden Baudenkmäler nicht mehr<br />
entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung genutzt, so sollen die<br />
Eigentümer und die sonst dinglich oder obligatorisch zur Nutzung Berechtigten<br />
eine der ursprünglichen gleiche oder gleichwertige Nutzung anstreben. 3 Soweit<br />
dies nicht möglich ist, soll eine Nutzung gewählt werden, die eine möglichst<br />
weitgehende Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet. 4 Sind<br />
verschiedene Nutzungen möglich, so soll diejenige Nutzung gewählt werden,<br />
die das Baudenkmal und sein Zubehör am wenigsten beeinträchtigt. 5 Staat,<br />
Gemeinden und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sollen<br />
Eigentümer und Besitzer unterstützen. 6 Die Eigentümer und die sonst dinglich<br />
oder obligatorisch zur Nutzung Berechtigten können bei Vorliegen der<br />
Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 2 verpflichtet werden, eine bestimmte<br />
Nutzungsart durchzuführen; soweit sie nicht zur Durchführung verpflichtet<br />
werden, können sie zur Duldung einer bestimmten Nutzungsart verpflichtet<br />
werden.<br />
Bay DSchG Art. 6 Maßnahmen an Baudenkmälern<br />
(1) 1 Wer<br />
1. Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort<br />
verbringen oder<br />
2. geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern, an einen anderen<br />
Ort verbringen oder aus einem Baudenkmal entfernen<br />
will, bedarf der Erlaubnis. 2 Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der Nähe<br />
von Baudenkmälern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will,<br />
wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler<br />
auswirken kann. 3 Wer ein Ensemble verändern will, bedarf der Erlaubnis<br />
nur, wenn die Veränderung eine bauliche Anlage betrifft, die für sich<br />
genommen ein Baudenkmal ist, oder wenn sie sich auf das<br />
Erscheinungsbild des Ensembles auswirken kann.<br />
(2) 1 Die Erlaubnis kann im Fall des Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 versagt<br />
werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die<br />
unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen. 2 Im Fall<br />
des Absatzes 1 Satz 2 kann die Erlaubnis versagt werden, soweit das<br />
Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten
Erscheinungsbilds oder der künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals<br />
führen würde und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die<br />
unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen.<br />
(3) 1 Ist eine Baugenehmigung oder an ihrer Stelle eine bauaufsichtliche<br />
Zustimmung oder abgrabungsaufsichtliche Genehmigung erforderlich,<br />
entfällt die Erlaubnis. 2 Ist in den Fällen des Art. 18 Abs. 2 der Bayerischen<br />
Bauordnung (BayBO) keine Baugenehmigung oder bauaufsichtliche<br />
Zustimmung, jedoch eine durch die Denkmaleigenschaft bedingte<br />
Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO erforderlich, schließt die<br />
Erlaubnis nach diesem Gesetz die Zustimmung im Einzelfall nach Art. 18<br />
Abs. 2 BayBO und die Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO ein.<br />
(4) Bei Entscheidungen nach den Abs. 1 bis 3 sind auch die Belange von<br />
Menschen mit Behinderung und von Menschen mit sonstigen<br />
Mobilitätsbeeinträchtigungen zu berücksichtigen.<br />
III. Bodendenkmäler<br />
Bay DSchG Art. 7 Ausgraben von Bodendenkmälern<br />
(1) 1 Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem<br />
anderen Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl<br />
er weiß oder vermutet oder den Umständen nach annehmen muß, daß<br />
sich dort Bodendenkmäler befinden, bedarf der Erlaubnis. 2 Die Erlaubnis<br />
kann versagt werden, soweit dies zum Schutz eines Bodendenkmals<br />
erforderlich ist.<br />
(2) 1 Die Bezirke können durch Verordnung bestimmte Grundstücke, in oder<br />
auf denen Bodendenkmäler zu vermuten sind, zu Grabungsschutzgebieten<br />
erklären. 2 In einem Grabungsschutzgebiet bedürfen alle Arbeiten, die<br />
Bodendenkmäler gefährden können, der Erlaubnis. 3 Art. 6 Abs. 2 Satz 2<br />
und Abs. 3 gelten entsprechend. 4 Grabungsschutzgebiete sind im<br />
Flächennutzungsplan kenntlich zu machen.<br />
(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 gelten nicht für Grabungen, die vom<br />
Landesamt für Denkmalpflege oder unter seiner Mitwirkung vorgenommen<br />
oder veranlaßt werden.<br />
(4) 1 Wer in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz oder zum Teil über der<br />
Erdoberfläche erkennbar sind, Anlagen errichten, verändern oder<br />
beseitigen will, bedarf der Erlaubnis, wenn sich dies auf Bestand oder<br />
Erscheinungsbild eines dieser Bodendenkmäler auswirken kann. 2 Art. 6<br />
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend.<br />
(5) 1 Soll eine Grabung auf einem fremden Grundstück erfolgen, so kann der<br />
Eigentümer verpflichtet werden, die Grabung zuzulassen, wenn das<br />
Landesamt für Denkmalpflege festgestellt hat, daß ein besonderes<br />
öffentliches Interesse an der Grabung besteht. 2 Der Inhaber der<br />
Grabungsgenehmigung hat den dem Eigentümer entstehenden Schaden<br />
zu ersetzen.<br />
Bay DSchG Art. 8 Auffinden von Bodendenkmälern<br />
(1) 1 Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der<br />
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege
anzuzeigen. 2 Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der<br />
Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der<br />
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 3 Die Anzeige eines der<br />
Verpflichteten befreit die übrigen. 4 Nimmt der Finder an den Arbeiten, die<br />
zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so<br />
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten<br />
befreit.<br />
(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von<br />
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die<br />
Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die<br />
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei Arbeiten, die vom Landesamt für<br />
Denkmalpflege oder unter seiner Mitwirkung vorgenommen oder veranlaßt<br />
werden.<br />
(4) Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer<br />
eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler gefunden werden, können<br />
verpflichtet werden, die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen<br />
Bergung des Fundgegenstands sowie zur Klärung der Fundumstände und<br />
zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler<br />
zu dulden.<br />
(5) Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Denkmalpflege oder<br />
einer Denkmalschutzbehörde unverzüglich zur Aufbewahrung zu<br />
übergeben, wenn die Gefahr ihres Abhandenkommens besteht.<br />
Bay DSchG Art. 9 Auswertung von Funden<br />
Der Eigentümer eines beweglichen Bodendenkmals, die dinglich<br />
Verfügungsberechtigten und die unmittelbaren Besitzer können verpflichtet<br />
werden, dieses dem Landesamt für Denkmalpflege befristet zur<br />
wissenschaftlichen Auswertung und Dokumentation zu überlassen.<br />
IV. Eingetragene bewegliche Denkmäler<br />
Bay DSchG Art. 10 Erlaubnispflicht<br />
(1) 1 Wer ein eingetragenes bewegliches Denkmal beseitigen, verändern oder<br />
an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis. 2 Die Erlaubnis<br />
kann versagt werden, soweit dies zum Schutz des Denkmals erforderlich<br />
ist.<br />
(2) 1 Die Veräußerung eines eingetragenen beweglichen Denkmals ist dem<br />
Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich anzuzeigen. 2 Zur Anzeige sind<br />
der Veräußerer und der Erwerber verpflichtet.<br />
V. Verfahrensbestimmungen<br />
Bay DSchG Art. 11 Denkmalschutzbehörden<br />
(1) 1 Untere Denkmalschutzbehörden sind die Kreisverwaltungsbehörden.<br />
2 Soweit kreisangehörigen Gemeinden die Aufgaben der Unteren<br />
Bauaufsichtsbehörden übertragen sind oder übertragen werden, gilt diese<br />
Übertragung auch für die Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörden.<br />
3 Art. 115 Abs. 2 der Gemeindeordnung gilt entsprechend.
(2) Höhere Denkmalschutzbehörden sind die Regierungen.<br />
(3) Oberste Denkmalschutzbehörde ist das für das Denkmalschutzrecht<br />
zuständige Staatsministerium.<br />
(4) 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Unteren<br />
Denkmalschutzbehörden für den Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s zuständig. 2 In<br />
den Fällen des Art. 73 Abs. 1 BayBO treten die Höheren an die Stelle der<br />
Unteren Denkmalschutzbehörden.<br />
(5) Die Aufgaben der Denkmalschutzbehörden sind Staatsaufgaben; für die<br />
Gemeinden sind sie übertragene Aufgaben.<br />
Bay DSchG Art. 12 Landesamt für Denkmalpflege<br />
(1) 1 Das Landesamt für Denkmalpflege ist die staatliche Fachbehörde für alle<br />
Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. 2 Es ist dem<br />
Staatsministerium unmittelbar nachgeordnet.<br />
(2) 1 Dem Landesamt für Denkmalpflege obliegen die Denkmalpflege und die<br />
Mitwirkung beim Denkmalschutz. 2 Die Denkmalpflege umfasst auch die<br />
Erforschung der Denkmäler, soweit solche Vorhaben mit den sonstigen<br />
Aufgaben des Landesamts für Denkmalpflege in unmittelbarem<br />
Zusammenhang stehen und mit diesen vereinbar sind. 3 Insbesondere hat<br />
es folgende Aufgaben:<br />
1. Mitwirkung beim Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s und anderer einschlägiger<br />
Vorschriften nach Maßgabe der hierzu ergangenen und ergehenden<br />
Bestimmungen;<br />
2. Herausgabe von Richtlinien zur Pflege der Denkmäler unter Beteiligung<br />
der kommunalen Spitzenverbände;<br />
3. Erstellung und Fortführung der Inventare und der Denkmalliste;<br />
4. Konservierung und Restaurierung von Denkmälern, soweit die<br />
Konservierung und die Restaurierung nicht von anderen dafür zuständigen<br />
staatlichen Stellen durchgeführt werden;<br />
5. fachliche Beratung und Erstattung von Gutachten in allen<br />
Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;<br />
6. Überwachung der Ausgrabungen sowie die Überwachung und Erfassung<br />
der anfallenden beweglichen Bodendenkmäler;<br />
7. Fürsorge für Heimatmuseen und ähnliche Sammlungen, soweit diese<br />
nicht vom Staat verwaltet werden.<br />
4<br />
Das Staatsministerium kann dem Landesamt für Denkmalpflege weitere<br />
einschlägige Aufgaben zuweisen.<br />
(3) Die bisherigen Aufgaben der Bayerischen Verwaltung der staatlichen<br />
Schlösser, Gärten und Seen bleiben unberührt.<br />
Bay DSchG Art. 13 Heimatpfleger<br />
(1) 1 Die Heimatpfleger beraten und unterstützen die Denkmalschutzbehörden<br />
und das Landesamt für Denkmalpflege in den Fragen der Denkmalpflege<br />
und des Denkmalschutzes. 2 Ihnen ist durch die Denkmalschutzbehörden<br />
in den ihren Aufgabenbereich betreffenden Fällen rechtzeitig Gelegenheit<br />
zur Äußerung zu geben.
(2) Die Denkmalschutzbehörden und das Landesamt für Denkmalpflege sollen<br />
sich in geeigneten Fällen der Unterstützung kommunaler Stellen sowie<br />
privater Initiativen bedienen.<br />
Bay DSchG Art. 14 Landesdenkmalrat<br />
(1) 1 Der Landesdenkmalrat hat die Aufgabe, die Staatsregierung zu beraten<br />
und in wichtigen Fragen der Denkmalpflege mitzuwirken. 2 Soll eine<br />
Mehrheit von baulichen Anlagen (Ensemble) festgelegt werden, so ist der<br />
Landesdenkmalrat zu beteiligen. 3 Die Mitglieder des Denkmalrats werden<br />
vom Landtag bestellt, die Mitglieder nach Absatz 2 Buchst. b bis l auf<br />
Vorschlag der entsendenden Stelle. 4 Die Bestellung der Mitglieder erfolgt<br />
für die Dauer der jeweiligen Legislaturperiode. 5 Sie sind ehrenamtlich<br />
tätig. 6 Sie wählen einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 7 Das für das<br />
Denkmalschutzrecht zuständige Staatsministerium sowie die<br />
Staatsministerien des Innern (Oberste Baubehörde) und für<br />
Landesentwicklung und Umweltfragen sowie das Landesamt für<br />
Denkmalpflege sind zu allen Beratungen des Landesdenkmalrats<br />
einzuladen.<br />
(2) Der Landesdenkmalrat besteht aus<br />
a) sechs Abgeordneten des Landtags,<br />
b) je einem Vertreter des Bayerischen Gemeindetags, des Bayerischen<br />
Städtetags und des Landkreisverbands Bayern,<br />
c) einem Vertreter des Verband der bayerischen Bezirke e. V.,<br />
d) je zwei Vertretern der Katholischen Kirche und der Evangelisch-<br />
Lutherischen Landeskirche,<br />
e) drei Vertretern der privaten Denkmaleigentümer,<br />
f) einem Vertreter der Bayerischen Akademie der Schönen Künste,<br />
g) je einem Vertreter der Architektenschaft und der Deutschen Akademie<br />
für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Bayern,<br />
h) einem Vertreter des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege,<br />
i) einem Vertreter des Bayerischen Bauernverbands,<br />
j) nicht besetzt<br />
k) zwei vom Staatsministerium vorzuschlagenden sachverständigen<br />
Persönlichkeiten aus dem Gebiet der Kunstgeschichte und der Vor- und<br />
Frühgeschichte,<br />
l) bis zu fünf weiteren vom Staatsministerium vorzuschlagenden<br />
Persönlichkeiten.<br />
(3) Fraktionen des Landtags, auf die im Landesdenkmalrat kein Sitz gemäß<br />
Absatz 2 Buchst. a entfällt, erhalten zusätzlich einen Sitz.<br />
(4) Zu Klärung einzelner Sachfragen kann der Landesdenkmalrat<br />
Sachverständige ohne Stimmrecht als nicht ständige Mitglieder berufen.<br />
(5) Das Staatsministerium wird ermächtigt, Regelungen über die Gliederung,<br />
die Einberufung und die Geschäftsführung des Landesdenkmalrats und die<br />
Berufung seiner Mitglieder sowie über die den Mitgliedern des<br />
Landesdenkmalrats zu gewährende Reisekostenvergütung durch<br />
Rechtsverordnung zu treffen.
Bay DSchG Art. 15 Erlaubnisverfahren und Wiederherstellung<br />
(1) 1 Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach Art. 6, 7 und 10 Abs. 1 und<br />
auf Verpflichtung des Eigentümers nach Art. 7 Abs. 5 ist schriftlich bei der<br />
Gemeinde einzureichen, die ihn mit ihrer Stellungnahme unverzüglich der<br />
Unteren Denkmalschutzbehörde vorlegt. 2 Art. 75 und 76 BayBO gelten in<br />
den Fällen der Art. 6, 7 und 8, Abs. 2 entsprechend.<br />
(2) 1 Die Untere Denkmalschutzbehörde soll vor einer Entscheidung nach den<br />
Abschnitten II bis IV dieses <strong>Gesetze</strong>s das Landesamt für Denkmalpflege<br />
hören. 2 Art. 65 Abs. 1 Satz 3 BayBO gilt entsprechend.<br />
(2 a) Für eine Erlaubnis nach den Abschnitten II bis IV dieses <strong>Gesetze</strong>s gilt<br />
Art. 69 BayBO entsprechend.<br />
(3) Werden Handlungen nach Art. 6, 7, 8 Abs. 2 oder Art. 10 Abs. 1 ohne die<br />
erforderliche Erlaubnis, Baugenehmigung oder abgrabungsaufsichtliche<br />
Genehmigung durchgeführt, so kann die Untere Denkmalschutzbehörde<br />
verlangen, daß der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird, soweit<br />
dies noch möglich ist, oder daß Bau- und Bodendenkmäler und<br />
eingetragene bewegliche Denkmäler auf andere Weise wieder<br />
instandgesetzt werden.<br />
(4) Wer widerrechtlich Bau- oder Bodendenkmäler oder eingetragene<br />
bewegliche Denkmäler vorsätzlich oder grob fahrlässig zerstört oder<br />
beschädigt, ist unabhängig von der Verhängung einer Geldbuße zur<br />
Wiedergutmachung des von ihm angerichteten Schadens bis zu dessen<br />
vollem Umfang verpflichtet.<br />
(5) Die zuständige Behörde kann die Entscheidung über einen Antrag auf<br />
Erlaubnis, Baugenehmigung, baurechtliche Zustimmung oder<br />
abgrabungsaufsichtliche Genehmigung auf höchstens zwei Jahre<br />
aussetzen, soweit dies zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes,<br />
insbesondere für Untersuchungen des Baudenkmals und seiner<br />
Umgebung, erforderlich ist.<br />
Bay DSchG Art. 16 Betretungs- und Auskunftsrecht<br />
(1) Die Denkmalschutzbehörden und das Landesamt für Denkmalpflege sind<br />
berechtigt, im Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s Grundstücke auch gegen den<br />
Willen der Betroffenen zu betreten, soweit das zur Erhaltung eines Bauoder<br />
Bodendenkmals oder eines eingetragenen beweglichen Denkmals<br />
dringend erforderlich erscheint.<br />
(2) Eigentümer und Besitzer von Bau- und Bodendenkmälern und von<br />
eingetragenen beweglichen Denkmälern und sonstige Berechtigte sind<br />
verpflichtet, den Denkmalschutzbehörden und dem Landesamt für<br />
Denkmalpflege alle zum Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlichen Auskünfte<br />
zu erteilen.<br />
Bay DSchG Art. 17 Kostenfreiheit<br />
1 Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Kosten nicht erhoben.<br />
2 Schließt die Erlaubnis gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 2 die Zustimmung im<br />
Einzelfall nach Art. 18 Abs. 2 BayBO oder die Abweichung nach Art. 63 Abs. 1<br />
Satz 1 BayBO ein, werden für die Zustimmung oder die Abweichung Kosten<br />
nach dem Kostengesetz erhoben.
VI. Enteignung<br />
Bay DSchG Art. 18 Zulässigkeit der Enteignung<br />
(1) 1 Kann eine Gefahr für den Bestand oder die Gestalt eines Bau- oder<br />
Bodendenkmals oder eines eingetragenen beweglichen Denkmals auf<br />
andere Weise nicht nachhaltig abgewehrt werden, so ist die Enteignung<br />
zugunsten des Staates oder einer anderen juristischen Person des<br />
öffentlichen Rechts zulässig. 2 Zugunsten einer juristischen Person des<br />
Privatrechts ist die Enteignung dann zulässig, wenn die dauernde<br />
Erhaltung des Bau- oder Bodendenkmals oder des eingetragenen<br />
beweglichen Denkmals zu den satzungsmäßigen Aufgaben der juristischen<br />
Person gehört und bei Berücksichtigung aller Umstände gesichert<br />
erscheint.<br />
(2) 1 Zugunsten des Staates ist die Enteignung außerdem zulässig bei<br />
beweglichen Bodendenkmälern, an deren Erhaltung für die Öffentlichkeit<br />
ein besonderes Interesse besteht. 2 Im Fall des Satzes 1 kann der Antrag<br />
nur gestellt werden, wenn dem Landesamt für Denkmalpflege im<br />
Zeitpunkt der Antragstellung die vollständige Bergung des Bodendenkmals<br />
nicht länger als ein Jahr bekannt war.<br />
(3 bis 5) weggefallen<br />
Bay DSchG Art. 19 Vorkaufsrecht<br />
(1) 1 Dem Freistaat Bayern steht beim Kauf historischer Ausstattungsstücke,<br />
die nach Art. 1 Abs. 2 zusammen mit Baudenkmälern geschützt und in die<br />
Denkmalliste eingetragen sind, und beim Kauf von eingetragenen<br />
beweglichen Denkmälern ein Vorkaufsrecht zu. 2 Das Vorkaufsrecht darf<br />
nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt,<br />
insbesondere wenn die Ausstattungsstücke oder die eingetragenen<br />
beweglichen Denkmäler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder in<br />
ihrer Gesamtheit erhalten werden sollen. 3 Das Vorkaufsrecht ist<br />
ausgeschlossen, wenn der Eigentümer Ausstattungsstücke oder<br />
eingetragene bewegliche Denkmäler an seinen Ehegatten oder an eine<br />
Person veräußert, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder<br />
verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt ist.<br />
4<br />
Das Vorkaufsrecht beim Kauf historischer Ausstattungsstücke ist<br />
ausgeschlossen, wenn diese mit dem Baudenkmal veräußert werden und<br />
in dem Baudenkmal verbleiben sollen.<br />
(2) 1 Das Vorkaufsrecht kann nur binnen drei Monaten nach Mitteilung des<br />
Kaufvertrags an das Landesamt für Denkmalpflege durch das Landesamt<br />
für Denkmalpflege ausgeübt werden. 2 §§ 463 bis 468 Abs. 1, 469 Abs. 1,<br />
§ 471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden. 3 Das<br />
Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. 4 Es geht unbeschadet<br />
bundesrechtlicher Vorschriften allen anderen Vorkaufsrechten im Rang<br />
vor. 5 Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung des<br />
Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte.<br />
Bay DSchG Art. 20 Enteignende Maßnahmen<br />
(1) 1 Soweit der Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s eine über den Rahmen der<br />
Sozialgebundenheit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 des Grundgesetzes,
Art. 103 Abs. 2 und Art. 158 der Verfassung) hinausgehende Wirkung hat,<br />
ist dem Betroffenen nach den Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über<br />
die entschädigungspflichtige Enteignung Entschädigung in Geld zu<br />
gewähren. 2 Steuervorteile, die auf die Denkmaleigenschaft<br />
zurückzuführen sind, sind in allen Fällen in angemessenem Umfang auf die<br />
Entschädigung anzurechnen.<br />
(2) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde setzt auf Antrag des Betroffenen die<br />
Entschädigung fest. 2 Die Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
entschädigungspflichtige Enteignung über die Festsetzung der<br />
Entschädigung gelten sinngemäß.<br />
(3) 1 Ergeht auf einen neuen Antrag hin eine Entscheidung, die für den<br />
Entschädigungsberechtigten günstiger ist als die der<br />
Entschädigungsfestsetzung nach Absatz 1 zugrunde liegende<br />
Entscheidung, so ist in allen Fällen die Entschädigung auf die Höhe<br />
herabzusetzen, die der entstandenen Beeinträchtigung entspricht.<br />
2 3<br />
Absatz 2 gilt entsprechend. Ein überzahlter Betrag ist<br />
zurückzuerstatten, soweit der Entschädigungsberechtigte noch bereichert<br />
ist.<br />
Bay DSchG Art. 21 Tragung des Entschädigungsaufwands<br />
(1) 1 Der Freistaat Bayern und die Gemeinden haben die Entschädigung<br />
grundsätzlich gemeinsam zu tragen. 2 Absatz 5 bleibt unberührt. 3 Die<br />
Ansprüche des Berechtigten sind gegen den Freistaat Bayern zu richten.<br />
4<br />
Der Entschädigungsfonds erstattet dem Freistaat Bayern die dem<br />
Betroffenen gewährten Entschädigungsleistungen. 5 Für die<br />
Geltendmachung des Erstattungsanspruchs ist die Regierung zuständig.<br />
(2) 1 Die Oberste Denkmalschutzbehörde errichtet und verwaltet mit Wirkung<br />
zum 1. Januar des auf das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s folgenden Jahres<br />
einen Entschädigungsfonds als staatliches Sondervermögen ohne eigene<br />
Rechtspersönlichkeit. 2 Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom<br />
Freistaat Bayern und von den Gemeinden je zur Hälfte aufgebracht. 3 Sie<br />
betragen in der Regel je fünf Millionen Euro. 4 Durch Rechtsverordnung<br />
nach Absatz 4, die der Zustimmung des Landtags bedarf, können die<br />
Beiträge abweichend von Satz 3 festgesetzt werden; dabei kann nach<br />
Anhörung des Bayerischen Städtetags und des Bayerischen Gemeindetags<br />
die Beitragspflicht der Gemeinden bis auf 50 v. H. der vom Staat im<br />
Vorjahr nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 20 und nach Art. 4<br />
Abs. 3 erbrachten Leistungen erhöht werden, wenn die Mittel des Fonds<br />
zur Deckung dieser Leistungen nicht ausreichen.<br />
(3) Die Beiträge der einzelnen Gemeinden zu dem von ihnen insgesamt<br />
gemäß Absatz 2 zum Entschädigungsfonds zu leistenden Anteil bestimmen<br />
sich nach dem Verhältnis ihrer für das laufende Rechnungsjahr<br />
maßgebenden Umlagegrundlagen (Art. 18 Abs. 3, Art. 21 Abs. 3 des<br />
Finanzausgleichsgesetzes).<br />
(4) 1 Die Oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen<br />
mit den Staatsministerien des Innern und der Finanzen durch<br />
Rechtsverordnung die Einzelheiten, insbesondere auch des Berechnungsund<br />
Erhebungsverfahrens, zu regeln. 2 Es kann vorgesehen werden, daß<br />
das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung die Beiträge ermittelt
und festsetzt und daß die Erhebung bei den kreisangehörigen Gemeinden<br />
im Weg der Verrechnung über die Landkreise erfolgt.<br />
(5) Erfolgt eine Enteignung auf Grund eines Enteignungsverfahrens zugunsten<br />
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die nicht<br />
Gebietskörperschaft ist, oder zugunsten einer juristischen Person des<br />
Privatrechts, so hat diese die Entschädigung zu tragen.<br />
VII. Finanzierung<br />
Bay DSchG Art. 22 Leistungen<br />
(1) 1 Der Freistaat Bayern beteiligt sich unbeschadet bestehender<br />
Verpflichtungen in Höhe der jeweils im Staatshaushalt ausgewiesenen<br />
Mittel an den Kosten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege,<br />
insbesondere an den Kosten der Instandsetzung, Erhaltung, Sicherung<br />
und Freilegung von Denkmälern. 2 Die Höhe der Beteiligung richtet sich<br />
nach der Bedeutung und der Dringlichkeit des Falls und nach der<br />
Leistungsfähigkeit des Eigentümers.<br />
(2) Die kommunalen Gebietskörperschaften beteiligen sich im Rahmen ihrer<br />
Leistungsfähigkeit in angemessenem Umfang an den Kosten der in<br />
Absatz 1 genannten Maßnahmen.<br />
VIII. Ordnungswidrigkeiten<br />
Bay DSchG Art. 23<br />
(1) Mit Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro kann belegt werden,<br />
wer vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. Handlungen nach Art. 4 Abs. 4 vornimmt, obwohl ihm dies durch<br />
vollziehbare Anordnung untersagt wurde,<br />
2. ohne die nach Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 4 Satz 1 oder Art. 10 Abs. 1<br />
erforderliche Erlaubnis oder die an ihre Stelle tretende baurechtliche oder<br />
abgrabungsaufsichtliche Genehmigung Maßnahmen an einem Denkmal<br />
durchführt,<br />
3. ohne die nach Art. 7 Abs. 1 erforderliche Erlaubnis nach<br />
Bodendenkmälern gräbt oder zu einem anderen Zweck Erdarbeiten auf<br />
einem Grundstück vornimmt oder wer ohne die nach Art. 7 Abs. 2<br />
erforderliche Erlaubnis Arbeiten in einem Grabungsschutzgebiet<br />
durchführt, die Bodendenkmäler gefährden können,<br />
4. die gemäß Art. 8 Abs. 1 oder Art. 10 Abs. 2 erforderliche Anzeige nicht<br />
unverzüglich erstattet,<br />
5. die aufgefundenen Gegenstände und den Fundort nicht gemäß Art. 8<br />
Abs. 2 unverändert läßt,<br />
6. seiner Übergabepflicht gemäß Art. 8 Abs. 5 nicht unverzüglich<br />
nachkommt.<br />
(2) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten verjährt in fünf Jahren.
IX. Allgemeine Bestimmungen und Schlußbestimmungen<br />
Bay DSchG Art. 24 Grundrechtseinschränkung<br />
Die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des<br />
Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung), der freien Entfaltung der<br />
Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 101 der Verfassung) und<br />
des Eigentums (Art. 14 des Grundgesetzes, Art. 103 der Verfassung) werden<br />
durch dieses Gesetz eingeschränkt.<br />
Bay DSchG Art. 25 Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche<br />
Zwecke<br />
Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden<br />
vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen vom Landesamt für Denkmalpflege<br />
erteilt.<br />
Bay DSchG Art. 26 Kirchliche Denkmäler<br />
(1) Art. 10 §§ 3 und 4 des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl vom<br />
29. März 1924 und Art. 18 und 19 des Vertrags zwischen dem Freistaat<br />
Bayern und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des<br />
Rheins vom 15. November 1924 bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Sollen Entscheidungen über Bau- oder Bodendenkmäler oder über<br />
eingetragene bewegliche Denkmäler getroffen werden, die unmittelbar<br />
gottesdienstlichen Zwecken der Katholischen Kirche oder der Evangelisch-<br />
Lutherischen Kirche dienen, so haben die Denkmalschutzbehörden die von<br />
den zuständigen kirchlichen Oberbehörden festgestellten kirchlichen<br />
Belange zu berücksichtigen. 2 Die Kirchen sind am Verfahren zu beteiligen.<br />
3<br />
Die zuständige kirchliche Oberbehörde entscheidet im Benehmen mit der<br />
Obersten Denkmalschutzbehörde, falls die Untere und Höhere<br />
Denkmalschutzbehörde die geltend gemachten kirchlichen Belange nicht<br />
anerkennen. 4 Gegenüber anderen Religionsgemeinschaften, die<br />
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, gelten die Sätze 1 bis 3<br />
sinngemäß.<br />
Bay DSchG Art. 27 (weggefallen)<br />
Bay DSchG Art. 28 Inkrafttreten<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1973 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 25. Juni 1973 (GVBl. S. 328).<br />
(2) gegenstandslos
<strong>Bayerisches</strong> Datenschutzgesetz (Bay<br />
DSG)<br />
vom 23. Juli 1993 (GVBl. S. 498), geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 10. Juli 1998 (GVBl. S. 385), vom<br />
16. Dezember 1999 (GVBl. S. 521), vom 25. Oktober 2000 (GVBl. S. 752), vom 24. Dezember<br />
2002 (GVBl. S. 975), vom 26. Juli 2006 (GVBl. S. 405), vom 10. Juni 2008 (GVBl. S. 315), vom 2.<br />
April 2009 (GVBl. S. 49), vom 14. April 2009 (GVBl. S. 86), vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 380), vom<br />
27. Juli 2009 (GVBl. S. 400) (FN BayRS 204-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER ABSCHNITT Allgemeine Bestimmungen<br />
Art. 1 Zweck des <strong>Gesetze</strong>s<br />
Art. 2 Anwendungsbereich des <strong>Gesetze</strong>s<br />
Art. 3 Öffentliche Stellen, die am Wettbewerb teilnehmen<br />
Art. 4 Begriffsbestimmungen<br />
Art. 5 Datengeheimnis<br />
Art. 6 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im<br />
Auftrag<br />
Art. 7 Technische und organisatorische Maßnahmen<br />
Art. 8 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren<br />
ZWEITER ABSCHNITT Schutzrechte<br />
Art. 9 Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz<br />
Art. 10 Auskunft und Benachrichtigung<br />
Art. 11 Berichtigung<br />
Art. 12 Löschung, Sperrung<br />
Art. 13 Benachrichtigung nach Datenübermittlung<br />
Art. 14 Schadensersatz<br />
DRITTER ABSCHNITT Rechtsgrundlagen der Datenerhebung, -verarbeitung<br />
und -nutzung
Art. 15 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung<br />
Art. 16 Erhebung<br />
Art. 17 Verarbeitung und Nutzung<br />
Art. 18 Datenübermittlung an öffentliche Stellen<br />
Art. 19 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen<br />
Art. 20 Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften<br />
Art. 21 Datenübermittlung an Stellen im Ausland<br />
Art. 21 a Videobeobachtung und Videoaufzeichnung (Videoüberwachung)<br />
Art. 22 Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem Berufs- oder<br />
besonderen Amtsgeheimnis unterliegen<br />
Art. 23 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch<br />
Forschungseinrichtungen<br />
Art. 24 Rechtsverordnungsermächtigung für Datenübermittlungen<br />
VIERTER ABSCHNITT Durchführung des Datenschutzes bei öffentlichen<br />
Stellen<br />
Art. 25 Sicherstellung des Datenschutzes, behördliche<br />
Datenschutzbeauftragte<br />
Art. 26 Datenschutzrechtliche Freigabe automatisierter Verfahren<br />
Art. 27 Verfahrensverzeichnis<br />
Art. 28 Rechtsverordnungsermächtigungen<br />
FÜNFTER ABSCHNITT Landesbeauftragter für den Datenschutz<br />
Art. 29 Ernennung und Rechtsstellung<br />
Art. 30 Aufgaben<br />
Art. 31 Beanstandungen<br />
Art. 32 Unterstützung durch die öffentlichen Stellen
Art. 33 Datenschutzkommission<br />
SECHSTER ABSCHNITT Tätigkeit der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz<br />
bei nicht-öffentlichen Stellen<br />
Art. 34 Mitwirkung des Technischen Überwachungs-Vereins<br />
Art. 35 Kostenerhebung durch die Aufsichtsbehörden<br />
Art. 36 Weitere Aufgaben der Aufsichtsbehörden<br />
SIEBTER ABSCHNITT Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift,<br />
Schlußvorschriften<br />
Art. 37 Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift<br />
Art. 38 Änderung von <strong>Gesetze</strong>n<br />
Art. 39 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen<br />
ERSTER ABSCHNITT Allgemeine Bestimmungen<br />
Bay DSG Art. 1 Zweck des <strong>Gesetze</strong>s<br />
Zweck dieses <strong>Gesetze</strong>s ist es, die einzelnen davor zu schützen, daß sie bei der<br />
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch<br />
öffentliche Stellen in unzulässiger Weise in ihrem Persönlichkeitsrecht<br />
beeinträchtigt werden.<br />
Bay DSG Art. 2 Anwendungsbereich des <strong>Gesetze</strong>s<br />
(1) Die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s – ausgenommen der Sechste Abschnitt –<br />
gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener<br />
Daten durch Behörden, Gerichte und sonstige öffentliche Stellen des<br />
Freistaates Bayern, der Gemeinden, Gemeindeverbände und der sonstigen<br />
der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen<br />
des öffentlichen Rechts.<br />
(2) 1 Die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s gelten auch für Vereinigungen des<br />
privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen<br />
und an denen – ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen –<br />
1. eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des<br />
öffentlichen Rechts beteiligt sind, oder<br />
2. außer einer oder mehrerer der in Absatz 1 genannten juristischen<br />
Personen des öffentlichen Rechts auch eine oder mehrere der in § 2 Abs. 1<br />
des Bundesdatenschutzgesetzes genannten juristischen Personen des<br />
öffentlichen Rechts oder Vereinigungen beteiligt sind, wenn sie keine<br />
öffentlichen Stellen des Bundes gemäß § 2 Abs. 3 des<br />
Bundesdatenschutzgesetzes sind.<br />
2<br />
Beteiligt sich eine Vereinigung des privaten Rechts, auf die dieses Gesetz
nach Satz 1 Anwendung findet, an einer weiteren Vereinigung des<br />
privaten Rechts, so findet Satz 1 entsprechende Anwendung.<br />
(3) Für personenbezogene Daten in automatisierten Dateien, die<br />
ausschließlich aus verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend<br />
erstellt und nach ihrer verarbeitungstechnischen Nutzung automatisch<br />
gelöscht werden, gelten von den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s nur die<br />
Art. 5, 7, 17 Abs. 4, Art. 25, 29 bis 31, 32 Abs. 1 bis 3, Art. 33 und 37.<br />
(4) Die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s gelten nicht für die Ausübung des<br />
Begnadigungsrechts.<br />
(5) Die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s gelten für den Landtag nur, soweit er in<br />
Verwaltungsangelegenheiten tätig wird.<br />
(6) In bezug auf Gerichte und den Obersten Rechnungshof gelten der Vierte<br />
und Fünfte Abschnitt sowie Art. 9 nur, soweit sie in<br />
Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.<br />
(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz oder über<br />
Verfahren der Rechtspflege auf personenbezogene Daten anzuwenden<br />
sind, gehen sie den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s vor.<br />
(8) Die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s gehen denen des Bayerischen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des<br />
Sachverhalts personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt<br />
werden.<br />
(9) Dieses Gesetz läßt die Verpflichtung zur Wahrung der in § 203 Abs. 1 des<br />
Strafgesetzbuchs genannten Geheimnisse unberührt.<br />
Bay DSG Art. 3 Öffentliche Stellen, die am Wettbewerb teilnehmen<br />
(1) 1 Soweit öffentliche Stellen als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen,<br />
gelten für sie sowie für ihre Zusammenschlüsse und Verbände die<br />
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes mit Ausnahme des Zweiten<br />
Abschnitts. 2 Art. 2 Abs. 7 bleibt unberührt. 3 Für die Durchführung und die<br />
Kontrolle des Datenschutzes gelten an Stelle der §§ 4 d bis 4 g und 38 des<br />
Bundesdatenschutzgesetzes die Art. 9 und 25 bis 33.<br />
(2) 1 Soweit öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen am Wettbewerb<br />
teilnehmen, gelten für sie die Vorschriften des<br />
Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche<br />
Versicherungsunternehmen anzuwenden sind. 2 Für öffentlich-rechtliche<br />
Kreditinstitute sowie für ihre Zusammenschlüsse und Verbände gelten die<br />
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche<br />
Kreditinstitute anzuwenden sind. 3 Art. 2 Abs. 7 bleibt unberührt.<br />
(3) Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern unterliegt den<br />
Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s auch, soweit sie am Wettbewerb teilnimmt.<br />
Bay DSG Art. 4 Begriffsbestimmungen<br />
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder<br />
sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher<br />
Personen (Betroffene).<br />
(2) 1 Öffentliche Stellen im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind die in Art. 2 Abs. 1 und<br />
2 bezeichneten Stellen und Vereinigungen. 2 Öffentliche Stellen im Sinn
der Art. 18 und 24 sind darüber hinaus die öffentlichen Stellen des Bundes<br />
gemäß § 2 des Bundesdatenschutzgesetzes und der anderen Länder nach<br />
§ 2 des Bundesdatenschutzgesetzes und der jeweils maßgeblichen<br />
Landesdatenschutzgesetze. 3 Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und<br />
juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen<br />
des privaten Rechts, soweit sie nicht unter Satz 1 oder 2 fallen. 4 Nimmt<br />
eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen<br />
Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle.<br />
(3) 1 Eine Datei ist<br />
1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte<br />
Verfahren nach bestimmten Merkmalen ausgewertet werden kann<br />
(automatisierte Datei) oder<br />
2. jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig<br />
aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und<br />
ausgewertet werden kann (nicht automatisierte Datei).<br />
2<br />
Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie<br />
durch automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden<br />
können.<br />
(4) 1 Akten sind alle sonstigen amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienenden<br />
Unterlagen; dazu zählen auch Bild- und Tonträger. 2 Nicht hierunter fallen<br />
Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden<br />
sollen.<br />
(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über Betroffene.<br />
(6) 1 Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und<br />
Löschen personenbezogener Daten. 2 Im einzelnen ist, ungeachtet der<br />
dabei angewendeten Verfahren:<br />
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren<br />
personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zweck ihrer<br />
weiteren Verarbeitung oder Nutzung,<br />
2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter<br />
personenbezogener Daten,<br />
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch<br />
Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener Daten an Dritte in der<br />
Weise, daß<br />
a) die Daten durch die speichernde Stelle an Dritte weitergegeben werden<br />
oder<br />
b) Dritte Daten einsehen oder abrufen, die von der speichernden Stelle<br />
zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehalten werden,<br />
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten,<br />
um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,<br />
5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener<br />
Daten.<br />
(7) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich<br />
nicht um Verarbeitung handelt, insbesondere die Weitergabe von Daten<br />
innerhalb der speichernden Stelle an Teile derselben Stelle mit anderen<br />
Aufgaben oder anderem örtlichem Zuständigkeitsbereich.<br />
(8) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, daß<br />
die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr<br />
oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten
und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person<br />
zugeordnet werden können.<br />
(9) Speichernde Stelle ist jede öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten<br />
für sich selbst speichert oder durch andere im Auftrag speichern läßt.<br />
(10) 1 Dritte sind alle Personen oder Stellen außerhalb der speichernden Stelle.<br />
2<br />
Dritte sind nicht die Betroffenen sowie diejenigen Personen und Stellen,<br />
die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder<br />
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen<br />
Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben,<br />
verarbeiten oder nutzen.<br />
Bay DSG Art. 5 Datengeheimnis<br />
1 Den bei öffentlichen Stellen beschäftigten Personen ist es untersagt,<br />
personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen<br />
(Datengeheimnis). 2 Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer<br />
Tätigkeit fort.<br />
Bay DSG Art. 6 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung<br />
personenbezogener Daten im Auftrag<br />
(1) 1 Werden personenbezogene Daten durch andere Stellen im Auftrag<br />
erhoben, verarbeitet oder genutzt, bleibt der Auftraggeber für die<br />
Einhaltung der Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s und anderer Vorschriften über<br />
den Datenschutz verantwortlich. 2 Die im Zweiten Abschnitt genannten<br />
Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.<br />
(2) 1 Auftragnehmer sind unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der<br />
von ihnen getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen<br />
sorgfältig auszuwählen. 2 Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei<br />
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung, die technischen und<br />
organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse<br />
festzulegen sind. 3 Der Auftraggeber hat sich soweit erforderlich von der<br />
Einhaltung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen<br />
beim Auftragnehmer zu überzeugen.<br />
(3) 1 Ist eine öffentliche Stelle Auftragnehmer, so gelten für sie nur die Art. 5,<br />
7, 25, 29 bis 31, 32 Abs. 1 bis 3, Art. 33 und 37. 2 Der Auftragnehmer darf<br />
die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers erheben,<br />
verarbeiten oder nutzen. 3 Ist er der Ansicht, daß eine Weisung des<br />
Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den<br />
Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf<br />
hinzuweisen.<br />
(4) 1 Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung<br />
automatisierter Verfahren oder Datenverarbeitungsanlagen durch andere<br />
Stellen vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene<br />
Daten nicht ausgeschlossen werden kann. 2 Ist eine schriftliche<br />
Auftragserteilung nach Absatz 2 Satz 2 nicht möglich, so ist diese<br />
unverzüglich nachzuholen.
Bay DSG Art. 7 Technische und organisatorische Maßnahmen<br />
(1) 1 Öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten<br />
erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und<br />
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die<br />
Ausführung der Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s zu gewährleisten.<br />
2<br />
Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem<br />
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.<br />
(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, sind<br />
Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden<br />
personenbezogenen Daten geeignet sind,<br />
1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen<br />
personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren<br />
(Zugangskontrolle),<br />
2. zu verhindern, daß Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert<br />
oder entfernt werden können (Datenträgerkontrolle),<br />
3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte<br />
Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung gespeicherter<br />
personenbezogener Daten zu verhindern (Speicherkontrolle),<br />
4. zu verhindern, daß Datenverarbeitungssysteme mit Hilfe von<br />
Einrichtungen zur Datenübertragung von Unbefugten genutzt werden<br />
können (Benutzerkontrolle),<br />
5. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines<br />
Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer<br />
Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können<br />
(Zugriffskontrolle),<br />
6. zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt werden kann, an<br />
welche Stellen personenbezogene Daten durch Einrichtungen zur<br />
Datenübertragung übermittelt werden können (Übermittlungskontrolle),<br />
7. zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und festgestellt werden<br />
kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem in<br />
Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle),<br />
8. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im Auftrag<br />
verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers<br />
verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),<br />
9. zu verhindern, daß bei der Übertragung personenbezogener Daten<br />
sowie beim Transport von Datenträgern die Daten unbefugt gelesen,<br />
kopiert, verändert oder gelöscht werden können (Transportkontrolle),<br />
10. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu<br />
gestalten, daß sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes<br />
gerecht wird (Organisationskontrolle).<br />
Bay DSG Art. 8 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren<br />
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung<br />
personenbezogener Daten an Dritte durch Abruf ermöglicht, ist zulässig,<br />
soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen<br />
Interessen der Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten Stellen<br />
angemessen ist.<br />
(2) 1 Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, daß die Zulässigkeit des<br />
Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. 2 Hierzu haben sie schriftlich
festzulegen:<br />
1. die Aufgaben, zu deren Erfüllung personenbezogene Daten verarbeitet<br />
werden und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,<br />
2. die Datenempfänger,<br />
3. die Art der zu übermittelnden Daten,<br />
4. die nach Art. 7 erforderlichen technischen und organisatorischen<br />
Maßnahmen.<br />
(3) 1 Die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs beurteilt sich nach den für die<br />
Erhebung und Übermittlung geltenden Vorschriften. 2 Die Verantwortung<br />
für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Empfänger. 3 Die<br />
speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlaß<br />
besteht. 4 Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, daß die<br />
Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch geeignete<br />
Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann. 5 Wird ein<br />
Gesamtbestand personenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt<br />
(Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung<br />
und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufs oder der<br />
Übermittlung des Gesamtbestands.<br />
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die<br />
allen, sei es ohne oder nach besonderer Zulassung, zur Benutzung<br />
offenstehen.<br />
ZWEITER ABSCHNITT Schutzrechte<br />
Bay DSG Art. 9 Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz<br />
Jeder kann sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit dem<br />
Vorbringen wenden, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner<br />
personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen in seinen Rechten verletzt<br />
worden zu sein.<br />
Bay DSG Art. 10 Auskunft und Benachrichtigung<br />
(1) 1 Die speichernde Stelle hat den Betroffenen auf Antrag Auskunft zu<br />
erteilen über<br />
1. die zur Person gespeicherten Daten,<br />
2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder<br />
Nutzung,<br />
3. die Herkunft der Daten und die Empfänger übermittelter Daten, soweit<br />
diese Angaben gespeichert sind,<br />
4. die Empfänger regelmäßiger Datenübermittlungen,<br />
5. im Fall des Art. 6 Abs. 1 bis 3 die Auftragnehmer,<br />
6. im Fall des Art. 15 Abs. 6 den strukturierten Ablauf der automatisierten<br />
Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten und die dabei herangezogenen<br />
Entscheidungskriterien.<br />
2<br />
Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die ausschließlich Zwecken<br />
der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen.<br />
(2) Für die Auskunft werden Kosten nicht erhoben, es sei denn, daß mit der<br />
Auskunftserteilung ein besonderer Verwaltungsaufwand verbunden ist.
(3) 1 In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die<br />
Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. 2 Sind die<br />
personenbezogenen Daten nicht in automatisierten Dateien gespeichert,<br />
so wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die<br />
das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der<br />
Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom<br />
Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse steht. 3 Die<br />
speichernde Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der<br />
Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.<br />
(4) 1 Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung<br />
personenbezogener Daten an Behörden der Staatsanwaltschaft, an<br />
Polizeidienststellen, an Behörden der Finanzverwaltung, soweit sie<br />
personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im<br />
Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung<br />
speichern, an Verfassungsschutzbehörden, an den<br />
Bundesnachrichtendienst, an den Militärischen Abschirmdienst und, soweit<br />
die Sicherheit des Bundes berührt wird, an andere Behörden des<br />
Bundesministeriums der Verteidigung, so ist sie nur mit Zustimmung<br />
dieser Stellen zulässig. 2 Für die Versagung der Zustimmung durch<br />
Behörden des Freistaates Bayern gilt Absatz 5 entsprechend.<br />
(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit<br />
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung von Aufgaben der<br />
Gefahrenabwehr oder die Verfolgung von Straftaten,<br />
Ordnungswidrigkeiten oder berufsrechtlichen Vergehen gefährden würde,<br />
2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, die Sicherheit des<br />
Staates, die Landesverteidigung oder ein wichtiges wirtschaftliches oder<br />
finanzielles Interesse des Freistaates Bayern, eines anderen Landes, des<br />
Bundes oder der Europäischen Union – einschließlich Währungs-,<br />
Haushalts- und Steuerangelegenheiten – gefährden würde oder<br />
3. personenbezogene Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach<br />
einer Rechtsvorschrift oder wegen der überwiegenden berechtigten<br />
Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen und deswegen das<br />
Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muß.<br />
(6) 1 Die Ablehnung der Auskunftserteilung durch Behörden der<br />
Staatsanwaltschaft, durch Justizvollzugsanstalten und Behörden der<br />
Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer<br />
gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur<br />
Überwachung und Prüfung speichern, bedarf keiner Begründung. 2 Die<br />
Ablehnung der Auskunftserteilung durch sonstige öffentliche Stellen bedarf<br />
keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und<br />
rechtlichen Gründe der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck<br />
gefährdet würde. 3 In den Fällen der Sätze 1 und 2 ist der Betroffene<br />
darauf hinzuweisen, daß er sich an den Landesbeauftragten für den<br />
Datenschutz wenden kann.<br />
(7) 1 Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen<br />
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die<br />
Staatskanzlei, die Staatsministerien, die sonstigen obersten Dienststellen<br />
des Staates oder die obersten Aufsichtsbehörden jeweils für ihren<br />
Zuständigkeitsbereich im Einzelfall feststellen, daß dadurch die Sicherheit
des Freistaates Bayern, eines anderen Landes oder des Bundes gefährdet<br />
würde. 2 Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz an<br />
den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der<br />
speichernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden<br />
Auskunft zustimmt.<br />
(8) 1 Werden in einer Datei zur Person Betroffener Daten gespeichert, die<br />
weder von den Betroffenen mit ihrer Kenntnis erhoben noch von ihnen<br />
mitgeteilt worden sind, so hat die speichernde Stelle die Betroffenen von<br />
der Tatsache der Speicherung zu benachrichtigen und dabei die Art der<br />
Daten sowie die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der<br />
Speicherung zu nennen; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 2 Die<br />
Benachrichtigung erfolgt zum Zeitpunkt der Speicherung oder im Fall einer<br />
beabsichtigten Übermittlung spätestens mit deren Durchführung. 3 Dienen<br />
die Daten der Erstellung einer beabsichtigten Mitteilung an Betroffene,<br />
kann die Benachrichtigung mit dieser Mitteilung verbunden werden. 4 Die<br />
Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn<br />
1. eine Rechtsvorschrift die Speicherung der personenbezogenen Daten<br />
ausdrücklich vorsieht,<br />
2. die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Tatsache der<br />
Speicherung erlangt haben, oder<br />
3. die Benachrichtigung der Betroffenen unmöglich ist oder einen<br />
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.<br />
5<br />
Absatz 5 gilt entsprechend.<br />
(9) 1 Die Absätze 1 bis 8 gelten für Gerichte nur, soweit sie in<br />
Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. 2 Absatz 6 Satz 3 und Absatz 7<br />
gelten für den Obersten Rechnungshof nur, soweit er in<br />
Verwaltungsangelegenheiten tätig wird. 3 Absatz 8 gilt nicht für Behörden<br />
der Staatsanwaltschaft, für Justizvollzugsanstalten, für<br />
Führungsaufsichtsstellen und für Stellen der Gerichts- und<br />
Bewährungshilfe.<br />
Bay DSG Art. 11 Berichtigung<br />
1 Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 2 Wird<br />
bei personenbezogenen Daten in Akten festgestellt, daß sie unrichtig sind, oder<br />
wird ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten, so ist dies in den Akten zu<br />
vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten.<br />
Bay DSG Art. 12 Löschung, Sperrung<br />
(1) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu löschen, wenn<br />
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder<br />
2. ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer<br />
Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.<br />
(2) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu sperren, wenn<br />
1. ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die<br />
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen läßt oder<br />
2. eine Löschung nach Absatz 1 wegen der besonderen Art der<br />
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand<br />
möglich ist.
(3) 1 Personenbezogene Daten in Akten sind zu sperren, wenn die speichernde<br />
Stelle im Einzelfall feststellt, daß ihre Speicherung unzulässig ist. 2 Stellt<br />
die speichernde Stelle im Einzelfall fest, daß der gesamte Akt<br />
ausschließlich unzulässig gespeicherte Daten enthält, so sind die<br />
personenbezogenen Daten zu löschen.<br />
(4) 1 Personenbezogene Daten in Akten sind ferner zu sperren, wenn die<br />
speichernde Stelle im Einzelfall feststellt, daß ihre Kenntnis für die<br />
speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden<br />
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist und ohne die Sperrung schutzwürdige<br />
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden. 2 Stellt die speichernde<br />
Stelle im Einzelfall fest, daß der gesamte Akt zur Erfüllung der in ihrer<br />
Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, sind die<br />
personenbezogenen Daten zu löschen.<br />
(5) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, wenn Grund zu der<br />
Annahme besteht, daß durch eine Löschung die schutzwürdigen<br />
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden.<br />
(6) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt<br />
oder genutzt werden, wenn<br />
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden<br />
Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der<br />
speichernden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerläßlich oder<br />
zur Wahrnehmung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen oder zur<br />
Rechnungsprüfung erforderlich ist und<br />
2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie<br />
nicht gesperrt wären.<br />
(7) Daten, die wegen Unzulässigkeit der Speicherung gesperrt sind, dürfen<br />
ohne Einwilligung des Betroffenen nicht mehr übermittelt oder genutzt<br />
werden, es sei denn, daß dies zur Wahrnehmung von Aufsichts- und<br />
Kontrollbefugnissen oder zur Rechnungsprüfung erforderlich ist.<br />
(8) Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen<br />
Archiv zur Übernahme anzubieten, ist eine Löschung erst zulässig,<br />
nachdem die Unterlagen dem öffentlichen Archiv angeboten worden sind<br />
und von diesem nicht als archivwürdig übernommen worden sind oder<br />
über die Übernahme nicht fristgerecht (Art. 6 Abs. 4 <strong>Bayerisches</strong><br />
Archivgesetz oder auf Grund der entsprechenden Festlegungen der Träger<br />
von Archiven sonstiger öffentlicher Stellen nach Abschnitt III des<br />
Bayerischen Archivgesetzes) entschieden worden ist.<br />
Bay DSG Art. 13 Benachrichtigung nach Datenübermittlung<br />
Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie<br />
der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die<br />
Stellen zu verständigen, denen diese Daten übermittelt wurden, es sei denn,<br />
dass die Verständigung sich als unmöglich erweist oder mit einem<br />
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.<br />
Bay DSG Art. 14 Schadensersatz<br />
(1) 1 Fügt eine öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem<br />
Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige
oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner<br />
personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist ihr Träger dem<br />
Betroffenen zum Ersatz dieses Schadens verpflichtet. 2 Die Ersatzpflicht<br />
entfällt, soweit die öffentliche Stelle die nach den Umständen des Falles<br />
gebotene Sorgfalt beachtet hat.<br />
(2) 1 Fügt eine öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem<br />
Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige<br />
oder unrichtige automatisierte Verarbeitung seiner personenbezogenen<br />
Daten einen Schaden zu, ist sie dem Betroffenen unabhängig von einem<br />
Verschulden zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.<br />
2<br />
Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem<br />
Betroffenen der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in<br />
Geld zu ersetzen. 3 Der Anspruch ist insgesamt bis zu einem Betrag in<br />
Höhe von 125 000 Euro begrenzt. 4 Ist auf Grund desselben Ereignisses an<br />
mehrere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den<br />
Höchstbetrag von 125 000 Euro übersteigt, so verringern sich die<br />
einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr<br />
Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht. 5 Sind bei einer Datei mehrere<br />
Stellen speicherungsberechtigt und sind Geschädigte nicht in der Lage, die<br />
speichernde Stelle fest zu stellen, so haftet jede dieser Stellen.<br />
(3) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.<br />
(4) 1 Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen<br />
mitgewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 2 Auf die<br />
Verjährung finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
entsprechende Anwendung.<br />
(5) Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in weiterem Umfang als nach<br />
dieser Vorschrift haften oder nach denen andere für den Schaden<br />
verantwortlich sind, bleiben unberührt.<br />
(6) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen.<br />
DRITTER ABSCHNITT Rechtsgrundlagen der Datenerhebung, -<br />
verarbeitung und -nutzung<br />
Bay DSG Art. 15 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -<br />
nutzung<br />
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind<br />
nur zulässig, wenn<br />
1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder<br />
anordnet oder<br />
2. der Betroffene eingewilligt hat.<br />
(2) Wird eine Einwilligung eingeholt, so sind Betroffene auf den Zweck der<br />
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, auf die Empfänger vorgesehener<br />
Übermittlungen sowie unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf<br />
hinzuweisen, dass sie die Einwilligung verweigern können.<br />
(3) 1 Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer<br />
Umstände eine andere Form angemessen ist. 2 Im Bereich der<br />
wissenschaftlichen Forschung liegen solche besonderen Umstände auch
dann vor, wenn der bestimmte Forschungszweck durch die Schriftform<br />
erheblich beeinträchtigt würde. 3 In diesem Fall sind der Hinweis gemäß<br />
Absatz 2 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung<br />
des wissenschaftlichen Forschungszwecks ergibt, schriftlich festzuhalten.<br />
(4) Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt<br />
werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der<br />
Erklärung hervorzuheben.<br />
(5) 1 Widersprechen Betroffene schriftlich einer bestimmten Erhebung,<br />
Verarbeitung oder Nutzung und ergibt eine Abwägung im Einzelfall, dass<br />
das schutzwürdige Interesse eines Betroffenen wegen seiner besonderen<br />
persönlichen Situation das Interesse der öffentlichen Stelle an der<br />
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten überwiegt, so dürfen<br />
insoweit personenbezogene Daten nicht erhoben, verarbeitet oder genutzt<br />
werden. 2 Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift die Erhebung,<br />
Verarbeitung oder Nutzung anordnet.<br />
(6) 1 Entscheidungen, die für Betroffene eine rechtliche Folge nach sich ziehen<br />
oder sie erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine<br />
automatisierte Verarbeitung oder Nutzung zum Zweck der Bewertung<br />
einzelner Persönlichkeitsmerkmale gestützt werden. 2 Satz 1 gilt nicht,<br />
soweit<br />
1. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht,<br />
2. damit dem Begehren der Betroffenen stattgegeben wird, oder<br />
3. den Betroffenen die Tatsache einer Entscheidung nach Satz 1 mitgeteilt<br />
wird und ihnen Gelegenheit gegeben wird, ihren <strong>Stand</strong>punkt geltend zu<br />
machen; die öffentliche Stelle ist verpflichtet, nach Eingang der<br />
Stellungnahme ihre Entscheidung erneut zu prüfen.<br />
(7) 1 Das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen personenbezogener Daten, aus<br />
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen,<br />
religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die<br />
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über<br />
Gesundheit oder Sexualleben, ist über die Vorschriften dieses Abschnitts<br />
hinaus nur zulässig, wenn<br />
1. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht,<br />
2. die Betroffenen eingewilligt haben, wobei sich die Einwilligung<br />
ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss,<br />
3. es zum Schutz lebenswichtiger Interessen Betroffener oder Dritter<br />
erforderlich ist, sofern die Betroffenen aus physischen oder rechtlichen<br />
Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,<br />
4. es sich um Daten handelt, die Betroffene offenkundig öffentlich<br />
gemacht haben,<br />
5. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder von<br />
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist,<br />
6. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur<br />
Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinn des<br />
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln<br />
oder Zuchtmitteln im Sinn des Jugendgerichtsgesetzes oder zur<br />
Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,<br />
7. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das<br />
wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des
Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss<br />
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erheblich überwiegt und der<br />
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit<br />
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann,<br />
8. es erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten der öffentlichen<br />
Stellen auf dem Gebiet des Dienst- und Arbeitsrechts Rechnung zu tragen,<br />
oder<br />
9. es zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik,<br />
der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von<br />
Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten<br />
durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer<br />
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen.<br />
2<br />
Art. 20 bleibt unberührt.<br />
(8) 1 Die Absätze 5 bis 7 gelten für Strafgerichte nur, soweit sie in<br />
Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. 2 Die Absätze 5 bis 7 gelten<br />
nicht für Behörden der Staatsanwaltschaft, für Justizvollzugsanstalten, für<br />
Führungsaufsichtsstellen und für Stellen der Gerichts- und<br />
Bewährungshilfe.<br />
Bay DSG Art. 16 Erhebung<br />
(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis<br />
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der erhebenden Stelle liegenden<br />
Aufgaben erforderlich ist.<br />
(2) 1 Personenbezogene Daten, die nicht aus allgemein zugänglichen Quellen<br />
entnommen werden, sind beim Betroffenen mit seiner Kenntnis zu<br />
erheben. 2 Personenbezogene Daten dürfen bei Dritten nur erhoben<br />
werden, wenn<br />
1. eine Rechtsvorschrift eine solche Erhebung vorsieht oder zwingend<br />
voraussetzt,<br />
2.<br />
a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder im Einzelfall<br />
eine solche Erhebung erforderlich macht oder<br />
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand<br />
erfordern würde oder keinen Erfolg verspricht<br />
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß überwiegende<br />
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, oder<br />
3. die Daten nach Art. 18 Abs. 1 oder einer anderen Rechtsvorschrift von<br />
einer öffentlichen Stelle an die erhebende Stelle übermittelt werden<br />
dürfen.<br />
3<br />
Werden Daten beim Betroffenen ohne seine Kenntnis erhoben, gelten die<br />
Nummern 1 und 2 Buchst. a des Satzes 2 entsprechend.<br />
(3) 1 Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis<br />
erhoben, so ist der Erhebungszweck ihm gegenüber anzugeben. 2 Werden<br />
sie beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur<br />
Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung<br />
für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf,<br />
sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 3 Auf Verlangen ist<br />
der Betroffene über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der
Verweigerung von Angaben aufzuklären. 4 Bei einer Datenerhebung auf<br />
schriftlichem Weg ist die Rechtsvorschrift stets anzugeben.<br />
(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nichtöffentlichen<br />
Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die<br />
zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben<br />
hinzuweisen.<br />
Bay DSG Art. 17 Verarbeitung und Nutzung<br />
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist<br />
zulässig, wenn<br />
1. es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle<br />
liegenden Aufgaben erforderlich ist und<br />
2. es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind; ist<br />
keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke<br />
geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.<br />
(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 ist das Speichern, Verändern oder Nutzen<br />
personenbezogener Daten für andere Zwecke zulässig, wenn<br />
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder die<br />
Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange bestimmt,<br />
2. der Betroffene eingewilligt hat,<br />
3. offensichtlich ist, daß es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein<br />
Grund zu der Annahme besteht, daß er in Kenntnis des anderen Zwecks<br />
seine Einwilligung hierzu verweigern würde,<br />
4. die Daten für den anderen Zweck auf Grund einer durch<br />
Rechtsvorschrift festgelegten Auskunfts- oder Meldepflicht beim<br />
Betroffenen erhoben werden dürfen und der Betroffene dieser Pflicht nicht<br />
nachgekommen ist,<br />
5. Angaben des Betroffenen überprüft werden sollen, weil tatsächliche<br />
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,<br />
6. Angaben des Betroffenen zur Erlangung von finanziellen Leistungen<br />
öffentlicher Stellen mit anderen derartigen Angaben verglichen werden<br />
sollen,<br />
7. es zur Entscheidung über die Verleihung von staatlichen Orden oder<br />
Ehrenzeichen oder von sonstigen staatlichen Ehrungen erforderlich ist,<br />
8. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden<br />
können oder die speichernde Stelle die Daten veröffentlichen dürfte,<br />
9. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder von<br />
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr<br />
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person<br />
erforderlich ist,<br />
10. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur<br />
Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinn des<br />
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln<br />
oder Zuchtmitteln im Sinn des Jugendgerichtsgesetzes oder zur<br />
Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist oder<br />
11. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das<br />
wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des<br />
Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluß<br />
der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht<br />
werden kann.<br />
(3) 1 Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn<br />
sie der Wahrnehmung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen, der<br />
Erstellung von Geschäftsstatistiken, der Rechnungsprüfung, der<br />
Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die speichernde Stelle<br />
oder der Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren der<br />
Datenverarbeitung dient. 2 Das gilt auch für die Verarbeitung und Nutzung<br />
zu Ausbildungs- oder Prüfungszwecken durch die speichernde Stelle,<br />
soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen des<br />
Betroffenen entgegenstehen.<br />
(4) Personenbezogene Daten in automatisierten Dateien im Sinn des Art. 2<br />
Abs. 3 sowie personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der<br />
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines<br />
ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert<br />
werden, dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet oder genutzt werden.<br />
(5) 1 Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 1 bis 3 durch<br />
Weitergabe innerhalb der speichernden Stelle genutzt werden dürfen,<br />
weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder Dritter in Akten so<br />
verbunden, daß eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem<br />
Aufwand möglich ist, so ist die Weitergabe auch dieser Daten zulässig,<br />
soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen des<br />
Betroffenen oder Dritter entgegenstehen. 2 Eine darüber hinausgehende<br />
Nutzung oder Verarbeitung dieser Daten ist nur zulässig, soweit die Daten<br />
auch hierfür hätten weitergegeben werden dürfen.<br />
Bay DSG Art. 18 Datenübermittlung an öffentliche Stellen<br />
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen<br />
ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der<br />
übermittelnden oder der empfangenden Stelle liegenden Aufgaben<br />
erforderlich ist und für Zwecke erfolgt, für die eine Nutzung nach Art. 17<br />
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 zulässig wäre.<br />
(2) 1 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die<br />
übermittelnde Stelle. 2 Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des<br />
Empfängers, trägt dieser die Verantwortung. 3 In diesem Fall prüft die<br />
übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der<br />
Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, daß besonderer Anlaß zur<br />
Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. 4 Art. 8 Abs. 3 bleibt<br />
unberührt.<br />
(3) 1 Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten nur für den Zweck<br />
verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden<br />
sind. 2 Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur zulässig,<br />
wenn für diese Zwecke eine Nutzung nach Art. 17 Abs. 2 bis 4 zulässig<br />
wäre.<br />
(4) 1 Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt<br />
werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder<br />
Dritter in Akten so verbunden, daß eine Trennung nicht oder nur mit<br />
unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser
Daten zulässig, soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige<br />
Interessen des Betroffenen oder Dritter entgegenstehen. 2 Eine Nutzung<br />
oder Verarbeitung dieser Daten durch den Empfänger ist nur zulässig,<br />
soweit die Daten auch hierfür hätten übermittelt werden dürfen.<br />
Bay DSG Art. 19 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen<br />
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen ist<br />
zulässig, wenn<br />
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle<br />
liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen,<br />
die eine Nutzung nach Art. 17 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 zulassen würden<br />
oder<br />
2. die nicht-öffentliche Stelle ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis<br />
der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein<br />
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß der Übermittlung hat.<br />
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die<br />
übermittelnde Stelle.<br />
(3) 1 In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unterrichtet die<br />
übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten.<br />
2<br />
Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, daß er davon auf andere<br />
Weise Kenntnis erlangt, wenn die Unterrichtung wegen der Art der<br />
personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der schutzwürdigen<br />
Interessen des Betroffenen nicht geboten erscheint, oder wenn die<br />
Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl<br />
des Freistaates Bayern, eines anderen Landes oder des Bundes Nachteile<br />
bereiten würde.<br />
(4) 1 Die nicht-öffentliche Stelle darf die übermittelten Daten nur für den<br />
Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt<br />
worden sind. 2 Sie ist von der übermittelnden Stelle darauf hinzuweisen.<br />
3<br />
Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn<br />
eine Übermittlung nach Absatz 1 auch für die anderen Zwecke zulässig<br />
wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.<br />
Bay DSG Art. 20 Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche<br />
Religionsgesellschaften<br />
Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlichrechtlichen<br />
Religionsgesellschaften ist in entsprechender Anwendung von<br />
Art. 18 zulässig, wenn sichergestellt ist, daß bei dem Empfänger ausreichende<br />
Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.<br />
Bay DSG Art. 21 Datenübermittlung an Stellen im Ausland<br />
(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen<br />
innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der anderen<br />
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum<br />
oder an Organe und Einrichtungen der Europäischen Union gelten Art. 18<br />
Abs. 1, Art. 22 und 23 sowie für die Übermittlung an nicht-öffentliche<br />
Stellen innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der<br />
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum Art. 19 Abs. 1 und 3, soweit nicht besondere<br />
Rechtsvorschriften anzuwenden sind.<br />
(2) 1 Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb der<br />
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten<br />
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie an überund<br />
zwischenstaatliche Stellen gelten Art. 19 Abs. 1 und 3, Art. 22 und 23<br />
entsprechend nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5, soweit nicht besondere<br />
Rechtsvorschriften anzuwenden sind. 2 Die Datenübermittlung ist nur<br />
zulässig, wenn das Drittland oder die über- oder zwischenstaatliche Stelle<br />
ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. 3 Die<br />
Angemessenheit des Datenschutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller<br />
Umstände beurteilt, die bei Datenübermittlungen von Bedeutung sind;<br />
insbesondere werden die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer<br />
der geplanten Verarbeitung oder Nutzung, das Herkunfts- und das<br />
Endbestimmungsland, die in dem Drittland geltenden Rechtsvorschriften<br />
sowie die dort geltenden <strong>Stand</strong>esregeln und Sicherheitsmaßnahmen<br />
berücksichtigt. 4 Ist kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet,<br />
so ist die Übermittlung nur zulässig, wenn<br />
1. die Betroffenen ihre Einwilligung gegeben haben,<br />
2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der<br />
übermittelnden Stelle und den Betroffenen oder zur Durchführung von<br />
vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Veranlassung der Betroffenen<br />
getroffen worden sind, erforderlich ist,<br />
3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags<br />
erforderlich ist, der im Interesse Betroffener von der übermittelnden Stelle<br />
mit einem Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden soll,<br />
4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen<br />
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von<br />
Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,<br />
5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen<br />
Betroffener erforderlich ist,<br />
6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der<br />
Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder<br />
allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur<br />
Einsichtnahme offen steht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im<br />
Einzelfall gegeben sind oder<br />
7. die empfangende Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des<br />
Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit<br />
verbundenen Rechte vorweist; diese Garantien können sich insbesondere<br />
aus Vertragsklauseln ergeben.<br />
5<br />
Datenübermittlungen, die nach Satz 4 Nr. 7 vorgenommen werden, sind<br />
dem Staatsministerium des Innern mitzuteilen.<br />
(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die<br />
übermittelnde Stelle.<br />
(4) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu<br />
dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung<br />
sie ihm übermittelt werden.
Bay DSG Art. 21 a Videobeobachtung und Videoaufzeichnung<br />
(Videoüberwachung)<br />
(1) 1 Mit Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtungen sind die Erhebung<br />
(Videobeobachtung) und die Speicherung (Videoaufzeichnung)<br />
personenbezogener Daten zulässig, wenn dies im Rahmen der Erfüllung<br />
öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts erforderlich ist,<br />
1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich<br />
im Bereich öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher Verkehrsmittel, von<br />
Dienstgebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen<br />
oder in deren unmittelbarer Nähe aufhalten, oder<br />
2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel,<br />
Dienstgebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie<br />
die dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen<br />
zu schützen. 2 Es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass<br />
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt<br />
werden.<br />
(2) Die Videoüberwachung und die erhebende Stelle sind durch geeignete<br />
Maßnahmen erkennbar zu machen.<br />
(3) Die Daten dürfen für den Zweck verarbeitet und genutzt werden, für den<br />
sie erhoben worden sind, für einen anderen Zweck nur, soweit dies zur<br />
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder zur<br />
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von<br />
Straftaten erforderlich ist.<br />
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten<br />
Person zugeordnet, ist diese über die Tatsache der Speicherung<br />
entsprechend Art. 10 Abs. 8 zu benachrichtigen.<br />
(5) Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind<br />
spätestens drei Wochen nach der Datenerhebung zu löschen, soweit sie<br />
nicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung<br />
oder von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen<br />
benötigt werden.<br />
(6) 1 Art. 26 bis 28 gelten für die Videoaufzeichnung entsprechend.<br />
2<br />
Öffentliche Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten<br />
rechtzeitig vor dem Einsatz einer Videoaufzeichnung neben den in Art. 26<br />
Abs. 3 Satz 1 genannten Beschreibungen die räumliche Ausdehnung und<br />
Dauer der Videoaufzeichnung, die Maßnahmen nach Abs. 2 und die<br />
vorgesehenen Auswertungen mitzuteilen.<br />
Bay DSG Art. 22 Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die<br />
einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen<br />
1 Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis<br />
unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person oder<br />
Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt<br />
worden sind, dürfen von der speichernden Stelle nur für den Zweck verarbeitet<br />
oder genutzt werden, für den sie sie erhalten hat. 2 Für einen anderen Zweck<br />
dürfen die Daten nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn sie von der zur<br />
Verschwiegenheit verpflichteten Person oder Stelle auch für diesen Zweck<br />
übermittelt werden dürften und die zur Verschwiegenheit verpflichtete Person
oder Stelle in die Zweckänderung eingewilligt hat. 3 Die Übermittlung an eine<br />
nicht-öffentliche Stelle ist darüber hinaus nur zulässig, wenn die zur<br />
Verschwiegenheit verpflichtete Person oder Stelle eingewilligt hat.<br />
Bay DSG Art. 23 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten<br />
durch Forschungseinrichtungen<br />
(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte<br />
personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen<br />
Forschung verarbeitet oder genutzt werden.<br />
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere als öffentliche<br />
Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulässig,<br />
wenn diese sich verpflichten, übermittelte Daten nicht für andere Zwecke<br />
zu verarbeiten oder zu nutzen und die Vorschriften der Absätze 3 und 4<br />
einzuhalten.<br />
(3) 1 Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach<br />
dem Forschungszweck möglich ist. 2 Bis dahin sind die Merkmale<br />
gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder<br />
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person<br />
zugeordnet werden können. 3 Sie dürfen mit den Einzelangaben nur<br />
zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.<br />
(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen<br />
personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn der Betroffene<br />
eingewilligt hat oder dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen<br />
über Ereignisse der Zeitgeschichte unerläßlich ist.<br />
Bay DSG Art. 24 Rechtsverordnungsermächtigung für<br />
Datenübermittlungen<br />
1 Die Staatsregierung kann durch Rechtsverordnung für bestimmte Sachgebiete<br />
die Voraussetzungen näher regeln, unter denen personenbezogene Daten an<br />
öffentliche Stellen und an nicht-öffentliche Stellen übermittelt werden dürfen.<br />
2 Dabei sind die schutzwürdigen Belange der Betroffenen, berechtigte<br />
Interessen Dritter und die Belange einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen<br />
Verwaltung miteinander abzuwägen. 3 In der Rechtsverordnung sind die für die<br />
Übermittlung bestimmten Daten, deren Empfänger und der Zweck der<br />
Übermittlung zu bezeichnen.<br />
VIERTER ABSCHNITT Durchführung des Datenschutzes bei<br />
öffentlichen Stellen<br />
Bay DSG Art. 25 Sicherstellung des Datenschutzes, behördliche<br />
Datenschutzbeauftragte<br />
(1) Die Staatskanzlei, die Staatsministerien und die sonstigen obersten<br />
Dienststellen des Staates, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die<br />
sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen<br />
Personen des öffentlichen Rechts sowie die privatrechtlichen<br />
Vereinigungen, auf die dieses Gesetz gemäß Art. 2 Abs. 2 Anwendung<br />
findet, haben für ihren Bereich die Ausführung dieses <strong>Gesetze</strong>s sowie<br />
anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen.
(2) 1 Öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten mit Hilfe von<br />
automatisierten Verfahren verarbeiten oder nutzen, haben einen ihrer<br />
Beschäftigten zum behördlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.<br />
2<br />
Mehrere öffentliche Stellen können gemeinsam einen ihrer Beschäftigten<br />
bestellen; bei Staatsbehörden kann die Bestellung auch durch eine höhere<br />
Behörde erfolgen.<br />
(3) 1 Die behördlichen Datenschutzbeauftragten sind in dieser Eigenschaft der<br />
Leitung der öffentlichen Stelle oder deren ständigen Vertretung<br />
unmittelbar zu unterstellen; bei obersten Dienstbehörden können sie auch<br />
dem Ministerialdirektor (Amtschef), in Gemeinden einem berufsmäßigen<br />
Gemeinderatsmitglied unterstellt werden. 2 Sie sind in ihrer Eigenschaft als<br />
behördliche Datenschutzbeauftragte weisungsfrei. 3 Sie können sich in<br />
Zweifelsfällen unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz<br />
wenden. 4 Sie dürfen wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht<br />
benachteiligt werden. 5 Sie sind im erforderlichen Umfang von der<br />
Erfüllung sonstiger dienstlicher Aufgaben freizustellen. 6 Die Beschäftigten<br />
öffentlicher Stellen können sich in Angelegenheiten des Datenschutzes an<br />
ihre behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden.<br />
(4) 1 Die behördlichen Datenschutzbeauftragten haben die Aufgabe, auf die<br />
Einhaltung dieses <strong>Gesetze</strong>s und anderer Vorschriften über den<br />
Datenschutz in der öffentlichen Stelle hinzuwirken. 2 Sie können die zur<br />
Überwachung der Einhaltung dieses <strong>Gesetze</strong>s und anderer Vorschriften<br />
über den Datenschutz erforderliche Einsicht in Dateien und Akten der<br />
öffentlichen Stelle nehmen, soweit nicht gesetzliche Regelungen<br />
entgegenstehen; sie dürfen Akten mit personenbezogenen Daten, die dem<br />
Arztgeheimnis unterliegen, Akten über die Sicherheitsüberprüfung und<br />
nicht in Dateien geführte Personalakten nur mit Einwilligung der<br />
Betroffenen einsehen. 3 Sie sind zur Verschwiegenheit über Personen<br />
verpflichtet, die ihnen in ihrer Eigenschaft als behördliche<br />
Datenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese<br />
Tatsachen selbst, soweit sie nicht davon durch diese Personen befreit<br />
werden.<br />
Bay DSG Art. 26 Datenschutzrechtliche Freigabe automatisierter<br />
Verfahren<br />
(1) 1 Der erstmalige Einsatz von automatisierten Verfahren, mit denen<br />
personenbezogene Daten verarbeitet werden, bedarf der vorherigen<br />
schriftlichen Freigabe durch die das Verfahren einsetzende öffentliche<br />
Stelle. 2 Eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Satz 1 ist nicht<br />
erforderlich für Verfahren, welche durch den Vorstand der Anstalt für<br />
Kommunale Datenverarbeitung in Bayern bereits datenschutzrechtlich<br />
freigegeben worden sind, soweit diese Verfahren unverändert<br />
übernommen werden; das Gleiche gilt bei öffentlichen Stellen des<br />
Freistaates Bayern für Verfahren, welche durch das fachlich zuständige<br />
Staatsministerium oder die von ihm ermächtigte öffentliche Stelle für den<br />
landesweiten Einsatz datenschutzrechtlich freigegeben worden sind. 3 Für<br />
wesentliche Änderungen von Verfahren gelten die Sätze 1 und 2<br />
entsprechend.
(2) Die datenschutzrechtliche Freigabe hat folgende Angaben zu enthalten:<br />
1. Bezeichnung des Verfahrens,<br />
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung,<br />
3. Art der gespeicherten Daten,<br />
4. Kreis der Betroffenen,<br />
5. Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger,<br />
6. Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der<br />
Löschung,<br />
7. verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen,<br />
8. im Fall des Art. 6 Abs. 1 bis 3 die Auftragnehmer,<br />
9. Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer.<br />
(3) 1 Öffentliche Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten<br />
rechtzeitig vor dem Einsatz oder der wesentlichen Änderung eines<br />
automatisierten Verfahrens eine Verfahrensbeschreibung mit den in<br />
Absatz 2 aufgeführten Angaben zur Verfügung zu stellen; zugleich ist eine<br />
allgemeine Beschreibung der Art der für das Verfahren eingesetzten<br />
Datenverarbeitungsanlagen und der technischen und organisatorischen<br />
Maßnahmen nach Art. 7 und 8 beizugeben. 2 Die behördlichen<br />
Datenschutzbeauftragten erteilen die datenschutzrechtliche Freigabe,<br />
soweit nicht schon eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Absatz 1<br />
Sätze 2 und 3 vorliegt. 3 Wird ihren datenschutzrechtlichen Einwendungen<br />
nicht Rechnung getragen, so legen sie die Entscheidung über die<br />
datenschutzrechtliche Freigabe den Personen vor, denen sie nach Art. 25<br />
Abs. 3 Satz 1 unterstellt sind; bei den in Art. 15 Abs. 7 genannten Daten<br />
haben sie zuvor eine Stellungnahme des Landesbeauftragten für den<br />
Datenschutz einzuholen.<br />
Bay DSG Art. 27 Verfahrensverzeichnis<br />
(1) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten führen ein Verzeichnis der bei<br />
der öffentlichen Stelle eingesetzten und datenschutzrechtlich<br />
freigegebenen automatisierten Verfahren, mit denen personenbezogene<br />
Daten verarbeitet werden.<br />
(2) In dem Verzeichnis sind für jedes automatisierte Verfahren die in Art. 26<br />
Abs. 2 genannten Angaben fest zu halten.<br />
(3) 1 Das Verfahrensverzeichnis kann von jedem kostenfrei eingesehen<br />
werden. 2 Dies gilt nicht bei Behörden der Staatsanwaltschaft, bei<br />
Justizvollzugsanstalten, bei Führungsaufsichtsstellen, bei Stellen der<br />
Gerichts- und Bewährungshilfe und bei Behörden der Finanzverwaltung,<br />
soweit sie personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen<br />
Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung<br />
und Prüfung speichern. 3 Art. 10 Abs. 5 gilt entsprechend.<br />
Bay DSG Art. 28 Rechtsverordnungsermächtigungen<br />
(1) 1 Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das<br />
Nähere zur Ausgestaltung der datenschutzrechtlichen Freigabe und des<br />
Verfahrensverzeichnisses zu regeln, insbesondere zum Zweck der<br />
Vereinfachung der Verfahren und zur Entlastung der öffentlichen Stellen.<br />
2<br />
Die Staatsregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu<br />
bestimmen, dass
1. für automatisierte Verfahren, die dem internen Verwaltungsablauf<br />
dienen, wie Registraturverfahren, ausschließlich der Erstellung von Texten<br />
dienende Verfahren, Kommunikationsverzeichnisse und<br />
Anschriftenverzeichnisse für die Versendung an die Betroffenen,<br />
2. für automatisierte Verfahren, die ausschließlich Zwecken der<br />
Datensicherung und Datenschutzkontrolle dienen, und<br />
3. für automatisierte Verfahren, deren einziger Zweck das Führen eines<br />
Registers ist, das auf Grund einer Rechtsvorschrift zur Information der<br />
Öffentlichkeit bestimmt ist oder allen Personen, die ein berechtigtes<br />
Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offen steht,<br />
keine Freigabe und Aufnahme in das Verfahrensverzeichnis erforderlich<br />
sind.<br />
(2) 1 Die Bestellung behördlicher Datenschutzbeauftragter, die<br />
datenschutzrechtliche Freigabe und die Führung eines<br />
Verfahrensverzeichnisses sind nicht erforderlich, wenn in öffentlichen<br />
Stellen ausschließlich automatisierte Verfahren eingesetzt werden, von<br />
denen unter Berücksichtigung der erhobenen, verarbeiteten oder<br />
genutzten Daten eine Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten der<br />
Betroffenen unwahrscheinlich ist. 2 Die Staatsministerien regeln für ihren<br />
Geschäftsbereich und für die unter ihrer Aufsicht stehenden juristischen<br />
Personen des öffentlichen Rechts durch Rechtsverordnung, bei welchen<br />
öffentlichen Stellen die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind. 3 In der<br />
Rechtsverordnung sind die in Art. 26 Abs. 2 genannten Angaben fest zu<br />
halten; diese Angaben sind nicht erforderlich für automatisierte Verfahren,<br />
die dem internen Verwaltungsablauf dienen, wie Registraturverfahren,<br />
ausschließlich der Erstellung von Texten dienende Verfahren,<br />
Kommunikationsverzeichnisse und Anschriftenverzeichnisse für die<br />
Versendung an die Betroffenen.<br />
FÜNFTER ABSCHNITT Landesbeauftragter für den Datenschutz<br />
Bay DSG Art. 29 Ernennung und Rechtsstellung<br />
(1) 1 Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregierung einen<br />
Landesbeauftragten für den Datenschutz. 2 Die Ernennung, Entlassung und<br />
Abberufung erfolgt durch den Präsidenten des Landtags. 3 Der<br />
Landesbeauftragte für den Datenschutz ist Beamter auf Zeit und wird für<br />
die Dauer von sechs Jahren berufen. 4 Wiederwahl ist zulässig. 5 Vor Ablauf<br />
seiner Amtszeit kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz auf<br />
seinen Antrag entlassen werden; ohne seine Zustimmung kann er vor<br />
Ablauf seiner Amtszeit nur mit Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl des<br />
Landtags abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung der<br />
Vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies<br />
rechtfertigt.<br />
(2) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amts<br />
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen; er kann sich jederzeit an<br />
den Landtag wenden. 2 Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten<br />
des Landtags. 3 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist oberste<br />
Dienstbehörde im Sinn des § 96 der Strafprozeßordnung und des Art. 6<br />
Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes; die Vorlegung oder
Auslieferung von Akten oder anderen Schriftstücken sowie die<br />
Zeugenaussage bedürfen der Zustimmung des Präsidenten des Landtags.<br />
(3) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bedient sich einer<br />
Geschäftsstelle, die beim Landtag eingerichtet wird;<br />
Verwaltungsangelegenheiten der Geschäftsstelle werden vom<br />
Landtagsamt wahrgenommen, soweit sie nicht der Zuständigkeit des<br />
Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen. 2 Die Stellen sind im<br />
Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu<br />
besetzen. 3 Die Mitarbeiter können, falls sie mit der beabsichtigten<br />
Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im Einvernehmen mit dem<br />
Landesbeauftragten für den Datenschutz versetzt, abgeordnet oder<br />
umgesetzt werden. 4 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist<br />
Dienstvorgesetzter dieser Mitarbeiter. 5 Sie sind in ihrer Tätigkeit nach<br />
diesem Gesetz nur an seine Weisungen gebunden und unterstehen<br />
ausschließlich seiner Dienstaufsicht.<br />
(4) Die Personal- und Sachmittel der Geschäftsstelle werden im Einzelplan des<br />
Landtags gesondert ausgewiesen.<br />
Bay DSG Art. 30 Aufgaben<br />
(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert bei den<br />
öffentlichen Stellen die Einhaltung dieses <strong>Gesetze</strong>s und anderer<br />
Vorschriften über den Datenschutz.<br />
(2) 1 Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz<br />
erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder<br />
besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, insbesondere dem<br />
Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung. 2 Akten über die<br />
Sicherheitsprüfung unterliegen seiner Kontrolle nicht, wenn Betroffene der<br />
Kontrolle der auf sie bezogenen Daten widersprochen haben.<br />
3<br />
Unbeschadet des Kontrollrechts des Landesbeauftragten für den<br />
Datenschutz unterrichtet die speichernde Stelle die Betroffenen in<br />
allgemeiner Form über das ihnen zustehende Widerspruchsrecht. 4 Der<br />
Widerspruch ist schriftlich gegenüber der speichernden Stelle zu erklären.<br />
(3) Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz erstreckt<br />
sich nicht auf personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die<br />
Kommission nach Art. 2 des <strong>Gesetze</strong>s zur Ausführung des <strong>Gesetze</strong>s zu<br />
Artikel 10 Grundgesetz unterliegen, es sei denn, die Kommission ersucht<br />
den Landesbeauftragten für den Datenschutz, die Einhaltung der<br />
Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen und in<br />
bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu<br />
berichten.<br />
(4) 1 Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz über<br />
die Erhebung personenbezogener Daten durch Strafverfolgungsbehörden<br />
bei der Verfolgung von Straftaten ist erst nach Abschluß des<br />
Strafverfahrens zulässig. 2 Sie erstreckt sich nicht auf eine<br />
Datenerhebung, die gerichtlich überprüft wurde. 3 Die Sätze 1 und 2<br />
gelten für die Strafvollstreckung entsprechend.<br />
(5) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz erstattet dem Landtag und<br />
der Staatsregierung alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit. 2 Er
gibt dabei auch einen Überblick über die technischen und<br />
organisatorischen Maßnahmen nach Art. 7 und regt Verbesserungen des<br />
Datenschutzes an. 3 Der Bericht ist in der Datenschutzkommission<br />
vorzuberaten.<br />
(6) Der Landtag oder die Staatsregierung können den Landesbeauftragten für<br />
den Datenschutz ersuchen, bestimmte Vorgänge aus seinem<br />
Aufgabenbereich zu überprüfen.<br />
(7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Aufsichtsbehörden<br />
nach § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes tauschen regelmäßig die in<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben gewonnenen Erfahrungen aus.<br />
Bay DSG Art. 31 Beanstandungen<br />
(1) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz beanstandet festgestellte<br />
Verstöße gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den<br />
Datenschutz und fordert ihre Behebung in angemessener Frist. 2 Der<br />
Landesbeauftragte für den Datenschutz verständigt von der Beanstandung<br />
die nach Art. 25 Abs. 1 für die Sicherstellung des Datenschutzes<br />
verantwortliche Stelle. 3 Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts,<br />
die der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehen, verständigt er<br />
darüber hinaus auch die Aufsichtsbehörde.<br />
(2) 1 Wird die Beanstandung nicht behoben, so fordert der Landesbeauftragte<br />
für den Datenschutz von der für die Sicherstellung des Datenschutzes<br />
nach Art. 25 Abs. 1 verantwortlichen Stelle binnen angemessener Frist<br />
geeignete Maßnahmen. 2 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 3 Hat dies<br />
nach Ablauf dieser Frist keinen Erfolg, verständigt er den Landtag und die<br />
Staatsregierung.<br />
(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann von einer Beanstandung<br />
absehen, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen<br />
behobene Mängel handelt.<br />
Bay DSG Art. 32 Unterstützung durch die öffentlichen Stellen<br />
(1) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist von allen öffentlichen<br />
Stellen in der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 2 Ihm sind alle<br />
zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Auskünfte zu geben und auf<br />
Anforderung alle Unterlagen über die Erhebung, Verarbeitung oder<br />
Nutzung personenbezogener Daten zur Einsicht vorzulegen. 3 Er hat<br />
ungehinderten Zutritt zu allen Diensträumen, in denen öffentliche Stellen<br />
Daten erheben, verarbeiten oder nutzen.<br />
(2) 1 Für<br />
1. Einrichtungen der Rechtspflege, soweit sie strafverfolgend,<br />
strafvollstreckend oder strafvollziehend tätig werden,<br />
2. Behörden, soweit sie Steuern verwalten oder strafverfolgend oder in<br />
Bußgeldverfahren tätig werden und<br />
3. Polizei und Verfassungsschutzbehörden<br />
gilt Absatz 1 nur gegenüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz<br />
selbst und gegenüber den von ihm schriftlich besonders damit<br />
Beauftragten. 2 Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 1 gelten für diese Stellen<br />
nicht, soweit das jeweils zuständige Staatsministerium im Einzelfall
feststellt, daß die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des Freistaates<br />
Bayern, eines anderen Landes oder des Bundes gefährden würde.<br />
(3) Die Staatskanzlei und die Staatsministerien unterrichten den<br />
Landesbeauftragten für den Datenschutz rechtzeitig über Entwürfe von<br />
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Freistaates Bayern sowie über<br />
Planungen bedeutender Automationsvorhaben, sofern sie die Erhebung,<br />
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten betreffen.<br />
(4) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die nach Art. 27 zu führenden<br />
Verfahrensverzeichnisse dem Landesbeauftragten für den Datenschutz auf<br />
Anforderung zuzuleiten.<br />
Bay DSG Art. 33 Datenschutzkommission<br />
(1) 1 Beim Landtag wird eine Datenschutzkommission gebildet. 2 Sie besteht<br />
aus zehn Mitgliedern. 3 Der Landtag bestellt sechs Mitglieder aus seiner<br />
Mitte nach Maßgabe der Stärke seiner Fraktionen; dabei wird das<br />
Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers angewandt. 4 Für Fraktionen, die<br />
hiernach nicht zum Zuge kommen, kann der Landtag jeweils ein weiteres<br />
Mitglied bestellen, auch wenn sich dadurch die Zahl der Mitglieder nach<br />
Satz 2 erhöht. 5 Ferner bestellt der Landtag jeweils ein weiteres Mitglied<br />
auf Vorschlag<br />
1. der Staatsregierung,<br />
2. der kommunalen Spitzenverbände,<br />
3. des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und<br />
Frauen aus dem Bereich der gesetzlichen Sozialversicherungsträger und<br />
4. des Verbands freier Berufe e. V. in Bayern.<br />
6<br />
Für jedes Mitglied der Datenschutzkommission wird zugleich ein<br />
stellvertretendes Mitglied bestellt.<br />
(2) Die Mitglieder der Datenschutzkommission werden für fünf Jahre, die<br />
Mitglieder des Landtags für die Wahldauer des Landtags bestellt; sie sind<br />
in ihrer Tätigkeit an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.<br />
(3) 1 Die Datenschutzkommission unterstützt den Landesbeauftragten für den<br />
Datenschutz in seiner Arbeit. 2 Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.<br />
(4) 1 Die Datenschutzkommission tritt auf Antrag jedes ihrer Mitglieder oder<br />
des Landesbeauftragten für den Datenschutz zusammen. 2 Den Vorsitz<br />
führt ein Mitglied des Landtags.<br />
(5) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz nimmt an allen Sitzungen<br />
teil. 2 Er verständigt die Datenschutzkommission von Beanstandungen<br />
nach Art. 31 Abs. 1. 3 Vor Maßnahmen nach Art. 31 Abs. 2 ist der<br />
Datenschutzkommission Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.<br />
(6) 1 Die Mitglieder der Datenschutzkommission haben, auch nach ihrem<br />
Ausscheiden, über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen<br />
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2 Dies gilt nicht für<br />
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner<br />
Geheimhaltung bedürfen.<br />
(7) Die Mitglieder der Datenschutzkommission erhalten vom<br />
Landesbeauftragten für den Datenschutz Reisekostenvergütung in<br />
entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Bayerischen<br />
Reisekostengesetzes.
SECHSTER ABSCHNITT Tätigkeit der Aufsichtsbehörden für den<br />
Datenschutz bei nicht-öffentlichen Stellen<br />
Bay DSG Art. 34 Mitwirkung des Technischen Überwachungs-Vereins<br />
(1) 1 Die Aufsichtsbehörden nach § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes<br />
bedienen sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben des Technischen<br />
Überwachungs-Vereins Bayern Sachsen e. V.; dieser nimmt insoweit<br />
eigene Aufgaben wahr. 2 Die Bediensteten des Technischen<br />
Überwachungs-Vereins Bayern Sachsen e. V. haben die in § 38 Abs. 4 des<br />
Bundesdatenschutzgesetzes genannten Rechte; auch ihnen gegenüber<br />
besteht die in § 38 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes genannte<br />
Auskunftspflicht. 3 Der Technische Überwachungs-Verein Bayern Sachsen<br />
e. V. erhebt für seine Tätigkeit Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der<br />
Absätze 2 bis 6.<br />
(2) In den Fällen, in denen das Bundesdatenschutzgesetz eine Meldepflicht<br />
gegenüber den Aufsichtsbehörden bestimmt, sind die Gebühren und<br />
Auslagen von den Überwachten zu tragen.<br />
(3) 1 In den Fällen, in denen das Bundesdatenschutzgesetz keine Meldepflicht<br />
gegenüber den Aufsichtsbehörden bestimmt, sind die Gebühren und<br />
Auslagen von den Überprüften zu tragen, wenn Mängel festgestellt<br />
werden. 2 Werden keine Mängel festgestellt, sind Gebühren und Auslagen<br />
von denjenigen zu tragen, die die Tätigkeit veranlaßt haben, soweit dies<br />
nicht der Billigkeit widerspricht.<br />
(4) Für die Unterstützung der Beauftragten für den Datenschutz (§ 4 g Abs. 1<br />
Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes) sind Gebühren und Auslagen von<br />
den natürlichen oder juristischen Personen, Gesellschaften oder anderen<br />
Personenvereinigungen des privaten Rechts zu tragen, die die<br />
Beauftragten für den Datenschutz bestellt haben.<br />
(5) Schulden mehrere die Gebühren und Auslagen, so haften sie<br />
gesamtschuldnerisch.<br />
(6) Art. 71 des <strong>Gesetze</strong>s zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und<br />
anderer <strong>Gesetze</strong> gilt entsprechend.<br />
(7) 1 Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die<br />
Gebühren und Auslagen des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern<br />
Sachsen e. V. festzusetzen. 2 Die Höhe der Gebühren und Auslagen ist<br />
nach dem Aufwand und der Bedeutung der Leistung für die Schuldner zu<br />
bemessen.<br />
Bay DSG Art. 35 Kostenerhebung durch die Aufsichtsbehörden<br />
1 Die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) durch die<br />
Aufsichtsbehörden nach § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes bestimmt sich<br />
nach dem Kostengesetz. 2 Abweichend von Art. 2 Abs. 1 des Kostengesetzes<br />
gelten jedoch Art. 34 Abs. 2 bis 4 entsprechend.<br />
Bay DSG Art. 36 Weitere Aufgaben der Aufsichtsbehörden<br />
Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die<br />
Aufsichtsbehörden nach § 38 Abs. 6 des Bundesdatenschutzgesetzes als<br />
zuständige öffentliche Stellen nach § 33 Abs. 2 Nr. 6 und § 34 Abs. 4 in
Verbindung mit § 33 Abs. 2 Nr. 6 des Bundesdatenschutzgesetzes zu<br />
bestimmen.<br />
SIEBTER ABSCHNITT Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift,<br />
Schlußvorschriften<br />
Bay DSG Art. 37 Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift<br />
(1) Mit Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
unbefugt von diesem Gesetz oder von nach Art. 2 Abs. 7 diesem Gesetz<br />
vorgehenden Rechtsvorschriften geschützte personenbezogene Daten, die<br />
nicht offenkundig sind,<br />
1. speichert, verändert oder übermittelt,<br />
2. zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder<br />
3. abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft.<br />
(2) Ferner kann mit Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro belegt werden, wer<br />
1. die Übermittlung von durch dieses Gesetz oder durch nach Art. 2 Abs. 7<br />
diesem Gesetz vorgehenden Rechtsvorschriften geschützten<br />
personenbezogenen Daten, die nicht offenkundig sind, durch unrichtige<br />
Angaben erschleicht,<br />
2. entgegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 22 Satz 1 oder Art. 23 Abs. 1 die<br />
übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte<br />
weitergibt oder<br />
3. entgegen Art. 23 Abs. 3 Satz 3 die in Art. 23 Abs. 3 Satz 2<br />
bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt.<br />
(3) 1 Wer eine der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Handlungen gegen<br />
Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder<br />
einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei<br />
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2 Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.<br />
3<br />
Antragsberechtigt sind die Betroffenen, die speichernde öffentliche Stelle<br />
und der Landesbeauftragte für den Datenschutz.<br />
Bay DSG Art. 38 Änderung von <strong>Gesetze</strong>n (nicht abgedruckt)<br />
Bay DSG Art. 39 Inkrafttreten, Außerkrafttreten,<br />
Übergangsbestimmungen<br />
(1) 1 Dieses Gesetz tritt am 1. März 1994 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt das<br />
Bayerische Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten<br />
bei der Datenverarbeitung (<strong>Bayerisches</strong> Datenschutzgesetz – BayDSG)<br />
vom 28. April 1978 (BayRS 204-1-I), zuletzt geändert durch Art. 24 des<br />
<strong>Gesetze</strong>s vom 24. August 1990 (GVBl S. 323), außer Kraft. 3 Abweichend<br />
von Satz 2 tritt Art. 7 des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s zum Schutz vor<br />
Mißbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung vom<br />
28. April 1978 am 1. August 1993 außer Kraft. 4 Abweichend von Satz 1<br />
treten Art. 8 Abs. 3 Sätze 4 und 5 erst am 1. März 1995 in Kraft.<br />
(2) Die Verordnung über das Datenschutzregister<br />
(Datenschutzregisterverordnung – DSRegV) vom 23. November 1978<br />
(BayRS 204-1-1-I) tritt am 1. August 1993 außer Kraft.
(3) Die Berufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz erfolgt nach<br />
den Bestimmungen des Art. 29 Abs. 1 erstmalig zum 1. April 1994.<br />
(4) 1 Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s bereits<br />
datenschutzrechtlich freigegeben worden sind, müssen nicht erneut nach<br />
Art. 26 dieses <strong>Gesetze</strong>s datenschutzrechtlich freigegeben werden. 2 Die<br />
Anlagen- und Verfahrensverzeichnisse nach Art. 27 sind bis zum 1. März<br />
1995 einzurichten.
<strong>Bayerisches</strong> Gesetz über das<br />
Erziehungs- und Unterrichtswesen (Bay<br />
EUG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, ber. S. 632), geändert durch<br />
<strong>Gesetze</strong> vom 24. Dezember 2001 (GVBl. S. 1004), vom 8. Februar 2002 (GVBl. S. 32), vom 25. Juli<br />
2002 (GVBl. S. 326), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 962), vom 24. März 2003 (GVBl. S. 262),<br />
vom 26. Juli 2004 (GVBl. S. 282), vom 23. November 2004 (GVBl. S. 443), vom 8. März 2005<br />
(GVBl. S. 71), vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 264, ber. S. 516), vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 272),<br />
vom 26. Juli 2006 (GVBl. S. 397), vom 24. Juli 2007 (GVBl. S. 533), vom 20. Dezember 2007<br />
(GVBl. S. 919), vom 6. Mai 2008 (GVBl. S. 158), vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 467) (FN BayRS<br />
2230-1-1-UK)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Erster Teil Grundlagen<br />
Art. 1 Bildungs- und Erziehungsauftrag<br />
Art. 2 Aufgaben der Schulen<br />
Art. 3 Öffentliche und private Unterrichtseinrichtungen<br />
Art. 4 Schulbauten<br />
Art. 5 Schuljahr und Ferien<br />
Zweiter Teil Die öffentlichen Schulen<br />
Abschnitt I Gliederung des Schulwesens<br />
Art. 6<br />
Abschnitt II Die Schularten<br />
a) Allgemein bildende Schulen<br />
Art. 7 Die Grundschule und die Hauptschule (die Volksschule)<br />
Art. 8 Die Realschule<br />
Art. 9 Das Gymnasium<br />
Art. 10 Schulen des Zweiten Bildungswegs<br />
b) Berufliche Schulen<br />
Art. 11 Die Berufsschule
Art. 12<br />
Art. 13 Die Berufsfachschule<br />
Art. 14 Die Wirtschaftsschule<br />
Art. 15 Die Fachschule<br />
Art. 16 Die Fachoberschule<br />
Art. 17 Die Berufsoberschule<br />
Art. 18 Die Fachakademie<br />
c) Förderschulen und Schulen für Kranke<br />
Art. 19 Aufgaben der Förderschulen<br />
Art. 20 Förderschwerpunkte, Aufbau und Gliederung der Förderschulen<br />
Art. 21 Mobile Sonderpädagogische Dienste<br />
Art. 22 Schulvorbereitende Einrichtungen und Mobile Sonderpädagogische<br />
Hilfe<br />
Art. 23 Schulen für Kranke; Hausunterricht<br />
Art. 24 Förderschulen und Schulen für Kranke; Ausführungsbestimmungen<br />
d) Mittlerer Schulabschluss<br />
Art. 25 Mittlerer Schulabschluss<br />
Abschnitt III Errichtung und Auflösung von öffentlichen Schulen<br />
a) Allgemeine Grundsätze<br />
Art. 26 Staatliche Schulen<br />
Art. 27 Kommunale Schulen<br />
Art. 28 Berücksichtigung der Landesplanung<br />
Art. 29 Bezeichnung von Schulen<br />
Art. 30 Zusammenarbeit von Schulen
Art. 31 Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Einrichtungen der Erziehung,<br />
Bildung und Betreuung<br />
b) Besondere Regelungen für Pflichtschulen<br />
Art. 32 Volksschulen<br />
Art. 33 Förderschulen und Schulen für Kranke<br />
Art. 34 Berufsschulen<br />
Abschnitt IV Schulpflicht, Pflichtschulen, Sprengelpflicht,<br />
Gastschulverhältnisse, Wahl des schulischen Bildungswegs<br />
a) Schulpflicht<br />
Art. 35 Schulpflicht<br />
Art. 36 Erfüllung der Schulpflicht<br />
b) Vollzeitschulpflicht<br />
Art. 37 Vollzeitschulpflicht<br />
Artikel 37 a<br />
Art. 38 Freiwilliger Besuch der Hauptschule<br />
c) Berufsschulpflicht<br />
Art. 39 Berufsschulpflicht<br />
Art. 40 Berufsschulberechtigung<br />
d) Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf und für kranke Schülerinnen und Schüler<br />
Art. 41<br />
e) Sprengelpflicht, Gastschulverhältnisse<br />
Art. 42 Sprengelpflicht beim Besuch öffentlicher Pflichtschulen<br />
Art. 43 Gastschulverhältnisse<br />
f) Wahl des schulischen Bildungswesens<br />
Art. 44<br />
Abschnitt V Inhalte des Unterrichts
Art. 45 Lehrpläne, Stundentafeln, Richtlinien und Bildungsstandards<br />
Art. 46 Religionsunterricht<br />
Art. 47 Ethikunterricht<br />
Art. 48 Familien- und Sexualerziehung<br />
Abschnitt VI Grundsätze des Schulbetriebs<br />
Art. 49 Jahrgangsstufen, Klassen, Unterrichtsgruppen<br />
Art. 50 Fächer, Kurse, fachpraktische Ausbildung<br />
Art. 51 Lernmittel, Lehrmittel<br />
Art. 52 Nachweise des Leistungsstands, Bewertung der Leistungen, Zeugnisse<br />
Art. 53 Vorrücken und Wiederholen<br />
Art. 54 Abschlussprüfung<br />
Art. 55 Beendigung des Schulbesuchs<br />
Abschnitt VII Schülerinnen und Schüler<br />
Art. 56 Rechte und Pflichten<br />
Abschnitt VIII Schulleiterin oder Schulleiter, Lehrerkonferenz, Lehrkräfte<br />
Art. 57 Schulleiterin oder Schulleiter<br />
Art. 58 Lehrerkonferenz<br />
Art. 59 Lehrkräfte<br />
Art. 60 Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer, Werkmeisterinnen bzw.<br />
Werkmeister, Heilpädagogische Förderlehrerinnen bzw. Heilpädagogische<br />
Förderlehrer<br />
Art. 61 Angehörige kirchlicher Genossenschaften<br />
Abschnitt IX Einrichtungen zur Mitgestaltung des schulischen Lebens<br />
a) Schülermitverantwortung
Art. 62 Schülermitverantwortung, Schülervertretung<br />
Art. 62 a Landesschülerkonferenz, Landesschülerrat<br />
Art. 63 Schülerzeitung<br />
b) Elternvertretung<br />
Art. 64 Einrichtungen<br />
Art. 65 Bedeutung und Aufgaben<br />
Art. 66 Zusammensetzung des Elternbeirats<br />
Art. 67 Unterrichtung des Elternbeirats<br />
Art. 68 Durchführungsvorschriften<br />
c) Schulforum<br />
Art. 69<br />
d) Berufsschulbeirat<br />
Art. 70 Berufsschulbeirat<br />
Art. 71 Aufgaben<br />
Art. 72 Durchführungsvorschriften<br />
e) Landesschulbeirat<br />
Art. 73<br />
Abschnitt X Schule und Erziehungsberechtigte, Schule und Arbeitgeber<br />
Art. 74 Zusammenarbeit der Schule mit den Erziehungsberechtigten<br />
Art. 75 Pflichten der Schule<br />
Art. 76 Pflichten der Erziehungsberechtigten<br />
Art. 77 Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber<br />
Abschnitt XI Besondere Einrichtungen und Schulgesundheit<br />
Art. 78 Schulberatung
Art. 79 Bildstellenwesen<br />
Art. 80 Schulgesundheit<br />
Abschnitt XII Schulversuche, MODUS-Schulen<br />
Art. 81 Zweck<br />
Art. 82 Zulässigkeit<br />
Art. 83 Organisation<br />
Abschnitt XIII Kommerzielle und politische Werbung, Erhebung und<br />
Verarbeitung von Daten<br />
Art. 84 Kommerzielle und politische Werbung<br />
Art. 85 Erhebung und Verarbeitung von Daten<br />
Abschnitt XIV Ordnungsmaßnahmen als Erziehungsmaßnahmen<br />
Art. 86 Ordnungsmaßnahmen als Erziehungsmaßnahmen<br />
Art. 87 Entlassung<br />
Art. 88 Ausschluss<br />
Art. 88 a Unterrichtung der früheren Erziehungsberechtigten volljähriger<br />
Schülerinnen und Schüler über Ordnungsmaßnahmen<br />
Abschnitt XV Schulordnung<br />
Art. 89<br />
Dritter Teil Private Unterrichtseinrichtungen<br />
Abschnitt I Private Schulen (Schulen in freier Trägerschaft)<br />
a) Aufgabe<br />
Art. 90<br />
b) Ersatzschulen<br />
Art. 91 Begriffsbestimmung<br />
Art. 92 Genehmigung
Art. 93 Mindestlehrpläne, Mindeststundentafeln, Prüfungsordnungen<br />
Art. 94 Voraussetzungen für die Unterrichtsgenehmigung<br />
Art. 95 Untersagung der Tätigkeit<br />
Art. 96 Keine Sonderung der Schülerinnen und Schüler<br />
Art. 97 Wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte<br />
Art. 98 Bedingungen und Erlöschen der Genehmigung<br />
Art. 99 Änderungen der Genehmigungsvoraussetzungen, Auflösung einer<br />
Schule<br />
Art. 100 Staatlich anerkannte Ersatzschulen<br />
Art. 101 Ersatzschulen mit dem Charakter öffentlicher Schulen<br />
c) Ergänzungsschulen<br />
Art. 102 Begriffsbestimmung, Anzeigepflicht<br />
Art. 103 Untersagung<br />
Art. 104 Mindestlehrpläne, Prüfungen<br />
Abschnitt II Lehrgänge und Privatunterricht<br />
Art. 105<br />
Vierter Teil Heime für Schülerinnen und Schüler, Internate, Mittagsbetreuung<br />
Art. 106 Heimschulen, Internatsschulen<br />
Art. 107 Schülerheime, Mittagsbetreuung<br />
Art. 108 Heime bei Förderschulen<br />
Art. 109 Tagesheimschulen<br />
Art. 110 Untersagung<br />
Fünfter Teil Schulaufsicht<br />
Art. 111 Allgemeines, Leistungsvergleiche
Art. 112 Aufsicht über den Religionsunterricht<br />
Art. 113 Befugnisse der Schulaufsichtsbehörden<br />
Art. 113 a Evaluation<br />
Art. 114 Sachliche Zuständigkeit<br />
Art. 115 Schulämter<br />
Art. 116 Beteiligung an der Schulaufsicht<br />
Art. 117 Übertragung der Zuständigkeit<br />
Sechster Teil Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht,<br />
Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 118 Schulzwang<br />
Art. 119 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 120 Einschränkung von Grundrechten<br />
Siebter Teil Übergangs- und Schlussbestimmungen<br />
Abschnitt I Übergangsvorschriften zu diesem Gesetz in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 29. Februar 1988<br />
Art. 121 Ausnahmen vom Geltungsbereich des <strong>Gesetze</strong>s<br />
Art. 122 Besondere Bestimmungen<br />
Art. 123 Aufrechterhaltung von Sondervorschriften<br />
Art. 124 Wahrung des Rechtsstands<br />
Art. 125 Staatsinstitute für die Ausbildung von Fachlehrern und Förderlehrern<br />
Abschnitt II Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Änderung des<br />
Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über das Erziehungs- und Unterrichtswesen und anderer<br />
<strong>Gesetze</strong> vom 25. Juni 1994<br />
Art. 126 Schulen besonderer Art<br />
Art. 127 Schulnamen
Abschnitt III Schlussbestimmungen<br />
Art. 128 Rechts- und Verwaltungsvorschriften<br />
Art. 129 In-Kraft-Treten<br />
Erster Teil Grundlagen<br />
Bay EUG Art. 1 Bildungs- und Erziehungsauftrag<br />
(1) 1 Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und<br />
Erziehungsauftrag zu verwirklichen. 2 Sie sollen Wissen und Können<br />
vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. 3 Oberste<br />
Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung,<br />
vor der Würde des Menschen und vor der Gleichberechtigung von Männern<br />
und Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und<br />
Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles<br />
Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und<br />
Umwelt. 4 Die Schülerinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie, in<br />
der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinn<br />
der Völkerversöhnung zu erziehen.<br />
(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungsmäßige<br />
Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu achten.<br />
Bay EUG Art. 2 Aufgaben der Schulen<br />
(1) 1 Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe,<br />
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwickeln,<br />
zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu<br />
befähigen,<br />
zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher<br />
Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen, zur<br />
Anerkennung kultureller und religiöser Werte zu erziehen,<br />
Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter<br />
besonderer Berücksichtigung Bayerns zu vermitteln und die Liebe zur<br />
Heimat zu wecken,<br />
zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen,<br />
im Geist der Völkerverständigung zu erziehen,<br />
die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich-demokratischen und<br />
sozialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und außen<br />
zu fördern,<br />
die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu<br />
fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken,<br />
die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung ihrer<br />
Rechte und Pflichten in Familie, Staat und Gesellschaft zu befähigen,<br />
insbesondere Buben und junge Männer zu ermutigen, ihre künftige<br />
Vaterrolle verantwortlich anzunehmen sowie Familien- und Hausarbeit<br />
partnerschaftlich zu teilen,
auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu<br />
unterstützen und dabei insbesondere Mädchen und Frauen zu ermutigen,<br />
ihr Berufsspektrum zu erweitern,<br />
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu wecken.<br />
2<br />
Die sonderpädagogische Förderung ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten<br />
Aufgabe aller Schulen. 3 Sie werden dabei von den Mobilen<br />
Sonderpädagogischen Diensten unterstützt.<br />
(2) Die Schulen erschließen den Schülerinnen und Schülern das überlieferte<br />
und bewährte Bildungsgut und machen sie mit Neuem vertraut.<br />
(3) 1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehrkräfte, die Schülerinnen<br />
und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten (Schulgemeinschaft)<br />
arbeiten vertrauensvoll zusammen. 2 Die Schulgemeinschaft ist bestrebt,<br />
im Rahmen der gestärkten Eigenverantwortung der Schule das Lernklima<br />
und das Schulleben positiv und transparent zu gestalten und<br />
Meinungsverschiedenheiten im Rahmen der in der Schulgemeinschaft<br />
Verantwortlichen zu lösen.<br />
(4) 1 Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. 2 Die<br />
Öffnung erfolgt durch die Zusammenarbeit der Schulen mit<br />
außerschulischen Einrichtungen, insbesondere mit Betrieben, Sport- und<br />
anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, freien Trägern der<br />
Jugendhilfe, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit<br />
Einrichtungen der Weiterbildung.<br />
Bay EUG Art. 3 Öffentliche und private Unterrichtseinrichtungen<br />
(1) 1 Öffentliche Schulen sind staatliche oder kommunale Schulen. 2 Staatliche<br />
Schulen sind Schulen, bei denen der Dienstherr des Lehrpersonals der<br />
Freistaat Bayern ist. 3 Kommunale Schulen sind Schulen, bei denen der<br />
Dienstherr des Lehrpersonals eine bayerische kommunale Körperschaft<br />
(Gemeinde, Landkreis, Bezirk oder Zweckverband, ein<br />
Kommunalunternehmen oder ein gemeinsames Kommunalunternehmen)<br />
ist. 4 Öffentliche Schulen sind nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten.<br />
(2) 1 Private Schulen (Schulen in freier Trägerschaft) sind alle Schulen, die<br />
nicht öffentliche Schulen im Sinn des Absatzes 1 sind. 2 Sie müssen eine<br />
Bezeichnung führen, die eine Verwechslung mit öffentlichen Schulen<br />
ausschließt.<br />
(3) weggefallen<br />
Bay EUG Art. 4 Schulbauten<br />
(1) Die dem Unterricht dienenden Räume, Anlagen und sonstigen<br />
Einrichtungen müssen hinsichtlich Größe, baulicher Beschaffenheit und<br />
Ausstattung die Durchführung eines einwandfreien Schulbetriebs<br />
gewährleisten.<br />
(2) 1 Der Bau von öffentlichen Schulen und von privaten Ersatzschulen bedarf<br />
der schulaufsichtlichen Genehmigung; das Verfahren sowie die<br />
Mindestanforderungen hinsichtlich des Raumbedarfs regelt das<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung. 2 Bei Schulen,<br />
die nicht zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus gehören, entscheidet das zuständige Ressort im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium der Finanzen.<br />
Bay EUG Art. 5 Schuljahr und Ferien<br />
(1) 1 Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des folgenden<br />
Kalenderjahres. 2 Für einzelne Schularten können in der Schulordnung aus<br />
besonderen Gründen davon abweichende Ausbildungsabschnitte<br />
vorgesehen werden.<br />
(2) Die Ferien werden durch die Ferienordnung festgesetzt, die das zuständige<br />
Staatsministerium erlässt.<br />
Zweiter Teil Die öffentlichen Schulen<br />
Abschnitt I Gliederung des Schulwesens<br />
Bay EUG Art. 6<br />
(1) 1 Das Schulwesen gliedert sich in allgemein bildende und berufliche<br />
Schularten. 2 Diese haben im Rahmen des gemeinsamen Bildungs- und<br />
Erziehungsauftrags ihre eigenständige, gleichwertige Aufgabe.<br />
(2) Es bestehen folgende Schularten:<br />
1. Allgemein bildende Schulen:<br />
a) die Grundschule und die Hauptschule (die Volksschule),<br />
b) die Realschule,<br />
c) das Gymnasium,<br />
d) die Schulen des Zweiten Bildungswegs:<br />
aa) die Abendrealschule,<br />
bb) das Abendgymnasium,<br />
cc) das Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife);<br />
2. Berufliche Schulen:<br />
a) die Berufsschule,<br />
b) die Berufsfachschule,<br />
c) die Wirtschaftsschule,<br />
d) die Fachschule,<br />
e) die Fachoberschule,<br />
f) die Berufsoberschule,<br />
g) die Fachakademie;<br />
3. Förderschulen (Schulen zur sonderpädagogischen Förderung):<br />
a) allgemein bildende Förderschulen,<br />
b) berufliche Förderschulen;<br />
4. Schulen für Kranke.<br />
(3) Innerhalb einer Schulart können Ausbildungsrichtungen, die einen<br />
gemeinsamen besonderen Schwerpunkt des Lehrplans bezeichnen (z. B.<br />
naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium) und Fachrichtungen<br />
für gleichartige fachliche Zielsetzungen (z. B. Technikerschule für<br />
Elektrotechnik) eingerichtet werden.<br />
(4) 1 Fachoberschule und Berufsoberschule bilden die Berufliche Oberschule;<br />
diese kann Außenstellen an staatlichen Berufsschulen führen.
2 Fachschulen und Fachakademien sind Einrichtungen des postsekundären<br />
Bereichs.<br />
Abschnitt II Die Schularten<br />
a) Allgemein bildende Schulen<br />
Bay EUG Art. 7 Die Grundschule und die Hauptschule (die Volksschule)<br />
(1) Die Volksschule besteht aus der Grundschule und der Hauptschule.<br />
(2) 1 In den Volksschulen werden die Schülerinnen und Schüler nach den<br />
gemeinsamen Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und<br />
erzogen. 2 In Klassen mit Schülerinnen und Schülern gleichen<br />
Bekenntnisses wird darüber hinaus den besonderen Grundsätzen dieses<br />
Bekenntnisses Rechnung getragen.<br />
(3) 1 Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in<br />
jedem Klassenraum ein Kreuz angebracht. 2 Damit kommt der Wille zum<br />
Ausdruck, die obersten Bildungsziele der Verfassung auf der Grundlage<br />
christlicher und abendländischer Werte unter Wahrung der<br />
Glaubensfreiheit zu verwirklichen. 3 Wird der Anbringung des Kreuzes aus<br />
ernsthaften und einsehbaren Gründen des Glaubens oder der<br />
Weltanschauung durch die Erziehungsberechtigten widersprochen,<br />
versucht die Schulleiterin bzw. der Schulleiter eine gütliche Einigung.<br />
4<br />
Gelingt eine Einigung nicht, hat er nach Unterrichtung des Schulamts für<br />
den Einzelfall eine Regelung zu treffen, welche die Glaubensfreiheit des<br />
Widersprechenden achtet und die religiösen und weltanschaulichen<br />
Überzeugungen aller in der Klasse Betroffenen zu einem gerechten<br />
Ausgleich bringt; dabei ist auch der Wille der Mehrheit, soweit möglich, zu<br />
berücksichtigen.<br />
(4) 1 Die Grundschule schafft durch die Vermittlung einer grundlegenden<br />
Bildung die Voraussetzungen für jede weitere schulische Bildung. 2 Sie gibt<br />
in Jahren der kindlichen Entwicklung Hilfen für die persönliche Entfaltung.<br />
3<br />
Um den Kindern den Übergang zu erleichtern, arbeitet die Grundschule<br />
mit dem Kindergarten zusammen.<br />
(5) 1 Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. 2 Sie vereinigt alle<br />
Schulpflichtigen dieser Jahrgangsstufen, soweit sie nicht eine Förderschule<br />
besuchen.<br />
(6) 1 Die Hauptschule vermittelt eine grundlegende Allgemeinbildung, bietet<br />
Hilfen zur Berufsfindung und schafft Voraussetzungen für eine qualifizierte<br />
berufliche Bildung, sie eröffnet in Verbindung mit dem beruflichen<br />
Schulwesen Bildungswege, die zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung<br />
und zu weiteren beruflichen Qualifikationen führen können, sie schafft die<br />
schulischen Voraussetzungen für den Übertritt in weitere schulische<br />
Bildungsgänge bis zur Hochschulreife. 2 Die Hauptschule spricht<br />
Schülerinnen und Schüler an, die den Schwerpunkt ihrer Anlagen,<br />
Interessen und Leistungen im anschaulich-konkreten Denken und im<br />
praktischen Umgang mit den Dingen haben. 3 Das breite Feld von<br />
unterschiedlichen Anlagen, Interessen und Neigungen wird durch ein<br />
differenziertes Auswahlangebot neben den für alle Schülerinnen und
Schüler verbindlichen Fächern berücksichtigt; hierfür ist die Bildung<br />
eigener Klassen und Kurse möglich, z. B. Praxisklassen, Klassen bzw.<br />
Kurse für Aussiedlerschüler und Schülerinnen und Schüler mit nicht<br />
deutscher Muttersprache. 4 Für besonders leistungsstarke Schülerinnen<br />
und Schüler werden ab der Jahrgangsstufe 7 Mittlere-Reife-Klassen<br />
angeboten, in den Jahrgangsstufen 7 und 8 zur Vorbereitung auf Mittlere-<br />
Reife-Klassen auch Mittlere-Reife-Kurse.<br />
(7) 1 Die Hauptschule baut auf der Grundschule auf und umfasst die<br />
Jahrgangsstufen 5 bis 9 und, soweit Mittlere-Reife-Klassen in der<br />
Jahrgangsstufe 10 angeboten werden, auch die Jahrgangsstufe 10. 2 In<br />
der Jahrgangsstufe 9 verleiht sie, wenn die erforderlichen Leistungen<br />
erbracht sind, den erfolgreichen Hauptschulabschluss; die Schülerinnen<br />
und Schüler können durch eine besondere Leistungsfeststellung den<br />
qualifizierenden Hauptschulabschluss erwerben. 3 In der Jahrgangsstufe 10<br />
führt die Mittlere-Reife-Klasse zum mittleren Schulabschluss.<br />
(8) 1 Die Hauptschule stellt auf Antrag das Zeugnis über den qualifizierten<br />
beruflichen Bildungsabschluss aus, wenn der qualifizierende<br />
Hauptschulabschluss, befriedigende Kenntnisse in Englisch, die dem<br />
Leistungsstand eines fünfjährigen Unterrichts entsprechen, sowie ein<br />
überdurchschnittlicher Berufsabschluss nachgewiesen werden; Art. 11<br />
Abs. 2 Satz 2 Halbsätze 2 und 3 gelten entsprechend. 2 Örtlich zuständig<br />
ist die Hauptschule, an der der qualifizierende Hauptschulabschluss<br />
erworben worden ist.<br />
Bay EUG Art. 8 Die Realschule<br />
(1) 1 Die Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende<br />
Bildung. 2 Die Realschule ist gekennzeichnet durch ein in sich<br />
geschlossenes Bildungsangebot, das auch berufsorientierte Fächer<br />
einschließt. 3 Sie legt damit den Grund für eine Berufsausbildung und eine<br />
spätere qualifizierte Tätigkeit in einem weiten Bereich von Berufen mit<br />
vielfältigen theoretischen und praktischen Anforderungen. 4 Sie schafft die<br />
schulischen Voraussetzungen für den Übertritt in weitere schulische<br />
Bildungsgänge bis zur Hochschulreife.<br />
(2) 1 Die Realschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10, Realschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung auch weitere Jahrgangsstufen. 2 Sie baut<br />
auf der Grundschule auf und verleiht nach bestandener Abschlussprüfung<br />
den Realschulabschluss.<br />
(3) An der Realschule können ab der Jahrgangsstufe 7 folgende<br />
Ausbildungsrichtungen eingerichtet werden:<br />
1. Ausbildungsrichtung I mit Schwerpunkt im mathematischnaturwissenschaftlich-technischen<br />
Bereich,<br />
2. Ausbildungsrichtung II mit Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich,<br />
3. Ausbildungsrichtung III mit Schwerpunkt im fremdsprachlichen Bereich;<br />
die Ausbildungsrichtung kann ergänzt werden durch Schwerpunkte im<br />
musisch-gestaltenden, im hauswirtschaftlichen und sozialen Bereich.
Bay EUG Art. 9 Das Gymnasium<br />
Gemäß § 2 Abs. 1 des <strong>Gesetze</strong>s zur Änderung des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über das Erziehungs-<br />
und Unterrichtswesen vom 26. Juli 2004 (GVBl. S. 282) sind die Änderungen in § 9 am<br />
1. August in Kraft getreten. Abweichend davon gilt gemäß § 2 Abs. 2 Art. 9 Abs. 2 Satz 1,<br />
Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 BayEUG im Schuljahr 2004/2005 für die Jahrgangsstufen 7 mit 13, im<br />
Schuljahr 2005/2006 für die Jahrgangsstufen 8 mit 13, im Schuljahr 2006/2007 für die<br />
Jahrgangsstufen 9 mit 13, im Schuljahr 2007/2008 für die Jahrgangsstufen 10 mit 13, im<br />
Schuljahr 2008/2009 für die Jahrgangsstufen 11 mit 13, im Schuljahr 2009/2010 für die<br />
Jahrgangsstufen 12 und 13 und im Schuljahr 2010/11 für die Jahrgangsstufe 13 in der<br />
bisherigen Fassung weiter.<br />
(1) Das Gymnasium vermittelt die vertiefte allgemeine Bildung, die für ein<br />
Hochschulstudium vorausgesetzt wird; es schafft auch zusätzliche<br />
Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule.<br />
(2) 1 Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 12. 2 Es baut auf der<br />
Grundschule auf, schließt mit der Abiturprüfung ab und verleiht die<br />
allgemeine Hochschulreife.<br />
(3) 1 Am Gymnasium können folgende Ausbildungsrichtungen eingerichtet<br />
werden:<br />
1. Sprachliches Gymnasium; am Sprachlichen Gymnasium kann ein<br />
humanistisches Profil mit Latein als erster oder zweiter und Griechisch als<br />
dritter Fremdsprache eingerichtet werden; ein solches Gymnasium führt<br />
die Bezeichnung “Humanistisches Gymnasium”,<br />
2. Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium,<br />
3. Musisches Gymnasium,<br />
4. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium; dabei wird ein<br />
wirtschaftswissenschaftliches und/oder ein sozialwissenschaftliches Profil<br />
eingerichtet.<br />
2<br />
Bei der Ausbildungsrichtung nach Satz 1 Nr. 3 können bestehenden<br />
Sonderformen mit den Jahrgangsstufen 7 bis 12 weitergeführt werden.<br />
(4) 1 Für die Oberstufe gelten folgende Bestimmungen:<br />
1. Die Qualifikationsphase umfasst die Jahrgangsstufen 11 und 12.<br />
2. Die Jahrgangsstufen 11 und 12 gliedern sich in je zwei<br />
Ausbildungsabschnitte. Vorrückungsentscheidungen werden nicht<br />
getroffen. Es können Fächer und Seminare eingerichtet werden.<br />
3. In den Jahrgangsstufen 11 und 12 wird die Leistungsbewertung durch<br />
Noten und durch ein Punktesystem vorgenommen.<br />
4. Die allgemeine Hochschulreife wird auf Grund einer Gesamtqualifikation<br />
zuerkannt, die in der Abiturprüfung und in den Jahrgangsstufen 11 und 12<br />
erworben wird.<br />
2<br />
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, das<br />
Nähere zur Ausführung von Satz 1 Nrn. 1 bis 4 in der Schulordnung zu<br />
regeln, insbesondere das Fächerangebot und seine Zusammenfassung zu<br />
Aufgabenfeldern einschließlich der Wahlmöglichkeiten und<br />
Belegungsgrundsätze, die Leistungserhebung und -bewertung, die<br />
Voraussetzungen der Zulassung zur Abiturprüfung, die Bildung der<br />
Gesamtqualifikation, die Voraussetzungen für die Zuerkennung der<br />
allgemeinen Hochschulreife und die Gestaltung der Zeugnisse.
Bay EUG Art. 10 Schulen des Zweiten Bildungswegs<br />
(1) 1 Die Abendrealschule ist eine Schule, die Berufstätige im dreijährigen<br />
Abendunterricht zum Realschulabschluss führt. 2 Der Unterricht kann auch<br />
auf vier Jahre verteilt werden. 3 In der Abschlussklasse kann<br />
Tagesunterricht erteilt werden.<br />
(2) 1 Das Abendgymnasium ist eine Schule, die Berufstätige im vierjährigen<br />
Abendunterricht zur allgemeinen Hochschulreife führt. 2 In der<br />
Abschlussklasse kann Tagesunterricht erteilt werden.<br />
(3) Das Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife) ist ein Gymnasium<br />
besonderer Art, das Erwachsene, die sich bereits im Berufsleben bewährt<br />
haben, im dreijährigen Unterricht zur allgemeinen Hochschulreife führt.<br />
(4) Die Führung eines Familienhaushalts ist einer Berufstätigkeit<br />
gleichgestellt.<br />
b) Berufliche Schulen<br />
Bay EUG Art. 11 Die Berufsschule<br />
(1) 1 Die Berufsschule ist eine Schule mit Teilzeit- und Vollzeitunterricht im<br />
Rahmen der beruflichen Ausbildung, die von Berufsschulpflichtigen und<br />
Berufsschulberechtigten besucht wird. 2 Sie hat die Aufgabe, die<br />
Schülerinnen und Schüler in Abstimmung mit der betrieblichen<br />
Berufsausbildung oder unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Tätigkeit<br />
beruflich zu bilden und zu erziehen und die allgemeine Bildung zu fördern.<br />
(2) 1 Die Berufsschule verleiht nach Maßgabe der erzielten Leistungen den<br />
erfolgreichen Berufsschulabschluss. 2 Bei überdurchschnittlichen<br />
Leistungen wird mit dem erfolgreichen Berufsschulabschluss auch der<br />
mittlere Schulabschluss verliehen, wenn befriedigende Kenntnisse in<br />
Englisch, die dem Leistungsstand eines fünfjährigen Unterrichts<br />
entsprechen, und eine abgeschlossene Berufsausbildung nachgewiesen<br />
werden; in Fällen besonderer Härte kann eine andere moderne<br />
Fremdsprache als Englisch genehmigt werden; das Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus trifft die näheren Regelungen.<br />
(3) 1 Die Berufsschulen haben insbesondere die allgemeinen,<br />
berufsfeldübergreifenden sowie die für den Ausbildungsberuf oder die<br />
berufliche Tätigkeit erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse zu<br />
vermitteln und die fachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu<br />
vertiefen; im Berufsgrundschuljahr obliegt ihnen auf Berufsfeldbreite die<br />
Vermittlung von fachtheoretischen und fachpraktischen Kenntnissen und<br />
Fertigkeiten. 2 Die Ausbildung in der Berufsschule umfasst eine einjährige<br />
Grundstufe und eine darauf aufbauende mindestens einjährige Fachstufe.<br />
3<br />
Der Unterricht in der Grundstufe wird durchgeführt<br />
1. für anerkannte Ausbildungsberufe, die einem Berufsfeld zugeordnet<br />
sind, zur Vermittlung beruflicher Grundbildung<br />
a) im Teilzeitunterricht an einzelnen Unterrichtstagen oder als<br />
Blockunterricht (Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form)<br />
oder<br />
b) im Vollzeitunterricht (Berufsgrundschuljahr),<br />
2. für anerkannte Ausbildungsberufe, die keinem Berufsfeld zugeordnet
sind, in Teilzeitunterricht an einzelnen Unterrichtstagen oder als<br />
Blockunterricht.<br />
4<br />
Der Unterricht in der Grundstufe wird für Berufe nach Satz 3 Nr. 1 auf<br />
Berufsfelder, für Berufe nach Satz 3 Nr. 2 auf die einzelnen<br />
Ausbildungsberufe bezogen erteilt. 5 Beim Unterricht auf Berufsfeldbreite<br />
sind Berufsfeldschwerpunkte in dem rechtlich vorgegebenen Rahmen zu<br />
bilden. 6 Der Unterricht in der Fachstufe wird berufsspezifisch in<br />
Teilzeitform an einzelnen Unterrichtstagen oder als Blockunterricht erteilt.<br />
(4) 1 Die berufliche Grundbildung im Unterricht der Grundstufe wird durch<br />
Rechtsverordnung schrittweise sektoral und regional nach Maßgabe der<br />
fachlichen und regionalen Erfordernisse und der baulichen,<br />
organisatorischen und personellen Voraussetzungen, insbesondere<br />
vorhandener Einrichtungen, eingeführt; nach denselben Gesichtspunkten<br />
wird geregelt, ob die berufliche Grundbildung nach Absatz 3 Satz 3 Nr. 1<br />
im Vollzeit- oder im Teilzeitunterricht durchgeführt werden soll. 2 Für das<br />
Berufsgrundschuljahr werden die Berufsfelder festgelegt. 3 Die<br />
Rechtsverordnung wird vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus<br />
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem<br />
jeweils zuständigen Fachministerium nach Anhörung der<br />
Landesorganisationen der Fachverbände und der für die Berufsbildung<br />
zuständigen Stellen erlassen.<br />
Bay EUG Art. 12 (weggefallen)<br />
Bay EUG Art. 13 Die Berufsfachschule<br />
1 Die Berufsfachschule ist eine Schule, die, ohne eine Berufsausbildung<br />
vorauszusetzen, der Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit oder der<br />
Berufsausbildung dient und die Allgemeinbildung fördert. 2 Der<br />
Ausbildungsgang umfasst mindestens ein Schuljahr im Vollzeitunterricht. 3 Das<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann zulassen, dass<br />
Berufsfachschulen für sozialpflegerische und Gesundheitsberufe sowie für<br />
Musik, die für Schülerinnen und Schüler vorgesehen sind, die nicht mehr der<br />
Schulpflicht unterliegen und langjährig berufstätig waren, in Teilzeitform<br />
geführt werden; Art. 10 Abs. 4 gilt entsprechend. 4 Mit dem Abschlusszeugnis<br />
einer mindestens zweijährigen Berufsfachschule, die zu einer abgeschlossenen<br />
Berufsausbildung führt, wird bei überdurchschnittlichen Leistungen und dem<br />
Nachweis befriedigender Kenntnisse in Englisch, die dem Leistungsstand eines<br />
fünfjährigen Unterrichts entsprechen, der mittlere Schulabschluss verliehen;<br />
Art. 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsätze 2 und 3 gelten entsprechend.<br />
Bay EUG Art. 14 Die Wirtschaftsschule<br />
(1) Die Wirtschaftsschule vermittelt eine allgemeine Bildung und eine<br />
berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und<br />
bereitet auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit vor.<br />
(2) 1 Die Wirtschaftsschule ist eine Berufsfachschule und umfasst in<br />
zweistufiger Form die Jahrgangsstufen 10 und 11, in dreistufiger Form die<br />
Jahrgangsstufen 8 bis 10 und in vierstufiger Form die Jahrgangsstufen 7<br />
bis 10. 2 Sie baut in zweistufiger Form auf dem qualifizierenden<br />
Hauptschulabschluss, in dreistufiger Form auf der Jahrgangsstufe 7 und in
vierstufiger Form auf der Jahrgangsstufe 6 der Hauptschule auf. 3 Sie<br />
verleiht nach bestandener Abschlussprüfung den<br />
Wirtschaftsschulabschluss.<br />
(3) 1 An der Wirtschaftsschule in dreistufiger und vierstufiger Form können ab<br />
der Jahrgangsstufe 8 zwei Ausbildungsrichtungen eingerichtet werden. 2 In<br />
der Ausbildungsrichtung I wird die berufliche Grundbildung vertieft; in der<br />
Ausbildungsrichtung II wird die berufliche Grundbildung durch<br />
naturwissenschaftlich-mathematische Inhalte ergänzt.<br />
Bay EUG Art. 15 Die Fachschule<br />
1 Die Fachschule dient der vertieften beruflichen Fortbildung oder Umschulung<br />
und fördert die Allgemeinbildung; sie wird im Anschluss an eine<br />
Berufsausbildung und in der Regel an eine ausreichende praktische<br />
Berufstätigkeit besucht. 2 Der Ausbildungsgang umfasst bei Vollzeitunterricht<br />
mindestens ein halbes Schuljahr, bei Teilzeitunterricht einen entsprechend<br />
längeren Zeitraum. 3 Die mindestens einjährige Fachschule kann nach Maßgabe<br />
der Schulordnung die Fachschulreife verleihen. 4 Durch eine staatliche<br />
Ergänzungsprüfung kann die Fachhochschulreife erworben werden, die auf<br />
einschlägige Studiengänge beschränkt werden kann; das Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus regelt das Nähere durch Rechtsverordnung.<br />
Bay EUG Art. 16 Die Fachoberschule<br />
(1) Die Fachoberschule vermittelt eine allgemeine, fachtheoretische und<br />
fachpraktische Bildung.<br />
(2) 1 Die Fachoberschule baut auf einem mittleren Schulabschluss auf. 2 Sie<br />
umfasst die Jahrgangsstufen 11 und 12; in der Jahrgangsstufe 11 gehört<br />
zum Unterricht auch eine fachpraktische Ausbildung. 3 Die<br />
Leistungsbewertung wird durch Noten und durch ein Punktesystem<br />
vorgenommen. 4 Die Fachoberschule verleiht nach bestandener<br />
Fachabiturprüfung die Fachhochschulreife. 5 Für überdurchschnittlich<br />
qualifizierte Absolventen der Fachabiturprüfung kann eine<br />
Jahrgangsstufe 13 geführt werden. 6 Diese verleiht nach bestandener<br />
Abiturprüfung die fachgebundene Hochschulreife sowie bei Nachweis der<br />
notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache die allgemeine<br />
Hochschulreife.<br />
(3) An der Fachoberschule können folgende Ausbildungsrichtungen<br />
eingerichtet werden:<br />
1. Technik,<br />
2. Agrarwirtschaft,<br />
3. Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege,<br />
4. Sozialwesen,<br />
5. Gestaltung.<br />
Bay EUG Art. 17 Die Berufsoberschule<br />
(1) Die Berufsoberschule vermittelt eine allgemeine und fachtheoretische<br />
Bildung.<br />
(2) 1 Die Berufsoberschule baut auf einem mittleren Schulabschluss und einer<br />
der jeweiligen Ausbildungsrichtung entsprechenden abgeschlossenen
Berufsausbildung oder entsprechenden mehrjährigen Berufserfahrung auf.<br />
2<br />
Sie umfasst die Jahrgangsstufen 12 und 13 und kann auch in Teilzeitform<br />
geführt werden. 3 Insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit<br />
mittlerem Schulabschluss gemäß Art. 25 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 bis 4<br />
können einjährige Vorklassen eingerichtet werden. 4 Die Aufnahme in die<br />
Vorklasse ist auch mit erfolgreichem Hauptschulabschluss und einer<br />
abgeschlossenen Berufsausbildung nach Bestehen einer Aufnahmeprüfung<br />
beim zuständigen Ministerialbeauftragten für die Berufsoberschulen und<br />
Fachoberschulen möglich; nach erfolgreichem Besuch wird der mittlere<br />
Schulabschluss verliehen. 5 Die Leistungsbewertung wird durch Noten und<br />
ein Punktesystem vorgenommen. 6 Die Berufsoberschule schließt mit der<br />
Abiturprüfung ab und verleiht die fachgebundene Hochschulreife sowie bei<br />
Nachweis der notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache die<br />
allgemeine Hochschulreife; Schüler und Schülerinnen der<br />
Jahrgangsstufe 12 können sich der Fachabiturprüfung zum Erwerb der<br />
Fachhochschulreife unterziehen.<br />
(3) An der Berufsoberschule können folgende Ausbildungsrichtungen<br />
eingerichtet werden:<br />
1. Technik,<br />
2. Agrarwirtschaft,<br />
3. Wirtschaft,<br />
4. Sozialwesen.<br />
Bay EUG Art. 18 Die Fachakademie<br />
(1) Die Fachakademie bereitet durch eine vertiefte berufliche und allgemeine<br />
Bildung auf den Eintritt in eine angehobene Berufslaufbahn vor.<br />
(2) 1 Die Fachakademie umfasst bei Vollzeitunterricht mindestens zwei<br />
Schuljahre. 2 Sie baut auf einem mittleren Schulabschluss und in der Regel<br />
auf einer dem Ausbildungsziel dienenden beruflichen Ausbildung oder<br />
praktischen Tätigkeit auf. 3 Das Staatsministerium für Unterricht und<br />
Kultus kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass an Fachakademien<br />
künstlerischer Ausbildungsrichtungen an die Stelle des mittleren<br />
Schulabschlusses der Nachweis einer entsprechenden Begabung im<br />
jeweiligen Fachgebiet tritt; bei Fachakademien für Musik erlässt die<br />
Verordnung das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst<br />
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus.<br />
(3) 1 Das Studium an einer Fachakademie wird durch eine staatliche Prüfung<br />
abgeschlossen. 2 Durch eine staatliche Ergänzungsprüfung kann die<br />
Fachhochschulreife erworben werden, die auf einschlägige Studiengänge<br />
beschränkt werden kann; das Staatsministerium für Unterricht und Kultus<br />
regelt das Nähere durch Rechtsverordnung. 3 Überdurchschnittlich<br />
befähigten Absolventinnen und Absolventen der Fachakademie, die die<br />
Berechtigung zum Studium an einer Fachhochschule erworben haben,<br />
kann die fachgebundene Hochschulreife zuerkannt werden; das<br />
Staatsministerium regelt das Nähere durch Rechtsverordnung.<br />
(4) 1 Das zuständige Staatsministerium legt durch Rechtsverordnung im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus die<br />
Ausbildungsrichtungen der Fachakademien fest; es kann die
Ausbildungsrichtungen in Fachrichtungen unterteilen. 2 Eine Fachakademie<br />
kann verschiedene Ausbildungsrichtungen umfassen.<br />
c) Förderschulen und Schulen für Kranke<br />
Bay EUG Art. 19 Aufgaben der Förderschulen<br />
(1) Die Förderschulen diagnostizieren, erziehen, unterrichten, beraten und<br />
fördern Kinder und Jugendliche, die der sonderpädagogischen Förderung<br />
bedürfen und deswegen an einer allgemeinen oder beruflichen Schule<br />
nicht oder nicht ausreichend gefördert und unterrichtet werden können.<br />
(2) Zu den Aufgaben der Förderschulen gehören:<br />
1. die schulische Unterrichtung und Förderung in Klassen mit bestimmten<br />
Förderschwerpunkten,<br />
2. die vorschulische Förderung durch die Schulvorbereitenden<br />
Einrichtungen,<br />
3. im Rahmen der verfügbaren Stellen und Mittel<br />
a) die vorschulische Förderung durch die Mobile Sonderpädagogische Hilfe<br />
und<br />
b) die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste zur Unterstützung<br />
förderbedürftiger Schülerinnen und Schüler in den Schulen anderer<br />
Schularten (allgemeine Schulen) oder in Förderschulen.<br />
(3) 1 Die Förderschulen erfüllen den sonderpädagogischen Förderbedarf,<br />
indem sie eine den Anlagen und der individuellen Eigenart der Kinder und<br />
Jugendlichen gemäße Bildung und Erziehung vermitteln. 2 Sie tragen zur<br />
Persönlichkeitsentwicklung bei und unterstützen die soziale und berufliche<br />
Entwicklung. 3 Bei Kindern und Jugendlichen, die ständig auf fremde Hilfe<br />
angewiesen sind, können Erziehung und Unterrichtung pflegerische<br />
Aufgaben beinhalten.<br />
(4) 1 Auf die Förderschulen sind die Vorschriften für die allgemeinen Schulen<br />
unter Berücksichtigung der sonderpädagogischen Anforderungen<br />
entsprechend anzuwenden. 2 Für die Volksschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung gilt Art. 7 Abs. 3 entsprechend. 3 Soweit<br />
es mit den jeweiligen Förderschwerpunkten vereinbar ist, vermitteln die<br />
Förderschulen die gleichen Abschlüsse wie die vergleichbaren allgemeinen<br />
Schulen.<br />
Bay EUG Art. 20 Förderschwerpunkte, Aufbau und Gliederung der<br />
Förderschulen<br />
(1) Förderschulen können gebildet werden für<br />
1. den Förderschwerpunkt Sehen,<br />
2. den Förderschwerpunkt Hören,<br />
3. den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung,<br />
4. den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung,<br />
5. den Förderschwerpunkt Sprache,<br />
6. den Förderschwerpunkt Lernen,<br />
7. den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.<br />
(2) 1 Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung für die in Abs. 1 Nrn. 1<br />
bis 4 genannten Förderschwerpunkte sind Förderzentren mit dem<br />
jeweiligen Schwerpunkt. 2 Volksschulen zur sonderpädagogischen
Förderung mit nur einem der Förderschwerpunkte nach Abs. 1 Nrn. 5 bis 7<br />
führen die Bezeichnungen<br />
1. Schule zur Sprachförderung,<br />
2. Schule zur Lernförderung oder<br />
3. Schule zur Erziehungshilfe.<br />
3<br />
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die die<br />
Förderschwerpunkte Sprache und Lernen umfassen, sind<br />
Sonderpädagogische Förderzentren; sie können auch den<br />
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung berücksichtigen.<br />
4<br />
Sonderpädagogischen Förderzentren können Klassen für Kranke<br />
angegliedert werden.<br />
(3) Die anderen Förderschulen führen die Bezeichnung der entsprechenden<br />
allgemeinen Schulart mit dem Zusatz “zur sonderpädagogischen<br />
Förderung” und der Angabe des Schwerpunkts nach Abs. 1.<br />
(4) 1 Die Schulen umfassen<br />
1. Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung mit Klassen<br />
a) der Grundschulstufe mit den Jahrgangsstufen 1 bis 4, wobei die Klassen<br />
der Jahrgangsstufen 1 und 2 als Sonderpädagogische Diagnose- und<br />
Förderklassen geführt und um eine Jahrgangsstufe 1 A erweitert werden<br />
können, wenn die Diagnose- und Fördermaßnahmen für die<br />
Jahrgangsstufen 1 und 2 ein drittes Schulbesuchsjahr erfordern; bei<br />
Schulen mit den Förderschwerpunkten Sehen und Hören ist die<br />
Jahrgangsstufe 1 A verpflichtend.<br />
b) der Hauptschulstufe mit den Jahrgangsstufen 5 bis 9 und, sofern<br />
Mittlere-Reife-Klassen gebildet werden können, auch mit der<br />
Jahrgangsstufe 10, wobei zur Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung<br />
die Jahrgangsstufen 7 bis 9 als sonderpädagogische Diagnose- und<br />
Werkstattklassen ausgebildet werden können,<br />
c) der Berufsschulstufe mit den Jahrgangsstufen 10 bis 12 bei Schulen mit<br />
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, wobei die Berufsschulstufe<br />
auch die Aufgaben der Berufsschule für Schülerinnen und Schüler mit<br />
diesem Förderschwerpunkt erfüllt,<br />
d) – mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde – des<br />
Berufsvorbereitungsjahres (Form B oder C) bei Schulen mit dem<br />
Förderschwerpunkt Sehen, Hören oder körperliche und motorische<br />
Entwicklung,<br />
2. sonstige allgemein bildende Schulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung,<br />
3. berufliche Schulen zur sonderpädagogischen Förderung.<br />
2<br />
Um gleiche Abschlüsse zu erreichen, kann der Unterricht außer bei den<br />
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung über eine<br />
Jahrgangsstufe mehr als bei den vergleichbaren allgemeinen Schulen<br />
vorgesehen verteilt werden.<br />
(5) 1 Förderschulen, in denen auf der Grundlage der Lehrpläne der<br />
allgemeinen Schulen unterrichtet wird, können auch Schülerinnen und<br />
Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichten, sofern die<br />
personellen, räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten dies<br />
zulassen. 2 Satz 1 gilt nicht für den Besuch der Jahrgangsstufe 1 A.
Bay EUG Art. 21 Mobile Sonderpädagogische Dienste<br />
(1) 1 Die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste unterstützen die<br />
Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf, die nach Maßgabe des Art. 41 eine allgemeine Schule<br />
besuchen können; sie können auch an einer anderen Förderschule<br />
eingesetzt werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler in mehreren<br />
Förderschwerpunkten sonderpädagogischen Förderbedarf hat und vom<br />
Lehrpersonal der besuchten Förderschule nicht in allen Schwerpunkten<br />
gefördert werden kann. 2 Mobile Sonderpädagogische Dienste<br />
diagnostizieren und fördern die Schülerinnen und Schüler, sie beraten<br />
Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler,<br />
koordinieren sonderpädagogische Förderung und führen Fortbildungen für<br />
Lehrkräfte durch. 3 Mobile Sonderpädagogische Dienste werden von den<br />
nächstgelegenen Förderschulen mit entsprechendem Förderschwerpunkt<br />
geleistet.<br />
(2) Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Sehen, Hören sowie körperliche<br />
und motorische Entwicklung in die allgemeine Schule bedarf der<br />
Zustimmung des Schulaufwandsträgers; die Zustimmung kann nur bei<br />
erheblichen Mehraufwendungen verweigert werden.<br />
(3) Für die Fördermaßnahmen können einschließlich des anteiligen<br />
Lehrerstundeneinsatzes je Schüler in der besuchten allgemeinen Schule<br />
im längerfristigem Durchschnitt nicht mehr Lehrerstunden aufgewendet<br />
werden, als in der entsprechenden Förderschule je Schülerin bzw. Schüler<br />
eingesetzt werden.<br />
Bay EUG Art. 22 Schulvorbereitende Einrichtungen und Mobile<br />
Sonderpädagogische Hilfe<br />
(1) 1 Noch nicht schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf, die zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten auch im Hinblick auf<br />
die Schulfähigkeit sonderpädagogischer Anleitung und Unterstützung<br />
bedürfen, sollen in Schulvorbereitenden Einrichtungen gefördert werden,<br />
sofern sie die notwendige Förderung nicht in anderen, außerschulischen<br />
Einrichtungen (z. B. Kindergärten) erhalten. 2 Schulvorbereitende<br />
Einrichtungen sind Bestandteile von Volksschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung; der Schulleiter leitet auch die<br />
Schulvorbereitende Einrichtung. 3 Eine Schulvorbereitende Einrichtung hat<br />
keine anderen Förderschwerpunkte als die Förderschule, der sie angehört.<br />
4<br />
Die Schulvorbereitenden Einrichtungen verfolgen die in Art. 19 Abs. 3<br />
genannten Ziele in den letzten drei Jahren vor dem regelmäßigem Beginn<br />
der Schulpflicht. 5 Sie leisten die Förderung in Gruppen, in denen die<br />
Kinder höchstens im zeitlichen Umfang wie in der Jahrgangsstufe 1 der<br />
entsprechenden Schule unterwiesen werden.<br />
(2) 1 Für noch nicht schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf, die zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten, ihrer<br />
Gesamtpersönlichkeit und für ein selbständiges Lernen und Handeln auch<br />
im Hinblick auf die Schulreife spezielle sonderpädagogische Anleitung und<br />
Unterstützung benötigen, können die fachlich entsprechenden<br />
Förderschulen bei anderweitig nicht gedecktem Bedarf Mobile
Sonderpädagogische Hilfe in der Familie, im Kindergarten und im Rahmen<br />
der interdisziplinären Frühförderung (z. B. Frühförderstellen) leisten. 2 Sie<br />
fördern die Entwicklung der Kinder, beraten die Eltern und Erzieher und<br />
verfolgen dabei die in Art. 19 Abs. 3 Satz 2 genannten Ziele in<br />
interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den medizinischen,<br />
psychologischen, sonstigen pädagogischen, sozialen und anderen im<br />
Rahmen der Frühförderung zusammenwirkenden Diensten, deren<br />
Aufgaben, Rechtsgrundlagen, Organisation und Finanzierung unberührt<br />
bleiben. 3 Die Förderung setzt das Einverständnis der Eltern und bei der<br />
sonderpädagogischen Hilfe im Kindergarten die Absprache mit der Leitung<br />
des Kindergartens voraus.<br />
Bay EUG Art. 23 Schulen für Kranke; Hausunterricht<br />
(1) 1 Schulen für Kranke unterrichten Schülerinnen und Schüler, die sich in<br />
Krankenhäusern oder vergleichbaren, unter ärztlicher Leitung stehenden<br />
Einrichtungen aufhalten müssen. 2 Die Schülerinnen und Schüler bleiben<br />
Schülerinnen und Schüler der bisher besuchten Schulart und Schule; sie<br />
werden in der Regel nach den für diese Schulart geltenden Lehrplänen<br />
unter Berücksichtigung der sich aus den Krankheiten und dem<br />
Krankenhausaufenthalt ergebenden Bedingungen unterrichtet. 3 Die<br />
Schule für Kranke soll möglichst den Anschluss an die Schulausbildung<br />
gewährleisten und den Heilungsprozess unterstützen.<br />
(2) 1 Hausunterricht kann für längerfristig Kranke oder aus gesundheitlichen<br />
Gründen nicht schulbesuchsfähige Schülerinnen und Schüler erteilt<br />
werden. 2 Zuständig ist in der Regel die bisher besuchte Schule.<br />
(3) Beim Unterricht nach den Abs. 1 und 2 sollen im Rahmen der verfügbaren<br />
Mittel die Möglichkeiten der modernen Datenkommunikation genutzt<br />
werden; der Unterricht kann ganz oder teilweise in Form des durch<br />
Datenkommunikation unterstützten Fernunterrichts (virtueller Unterricht)<br />
erfolgen.<br />
Bay EUG Art. 24 Förderschulen und Schulen für Kranke;<br />
Ausführungsbestimmungen<br />
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, so weit<br />
erforderlich im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und im<br />
Benehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie<br />
und Frauen, bei nachfolgenden Nrn. 8 und 9 auch im Benehmen mit dem<br />
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, durch<br />
Rechtsverordnung<br />
1. die Zuständigkeit der einzelnen Förderschulformen zu beschreiben und<br />
voneinander abzugrenzen;<br />
2. die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, das Verfahren bei<br />
der Aufnahme und bei der Überweisung in eine Förderschule sowie beim<br />
freiwilligen Besuch der Förderschule über die Schulpflicht hinaus, außerdem<br />
das Verfahren bei der Überweisung aus der Förderschule in die Volksschule<br />
oder die Berufsschule zu regeln;<br />
3. die Voraussetzungen für die gemeinsame Förderung von Kindern und<br />
Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in den<br />
Förderschulen zu regeln;
4. Aufgaben, Formen und Inhalt der Förderung sowie Organisation der<br />
Schulvorbereitenden Einrichtungen einschließlich des Zusammenwirkens<br />
zwischen privaten und öffentlichen Aufgabenträgern und die Feststellung des<br />
sonderpädagogischen Förderbedarfs der Kinder im Vorschulalter zu regeln;<br />
5. Aufgaben, Formen, Inhalt, Umfang und Organisation der Mobilen<br />
Sonderpädagogischen Hilfe nach Art. 22 Abs. 2 zu regeln; für die Mobile<br />
Sonderpädagogische Hilfe können je Kind einschließlich der anteiligen<br />
Erzieherstunden im Kindergarten nicht mehr Betreuungsstunden aufgewendet<br />
werden, als anteilig je Kind für die Förderung in der Gruppe der<br />
entsprechenden Schulvorbereitenden Einrichtung eingesetzt werden;<br />
6. Aufgaben, Formen und Inhalt sowie Organisation der Mobilen<br />
Sonderpädagogischen Dienste einschließlich des Zusammenwirkens öffentlicher<br />
und privater Schulen und die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler, von<br />
den Fördermaßnahmen Gebrauch zu machen, zu regeln;<br />
7. Aufgaben, Ziele, Organisation und Zuordnung der Sonderpädagogischen<br />
Diagnose- und Förderklassen sowie der Sonderpädagogischen Diagnose- und<br />
Werkstattklassen zu regeln;<br />
8. Aufbau, Formen, Inhalt und Organisation der Schulen für Kranke zu regeln<br />
sowie die Erlaubnis zur Weitergabe ärztlicher Erkenntnisse an die Schulen für<br />
Kranke im erforderlichen Umfang zu schaffen;<br />
9. Voraussetzungen, Umfang und Organisation von Hausunterricht zu regeln;<br />
die Einholung von fachärztlichen oder amtsärztlichen Gutachten kann<br />
vorgeschrieben werden.<br />
d) Mittlerer Schulabschluss<br />
Bay EUG Art. 25 Mittlerer Schulabschluss<br />
(1) 1 Der mittlere Schulabschluss im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s wird durch das<br />
Abschlusszeugnis einer Realschule nachgewiesen. 2 Er wird ferner<br />
nachgewiesen durch<br />
1. das Abschlusszeugnis der 10. Klasse der Hauptschule,<br />
2. das Zeugnis über den qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss<br />
gemäß Art. 7 Abs. 8 Satz 1,<br />
3. das Abschlusszeugnis der Berufsschule gemäß Art. 11 Abs. 2 Satz 2,<br />
4. das Abschlusszeugnis der Berufsfachschule gemäß Art. 13 Satz 4,<br />
5. das Abschlusszeugnis der Wirtschaftsschule gemäß Art. 14 Abs. 2<br />
Satz 3,<br />
6. das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch der Vorklasse der<br />
Berufsoberschule gemäß Art. 17 Abs. 2 Satz 4.<br />
(2) Die Erlaubnis zum Vorrücken in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums<br />
und die Fachschulreife schließen den Nachweis eines mittleren<br />
Schulabschlusses ein.<br />
(3) 1 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, die<br />
Voraussetzungen für den Erwerb eines mittleren Schulabschlusses und die<br />
damit verbundenen schulischen Berechtigungen im Einzelnen durch<br />
Rechtsverordnung zu regeln. 2 Das Staatsministerium oder die von ihm<br />
beauftragte Stelle kann allgemein oder im Einzelfall ein anderes Zeugnis<br />
als einem in Absatz 1 genannten Zeugnis gleichwertig anerkennen.
Abschnitt III Errichtung und Auflösung von öffentlichen Schulen<br />
a) Allgemeine Grundsätze<br />
Bay EUG Art. 26 Staatliche Schulen<br />
(1) Volksschulen, Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung,<br />
Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung, Schulen für Kranke<br />
und Berufsschulen werden durch Rechtsverordnung der Regierung, die<br />
übrigen Schulen durch Rechtsverordnung des zuständigen<br />
Staatsministeriums errichtet und aufgelöst.<br />
(2) 1 Vor der Errichtung und Auflösung ist das Benehmen mit dem zuständigen<br />
Aufwandsträger, vor der Auflösung ist außerdem das Benehmen mit dem<br />
Elternbeirat oder dem Berufsschulbeirat herzustellen. 2 Volksschulen und<br />
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung werden im Benehmen<br />
mit den beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften, Elternbeiräten<br />
und kirchlichen Oberbehörden errichtet und aufgelöst.<br />
Bay EUG Art. 27 Kommunale Schulen<br />
(1) 1 Die Errichtung einer kommunalen Schule ist zulässig, wenn gewährleistet<br />
ist, dass die Ausbildung der an der Schule tätigen Lehrkräfte hinter der<br />
Ausbildung der bei entsprechenden staatlichen Schulen eingesetzten<br />
Lehrkräfte nicht zurücksteht und die dem Unterricht dienenden Räume<br />
und Anlagen die Durchführung eines einwandfreien Schulbetriebs<br />
sicherstellen. 2 Die Errichtung einer kommunalen Schule ist der<br />
Schulaufsichtsbehörde drei Monate vor Aufnahme des Unterrichts<br />
anzuzeigen. 3 Wesentliche Änderungen im Bereich der Schule sind<br />
ebenfalls anzuzeigen. 4 Die Einstellung von Lehrkräften, die in Bayern die<br />
Befähigung zum Lehramt erworben haben und entsprechend verwendet<br />
werden, stellt keine wesentliche Änderung dar.<br />
(2) 1 Errichtung und Auflösung einer kommunalen Schule erfolgen durch<br />
Satzung des kommunalen Schulträgers. 2 Vor der Auflösung einer<br />
kommunalen Schule ist das Benehmen mit dem Elternbeirat oder dem<br />
Berufsschulbeirat herzustellen. 3 Art. 99 Abs. 2 gilt entsprechend.<br />
(3) Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in eine kommunale Schule,<br />
die nicht Pflichtschule ist, darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil die<br />
Erziehungsberechtigten oder die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz<br />
oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht innerhalb des Gebiets des<br />
Schulträgers haben.<br />
(4) 1 Die Einstellung und Verwendung von Lehrkräften an beruflichen Schulen,<br />
die die erforderliche Befähigung zum Lehramt nicht besitzen, sowie die<br />
Bestellung unterhälftig beschäftigter Schulleiterinnen bzw. Schulleiter<br />
bedürfen der schulaufsichtlichen Genehmigung; die mit weniger als der<br />
Hälfte der Unterrichtspflichtzeit tätigen Lehrkräfte sollen die gleiche<br />
fachliche Vorbildung haben, wie sie für die Laufbahnen der hauptamtlichen<br />
Lehrkräfte vorgeschrieben ist. 2 Die Schulaufsichtsbehörde kann nach<br />
Richtlinien des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus die<br />
Mindestzahl der erforderlichen Lehrkräfte an beruflichen Schulen<br />
festsetzen.
Bay EUG Art. 28 Berücksichtigung der Landesplanung<br />
1 Bei der Errichtung und beim Betrieb öffentlicher Schulen sind die<br />
Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung zu beachten. 2 Den<br />
regionalen Gegebenheiten ist Rechnung zu tragen.<br />
Bay EUG Art. 29 Bezeichnung von Schulen<br />
1 In der Errichtungsverordnung wird den staatlichen Schulen, in der<br />
Errichtungssatzung den kommunalen Schulen eine amtliche Bezeichnung<br />
verliehen, aus der sich der Schulträger, die Schulart und der Schulort ergeben<br />
und die sie von anderen am selben Ort bestehenden Schulen der gleichen<br />
Schulart unterscheidet; die Angabe des Schulträgers entfällt bei den<br />
staatlichen Volksschulen und Volksschulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung. 2 Bei Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachakademien und, soweit<br />
erforderlich, bei Fachoberschulen und Berufsoberschulen enthält die<br />
Bezeichnung auch die geführte Ausbildungsrichtung oder Fachrichtung. 3 Der<br />
Schule kann vom Schulträger mit Zustimmung des Schulaufwandsträgers, der<br />
Lehrerkonferenz, des Elternbeirats und der Schülermitverantwortung, bei<br />
Berufsschulen des Berufsschulbeirats neben der amtlichen Bezeichnung ein<br />
Name verliehen werden. 4 Schülerinnen und Schülern an Förderschulen, die<br />
nach einem Lehrplan unterrichtet werden, der dem Anforderungsniveau des<br />
Lehrplans der jeweiligen allgemeinen Schule entspricht, können in den letzten<br />
beiden Schuljahren Zeugnisse mit einer abweichenden Schulbezeichnung<br />
erhalten; das Nähere regeln die Schulordnungen.<br />
Bay EUG Art. 30 Zusammenarbeit von Schulen<br />
(1) 1 Die Schulen aller Schularten haben zusammenzuarbeiten. 2 Dies gilt<br />
insbesondere für Schulen im gleichen Einzugsbereich zur Ergänzung des<br />
Unterrichtsangebots, zur Durchführung gemeinsamer<br />
Schulveranstaltungen und zur Abstimmung der Unterrichtszeiten. 3 Die<br />
Zusammenarbeit zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen soll im<br />
Unterricht und im Schulleben besonders gefördert werden. 4 Dazu können<br />
mit Zustimmung der beteiligten Schulaufwandsträger auch Außenklassen<br />
von allgemeinen Schulen an Förderschulen und von Förderschulen an<br />
allgemeinen Schulen sowie Kooperationsklassen an Volksschulen gebildet<br />
werden. 5 Erziehungsberechtigte, deren Kinder nach Art. 41<br />
förderschulpflichtig sind, haben die Möglichkeit die Einrichtung einer<br />
Außenklasse zu beantragen. 6 Außenklassen sowie Kooperationsklassen<br />
sollen eingerichtet werden, wenn dies organisatorisch, personell und<br />
sachlich ermöglicht werden kann. 7 Das zuständige Staatsministerium wird<br />
ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln, soweit<br />
erforderlich im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.<br />
(2) Die Zusammenfassung beruflicher Schulen innerhalb von beruflichen<br />
Schulzentren ist anzustreben.<br />
Bay EUG Art. 31 Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Einrichtungen<br />
der Erziehung, Bildung und Betreuung<br />
(1) 1 Die Schulen arbeiten in Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Jugendämtern<br />
und den Trägern der freien Jugendhilfe sowie anderen Trägern und<br />
Einrichtungen der außerschulischen Erziehung und Bildung zusammen.
2<br />
Sie sollen das zuständige Jugendamt unterrichten, wenn Tatsachen<br />
bekannt werden, die darauf schließen lassen, dass das Wohl einer<br />
Schülerin oder eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist<br />
und deshalb Maßnahmen der Jugendhilfe notwendig sind.<br />
(2) 1 Die Schulen sollen durch Zusammenarbeit mit Horten, Tagesheimen und<br />
ähnlichen Einrichtungen die Betreuung von Schülerinnen und Schülern<br />
außerhalb der Unterrichtszeit fördern. 2 Mittagsbetreuung wird bei Bedarf<br />
an der Grundschule, in geeigneten Fällen auch an anderen Schularten<br />
nach Maßgabe der im Staatshaushalt ausgebrachten Mittel im<br />
Zusammenwirken mit den Kommunen und den Erziehungsberechtigten<br />
angeboten. 3 Diese bietet den Erziehungsberechtigten in Zusammenarbeit<br />
mit der Schule eine verlässliche Betreuung für die Zeiten, die über das<br />
Unterrichtsende hinausgehen.<br />
b) Besondere Regelungen für Pflichtschulen<br />
Bay EUG Art. 32 Volksschulen<br />
(1) Öffentliche Volksschulen können nur als staatliche Schulen errichtet<br />
werden.<br />
(2) 1 Die Volksschulen sind so zu errichten, dass die Schülerinnen und Schüler<br />
grundsätzlich auf Jahrgangsklassen verteilt sind. 2 An Grundschulen<br />
können Jahrgangsklassen gebildet oder zwei Jahrgangsstufen in einer<br />
Klasse zusammengefasst werden. 3 Die Hauptschulen sollen soweit als<br />
möglich in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 mehrzügig geführt werden.<br />
(3) Eine Volksschule soll entweder alle Jahrgangsstufen umfassen (Vollschule)<br />
oder die Jahrgangsstufen der Grundschule oder die Jahrgangsstufen der<br />
Hauptschule (Teilschule).<br />
(4) 1 Eine Volksschule kann entweder für eine Gemeinde allein<br />
(Gemeindeschule) oder für mehrere Gemeinden, Gemeindeteile und<br />
gemeindefreie Gebiete gemeinsam (Verbandsschule) errichtet werden.<br />
2<br />
Eine Verbandsschule muss errichtet werden, wenn keine Gemeindeschule<br />
errichtet werden kann, die den Grundsätzen des Absatzes 2 entspricht.<br />
(5) 1 Die Regierung bestimmt für jede Volksschule in der Rechtsverordnung<br />
nach Art. 26 ein räumlich abgegrenztes Gebiet als Schulsprengel. 2 Eine<br />
Volksschule, die eine Grundschule und eine Hauptschule umfasst, kann für<br />
die beiden Teilschulen verschieden große Sprengel haben. 3 Für die<br />
Jahrgangsstufe 10 werden keine eigenen Sprengel gebildet.<br />
(6) Volksschulen, die die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 nicht oder<br />
nicht mehr erfüllen, sind aufzulösen.<br />
(7) 1 Mittlere-Reife-Klassen der Hauptschule werden vom Staatlichen<br />
Schulamt nach Bedarf an Volksschulen eingerichtet, an denen mindestens<br />
die Jahrgangsstufen 7 bis 9 geführt werden. 2 Die Einrichtung erfolgt im<br />
Benehmen mit dem Aufwandsträger und dem Elternbeirat.<br />
Bay EUG Art. 33 Förderschulen und Schulen für Kranke<br />
(1) 1 Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke werden als staatliche<br />
Schulen errichtet, soweit nicht eine kommunale Körperschaft durch<br />
öffentlich-rechtliche Vereinbarung ermächtigt ist, eine solche Schule zu
etreiben. 2 Besondere gesetzliche Verpflichtungen der Bezirke zur<br />
Unterhaltung von Schulen für Blinde und Gehörlose bleiben unberührt.<br />
(2) Von der Errichtung einer öffentlichen Förderschule soll abgesehen werden,<br />
wenn die ausreichende Unterrichtung und Erziehung der Schulpflichtigen<br />
mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch eine private, auf<br />
gemeinnütziger Grundlage betriebene Förderschule gewährleistet ist und<br />
sich der private Schulträger verpflichtet, alle Schülerinnen und Schüler<br />
aufzunehmen und nach den staatlichen Lehrplänen zu unterrichten, sofern<br />
die private Schule die heimatnächste Einrichtung für die Schülerinnen und<br />
Schüler mit entsprechendem sonderpädagogischem Förderbedarf ist.<br />
(3) 1 Die Schulsprengel werden gebildet für öffentliche<br />
1. Förderzentren mit den Schwerpunkten Sehen, Hören und körperliche<br />
und motorische Entwicklung, Volksschulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung, Förderschwerpunkt Sprache, mit den Jahrgangsstufen 7 bis 9,<br />
soweit Mittlere-Reife-Klassen in der Jahrgangsstufe 10 angeboten werden,<br />
auch die Jahrgangsstufe 10, und Berufsschulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung für das Gebiet oder Teilgebiet eines Bezirks oder durch<br />
Zusammenschluss von Gebieten oder Gebietsteilen mehrerer Bezirke,<br />
2. Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung mit den<br />
Förderschwerpunkten Sprache, Lernen sowie emotionale und soziale<br />
Entwicklung einschließlich der daraus gebildeten Sonderpädagogischen<br />
Förderzentren, Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige<br />
Entwicklung und Schulen für Kranke für die Gebiete oder Teilgebiete von<br />
Landkreisen oder kreisfreien Gemeinden oder durch Zusammenschluss<br />
von Gebieten oder Gebietsteilen mehrerer Landkreise oder kreisfreier<br />
Gemeinden.<br />
2<br />
Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke werden jeweils für<br />
einen Schulsprengel errichtet, der hinreichend groß ist, um nach der Zahl<br />
der Schülerinnen und Schüler eine grundsätzlich in Jahrgangsklassen<br />
gegliederte Schule erwarten zu lassen. 3 Das Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus kann durch Bekanntmachung festlegen, in welchen<br />
Fällen bei Förderschulen von der Gliederung in Jahrgangsklassen<br />
abgewichen werden kann.<br />
(4) 1 Die Regierung bestimmt für jede Volksschule zur sonderpädagogischen<br />
Förderung und für jede Schule für Kranke in der Rechtsverordnung nach<br />
Art. 26 ein räumlich abgegrenztes Gebiet als Schulsprengel; für<br />
Schulvorbereitende Einrichtungen, für bestimmte Jahrgangsstufen oder für<br />
einzelne Förderschwerpunkte können gesonderte Schulsprengel gebildet<br />
werden. 2 Erstreckt sich der Sprengel über das Gebiet eines<br />
Regierungsbezirks hinaus, entscheidet die Regierung, in deren Amtsbezirk<br />
die Schule ihren Sitz hat, im Einvernehmen mit der Regierung, auf deren<br />
Amtsbezirk sich der Sprengel erstrecken soll. 3 Art. 32 Abs. 5 Sätze 2 und<br />
3 gelten entsprechend. 4 Für Berufsschulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung gelten Art. 34 Abs. 2 und 3 entsprechend. 5 Mittlere-Reife-<br />
Klassen können bei Bedarf von der Regierung an Volksschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung mit den Schwerpunkten Sehen, Hören,<br />
körperliche und motorische Entwicklung, Sprache sowie emotionale und<br />
soziale Entwicklung errichtet werden. 6 Art. 32 Abs. 7 Satz 2 gilt<br />
entsprechend.
(5) Förderschulen und Schulen für Kranke, die die Voraussetzungen des<br />
Absatzes 3 Sätze 2 und 3 nicht erfüllen, sind aufzulösen.<br />
Bay EUG Art. 34 Berufsschulen<br />
(1) 1 Eine selbstständige Berufsschule muss im Regelfall mindestens 40<br />
Klassen mit Teilzeitunterricht haben. 2 Klassen mit Vollzeitunterricht<br />
werden als 2,5fache Teilzeitklassen auf die Mindestklassenzahl<br />
angerechnet. 3 Ausnahmen bedürfen für nicht staatliche Berufsschulen der<br />
schulaufsichtlichen Genehmigung.<br />
(2) 1 Die Regierung bildet durch Rechtsverordnung für jede Berufsschule den<br />
Schulsprengel, der für die örtliche Erfüllung der Berufsschulpflicht<br />
maßgebend ist (Grundsprengel). 2 Zur Bildung von nach<br />
Ausbildungsberufen gegliederten Fachklassen kann sich der Schulsprengel<br />
über das Gebiet des Aufwandsträgers hinaus erstrecken (Fachsprengel);<br />
ein Fachsprengel kann auf berufsspezifische Teile des fachlichen<br />
Unterrichts beschränkt werden. 3 Die Sprengel staatlicher Berufsschulen<br />
werden im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger gebildet. 4 Die<br />
Errichtung von Sprengeln an kommunalen Berufsschulen bedarf des<br />
Einvernehmens mit dem Schulträger.<br />
(3) Berufsschulen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht oder nicht<br />
mehr erfüllen, sollen aufgelöst werden, es sei denn, sie sind in beruflichen<br />
Schulzentren zusammengefasst oder werden in Personalunion mit anderen<br />
beruflichen Schulen geführt.<br />
Abschnitt IV Schulpflicht, Pflichtschulen, Sprengelpflicht,<br />
Gastschulverhältnisse, Wahl des schulischen Bildungswegs<br />
a) Schulpflicht<br />
Bay EUG Art. 35 Schulpflicht<br />
(1) 1 Wer die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt und in Bayern seinen<br />
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in einem Berufsausbildungsverhältnis<br />
oder einem Beschäftigungsverhältnis steht, unterliegt der Schulpflicht<br />
(Schulpflichtiger). 2 Schulpflichtig im Sinn des Satzes 1 ist auch, wer<br />
1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzt,<br />
2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 wegen des<br />
Krieges in seinem Heimatland oder nach § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5<br />
des Aufenthaltsgesetzes besitzt,<br />
3. eine Duldung nach § 60 a des Aufenthaltsgesetzes besitzt,<br />
4. vollziehbar ausreisepflichtig ist, auch wenn eine<br />
Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,<br />
unabhängig davon, ob er selbst diese Voraussetzungen erfüllt oder nur<br />
einer seiner Erziehungsberechtigten; in den Fällen der Nummern 1 und 2<br />
beginnt die Schulpflicht drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland.<br />
3<br />
Völkerrechtliche Abkommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen<br />
bleiben unberührt.<br />
(2) Die Schulpflicht dauert zwölf Jahre, soweit dieses Gesetz nichts anderes<br />
bestimmt.
(3) Die Schulpflicht gliedert sich in die Vollzeitschulpflicht und die<br />
Berufsschulpflicht.<br />
(4) 1 Die Erziehungsberechtigten müssen minderjährige Schulpflichtige bei der<br />
Schule anmelden, an der die Schulpflicht erfüllt werden soll; volljährige<br />
Schulpflichtige haben sich selbst anzumelden. 2 Die gleiche Verpflichtung<br />
trifft die Ausbildenden und Arbeitgeber sowie die von ihnen Beauftragten<br />
für die bei ihnen beschäftigten Berufsschulpflichtigen.<br />
Bay EUG Art. 36 Erfüllung der Schulpflicht<br />
(1) 1 Die Schulpflicht wird erfüllt durch den Besuch<br />
1. einer Pflichtschule (Volksschule, Berufsschule, einschließlich der<br />
entsprechenden Förderschule),<br />
2. eines Gymnasiums, einer Realschule, einer Wirtschaftsschule, einer<br />
Berufsfachschule (vorbehaltlich der Nummer 3) oder der jeweils<br />
entsprechenden Förderschule, Schule für Kranke,<br />
3. einer Ergänzungsschule, deren Eignung hierfür das Staatsministerium<br />
für Unterricht und Kultus festgestellt hat; das Gleiche gilt für<br />
Vollzeitlehrgänge an Berufsförderungseinrichtungen, deren Eignung vom<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit den<br />
beteiligten Staatsministerien festgestellt ist.<br />
2<br />
Die Schulaufsichtsbehörde kann den Besuch einer privaten Berufsschule<br />
oder Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung anordnen, wenn<br />
die Ausbildung des Schulpflichtigen dies erfordert und der Träger der<br />
privaten Schule zustimmt; vor der Entscheidung sind die<br />
Erziehungsberechtigten oder der volljährige Schulpflichtige zu hören.<br />
(2) 1 Die Schulpflicht kann auch an einer Schule außerhalb des<br />
Geltungsbereichs dieses <strong>Gesetze</strong>s erfüllt werden, wenn diese den in<br />
Absatz 1 genannten Schulen gleichwertig ist. 2 Beim Besuch einer<br />
außerbayerischen Berufsschule gilt Art. 43 Abs. 5.<br />
(3) 1 Für jeden aus dem Ausland zugezogenen Schulpflichtigen stellt die<br />
Schule fest, in welche Jahrgangsstufe der Pflichtschule er einzuweisen ist.<br />
2<br />
Es gilt derjenige Teil der Schulpflicht als zurückgelegt, der dem durch die<br />
Einweisung bestimmten Zeitpunkt regelmäßig vorausgeht. 3 Die<br />
Schülerinnen und Schüler sind in der Pflichtschule grundsätzlich in die<br />
Jahrgangsstufe einzuweisen, in die Schulpflichtige gleichen Alters, die seit<br />
Beginn ihrer Schulpflicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern haben,<br />
regelmäßig eingestuft sind. 4 Die Schülerinnen und Schüler, die wegen<br />
ihres allgemein mangelnden Bildungsstands dem Unterricht ihrer<br />
Jahrgangsstufe nicht folgen können, können bis zu zwei Jahrgangsstufen<br />
tiefer eingestuft werden; eine Verlängerung der Schulpflicht findet<br />
hierdurch nicht statt. 5 Ein Schulpflichtiger, der dem Unterricht wegen<br />
mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache nicht folgen kann, ist, soweit<br />
organisatorisch und finanziell möglich, besonderen Klassen oder<br />
Unterrichtsgruppen zuzuweisen. 6 Art. 44 bleibt unberührt.
) Vollzeitschulpflicht<br />
Bay EUG Art. 37 Vollzeitschulpflicht<br />
(1) 1 Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum<br />
31. Dezember sechs Jahre alt werden oder bereits einmal von der<br />
Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden oder unter den<br />
Voraussetzungen des Abs. 2 Satz 6 die Einschulung nicht wahrgenommen<br />
haben. 2 Ferner wird auf Antrag der Erziehungsberechtigten ein Kind<br />
schulpflichtig, wenn auf Grund der körperlichen, sozialen und geistigen<br />
Entwicklung zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht<br />
teilnehmen wird; ein schulpsychologisches Gutachten ist erforderlich.<br />
(2) 1 Ein Kind, das am 31. Dezember mindestens sechs Jahre alt ist, kann für<br />
ein Schuljahr von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt werden,<br />
wenn auf Grund der körperlichen oder geistigen Entwicklung zu erwarten<br />
ist, dass es nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. 2 Die<br />
Zurückstellung soll vor Aufnahme des Unterrichts verfügt werden; sie ist<br />
noch bis zum 30. November zulässig, wenn sich erst innerhalb dieser Frist<br />
herausstellt, dass das Kind nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen<br />
kann. 3 Die Zurückstellung ist nur einmal und nur dann zulässig, wenn<br />
kein Anlass besteht, die Überweisung an eine Förderschule zu beantragen.<br />
4<br />
Vor der Entscheidung hat die Schule die Erziehungsberechtigten zu<br />
hören. 5 Für den Widerruf einer Aufnahme auf Antrag gelten Satz 2<br />
Halbsatz 2 und Satz 4. 6 Im Fall des Abs. 1 Satz 1 haben die<br />
Erziehungsberechtigten bei einem Kind, das nach dem 30. September<br />
sechs Jahre alt wird, die Möglichkeit, auf Antrag erst den nächsten<br />
Einschulungstermin wahrzunehmen.<br />
(3) 1 Die Vollzeitschulpflicht endet nach neun Schuljahren. 2 Sie kann durch<br />
Überspringen von Jahrgangsstufen verkürzt werden. 3 Das<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, das<br />
Überspringen von Jahrgangsstufen in den Schulordnungen zu regeln.<br />
(4) 1 Abweichend von Abs. 1 und 2 gelten statt des Stichtags 31. Dezember<br />
für die Einschulung<br />
zum Schuljahr 2005/06 der 31. Juli,<br />
zum Schuljahr 2006/07 der 31. August,<br />
zum Schuljahr 2007/08 der 30. September,<br />
zum Schuljahr 2008/09 der 31. Oktober,<br />
zum Schuljahr 2009/10 der 30. November.<br />
2 Für Kinder, die bis zum 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist ein<br />
schulpsychologisches Gutachten abweichend von Abs. 1 Satz 2 nicht<br />
erforderlich.<br />
Bay EUG Artikel 37 a (weggefallen)<br />
Bay EUG Art. 38 Freiwilliger Besuch der Hauptschule<br />
1 Ein Schulpflichtiger, der nach neun oder zehn Schulbesuchsjahren den<br />
erfolgreichen Hauptschulabschluss oder den qualifizierenden<br />
Hauptschulabschluss nicht erreicht hat, darf in unmittelbarem Anschluss daran
auf Antrag seiner Erziehungsberechtigten in seinem zehnten oder elften<br />
Schulbesuchsjahr die Hauptschule besuchen; in besonderen Ausnahmefällen<br />
kann die zuständige Schule auch den weiteren Besuch in einem zwölften<br />
Schuljahr genehmigen. 2 Die Aufnahme kann insbesondere abgelehnt werden,<br />
wenn zu erwarten ist, dass durch die Anwesenheit der Schülerin oder des<br />
Schülers die Sicherheit oder die Ordnung des Schulbetriebs oder die<br />
Verwirklichung der Bildungsziele der Schule erheblich gefährdet ist. 3 Die Zeit,<br />
die eine Schülerin oder ein Schüler die Hauptschule freiwillig nach Satz 1<br />
besucht, wird auf die Dauer der Berufsschulpflicht angerechnet. 4 Art. 39 Abs. 2<br />
bleibt unberührt.<br />
c) Berufsschulpflicht<br />
Bay EUG Art. 39 Berufsschulpflicht<br />
(1) Nach dem Ende der Vollzeitschulpflicht oder des freiwilligen Besuchs der<br />
Hauptschule nach Art. 38 wird die Schulpflicht durch den Besuch der<br />
Berufsschule erfüllt, soweit keine andere in Art. 36 genannte Schule<br />
besucht wird.<br />
(2) 1 Wer in einem Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder<br />
der Handwerksordnung steht, ist bis zum Ende des Schuljahres<br />
berufsschulpflichtig, in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird; davon<br />
ausgenommen sind Auszubildende mit Hochschulzugangsberechtigung.<br />
2<br />
Die Berufsschulpflicht endet mit dem Abschluss einer staatlich<br />
anerkannten Berufsausbildung. 3 Die Berufsschulpflicht nach Satz 1<br />
schließt die Verpflichtung zum Besuch des Berufsgrundschuljahres ein,<br />
wenn es für den gewählten Ausbildungsberuf nach Art. 11 Abs. 4<br />
eingeführt ist.<br />
(3) 1 Vom Besuch der Berufsschule befreit ist, wer<br />
1. in den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des mittleren Dienstes<br />
eingestellt wurde,<br />
2. der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Bayerischen<br />
Bereitschaftspolizei angehört,<br />
3. ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr ableistet,<br />
4. ein Berufsvorbereitungsjahr, das Berufsgrundschuljahr, ein Vollzeitjahr<br />
an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufsfachschule oder<br />
einen einjährigen Vollzeitlehrgang, der der Berufsvorbereitung dient, mit<br />
Erfolg besucht hat,<br />
5. den mittleren Schulabschluss erreicht hat,<br />
6. von der Berufsschule nach Art. 86 Abs. 4 Satz 2 entlassen ist.<br />
2<br />
Absatz 2 bleibt unberührt.<br />
(4) 1 Berufsschulpflichtige ohne Ausbildungsverhältnis können allgemein oder<br />
im Einzelfall vom Besuch der Berufsschule befreit werden<br />
1. bei einem Besuch von Vollzeitlehrgängen, die der Vorbereitung auf<br />
staatlich geregelte schulische Abschlussprüfungen dienen,<br />
2. nach elf Schulbesuchsjahren, wenn ein Beschäftigungsverhältnis<br />
besteht,<br />
3. bei Vorliegen eines Härtefalls.<br />
2<br />
Absatz 2 bleibt unberührt.
Bay EUG Art. 40 Berufsschulberechtigung<br />
(1) 1 Personen, die nicht mehr berufsschulpflichtig sind, sich aber in<br />
Berufsausbildung befinden, sind zum Besuch der Berufsschule berechtigt;<br />
die Ausbildenden haben den Besuch der Berufsschule zu gestatten. 2 Nicht<br />
mehr berufsschulpflichtige Personen sind zum Besuch des<br />
Berufsgrundschuljahres berechtigt.<br />
(2) Umschülerinnen und Umschüler für einen anerkannten Ausbildungsberuf<br />
mit einem Umschulungsvertrag nach § 60 des Berufsbildungsgesetzes<br />
oder § 42 g der Handwerksordnung haben das Recht, am Unterricht der<br />
Berufsschule teilzunehmen.<br />
d) Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler mit<br />
sonderpädagogischem Förderbedarf und für kranke Schülerinnen und<br />
Schüler<br />
Bay EUG Art. 41<br />
(1) 1 Schulpflichtige mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die am<br />
gemeinsamen Unterricht in der allgemeinen Schule nicht aktiv teilnehmen<br />
können oder deren sonderpädagogischer Förderbedarf an der allgemeinen<br />
Schule auch mit Unterstützung durch Mobile Sonderpädagogische Dienste<br />
nicht oder nicht hinreichend erfüllt werden kann, haben eine für sie<br />
geeignete Förderschule zu besuchen. 2 Eine Schülerin oder ein Schüler<br />
kann aktiv am gemeinsamen Unterricht der allgemeinen Schule<br />
teilnehmen, wenn sie oder er dort, gegebenenfalls unterstützt durch<br />
Maßnahmen des Art. 21 Abs. 3, überwiegend in der Klassengemeinschaft<br />
unterrichtet werden, den verschiedenen Unterrichtsformen der<br />
allgemeinen Schule folgen und dabei schulische Fortschritte erzielen kann<br />
sowie gemeinschaftsfähig ist. 3 Schulpflichtige, die sich wegen einer<br />
Krankheit längere Zeit in Einrichtungen, an denen Schulen oder Klassen<br />
für Kranke gebildet sind, aufhalten, haben die jeweilige Schule oder Klasse<br />
für Kranke zu besuchen, so weit dies nicht aus medizinischen Gründen<br />
ausgeschlossen ist.<br />
(2) 1 Eine zweite Zurückstellung von der Aufnahme in die Förderschule kann<br />
nur in besonderen Ausnahmefällen erfolgen. 2 Sie kann mit Empfehlungen<br />
zur Förderung verbunden werden. 3 Das Nähere bestimmt die<br />
Schulordnung.<br />
(3) 1 Die Anmeldung an einer Förderschule soll nur erfolgen, wenn die<br />
Grundschule festgestellt hat, dass die Voraussetzungen des Abs. 1 Sätze 1<br />
und 2 für eine Unterrichtung an der Grundschule nicht gegeben sind.<br />
2 3<br />
Ausnahmen hiervon regelt die jeweilige Schulordnung. Vor der<br />
Aufnahme ist ein sonderpädagogisches Gutachten zu erstellen, das den<br />
Förderbedarf beschreibt und eine Empfehlung zum geeigneten Förderort<br />
ausspricht. 4 Die Erziehungsberechtigten sind rechtzeitig über Zeitpunkt,<br />
Art und Umfang der Begutachtung zu informieren und im Rahmen des<br />
Begutachtungsverfahrens anzuhören. 5 Soweit erforderlich, können auch<br />
ärztliche oder schulpsychologische Gutachten ergänzend angefordert<br />
werden; eine Empfehlung des Kindergartens oder der Schulvorbereitenden<br />
Einrichtung soll einbezogen werden. 6 Die Schulpflichtigen sind<br />
verpflichtet, an der Erstellung der Gutachten mitzuwirken. 7 Stimmen die
Erziehungsberechtigten der Aufnahme in eine Förderschule nicht zu,<br />
entscheidet das zuständige Staatliche Schulamt. 8 Auf Antrag der<br />
Erziehungsberechtigten findet vor der Entscheidung des Schulamts eine<br />
mündliche Erörterung mit den Beteiligten statt. 9 Kommt im<br />
Erörterungstermin kein Einvernehmen zu <strong>Stand</strong>e, können die<br />
Erziehungsberechtigten verlangen, dass die Feststellungen und<br />
Empfehlungen im sonderpädagogischen Gutachten durch eine<br />
überörtliche, unabhängige Fachkommission überprüft werden; die<br />
Mitglieder der Kommission dürfen am bisherigen Verfahren nicht beteiligt<br />
gewesen sein. 10 Das Schulamt hat das Votum der Fachkommission in<br />
seiner Entscheidung zu würdigen.<br />
(4) Für Schülerinnen oder Schüler, die nach Art. 20 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1<br />
Buchst. a die Jahrgangsstufe 1 A besuchen, endet die Vollzeitschulpflicht<br />
nach zehn Schuljahren, für Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige<br />
Entwicklung nach zwölf Schuljahren.<br />
(5) 1 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die<br />
den erfolgreichen Hauptschulabschluss, den qualifizierenden<br />
Hauptschulabschluss oder den erfolgreichen Abschluss ihrer<br />
Förderschulform nicht erreicht haben, dürfen über das Ende der<br />
Vollzeitschulpflicht hinaus auf Antrag der Erziehungsberechtigten die<br />
Schule bis zu zwei weitere Schuljahre, in besonderen Ausnahmefällen<br />
nach Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde auch ein drittes Jahr<br />
besuchen. 2 Art. 38 Satz 2 gilt entsprechend.<br />
(6) 1 Für die Berufsschulpflicht der Schülerinnen und Schüler nach Abs. 1 gilt<br />
Art. 39, für die Berufsschulberechtigung Art. 40 entsprechend. 2 Nicht<br />
mehr Berufsschulpflichtige sind nach Maßgabe der Schulordnung zum<br />
Berufsschulbesuch berechtigt, wenn sie an einem Förderungslehrgang<br />
teilnehmen oder ein Berufsvorbereitungsjahr besuchen wollen.<br />
3<br />
Umschülerinnen und Umschüler haben das Recht, am Unterricht der<br />
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung teilzunehmen, sofern<br />
ein solcher Unterricht für Schulpflichtige eingerichtet ist. 4 Die<br />
Berufsschulpflicht für Schülerinnen und Schüler mit dem<br />
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist durch den mindestens<br />
zwölfjährigen Besuch der Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung<br />
(einschließlich Berufsschulstufe) erfüllt.<br />
(7) 1 Ein Schulpflichtiger, der eine allgemeine Schule besucht, kann auf Antrag<br />
der besuchten Schule oder auf Antrag seiner Erziehungsberechtigten, bei<br />
Volljährigkeit auf eigenen Antrag, unter den Voraussetzungen des Abs. 1<br />
Satz 1 an eine für ihn geeignete Förderschule überwiesen werden. 2 Vor<br />
der Entscheidung findet eine umfassende Beratung der<br />
Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin oder des<br />
volljährigen Schülers statt. 3 Für das Überweisungsverfahren gelten Abs. 3<br />
Sätze 3 bis 10 entsprechend. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für<br />
die Überweisung von einer Förderschulform in eine andere; zuständige<br />
Schulaufsichtsbehörde ist die Regierung. 5 Die Schulpflicht kann auch an<br />
einer dem sonderpädagogischen Förderbedarf entsprechenden Schule<br />
nach Art. 20 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 erfüllt werden.<br />
(8) 1 Schülerinnen und Schüler einer Förderschule, von denen zu erwarten ist,<br />
dass sie am Unterricht der Volksschule oder Berufsschule mit Erfolg
teilnehmen können, sind an die Volksschule oder Berufsschule zu<br />
überweisen. 2 Im Übrigen können Schülerinnen und Schüler, für die<br />
dieVerpflichtung zum Besuch einer Förderschule nach Maßgabe des Abs. 1<br />
Satz 1 nicht mehr gegeben ist, auf Antrag der Erziehungsberechtigten<br />
oder der volljährigen Schülerin bzw. des volljährigen Schülers an die<br />
Volksschule oder Berufsschule überwiesen werden. 3 Abs. 3 Sätze 5 bis 10<br />
gelten entsprechend; zuständige Schulaufsichtsbehörde ist die Regierung.<br />
(9) Ansprüche an Sozialleistungsträger regeln sich nach den für diese<br />
geltenden Vorschriften.<br />
e) Sprengelpflicht, Gastschulverhältnisse<br />
Bay EUG Art. 42 Sprengelpflicht beim Besuch öffentlicher<br />
Pflichtschulen<br />
(1) Schülerinnen und Schüler der Volksschulen erfüllen ihre Schulpflicht in der<br />
Schule, in deren Schulsprengel sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.<br />
(2) Bestehen innerhalb einer Gemeinde mehrere Volksschulen, so kann das<br />
Schulamt im Benehmen mit der zuständigen Gemeinde und den<br />
betroffenen Elternbeiräten zur Bildung möglichst gleich starker Klassen für<br />
die Dauer von bis zu vier Schuljahren Abweichungen von den<br />
Schulsprengelgrenzen anordnen.<br />
(3) 1 Die Erfüllung der Berufsschulpflicht richtet sich für Schülerinnen und<br />
Schüler, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, nach dem<br />
Beschäftigungsort, für die Übrigen nach dem Ort des gewöhnlichen<br />
Aufenthalts. 2 Ist der Beschäftigungsort oder der Ort des gewöhnlichen<br />
Aufenthalts zweifelhaft, so entscheidet die Regierung, welche Schule zu<br />
besuchen ist.<br />
(4) Berufsschulpflichtige, die in Bayern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,<br />
aber außerhalb Bayerns beschäftigt sind, sind zum Besuch der für ihren<br />
gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Berufsschule verpflichtet, wenn sie<br />
nicht die für den Beschäftigungsort zuständige außerbayerische<br />
Berufsschule besuchen können.<br />
(5) Wenn es die örtlichen Verhältnisse nahe legen oder Jahrgangsfachklassen<br />
in Bayern nicht gebildet werden können, ist es möglich, Schülerinnen und<br />
Schüler zum Besuch einer außerbayerischen Berufsschule zu verpflichten;<br />
Art. 43 Abs. 5 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.<br />
(6) Auf Berufsschulberechtigte finden die Absätze 3 bis 5 entsprechende<br />
Anwendung.<br />
(7) Für die Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung gelten die<br />
Abs. 1 und 2, für die Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung<br />
gelten die Abs. 3 bis 5 entsprechend.<br />
Bay EUG Art. 43 Gastschulverhältnisse<br />
(1) 1 Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann aus zwingenden<br />
persönlichen Gründen der Besuch einer anderen Volksschule gestattet<br />
werden. 2 Die Entscheidung trifft die Gemeinde, in der die Schülerinnen<br />
und Schüler ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, im Einvernehmen mit<br />
dem aufnehmenden Schulaufwandsträger nach Anhörung der betroffenen
Schulen. 3 Die Fachaufsicht obliegt dem Schulamt, das die Aufsicht über<br />
die Schule ausübt, in deren Schulsprengel die Schülerinnen und Schüler<br />
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 4 Das Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus wird ermächtigt, das Verfahren durch<br />
Rechtsverordnung zu regeln.<br />
(2) Das Schulamt kann Schülerinnen und Schüler einer anderen Volksschule<br />
zuweisen<br />
1. in Mittlere-Reife-Klassen und in Klassen und Unterrichtsgruppen, die für<br />
besondere pädagogische Aufgaben eingerichtet sind,<br />
2. zum Unterricht in einzelnen Fächern,<br />
3. wenn sich in einer Jahrgangsstufe der Hauptschule zu wenige Schüler<br />
für die Bildung einer Klasse befinden, im Benehmen mit den betroffenen<br />
Schulaufwandsträgern,<br />
4. in den Fällen des Art. 86 Abs. 2 Nr. 7.<br />
(3) Bestehen innerhalb einer Gemeinde mehrere Volksschulen, so kann das<br />
Schulamt im Benehmen mit der Gemeinde zur Bildung möglichst gleich<br />
starker Klassen für die Dauer von bis zu sechs Jahren auch einzelne<br />
Schülerinnen und Schüler einer benachbarten Volksschule zuweisen.<br />
(4) 1 Für Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung (einschließlich der<br />
Schulvorbereitenden Einrichtungen) gelten die Absätze 1 bis 3<br />
entsprechend; die Entscheidung nach Abs. 1 trifft die Gebietskörperschaft<br />
des gewöhnlichen Aufenthalts der Schülerinnen und Schüler, für deren<br />
Gebiet oder Teilgebiet die entsprechende Förderschule errichtet ist oder<br />
errichtet werden müsste, bei Entscheidungen nach Abs. 2 und 3 ist<br />
anstelle des Schulamts die Regierung zuständig. 2 Die<br />
Schulaufsichtsbehörde kann Schülerinnen und Schüler bzw. Kinder der<br />
nächstgelegenen geeigneten Förderschule zuweisen, wenn sie ihren<br />
gewöhnlichen Aufenthalt an einem Ort haben, der von keinem Sprengel<br />
einer nach ihrem sonderpädagogischen Förderbedarf in Betracht<br />
kommenden Schule erfasst ist; bei privaten Volksschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung setzt dies die Zustimmung des Trägers<br />
voraus.<br />
(5) 1 Aus wichtigen Gründen kann der Besuch einer anderen Berufsschule<br />
genehmigt oder angeordnet werden. 2 Das Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung<br />
Tatbestände festzulegen, die als wichtige Gründe gelten. 3 Für die<br />
Genehmigung eines Gastschulverhältnisses ist die abgebende Berufsschule<br />
zuständig, wenn mit der aufnehmenden Berufsschule und den zuständigen<br />
Schulaufwandsträgern über die Begründung des Gastschulverhältnisses<br />
Einvernehmen besteht. 4 In den übrigen Fällen entscheidet die für die<br />
abgebende Schule zuständige Regierung. 5 Für Berufsschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.<br />
f) Wahl des schulischen Bildungswesens<br />
Richtig wohl: Bildungswegs<br />
Bay EUG Art. 44<br />
(1) 1 Soweit nicht Pflichtschulen zu besuchen sind, haben die<br />
Erziehungsberechtigten und die volljährigen Schülerinnen und Schüler das
Recht, Schulart, Ausbildungsrichtung und Fachrichtung zu wählen. 2 Für<br />
die Aufnahme sind Eignung und Leistung der Schülerin bzw. des Schülers<br />
maßgebend.<br />
(2) 1 Für Schulen, die nicht Pflichtschulen sind, wird das zuständige<br />
Staatsministerium ermächtigt, die Voraussetzungen der Aufnahme<br />
(einschließlich Altersgrenzen) und eine Probezeit in der Schulordnung zu<br />
regeln; dabei kann die Aufnahme von einer der Aufgabenstellung der<br />
Schule entsprechenden Leistungsfeststellung abhängig gemacht werden.<br />
2<br />
Ab Jahrgangsstufe 10 kann die Aufnahme versagt werden, wenn die<br />
Schülerin oder der Schüler wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat<br />
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt<br />
worden ist, die Strafe noch der unbeschränkten Auskunft unterliegt und<br />
wenn nach der Art der begangenen Straftat durch die Anwesenheit des<br />
Schülers die Sicherheit oder die Ordnung des Schulbetriebs oder die<br />
Verwirklichung der Bildungsziele der Schule erheblich gefährdet wäre.<br />
(3) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule an einem<br />
bestimmten Ort besteht nicht.<br />
(4) 1 Die Zulassung zu einer Ausbildungs- oder Fachrichtung einer Schulart<br />
darf im notwendigen Umfang nur dann beschränkt werden, wenn die Zahl<br />
der Bewerbungen die Zahl der Ausbildungsplätze erheblich übersteigt und<br />
ein geordneter Unterrichtsbetrieb nicht mehr sichergestellt werden kann.<br />
2<br />
Das zuständige Staatsministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit<br />
dem Landesschulbeirat durch Rechtsverordnung das Verfahren der<br />
Zulassung nach Gesichtspunkten der Eignung und der Leistung zu regeln;<br />
Wartezeit und Härtefälle sollen berücksichtigt werden; für kommunale<br />
Schulen kann der Schulträger dies durch eine Satzung regeln, falls eine<br />
Rechtsverordnung für die betreffende Schulart und Ausbildungsrichtung<br />
nicht erlassen worden ist.<br />
Abschnitt V Inhalte des Unterrichts<br />
Bay EUG Art. 45 Lehrpläne, Stundentafeln, Richtlinien und<br />
Bildungsstandards<br />
(1) 1 Grundlage für Unterricht und Erziehung bilden die Lehrpläne, die<br />
Stundentafel, in der Art und Umfang des Unterrichtsangebots einer<br />
Schulart festgelegt ist, und sonstige Richtlinien. 2 Lehrpläne, Stundentafeln<br />
und Richtlinien richten sich nach den besonderen Bildungszielen und<br />
Aufgaben der jeweiligen Schulart; sie haben die Vermittlung von Wissen<br />
und Können und die erzieherische Aufgabe der Schule zu berücksichtigen.<br />
3<br />
Wissen und Können beziehen sich auch auf <strong>Stand</strong>ards, die in<br />
länderübergreifenden Verfahren mit Zustimmung des Staatsministeriums<br />
für Unterricht und Kultus festgelegt werden.<br />
(2) 1 Lehrpläne, Stundentafeln und Richtlinien erlässt, bei grundlegenden<br />
Maßnahmen im Benehmen mit dem Landesschulbeirat (Art. 73 Abs. 2<br />
Satz 2 Nr. 1), das zuständige Staatsministerium. 2 Bei Lehrplänen und<br />
Stundentafeln für berufliche Schulen handelt es hierbei im Benehmen mit<br />
den betreffenden Staatsministerien, Verbänden und Organisationen, für<br />
Fachakademien außerdem im Einvernehmen mit dem Staatsministerium
für Unterricht und Kultus. 3 Bei kommunalen beruflichen Schulen kann es<br />
sich auf die Genehmigung beschränken. 4 Das zuständige<br />
Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für die<br />
einzelnen Schularten und deren Jahrgangsstufen unter Berücksichtigung<br />
der einzelnen Ausbildungs- und Fachrichtungen in den Stundentafeln vor<br />
allem Folgendes festzulegen:<br />
1. die Unterrichtsfächer,<br />
2. die Verbindlichkeit der Unterrichtsfächer (Pflichtfach, Wahlpflichtfach,<br />
Wahlfach),<br />
3. die Mindest- und Höchstsumme der wöchentlichen Unterrichtsstunden<br />
aller Unterrichtsfächer,<br />
4. die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden, die auf jedes<br />
Unterrichtsfach entfallen,<br />
5. Kurse innerhalb oder an Stelle von Fächern gemäß Art. 50 Abs. 3.<br />
5<br />
Dabei ist auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Aufwandsträger<br />
Rücksicht zu nehmen. 6 Soweit der einzelnen Schule in den Stundentafeln<br />
vom zuständigen Staatsministerium in Einzelfragen Entscheidungen<br />
eingeräumt werden, können diese in der Rechtsverordnung dem<br />
Schulforum übertragen werden.<br />
(3) 1 Zur Erstellung von Lehrplänen beruft das zuständige Staatsministerium<br />
Lehrplankommissionen. 2 Lehrpläne sind nach Maßgabe fachlicher,<br />
didaktischer, pädagogischer und schulpraktischer Gesichtspunkte zu<br />
erstellen und aufeinander abzustimmen. 3 Den Lehrplänen für die<br />
Berufsschulen und Berufsfachschulen werden die Rahmenlehrpläne der<br />
Kultusministerkonferenz zugrunde gelegt.<br />
Bay EUG Art. 46 Religionsunterricht<br />
(1) 1 Der Religionsunterricht ist an den Volksschulen, Realschulen, Gymnasien,<br />
Förderschulen, Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, Fachoberschulen,<br />
Berufsoberschulen, an sonstigen Schulen nach Maßgabe der<br />
Schulordnung, ordentliches Lehrfach (Pflichtfach). 2 Er wird nach<br />
Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der<br />
betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt.<br />
(2) 1 Lehrkräfte bedürfen zur Erteilung des Religionsunterrichts der<br />
Bevollmächtigung durch die betreffende Kirche oder<br />
Religionsgemeinschaft. 2 Keine Lehrkraft darf gegen ihren Willen<br />
verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.<br />
(3) An den Volksschulen und Volksschulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung können die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften<br />
bestellten Lehrkräfte für den Religionsunterricht den gesamten<br />
Religionsunterricht erteilen.<br />
(4) 1 Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihre Kinder vom<br />
Religionsunterricht abzumelden. 2 Nach Vollendung des 18. Lebensjahres<br />
steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern selbst zu. 3 Das Nähere<br />
über Teilnahme und Abmeldung regelt das Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus durch Rechtsverordnung.
Bay EUG Art. 47 Ethikunterricht<br />
(1) Ethikunterricht ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler Pflichtfach, die<br />
nicht am Religionsunterricht teilnehmen.<br />
(2) 1 Der Ethikunterricht dient der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu<br />
werteinsichtigem Urteilen und Handeln. 2 Sein Inhalt orientiert sich an den<br />
sittlichen Grundsätzen, wie sie in der Verfassung und im Grundgesetz<br />
niedergelegt sind. 3 Im Übrigen berücksichtigt er die Pluralität der<br />
Bekenntnisse und Weltanschauungen.<br />
Bay EUG Art. 48 Familien- und Sexualerziehung<br />
(1) 1 Unbeschadet des natürlichen Erziehungsrechts der Eltern gehört<br />
Familien- und Sexualerziehung zu den Aufgaben der Schulen gemäß Art. 1<br />
und 2. 2 Sie ist als altersgemäße Erziehung zu verantwortlichem<br />
geschlechtlichen Verhalten Teil der Gesamterziehung mit dem vorrangigen<br />
Ziel der Förderung von Ehe und Familie. 3 Familien- und Sexualerziehung<br />
wird im Rahmen mehrerer Fächer durchgeführt.<br />
(2) Familien- und Sexualerziehung richtet sich nach den in der Verfassung,<br />
insbesondere in Art. 118 Abs. 2, Art. 124, Art. 131 sowie Art. 135 Satz 2<br />
festgelegten Wertentscheidungen und Bildungszielen unter Wahrung der<br />
Toleranz für unterschiedliche Wertvorstellungen.<br />
(3) Ziel, Inhalt und Form der Familien- und Sexualerziehung sind den<br />
Erziehungsberechtigten rechtzeitig mitzuteilen und mit ihnen zu<br />
besprechen.<br />
(4) Richtlinien für Familien- und Sexualerziehung in den einzelnen Schularten,<br />
Fächern und Jahrgangsstufen erlässt das Staatsministerium für Unterricht<br />
und Kultus im Benehmen mit dem Landesschulbeirat.<br />
Abschnitt VI Grundsätze des Schulbetriebs<br />
Bay EUG Art. 49 Jahrgangsstufen, Klassen, Unterrichtsgruppen<br />
(1) 1 Der Unterricht wird in der Regel nach Jahrgangsstufen in Klassen erteilt,<br />
die für ein Schuljahr gebildet werden. 2 Für einzelne Schularten kann das<br />
zuständige Staatsministerium in der Schulordnung Unterricht in<br />
Halbjahreszeiträumen und anderen Gruppierungen (z. B. Kurse) vorsehen<br />
sowie Mindest- und Höchstzahlen der Schülerinnen und Schüler<br />
festsetzen. 3 Die Schulordnung kann vorsehen, dass in besonderen Fällen<br />
die Schule, bei Volksschulen das Staatliche Schulamt im Schulamtsbezirk,<br />
von den festgesetzten Mindest- und Höchstzahlen durch<br />
Ausgleichsregelungen abweichen kann.<br />
(2) 1 An Volksschulen werden von der Schule unter Beachtung pädagogischer<br />
und schulorganisatorischer Erfordernisse Schülerinnen und Schüler<br />
gleichen Bekenntnisses einer Klasse zugewiesen, wenn für die<br />
Jahrgangsstufe zwei oder mehr Klassen (Parallelklassen) gebildet worden<br />
sind und die Erziehungsberechtigten zustimmen; ein Anspruch auf<br />
Aufnahme in eine solche Klasse besteht nicht. 2 Bei der Anmeldung der<br />
vollzeitschulpflichtigen Kinder an der Volksschule geben die<br />
Erziehungsberechtigten eine Erklärung darüber ab, ob sie der Zuweisung
in eine Klasse mit Schülerinnen und Schülern gleichen Bekenntnisses<br />
zustimmen, falls für die Jahrgangsstufe Parallelklassen gebildet werden.<br />
3 Diese Erklärung gilt für die Dauer des Besuchs der Volksschule, wenn sie<br />
nicht widerrufen wird; der Widerruf wird mit Beginn des folgenden<br />
Schuljahres wirksam.<br />
Bay EUG Art. 50 Fächer, Kurse, fachpraktische Ausbildung<br />
(1) Die Fächer, in denen unterrichtet wird, sind entweder Pflichtfächer,<br />
Wahlpflichtfächer oder Wahlfächer.<br />
(2) 1 Der Unterricht in Pflichtfächern und in gewählten Fächern muss von allen<br />
Schülerinnen und Schülern besucht werden, soweit nicht in<br />
Rechtsvorschriften Ausnahmen vorgesehen sind. 2 Bei Wahlpflichtfächern<br />
ist innerhalb der von der Schule angebotenen Fächer oder Fächergruppen<br />
zu wählen. 3 Bei Wahlfächern können die Erziehungsberechtigten oder die<br />
volljährigen Schülerinnen und Schüler über die Anmeldung zum Unterricht<br />
entscheiden; über die Zulassung entscheidet die Schule.<br />
(3) 1 Innerhalb oder an Stelle von Fächern können Kurse mit unterschiedlichen<br />
Leistungsanforderungen eingerichtet werden. 2 Im Rahmen des Unterrichts<br />
kann eine fachpraktische Ausbildung vorgeschrieben werden.<br />
(4) Das zuständige Staatsministerium kann auch Praktika und<br />
Anerkennungszeiten fordern, soweit dies für das Erreichen des<br />
Ausbildungsziels erforderlich ist.<br />
Bay EUG Art. 51 Lernmittel, Lehrmittel<br />
(1) 1 Schulbücher, Arbeitshefte und Arbeitsblätter dürfen in der Schule nur<br />
verwendet werden, wenn sie für den Gebrauch in der betreffenden<br />
Schulart und Jahrgangsstufe sowie in dem betreffenden Unterrichtsfach<br />
schulaufsichtlich zugelassen sind. 2 Die Zulassung setzt voraus, dass diese<br />
Lernmittel die Anforderungen der Lehrpläne, Stundentafeln und sonstigen<br />
Richtlinien (Art. 45 Abs. 1) erfüllen und den pädagogischen und fachlichen<br />
Erkenntnissen für die betreffende Schulart und Jahrgangsstufe<br />
entsprechen. 3 Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Lernmittel der Fächer des<br />
fachlichen Unterrichts an beruflichen Schulen; auch bei diesen Lernmitteln<br />
ist auf die alters- und lehrplangemäße Verwendung in der Schule zu<br />
achten.<br />
(2) 1 Das zuständige Staatsministerium erlässt die für die schulaufsichtliche<br />
Prüfung und Zulassung von Lernmitteln erforderlichen<br />
Ausführungsvorschriften. 2 Es wird insbesondere ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung die Lernmittel, die prüfungspflichtig sind, die<br />
Anforderungen an die äußere Gestaltung sowie Zuständigkeit und<br />
Verfahren festzulegen.<br />
(3) Über die Einführung zugelassener oder nach Abs. 1 Satz 3 nicht<br />
zulassungspflichtiger Lernmittel an der Schule entscheidet die<br />
Lehrerkonferenz oder der zuständige Ausschuss im Rahmen der zur<br />
Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Abstimmung mit dem Elternbeirat<br />
und bei Berufsschulen mit dem Berufsschulbeirat.<br />
(4) 1 Nicht in die Lernmittelfreiheit einbezogene zugelassene oder nicht<br />
zulassungspflichtige Lernmittel werden von den Erziehungsberechtigten
oder den Schülern selbst beschafft. 2 Die Schule kann die Verwendung<br />
bestimmter übriger Lernmittel im Sinn des Art. 21 Abs. 3 Satz 4 des<br />
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Abstimmung mit<br />
dem Elternbeirat und bei Berufsschulen mit dem Berufsschulbeirat<br />
anordnen und hierbei insbesondere Höchstbeträge vorsehen.<br />
(5) Das zuständige Staatsministerium kann durch Rechtsverordnung das<br />
Verfahren und die Voraussetzungen der Zulassung und Verwendung von<br />
Lehrmitteln einschließlich audiovisueller Medien regeln.<br />
Bay EUG Art. 52 Nachweise des Leistungsstands, Bewertung der<br />
Leistungen, Zeugnisse<br />
(1) 1 Zum Nachweis des Leistungsstands erbringen die Schülerinnen und<br />
Schüler in angemessenen Zeitabständen entsprechend der Art des Fachs<br />
schriftliche, mündliche und praktische Leistungen. 2 Art, Zahl, Umfang,<br />
Schwierigkeit und Gewichtung der Leistungsnachweise richten sich nach<br />
den Erfordernissen der jeweiligen Schulart und Jahrgangsstufe sowie der<br />
einzelnen Fächer. 3 Die Art und Weise der Erhebung der Nachweise des<br />
Leistungsstandes ist den Schülerinnen und Schülern vorher bekannt zu<br />
geben; die Bewertung der Leistungen ist den Schülern mit Notenstufe und<br />
der Begründung für die Benotung zu eröffnen. 4 Leistungsnachweise<br />
dienen der Leistungsbewertung und als Beratungsgrundlage.<br />
(2) 1 Die einzelnen schriftlichen, mündlichen und praktischen<br />
Leistungsnachweise sowie die gesamte während eines Schuljahres oder<br />
sonstigen Ausbildungsabschnitts in den einzelnen Fächern erbrachte<br />
Leistung werden nach folgenden Notenstufen bewertet:<br />
sehr gut = 1 (Leistung entspricht den Anforderungen in<br />
besonderem Maße)<br />
gut = 2 (Leistung entspricht voll den Anforderungen)<br />
befriedigend = 3 (Leistung entspricht im Allgemeinen den<br />
Anforderungen)<br />
ausreichend = 4 (Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im<br />
Ganzen noch den Anforderungen)<br />
mangelhaft = 5 (Leistung entspricht nicht den Anforderungen, lässt<br />
jedoch erkennen, dass trotz deutlicher<br />
Verständnislücken die notwendigen Grundkenntnisse<br />
vorhanden sind)<br />
ungenügend = 6 (Leistung entspricht nicht den Anforderungen und<br />
lässt selbst die notwendigen Grundkenntnisse nicht<br />
erkennen).<br />
2 Art. 9 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3, Art. 16 Abs. 2 Satz 3 und Art. 17 Abs. 2 Satz 5<br />
bleiben unberührt. 3 Die Schulordnungen können vorsehen, dass in<br />
bestimmten Jahrgangsstufen der Grundschule und der Förderschule, in<br />
Wahlfächern sowie bei ausländischen Schülerinnen und Schülern in<br />
Pflichtschulen und bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf in Volksschulen und Berufsschulen die Noten durch eine<br />
allgemeine Bewertung ersetzt werden. 4 Auf Wunsch der
Erziehungsberechtigten oder Schülerinnen und Schüler hat die Lehrkraft die<br />
erzielten Noten zu nennen.<br />
(3) 1 Unter Berücksichtigung der einzelnen schriftlichen, mündlichen und<br />
praktischen Leistungen werden Zeugnisse erteilt. 2 Hierbei werden die<br />
gesamten Leistungen einer Schülerin bzw. eines Schülers unter Wahrung<br />
der Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler in pädagogischer<br />
Verantwortung der Lehrkraft bewertet. 3 Daneben sollen Bemerkungen<br />
oder Bewertungen nach Abs. 2 Satz 1 oder in anderer Form über Anlagen,<br />
Mitarbeit und Verhalten der Schülerin oder des Schülers in das Zeugnis<br />
aufgenommen werden.<br />
(4) Regelungen über den Notenausgleich können in den Schulordnungen<br />
vorgesehen werden.<br />
Bay EUG Art. 53 Vorrücken und Wiederholen<br />
(1) In die nächsthöhere Jahrgangsstufe rücken Schülerinnen und Schüler vor,<br />
die während des laufenden Schuljahres oder des sonstigen<br />
Ausbildungsabschnitts die erforderlichen Leistungsnachweise erbracht und<br />
dabei den Anforderungen genügt haben.<br />
(2) Schülerinnen und Schüler, die die Erlaubnis zum Vorrücken nicht erhalten<br />
haben, können die bisher besuchte Jahrgangsstufe derselben Schulart<br />
wiederholen.<br />
(3) 1 Das Wiederholen ist nicht zulässig für Schülerinnen und Schüler, die<br />
1. dieselbe Jahrgangsstufe zum zweiten Mal wiederholen müssten,<br />
2. nach Wiederholung einer Jahrgangsstufe auch die nächstfolgende<br />
wiederholen müssten.<br />
2<br />
Das Wiederholen ist außerdem nicht zulässig für Schülerinnen und<br />
Schüler der Gymnasien und Realschulen, die innerhalb der<br />
Jahrgangsstufen 5 bis 7 zum zweiten Mal nicht vorrücken durften.<br />
(4) 1 Zuständig für die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist die<br />
Klassenkonferenz. 2 Für einzelne Schularten kann in der Schulordnung ein<br />
anderes aus Lehrkräften der Schule gebildetes Gremium oder die<br />
Klassenleiterin bzw. der Klassenleiter bestimmt werden. 3 Mitglieder der<br />
Klassenkonferenz sind die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte und<br />
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter oder eine von ihr bzw. ihm<br />
beauftragte Lehrkraft als Vorsitzender.<br />
(5) 1 Von den Folgen nach Absatz 3 kann die Lehrerkonferenz befreien, wenn<br />
zuverlässig anzunehmen ist, dass die Ursache des Misserfolgs nicht in<br />
mangelnder Eignung oder schuldhaftem Verhalten der Schülerin oder des<br />
Schülers gelegen ist. 2 Die Lehrerkonferenz entscheidet auch darüber, ob<br />
bei einer Schülerin oder einem Schüler, die oder der von einer Schule<br />
anderer Art übergetreten ist und an der zuvor besuchten Schule bereits<br />
einmal wiederholt hat, Absatz 3 anzuwenden ist.<br />
(6) 1 Schülerinnen und Schülern, die die Erlaubnis zum Vorrücken nicht<br />
erhalten haben, kann in einzelnen Schularten und Jahrgangsstufen nach<br />
Maßgabe näherer Regelungen in den Schulordnungen das Vorrücken auf<br />
Probe gestattet werden; das Vorrücken kann ihnen noch gestattet werden,<br />
wenn sie sich einer Nachprüfung zu Beginn des folgenden Schuljahres<br />
erfolgreich unterzogen haben. 2 Schülerinnen und Schülern, die infolge
nachgewiesener erheblicher Beeinträchtigungen ohne eigenes Verschulden<br />
wegen Leistungsminderungen die Voraussetzungen zum Vorrücken nicht<br />
erfüllen (z. B. wegen Krankheit), kann das Vorrücken auf Probe gestattet<br />
werden, wenn zu erwarten ist, dass die entstandenen Lücken geschlossen<br />
werden können und das angestrebte Bildungsziel erreicht werden kann.<br />
(7) 1 Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Schülerinnen und Schüler der<br />
Berufsschulen und Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung.<br />
2<br />
Für Schülerinnen und Schüler der Volksschulen und der Volksschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung gelten an Stelle der Absätze 3 und 5 die<br />
Bestimmungen über die Vollzeitschulpflicht nach Maßgabe näherer<br />
Regelungen in den Schulordnungen.<br />
Bay EUG Art. 54 Abschlussprüfung<br />
(1) 1 Der Besuch der Schule wird in der Regel durch eine Prüfung<br />
abgeschlossen (Abschlussprüfung). 2 Bei Berufsschulen kann nach<br />
Maßgabe der Schulordnung auf eine Abschlussprüfung verzichtet werden,<br />
wenn sich die Schülerinnen und Schüler einer Berufsabschlussprüfung<br />
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung unterziehen,<br />
an der Lehrkräfte an beruflichen Schulen mitwirken.<br />
(2) Die Abschlussprüfung wird vor einem Prüfungsausschuss, dessen Vorsitz<br />
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter inne hat, abgelegt, sofern das<br />
zuständige Staatsministerium allgemein oder für den Einzelfall nicht<br />
anderes bestimmt.<br />
(3) 1 Die Abschlussprüfung umfasst nach Maßgabe der Rechtsvorschriften für<br />
die einzelnen Schularten entsprechend der Art des jeweiligen Fachs einen<br />
schriftlichen, einen mündlichen und einen praktischen Teil. 2 Für die<br />
Bewertung der Prüfungsleistungen gilt Art. 52 Abs. 2 entsprechend.<br />
(4) 1 Nach bestandener Abschlussprüfung erhält der Prüfling ein<br />
Abschlusszeugnis. 2 Dieses enthält die Noten in den einzelnen Fächern und<br />
die Feststellung, welche Berechtigung das Zeugnis verleiht. Zusätzlich<br />
kann das Zeugnis eine allgemeine Beurteilung enthalten.<br />
(5) 1 Ein Prüfling, der die Abschlussprüfung nicht bestanden hat, kann zur<br />
Abschlussprüfung erst zum nächsten Prüfungstermin und nur noch einmal<br />
zugelassen werden. 2 Mit Genehmigung des zuständigen<br />
Staatsministeriums oder der von ihm beauftragten Stelle kann die<br />
Abschlussprüfung ein zweites Mal wiederholt werden. 3 Ein Prüfling, der<br />
zur Wiederholung der Abschlussprüfung zugelassen worden ist, darf auch<br />
die betreffende Jahrgangsstufe oder den betreffenden<br />
Ausbildungsabschnitt wiederholen, falls er damit nicht die<br />
Höchstausbildungsdauer überschreitet (Art. 55 Abs. 1 Nr. 6). 4 Die<br />
Bestimmungen über die Schulpflicht bleiben unberührt.<br />
Bay EUG Art. 55 Beendigung des Schulbesuchs<br />
(1) Bei den Schülerinnen und Schülern anderer als Pflichtschulen endet der<br />
Schulbesuch<br />
1. durch Austritt,<br />
2. durch Nichtbestehen einer Probezeit, es sei denn, dass die Schülerin<br />
oder der Schüler in eine andere Jahrgangsstufe zurückverwiesen wird
(Art. 44 Abs. 2 Satz 1, Art. 53 Abs. 6 Satz 2),<br />
3. durch Erteilung des Abschlusszeugnisses oder des<br />
Entlassungszeugnisses, spätestens aber mit Ablauf des Schuljahres, in<br />
dem die Abschlussprüfung bestanden wird,<br />
4. mit Ablauf des Schuljahres, in dem eine Schülerin bzw. ein Schüler die<br />
Erlaubnis zum Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe nicht erhalten<br />
oder die Abschlussprüfung nicht bestanden hat und ein Wiederholen nicht<br />
mehr zulässig ist,<br />
5. durch Entlassung,<br />
6. durch Überschreitung der Höchstausbildungsdauer, die für die einzelnen<br />
Schularten in der Schulordnung festgelegt ist; für Härtefalle können<br />
Ausnahmen vorgesehen werden.<br />
(2) 1 Bleibt eine Schülerin oder ein Schüler einer Schule, die keine<br />
Pflichtschule ist, längere Zeit ohne ausreichende Entschuldigung dem<br />
Unterricht fern, so kann die Schule nach erfolgloser Erkundigung und<br />
vorheriger schriftlicher Ankündigung in angemessener Frist das<br />
Fernbleiben einer Austrittserklärung gleichstellen. 2 Die Schulpflicht bleibt<br />
davon unberührt.<br />
(3) Die Beendigung des Schulbesuchs bei Pflichtschulen richtet sich nach der<br />
Dauer der Schulpflicht.<br />
Abschnitt VII Schülerinnen und Schüler<br />
Bay EUG Art. 56 Rechte und Pflichten<br />
(1) 1 Schülerinnen und Schüler im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s und der auf Grund<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen Vorschriften sind Personen, die in den Schulen<br />
unterrichtet und erzogen werden. 2 Alle Schülerinnen und Schüler haben<br />
gemäß Art. 128 der Verfassung ein Recht darauf, eine ihren erkennbaren<br />
Fähigkeiten und ihrer inneren Berufung entsprechende schulische Bildung<br />
und Förderung zu erhalten. 3 Aus diesem Recht ergeben sich einzelne<br />
Ansprüche, wenn und soweit sie nach Voraussetzungen und Inhalt in<br />
diesem Gesetz oder auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s bestimmt sind.<br />
(2) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, entsprechend ihrem Alter<br />
und ihrer Stellung innerhalb des Schulverhältnisses<br />
1. sich am Schulleben zu beteiligen,<br />
2. im Rahmen der Schulordnung und der Lehrpläne an der Gestaltung des<br />
Unterrichts mitzuwirken,<br />
3. über wesentliche Angelegenheiten des Schulbetriebs hinreichend<br />
unterrichtet zu werden,<br />
4. Auskunft über ihren Leistungsstand und Hinweise auf eine Förderung zu<br />
erhalten,<br />
5. bei als ungerecht empfundener Behandlung oder Beurteilung sich<br />
nacheinander an Lehrkräfte, an die Schulleiterin bzw. den Schulleiter und<br />
an das Schulforum zu wenden.<br />
(3) 1 Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ihre Meinung frei zu<br />
äußern; im Unterricht ist der sachliche Zusammenhang zu wahren. 2 Die<br />
Bestimmungen über Schülerzeitung (Art. 63) und politische Werbung<br />
(Art. 84) bleiben unberührt.
(4) 1 Alle Schülerinnen und Schüler haben sich so zu verhalten, dass die<br />
Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. 2 Sie<br />
haben insbesondere die Pflicht, am Unterricht regelmäßig teilzunehmen<br />
und die sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen zu besuchen. 3 Die<br />
Schülerinnen und Schüler haben alles zu unterlassen, was den<br />
Schulbetrieb oder die Ordnung der von ihnen besuchten Schule oder einer<br />
anderen Schule stören könnte.<br />
(5) 1 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und<br />
sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken<br />
verwendet werden, auszuschalten. 2 Die unterrichtende oder die außerhalb<br />
des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten.<br />
3<br />
Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges<br />
digitales Speichermedium vorübergehend einbehalten werden.<br />
Abschnitt VIII Schulleiterin oder Schulleiter, Lehrerkonferenz,<br />
Lehrkräfte<br />
Bay EUG Art. 57 Schulleiterin oder Schulleiter<br />
(1) 1 Für jede Schule ist eine Person mit der Schulleitung zu betrauen; sie ist<br />
zugleich Lehrkraft an der Schule (Schulleiterin oder Schulleiter). 2 Bei<br />
Förderschulen und beruflichen Schulzentren (Art. 30 Abs. 2) kann eine<br />
Person mit der Leitung mehrerer Schulen, auch verschiedener Schularten,<br />
betraut werden; sie ist zugleich Lehrkraft an einer der Schulen.<br />
(2) 1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für einen geordneten<br />
Schulbetrieb und Unterricht sowie gemeinsam mit den Lehrkräften für die<br />
Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler sowie die<br />
Überwachung der Schulpflicht verantwortlich; sie oder er hat sich über das<br />
Unterrichtsgeschehen zu informieren. 2 In Erfüllung dieser Aufgaben ist sie<br />
oder er den Lehrkräften und dem sonstigen pädagogischen Personal sowie<br />
dem Verwaltungs- und Hauspersonal gegenüber weisungsberechtigt. 3 Sie<br />
oder er berät die Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Personal und<br />
sorgt für deren Zusammenarbeit.<br />
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule nach außen.<br />
Bay EUG Art. 58 Lehrerkonferenz<br />
(1) 1 An jeder Schule besteht eine Lehrerkonferenz. 2 Wenn an einer Schule<br />
mehrere Schularten oder Ausbildungsrichtungen als Abteilungen geführt<br />
werden, kann die Schulordnung die Bildung von Teilkonferenzen der<br />
Lehrkräfte dieser Abteilungen vorsehen. 3 Bei Schulen mit mehr als 25 mit<br />
mindestens der Hälfte der Unterrichtspflichtzeit beschäftigten Lehrkräften<br />
werden für die Dauer eines Schuljahres ein Disziplinarausschuss und ein<br />
Lehr- und Lernmittelausschuss, die insoweit die Aufgaben der<br />
Lehrerkonferenz wahrnehmen, sowie sonstige Ausschüsse nach näherer<br />
Bestimmung der Schulordnung gebildet.<br />
(2) 1 Mitglieder der Lehrerkonferenz sind alle an der Schule tätigen Lehrkräfte,<br />
die Beamten im Vorbereitungsdienst, die an der Schule<br />
eigenverantwortlichen Unterricht erteilen, sowie die Förderlehrer und das<br />
Personal für die heilpädagogische Unterrichtshilfe. 2 Den Vorsitz führt die
Schulleiterin oder der Schulleiter. 3 Die Vertreter der<br />
Schulaufsichtsbehörden sind zur Teilnahme an den Sitzungen berechtigt.<br />
(3) 1 Die Lehrerkonferenz hat die Aufgabe, die Erziehungs- und<br />
Unterrichtsarbeit sowie das kollegiale und pädagogische Zusammenwirken<br />
der Lehrkräfte an der Schule zu sichern. 2 Die Aufgaben der Schulleiterin<br />
oder des Schulleiters und die pädagogische Verantwortung der einzelnen<br />
Lehrkraft bleiben unberührt.<br />
(4) 1 Die Lehrerkonferenz beschließt in den Angelegenheiten, die ihr durch<br />
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Entscheidung zugewiesen sind,<br />
mit bindender Wirkung für die Schulleiterin oder den Schulleiter und die<br />
übrigen Mitglieder der Lehrerkonferenz. 2 In den übrigen Angelegenheiten<br />
gefasste Beschlüsse bedeuten Empfehlungen.<br />
(5) 1 Für die Ausführung der Beschlüsse der Lehrerkonferenz nach Absatz 4<br />
Satz 1 ist die Schulleiterin oder der Schulleiter verantwortlich. 2 Ist die<br />
Schulleiterin oder der Schulleiter der Auffassung, dass ein Beschluss der<br />
Lehrerkonferenz gegen eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift verstößt<br />
oder dass sie oder er für die Ausführung des Beschlusses nicht die<br />
Verantwortung übernehmen kann, so hat er den Gegenstand dieses<br />
Beschlusses in einer weiteren, innerhalb eines Monats einzuberufenden<br />
Sitzung noch einmal zur Beratung zu stellen. 3 Handelt es sich um eine<br />
Angelegenheit, die der Lehrerkonferenz nach Absatz 4 Satz 1 zur<br />
Entscheidung zugewiesen ist, so hat die Schulleiterin oder der Schulleiter<br />
den Beschluss zu beanstanden, den Vollzug auszusetzen und – in<br />
dringenden Fällen ohne wiederholte Beratung – die Entscheidung der<br />
Schulaufsichtsbehörde herbeizuführen. 4 Die Beanstandung ist schriftlich<br />
oder (unter Verwendung einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten<br />
elektronischen Signatur) elektronisch zu begründen. 5 Bis zur<br />
Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde darf der Beschluss nicht<br />
ausgeführt werden. 6 Die Schulaufsichtsbehörde kann im Übrigen auch<br />
entscheiden, wenn die Lehrerkonferenz oder ein zuständiger Ausschuss in<br />
einer wichtigen Angelegenheit nicht tätig wird oder schulaufsichtlichen<br />
Beanstandungen nicht Rechnung trägt.<br />
(6) Die Schulordnung trifft die näheren Regelungen, insbesondere über die<br />
Zuständigkeit, die Mitglieder und den Vorsitz der Teilkonferenzen und<br />
Ausschüsse sowie über den Geschäftsgang, die Sitzungsteilnahme, die<br />
Stimmberechtigung, die Beschlussfähigkeit und die Beschlussfassung in<br />
der Lehrerkonferenz, den Teilkonferenzen und den Ausschüssen.<br />
Bay EUG Art. 59 Lehrkräfte<br />
(1) 1 Die Lehrkräfte tragen die unmittelbare pädagogische Verantwortung für<br />
den Unterricht und die Erziehung der Schülerinnen und Schüler.<br />
2<br />
Gegenüber dem ihnen zugeordneten sonstigen pädagogischen Personal<br />
sind sie weisungsbefugt. 3 Art. 111 bis 117 und die dienstrechtlichen<br />
Vorschriften bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Die Lehrkräfte haben den in Art. 1 und 2 niedergelegten Bildungs- und<br />
Erziehungsauftrag sowie die Lehrpläne und Richtlinien für den Unterricht<br />
und die Erziehung zu beachten. 2 Sie müssen die verfassungsrechtlichen<br />
Grundwerte glaubhaft vermitteln. 3 Äußere Symbole und Kleidungsstücke,<br />
die eine religiöse oder weltanschauliche Überzeugung ausdrücken, dürfen
von Lehrkräften im Unterricht nicht getragen werden, sofern die Symbole<br />
oder Kleidungsstücke bei den Schülerinnen und Schülern oder den Eltern<br />
auch als Ausdruck einer Haltung verstanden werden können, die mit den<br />
verfassungsrechtlichen Grundwerten und Bildungszielen der Verfassung<br />
einschließlich den christlich-abendländischen Bildungs- und Kulturwerten<br />
nicht vereinbar ist. 4 Art. 84 Abs. 2 bleibt unberührt. 5 Für Lehrkräfte im<br />
Vorbereitungsdienst können im Einzelfall Ausnahmen von der Bestimmung<br />
des Satzes 3 zugelassen werden.<br />
(3) Die Lehrkräfte erfüllen ihre Aufgaben im vertrauensvollen<br />
Zusammenwirken mit den Schülerinnen und Schülern und den<br />
Erziehungsberechtigten, bei den beruflichen Schulen außerdem mit den<br />
Ausbildenden, den Arbeitgebern und den Arbeitnehmervertretern und<br />
Arbeitnehmervertreterinnen der von ihnen unterrichteten Schülerinnen<br />
und Schüler.<br />
Bay EUG Art. 60 Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer,<br />
Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister, Heilpädagogische<br />
Förderlehrerinnen bzw. Heilpädagogische Förderlehrer<br />
(1) 1 Die Förderlehrerin bzw. der Förderlehrer unterstützt den Unterricht und<br />
trägt durch die Arbeit mit Schülergruppen zur Sicherung des<br />
Unterrichtserfolges bei. 2 Art. 59 Abs. 2 gilt entsprechend. 3 Sie bzw. er<br />
nimmt besondere Aufgaben der Betreuung von Schülerinnen und Schülern<br />
selbständig und eigenverantwortlich wahr und wirkt bei sonstigen<br />
Schulveranstaltungen und Verwaltungstätigkeiten mit.<br />
(2) 1 Heilpädagogische Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer,<br />
Werkmeisterinnen bzw. Werkmeister und sonstiges Personal für<br />
heilpädagogische Unterrichtshilfe an Förderschulen unterstützen die<br />
Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit der Lehrkraft; im Rahmen eines mit<br />
den Sonderschullehrerinnen bzw. Sonderschullehrern gemeinsam<br />
erstellten Gesamtplans wirken sie bei Erziehung, Unterrichtung und<br />
Beratung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf mit. 2 Sie nehmen diese Aufgaben selbständig und<br />
eigenverantwortlich wahr und wirken bei sonstigen Schulveranstaltungen<br />
und bei Verwaltungstätigkeiten mit. 3 Heilpädagogische Förderlehrerinnen<br />
bzw. Förderlehrer und das sonstige Personal für heilpädagogische<br />
Unterrichtshilfe leiten die Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtungen<br />
im Einvernehmen mit der Sonderschullehrerin bzw. dem<br />
Sonderschullehrer und erfüllen in Absprache mit dem Sonderschullehrer<br />
Aufgaben der sonderpädagogischen Förderung und Beratung im Rahmen<br />
der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste und Hilfen.<br />
Bay EUG Art. 61 Angehörige kirchlicher Genossenschaften<br />
(1) 1 Kirchliche Genossenschaften, die über Lehrkräfte oder Förderlehrerinnen<br />
bzw. Förderlehrer verfügen, deren Ausbildung nicht hinter der Ausbildung<br />
der staatlichen Lehrkräfte oder Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer<br />
zurücksteht, können auf ihren Antrag von der Regierung durch<br />
Gestellungsvertrag mit der Tätigkeit an Volksschulen oder Volksschulen<br />
zur sonderpädagogischen Förderung beauftragt werden. 2 Die beauftragten
Lehrkräfte und Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer unterliegen dem<br />
fachlichen Weisungsrecht des Schulamts.<br />
(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung die Dienstbezeichnungen zu bestimmen, die den von<br />
den kirchlichen Genossenschaften zur Verfügung gestellten Lehrkräften<br />
verliehen werden können.<br />
Abschnitt IX Einrichtungen zur Mitgestaltung des schulischen<br />
Lebens<br />
a) Schülermitverantwortung<br />
Bay EUG Art. 62 Schülermitverantwortung, Schülervertretung<br />
(1) 1 Im Rahmen der Schülermitverantwortung soll allen Schülerinnen und<br />
Schülern die Möglichkeit gegeben werden, Leben und Unterricht ihrer<br />
Schule ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit entsprechend<br />
mitzugestalten; hierfür werden Schülersprecher und Schülersprecherinnen<br />
sowie deren Stellvertreter und deren Stellvertreterinnen gewählt. 2 Die<br />
Schülerinnen und Schüler werden dabei von der Schulleiterin oder vom<br />
Schulleiter, von den Lehrkräften und den Erziehungsberechtigten<br />
unterstützt. 3 Zu den Aufgaben der Schülermitverantwortung gehören<br />
insbesondere die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, die<br />
Übernahme von Ordnungsaufgaben, die Wahrnehmung schulischer<br />
Interessen der Schülerinnen und Schüler und die Mithilfe bei der Lösung<br />
von Konfliktfällen. 4 Zu den Rechten der Schülermitverantwortung gehört<br />
es,<br />
1. in allen sie betreffenden Angelegenheiten durch die Schule informiert zu<br />
werden (Informationsrecht),<br />
2. Wünsche und Anregungen der Schülerinnen und Schüler an Lehrkräfte,<br />
die Leiterin oder den Leiter der Schule und den Elternbeirat zu übermitteln<br />
(Anhörungs- und Vorschlagsrecht),<br />
3. auf Antrag der betroffenen Schülerinnen und Schüler ihre Hilfe und<br />
Vermittlung einzusetzen, wenn diese glauben, es sei ihnen Unrecht<br />
geschehen (Vermittlungsrecht),<br />
4. Beschwerden allgemeiner Art bei Lehrkräften, bei der Leiterin oder<br />
beim Leiter der Schule und im Schulforum vorzubringen<br />
(Beschwerderecht),<br />
5. bei der Aufstellung und Durchführung der Hausordnung, der<br />
Organisation und Betreuung von besonderen Veranstaltungen und im<br />
Schulforum mitzuwirken,<br />
6. zur Gestaltung von Kursen und Schulveranstaltungen und im Rahmen<br />
der Lehrpläne zum Unterricht Anregungen zu geben und Vorschläge zu<br />
unterbreiten.<br />
5<br />
Die Rechte einzelner Schülerinnen und Schüler nach Art. 56 bleiben<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Die Aufgaben der Schülermitverantwortung werden insbesondere durch<br />
folgende Einrichtungen der Schülervertretung wahrgenommen:<br />
1. Klassensprecherinnen und Klassensprecher und ihre jeweiligen<br />
Stellvertreter,
2. Klassensprecherversammlung,<br />
3. erste, zweite und dritte Schülersprecherin bzw. erster, zweiter und<br />
dritter Schülersprecher,<br />
4. Schülerausschuss,<br />
5. Stadt- und Landkreisschülersprecherinnen und Stadt- und<br />
Landkreisschülersprecher im Bereich der Hauptschulen,<br />
6. Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher,<br />
7. Landesschülerkonferenz.<br />
2<br />
Soweit die Schülerinnen und Schüler nicht in Klassen zusammengefasst<br />
sind, tritt an die Stelle der Klassensprecherin bzw. des Klassensprechers<br />
die Jahrgangsstufensprecherin bzw. der Jahrgangsstufensprecher; neben<br />
den Jahrgangsstufensprecherinnen und Jahrgangsstufensprechern können<br />
Kurssprecherinnen und Kurssprecher vorgesehen werden.<br />
(3) 1 Ab Jahrgangsstufe 5 wählt jede Klasse aus ihrer Mitte eine<br />
Klassensprecherin oder einen Klassensprecher und ihren bzw. seinen<br />
Stellvertreter. 2 Der Klassensprecherin bzw. dem Klassensprecher obliegen<br />
die Aufgaben der Schülermitverantwortung als Schülervertretung für die<br />
Klasse.<br />
(4) 1 Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher, ihre jeweiligen<br />
Stellvertreter sowie die Schülersprecherinnen und Schülersprecher bilden<br />
die Klassensprecherversammlung. 2 Die Klassensprecherversammlung<br />
behandelt Fragen, die über den Kreis einer Klasse hinaus für die gesamte<br />
Schülerschaft von Interesse sind.<br />
(5) 1 Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher und ihre jeweiligen<br />
Stellvertreter wählen die drei Schülersprecherinnen und Schülersprecher;<br />
die Schulordnungen können das Schulforum dazu ermächtigen, durch<br />
Beschluss das Wahlrecht auf alle Schülerinnen und Schüler auszudehnen.<br />
2<br />
Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher bilden den<br />
Schülerausschuss. 3 Der Schülerausschuss ist ausführendes Organ der<br />
Klassensprecherversammlung; er kann im Rahmen der Aufgaben der<br />
Schülermitverantwortung und der Beschlüsse der<br />
Klassensprecherversammlung der Schulleiterin oder dem Schulleiter, der<br />
Lehrerkonferenz, dem Elternbeirat, dem Schulforum und einzelnen<br />
Lehrkräften Wünsche und Anregungen vortragen. 4 Die Schulleiterin oder<br />
der Schulleiter unterrichtet den Schülerausschuss über Angelegenheiten,<br />
die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, sowie über Rechtsund<br />
Verwaltungsvorschriften und Beschlüsse der Lehrerkonferenz, soweit<br />
sie allgemeine Schülerangelegenheiten betreffen.<br />
(6) 1 Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher, im Bereich der<br />
Hauptschule die Stadt- und Landkreisschülersprecherinnen und Stadt- und<br />
Landkreisschülersprecher wählen aus ihrer Mitte für die jeweiligen<br />
Regierungsbezirke bzw. Dienstbereiche der Ministerialbeauftragten die<br />
Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher und deren<br />
Stellvertreterinnen und Stellvertreter. 2 Die Anzahl der gewählten<br />
Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher beträgt<br />
1. für die Hauptschulen sieben,<br />
2. für die Realschulen acht,<br />
3. für die Gymnasien acht,<br />
4. für die Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen,
Fachschulen und Fachakademien insgesamt sieben,<br />
5. für die Fachoberschulen und Berufsoberschulen insgesamt drei und<br />
6. für die Förderschulen sieben.<br />
3 Zu den Aufgaben der Bezirksschülersprecherinnen und<br />
Bezirksschülersprecher gehört insbesondere der Erfahrungsaustausch<br />
bezüglich der die jeweilige Schulart betreffenden Angelegenheiten. 4 Die<br />
insgesamt 40 Bezirksschülersprecherinnen und Bezirksschülersprecher<br />
bilden die Landesschülerkonferenz (Art. 62 a).<br />
(7) 1 Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher und ihre jeweiligen<br />
Stellvertreter können für jeweils ein Schuljahr eine Verbindungslehrkraft<br />
wählen; wählbar sind Lehrkräfte, die an der Schule mit mindestens der<br />
Hälfte der Unterrichtspflichtzeit unbefristet beschäftigt sind, sowie<br />
Förderlehrerinnen bzw. Förderlehrer unter entsprechenden<br />
Voraussetzungen. 2 Das Schulforum kann beschließen, dass die Wahl<br />
durch alle Schülerinnen und Schüler erfolgt. 3 Die Verbindungslehrkräfte<br />
pflegen die Verbindung zwischen Schulleiterinnen bzw. Schulleiter und<br />
Lehrkräften einerseits und den Schülerinnen und Schülern andererseits.<br />
4<br />
Sie beraten die Einrichtungen der Schülermitverantwortung und<br />
vermitteln bei Beschwerden.<br />
(8) Auf Antrag gibt die Schulleiterin oder der Schulleiter den Mitgliedern der<br />
Klassensprecherversammlung oder des Schülerausschusses an<br />
Vollzeitschulen in der Regel einmal im Monat Gelegenheit, auch während<br />
der Unterrichtszeit zu einer Besprechung zusammenzukommen.<br />
(9) 1 Das Nähere regelt die Schulordnung. 2 Für berufliche Schulen können die<br />
Einrichtungen und die Wahl der Schulervertretung in der Schulordnung<br />
abweichend von den Absätzen 2 bis 5 geregelt werden.<br />
(10) Die notwendigen Kosten der Wahrnehmung der Aufgaben der<br />
Schülermitverantwortung auf der Stadt-, Landkreis-, Bezirks- und<br />
Landesebene trägt der Freistaat Bayern im Rahmen der zur Verfügung<br />
stehenden Haushaltsmittel.<br />
Bay EUG Art. 62 a Landesschülerkonferenz, Landesschülerrat<br />
(1) 1 Die Landesschülerkonferenz dient insbesondere der Erörterung<br />
allgemeiner schulischer Angelegenheiten. 2 Sie tagt wenigstens zweimal im<br />
Jahr. 3 Art und Umfang der Aufsicht über die teilnehmenden Schülerinnen<br />
und Schüler richtet sich nach deren Alter und Reife. 4 Die<br />
Landesschülerkonferenz ist berechtigt, sich eine Geschäftsordnung zu<br />
geben.<br />
(2) 1 Aus der Mitte der Landesschülerkonferenz werden insgesamt sechs<br />
Landesschülersprecherinnen und Landesschülersprecher für ein Jahr<br />
gewählt. 2 Dabei werden für die Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien<br />
und Förderschulen jeweils eine Landesschülersprecherin oder ein<br />
Landesschülersprecher gewählt; für die Gruppe der Berufsschulen,<br />
Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Fachschulen und Fachakademien<br />
sowie für die Gruppe der Fachoberschulen und Berufsoberschulen wird je<br />
eine Landesschülersprecherin oder ein Landesschülersprecher gewählt.<br />
3<br />
Diese bilden den Vorstand der Landesschülerkonferenz<br />
(Landesschülerrat). 4 Gleichzeitig werden entsprechend die<br />
Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Landesschülersprecherinnen und
Landesschülersprecher gewählt. 5 Aus deren Mitte werden zwei<br />
Schülerinnen oder Schüler zum Zweck der Mitgliedschaft im<br />
Landesschulbeirat gewählt.<br />
(3) 1 Zu den Rechten des Landesschülerrats gehört es,<br />
1. in Bezug auf grundlegende, die Schülerinnen und Schüler betreffende<br />
schulische Angelegenheiten durch das Staatsministerium für Unterricht<br />
und Kultus informiert und angehört zu werden (Informations- und<br />
Anhörungsrecht) und<br />
2. Anregungen und Vorschläge der Schülerinnen und Schüler an das<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu richten (Vorschlagsrecht).<br />
2<br />
Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.<br />
(4) Zur Beratung der Schülerinnen und Schüler bei ihrer Tätigkeit in der<br />
Landesschülerkonferenz und zur Unterstützung der Kommunikation<br />
zwischen ihnen und den Schulaufsichtsbehörden wird eine Lehrkraft als<br />
Koordinatorin oder Koordinator bestellt.<br />
Bay EUG Art. 63 Schülerzeitung<br />
(1) 1 Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von Schülerinnen und Schülern für<br />
Schülerinnen und Schüler derselben Schule geschrieben werden. 2 Die<br />
Schülerinnen und Schüler machen durch die Herausgabe von<br />
Schülerzeitungen vom Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch.<br />
3<br />
Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, an der Schülerzeitung<br />
mitzuwirken. 4 Die Redaktion der Schülerzeitung hat das Wahlrecht, ob die<br />
Schülerzeitung als Einrichtung der Schule im Rahmen der<br />
Schülermitverantwortung oder als Druckwerk im Sinn des Bayerischen<br />
Pressegesetzes (BayPrG) erscheint. 5 Die Redaktion soll sich eine<br />
beratende Lehrkraft wählen, die die Schülerzeitung pädagogisch betreut.<br />
(2) 1 Erscheint die Schülerzeitung als Druckwerk im Sinn des Bayerischen<br />
Pressegesetzes, soll die Schulleiterin oder der Schulleiter die Herausgeber<br />
und Redakteure über die presserechtlichen Folgen (Art. 3 Abs. 2, Art. 5, 7<br />
bis 10 und 11 BayPrG) informieren. 2 Die Haftung der<br />
Erziehungsberechtigten für minderjährige Schülerinnen und Schüler bleibt<br />
unberührt. 3 Die Schule unterrichtet die Erziehungsberechtigten der<br />
mitwirkenden minderjährigen Schülerinnen und Schüler über die<br />
Entscheidung der Schülerzeitungsredaktion, die Schülerzeitung als<br />
Druckwerk im Sinn des Bayerischen Pressegesetzes herauszugeben.<br />
(3) Die Grundsätze einer fairen Berichterstattung sind zu beachten; auf die<br />
Vielfalt der Meinungen und auf den Bildungs- und Erziehungsauftrag der<br />
Schule ist Rücksicht zu nehmen.<br />
(4) 1 Soll die Schülerzeitung auf dem Schulgelände verteilt werden, ist der<br />
Schulleiterin oder dem Schulleiter rechtzeitig vor Drucklegung ein<br />
Exemplar zur Kenntnis zu geben. 2 Sie oder er kann Einwendungen<br />
erheben. 3 Berücksichtigt die Redaktion die Einwendungen nicht, so hat sie<br />
die Schülerzeitung zusammen mit einer Stellungnahme dem Schulforum<br />
vorzulegen. 4 Das Schulforum soll auf eine gütliche Einigung hinwirken;<br />
scheitert die gütliche Einigung, kann das Schulforum die Verteilung der<br />
Schülerzeitung auf dem Schulgelände untersagen.
(5) Soweit der Inhalt der Schülerzeitung das Recht der persönlichen Ehre<br />
verletzt oder in anderer Weise gegen Rechtsvorschriften verstößt, kann<br />
die Schulleiterin oder der Schulleiter die Verteilung auf dem Schulgelände,<br />
und für den Fall, dass die Schülerzeitung als Einrichtung der Schule im<br />
Rahmen der Schülermitverantwortung erscheint, auch die Herausgabe<br />
untersagen; die Schulleiterin oder der Schulleiter begründet die<br />
Entscheidung innerhalb einer Woche schriftlich.<br />
(6) weggefallen<br />
b) Elternvertretung<br />
Bay EUG Art. 64 Einrichtungen<br />
(1) An allen Volksschulen, Realschulen, Gymnasien, Fachoberschulen und an<br />
Berufsfachschulen, an denen die Schulpflicht erfüllt werden kann, sowie an<br />
entsprechenden Schulen zur sonderpädagogischen Förderung wird ein<br />
Elternbeirat gebildet.<br />
(2) 1 An allen Volksschulen wird außerdem eine für die Eltern der Klasse<br />
sprechende Person (Klassenelternsprecher) gewählt; für Gymnasien,<br />
Realschulen und Wirtschaftsschulen können auf Antrag des Elternbeirats<br />
Klassenelternsprecher für alle oder einzelne Jahrgangsstufen der Schule<br />
als Helfer des Elternbeirats gewählt werden. 2 Bestehen innerhalb einer<br />
Gemeinde oder eines Schulverbands mehrere Volksschulen oder<br />
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung, so wird für diese<br />
zusätzlich ein gemeinsamer Elternbeirat gebildet. 3 Satz 2 gilt für<br />
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung entsprechend, soweit<br />
ein Landkreis oder Bezirk den Sachbedarf mehrerer Volksschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung trägt.<br />
(3) An den in Absatz 1 genannten Schulen wird für jede Klasse mindestens<br />
einmal im Schuljahr eine Klassenelternversammlung abgehalten.<br />
Bay EUG Art. 65 Bedeutung und Aufgaben<br />
(1) 1 Der Elternbeirat ist die Vertretung der Erziehungsberechtigten der<br />
Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern volljähriger Schülerinnen und<br />
Schüler einer Schule; Art. 74 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung. 2 Er wirkt<br />
mit in Angelegenheiten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung<br />
sind. 3 Aufgabe des Elternbeirats ist es insbesondere,<br />
1. das Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und den Lehrkräften, die<br />
gemeinsam für die Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler<br />
verantwortlich sind, zu vertiefen,<br />
2. das Interesse der Eltern für die Bildung und Erziehung der Schülerinnen<br />
und Schüler zu wahren,<br />
3. den Eltern aller Schülerinnen und Schüler oder der Schülerinnen und<br />
Schüler einzelner Klassen in besonderen Veranstaltungen Gelegenheit zur<br />
Unterrichtung und zur Aussprache zu geben,<br />
4. Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten,<br />
5. durch gewählte Vertreter an den Beratungen des Schulforums<br />
teilzunehmen (Art. 69 Abs. 2),<br />
6. bei der Entscheidung über einen unterrichtsfreien Tag nach Art. 89<br />
Abs. 2 Nr. 4 das Einvernehmen herzustellen,
7. sich im Rahmen der Abstimmung nach Art. 51 Abs. 4 Satz 2 zu äußern,<br />
8. im Verfahren, das zur Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers<br />
führen kann, die in Art. 87 Abs. 1 genannten Rechte wahrzunehmen,<br />
9. im Verfahren, das zum Ausschluss einer Schülerin oder eines Schülers<br />
von allen Schulen einer oder mehrerer Schularten führen kann, die in<br />
Art. 88 Abs. 1 genannten Rechte wahrzunehmen,<br />
10. bei Errichtung und Auflösung von staatlichen und kommunalen<br />
Schulen unter den in Art. 26 Abs. 2, Art. 27 Abs. 2 Satz 2 genannten<br />
Voraussetzungen mitzuwirken,<br />
11. bei Abweichungen von den Sprengelgrenzen unter den in Art. 42<br />
Abs. 2 und 7 genannten Voraussetzungen mitzuwirken,<br />
12. bei der Bestimmung eines Namens für die Schule nach Art. 29 Satz 3<br />
mitzuwirken,<br />
13. das Einvernehmen bei der Änderung von Ausbildungsrichtungen, bei<br />
der Einführung von Schulversuchen und bei der Stellung eines Antrags auf<br />
Zuerkennung des Status einer MODUS-Schule herzustellen.<br />
4<br />
Der Elternbeirat wirkt außerdem mit, soweit dies in der Schulordnung<br />
vorgesehen ist.<br />
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 nimmt der Klassenelternsprecher die Belange<br />
der Eltern der Schülerinnen oder Schüler einer Klasse, der gemeinsame<br />
Elternbeirat die Belange der Eltern der Schüler mehrerer Volksschulen<br />
oder Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung wahr.<br />
Bay EUG Art. 66 Zusammensetzung des Elternbeirats<br />
(1) 1 Für je 50 Schülerinnen und Schüler einer Schule, bei Förderschulen für je<br />
15 Schülerinnen und Schüler, ist ein Mitglied des Elternbeirats zu wählen;<br />
der Elternbeirat hat jedoch mindestens fünf und höchstens zwölf<br />
Mitglieder. 2 Der Elternbeirat kann durch Beschluss weitere Mitglieder, die<br />
die Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen, mit beratender Funktion<br />
hinzuziehen; die Anzahl der hinzugezogenen Mitglieder darf nicht mehr als<br />
ein Drittel der gewählten Mitglieder betragen. 3 Der Elternbeirat ist<br />
berechtigt, sich eine Geschäftsordnung zu geben.<br />
(2) 1 Der Elternbeirat an Volksschulen mit nicht mehr als neun Klassen besteht<br />
aus den Klassenelternsprechern. 2 An den übrigen Volksschulen wählen die<br />
Klassenelternsprecher aus ihrer Mitte den aus neun Mitgliedern<br />
bestehenden Elternbeirat. 3 Der Elternbeirat kann durch Beschluss weitere<br />
Mitglieder, die die Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen, mit beratender<br />
Funktion hinzuziehen; die Anzahl der hinzugezogenen Mitglieder darf nicht<br />
mehr als ein Drittel der gewählten Mitglieder betragen. 4 Der Elternbeirat<br />
ist berechtigt, sich eine Geschäftsordnung zu geben.<br />
(3) 1 Wird eine Schule im Zeitpunkt der Wahl des Elternbeirats von<br />
mindestens 50 Schülerinnen und Schülern, bei Volksschulen und<br />
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung von mindestens 15<br />
Schülerinnen und Schülern besucht, die in einem Schülerheim oder einer<br />
ähnlichen Einrichtung untergebracht sind, so ist auch die Leiterin bzw. der<br />
Leiter dieser Einrichtung Mitglied des Elternbeirats, sofern sie bzw. er<br />
nicht zugleich Schulleiterin bzw. Schulleiter, Lehrkraft oder Förderlehrerin<br />
bzw. Förderlehrer der betreffenden Schule ist. 2 Das gleiche gilt, wenn die<br />
Zahl dieser Schülerinnen und Schüler ein Fünftel der Gesamtschülerzahl
erreicht. 3 Ist die Zahl geringer, so können die Leiterinnen bzw. Leiter<br />
dieser Einrichtungen wie Erziehungsberechtigte für den Elternbeirat<br />
wählen und gewählt werden.<br />
(4) 1 Der gemeinsame Elternbeirat besteht bei nicht mehr als vier<br />
Volksschulen innerhalb einer Gemeinde oder eines Schulverbands aus den<br />
Vorsitzenden der Elternbeiräte und ihren Stellvertretern; bei mehr als vier<br />
Volksschulen wählen die Vorsitzenden aus den Mitgliedern der<br />
Elternbeiräte den aus neun Mitgliedern bestehenden gemeinsamen<br />
Elternbeirat. 2 Satz 1 gilt für Volksschulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung entsprechend.<br />
Bay EUG Art. 67 Unterrichtung des Elternbeirats<br />
(1) 1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Elternbeirat zum<br />
frühestmöglichen Zeitpunkt über alle Angelegenheiten, die für die Schule<br />
von allgemeiner Bedeutung sind. 2 Sie oder er erteilt die für die Arbeit des<br />
Elternbeirats notwendigen Auskünfte. 3 Auf Wunsch des Elternbeirats soll<br />
die Schulleiterin oder der Schulleiter einer Lehrkraft Gelegenheit geben,<br />
den Elternbeirat zu informieren.<br />
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Schulaufsichtsbehörde und der<br />
Aufwandsträger prüfen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Anregungen<br />
und Vorschläge des Elternbeirats binnen angemessener Frist und teilen<br />
diesem das Ergebnis mit, wobei im Fall der Ablehnung das Ergebnis – auf<br />
Antrag schriftlich – zu begründen ist.<br />
Bay EUG Art. 68 Durchführungsvorschriften<br />
1 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, nach<br />
Anhörung des Landesschulbeirats durch Rechtsverordnung insbesondere<br />
Amtszeit, Mitgliedschaft, Wahlverfahren, Geschäftsgang, Beschlussfähigkeit<br />
und Beschlussfassung der Einrichtungen der Elternvertretung zu regeln; der<br />
Elternvertretung kann das Recht eingeräumt werden, sich eine Wahlordnung<br />
zu geben. 2 In der Rechtsverordnung können auch andere Personen, die<br />
Schülerinnen und Schüler tatsächlich erziehen, mit Zustimmung der<br />
Personensorgeberechtigten den Erziehungsberechtigten gleichgestellt werden.<br />
c) Schulforum<br />
Bay EUG Art. 69<br />
(1) 1 An allen Schulen, an denen ein Elternbeirat besteht, wird ein Schulforum<br />
eingerichtet. 2 Dies gilt nicht für Grundschulen. 3 Bei den Berufsschulen<br />
nimmt der Berufsschulbeirat die Aufgaben des Schulforums mit Ausnahme<br />
der in Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 genannten Aufgabe wahr.<br />
(2) 1 Mitglieder des Schulforums sind die Schulleiterin oder der Schulleiter<br />
sowie zwei von der Lehrerkonferenz gewählte Lehrkräfte, der<br />
Elternbeiratsvorsitzende sowie zwei vom Elternbeirat gewählte<br />
Elternbeiratsmitglieder und der Schülerausschuss. 2 Den Vorsitz im<br />
Schulforum führt die Schulleiterin oder der Schulleiter. 3 Der<br />
Aufwandsträger ist rechtzeitig über die ihn berührenden Angelegenheiten<br />
zu informieren; er kann verlangen, an der Beratung teilzunehmen.
(3) 1 Das Schulforum beschließt in den Angelegenheiten, die ihm zur<br />
Entscheidung zugewiesen sind, mit bindender Wirkung für die Schule. 2 In<br />
den übrigen Angelegenheiten gefasste Beschlüsse bedeuten<br />
Empfehlungen.<br />
(4) 1 Das Schulforum berät Fragen, die Schülerinnen und Schüler, Eltern und<br />
Lehrkräfte gemeinsam betreffen, und gibt Empfehlungen ab. 2 Folgende<br />
Entscheidungen werden im Einvernehmen mit dem Schulforum getroffen:<br />
1. die Entwicklung eines eigenen Schulprofils, das der Genehmigung der<br />
Schulaufsichtsbehörde bedarf,<br />
2. die Stellung eines Antrags auf Zuerkennung des Status einer MODUS-<br />
Schule,<br />
3. Erlass von Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren<br />
Schulbetriebs (Hausordnung),<br />
4. Festlegung der Pausenordnung und Pausenverpflegung,<br />
5. Grundsätze über die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des<br />
Schullebens.<br />
3<br />
Kann eine einvernehmliche Entscheidung nicht in angemessener Zeit<br />
herbeigeführt werden, legt die Schulleiterin oder der Schulleiter die<br />
Angelegenheit der Schulaufsichtsbehörde vor, die eine Entscheidung trifft.<br />
4<br />
Bei der Festlegung eines jährlichen Höchstbetrags für schulische<br />
Veranstaltungen ist eine Abstimmung mit dem Elternbeirat erforderlich.<br />
5<br />
Dem Schulforum ist insbesondere Gelegenheit zu einer vorherigen<br />
Stellungnahme zu geben zu<br />
1. wesentlichen Fragen der Schulorganisation, soweit nicht eine<br />
Mitwirkung der Erziehungsberechtigten oder des Elternbeirats<br />
vorgeschrieben ist,<br />
2. Fragen der Schulwegsicherung und der Unfallverhütung in Schulen,<br />
3. Baumaßnahmen im Bereich der Schule,<br />
4. Grundsätzen der Schulsozialarbeit,<br />
5. der Namensgebung einer Schule.<br />
6<br />
Im Fall des Art. 63 Abs. 4 Satz 3 ist das Schulforum unverzüglich<br />
einzuberufen. 7 Das Schulforum kann ferner auf Antrag eines Betroffenen<br />
in Konfliktfällen vermitteln; Ordnungsmaßnahmen, bei denen die<br />
Mitwirkung des Elternbeirats vorgesehen ist, werden im Schulforum nicht<br />
behandelt.<br />
(5) Wird einem Beschluss des Schulforums von der für die Entscheidung<br />
zuständigen Stelle nicht entsprochen, so ist dies gegenüber dem<br />
Schulforum – auf dessen Antrag schriftlich – zu begründen.<br />
(6) Das Schulforum wird von der Schulleiterin oder vom Schulleiter<br />
mindestens zweimal in jedem Schulhalbjahr einberufen.<br />
(7) Die Schulordnung trifft die näheren Regelungen, insbesondere über<br />
Geschäftsgang, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung.<br />
d) Berufsschulbeirat<br />
Bay EUG Art. 70 Berufsschulbeirat<br />
(1) An jeder Berufsschule wird ein Berufsschulbeirat gebildet.<br />
(2) Unterhält ein kommunaler Schulträger mehrere Berufsschulen, so ist<br />
außerdem ein gemeinsamer Berufsschulbeirat für alle Schulen zu bilden.
Bay EUG Art. 71 Aufgaben<br />
(1) 1 Der Berufsschulbeirat hat die Aufgabe, die Beziehungen zwischen Schule,<br />
Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten, Ausbildungsbetrieb,<br />
Arbeitswelt und Wirtschaft zu fördern. 2 Der Berufsschulbeirat wirkt<br />
außerdem mit, soweit dies in der Schulordnung vorgesehen ist.<br />
(2) Der gemeinsame Berufsschulbeirat wirkt bei den Angelegenheiten mit, die<br />
alle oder mehrere Berufsschulen des Schulträgers betreffen.<br />
Bay EUG Art. 72 Durchführungsvorschriften<br />
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung insbesondere Zusammensetzung, Amtszeit, Mitgliedschaft,<br />
Auswahlverfahren, Geschäftsgang, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung zu<br />
regeln.<br />
e) Landesschulbeirat<br />
Bay EUG Art. 73<br />
(1) Zur Beratung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auf dem<br />
Gebiet der Bildung und Erziehung wird ein Landesschulbeirat eingerichtet.<br />
(2) 1 Der Landesschulbeirat wird zu wichtigen Vorhaben auf dem Gebiet der<br />
Bildung und Erziehung durch das Staatsministerium für Unterricht und<br />
Kultus angehört. 2 Der Beratung im Landesschulbeirat bedürfen vor allem:<br />
1. grundlegende Maßnahmen im Bereich der Lehrpläne, Stundentafeln und<br />
Richtlinien (Art. 45 Abs. 2 Satz 1) einschließlich der Richtlinien für<br />
Familien- und Sexualerziehung (Art. 48 Abs. 4),<br />
2. der Erlass oder grundlegende Änderungen von<br />
a) Schulordnungen für die in Art. 7 bis 11, 14, 16 und 17 genannten<br />
Schularten (Art. 89 Abs. 1 Satz 1),<br />
b) Rechtsverordnungen über das Verfahren bei<br />
Zulassungsbeschränkungen (Art. 44 Abs. 4 Satz 2),<br />
c) Regelungen über Vorbereitung und Verbreitung von Schülerzeitungen<br />
(Art. 63 Abs. 6),<br />
d) Rechtsverordnungen über die Einrichtungen der Elternvertretungen<br />
(Art. 68),<br />
3. Entwürfe von <strong>Gesetze</strong>n und sonstigen Verordnungen, soweit sie<br />
grundsätzliche schulische Fragen betreffen,<br />
4. wichtige Schulversuche und deren Ergebnisse.<br />
3<br />
Der Landesschulbeirat kann dazu Vorschläge einbringen und<br />
Empfehlungen aussprechen. 4 Den Vorsitz bei den Beratungen führt das<br />
den Geschäftsbereich Unterricht und Kultus leitende Mitglied der<br />
Staatsregierung oder seine Vertretung.<br />
(3) 1 Die Mitglieder des Landesschulbeirats werden vom Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus berufen, und zwar<br />
1. bis zu acht Mitglieder aus dem Kreis der Eltern,<br />
2. acht Mitglieder aus dem Kreis der Lehrkräfte,<br />
3. die sechs Landesschülersprecherinnen und Landesschülersprecher und<br />
die gemäß Art. 62 a Abs. 2 Satz 5 gewählten Schülerinnen und Schüler,<br />
4. je ein Mitglied auf Vorschlag<br />
a) der Katholischen Kirche,
) der Evangelisch-Lutherischen Kirche,<br />
c) des Bayerischen Städtetags,<br />
d) des Bayerischen Gemeindetags,<br />
e) des Bayerischen Landkreistags,<br />
f) des Verbands der Bayerischen Bezirke,<br />
g) der Industrie- und Handelskammern,<br />
h) der Handwerkskammern,<br />
i) des Deutschen Gewerkschaftsbunds und des Bayerischen<br />
Beamtenbunds,<br />
j) nicht besetzt<br />
k) des Bayerischen Bauernverbands,<br />
l) des Bayerischen Jugendrings,<br />
m) der Hochschulen,<br />
n) der privaten Schulen,<br />
5. fünf Mitglieder, die unter dem Gesichtspunkt der notwendigen<br />
Ergänzung des Beirats aus den Bereichen Frühpädagogik, Berufliche<br />
Bildung, Erwachsenenbildung, Kunst und Journalistik berufen werden.<br />
2<br />
Die in Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Vertreter werden auf Vorschlag der<br />
auf Landesebene bestehenden Verbände berufen; die verschiedenen<br />
Schularten sind zu berücksichtigen. 3 Das Staatsministerium für Unterricht<br />
und Kultus kann von sich aus oder auf Vorschlag des Landesschulbeirats<br />
weitere Sachverständige zu den Beratungen zuziehen.<br />
(4) 1 Die Mitglieder nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 können im Rahmen des<br />
Landesschulbeirats einen Landeselternrat bilden. 2 Dieser kann Vorschläge<br />
und Empfehlungen unmittelbar an das Staatsministerium für Unterricht<br />
und Kultus richten.<br />
(5) 1 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus regelt das Verfahren bei<br />
der Berufung und die Amtszeit der Mitglieder sowie die Geschäftsführung<br />
durch Rechtsverordnung. 2 Der Landesschulbeirat gibt sich eine<br />
Geschäftsordnung; er kann Fachausschüsse einsetzen.<br />
Abschnitt X Schule und Erziehungsberechtigte, Schule und<br />
Arbeitgeber<br />
Bay EUG Art. 74 Zusammenarbeit der Schule mit den<br />
Erziehungsberechtigten<br />
(1) Die gemeinsame Erziehungsaufgabe, die Schule und<br />
Erziehungsberechtigte zu erfüllen haben, erfordert eine von gegenseitigem<br />
Vertrauen getragene Zusammenarbeit.<br />
(2) 1 Erziehungsberechtigter im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist, wem nach dem<br />
bürgerlichen Recht die Sorge für die Person der minderjährigen Schülerin<br />
oder des minderjährigen Schülers obliegt. 2 Pflegepersonen und<br />
Heimerzieher, die nach den Bestimmungen des Achten Buchs<br />
Sozialgesetzbuch zur Vertretung in der Ausübung der elterlichen Sorge<br />
berechtigt sind, stehen im Rahmen ihrer Vertretungsmacht den<br />
Erziehungsberechtigten gleich.
Bay EUG Art. 75 Pflichten der Schule<br />
(1) 1 Die Schule ist verpflichtet, die Erziehungsberechtigten möglichst<br />
frühzeitig über ein auffallendes Absinken des Leistungsstands und sonstige<br />
wesentliche, die Schülerin oder den Schüler betreffende Vorgänge<br />
schriftlich, aber nicht in elektronischer Form zu unterrichten. 2 Art. 88 a<br />
gilt entsprechend. 3 Ist eine Benachrichtigung unterblieben, so kann<br />
daraus ein Recht auf Vorrücken nicht hergeleitet werden.<br />
(2) Steht am Ende eines Schuljahres fest, dass eine Schülerin oder ein<br />
Schüler in die nächsthöhere Jahrgangsstufe nicht vorrücken darf oder die<br />
Abschlussprüfung nicht bestanden hat, so ist die Schule verpflichtet, den<br />
Erziehungsberechtigten über den weiteren Bildungsweg der Schülerin oder<br />
des Schülers eine Beratung anzubieten.<br />
Bay EUG Art. 76 Pflichten der Erziehungsberechtigten<br />
1 Die Erziehungsberechtigten müssen dafür sorgen, dass minderjährige<br />
Schulpflichtige am Unterricht regelmäßig teilnehmen und die sonstigen<br />
verbindlichen Schulveranstaltungen besuchen. 2 Die Erziehungsberechtigten<br />
sind ferner verpflichtet, um die gewissenhafte Erfüllung der schulischen<br />
Pflichten und der von der Schule gestellten Anforderungen durch die<br />
Schülerinnen und Schüler besorgt zu sein und die Erziehungsarbeit der Schule<br />
zu unterstützen.<br />
Bay EUG Art. 77 Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber<br />
Ausbildende, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Berufsschulpflichtige<br />
beschäftigen, haben ebenso wie die von ihnen Beauftragten die<br />
Berufsschulpflichtigen zur Teilnahme am Unterricht und zum Besuch der<br />
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen anzuhalten.<br />
Abschnitt XI Besondere Einrichtungen und Schulgesundheit<br />
Bay EUG Art. 78 Schulberatung<br />
(1) 1 Jede Schule und jede Lehrkraft hat die Aufgabe, die<br />
Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler in Fragen der<br />
Schullaufbahn zu beraten und ihnen bei der Wahl der<br />
Bildungsmöglichkeiten entsprechend den Anlagen und Fähigkeiten des<br />
Einzelnen zu helfen. 2 Zur Unterstützung der Schulen bei der<br />
Schulberatung werden Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen und<br />
Schulpsychologinnen bestellt.<br />
(2) Die Aufgaben, die über den Bereich einer Schule hinausgehen, werden von<br />
staatlichen Schulberatungsstellen wahrgenommen.<br />
(3) Das zuständige Staatsministerium erlässt Richtlinien für die Schulberatung<br />
und regelt deren Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und anderen<br />
Beratungsdiensten.<br />
Bay EUG Art. 79 Bildstellenwesen<br />
Die von den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden errichteten und<br />
unterhaltenen Kreis- und Stadtbildstellen (kommunale Medienzentren)
versorgen die Schulen und die Träger außerschulischer Bildungs- und<br />
Erziehungsarbeit mit Medien und erfüllen die damit zusammenhängenden<br />
pädagogischen Aufgaben.<br />
Bay EUG Art. 80 Schulgesundheit<br />
1 Kinder haben im Jahr vor der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1 an einer<br />
Schuleingangsuntersuchung teilzunehmen. 2 Schülerinnen und Schüler sind<br />
verpflichtet, sich den Untersuchungen im Rahmen der Schulgesundheitspflege<br />
nach Art. 14 Abs. 5 Sätze 1 und 2 des Gesundheitsdienst- und<br />
Verbraucherschutzgesetzes und sonstigen Untersuchungen, die in gesetzlichen<br />
Vorschriften vorgesehen sind, durch den öffentlichen Gesundheitsdienst zu<br />
unterziehen. 3 Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2<br />
Satz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.<br />
Abschnitt XII Schulversuche, MODUS-Schulen<br />
Bay EUG Art. 81 Zweck<br />
1 Schulversuche und MODUS-Schulen dienen der Weiterentwicklung des<br />
Schulwesens. 2 Sie haben den Zweck, neue Organisationsformen für Unterricht<br />
und Erziehung einschließlich neuer Schularten und wesentliche inhaltliche<br />
Änderungen zu erproben.<br />
Bay EUG Art. 82 Zulässigkeit<br />
(1) 1 Schulversuche sind zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die<br />
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Schulversuchs die gleichen oder<br />
gleichwertigen Abschlüsse oder Berechtigungen erwerben können wie an<br />
Schulen außerhalb des Schulversuchs. 2 Ferner müssen Schulversuche so<br />
gestaltet sein, dass während des Schulversuchs der Übertritt an Schulen<br />
außerhalb des Schulversuchs möglich bleibt.<br />
(2) Die von der Durchführung eines Schulversuchs betroffenen Schülerinnen<br />
und Schüler haben keinen Anspruch darauf, dass die vor dem<br />
Schulversuch in der Schule bestehenden Organisationsformen für<br />
Unterricht und Erziehung fortgeführt werden.<br />
(3) In Abweichung von Absatz 1 ist ein Schulversuch zulässig, soweit hierzu<br />
das Einverständnis der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen<br />
Schülerinnen und Schüler vorliegt und den Schülerinnen und Schülern, die<br />
am Schulversuch nicht teilnehmen, am Wohnort oder in zumutbarer<br />
Entfernung hiervon der Besuch einer Schule der Art möglich ist, wie sie<br />
vor Einführung des Schulversuchs bestanden hat.<br />
(4) Schulversuche bedürfen der vorherigen Zustimmung des zuständigen<br />
Staatsministeriums.<br />
(5) 1 Zur Verbesserung der Qualität von Unterricht und Erziehung kann das<br />
zuständige Staatsministerium im Rahmen der verfügbaren Stellen und<br />
Mittel einer bestehenden Schule auf schriftlichen Antrag für einen<br />
Zeitraum von fünf Jahren den Status einer MODUS-Schule zuerkennen;<br />
auf Antrag kann die Verlängerung des Status um jeweils weitere fünf<br />
Jahre gewährt werden. 2 Der Status berechtigt die Schule,<br />
Weiterentwicklungsmaßnahmen, insbesondere in den Arbeitsfeldern
Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Personalführung sowie<br />
inner- und außerschulische Partnerschaften, zu erproben. 3 Den MODUS-<br />
Schulen ist es gestattet, von den Schulordnungen abzuweichen, soweit<br />
sichergestellt ist, dass die Lehrplanziele erreicht und die Maßgaben des<br />
Abs. 1 eingehalten werden. 4 Voraussetzung für die erstmalige<br />
Zuerkennung und Verlängerung des Status ist, dass im Rahmen einer<br />
externen Evaluation die Eignung der Schule hierfür festgestellt wird.<br />
5<br />
Art. 113 a gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass personenbezogene<br />
Daten, die im Rahmen der Eignungsprüfung erhoben werden, nur mit<br />
Zustimmung der betroffenen Personen an die Schulaufsichtsbehörden<br />
übermittelt werden. 6 Dem zuständigen Staatsministerium ist jede<br />
Weiterentwicklungsmaßnahme spätestens am 1. Juni vor Beginn des<br />
Schuljahres, in dem die Maßnahme begonnen werden soll, anzuzeigen.<br />
7 8<br />
Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Die Ausübung der<br />
Schulaufsicht bleibt unberührt.<br />
Bay EUG Art. 83 Organisation<br />
(1) 1 Die Einführung eines Schulversuchs an staatlichen Schulen sowie die<br />
Antragstellung auf Zuerkennung des Status einer MODUS-Schule erfolgen<br />
im Benehmen mit dem Aufwandsträger, soweit dieses nicht bereits nach<br />
Art. 26 Abs. 2 herzustellen ist. 2 Die Antragstellung auf Zuerkennung des<br />
Status einer MODUS-Schule an kommunale Schulen erfolgt im<br />
Einvernehmen mit dem Schulträger.<br />
(2) 1 Schulversuche sind vor ihrer Einführung, der Status einer MODUS-Schule<br />
unverzüglich nach der Zuerkennung, den Erziehungsberechtigten der vom<br />
Schulversuch betroffenen Schülerinnen und Schüler oder bei Volljährigkeit<br />
den Schülerinnen und Schülern selbst und außerdem im Amtsblatt des<br />
zuständigen Staatsministeriums bekannt zu machen. 2 Die<br />
Bekanntmachung muss bei einem Schulversuch Auskunft über Ziel, Inhalt<br />
und Dauer sowie über die im Rahmen des Schulversuchs möglichen<br />
Abschlüsse und Berechtigungen, bei der Zuerkennung des Status einer<br />
MODUS-Schule über den Akt der Zuerkennung und dessen Dauer geben.<br />
3<br />
Im Übrigen gelten für die zur Durchführung eines Schulversuchs<br />
notwendige Errichtung oder Auflösung von Schulen die für die<br />
betreffenden Schulen erlassenen Vorschriften.<br />
(3) Das zuständige Staatsministerium kann durch Rechtsverordnung die<br />
Schul- und Dienstaufsicht und die Zuständigkeiten hierfür abweichend von<br />
den geltenden Vorschriften regeln, soweit dies zur Durchführung des<br />
Schulversuchs und zur Aufsicht über die MODUS-Schulen notwendig ist.<br />
Abschnitt XIII Kommerzielle und politische Werbung, Erhebung<br />
und Verarbeitung von Daten<br />
Bay EUG Art. 84 Kommerzielle und politische Werbung<br />
(1) 1 Der Vertrieb von Gegenständen aller Art, Ankündigungen und Werbung<br />
hierzu, das Sammeln von Bestellungen sowie der Abschluss sonstiger<br />
Geschäfte sind in der Schule untersagt. 2 Ausnahmen im schulischen<br />
Interesse insbesondere für Sammelbestellungen regelt die Schulordnung.
(2) Politische Werbung im Rahmen von Schulveranstaltungen oder auf dem<br />
Schulgelände ist nicht zulässig.<br />
(3) 1 Schülerinnen und Schüler dürfen Abzeichen, Anstecknadeln, Plaketten,<br />
Aufkleber und ähnliche Zeichen tragen, wenn dadurch nicht der<br />
Schulfriede, der geordnete Schulbetrieb, die Erfüllung des Bildungs- und<br />
Erziehungsauftrags, das Recht der persönlichen Ehre oder die Erziehung<br />
zur Toleranz gefährdet wird. 2 Im Zweifelsfall entscheidet hierüber die<br />
Schulleiterin bzw. der Schulleiter. 3 Die bzw. der Betroffene kann die<br />
Behandlung im Schulforum verlangen.<br />
Bay EUG Art. 85 Erhebung und Verarbeitung von Daten<br />
(1) 1 Zur Erfüllung der den Schulen durch Rechtsvorschriften jeweils<br />
zugewiesenen Aufgaben sind die Erhebung und die Verarbeitung von<br />
Daten zulässig. 2 Dazu gehören personenbezogene Daten der Schülerinnen<br />
und Schüler und der Erziehungsberechtigten, insbesondere Adressdaten,<br />
schulische Daten, Leistungsdaten sowie Daten zur Vorbildung und<br />
Berufsausbildung. 3 Der Betroffene ist zur Angabe der Daten verpflichtet;<br />
er ist bei der Datenerhebung auf diese Rechtsvorschrift hinzuweisen.<br />
(2) 1 Die Weitergabe von Daten und Unterlagen über Schülerinnen und<br />
Schüler und Erziehungsberechtigte an außerschulische Stellen ist im<br />
Übrigen untersagt, falls nicht ein rechtlicher Anspruch auf die Herausgabe<br />
der Daten nachgewiesen wird. 2 Das Recht, Straftaten oder<br />
Ordnungswidrigkeiten anzuzeigen, bleibt unberührt.<br />
(3) Gibt eine Schule für die Schülerinnen und Schüler und<br />
Erziehungsberechtigten einen Jahresbericht heraus, so dürfen darin<br />
folgende personenbezogene Daten enthalten sein:<br />
Name, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse der Schülerinnen und<br />
Schüler, Name, Fächerverbindung und Verwendung der einzelnen Lehrkräfte,<br />
Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen einzelner<br />
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigter.<br />
Abschnitt XIV Ordnungsmaßnahmen als Erziehungsmaßnahmen<br />
Bay EUG Art. 86 Ordnungsmaßnahmen als Erziehungsmaßnahmen<br />
(1) Zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags oder zum Schutz von<br />
Personen und Sachen können nach dem Grundsatz der<br />
Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schülerinnen und<br />
Schülern getroffen werden, soweit andere Erziehungsmaßnahmen nicht<br />
ausreichen.<br />
(2) 1 Ordnungsmaßnahmen sind:<br />
1. der schriftliche Verweis durch die Lehrkraft oder die Förderlehrerin bzw.<br />
den Förderlehrer,<br />
2. der verschärfte Verweis durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter,<br />
3. die Versetzung in eine Parallelklasse der gleichen Schule durch die<br />
Schulleiterin bzw. den Schulleiter,<br />
4. der Ausschluss in einem Fach für die Dauer von bis zu vier Wochen<br />
durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter,<br />
5. der Ausschluss vom Unterricht für drei bis sechs Unterrichtstage, bei
Berufsschulen mit Teilzeitunterricht für höchstens zwei Unterrichtstage,<br />
durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter<br />
6. der Ausschluss vom Unterricht für zwei bis vier Wochen ab dem siebten<br />
Schulbesuchsjahr durch die Lehrerkonferenz,<br />
6 a. der Ausschluss vom Unterricht für mehr als vier Wochen, längstens<br />
bis zum Ablauf des laufenden Schuljahres bei Hauptschulen und<br />
Hauptschulstufen der Förderschulen ab dem siebten Schulbesuchsjahr<br />
bzw. bei Berufsschulen sowie Berufsschulen zur sonderpädagogischen<br />
Förderung durch die Lehrerkonferenz im Einvernehmen mit dem örtlichen<br />
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf mögliche Leistungen<br />
nach Maßgabe des Achten Buches Sozialgesetzbuch,<br />
7. bei Pflichtschulen die Zuweisung an eine andere Schule der gleichen<br />
Schulart auf Vorschlag der Lehrerkonferenz durch die<br />
Schulaufsichtsbehörde,<br />
8. die Androhung der Entlassung von der Schule durch die<br />
Lehrerkonferenz,<br />
9. die Entlassung von der Schule durch die Lehrerkonferenz (Art. 87),<br />
10. der Ausschluss von allen Schulen einer oder mehrerer Schularten<br />
durch das zuständige Staatsministerium (Art. 88).<br />
2<br />
Eine Ordnungsmaßnahme in elektronischer Form ist ausgeschlossen.<br />
(3) 1 Andere als die in Absatz 2 aufgeführten Ordnungsmaßnahmen sowie die<br />
Verhängung von Ordnungsmaßnahmen gegenüber Klassen oder Gruppen<br />
als solche sind nicht zulässig. 2 Körperliche Züchtigung ist nicht zulässig.<br />
(4) 1 Gegenüber Schulpflichtigen in Berufsschulen und in Berufsschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung, die in einem Ausbildungsverhältnis<br />
stehen, sind die Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 6 und 6 a<br />
nicht zulässig. 2 Gegenüber Schulpflichtigen in Pflichtschulen sind die<br />
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Nrn. 8 bis 10 nicht zulässig. 3 Die<br />
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Nrn. 8 und 9 sind jedoch gegenüber<br />
Schulpflichtigen in Berufsschulen, die in keinem Ausbildungsverhältnis<br />
stehen, sowie gegenüber Schulpflichtigen zulässig, die die Hauptschule<br />
nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht besuchen.<br />
(5) 1 Die Ordnungsmaßnahme der Versetzung in eine Parallelklasse (Absatz 2<br />
Nr. 3) kann auch neben den Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Nrn. 1,<br />
2, 4, 5, 6, 6 a und 8 angewandt werden. 2 Im Fall einer<br />
Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Nr. 6, 6 a oder Nr. 8 entscheidet über<br />
eine zusätzliche Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Nr. 3 die<br />
Lehrerkonferenz.<br />
(6) 1 Bei einer Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 a kann die<br />
Schulaufsichtsbehörde, im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der<br />
öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf mögliche Leistungen nach<br />
Maßgabe des Achten Buches Sozialgesetzbuch, auch entscheiden, dass<br />
1. die Vollzeitschulpflicht der Schülerin bzw. des Schülers mit Ablauf des<br />
achten Schulbesuchsjahres beendet wird,<br />
2. nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht nach Nr. 1 auch die<br />
Berufsschulpflicht beendet wird, wenn die Schülerin oder der Schüler noch<br />
nicht in die Berufsschule oder die Berufsschule zur sonderpädagogischen<br />
Förderung aufgenommen ist,<br />
3. die Berufsschulpflicht beendet wird, wenn die Schülerin oder der
Schüler bereits in die Berufsschule oder die Berufsschule zur<br />
sonderpädagogischen Förderung aufgenommen ist.<br />
2<br />
Die Entscheidung nach Satz 1 Nrn. 1 und 3 erfolgt auf Antrag der<br />
Lehrerkonferenz. 3 Sie setzt voraus, dass das Verhalten der Schülerin bzw.<br />
des Schülers den Bildungsanspruch der Mitschülerinnen und Mitschüler<br />
schwerwiegend und dauerhaft beeinträchtigt oder im Fall des Satzes 1<br />
Nr. 2 eine solche Beeinträchtigung im Berufsschulunterricht zu erwarten<br />
wäre. 4 Art. 88 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 5 Die<br />
zuständigen schulischen Beratungsfachkräfte sind von der<br />
Lehrerkonferenz vor der Antragstellung gutachtlich zu hören; die<br />
Stellungnahme ist der Schulaufsichtsbehörde zusammen mit dem Antrag<br />
zu übermitteln.<br />
(7) Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Nr. 4 sind nur zulässig, wenn der<br />
Schülerin oder der Schüler durch schwere oder wiederholte Störung des<br />
Unterrichts in diesem Fach, Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Nrn. 6<br />
bis 10 sind nur zulässig, wenn der Schülerin oder der Schüler durch<br />
schweres oder wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der Aufgabe der<br />
Schule oder die Rechte anderer gefährdet hat.<br />
(8) Außerschulisches Verhalten darf Anlass einer Ordnungsmaßnahme nur<br />
sein, soweit es die Verwirklichung der Aufgabe der Schule gefährdet.<br />
(9) 1 Vor der Anwendung von Ordnungsmaßnahmen können schulische<br />
Beratungsfachkräfte hinzugezogen werden. 2 Es ist der Schülerin bzw. dem<br />
Schüler, bei Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Nrn. 3 bis 10 zusätzlich<br />
auch den Erziehungsberechtigten der Schülerin bzw. des Schülers,<br />
Gelegenheit zur Äußerung zu geben, bei Ordnungsmaßnahmen nach<br />
Absatz 2 Nrn. 6 a bis 10 auf Antrag persönlich in der Lehrerkonferenz.<br />
3<br />
Die Schülerin oder der Schüler und die Erziehungsberechtigten können<br />
eine Lehrkraft ihres Vertrauens einschalten. 4 Bei der Einleitung des<br />
Anhörungsverfahrens sind die Berechtigten auf das Antragsrecht nach<br />
Satz 2 und die Möglichkeiten nach Satz 3 hinzuweisen.<br />
(10) 1 Bei Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nrn. 6, 6 a, 7 und 8 wirkt auf<br />
Antrag eines Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers oder<br />
der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers der Elternbeirat<br />
mit. 2 Die Stellungnahme des Elternbeirats ist bei der Entscheidung zu<br />
würdigen. 3 Entspricht die Lehrerkonferenz nicht der Stellungnahme des<br />
Elternbeirats, so ist dies gegenüber dem Elternbeirat zu begründen; im<br />
Fall der Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Nr. 7 ist die Stellungnahme<br />
des Elternbeirats dem Vorschlag der Lehrerkonferenz an die<br />
Schulaufsichtsbehörde beizufügen.<br />
(11) 1 Vor Erlass von Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 a und<br />
Abs. 6 übermittelt die Schulleitung bzw. die Schulaufsichtsbehörde die<br />
Entscheidung der Lehrerkonferenz nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 a bzw. deren<br />
Antrag nach Abs. 6 Satz 2 dem örtlichen Träger der öffentlichen<br />
Jugendhilfe; bei Maßnahmen nach Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 teilt die<br />
Schulaufsichtsbehörde dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe<br />
ihren Entschluss zur Verkürzung der Berufsschulpflicht mit. 2 Dessen<br />
Einvernehmen gilt als erteilt, wenn er nicht binnen der Frist nach Satz 3<br />
widerspricht. 3 Die Frist beträgt bei Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2
Satz 1 Nr. 6 a zwei Wochen, bei Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 6 vier<br />
Wochen nach Zugang der Mitteilung nach Satz 1.<br />
(12) 1 Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2<br />
Satz 1 Nr. 6 a und die Beendigung der Schulpflicht nach Abs. 6 nach<br />
Anhörung der Schülerin oder des Schülers, der Erziehungsberechtigten,<br />
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, des Elternbeirats, wenn<br />
dieser nach Abs. 10 an der Ordnungsmaßnahme mitgewirkt hat, und der<br />
schulischen Beratungsfachkräfte aufheben, wenn neue Tatsachen bekannt<br />
geworden sind, die erwarten lassen, dass die Schülerin oder der Schüler<br />
nicht mehr ein den Ausschluss bzw. die Beendigung der Schulpflicht<br />
begründendes Verhalten zeigen wird. 2 Die Beendigung der<br />
Berufsschulpflicht ist aufzuheben, wenn ein Ausbildungsverhältnis<br />
aufgenommen wird und eine Berufsschulpflicht nach Art. 39 Abs. 2 Satz 1<br />
besteht.<br />
(13) 1 Gefährdet eine Schülerin oder ein Schüler durch ihr bzw. sein Verhalten<br />
das Leben oder in erheblicher Weise die Gesundheit von Schülerinnen<br />
bzw. Schülern oder Lehrkräften, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter<br />
die Schülerin oder den Schüler längstens bis zur Vollziehbarkeit einer<br />
Entscheidung über schulische Ordnungsmaßnahmen, über die<br />
Überweisung an eine Förderschule, eine Aufnahme in eine Schule für<br />
Kranke oder in eine andere Einrichtung, in der die Schulpflicht erfüllt<br />
werden kann, auch bei bestehender Schulpflicht vom Besuch der Schule<br />
ausschließen, sofern die Gefahr nicht anders abwendbar ist. 2 Die<br />
Schulaufsichtsbehörde, der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe,<br />
die Polizei, die Erziehungsberechtigten und die zuständigen schulischen<br />
Beratungsfachkräfte sind unverzüglich zu informieren. 3 Wird wegen<br />
desselben Sachverhalts auch eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1<br />
Nrn. 5, 6 oder 6 a getroffen, soll die Zeit des Ausschlusses vom<br />
Schulbesuch nach Satz 1 auf die Dauer der Ordnungsmaßnahme<br />
angerechnet werden.<br />
(14) Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen<br />
Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 3 bis 10 sowie gegen<br />
Maßnahmen nach Abs. 13 Satz 1 entfällt.<br />
(15) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung das Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen, insbesondere<br />
bei der Anhörung der Beteiligten und bei der Feststellung des<br />
Sachverhalts, sowie sonstigen Erziehungsmaßnahmen zu regeln; als<br />
Erziehungsmaßnahme kann bei nicht hinreichender Beteiligung der<br />
Schülerin oder des Schülers am Unterricht auch eine Nacharbeit unter<br />
Aufsicht einer Lehrkraft vorgesehen werden.<br />
Bay EUG Art. 87 Entlassung<br />
(1) 1 Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers kann die<br />
Lehrerkonferenz nur mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen ihrer<br />
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließen. 2 Die<br />
Lehrerkonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer<br />
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 3 Auf Antrag eines<br />
Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers oder der<br />
volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers wirkt der Elternbeirat
im Entlassungsverfahren mit; hierauf ist bei Einleitung des<br />
Anhörungsverfahrens hinzuweisen. 4 Die Stellungnahme des Elternbeirats<br />
ist bei der Entscheidung zu würdigen. 5 Entspricht die Lehrerkonferenz<br />
nicht der Stellungnahme des Elternbeirats, so ist dies gegenüber dem<br />
Elternbeirat zu begründen. 6 Hat sich der Elternbeirat mit einer Mehrheit<br />
von zwei Dritteln seiner Mitglieder gegen die Entlassung ausgesprochen,<br />
so kann die Entlassung nur im Einvernehmen mit der zuständigen<br />
Schulaufsichtsbehörde ausgesprochen werden.<br />
(2) Im Entlassungsverfahren ist nach Lage des Falls der Schularzt oder der<br />
zuständige Schulpsychologe zur gutachtlichen Äußerung beizuziehen.<br />
(3) 1 Eine entlassene Schülerin oder ein entlassener Schüler kann an einer<br />
anderen Schule aufgenommen werden. 2 In die früher besuchte Schule<br />
darf sie bzw. er frühestens ein halbes Jahr nach der Entlassung, aber nur<br />
zu Beginn des Schuljahres, wieder eintreten; Voraussetzung ist, dass er<br />
sich inzwischen tadelfrei geführt hat und andere öffentliche Schulen der<br />
gleichen Schulart und Ausbildungsrichtung am Ort oder in zumutbarer<br />
Entfernung nicht besucht werden können. 3 Eine nach Art. 86 Abs. 4<br />
Satz 2 entlassene Berufsschülerin oder ein nach Art. 86 Abs. 4 Satz 2<br />
entlassener Berufsschüler ist bei Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses<br />
an der zuständigen Berufsschule wieder aufzunehmen; Gleiches gilt auf<br />
Antrag der Schülerin bzw. des Schülers auch ohne Aufnahme eines<br />
Ausbildungsverhältnisses frühestens drei Monate nach der Entlassung,<br />
wenn ein regelmäßiger Schulbesuch zu erwarten ist.<br />
(4) Für Schülerinnen oder Schüler, die bereits zweimal entlassen wurden, ist<br />
die Aufnahme in eine andere Schule der gleichen Schulart nur vom<br />
nächsten Schuljahr an mit Genehmigung des zuständigen<br />
Staatsministeriums zulässig, das auch die Schule bestimmt.<br />
Bay EUG Art. 88 Ausschluss<br />
(1) 1 Sind bei einer zur Entlassung führenden Verfehlung Tatumstände<br />
gegeben, die die Ordnung oder die Sicherheit des Schulbetriebs oder die<br />
Verwirklichung des Bildungsziels der betreffenden Schulart besonders<br />
gefährden, so hat die Lehrerkonferenz unmittelbar nach dem Beschluss<br />
über die Entlassung gesondert zu beschließen, ob Antrag auf den<br />
Ausschluss der Schülerin bzw. des Schülers von allen Schulen dieser<br />
Schulart gestellt wird. 2 Ein Beschluss der Lehrerkonferenz, durch den<br />
dieser Antrag gestellt wird, bedarf einer Mehrheit von mindestens zwei<br />
Dritteln der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.<br />
3 4<br />
Art. 87 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Hat der Elternbeirat im<br />
Entlassungsverfahren mitgewirkt, so ist er auch bei der Frage des<br />
Ausschlusses beratend zu beteiligen; einem Antrag auf Ausschluss ist in<br />
diesem Fall eine Stellungnahme des Elternbeirats beizugeben.<br />
5<br />
Erforderlichenfalls ist der Schularzt oder der zuständige Schulpsychologe<br />
vor der Beschlussfassung der Lehrerkonferenz gutachtlich zu hören.<br />
(2) Schülerinnen und Schüler können von der besuchten oder allen Schulen<br />
einer oder mehrerer Schularten unbeschadet der Erfüllung der Schulpflicht<br />
entlassen und ausgeschlossen werden, wenn sie wegen einer vorsätzlich<br />
begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr<br />
rechtskräftig verurteilt worden sind, die Strafe noch der unbeschränkten
Auskunft unterliegt und wenn nach der Art der von den Schülerinnen und<br />
Schülern begangenen Straftat die Ordnung oder die Sicherheit des<br />
Schulbetriebs oder die Verwirklichung der Bildungsziele der Schule<br />
erheblich gefährdet ist.<br />
(3) Ausgeschlossene Schülerinnen und Schüler können vom zuständigen<br />
Staatsministerium zu einer oder mehreren Schularten wieder zugelassen<br />
werden, wenn die Gründe, die zum Ausschluss geführt haben, nicht in<br />
gleichem Umfang fortbestehen.<br />
Bay EUG Art. 88 a Unterrichtung der früheren Erziehungsberechtigten<br />
volljähriger Schülerinnen und Schüler über Ordnungsmaßnahmen<br />
Frühere Erziehungsberechtigte volljähriger Schülerinnen und Schüler, welche<br />
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen über<br />
Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 3 bis 10 unterrichtet werden.<br />
Abschnitt XV Schulordnung<br />
Bay EUG Art. 89<br />
(1) 1 Das zuständige Staatsministerium regelt durch Rechtsverordnung den<br />
Schulbetrieb und die inneren Schulverhältnisse an öffentlichen Schulen in<br />
Schulordnungen, bei Fachakademien im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 2 Für kommunale Schulen<br />
kann es auch Schulordnungen genehmigen. 3 Inhalt und Umfang der<br />
Schulordnungen bestimmen sich nach dem in der Verfassung und in<br />
diesem Gesetz festgelegten Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule;<br />
der notwendige Freiraum für die Erfüllung auch der erzieherischen<br />
Aufgabe der Schule und der einzelnen Lehrkraft ist zu sichern.<br />
(2) Die Schulordnungen sollen insbesondere regeln:<br />
1. den Aufbau der einzelnen Schularten, Ausbildungs- und Fachrichtungen,<br />
soweit dies über die Regelungen dieses <strong>Gesetze</strong>s hinaus erforderlich ist;<br />
zusätzliche Ausbildungs- und Fachrichtungen können aus besonderen<br />
pädagogischen, fachlichen oder beruflichen Gründen vorgesehen werden,<br />
2. das Verfahren bei der Aufnahme,<br />
3. die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen<br />
schulischen Veranstaltungen einschließlich Befreiung, Beurlaubung,<br />
Schulversäumnisse und der Vorlage ärztlicher und schulärztlicher<br />
Zeugnisse,<br />
4. die Unterrichtszeit; aus besonderen Gründen und im Einvernehmen mit<br />
dem Elternbeirat, dem Schulaufwandsträger sowie dem Aufgabenträger<br />
der Schülerbeförderung kann die Schulleiterin oder der Schulleiter bis zu<br />
einem Tag im Schuljahr für unterrichtsfrei erklären und festlegen, wann<br />
der entfallene Unterricht zeitnah nachzuholen ist,<br />
5. den Unterricht und das Vorrücken in der Schule, einschließlich der<br />
Wiederholung und des Überspringens einzelner Jahrgangsstufen oder<br />
Ausbildungsabschnitte, des Vorrückens auf Probe und der Nachprüfung;<br />
dabei sind das Verfahren und die für die Entscheidung maßgeblichen<br />
Fächer und Schülerleistungen sowie die hierfür geltenden<br />
Bewertungsgrundsätze zu regeln,
6. den Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher<br />
Muttersprache, soweit dies über die Regelungen für deutsche Schülerinnen<br />
und Schüler hinaus erforderlich ist,<br />
7. die während des Schulbesuchs und, soweit keine besonderen Prüfungen<br />
stattfinden, bei dessen Abschluss zu erteilenden Zeugnisse einschließlich<br />
der zu bewertenden Fächer, der Bewertungsgrundsätze und der mit einem<br />
erfolgreichen Abschluss verbundenen Berechtigungen,<br />
8. Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler; für einzelne<br />
Schularten und Schulveranstaltungen, bei denen ein erhöhtes<br />
Haftungsrisiko besteht, kann der Abschluss einer<br />
Schülerhaftpflichtversicherung verlangt werden,<br />
9. Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten und der für die<br />
Berufsausbildung der Schülerinnen und Schüler Mitverantwortlichen<br />
gegenüber der Schule,<br />
10. die Zulässigkeit von Erhebungen und Sammlungen sowie die<br />
Verteilung von Druckschriften in Schulen,<br />
11. die finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen im Rahmen der<br />
Schülermitverantwortung sowie von sonstigen schulischen<br />
Veranstaltungen,<br />
12. die Abschlussprüfungen, insbesondere<br />
a) Zweck der Prüfung, Prüfungsgegenstände und Prüfungsanforderungen,<br />
b) das Prüfungsverfahren einschließlich der Zusammensetzung des<br />
Prüfungsausschusses, der Zulassungsvoraussetzungen, der<br />
Bewertungsgrundsätze und der Voraussetzungen des Bestehens der<br />
Prüfung,<br />
c) die Erteilung von Prüfungszeugnissen und die mit einer erfolgreichen<br />
Prüfung verbundenen Berechtigungen sowie die Folgen des<br />
Nichtbestehens der Prüfung,<br />
d) die Teilnahme von Bewerberinnen und Bewerbern, die an der von ihnen<br />
besuchten Schule die gewünschte Berechtigung nicht erlangen können; in<br />
Prüfungsvorschriften sind die Besonderheiten im Sinn des Art. 90 zu<br />
berücksichtigen; es ist sicherzustellen, dass bei den Prüfungen die<br />
Schülerinnen und Schüler genehmigter Ersatzschulen gegenüber den<br />
Schülern der entsprechenden öffentlichen Schulen nicht benachteiligt<br />
werden,<br />
e) die Teilnahme von Bewerberinnen und Bewerbern, die keiner Schule<br />
angehören; die Abschlussprüfungen können auch in gesonderten<br />
Prüfungsordnungen geregelt werden,<br />
13. die Voraussetzungen für den Erwerb eines qualifizierenden<br />
Hauptschulabschlusses.<br />
Dritter Teil Private Unterrichtseinrichtungen<br />
Abschnitt I Private Schulen (Schulen in freier Trägerschaft)<br />
a) Aufgabe<br />
Bay EUG Art. 90<br />
1 Private Schulen dienen der Aufgabe, das öffentliche Schulwesen zu<br />
vervollständigen und zu bereichern. 2 Sie sind im Rahmen der <strong>Gesetze</strong> frei in
der Entscheidung über eine besondere pädagogische, religiöse oder<br />
weltanschauliche Prägung, über Lehr- und Erziehungsmethoden, über Lehrstoff<br />
und Formen der Unterrichtsorganisation. 3 Die Bestimmungen über die<br />
Schulpflicht gelten auch an Privatschulen. 4 Für die privaten<br />
Schulvorbereitenden Einrichtungen (Art. 22 Abs. 1) gelten die Bestimmungen<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s entsprechend.<br />
b) Ersatzschulen<br />
Bay EUG Art. 91 Begriffsbestimmung<br />
Ersatzschulen sind private Schulen, die in ihren Bildungs- und Erziehungszielen<br />
öffentlichen im Freistaat Bayern vorhandenen oder vorgesehenen Schulen<br />
entsprechen.<br />
Bay EUG Art. 92 Genehmigung<br />
(1) 1 Ersatzschulen dürfen nur mit staatlicher Genehmigung errichtet und<br />
betrieben werden. 2 Der Antrag ist mit allen erforderlichen Unterlagen<br />
spätestens vier Monate vor Schuljahresbeginn bei der<br />
Schulaufsichtsbehörde einzureichen.<br />
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn<br />
1. derjenige, der eine Ersatzschule errichten, betreiben oder leiten will, die<br />
Gewähr dafür bietet, dass er nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung<br />
verstößt,<br />
2. die Ersatzschule in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der<br />
wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung ihrer Lehrkräfte hinter<br />
den öffentlichen Schulen nicht zurücksteht (Art. 4, 93 und 94),<br />
3. eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den<br />
Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird (Art. 96),<br />
4. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend<br />
gesichert ist (Art. 97).<br />
(3) 1 Eine Volksschule ist als Ersatzschule nur zuzulassen, wenn die zuständige<br />
Regierung als Schulaufsichtsbehörde ein besonderes pädagogisches<br />
Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn<br />
sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule<br />
errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der<br />
betreffenden Gemeinde nicht besteht. 2 Mittlere-Reife-Klassen/-Kurse<br />
können an einer privaten Volksschule eingerichtet werden, die mindestens<br />
die Jahrgangsstufen 7 bis 9 führt.<br />
(4) 1 In der Heimberufsschule erfolgt die berufliche und die schulische<br />
Ausbildung in der Schule und im Heim. 2 In der Werkberufsschule<br />
übernimmt der Ausbildende sowohl die Berufsausbildung als auch die<br />
schulische Bildung der Schülerinnen und Schüler.<br />
(5) 1 Auf genehmigte Ersatzschulen finden Art. 45 Abs. 1 Satz 3, Art. 50, 52<br />
Abs. 2 und 3, Art. 56 Abs. 4 und Art. 80 Anwendung; Art. 90 bleibt<br />
unberührt. 2 Genehmigte Ersatzschulen können die Noten (Art. 52 Abs. 2)<br />
durch eine allgemeine Bewertung (z. B. Wortgutachten) ersetzen.<br />
3<br />
Genehmigten Ersatzschulen, die für Kinder nicht deutscher<br />
Staatsangehöriger bestimmt sind, kann ein von Art. 5 Abs. 1<br />
abweichendes Schuljahr genehmigt werden.
(6) 1 Ersatzschulen, die eine nicht nur vorläufige Genehmigung haben (Art. 98<br />
Abs. 1), dürfen die zusätzliche Bezeichnung “staatlich genehmigt” führen.<br />
2 Art. 29 findet entsprechende Anwendung.<br />
Bay EUG Art. 93 Mindestlehrpläne, Mindeststundentafeln,<br />
Prüfungsordnungen<br />
(1) 1 Das zuständige Staatsministerium kann Mindestlehrpläne und<br />
Mindeststundentafeln erlassen oder genehmigen, den Abschluss der<br />
Ausbildung von Prüfungen abhängig machen, Prüfungsordnungen erlassen<br />
oder genehmigen und Schulordnungen genehmigen. 2 Das zuständige<br />
Staatsministerium kann in Einzelfällen Ausnahmen genehmigen.<br />
(2) Für private Volksschulen müssen Mindestlehrpläne aufgestellt werden.<br />
Bay EUG Art. 94 Voraussetzungen für die Unterrichtsgenehmigung<br />
(1) 1 Die Anforderungen an die Ausbildung der Lehrkräfte sind erfüllt, wenn<br />
eine fachliche und pädagogische Ausbildung sowie Prüfungen<br />
nachgewiesen werden, die der Ausbildung und den Prüfungen der<br />
Lehrkräfte an den entsprechenden öffentlichen Schulen gleichartig sind<br />
oder ihnen im Wert gleichkommen. 2 Die Anforderungen an die persönliche<br />
Eignung der Lehrkraft sind erfüllt, wenn in der Person der Lehrkraft keine<br />
schwerwiegenden Tatsachen vorliegen, die einer unterrichtlichen oder<br />
erzieherischen Tätigkeit (Art. 59 Abs. 1 Satz 1) entgegenstehen.<br />
(2) Das zuständige Staatsministerium verzichtet auf den Nachweis gemäß<br />
Abs. 1 Satz 1, wenn die Eignung der Lehrkraft durch gleichwertige freie<br />
Leistungen nachgewiesen wird.<br />
(3) 1 Der Nachweis der pädagogischen Eignung kann im Rahmen der Tätigkeit<br />
an der Privatschule innerhalb einer von der Schulaufsichtsbehörde zu<br />
bestimmenden Frist erbracht werden. 2 Eine Genehmigung ist zunächst<br />
unter Vorbehalt des Widerrufs für eine Probezeit zu erteilen, die bis zu drei<br />
Jahre dauern darf; nach Ablauf dieser Probezeit ist die Genehmigung<br />
entweder endgültig zu versagen oder zu erteilen.<br />
(4) Wird die Verwendung einer Lehrkraft von der zuständigen<br />
Schulaufsichtsbehörde nicht genehmigt, so können die betroffenen<br />
Schulen eine mündliche Erörterung zwischen Vertretern der Schule und<br />
der Schulaufsichtsbehörde verlangen.<br />
Bay EUG Art. 95 Untersagung der Tätigkeit<br />
Die Schulaufsichtsbehörde kann Schulleiterinnen und Schulleitern, Lehrkräften<br />
und Erzieherinnen und Erziehern die Ausübung ihrer Tätigkeit untersagen,<br />
wenn sie ein Verhalten zeigen, das bei vertragsmäßig beschäftigten<br />
Schulleiterinnen und Schulleitern, Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern<br />
an öffentlichen Schulen die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses<br />
rechtfertigen würde, oder wenn die Schule ohne die erforderliche<br />
Genehmigung betrieben wird.<br />
Bay EUG Art. 96 Keine Sonderung der Schülerinnen und Schüler<br />
1 Um eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den<br />
Besitzverhältnissen der Eltern zu vermeiden, sind, soweit notwendig, von den
Trägern der Privatschulen Erleichterungen bezüglich des Schul- oder<br />
Heimgeldes oder Beihilfen in einem Umfang zu gewähren, der es auch einer für<br />
die Größe der Schule oder des Heims angemessenen Zahl finanziell bedürftiger<br />
Schülerinnen und Schüler ermöglicht, die Schule zu besuchen. 2 Erziehung,<br />
Unterricht und Heimleben sind so zu gestalten, dass keine Unterscheidungen<br />
nach Herkunft, <strong>Stand</strong>, Einkommen und Vermögen der Eltern gemacht werden.<br />
Bay EUG Art. 97 Wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte<br />
(1) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte an einer<br />
Ersatzschule, die nicht einer kirchlichen Genossenschaft angehören, ist<br />
dann genügend gesichert, wenn<br />
1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftlicher oder (unter Verwendung<br />
einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur)<br />
elektronischer Vertrag abgeschlossen ist, in dem klare<br />
Kündigungsbedingungen, der Anspruch auf Urlaub und die regelmäßige<br />
Pflichtstundenzahl festgelegt sind,<br />
2. die Gehälter und Vergütungen bei entsprechenden Anforderungen<br />
hinter den Gehältern der Lehrkräfte an vergleichbaren öffentlichen<br />
Schulen nicht wesentlich zurückbleiben und in regelmäßigen<br />
Zeitabschnitten gezahlt werden,<br />
3. für die Lehrkräfte eine Anwartschaft auf Versorgung erworben wird, die<br />
wenigstens den Bestimmungen der Angestelltenversicherung entspricht.<br />
(2) 1 Ersatzschulen, die nicht nur vorläufig genehmigt sind (Art. 98 Abs. 1),<br />
können den an ihnen mit mindestens der Hälfte der Unterrichtspflichtzeit<br />
tätigen Lehrkräften nach Maßgabe des Arbeitsvertrags auf die Dauer der<br />
Verwendung das Recht einräumen, Berufsbezeichnungen zu führen, die<br />
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus für bestimmte Gruppen<br />
von Lehrkräften allgemein festsetzt. 2 Lehrkräfte, die wegen Alters oder<br />
Dienstunfähigkeit ausscheiden, sind berechtigt, ihre bisherige<br />
Berufsbezeichnung mit dem Zusatz “a. D.” widerruflich weiterzuführen.<br />
Bay EUG Art. 98 Bedingungen und Erlöschen der Genehmigung<br />
(1) 1 Ersatzschulen, bei denen die Voraussetzungen für die Erteilung der<br />
Genehmigung noch nicht voll erfüllt sind, kann die Genehmigung nach<br />
Anhörung des Trägers unter der Bedingung erteilt werden, dass die noch<br />
fehlenden Voraussetzungen innerhalb einer von der Schulaufsichtsbehörde<br />
festzusetzenden Frist erfüllt werden. 2 Die Erteilung dieser Genehmigung<br />
ist nur zulässig, wenn das leibliche oder sittliche Wohl der Schülerinnen<br />
und Schüler nicht beeinträchtigt oder gefährdet wird und Erziehung und<br />
Ausbildung hinreichend gewährleistet sind.<br />
(2) 1 Die Genehmigung für eine Schule erlischt, wenn die Schule nicht binnen<br />
eines Jahres seit Zustellung oder Eröffnung des Genehmigungsbescheids<br />
in Betrieb genommen wird oder wenn der Schulbetrieb ein Jahr geruht<br />
hat. 2 Dies gilt nicht, wenn sich aus dem Genehmigungsbescheid etwas<br />
anderes ergibt oder wenn die Frist verlängert worden ist.
Bay EUG Art. 99 Änderungen der Genehmigungsvoraussetzungen,<br />
Auflösung einer Schule<br />
(1) 1 Wesentliche Änderungen in den Voraussetzungen für die Genehmigung<br />
bedürfen der Genehmigung. 2 Bei der Einstellung von Lehrkräften, die für<br />
die jeweilige Schulart voll ausgebildet sind (Art. 94 Abs. 1), genügt die<br />
Anzeige.<br />
(2) Die Auflösung einer Schule ist nur zum Ende eines Schuljahres zulässig;<br />
sie ist spätestens drei Monate vorher der Schulaufsichtsbehörde<br />
anzuzeigen.<br />
Bay EUG Art. 100 Staatlich anerkannte Ersatzschulen<br />
(1) 1 Einer Ersatzschule, die die Gewähr dafür bietet, dass sie dauernd die an<br />
gleichartige oder verwandte öffentliche Schulen gestellten Anforderungen<br />
erfüllt, wird vom zuständigen Staatsministerium auf Antrag die<br />
Eigenschaft einer staatlich anerkannten Ersatzschule verliehen.<br />
2<br />
Förderschulen kann die Eigenschaft einer staatlich anerkannten<br />
Ersatzschule auch verliehen werden, wenn sie mit Rücksicht auf die aus<br />
dem sonderpädagogischen Förderbedarf herrührenden Ziele nicht voll<br />
ausgebaut sind.<br />
(2) 1 Staatlich anerkannte Ersatzschulen sind im Rahmen des Art. 90<br />
verpflichtet, bei der Aufnahme, beim Vorrücken und beim Schulwechsel<br />
von Schülerinnen und Schülern sowie bei der Abhaltung von Prüfungen die<br />
für öffentliche Schulen geltenden Regelungen anzuwenden. 2 Mit der<br />
Anerkennung erhält die Schule das Recht, Zeugnisse zu erteilen, die die<br />
gleiche Berechtigung verleihen wie die der öffentlichen Schulen. 3 Die<br />
Schülersprecherinnen und Schülersprecher staatlich anerkannter<br />
Ersatzschulen sind bei den Wahlen zu den in Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 5<br />
bis 7 genannten Einrichtungen der Schülermitverantwortung sowohl aktiv<br />
als auch passiv wahlberechtigt.<br />
(3) weggefallen<br />
Bay EUG Art. 101 Ersatzschulen mit dem Charakter öffentlicher<br />
Schulen<br />
(1) Einer staatlich anerkannten Ersatzschule wird vom zuständigen<br />
Staatsministerium auf Antrag der Charakter einer öffentlichen Schule<br />
verliehen.<br />
(2) Eine Schule mit dem Charakter einer öffentlichen Schule ist verpflichtet,<br />
die für entsprechende öffentliche Schulen erlassene Schulordnung<br />
anzuwenden.<br />
c) Ergänzungsschulen<br />
Bay EUG Art. 102 Begriffsbestimmung, Anzeigepflicht<br />
(1) Ergänzungsschulen sind private Schulen, die nicht Ersatzschulen im Sinn<br />
des Art. 91 sind.<br />
(2) 1 Die Errichtung einer Ergänzungsschule ist der Schulaufsichtsbehörde drei<br />
Monate vor Aufnahme des Unterrichts anzuzeigen. 2 Der Anzeige sind der
Lehrplan sowie Nachweise über den Schulträger, die Schuleinrichtungen<br />
und die Vorbildung des Leiters und der Lehrkräfte beizufügen.<br />
(3) Nachträgliche wesentliche Änderungen sind unter Beigabe der Nachweise<br />
alsbald anzuzeigen.<br />
Bay EUG Art. 103 Untersagung<br />
1 Errichtung und Betrieb einer Ergänzungsschule können von der<br />
Schulaufsichtsbehörde untersagt werden, wenn Schulträger, Leiter, Lehrkräfte<br />
oder Einrichtungen der Ergänzungsschule den Anforderungen nicht<br />
entsprechen, die durch Gesetz oder auf Grund von <strong>Gesetze</strong>n vorgeschrieben<br />
oder die zum Schutz der Schülerinnen und Schüler an sie zu stellen sind, und<br />
wenn den Mängeln trotz Aufforderung der Schulaufsichtsbehörde innerhalb<br />
einer bestimmten Frist nicht abgeholfen worden ist. 2 Art. 95 gilt entsprechend.<br />
Bay EUG Art. 104 Mindestlehrpläne, Prüfungen<br />
Das zuständige Staatsministerium kann für Ergänzungsschulen<br />
Mindestlehrpläne genehmigen, den Abschluss der Ausbildungen von Prüfungen<br />
abhängig machen und Prüfungsordnungen genehmigen.<br />
Abschnitt II Lehrgänge und Privatunterricht<br />
Bay EUG Art. 105<br />
1 Private Lehrgänge und Privatunterricht dürfen keine Bezeichnungen führen<br />
oder Zeugnisse erteilen, die mit Bezeichnungen oder Zeugnissen öffentlicher<br />
oder privater Schulen verwechselt werden können. 2 Art. 103 gilt<br />
entsprechend.<br />
Vierter Teil Heime für Schülerinnen und Schüler, Internate,<br />
Mittagsbetreuung<br />
Bay EUG Art. 106 Heimschulen, Internatsschulen<br />
(1) 1 An Schulen können Schülerheime eingerichtet werden, deren Aufgabe es<br />
ist, Schülerinnen und Schüler dieser Schulen erzieherisch zu betreuen<br />
sowie ihnen Unterkunft und Verpflegung zu gewähren. 2 Schule und Heim<br />
bilden eine pädagogische Einheit (Heimschule). 3 Heimschulen können sich<br />
auch als Internate oder Internatsschulen bezeichnen.<br />
(2) 1 Für die Errichtung eines Schülerheims an einer Schule gelten die<br />
Vorschriften über die Errichtung der Schule entsprechend. 2 Wesentliche<br />
Änderungen und die Auflösung sind anzuzeigen. 3 Die Schulaufsicht<br />
erstreckt sich auch auf das Schülerheim.<br />
(3) 1 Absatz 2 findet auf Schülerheime keine Anwendung, die mit Volksschulen<br />
verbunden sind. 2 Diese unterstehen der Aufsicht nach den Bestimmungen<br />
des Achten Buchs Sozialgesetzbuch. 3 Das Gleiche gilt für Schülerheime an<br />
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die nicht<br />
Landesschulen sind.
Bay EUG Art. 107 Schülerheime, Mittagsbetreuung<br />
(1) 1 Ein nicht mit einer Schule verbundenes Schülerheim, das Schülerinnen<br />
und Schülern unter 18 Jahren Unterkunft und Verpflegung bietet und auch<br />
der erzieherischen Betreuung der Schülerinnen und Schüler dient,<br />
untersteht ebenso wie ein einem solchen Schülerheim angegliedertes<br />
Tagesheim der Schulaufsicht; seine Errichtung ist der<br />
Schulaufsichtsbehörde drei Monate vor Aufnahme des Betriebs<br />
anzuzeigen. 2 Der Anzeige sind Nachweise über den Träger des Heims, die<br />
Einrichtungen des Heims und die Person des Leiters beizufügen.<br />
3<br />
Wesentliche Änderungen und die Auflösung sind ebenfalls anzuzeigen.<br />
4<br />
Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Mittagsbetreuung (Art. 31 Abs. 2 Sätze 2<br />
und 3) entsprechend.<br />
(2) 1 Absatz 1 gilt nicht für Schülerheime, die Grundschüler oder überwiegend<br />
Hauptschüler, Schülerinnen und Schüler der Volksschulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung, Schülerinnen und Schüler der<br />
Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung und<br />
Berufsschülerinnen und Berufsschüler aufnehmen. 2 Diese unterstehen der<br />
Aufsicht nach den Bestimmungen des Achten Buchs Sozialgesetzbuch.<br />
Bay EUG Art. 108 Heime bei Förderschulen<br />
(1) 1 Um den Besuch öffentlicher Förderschulen sicherzustellen, sind die<br />
erforderlichen Heime oder ähnliche Einrichtungen zu schaffen. 2 Kommt<br />
der Träger des Schulaufwands dieser Verpflichtung nicht oder nicht<br />
hinreichend nach, so bestimmt die Aufsichtsbehörde nach Anhörung des<br />
Trägers die jeweils notwendige Art und Größe der Einrichtung. 3 Die<br />
Bestimmungen des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch und des Achten<br />
Buchs Sozialgesetzbuch bleiben unberührt.<br />
(2) Für die Errichtung von Heimen oder ähnlichen Einrichtungen bei<br />
Förderschulen gilt Art. 33 Abs. 2 entsprechend.<br />
Bay EUG Art. 109 Tagesheimschulen<br />
1 Tagesheimschulen bieten nach Beendigung des in der Regel am Vormittag<br />
erteilten Unterrichts eine den Aufgaben der Schulen entsprechende<br />
pädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler für den Nachmittag an.<br />
2 Art. 106 gilt entsprechend.<br />
Bay EUG Art. 110 Untersagung<br />
Errichtung und Betrieb eines Heims für Schülerinnen und Schüler nach Art. 106<br />
Abs. 1 und Art. 107 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 sowie einer Mittagsbetreuung nach<br />
Art. 107 Abs. 1 Satz 4 können von der Schulaufsichtsbehörde untersagt<br />
werden, wenn Tatsachen festgestellt werden, die geeignet sind, das leibliche,<br />
geistige und seelische Wohl der in der Einrichtung betreuten Schülerinnen und<br />
Schüler zu gefährden, und eine unverzügliche Beseitigung der Gefährdung<br />
nicht zu erwarten ist.
Fünfter Teil Schulaufsicht<br />
Bay EUG Art. 111 Allgemeines, Leistungsvergleiche<br />
(1) Zur staatlichen Schulaufsicht gehören die Planung und Ordnung des<br />
Unterrichtswesens, die Sicherung der Qualität von Erziehung und<br />
Unterricht, die Förderung und Beratung der Schulen und die Aufsicht über<br />
die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitung<br />
und das pädagogische Personal.<br />
(2) Die Grenzen der staatlichen Schulaufsicht über die privaten Schulen<br />
bestimmen sich nach Art. 7 des Grundgesetzes und Art. 134 der<br />
Verfassung.<br />
(3) Bei öffentlichen Schulen und bei Ersatzschulen entscheidet in inneren<br />
Schulangelegenheiten das zuständige Organ der Schule, soweit nicht die<br />
Schulaufsichtsbehörde zuständig ist.<br />
(4) Das zuständige Staatsministerium kann Schülerinnen, Schüler und<br />
Lehrkräfte verpflichten, an Leistungsvergleichen teilzunehmen, die<br />
Zwecken der Qualitätssicherung und -steigerung dienen.<br />
Bay EUG Art. 112 Aufsicht über den Religionsunterricht<br />
(1) 1 Die staatliche Schulaufsicht erstreckt sich auch auf den<br />
Religionsunterricht; die Kirchen und Religionsgemeinschaften bestimmen<br />
jedoch den Lehrinhalt und die Didaktik im Rahmen der geltenden<br />
Bestimmungen und kirchenvertraglichen Vereinbarungen. 2 Sie können<br />
durch Beauftragte den Religionsunterricht ihres Bekenntnisses besuchen<br />
lassen und sich dadurch von der Übereinstimmung des erteilten<br />
Unterrichts mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft, vom <strong>Stand</strong><br />
der Kenntnisse in der Religionslehre und von der religiös-sittlichen<br />
Erziehung der bekenntniszugehörigen Schülerinnen und Schüler<br />
unterrichten.<br />
(2) 1 Die Kirchen und Religionsgemeinschaften und ihre Vertreter haben<br />
gegenüber den Lehrkräften, die Religionsunterricht erteilen, keine<br />
dienstaufsichtlichen Befugnisse. 2 Jedoch können sich die Beauftragten der<br />
Kirchen und Religionsgemeinschaften mit diesen Lehrkräften über die<br />
Abstellung wahrgenommener Mängel ins Benehmen setzen. 3 Sie können<br />
die Schulaufsichtsbehörden anrufen, wenn Beanstandungen zu erheben<br />
sind.<br />
Bay EUG Art. 113 Befugnisse der Schulaufsichtsbehörden<br />
(1) 1 Die Schulaufsichtsbehörden haben in Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
insbesondere das Recht, die Unterrichtseinrichtungen und Heime zu<br />
besichtigen, Einblick in deren Betrieb zu nehmen sowie Berichte,<br />
Nachweise und statistische Angaben zu fordern. 2 Für Abschlussprüfungen<br />
können sie Prüfungskommissäre und beim Probeunterricht einen<br />
Vorsitzenden des Aufnahmeausschusses bestellen.<br />
(2) Schulaufsichtliche Anordnungen können sowohl an den Träger als auch an<br />
den Leiter einer Unterrichtseinrichtung oder eines Heims gerichtet werden.
Bay EUG Art. 113 a Evaluation<br />
(1) 1 Die Schulen und die Schulaufsichtsbehörden verfolgen das Ziel, die<br />
Qualität schulischer Arbeit zu sichern und zu verbessern. 2 Zur Bewertung<br />
der Schul- und Unterrichtsqualität evaluieren sich die Schulen regelmäßig<br />
selbst (interne Evaluation) und evaluieren die Schulaufsichtsbehörden in<br />
angemessenen zeitlichen Abständen im Rahmen der verfügbaren Stellen<br />
und Mittel die staatlichen Schulen und, soweit dies im Rahmen der<br />
Schulaufsicht notwendig ist, die Schulen in kommunaler Trägerschaft<br />
(externe Evaluation). 3 Die externe Evaluation kann als freiwillige Leistung<br />
auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem zuständigen<br />
Staatsministerium von den Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft<br />
in Anspruch genommen werden.<br />
(2) 1 Bei der Planung und Durchführung der externen Evaluation wirken die<br />
Schulaufsichtsbehörden mit der Qualitätsagentur im Staatsinstitut für<br />
Schulqualität und Bildungsforschung zusammen. 2 Die<br />
Schulaufsichtsbehörden setzen Evaluationsgruppen ein, die speziell für<br />
diese Aufgabe qualifiziert werden. 3 An diesen Gruppen können die<br />
Schulaufsichtsbehörden private Dritte beteiligen, die über die erforderliche<br />
Eignung und Fachkunde verfügen; die Zuerkennung der Eignung setzt<br />
voraus, dass die mit der Evaluation betrauten Personen nach dem<br />
Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden.<br />
(3) 1 Zur internen und externen Evaluation können die Schulen, die<br />
Schulaufsichtsbehörden sowie im Rahmen des Abs. 2 die Qualitätsagentur<br />
im Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung<br />
personenbezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen erheben,<br />
verarbeiten und nutzen. 2 Dabei stellen die in Satz 1 genannten Stellen<br />
sicher, dass nur insoweit personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet<br />
und genutzt werden, als das öffentliche Interesse die schutzwürdigen<br />
Belange der Betroffenen erheblich überwiegt und der Zweck der<br />
Evaluation auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem<br />
Aufwand erreicht werden kann. 3 Eine Verarbeitung und Nutzung der<br />
personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken ist unzulässig. 4 Vor der<br />
Durchführung einer Evaluation werden die Betroffenen über das Ziel des<br />
Vorhabens, die Art ihrer Beteiligung an der Untersuchung, die<br />
Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten sowie über die zur Einsichtnahme<br />
in die personenbezogenen Daten Berechtigten schriftlich informiert. 5 Die<br />
personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies nach dem<br />
Zweck der Evaluation möglich ist. 6 Bis dahin werden die Merkmale, mit<br />
denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer<br />
bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können,<br />
gesondert gespeichert. 7 Sie werden mit den Einzelangaben nur<br />
zusammengeführt, soweit der Zweck der Evaluation dies erfordert.<br />
8<br />
Soweit Ergebnisse der Evaluation veröffentlicht werden, erfolgt dies<br />
ausschließlich in nicht personenbezogener Form. 9 Personenbezogene<br />
Daten werden spätestens ein Jahr nach ihrer Erhebung gelöscht, die<br />
entsprechenden Unterlagen nach dieser Frist vernichtet.
Bay EUG Art. 114 Sachliche Zuständigkeit<br />
(1) Die unmittelbare staatliche Schulaufsicht obliegt<br />
1. dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus bei Gymnasien,<br />
Fachoberschulen, Berufsoberschulen, Realschulen einschließlich der<br />
entsprechenden Schulen zur sonderpädagogischen Förderung und der<br />
Schulen, die ganz oder teilweise die Lernziele der vorgenannten Schulen<br />
verfolgen,<br />
2. dem Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bei<br />
Fachakademien für Musik,<br />
3. dem Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten bei Schulen in<br />
seinem Geschäftsbereich,<br />
4. dem Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus bei Unterrichtseinrichtungen<br />
in Justizvollzugsanstalten,<br />
5. den Regierungen<br />
a) bei öffentlichen Volksschulen für die schulaufsichtliche Genehmigung<br />
von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,<br />
b) bei privaten Volksschulen,<br />
c) bei Förderschulen (einschließlich der zugehörigen Einrichtungen der<br />
Mittagsbetreuung), soweit die Schulaufsicht nicht durch Nummer 1 oder<br />
Nummer 5 Buchst. d geregelt ist,<br />
d) bei Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen, Fachschulen<br />
und Fachakademien einschließlich der entsprechenden Schulen zur<br />
sonderpädagogischen Förderung,<br />
e) bei Schulen für Kranke,<br />
f) bei Ergänzungsschulen unbeschadet der Regelung in Nummer 1,<br />
g) bei Sing- und Musikschulen,<br />
h) bei Lehrgängen in Verbindung mit dem Bayerischen Rundfunk<br />
(Telekolleg),<br />
i) bei den in Nummer 7 genannten Einrichtungen, wenn diese von<br />
kommunalen Trägern oder von staatlich verwalteten Stiftungen errichtet<br />
oder betrieben werden,<br />
6. den Schulämtern<br />
a) bei öffentlichen Volksschulen,<br />
b) bei Einrichtungen der Mittagsbetreuung, soweit nicht in Nummer 5<br />
Buchst. c geregelt,<br />
7. den Kreisverwaltungsbehörden<br />
a) bei Lehrgängen,<br />
b) bei den nach Art. 107 anzeigepflichtigen Schülerheimen und<br />
Tagesheimen,<br />
soweit sie nicht in Nummer 5 Buchst. g, h und i und in Absatz 2 genannt<br />
sind.<br />
(2) Wird ein Lehrgang an einer öffentlichen Schule eingerichtet, so obliegt der<br />
für die Schule zuständigen Aufsichtsbehörde auch die Aufsicht über den<br />
Lehrgang.<br />
(3) Bei Heimschulen im Sinn des Art. 106 sowie bei Tagesheimschulen im<br />
Sinn des Art. 109 erstreckt sich die Zuständigkeit der nach Absatz 1 für<br />
die Schule zuständigen Schulaufsichtsbehörde auch auf das Heim und die<br />
außerunterrichtliche Betreuung.
(4) 1 Im Zweifelsfall entscheidet die höhere der beteiligten<br />
Schulaufsichtsbehörden über die sachliche Zuständigkeit. 2 Ist die<br />
Zuständigkeit bei einer Schulart zweifelhaft, so können die beteiligten<br />
Staatsministerien die sachliche Zuständigkeit durch Rechtsverordnung<br />
feststellen.<br />
Bay EUG Art. 115 Schulämter<br />
(1) Für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Gemeinde besteht ein<br />
Schulamt (Staatliches Schulamt).<br />
(2) 1 Das Schulamt wird gemeinsam von der Landrätin oder dem Landrat oder<br />
der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister (rechtlicher Leiter)<br />
und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen (fachlicher Leiter)<br />
geleitet. 2 Die Vertretung der Landrätin oder des Landrats und der<br />
Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters richtet sich nach den<br />
Vorschriften der Landkreisordnung und der Gemeindeordnung. 3 Die<br />
Landrätin oder der Landrat und die Oberbürgermeisterin oder der<br />
Oberbürgermeister können sich in der Leitung des Schulamts durch einen<br />
Beamten vertreten lassen, der die Befähigung für das Richteramt hat.<br />
4<br />
Wo es die örtlichen Verhältnisse nahe legen, soll einem fachlichen Leiter<br />
die Leitung von zwei, in besonderen Fällen auch mehr als zwei,<br />
Schulämtern übertragen werden.<br />
(3) 1 Dem Schulamt oder den unter gemeinsamer fachlicher Leitung<br />
stehenden Schulämtern können für den fachlichen Aufgabenbereich nach<br />
Bedarf weitere Schulaufsichtsbeamte und Mitarbeiter zugeteilt werden.<br />
2<br />
Die Landrätin oder der Landrat oder die Oberbürgermeisterin oder der<br />
Oberbürgermeister kann den Bediensteten des Landratsamts oder der<br />
kreisfreien Gemeinde Aufgabengebiete und Befugnisse aus seinem<br />
Aufgabenbereich übertragen und entsprechende Vollmacht erteilen.<br />
(4) 1 Zum Aufgabenbereich der Landrätin oder des Landrats und der<br />
Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters gehören die<br />
Angelegenheiten vorwiegend rechtlicher Natur, zum Aufgabenbereich des<br />
fachlichen Leiters die Angelegenheiten vorwiegend fachlicher Natur. 2 Das<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus regelt im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung die<br />
Aufgabenbereiche im Schulamt, das Zusammenwirken in der Leitung des<br />
Schulamts und die Grundsätze für die Vertretungsbefugnis.<br />
Bay EUG Art. 116 Beteiligung an der Schulaufsicht<br />
(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann kommunale<br />
Schulträger, die eine geeignete hauptamtlich tätige, fachlich vorgebildete<br />
Sachbearbeiterin bzw. einen geeigneten hauptamtlich tätigen, fachlich<br />
vorgebildeten Sachbearbeiter für eine Schulart haben, insoweit an der<br />
Schulaufsicht beteiligen.<br />
(2) Einem berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied, dem die Leitung des<br />
Schulwesens einer kreisfreien Gemeinde obliegt, kann für die Dauer seiner<br />
Amtszeit auf Antrag der kreisfreien Gemeinde in widerruflicher Weise die<br />
fachliche Leitung des Schulamts übertragen werden, wenn es die<br />
Voraussetzungen für die Zulassung zur Laufbahn des<br />
Schulaufsichtsdienstes der Volksschulen erfüllt.
(3) 1 Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung, der<br />
Bezirksordnung und des <strong>Gesetze</strong>s über die kommunale Zusammenarbeit<br />
hinsichtlich der Rechtsaufsicht bleiben unberührt. 2 Die Rechtsaufsicht<br />
bezieht sich auch auf die räumlichen Schulverhältnisse sowie auf die<br />
wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte.<br />
(4) Die Schulaufsichtsbehörden können zur Ausübung der Aufsicht die ihnen<br />
nachgeordneten Behörden und besondere Beauftragte heranziehen.<br />
Bay EUG Art. 117 Übertragung der Zuständigkeit<br />
1 Die beteiligten Staatsministerien können durch Rechtsverordnung<br />
Zuständigkeiten auf nachgeordnete Behörden übertragen, wenn dies zur<br />
Anpassung an geänderte Verhältnisse oder zum Zweck der<br />
Verwaltungsvereinfachung geboten ist. 2 Aus den gleichen Gründen kann die<br />
Übertragung im Einzelfall erfolgen; dies gilt für die Regierungen entsprechend.<br />
Sechster Teil Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht,<br />
Ordnungswidrigkeiten<br />
Bay EUG Art. 118 Schulzwang<br />
(1) 1 Nimmt eine Schulpflichtige oder ein Schulpflichtiger ohne berechtigten<br />
Grund am Unterricht oder an den sonstigen verbindlichen<br />
Schulveranstaltungen (Art. 56 Abs. 4 Satz 2) nicht teil, so kann die Schule<br />
bei der Kreisverwaltungsbehörde die Durchführung des Schulzwangs<br />
beantragen. 2 Die Kreisverwaltungsbehörde kann durch ihre Beauftragten<br />
die Schulpflichtige oder den Schulpflichtigen der Schule zwangsweise<br />
zuführen. 3 Eine Vorladung der oder des Schulpflichtigen ist nicht<br />
erforderlich.<br />
(2) Zur Durchführung des Schulzwangs dürfen die Beauftragten der<br />
Kreisverwaltungsbehörde Wohnungen, Geschäftsräume und befriedetes<br />
Besitztum betreten und unmittelbaren Zwang ausüben.<br />
(3) 1 Eine Schulpflichtige oder ein Schulpflichtiger, aus deren oder dessen<br />
Verhalten sich Hinweise auf eine mögliche Erkrankung ergeben, die die<br />
Schulbesuchsfähigkeit beeinträchtigt, ist nach Aufforderung durch die<br />
Schule verpflichtet, sich durch den öffentlichen Gesundheitsdienst<br />
untersuchen zu lassen, soweit sie oder er nicht der Schule nachweist, dass<br />
sie bzw. er von einem Facharzt, insbesondere von einem Facharzt für<br />
Kinder- und Jugendmedizin oder Facharzt für (Kinder- und Jugend-<br />
)Psychiatrie und Psychotherapie, hinsichtlich dieser<br />
Verhaltensauffälligkeiten untersucht worden ist bzw. behandelt wird;<br />
Art. 80 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 2 Vor der Aufforderung sind die<br />
zuständigen schulischen Beratungsfachkräfte zu hören.<br />
(4) 1 Soweit in diesem Gesetz eine Beteiligung des öffentlichen<br />
Gesundheitsdienstes vorgeschrieben ist, sind die Erziehungsberechtigten<br />
verpflichtet, die minderjährige Schulpflichtige oder den minderjährigen<br />
Schulpflichtigen zur Durchführung der Untersuchungen dem<br />
Gesundheitsamt zuzuführen; volljährige Schulpflichtige sind verpflichtet,<br />
sich am Gesundheitsamt untersuchen zu lassen. 2 Kommen<br />
Erziehungsberechtigte und Schulpflichtige diesen Verpflichtungen ohne<br />
berechtigten Grund nicht nach, so kann die Kreisverwaltungsbehörde auf
Antrag der Schulaufsichtsbehörde Schulpflichtige durch ihre Beauftragten<br />
dem Gesundheitsamt zwangsweise zuführen. Absatz 2 findet<br />
entsprechende Anwendung.<br />
Bay EUG Art. 119 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Anmeldung einer oder<br />
eines Schulpflichtigen zum Besuch der Volksschule, der Berufsschule oder<br />
der Förderschule unterlässt (Art. 35 Abs. 4),<br />
2. vorsätzlich seine Erziehungs-, Ausbildungs- oder<br />
Arbeitgeberverpflichtung nach Art. 76 Satz 1 oder nach Art. 77 nicht<br />
erfüllt; das Gleiche gilt für Personen, denen die Erziehung minderjähriger<br />
Schulpflichtiger durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz oder teilweise<br />
übertragen ist,<br />
3. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger am Unterricht oder an den<br />
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen (Art. 56 Abs. 4) vorsätzlich<br />
nicht teilnimmt,<br />
4. eine Schule, ein Heim für Schülerinnen bzw. Schüler oder eine<br />
Einrichtung der Mittagsbetreuung<br />
a) ohne die erforderliche Genehmigung oder die vorgeschriebene Anzeige<br />
oder<br />
b) nach vollziehbarer Rücknahme oder vollziehbarem Widerruf der<br />
Genehmigung oder nach vollziehbarer Untersagung der Errichtung oder<br />
Fortführung errichtet oder leitet,<br />
5. eine mit der Genehmigung verbundene vollziehbare Auflage nicht<br />
erfüllt,<br />
6. einer auf Grund von Art. 3 Abs. 2 Satz 2, Art. 95 oder 100 Abs. 2<br />
Satz 1 erlassenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt,<br />
7. unbefugt eine nach Art. 97 Abs. 2 festgesetzte Berufsbezeichnung<br />
führt,<br />
8. als Schulleiterin oder Schulleiter, Lehrkraft oder Erzieherin oder<br />
Erzieher an einer Schule tätig ist, obwohl ihm dies untersagt worden ist,<br />
9. als Unternehmerin, Unternehmer, Leiterin, Leiter oder Lehrkraft den<br />
Vorschriften des Art. 105 Satz 1 zuwiderhandelt,<br />
10. nicht belegt<br />
11. entgegen Art. 118 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 in Verbindung mit Abs. 3<br />
einen minderjährigen Schulpflichtigen oder eine minderjährige<br />
Schulpflichtige nicht dem Gesundheitsamt zuführt oder entgegen Art. 118<br />
Satz 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit Abs. 3 sich nicht am Gesundheitsamt<br />
untersuchen lässt.<br />
(2) 1 Will die Kreisverwaltungsbehörde das Verfahren wegen einer<br />
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 einstellen, so hat sie<br />
vorher die Schule zu hören. 2 Der Erlass eines Bußgeldbescheides ist der<br />
Schule mitzuteilen.<br />
Bay EUG Art. 120 Einschränkung von Grundrechten<br />
Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s können im Vollzug der Bestimmungen über die<br />
Schulpflicht die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person<br />
und Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 102 Abs. 1,
Art. 106 Abs. 3 der Verfassung, Art. 2 Abs. 2, Art. 13 Abs. 1 des<br />
Grundgesetzes).<br />
Siebter Teil Übergangs- und Schlussbestimmungen<br />
Abschnitt I Übergangsvorschriften zu diesem Gesetz in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Februar 1988<br />
Bay EUG Art. 121 Ausnahmen vom Geltungsbereich des <strong>Gesetze</strong>s<br />
(1) Dieses Gesetz gilt nicht für<br />
1. öffentliche Schulen und Lehrgänge, die der Aus- und Weiterbildung der<br />
Angehörigen des öffentlichen Dienstes und der im Vorbereitungsdienst<br />
befindlichen Personen dienen,<br />
2. Einrichtungen, die errichtet oder betrieben werden<br />
a) auf Grund der Vorschriften des <strong>Gesetze</strong>s zur Ordnung des Handwerks<br />
(Handwerksordnung) von Handwerksinnungen, Innungsverbänden,<br />
Kreishandwerkerschaften und Handwerkskammern,<br />
b) auf Grund der Vorschriften des <strong>Gesetze</strong>s zur vorläufigen Regelung des<br />
Rechts der Industrie- und Handelskammern,<br />
c) von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, politischen Parteien,<br />
Gewerkschaften, berufsständischen oder genossenschaftlichen<br />
Vereinigungen und Organisationen für ihre Bediensteten oder Mitglieder<br />
über 18 Jahre und ohne die Absicht, Gewinne zu erzielen,<br />
es sei denn, dass sie öffentliche Schulen ersetzen,<br />
3. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen im Sinn des Fünften und<br />
Siebten Abschnitts des Vierten Kapitels des Dritten Buchs<br />
Sozialgesetzbuch, es sei denn, es handelt sich um eine Ersatzschule nach<br />
Art. 91.<br />
(2) Für Veranstaltungen, die auf Grund des <strong>Gesetze</strong>s zur Förderung der<br />
Erwachsenenbildung förderungsfähig sind, gilt lediglich Art. 128 Abs. 3.<br />
Bay EUG Art. 122 Besondere Bestimmungen<br />
(1) 1 Für Schulen des Gesundheitswesens kann die Schulordnung<br />
Abweichungen von Art. 5, 13, 52 bis 55, 62 und 86 bis 88 vorsehen,<br />
soweit dies im Hinblick auf Bundesrecht über die Zulassung zu nicht<br />
ärztlichen Heilberufen oder wegen der Verbindung der Schule mit einer<br />
Einrichtung, die anderen als Unterrichtszwecken dient, oder zur Wahrung<br />
des Wohls von Patienten und anderen Pflegebefohlenen erforderlich ist.<br />
2<br />
Satz 1 gilt entsprechend bei Schulen für sozialpflegerische und<br />
sozialpädagogische Berufe und bei Schulen mit künstlerischer<br />
Ausbildungsrichtung, soweit dies wegen der Verbindung der Schule mit<br />
einer Einrichtung, die anderen als Unterrichtszwecken dient, oder zur<br />
Wahrung des Wohls der Pflegebefohlenen erforderlich ist.<br />
(2) Für Schulen, die überwiegend von Erwachsenen besucht werden, kann die<br />
Schulordnung Abweichungen von Art. 5, 48, 56, 62 bis 69 und 86<br />
vorsehen, soweit dies wegen des erwachsenenspezifischen Charakters der<br />
Ausbildung erforderlich ist.
(3) Für Förderschulen und Schulen für Kranke kann die Schulordnung<br />
Abweichungen von Art. 49 bis 55, 62, 63 und 69 vorsehen, so weit dies<br />
wegen des sonderpädagogischen Förderbedarfs oder der Krankheit der<br />
Schülerinnen oder Schüler erforderlich ist.<br />
(4) Art. 5 gilt nicht für angezeigte Ergänzungsschulen und für private<br />
Berufsfachschulen nach Art. 124 Abs. 5, es sei denn, sie werden von<br />
Schülerinnen und Schülern besucht, die noch der Vollzeitschulpflicht<br />
unterliegen.<br />
Bay EUG Art. 123 Aufrechterhaltung von Sondervorschriften<br />
Unberührt bleiben die Bestimmungen auf Grund von Staatsverträgen,<br />
insbesondere die Bestimmungen des Bayerischen Konkordats mit dem Heiligen<br />
Stuhl vom 29. März 1924 und des Vertrags zwischen dem Bayerischen Staat<br />
und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins vom<br />
15. November 1924 in der jeweils geltenden Fassung.<br />
Bay EUG Art. 124 Wahrung des Rechtsstands<br />
(1) Genehmigungen auf Grund der bisherigen Vorschriften bleiben<br />
aufrechterhalten, soweit es sich um Unterrichtseinrichtungen handelt, die<br />
nach diesem Gesetz genehmigungspflichtig sind; im Übrigen erlöschen sie.<br />
(2) 1 Die vor dem In-Kraft-Treten dieses <strong>Gesetze</strong>s verliehenen Berechtigungen<br />
bleiben unbeschadet der Vorschriften des Art. 100 in Kraft; sie sind zu<br />
entziehen, wenn die bei der Verleihung geforderten Voraussetzungen nicht<br />
mehr vorliegen. 2 Bei einem Wechsel des Schulträgers können die diesem<br />
verliehenen Berechtigungen dem neuen Schulträger ganz oder teilweise<br />
belassen werden.<br />
(3) 1 Sofern dieses Gesetz an die Genehmigung oder Anerkennung einer<br />
Privatschule höhere Anforderungen als das frühere Recht stellt, kann ihr<br />
die Schulaufsichtsbehörde aufgeben, die Anforderungen innerhalb einer<br />
angemessenen Frist zu erfüllen. 2 Kommt die Schule dieser Auflage nicht<br />
nach, so kann die Genehmigung oder Anerkennung entzogen werden.<br />
(4) Ist eine Ergänzungsschule vor dem In-Kraft-Treten dieses <strong>Gesetze</strong>s von<br />
der Schulaufsichtsbehörde genehmigt worden, so gilt die Anzeigepflicht als<br />
erfüllt.<br />
(5) Private Berufsfachschulen, die am 1. August 1986 als genehmigte<br />
Ersatzschulen betrieben wurden, behalten auch dann ihren Status als<br />
Ersatzschule, wenn die Voraussetzungen des Art. 91 nicht gegeben sind.<br />
Bay EUG Art. 125 Staatsinstitute für die Ausbildung von Fachlehrern<br />
und Förderlehrern<br />
(1) Das Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrerinnen und Fachlehrern<br />
und die ihm angegliederten Fachausbildungsstätten haben die Aufgabe der<br />
fachlichen und pädagogischen Ausbildung für die Laufbahn der Fachlehrer.<br />
(2) Das Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrerinnen und<br />
Förderlehrern hat die Aufgabe der fachlichen und pädagogischen<br />
Ausbildung für die Laufbahn der Förderlehrerinnen und Förderlehrer.<br />
(3) 1 Der Besuch der Staatsinstitute setzt einen mittleren Schulabschluss<br />
voraus. 2 Weitere Zulassungsvoraussetzungen hinsichtlich der fachlichen
Vorbildung können in den Studienordnungen der Staatsinstitute festgelegt<br />
werden. 3 Zusammen mit der Abschlussprüfung kann unter besonderen, in<br />
den Studienordnungen näher zu bestimmenden Voraussetzungen eine<br />
fachgebundene Hochschulreife verliehen werden.<br />
(4) 1 Für die Staatsinstitute oder, soweit diese in Abteilungen unter eigener<br />
fachlicher Leitung gegliedert sind, für diese Abteilungen und für die<br />
Fachausbildungsstätten gelten die Art. 5, 26 Abs. 1, Art. 44, 45 Abs. 1<br />
und 2 Satz 1, Art. 52, 55, 56, 57, 58, 59, 62 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 8,<br />
Art. 84, 85, 86 Abs. 1, 3, 6 bis 9, Art. 87 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 3 und<br />
4, Art. 88 Abs. 1 Sätze 1 bis 3, Abs. 2 und 3 und Art. 89 entsprechend.<br />
2<br />
Die im Rahmen des Art. 86 Abs. 2 zulässigen Ordnungsmaßnahmen<br />
werden in den Studien- und Schulordnungen festgesetzt. 3 Die Aufsicht<br />
obliegt dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus; Art. 117 gilt<br />
entsprechend. 4 Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Ausbildung von<br />
Fachlehreranwärterinnen und Fachlehreranwärtern im<br />
Vorbereitungsdienst.<br />
Abschnitt II Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Änderung<br />
des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über das Erziehungs- und<br />
Unterrichtswesen und anderer <strong>Gesetze</strong> vom 25. Juni 1994<br />
Bay EUG Art. 126 Schulen besonderer Art<br />
(1) 1 Als Schulen besonderer Art können die Städtische schulartunabhängige<br />
Orientierungsstufe München-Neuperlach in den Jahrgangsstufen 5 und 6<br />
und die Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule München und die Staatliche<br />
Gesamtschule Hollfeld geführt werden. 2 Die Schülerinnen und Schüler<br />
werden entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit den gebildeten Klassen und<br />
Kursen zugewiesen. 3 Die Schulen führen nach der Jahrgangsstufe 9 zum<br />
Hauptschulabschluss und nach der Jahrgangsstufe 10 zum<br />
Realschulabschluss oder zur Berechtigung zum Übergang in die<br />
Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums. 4 An diesen Schulen kann die<br />
Vollzeitschulpflicht erfüllt werden.<br />
(2) 1 Als Schulen besonderer Art können die Staatliche kooperative<br />
Gesamtschule Senefelder-Schule Treuchtlingen und – soweit die<br />
Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllt werden – die Evangelische<br />
kooperative Gesamtschule Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg geführt werden.<br />
2<br />
Diese Schulen werden als Zusammenschluss einer Hauptschule, einer<br />
Realschule und eines Gymnasiums, bei der Evangelischen kooperativen<br />
Gesamtschule Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg zusätzlich einer<br />
Fachoberschule, geführt, die unter einer Leitung stehen sollen.<br />
(3) 1 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus regelt den Schulbetrieb<br />
und die inneren Schulverhältnisse in einer Schulordnung nach Art. 89, vor<br />
deren Erlass der Landesschulbeirat zu hören ist. 2 In dieser Schulordnung<br />
sind insbesondere Umfang und Zeitpunkt der Differenzierung in<br />
Leistungsstufen festzulegen; ab Jahrgangsstufe 9 müssen<br />
abschlussbezogene Klassen gebildet werden.<br />
(4) 1 Die unmittelbare staatliche Schulaufsicht über die Schulen besonderer<br />
Art obliegt dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 2 Dieses kann
zur Ausübung der Aufsicht ihm nachgeordnete Behörden und besondere<br />
Beauftragte heranziehen.<br />
Bay EUG Art. 127 Schulnamen<br />
Die Namen der bestehenden Schulen bleiben von Art. 29 unberührt.<br />
Abschnitt III Schlussbestimmungen<br />
Bay EUG Art. 128 Rechts- und Verwaltungsvorschriften<br />
(1) Rechtsverordnungen auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlässt das zuständige<br />
Staatsministerium, soweit nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann durch<br />
Rechtsverordnung aus Gründen der Sicherheit und Gesundheit für<br />
Sportlehrerinnen und Sportlehrer den Nachweis einer staatlichen<br />
Fachprüfung verlangen. 2 Das Staatsministerium für Wissenschaft,<br />
Forschung und Kunst kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus regeln, unter welchen<br />
fachlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen ein<br />
Lehrgang die Bezeichnung Singschule und Musikschule führen darf; damit<br />
soll der besondere Wert dieser Lehrgänge für die musikalische Erziehung<br />
der Jugend gesichert werden.<br />
(3) 1 Das zuständige Staatsministerium kann für Bildungseinrichtungen, die<br />
außerhalb der Ausbildung an öffentlichen oder privaten Schulen bestehen<br />
oder vorgesehen sind, Prüfungen einführen und Prüfungsordnungen<br />
erlassen. 2 Soweit die Bildungseinrichtungen in ihren Bildungszielen mit<br />
denen bestehender öffentlicher oder privater Schulen übereinstimmen,<br />
müssen die Prüfungen inhaltlich den entsprechenden Abschlussprüfungen<br />
der schulischen Bildungsgänge gleichwertig sein. 3 Für die Studienkollegs<br />
bei den Universitäten des Freistaates Bayern und Studienkollegs bei den<br />
Fachhochschulen des Freistaates Bayern sowie für die Sonderlehrgänge<br />
für Aussiedlerinnen, Aussiedler, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler<br />
zum Erwerb der Hochschulreife kann das Staatsministerium für Unterricht<br />
und Kultus außerdem in entsprechender Anwendung des Art. 89<br />
Studienordnungen erlassen.<br />
(4) Lehrkräften, die aus dem öffentlichen Schuldienst in den<br />
Auslandsschuldienst beurlaubt sind, kann die Ernennungsbehörde für die<br />
Dauer ihrer Verwendung als Schulleiterin bzw. Schulleiter, stellvertretende<br />
Schulleiterin bzw. stellvertretender Schulleiter oder Fachberaterin bzw.<br />
Fachberater das Führen einer Bezeichnung gestatten, die der<br />
Amtsbezeichnung vergleichbarer Lehrkräfte an öffentlichen Schulen<br />
entspricht.<br />
Bay EUG Art. 129 In-Kraft-Treten<br />
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1983 in Kraft. 2 (gegenstandslos)<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten des <strong>Gesetze</strong>s in der ursprünglichen<br />
Fassung vom 10. September 1982 (GVBl S. 743, ber. S. 1032; BayRS 2230-1-1-UK). Der Zeitpunkt<br />
des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.
Verordnung zur Ausführung des<br />
Gaststättengesetzes (Bay GastV)<br />
vom 22. Juli 1986 GVBl. S. 295 , geändert durch Verordnungen vom 24. Mai 1994 GVBl. S. 433 ,<br />
vom 18. Dezember 2001 GVBl. S. 1030 , vom 21. Januar 2003 GVBl. S. 6 , durch Gesetz vom 27.<br />
Dezember 2004 GVBl. S. 539 (FN BayRS 7130-1-W)<br />
Auf Grund von § 14 Sätze 1 und 2, § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 2 Satz 1, § 26<br />
Abs. 1 Satz 2 und § 30 des Gaststättengesetzes sowie § 155 Abs. 2 der<br />
Gewerbeordnung erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung:<br />
Bay GastV § 1 Zuständigkeit<br />
(1) 1 Die Ausführung des Gaststättengesetzes und der nach ihm ergangenen<br />
Rechtsverordnungen obliegt den Kreisverwaltungsbehörden, soweit im<br />
folgenden nicht anderes bestimmt ist. 2 Die Zuständigkeit der Großen<br />
Kreisstädte als Kreisverwaltungsbehörden ergibt sich aus der Verordnung<br />
über Aufgaben der Großen Kreisstädte.<br />
(2) Für die Ausführung des Gaststättengesetzes und der nach ihm ergangenen<br />
Rechtsverordnungen sowie den Vollzug des § 15 Abs. 2 der<br />
Gewerbeordnung, soweit sich diese Bestimmung auf Gewerbebetriebe<br />
bezieht, die dem Gaststättengesetz unterliegen, sind die kreisangehörigen<br />
Gemeinden zuständig, soweit ihnen durch Rechtsverordnung nach Art. 59<br />
Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung die Aufgaben der unteren<br />
Bauaufsichtsbehörde übertragen wurden.<br />
(3) Für die Ausführung des § 12 des Gaststättengesetzes sowie des § 15<br />
Abs. 2 der Gewerbeordnung, soweit sich diese Bestimmung auf<br />
Gewerbebetriebe bezieht, die der Vorschrift des § 12 des<br />
Gaststättengesetzes unterliegen, sind die Gemeinden zuständig.<br />
(4) Anzeigen nach § 6 sind bei den Gemeinden zu erstatten.<br />
(5) Für den Erlaß von Verordnungen nach § 10 sind das Staatsministerium<br />
des Innern und die Gemeinden zuständig.<br />
(6) Für die Anordnung von Ausnahmen von der Sperrzeit für einzelne Betriebe<br />
nach § 11 sind die Gemeinden, in Ausnahmefällen auch die<br />
Polizeiinspektionen und -stationen zuständig.<br />
(7) Die Überwachungsbefugnisse nach § 22 des Gaststättengesetzes stehen<br />
im Zusammenhang mit der Sperrzeit auch den Polizeiinspektionen und -<br />
stationen zu.<br />
Bay GastV § 2 Verfahren<br />
(1) 1 Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis, einer Stellvertretungserlaubnis,<br />
einer vorläufigen Erlaubnis, einer vorläufigen Stellvertretungserlaubnis<br />
oder einer Gestattung im Sinn der §§ 2, 9, 11 und 12 des<br />
Gaststättengesetzes ist schriftlich einzureichen. 2 Antragsteller haben die<br />
Angaben zu machen und die Unterlagen beizubringen, die für die<br />
Bearbeitung und Beurteilung des Antrags von Bedeutung sein können.<br />
3 Bei Anträgen auf Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis sind Angaben
und Unterlagen über die Person der Antragsteller und der Stellvertreter<br />
beizubringen.<br />
(2) 1 Die Entscheidung über den Antrag bedarf der Schriftform. 2 Die<br />
Entscheidung über die Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit nach<br />
§ 11 soll in Schriftform ergehen.<br />
Bay GastV § 3 Straußwirtschaften<br />
(1) Der Ausschank von selbsterzeugtem Wein bedarf für die Dauer von vier<br />
zusammenhängenden Monaten oder in zwei zusammenhängenden<br />
Zeitabschnitten von insgesamt vier Monaten im Jahr keiner Erlaubnis<br />
(Straußwirtschaft).<br />
(2) Wer Wein gewerbsmäßig in den Verkehr bringt, darf daneben nicht eine<br />
Straußwirtschaft betreiben.<br />
(3) Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, dürfen insgesamt<br />
nur vier Monate im Jahr eine Straußwirtschaft betreiben.<br />
Bay GastV § 4 Räumliche Voraussetzungen<br />
(1) Der Ausschank in einer Straußwirtschaft ist nur in Räumen zulässig, die<br />
am Ort des Weinbaubetriebs gelegen sind.<br />
(2) 1 Der Ausschank in einer Straußwirtschaft darf nicht in Räumen<br />
stattfinden, die eigens zu diesem Zweck angemietet sind. 2 In besonderen<br />
Härtefällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.<br />
(3) Eine Straußwirtschaft darf nicht mit einer anderen Schank- oder<br />
Speisewirtschaft oder mit einem Beherbergungsbetrieb verbunden<br />
werden.<br />
(4) In einer Straußwirtschaft dürfen nicht mehr als 40 Sitzplätze vorhanden<br />
sein.<br />
(5) Der Betrieb einer Straußwirtschaft kann untersagt und seine Fortsetzung<br />
verhindert werden, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 2 oder<br />
Nr. 3 des Gaststättengesetzes vorliegen.<br />
Bay GastV § 5 Verabreichen von Speisen, Nebenleistungen<br />
(1) In einer Straußwirtschaft dürfen nur kalte und einfach zubereitete warme<br />
Speisen verabreicht werden.<br />
(2) § 7 Abs. 2 Nr. 2 des Gaststättengesetzes findet keine Anwendung auf die<br />
Abgabe von Flaschenbier, von alkoholfreien Getränken, die der Straußwirt<br />
in seinem Betrieb nicht verabreicht, und von Süßwaren.<br />
Bay GastV § 6 Anzeige<br />
Wer eine Straußwirtschaft betreiben will, hat dies mindestens zwei Wochen vor<br />
Beginn des Betriebs anzuzeigen und dabei mitzuteilen<br />
1. den Zeitraum, während dessen der Ausschank stattfinden soll,<br />
2. den Ort und die Lage, aus denen die zur Herstellung des Weins verwendeten<br />
Trauben stammen, sowie den Ort, an dem die Trauben gekeltert worden sind<br />
und der Wein ausgebaut worden ist,<br />
3. die zum Betrieb der Straußwirtschaft bestimmten Räume.
Bay GastV § 7 Erlaubnisfreier Betrieb<br />
(1) 1 Soweit der Ausschank selbsterzeugter Getränke nach § 26 Abs. 1 Satz 1<br />
des Gaststättengesetzes in Verbindung mit Art. 2 des <strong>Gesetze</strong>s über<br />
Realgewerbeberechtigungen und den Ausschank eigener Erzeugnisse<br />
(BayRS 7100-1-W) keiner Erlaubnis bedarf, kann der Betrieb untersagt<br />
und seine Fortsetzung verhindert werden, wenn die Voraussetzungen des<br />
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 des Gaststättengesetzes vorliegen. 2 § 7 Abs. 2<br />
Nr. 2 des Gaststättengesetzes findet keine Anwendung auf die Abgabe von<br />
nicht selbsterzeugtem Flaschenbier, von alkoholfreien Getränken, die der<br />
Schankwirt in seinem Betrieb nicht verabreicht, und von Süßwaren.<br />
(2) 1 Soweit der Absatz selbsterzeugten Weins nach § 26 Abs. 1 Satz 1 des<br />
Gaststättengesetzes keiner Erlaubnis bedarf, darf der Ausschank des<br />
Weins nur innerhalb von vier zusammenhängenden Monaten oder in zwei<br />
zusammenhängenden Zeitabschnitten von insgesamt vier Monaten im Jahr<br />
erfolgen. 2 Neben Absatz 1 finden § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1,<br />
Abs. 3 und 4 und § 6 entsprechende Anwendung. 3 Auf Antrag können<br />
Befreiungen von den Verpflichtungen nach § 4 Abs. 1 bis 4 erteilt werden,<br />
wenn dies dem örtlichen Herkommen entspricht und die Einhaltung der<br />
Vorschrift im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde.<br />
Bay GastV § 8 Allgemeine Sperrzeit<br />
(1) Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche<br />
Vergnügungsstätten beginnt um 5 Uhr und endet um 6 Uhr.<br />
(2) In der Nacht zum 1. Januar ist die Sperrzeit aufgehoben.<br />
Bay GastV § 9 Ausnahmen für bestimmte Betriebsarten<br />
1 Für den Betrieb der Schank- oder Speisewirtschaften oder einer öffentlichen<br />
Vergnügungsstätte in Schiffen und Kraftfahrzeugen gilt keine Sperrzeit, wenn<br />
sich der Betrieb auf die Fahrgäste beschränkt. 2 Für auf Autobahnen mit<br />
Zeichen 448.1 Straßenverkehrsordnung angekündigte Autohöfe gilt keine<br />
allgemeine Sperrzeit; § 11 bleibt unberührt.<br />
Bay GastV § 10 Allgemeine Ausnahmen<br />
Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher<br />
Verhältnisse kann die Sperrzeit durch Verordnung verlängert oder aufgehoben<br />
werden.<br />
Bay GastV § 11 Ausnahme für einzelne Betriebe<br />
Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher<br />
Verhältnisse kann für einzelne Betriebe der Beginn der Sperrzeit bis höchstens<br />
19 Uhr vorverlegt und das Ende der Sperrzeit bis 8 Uhr hinausgeschoben oder<br />
die Sperrzeit befristet und widerruflich aufgehoben werden.<br />
Bay GastV § 12 Anzeigepflicht, Erlaubnis<br />
(1) 1 Soweit dies zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zum Schutz der<br />
Gäste erforderlich ist, können die Gewerbetreibenden verpflichtet werden,<br />
über die in ihrem Betrieb beschäftigten Personen innerhalb einer Woche<br />
nach Beginn der Beschäftigung Anzeige zu erstatten. 2 In der Anzeige sind
für die beschäftigten Personen anzugeben:<br />
1. Vorname und Familienname,<br />
2. Geburtsname, sofern dieser vom Familiennamen abweicht,<br />
3. Geburtsdatum und Geburtsort,<br />
4. Geburtsname der Mutter,<br />
5. Staatsangehörigkeit,<br />
6. letzter Aufenthaltsort und vorhergehende Beschäftigungsstelle,<br />
7. Beginn der Beschäftigung.<br />
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 kann die Beschäftigung<br />
von Personen für einzelne Betriebe von einer Erlaubnis abhängig gemacht<br />
werden.<br />
Bay GastV § 13 Ordnungswidrigkeiten<br />
Nach § 28 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 3 des Gaststättengesetzes kann mit einer<br />
Geldbuße bis zu fünftausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder<br />
fahrlässig<br />
1. über den in § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 1 Satz 2 erlaubten Umfang hinaus<br />
Waren abgibt,<br />
2. entgegen § 6 oder einer auf Grund des § 12 Abs. 1 begründeten<br />
Verpflichtung die Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht<br />
rechtzeitig erstattet,<br />
3. den Vorschriften des § 7 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 zuwiderhandelt,<br />
4. Personen ohne die auf Grund einer Verpflichtung nach § 12 Abs. 2<br />
erforderliche Erlaubnis beschäftigt.<br />
Bay GastV § 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft.<br />
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes<br />
(Gaststättenverordnung – GastV) vom 23. April 1971 (GVBl S. 150, BayRS<br />
7130-1-W), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 1983 (GVBl<br />
S. 102), außer Kraft.
Verordnung über Hunde mit<br />
gesteigerter Aggressivität und<br />
Gefährlichkeit (Bay GefHundeV)<br />
vom 10. Juli 1992 GVBl. S. 268, geändert durch Verordnung vom 4. September 2002 GVBl. S. 513,<br />
ber. S. 583 (FN BayRS 2011-2-7-I)<br />
Auf Grund von Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 des Landesstraf- und<br />
Verordnungsgesetzes – LStVG – (BayRS 2011-2-1), zuletzt geändert durch<br />
Gesetz vom 10. Juni 1992 (GVBl S. 152), erläßt das Bayerische<br />
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:<br />
Bay GefHundeV § 1<br />
(1) Bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren<br />
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden wird die Eigenschaft<br />
als Kampfhunde stets vermutet:<br />
- Pit-Bull<br />
- Bandog<br />
- American Staffordshire Terrier<br />
- Staffordshire Bullterrier<br />
- Tosa-Inu.<br />
(2) 1 Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigenschaft als<br />
Kampfhunde vermutet, solange nicht der zuständigen Behörde für die<br />
einzelnen Hunde nachgewiesen wird, dass diese keine gesteigerte<br />
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren<br />
aufweisen:<br />
- Alano<br />
- American Bulldog<br />
- Bullmastiff<br />
- Bullterrier<br />
- Cane Corso<br />
- Dog Argentino<br />
- Dogue de Bordeaux<br />
- Fila Brasileiro<br />
- Mastiff<br />
- Mastin Espanol<br />
- Mastino Napoletano<br />
- Perro de Presa Canario (Dogo Canario)<br />
- Perro de Presa Mallorquin<br />
- Rottweiler.<br />
2<br />
Dies gilt auch für Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit<br />
anderen als den von Absatz 1 erfaßten Hunden.<br />
(3) Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hundes als<br />
Kampfhund im Einzelfall aus seiner Ausbildung mit dem Ziel einer<br />
gesteigerten Aggressivität oder Gefährlichkeit ergeben.
Bay GefHundeV § 2<br />
Diese Verordnung tritt am 1. August 1992 in Kraft.
Gesetz über die Wahl der<br />
Gemeinderäte, der Bürgermeister, der<br />
Kreistage und der Landräte (Bay<br />
GLKrWG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung v. 7. November 2006 GVBl. S. 834 (FN BayRS 2021-1/2-2-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Bestimmungen<br />
ABSCHNITT I Wahlrecht, Stimmrecht<br />
Art. 1 Wahlrecht<br />
Art. 2 Ausschluss vom Wahlrecht<br />
Art. 3 Stimmrecht<br />
ABSCHNITT II Wahlorgane, Beschwerdeausschuss<br />
Art. 4 Wahlorgane<br />
Art. 5 Wahlleiter, Wahlausschuss<br />
Art. 6 Wahlvorsteher, Wahlvorstand, Briefwahlvorsteher, Briefwahlvorstand<br />
Art. 7 Wahlehrenamt<br />
Art. 7 a Gemeindefreie Gebiete<br />
Art. 8 Beschwerdeausschuss<br />
ABSCHNITT III Vorbereitung und Durchführung der Wahl, Sicherung der<br />
Wahlfreiheit<br />
Art. 9 Wahltag<br />
Art. 10 Zusammentreffen mehrerer Wahlen und Abstimmungen<br />
Art. 11 Wahlkreis, Stimmbezirke<br />
Art. 12 Wählerverzeichnisse
Art. 13 Erteilung von Wahlscheinen<br />
Art. 14 Briefwahl<br />
Art. 15 Dauer der Abstimmung<br />
Art. 16 Stimmzettel, Wahlscheine, Briefwahlunterlagen<br />
Art. 17 Grundsatz der Öffentlichkeit<br />
Art. 18 Abstimmungsgeheimnis<br />
Art. 19 Feststellung des Wahlergebnisses<br />
Art. 20 Unzulässige Beeinflussung, unzulässige Veröffentlichung von<br />
Befragungen, Wahlgeheimnis<br />
ZWEITER TEIL Wahl der Gemeinderatsmitglieder und der Kreisräte<br />
ABSCHNITT I Grundsätze<br />
Art. 21 Wählbarkeit für das Amt des Gemeinderatsmitglieds und des Kreisrats<br />
Art. 22 Wahlrechtsgrundsätze<br />
Art. 23 Wahlzeit<br />
ABSCHNITT II Wahlvorschläge<br />
Art. 24 Wahlvorschlagsrecht<br />
Art. 25 Inhalt und Form der Wahlvorschläge<br />
Art. 26 Verbindung von Wahlvorschlägen<br />
Art. 27 Unterstützung von Wahlvorschlägen<br />
Art. 28 Eintragung in Unterstützungslisten, Eintragungsscheine<br />
Art. 29 Aufstellung der sich bewerbenden Personen<br />
Art. 30 Beauftragte für die Wahlvorschläge<br />
Art. 31 Einreichung der Wahlvorschläge
Art. 32 Zulassung der Wahlvorschläge<br />
Art. 33 Bekanntmachung und Reihenfolge der Wahlvorschläge<br />
ABSCHNITT III Verhältniswahl<br />
Art. 34 Stimmenzahl und Vergabe der Stimmen<br />
Art. 35 Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge<br />
Art. 36 Verteilung der Sitze an die sich bewerbenden Personen<br />
Art. 37 Listennachfolger<br />
ABSCHNITT IV Mehrheitswahl<br />
Art. 38 Mehrheitswahl<br />
DRITTER TEIL Wahl des ersten Bürgermeisters und des Landrats<br />
ABSCHNITT I Grundsätze<br />
Art. 39 Wählbarkeit für das Amt des ersten Bürgermeisters und des Landrats<br />
Art. 40 Wahlrechtsgrundsätze<br />
Art. 41 Amtszeit des ehrenamtlichen ersten Bürgermeisters<br />
Art. 42 Amtszeit des berufsmäßigen ersten Bürgermeisters und des Landrats<br />
Art. 43 Beginn und Verlängerung der Amtszeit, Beauftragter<br />
Art. 44 Festsetzung eines abweichenden Wahltermins<br />
ABSCHNITT II Wahlvorschläge, Wahlergebnis<br />
Art. 45 Wahlvorschläge<br />
Art. 46 Wahlergebnis, Stichwahl, Wiederholungswahl<br />
VIERTER TEIL Annahme der Wahl, Amtsverlust<br />
Art. 47 Annahme der Wahl<br />
Art. 48 Amtshindernisse, Amtsverlust, Nachrücken
Art. 49 Amtsverlust bei Partei- oder Vereinsverbot<br />
FÜNFTER TEIL Überprüfung der Wahl<br />
Art. 50 Wahlprüfung<br />
Art. 51 Wahlanfechtung<br />
Art. 52 Rechtsweg, Nachwahl, Neuwahl<br />
SECHSTER TEIL Kosten, Wahlstatistik, Vollzugsvorschriften<br />
Art. 53 Freistellungs- und Erstattungsanspruch<br />
Art. 54 Kosten<br />
Art. 55 Feststellung der Einwohnerzahl, Fristen und Termine<br />
Art. 56 Wahlstatistik<br />
Art. 57 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 58 Vollzugsvorschriften<br />
SIEBTER TEIL Schlussbestimmungen<br />
Art. 59 Schriftform<br />
Art. 60 Inkrafttreten, Aufhebung anderer <strong>Gesetze</strong><br />
Art. 61 Übergangsregelung<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Bestimmungen<br />
ABSCHNITT I Wahlrecht, Stimmrecht<br />
Bay GLKrWG Art. 1 Wahlrecht<br />
(1) Wahlberechtigt bei Gemeinde- und Landkreiswahlen sind alle Personen,<br />
die am Wahltag<br />
1. Unionsbürger sind,<br />
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,<br />
3. sich seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis mit dem Schwerpunkt<br />
ihrer Lebensbeziehungen aufhalten,<br />
4. nicht nach Art. 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
(2) Unionsbürger sind alle Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des<br />
Grundgesetzes sowie die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten<br />
der Europäischen Union.<br />
(3) 1 Der Aufenthalt mit dem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen wird dort<br />
vermutet, wo die Person gemeldet ist. 2 Ist eine Person in mehreren<br />
Gemeinden gemeldet, wird dieser Aufenthalt dort vermutet, wo sie mit der<br />
Hauptwohnung gemeldet ist. 3 Bei der Berechnung der Frist nach Absatz 1<br />
Nr. 3 wird der Tag der Aufenthaltsnahme in die Frist einbezogen.<br />
(4) Wer das Wahlrecht in einer Gemeinde oder in einem Landkreis infolge<br />
Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in<br />
den Wahlkreis zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wahlberechtigt.<br />
Bay GLKrWG Art. 2 Ausschluss vom Wahlrecht<br />
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist,<br />
1. wer infolge deutschen Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,<br />
2. derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer<br />
nach deutschem Recht nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies<br />
gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und<br />
§ 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht<br />
erfasst,<br />
3. wer sich auf Grund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des<br />
Strafgesetzbuchs in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet.<br />
Bay GLKrWG Art. 3 Stimmrecht<br />
(1) Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in einem Wählerverzeichnis<br />
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.<br />
(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Stimmbezirk<br />
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.<br />
(3) Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben<br />
1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Stimmbezirk der<br />
Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,<br />
2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Stimmbezirk<br />
innerhalb des Landkreises, zu dem die Gemeinde gehört, die den<br />
Wahlschein ausgestellt hat; gilt der Wahlschein zugleich für<br />
Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde<br />
erfolgen,<br />
3. durch Briefwahl.<br />
(4) 1 Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur<br />
persönlich ausüben. 2 Ist sie des Lesens unkundig oder wegen einer<br />
körperlichen Behinderung nicht in der Lage, ihr Stimmrecht auszuüben,<br />
kann sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen.<br />
ABSCHNITT II Wahlorgane, Beschwerdeausschuss<br />
Bay GLKrWG Art. 4 Wahlorgane<br />
(1) 1 Die Wahlorgane sind Organe der Gemeinde oder des Landkreises. 2 Sie<br />
sind an Weisungen der übrigen Organe der Gebietskörperschaften nicht
gebunden. 3 Die Bestimmungen über die Fachaufsicht bleiben unberührt.<br />
4<br />
Eine Ersatzvornahme nach Art. 113 GO und Art. 99 LKrO ist ohne<br />
vorhergehende Weisung und Androhung mit Fristsetzung zulässig. 5 Die<br />
Gemeinde oder der Landkreis ist vor der Ersatzvornahme anzuhören;<br />
dabei ist Gelegenheit zu geben, binnen einer angemessenen Frist<br />
rechtmäßig zu entscheiden.<br />
(2) Wahlorgane sind<br />
1. ein Wahlleiter und ein Wahlausschuss für die Gemeindewahlen sowie<br />
ein Wahlleiter und ein Wahlausschuss für die Landkreiswahlen,<br />
2. ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für jeden Stimmbezirk,<br />
3. ein oder mehrere Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstände.<br />
(3) Niemand darf die Tätigkeit von mehreren Wahlorganen ausüben oder in<br />
mehr als einem Wahlorgan Mitglied oder stellvertretende Person sein.<br />
(4) 1 Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 2 Bei<br />
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds.<br />
(5) 1 Die Amtszeit der Wahlorgane beginnt mit ihrer Berufung. 2 Sie endet mit<br />
dem Beginn der Wahlzeit des Gemeinderats oder des Kreistags; bei einer<br />
nicht mit der Gemeinderatswahl verbundenen Wahl des ersten<br />
Bürgermeisters oder bei einer nicht mit der Kreistagswahl verbundenen<br />
Wahl des Landrats endet sie mit dem Beginn von dessen Amtszeit.<br />
Bay GLKrWG Art. 5 Wahlleiter, Wahlausschuss<br />
(1) 1 Der Gemeinderat beruft den ersten Bürgermeister, einen der weiteren<br />
Bürgermeister, einen der weiteren Stellvertreter, ein sonstiges<br />
Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem Kreis der Bediensteten<br />
der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft zum Wahlleiter für die<br />
Gemeindewahlen. 2 Der Kreistag oder an seiner Stelle der Kreisausschuss<br />
beruft den Landrat, den Stellvertreter des Landrats, einen seiner weiteren<br />
Stellvertreter, einen sonstigen Kreisrat oder eine Person aus dem Kreis<br />
der Bediensteten des Landratsamts zum Wahlleiter für die<br />
Landkreiswahlen. 3 Außerdem wird aus diesem Personenkreis zugleich eine<br />
stellvertretende Person berufen. 4 Zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen<br />
oder zu dessen Stellvertretung kann nicht berufen werden, wer bei der<br />
Wahl zum ersten Bürgermeister oder zum Gemeinderat mit seinem<br />
Einverständnis als sich bewerbende Person aufgestellt worden ist, für<br />
diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung geleitet hat oder für diese<br />
Wahlen Beauftragter eines Wahlvorschlags oder dessen Stellvertretung<br />
ist; entsprechendes gilt bei Landkreiswahlen. 5 Die Berufung ist der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.<br />
(2) 1 Mitglieder des Wahlausschusses sind der Wahlleiter als vorsitzendes<br />
Mitglied und vier von ihm berufene Wahlberechtigte als Beisitzer. 2 Für<br />
jeden Beisitzer beruft er eine stellvertretende Person. 3 Bei der Auswahl<br />
der Beisitzer sind nach Möglichkeit die Parteien und die Wählergruppen in<br />
der Reihenfolge der bei der letzten Gemeinderats- oder Kreistagswahl<br />
erhaltenen Stimmenzahlen zu berücksichtigen und die von ihnen<br />
rechtzeitig vorgeschlagenen Wahlberechtigten zu berufen. 4 Abs. 1 Satz 4<br />
gilt entsprechend. 5 Keine Partei oder Wählergruppe darf durch mehrere<br />
Beisitzer vertreten sein.
(3) 1 Der Wahlleiter bestellt einen Schriftführer für den Wahlausschuss.<br />
2 Dieser ist nur stimmberechtigt, wenn er zugleich Beisitzer ist.<br />
Bay GLKrWG Art. 6 Wahlvorsteher, Wahlvorstand, Briefwahlvorsteher,<br />
Briefwahlvorstand<br />
(1) Die Wahlvorsteher, die Briefwahlvorsteher und ihre Stellvertretung werden<br />
von der Gemeinde berufen.<br />
(2) 1 Mitglieder der Wahlvorstände (Briefwahlvorstände) sind der<br />
Wahlvorsteher (Briefwahlvorsteher) als vorsitzendes Mitglied, eine mit<br />
seiner Stellvertretung betraute Person sowie mindestens drei Beisitzer, die<br />
die Gemeinde entsprechend Art. 5 Abs. 2 Satz 3 aus dem Kreis der in der<br />
Gemeinde Wahlberechtigten oder der wahlberechtigten<br />
Gemeindebediensteten beruft. 2 Die Gemeinde bestellt aus dem Kreis der<br />
Beisitzer einen Schriftführer und dessen Stellvertretung.<br />
(3) Bildet die Gemeinde nur einen Stimmbezirk, übernimmt der Wahlvorstand<br />
die Geschäfte des Briefwahlvorstands.<br />
(4) 1 Die Gemeinden sind befugt, personenbezogene Daten von<br />
Wahlberechtigten zum Zweck ihrer Berufung zu Mitgliedern von<br />
Wahlvorständen und Briefwahlvorständen zu erheben, zu verarbeiten und<br />
zu nutzen. 2 Zu diesem Zweck dürfen personenbezogene Daten von<br />
Wahlberechtigten, die zur Tätigkeit in Wahlvorständen und<br />
Briefwahlvorständen geeignet sind, auch für künftige Abstimmungen<br />
verarbeitet und genutzt werden, sofern die betroffene Person der<br />
Verarbeitung oder Nutzung nicht widersprochen hat. 3 Die betroffene<br />
Person ist über das Widerspruchsrecht zu unterrichten. 4 Im Einzelnen<br />
dürfen folgende Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden:<br />
Familienname, Vorname, akademische Grade, Tag der Geburt,<br />
Anschriften, Telefonnummern, Zahl der Berufungen zu einem Mitglied der<br />
Wahlvorstände und der Briefwahlvorstände und die dabei ausgeübte<br />
Funktion.<br />
(5) 1 Auf Ersuchen der Gemeinde sind zur Sicherstellung der Durchführung der<br />
Wahl die Behörden des Freistaates Bayern, der Gemeinden, der<br />
Landkreise und der Bezirke sowie der sonstigen der Aufsicht des<br />
Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen<br />
Rechts verpflichtet, aus dem Kreis ihrer Bediensteten unter Angabe von<br />
Familienname, Vorname, akademischen Graden, Tag der Geburt,<br />
Anschriften und Telefonnummern zum Zweck der Berufung als Mitglieder<br />
der Wahlvorstände und der Briefwahlvorstände wahlberechtigte Personen<br />
zu benennen, die im Gebiet der ersuchenden Gemeinde wohnen. 2 Die<br />
ersuchte Stelle hat die Betroffenen über die ermittelten Daten und den<br />
Empfänger zu benachrichtigen.<br />
Bay GLKrWG Art. 7 Wahlehrenamt<br />
(1) Bei Wahlehrenämtern entscheidet die Gemeinde, beim Wahlausschuss für<br />
die Landkreiswahlen der Landkreis, ob ein wichtiger Grund nach Art. 19<br />
GO oder Art. 13 LKrO vorliegt.
(2) 1 Die Wahlorgane, ihre Mitglieder, die Stellvertreter und die Schriftführer<br />
sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. 2 Im<br />
Übrigen gelten Art. 20 GO und Art. 14 LKrO.<br />
(3) Die Gemeinde, beim Wahlausschuss für die Landkreiswahlen der<br />
Landkreis, kann eine angemessene Entschädigung gewähren.<br />
Bay GLKrWG Art. 7 a Gemeindefreie Gebiete<br />
In gemeindefreien Gebieten werden bei Landkreiswahlen die<br />
Gemeindeaufgaben von derjenigen kreisangehörigen Gemeinde<br />
wahrgenommen, die für das gemeindefreie Gebiet als Meldebehörde zuständig<br />
ist.<br />
Bay GLKrWG Art. 8 Beschwerdeausschuss<br />
1 2<br />
Bei jeder Regierung wird ein Beschwerdeausschuss gebildet. Dieser besteht<br />
aus<br />
1. dem Regierungspräsidenten oder einem von ihm bestellten Mitglied mit der<br />
Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst oder für das Richteramt als<br />
vorsitzendem Mitglied,<br />
2. einem vom Präsidenten des für den Regierungsbezirk zuständigen<br />
Verwaltungsgerichts benannten Mitglied aus dem Kreis der berufsmäßigen<br />
Richter dieses Gerichts und<br />
3. einem vom Präsidenten des für den Sitz der Regierung zuständigen<br />
Oberlandesgerichts benannten Mitglied aus dem Kreis der berufsmäßigen<br />
Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit.<br />
3<br />
Für die Mitglieder nach Nrn. 2 und 3 ist je ein stellvertretendes Mitglied zu<br />
benennen. 4 Die Benennung gilt für die Dauer von sechs Jahren; sie kann aus<br />
wichtigem Grund geändert werden.<br />
ABSCHNITT III Vorbereitung und Durchführung der Wahl,<br />
Sicherung der Wahlfreiheit<br />
Bay GLKrWG Art. 9 Wahltag<br />
(1) Wahlen finden an einem Sonntag statt.<br />
(2) 1 Die allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen finden jeweils an<br />
einem Sonntag im Monat März statt. 2 Die Staatsregierung setzt<br />
spätestens sechs Monate vor dem Wahltag den Tag für die Wahlen fest.<br />
Bay GLKrWG Art. 10 Zusammentreffen mehrerer Wahlen und<br />
Abstimmungen<br />
(1) 1 Am Tag einer Bezirkswahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl,<br />
einer Abstimmung über einen Volksentscheid oder während der<br />
Eintragungsfrist für ein Volksbegehren dürfen keine Gemeinde- oder<br />
Landkreiswahlen oder sonstige Abstimmungen stattfinden. 2 Am Tag einer<br />
Gemeinde- oder Landkreiswahl dürfen keine sonstigen Abstimmungen<br />
stattfinden.<br />
(2) 1 Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums des<br />
Innern. 2 Sie können zugelassen werden, wenn gegen die Durchführbarkeit
der Wahl oder der Abstimmung keine Bedenken bestehen und eine<br />
Beeinflussung der Wahl oder der Abstimmung nicht zu befürchten ist.<br />
Bay GLKrWG Art. 11 Wahlkreis, Stimmbezirke<br />
(1) Bei Gemeindewahlen bildet jede Gemeinde, bei Landkreiswahlen bildet<br />
jeder Landkreis einen Wahlkreis.<br />
(2) 1 Wahlkreise können in Stimmbezirke eingeteilt werden. 2 Die Einteilung<br />
erfolgt jeweils durch die Gemeinde. 3 Gemeinden mit mehr als 2 500<br />
Einwohnern sind in Stimmbezirke einzuteilen.<br />
(3) 1 Kein Stimmbezirk darf mehr als 2 500 Wahlberechtigte umfassen. 2 Die<br />
Zahl der Wahlberechtigten eines Stimmbezirks darf nicht so gering sein,<br />
dass erkennbar wird, wie einzelne Personen gewählt haben.<br />
Bay GLKrWG Art. 12 Wählerverzeichnisse<br />
(1) Die Gemeinden legen für jeden allgemeinen Stimmbezirk ein neues<br />
Wählerverzeichnis an und tragen darin die Wahlberechtigten von Amts<br />
wegen oder auf Antrag ein.<br />
(2) 1 Die Gemeinden halten die Wählerverzeichnisse an den Werktagen vom<br />
20. bis zum 16. Tag vor dem Wahltag zur Einsicht bereit (Einsichtsfrist).<br />
2<br />
Einsicht nehmen darf zum Prüfen der Richtigkeit oder der Vollständigkeit<br />
des Wählerverzeichnisses jede wahlberechtigte Person<br />
1. zu den zu ihrer Person eingetragenen Daten,<br />
2. zu Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen,<br />
wenn sie Tatsachen glaubhaft macht, aus denen sich insoweit eine<br />
Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses<br />
ergeben kann. Dieses Recht besteht nicht hinsichtlich der Daten von<br />
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß<br />
Art. 34 Abs. 5 des Meldegesetzes eingetragen ist.<br />
(3) 1 Beschwerden wegen der Richtigkeit oder der Vollständigkeit der<br />
Wählerverzeichnisse können innerhalb der Einsichtsfrist, gegen die<br />
Ablehnung von Anträgen auf Eintragung in das Wählerverzeichnis bis zum<br />
13. Tag vor dem Wahltag schriftlich oder zur Niederschrift bei der<br />
Gemeinde eingelegt werden. 2 Falls diese nicht abhilft, hat sie die<br />
Beschwerde unverzüglich, jedoch spätestens bis zum zehnten Tag vor<br />
dem Wahltag, der Rechtsaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorzulegen.<br />
3<br />
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat spätestens am vierten Tag vor dem<br />
Wahltag über die Beschwerde zu entscheiden. 4 Gegen die Entscheidung<br />
der Rechtsaufsichtsbehörde ist der Verwaltungsrechtsweg nach der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegeben. 5 Das Vorverfahren nach<br />
§ 68 VwGO entfällt. 6 Die Klage hat für die Durchführung des sonstigen<br />
Wahlverfahrens keine aufschiebende Wirkung.<br />
Bay GLKrWG Art. 13 Erteilung von Wahlscheinen<br />
(1) Wer glaubhaft macht, verhindert zu sein, in dem Stimmbezirk<br />
abzustimmen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist, oder wer<br />
aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis<br />
nicht aufgenommen worden ist, erhält von der Gemeinde auf Antrag einen<br />
Wahlschein.
(2) 1 Gegen die Versagung eines Wahlscheins kann spätestens am sechsten<br />
Tag vor dem Wahltag Beschwerde an die Rechtsaufsichtsbehörde erhoben<br />
werden. 2 Diese hat spätestens am vierten Tag vor dem Wahltag über die<br />
Beschwerde zu entscheiden. 3 Art. 12 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 gelten<br />
entsprechend.<br />
Bay GLKrWG Art. 14 Briefwahl<br />
(1) 1 Bei der Briefwahl hat die stimmberechtigte Person der Gemeinde im<br />
verschlossenen Wahlbriefumschlag<br />
1. den Wahlschein und<br />
2. die Stimmzettel im verschlossenen Wahlumschlag<br />
zu übersenden. 2 Der Wahlbrief muss bei der Gemeinde, die den<br />
Wahlschein ausgestellt hat, spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen.<br />
3<br />
Art. 15 Abs. 2 gilt entsprechend.<br />
(2) Auf dem Wahlschein hat die wählende Person oder die Person ihres<br />
Vertrauens an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich<br />
oder gemäß dem erklärten Willen der wählenden Person gekennzeichnet<br />
worden sind.<br />
Bay GLKrWG Art. 15 Dauer der Abstimmung<br />
(1) Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.<br />
(2) Trifft eine Gemeinde- oder eine Landkreiswahl mit einer anderen Wahl<br />
zusammen, deren Abstimmung über 18 Uhr hinaus dauert, endet die<br />
Abstimmung mit der für die andere Wahl bestimmten Uhrzeit.<br />
(3) In Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk bilden, kann bei<br />
Gemeindewahlen die Abstimmung vorzeitig beendet werden, wenn alle<br />
Stimmberechtigten abgestimmt haben und nicht zugleich andere Wahlen<br />
oder Abstimmungen stattfinden.<br />
Bay GLKrWG Art. 16 Stimmzettel, Wahlscheine, Briefwahlunterlagen<br />
1 Für die Gemeindewahlen und die Landkreiswahlen sind in ganz Bayern<br />
einheitliche amtliche Stimmzettel zu verwenden. 2 Die Stimmzettel für die<br />
Gemeindewahlen sind von der Gemeinde, die Stimmzettel für die<br />
Landkreiswahlen vom Landkreis zu beschaffen. 3 Für die Beschaffung der<br />
Wahlscheine und der Briefwahlunterlagen (Wahlbriefumschläge,<br />
Wahlumschläge und Merkblätter) sorgen bei den Gemeindewahlen und bei den<br />
mit diesen verbundenen Landkreiswahlen die Gemeinden, bei den sonstigen<br />
Landkreiswahlen die Landkreise.<br />
Bay GLKrWG Art. 17 Grundsatz der Öffentlichkeit<br />
(1) Die Durchführung der Abstimmung ist öffentlich.<br />
(2) 1 Die Wahlausschüsse, die Wahlvorstände und die Briefwahlvorstände<br />
verhandeln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sitzung, soweit nicht<br />
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte<br />
Ansprüche Einzelner entgegenstehen. 2 Über den Ausschluss der<br />
Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden.<br />
3<br />
Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der
Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung<br />
weggefallen sind.<br />
(3) 1 Der Wahlausschuss, der Wahlvorstand und der Briefwahlvorstand können<br />
Personen, die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum, dem<br />
Abstimmungsraum oder dem Auszählraum verweisen.<br />
2<br />
Stimmberechtigten im Abstimmungsraum ist zuvor Gelegenheit zur<br />
Stimmabgabe zu geben.<br />
Bay GLKrWG Art. 18 Abstimmungsgeheimnis<br />
1 Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass die abstimmende Person die<br />
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen kann. 2 Für die Aufnahme der<br />
Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden, die die Wahrung des<br />
Abstimmungsgeheimnisses sicherstellen.<br />
Bay GLKrWG Art. 19 Feststellung des Wahlergebnisses<br />
(1) Der Wahlvorstand leitet die Durchführung der Abstimmung, entscheidet<br />
über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen und stellt das<br />
Abstimmungsergebnis für den Stimmbezirk fest.<br />
(2) 1 Der Briefwahlvorstand entscheidet über die Zulassung oder die<br />
Zurückweisung der Wahlbriefe. 2 Er entscheidet über die Gültigkeit der<br />
abgegebenen Stimmen und stellt das Ergebnis der Briefwahl für seinen<br />
Bereich fest. 3 Wurden weniger als 50 Wahlbriefe zugelassen, entscheidet<br />
ein von der Gemeinde bestimmter Wahlvorstand über die Gültigkeit der<br />
abgegebenen Stimmen aus der Briefwahl zusammen mit den im<br />
Abstimmungsraum abgegebenen Stimmen und stellt ein gemeinsames<br />
Ergebnis fest.<br />
(3) 1 Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis für den Wahlkreis fest. 2 Er<br />
ist befugt die Stimmergebnisse einschließlich der Auswertung der<br />
Stimmzettel und der Entscheidungen der Wahlvorstände und der<br />
Briefwahlvorstände sowie die Entscheidungen über die Wählbarkeit zu<br />
berichtigen. 3 Der Wahlleiter verkündet das Wahlergebnis.<br />
Bay GLKrWG Art. 20 Unzulässige Beeinflussung, unzulässige<br />
Veröffentlichung von Befragungen, Wahlgeheimnis<br />
(1) Während der Abstimmungszeit ist in und an dem Gebäude, in dem sich<br />
der Abstimmungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu<br />
dem Gebäude jede Beeinflussung der Abstimmenden durch Wort, Ton,<br />
Schrift, Bild oder auf andere Weise, insbesondere durch Umfragen oder<br />
durch Unterschriftensammlungen, sowie jede Behinderung oder erhebliche<br />
Belästigung der Abstimmenden verboten.<br />
(2) Vor Ablauf der Abstimmungszeit dürfen Ergebnisse von Befragungen über<br />
den Inhalt der Stimmrechtsausübung, die nach der Stimmabgabe<br />
vorgenommen wurden, nicht veröffentlicht werden.<br />
(3) Den mit der Durchführung der Wahl betrauten Behörden und den<br />
Wahlorganen ist es untersagt, den Inhalt der Stimmrechtsausübung in<br />
irgendeiner Weise zu beeinflussen oder das Wahlgeheimnis zu verletzen.
ZWEITER TEIL Wahl der Gemeinderatsmitglieder und der Kreisräte<br />
ABSCHNITT I Grundsätze<br />
Bay GLKrWG Art. 21 Wählbarkeit für das Amt des<br />
Gemeinderatsmitglieds und des Kreisrats<br />
(1) Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds oder eines Kreisrats ist jede<br />
Person wählbar, die am Wahltag<br />
1. Unionsbürger im Sinn des Art. 1 Abs. 2 ist,<br />
2. das 18. Lebensjahr vollendet hat,<br />
3. sich seit mindestens sechs Monaten im Wahlkreis mit dem Schwerpunkt<br />
ihrer Lebensbeziehungen aufhält; Art. 1 Abs. 3 und 4 gelten<br />
entsprechend.<br />
(2) Nicht wählbar ist, wer am Wahltag<br />
1. nach Art. 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,<br />
2. infolge deutschen Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur<br />
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt,<br />
3. sich wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in<br />
Sicherungsverwahrung befindet oder<br />
4. sich als<br />
a) erster Bürgermeister in seiner Gemeinde als ehrenamtliches<br />
Gemeinderatsmitglied,<br />
b) Oberbürgermeister einer kreisfreien Gemeinde als Kreisrat,<br />
c) Landrat in einer kreisfreien Gemeinde als ehrenamtliches<br />
Gemeinderatsmitglied,<br />
d) Landrat als Kreisrat<br />
bewirbt, wenn seine Amtszeit nicht mit der Wahlzeit des zu wählenden<br />
Gemeinderats oder Kreistags übereinstimmt. Das gilt nicht, wenn im<br />
Einzelfall aus besonderen Umständen darauf geschlossen werden kann,<br />
dass das Ehrenamt tatsächlich angetreten wird.<br />
Bay GLKrWG Art. 22 Wahlrechtsgrundsätze<br />
(1) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder und die Kreisräte werden in<br />
allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl nach den<br />
Grundsätzen eines verbesserten Verhältniswahlrechts gewählt.<br />
(2) Wird in einem Wahlkreis kein oder nur ein Wahlvorschlag zugelassen,<br />
findet Mehrheitswahl statt.<br />
Bay GLKrWG Art. 23 Wahlzeit<br />
(1) Die Wahlzeit der bei allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen neu<br />
gewählten Gemeinderäte und Kreistage beträgt sechs Jahre und beginnt<br />
jeweils an dem der Wahl folgenden 1. Mai.<br />
(2) 1 Endet die Wahlzeit im Sinn des Abs. 1 durch bestandskräftige<br />
Entscheidung vorzeitig, wird für den Rest der Wahlzeit neu gewählt. 2 Liegt<br />
das vorzeitige Ende jedoch innerhalb der letzten zwei Jahre der Wahlzeit,<br />
wird der Gemeinderat oder der Kreistag bis zum Ablauf der Wahlzeit der<br />
nächsten allgemeinen Wahlen neu gewählt. 3 Die Wahlen sollen innerhalb<br />
von drei Monaten nach Bestandskraft der Entscheidung stattfinden; den
Wahltermin setzt die Rechtsaufsichtsbehörde fest. 4 Wahlen, die zwischen<br />
dem einer allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahl vorausgehenden<br />
1. Dezember und den allgemeinen Wahlen abzuhalten wären, finden<br />
zusammen mit diesen Wahlen statt. 5 Die Wahlzeit des neugewählten<br />
Gemeinderats oder des Kreistags beginnt in den Fällen der Sätze 1 bis 3<br />
mit der Annahme der Wahl durch alle Mitglieder, spätestens am 29. Tag<br />
nach dem Wahltag.<br />
(3) Bis zum Zusammentritt des neugewählten Gemeinderats führt der erste<br />
Bürgermeister die Geschäfte, bis zum Zusammentritt des neugewählten<br />
Kreistags der Landrat.<br />
ABSCHNITT II Wahlvorschläge<br />
Bay GLKrWG Art. 24 Wahlvorschlagsrecht<br />
(1) 1 Wahlvorschläge können von Parteien und von Wählergruppen eingereicht<br />
werden (Wahlvorschlagsträger). 2 Der Begriff der Partei richtet sich nach<br />
dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz).<br />
3<br />
Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen<br />
natürlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeinde- oder an<br />
Landkreiswahlen zu beteiligen. 4 Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien<br />
und Wählergruppen, die im Gemeinderat oder im Kreistag seit dessen<br />
letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags<br />
ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren.<br />
(2) 1 Die Prüfung, ob eine Wählergruppe mit einer bereits im letzten<br />
Gemeinderat oder im letzten Kreistag auf Grund eines eigenen<br />
Wahlvorschlags vertretenen Wählergruppe übereinstimmt, richtet sich<br />
nach folgenden Gesichtspunkten:<br />
1. War eine organisierte Wählergruppe bereits bei Einreichung des<br />
Wahlvorschlags zur vorhergehenden Wahl nach bürgerlichem Recht<br />
organisiert, gelten die Grundsätze des bürgerlichen Rechts.<br />
2. In den übrigen Fällen ist die Übereinstimmung dann gegeben, wenn<br />
mindestens sechs Wahlberechtigte den jetzigen Wahlvorschlag<br />
unterzeichnet haben oder sich auf ihm bewerben, die auch den früheren<br />
Wahlvorschlag unterzeichnet oder sich auf ihm beworben haben. Erfüllen<br />
mehrere Wählergruppen diese Voraussetzungen, stimmt diejenige<br />
Wählergruppe mit der im letzten Gemeinderat oder im letzten Kreistag<br />
vertretenen Wählergruppe überein, die die größte Anzahl an<br />
übereinstimmenden unterzeichnenden oder sich bewerbenden Personen<br />
hat.<br />
2<br />
Wird ein Nachweis über die Organisation bei der Einreichung des<br />
Wahlvorschlags nicht erbracht, gilt die Wählergruppe als nicht organisiert.<br />
(3) 1 Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.<br />
2<br />
Ein Mehrfachauftreten eines Wahlvorschlagsträgers liegt nur dann vor,<br />
wenn<br />
1. ein Wahlvorschlagsträger mehrere Wahlvorschläge mit demselben<br />
Kennwort einreicht,<br />
2. ein Wahlvorschlagsträger mehrere Wahlvorschläge für verschiedene<br />
Teile des Wahlkreises einreicht und die räumliche Trennung im Kennwort
zum Ausdruck bringt,<br />
3. mehrere Wahlvorschläge von derselben Versammlung aufgestellt<br />
worden sind,<br />
4. ein Wahlvorschlagsträger durch seine Organe einen weiteren<br />
Wahlvorschlag sonst beherrschend betreibt.<br />
3 Das Handeln von Untergliederungen eines Wahlvorschlagsträgers ist<br />
diesem zuzurechnen. 4 Der Wahlvorschlagsträger hat nach Aufforderung<br />
dem Wahlleiter mitzuteilen, für welchen Wahlvorschlag er sich<br />
entscheidet, falls ein Mehrfachauftreten festgestellt wird; unterlässt er<br />
diese Mitteilung, sind die Wahlvorschläge für ungültig zu erklären.<br />
Bay GLKrWG Art. 25 Inhalt und Form der Wahlvorschläge<br />
(1) 1 Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben<br />
sein, die am 41. Tag vor dem Wahltag wahlberechtigt und nicht sich<br />
bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags sind. 2 Jede<br />
Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; Art. 24 Abs. 3 Satz 4<br />
gilt entsprechend.<br />
(2) 1 Jeder Wahlvorschlag darf höchstens so viele sich bewerbende Personen<br />
enthalten, wie ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder oder Kreisräte zu<br />
wählen sind. 2 In Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnern und bei<br />
Mehrheitswahl kann die Zahl der sich bewerbenden Personen im<br />
Wahlvorschlag bis auf das Doppelte der zu wählenden ehrenamtlichen<br />
Gemeinderatsmitglieder erhöht werden.<br />
(3) 1 Jede sich bewerbende Person darf nur für einen Wahlvorschlag<br />
aufgestellt werden. 2 Sie muss hierzu ihre Zustimmung schriftlich erteilen;<br />
Art. 24 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. 3 Die Zustimmung kann nach<br />
Ablauf der Einreichungsfrist nicht mehr zurückgenommen werden.<br />
(4) 1 Im Wahlvorschlag kann auch bestimmt werden, dass dieselbe sich<br />
bewerbende Person auf dem Stimmzettel zweimal oder dreimal aufgeführt<br />
wird. 2 Auf dem Stimmzettel erscheinen die dreifach aufzuführenden sich<br />
bewerbenden Personen zuerst und die zweifach aufzuführenden vor den<br />
übrigen sich bewerbenden Personen.<br />
(5) 1 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen des Wahlvorschlagsträgers als<br />
Kennwort tragen. 2 Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen<br />
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 3 Dem<br />
Kennwort ist eine weitere Bezeichnung hinzuzufügen, wenn dies zur<br />
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist; der<br />
Wahlausschuss hat dem Kennwort eine weitere Bezeichnung<br />
hinzuzufügen, wenn dies der Wahlvorschlagsträger trotz Aufforderung<br />
durch den Wahlleiter unterlassen hat.<br />
Bay GLKrWG Art. 26 Verbindung von Wahlvorschlägen<br />
(1) 1 Die Verbindung von Wahlvorschlägen (Listenverbindung) ist zulässig,<br />
wenn alle Wahlvorschläge in gleicher Weise untereinander verbunden sind.<br />
2 Die Listenverbindung ist auf dem Stimmzettel kenntlich zu machen.
Bay GLKrWG Art. 27 Unterstützung von Wahlvorschlägen<br />
(1) 1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen über die nach<br />
Art. 25 Abs. 1 Satz 1 erforderlichen Unterschriften hinaus von weiteren<br />
Wahlberechtigten unterstützt werden. 2 Neue Wahlvorschlagsträger<br />
benötigen keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei<br />
der letzten Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf<br />
vom Hundert der im Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder<br />
bei der letzten Bundestagswahl mindestens fünf vom Hundert der im Land<br />
abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 3 Maßgeblich sind die<br />
vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt<br />
gemachten Ergebnisse.<br />
(2) Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen<br />
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer<br />
Gesamtheit im Gemeinderat oder im Kreistag seit dessen letzter Wahl auf<br />
Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor<br />
dem Wahltag vertreten waren oder wenn mindestens einer der beteiligten<br />
Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften<br />
benötigt.<br />
(3) Die Zahl der Wahlberechtigten, die den Vorschlag zusätzlich unterstützen<br />
müssen, beträgt<br />
1. bei Gemeinderatswahlen<br />
a) in Gemeinden mit bis zu<br />
1 000 Einwohnern<br />
40<br />
2 000 Einwohnern<br />
50<br />
3 000 Einwohnern<br />
60<br />
5 000 Einwohnern<br />
80<br />
10 000 Einwohnern<br />
120<br />
20 000 Einwohnern<br />
180<br />
30 000 Einwohnern<br />
190<br />
50 000 Einwohnern<br />
215<br />
100 000 Einwohnern<br />
340<br />
150 000 Einwohnern<br />
385,<br />
b) in den Städten<br />
Augsburg<br />
470<br />
Nürnberg<br />
610<br />
München<br />
1 000;
2. bei Kreistagswahlen<br />
a) in Landkreisen mit bis zu<br />
100 000 Einwohnern<br />
340<br />
150 000 Einwohnern<br />
385<br />
200 000 Einwohnern<br />
430,<br />
b) in Landkreisen mit mehr als<br />
200 000 Einwohnern<br />
470.<br />
Bay GLKrWG Art. 28 Eintragung in Unterstützungslisten,<br />
Eintragungsscheine<br />
(1) 1 Soweit erforderlich, werden für jeden Wahlvorschlag von den Wahlleitern<br />
am Tag nach der Einreichung bis 12 Uhr des 41. Tags vor dem Wahltag<br />
bei Gemeindewahlen und bei Landkreiswahlen in den Gemeinden<br />
Unterstützungslisten aufgelegt. 2 Art. 20 gilt entsprechend.<br />
(2) 1 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen wollen, haben<br />
sich dazu in der Gemeinde, in der sie spätestens am letzten Tag der<br />
Eintragungsfrist wahlberechtigt sind, in Unterstützungslisten einzutragen;<br />
ausgeschlossen sind sich bewerbende Personen und Ersatzleute von<br />
Wahlvorschlägen sowie Wahlberechtigte, die sich in eine andere<br />
Unterstützungsliste eingetragen oder einen Wahlvorschlag unterzeichnet<br />
haben. 2 Art. 24 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. 3 Die Zurücknahme<br />
gültiger Unterschriften ist wirkungslos.<br />
(3) 1 Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. 2 Wer glaubhaft<br />
macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur<br />
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen<br />
Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein.<br />
3<br />
Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die<br />
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung<br />
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt,<br />
die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. 4 Die<br />
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein außerdem an Eides<br />
statt zu versichern, dass die Voraussetzungen nach Satz 2 vorliegen.<br />
(4) 1 Gegen die Versagung eines Eintragungsscheins kann spätestens am<br />
sechsten Tag vor Ablauf der Eintragungsfrist Beschwerde an die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde erhoben werden. 2 Diese hat spätestens am<br />
vierten Tag vor dem letzten Tag der Eintragungsfrist über die Beschwerde<br />
zu entscheiden. 3 Gegen die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde ist<br />
der Verwaltungsrechtsweg nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)<br />
gegeben. 4 Das Vorverfahren nach § 68 VwGO entfällt. 5 Die Klage hat für<br />
die Durchführung des sonstigen Wahlverfahrens keine aufschiebende<br />
Wirkung.<br />
Bay GLKrWG Art. 29 Aufstellung der sich bewerbenden Personen<br />
(1) 1 Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufzustellenden sich<br />
bewerbenden Personen müssen in einer zu diesem Zweck für den
gesamten Wahlkreis einberufenen Versammlung von den im Zeitpunkt<br />
ihres Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigten Anhängern der Partei<br />
oder der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 2 Jede<br />
an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesende<br />
Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. 3 Den sich für die Aufstellung<br />
bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm<br />
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 4 Die<br />
Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem<br />
Wahltag stattfinden.<br />
(2) 1 In Wahlkreisen mit mehreren Stimmbezirken können die sich<br />
bewerbenden Personen durch eine für den Wahlkreis einberufene<br />
Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder einer<br />
Wählergruppe zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung<br />
aufgestellt werden; die Delegierten müssen im Zeitpunkt ihres<br />
Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. 2 Die<br />
Delegiertenversammlung kann auch eine nach der Satzung einer Partei<br />
oder einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellte<br />
Versammlung sein, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder nicht früher als<br />
zwei Jahre vor dem Wahltag von den Mitgliedern gewählt worden ist, die<br />
im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt<br />
waren.<br />
(3) Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden<br />
Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich<br />
bewerbende Personen aufzustellen.<br />
(4) 1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. 2 Die<br />
Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person<br />
und zwei Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilgenommen<br />
haben, zu unterschreiben. 3 Jede wahlberechtigte Person darf nur eine<br />
Niederschrift unterzeichnen; Art. 24 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. 4 Der<br />
Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich<br />
diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und Unterschrift<br />
eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben.<br />
Bay GLKrWG Art. 30 Beauftragte für die Wahlvorschläge<br />
(1) 1 In jedem Wahlvorschlag soll ein Beauftragter und seine Stellvertretung<br />
bezeichnet werden; fehlt diese Bezeichnung, gilt die Person, die als erste<br />
unterzeichnet hat, als Beauftragter, die zweite als Stellvertretung. 2 Der<br />
Beauftragte und die stellvertretende Person müssen wahlberechtigt sein.<br />
(2) 1 Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der<br />
Beauftragte oder seine Stellvertretung berechtigt, verbindliche<br />
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 2 Im<br />
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten.<br />
(3) Der Beauftragte und seine Stellvertretung können durch schriftliche<br />
Erklärung der Mehrheit derjenigen, die den Wahlvorschlag unterzeichnet<br />
haben, gegenüber dem Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt<br />
werden.
Bay GLKrWG Art. 31 Einreichung der Wahlvorschläge<br />
1 Die Wahlvorschläge sind spätestens bis 18 Uhr des 52. Tags vor dem Wahltag<br />
einzureichen; ihre Zurücknahme ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zulässig.<br />
2 Wurde bis zu diesem Zeitpunkt kein oder nur ein Wahlvorschlag eingereicht,<br />
können Wahlvorschläge noch bis 18 Uhr des 45. Tags vor dem Wahltag<br />
nachgereicht werden. 3 Wurde bis zum Ende dieser Nachfrist nur ein<br />
Wahlvorschlag eingereicht, kann dieser bis 18 Uhr des 41. Tags vor dem<br />
Wahltag auf doppelt so viele sich bewerbende Personen ergänzt werden, wie<br />
ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder oder Kreisräte zu wählen sind; eine<br />
mehrfache Aufführung sich bewerbender Personen wird dann gegenstandslos.<br />
4 In Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnern dürfen nachgereichte Wahlvorschläge<br />
unter Beachtung des Art. 25 Abs. 4 über die Zahl der zu wählenden<br />
Gemeinderatsmitglieder hinaus nur so viele weitere sich bewerbende Personen<br />
enthalten, wie der Wahlvorschlag aufweist, der bis zum 52. Tag vor dem<br />
Wahltag eingereicht worden ist.<br />
Bay GLKrWG Art. 32 Zulassung der Wahlvorschläge<br />
(1) 1 Der Wahlleiter hat die Wahlvorschläge nach Eingang unverzüglich auf<br />
Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 2 Stellt er Mängel fest,<br />
benachrichtigt er unverzüglich die Beauftragten und fordert sie auf, diese,<br />
soweit möglich, bis 18 Uhr des 41. Tags vor dem Wahltag zu beseitigen.<br />
3<br />
Ergeben sich Zweifel an der Gültigkeit des Wahlvorschlags, hat der<br />
Wahlleiter den Beauftragten aufzufordern, Unterlagen oder Erklärungen<br />
innerhalb dieser Frist nachzureichen, die geeignet sind, die Bedenken<br />
gegen die Zulassung des Wahlvorschlags auszuräumen.<br />
(2) 1 Der Wahlausschuss tritt am 40. Tag vor dem Wahltag zusammen und<br />
beschließt über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge und über<br />
die Zulässigkeit von Listenverbindungen. 2 Die Entscheidung ist in der<br />
Sitzung bekannt zu geben.<br />
(3) 1 Hat der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag ganz oder teilweise für<br />
ungültig erklärt, hat er das dem Beauftragten dieses Wahlvorschlags<br />
unverzüglich, möglichst noch am selben Tag mitzuteilen. 2 Gegen diese<br />
Entscheidung kann der betroffene Wahlvorschlagsträger Einwendungen bis<br />
18 Uhr des 34. Tags vor dem Wahltag erheben. 3 Der Wahlausschuss muss<br />
auf diese Einwendungen hin und kann von Amts wegen bis 24 Uhr des<br />
33. Tags vor dem Wahltag über die Gültigkeit von Wahlvorschlägen<br />
nochmals beschließen. 4 Bis zur abschließenden Entscheidung des<br />
Wahlausschusses können behebbare Mängel der eingereichten<br />
Wahlvorschläge noch beseitigt werden.<br />
(4) 1 Hilft der Wahlausschuss Einwendungen nicht ab oder wird ein Beschluss,<br />
der die Gültigkeit eines Wahlvorschlags festgestellt hat, von Amts wegen<br />
geändert, entscheidet auf Antrag des betroffenen Wahlvorschlagsträgers<br />
der Beschwerdeausschuss. 2 Der Antrag ist bis 18 Uhr des 31. Tags vor<br />
dem Wahltag schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter<br />
einzureichen. 3 Der Beschwerdeausschuss entscheidet bis 24 Uhr des 27.<br />
Tags vor dem Wahltag; dem Wahlleiter ist Gelegenheit zur Äußerung<br />
gegeben. 4 Im Übrigen können Beschlüsse des Wahlausschusses nur bei<br />
der Überprüfung der Wahl nachgeprüft werden; Art. 19 Abs. 3 Satz 2<br />
bleibt unberührt.
Bay GLKrWG Art. 33 Bekanntmachung und Reihenfolge der<br />
Wahlvorschläge<br />
(1) Der Wahlleiter hat die vom Wahlausschuss oder vom<br />
Beschwerdeausschuss zugelassenen Wahlvorschläge zusammengefasst<br />
spätestens am 26. Tag vor dem Wahltag bekannt zu machen.<br />
(2) 1 Bei der Bekanntmachung werden die Wahlvorschläge in folgender<br />
Reihenfolge genannt:<br />
1. Die Wahlvorschläge von Wahlvorschlagsträgern nach der Zahl der bei<br />
der letzten Landtagswahl auf sie entfallenen Sitze,<br />
2. die Wahlvorschläge von Wahlvorschlagsträgern nach der Zahl der bei<br />
der letzten Gemeinderatswahl oder bei der letzten Kreistagswahl auf sie<br />
entfallenen Sitze,<br />
3. die übrigen Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge der<br />
Kennworte.<br />
2<br />
Bei gleicher Sitzzahl richtet sich die Reihenfolge nach der Zahl der<br />
Stimmen. 3 Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen richtet sich die Reihenfolge<br />
nach der Partei oder der Wählergruppe, die im Kennwort an erster Stelle<br />
steht.<br />
ABSCHNITT III Verhältniswahl<br />
Bay GLKrWG Art. 34 Stimmenzahl und Vergabe der Stimmen<br />
Liegen mehrere Wahlvorschläge vor, wird das Stimmrecht nach den<br />
Grundsätzen der Verhältniswahl unter Beachtung der nachstehenden<br />
Bestimmungen ausgeübt:<br />
1. Die stimmberechtigte Person hat so viele Stimmen, wie ehrenamtliche<br />
Gemeinderatsmitglieder oder Kreisräte zu wählen sind. In Gemeinden bis zu<br />
3 000 Einwohnern hat sie, falls von der Möglichkeit des Art. 25 Abs. 2 Satz 2<br />
Gebrauch gemacht wird, bis zu doppelt so viele Stimmen.<br />
2. Die stimmberechtigte Person kann ihre Stimmen nur sich bewerbenden<br />
Personen geben, deren Namen in einem zugelassenen Wahlvorschlag enthalten<br />
sind.<br />
3. Die stimmberechtigte Person kann durch Kennzeichnung eines<br />
Wahlvorschlags diesen unverändert annehmen. Eine unveränderte Annahme<br />
liegt nicht vor, wenn die stimmberechtigte Person außerdem in einem oder<br />
mehreren Wahlvorschlägen einzelnen sich bewerbenden Personen Stimmen<br />
gibt.<br />
4. Die stimmberechtigte Person kann innerhalb der ihr zustehenden<br />
Stimmenzahl einer sich bewerbenden Person bis zu drei Stimmen geben.<br />
5. Die stimmberechtigte Person kann innerhalb der ihr zustehenden<br />
Stimmenzahl ihre Stimmen sich bewerbenden Personen aus verschiedenen<br />
Wahlvorschlägen geben.<br />
Bay GLKrWG Art. 35 Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge<br />
(1) 1 Die Sitze werden auf die Wahlvorschläge nach dem Verhältnis der<br />
Gesamtzahlen der gültigen Stimmen verteilt, welche für die in den<br />
einzelnen sowie in den verbundenen Wahlvorschlägen aufgeführten sich<br />
bewerbenden Personen abgegeben worden sind. 2 Stimmen, die für eine
nicht wählbare Person abgegeben worden sind, sind ungültig; hat die<br />
Person die Wählbarkeit erst nach Zulassung des Wahlvorschlags verloren,<br />
werden die Stimmen jedoch hinsichtlich der Sitzverteilung als gültig<br />
gewertet.<br />
(2) 1 Bei der Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge werden die<br />
Gesamtstimmenzahlen, die für die einzelnen oder, soweit<br />
Listenverbindungen bestehen, für die verbundenen Wahlvorschläge<br />
festgestellt worden sind, nacheinander so lange durch 1, 2, 3, 4 usw.<br />
geteilt, bis so viele Höchstteilungszahlen ermittelt sind, wie Sitze zu<br />
vergeben sind. 2 Jedem Wahlvorschlag oder jeder Verbindung von<br />
Wahlvorschlägen wird dabei der Reihe nach so oft ein Sitz angerechnet,<br />
wie er jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. 3 Bei gleichem Anspruch<br />
mehrerer Wahlvorschläge auf einen Sitz fällt dieser dem Wahlvorschlag<br />
zu, dessen in Betracht kommende sich bewerbende Person die größere<br />
Stimmenzahl aufweist; sonst entscheidet das Los.<br />
(3) 1 Innerhalb verbundener Wahlvorschläge werden die nach Absatz 1 auf sie<br />
entfallenen Sitze auf die Wahlvorschläge nach dem Verhältnis der<br />
Gesamtzahlen der gültigen Stimmen verteilt, welche für die in den<br />
Wahlvorschlägen aufgestellten sich bewerbenden Personen abgegeben<br />
worden sind. 2 Abs. 2 gilt dabei entsprechend.<br />
(4) Fallen einem Wahlvorschlag mehr Sitze zu, als er sich bewerbende<br />
Personen enthält, bleiben die übrigen Sitze unbesetzt.<br />
Bay GLKrWG Art. 36 Verteilung der Sitze an die sich bewerbenden<br />
Personen<br />
1 Die einem Wahlvorschlag zugefallenen Sitze werden den darin enthaltenen<br />
sich bewerbenden wählbaren Personen in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen<br />
zugewiesen. 2 Haben mehrere sich bewerbende Personen die gleiche<br />
Stimmenzahl erhalten, entscheidet das Los.<br />
Bay GLKrWG Art. 37 Listennachfolger<br />
(1) 1 Die nicht gewählten sich bewerbenden Personen und die gewählten sich<br />
bewerbenden Personen, die nach Art. 31 Abs. 3 GO oder nach Art. 24<br />
Abs. 3 LKrO das Amt nicht antreten können oder ausscheiden, sind in der<br />
Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Listennachfolger; bei Stimmengleichheit<br />
entscheidet das Los. 2 Bei einem verbundenen Wahlvorschlag sind die<br />
Listennachfolger aus demselben Wahlvorschlag in der Reihenfolge nach<br />
Satz 1 zu nehmen.<br />
(2) 1 Über das Nachrücken eines Listennachfolgers ist in dem Zeitpunkt zu<br />
entscheiden, in dem der Listennachfolger zum Nachrücken berufen ist.<br />
2<br />
Kann er zu diesem Zeitpunkt das Amt nicht antreten oder müsste er<br />
ausscheiden, wird er auf der Liste der Listennachfolger gestrichen; das gilt<br />
nicht für Listennachfolger, die nach Art. 31 Abs. 3 GO, Art. 24 Abs. 3 LKrO<br />
oder nach Art. 48 Abs. 3 das Amt nicht antreten können.
ABSCHNITT IV Mehrheitswahl<br />
Bay GLKrWG Art. 38 Mehrheitswahl<br />
(1) 1 Wird kein oder nur ein Wahlvorschlag zugelassen, ist nach den<br />
Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene sich<br />
bewerbende Personen und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf eine<br />
sich bewerbende Person zu wählen. 2 Die stimmberechtigte Person hat<br />
doppelt so viele Stimmen, wie ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder oder<br />
Kreisräte zu wählen sind.<br />
(2) 1 Gewählt sind höchstens so viele Personen, wie Sitze zu vergeben sind.<br />
2<br />
Die Reihenfolge der Gewählten richtet sich nach deren Stimmenzahlen;<br />
bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 3 Für Listennachfolger gilt<br />
Art. 37 mit Ausnahme von dessen Abs. 1 Satz 2 entsprechend.<br />
DRITTER TEIL Wahl des ersten Bürgermeisters und des Landrats<br />
ABSCHNITT I Grundsätze<br />
Bay GLKrWG Art. 39 Wählbarkeit für das Amt des ersten<br />
Bürgermeisters und des Landrats<br />
(1) 1 Für das Amt des ersten Bürgermeisters und des Landrats ist jede Person<br />
wählbar, die am Wahltag<br />
1. Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,<br />
2. das 21. Lebensjahr vollendet hat,<br />
3. sich im Fall der Bewerbung um das Amt des ehrenamtlichen ersten<br />
Bürgermeisters seit mindestens sechs Monaten in der Gemeinde mit dem<br />
Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhält; Art. 1 Abs. 3 und 4 gelten<br />
entsprechend.<br />
(2) 1 Nicht wählbar ist, wer am Wahltag<br />
1. nach Art. 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,<br />
2. infolge deutschen Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur<br />
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt,<br />
3. sich wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in<br />
Sicherungsverwahrung befindet,<br />
4. von einem deutschen Gericht in Disziplinarverfahren zur Entfernung aus<br />
dem Dienst oder zur Aberkennung des Ruhegehalts rechtskräftig verurteilt<br />
worden ist,<br />
5. nachweisbar nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die<br />
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und<br />
der Verfassung eintritt, oder<br />
6. nachweisbar dienstunfähig ist.<br />
2<br />
Zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister und zum Landrat kann<br />
außerdem nicht gewählt werden, wer am Tag des Beginns der Amtszeit<br />
das 65. Lebensjahr vollendet hat.<br />
Bay GLKrWG Art. 40 Wahlrechtsgrundsätze<br />
(1) Der erste Bürgermeister und der Landrat werden in allgemeiner, gleicher,<br />
unmittelbarer, geheimer und freier Wahl von den Wahlberechtigten aus
dem Kreis der vom Wahlausschuss zugelassenen sich bewerbenden<br />
Personen gewählt.<br />
(2) Wird kein oder nur ein Wahlvorschlag zugelassen, wird die Wahl ohne<br />
Bindung an eine vorgeschlagene sich bewerbende Person durchgeführt.<br />
(3) Jede stimmberechtigte Person hat nur eine Stimme.<br />
Bay GLKrWG Art. 41 Amtszeit des ehrenamtlichen ersten<br />
Bürgermeisters<br />
(1) Der ehrenamtliche erste Bürgermeister wird zugleich mit dem<br />
Gemeinderat auf die Dauer von sechs Jahren gewählt.<br />
(2) Endet das Beamtenverhältnis des bisherigen ersten Bürgermeisters<br />
während der Wahlzeit des Gemeinderats, findet eine Neuwahl eines<br />
ehrenamtlichen ersten Bürgermeisters vorbehaltlich Art. 43 Abs. 2 für den<br />
Rest der Wahlzeit des Gemeinderats statt.<br />
Bay GLKrWG Art. 42 Amtszeit des berufsmäßigen ersten<br />
Bürgermeisters und des Landrats<br />
(1) 1 Der berufsmäßige erste Bürgermeister und der Landrat werden auf die<br />
Dauer von sechs Jahren gewählt. 2 Sie werden zugleich mit dem<br />
Gemeinderat oder dem Kreistag gewählt, wenn der Beginn ihrer Amtszeit<br />
mit dem Beginn der Wahlzeit des Gemeinderats oder des Kreistags<br />
zusammenfällt.<br />
(2) 1 Endet das Beamtenverhältnis des bisherigen ersten Bürgermeisters oder<br />
des bisherigen Landrats während der Wahlzeit des Gemeinderats oder des<br />
Kreistags, findet eine Neuwahl eines berufsmäßigen ersten Bürgermeisters<br />
oder eines Landrats vorbehaltlich Art. 43 Abs. 2 für den Rest der Wahlzeit<br />
des Gemeinderats oder des Kreistags statt, es sei denn, die Amtszeit<br />
würde weniger als vier Jahre betragen. 2 Dasselbe gilt, wenn das Ruhen<br />
der Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis wegen der Wahl in<br />
eine gesetzgebende Körperschaft eintritt.<br />
(3) 1 Ist ein berufsmäßiger erster Bürgermeister für eine über das Ende der<br />
Wahlzeit des Gemeinderats oder ein Landrat für eine über das Ende der<br />
Wahlzeit des Kreistags hinaus reichende Amtszeit gewählt, kann der<br />
Gemeinderat auf Antrag des ersten Bürgermeisters oder der Kreistag auf<br />
Antrag des Landrats bis zu dem der nächsten allgemeinen Gemeinde- und<br />
Landkreiswahl vorausgehenden 30. September beschließen, dass die<br />
Amtszeit vorzeitig mit dem Ablauf der Wahlzeit des Gemeinderats oder<br />
des Kreistags endet. 2 Der Beschluss ist amtlich bekannt zu machen.<br />
Bay GLKrWG Art. 43 Beginn und Verlängerung der Amtszeit,<br />
Beauftragter<br />
(1) Die Amtszeit eines ersten Bürgermeisters oder eines Landrats beginnt am<br />
Tag nach der Feststellung des Wahlergebnisses, jedoch nicht vor Ablauf<br />
der Amtszeit der bisherigen das Amt innehabenden Person.<br />
(2) Beginnt die Amtszeit innerhalb der letzten zwei Jahre der Wahlzeit des<br />
Gemeinderats oder des Kreistags, endet sie mit dem Ablauf der folgenden<br />
Wahlzeit des Gemeinderats oder des Kreistags.
(3) 1 Ist zu Beginn der Wahlzeit des Gemeinderats noch kein erster<br />
Bürgermeister oder zu Beginn der Wahlzeit des Kreistags noch kein<br />
Landrat im Amt, kann die Rechtsaufsichtsbehörde ein<br />
Gemeinderatsmitglied mit der Wahrnehmung der Geschäfte des ersten<br />
Bürgermeisters oder einen Kreisrat mit der Wahrnehmung der Geschäfte<br />
des Landrats beauftragen. 2 Der Beauftragte hat sich auf laufende und auf<br />
unaufschiebbare Geschäfte zu beschränken.<br />
Bay GLKrWG Art. 44 Festsetzung eines abweichenden Wahltermins<br />
(1) 1 Endet die Amtszeit eines ersten Bürgermeisters nicht mit der Wahlzeit<br />
des Gemeinderats oder die Amtszeit eines Landrats nicht mit der Wahlzeit<br />
des Kreistags, setzt die Rechtsaufsichtsbehörde den Wahltermin fest.<br />
2<br />
Steht schon vorher fest, wann die Amtszeit endet, soll die Wahl innerhalb<br />
der letzten drei Monate, bei Zusammentreffen mehrerer Wahlen oder<br />
Abstimmungen im Sinn von Art. 10 innerhalb der letzten sechs Monate<br />
dieser Amtszeit stattfinden. 3 Im Übrigen soll die Wahl innerhalb von drei<br />
Monaten nach Beendigung der Amtszeit abgehalten werden. 4 Endet die<br />
Amtszeit infolge einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung,<br />
beginnt die Frist ab Rechtskraft oder Bestandskraft der Entscheidung.<br />
(2) 1 Verliert eine sich bewerbende Person die Wählbarkeit nach der Zulassung<br />
des Wahlvorschlags, findet die Wahl nicht statt. 2 Ob die Voraussetzungen<br />
vorliegen, entscheidet der Wahlausschuss. 3 Die Wahl ist nachzuholen.<br />
4<br />
Die Nachholungswahl soll innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der<br />
ausgefallenen Wahl stattfinden. 5 Den Wahltermin setzt die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde fest. 6 Die Wahl ist auf der Grundlage des<br />
bisherigen Wahlverfahrens durchzuführen. 7 Die Wählerverzeichnisse sind<br />
jedoch auf den neuesten <strong>Stand</strong> zu bringen. 8 Neue Wahlvorschläge können<br />
eingereicht werden.<br />
(3) Wahlen, die zwischen dem einer allgemeinen Gemeinde- und<br />
Landkreiswahl vorausgehenden 1. Dezember und den allgemeinen Wahlen<br />
abzuhalten wären, finden zusammen mit diesen Wahlen statt.<br />
ABSCHNITT II Wahlvorschläge, Wahlergebnis<br />
Bay GLKrWG Art. 45 Wahlvorschläge<br />
(1) 1 Für die Aufstellung, Einreichung, Zulassung, Bekanntmachung und<br />
Reihenfolge von Wahlvorschlägen für den ersten Bürgermeister und den<br />
Landrat gelten die Vorschriften des Zweiten Teils, Abschnitt II, mit<br />
Ausnahme des Art. 26 und des Art. 32 Abs. 4 Sätze 1 bis 3, entsprechend.<br />
2<br />
Bei der Anwendung des Art. 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 ist auch<br />
für die Wahl des ersten Bürgermeisters auf die Zahl der bei der letzten<br />
Gemeinderatswahl und für die Wahl des Landrats auf die Zahl der bei der<br />
letzten Kreistagswahl erhaltenen Sitze abzustellen.<br />
(2) Ein neuer Wahlvorschlagsträger bedarf unbeschadet des Art. 27 Abs. 1<br />
Satz 2 und Abs. 2 auch dann keiner Unterstützungsunterschriften, wenn<br />
er im Gemeinderat oder im Kreistag seit dessen letzter Wahl auf Grund<br />
eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem<br />
Wahltag vertreten war.
(3) Wird eine sich bewerbende Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern<br />
aufgestellt, ist sie in geheimer Abstimmung entweder in einer<br />
gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlungen zu<br />
wählen.<br />
Bay GLKrWG Art. 46 Wahlergebnis, Stichwahl, Wiederholungswahl<br />
(1) 1 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen<br />
erhält. 2 Erhält niemand diese Mehrheit, findet am zweiten Sonntag nach<br />
dem Wahltag eine Stichwahl unter den zwei Personen statt, die bei der<br />
ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. 3 Erhalten mehr<br />
als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los, wer<br />
von ihnen in die Stichwahl kommt. 4 Die Stichwahlteilnehmer können vor<br />
der Stichwahl zurücktreten, bei der Wahl zum ehrenamtlichen ersten<br />
Bürgermeister jedoch nur aus wichtigem Grund im Sinn von Art. 19 Abs. 1<br />
Satz 3 GO.<br />
(2) 1 Die Stichwahl findet nicht statt, wenn<br />
1. mehr als zwei Personen die höchste Stimmenzahl erhalten haben,<br />
2. einer der Stichwahlteilnehmer die Wählbarkeit verliert oder<br />
3. einer der Stichwahlteilnehmer wirksam zurückgetreten ist.<br />
2<br />
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Wahlausschuss.<br />
3<br />
Die Wahl ist zu wiederholen.<br />
(3) 1 Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl<br />
stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht<br />
verloren hat. 2 Bei der Stichwahl ist gewählt, wer von den abgegebenen<br />
gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. 3 Bei gleicher<br />
Stimmenzahl entscheidet das Los.<br />
(4) Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei einer Wahl ungültig, ist die<br />
Wahl zu wiederholen.<br />
(5) Für die Wiederholungswahl gelten Art. 44 Abs. 2 Sätze 4 bis 8<br />
entsprechend.<br />
VIERTER TEIL Annahme der Wahl, Amtsverlust<br />
Bay GLKrWG Art. 47 Annahme der Wahl<br />
(1) 1 Der Wahlleiter verständigt unverzüglich die Gewählten von ihrer Wahl<br />
und fordert sie auf, binnen einer Woche zu erklären, ob sie die Wahl<br />
annehmen. 2 Verständigung und Erklärung müssen schriftlich oder zur<br />
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung, bei Landkreiswahlen beim<br />
Landratsamt, gegeben werden. 3 Bei der Verständigung der zu einem<br />
Ehrenamt Gewählten ist darauf hinzuweisen, dass die Ablehnung der Wahl<br />
nur aus wichtigem Grund im Sinn von Art. 19 Abs. 1 Satz 3 GO, Art. 13<br />
Abs. 1 Satz 3 LKrO zulässig ist, und dass die Ablehnung ohne wichtigen<br />
Grund bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen als Annahme gilt. 4 Die zu<br />
Gemeinderatsmitgliedern und zu Kreisräten Gewählten müssen zudem<br />
ihre Bereitschaft zur Eidesleistung oder zur Ablegung eines Gelöbnisses<br />
nach Art. 31 Abs. 4 GO, Art. 24 Abs. 4 LKrO erklären.<br />
(2) 1 Die Wahl kann nur vorbehaltlos angenommen werden; der<br />
Annahmeerklärung beigefügte Vorbehalte oder Bedingungen sind<br />
unwirksam. 2 Lehnt eine zum Gemeinderatsmitglied oder zum Kreisrat
gewählte Person die Eidesleistung oder die Ablegung eines Gelöbnisses ab,<br />
gilt die Wahl als abgelehnt.<br />
(3) 1 Bei Gemeinderats- und Kreistagswahlen gilt die Wahl als angenommen,<br />
wenn sie nicht wirksam abgelehnt wurde. 2 Bei Bürgermeister- und<br />
Landratswahlen gilt die Wahl als abgelehnt, wenn sie nicht wirksam<br />
angenommen wurde.<br />
(4) 1 Über eine Ablehnung der Wahl einer zu einem Ehrenamt gewählten<br />
Person entscheidet der Wahlausschuss; Art. 19 Abs. 1 Satz 4 GO und<br />
Art. 13 Abs. 1 Satz 4 LKrO finden Anwendung. 2 Bei einer wirksamen<br />
Ablehnung einer in den Gemeinderat oder in den Kreistag gewählten<br />
Person verständigt der Wahlleiter unverzüglich den Listennachfolger<br />
entsprechend Abs. 1. 3 Wird die Wahl zum ersten Bürgermeister oder zum<br />
Landrat abgelehnt oder gilt sie nach Abs. 3 Satz 2 als abgelehnt, findet<br />
eine Neuwahl statt. 4 Für diese gilt Art. 44 entsprechend mit der Maßgabe,<br />
dass der Wahltermin innerhalb von drei Monaten nach Ablehnung der<br />
Wahl liegen soll.<br />
Bay GLKrWG Art. 48 Amtshindernisse, Amtsverlust, Nachrücken<br />
(1) 1 Eine in den Gemeinderat oder in den Kreistag gewählte Person kann ihr<br />
Amt nicht antreten, ein ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied oder ein<br />
Kreisrat verliert sein Amt<br />
1. bei Verlust der Wählbarkeit,<br />
2. bei Verweigerung der Eidesleistung oder des Ablegens des Gelöbnisses,<br />
3. in den Fällen des Art. 31 Abs. 3 GO oder des Art. 24 Abs. 3 LKrO; das<br />
gilt nicht bei der Wahl zum weiteren Bürgermeister oder zum<br />
Stellvertreter des Landrats.<br />
2<br />
In diesem Fall rückt ein Listennachfolger nach.<br />
(2) 1 Eine zum ehrenamtlichen ersten Bürgermeister gewählte Person kann in<br />
den Fällen des Art. 31 Abs. 3 GO ihr Amt nicht antreten. 2 In diesem Fall<br />
findet eine Neuwahl entsprechend Art. 44 statt.<br />
(3) Ein erster Bürgermeister kann nicht gleichzeitig ehrenamtliches<br />
Gemeinderatsmitglied, ein Landrat nicht gleichzeitig Kreisrat sein.<br />
(4) 1 Der Wahlausschuss stellt ein Amtshindernis fest und entscheidet über<br />
das Nachrücken des Listennachfolgers. 2 Ist die Amtszeit des<br />
Wahlausschusses beendet, stellt der Gemeinderat oder der Kreistag ein<br />
Amtshindernis oder einen Amtsverlust fest und entscheidet über das<br />
Nachrücken des Listennachfolgers. 3 Für den Listennachfolger gilt Art. 47<br />
entsprechend.<br />
Bay GLKrWG Art. 49 Amtsverlust bei Partei- oder Vereinsverbot<br />
(1) 1 Erklärt das Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 21 des Grundgesetzes<br />
eine Partei für verfassungswidrig, verlieren die ehrenamtlichen<br />
Gemeinderatsmitglieder oder Kreisräte, die auf Grund eines<br />
Wahlvorschlags dieser Partei gewählt worden sind oder die der für<br />
verfassungswidrig erklärten Partei zur Zeit der Verkündung der<br />
Entscheidung angehören, mit der Verkündung der Entscheidung ihr Amt,<br />
soweit nicht in der Entscheidung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
2 Entsprechendes gilt beim Verbot einer Wählergruppe nach Vereinsrecht;<br />
an die Stelle der Verkündung der Entscheidung tritt deren Bestandskraft.<br />
(2) 1 Soweit ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder oder Kreisräte nach Abs. 1<br />
ihr Amt verloren haben, bleiben die freigewordenen Sitze unbesetzt. 2 Dies<br />
gilt nicht, wenn die Ausgeschiedenen auf Grund eines Wahlvorschlags<br />
einer nicht für verfassungswidrig erklärten Partei oder einer nicht<br />
verbotenen Wählergruppe gewählt waren; in diesem Fall rücken die<br />
nächstfolgenden Listennachfolger dieses Wahlvorschlags nach, soweit<br />
nicht auch auf diese die Voraussetzungen des Abs. 1 zutreffen.<br />
(3) 1 Im Fall des Abs. 2 Satz 1 verringert sich die gesetzliche Mitgliederzahl<br />
des Gemeinderats oder des Kreistags für den Rest der Wahlzeit<br />
entsprechend. 2 Eine Neuverteilung der verbleibenden Sitze findet nicht<br />
statt.<br />
(4) Den Verlust des Amts stellt die Rechtsaufsichtsbehörde fest.<br />
FÜNFTER TEIL Überprüfung der Wahl<br />
Bay GLKrWG Art. 50 Wahlprüfung<br />
(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft von Amts wegen die Vorbereitung und<br />
die Durchführung der Wahlen sowie das vom Wahlausschuss festgestellte<br />
Ergebnis.<br />
(2) 1 Wurden Wahlvorschriften verletzt, hat die Rechtsaufsichtsbehörde das<br />
Wahlergebnis zu berichtigen, wenn<br />
1. bei der Bürgermeisterwahl oder der Landratswahl eine andere Person<br />
das Amt erhalten hätte,<br />
2. bei der Gemeinderatswahl oder der Kreistagswahl die Verteilung der<br />
Sitze auf die Wahlvorschläge anders wäre, andere Personen das Amt<br />
erhalten hätten, andere Personen Listennachfolger wären oder die<br />
Reihenfolge der Listennachfolger anders wäre; dies gilt auch im Fall des<br />
Art. 35 Abs. 1 Satz 2.<br />
2<br />
Wären bei der Einhaltung der Wahlvorschriften lediglich andere<br />
Stimmenzahlen festzustellen, kann sie das Wahlergebnis berichtigen. 3 Sie<br />
ist befugt, die Auswertung der Stimmzettel einschließlich der<br />
Entscheidungen der Wahlvorstände und der Briefwahlvorstände zu<br />
berichtigen.<br />
(3) Wurden Wahlvorschriften verletzt und ist es möglich, dass es dadurch zu<br />
einer unrichtigen Sitzverteilung, Ämterverteilung oder Listennachfolge im<br />
Sinn des Abs. 2 Satz 1 gekommen ist, die nicht berichtigt werden kann,<br />
hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Wahl für ungültig zu erklären.<br />
(4) 1 Berichtigung und Ungültigerklärung sind nur innerhalb einer Frist von<br />
vier Monaten nach Verkündung des Wahlergebnisses zulässig. 2 Ist auf<br />
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen, dass die Wahl zu<br />
berichtigen oder für ungültig zu erklären ist, bedarf es aber noch einer<br />
weiteren Aufklärung des Sachverhalts, kann die Rechtsaufsichtsbehörde<br />
die Frist verlängern.<br />
(5) Eine bestandskräftige oder sofort vollziehbare Berichtigung oder<br />
Ungültigerklärung berührt nicht die Wirksamkeit vorher gefasster<br />
Beschlüsse und vorgenommener Amtshandlungen.
(6) 1 Ist die Wahlzeit und die Amtszeit des Gemeinderats und des ersten<br />
Bürgermeisters oder des Kreistags und des Landrats beendet, führt ein<br />
von der Rechtsaufsichtsbehörde eingesetzter Beauftragter die Geschäfte<br />
bis zum Amtsantritt des neugewählten ersten Bürgermeisters, des<br />
neugewählten Landrats oder eines Stellvertreters. 2 Der Beauftragte hat<br />
sich auf laufende und auf unaufschiebbare Geschäfte zu beschränken.<br />
Bay GLKrWG Art. 51 Wahlanfechtung<br />
1 Jede wahlberechtigte Person, bei der Wahl eines berufsmäßigen ersten<br />
Bürgermeisters oder eines Landrats auch jede in einem zugelassenen<br />
Wahlvorschlag aufgeführte sich bewerbende Person, kann innerhalb von 14<br />
Tagen nach Verkündung des Wahlergebnisses die Wahl durch schriftliche<br />
Erklärung wegen der Verletzung wahlrechtlicher Vorschriften bei der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde anfechten. 2 Für die Entscheidung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde gilt Art. 50 entsprechend. 3 Berichtigt die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde ein Wahlergebnis von Amts wegen oder erklärt sie eine<br />
angefochtene Wahl von Amts wegen für ungültig, ist die Entscheidung auch auf<br />
die Wahlanfechtung zu erstrecken.<br />
Bay GLKrWG Art. 52 Rechtsweg, Nachwahl, Neuwahl<br />
(1) 1 Gegen die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde ist der<br />
Verwaltungsrechtsweg nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegeben.<br />
2<br />
Das Vorverfahren nach § 68 VwGO entfällt.<br />
(2) 1 Ist die Ungültigerklärung einer Wahl bestandskräftig geworden, setzt die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich einen neuen Wahltermin fest.<br />
2<br />
Dieser ist möglichst innerhalb eines Jahres seit dem Tag der für ungültig<br />
erklärten Wahl zu legen und soll spätestens drei Monate nach<br />
Bestandskraft der Ungültigerklärung der Wahl liegen. 3 Wenn zwischen<br />
dem Tag der für ungültig erklärten Wahl und dem neuen Wahltermin nicht<br />
mehr als ein Jahr liegt, findet eine Nachwahl statt. 4 Kann die Wahl nicht<br />
innerhalb eines Jahres seit dem Tag der für ungültig erklärten Wahl<br />
durchgeführt werden, findet eine Neuwahl statt.<br />
(3) 1 Bei der Nachwahl ist das Wahlverfahren insoweit zu wiederholen, als<br />
Wahlrechtsverstöße zur Ungültigerklärung geführt haben. 2 Die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde kann die Nachwahl auf die Abstimmung in allen<br />
oder in einzelnen Stimmbezirken oder auf die Briefwahl beschränken,<br />
wenn die zur Ungültigerklärung führenden Wahlrechtsverstöße sich nur<br />
dort ausgewirkt haben können. 3 Im Fall des Abs. 7 Sätze 2 und 3 ist eine<br />
Beschränkung nicht möglich.<br />
(4) Wahlberechtigt bei der Nachwahl ist, wer das Wahlrecht am Tag der<br />
Nachwahl besitzt; die Wählerverzeichnisse sind auf den neuesten <strong>Stand</strong> zu<br />
bringen.<br />
(5) 1 Wurde die Nachwahl auf die Abstimmung in Stimmbezirken beschränkt,<br />
ist wahlberechtigt, wer in diesen Stimmbezirken wahlberechtigt ist und bei<br />
der für ungültig erklärten Wahl keinen Wahlschein erhalten hat.<br />
2<br />
Abweichend von Satz 1 ist auch wahlberechtigt, wer bei der für ungültig<br />
erklärten Wahl die Stimme im Abstimmungsraum eines dieser<br />
Stimmbezirke mit Wahlschein abgegeben hat, wenn er das Wahlrecht in<br />
der Zwischenzeit nicht verloren hat.
(6) Wurde die Nachwahl auf die Briefwahl beschränkt, ist nur wahlberechtigt,<br />
wer bei der für ungültig erklärten Wahl einen Wahlschein erhalten hat und<br />
die Stimme nicht mit dem Wahlschein in einem Abstimmungsraum<br />
abgegeben hat.<br />
(7) 1 Bei der Nachwahl ist wählbar, wer die Wählbarkeit am Tag der Nachwahl<br />
noch besitzt. 2 Sich bewerbende Personen können innerhalb einer Woche<br />
nach Bestandskraft der Ungültigerklärung von der Bewerbung<br />
zurücktreten, bei Bewerbung um ein Ehrenamt jedoch nur aus wichtigem<br />
Grund im Sinn von Art. 19 Abs. 1 Satz 3 GO und Art. 13 Abs. 1 Satz 3<br />
LKrO. 3 Die Erklärung muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der<br />
Gemeindeverwaltung, bei Landkreiswahlen beim Landratsamt, gegeben<br />
werden. 4 Ob die sich bewerbenden Personen die Wählbarkeit noch<br />
besitzen oder ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der<br />
Wahlausschuss bis 24 Uhr des zweiten Tags nach Ablauf der Frist nach<br />
Satz 2. 5 Stehen keine sich bewerbenden Personen mehr zur Verfügung,<br />
findet eine Neuwahl statt.<br />
(8) 1 Eine Nachwahl wird von denjenigen Wahlorganen durchgeführt, die<br />
bereits bei der für ungültig erklärten Wahl im Amt waren, wenn das<br />
Wahlverfahren nicht insgesamt zu wiederholen ist; eine fehlerhafte<br />
Besetzung ist zu bereinigen. 2 Das Gesamtergebnis der Wahl ist neu<br />
festzustellen.<br />
SECHSTER TEIL Kosten, Wahlstatistik, Vollzugsvorschriften<br />
Bay GLKrWG Art. 53 Freistellungs- und Erstattungsanspruch<br />
(1) 1 Arbeitnehmer, die zu Mitgliedern des Wahlvorstands berufen werden,<br />
sind zur Arbeitsleistung nicht verpflichtet, soweit ihre Mitwirkung zur<br />
Ermittlung des Wahlergebnisses erforderlich ist. 2 Ihre Abwesenheit haben<br />
sie unter Vorlage einer Bescheinigung der Gemeinde dem Arbeitgeber<br />
rechtzeitig mitzuteilen. 3 Dieser ist verpflichtet, ihnen für die in Satz 1<br />
bestimmte Zeit das Arbeitsentgelt einschließlich aller Nebenleistungen und<br />
Zulagen fortzuzahlen, das sie ohne ihre Tätigkeit im Wahlvorstand erzielt<br />
hätten. 4 Den Arbeitgebern sind auf Antrag die nach Satz 3 zu<br />
erbringenden Leistungen einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung<br />
und zur Bundesanstalt für Arbeit von der Gemeinde zu erstatten. 5 Der<br />
Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach dem Wahltag bei der<br />
Gemeinde zu stellen.<br />
(2) Für Angehörige des öffentlichen Dienstes gilt Abs. 1 mit Ausnahme der<br />
Sätze 4 und 5.<br />
(3) 1 Die Gemeinde kann anderen Wahlvorstandsmitgliedern auf Antrag eine<br />
pauschalierte Ersatzleistung für den Verdienstausfall oder sonstigen<br />
Nachteil gewähren, der ihnen während der in Abs. 1 Satz 1 bestimmten<br />
Zeit entstanden ist. 2 Im Übrigen gelten Art. 20 a Abs. 2 Nrn. 2 und 3 GO.<br />
Bay GLKrWG Art. 54 Kosten<br />
(1) Die Kosten der Gemeindewahlen tragen die Gemeinden.<br />
(2) 1 Die Kosten der Landkreiswahlen tragen die Landkreise. 2 Die Gemeinden<br />
tragen jedoch die Kosten für die Bereitstellung der Wahlräume und für die<br />
Beschaffung und die Herstellung der für die Wahl nötigen Gegenstände.
(3) Ist eine Landkreiswahl mit einer Gemeindewahl verbunden, gelten die<br />
Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass Aufwendungen, die nicht getrennt<br />
einer der beiden Wahlen zugeordnet werden können, Gemeinde und<br />
Landkreis je zur Hälfte tragen.<br />
(4) Sind Gemeinden Mitglieder einer Verwaltungsgemeinschaft, trägt diese an<br />
Stelle der Gemeinden die Kosten.<br />
(5) Soweit Kosten zu erstatten sind, können diese nach einem festen Betrag<br />
je stimmberechtigte Person abgegolten werden.<br />
Bay GLKrWG Art. 55 Feststellung der Einwohnerzahl, Fristen und<br />
Termine<br />
(1) 1 Soweit nach diesem Gesetz die Einwohnerzahl in Betracht kommt, ist der<br />
letzte fortgeschriebene <strong>Stand</strong> der Bevölkerung, der vom Landesamt für<br />
Statistik und Datenverarbeitung früher als sechs Monate vor dem Wahltag<br />
veröffentlicht wurde, zugrunde zu legen. 2 Das gilt auch für die Zahl der zu<br />
wählenden Gemeinderatsmitglieder und Kreisräte; Art. 31 Abs. 2 Satz 4<br />
GO und Art. 24 Abs. 2 Satz 2 LKrO bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine ändern sich<br />
nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen<br />
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag<br />
fällt. 2 Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind<br />
behördliche Änderungen von Fristen sowie eine Wiedereinsetzung in den<br />
vorigen <strong>Stand</strong> ausgeschlossen.<br />
Bay GLKrWG Art. 56 Wahlstatistik<br />
(1) 1 Die Ergebnisse der Wahlen sind vom Landesamt für Statistik und<br />
Datenverarbeitung statistisch zu bearbeiten. 2 Die Gemeinden und die<br />
Landkreise übermitteln dem Landesamt die dafür erforderlichen Angaben.<br />
(2) 1 Gemeinden mit einer räumlich, organisatorisch und personell von<br />
anderen Verwaltungsstellen getrennten mit der Durchführung statistischer<br />
Aufgaben betrauten Stelle können durch diese Stelle für geeignete<br />
Stimmbezirke auch nach Geschlecht und nach Altersgruppen gegliederte<br />
Statistiken der stimmberechtigten und der wählenden Personen unter<br />
Berücksichtigung der Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge<br />
erstellen. 2 Die Trennung der Abstimmung nach Geschlecht und<br />
Altersgruppe ist nur zulässig, wenn die Stimmabgabe der einzelnen<br />
wählenden Personen dadurch nicht erkennbar wird. 3 Auswertungen für<br />
einzelne Stimmbezirke dürfen nicht veröffentlicht werden.<br />
Bay GLKrWG Art. 57 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen Art. 20 Abs. 1, auch in<br />
Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 Satz 2, Abstimmende oder Unterzeichnende<br />
beeinflusst, behindert oder belästigt.<br />
(2) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
entgegen Art. 20 Abs. 2 vor Ablauf der Abstimmungszeit Ergebnisse von<br />
Befragungen über den Inhalt der Stimmrechtsausübung, die nach der<br />
Stimmabgabe vorgenommen wurden, veröffentlicht.
Bay GLKrWG Art. 58 Vollzugsvorschriften<br />
1 Das Staatsministerium des Innern erlässt durch Rechtsverordnung die zum<br />
Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlichen Vorschriften. 2 Es kann darin<br />
insbesondere Bestimmungen treffen über<br />
1. den Begriff des Aufenthalts im Sinn des Art. 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3,<br />
2. die Bildung der Wahlorgane und der Beschwerdeausschüsse,<br />
3. die Einteilung der Stimmbezirke,<br />
4. die Anlegung der Wählerverzeichnisse und die Eintragung der<br />
Wahlberechtigten,<br />
5. die Erteilung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen,<br />
6. die Einrichtung der Wahlräume,<br />
7. die Gestaltung der Stimmzettel, wobei auch Regelungen zur barrierefreien<br />
Teilnahme an Wahlen für blinde, erblindete und stark sehbehinderte Wähler<br />
und zur Einbeziehung von Blindenvereinigungen in Herstellung und Verteilung<br />
von Stimmzettelschablonen samt Kostenerstattung getroffen werden können,<br />
8. die Aufstellung, die Einreichung, die Unterstützung, den Inhalt und die Form<br />
der Wahlvorschläge mit den dazugehörigen Unterlagen, ihre Prüfung, die<br />
Beseitigung von Mängeln sowie ihre Zulassung oder ihre Zurückweisung,<br />
9. die Vorbereitung und die Durchführung der Wahlhandlung,<br />
10. die Durchführung der Briefwahl und die Zulassung oder die Zurückweisung<br />
von Wahlbriefen,<br />
11. die Wahl in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Klöstern, in<br />
Justizvollzugsanstalten,<br />
12. die möglichen Arten der Stimmvergabe und deren Gültigkeit oder<br />
Ungültigkeit,<br />
13. die Feststellung und die Bekanntmachung des Wahlergebnisses,<br />
14. die Annahme der Wahl und den Amtsverlust,<br />
15. die Wahlprüfung und die Wahlanfechtung,<br />
16. die Neuwahl und die Nachwahl,<br />
17. die Kosten der Wahl,<br />
18. die Gestaltung von Vordrucken und<br />
19. die Wahlstatistik.<br />
SIEBTER TEIL Schlussbestimmungen<br />
Bay GLKrWG Art. 59 Schriftform<br />
Soweit in diesem Gesetz und in der hierzu erlassenen Wahlordnung nichts<br />
anderes bestimmt ist, müssen vorgeschriebene Erklärungen persönlich und<br />
handschriftlich unterzeichnet sein und bei dem zuständigen Wahlorgan oder<br />
der zuständigen Stelle der Wahlorganisation im Original vorliegen.<br />
Bay GLKrWG Art. 60 Inkrafttreten, Aufhebung anderer <strong>Gesetze</strong><br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 1994 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ursprünglichen Fassung vom 10. August 1994 (GVBl S. 747). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens<br />
der späteren Änderungsgesetze ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(2) gegenstandslos
Bay GLKrWG Art. 61 Übergangsregelung<br />
(1) Dieses Gesetz ist erstmals für die allgemeinen Gemeinde- und<br />
Landkreiswahlen 2008 anzuwenden.<br />
(2) Für vorher stattfindende Gemeinde- und Landkreiswahlen sind die<br />
Vorschriften des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 2000 (GVBl S. 198,<br />
BayRS 2021-1/2-I), zuletzt geändert durch § 3 des <strong>Gesetze</strong>s vom 9. Juli<br />
2003 (GVBl S. 419), sowie Art. 17 Abs. 2 Nr. 12 <strong>Bayerisches</strong><br />
Datenschutzgesetz vom 23. Juli 1993 (GVBl S. 498, BayRS 204-1-I),<br />
zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzs vom 24. Dezember 2002 (GVBl<br />
S. 975), weiterhin anzuwenden.
Gemeindeordnung für den Freistaat<br />
Bayern (Bay GO)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 26. März 1999 (GVBl. S. 86), vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 542), vom 28. März 2000<br />
(GVBl. S. 136), vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 962), vom 9.<br />
Juli 2003 (GVBl. S. 416), vom 7. August 2003 (GVBl. S. 497), vom 26. Juli 2004 (GVBl. S. 272),<br />
vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 659), vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 665), vom 26. Juli<br />
2006 (GVBl. S. 405), vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 975), vom 10. April 2007 (GVBl. S. 271),<br />
vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 958), vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 400) (FN BayRS 2020-1-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Wesen und Aufgaben der Gemeinde<br />
1. ABSCHNITT Begriff, Benennung und Hoheitszeichen<br />
Art. 1 Begriff<br />
Art. 2 Name<br />
Art. 3 Städte und Märkte<br />
Art. 4 Wappen und Fahnen; Dienstsiegel<br />
2. ABSCHNITT Rechtsstellung und Wirkungskreis<br />
Art. 5 Kreisangehörigkeit und Kreisfreiheit<br />
Art. 5 a Eingliederung in den Landkreis; Große Kreisstadt<br />
Art. 6 Allseitiger Wirkungskreis<br />
Art. 7 Eigene Angelegenheiten<br />
Art. 8 Übertragene Angelegenheiten<br />
Art. 9 Weitere Aufgaben der kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädte<br />
3. ABSCHNITT Gemeindegebiet und gemeindefreies Gebiet<br />
Art. 10 Gemeindegebiet und Bestandsgarantie<br />
Art. 10 a Gemeindefreie Gebiete<br />
Art. 11 Änderungen
Art. 12 Zuständige Behörde; Fortgeltung des Ortsrechts<br />
Art. 13 Weitere Folgen der Änderungen<br />
Artikel 13 a<br />
Art. 14 Bekanntmachung; Gebühren<br />
4. ABSCHNITT Rechte und Pflichten der Gemeindeangehörigen<br />
Art. 15 Einwohner und Bürger<br />
Art. 16 Ehrenbürgerrecht<br />
Art. 17 Wahlrecht<br />
Art. 18 Mitberatungsrecht (Bürgerversammlung)<br />
Art. 18 a Bürgerbegehren und Bürgerentscheid<br />
Art. 18 b Bürgerantrag<br />
Art. 19 Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
Art. 20 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht<br />
Art. 20 a Entschädigung<br />
Art. 21 Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der Gemeindelasten<br />
5. ABSCHNITT Gemeindehoheit<br />
Art. 22 Verwaltungs- und Finanzhoheit<br />
Art. 23 Ortsrecht<br />
Art. 24 Inhalt der Satzungen<br />
Artikel 25<br />
Art. 26 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung<br />
Art. 27 Verwaltungsverfügungen; Zwangsmaßnahmen<br />
Art. 28 Geldbußen und Verwarnungsgelder
ZWEITER TEIL Verfassung und Verwaltung der Gemeinde<br />
1. ABSCHNITT Gemeindeorgane und ihre Hilfskräfte<br />
Art. 29 Hauptorgane<br />
Art. 30 Rechtsstellung, Aufgaben des Gemeinderats<br />
Art. 31 Zusammensetzung des Gemeinderats<br />
Art. 32 Aufgaben der Ausschüsse<br />
Art. 33 Zusammensetzung der Ausschüsse; Vorsitz<br />
Art. 34 Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters<br />
Art. 35 Rechtsstellung der weiteren Bürgermeister<br />
Art. 36 Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderats<br />
Art. 37 Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters<br />
Art. 38 Verpflichtungsgeschäfte; Vertretung der Gemeinde nach außen<br />
Art. 39 Stellvertretung; Übertragung von Befugnissen<br />
Art. 40 Berufung und Aufgaben<br />
Art. 41 Rechtsstellung<br />
Art. 42 Notwendigkeit bestimmter Fachkräfte<br />
Art. 43 Anstellung und Arbeitsbedingungen<br />
Art. 44 Stellenplan<br />
2. ABSCHNITT Geschäftsgang<br />
Art. 45 Geschäftsordnung<br />
Art. 46 Geschäftsleitung<br />
Art. 47 Sitzungszwang; Beschlußfähigkeit<br />
Art. 48 Teilnahmepflicht; Ordnungsgeld gegen Säumige
Art. 49 Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung<br />
Art. 50 Einschränkung des Vertretungsrechts<br />
Art. 51 Form der Beschlußfassung; Wahlen<br />
Art. 52 Öffentlichkeit<br />
Art. 53 Handhabung der Ordnung<br />
Art. 54 Niederschrift<br />
Art. 55 Geschäftsgang der Ausschüsse<br />
3. ABSCHNITT Verwaltungsgrundsätze und Verwaltungsaufgaben<br />
Art. 56 Gesetzmäßigkeit; Geschäftsgang<br />
Art. 56 a Geheimhaltung<br />
Art. 57 Aufgaben des eigenen Wirkungskreises<br />
Art. 58 Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br />
Art. 59 Zuständigkeit für den <strong>Gesetze</strong>svollzug<br />
4. ABSCHNITT Stadtbezirke und Gemeindeteile<br />
Art. 60 Einteilung in Stadtbezirke<br />
Art. 60 a Ortssprecher<br />
DRITTER TEIL Gemeindewirtschaft<br />
1. ABSCHNITT Haushaltswirtschaft<br />
Art. 61 Allgemeine Haushaltsgrundsätze<br />
Art. 62 Grundsätze der Einnahmebeschaffung<br />
Art. 63 Haushaltssatzung<br />
Art. 64 Haushaltsplan<br />
Art. 65 Erlaß der Haushaltssatzung
Art. 66 Planabweichungen<br />
Art. 67 Verpflichtungsermächtigungen<br />
Art. 68 Nachtragshaushaltssatzungen<br />
Art. 69 Vorläufige Haushaltsführung<br />
Art. 70 Mittelfristige Finanzplanung<br />
2. ABSCHNITT Kreditwesen<br />
Art. 71 Kredite<br />
Art. 72 Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten<br />
Art. 73 Kassenkredite<br />
3. ABSCHNITT Vermögenswirtschaft<br />
Art. 74 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze<br />
Art. 75 Veräußerung von Vermögen<br />
Art. 76 Rücklagen, Rückstellungen<br />
Art. 77 Zwangsvollstreckung in Gemeindevermögen wegen einer<br />
Geldforderung<br />
Artikel 78 und 79<br />
Art. 80 Verbot der Neubegründung; Übertragungsbeschränkungen<br />
Art. 81 Lasten und Ausgaben<br />
Art. 82 Ablösung und Aufhebung<br />
Art. 83 Art und Umfang der Entschädigung<br />
Art. 84 Begriff; Verwaltung<br />
Art. 85 Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebung der<br />
Zweckbestimmung<br />
4. ABSCHNITT Gemeindliche Unternehmen
Art. 86 Rechtsformen<br />
Art. 87 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen<br />
Art. 88 Eigenbetriebe<br />
Art. 89 Selbständige Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts<br />
Art. 90 Organe des Kommunalunternehmens, Personal<br />
Art. 91 Sonstige Vorschriften für Kommunalunternehmen<br />
Art. 92 Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 93 Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 94 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 95 Grundsätze für die Führung gemeindlicher Unternehmen<br />
Art. 96 Anzeigepflichten<br />
Artikel 97 bis 99<br />
5. ABSCHNITT Kassen- und Rechnungswesen<br />
Art. 100 Gemeindekasse<br />
Art. 101 Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften<br />
Art. 102 Rechnungslegung, Jahresabschluss<br />
Art. 102 a Konsolidierter Jahresabschluss<br />
6. ABSCHNITT Prüfungswesen<br />
Art. 103 Örtliche Prüfungen<br />
Art. 104 Rechnungsprüfungsamt<br />
Art. 105 Überörtliche Prüfungen<br />
Art. 106 Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen<br />
Art. 107 Abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen
VIERTER TEIL Staatliche Aufsicht und Rechtsmittel<br />
1. ABSCHNITT Rechtsaufsicht und Fachaufsicht<br />
Art. 108 Sinn der staatlichen Aufsicht<br />
Art. 109 Inhalt und Grenzen der Aufsicht<br />
Art. 110 Rechtsaufsichtsbehörden<br />
Art. 111 Informationsrecht<br />
Art. 112 Beanstandungsrecht<br />
Art. 113 Recht der Ersatzvornahme<br />
Art. 114 Bestellung eines Beauftragten<br />
Art. 115 Fachaufsichtsbehörden<br />
Art. 116 Befugnisse der Fachaufsicht<br />
Art. 117 Genehmigungsbehörde<br />
Art. 117 a Ausnahmegenehmigungen<br />
2. ABSCHNITT Rechtsmittel<br />
Artikel 118<br />
Art. 119 Erlaß des Widerspruchsbescheids (§ 73 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)<br />
Art. 120 Anfechtung aufsichtlicher Verwaltungsakte<br />
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 121 Inkrafttreten<br />
Art. 122 Einwohnerzahl<br />
Art. 123 Ausführungsvorschriften<br />
Art. 124 Einschränkung von Grundrechten
ERSTER TEIL Wesen und Aufgaben der Gemeinde<br />
1. ABSCHNITT Begriff, Benennung und Hoheitszeichen<br />
Bay GO Art. 1 Begriff<br />
1 Die Gemeinden sind ursprüngliche Gebietskörperschaften mit dem Recht, die<br />
örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der <strong>Gesetze</strong> zu ordnen und zu<br />
verwalten. 2 Sie bilden die Grundlagen des Staates und des demokratischen<br />
Lebens.<br />
Bay GO Art. 2 Name<br />
(1) Die Gemeinden haben ein Recht auf ihren geschichtlichen Namen.<br />
(2) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann nach Anhörung des Gemeinderats und<br />
der beteiligten Gemeindebürger<br />
1. wegen eines öffentlichen Bedürfnisses den Namen einer Gemeinde oder<br />
eines Gemeindeteils ändern oder den Namen eines Gemeindeteils<br />
aufheben;<br />
2. einem bewohnten Gemeindeteil einen Namen geben.<br />
(3) 1 Wird eine Gemeinde oder werden Gemeindeteile als Heilbad,<br />
Kneippheilbad oder Schrothheilbad nach Art. 7 Abs. 1 und 5 des<br />
Kommunalabgabengesetzes anerkannt, spricht die Anerkennungsbehörde<br />
auf Antrag der Gemeinde aus, daß die Bezeichnung Bad Bestandteil des<br />
Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils wird. 2 Wird die<br />
Anerkennung aufgehoben, entfällt der Namensbestandteil Bad. 3 Wegen<br />
eines dringenden öffentlichen Bedürfnisses kann die<br />
Anerkennungsbehörde abweichend vom Antrag nach Satz 1 oder von<br />
Satz 2 entscheiden.<br />
(4) Die Entscheidungen und die Änderungen nach den Absätzen 2 und 3 sind<br />
im Staatsanzeiger bekanntzumachen.<br />
Bay GO Art. 3 Städte und Märkte<br />
(1) Städte und Märkte heißen die Gemeinden, die diese Bezeichnung nach<br />
bisherigem Recht führen oder denen sie durch das Staatsministerium des<br />
Innern neu verliehen wird.<br />
(2) Die Bezeichnung Stadt oder Markt darf nur an Gemeinden verliehen<br />
werden, die nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und wirtschaftlichen<br />
Verhältnissen der Bezeichnung entsprechen.<br />
(3) Die Stadt München führt die Bezeichnung Landeshauptstadt.<br />
Bay GO Art. 4 Wappen und Fahnen; Dienstsiegel<br />
(1) 1 Die Gemeinden können ihre geschichtlichen Wappen und Fahnen führen.<br />
2 Sie sind verpflichtet, sich bei der Änderung bestehender und der<br />
Annahme neuer Wappen und Fahnen von der Generaldirektion der<br />
Staatlichen Archive Bayerns beraten zu lassen und, soweit sie deren<br />
Stellungnahme nicht folgen wollen, den Entwurf der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.
(2) 1 Gemeinden mit eigenem Wappen führen dieses in ihrem Dienstsiegel.<br />
2 Die übrigen Gemeinden führen in ihrem Dienstsiegel das kleine<br />
Staatswappen.<br />
(3) Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen der Gemeinde nur mit deren<br />
Genehmigung verwendet werden.<br />
2. ABSCHNITT Rechtsstellung und Wirkungskreis<br />
Bay GO Art. 5 Kreisangehörigkeit und Kreisfreiheit<br />
(1) Die Gemeinden sind kreisangehörig oder kreisfrei.<br />
(2) Kreisfrei sind die Gemeinden, die diese Eigenschaft beim Inkrafttreten<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s besitzen.<br />
(3) 1 Mit Zustimmung des Landtags können Gemeinden mit mehr als 50 000<br />
Einwohnern bei entsprechender Bedeutung nach Anhörung des Kreistags<br />
durch Rechtsverordnung der Staatsregierung für kreisfrei erklärt werden.<br />
2 Hierbei ist auf die Leistungsfähigkeit des Landkreises Rücksicht zu<br />
nehmen. 3 Die Rechtsverordnung kann finanzielle Verpflichtungen der<br />
ausscheidenden Gemeinde gegenüber dem Landkreis festlegen. 4 Im<br />
übrigen werden die vermögensrechtlichen Verhältnisse durch Übereinkunft<br />
zwischen dem Landkreis und der ausscheidenden Gemeinde geregelt.<br />
5 Der Übereinkunft kommt mit dem in ihr bestimmten Zeitpunkt,<br />
frühestens jedoch mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung, unmittelbar<br />
rechtsbegründende Wirkung zu. 6 Kommt eine Übereinkunft nicht<br />
zustande, so entscheiden das Verwaltungsgericht und in der<br />
Berufungsinstanz der Verwaltungsgerichtshof als Schiedsgerichte.<br />
Bay GO Art. 5 a Eingliederung in den Landkreis; Große Kreisstadt<br />
(1) 1 Aus Gründen des öffentlichen Wohls können durch Rechtsverordnung der<br />
Staatsregierung mit Zustimmung des Landtags kreisfreie Gemeinden auf<br />
ihren Antrag oder von Amts wegen nach Anhörung der Gemeinde in einen<br />
Landkreis eingegliedert werden. 2 Der Landkreis ist vorher zu hören; den<br />
Gemeindebürgern soll Gelegenheit gegeben werden, zu der Eingliederung<br />
in geheimer Abstimmung Stellung zu nehmen.<br />
(2) 1 Der Landkreis ist auf Verlangen der eingegliederten Gemeinde<br />
verpflichtet, bisher von der Gemeinde betriebene Einrichtungen zu<br />
übernehmen, wenn deren Betrieb allgemein zu den Aufgaben eines<br />
Landkreises gehört. 2 Die Schulden aus Darlehen für diese Einrichtungen<br />
muß der Landkreis dann und insoweit nicht übernehmen, als die<br />
Übernahme nicht zumutbar ist, insbesondere, wenn für die Einrichtungen<br />
in unverhältnismäßig hohem überdurchschnittlichem Umfang Darlehen<br />
aufgenommen worden sind. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für<br />
die Mitgliedschaft der eingegliederten Gemeinden in einem Zweckverband,<br />
dessen Aufgabe allgemein zu den Aufgaben eines Landkreises gehört.<br />
4<br />
Der Landkreis ist verpflichtet, gemeindliche Angestellte und Arbeiter,<br />
deren Aufgabenbereich auf den Landkreis übergeht, auf deren Verlangen<br />
oder auf Verlangen der eingegliederten Gemeinde in sinngemäßer<br />
Anwendung des Art. 51 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)zu<br />
übernehmen. 5 Art. 5 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 gelten sinngemäß.
(3) 1 Mit dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung (Absatz 1 Satz 1) wird die<br />
bisher kreisfreie Gemeinde Große Kreisstadt. 2 Eine Gemeinde kann auf die<br />
Rechte einer Großen Kreisstadt verzichten; das Staatsministerium des<br />
Innern bestimmt nach Anhörung des Kreistags durch Rechtsverordnung<br />
den Zeitpunkt, zu dem der Verzicht wirksam wird.<br />
(4) Gemeinden mit mehr als 30 000 Einwohnern können auf ihren Antrag<br />
nach Anhörung des Kreistags durch Rechtsverordnung des<br />
Staatsministeriums des Innern zu Großen Kreisstädten erklärt werden,<br />
wenn ihre Leistungs- und Verwaltungskraft die Gewähr dafür bietet, daß<br />
sie die Aufgaben einer Großen Kreisstadt ordnungsgemäß erfüllen können.<br />
Bay GO Art. 6 Allseitiger Wirkungskreis<br />
(1) 1 Den Gemeinden steht in ihrem Gebiet die Erfüllung aller öffentlichen<br />
Aufgaben zu. 2 Ausnahmen bedürfen eines <strong>Gesetze</strong>s.<br />
(2) Die Gemeindeaufgaben sind eigene oder übertragene Angelegenheiten.<br />
Bay GO Art. 7 Eigene Angelegenheiten<br />
(1) Der eigene Wirkungskreis der Gemeinden umfaßt alle Angelegenheiten der<br />
örtlichen Gemeinschaft (Art. 83 Abs. 1 der Verfassung).<br />
(2) 1 In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises handeln die Gemeinden<br />
nach eigenem Ermessen. 2 Sie sind nur an die gesetzlichen Vorschriften<br />
gebunden.<br />
Bay GO Art. 8 Übertragene Angelegenheiten<br />
(1) Der übertragene Wirkungskreis der Gemeinden umfaßt alle<br />
Angelegenheiten, die das Gesetz den Gemeinden zur Besorgung namens<br />
des Staates oder anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts zuweist.<br />
(2) Für die Erledigung übertragener Angelegenheiten können die zuständigen<br />
Staatsbehörden den Gemeinden Weisungen erteilen.<br />
(3) 1 Den Gemeinden, insbesondere den kreisfreien Gemeinden, können<br />
Angelegenheiten auch zur selbständigen Besorgung übertragen werden.<br />
2<br />
Art. 7 Abs. 2 ist hierbei sinngemäß anzuwenden.<br />
(4) Bei der Zuweisung von Angelegenheiten sind gleichzeitig die notwendigen<br />
Mittel zur Verfügung zu stellen.<br />
Bay GO Art. 9 Weitere Aufgaben der kreisfreien Gemeinden und<br />
Großen Kreisstädte<br />
(1) 1 Die kreisfreie Gemeinde erfüllt im übertragenen Wirkungskreis alle<br />
Aufgaben, die sonst vom Landratsamt als der unteren staatlichen<br />
Verwaltungsbehörde wahrzunehmen sind; sie ist insoweit<br />
Kreisverwaltungsbehörde. 2 Sie erfüllt ferner die den Landkreisen<br />
obliegenden Aufgaben des eigenen und des übertragenen<br />
Wirkungskreises.<br />
(2) 1 Die Große Kreisstadt erfüllt im übertragenen Wirkungskreis Aufgaben,<br />
die sonst vom Landratsamt als der unteren staatlichen<br />
Verwaltungsbehörde wahrzunehmen sind in dem Umfang, der durch<br />
Rechtsverordnung der Staatsregierung allgemein bestimmt wird; sie ist
insoweit Kreisverwaltungsbehörde. 2 In der Rechtsverordnung nach<br />
Art. 5 a Abs. 1 oder in einer Rechtsverordnung des Staatsministeriums<br />
des Innern können ihr weitere Aufgaben der unteren staatlichen<br />
Verwaltungsbehörde und auf Antrag mit Zustimmung des Kreistags auch<br />
einzelne Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises der Landkreise<br />
übertragen werden.<br />
3. ABSCHNITT Gemeindegebiet und gemeindefreies Gebiet<br />
Bay GO Art. 10 Gemeindegebiet und Bestandsgarantie<br />
(1) 1 Jeder Teil des Staatsgebiets ist grundsätzlich einer Gemeinde<br />
zugewiesen. 2 Die Gesamtheit der zu einer Gemeinde gehörenden<br />
Grundstücke bildet das Gemeindegebiet.<br />
(2) Die Gemeinden haben ein Recht auf Erhaltung ihres Bestands und ihres<br />
Gebiets unbeschadet der Vorschrift des Art. 11.<br />
Bay GO Art. 10 a Gemeindefreie Gebiete<br />
(1) Die keiner Gemeinde zugewiesenen Teile des Staatsgebiets sind<br />
gemeindefreie (ausmärkische) Gebiete.<br />
(2) 1 Die Aufgaben, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erfüllt werden<br />
müssen und die in den kreisangehörigen Gemeinden zum eigenen<br />
Wirkungskreis gehören, nimmt im gemeindefreien Gebiet der<br />
Grundstückseigentümer auf seine Kosten wahr. 2 Gehören die Grundstücke<br />
verschiedenen Eigentümern, so erfüllen diese die Aufgaben gemeinsam<br />
und tragen die Kosten anteilig nach dem Verhältnis der Größe der Fläche<br />
ihrer im gemeindefreien Gebiet gelegenen Grundstücke; forstwirtschaftlich<br />
genutzte Flächen sind zu zwei Dritteln und minderwertige<br />
landwirtschaftliche Nutzflächen (insbesondere Hutungen, Streuwiesen und<br />
Ödländereien) zu einem Drittel anzurechnen. 3 Die Grundstückseigentümer<br />
können die Verteilung der Aufgaben und die Kostentragung mit<br />
Genehmigung der Aufsichtsbehörde in anderer Weise vereinbaren, wenn<br />
dadurch die Erfüllung der Aufgaben nicht gefährdet wird.<br />
(3) 1 Wenn es zur ordnungsmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2<br />
erforderlich ist, kann die Aufsichtsbehörde den Eigentümer der größten<br />
anrechenbaren Grundstücksfläche verpflichten, die Aufgaben im ganzen<br />
gemeindefreien Gebiet zu erfüllen; die anderen Grundstückseigentümer<br />
haben sich an den notwendigen Kosten, die hieraus entstehen, nach dem<br />
Verhältnis der anrechenbaren Größe ihrer Grundstücksflächen zu<br />
beteiligen. 2 Werden die Kosten nicht innerhalb von drei Monaten erstattet,<br />
so setzt die Aufsichtsbehörde die auf die einzelnen<br />
Grundstückseigentümer entfallenden Erstattungsbeträge fest und zieht sie<br />
für den verpflichteten Grundstückseigentümer wie Verwaltungskosten ein.<br />
(4) 1 Bewirkt die Kostenverteilung nach dem Verhältnis der anrechenbaren<br />
Größe der Grundstücksflächen (Absatz 2 Satz 2) für einzelne Eigentümer<br />
eine besondere Härte und kommt eine Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 3<br />
innerhalb einer auf Antrag eines Beteiligten von der Aufsichtsbehörde zu<br />
setzenden Frist von drei Monaten nicht zustande, so setzt die
Aufsichtsbehörde die von den einzelnen Grundstückseigentümern zu<br />
tragenden Kostenanteile fest. 2 Absatz 3 Satz 2 gilt sinngemäß.<br />
(5) 1 Die hoheitlichen Befugnisse, die im Gemeindegebiet den<br />
kreisangehörigen Gemeinden zustehen, übt im gemeindefreien Gebiet das<br />
Landratsamt als untere staatliche Verwaltungsbehörde aus. 2 Es erledigt<br />
ferner alle Aufgaben, die zum übertragenen Wirkungskreis einer Gemeinde<br />
gehören.<br />
(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht, soweit die Erfüllung von Aufgaben des<br />
eigenen Wirkungskreises oder die Ausübung hoheitlicher Befugnisse und<br />
die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im<br />
gemeindefreien Gebiet durch besondere Rechtsvorschriften anders<br />
geregelt sind.<br />
(7) 1 Aufsichtsbehörde über die gemeindefreien Gebiete für die Aufgaben nach<br />
den Absätzen 2 bis 4 ist das Landratsamt als untere staatliche<br />
Verwaltungsbehörde. 2 Für die Aufsicht gelten die Art. 108, 109 Abs. 1 und<br />
Art. 111 bis 113 entsprechend.<br />
(8) Die gemeindefreien Gebiete oder Teile hiervon werden vom Landratsamt<br />
benannt.<br />
Bay GO Art. 11 Änderungen<br />
(1) 1 Gemeindefreie Gebiete oder Teile hiervon sind auf Antrag angrenzender<br />
Gemeinden in diese einzugliedern, wenn nicht dringende Gründe des<br />
öffentlichen Wohls entgegenstehen. 2 Beantragen mehrere Gemeinden die<br />
Eingliederung, so richtet sich die Entscheidung darüber, ob und in<br />
welchem Umfang den Anträgen stattgegeben wird, nach Gründen des<br />
öffentlichen Wohls. 3 Aus den gleichen Gründen können Entscheidungen<br />
nach den Sätzen 1 und 2 auch von Amts wegen getroffen werden; dabei<br />
können auch neue Gemeinden gebildet werden. 4 Falls dringende Gründe<br />
des öffentlichen Wohls vorliegen, können auf Antrag oder von Amts wegen<br />
unbewohntes Gemeindegebiet oder Teile hiervon einem gemeindefreien<br />
Gebiet angegliedert oder zu einem neuen gemeindefreien Gebiet erklärt<br />
werden. 5 Vor der Änderung sind die beteiligten Gemeinden und<br />
Landkreise sowie die Eigentümer der gemeindefreien Grundstücke im<br />
Änderungsgebiet zu hören. 6 Für die Kreisbürger, die seit mindestens<br />
sechs Monaten im Änderungsgebiet ihren Aufenthalt haben, kann eine<br />
geheime Abstimmung angeordnet werden.<br />
(2) 1 Änderungen im Bestand oder Gebiet von Gemeinden können<br />
unbeschadet des Absatzes 1 vorgenommen werden,<br />
1. wenn Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen und die beteiligten<br />
Gemeinden einverstanden sind,<br />
2. gegen den Willen beteiligter Gemeinden, wenn dringende Gründe des<br />
öffentlichen Wohls vorliegen.<br />
2<br />
Vor Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 2 sind die beteiligten Gemeinden zu<br />
hören.<br />
(3) Eine Gemeinde kann durch Ausgliederung aus einer bestehenden<br />
Gemeinde gebildet werden, wenn<br />
1. Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen,<br />
2. die zu bildende Gemeinde mindestens 2 000 Einwohner hat oder
Mitgliedsgemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft wird und<br />
3. die bestehende Gemeinde mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der<br />
Mitglieder des Gemeinderats zustimmt.<br />
(4) Den Gemeindebürgern, deren gemeindliche Zugehörigkeit wechselt, soll<br />
Gelegenheit gegeben werden, zu der Änderung, bei der Bildung einer<br />
Gemeinde auch zu deren Namen, in geheimer Abstimmung Stellung zu<br />
nehmen.<br />
Bay GO Art. 12 Zuständige Behörde; Fortgeltung des Ortsrechts<br />
(1) 1 Die in Art. 11 genannten Änderungen werden durch Gesetz<br />
vorgenommen, wenn dadurch eine Gemeinde im Bestand geändert oder<br />
neu gebildet wird. 2 Die übrigen in Art. 11 genannten Änderungen werden<br />
durch Rechtsverordnung vorgenommen; diese erläßt das Landratsamt,<br />
wenn nur Teile von Gemeindegebiet umgemeindet werden, die von nicht<br />
mehr als 50 Einwohnern bewohnt werden, sonst die Regierung. 3 Die<br />
Regierung kann in der Rechtsverordnung, für deren Erlaß sie zuständig ist,<br />
auch Teile von Gemeindegebieten, die von nicht mehr als 50 Einwohnern<br />
bewohnt werden, umgemeinden, wenn die Umgemeindung mit der<br />
anderen Änderung rechtlich oder sachlich zusammenhängt.<br />
(2) 1 Wird eine Gemeinde durch Ausgliederung aus einer bestehenden<br />
Gemeinde gebildet, gilt das Ortsrecht in seinem bisherigen<br />
Geltungsbereich fort. 2 Bei Gebietsänderungen erstreckt sich das Ortsrecht<br />
der aufnehmenden Gemeinde auf das aufgenommene Gebiet, wenn nicht<br />
in der Vorschrift über die Gebietsänderung etwas Abweichendes bestimmt<br />
ist.<br />
Bay GO Art. 13 Weitere Folgen der Änderungen<br />
(1) 1 Unbeschadet des Art. 9 Abs. 2 Satz 3 der Bezirksordnung und des Art. 9<br />
Abs. 2 Satz 3 der Landkreisordnung regelt im Fall des Art. 12 Abs. 1<br />
Satz 1 die Regierung, im Übrigen die gemäß Art. 12 Abs. 1 Sätze 2 und 3<br />
zuständige Behörde die mit der Änderung zusammenhängenden weiteren<br />
Rechts- und Verwaltungsfragen. 2 Sie kann insbesondere eine Neuwahl<br />
oder Ergänzung der gemeindlichen Vertretungsorgane für den Rest der<br />
Wahlzeit anordnen. 3 Beträgt der Rest der Wahlzeit weniger als zwei Jahre,<br />
so kann die zuständige Behörde bestimmen, daß die Wahlzeit der neu<br />
gewählten Vertretungsorgane erst mit Ablauf der folgenden Wahlzeit<br />
endet.<br />
(2) 1 Die vermögensrechtlichen Verhältnisse werden durch Übereinkunft der<br />
beteiligten Gemeinden geregelt. 2 Der Übereinkunft kommt mit dem in ihr<br />
bestimmten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Rechtswirksamkeit der<br />
Änderung, unmittelbar rechtsbegründende Wirkung zu. 3 Kommt eine<br />
Übereinkunft nicht zustande, so entscheiden das Verwaltungsgericht und<br />
in der Berufungsinstanz der Verwaltungsgerichtshof als Schiedsgerichte.<br />
(3) Soweit der Aufenthalt Voraussetzung für Rechte und Pflichten ist, gilt in<br />
den Fällen des Art. 11 der vor der Änderung liegende Aufenthalt im<br />
Änderungsgebiet als Aufenthalt in der neuen Gemeinde.
Bay GO Artikel 13 a (weggefallen)<br />
Bay GO Art. 14 Bekanntmachung; Gebühren<br />
(1) Rechtsverordnungen nach Art. 12 sind, soweit sie vom Landratsamt<br />
erlassen werden, gemäß Art. 51 Abs. 1 des Landesstraf- und<br />
Verordnungsgesetzes in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 der<br />
Landkreisordnung, soweit sie von der Regierung erlassen werden, im<br />
Amtsblatt der Regierung bekanntzumachen.<br />
(2) 1 Für Änderungen nach Art. 11 und Rechtshandlungen, die aus Anlaß<br />
solcher Änderungen erforderlich sind, werden Abgaben (insbesondere<br />
auch die Kosten nach dem Gerichtskostengesetz und der Kostenordnung<br />
einschließlich der Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren) nicht<br />
erhoben, soweit eine Befreiung landesrechtlich zulässig ist. 2 Auslagen<br />
werden nicht ersetzt.<br />
4. ABSCHNITT Rechte und Pflichten der Gemeindeangehörigen<br />
Bay GO Art. 15 Einwohner und Bürger<br />
(1) 1 Gemeindeangehörige sind alle Gemeindeeinwohner. 2 Sie haben<br />
gegenüber der Gemeinde die gleichen Rechte und Pflichten. 3 Ausnahmen<br />
bedürfen eines besonderen Rechtstitels.<br />
(2) Gemeindebürger sind die Gemeindeangehörigen, die in ihrer Gemeinde<br />
das Recht, an den Gemeindewahlen teilzunehmen, besitzen.<br />
Bay GO Art. 16 Ehrenbürgerrecht<br />
(1) Die Gemeinden können Persönlichkeiten, die sich um sie besonders<br />
verdient gemacht haben, zu Ehrenbürgern ernennen.<br />
(2) Die Gemeinden können die Ernennung zu Ehrenbürgern wegen<br />
unwürdigen Verhaltens widerrufen; der Beschluß bedarf einer Mehrheit<br />
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderats.<br />
Bay GO Art. 17 Wahlrecht<br />
Die Gemeindebürger wählen den Gemeinderat und mit der Mehrheit der<br />
abgegebenen gültigen Stimmen den ersten Bürgermeister.<br />
Bay GO Art. 18 Mitberatungsrecht (Bürgerversammlung)<br />
(1) 1 In jeder Gemeinde hat der erste Bürgermeister mindestens einmal<br />
jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine<br />
Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten<br />
einzuberufen. 2 In größeren Gemeinden sollen Bürgerversammlungen auf<br />
Teile des Gemeindegebiets beschränkt werden.<br />
(2) 1 Eine Bürgerversammlung muß innerhalb von drei Monaten stattfinden,<br />
wenn das von mindestens 5 v. H., in den Gemeinden mit mehr als 10 000<br />
Einwohnern von mindestens 2,5 v. H. der Gemeindebürger unter Angabe<br />
der Tagesordnung schriftlich beantragt wird; die Bürgerversammlung kann<br />
eine Ergänzung der Tagesordnung beschließen, wenn es spätestens eine<br />
Woche vor der Bürgerversammlung bei der Gemeinde schriftlich beantragt
wird. 2 Die Tagesordnung darf nur gemeindliche Angelegenheiten zum<br />
Gegenstand haben. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für<br />
Gemeindeteile, die bei Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s noch selbständige<br />
Gemeinden waren, und in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern für<br />
Stadtbezirke; die Tagesordnungspunkte sollen sich vor allem auf den<br />
Gemeindeteil oder Stadtbezirk beziehen. 4 Die Einberufung einer<br />
Bürgerversammlung nach den Sätzen 1 und 3 kann nur einmal jährlich<br />
beantragt werden.<br />
(3) 1 Das Wort können grundsätzlich nur Gemeindebürger erhalten.<br />
2<br />
Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen; der Vorsitzende<br />
soll einem Vertreter der Aufsichtsbehörde auf Verlangen das Wort erteilen.<br />
3<br />
Den Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder ein<br />
von ihm bestellter Vertreter.<br />
(4) 1 Empfehlungen der Bürgerversammlungen müssen innerhalb einer Frist<br />
von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt werden. 2 Diese Frist und<br />
die Frist nach Absatz 2 Satz 1 ruhen während der gemäß Art. 32 Abs. 4<br />
Satz 1 bestimmten Ferienzeit.<br />
Bay GO Art. 18 a Bürgerbegehren und Bürgerentscheid<br />
(1) Die Gemeindebürger können über Angelegenheiten des eigenen<br />
Wirkungskreises der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen<br />
(Bürgerbegehren).<br />
(2) Der Gemeinderat kann beschließen, daß über eine Angelegenheit des<br />
eigenen Wirkungskreises der Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfindet.<br />
(3) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über Angelegenheiten, die kraft<br />
Gesetz dem ersten Bürgermeister obliegen, über Fragen der inneren<br />
Organisation der Gemeindeverwaltung, über die Rechtsverhältnisse der<br />
Gemeinderatsmitglieder, der Bürgermeister und der<br />
Gemeindebediensteten und über die Haushaltssatzung.<br />
(4) 1 Das Bürgerbegehren muss bei der Gemeinde eingereicht werden und<br />
eine mit Ja oder Nein zu entscheidende Fragestellung und eine<br />
Begründung enthalten sowie bis zu drei Personen benennen, die<br />
berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. 2 Für den Fall ihrer<br />
Verhinderung oder ihres Ausscheidens können auf den Unterschriftenlisten<br />
zusätzlich stellvertretende Personen benannt werden.<br />
(5) 1 Das Bürgerbegehren kann nur von Personen unterzeichnet werden, die<br />
am Tage der Einreichung des Bürgerbegehrens Gemeindebürger sind.<br />
2<br />
Für die Feststellung der Zahl der gültigen Unterschriften ist das von der<br />
Gemeinde zum <strong>Stand</strong> dieses Tages anzulegende Bürgerverzeichnis<br />
maßgebend.<br />
(6) Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden<br />
bis zu 10.000 Einwohnern von mindestens 10 v. H.,<br />
bis zu 20.000 Einwohnern von mindestens 9 v. H.,<br />
bis zu 30.000 Einwohnern von mindestens 8 v. H.,<br />
bis zu 50.000 Einwohnern von mindestens 7 v. H.,<br />
bis zu 100.000 Einwohnern von mindestens 6 v. H.,
is zu 500.000 Einwohnern von mindestens 5 v. H.,<br />
mit mehr als 500.000 Einwohnern von mindestens 3 v. H.<br />
der Gemeindebürger unterschrieben sein.<br />
(7) weggefallen<br />
(8) 1 Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat<br />
unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung des<br />
Bürgerbegehrens. 2 Gegen die Entscheidung können die<br />
vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens ohne<br />
Vorverfahren Klage erheben.<br />
(9) Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur<br />
Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren<br />
entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr<br />
getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr<br />
begonnen werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche<br />
Verpflichtungen der Gemeinde hierzu bestanden.<br />
(10) 1 Der Bürgerentscheid ist an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten<br />
nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens<br />
durchzuführen; der Gemeinderat kann die Frist im Einvernehmen mit den<br />
vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens um höchstens<br />
drei Monate verlängern. 2 Die Kosten des Bürgerentscheids trägt die<br />
Gemeinde. 3 Stimmberechtigt ist jeder Gemeindebürger. 4 Die Möglichkeit<br />
der brieflichen Abstimmung ist zu gewährleisten.<br />
(11) 1 Ist in einem Stadtbezirk ein Bezirksausschuß gebildet worden, so kann<br />
über Angelegenheiten, die diesem Bezirksausschuß zur Entscheidung<br />
übertragen sind, auch innerhalb des Stadtbezirks ein Bürgerentscheid<br />
stattfinden. 2 Stimmberechtigt ist jeder im Stadtbezirk wohnhafte<br />
Gemeindebürger. 3 Das Bürgerbegehren ist beim Bezirksausschuss zur<br />
Weiterleitung an den Stadtrat einzureichen. 4 Die Vorschriften der<br />
Absätze 2 bis 16 finden entsprechend Anwendung.<br />
(12) 1 Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne<br />
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der abgegebenen gültigen<br />
Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit in Gemeinden<br />
bis zu 50.000 Einwohner mindestens 20 v. H.,<br />
bis zu 100.000 Einwohnern mindestens 15 v. H.,<br />
mit mehr als 100.000 Einwohnern mindestens 10 v. H.<br />
der Stimmberechtigten beträgt. 2 Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als<br />
mit Nein beantwortet. 3 Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide<br />
stattfinden, hat der Gemeinderat eine Stichfrage für den Fall zu beschließen,<br />
dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander<br />
nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden (Stichentscheid). 4 Es<br />
gilt dann diejenige Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit<br />
der abgegebenen gültigen Stimmen ausspricht. 5 Bei Stimmengleichheit im<br />
Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten<br />
Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.<br />
(13) 1 Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses des<br />
Gemeinderates. 2 Der Bürgerentscheid kann innerhalb eines Jahres nur
durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden, es sei denn, dass<br />
sich die dem Bürgerentscheid zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage<br />
wesentlich geändert hat.<br />
(14) 1 Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung<br />
der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. 2 Für einen<br />
Beschluss nach Satz 1 gilt die Bindungswirkung des Absatzes 13 Satz 2<br />
entsprechend.<br />
(15) 1 Die im Gemeinderat und die von den vertretungsberechtigten Personen<br />
des Bürgerbegehrens vertretenen Auffassungen zum Gegenstand des<br />
Bürgerentscheids dürfen in Veröffentlichungen und Veranstaltungen der<br />
Gemeinde nur in gleichem Umfang dargestellt werden. 2 Zur Information<br />
der Bürgerinnen und Bürger werden von der Gemeinde den Beteiligten die<br />
gleichen Möglichkeiten wie bei Gemeinderatswahlen eröffnet.<br />
(16) Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist in der Gemeinde in der ortsüblichen<br />
Weise bekanntzumachen.<br />
(17) 1 Die Gemeinden können das Nähere durch Satzung regeln. 2 Das Recht<br />
auf freies Unterschriftensammeln darf nicht eingeschränkt werden.<br />
(18) Art. 3 a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine<br />
Anwendung.<br />
Bay GO Art. 18 b Bürgerantrag<br />
(1) 1 Die Gemeindebürger können beantragen, dass das zuständige<br />
Gemeindeorgan eine gemeindliche Angelegenheit behandelt<br />
(Bürgerantrag). 2 Ein Bürgerantrag darf nicht Angelegenheiten zum<br />
Gegenstand haben, für die innerhalb eines Jahres vor Antragseinreichung<br />
bereits ein Bürgerantrag gestellt worden ist.<br />
(2) 1 Der Bürgerantrag muss bei der Gemeinde eingereicht werden, eine<br />
Begründung enthalten und bis zu drei Personen benennen, die berechtigt<br />
sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. 2 Für den Fall ihrer Verhinderung<br />
oder ihres Ausscheidens können auf den Unterschriftenlisten zusätzlich<br />
stellvertretende Personen benannt werden.<br />
(3) 1 Der Bürgerantrag muss von mindestens 1 v.H. der Gemeindeeinwohner<br />
unterschrieben sein. 2 Unterschriftsberechtigt sind die Gemeindebürger.<br />
(4) Über die Zulässigkeit eines Bürgerantrags entscheidet das für die<br />
Behandlung der Angelegenheit zuständige Gemeindeorgan innerhalb eines<br />
Monats seit der Einreichung des Bürgerantrags.<br />
(5) Ist die Zulässigkeit des Bürgerantrags festgestellt, hat ihn das zuständige<br />
Gemeindeorgan innerhalb von drei Monaten zu behandeln.<br />
(6) 1 In Gemeinden, in denen Bezirksausschüsse gebildet sind, können in<br />
Angelegenheiten, für die die Bezirksausschüsse zuständig sind,<br />
Bürgeranträge gestellt werden. 2 Hierfür gelten die Absätze 1 bis 5<br />
entsprechend mit der Maßgabe, dass<br />
1. unterschriftsberechtigt nur ist, wer im Zuständigkeitsbereich des<br />
Bezirksausschusses Gemeindebürger ist,<br />
2. sich die erforderliche Unterschriftenzahl nach der Einwohnerzahl des<br />
Stadtbezirks berechnet,
3. der Bezirksausschuss über die Zulässigkeit des Bürgerantrags und über<br />
für zulässig erklärte Bürgeranträge entscheidet.<br />
(7) Die Fristen nach den Absätzen 4 und 5 ruhen während der gemäß Art. 32<br />
Abs. 4 Satz 1 bestimmten Ferienzeit.<br />
(8) Art. 3 a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine<br />
Anwendung.<br />
Bay GO Art. 19 Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
(1) 1 Die Gemeindebürger sind zur Übernahme gemeindlicher Ehrenämter<br />
verpflichtet. 2 Sie können nur aus wichtigem Grund die Übernahme von<br />
Ehrenämtern ablehnen oder ein Ehrenamt niederlegen. 3 Als wichtiger<br />
Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der Verpflichtete die Tätigkeit<br />
nicht ordnungsgemäß ausüben kann. 4 Wer ohne wichtigen Grund die<br />
Übernahme eines Ehrenamts ablehnt oder ein Ehrenamt niederlegt, kann<br />
mit Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro belegt werden.<br />
(2) 1 Ehrenamtlich tätige Personen können von der Stelle, die sie berufen hat,<br />
abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2 Ein solcher liegt<br />
auch dann vor, wenn die ehrenamtlich tätige Person ihre Pflichten gröblich<br />
verletzt oder sich als unwürdig erwiesen hat.<br />
(3) Die besonderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.<br />
Bay GO Art. 20 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht<br />
(1) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger sind verpflichtet, ihre Obliegenheiten<br />
gewissenhaft wahrzunehmen.<br />
(2) 1 Sie haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit<br />
bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren; das<br />
gilt nicht für Mitteilungen im amtlichen Verkehr und über Tatsachen, die<br />
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung<br />
bedürfen. 2 Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheimzuhaltenden<br />
Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. 3 Sie haben auf Verlangen des<br />
Gemeinderats amtliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche<br />
Darstellungen und Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge<br />
herauszugeben, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt. 4 Diese<br />
Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung des Ehrenamts fort. 5 Die<br />
Herausgabepflicht trifft auch die Hinterbliebenen und Erben.<br />
(3) 1 Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger dürfen ohne Genehmigung über<br />
Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu bewahren haben,<br />
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen<br />
abgeben. 2 Die Genehmigung erteilt der erste Bürgermeister. 3 Über die<br />
Versagung der Genehmigung, als Zeuge auszusagen, entscheidet die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde; im übrigen gelten Art. 84 Abs. 3 und 4 des<br />
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.<br />
(4) 1 Wer den Verpflichtungen der Absätze 1, 2 oder 3 Satz 1 schuldhaft<br />
zuwiderhandelt, kann im Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu<br />
zweihundertfünfzig Euro, bei unbefugter Offenbarung personenbezogener<br />
Daten bis zu fünfhundert Euro, belegt werden; die Verantwortlichkeit nach<br />
anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. 2 Die Haftung<br />
gegenüber der Gemeinde richtet sich nach den für den ersten
Bürgermeister geltenden Vorschriften und tritt nur ein, wenn Vorsatz oder<br />
grobe Fahrlässigkeit zur Last liegt. 3 Die Gemeinde stellt die<br />
Verantwortlichen von der Haftung frei, wenn sie von Dritten unmittelbar in<br />
Anspruch genommen werden und der Schaden weder vorsätzlich noch<br />
grob fahrlässig verursacht worden ist.<br />
(5) Für die ehrenamtlichen Bürgermeister gelten die besonderen gesetzlichen<br />
Vorschriften.<br />
Bay GO Art. 20 a Entschädigung<br />
(1) 1 Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger haben Anspruch auf angemessene<br />
Entschädigung. 2 Das Nähere wird durch Satzung bestimmt. 3 Auf die<br />
Entschädigung kann nicht verzichtet werden. 4 Der Anspruch ist nicht<br />
übertragbar.<br />
(2) Ehrenamtlich tätige Gemeindebürger erhalten ferner für die nach Maßgabe<br />
näherer Bestimmung in der Satzung zur Wahrnehmung des Ehrenamts<br />
notwendige Teilnahme an Sitzungen, Besprechungen oder anderen<br />
Veranstaltungen folgende Ersatzleistungen:<br />
1. Angestellten und Arbeitern wird der ihnen entstandene nachgewiesene<br />
Verdienstausfall ersetzt.<br />
2. Selbständig Tätige können für die ihnen entstehende Zeitversäumnis<br />
eine Verdienstausfallentschädigung erhalten. Die Entschädigung wird auf<br />
der Grundlage eines satzungsmäßig festgelegten Pauschalsatzes gewährt.<br />
Wegezeiten können in angemessenem Umfang berücksichtigt werden.<br />
3. Personen, die keine Ersatzansprüche nach Nummern 1 und 2 haben,<br />
denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht,<br />
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die<br />
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, können eine<br />
Entschädigung erhalten. Die Entschädigung wird auf der Grundlage eines<br />
satzungsmäßig festgelegten Pauschalsatzes gewährt. Der Pauschalsatz<br />
darf nicht höher sein als der Pauschalsatz nach Nummer 2. Wegezeiten<br />
können in angemessenem Umfang berücksichtigt werden.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für den ersten Bürgermeister und für die<br />
berufsmäßigen weiteren Bürgermeister.<br />
(4) 1 Vergütungen für Tätigkeiten, die ehrenamtlich tätige Gemeindebürger<br />
kraft Amtes oder auf Vorschlag oder Veranlassung der Gemeinde in einem<br />
Aufsichtsrat, Vorstand oder sonstigen Organ oder Gremium eines<br />
privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmens<br />
wahrnehmen, sind an die Gemeinde abzuführen, soweit sie insgesamt<br />
einen Betrag von 4 908 Euro im Kalenderjahr übersteigen. 2 Von der<br />
Gemeinde veranlasst sind auch Tätigkeiten, die von einem Unternehmen,<br />
an dem sie unmittelbar oder mittelbar ganz oder mehrheitlich beteiligt ist,<br />
einem ehrenamtlich tätigen Gemeindebürger übertragen werden. 3 Der<br />
Betrag verdoppelt sich für Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eines<br />
vergleichbaren Organs der in Satz 1 genannten Unternehmen und erhöht<br />
sich für deren Stellvertreter um 50 v. H. 4 Bei der Festsetzung des<br />
abzuführenden Betrags sind von den Vergütungen Aufwendungen<br />
abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich<br />
entstanden sind. 5 Die Ablieferungsregelungen nach dem<br />
beamtenrechtlichen Nebentätigkeitsrecht finden keine Anwendung.
Bay GO Art. 21 Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der<br />
Gemeindelasten<br />
(1) 1 Alle Gemeindeangehörigen sind nach den bestehenden allgemeinen<br />
Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu<br />
benutzen. 2 Sie sind verpflichtet, die Gemeindelasten zu tragen.<br />
(2) 1 Mehrere technisch selbständige Anlagen der Gemeinde, die demselben<br />
Zweck dienen, können eine Einrichtung oder einzelne rechtlich<br />
selbständige Einrichtungen bilden. 2 Die Gemeinde entscheidet das durch<br />
Satzung; trifft sie keine Regelung, liegt nur eine Einrichtung vor.<br />
(3) Auswärts wohnende Personen haben für ihren Grundbesitz oder ihre<br />
gewerblichen Niederlassungen im Gemeindegebiet gegenüber der<br />
Gemeinde die gleichen Rechte und Pflichten wie ortsansässige<br />
Grundbesitzer und Gewerbetreibende.<br />
(4) Die Vorschriften in den Absätzen 1 und 3 finden auf juristische Personen<br />
und Personenvereinigungen entsprechende Anwendung.<br />
(5) Die Benutzung der öffentlichen, dem Gemeingebrauch dienenden<br />
Einrichtungen steht nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften<br />
jedermann zu.<br />
5. ABSCHNITT Gemeindehoheit<br />
Bay GO Art. 22 Verwaltungs- und Finanzhoheit<br />
(1) Die Hoheitsgewalt der Gemeinde umfaßt das Gemeindegebiet und seine<br />
gesamte Bevölkerung (Gemeindehoheit).<br />
(2) 1 Die Gemeinden haben das Recht, ihr Finanzwesen im Rahmen der<br />
gesetzlichen Bestimmungen selbst zu regeln. 2 Sie sind insbesondere<br />
befugt, zur Deckung des für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen<br />
Finanzbedarfs Abgaben nach Maßgabe der <strong>Gesetze</strong> zu erheben, soweit<br />
ihre sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. 3 Zu diesem Zweck ist ihnen<br />
das Recht zur Erhebung eigener Steuern und sonstiger Abgaben im<br />
ausreichenden Maß zu gewährleisten.<br />
(3) Der Staat hat den Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben weitere Mittel<br />
im Rahmen des Staatshaushalts zuzuweisen.<br />
Bay GO Art. 23 Ortsrecht<br />
1 Die Gemeinden können zur Regelung ihrer Angelegenheiten Satzungen<br />
erlassen. 2 Satzungen zur Regelung übertragener Angelegenheiten, bewehrte<br />
Satzungen (Art. 24 Abs. 2) und Verordnungen sind nur in den gesetzlich<br />
bestimmten Fällen zulässig. 3 In solchen Satzungen und in Verordnungen soll<br />
ihre besondere Rechtsgrundlage angegeben werden.<br />
Bay GO Art. 24 Inhalt der Satzungen<br />
(1) In den Satzungen können die Gemeinden insbesondere<br />
1. die Benutzung ihres Eigentums und ihrer öffentlichen Einrichtungen<br />
regeln,<br />
2. aus Gründen des öffentlichen Wohls den Anschluß an die<br />
Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallentsorgung, die
Straßenreinigung und ähnliche der Gesundheit dienende Einrichtungen<br />
vorschreiben und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Vorschriften die<br />
Benutzung dieser Einrichtungen sowie der Bestattungseinrichtungen und<br />
von Schlachthöfen zur Pflicht machen,<br />
3. für Grundstücke, die einer neuen Bebauung zugeführt werden, und in<br />
Sanierungsgebieten den Anschluß an Einrichtungen zur Versorgung mit<br />
Fernwärme und deren Benutzung zur Pflicht machen, sofern der Anschluß<br />
aus besonderen städtebaulichen Gründen oder zum Schutz vor<br />
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinn des Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetzes notwendig ist; ausgenommen sind Grundstücke<br />
mit emissionsfreien Heizeinrichtungen,<br />
4. Gemeindedienste (Hand- und Spanndienste) zur Erfüllung<br />
gemeindlicher Aufgaben unter angemessener Berücksichtigung der<br />
persönlichen Verhältnisse der Pflichtigen anordnen.<br />
(2) 1 In den Satzungen kann die Ersatzvornahme auf Kosten säumiger<br />
Verpflichteter für zulässig erklärt werden. 2 In den Fällen des Absatzes 1<br />
Nrn. 1 bis 3 können in der Satzung Zuwiderhandlungen als<br />
Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro<br />
bedroht werden (bewehrte Satzung). 3 In Satzungen nach Absatz 1 Nrn. 2<br />
und 3 kann vorgeschrieben werden, daß Eigentümer das Anbringen und<br />
Verlegen örtlicher Leitungen für die Wasserversorgung, die<br />
Abwasserbeseitigung und die Versorgung mit Fernwärme auf ihrem<br />
Grundstück zu dulden haben, wenn dieses an die Einrichtung<br />
angeschlossen oder anzuschließen ist, in wirtschaftlichem Zusammenhang<br />
mit der Einrichtung benutzt wird oder wenn die Möglichkeit der<br />
Inanspruchnahme der Einrichtung für das Grundstück sonst vorteilhaft ist;<br />
die Duldungspflicht entfällt, wenn die Inanspruchnahme des Grundstücks<br />
Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten<br />
würde.<br />
(3) In Satzungen nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 und in Satzungen, die auf Grund<br />
anderer <strong>Gesetze</strong>, die auf diesen Artikel verweisen, erlassen werden, kann<br />
bestimmt werden, daß die von der Gemeinde mit dem Vollzug dieser<br />
Satzungen beauftragten Personen berechtigt sind, zur Überwachung der<br />
Pflichten, die sich nach diesen Satzungen und <strong>Gesetze</strong>n ergeben, zu<br />
angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen,<br />
Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten.<br />
(4) 1 Ein Benutzungszwang nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 darf nicht zum<br />
Nachteil von Einrichtungen der Kirchen, anerkannter<br />
Religionsgemeinschaften oder solcher weltanschaulicher Gemeinschaften<br />
verfügt werden, deren Bestrebungen den allgemein geltenden <strong>Gesetze</strong>n<br />
nicht widersprechen. 2 Voraussetzung ist, daß diese Einrichtungen<br />
unmittelbar religiösen oder weltanschaulichen Zwecken dienen.<br />
Bay GO Artikel 25 (weggefallen)<br />
Bay GO Art. 26 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung<br />
(1) 1 Satzungen treten eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2 In<br />
der Satzung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt werden, in bewehrten<br />
Satzungen und anderen Satzungen, die nicht mit rückwirkender Kraft
erlassen werden dürfen, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung<br />
folgende Tag.<br />
(2) 1 Satzungen sind auszufertigen und im Amtsblatt der Gemeinde amtlich<br />
bekanntzumachen; das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft gilt als<br />
Amtsblatt der Gemeinde, wenn die Gemeinde, die einer<br />
Verwaltungsgemeinschaft angehört, kein eigenes Amtsblatt unterhält.<br />
2<br />
Hat die Gemeinde kein Amtsblatt im Sinn des Satzes 1, so sind die<br />
Satzungen im Amtsblatt des Landkreises oder des Landratsamts, sonst in<br />
anderen regelmäßig erscheinenden Druckwerken amtlich<br />
bekanntzumachen; die amtliche Bekanntmachung kann auch dadurch<br />
bewirkt werden, daß die Satzung in der Verwaltung der Gemeinde<br />
niedergelegt und die Niederlegung durch Anschlag an den für öffentliche<br />
Bekanntmachungen allgemein bestimmten Stellen (Gemeindetafeln) oder<br />
durch Mitteilung in einer Tageszeitung bekanntgegeben wird.<br />
Bay GO Art. 27 Verwaltungsverfügungen; Zwangsmaßnahmen<br />
(1) Die Gemeinden können im eigenen und übertragenen Wirkungskreis die<br />
zur Durchführung von <strong>Gesetze</strong>n, Rechtsverordnungen und Satzungen<br />
notwendigen Verfügungen an bestimmte Personen erlassen und unter<br />
Anwendung der gesetzlichen Zwangsmittel vollziehen.<br />
(2) 1 Verwaltungsakte, Ladungen oder sonstige Mitteilungen, die auf Grund<br />
von Rechtsvorschriften außerhalb dieses <strong>Gesetze</strong>s amtlich, öffentlich oder<br />
ortsüblich bekanntzumachen sind, hat die Gemeinde wie ihre Satzungen<br />
bekanntzumachen. 2 Sind Pläne, Karten oder sonstige Nachweise<br />
Bestandteil einer Mitteilung nach Satz 1, so kann die Bekanntmachung<br />
unbeschadet anderer Vorschriften auch dadurch bewirkt werden, daß die<br />
Mitteilung mit den Nachweisen auf die Dauer von zwei Wochen in der<br />
Verwaltung der Gemeinde ausgelegt wird; der Gegenstand der Mitteilung<br />
sowie Ort und Zeit der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher<br />
nach Satz 1 bekanntzumachen.<br />
Bay GO Art. 28 Geldbußen und Verwarnungsgelder<br />
Geldbußen und Verwarnungsgelder, die auf Grund bewehrter Satzungen und<br />
Verordnungen festgesetzt werden, fließen in die Gemeindekasse.<br />
ZWEITER TEIL Verfassung und Verwaltung der Gemeinde<br />
1. ABSCHNITT Gemeindeorgane und ihre Hilfskräfte<br />
Bay GO Art. 29 Hauptorgane<br />
Die Gemeinde wird durch den Gemeinderat verwaltet, soweit nicht der erste<br />
Bürgermeister selbständig entscheidet (Art. 37).
a) Der Gemeinderat und seine Ausschüsse<br />
Bay GO Art. 30 Rechtsstellung, Aufgaben des Gemeinderats<br />
(1) 1 Der Gemeinderat ist die Vertretung der Gemeindebürger. 2 Er führt in<br />
Städten die Bezeichnung Stadtrat, in Märkten die Bezeichnung<br />
Marktgemeinderat.<br />
(2) Der Gemeinderat entscheidet im Rahmen des Art. 29 über alle<br />
Angelegenheiten, für die nicht beschließende Ausschüsse (Art. 32) bestellt<br />
sind.<br />
(3) Der Gemeinderat überwacht die gesamte Gemeindeverwaltung,<br />
insbesondere auch die Ausführung seiner Beschlüsse.<br />
Bay GO Art. 31 Zusammensetzung des Gemeinderats<br />
(1) Der Gemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister und den<br />
Gemeinderatsmitgliedern.<br />
(2) 1 Die Gemeinderatsmitglieder werden in ehrenamtlicher Eigenschaft<br />
gewählt. 2 Ihre Zahl, einschließlich weiterer Bürgermeister, beträgt in<br />
Gemeinden<br />
mit bis zu 1 000 Einwohnern 8,<br />
mit mehr als 1 000 bis zu 2 000 Einwohnern 12,<br />
mit mehr als 2 000 bis zu 3 000 Einwohnern 14,<br />
mit mehr als 3 000 bis zu 5 000 Einwohnern 16,<br />
mit mehr als 5 000 bis zu 10 000 Einwohnern 20,<br />
mit mehr als 10 000 bis zu 20 000 Einwohnern 24,<br />
mit mehr als 20 000 bis zu 30 000 Einwohnern 30,<br />
mit mehr als 30 000 bis zu 50 000 Einwohnern 40,<br />
mit mehr als 50 000 bis zu 100 000 Einwohnern 44,<br />
mit mehr als 100 000 bis zu 200 000 Einwohnern 50,<br />
mit mehr als 200 000 bis zu 500 000 Einwohnern 60.<br />
3<br />
Die Zahl der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder einschließlich<br />
weiterer Bürgermeister beträgt in der Stadt Nürnberg 70 und in der<br />
Landeshauptstadt München 80. 4 Sinkt die Einwohnerzahl in einer<br />
Gemeinde unter eine der in Satz 2 genannten Einwohnergrenzen, so ist die<br />
Zahl der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erst in der übernächsten<br />
Wahlzeit auf die gesetzlich vorgeschriebene Zahl zu verringern.<br />
(3) 1 Ehrenamtliche Bürgermeister oder ehrenamtliche<br />
Gemeinderatsmitglieder in einer Gemeinde können nicht sein:<br />
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte dieser Gemeinde,<br />
2. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte einer<br />
Verwaltungsgemeinschaft, der die Gemeinde angehört,<br />
3. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen<br />
oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an<br />
denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine Beteiligung<br />
am Stimmrecht genügt,<br />
Entscheidung des BVerfG vom 4. April 1978 – 2 BvR 1108/77 – (BGBl. I S. 622):Artikel 31<br />
Abs. 4 Nr. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung des <strong>Gesetze</strong>s zur
Änderung der Rechtsstellung kommunaler Mandatsträger vom 8. Juli 1977 (Gesetz- und<br />
Verordnungsbl. S. 333) ist insoweit unvereinbar mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, als<br />
auch hauptberufliche Angestellte im Sinne dieser Vorschrift, die keinen bestimmenden Einfluß<br />
auf Unternehmensentscheidungen haben, nicht ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder sein<br />
können.<br />
4. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar<br />
mit Fragen der Rechtsaufsicht befaßt sind, ausgenommen der gewählte<br />
Stellvertreter des Landrats.<br />
2<br />
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Beamte während der Dauer des<br />
Ehrenamts ohne Dienstbezüge beurlaubt ist oder wenn seine Rechte und<br />
Pflichten aus dem Dienstverhältnis wegen der Wahl in eine gesetzgebende<br />
Körperschaft ruhen; dies gilt für Angestellte entsprechend. 3 Ein Landrat<br />
kann nicht ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied einer kreisfreien<br />
Gemeinde sein. 4 Ein ehrenamtlicher Bürgermeister kann nicht<br />
berufsmäßiger Bürgermeister einer anderen Gemeinde sein.<br />
(4) 1 Alle Gemeinderatsmitglieder sind in der ersten nach ihrer Berufung<br />
stattfindenden öffentlichen Sitzung in feierlicher Form zu vereidigen. 2 Die<br />
Eidesformel lautet:“Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die<br />
Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern.<br />
Ich schwöre, den <strong>Gesetze</strong>n gehorsam zu sein und meine Amtspflichten<br />
gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu<br />
wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.” 3 Der<br />
Eid kann auch ohne die Worte “so wahr mir Gott helfe” geleistet werden.<br />
4<br />
Erklärt ein Gemeinderatsmitglied, daß es aus Glaubens- oder<br />
Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat es an Stelle der Worte<br />
“ich schwöre” die Worte “ich gelobe” zu sprechen oder das Gelöbnis mit<br />
einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung<br />
seiner Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden, gleichwertigen<br />
Beteuerungsformel einzuleiten. 5 Den Eid nimmt der erste Bürgermeister<br />
ab. 6 Die Eidesleistung entfällt für die Gemeinderatsmitglieder, die im<br />
Anschluß an ihre Amtszeit wieder zum Gemeinderatsmitglied der gleichen<br />
Gemeinde gewählt wurden.<br />
Bay GO Art. 32 Aufgaben der Ausschüsse<br />
(1) Der Gemeinderat kann vorberatende Ausschüsse bilden.<br />
(2) 1 Der Gemeinderat kann die Verwaltung bestimmter Geschäftszweige oder<br />
die Erledigung einzelner Angelegenheiten beschließenden Ausschüssen<br />
(Gemeindesenaten) übertragen. 2 Auf beschließende Ausschüsse können<br />
nicht übertragen werden<br />
1. die Beschlußfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die<br />
Gemeinde der Genehmigung bedarf,<br />
2. der Erlaß von Satzungen und Verordnungen, ausgenommen alle<br />
Bebauungspläne und alle sonstigen Satzungen nach den Vorschriften des<br />
Ersten Kapitels des Baugesetzbuchs sowie alle örtlichen Bauvorschriften<br />
im Sinn des Art. 81 BayBO, auch in den Fällen des Art. 81 Abs. 2 BayBO,<br />
3. die Beschlußfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der<br />
Gemeindebediensteten und über beamten-, besoldungs-, versorgungsund<br />
disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeister und der<br />
berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz über<br />
kommunale Wahlbeamte oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas
anderes bestimmen,<br />
4. die Beschlußfassung über die Haushaltssatzung und über die<br />
Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68),<br />
5. die Beschlußfassung über den Finanzplan (Art. 70),<br />
6. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen sowie die Beschlußfassung über die Entlastung<br />
(Art. 102),<br />
7. Entscheidungen über gemeindliche Unternehmen im Sinn von Art. 96,<br />
8. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im übrigen<br />
vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 88),<br />
9. Bestellung und die Abberufung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts<br />
sowie seines Stellvertreters,<br />
10. die Beschlußfassung über Änderungen von bewohntem<br />
Gemeindegebiet.<br />
(3) 1 Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen<br />
Angelegenheiten an Stelle des Gemeinderats, wenn nicht der erste<br />
Bürgermeister oder sein Stellvertreter im Ausschuß, ein Drittel der<br />
stimmberechtigten Ausschußmitglieder oder ein Viertel der<br />
Gemeinderatsmitglieder binnen einer Woche die Nachprüfung durch den<br />
Gemeinderat beantragt. 2 Soweit ein Beschluß eines Ausschusses die<br />
Rechte Dritter berührt, wird er erst nach Ablauf einer Frist von einer<br />
Woche wirksam.<br />
(4) 1 Der Gemeinderat kann in der Geschäftsordnung eine Ferienzeit bis zu<br />
sechs Wochen bestimmen. 2 Für die Dauer der Ferienzeit ist ein<br />
Ferienausschuß nach den für beschließende Ausschüsse geltenden<br />
Vorschriften zu bilden, der alle Aufgaben erledigt, für die sonst der<br />
Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuß zuständig ist; die Absätze<br />
2 und 3 sind nicht anzuwenden. 3 Der Ferienausschuß kann jedoch keine<br />
Aufgaben erledigen, die dem Werkausschuß obliegen oder kraft <strong>Gesetze</strong>s<br />
von besonderen Ausschüssen wahrgenommen werden müssen oder nach<br />
der Geschäftsordnung nicht vom Ferienausschuß wahrgenommen werden<br />
dürfen.<br />
(5) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen.<br />
Bay GO Art. 33 Zusammensetzung der Ausschüsse; Vorsitz<br />
(1) 1 Die Zusammensetzung der Ausschüsse regelt der Gemeinderat in der<br />
Geschäftsordnung (Art. 45). 2 Hierbei hat der Gemeinderat dem<br />
Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen<br />
Rechnung zu tragen. 3 Haben dabei mehrere Parteien oder Wählergruppen<br />
gleichen Anspruch auf einen Sitz, so ist statt eines Losentscheids auch der<br />
Rückgriff auf die Zahl der bei der Wahl auf diese Parteien oder<br />
Wählergruppen abgegebenen Stimmen zulässig. 4 Die Bestellung anderer<br />
als der von den Parteien oder Wählergruppen vorgeschlagenen Personen<br />
ist nicht zulässig. 5 Gemeinderatsmitglieder können sich zur Entsendung<br />
gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen.<br />
(2) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürgermeister, einer<br />
seiner Stellvertreter oder ein vom Gemeinderat bestimmtes<br />
Gemeinderatsmitglied.
) Der erste Bürgermeister und seine Stellvertreter<br />
Bay GO Art. 34 Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters<br />
(1) 1 Der erste Bürgermeister ist Beamter der Gemeinde. 2 In kreisfreien<br />
Gemeinden und in Großen Kreisstädten führt er die Amtsbezeichnung<br />
Oberbürgermeister. 3 In diesen Gemeinden und in kreisangehörigen<br />
Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern ist der erste Bürgermeister<br />
Beamter auf Zeit (berufsmäßiger Bürgermeister).<br />
(2) 1 In kreisangehörigen Gemeinden, die mehr als 5 000, höchstens aber<br />
10 000 Einwohner haben, ist der erste Bürgermeister Ehrenbeamter<br />
(ehrenamtlicher Bürgermeister), wenn das der Gemeinderat spätestens<br />
am 67. Tag vor einer Bürgermeisterwahl durch Satzung bestimmt. 2 In<br />
Gemeinden bis zu 5 000 Einwohnern ist der erste Bürgermeister<br />
Ehrenbeamter, wenn nicht der Gemeinderat spätestens am 67. Tag vor<br />
einer Bürgermeisterwahl durch Satzung bestimmt, daß der erste<br />
Bürgermeister Beamter auf Zeit sein soll.<br />
(3) Entscheidend ist die letzte fortgeschriebene Einwohnerzahl, die vom<br />
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung früher als sechs Monate<br />
vor der Bürgermeisterwahl veröffentlicht wurde.<br />
(4) Satzungen nach Absatz 2 gelten auch für künftige Amtszeiten, wenn sie<br />
nicht der Gemeinderat spätestens am 67. Tag vor einer<br />
Bürgermeisterwahl aufhebt.<br />
(5) Das Nähere über das Beamtenverhältnis des ersten Bürgermeisters<br />
bestimmt das Gesetz über kommunale Wahlbeamte.<br />
Bay GO Art. 35 Rechtsstellung der weiteren Bürgermeister<br />
(1) 1 Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Wahlzeit<br />
einen oder zwei weitere Bürgermeister. 2 Weitere Bürgermeister sind<br />
Ehrenbeamte der Gemeinde (ehrenamtliche weitere Bürgermeister), wenn<br />
nicht der Gemeinderat durch Satzung bestimmt, daß sie Beamte auf Zeit<br />
sein sollen (berufsmäßige weitere Bürgermeister).<br />
(2) 1 Zum weiteren Bürgermeister sind die ehrenamtlichen<br />
Gemeinderatsmitglieder wählbar, welche die Voraussetzungen für die<br />
Wahl zum ersten Bürgermeister erfüllen. 2 Für die Wahl der weiteren<br />
Bürgermeister gilt Art. 51 Abs. 3.<br />
(3) Das Nähere über das Beamtenverhältnis eines weiteren Bürgermeisters<br />
bestimmt das Gesetz über kommunale Wahlbeamte.<br />
(4) Endet das Beamtenverhältnis eines weiteren Bürgermeisters während der<br />
Wahlzeit des Gemeinderats, so findet für den Rest der Wahlzeit innerhalb<br />
von drei Monaten eine Neuwahl statt; dasselbe gilt, wenn das Ruhen der<br />
Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis wegen der Wahl in eine<br />
gesetzgebende Körperschaft eintritt.<br />
Bay GO Art. 36 Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderats<br />
1 Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemeinderat und vollzieht seine<br />
Beschlüsse. 2 Soweit er persönlich beteiligt ist, handelt sein Vertreter.
Bay GO Art. 37 Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters<br />
(1) 1 Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit<br />
1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine<br />
grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen<br />
erwarten lassen,<br />
2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines<br />
Bundesgesetzes übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten<br />
der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes<br />
der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder personalrechtliche<br />
Entscheidungen der Gemeinderat zuständig ist,<br />
3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der<br />
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheimzuhalten sind.<br />
2<br />
Für die laufenden Angelegenheiten nach Satz 1 Nr. 1, die nicht unter<br />
Nummern 2 und 3 fallen, kann der Gemeinderat Richtlinien aufstellen.<br />
(2) 1 Der Gemeinderat kann dem ersten Bürgermeister durch die<br />
Geschäftsordnung weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung<br />
übertragen; das gilt nicht für den Erlaß von Satzungen und für<br />
Angelegenheiten, die nach Art. 32 Abs. 2 Satz 2 nicht auf beschließende<br />
Ausschüsse übertragen werden können. 2 Der Gemeinderat kann dem<br />
ersten Bürgermeister übertragene Angelegenheiten im Einzelfall nicht<br />
wieder an sich ziehen; das Recht des Gemeinderats, die Übertragung<br />
allgemein zu widerrufen, bleibt unberührt.<br />
(3) 1 Der erste Bürgermeister ist befugt, an Stelle des Gemeinderats oder<br />
eines Ausschusses dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare<br />
Geschäfte zu besorgen. 2 Hiervon hat er dem Gemeinderat oder dem<br />
Ausschuß in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.<br />
(4) Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über die Beamten,<br />
Angestellten und Arbeiter der Gemeinde.<br />
Bay GO Art. 38 Verpflichtungsgeschäfte; Vertretung der Gemeinde<br />
nach außen<br />
(1) Der erste Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen.<br />
(2) 1 Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet werden soll,<br />
bedürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer Form mit einer<br />
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur versehen<br />
sein; das gilt nicht für ständig wiederkehrende Geschäfte des täglichen<br />
Lebens, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. 2 Die Erklärungen<br />
sind durch den ersten Bürgermeister oder seinen Stellvertreter unter<br />
Angabe der Amtsbezeichnung zu unterzeichnen. 3 Sie können auf Grund<br />
einer den vorstehenden Erfordernissen entsprechenden Vollmacht auch<br />
von Gemeindebediensteten unterzeichnet werden.<br />
Bay GO Art. 39 Stellvertretung; Übertragung von Befugnissen<br />
(1) 1 Die weiteren Bürgermeister vertreten den ersten Bürgermeister im Fall<br />
seiner Verhinderung in ihrer Reihenfolge. 2 Die weiteren Stellvertreter<br />
bestimmt der Gemeinderat aus der Mitte der Gemeinderatsmitglieder, die<br />
Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind.
(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen der Geschäftsverteilung<br />
(Art. 46) einzelne seiner Befugnisse den weiteren Bürgermeistern, nach<br />
deren Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied und in<br />
Angelegenheiten der laufenden Verwaltung einem Gemeindebediensteten<br />
übertragen; eine darüber hinausgehende Übertragung auf einen<br />
Bediensteten bedarf zusätzlich der Zustimmung des Gemeinderats.<br />
c) Die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder<br />
Bay GO Art. 40 Berufung und Aufgaben<br />
1 In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern kann der Gemeinderat<br />
berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder wählen. 2 Sie haben in den Sitzungen<br />
des Gemeinderats und seiner Ausschüsse in Angelegenheiten ihres<br />
Aufgabengebiets beratende Stimme.<br />
Bay GO Art. 41 Rechtsstellung<br />
(1) 1 Die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder werden auf höchstens sechs<br />
Jahre gewählt und auf Grund dieser Wahl zum Beamten auf Zeit ernannt.<br />
2 3<br />
Für die Wahl gilt Art. 51 Abs. 3. Wiederwahl ist zulässig.<br />
(2) Das Nähere über das Beamtenverhältnis eines berufsmäßigen<br />
Gemeinderatsmitglieds bestimmt das Gesetz über kommunale<br />
Wahlbeamte.<br />
d) Gemeindebedienstete<br />
Bay GO Art. 42 Notwendigkeit bestimmter Fachkräfte<br />
(1) Die Gemeinden müssen das fachlich geeignete Verwaltungspersonal<br />
anstellen, das erforderlich ist, um den ordnungsgemäßen Gang der<br />
Geschäfte zu gewährleisten.<br />
(2) Unbeschadet der Verpflichtung nach Abs. 1 gilt:<br />
1. Kreisfreie Gemeinden und Große Kreisstädte müssen mindestens einen<br />
Gemeindebeamten mit der Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst<br />
oder für das Richteramt haben, wenn nicht der Oberbürgermeister diese<br />
Befähigung besitzt;<br />
2. andere Gemeinden sollen mindestens einen Gemeindebeamten mit der<br />
Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst haben, wenn nicht der<br />
erste Bürgermeister mindestens diese Befähigung besitzt und berufsmäßig<br />
tätig ist oder die Gemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft angehört.<br />
(3) Gemeindeangestellte mit Dienstaufgaben, die in vergleichbaren Fällen von<br />
Staatsbeamten versehen werden, sind zu Beamten zu ernennen.<br />
Bay GO Art. 43 Anstellung und Arbeitsbedingungen<br />
(1) 1 Der Gemeinderat ist zuständig,<br />
1. die Beamten der Gemeinde zu ernennen, zu befördern, zu einem<br />
anderen Dienstherrn abzuordnen oder zu versetzen, in den Ruhestand zu<br />
versetzen und zu entlassen,<br />
2. die Angestellten der Gemeinde einzustellen, höherzugruppieren und zu<br />
entlassen.<br />
2 Der Gemeinderat kann diese Befugnisse einem beschließenden Ausschuß
(Art. 32 Abs. 2 bis 5) übertragen, und zwar auch in Angelegenheiten, zu<br />
deren Erledigung die Gemeinde der Genehmigung bedarf.<br />
(2) 1 Die Arbeiter der Gemeinde werden durch den ersten Bürgermeister<br />
eingestellt, höhergruppiert und entlassen. 2 Befugnisse nach Absatz 1<br />
Satz 1 kann der Gemeinderat dem ersten Bürgermeister übertragen<br />
1. für Beamte des einfachen und des mittleren Dienstes und für<br />
Angestellte, deren Vergütung mit der Besoldung dieser Beamten<br />
vergleichbar ist,<br />
2. in kreisfreien Gemeinden auch für Beamte des gehobenen Dienstes und<br />
der ersten beiden Ämter des höheren Dienstes und für Angestellte, deren<br />
Vergütung mit der Besoldung dieser Beamten vergleichbar ist.<br />
3<br />
Ein solcher Beschluß bedarf der Mehrheit der stimmberechtigten<br />
Mitglieder des Gemeinderats; falls der Beschluß nicht mit dieser Mehrheit<br />
wieder aufgehoben wird, gilt er bis zum Ende der Wahlzeit des<br />
Gemeinderats. 4 Art. 39 Abs. 2 findet Anwendung.<br />
(3) Dienstvorgesetzter der Gemeindebeamten ist der erste Bürgermeister.<br />
(4) Die Arbeitsbedingungen, Vergütungen (Gehälter und Löhne) der<br />
Angestellten und Arbeiter müssen angemessen sein.<br />
Bay GO Art. 44 Stellenplan<br />
1 Der Stellenplan (Art. 64 Abs. 2 Satz 2) ist einzuhalten. 2 Abweichungen sind<br />
nur im Rahmen des Art. 68 Abs. 3 Nr. 2 zulässig.<br />
2. ABSCHNITT Geschäftsgang<br />
Bay GO Art. 45 Geschäftsordnung<br />
(1) Der Gemeinderat gibt sich eine Geschäftsordnung.<br />
(2) Die Geschäftsordnung muß Bestimmungen über die Frist und Form der<br />
Einladung zu den Sitzungen sowie über den Geschäftsgang des<br />
Gemeinderats und seiner Ausschüsse enthalten.<br />
Bay GO Art. 46 Geschäftsleitung<br />
(1) 1 Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet und verteilt der erste<br />
Bürgermeister die Geschäfte. 2 Über die Verteilung der Geschäfte unter die<br />
Gemeinderatsmitglieder beschließt der Gemeinderat.<br />
(2) 1 Der erste Bürgermeister bereitet die Beratungsgegenstände vor. 2 Er<br />
beruft den Gemeinderat unter Angabe der Tagesordnung mit<br />
angemessener Frist ein, erstmals unverzüglich nach Beginn der Wahlzeit.<br />
3<br />
Der Gemeinderat ist auch unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel<br />
der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder schriftlich unter Bezeichnung<br />
des Beratungsgegenstands verlangt. 4 Die Sitzung muß spätestens am<br />
14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens<br />
stattfinden.<br />
Bay GO Art. 47 Sitzungszwang; Beschlußfähigkeit<br />
(1) Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen.
(2) Er ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen<br />
sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.<br />
(3) 1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben<br />
Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der<br />
Erschienenen beschlußfähig. 2 Bei der zweiten Einladung muß auf diese<br />
Bestimmung hingewiesen werden.<br />
Bay GO Art. 48 Teilnahmepflicht; Ordnungsgeld gegen Säumige<br />
(1) 1 Die Gemeinderatsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen und<br />
Abstimmungen teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte zu<br />
übernehmen. 2 Kein Mitglied darf sich der Stimme enthalten.<br />
(2) Gegen Mitglieder, die sich diesen Verpflichtungen ohne genügende<br />
Entschuldigung entziehen, kann der Gemeinderat Ordnungsgeld bis zu<br />
zweihundertfünfzig Euro im Einzelfall verhängen.<br />
(3) Entzieht sich ein ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied nach zwei wegen<br />
Versäumnis erkannten Ordnungsgeldern innerhalb von sechs Monaten<br />
weiterhin seiner Pflicht, an den Gemeinderatssitzungen teilzunehmen, so<br />
kann der Gemeinderat den Verlust des Amts aussprechen.<br />
Bay GO Art. 49 Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung<br />
(1) 1 Ein Mitglied kann an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen,<br />
wenn der Beschluß ihm selbst, seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner,<br />
einem Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer<br />
von ihm kraft <strong>Gesetze</strong>s oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder<br />
juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen<br />
kann. 2 Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer als öffentlicher<br />
Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat.<br />
(2) Absatz 1 gilt nicht<br />
1. für Wahlen,<br />
2. für Beschlüsse, mit denen der Gemeinderat eine Person zum Mitglied<br />
eines Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen der<br />
Gemeinde in eine andere Einrichtung entsendet, dafür vorschlägt oder<br />
daraus abberuft.<br />
(3) Ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, entscheidet der<br />
Gemeinderat ohne Mitwirkung des persönlich Beteiligten.<br />
(4) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen<br />
Mitglieds hat die Ungültigkeit des Beschlusses nur zur Folge, wenn sie für<br />
das Abstimmungsergebnis entscheidend war.<br />
Bay GO Art. 50 Einschränkung des Vertretungsrechts<br />
Gemeinderatsmitglieder dürfen Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde nur als<br />
gesetzliche Vertreter geltend machen.<br />
Bay GO Art. 51 Form der Beschlußfassung; Wahlen<br />
(1) 1 Beschlüsse des Gemeinderats werden in offener Abstimmung mit<br />
Mehrheit der Abstimmenden gefaßt. 2 Bei Stimmengleichheit ist der Antrag<br />
abgelehnt.
(2) 1 Kein Mitglied des Gemeinderats darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner<br />
Abstimmung gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des<br />
Gemeinderats zur Verantwortung gezogen werden. 2 Die Haftung<br />
gegenüber der Gemeinde ist nicht ausgeschlossen, wenn das<br />
Abstimmungsverhalten eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. 3 Die<br />
Verantwortlichkeit nach bundesrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt.<br />
(3) 1 Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. 2 Sie sind nur<br />
gültig, wenn sämtliche Mitglieder unter Angabe des Gegenstands geladen<br />
sind und die Mehrheit von ihnen anwesend und stimmberechtigt ist.<br />
3<br />
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen<br />
erhält. 4 Neinstimmen und leere Stimmzettel sind ungültig. 5 Ist<br />
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu<br />
wiederholen. 6 Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und<br />
erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen<br />
Stimmen, so tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten<br />
Stimmenzahlen ein. 7 Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet<br />
das Los.<br />
(4) Absatz 3 gilt für alle Entscheidungen des Gemeinderats, die in diesem<br />
Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden.<br />
Bay GO Art. 52 Öffentlichkeit<br />
(1) 1 Zeitpunkt und Ort der Sitzungen des Gemeinderats sind unter Angabe<br />
der Tagesordnung, spätestens am dritten Tag vor der Sitzung, ortsüblich<br />
bekanntzumachen. 2 Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des<br />
Gemeinderats.<br />
(2) 1 Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der<br />
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen.<br />
2<br />
Über den Ausschluß der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung<br />
beraten und entschieden.<br />
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit<br />
bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen<br />
sind.<br />
(4) Die Sitzungen haben in einem der Allgemeinheit zugänglichen Raum<br />
stattzufinden.<br />
Bay GO Art. 53 Handhabung der Ordnung<br />
(1) 1 Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. 2 Er<br />
ist berechtigt, Zuhörer, welche die Ordnung stören, entfernen zu lassen.<br />
3<br />
Er kann mit Zustimmung des Gemeinderats Mitglieder, welche die<br />
Ordnung fortgesetzt erheblich stören, von der Sitzung ausschließen.<br />
(2) Wird durch ein bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenes<br />
Mitglied die Ordnung innerhalb von zwei Monaten neuerdings erheblich<br />
gestört, so kann ihm der Gemeinderat für zwei weitere Sitzungen die<br />
Teilnahme untersagen.<br />
Bay GO Art. 54 Niederschrift<br />
(1) 1 Die Verhandlungen des Gemeinderats sind niederzuschreiben. 2 Die<br />
Niederschrift muß Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden
Gemeinderatsmitglieder und die der abwesenden unter Angabe ihres<br />
Abwesenheitsgrundes, die behandelten Gegenstände, die Beschlüsse und<br />
das Abstimmungsergebnis ersehen lassen. 3 Jedes Mitglied kann<br />
verlangen, daß in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt<br />
hat.<br />
(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu<br />
unterschreiben und vom Gemeinderat zu genehmigen.<br />
(3) 1 Die Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Niederschrift einsehen<br />
und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse<br />
erteilen lassen. 2 Die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche<br />
Sitzungen steht allen Gemeindebürgern frei; dasselbe gilt für auswärts<br />
wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer<br />
gewerblichen Niederlassungen im Gemeindegebiet.<br />
Bay GO Art. 55 Geschäftsgang der Ausschüsse<br />
(1) Den Geschäftsgang der vorberatenden Ausschüsse regelt der Gemeinderat<br />
in seiner Geschäftsordnung.<br />
(2) Auf den Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse finden die<br />
Vorschriften der Art. 46 bis 54 entsprechende Anwendung.<br />
3. ABSCHNITT Verwaltungsgrundsätze und Verwaltungsaufgaben<br />
Bay GO Art. 56 Gesetzmäßigkeit; Geschäftsgang<br />
(1) 1 Die gemeindliche Verwaltungstätigkeit muß mit der Verfassung und den<br />
<strong>Gesetze</strong>n im Einklang stehen. 2 Sie darf nur von sachlichen<br />
Gesichtspunkten geleitet sein.<br />
(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, für den ordnungsgemäßen Gang der<br />
Geschäfte zu sorgen und die dafür erforderlichen Einrichtungen zu<br />
schaffen.<br />
(3) Jeder Gemeindeeinwohner kann sich mit Eingaben und Beschwerden an<br />
den Gemeinderat wenden.<br />
Bay GO Art. 56 a Geheimhaltung<br />
(1) 1 Alle Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer<br />
wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten<br />
nicht bekannt werden dürfen, sind von den Gemeinden geheimzuhalten.<br />
2<br />
Die in anderen Rechtsvorschriften geregelte Verpflichtung zur<br />
Verschwiegenheit bleibt unberührt.<br />
(2) 1 Zur Geheimhaltung der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten<br />
haben die Gemeinden die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 2 Sie<br />
haben insoweit auch die für die Behörden des Freistaates Bayern<br />
geltenden Verwaltungsvorschriften zu beachten. 3 Das Staatsministerium<br />
des Innern kann hierzu Richtlinien aufstellen und Weisungen erteilen, die<br />
nicht der Einschränkung nach Art. 109 Abs. 2 Satz 2 unterliegen.<br />
(3) 1 Der erste Bürgermeister ist zu Beginn seiner Amtszeit durch die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde schriftlich besonders zu verpflichten, die in<br />
Absatz 1 Satz 1 genannten Angelegenheiten geheimzuhalten und die
hierfür geltenden Vorschriften zu beachten. 2 In gleicher Weise hat der<br />
erste Bürgermeister seine Stellvertreter zu verpflichten.<br />
3 Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebedienstete hat er zu verpflichten,<br />
bevor sie mit den in Absatz 1 Satz 1 genannten Angelegenheiten befaßt<br />
werden. 4 Art. 3 a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet<br />
keine Anwendung.<br />
Bay GO Art. 57 Aufgaben des eigenen Wirkungskreises<br />
(1) 1 Im eigenen Wirkungskreis sollen die Gemeinden in den Grenzen ihrer<br />
Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen und erhalten,<br />
die nach den örtlichen Verhältnissen für das wirtschaftliche, soziale und<br />
kulturelle Wohl und die Förderung des Gemeinschaftslebens ihrer<br />
Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur<br />
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der<br />
Feuersicherheit, der öffentlichen Reinlichkeit, des öffentlichen Verkehrs,<br />
der Gesundheit, der öffentlichen Wohlfahrtspflege einschließlich der<br />
Jugendhilfe, des öffentlichen Unterrichts und der Erwachsenenbildung, der<br />
Jugendertüchtigung, des Breitensports und der Kultur- und Archivpflege;<br />
hierbei sind die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu<br />
berücksichtigen. 2 Die Verpflichtung, diese Aufgaben zu erfüllen, bestimmt<br />
sich nach den besonderen gesetzlichen Vorschriften.<br />
(2) 1 Die Gemeinden sind unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter<br />
in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, die aus Gründen des<br />
öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit<br />
Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten. 2 Sonstige gesetzlich<br />
festgelegte Verpflichtungen der Gemeinden bleiben unberührt.<br />
(3) Übersteigt eine Pflichtaufgabe die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, so<br />
ist die Aufgabe in kommunaler Zusammenarbeit zu erfüllen.<br />
Bay GO Art. 58 Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br />
(1) Im übertragenen Wirkungskreis obliegt den Gemeinden die Erfüllung der<br />
örtlichen Aufgaben der inneren Verwaltung, soweit hierfür nicht besondere<br />
Behörden bestellt sind, und die gesetzlich vorgesehene Mitwirkung in der<br />
sonstigen öffentlichen Verwaltung.<br />
(2) Die Gemeinden sind in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft den<br />
Gemeindeangehörigen bei der Einleitung von Verwaltungsverfahren<br />
behilflich, auch wenn für deren Durchführung eine andere Behörde<br />
zuständig ist.<br />
(3) Vordrucke für Anträge, Anzeigen und Meldungen, die ihnen von anderen<br />
Behörden überlassen werden, haben die Gemeinden bereitzuhalten.<br />
(4) 1 Soweit Anträge bei der Regierung, dem Bezirk oder dem Landratsamt<br />
einzureichen sind, haben auch die Gemeinden die Anträge<br />
entgegenzunehmen und unverzüglich an die betreffende Behörde<br />
weiterzuleiten. 2 Die Staatsregierung kann durch Rechtsverordnung<br />
Anträge, die bei anderen Behörden zu stellen sind, in diese Regelung<br />
einbeziehen. 3 Die Antragstellung bei der Gemeinde gilt als Antragstellung<br />
bei der zuständigen Behörde, soweit sich nicht aus Bundesrecht etwas<br />
anderes ergibt.
Bay GO Art. 59 Zuständigkeit für den <strong>Gesetze</strong>svollzug<br />
(1) Der Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im übertragenen<br />
Wirkungskreis und die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und<br />
Weisungen der Staatsbehörden obliegen dem Gemeinderat, in den Fällen<br />
des Art. 37 dem ersten Bürgermeister.<br />
(2) Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des Gemeinderats oder<br />
seiner Ausschüsse für rechtswidrig, so hat er sie zu beanstanden, ihren<br />
Vollzug auszusetzen und, soweit erforderlich, die Entscheidung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 110) herbeizuführen.<br />
4. ABSCHNITT Stadtbezirke und Gemeindeteile<br />
Bay GO Art. 60 Einteilung in Stadtbezirke<br />
(1) 1 Das Gebiet der Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern ist in<br />
Stadtbezirke einzuteilen. 2 Dabei sind die geschichtlichen Zusammenhänge<br />
und Namen sowie die Besonderheiten der Bevölkerungs- und<br />
Wirtschaftsverhältnisse zu beachten.<br />
(2) 1 In den Stadtbezirken können für bestimmte auf ihren Bereich entfallende<br />
Verwaltungsaufgaben vom Stadtrat Bezirksverwaltungsstellen und<br />
Bezirksausschüsse gebildet werden. 2 Der Stadtrat und in Angelegenheiten<br />
nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der erste Bürgermeister können dabei<br />
den Bezirksausschüssen die Vorberatung oder die Entscheidung unter<br />
Beachtung der Belange der gesamten Stadt übertragen. 3 In Städten mit<br />
mehr als einer Million Einwohnern sind Bezirksausschüsse zu bilden.<br />
(3) 1 Werden Bezirksausschüsse gebildet, so hat deren Zusammensetzung<br />
entsprechend dem Wahlergebnis der Stadtratswahlen im jeweiligen<br />
Stadtbezirk zu erfolgen. 2 Sind den Bezirksausschüssen eigene<br />
Entscheidungsrechte übertragen, werden die Mitglieder der<br />
Bezirksausschüsse von den im Stadtbezirk wohnenden Gemeindebürgern<br />
gleichzeitig mit den Stadtratsmitgliedern für die Wahlzeit des Stadtrats<br />
gewählt. 3 Geschieht die Übertragung eigener Entscheidungsrechte<br />
innerhalb der Wahlzeit des Stadtrats, erfolgt die Wahl der Mitglieder der<br />
Bezirksausschüsse zum Zeitpunkt der Übertragung der<br />
Entscheidungsrechte. 4 Für die Wahl gelten die Vorschriften über die Wahl<br />
der Gemeinderäte mit Ausnahme des Art. 31 Abs. 3 dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Wahlorgane für die Wahl der<br />
Stadträte auch für die Wahl der Mitglieder der Bezirksausschüsse<br />
zuständig sind und dass das Ergebnis dieser Wahl erst nach der<br />
Feststellung des Ergebnisses der Stadtratswahl zu ermitteln und<br />
festzustellen ist.<br />
(4) Empfehlungen und Anträge der Bezirksausschüsse, für die der Stadtrat<br />
zuständig ist, sind von diesem oder einem beschließenden Ausschuß<br />
innerhalb einer Frist von drei Monaten zu behandeln.<br />
(5) 1 Das Nähere regelt eine Gemeindesatzung. 2 Den<br />
Bezirksverwaltungsstellen kann der erste Bürgermeister in<br />
Angelegenheiten der laufenden Verwaltung auch einzelne seiner<br />
Befugnisse übertragen (Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 1).
Bay GO Art. 60 a Ortssprecher<br />
(1) 1 In Gemeindeteilen, die am 18. Januar 1952 noch selbständige<br />
Gemeinden waren und die im Gemeinderat nicht vertreten sind, hat auf<br />
Antrag eines Drittels der dort ansässigen Gemeindebürger der erste<br />
Bürgermeister eine Ortsversammlung einzuberufen, die aus ihrer Mitte in<br />
geheimer Wahl einen Ortssprecher wählt. 2 Art. 51 Abs. 3 Sätze 3 bis 6<br />
gelten entsprechend. 3 Die Amtszeit des Ortssprechers endet mit der<br />
Wahlzeit des Gemeinderats; sie endet nicht deshalb, weil der Gemeindeteil<br />
im Gemeinderat vertreten wird.<br />
(2) 1 Der Ortssprecher kann an allen Sitzungen des Gemeinderats mit<br />
beratender Stimme teilnehmen und Anträge stellen. 2 Der Gemeinderat<br />
kann diese Rechte durch die Geschäftsordnung auf die Wahrnehmung<br />
örtlicher Angelegenheiten beschränken.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn für den Gemeindeteil<br />
ein Bezirksausschuß nach Art. 60 Abs. 2 besteht.<br />
DRITTER TEIL Gemeindewirtschaft<br />
1. ABSCHNITT Haushaltswirtschaft<br />
Bay GO Art. 61 Allgemeine Haushaltsgrundsätze<br />
(1) 1 Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen,<br />
daß die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 2 Die dauernde<br />
Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist sicherzustellen, eine Überschuldung<br />
ist zu vermeiden. 3 Dabei ist den Erfordernissen des<br />
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und dem § 51 a des<br />
Haushaltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen, insbesondere der<br />
Verantwortung zur Einhaltung der Bestimmungen in Art. 104 des<br />
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des<br />
europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes nachzukommen.<br />
(2) 1 Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu<br />
führen. 2 Aufgaben sollen in geeigneten Fällen daraufhin untersucht<br />
werden, ob und in welchem Umfang sie durch nichtkommunale Stellen,<br />
insbesondere durch private Dritte oder unter Heranziehung Dritter,<br />
mindestens ebenso gut erledigt werden können.<br />
(3) 1 Bei der Führung der Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde finanzielle<br />
Risiken zu minimieren. 2 Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn besondere<br />
Umstände, vor allem ein grobes Missverhältnis bei der Risikoverteilung zu<br />
Lasten der Gemeinde, die Gefahr eines erheblichen Vermögensschadens<br />
begründen.<br />
(4) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten<br />
kommunalen Buchführung oder nach den Grundsätzen der Kameralistik zu<br />
führen.<br />
Bay GO Art. 62 Grundsätze der Einnahmebeschaffung<br />
(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen<br />
1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von ihr<br />
erbrachten Leistungen,<br />
2. im übrigen aus Steuern<br />
zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.<br />
(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere<br />
Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.<br />
Bay GO Art. 63 Haushaltssatzung<br />
(1) 1 Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu<br />
erlassen. 2 Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei<br />
Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.<br />
(2) 1 Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung<br />
1. des Haushaltsplans unter Angabe<br />
a) des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres<br />
sowie des sich daraus ergebenden Saldos des Ergebnishaushalts, des<br />
Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der<br />
Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres sowie des sich daraus<br />
ergebenden Saldos des Finanzhaushalts bei Haushaltswirtschaft nach den<br />
Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
b) des Gesamtbetrags der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres<br />
bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik,<br />
2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für<br />
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
(Kreditermächtigungen),<br />
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen<br />
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen<br />
beziehungsweise Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten<br />
(Verpflichtungsermächtigungen),<br />
4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,<br />
5. des Höchstbetrags der Kassenkredite.<br />
2<br />
Die Angaben nach Satz 1 Nrn. 2, 3 und 5 sind getrennt für das<br />
Haushaltswesen der Gemeinde und die Wirtschaftsführung von<br />
Eigenbetrieben zu machen. 3 Die Haushaltssatzung kann weitere<br />
Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Einzahlungen sowie<br />
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise auf die Einnahmen<br />
und Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.<br />
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt<br />
für das Haushaltsjahr.<br />
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch<br />
Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.<br />
Bay GO Art. 64 Haushaltsplan<br />
(1) 1 2 Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der<br />
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich<br />
1. anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden<br />
Aufwendungen sowie zu leistenden Auszahlungen bei Haushaltswirtschaft
nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
2. zu erwartenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben bei<br />
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik,<br />
3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.<br />
3<br />
Die Vorschriften über die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge<br />
und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen, Ausgaben und<br />
Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe der Gemeinde bleiben<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Der Haushaltsplan ist bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
doppelten kommunalen Buchführung in einen Ergebnishaushalt und einen<br />
Finanzhaushalt, bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt<br />
zu gliedern. 2 Der Stellenplan für die Beamten und Angestellten der<br />
Gemeinde ist Teil des Haushaltsplans. 3 Die bei der Sparkasse<br />
beschäftigten Beamten und Angestellten sind in diesem Stellenplan nicht<br />
auszuweisen, wenn und soweit nach Sparkassenrecht ein verbindlicher<br />
Stellenplan aufzustellen ist.<br />
(3) 1 Der Haushaltsplan muß ausgeglichen sein. 2 Er ist Grundlage für die<br />
Haushaltswirtschaft der Gemeinde und nach Maßgabe dieses <strong>Gesetze</strong>s und<br />
der auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen Vorschriften für die<br />
Haushaltsführung verbindlich. 3 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter<br />
werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.<br />
Bay GO Art. 65 Erlaß der Haushaltssatzung<br />
(1) Der Gemeinderat beschließt über die Haushaltssatzung samt ihren<br />
Anlagen in öffentlicher Sitzung.<br />
(2) Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor<br />
Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.<br />
(3) 1 Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Bestandteilen sind<br />
sogleich nach der Genehmigung amtlich bekanntzumachen.<br />
2<br />
Haushaltssatzungen ohne solche Bestandteile sind frühestens einen<br />
Monat nach der Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde amtlich<br />
bekanntzumachen, sofern nicht die Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung<br />
beanstandet. 3 Gleichzeitig ist der Haushaltsplan eine Woche lang<br />
öffentlich aufzulegen; darauf ist in der amtlichen Bekanntmachung der<br />
Haushaltssatzung hinzuweisen.<br />
Bay GO Art. 66 Planabweichungen<br />
(1) 1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen<br />
beziehungsweise Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind<br />
und die Deckung gewährleistet ist. 2 Sind sie erheblich, sind sie vom<br />
Gemeinderat zu beschließen.<br />
(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die im<br />
Haushaltsplan nicht vorgesehene Verpflichtungen zu Leistungen der<br />
Gemeinde entstehen können.<br />
(3) Art. 68 Abs. 2 bleibt unberührt.<br />
(4) 1 Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind<br />
überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise
Ausgaben in nicht erheblichem Umfang auch dann zulässig, wenn ihre<br />
Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlaß einer<br />
Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden<br />
Jahr gewährleistet ist. 2 Hierüber entscheidet der Gemeinderat.<br />
(5) Der Gemeinderat kann Richtlinien über die Abgrenzungen aufstellen.<br />
Bay GO Art. 67 Verpflichtungsermächtigungen<br />
(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen beziehungsweise<br />
Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in<br />
künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen werden,<br />
wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.<br />
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem<br />
Haushaltsjahr folgenden drei Jahre vorgesehen werden, in Ausnahmefällen<br />
bis zum Abschluß einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie<br />
der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.<br />
(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des<br />
Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende<br />
Haushaltsjahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum<br />
Erlaß dieser Haushaltssatzung.<br />
(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen<br />
der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren<br />
Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.<br />
(5) 1 Verpflichtungen im Sinn des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder<br />
außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis<br />
besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der<br />
Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. 2 Art. 66 Abs. 1<br />
Satz 2 gilt entsprechend.<br />
Bay GO Art. 68 Nachtragshaushaltssatzungen<br />
(1) 1 Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres<br />
durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 2 Für die<br />
Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die<br />
Haushaltssatzung entsprechend.<br />
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu<br />
erlassen, wenn<br />
1. sich zeigt, daß trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag<br />
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der<br />
Haushaltssatzung erreicht werden kann,<br />
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen und<br />
Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben in einem im Verhältnis zu den<br />
Gesamtaufwendungen und -auszahlungen beziehungsweise<br />
Gesamtausgaben des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet<br />
werden müssen,<br />
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts beziehungsweise Ausgaben des<br />
Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,<br />
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder in eine höhere
Vergütungsgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die<br />
entsprechenden Stellen nicht enthält.<br />
(3) Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf<br />
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und<br />
Baumaßnahmen, soweit die Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben<br />
nicht erheblich und unabweisbar sind,<br />
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer<br />
Personalausgaben, die auf Grund des Beamten- oder Tarifrechts oder für<br />
die Erfüllung neuer Aufgaben notwendig werden.<br />
Bay GO Art. 69 Vorläufige Haushaltsführung<br />
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht<br />
bekanntgemacht, so darf die Gemeinde<br />
1. finanzielle Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist<br />
oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar<br />
sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige<br />
Leistungen des Finanzhaushalts beziehungsweise des<br />
Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge<br />
vorgesehen waren, fortsetzen,<br />
2. die in der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den<br />
Sätzen des Vorjahres erheben,<br />
3. Kredite umschulden,<br />
4. Kassenkredite bis zu dem zuletzt in einer Haushaltssatzung<br />
festgesetzten Höchstbetrag oder, wenn besondere Umstände im Einzellfall<br />
eine Erhöhung rechtfertigen, auch darüber hinaus aufnehmen.<br />
(2) 1 Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der<br />
Beschaffungen und der sonstigen Leistungen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus,<br />
darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel des<br />
durchschnittlichen Betrags der für die vier Vorjahre festgesetzten Kredite<br />
aufnehmen. 2 Eine angemessene Erhöhung dieser Kreditaufnahme ist<br />
zulässig, wenn besondere Umstände im Einzelfall diese Erhöhung<br />
rechtfertigen.<br />
(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das<br />
neue Jahr erlassen ist.<br />
(4) 1 Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 und Abs. 2 bedürfen der<br />
Genehmigung. 2 Die Gemeinde hat im Antrag darzulegen, wie und bis<br />
wann sie den Erlass einer Haushaltssatzung sicherstellen kann. 3 Die<br />
Genehmigung darf den Zielen der Wiederherstellung einer geordneten<br />
Haushaltswirtschaft und der dauernden Leistungsfähigkeit nicht<br />
widersprechen; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.<br />
Bay GO Art. 70 Mittelfristige Finanzplanung<br />
(1) 1 Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige<br />
Finanzplanung zugrundezulegen. 2 Das erste Planungsjahr der<br />
Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.<br />
(2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm<br />
aufzustellen.
(3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen<br />
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben und die<br />
Deckungsmöglichkeiten darzustellen.<br />
(4) Der Finanzplan ist dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der<br />
Haushaltssatzung vorzulegen.<br />
(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der<br />
Entwicklung anzupassen und fortzuführen.<br />
2. ABSCHNITT Kreditwesen<br />
Bay GO Art. 71 Kredite<br />
(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des Art. 62 Abs. 3 nur im<br />
Finanzhaushalt beziehungsweise im Vermögenshaushalt und nur für<br />
Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und zur<br />
Umschuldung aufgenommen werden.<br />
(2) 1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen<br />
und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der<br />
Haushaltssatzung der Genehmigung (Gesamtgenehmigung). 2 Die<br />
Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten<br />
Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter<br />
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 3 Sie ist in der Regel zu<br />
versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden<br />
Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen.<br />
(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste<br />
Jahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlaß dieser<br />
Haushaltssatzung.<br />
(4) 1 Die Aufnahme der einzelnen Kredite bedarf der Genehmigung<br />
(Einzelgenehmigung), sobald die Kreditaufnahmen für die Gemeinden<br />
nach § 19 des <strong>Gesetze</strong>s zur Förderung der Stabilität und des Wachstums<br />
der Wirtschaftbeschränkt worden sind. 2 Die Einzelgenehmigung kann nach<br />
Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden.<br />
(5) 1 Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit den<br />
Staatsministerien der Finanzen und für Wirtschaft, Infrastruktur und<br />
Verkehr durch Rechtsverordnung die Aufnahme von Krediten von der<br />
Genehmigung (Einzelgenehmigung) abhängig machen, wenn der<br />
Konjunkturrat für die öffentliche Hand nach § 18 Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s zur<br />
Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft eine<br />
Beschränkung der Kreditaufnahme durch die Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände empfohlen hat. 2 Die Genehmigung ist zu versagen,<br />
wenn dies zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen<br />
Gleichgewichts geboten ist oder wenn die Kreditbedingungen wirtschaftlich<br />
nicht vertretbar sind. 3 Solche Rechtsverordnungen sind auf längstens ein<br />
Jahr zu befristen.<br />
(6) 1 Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten<br />
bestellen. 2 Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn<br />
die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.
Bay GO Art. 72 Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten<br />
(1) Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich<br />
gleichkommen, bedarf der Genehmigung.<br />
(2) 1 Die Gemeinde darf Bürgschaften, Gewährverträge und Verpflichtungen<br />
aus verwandten Rechtsgeschäften, die ein Einstehen für fremde Schuld<br />
oder für den Eintritt oder Nichteintritt bestimmter Umstände zum<br />
Gegenstand haben, nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. 2 Die<br />
Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung, wenn sie nicht im Rahmen<br />
der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.<br />
(3) Die Gemeinde bedarf zur Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter<br />
der Genehmigung.<br />
(4) 1 Für die Genehmigung gelten Art. 71 Abs. 2 Sätze 2 und 3, im Fall der<br />
vorläufigen Haushaltsführung Art. 69 Abs. 4 Sätze 2 und 3 entsprechend.<br />
2<br />
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn das Rechtsgeschäft nicht eine<br />
Investition zum Gegenstand hat, sondern auf die Erzielung wirtschaftlicher<br />
Vorteile dadurch gerichtet ist, dass die Gemeinde einem Dritten<br />
inländische steuerliche Vorteile verschafft.<br />
(5) Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung Rechtsgeschäfte<br />
von der Genehmigung freistellen,<br />
1. die die Gemeinden zur Erfüllung bestimmter Aufgaben eingehen oder<br />
2. die für die Gemeinden keine besondere Belastung bedeuten oder<br />
3. die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren.<br />
Bay GO Art. 73 Kassenkredite<br />
(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben<br />
kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung<br />
festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine<br />
anderen Mittel zur Verfügung stehen.<br />
(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag soll für die<br />
Haushaltswirtschaft ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten<br />
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beziehungsweise ein<br />
Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen und für<br />
den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge<br />
nicht übersteigen.<br />
3. ABSCHNITT Vermögenswirtschaft<br />
a) Allgemeines<br />
Bay GO Art. 74 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze<br />
(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, wenn das zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.<br />
(2) 1 Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten<br />
und ordnungsgemäß nachzuweisen. 2 Bei Geldanlagen ist auf eine<br />
ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag<br />
bringen.
(3) Für die Bewirtschaftung eines Gemeindewaldes gelten neben den<br />
Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s die Vorschriften des Waldgesetzes für<br />
Bayern.<br />
(4) 1 Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder<br />
Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.<br />
2<br />
Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen<br />
nur in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung<br />
notwendig ist.<br />
Bay GO Art. 75 Veräußerung von Vermögen<br />
(1) 1 Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben nicht braucht, veräußern. 2 Vermögensgegenstände dürfen in<br />
der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.<br />
(2) 1 Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands gilt<br />
Absatz 1 entsprechend. 2 Ausnahmen sind insbesondere zulässig bei der<br />
Vermietung kommunaler Gebäude zur Sicherung preiswerten Wohnens<br />
und zur Sicherung der Existenz kleiner und ertragsschwacher<br />
Gewerbebetriebe.<br />
(3) 1 Die Verschenkung und die unentgeltliche Überlassung von<br />
Gemeindevermögen sind unzulässig (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 der<br />
Verfassung). 2 Die Veräußerung oder Überlassung von Gemeindevermögen<br />
in Erfüllung von Gemeindeaufgaben oder herkömmlicher Anstandspflichten<br />
fällt nicht unter dieses Verbot.<br />
(4) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der<br />
Gemeinde und nur dann in Stiftungsvermögen eingebracht werden, wenn<br />
der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht<br />
werden kann.<br />
Bay GO Art. 76 Rücklagen, Rückstellungen<br />
(1) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten<br />
kommunalen Buchführung hat die Gemeinde ihre stetige<br />
Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 2 Überschüsse der Ergebnisrechnung<br />
sind den Rücklagen zuzuführen, soweit nicht Fehlbeträge aus Vorjahren<br />
auszugleichen sind.<br />
(2) Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen<br />
Buchführung sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unterlassene<br />
Aufwendungen für Instandhaltung Rückstellungen zu bilden.<br />
(3) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik hat die<br />
Gemeinde für Zwecke des Vermögenshaushalts und zur Sicherung der<br />
Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden.<br />
2<br />
Rücklagen für andere Zwecke sind zulässig.<br />
Bay GO Art. 77 Zwangsvollstreckung in Gemeindevermögen wegen<br />
einer Geldforderung<br />
(1) 1 Der Gläubiger einer bürgerlich-rechtlichen Geldforderung gegen die<br />
Gemeinde muß, soweit er nicht dingliche Rechte verfolgt, vor der<br />
Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen dieser Forderung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde eine beglaubigte Abschrift des vollstreckbaren
Titels zustellen. 2 Die Zwangsvollstreckung darf erst einen Monat nach der<br />
Zustellung an die Rechtsaufsichtsbehörde beginnen.<br />
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für öffentlich-rechtliche Geldforderungen,<br />
soweit nicht Sondervorschriften bestehen.<br />
(3) Über das Vermögen der Gemeinde findet ein Insolvenz- oder gerichtliches<br />
Vergleichsverfahren nicht statt.<br />
Bay GO Artikel 78 und 79 (weggefallen)<br />
b) Öffentliche Nutzungsrechte<br />
Bay GO Art. 80 Verbot der Neubegründung;<br />
Übertragungsbeschränkungen<br />
(1) Öffentliche Rechte einzelner auf Nutzungen am Gemeindevermögen oder<br />
an ehemaligem Ortschaftsvermögen (Nutzungsrechte) können nicht neu<br />
begründet, erweitert oder in der Nutzungsart geändert oder aufgeteilt<br />
werden.<br />
(2) 1 Nutzungsrechte sind nur begründet, wenn ein besonderer Rechtstitel<br />
vorhanden ist oder wenn das Recht mindestens seit dem 18. Januar 1922<br />
ununterbrochen kraft Rechtsüberzeugung ausgeübt wird.<br />
2<br />
Unschädlich sind<br />
1. Unterbrechungen, die die Berechtigten nicht zu vertreten haben,<br />
2. Unterbrechungen bei der Ausübung eines ausschließlich<br />
landwirtschaftlichen Nutzungsrechts, die nicht länger als drei Jahre dauern<br />
und durch die Umstrukturierung des landwirtschaftlichen Betriebs<br />
verursacht sind.<br />
3<br />
Nutzungsrechte, die nicht ausschließlich landwirtschaftlichen Zwecken<br />
dienen, erlöschen nicht durch die Einstellung des landwirtschaftlichen<br />
Betriebs.<br />
(3) 1 Die Übertragung eines Nutzungsrechts, das auf einem Anwesen ruht, auf<br />
ein anderes Anwesen, die Häufung von mehr als einem vollen<br />
Nutzungsrecht auf ein Anwesen oder die Zerstückelung eines<br />
Nutzungsrechts sind nur aus wichtigem Grund, nur innerhalb derselben<br />
Gemeinde und nur dann zulässig, wenn das Anwesen, auf welches das<br />
Nutzungsrecht übertragen werden soll, das Haus- und Hofgrundstück<br />
eines ausübenden Land- oder Forstwirts ist. 2 Sie bedürfen der<br />
Genehmigung der Gemeinde. 3 Die Übertragung eines Nutzungsrechts auf<br />
eine juristische Person des privaten Rechts oder eine Gesellschaft des<br />
Handelsrechts ist unzulässig.<br />
Bay GO Art. 81 Lasten und Ausgaben<br />
(1) 1 Wer Nutzungen bezieht, hat die auf dem Gegenstand des Nutzungsrechts<br />
ruhenden Lasten zu tragen und die zur Gewinnung der Nutzungen und zur<br />
Erhaltung oder zur Erhöhung der Ertragsfähigkeit erforderlichen Ausgaben<br />
zu bestreiten. 2 Wird Gemeindevermögen teilweise von der Gemeinde,<br />
teilweise von Berechtigten genutzt, so sind diese Lasten und Ausgaben<br />
entsprechend zu teilen.<br />
(2) 1 Die Berechtigten sind verpflichtet, für die Nutzungen Gegenleistungen an<br />
die Gemeinde zu entrichten, soweit dies bisher der Fall war. 2 Die Höhe
der Gegenleistungen bemißt sich nach dem Wertverhältnis zwischen<br />
Nutzungen und Gegenleistungen am 1. Januar 1938.<br />
Bay GO Art. 82 Ablösung und Aufhebung<br />
(1) 1 Nutzungsrechte können durch Vereinbarung zwischen den Berechtigten<br />
und der Gemeinde abgelöst werden. 2 Mit Zustimmung der Mehrheit der<br />
Berechtigten können sämtliche Nutzungsrechte von der Gemeinde<br />
abgelöst werden; dabei richtet sich das Stimmrecht nach den Anteilen am<br />
Gesamtnutzungsrecht. 3 Werden einzelne Nutzungsrechte abgelöst, so<br />
gehen sie auf die Gemeinde über; sie kann die Rechte nicht auf Dritte<br />
übertragen. 4 Werden sämtliche Nutzungsrechte abgelöst, so gehen sie<br />
unter.<br />
(2) Nutzungsrechte können auf Antrag der Gemeinde durch die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde aufgehoben werden, wenn die Gemeinde<br />
belastete Grundstücke ganz oder teilweise aus Gründen des Gemeinwohls<br />
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt.<br />
(3) Werden Nutzungsrechte von der Gemeinde abgelöst oder von der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde aufgehoben, so sind die Berechtigten von der<br />
Gemeinde angemessen zu entschädigen.<br />
Bay GO Art. 83 Art und Umfang der Entschädigung<br />
(1) 1 Die Entschädigung ist in Geld durch Zahlung eines einmaligen Betrags zu<br />
leisten. 2 Die Berechtigten können verlangen, in Grundstücken entschädigt<br />
zu werden, wenn<br />
1. sie zur Sicherung ihrer Berufs- und Erwerbstätigkeit darauf angewiesen<br />
sind,<br />
2. das der Gemeinde zugemutet werden kann und<br />
3. andere Vorschriften einer Entschädigung in Grundstücken nicht<br />
entgegenstehen.<br />
3<br />
Ein Anspruch auf Zuteilung bestimmter Grundstücke besteht nicht.<br />
(2) 1 Als Grundlage einer angemessenen Entschädigung gilt im allgemeinen<br />
der Wert des Fünfundzwanzigfachen des durchschnittlichen jährlichen<br />
Reinertrags der Nutzungen, die in den der Ablösung oder Aufhebung<br />
unmittelbar vorhergehenden 15 Jahren gezogen worden sind oder bei<br />
ungehinderter rechtmäßiger Ausübung des Rechts hätten gezogen werden<br />
können. 2 Für die vereinbarte Ablösung gilt Entsprechendes.<br />
(3) Über die Höhe der Entschädigung entscheiden im Streitfall die<br />
ordentlichen Gerichte.<br />
(4) 1 Waldgenossenschaften, die im Zusammenhang mit der Ablösung oder<br />
Aufhebung von Nutzungsrechten als Körperschaften des öffentlichen<br />
Rechts gebildet wurden, können aufgelöst werden, wenn andere<br />
Vorschriften nicht entgegenstehen. 2 Die Rechtsverhältnisse bestehender<br />
Waldgenossenschaften, insbesondere ihre Aufgaben, die Rechte und<br />
Pflichten ihrer Mitglieder, ihre Auflösung und die Aufsicht werden durch<br />
Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern geregelt.
c) Von der Gemeinde verwaltete nichtrechtsfähige (fiduziarische)<br />
Stiftungen<br />
Bay GO Art. 84 Begriff; Verwaltung<br />
(1) Vermögenswerte, die die Gemeinde von Dritten unter der Auflage<br />
entgegennimmt, sie zu einem bestimmten öffentlichen Zweck zu<br />
verwenden, ohne daß eine rechtsfähige Stiftung entsteht, sind ihrer<br />
Zweckbestimmung gemäß nach den für das Gemeindevermögen<br />
geltenden Vorschriften zu verwalten.<br />
(2) 1 Die Vermögenswerte sind in ihrem Bestand ungeschmälert zu erhalten.<br />
2<br />
Sie sind vom übrigen Gemeindevermögen getrennt zu verwalten und so<br />
anzulegen, daß sie für ihren Verwendungszweck verfügbar sind.<br />
(3) 1 Der Ertrag darf nur für den Stiftungszweck verwendet werden. 2 Ist eine<br />
Minderung eingetreten, so sollen die Vermögensgegenstände aus dem<br />
Ertrag wieder ergänzt werden.<br />
Bay GO Art. 85 Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebung der<br />
Zweckbestimmung<br />
1 Soweit eine Änderung des Verwendungszwecks oder die Aufhebung der<br />
Zweckbestimmung zulässig ist, beschließt hierüber der Gemeinderat. 2 Der<br />
Beschluß bedarf der Genehmigung.<br />
4. ABSCHNITT Gemeindliche Unternehmen<br />
Bay GO Art. 86 Rechtsformen<br />
Die Gemeinde kann Unternehmen außerhalb ihrer allgemeinen Verwaltung in<br />
folgenden Rechtsformen betreiben:<br />
1. als Eigenbetrieb,<br />
2. als selbständiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts,<br />
3. in den Rechtsformen des Privatrechts.<br />
Bay GO Art. 87 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und<br />
Beteiligungen<br />
(1) 1 Die Gemeinde darf ein Unternehmen im Sinn von Art. 86 nur errichten,<br />
übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn<br />
1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert, insbesondere wenn<br />
die Gemeinde mit ihm gesetzliche Verpflichtungen oder ihre Aufgaben<br />
gemäß Art. 83 Abs. 1 der Verfassung und Art. 57 dieses <strong>Gesetze</strong>s erfüllen<br />
will,<br />
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen<br />
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen<br />
Bedarf steht,<br />
3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für die<br />
Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Verwaltung geeignet sind,<br />
4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der<br />
Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird<br />
oder erfüllt werden kann.<br />
2 Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde oder
ihre Unternehmen an dem vom Wettbewerb beherrschten<br />
Wirtschaftsleben teilnehmen, um Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem<br />
öffentlichen Zweck. 3 Soweit Unternehmen entgegen Satz 2 vor dem<br />
1. September 1998 errichtet oder übernommen wurden, dürfen sie<br />
weitergeführt, jedoch nicht erweitert werden.<br />
(2) 1 Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen außerhalb des<br />
Gemeindegebiets nur tätig werden, wenn dafür die Voraussetzungen des<br />
Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen<br />
kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. 2 Bei der Versorgung<br />
mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den<br />
Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine Einschränkung des<br />
Wettbewerbs zulassen.<br />
(3) 1 Für die Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen gilt Absatz 1<br />
entsprechend. 2 Absatz 2 gilt entsprechend, wenn sich die Gemeinde an<br />
einem auch außerhalb ihres Gebiets tätigen Unternehmen in einem<br />
Ausmaß beteiligt, das den auf das Gemeindegebiet entfallenden Anteil an<br />
den Leistungen des Unternehmens erheblich übersteigt.<br />
(4) 1 Bankunternehmen darf die Gemeinde weder errichten noch sich an ihnen<br />
beteiligen. 2 Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den<br />
besonderen Vorschriften. 3 Die Gemeinde kann einen einzelnen<br />
Geschäftsanteil an einer eingetragenen Kreditgenossenschaft erwerben,<br />
wenn eine Nachschußpflicht ausgeschlossen oder die Haftsumme auf einen<br />
bestimmten Betrag beschränkt ist.<br />
Bay GO Art. 88 Eigenbetriebe<br />
(1) Eigenbetriebe sind gemeindliche Unternehmen, die außerhalb der<br />
allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene<br />
Rechtspersönlichkeit geführt werden.<br />
(2) Für Eigenbetriebe bestellt der Gemeinderat eine Werkleitung und einen<br />
Werkausschuß.<br />
(3) 1 Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs. 2 Sie ist<br />
insoweit zur Vertretung nach außen befugt; der Gemeinderat kann ihr mit<br />
Zustimmung des ersten Bürgermeisters weitere Vertretungsbefugnisse<br />
übertragen. 3 Die Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im<br />
Eigenbetrieb und führt die Dienstaufsicht über sie und die im Eigenbetrieb<br />
tätigen Angestellten und Arbeiter. 4 Der Gemeinderat kann mit<br />
Zustimmung des ersten Bürgermeisters der Werkleitung für Beamte,<br />
Angestellte und Arbeiter im Eigenbetrieb personalrechtliche Befugnisse in<br />
entsprechender Anwendung von Art. 43 Abs. 2 übertragen.<br />
(4) 1 Im übrigen beschließt über die Angelegenheiten des Eigenbetriebs der<br />
Werkausschuß, soweit nicht der Gemeinderat sich die Entscheidung<br />
allgemein vorbehält oder im Einzelfall an sich zieht. 2 Der Werkausschuß<br />
ist ein beschließender Ausschuß im Sinn der Art. 32 und 55. 3 Im Fall des<br />
Art. 43 Abs. 1 Satz 2 sollen Befugnisse gegenüber Beamten, Angestellten<br />
und Arbeitern im Eigenbetrieb auf den Werkausschuß übertragen werden.<br />
(5) 1 Die Art. 61, 62, 67, 69 bis 72, 73 Abs. 1, Art. 74, 75, 77, 100 Abs. 4 und<br />
Art. 101 gelten entsprechend. 2 Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
werden die Angelegenheiten des Eigenbetriebs durch eine Betriebssatzung<br />
geregelt.<br />
(6) 1 Die Gemeinde kann Einrichtungen innerhalb der allgemeinen Verwaltung<br />
(Regiebetriebe) ganz oder teilweise nach den Vorschriften über die<br />
Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe führen, wenn die Abweichung von<br />
den allgemeinen kommunalwirtschaftlichen Vorschriften nach Art und<br />
Umfang der Einrichtung zweckmäßig ist. 2 Hierbei können auch<br />
Regelungen getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetriebe<br />
geltenden Vorschriften abweichen.<br />
Bay GO Art. 89 Selbständige Kommunalunternehmen des öffentlichen<br />
Rechts<br />
(1) 1 Die Gemeinde kann selbständige Unternehmen in der Rechtsform einer<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) errichten oder<br />
bestehende Regie- und Eigenbetriebe im Weg der Gesamtrechtsnachfolge<br />
in Kommunalunternehmen umwandeln. 2 Das Kommunalunternehmen<br />
kann sich nach Maßgabe der Unternehmenssatzung und in entsprechender<br />
Anwendung der für die Gemeinde geltenden Vorschriften an anderen<br />
Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient.<br />
(2) 1 Die Gemeinde kann dem Kommunalunternehmen einzelne oder alle mit<br />
einem bestimmten Zweck zusammenhängende Aufgaben ganz oder<br />
teilweise übertragen. 2 Sie kann nach Maßgabe des Art. 24 durch<br />
gesonderte Satzung einen Anschluß- und Benutzungszwang zugunsten des<br />
Kommunalunternehmens festlegen und das Unternehmen zur<br />
Durchsetzung entsprechend Art. 27 ermächtigen. 3 Sie kann ihm auch das<br />
Recht einräumen, an ihrer Stelle Satzungen und, soweit <strong>Landesrecht</strong> zu<br />
deren Erlaß ermächtigt, auch Verordnungen für das übertragene<br />
Aufgabengebiet zu erlassen; Art. 26 gilt sinngemäß.<br />
(2 a) 1 Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem<br />
ausschließlich die Gemeinde beteiligt ist, kann durch Formwechsel in ein<br />
Kommunalunternehmen umgewandelt werden. 2 Die Umwandlung ist nur<br />
zulässig, wenn keine Sonderrechte im Sinn des § 23 des<br />
Umwandlungsgesetzes (UmwG) und keine Rechte Dritter an den Anteilen<br />
der Gemeinde bestehen. 3 Der Formwechsel setzt den Erlass der<br />
Unternehmenssatzung durch die Gemeinde und einen sich darauf<br />
beziehenden Umwandlungsbeschluss der formwechselnden Gesellschaften<br />
voraus. 4 Die §§ 193 bis 195, 197 bis 199, 200 Abs. 1 und § 201 UmwG<br />
sind entsprechend anzuwenden. 5 Die Anmeldung zum Handelsregister<br />
entsprechend § 198 UmwG erfolgt durch das vertretungsberechtigte<br />
Organ der Kapitalgesellschaft. 6 Abweichend von Abs. 3 Satz 4 wird die<br />
Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Kommunalunternehmen mit<br />
dessen Eintragung oder, wenn es nicht eingetragen wird, mit der<br />
Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister wirksam; § 202 Abs. 1<br />
und 3 UmwG ist entsprechend anzuwenden. 7 Ist bei der<br />
Kapitalgesellschaft ein Betriebsrat eingerichtet, bleibt dieser nach dem<br />
Wirksamwerden der Umwandlung als Personalrat des<br />
Kommunalunternehmens bis zu den nächsten regelmäßigen<br />
Personalratswahlen bestehen.
(3) 1 Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältnisse des Kommunalunternehmens<br />
durch eine Unternehmenssatzung. 2 Die Unternehmenssatzung muß<br />
Bestimmungen über den Namen und die Aufgaben des Unternehmens, die<br />
Anzahl der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats und die<br />
Höhe des Stammkapitals enthalten. 3 Die Gemeinde hat die<br />
Unternehmenssatzung und deren Änderungen gemäß Art. 26 Abs. 2<br />
bekanntzumachen. 4 Das Kommunalunternehmen entsteht am Tag nach<br />
der Bekanntmachung, wenn nicht in der Unternehmenssatzung ein<br />
späterer Zeitpunkt bestimmt ist.<br />
(4) Die Gemeinde haftet für die Verbindlichkeiten des<br />
Kommunalunternehmens unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus<br />
dessen Vermögen zu erlangen ist (Gewährträgerschaft).<br />
Bay GO Art. 90 Organe des Kommunalunternehmens, Personal<br />
(1) 1 Das Kommunalunternehmen wird von einem Vorstand in eigener<br />
Verantwortung geleitet, soweit nicht gesetzlich oder durch die<br />
Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. 2 Der Vorstand vertritt<br />
das Kommunalunternehmen nach außen. 3 Die Gemeinde hat darauf<br />
hinzuwirken, daß jedes Vorstandsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die<br />
ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9<br />
Buchst. a des Handelsgesetzbuchs der Gemeinde jährlich zur<br />
Veröffentlichung mitzuteilen.<br />
(2) 1 Die Geschäftsführung des Vorstands wird von einem Verwaltungsrat<br />
überwacht. 2 Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf höchstens fünf<br />
Jahre; eine erneute Bestellung ist zulässig. 3 Er entscheidet außerdem<br />
über<br />
1. den Erlaß von Satzungen und Verordnungen gemäß Art. 89 Abs. 2<br />
Satz 3,<br />
2. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,<br />
3. die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die<br />
Leistungsnehmer,<br />
4. die Beteiligung des Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen,<br />
5. die Bestellung des Abschlußprüfers,<br />
6. die Ergebnisverwendung.<br />
4<br />
Im Fall des Satzes 3 Nr. 1 unterliegen die Mitglieder des Verwaltungsrats<br />
den Weisungen des Gemeinderats. 5 Die Unternehmenssatzung kann<br />
vorsehen, daß der Gemeinderat den Mitgliedern des Verwaltungsrats auch<br />
in bestimmten anderen Fällen Weisungen erteilen kann. 6 Die Abstimmung<br />
entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit des Beschlusses des<br />
Verwaltungsrats nicht. 7 Für den Ausschluss wegen persönlicher<br />
Beteiligung gilt Art. 49 entsprechend.<br />
(3) 1 Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und den<br />
übrigen Mitgliedern. 2 Den Vorsitz führt der erste Bürgermeister; mit<br />
seiner Zustimmung kann der Gemeinderat eine andere Person zum<br />
vorsitzenden Mitglied bestellen. 3 Das vorsitzende Mitglied nach Satz 2<br />
Halbsatz 2 und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom<br />
Gemeinderat für sechs Jahre bestellt. 4 Die Amtszeit von Mitgliedern des<br />
Verwaltungsrats, die dem Gemeinderat angehören, endet mit dem Ende<br />
der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Gemeinderat
oder bei berufsmäßigen Gemeinderatsmitgliedern mit dem Ausscheiden<br />
aus dem Beamtenverhältnis. 5 Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr<br />
Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus. 6 Mitglieder des<br />
Verwaltungsrats können nicht sein:<br />
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte des<br />
Kommunalunternehmens,<br />
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen<br />
oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an<br />
denen das Kommunalunternehmen mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine<br />
Beteiligung am Stimmrecht genügt,<br />
3. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar<br />
mit Aufgaben der Aufsicht über das Kommunalunternehmen befaßt sind.<br />
(4) 1 Das Kommunalunternehmen hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu<br />
sein, wenn es auf Grund einer Aufgabenübertragung nach Art. 89 Abs. 2<br />
hoheitliche Befugnisse ausübt. 2 Wird es aufgelöst, hat die Gemeinde die<br />
Beamten und die Versorgungsempfänger zu übernehmen. 3 Wird das<br />
Unternehmensvermögen ganz oder teilweise auf andere juristische<br />
Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übertragen, so<br />
gelten für die Übernahme und die Rechtsstellung der Beamten und der<br />
Versorgungsempfänger des Kommunalunternehmens Art. 51 bis 54 und<br />
69 BayBG, bei länderübergreifendem Vermögensübergang §§ 16 bis 19<br />
des Beamtenstatusgesetzes.<br />
(5) 1 Beamten in einem Regie- oder Eigenbetrieb, der nach Art. 89 Abs. 1<br />
Satz 1 ganz oder teilweise in ein Kommunalunternehmen umgewandelt<br />
wird, kann im dienstlichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer<br />
Zustimmung eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit bei dem<br />
Kommunalunternehmen zugewiesen werden. 2 Die Zuweisung bedarf nicht<br />
der Zustimmung des Beamten, wenn dringende öffentliche Interessen sie<br />
erfordern. 3 Die Rechtsstellung des Beamten bleibt unberührt. 4 Über die<br />
Zuweisung entscheidet die oberste Dienstbehörde.<br />
Bay GO Art. 91 Sonstige Vorschriften für Kommunalunternehmen<br />
(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht von Kommunalunternehmen<br />
werden nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften<br />
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt und geprüft, sofern nicht<br />
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche<br />
Vorschriften entgegenstehen.<br />
(2) Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde haben das Recht, sich<br />
zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach Art. 106 Abs. 4 Sätze 2<br />
und 3 auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck den<br />
Betrieb, die Bücher und Schriften des Kommunalunternehmens<br />
einzusehen.<br />
(3) Die Art. 4 Abs. 2, Art. 61, 62, 69, 70, 74, 75, 77 und 101 und die<br />
Vorschriften des Vierten Teils über die staatliche Aufsicht und die<br />
Rechtsmittel sind auf das Kommunalunternehmen sinngemäß<br />
anzuwenden.<br />
(4) Das Unternehmen ist zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in<br />
demselben Umfang berechtigt wie die Gemeinde, wenn es auf Grund einer
Aufgabenübertragung nach Art. 89 Abs. 2 hoheitliche Befugnisse ausübt<br />
und bei der Aufgabenübertragung nichts Abweichendes geregelt wird.<br />
Bay GO Art. 92 Unternehmen in Privatrechtsform<br />
(1) 1 Gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform und gemeindliche<br />
Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform sind nur zulässig, wenn<br />
1. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sichergestellt ist, daß das<br />
Unternehmen den öffentlichen Zweck gemäß Art. 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1<br />
erfüllt,<br />
2. die Gemeinde angemessenen Einfluß im Aufsichtsrat oder in einem<br />
entsprechenden Gremium erhält,<br />
3. die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten, ihrer<br />
Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird; die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde kann von der Haftungsbegrenzung befreien.<br />
2<br />
Zur Sicherstellung des öffentlichen Zwecks von Gesellschaften mit<br />
beschränkter Haftung soll im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung<br />
bestimmt werden, daß die Gesellschafterversammlung auch über den<br />
Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen und<br />
über den Abschluß und die Änderung von Unternehmensverträgen<br />
beschließt. 3 In der Satzung von Aktiengesellschaften soll bestimmt<br />
werden, daß zum Erwerb und zur Veräußerung von Unternehmen und<br />
Beteiligungen die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig ist.<br />
(2) Die Gemeinde darf dem Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen<br />
durch Unternehmen in Privatrechtsform, an denen sie unmittelbar oder<br />
mittelbar beteiligt ist, nur unter entsprechender Anwendung der für sie<br />
selbst geltenden Vorschriften zustimmen.<br />
Bay GO Art. 93 Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in<br />
Privatrechtsform<br />
(1) 1 Der erste Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der<br />
Gesellschafterversammlung oder einem entsprechenden Organ. 2 Mit<br />
Zustimmung des ersten Bürgermeisters und der weiteren Bürgermeister<br />
kann der Gemeinderat eine andere Person zur Vertretung widerruflich<br />
bestellen.<br />
(2) 1 Die Gemeinde soll bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder<br />
der Satzung darauf hinwirken, daß ihr das Recht eingeräumt wird,<br />
Mitglieder in einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu<br />
entsenden, soweit das zur Sicherung eines angemessenen Einflusses<br />
notwendig ist. 2 Vorbehaltlich entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften<br />
haben Personen, die von der Gemeinde entsandt oder auf ihre<br />
Veranlassung gewählt wurden, die Gemeinde über alle wichtigen<br />
Angelegenheiten möglichst frühzeitig zu unterrichten und ihr auf<br />
Verlangen Auskunft zu erteilen. 3 Soweit zulässig, soll sich die Gemeinde<br />
ihnen gegenüber Weisungsrechte im Gesellschaftsvertrag oder der<br />
Satzung vorbehalten.<br />
(3) 1 Wird die Person, die die Gemeinde vertritt oder werden die in Absatz 2<br />
genannten Personen aus ihrer Tätigkeit haftbar gemacht, stellt die<br />
Gemeinde sie von der Haftung frei. 2 Bei Vorsatz oder grober<br />
Fahrlässigkeit kann die Gemeinde Rückgriff nehmen, es sei denn, das
schädigende Verhalten beruhte auf ihrer Weisung. 3 Die Sätze 1 und 2<br />
gelten entsprechend für Personen, die auf Veranlassung der Gemeinde als<br />
nebenamtliche Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans<br />
bestellt sind.<br />
Bay GO Art. 94 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in<br />
Privatrechtsform<br />
(1) 1 Gehören der Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53<br />
des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) bezeichneten Umfang, so hat sie<br />
1. darauf hinzuwirken, daß in sinngemäßer Anwendung der für<br />
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein<br />
Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige<br />
Finanzplanung zugrunde gelegt wird,<br />
2. dafür Sorge zu tragen, daß der Jahresabschluß und der Lagebericht<br />
nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des<br />
Handelsgesetzbuchs aufgestellt und geprüft werden, sofern nicht<br />
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche<br />
Vorschriften entgegenstehen,<br />
3. die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG auszuüben,<br />
4. darauf hinzuwirken, daß ihr und dem für sie zuständigen überörtlichen<br />
Prüfungsorgan die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt<br />
werden,<br />
5. darauf hinzuwirken, daß jedes Mitglied des geschäftsführenden<br />
Unternehmensorgans vertraglich verpflichtet wird, die ihm im<br />
Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9<br />
Buchst. a des Handelsgesetzbuchs der Gemeinde jährlich zur<br />
Veröffentlichung entsprechend Absatz 3 Satz 2 mitzuteilen.<br />
2<br />
Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.<br />
(2) 1 Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen keine<br />
Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 HGrG, so soll die Gemeinde,<br />
soweit ihr Interesse das erfordert, darauf hinwirken, daß in der Satzung<br />
oder im Gesellschaftsvertrag der Gemeinde die Rechte nach § 53 Abs. 1<br />
HGrG und der Gemeinde und dem für sie zuständigen überörtlichen<br />
Prüfungsorgan die Befugnisse nach § 54 HGrG eingeräumt werden. 2 Bei<br />
mittelbaren Beteiligungen gilt das nur, wenn die Beteiligung den vierten<br />
Teil der Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der die<br />
Gemeinde allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften oder<br />
deren Zusammenschlüssen mit Mehrheit im Sinn des § 53 HGrG beteiligt<br />
ist.<br />
(3) 1 Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an<br />
Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr<br />
mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört.<br />
2<br />
Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des<br />
öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung<br />
der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des<br />
geschäftsführenden Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5, die<br />
Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. 3 Haben die Mitglieder des<br />
geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis mit der<br />
Veröffentlichung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, sind ihre Gesamtbezüge
so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften<br />
des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluß<br />
aufgenommen werden. 4 Der Bericht ist dem Gemeinderat vorzulegen.<br />
5<br />
Die Gemeinde weist ortsüblich darauf hin, daß jeder Einsicht in den<br />
Bericht nehmen kann.<br />
Bay GO Art. 95 Grundsätze für die Führung gemeindlicher<br />
Unternehmen<br />
(1) 1 Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen sind unter Beachtung<br />
betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit so zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt wird.<br />
2<br />
Entsprechendes gilt für die Steuerung und Überwachung von<br />
Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Gemeinde mit mehr als<br />
50 v. H. beteiligt ist; bei einer geringeren Beteiligung soll die Gemeinde<br />
darauf hinwirken.<br />
(2) Gemeindliche Unternehmen dürfen keine wesentliche Schädigung und<br />
keine Aufsaugung selbständiger Betriebe in Landwirtschaft, Handwerk,<br />
Handel, Gewerbe und Industrie bewirken.<br />
Bay GO Art. 96 Anzeigepflichten<br />
(1) 1 Entscheidungen der Gemeinde über<br />
1. die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung sowie die<br />
Änderung der Rechtsform oder der Aufgaben gemeindlicher Unternehmen,<br />
2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gemeinde an<br />
Unternehmen,<br />
3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung gemeindlicher Unternehmen<br />
oder Beteiligungen,<br />
4. die Auflösung von Kommunalunternehmen<br />
sind der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig, mindestens aber sechs<br />
Wochen vor ihrem Vollzug, vorzulegen. 2 In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2<br />
und 3 besteht keine Anzeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als<br />
den zwanzigsten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft. 3 Aus der<br />
Vorlage muß zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt<br />
sind. 4 Die Unternehmenssatzung von Kommunalunternehmen ist der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde stets vorzulegen.<br />
(2) Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 und die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für<br />
Entscheidungen des Verwaltungsrats eines Kommunalunternehmens.<br />
Bay GO Artikel 97 bis 99 (weggefallen)<br />
5. ABSCHNITT Kassen- und Rechnungswesen<br />
Bay GO Art. 100 Gemeindekasse<br />
(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte der Gemeinde.<br />
(2) 1 Die Gemeinde hat einen Kassenverwalter und einen Stellvertreter zu<br />
bestellen. 2 Diese Verpflichtung entfällt, wenn sie ihre Kassengeschäfte<br />
ganz durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen läßt.<br />
3<br />
Die Anordnungsbefugten der Gemeindeverwaltung, der Leiter und die
Prüfer des Rechnungsprüfungsamts und Bedienstete, denen örtliche<br />
Kassenprüfungen übertragen sind, können nicht gleichzeitig die Aufgaben<br />
eines Kassenverwalters oder seines Stellvertreters wahrnehmen.<br />
(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen weder miteinander<br />
noch mit den Anordnungsbefugten der Gemeindeverwaltung, dem Leiter<br />
und den Prüfern des Rechnungsprüfungsamts und den Bediensteten,<br />
denen örtliche Kassenprüfungen übertragen sind, durch ein<br />
Angehörigenverhältnis im Sinn des Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes verbunden sein.<br />
(4) 1 Sonderkassen sollen mit der Gemeindekasse verbunden werden. 2 Ist<br />
eine Sonderkasse nicht mit der Gemeindekasse verbunden, gelten für den<br />
Verwalter der Sonderkasse und dessen Stellvertreter die Absätze 2 und 3<br />
entsprechend.<br />
Bay GO Art. 101 Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften<br />
Die Gemeinde kann das Ermitteln von Ansprüchen und von<br />
Zahlungsverpflichtungen, das Vorbereiten der entsprechenden<br />
Kassenanordnungen, die Kassengeschäfte und das Rechnungswesen ganz oder<br />
zum Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lassen,<br />
wenn die ordnungsgemäße und sichere Erledigung und die Prüfung nach den<br />
für die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind.<br />
Bay GO Art. 102 Rechnungslegung, Jahresabschluss<br />
(1) 1 Im Jahresabschluss beziehungsweise in der Jahresrechnung ist das<br />
Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des <strong>Stand</strong>s des Vermögens<br />
und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres<br />
nachzuweisen. 2 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
doppelten kommunalen Buchführung besteht der Jahresabschluss aus der<br />
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz)<br />
und dem Anhang. 3 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
Kameralistik besteht die Jahresrechnung aus dem kassenmäßigen<br />
Abschluss und der Haushaltsrechnung. 4 Der Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht<br />
zu erläutern.<br />
(2) Der Jahresabschluss beziehungsweise die Jahresrechnung ist innerhalb<br />
von sechs Monaten, der konsolidierte Jahresabschluss (Art. 102 a)<br />
innerhalb von zehn Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres<br />
aufzustellen und sodann dem Gemeinderat vorzulegen.<br />
(3) 1 Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der<br />
Jahresabschlüsse (Art. 103) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten<br />
stellt der Gemeinderat alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des<br />
auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres den Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und<br />
beschließt über die Entlastung. 2 Ist ein konsolidierter Jahresabschluss<br />
aufzustellen (Art. 102 a), tritt an die Stelle des 30. Juni der 31. Dezember<br />
des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres. 3 Verweigert<br />
der Gemeinderat die Entlastung oder spricht er sie mit Einschränkungen<br />
aus, hat er die dafür maßgebenden Gründe anzugeben.
(4) Die Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Berichte über die<br />
Prüfungen einsehen.<br />
Bay GO Art. 102 a Konsolidierter Jahresabschluss<br />
(1) 1 Mit dem Jahresabschluss der Gemeinde sind die Jahresabschlüsse<br />
1. der außerhalb der allgemeinen Verwaltung geführten Sondervermögen<br />
ohne eigene Rechtspersönlichkeit,<br />
2. der rechtlich selbstständigen Organisationseinheiten und<br />
Vermögensmassen mit Nennkapital oder variablen Kapitalenteilen,<br />
3. der Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften mit<br />
kaufmännischer Rechnungslegung und der gemeinsamen<br />
Kommunalunternehmen und<br />
4. der von der Gemeinde verwalteten kommunalen Stiftungen mit<br />
kaufmännischem Rechnungswesen<br />
zu konsolidieren. 2 Das gilt nicht für die Jahresabschlüsse der Sparkassen.<br />
(2) 1 Aufgabenträger nach Abs. 1 sind entsprechend den §§ 300 bis 309 des<br />
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren (Volkskonsolidierung), wenn bei der<br />
Gemeinde die dem § 290 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs<br />
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. 2 Andere Aufgabenträger als<br />
nach Satz 1 sind entsprechend den §§ 311 und 312 des<br />
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren, es sei denn, sie sind für die<br />
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes<br />
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung.<br />
3<br />
Aufgabenträger nach Abs. 1 Nr. 3 können auch entsprechend § 310 des<br />
Handelsgesetzbuchs anteilsmäßig konsolidiert werden. 4 Für den Anteil an<br />
einem Zweckverband oder einer Verwaltungsgemeinschaft ist der<br />
Umlageschlüssel maßgebend.<br />
(3) Der konsolidierte Jahresabschluss ist durch eine Kapitalflussrechnung zu<br />
ergänzen und durch einen Konsolidierungsbericht zu erläutern.<br />
(4) Die Gemeinde hat bei den in Abs. 1 Satz 1 genannten Aufgabenträgern,<br />
Organisationseinheiten und Vermögensmassen darauf hinzuwirken, dass<br />
ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen alle Informationen und<br />
Unterlagen zu erhalten, die sie für die Konsolidierung der<br />
Jahresabschlüsse für erforderlich hält.<br />
6. ABSCHNITT Prüfungswesen<br />
Bay GO Art. 103 Örtliche Prüfungen<br />
(1) 1 Der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung sowie die Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen werden entweder vom Gemeinderat oder von einem<br />
Rechnungsprüfungsausschuss geprüft (örtliche Rechnungsprüfung). 2 Über<br />
die Beratungen sind Niederschriften aufzunehmen.<br />
(2) In Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern bildet der Gemeinderat aus<br />
seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuß mit mindestens drei und<br />
höchstens sieben Mitgliedern und bestimmt ein Ausschußmitglied zum<br />
Vorsitzenden; Art. 33 Abs. 2 findet keine Anwendung.
(3) 1 Zur Prüfung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten<br />
Jahresabschlusses sowie der Jahresrechnung können Sachverständige<br />
zugezogen werden. 2 In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt<br />
eingerichtet ist (Art. 104), ist das Rechnungsprüfungsamt umfassend als<br />
Sachverständiger heranzuziehen.<br />
(4) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse ist<br />
innerhalb von zwölf Monaten, die des konsolidierten Jahresabschlusses<br />
innerhalb von 18 Monaten nach Abschluß des Haushaltsjahres<br />
durchzuführen.<br />
(5) 1 Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem ersten Bürgermeister. 2 Er<br />
bedient sich in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt<br />
eingerichtet ist, dieses Amts.<br />
Bay GO Art. 104 Rechnungsprüfungsamt<br />
(1) 1 Kreisfreie Gemeinden müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrichten.<br />
2<br />
Kreisangehörige Gemeinden können ein Rechnungsprüfungsamt<br />
einrichten, wenn ein Bedürfnis dafür besteht und die Kosten in<br />
angemessenem Verhältnis zum Umfang der Verwaltung stehen.<br />
(2) 1 Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der örtlichen Rechnungsprüfung dem<br />
Gemeinderat und bei den örtlichen Kassenprüfungen dem ersten<br />
Bürgermeister unmittelbar verantwortlich. 2 Der Gemeinderat und der<br />
erste Bürgermeister können besondere Aufträge zur Prüfung der<br />
Verwaltung erteilen. 3 Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der<br />
Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz<br />
unterworfen. 4 Im übrigen bleiben die Befugnisse des ersten<br />
Bürgermeisters unberührt, dem das Rechnungsprüfungsamt unmittelbar<br />
untersteht.<br />
(3) 1 Der Gemeinderat bestellt den Leiter, seinen Stellvertreter und die Prüfer<br />
des Rechnungsprüfungsamts und beruft sie ab. 2 Der Gemeinderat kann<br />
den Leiter des Rechnungsprüfungsamts und seinen Stellvertreter gegen<br />
ihren Willen nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl<br />
der Mitglieder des Gemeinderats abberufen, wenn sie ihre Aufgabe nicht<br />
ordnungsgemäß erfüllen. 3 Die Abberufung von Prüfern des<br />
Rechnungsprüfungsamts gegen ihren Willen bedarf einer Mehrheit von<br />
zwei Dritteln der stimmberechtigten Gemeinderatsmitglieder.<br />
(4) 1 Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts muß Beamter auf Lebenszeit<br />
sein. 2 Er muß mindestens die Befähigung für den gehobenen<br />
nichttechnischen Verwaltungsdienst und die für sein Amt erforderliche<br />
Erfahrung und Eignung besitzen.<br />
(5) 1 Der Leiter, sein Stellvertreter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts<br />
dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur innehaben, wenn das mit<br />
ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 2 Sie dürfen Zahlungen für die<br />
Gemeinde weder anordnen noch ausführen. 3 Für den Leiter des<br />
Rechnungsprüfungsamts und seinen Stellvertreter gilt außerdem Art. 100<br />
Abs. 3 entsprechend.
Bay GO Art. 105 Überörtliche Prüfungen<br />
(1) Die überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfungen werden bei den<br />
Mitgliedern des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands durch diesen<br />
Verband, bei den übrigen Gemeinden durch die staatlichen<br />
Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter durchgeführt (überörtliche<br />
Prüfungsorgane).<br />
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung findet alsbald nach der Feststellung<br />
des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses<br />
beziehungsweise der Jahresrechnung sowie der Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen statt.<br />
Bay GO Art. 106 Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen<br />
(1) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die<br />
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere<br />
darauf, ob<br />
1. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten worden sind,<br />
2. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen<br />
beziehungsweise die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind<br />
sowie der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung sowie die Vermögensnachweise<br />
ordnungsgemäß aufgestellt sind,<br />
3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,<br />
4. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf<br />
andere Weise wirksamer erfüllt werden können.<br />
(2) 1 Die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser einschließlich der<br />
Jahresabschlüsse unterliegen der Rechnungsprüfung. 2 Absatz 1 gilt<br />
entsprechend.<br />
(3) 1 Die Rechnungsprüfung umfaßt auch die Wirtschaftsführung der<br />
Eigenbetriebe unter entsprechender Anwendung des Absatzes 1. 2 Dabei<br />
ist auf das Ergebnis der Abschlußprüfung (Art. 107) mit abzustellen.<br />
(4) 1 Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird die Betätigung der Gemeinde bei<br />
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die<br />
Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung<br />
kaufmännischer Grundsätze mitgeprüft. 2 Entsprechendes gilt bei Erwerbsund<br />
Wirtschaftsgenossenschaften, in denen die Gemeinde Mitglied ist,<br />
sowie bei Kommunalunternehmen. 3 Die Rechnungsprüfung umfaßt ferner<br />
die Buch-, Betriebs- und sonstigen Prüfungen, die sich die Gemeinde bei<br />
der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat.<br />
(5) Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsmäßige Erledigung der<br />
Kassengeschäfte, die ordnungsmäßige Einrichtung der Kassen und das<br />
Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft.<br />
(6) 1 Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde und das für sie<br />
zuständige überörtliche Prüfungsorgan können verlangen, dass ihnen oder<br />
ihren beauftragten Prüfern Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
für erforderlich halten, vorgelegt oder ihnen innerhalb einer bestimmten<br />
Frist übersandt werden. 2 Auskünfte sind ihnen oder ihren beauftragten<br />
Prüfern zu erteilen. 3 Die Auskunftspflicht nach den Sätzen 1 und 2 besteht
auch, soweit hierfür in anderen Bestimmungen eine besondere<br />
Rechtsvorschrift gefordert wird, und umfasst auch elektronisch<br />
gespeicherte Daten sowie deren automatisierten Abruf.<br />
Bay GO Art. 107 Abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und<br />
Kommunalunternehmen<br />
(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht eines Eigenbetriebs und eines<br />
Kommunalunternehmens sollen spätestens innerhalb von neun Monaten<br />
nach Schluß des Wirtschaftsjahres durch einen sachverständigen Prüfer<br />
(Abschlußprüfer) geprüft sein.<br />
(2) Die Abschlußprüfung wird vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband<br />
oder von einem Wirtschaftsprüfer oder von einer<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt.<br />
(3) 1 Die Abschlußprüfung erstreckt sich auf die Vollständigkeit und<br />
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der<br />
Buchführung und des Lageberichts. 2 Dabei werden auch geprüft<br />
1. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,<br />
2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität<br />
und Rentabilität,<br />
3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn<br />
diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von<br />
Bedeutung waren,<br />
4. die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen<br />
Jahresfehlbetrags.<br />
VIERTER TEIL Staatliche Aufsicht und Rechtsmittel<br />
1. ABSCHNITT Rechtsaufsicht und Fachaufsicht<br />
Bay GO Art. 108 Sinn der staatlichen Aufsicht<br />
Die Aufsichtsbehörden sollen die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
verständnisvoll beraten, fördern und schützen sowie die Entschlußkraft und die<br />
Selbstverantwortung der Gemeindeorgane stärken.<br />
Bay GO Art. 109 Inhalt und Grenzen der Aufsicht<br />
(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Art. 7) beschränkt<br />
sich die staatliche Aufsicht darauf, die Erfüllung der gesetzlich<br />
festgelegten und übernommenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben und<br />
Verpflichtungen der Gemeinden und die Gesetzmäßigkeit ihrer<br />
Verwaltungstätigkeit zu überwachen (Rechtsaufsicht).<br />
(2) 1 In den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises (Art. 8)<br />
erstreckt sich die staatliche Aufsicht auch auf die Handhabung des<br />
gemeindlichen Verwaltungsermessens (Fachaufsicht). 2 Eingriffe in das<br />
Verwaltungsermessen sind auf die Fälle zu beschränken, in denen<br />
1. das Gemeinwohl oder öffentlich-rechtliche Ansprüche einzelner eine<br />
Weisung oder Entscheidung erfordern oder<br />
2. die Bundesregierung nach Art. 84 Abs. 5 oder Art. 85 Abs. 3 des<br />
Grundgesetzes eine Weisung erteilt.
Bay GO Art. 110 Rechtsaufsichtsbehörden<br />
1 Die Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden obliegt dem<br />
Landratsamt als staatliche Verwaltungsaufgabe. 2 Die Rechtsaufsicht über die<br />
kreisfreien Gemeinden obliegt der Regierung. 3 Diese ist obere<br />
Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden. 4 Das<br />
Staatsministerium des Innern ist obere Rechtsaufsichtsbehörde für die<br />
kreisfreien Gemeinden.<br />
Bay GO Art. 111 Informationsrecht<br />
1 Die Rechtsaufsichtsbehörde ist befugt, sich über alle Angelegenheiten der<br />
Gemeinde zu unterrichten. 2 Sie kann insbesondere Anstalten und<br />
Einrichtungen der Gemeinde besichtigen, die Geschäfts- und Kassenführung<br />
prüfen sowie Berichte und Akten einfordern.<br />
Bay GO Art. 112 Beanstandungsrecht<br />
1 Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechtswidrige Beschlüsse und Verfügungen<br />
der Gemeinde beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung verlangen.<br />
2 Bei Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben oder Verpflichtungen kann<br />
die Rechtsaufsichtsbehörde die Gemeinde zur Durchführung der notwendigen<br />
Maßnahmen auffordern.<br />
Bay GO Art. 113 Recht der Ersatzvornahme<br />
1 Kommt die Gemeinde binnen einer ihr gesetzten angemessenen Frist den<br />
Anordnungen der Rechtsaufsichtsbehörde nicht nach, kann diese die<br />
notwendigen Maßnahmen an Stelle der Gemeinde verfügen und vollziehen.<br />
2 Die Kosten trägt die Gemeinde.<br />
Bay GO Art. 114 Bestellung eines Beauftragten<br />
(1) Ist der geordnete Gang der Verwaltung durch Beschlußunfähigkeit des<br />
Gemeinderats oder durch seine Weigerung, gesetzmäßige Anordnungen<br />
der Rechtsaufsichtsbehörde auszuführen, ernstlich behindert, so kann die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde den ersten Bürgermeister ermächtigen, bis zur<br />
Behebung des gesetzwidrigen Zustands für die Gemeinde zu handeln.<br />
(2) 1 Weigert sich der erste Bürgermeister oder ist er aus tatsächlichen oder<br />
rechtlichen Gründen verhindert, die Aufgaben nach Absatz 1<br />
wahrzunehmen, so beauftragt die Rechtsaufsichtsbehörde die weiteren<br />
Bürgermeister in ihrer Reihenfolge, für die Gemeinde zu handeln, solange<br />
es erforderlich ist. 2 Sind keine weiteren Bürgermeister vorhanden oder<br />
sind auch sie verhindert oder nicht handlungswillig, so handelt die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde für die Gemeinde.<br />
(3) Die Staatsregierung kann ferner, wenn sich der gesetzwidrige Zustand<br />
anders nicht beheben lässt, den Gemeinderat auflösen und dessen<br />
Neuwahl anordnen.<br />
Bay GO Art. 115 Fachaufsichtsbehörden<br />
(1) 1 Die Zuständigkeit zur Führung der Fachaufsicht auf den einzelnen<br />
Gebieten des übertragenen Wirkungskreises bestimmt sich nach den<br />
hierfür geltenden besonderen Vorschriften. 2 Soweit solche besonderen
Vorschriften nicht bestehen, obliegt den Rechtsaufsichtsbehörden auch die<br />
Führung der Fachaufsicht.<br />
(2) Soweit Große Kreisstädte Aufgaben wahrnehmen, die ihnen nach Art. 9<br />
Abs. 2 übertragen sind, richtet sich die Fachaufsicht nach den für<br />
kreisfreie Gemeinden geltenden Vorschriften.<br />
Bay GO Art. 116 Befugnisse der Fachaufsicht<br />
(1) 1 Die Fachaufsichtsbehörden können sich über Angelegenheiten des<br />
übertragenen Wirkungskreises in gleicher Weise wie die<br />
Rechtsaufsichtsbehörden unterrichten (Art. 111). 2 Sie können ferner der<br />
Gemeinde für die Behandlung übertragener Angelegenheiten unter<br />
Beachtung des Art. 109 Abs. 2 Satz 2 Weisungen erteilen. 3 Zu<br />
weitergehenden Eingriffen in die Gemeindeverwaltung sind die<br />
Fachaufsichtsbehörden unbeschadet der Entscheidung über Widersprüche<br />
(Art. 119 Nr. 2) nicht befugt.<br />
(2) 1 Die Rechtsaufsichtsbehörden sind verpflichtet, die Fachaufsichtsbehörden<br />
bei der Durchführung ihrer gesetzlichen Aufgaben nötigenfalls unter<br />
Anwendung der in den Art. 113 und 114 festgelegten Befugnisse zu<br />
unterstützen. 2 Bei der Ersatzvornahme tritt die Weisung der<br />
Fachaufsichtsbehörde an die Stelle der Anordnung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde. 3 Soweit Große Kreisstädte Aufgaben<br />
wahrnehmen, die ihnen nach Art. 9 Abs. 2 übertragen sind, richtet sich die<br />
Zuständigkeit der Rechtsaufsichtsbehörden im Rahmen von Satz 1 nach<br />
den für kreisfreie Gemeinden geltenden Vorschriften.<br />
Bay GO Art. 117 Genehmigungsbehörde<br />
(1) Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Genehmigungen erteilt, soweit<br />
nichts anderes bestimmt ist, die Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 110).<br />
(2) Gemeindliche Beschlüsse sowie Geschäfte des bürgerlichen Rechts<br />
erlangen Rechtswirksamkeit erst mit der Erteilung der nach diesem Gesetz<br />
erforderlichen Genehmigung.<br />
(3) Die Anträge auf Erteilung der Genehmigungen sind ohne schuldhafte<br />
Verzögerung zu verbescheiden.<br />
Bay GO Art. 117 a Ausnahmegenehmigungen<br />
1 Das Staatsministerium des Innern kann im Interesse der Weiterentwicklung<br />
der kommunalen Selbstverwaltung zur Erprobung neuer Modelle der Steuerung<br />
und des Haushalts- und Rechnungswesens, der Verfahrensvereinfachung und<br />
der Verwaltungsführung auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen von Regelungen<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s und der nach Art. 123 erlassenen Vorschriften genehmigen.<br />
2 Die Genehmigung ist zu befristen. 3 Bedingungen und Auflagen sind<br />
insbesondere zulässig, um die Vergleichbarkeit des Kommunalrechtsvollzugs<br />
auch im Rahmen einer Erprobung möglichst zu wahren und die Ergebnisse der<br />
Erprobung für andere Gemeinden, für Landkreise und für Bezirke nutzbar zu<br />
machen.
2. ABSCHNITT Rechtsmittel<br />
Bay GO Artikel 118 (weggefallen)<br />
Bay GO Art. 119 Erlaß des Widerspruchsbescheids<br />
(§ 73 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)<br />
Den Widerspruchsbescheid erläßt<br />
1. in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde, die dabei auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit<br />
beschränkt ist; zuvor hat die Selbstverwaltungsbehörde nach § 72 VwGO auch<br />
die Zweckmäßigkeit zu überprüfen,<br />
2. in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises die<br />
Fachaufsichtsbehörde; ist Fachaufsichtsbehörde eine oberste Landesbehörde,<br />
so entscheidet die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat; Art. 109<br />
Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung.<br />
Bay GO Art. 120 Anfechtung aufsichtlicher Verwaltungsakte<br />
Über den Widerspruch kreisangehöriger Gemeinden gegen einen aufsichtlichen<br />
Verwaltungsakt entscheidet<br />
1. in Angelegenheiten der Rechtsaufsicht die Regierung,<br />
2. in Angelegenheiten der Fachaufsicht die höhere Fachaufsichtsbehörde; ist<br />
höhere Fachaufsichtsbehörde eine oberste Landesbehörde, so entscheidet die<br />
Behörde, die den aufsichtlichen Verwaltungsakt erlassen hat.<br />
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay GO Art. 121 Inkrafttreten<br />
(1) 1 Dieses Gesetz ist dringlich. 2 Es tritt am 18. Januar 1952 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ursprünglichen Fassung vom 25. Januar 1952 (GVBl S. 19). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens<br />
der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(2) gegenstandslos<br />
Bay GO Art. 122 Einwohnerzahl<br />
(1) 1 Soweit nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
erlassenen Rechtsverordnung die Einwohnerzahl von rechtlicher<br />
Bedeutung ist, ist die Einwohnerzahl maßgebend, die bei der letzten Wahl<br />
der Gemeinderatsmitglieder zugrunde gelegt wurde. 2 Art. 34 Abs. 3 bleibt<br />
unberührt.<br />
(2) weggefallen<br />
Bay GO Art. 123 Ausführungsvorschriften<br />
(1) 1 Das Staatsministerium des Innern erläßt die zum Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
erforderlichen Ausführungsvorschriften. 2 Es wird insbesondere ermächtigt,<br />
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch<br />
Rechtsverordnungen zu regeln:<br />
1. den Inhalt und die Gestaltung des Haushaltsplans einschließlich des<br />
Stellenplans, der mittelfristigen Finanzplanung und des<br />
Investitionsprogramms, ferner die Veranschlagung von Einzahlungen,
Auszahlungen, Erträgen und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen,<br />
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einen vom Haushaltsjahr<br />
abweichenden Wirtschaftszeitraum,<br />
2. die Ausführung des Haushaltsplans, die Anordnung von Zahlungen, die<br />
Haushaltsüberwachung, die Stundung, die Niederschlagung und den Erlaß<br />
von Ansprüchen und die Behandlung von Kleinbeträgen,<br />
3. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen und die Vergabe von<br />
Aufträgen,<br />
4. die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme und Verwendung von<br />
Rücklagen und deren Mindesthöhe,<br />
5. die Bildung und Auflösung von Rückstellungen,<br />
6. die Geldanlagen und ihre Sicherung,<br />
7. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und die Abschreibung der<br />
Vermögensgegenstände; dabei kann die Bewertung und Abschreibung auf<br />
einzelne Bereiche beschränkt werden,<br />
8. die Aufstellung der Eröffnungsbilanz auch unter Abweichung von Art. 74<br />
Abs. 4 und der folgenden Bilanzen,<br />
9. die Kassenanordnungen, die Aufgaben und die Organisation der<br />
Gemeindekasse und der Sonderkassen, den Zahlungsverkehr, die<br />
Verwaltung der Kassenmittel, der Wertgegenstände und anderer<br />
Gegenstände, die Buchführung sowie die Möglichkeit, daß die Buchführung<br />
und die Verwahrung von Wertgegenständen von den Kassengeschäften<br />
abgetrennt werden können,<br />
10. den Inhalt und die Gestaltung der Jahresrechnung und die Abwicklung<br />
der Vorjahresergebnisse,<br />
11. den Inhalt und die Gestaltung des Jahresabschlusses und des<br />
konsolidierten Jahresabschlusses; dabei können auch Ausnahmen von der<br />
und Übergangsfristen für die Konsolidierungspflicht vorgesehen werden,<br />
12. den Inhalt und die Gestaltung des Rechenschaftsberichts zur<br />
Jahresrechnung beziehungsweise zum Jahresabschluss, des Anhangs zum<br />
Jahresabschluss sowie des Konsolidierungsberichts zum konsolidierten<br />
Jahresabschluss,<br />
13. den Aufbau und die Verwaltung, die Wirtschaftsführung, das<br />
Rechnungswesen und die Prüfung der Eigenbetriebe,<br />
14. die Prüfung der Jahresrechnungen, der Jahresabschlüsse und der<br />
konsolidierten Jahresabschlüsse, die Prüfung der Gemeindekasse und der<br />
Sonderkassen, die Abschlußprüfung und die Freistellung von der<br />
Abschlußprüfung, die Prüfung von Verfahren der automatisierten<br />
Datenverarbeitung im Bereich des Finanzwesens der Gemeinden, die<br />
Rechte und Pflichten der Prüfer, die über Prüfungen zu erstellenden<br />
Berichte und deren weitere Behandlung sowie die Organisation der<br />
staatlichen Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter,<br />
15. das Verfahren bei der Errichtung der Kommunalunternehmen sowie<br />
bei der Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Kommunalunternehmen<br />
und den Aufbau, die Verwaltung, die Wirtschaftsführung sowie das<br />
Rechnungs- und Prüfungswesen der Kommunalunternehmen.<br />
3 Das Staatsministerium des Innern wird weiter ermächtigt, im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,<br />
Familie, Frauen und Gesundheit und mit dem Staatsministerium der
Finanzen die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser und der<br />
Pflegeeinrichtungen der Gemeinden durch Rechtsverordnung zu regeln.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium des Innern erläßt die erforderlichen<br />
Verwaltungsvorschriften und gibt Muster, insbesondere für<br />
1. die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung,<br />
2. die Darstellung des Haushaltsplans und des mittelfristigen Finanzplans<br />
insbesondere<br />
a) die Konten und Produkte bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen<br />
der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
b) die Gliederung und die Gruppierung bei Haushaltswirtschaft nach den<br />
Grundsätzen der Kameralistik,<br />
3. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen, des mittelfristigen<br />
Finanzplans und des Investitionsprogramms,<br />
4. die Gliederung und die Form des Jahresabschlusses und des<br />
konsolidierten Jahresabschlusses,<br />
5. die Darstellung und die Form der Vermögensnachweise,<br />
6. die Kassenanordnungen, die Buchführung, die Jahresrechnung und ihre<br />
Anlagen,<br />
7. die Gliederung und die Form des Wirtschaftsplans und seiner Anlagen, des<br />
mittelfristigen Finanzplans und des Investitionsprogramms, des<br />
Jahresabschlusses, der Anlagenachweise und der Erfolgsübersicht für<br />
Eigenbetriebe und für Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen,<br />
im Allgemeinen Ministerialblatt bekannt. 2 Es kann solche Muster für<br />
verbindlich erklären. 3 Die Zuordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle zu den<br />
Darstellungen gemäß Satz 1 Nrn. 2 bis 5 kann durch Verwaltungsvorschrift<br />
in gleicher Weise verbindlich festgestellt werden. 4 Die<br />
Verwaltungsvorschriften zur Darstellung des Haushaltsplans und des<br />
mittelfristigen Finanzplans sind im Einvernehmen mit dem Staatsministerium<br />
der Finanzen zu erlassen.<br />
Bay GO Art. 124 Einschränkung von Grundrechten<br />
Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s können die Grundrechte auf Freiheit der Person und<br />
der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2,<br />
Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 102 und 106 Abs. 3 der Verfassung).
Verordnung über Aufgaben der Großen<br />
Kreisstädte (Bay GrKrV)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 1991 (GVBl. S. 123), geändert durch<br />
Verordnungen vom 28. Juli 1992 (GVBl. S. 278), vom 15. September 1992 (GVBl. S. 440), vom 13.<br />
Oktober 1992 (GVBl. S. 528, ber. S. 771), vom 14. September 1993 (GVBl. S. 724), vom 8. Januar<br />
1996 (GVBl. S. 3), vom 14. Dezember 1999 (GVBl. S. 561), vom 7. Mai 2002 (GVBl. S. 199), vom<br />
8. Mai 2007 (GVBl. S. 326), durch Gesetz vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 864), durch<br />
Verordnung vom 11. Dezember 2007 (GVBl. S. 981), durch Gesetz vom 10. Juni 2008 (GVBl.<br />
S. 319) (FN BayRS 2020-1-1-3-I)<br />
Auf Grund des Art. 9 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung und des § 36 Abs. 2<br />
Satz 1 des <strong>Gesetze</strong>s über Ordnungswidrigkeiten erläßt die Bayerische<br />
Staatsregierung folgende Verordnung:<br />
Bay GrKrV § 1<br />
(1) Die Großen Kreisstädte erfüllen im übertragenen Wirkungskreis folgende<br />
Aufgaben, die sonst vom Landratsamt als der unteren staatlichen<br />
Verwaltungsbehörde wahrzunehmen sind:<br />
1. Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde (Art. 53 Abs. 1 der<br />
Bayerischen Bauordnung),<br />
2. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde (§ 21 des<br />
Wasserhaushaltsgesetzes – WHG –, Art. 68, 69 und 75 des Bayerischen<br />
Wassergesetzes – BayWG –)<br />
a) in Verfahren über eine Erlaubnis nach § 7 WHG in Verbindung mit<br />
Art. 16, 17 und 17 a BayWG für das Einleiten von Abwasser aus<br />
Kleinkläranlagen mit einem Anfall häuslicher Abwässer bis zu 8 m 3 je Tag<br />
und von Niederschlagswasser, soweit die Einleitung nicht nach § 7 Abs. 1<br />
in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 4 des Abwasserabgabengesetzes<br />
abgabepflichtig ist, in Gewässer,<br />
b) nach §§ 19 g bis 19 l WHG Art. 37 BayWG und den auf diese Vorschrift<br />
gestützten Rechtsverordnungen bei Heizölverbrauchertankanlagen,<br />
c) nach § 21 WHG und Art. 68 und 69 BayWG in den Fällen der<br />
Buchstaben a und b,<br />
d) nach § 31 b Abs. 4 Satz 3 WHG,<br />
3. Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde (Art. 4 Abs. 1 des<br />
<strong>Gesetze</strong>s über Zuständigkeiten im Verkehrswesen),<br />
4. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde zum Vollzug des<br />
Gaststättengesetzes und der auf Grund des Gaststättengesetzes<br />
ergangenen Verordnung (§ 1 Abs. 1 der Gaststättenverordnung) sowie<br />
zum Vollzug des § 15 Abs. 2 Satz 1 der Gewerbeordnung, soweit sich<br />
diese Vorschrift auf Gewerbetreibende bezieht, die den Vorschriften des<br />
Gaststättengesetzes unterliegen,<br />
5. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde zum Vollzug der §§ 33 a und<br />
33 i der Gewerbeordnung (GewO) sowie des § 15 Abs. 2 Satz 1 GewO,<br />
soweit sich diese Vorschrift auf Gewerbebetriebe bezieht, die den<br />
Vorschriften der §§ 33 a und 33 i GewO unterliegen, und zum Vollzug der<br />
§§ 69 bis 69 b sowie § 70 a GewO, auch in Verbindung mit § 60 b Abs. 2<br />
GewO (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung der<br />
Gewerbeordnung),
6. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde zum Vollzug des<br />
Bestattungsgesetzes und der auf Grund des Bestattungsgesetzes<br />
ergangenen Verordnung (§ 31 der Bestattungsverordnung),<br />
7. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde zum Vollzug des § 10 des<br />
<strong>Gesetze</strong>s zum Schutz gegen Fluglärm (Art. 2 des <strong>Gesetze</strong>s zur Ausführung<br />
des <strong>Gesetze</strong>s zum Schutz gegen Fluglärm),<br />
8. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde zum Vollzug des § 1 Abs. 2 der<br />
Verordnung zur Durchführung des Wohnraumförderungs- und<br />
Wohnungsbindungsrechts (DVWoR),<br />
9. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde zum Vollzug des Art. 19 Abs. 3<br />
und 5 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes,<br />
10. weggefallen<br />
11. Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde zum Vollzug des § 11 der<br />
Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen, wenn das Bauprodukt<br />
ausschließlich im bauaufsichtlichen Bereich oder in einem Bereich<br />
Verwendung findet, für den den Großen Kreisstädten nach den<br />
vorstehenden Nummern der Aufgabenvollzug übertragen worden ist.<br />
(2) Die Zuständigkeit der Großen Kreisstädte für die Verfolgung und Ahndung<br />
von Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach der Verordnung über<br />
Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht.<br />
Bay GrKrV § 2<br />
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1972 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung in der ursprünglichen<br />
Fassung vom 15. Juni 1972 (GVBl S. 202). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren<br />
Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsverordnungen.
<strong>Bayerisches</strong> Immissionsschutzgesetz<br />
(Bay ImSchG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 16. Juli 1986 (GVBl. S. 135), vom 28. Juni 1990 (GVBl. S. 213, ber.<br />
S. 231), vom 27. Februar 1991 (GVBl. S. 64), vom 26. März 1992 (GVBl. S. 42), vom 24. Juli 1996<br />
(GVBl. S. 290), vom 9. Mai 1998 (GVBl. S. 243), vom 24. Dezember 2001 (GVBl. S. 999), vom 25.<br />
Mai 2003 (GVBl. S. 335), vom 7. Dezember 2004 (GVBl. S. 499), vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 287),<br />
vom 10. Juni 2008 (GVBl. S. 317), vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 466)<br />
Amtliche Fußnote: Dieses Gesetz dient auch der weiteren Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG des<br />
Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen<br />
(ABl EG 1997 Nr. L 10 S. 13).<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Ausführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes<br />
Art. 1 Genehmigungsbedürftige Anlagen<br />
Art. 2 Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen<br />
Art. 3 Anlagen in Betriebsbereichen<br />
Art. 4 Überwachung<br />
Art. 4 a Sonderregelung für kerntechnische Anlagen<br />
Art. 5 Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen<br />
Art. 6 Luftüberwachung<br />
Art. 7 Emissionskataster<br />
Art. 8 Luftreinhaltepläne<br />
Art. 8 a Lärmkarten und Lärmaktionspläne<br />
Art. 9 Finanzhilfen<br />
Art. 10 Verordnungen der Gemeinden<br />
ZWEITER TEIL Schutz vor Einwirkungen aus unnötig störenden Betätigungen<br />
Art. 11<br />
Art. 12 Motoren
Art. 13 und 13 a<br />
Art. 14 Verordnungen der Gemeinden<br />
§ 15<br />
DRITTER TEIL Verhinderung von Störfällen und Begrenzung der<br />
Auswirkungen von Störfällen durch den Umgang mit gefährlichen Stoffen in<br />
Anlagen in nicht gewerblichen und nicht wirtschaftlichen Betriebsbereichen<br />
Art. 16 Anwendungsbereich und materielle Anforderungen<br />
Art. 16 a Zuständigkeit<br />
Art. 16 b Verordnungsermächtigung<br />
VIERTER TEIL Gemeinsame und Schlussvorschriften<br />
Art. 17 Einschränkung von Grundrechten<br />
Art. 18 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 19 Aufsicht und Oberste Landesbehörde, Auffangzuständigkeit<br />
Art. 19 a Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Änderung des Bayerischen<br />
Immissionsschutzgesetzes vom 24. Dezember 2001<br />
Art. 20 Inkrafttreten<br />
ERSTER TEIL Ausführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes<br />
Bay ImSchG Art. 1 Genehmigungsbedürftige Anlagen<br />
(1) Zuständige Behörde nach §§ 4 bis 21 des Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) (Genehmigungsbehörde) ist<br />
a)<br />
- für Anlagen der öffentlichen Versorgung zur Erzeugung von Strom,<br />
Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den<br />
Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung,<br />
ausgenommen Anlagen zum Einsatz von Biogas und von<br />
naturbelassenem Holz mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger<br />
als 10 MW, sowie für Elektroumspannanlagen der öffentlichen<br />
Versorgung mit einer Oberspannung von 220 Kilovolt oder mehr<br />
einschließlich der Schaltfelder,<br />
- für Anlagen der öffentlichen Entsorgung zur thermischen Behandlung<br />
von Abfällen zur Beseitigung und Anlagen der öffentlichen Entsorgung<br />
zur Lagerung oder Behandlung gefährlicher Abfälle zur Beseitigung sowie<br />
- für Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen,
die Regierung,<br />
b) für Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörde unterliegen, das<br />
Bergamt,<br />
c) für die übrigen Anlagen die Kreisverwaltungsbehörde.<br />
(2) 1 Die Genehmigungsbehörde ist zuständig für sonstige Amtshandlungen,<br />
die im Bundes-Immissionsschutzgesetz und in den auf dieses Gesetz<br />
gestützten Rechtsverordnungen vorgesehen sind, insbesondere für die<br />
Anordnung von Ermittlungen und Prüfungen, die Bestellung von<br />
Betriebsbeauftragten, die Entgegennahme von Anzeigen und die<br />
Zulassung von Ausnahmen. 2 Sie ist ferner zuständig für die<br />
Betriebsuntersagung wegen fehlender Deckungsvorsorge nach dem<br />
Gesetz über die Umwelthaftung.<br />
Bay ImSchG Art. 2 Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen<br />
(1) Die Kreisverwaltungsbehörde trifft die Anordnungen nach §§ 24, 25<br />
BImSchG und ist die zuständige Behörde für sonstige Amtshandlungen im<br />
Sinn von Art. 1 Abs. 2.<br />
(2) Abweichend von Absatz 1 ist für Anlagen, die der Aufsicht der<br />
Bergbehörde unterliegen, das Bergamt zuständig.<br />
(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Gemeinde zuständige Behörde für die<br />
Zulassung von Ausnahmen von den Regelungen der Betriebszeiten für<br />
Rasenmäher, soweit das Bundesrecht dazu befugt.<br />
Bay ImSchG Art. 3 Anlagen in Betriebsbereichen<br />
1 Für Amtshandlungen im Sinn von Art. 1 Abs. 2 oder Art. 2, die einen<br />
Betriebsbereich nach § 3 Abs. 5 a BImSchG (Betriebsbereich) als Ganzes<br />
betreffen, ist die Behörde zuständig, die für die Anlagen im Betriebsbereich<br />
zuständig ist. 2 Sind nach Satz 1 mehrere Behörden zuständig, ist die<br />
Regierung zuständige Behörde, es sei denn, sie bestimmt, dass eine nach<br />
Satz 1 zuständige Behörde zu entscheiden hat. 3 Die zuständige Behörde<br />
nimmt Amtshandlungen im Sinn von Satz 1 im Einvernehmen mit allen<br />
Behörden vor, die nach den Art. 1 oder 2 für Anlagen im Betriebsbereich<br />
zuständig sind, es sei denn, es ist eine Anzeige entgegenzunehmen oder es ist<br />
Gefahr im Verzug; in diesen Fällen sind die anderen Behörden unverzüglich<br />
von der Amtshandlung zu unterrichten.<br />
Bay ImSchG Art. 4 Überwachung<br />
(1) 1 Die Einhaltung der Anforderungen, die nach dem BImSchG oder den auf<br />
dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen an Anlagen oder<br />
Betriebsbereiche gestellt werden, überwachen die nach den Art. 1 bis 3<br />
zuständigen Behörden. 2 Abweichend davon trifft das Landesamt für<br />
Umwelt die erforderlichen Feststellungen bezüglich der Einhaltung der<br />
Anforderungen an Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen<br />
sowie an Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen zur<br />
Beseitigung und an Anlagen der Träger der Sonderabfallbeseitigung. 3 Die<br />
Regierung ist zuständige Behörde für die Erstellung des<br />
Überwachungssystems nach § 16 der Zwölften Verordnung zur<br />
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung<br />
– 12. BImSchV) in der jeweiligen Fassung. 4 Für die Überwachung der
Einhaltung der Betriebszeiten für Rasenmäher ist die Gemeinde zuständige<br />
Behörde.<br />
(2) 1 Das Landesamt für Umwelt überwacht die Einhaltung von Anforderungen,<br />
die in Verordnungen nach §§ 34, 35 und 37 BImSchG an Stoffe und<br />
Erzeugnisse gestellt werden. 2 Die Kreisverwaltungsbehörde oder das<br />
Bergamt unterstützt als beauftragte Behörde auf Ersuchen das Landesamt<br />
für Umwelt insbesondere durch die Entnahme von Stichproben; diese<br />
Maßnahmen gelten als Maßnahmen des Landesamts für Umwelt.<br />
(3) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde überwacht die Einhaltung von<br />
Anforderungen, die in einer Verordnung nach § 38 BImSchG an Fahrzeuge<br />
gestellt werden, die den verkehrsrechtlichen Vorschriften des Bundes nicht<br />
unterliegen. 2 In Betrieben, die der Aufsicht der Bergbehörde unterliegen,<br />
überwacht das Bergamt diese Fahrzeuge. 3 Schienenbahnen, die dem<br />
Geltungsbereich des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes<br />
unterliegen, überwacht die für die Aufsicht nach diesem Gesetz zuständige<br />
Behörde.<br />
(4) Die Überwachungsbehörde ist zuständig für Amtshandlungen, die in den in<br />
den Absätzen 2 und 3 genannten Verordnungen vorgesehen sind.<br />
(5) Die Emissionserklärung nach § 27 BImSchG und den darauf gestützten<br />
Verordnungen ist gegenüber dem Landesamt für Umwelt abzugeben; es<br />
ist zuständig für Amtshandlungen im Vollzug dieser Vorschrift.<br />
(6) Das Landesamt für Umwelt erhebt die nach § 19 der Verordnung über<br />
Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen (13. BImSchV) vom 20. Juli 2004<br />
(BGBl I S. 1717, ber. 2847) in der jeweils geltenden Fassung vom<br />
Betreiber vorzulegenden Berichte und ist zuständig für Amtshandlungen<br />
im Vollzug dieser Vorschrift.<br />
(7) Mitteilungen nach § 31 BImSchG sind an die anordnenden Behörden und<br />
an das Landesamt für Umwelt zu richten.<br />
(8) Das Landesamt für Umwelt ist zuständige Behörde für die staatliche<br />
Anerkennung von Fachstellen und Lehrgängen nach dem BImSchG oder<br />
darauf gestützter Rechtsverordnungen.<br />
Bay ImSchG Art. 4 a Sonderregelung für kerntechnische Anlagen<br />
Die Regierung ist zuständige Immissionsschutzbehörde für Anlagen, die einer<br />
Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes bedürfen.<br />
Bay ImSchG Art. 5 Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen<br />
Die Kreisverwaltungsbehörde setzt die Entschädigung nach § 42 Abs. 3<br />
BImSchG fest.<br />
Bay ImSchG Art. 6 Luftüberwachung<br />
(1) 1 Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
kann zur Feststellung von Luftverunreinigungen die Zusammensetzung<br />
der Luft durch Messungen zeitweilig oder dauernd beobachten lassen.<br />
2 Soweit es für die Beobachtung erforderlich ist, haben die Eigentümer und<br />
Besitzer von Grundstücken den mit der Messung Beauftragten den Zutritt<br />
zu gestatten. 3 Auf die berechtigten Belange der Eigentümer und Besitzer<br />
ist Rücksicht zu nehmen.
(2) 1 In Untersuchungsgebieten hat das Landesamt für Umwelt die<br />
Feststellungen und Untersuchungen nach § 44 Abs. 1 BImSchG<br />
vorzunehmen. 2 Das Landesamt für Umwelt ist die für den<br />
Immissionsschutz zuständige Behörde nach § 40 Abs. 2 Satz 1 BImSchG.<br />
Bay ImSchG Art. 7 Emissionskataster<br />
1 Für Untersuchungsgebiete und besonders gefährdete oder schutzbedürftige<br />
Gebiete wird vom Landesamt für Umwelt ein Emissionskataster nach § 46<br />
BImSchG aufgestellt. 2 Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und<br />
Verbraucherschutz bestimmt die besonders gefährdeten oder<br />
schutzbedürftigen Gebiete.<br />
Bay ImSchG Art. 8 Luftreinhaltepläne<br />
Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz stellt<br />
die Luftreinhaltepläne nach § 47 BImSchG auf.<br />
Bay ImSchG Art. 8 a Lärmkarten und Lärmaktionspläne<br />
(1) Nach <strong>Landesrecht</strong> zuständige Behörde im Sinn von § 47 e Abs. 1 BImSchG<br />
für die Ausarbeitung von Lärmkarten nach § 47 c BImSchG ist das<br />
Landesamt für Umwelt.<br />
(2) 1 Nach <strong>Landesrecht</strong> zuständige Behörde im Sinn von § 47 e Abs. 1<br />
BImSchG für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen nach § 47 d BImSchG<br />
für Bundesautobahnen, Großflughäfen und Haupteisenbahnstrecken ist die<br />
Regierung. 2 Benachbarte Lärmaktionspläne sind aufeinander<br />
abzustimmen. 3 Lärmaktionspläne bedürfen, soweit nicht die Regierung für<br />
die Aufstellung zuständig ist, des Einvernehmens der Regierung und,<br />
soweit diese Lärmaktionspläne Maßnahmen mit Einfluss auf den<br />
Eisenbahnverkehr vorsehen, des Einvernehmens des Staatsministeriums<br />
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. 4 Lärmaktionspläne<br />
der Regierung bedürfen des Einvernehmens der betroffenen Gemeinden.<br />
(3) Die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen richtet sich nach den<br />
hierfür verfügbaren Haushaltsmitteln und nach Maßgabe der festgestellten<br />
Prioritäten.<br />
(4) 1 Die zuständigen Behörden können Daten erheben, verarbeiten und<br />
nutzen sowie Auskünfte und Aufzeichnungen verlangen. 2 Die Weitergabe<br />
von Daten an Dritte zum Zweck der Ausarbeitung von Lärmkarten und<br />
Lärmaktionsplänen ist zulässig.<br />
Bay ImSchG Art. 9 Finanzhilfen<br />
1 Zur Erfüllung von Verpflichtungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
können den Betreibern bestehender Anlagen Zuwendungen gewährt werden.<br />
2 Die Zuwendungen werden nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen<br />
Bestimmungen, insbesondere des Art. 23 der Bayerischen Haushaltsordnung<br />
und nach Maßgabe der im Haushalt ausgewiesenen Mittel gewährt.<br />
Bay ImSchG Art. 10 Verordnungen der Gemeinden<br />
(1) Zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch Luftverunreinigungen<br />
oder Geräusche können die Gemeinden durch Verordnung die Errichtung
und den Betrieb von Anlagen und die Verwendung bestimmter Brennstoffe<br />
verbieten, zeitlich beschränken oder von Vorkehrungen abhängig machen.<br />
(2) 1 Die Gemeinden können Ausnahmen für den Einzelfall zulassen, wenn<br />
schädliche Einwirkungen nicht zu befürchten sind. 2 Sie müssen<br />
Ausnahmen zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange dies<br />
erfordern.<br />
(3) Die Gemeinden überwachen die Durchführung ihrer Verordnungen.<br />
ZWEITER TEIL Schutz vor Einwirkungen aus unnötig störenden<br />
Betätigungen<br />
Bay ImSchG Art. 11 (weggefallen)<br />
Bay ImSchG Art. 12 Motoren<br />
(1) Es ist verboten,<br />
1. lärm- oder abgaserzeugende Motoren unnötig laufen zu lassen,<br />
2. motorisierte Schneefahrzeuge, insbesondere Motorschlitten zu<br />
betreiben,<br />
3. Verbrennungsmotoren von Krafträdern oder Verbrennungshilfsmotoren<br />
von Fahrrädern in unmittelbarer Nähe fremder Wohnungen sowie in der<br />
freien Natur ohne Notwendigkeit anzulassen und laufen zu lassen.<br />
(2) Vom Verbot nach Absatz 1 Nr. 2 können die Kreisverwaltungsbehörden,<br />
vom Verbot nach Absatz 1 Nr. 3 die Gemeinden Ausnahmen zulassen,<br />
wenn ein Bedürfnis hierfür auch unter Berücksichtigung der öffentlichen<br />
Sicherheit und Ordnung sowie des Schutzes der Allgemeinheit oder<br />
Nachbarschaft vor Lärm anzuerkennen ist.<br />
Bay ImSchG Art. 13 und 13 a (weggefallen)<br />
Bay ImSchG Art. 14 Verordnungen der Gemeinden<br />
Zum Schutz vor unnötigen Störungen können die Gemeinden Verordnungen<br />
über die zeitliche Beschränkung ruhestörender Hausarbeiten oder<br />
Gartenarbeiten, über die Benutzung von Musikinstrumenten,<br />
Tonübertragungsgeräten und Tonwiedergabegeräten sowie über das Halten<br />
von Haustieren erlassen.<br />
Bay ImSchG § 15 (weggefallen)<br />
DRITTER TEIL Verhinderung von Störfällen und Begrenzung der<br />
Auswirkungen von Störfällen durch den Umgang mit gefährlichen<br />
Stoffen in Anlagen in nicht gewerblichen und nicht wirtschaftlichen<br />
Betriebsbereichen<br />
Bay ImSchG Art. 16 Anwendungsbereich und materielle Anforderungen<br />
(1) Die Bestimmungen dieses Teils des <strong>Gesetze</strong>s finden Anwendung auf<br />
Anlagen in Betriebsbereichen, die nicht gewerblichen Zwecken dienen und<br />
nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden.<br />
(2) § 20 Abs. 1 a und §§ 24, 25 und 52 BImSchG in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl I S. 880), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 9. September 2001 (BGBl I S. 2331), gelten<br />
entsprechend; hinsichtlich der Kostenlastverteilung gilt die Regelung in<br />
§ 52 Abs. 4 BImSchG für genehmigungsbedürftige Anlagen.<br />
(3) 1 Ferner gelten § 1 Abs. 1, 2 und 5 und §§ 2 bis 16, 19 und 20 der<br />
Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV) vom<br />
26. April 2000 (BGBl I S. 603) entsprechend. 2 Die in § 20 Abs. 1, 2 und 5<br />
der Störfall-Verordnung genannten Fristen sind auf den Zeitpunkt des In-<br />
Kraft-Tretens dieses <strong>Gesetze</strong>s zu beziehen.<br />
Bay ImSchG Art. 16 a Zuständigkeit<br />
Die Regierung ist zuständige Behörde für den Vollzug des Art. 16.<br />
Bay ImSchG Art. 16 b Verordnungsermächtigung<br />
Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz wird<br />
ermächtigt, zur Verhinderung von Störfällen und zur Begrenzung ihrer<br />
Auswirkungen durch den Umgang mit gefährlichen Stoffen in Anlagen, die<br />
Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs sind und nicht gewerblichen<br />
Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen<br />
Verwendung finden, durch Rechtsverordnung die Regelungen des Art. 16 in<br />
einem § 23 Abs. 1 BImSchG entsprechenden Ausmaß zu ergänzen und zu<br />
ändern.<br />
VIERTER TEIL Gemeinsame und Schlussvorschriften<br />
Bay ImSchG Art. 17 Einschränkung von Grundrechten<br />
Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s kann das Grundrecht der Unverletzlichkeit der<br />
Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung)<br />
eingeschränkt werden.<br />
Bay ImSchG Art. 18 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer<br />
vorsätzlich oder fahrlässig einer Verordnung nach Art. 10 zuwiderhandelt,<br />
wenn die Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese<br />
Bußgeldvorschrift verweist.<br />
(2) Mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro kann belegt werden,<br />
wer vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. entgegen Art. 12 Abs. 1 Motoren betreibt,<br />
2. einer mit einer Erlaubnis nach Art. 12 Abs. 2 verbundenen vollziehbaren<br />
Auflage zuwiderhandelt,<br />
3. einer auf Grund des Art. 14 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt,<br />
wenn die Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese<br />
Bußgeldvorschrift verweist.<br />
(3) Im Anwendungsbereich des Dritten Teils dieses <strong>Gesetze</strong>s gilt § 62 Abs. 1<br />
Nr. 2, 5 und 7, Abs. 2 Nr. 4 und 5 und Abs. 3 BImSchG in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl I S. 880), zuletzt geändert<br />
durch Gesetz vom 9. September 2001 (BGBl I S. 2331), in Verbindung mit<br />
§ 21 Abs. 1 und 3 der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV) vom<br />
26. April 2000 (BGBl I S. 603) entsprechend.<br />
Bay ImSchG Art. 19 Aufsicht und Oberste Landesbehörde,<br />
Auffangzuständigkeit<br />
(1) 1 Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
hat die oberste Aufsicht über den Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s, des BImSchG<br />
sowie der auf diese <strong>Gesetze</strong> gestützten Rechtsvorschriften; es ist Oberste<br />
Landesbehörde im Sinn dieser Rechtsvorschriften. 2 Es leistet die<br />
erforderlichen Beiträge zur Erfüllung der Unterrichtungspflichten, die die<br />
Europäische Gemeinschaft den Mitgliedstaaten auferlegt.<br />
(2) Für Aufgaben und Befugnisse nach diesem Gesetz, nach dem BImSchG<br />
sowie nach den auf diese <strong>Gesetze</strong> gestützten Verordnungen, die keiner<br />
anderen Behörde zugewiesen sind, ist die Regierung zuständige Behörde.<br />
Bay ImSchG Art. 19 a Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Änderung<br />
des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes vom 24. Dezember 2001<br />
In Verfahren zur Genehmigung von Anlagen, für die im Zeitpunkt des In-Kraft-<br />
Tretens der Änderung von Art. 1 dieses <strong>Gesetze</strong>s bereits ein vollständiger<br />
Genehmigungsantrag vorlag, führt die bis zu diesem Zeitpunkt zuständige<br />
Behörde das Genehmigungsverfahren zu Ende.<br />
Bay ImSchG Art. 20 Inkrafttreten<br />
(1) 1 Die Art. 1 bis 4 dieses <strong>Gesetze</strong>s treten mit Wirkung vom 1. April 1974 in<br />
Kraft. 2 (Satz 2 gegenstandslos)<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Oktober 1974 (GVBl S. 499).<br />
(2) 1 Die übrigen Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s treten am 1. November 1974 in<br />
Kraft. 2 (Sätze 2 und 3 gegenstandslos)<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Oktober 1974 (GVBl S. 499).<br />
(3) gegenstandslos
<strong>Bayerisches</strong> Jagdgesetz (Bay JG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 30. Juli 1987 (GVBl. S. 246, ber. S. 391), vom 9. August 1993 (GVBl.<br />
S. 547), vom 24. Mai 1996 (GVBl. S. 185), vom 23. April 1997 (GVBl. S. 62), vom 24. April 2001<br />
(GVBl. S. 140), vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 470), vom 9. Mai 2005 (GVBl. S. 138), vom 26. Juli<br />
2005 (GVBl. S. 274), vom 22. Dezember 2006 (GVBl. S. 1056), vom 20. Dezember 2007 (GVBl.<br />
S. 958)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
I. ABSCHNITT Grundsätze<br />
Art. 1 <strong>Gesetze</strong>szweck<br />
Art. 2 Staatliche Aufsicht und Förderung<br />
II. ABSCHNITT Jagdreviere, Hegegemeinschaften<br />
1. Allgemeine Vorschriften<br />
Art. 3 Feststellung der Jagdreviere<br />
Art. 4 Gestaltung der Jagdreviere<br />
Art. 5 Pachtpreisregelung und Entschädigung bei Angliederung von Flächen<br />
Art. 6 Befriedete Bezirke; Ruhen der Jagd<br />
Art. 7 Verantwortlicher Revierinhaber<br />
2. Jagdreviere<br />
Art. 8 Eigenjagdreviere<br />
Art. 9 Staatsjagdreviere<br />
Art. 10 Gemeinschaftsjagdreviere<br />
Art. 11 Jagdgenossenschaft<br />
Art. 12 Jagdnutzung<br />
3. Hegegemeinschaften<br />
Art. 13 Aufgaben und räumlicher Wirkungsbereich der Hegegemeinschaften<br />
III. ABSCHNITT Beteiligung Dritter an der Ausübung des Jagdrechts
Art. 14 Verpachtung von Teilen eines Jagdreviers; Mindestpachtzeit;<br />
Beanstandungsverfahren; Änderung von Jagdpachtverträgen<br />
Art. 15 Mehrzahl von Jagdpächtern<br />
Art. 16 Pachthöchstfläche; Eintragung in den Jagdschein<br />
Art. 17 Jagderlaubnis<br />
Art. 18 Nichtigkeit von Jagdpachtverträgen und Jagderlaubnisverträgen<br />
Art. 19 Erlöschen des Jagdpachtvertrags<br />
Art. 20 Tod des Jagdpächters<br />
IV. ABSCHNITT Schutz des Wildes und seiner Lebensräume<br />
Art. 21 Wildschutzgebiete<br />
Art. 22 Schutz der Nist-, Brut- und Zufluchtstätten des Wildes<br />
Art. 22 a Schutz kranken und verletzten Wildes<br />
Art. 23 Wildgehege<br />
Art. 24 Wildpark<br />
Art. 25 Wintergatter<br />
V. ABSCHNITT Förderung des Jagdwesens<br />
Art. 26 Mittel und Gegenstand der Förderung<br />
Art. 27 Verfahren<br />
VI. ABSCHNITT Jagdausübung<br />
1. Allgemeines<br />
Art. 28 Jägerprüfung, Falknerprüfung, Jagdschein<br />
2. Jagdbeschränkungen<br />
Art. 29 Sachliche Gebote und Verbote<br />
Art. 29 a Jagd mit Fallen
Art. 30 Treibjagd, Gesellschaftsjagd<br />
Art. 31 Örtliche Beschränkungen<br />
Art. 32 Regelung der Bejagung<br />
Art. 33 Jagd- und Schonzeiten<br />
3. Hegebeschränkungen<br />
Art. 34 Aussetzen von Tierarten<br />
4. Besondere Rechte und Pflichten bei der Jagdausübung<br />
Art. 35 Wegerecht<br />
Art. 36 Jagdeinrichtungen<br />
Art. 37 Wildfolge<br />
Art. 38 Verfolgung kranken oder krankgeschossenen Wildes in befriedeten<br />
Bezirken<br />
Art. 39 Verwendung von Jagdhunden<br />
VII. ABSCHNITT Jagdschutz<br />
Art. 40 Inhalt des Jagdschutzes; Pflicht zur Ausübung des Jagdschutzes<br />
Art. 41 Jagdschutzberechtigte<br />
Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten<br />
Art. 43 Natürliche Äsung; Fütterung des Wildes<br />
VIII. ABSCHNITT Wild- und Jagdschaden<br />
Art. 44 Verhinderung übermäßigen Wildschadens auf eingezäunten<br />
Waldflächen<br />
Art. 45 Erstattungsausschluß<br />
Art. 46 Ersatz weiterer Wildschäden<br />
Art. 47 Ermächtigungen<br />
Art. 47 a Verfahren in Wild- und Jagdschadenssachen
IX. ABSCHNITT Wildhandel<br />
Art. 48 Überwachung des Wildhandels<br />
X. ABSCHNITT Organisation, Zuständigkeit, Verfahren<br />
Art. 49 Jagdbehörden, Jagdberater<br />
Art. 50 Jagdbeirat<br />
Art. 51 Vereinigungen der Jäger<br />
Art. 52 Sachliche Zuständigkeit<br />
Art. 53 Örtliche Zuständigkeit<br />
Art. 54<br />
Art. 55 Vorläufige Anordnung<br />
XI. ABSCHNITT Ahndungsvorschriften<br />
Art. 56 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 57 Verbot der Jagdausübung<br />
Art. 58 Einziehung<br />
XII. ABSCHNITT Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 59 Enteignende Maßnahmen<br />
Art. 60 Überleitungsvorschrift<br />
Art. 61 Ausführungsvorschriften<br />
Art. 62 Verweisungen auf aufgehobene Vorschriften<br />
Art. 63<br />
Art. 64 Inkrafttreten; Aufhebung von Vorschriften
I. ABSCHNITT Grundsätze<br />
Bay JG Art. 1 <strong>Gesetze</strong>szweck<br />
(1) 1 Die freilebende Tierwelt ist wesentlicher Bestandteil der heimischen<br />
Natur. 2 Sie ist als Teil des natürlichen Wirkungsgefüges in ihrer Vielfalt zu<br />
bewahren.<br />
(2) Dieses Gesetz soll neben dem Bundesjagdgesetz dazu dienen:<br />
1. einen artenreichen und gesunden Wildbestand in einem ausgewogenen<br />
Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten,<br />
2. die natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes zu sichern und zu<br />
verbessern,<br />
3. Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und<br />
fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild möglichst zu vermeiden,<br />
insbesondere soll die Bejagung die natürliche Verjüngung der<br />
standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen<br />
ermöglichen,<br />
4. die jagdlichen Interessen mit den sonstigen öffentlichen Belangen,<br />
insbesondere mit den Belangen der Landeskultur, des Naturschutzes und<br />
der Landschaftspflege auszugleichen.<br />
Bay JG Art. 2 Staatliche Aufsicht und Förderung<br />
(1) Der Staat ordnet und beaufsichtigt das gesamte Jagdwesen und schützt<br />
die Jagd als Kulturgut.<br />
(2) 1 Das Jagdwesen wird aus dem Aufkommen der Jagdabgabe (Art. 26 und<br />
27) gefördert. 2 Die Förderung nach anderen Vorschriften und<br />
Programmen bleibt unberührt.<br />
II. ABSCHNITT Jagdreviere, Hegegemeinschaften<br />
1. Allgemeine Vorschriften<br />
Bay JG Art. 3 Feststellung der Jagdreviere<br />
Bestand, Umfang und Grenzen eines Jagdreviers (Jagdbezirks) werden, falls<br />
erforderlich, durch die Jagdbehörde festgestellt.<br />
Bay JG Art. 4 Gestaltung der Jagdreviere<br />
(1) 1 Jagdreviere sind durch Abtrennung, Angliederung oder Austausch von<br />
Grundflächen abzurunden, wenn Jagdpflege und Jagdausübung dies<br />
erfordern. 2 Bei der Abrundung soll die Gesamtgröße der Jagdreviere<br />
möglichst wenig verändert werden; Möglichkeiten eines Flächenausgleichs<br />
sind auszuschöpfen. 3 Durch Abrundung darf ein Jagdrevier seine<br />
gesetzliche Mindestgröße (Art. 8 Abs. 1, Art. 10 Abs. 1) nicht verlieren.<br />
(2) 1 Die Abrundung kann durch Vereinbarung der Beteiligten<br />
(Jagdgenossenschaft, Eigentümer oder Nutznießer eines Eigenjagdreviers)<br />
oder von Amts wegen vorgenommen werden. 2 Die Vereinbarung bedarf<br />
der Schriftform und der Zustimmung der Jagdbehörde.<br />
(3) 1 Ist die Ausübung des Jagdrechts auf einer anzugliedernden oder<br />
abzutrennenden Grundfläche verpachtet, so darf während der Pachtdauer
eine Abrundungsmaßnahme nur mit Zustimmung der Parteien des<br />
Jagdpachtvertrags durchgeführt werden. 2 Wird der Abrundung nicht<br />
zugestimmt, so wird diese erst mit der Beendigung des<br />
Jagdpachtverhältnisses der nichtzustimmenden Vertragspartei, bei<br />
mehreren nichtzustimmenden Vertragsparteien mit Beendigung des am<br />
längsten laufenden Jagdpachtvertrags der nichtzustimmenden<br />
Vertragsparteien wirksam. 3 Der Zustimmung bedarf es insoweit nicht, als<br />
Jagdpachtverträge vor ihrem Ablauf verlängert oder neu abgeschlossen<br />
werden und im Zeitpunkt der Verlängerung oder des Neuabschlusses ein<br />
Abrundungsverfahren bereits anhängig ist.<br />
Bay JG Art. 5 Pachtpreisregelung und Entschädigung bei Angliederung<br />
von Flächen<br />
(1) Wird eine Grundfläche während der Laufzeit eines Jagdpachtvertrages<br />
einem Jagdrevier angegliedert oder von diesem abgetrennt, so erhöht<br />
oder ermäßigt sich der Pachtpreis entsprechend der Größe der<br />
angegliederten oder abgetrennten Fläche, falls nicht die Beteiligten etwas<br />
anderes vereinbaren.<br />
(2) 1 Wird eine Grundfläche einem Eigenjagdrevier angegliedert, so hat der<br />
Eigentümer der Grundfläche gegen den Eigentümer oder Nutznießer des<br />
Eigenjagdreviers einen Anspruch auf eine Entschädigung. 2 Diese bemißt<br />
sich, wenn das Eigenjagdrevier verpachtet ist, nach Absatz 1. 3 Ist das<br />
Eigenjagdrevier nicht verpachtet, so setzt, wenn sich die Beteiligten über<br />
die Höhe der Entschädigung nicht einigen, die Jagdbehörde eine<br />
angemessene Entschädigung fest. 4 Auf das Rechtsverhältnis zwischen<br />
dem Eigentümer der Grundflächen und dem Eigentümer oder Nutznießer<br />
des Eigenjagdreviers finden im übrigen die Vorschriften des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs über die Pacht sinngemäß Anwendung, soweit nichts anderes<br />
vereinbart ist.<br />
Bay JG Art. 6 Befriedete Bezirke; Ruhen der Jagd<br />
(1) Befriedete Bezirke (§ 6 des Bundesjagdgesetzes) sind:<br />
1. Gebäude, die zum Aufenthalt von Menschen dienen, und Gebäude, die<br />
mit solchen Gebäuden räumlich zusammenhängen,<br />
2. Hofräume und Hausgärten, die unmittelbar an eine Behausung im Sinn<br />
der Nummer 1 anschließen und durch eine Umfriedung begrenzt sind,<br />
3. sonstige überbaute Flächen im Geltungsbereich eines Bebauungsplans<br />
und Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile,<br />
4. Friedhöfe,<br />
5. Tiergärten.<br />
(2) 1 Darüber hinaus kann die Jagdbehörde für befriedet erklären:<br />
1. sonstige Flächen im Geltungsbereich eines Bebauungsplans mit<br />
Ausnahme der in § 9 Abs. 1 Nr. 18 des Bundesbaugesetzes genannten<br />
Flächen,<br />
2. Grundflächen, die gegen das Ein- oder Auswechseln von Wild –<br />
ausgenommen Federwild, Wildkaninchen und Raubwild – und gegen<br />
unbefugten Zutritt von Menschen dauernd abgeschlossen und deren<br />
Eingänge absperrbar sind.
2 Auf Wildgehege (Art. 23 Abs. 1), die jagdlichen Zwecken dienen, und auf<br />
Wintergatter (Art. 25) findet Satz 1 keine Anwendung.<br />
(3) 1 In befriedeten Bezirken kann die Jagdbehörde dem Eigentümer, dem<br />
Nutzungsberechtigten, dem Revierinhaber oder deren Beauftragten<br />
bestimmte Jagdhandlungen unter Beschränkung auf bestimmte Wildarten<br />
und auf eine bestimmte Zeit gestatten. 2 Eines Jagdscheins bedarf es<br />
nicht. 3 Jagdhandlungen mit der Schußwaffe dürfen dem Eigentümer, dem<br />
Nutzungsberechtigten oder einem Beauftragten nur gestattet werden,<br />
wenn diese im Besitz eines gültigen Jagdscheins oder für den Gebrauch<br />
von Schußwaffen im Sinn des § 17 Abs. 1 Nr. 4 des Bundesjagdgesetzes<br />
ausreichend versichert sind. 4 Die waffenrechtlichen Vorschriften bleiben<br />
unberührt. 5 Das Aneignungsrecht hat derjenige, dem oder dessen<br />
Beauftragten die Jagdhandlung gestattet wurde.<br />
(4) 1 Mit Zustimmung der Jagdbehörde kann der Eigentümer oder Nutznießer<br />
des Eigenjagdreviers oder die Jagdgenossenschaft die Jagd ruhen lassen.<br />
2<br />
Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn dadurch die<br />
Verwirklichung der in Art. 1 Abs. 2 genannten Ziele nicht gefährdet wird.<br />
Bay JG Art. 7 Verantwortlicher Revierinhaber<br />
(1) 1 Derjenige, dem die Ausübung des Jagdrechts in einem Jagdrevier zusteht<br />
(Jagdausübungsberechtigter), ist verpflichtet, dort das Jagdrecht<br />
auszuüben. 2 Er ist der für die Ausübung des Jagdrechts einschließlich des<br />
Jagdschutzes verantwortliche Revierinhaber.<br />
(2) 1 Ist der Eigentümer oder Nutznießer eines Eigenjagdreviers eine<br />
Personenmehrheit, eine juristische Person oder nichtjagdpachtfähig (§ 11<br />
Abs. 5 des Bundesjagdgesetzes), so hat er der Jagdbehörde eine oder<br />
mehrere jagdpachtfähige Personen als im Sinn des Absatzes 1 Satz 2<br />
verantwortliche Personen zu benennen, wenn die Jagd nicht durch<br />
Verpachtung ausgeübt wird. 2 Es dürfen nicht mehr Personen als<br />
verantwortlich benannt werden als nach Art. 15 Abs. 1 Jagdpächter sein<br />
dürfen.<br />
(3) Absatz 2 gilt sinngemäß, wenn und solang der Revierinhaber aus Gründen,<br />
die in seiner Person liegen, an der Ausübung des Jagdrechts einschließlich<br />
des Jagdschutzes längere Zeit verhindert ist.<br />
(4) Mitpächter oder mehrere für ein Jagdrevier verantwortliche Personen im<br />
Sinn des Absatzes 2 haben auf Verlangen der Jagdbehörde einen von<br />
ihnen als Bevollmächtigten zu benennen, der gegenüber der Jagdbehörde<br />
in allen die Jagdausübung in dem Jagdrevier betreffenden<br />
Angelegenheiten zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen sowie<br />
zum Empfang von Urkunden und Sachen berechtigt ist.<br />
2. Jagdreviere<br />
Bay JG Art. 8 Eigenjagdreviere<br />
(1) 1 Die Mindestgröße eines Eigenjagdreviers beträgt 81,755 ha, im<br />
Hochgebirge mit seinen Vorbergen 300 ha. 2 Grundflächen, die kein<br />
Jagdrevier bilden und von mehreren Eigenjagdrevieren umschlossen<br />
werden, sind durch die Jagdbehörde einem oder mehreren dieser<br />
angrenzenden Jagdreviere anzugliedern; werden sie nur von einem
Eigenjagdrevier umschlossen, so sind sie dessen Bestandteil. 3 Die Art. 4<br />
Abs. 3, Art. 5 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 6 (Angliederungsgenossenschaft)<br />
sind entsprechend anzuwenden.<br />
(2) 1 Eigenjagdreviere können mit Zustimmung der Jagdbehörde in mehrere<br />
selbständige Jagdreviere aufgeteilt werden. 2 Die Jagdbehörde darf nur<br />
zustimmen, wenn jeder Teil für sich die Mindestgröße von 250 ha, im<br />
Hochgebirge mit seinen Vorbergen von 500 ha hat, und wenn jedes<br />
Teilrevier eine ordnungsgemäße Jagdausübung gestattet.<br />
Bay JG Art. 9 Staatsjagdreviere<br />
(1) Staatsjagdreviere sind die Eigenjagdreviere des Freistaates Bayern mit<br />
den angegliederten und ausschließlich der abgetrennten Grundflächen.<br />
(2) 1 Der Staat übt das Jagdrecht selbst oder durch Verpachtung aus, soweit<br />
nicht der Bayerischen Staatsforsten das Jagdausübungsrecht gemäß Art. 4<br />
Abs. 1 des Staatsforstengesetzes zusteht. 2 Übt der Staat das Jagdrecht<br />
selbst aus, findet Art. 7 Abs. 2 keine Anwendung.<br />
(3) Inhaber eines gültigen Jagdscheins können in den nichtverpachteten<br />
Staatsjagdrevieren neben dem Personal, durch das der Staat die Jagd<br />
ausüben läßt, als Jagdgäste zur Jagdausübung zugelassen werden; Jäger<br />
ohne ständige Jagdmöglichkeit auch durch Ausgabe befristeter<br />
Jagderlaubnisscheine.<br />
Bay JG Art. 10 Gemeinschaftsjagdreviere<br />
(1) 1 Die Mindestgröße eines Gemeinschaftsjagdreviers beträgt 250 ha, im<br />
Hochgebirge mit seinen Vorbergen 500 ha. 2 Befriedete Bezirke zählen bei<br />
der Berechnung der Mindestgröße nicht mit.<br />
(2) 1 Die außerhalb eines Gemeinschaftsjagdreviers liegenden Grundflächen<br />
eines Gemeindegebiets oder eines gemeindefreien Gebiets sind durch die<br />
Jagdbehörde angrenzenden Jagdrevieren anzugliedern, sofern sie nicht<br />
nach § 8 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes zu einem<br />
Gemeinschaftsjagdrevier zusammengelegt werden. 2 Werden solche<br />
Flächen von einem Jagdrevier ganz umschlossen, so sind sie dessen<br />
Bestandteil. 3 Art. 4 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.<br />
(3) Einem Antrag auf Zusammenlegung zusammenhängender Grundflächen<br />
zu einem Gemeinschaftsjagdrevier ist unter den Voraussetzungen des § 8<br />
Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes stattzugeben, wenn er von der Mehrheit<br />
der Grundstückseigentümer jeder der beteiligten Gemeinden gestellt wird<br />
und die Antragsteller in ihrer Gemeinde jeweils gemeinsam über mehr als<br />
die Hälfte der zusammenhängenden Grundflächen verfügen.<br />
(4) Die Teilung eines Gemeinschaftsjagdreviers in mehrere selbständige<br />
Jagdreviere (§ 8 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes) darf die Jagdbehörde<br />
nur zulassen, wenn die Jagdgenossenschaft dies beschlossen hat und<br />
jeder Teil für sich die gesetzliche Mindestgröße (Absatz 1) hat und eine<br />
ordnungsgemäße Jagdausübung gestattet.<br />
Bay JG Art. 11 Jagdgenossenschaft<br />
(1) 1 Die Jagdgenossenschaft (§ 9 des Bundesjagdgesetzes) ist eine<br />
Körperschaft des öffentlichen Rechts. 2 Sie untersteht der staatlichen
Aufsicht der Jagdbehörden. 3 Diese haben ihr gegenüber die gleichen<br />
Befugnisse, wie sie den kommunalen Aufsichtsbehörden gegenüber den<br />
Gemeinden in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises zustehen.<br />
(2) 1 Die Jagdgenossenschaft hat eine Satzung zu beschließen, die der<br />
Genehmigung der Jagdbehörden bedarf. 2 Erläßt das Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft und Forsten Satzungsmuster, so ist eine Satzung von der<br />
Genehmigungspflicht befreit, wenn sie keine oder nur solche<br />
Abweichungen enthält, die im Satzungsmuster selbst vorgesehen sind; in<br />
diesem Fall soll die Satzung spätestens vier Wochen vor ihrem<br />
Inkrafttreten der Jagdbehörde vorgelegt werden. 3 Die Satzung ist<br />
ortsüblich bekanntzumachen. 4 Das Staatsministerium für Landwirtschaft<br />
und Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung<br />
Mindestanforderungen für die Satzungen aufzustellen, in denen auch<br />
Vorschriften über die Verwaltung des Vermögens der<br />
Jagdgenossenschaften enthalten sein sollen. 5 Kommt die<br />
Jagdgenossenschaft der Aufforderung der Jagdbehörde zum Erlaß einer<br />
Satzung nicht innerhalb einer ihr gesetzten angemessenen Frist nach, so<br />
erläßt die Jagdbehörde eine Satzung für die Jagdgenossenschaft.<br />
(3) 1 Die Jagdgenossenschaft kann für ihren durch die sonstigen Einnahmen<br />
nicht gedeckten Bedarf Umlagen von den Jagdgenossen erheben. 2 Die<br />
Umlagen können von der Jagdgenossenschaft wie Kommunalabgaben<br />
beigetrieben werden.<br />
(4) Die Kosten der vorübergehenden Geschäftsführung (§ 9 Abs. 2 Satz 3 des<br />
Bundesjagdgesetzes) bis zur Wahl des Jagdvorstands trägt die<br />
Jagdgenossenschaft.<br />
(5) Gehören zu einem Gemeinschaftsjagdrevier Flächen verschiedener<br />
Gemeinden oder gemeindefreier Gebiete, so nimmt der Bürgermeister der<br />
Gemeinde, in deren Gebiet der größte Flächenanteil des<br />
Gemeinschaftsjagdreviers liegt, nach § 9 Abs. 2 Satz 3 des<br />
Bundesjagdgesetzes bis zur Wahl des Jagdvorstands dessen Geschäfte<br />
wahr.<br />
(6) 1 Besteht die einem Eigenjagdrevier angegliederte Grundfläche aus<br />
mehreren selbständigen Grundstücken, die im Eigentum von mehr als<br />
15 Personen stehen, so bilden diese Personen zur Vertretung ihrer Rechte,<br />
die sich aus der Angliederung ergeben, eine Jagdgenossenschaft<br />
(Angliederungsgenossenschaft). 2 Auf die Angliederungsgenossenschaft<br />
finden die §§ 9 und 10 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes und die Absätze 1<br />
bis 5 sinngemäß Anwendung.<br />
Bay JG Art. 12 Jagdnutzung<br />
(1) 1 Die Jagdgenossenschaft kann die Verpachtung insbesondere auf den<br />
Kreis der Jagdgenossen (§ 10 Abs. 1 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes) oder<br />
der jagdpachtfähigen Personen beschränken, die ihre Hauptwohnung in<br />
einer bestimmten Höchstentfernung zum Jagdrevier haben. 2 Sie kann<br />
außerdem ihre Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung sowie zur<br />
Erteilung entgeltlicher Dauerjagderlaubnisscheine (Art. 15 Abs. 2, Art. 17<br />
Abs. 2 Satz 1) davon abhängig machen, daß ortsansässige<br />
jagdpachtfähige Personen angemessen berücksichtigt werden. 3 Die<br />
Inhaber von Dauerjagderlaubnisscheinen sind dem Jagdvorsteher
mitzuteilen. 4 Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird<br />
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Art der<br />
Verpachtung von Gemeinschaftsjagdrevieren (z. B. öffentliche<br />
Versteigerung, öffentliche Ausbietung, freihändige Vergabe) und das dabei<br />
anzuwendende Verfahren zu erlassen.<br />
(2) Wird die Jagd durch angestellte Jäger ausgeübt, so dürfen nicht mehr<br />
Personen angestellt werden, als nach Art. 15 Abs. 1 Jagdpächter sein<br />
dürfen.<br />
3. Hegegemeinschaften<br />
Bay JG Art. 13 Aufgaben und räumlicher Wirkungsbereich der<br />
Hegegemeinschaften<br />
(1) Die Revierinhaber von zusammenhängenden Jagdrevieren, die einen<br />
bestimmten Lebensraum für das Wild umfassen, können eine<br />
Hegegemeinschaft bilden, um eine ausgewogene Hege der vorkommenden<br />
Wildarten und eine einheitliche großräumige Abschussregelung zu<br />
ermöglichen (§ 10 a Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes).<br />
(2) 1 Zu den Aufgaben einer Hegegemeinschaft zählen insbesondere<br />
1. Hegemaßnahmen in den einzelnen Jagdrevieren abzustimmen und<br />
gemeinsam durchzuführen,<br />
2. bei der Wildbestandsermittlung mitzuwirken,<br />
3. die Abschussplanvorschläge aufeinander abzustimmen,<br />
4. auf die Erfüllung der Abschusspläne hinzuwirken.<br />
2<br />
An den Beratungen der Hegegemeinschaften, bei denen sich die<br />
Mitglieder auch vertreten lassen können, sind die Jagdvorstände der<br />
beteiligten Jagdgenossenschaften und die Inhaber der verpachteten<br />
Eigenjagdreviere zu beteiligen. 3 Soweit Abschusspläne vom Revierinhaber<br />
nicht im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand oder dem Inhaber des<br />
Eigenjagdreviers aufgestellt worden sind, hat die Hegegemeinschaft auf<br />
eine einvernehmliche Abschussplanung hinzuwirken (§ 21 Abs. 2 Sätze 3<br />
und 4 des Bundesjagdgesetzes und Art. 32 Abs. 1 Satz 1 dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s).<br />
(3) Die Mitglieder der Hegegemeinschaft wählen in der Regel aus dem Kreis<br />
der ihr angehörenden Revierinhaber für eine bestimmte Amtszeit einen<br />
Vorsitzenden und einen Stellvertreter, die zuverlässig, jagdlich erfahren<br />
und mit den Verhältnissen in der Hegegemeinschaft vertraut sein sollen.<br />
(4) 1 Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über die Abgrenzung des<br />
räumlichen Wirkungsbereichs der Hegegemeinschaften und die Mitwirkung<br />
der anerkannten Vereinigungen der Jäger (Art. 51) dazu, ferner über die<br />
Abgabe von Empfehlungen der Hegegemeinschaften zur Abschußplanung<br />
und ihre Mitwirkung bei der Erfüllung der Abschußpläne. 2 Dabei kann die<br />
Zuständigkeit für die Abgrenzung des räumlichen Wirkungsbereichs der<br />
Hegegemeinschaften auf nachgeordnete Jagdbehörden übertragen<br />
werden.<br />
(5) Beteiligt sich ein Revierinhaber nicht an der Hegegemeinschaft, so gibt der<br />
Vorsitzende der Hegegemeinschaft, in deren räumlichen Wirkungsbereich<br />
das Jagdrevier liegt, eine Empfehlung zur Abschußplanung ab, die dem
Revierinhaber und der Jagdgenossenschaft oder, bei verpachteten<br />
Eigenjagdrevieren, dem Inhaber des Eigenjagdreviers sowie der<br />
Jagdbehörde zuzuleiten ist.<br />
III. ABSCHNITT Beteiligung Dritter an der Ausübung des<br />
Jagdrechts<br />
Bay JG Art. 14 Verpachtung von Teilen eines Jagdreviers;<br />
Mindestpachtzeit; Beanstandungsverfahren; Änderung von<br />
Jagdpachtverträgen<br />
(1) 1 Die Verpachtung eines Teils eines Jagdreviers bedarf der Zustimmung<br />
der Jagdbehörde. 2 Die für die Teilung von Jagdrevieren vorgeschriebenen<br />
Mindestgrößen gelten entsprechend. 3 Die Jagdbehörde darf der<br />
Teilverpachtung nur zustimmen, wenn sowohl der verpachtete als auch<br />
der verbleibende Teil eine ordnungsgemäße Jagdausübung gestattet. 4 Die<br />
Jagdbehörde kann die Verpachtung eines Teils von geringerer Größe an<br />
den Revierinhaber eines angrenzenden Jagdreviers zulassen, wenn dies<br />
einer besseren Reviergestaltung dient.<br />
(2) 1 Die Mindestpachtzeit beträgt für Niederwildreviere neun Jahre, für<br />
Hochwildreviere zwölf Jahre. 2 Die Jagdbehörde kann im Fall des<br />
Absatzes 1 Satz 4 oder für die Aufnahme eines Mitpächters oder sonst,<br />
wenn besondere Gründe vorliegen, ausnahmsweise eine kürzere Pachtzeit<br />
zulassen.<br />
(3) Eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die Inhaber eines oder<br />
mehrerer Eigenjagdreviere ist und Flächen zur Jagdausübung zupachten<br />
will, kann Jagdpächter sein.<br />
(4) 1 Ein Jagdpachtvertrag kann nach § 12 des Bundesjagdgesetzes auch<br />
beanstandet werden, wenn im Verfahren bei der Verpachtung von<br />
Gemeinschaftsjagdrevieren zwingende Vorschriften der nach Art. 12<br />
Abs. 1 Satz 4 erlassenen Rechtsverordnung verletzt worden sind. 2 Das<br />
gleiche gilt, wenn zu erwarten ist, daß der Jagdpächter nicht die Gewähr<br />
für eine den Zielen des Art. 1 Abs. 2 entsprechende Jagdausübung bietet.<br />
(5) Die Bestimmungen über den Jagdpachtvertrag gelten sinngemäß für die<br />
Änderung oder Verlängerung eines Jagdpachtvertrags.<br />
Bay JG Art. 15 Mehrzahl von Jagdpächtern<br />
(1) 1 Die Zahl der Jagdpächter wird bei Jagdrevieren mit einem Umfang bis zu<br />
250 ha, im Hochgebirge mit seinen Vorbergen bis zu 500 ha auf zwei<br />
beschränkt (Mitpacht); in größeren Jagdrevieren ist für je weitere<br />
angefangene 250 ha, im Hochgebirge mit seinen Vorbergen für je weitere<br />
angefangene 500 ha ein weiterer Pächter zulässig. 2 Bei der Berechnung<br />
der nach Satz 1 erforderlichen Reviergrößen bleiben die befriedeten<br />
Bezirke außer Betracht.<br />
(2) 1 Die Bestimmungen über den Jagdpachtvertrag gelten mit Ausnahme des<br />
Art. 14 Abs. 2 Satz 1 auch für die Weiter- und Unterverpachtung. 2 In<br />
diesen Fällen darf die Zahl der jagdausübungsberechtigten Personen die<br />
zulässige Zahl der Jagdpächter nach Absatz 1 nicht überschreiten.
Bay JG Art. 16 Pachthöchstfläche; Eintragung in den Jagdschein<br />
(1) 1 Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des<br />
Jagdrechts zusteht, darf im Hochgebirge mit seinen Vorbergen nicht mehr<br />
als 2 000 ha umfassen (§ 11 Abs. 3 Satz 4 des Bundesjagdgesetzes). 2 Bei<br />
Anpachtungen im Hochgebirge mit seinen Vorbergen und außerhalb sind<br />
die Pachtflächen im Verhältnis zu den zulässigen Pachthöchstflächen<br />
aufeinander anzurechnen.<br />
(2) Auf den vertraglichen Flächenanteil eines Mitpächters (§ 11 Abs. 3 Satz 3<br />
des Bundesjagdgesetzes) ist mindestens die Fläche anzurechnen, die bei<br />
Teilung der Fläche des Jagdreviers durch die nach Art. 15 Abs. 1 zulässige<br />
Zahl der Jagdpächter auf den einzelnen entfällt.<br />
(3) 1 Wer die Erteilung oder Verlängerung eines Jahresjagdscheins beantragt,<br />
hat dabei schriftlich anzugeben, ob er<br />
1. als Inhaber eines Eigenjagdreviers,<br />
2. als Jagdpächter oder Unterpächter oder<br />
3. als Mitpächter<br />
in einem Jagdrevier zur Jagdausübung befugt ist und für welche Flächen,<br />
im Fall der Nummer 3 die anteilig auf ihn entfallende Fläche (§ 11 Abs. 3<br />
Satz 3 des Bundesjagdgesetzes). 2 Die Jagdbehörde kann die Erteilung<br />
oder Verlängerung des Jagdscheins aussetzen, bis die Angaben gemacht<br />
sind. 3 Sie hat die Flächen in den Jagdschein einzutragen. 4 Sie kann die<br />
Vorlage des Jagdpachtvertrags oder sonstige Nachweise verlangen.<br />
Bay JG Art. 17 Jagderlaubnis<br />
(1) 1 Der Revierinhaber kann einem Dritten (Jagdgast) eine Jagderlaubnis<br />
erteilen. 2 Diese kann auch beschränkt erteilt werden. 3 Bei mehreren<br />
Revierinhabern muß die Jagderlaubnis von allen Revierinhabern erteilt<br />
werden. 4 Die Revierinhaber können sich gegenseitig zur Erteilung von<br />
Jagderlaubnissen schriftlich bevollmächtigen.<br />
(2) 1 Auf die entgeltliche Erteilung einer Jagderlaubnis sind § 11 Abs. 4 Satz 1<br />
und Abs. 5, §§ 12 und 13 des Bundesjagdgesetzes und Art. 15 Abs. 1 und<br />
Art. 16 dieses <strong>Gesetze</strong>s entsprechend anzuwenden. 2 Dies gilt nicht für<br />
eine vorübergehende Überlassung der Jagdausübung.<br />
(3) Soweit der Jagdgast bei der Jagdausübung nicht von einem Revierinhaber,<br />
einem angestellten Jäger oder Jagdaufseher begleitet wird, hat er eine auf<br />
seinen Namen lautende schriftliche Jagderlaubnis bei sich zu führen, die er<br />
auf Verlangen den Jagdschutzberechtigten (§ 25 des Bundesjagdgesetzes,<br />
Art. 40 Abs. 2 und Art. 41) zur Prüfung auszuhändigen hat.<br />
(4) Der Jagdgast ist nicht Jagdausübungsberechtigter im Sinn des<br />
Bundesjagdgesetzes und dieses <strong>Gesetze</strong>s.<br />
(5) Angestellte Jäger und Jagdaufseher sind im Rahmen ihres<br />
Anstellungsvertrags zur Jagdausübung innerhalb ihres Dienstbereichs<br />
berechtigt; sie benötigen dazu keinen Jagderlaubnisschein.<br />
Bay JG Art. 18 Nichtigkeit von Jagdpachtverträgen und<br />
Jagderlaubnisverträgen<br />
1 Ein Vertrag, der gegen die Bestimmungen der Art. 15, Art. 16 Abs. 2 und<br />
Art. 17 Abs. 1 und 2 verstößt, ist nichtig. 2 Das gleiche gilt für einen
Jagdpachtvertrag, der den Vorschriften des Art. 14 Abs. 1 nicht oder wegen<br />
Ausscheidens eines Inhabers einer entgeltlichen Jagderlaubnis den Vorschriften<br />
des § 11 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes nicht mehr entspricht und dieser<br />
Mangel bis zum Beginn des nächsten Jagdjahres nicht behoben wird.<br />
Bay JG Art. 19 Erlöschen des Jagdpachtvertrags<br />
Ist die Gültigkeitsdauer eines Jagdscheins abgelaufen, so erlischt der<br />
Jagdpachtvertrag oder Jagderlaubnisvertrag im Fall des § 13 Satz 2 des<br />
Bundesjagdgesetzes nur dann, wenn der Jagdpächter oder Inhaber der<br />
entgeltlichen Dauerjagderlaubnis innerhalb einer von der Jagdbehörde<br />
gesetzten angemessenen Frist einen Jahresjagdschein nicht beantragt oder<br />
sonstige Voraussetzungen dafür nicht erfüllt.<br />
Bay JG Art. 20 Tod des Jagdpächters<br />
1 Ist beim Tod des Jagdpächters der Erbe nichtjagdpachtfähig (§ 11 Abs. 5 des<br />
Bundesjagdgesetzes) oder sind mehrere Erben vorhanden, so sind der<br />
Jagdbehörde eine oder mehrere jagdpachtfähige Personen als verantwortlich<br />
im Sinn des Art. 7 Abs. 1 Satz 2 zu benennen. 2 Es dürfen nicht mehr Personen<br />
als verantwortlich benannt werden, als nach Art. 15 Abs. 1 Jagdpächter sein<br />
dürfen.<br />
IV. ABSCHNITT Schutz des Wildes und seiner Lebensräume<br />
Bay JG Art. 21 Wildschutzgebiete<br />
(1) 1 Flächen, die zum Schutz und zur Erhaltung von Wildarten, zur<br />
Wildschadensverhütung oder für die Wildforschung von besonderer<br />
Bedeutung sind, können zu Wildschutzgebieten erklärt werden. 2 Das gilt<br />
insbesondere für Flächen, auf denen sich das Wild zum Brüten, Setzen<br />
oder zur Rast bevorzugt aufzuhalten pflegt, sowie für Bereiche, in denen<br />
es gefüttert werden muß.<br />
(2) 1 In Wildschutzgebieten kann das Betreten von Flächen und<br />
nichtöffentlichen Wegen zeitweise, insbesondere während der<br />
Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserzeiten verboten oder beschränkt<br />
werden, soweit es der Schutzzweck erfordert. 2 Die ordnungsgemäße land-<br />
, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung bleibt grundsätzlich<br />
unberührt.<br />
(3) 1 Wildschutzgebiete und die zur Erreichung des Schutzzwecks<br />
erforderlichen Gebote und Verbote werden durch Rechtsverordnung der<br />
unteren Jagdbehörde im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde<br />
festgelegt. 2 Vor Erlaß der Rechtsverordnung sind die betroffenen<br />
Eigentümer oder sonstigen Berechtigten zu hören. 3 Art. 46 Abs. 1, 2, 4<br />
und 5 und Art. 47 des Bayerischen Naturschutzgesetzes sind sinngemäß<br />
anzuwenden.<br />
(4) Die untere Jagdbehörde kann ferner durch Rechtsverordnung oder<br />
Einzelanordnung das Betreten von Teilen der freien Natur im<br />
erforderlichen Umfang zum Schutz der dem Wild als Nahrungsquellen,<br />
Aufzucht-, Brut- und Nistgelegenheiten dienenden Lebensbereiche
(Biotope) sowie zur Durchführung der Wildfütterung in Notzeiten und von<br />
Gesellschaftsjagden vorübergehend untersagen oder beschränken.<br />
Bay JG Art. 22 Schutz der Nist-, Brut- und Zufluchtstätten des Wildes<br />
(1) 1 Der Revierinhaber ist befugt, mit Genehmigung der Jagdbehörde Bild-<br />
und Schrifttafeln anzubringen, die auf die nach § 19 a Satz 1 des<br />
Bundesjagdgesetzes geschützten Zuflucht-, Nist-, Brut- und Wohnstätten<br />
des Wildes sowie auf die Folgen eines Verstoßes gegen diese Vorschrift<br />
(§ 39 Abs. 1 Nr. 5 des Bundesjagdgesetzes) hinweisen. 2 Durch die<br />
Hinweistafeln darf das Landschaftsbild nicht verunstaltet werden.<br />
(2) 1 Das Verbot des § 19 a Satz 1 des Bundesjagdgesetzes steht einer<br />
ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung sowie der<br />
rechtmäßigen Ausübung der Jagd und Fischerei nicht entgegen. 2 Von dem<br />
Verbot kann ferner in Einzelfällen zu wissenschaftlichen Zwecken, Lehr-<br />
und Forschungszwecken Befreiung erteilt werden.<br />
(3) 1 Verboten ist, die Nester und Gelege des Federwildes zu beschädigen,<br />
wegzunehmen oder zu zerstören. 2 Art. 33 Abs. 5 Nr. 1 bleibt unberührt.<br />
Bay JG Art. 22 a Schutz kranken und verletzten Wildes<br />
Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung im Rahmen des § 36 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 des<br />
Bundesjagdgesetzes Vorschriften über das Aufnehmen, die Pflege und die<br />
Aufzucht verletzten oder kranken Wildes und dessen Verbleib zu erlassen;<br />
diese Vorschriften können sich auch auf Eier oder sonstige Entwicklungsformen<br />
solchen Wildes erstrecken.<br />
Bay JG Art. 23 Wildgehege<br />
(1) Wildgehege sind vollständig eingefriedete Grundflächen, auf denen<br />
überwiegend sonst wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen,<br />
dauernd oder vorübergehend gehalten oder zu Jagdzwecken gehegt<br />
werden.<br />
(2) 1 Die Errichtung, die Erweiterung und der Betrieb von Wildgehegen, in<br />
denen Wild zu Jagdzwecken gehegt wird, sind genehmigungspflichtig; für<br />
sonstige Wildgehege gilt dies ab einer Mindestgröße von 10 ha. 2 Die<br />
Genehmigung erteilt die Jagdbehörde. 3 Diese entscheidet insoweit auch<br />
als untere Naturschutzbehörde über die Voraussetzungen des Art. 20 a<br />
des Bayerischen Naturschutzgesetzes. 4 Die Genehmigung wird durch eine<br />
nach anderen Vorschriften zugleich erforderliche behördliche Gestattung<br />
ersetzt; ist die zuständige Behörde nicht zugleich Jagdbehörde und<br />
Naturschutzbehörde, so entscheidet sie im Einvernehmen mit diesen<br />
Behörden.<br />
(3) 1 Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn<br />
1. durch das Wildgehege der Lebensraum der Wildarten außerhalb<br />
desselben nicht in unangemessener Weise eingeschränkt wird,<br />
2. die Jagdausübung nicht wesentlich beeinträchtigt wird und<br />
3. das Wildgehege so gesichert ist, daß die Tiere nicht entweichen können.<br />
2<br />
Die Errichtung von Wildgehegen, in denen Wild zu Jagdzwecken gehegt<br />
wird, darf außerdem nur genehmigt werden, wenn diese
zusammenhängend mindestens die Größe eines Eigenjagdreviers haben<br />
und ihre Flächen im Eigentum einer Person oder einer<br />
Personengemeinschaft stehen.<br />
(4) 1 Die Genehmigung ist für bestimmte Tierarten zu erteilen. 2 Sie kann mit<br />
Nebenbestimmungen versehen werden. 3 Die Jagdbehörde kann auch<br />
nachträglich Auflagen anordnen. 4 Sie kann insbesondere die Höchstzahlen<br />
der zu haltenden Tiere bestimmen. 5 Das Beseitigungsverfahren richtet<br />
sich nach Art. 76 Sätze 1 und 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO).<br />
(5) 1 Wildgehege, die bei Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s bereits bestehen, sind<br />
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s bei der<br />
Jagdbehörde anzuzeigen. 2 Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn das<br />
Wildgehege nach anderen gesetzlichen Bestimmungen genehmigt worden<br />
ist oder die Jagdbehörde nicht binnen drei Monaten nach Eingang der<br />
Anzeige die Genehmigung versagt; mit der Versagung der Genehmigung<br />
kann die Beseitigung des Wildgeheges nach Art. 76 Sätze 1 und 3 BayBO<br />
angeordnet werden. 3 Soweit diese Maßnahmen enteignend wirken, ist den<br />
Betroffenen Entschädigung nach den Vorschriften des Bayerischen<br />
<strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige Enteignung zu gewähren.<br />
4 5<br />
Entschädigungspflichtig ist der Freistaat Bayern. Zuständig für die<br />
Festsetzung der Entschädigung ist die Kreisverwaltungsbehörde.<br />
(6) 1 Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Registrierung und die<br />
Regulierung der Tierbestände in Wildgehegen sowie über die Gestaltung<br />
der Gehegeanlagen zu erlassen. 2 Die Rechtsverordnung ergeht im<br />
Einvernehmen mit den , soweit sie die Gestaltung der Gehegeanlagen<br />
betrifft.<br />
Bay JG Art. 24 Wildpark<br />
(1) 1 Wildgehege, in denen Schalenwild zu Jagdzwecken gehegt und durch<br />
Jagdhandlungen genutzt wird, können als Wildpark (§ 20 Abs. 2 des<br />
Bundesjagdgesetzes) anerkannt werden. 2 Das Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, die Voraussetzungen der<br />
Anerkennung durch Rechtsverordnung zu regeln.<br />
(2) Die Bezeichnung “Wildpark” darf nur für die nach Absatz 1 Satz 1<br />
anerkannten Wildgehege verwendet werden.<br />
Bay JG Art. 25 Wintergatter<br />
1 Wintergatter sind Wildgehege, in denen Rotwild zur Vermeidung übermäßiger<br />
Wildschäden während der Notzeit zur Fütterung gehalten wird. 2 Auf sie finden<br />
die Vorschriften des Art. 23 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1, Sätze 2 bis 4, Abs. 4<br />
Sätze 2, 3 und 5 und Abs. 5 Anwendung. 3 Die Genehmigung darf im übrigen<br />
nur erteilt werden, wenn der Verfügungsberechtigte dem Vorhaben zugestimmt<br />
hat.
V. ABSCHNITT Förderung des Jagdwesens<br />
Bay JG Art. 26 Mittel und Gegenstand der Förderung<br />
(1) 1 Mit der Gebühr für den Jagdschein wird vom Jagdscheininhaber eine<br />
Jagdabgabe erhoben, die vom Staatsministerium für Landwirtschaft und<br />
Forsten zur Förderung des Jagdwesens zu verwenden ist. 2 Gefördert<br />
sollen insbesondere werden:<br />
1. Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen des<br />
Wildes,<br />
2. Erforschung der Lebens- und Umweltbedingungen der Wildarten,<br />
3. Erforschung von Möglichkeiten zur Verhütung und Verhinderung von<br />
Wildschäden in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft,<br />
4. das Berufsjägerwesen,<br />
5. die Errichtung und der Betrieb von Muster- und Lehrrevieren sowie<br />
sonstige Maßnahmen und Einrichtungen zur Information und Aus- und<br />
Fortbildung der Jäger, der Jagdvorsteher sowie der für den Vollzug der<br />
jagdrechtlichen Vorschriften zuständigen Organe.<br />
(2) 1 Die Höhe der Jagdabgabe beträgt für den Tagesjagdschein und den<br />
Einjahresjagdschein die Hälfte der Jagdscheingebühr. 2 Für den<br />
Dreijahresjagdschein wird der dreifache Betrag der Jagdabgabe für den<br />
Einjahresjagdschein erhoben.<br />
Bay JG Art. 27 Verfahren<br />
1 Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten entscheidet über die<br />
Verteilung der für Zwecke der Forschung und für sonstige zentrale Zwecke zu<br />
verwendenden Anteile der Jagdabgabe im Benehmen mit den anerkannten<br />
Vereinigungen der Jäger (Art. 51). 2 Es stellt das verbleibende Aufkommen<br />
dem Landesjagdverband Bayern e. V. für die Förderung der Jagd zur<br />
Verfügung; der Haushalt des Landesjagdverbands Bayern e. V. unterliegt<br />
insoweit der Genehmigung des Staatsministeriums für Landwirtschaft und<br />
Forsten. 3 Bei der Festlegung der Förderanteile nach den Sätzen 1 und 2 ist der<br />
Jagdbeirat der obersten Jagdbehörde anzuhören.<br />
VI. ABSCHNITT Jagdausübung<br />
1. Allgemeines<br />
Bay JG Art. 28 Jägerprüfung, Falknerprüfung, Jagdschein<br />
(1) 1 Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung eine Prüfungsordnung für die Jäger- und<br />
Falknerprüfung zu erlassen. 2 In der Prüfungsordnung sind insbesondere<br />
die Zulassungsvoraussetzungen, die Grundsätze des Prüfungsverfahrens,<br />
die Prüfungsorgane, die Prüfungsanforderungen und die Prüfungsfächer<br />
festzulegen. 3 Ferner können Bestimmungen über die Ausbildung der<br />
Prüfungsbewerber und über der Jägerprüfung gleichgestellte Prüfungen<br />
getroffen werden. 4 Es ist weiter festzulegen, daß die erforderlichen<br />
Kenntnisse für die Jagd mit Fallen durch Teilnahme an einem Lehrgang<br />
nachzuweisen sind; auf diesen Nachweis kann verzichtet werden, wenn<br />
der Prüfungsbewerber bei der Anmeldung zur Jägerprüfung die Erklärung
abgibt, auf die Ausübung der Fallenjagd zu verzichten; der Verzicht kann<br />
widerrufen werden, wenn die Teilnahme an einem Lehrgang zu einem<br />
späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. 5 Soweit die Rechtsverordnung nach<br />
Satz 1 Belange des Lebensmittelrechts (Wildbrethygiene), des<br />
Tierschutzrechts sowie des Naturschutz- und Landschaftspflegerechts<br />
betrifft, ergeht sie im Benehmen mit den<br />
(2) Der Jahresjagdschein wird als Einjahresjagdschein und als<br />
Dreijahresjagdschein erteilt.<br />
(3) 1 Die Erteilung des Jagdscheins ist von dem Nachweis einer ausreichenden<br />
Jagdhaftpflichtversicherung (§ 17 Abs. 1 Nr. 4 des Bundesjagdgesetzes)<br />
abhängig zu machen. 2 Besteht keine ausreichende Versicherung, so ist<br />
ein erteilter Jagdschein unverzüglich der zuständigen Jagdbehörde<br />
abzuliefern. 3 Erfährt diese auf andere Weise, daß keine ausreichende<br />
Versicherung besteht, so hat sie den Jagdschein unverzüglich nach § 18<br />
Satz 1 des Bundesjagdgesetzes für ungültig zu erklären und einzuziehen.<br />
4<br />
Zuständige Stelle im Sinn des § 158 c Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s über den<br />
Versicherungsvertrag ist die für den Entzug des Jagdscheins zuständige<br />
Jagdbehörde. 5 Kennt der Versicherer diese nicht, so ist die Anzeige an die<br />
Jagdbehörde zu richten, die den Jagdschein erteilt hat.<br />
2. Jagdbeschränkungen<br />
Bay JG Art. 29 Sachliche Gebote und Verbote<br />
(1) Auf krankgeschossenes Wild ist zeitgerecht und fachgemäß nachzusuchen.<br />
(2) Verboten ist – in Ergänzung zu § 19 des Bundesjagdgesetzes –<br />
1. Wild, insbesondere zur Abrichtung und Prüfung von Jagdhunden,<br />
absichtlich krankzuschießen,<br />
2. die Jagd auf Wild mit Fanggeräten oder Fangvorrichtungen auszuüben;<br />
dies gilt vorbehaltlich des Art. 29 a nicht für die Jagd auf Raubwild und<br />
Wildkaninchen,<br />
3. die Jagd auf sonstiges Haarwild, mit Ausnahme von Schwarzwild und<br />
Raubwild, zur Nachtzeit (§ 19 Abs. 1 Nr. 4 des Bundesjagdgesetzes)<br />
auszuüben,<br />
4. die Jagd auf Schalenwild, mit Ausnahme von Schwarzwild, als Treibjagd<br />
auszuüben,<br />
5. das Wild durch Lappen oder sonstige Mittel zu hindern, aus seinen oder<br />
in seine Tageseinstände zu wechseln,<br />
6. auf Wild, das durch Überflutungen, Lawinen oder sonstige<br />
Naturkatastrophen in Not geraten oder zum Verlassen der Einstände<br />
gezwungen worden ist, die Jagd auszuüben; dies gilt nicht, soweit die Not<br />
des Wildes nur durch Erlegung beendet werden kann,<br />
7. die Jagd unter Verwendung von Betäubungs- oder Lähmungsmitteln,<br />
Sprengstoffen, Gasen oder von Schußwaffen mit Schalldämpfern<br />
auszuüben,<br />
8. Wild aus Luftfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder maschinengetriebenen<br />
Wasserfahrzeugen zu beschießen; das Verbot umfasst nicht das<br />
Beschießen von Wild aus Kraftfahrzeugen durch Körperbehinderte mit<br />
Erlaubnis der Jagdbehörde.
(3) Die Jagdbehörde kann Ausnahmen zulassen<br />
1. in besonderen Einzelfällen, insbesondere zur Durchführung von<br />
Hegemaßnahmen oder zu wissenschaftlichen Zwecken, von dem Verbot<br />
des Absatzes 2 Nr. 2, soweit es sich nicht um die Verwendung von<br />
Schlagfallen (Art. 29 a) handelt,<br />
2. in begründeten Einzelfällen von den Verboten der Verwendung von<br />
Betäubungs- oder Lähmungsmitteln oder von Schusswaffen mit<br />
Schalldämpfern (Abs. 2 Nr. 7),<br />
3. von dem Verbot des § 19 Abs. 1 Nr. 4 des Bundesjagdgesetzes für die<br />
Nachtjagd auf Rotwild, soweit es die Landeskultur erfordert.<br />
(4) Das Verbot des § 19 Abs. 1 Nr. 10 des Bundesjagdgesetzes gilt nicht für<br />
Kirrungen.<br />
(5) 1 Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung die Verbote des § 19 Abs. 1 des<br />
Bundesjagdgesetzes, mit Ausnahme der Nummer 16, zu erweitern oder<br />
aus besonderen Gründen, insbesondere aus Gründen der<br />
Wildseuchenbekämpfung und Landeskultur, zur Beseitigung kranken oder<br />
kümmernden Wildes, zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden, zu<br />
wissenschaftlichen Zwecken, Lehr- und Forschungszwecken oder bei<br />
Störung des biologischen Gleichgewichts einzuschränken; soweit Federwild<br />
betroffen ist, ist die Einschränkung nur aus den in Art. 9 Abs. 1 der<br />
Richtlinie 79/409/EWG genannten Gründen und nach den in Art. 9 Abs. 2<br />
dieser Richtlinie genannten Maßgaben zulässig. 2 Unter den gleichen<br />
Voraussetzungen kann die Jagdbehörde die Verbote auch durch<br />
Einzelanordnung einschränken. 3 Die tierseuchenrechtlichen Vorschriften<br />
bleiben unberührt.<br />
Bay JG Art. 29 a Jagd mit Fallen<br />
(1) 1 Die verwendeten Fallen müssen ihrer Bauart nach Mindestanforderungen<br />
erfüllen, die ein sofortiges Töten oder einen unversehrten Lebendfang<br />
gewährleisten. 2 Fangeisen dürfen nur verwendet werden, wenn zusätzlich<br />
1. ihre Betriebssicherheit regelmäßig überprüft wird und<br />
2. sie dauerhaft so gekennzeichnet sind, daß ihr Besitzer feststellbar ist.<br />
(2) 1 Fangeisen dürfen nur in geschlossenen Räumen, Fangbunkern oder<br />
Fanggärten, in denen die Schlagfalle nach oben verblendet ist, so<br />
aufgestellt werden, daß von ihnen keine Gefährdung von Menschen,<br />
geschützten Tieren und Haustieren ausgeht. 2 Art. 42 Abs. 1 Nr. 2 bleibt<br />
unberührt.<br />
(3) Die Verwendung von Schlagfallen ist der Jagdbehörde anzuzeigen.<br />
(4) 1 Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung<br />
und Verbraucherschutz und dem Staatsministerium für Landesentwicklung<br />
und Umweltfragen das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln. 2 Mit<br />
der Durchführung der Lehrgänge (Art. 28 Abs. 1 Satz 4), der Überprüfung<br />
der Fangeisen auf ihre Betriebssicherheit, ihrer Kennzeichnung und<br />
Registrierung (Absatz 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2) kann der Landesjagdverband<br />
Bayern e. V. betraut werden; in diesem Fall hat der Landesjagdverband<br />
Bayern e. V. oder dessen zuständige Kreisgruppe der Jagdbehörde auf
Verlangen die Ergebnisse der Funktionsprüfung sowie die Namen und<br />
Anschriften der Besitzer der gekennzeichneten Fangeisen mitzuteilen.<br />
Bay JG Art. 30 Treibjagd, Gesellschaftsjagd<br />
(1) Treibjagd ist die Jagd, an der neben Schützen mehr als vier Personen als<br />
Treiber und Abwehrer teilnehmen.<br />
(2) Gesellschaftsjagd ist die Jagd, an der mehr als vier Personen teilnehmen.<br />
Bay JG Art. 31 Örtliche Beschränkungen<br />
(1) 1 Die Ausübung der Jagd in Nationalparken wird durch Rechtsverordnung<br />
nach Art. 8 Abs. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes, in<br />
Naturschutzgebieten durch Rechtsverordnung nach den Art. 7 und 45 des<br />
Bayerischen Naturschutzgesetzes geregelt. 2 Vorschriften über die<br />
Ausübung der Jagd in Wildparken erläßt das Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft und Forsten durch Rechtsverordnung (§ 20 Abs. 2 des<br />
Bundesjagdgesetzes).<br />
(2) 1 In Wintergattern (Art. 25) darf Schalenwild, ausgenommen krankes und<br />
kümmerndes Wild, nicht erlegt werden. 2 Ausnahmen können zugelassen<br />
werden, wenn dies mit Rücksicht auf das allgemeine Wohl, insbesondere<br />
auf die Interessen der Land- und Forstwirtschaft und die Belange des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege notwendig ist.<br />
(3) Die höhere Jagdbehörde kann die Bejagung von Wildarten, die in ihrem<br />
Bestand bedroht erscheinen, in bestimmten Gebieten oder in bestimmten<br />
Jagdrevieren durch Rechtsverordnung oder durch Anordnung für den<br />
Einzelfall dauernd oder zeitweise gänzlich verbieten (§ 21 Abs. 3 des<br />
Bundesjagdgesetzes).<br />
Bay JG Art. 32 Regelung der Bejagung<br />
(1) 1 Der Abschußplan (§ 21 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes) ist für den<br />
Zeitraum von ein bis drei Jahren zahlenmäßig getrennt nach Wildart und<br />
Geschlecht vom Revierinhaber im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand,<br />
bei verpachteten Eigenjagdrevieren im Einvernehmen mit dem<br />
Jagdberechtigten aufzustellen und von der Jagdbehörde im Einvernehmen<br />
mit dem Jagdbeirat (Art. 50 Abs. 2 und 6) zu bestätigen oder<br />
festzusetzen. 2 Bei der Abschußplanung ist neben der körperlichen<br />
Verfassung des Wildes vorrangig der Zustand der Vegetation,<br />
insbesondere der Waldverjüngung zu berücksichtigen. 3 Den zuständigen<br />
Forstbehörden ist vorher Gelegenheit zu geben, sich auf der Grundlage<br />
eines forstlichen Gutachtens über eingetretene Wildschäden an forstlich<br />
genutzten Grundstücken zu äußern und ihre Auffassung zur Situation der<br />
Waldverjüngung darzulegen. 4 Ist zwischen der Jagdbehörde und dem<br />
Jagdbeirat ein Einvernehmen nicht zu erzielen, so entscheidet die<br />
nächsthöhere Jagdbehörde.<br />
(2) 1 Der Revierinhaber ist verpflichtet, den Abschußplan für Schalenwild<br />
notfalls unter Hinzuziehung anderer Jagdscheininhaber zu erfüllen. 2 Die<br />
Jagdbehörde trifft die zur Erfüllung des Abschußplans erforderlichen<br />
Anordnungen. 3 Die Vorschrift des § 27 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes<br />
findet entsprechende Anwendung; Art. 32 Satz 2 des Bayerischen
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes gilt nicht. 4 Ein für<br />
den Fall der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung des Abschußplans<br />
angedrohtes Zwangsgeld kann auch beigetrieben werden, wenn nach<br />
Ablauf der Jagdzeit feststeht, daß der Abschußplan nicht mehr erfüllt<br />
werden kann.<br />
(3) 1 Anordnungen nach Absatz 2 Satz 2 ergehen im Fall des Art. 7 Abs. 4 an<br />
den Bevollmächtigten, der auf die Erfüllung des Abschußplans durch die<br />
Mitpächter oder die verantwortlichen Personen im Sinn des Art. 7 Abs. 2<br />
hinzuwirken hat. 2 Handlungen des Bevollmächtigten, die zur Erfüllung des<br />
Abschußplans erforderlich sind, haben die übrigen Mitpächter oder<br />
verantwortlichen Personen zu dulden.<br />
(4) 1 Über erlegtes und verendetes Schalenwild mit Ausnahme des vor Beginn<br />
seiner Jagdzeit gefallenen Jungwildes ist<br />
1. der Jagdbehörde eine schriftliche Abschußmeldung zu erstatten und<br />
2. eine Streckenliste zu führen, die der Jagdbehörde auf Verlangen<br />
jederzeit vorzulegen ist.<br />
2<br />
Die Jagdbehörde kann vom Revierinhaber verlangen, ihr oder einem von<br />
ihr Beauftragten das erlegte Wild oder Teile desselben vorzulegen.<br />
(5) 1 Die Erlegung von krankem Wild außerhalb der Jagdzeiten sowie innerhalb<br />
der Jagdzeiten über den Abschußplan hinaus ist der Jagdbehörde unter<br />
Angabe der Art der Erkrankung oder Verletzung unverzüglich mitzuteilen.<br />
2<br />
Auf Verlangen ist das erlegte Wild der Jagdbehörde oder einem von ihr<br />
Beauftragten vorzuzeigen.<br />
(6) 1 Für bestimmte Jagdreviere können zu wissenschaftlichen Zwecken, Lehrund<br />
Forschungszwecken durch Einzelanordnung Ausnahmen von den<br />
Vorschriften über die Hege und Bejagung, insbesondere die zulässige<br />
Wilddichte zugelassen werden. 2 Die Ausnahme darf nur erteilt werden,<br />
wenn dadurch weder eine Störung des biologischen Gleichgewichts noch<br />
eine Schädigung der Landeskultur zu befürchten ist und wenn der<br />
Revierinhaber und der Jagdberechtigte oder die Jagdgenossenschaft<br />
zugestimmt haben. 3 Die Zustimmung ist unwiderruflich.<br />
(7) Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung<br />
1. nähere Vorschriften über die Abschußplanung sowie über die<br />
Bestätigung und Festsetzung der Abschußpläne, ferner über die<br />
Überwachung ihrer Durchführung und über die Erzwingung ihrer Erfüllung<br />
zu erlassen (§ 21 Abs. 2 Satz 7 des Bundesjagdgesetzes),<br />
2. Vorschriften über die Erhebung von Daten über die Revierverhältnisse<br />
und das erlegte Wild, ferner über die Erhebung des Bestands der<br />
Wildarten sowie der Abschuß- und Fangergebnisse zu erlassen,<br />
3. Gebiete für die Hege und Bejagung von Schalenwild festzulegen, diese<br />
Gebiete in Bezirke zu unterteilen, ferner die Jagd- und Forstbehörden zu<br />
bestimmen, die für die Abschußplanung in diesen Gebieten zuständig sind<br />
und erforderlichenfalls gemeinsame Jagdbeiräte vorzusehen.<br />
(8) Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten kann Richtlinien für<br />
die Hege und Bejagung des Wildes erlassen.<br />
(9) Ohne Abschußplan bejagt werden darf Schalenwild in Gebieten, in denen<br />
die Hege auf Grund einer Verordnung nach Absatz 7 Nr. 3 untersagt ist.
Bay JG Art. 33 Jagd- und Schonzeiten<br />
(1) Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung<br />
1. Tierarten, die in § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes nicht genannt sind,<br />
dem Jagdrecht zu unterstellen und für diese Tierarten Jagdzeiten<br />
festzusetzen,<br />
2. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes die Jagdzeiten<br />
abzukürzen oder aufzuheben,<br />
3. weggefallen<br />
(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 ergehen im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen.<br />
(3) Die höhere Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung<br />
1. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes für bestimmte<br />
Gebiete oder für einzelne Jagdreviere aus besonderen Gründen,<br />
insbesondere aus Gründen der Wildseuchenbekämpfung und Landeskultur,<br />
zur Beseitigung kranken und kümmernden Wildes, zur Vermeidung von<br />
übermäßigen Wildschäden, zu wissenschaftlichen Zwecken, Lehr- und<br />
Forschungszwecken, bei Störung des biologischen Gleichgewichts oder der<br />
Wildhege die Schonzeiten aufzuheben,<br />
2. gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes bei Störung des<br />
biologischen Gleichgewichts oder bei schwerer Schädigung der<br />
Landeskultur Jagdzeiten festzusetzen,<br />
3. gemäß § 22 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes aus Gründen der<br />
Landeskultur Schonzeiten für Wild gänzlich zu versagen,<br />
4. gemäß § 22 Abs. 4 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes Ausnahmen von<br />
dem Jagdverbot in den Setz- und Brutzeiten für Schwarzwild,<br />
Wildkaninchen, Fuchs, Ringel- und Türkentaube, Silber- und Lachmöwe<br />
sowie für die nach <strong>Landesrecht</strong> dem Jagdrecht unterstellten Tierarten zu<br />
bestimmen.<br />
(4) 1 Rechtsverordnungen nach Absatz 3 werden, wenn eine landeseinheitliche<br />
Regelung erforderlich oder zweckmäßig ist, vom Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft und Forsten erlassen. 2 Solche Rechtsverordnungen setzen<br />
entgegenstehende oder inhaltsgleiche Vorschriften der nachgeordneten<br />
Jagdbehörden außer Kraft. 3 Haben solche Rechtsverordnungen die<br />
Bekämpfung von Wildseuchen zum Gegenstand, so ist das<br />
Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz zu<br />
beteiligen.<br />
(5) Die Jagdbehörde kann<br />
1. in Einzelfällen für den Lebendfang von Wild Ausnahmen nach § 22<br />
Abs. 1 Satz 4 des Bundesjagdgesetzes und zu wissenschaftlichen, Lehrund<br />
Forschungszwecken oder für Zwecke der Aufzucht und<br />
Wiedereinsetzung Ausnahmen nach § 22 Abs. 4 Satz 5 des<br />
Bundesjagdgesetzes zulassen und das Sammeln der Eier von Ringel- und<br />
Türkentauben sowie von Silber- und Lachmöwen nach § 22 Abs. 4 Satz 6<br />
des Bundesjagdgesetzes erlauben,<br />
2. Regelungen nach Absatz 3 Nrn. 1 und 2 auch durch Einzelanordnung<br />
treffen und gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes<br />
Ausnahmen zulassen,<br />
3. gemäß § 22 Abs. 4 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes im Einzelfall das
Aushorsten von Nestlingen und Ästlingen der Habichte für Beizzwecke<br />
genehmigen.<br />
3. Hegebeschränkungen<br />
Bay JG Art. 34 Aussetzen von Tierarten<br />
(1) Als fremd im Sinn des § 28 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes gelten<br />
Tierarten, die im Geltungsbereich des Bundesjagdgesetzes bei dessen<br />
Inkrafttreten (1. April 1953) freilebend nicht heimisch waren.<br />
(2) 1 Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tierarten in der freien Natur<br />
ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Jagdbehörde zulässig.<br />
2<br />
Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn durch das Aussetzen<br />
oder das Ansiedeln eine Störung des biologischen Gleichgewichts oder<br />
eine Schädigung der Landeskultur oder Gefahren für die öffentliche<br />
Sicherheit nicht zu befürchten sind.<br />
(3) Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung das Hegen oder Aussetzen weiterer Tierarten im<br />
Sinn von § 28 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes, die dem Jagdrecht<br />
unterliegen, aus den in Absatz 2 Satz 2 genannten Gründen zu<br />
beschränken oder zu verbieten.<br />
4. Besondere Rechte und Pflichten bei der Jagdausübung<br />
Bay JG Art. 35 Wegerecht<br />
(1) 1 Wer die Jagd ausübt, aber zum Jagdrevier nicht auf einem zum<br />
allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg oder nur auf einem unzumutbaren<br />
Weg gelangen kann, ist zum Betreten fremder Jagdreviere in<br />
Jagdausrüstung auch auf einem nicht zum allgemeinen Gebrauch<br />
bestimmten Weg (Jägernotweg) befugt, der notfalls durch die<br />
Jagdbehörde bestimmt wird. 2 Der Eigentümer des Grundstücks, über das<br />
der Jägernotweg führt, kann eine angemessene Entschädigung verlangen,<br />
die auf Antrag der Beteiligten durch die Jagdbehörde festgesetzt wird.<br />
(2) Bei Benutzung des Jägernotwegs dürfen Langwaffen nur ungeladen und<br />
Hunde nur angeleint mitgeführt werden.<br />
Bay JG Art. 36 Jagdeinrichtungen<br />
1 Der Revierinhaber darf auf land- oder forstwirtschaftlich genutzten<br />
Grundstücken besondere, das Eigentum wesentlich beeinträchtigende Anlagen<br />
nur mit Einwilligung des Grundstückseigentümers oder Nutzungsberechtigten<br />
errichten; die Einwilligung kann durch die Jagdbehörde ersetzt werden, wenn<br />
dem Eigentümer des Grundstücks die Duldung der Anlage unter<br />
Berücksichtigung der jagdlichen Erfordernisse zumutbar ist. 2 Der Eigentümer<br />
des Grundstücks kann eine angemessene Entschädigung verlangen, die auf<br />
Antrag eines der Beteiligten durch die Jagdbehörde festgesetzt wird.<br />
Bay JG Art. 37 Wildfolge<br />
(1) 1 Wechselt krankgeschossenes Wild in ein benachbartes Revier, so hat der<br />
Jagdausübende den Anschuß und die Stelle des Überwechselns nach<br />
Möglichkeit kenntlich zu machen. 2 Außerdem hat er das Überwechseln
dem Inhaber des Nachbarreviers oder dessen Vertreter unverzüglich<br />
anzuzeigen; das gilt auch für Wild, das aufgrund anderer Ursachen schwer<br />
krank oder verletzt ist. 3 Für die Nachsuche hat er sich selbst oder eine mit<br />
den Vorgängen vertraute Person zur Verfügung zu stellen.<br />
(2) Ist der Schütze ein Jagdgast, so ist neben diesem auch der Revierinhaber,<br />
wenn er vom Überwechseln des krankgeschossenen Wildes Kenntnis<br />
erhält, zur Anzeige verpflichtet.<br />
(3) 1 Wechselt krankgeschossenes Wild über die Grenze und ist es für einen<br />
sicheren Schuß erreichbar, so ist es vom Jagdausübenden zu erlegen und<br />
zu versorgen. 2 Die Pflicht zur Versorgung erstreckt sich auch auf<br />
krankgeschossenes Wild, das nach dem Überwechseln in Sichtweite von<br />
der Grenze im benachbarten Revier verendet. 3 Langwaffen dürfen beim<br />
Überschreiten der Grenze nur ungeladen mitgeführt werden. 4 Das<br />
Fortschaffen des erlegten Schalenwildes ist unzulässig. 5 Das Erlegen ist<br />
dem Inhaber des benachbarten Jagdreviers oder dessen Vertreter<br />
unverzüglich anzuzeigen. 6 Fortgeschafftes oder vom Hund aus dem<br />
Nachbarrevier gebrachtes Wild ist dem Inhaber des Nachbarreviers<br />
abzuliefern.<br />
(4) 1 Unbeschadet einer anderweitigen Vereinbarung gehören in den Fällen der<br />
Absätze 1 und 3 das Wildbret und die Erinnerungsstücke (Kopfschmuck<br />
und Grandeln des Schalenwildes, Waffen des Schwarzwildes) dem<br />
Revierinhaber, in dessen Jagdrevier das Wild zur Strecke kommt. 2 Das<br />
erlegte Wild ist auf den Abschußplan desjenigen Reviers anzurechnen, in<br />
dem es angeschossen wurde.<br />
(5) Über die Vorschriften der Absätze 1, 3 und 4 hinausgehende<br />
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.<br />
Bay JG Art. 38 Verfolgung kranken oder krankgeschossenen Wildes in<br />
befriedeten Bezirken<br />
1 Die Verfolgung kranken oder krankgeschossenen Wildes im eigenen<br />
Jagdrevier ist in Gebieten zulässig, in denen die Jagd ruht oder nur eine<br />
beschränkte Jagdausübung gestattet ist. 2 Das gilt nicht für Gebäude,<br />
Hofräume und Hausgärten im Sinn von Art. 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2; dem<br />
Revierinhaber steht jedoch auch in diesen Fällen das Aneignungsrecht zu; der<br />
Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte ist zur Herausgabe<br />
verpflichtet.<br />
Bay JG Art. 39 Verwendung von Jagdhunden<br />
(1) 1 Bei jeder Such-, Drück-, Riegel- und Treibjagd sowie bei jeder Jagdart<br />
auf Wasserwild sind brauchbare Jagdhunde in genügender Zahl zu<br />
verwenden. 2 Auch der bei einer anderen Jagdart zur Nachsuche<br />
verwendete Hund muß brauchbar sein.<br />
(2) Die Jagdbehörde kann dem Revierinhaber die Verpflichtung zur Haltung<br />
eines zur Nachsuche brauchbaren Jagdhunds auferlegen.<br />
(3) Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Feststellung der<br />
Brauchbarkeit von Jagdhunden zu erlassen und hierbei Prüfungen<br />
vorzuschreiben sowie ihre Durchführung und die Prüfungszulassung zu
egeln; mit der Durchführung von Brauchbarkeitsprüfungen und der<br />
Feststellung der Brauchbarkeit von Jagdhunden können die anerkannten<br />
Vereinigungen der Jäger (Art. 51) betraut werden.<br />
VII. ABSCHNITT Jagdschutz<br />
Bay JG Art. 40 Inhalt des Jagdschutzes; Pflicht zur Ausübung des<br />
Jagdschutzes<br />
(1) Der Jagdschutz umfaßt auch den Schutz des Wildes vor<br />
Beeinträchtigungen durch dem Jagdrecht nicht unterliegende Tierarten,<br />
soweit diese keinem besonderen Schutz nach Naturschutzrecht unterstellt<br />
sind, sowie vor aufsichtslosen Hunden und Katzen.<br />
(2) Der Revierinhaber (Art. 7 Abs. 1 Satz 2) ist verpflichtet, den Jagdschutz<br />
(§ 23 des Bundesjagdgesetzes und Absatz 1) in seinem Jagdrevier<br />
auszuüben.<br />
Bay JG Art. 41 Jagdschutzberechtigte<br />
(1) Der Revierinhaber kann zum Schutz der Jagd volljährige, zuverlässige<br />
Personen als Jagdaufseher anstellen.<br />
(2) 1 Für die Bestätigung von Jagdaufsehern (§ 25 Abs. 1 Satz 1 des<br />
Bundesjagdgesetzes) ist die Jagdbehörde zuständig. 2 Die Bestätigung darf<br />
nur versagt werden, wenn der Jagdaufseher nicht Inhaber eines gültigen<br />
Jahresjagdscheins ist oder Bedenken gegen seine persönliche<br />
Zuverlässigkeit oder fachliche Eignung bestehen.<br />
(3) Neben dem Revierinhaber und dem bestätigten Jagdaufseher übt den<br />
Jagdschutz auch die Bayerische Staatliche Polizei aus, soweit er die Sorge<br />
für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes erlassenen Vorschriften und<br />
den Schutz vor Wilderern umfaßt.<br />
(4) 1 Der Revierinhaber kann auch einem Jagdgast die Ausübung des<br />
Jagdschutzes erlauben, soweit er den Schutz des Wildes vor Tieren im<br />
Sinn des Art. 40 Abs. 1, vor Futternot und Wildseuchen umfaßt. 2 Art. 17<br />
Abs. 3 gilt sinngemäß.<br />
(5) 1 Die Jagdbehörde kann die Anstellung eines oder mehrerer bestätigter<br />
Jagdaufseher verlangen, wenn es zumutbar und zum Jagdschutz<br />
notwendig ist oder der Revierinhaber seinen Verpflichtungen zur Hege<br />
oder Regulierung des Wildbestands trotz schriftlicher Aufforderung nicht<br />
nachkommt. 2 Soweit es Reviergröße, Revierbeschaffenheit oder<br />
Wildbestand erfordern, kann die Jagdbehörde auch die Anstellung eines<br />
oder mehrerer hauptberuflich angestellter bestätigter Jagdaufseher<br />
verlangen. 3 Bei Hochwildrevieren über 1000 ha soll der bestätigte<br />
Jagdaufseher Berufsjäger oder forstlich ausgebildet sein. 4 Wer<br />
Berufsjäger oder forstlich ausgebildet im Sinn von § 25 Abs. 1 Satz 2 des<br />
Bundesjagdgesetzes ist, wird durch Rechtsverordnung des<br />
Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten bestimmt.<br />
(6) 1 Der Revierinhaber und der bestätigte Jagdaufseher sind verpflichtet, bei<br />
Ausübung des Jagdschutzes auf Verlangen des Betroffenen sich<br />
auszuweisen, und zwar der Revierinhaber durch Vorzeigen seines
Jagdscheins, der Jagdaufseher durch Vorzeigen des Ausweises über seine<br />
Bestätigung; dies gilt nicht, wenn die Ausweisung aus Sicherheitsgründen<br />
nicht zugemutet werden kann. 2 Die bestätigten Jagdaufseher müssen bei<br />
der Ausübung ihrer Tätigkeit außerdem ein Dienstabzeichen tragen. 3 Das<br />
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten erläßt im Einvernehmen<br />
mit dem Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung<br />
Vorschriften über die Dienstabzeichen.<br />
Bay JG Art. 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten<br />
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,<br />
1. Personen, die in einem Jagdrevier unberechtigt jagen oder eine<br />
sonstige Zuwiderhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften begehen oder<br />
außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Wege ohne<br />
Berechtigung hierzu zur Jagd ausgerüstet angetroffen werden, zur<br />
Feststellung ihrer Personalien anzuhalten und ihnen gefangenes oder<br />
erlegtes Wild, Waffen, Jagd- und Fanggeräte, Hunde und Frettchen sowie<br />
Beizvögel abzunehmen,<br />
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten. Hunde gelten als wildernd, wenn<br />
sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden<br />
können. Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer<br />
Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude<br />
angetroffen werden. Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen,<br />
die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als<br />
300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind. Sie<br />
gilt nicht gegenüber Jagd-, Dienst-, Blinden- und Hirtenhunden, soweit sie<br />
als solche kenntlich sind und solange sie von der führenden Person zu<br />
ihrem Dienst verwendet werden oder sich aus Anlaß des Dienstes ihrer<br />
Einwirkung entzogen haben sowie gegenüber in Fallen gefangenen Katzen,<br />
deren Besitzer eindeutig und für den Jagdschutzberechtigten in<br />
zumutbarer Weise festgestellt werden können.<br />
(2) Soweit der Revierinhaber einem Jagdgast nach Art. 41 Abs. 4 die<br />
Ausübung des Jagdschutzes übertragen hat, stehen diesem die Befugnisse<br />
nach Absatz 1 Nr. 2 ebenfalls zu.<br />
(3) Die bestätigten Jagdaufseher, die Berufsjäger oder forstlich ausgebildet<br />
sind, haben die Aufgaben und Befugnisse der Naturschutzwacht.<br />
Bay JG Art. 43 Natürliche Äsung; Fütterung des Wildes<br />
(1) 1 Der Schutz und die Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes<br />
sind Aufgabe des Revierinhabers, der im Einvernehmen mit den<br />
Grundstückseigentümern oder Nutzungsberechtigten durch Maßnahmen<br />
der Reviergestaltung und Äsungsverbesserung die Voraussetzungen dafür<br />
schaffen soll, daß das Wild auch in der vegetationsarmen Zeit natürliche<br />
Äsung findet. 2 Auf Grund anderer Vorschriften bestehende<br />
Verpflichtungen bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Durch die Fütterung des Wildes darf die Verwirklichung des Hegeziels<br />
(§ 1 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes) nicht gefährdet werden. 2 Das<br />
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung Vorschriften zur Verhinderung einer mißbräuchlichen<br />
Wildfütterung zu erlassen.
(3) 1 Der Revierinhaber ist verpflichtet, in der Notzeit für angemessene<br />
Wildfütterung zu sorgen und die dazu erforderlichen Fütterungsanlagen zu<br />
unterhalten. 2 Das gilt nicht für Rotwild, das auf Grund einer<br />
Rechtsverordnung nach Art. 32 Abs. 7 Nr. 3 nicht gehegt werden darf.<br />
(4) Kommt der Revierinhaber der Verpflichtung nach Absatz 3 trotz<br />
Aufforderung durch die Jagdbehörde nicht nach, so kann die Jagdbehörde<br />
auf seine Rechnung die Fütterung vornehmen und ausreichende<br />
Fütterungsanlagen aufstellen lassen.<br />
VIII. ABSCHNITT Wild- und Jagdschaden<br />
Bay JG Art. 44 Verhinderung übermäßigen Wildschadens auf<br />
eingezäunten Waldflächen<br />
Zum Schutz von Forstkulturen und forstlichen Verjüngungsflächen, die gegen<br />
das Eindringen von Schalenwild mit den üblichen Schutzvorrichtungen (§ 32<br />
Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes, Art. 47 Nr. 2) versehen sind und deren Größe<br />
10 ha nicht überschreitet, kann die Jagdbehörde nach § 27 des<br />
Bundesjagdgesetzes auf Antrag des Grundeigentümers oder<br />
Nutzungsberechtigten anordnen, daß der Revierinhaber unabhängig von den<br />
Schonzeiten innerhalb einer bestimmten Frist in bestimmtem Umfang<br />
eingewechseltes Schalenwild zu erlegen hat.<br />
Bay JG Art. 45 Erstattungsausschluß<br />
1 Wildschaden an Grundflächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden<br />
darf, ist nicht zu ersetzen. 2 Die Grundflächen bleiben bei der Berechnung der<br />
anteiligen Ersatzleistung für den Wildschaden an anderen Grundstücken (§ 29<br />
Abs. 1 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes) außer Ansatz.<br />
Bay JG Art. 46 Ersatz weiterer Wildschäden<br />
Ist für den ganzen oder teilweisen Verlust der Ernte Ersatz geleistet, so kann<br />
wegen eines weiteren Schadens im gleichen Wirtschaftsjahr Ersatz nur verlangt<br />
werden, wenn die Neubestellung im Rahmen der üblichen Bewirtschaftung<br />
liegt.<br />
Bay JG Art. 47 Ermächtigungen<br />
Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung<br />
1. im Rahmen des § 29 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes die<br />
Wildschadensersatzpflicht auf andere Wildarten auszudehnen,<br />
2. Bestimmungen über die Verpflichtung zur Leistung von Wildschadensersatz<br />
in den Fällen des § 32 Abs. 2 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes zu erlassen,<br />
soweit sie zur Vermeidung unzumutbarer Wildschäden in der Land- und<br />
Forstwirtschaft unerläßlich sind, sowie darüber zu erlassen, welche<br />
Schutzvorrichtungen als üblich anzusehen sind (§ 32 Abs. 2 Satz 2 des<br />
Bundesjagdgesetzes),<br />
3. Vorschriften über die Erhebung von Daten über die Wildschadenssituation<br />
(Art, Ausmaß und regionale Verteilung der Wildschäden) und über geleistete<br />
Wildschadensbeträge zu erlassen.
Bay JG Art. 47 a Verfahren in Wild- und Jagdschadenssachen<br />
(1) 1 Wild- und Jagdschäden können im ordentlichen Rechtsweg erst geltend<br />
gemacht werden, wenn das Vorverfahren nach § 35 des<br />
Bundesjagdgesetzes stattgefunden hat. 2 Das Vorverfahren führt die<br />
Gemeinde im eigenen Wirkungskreis durch; im Fall ihrer Beteiligung die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde. 3 Verspätet angemeldete Ansprüche oder wegen<br />
Fehlens eines ersatzfähigen Wild- oder Jagdschadens offensichtlich<br />
unbegründete Anträge sind zurückzuweisen. 4 Im Übrigen wird das<br />
Vorverfahren mit der Niederschrift über die gütliche Einigung oder, wenn<br />
eine solche nicht erreicht wird, mit dem Erlass des Vorbescheids<br />
abgeschlossen. 5 Gegen den Zurückweisungs- oder Vorbescheid kann<br />
binnen einer Notfrist von vier Wochen nach Zustellung Klage vor den<br />
ordentlichen Gerichten erhoben werden. 6 § 23 des<br />
Gerichtsverfassungsgesetzes findet Anwendung.<br />
(2) Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt,<br />
durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Anmeldung (§ 34 des<br />
Bundesjagdgesetzes) und des Vorverfahrens zu regeln, einschließlich der<br />
Kostentragung und der Zwangsvollstreckung aus der Niederschrift über<br />
die gütliche Einigung oder aus dem Vorbescheid.<br />
IX. ABSCHNITT Wildhandel<br />
Bay JG Art. 48 Überwachung des Wildhandels<br />
Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern<br />
Vorschriften über die behördliche Überwachung des gewerbsmäßigen Ankaufs,<br />
Verkaufs und Tausches sowie der gewerbsmäßigen Verarbeitung von Wildbret<br />
und die behördliche Überwachung der Wildhandelsbücher zu erlassen (§ 36<br />
Abs. 2 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes).<br />
X. ABSCHNITT Organisation, Zuständigkeit, Verfahren<br />
Bay JG Art. 49 Jagdbehörden, Jagdberater<br />
(1) 1 Der Vollzug des Bundesjagdgesetzes, dieses <strong>Gesetze</strong>s und der auf Grund<br />
dieser <strong>Gesetze</strong> erlassenen Rechtsverordnungen ist grundsätzlich Aufgabe<br />
des Staates. 2 Er obliegt den Jagdbehörden. 3 Soweit wesentliche Belange<br />
der Land- und Forstwirtschaft berührt sind, sind die Ämter für<br />
Landwirtschaft und Forsten zu beteiligen. 4 Soweit wesentliche Belange<br />
des Naturschutzes oder der Landschaftspflege berührt werden, sind<br />
diejenigen Naturschutzbehörden zu beteiligen, die dem<br />
Zuständigkeitsbereich der Jagdbehörde der vergleichbaren<br />
Verwaltungsstufe entsprechen.<br />
(2) Jagdbehörden im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind<br />
1. das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten als oberste<br />
Jagdbehörde,<br />
2. die Regierungen als höhere Jagdbehörden,<br />
3. die Kreisverwaltungsbehörden als untere Jagdbehörden.
(3) 1 Zur laufenden sachverständigen Beratung der Jagdbehörden sind nach<br />
Anhörung des Jagdbeirats (Art. 50) ehrenamtliche Berater (Jagdberater)<br />
zu bestellen. 2 Die Jagdberater und je ein Stellvertreter werden aus dem<br />
Kreis der Jagdscheininhaber für fünf Jagdjahre widerruflich bestellt. 3 Die<br />
Zahl der Jagdberater soll je Behörde zwei nicht überschreiten. 4 Ihre<br />
Aufgabe und Stellung innerhalb der Jagdbehörde und die<br />
Aufwandsentschädigung werden durch Rechtsverordnung geregelt, die<br />
vom Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten zu erlassen ist. 5 In<br />
der Regel sollen die Jagdberater kein wichtiges Amt in einer Organisation<br />
der im Jagdbeirat vertretenen Interessengruppen bekleiden.<br />
Bay JG Art. 50 Jagdbeirat<br />
(1) Zur Beratung aller Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung sowie<br />
wichtiger Einzelfragen wird bei jeder Jagdbehörde ein Jagdbeirat (§ 37<br />
Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes) gebildet.<br />
(2) Der Jagdbeirat bei der unteren Jagdbehörde besteht aus deren Vertreter<br />
als Vorsitzendem und aus fünf Mitgliedern, nämlich je einem Vertreter der<br />
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Jagdgenossenschaften, der Jäger<br />
und des Natur- und Waldschutzes.<br />
(3) Der Jagdbeirat bei der höheren Jagdbehörde besteht aus deren Vertreter<br />
als Vorsitzendem und aus neun Mitgliedern, nämlich aus zwei der<br />
Jagdgenossenschaften und je einem Vertreter der Landwirtschaft, der<br />
staatlichen und privaten Forstwirtschaft, der Teich- und<br />
Fischereiwirtschaft, der Jäger, des Naturschutzes und Waldschutzes.<br />
(4) 1 Der Jagdbeirat bei der obersten Jagdbehörde besteht aus deren Vertreter<br />
als Vorsitzendem und aus 14 Mitgliedern. 2 Von diesen müssen drei den<br />
Jagdgenossenschaften, je zwei der Landwirtschaft und den Jägern sowie je<br />
ein Mitglied der staatlichen und privaten Forstwirtschaft, den<br />
Berufsjägern, der Fischerei, dem Tierschutz, dem Naturschutz und<br />
Waldschutz angehören.<br />
(5) 1 Zu den Beratungen des Jagdbeirats können vom Vorsitzenden weitere<br />
Sachkundige zugezogen werden. 2 Den Trägern öffentlicher Belange ist auf<br />
Verlangen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.<br />
(6) 1 Die Mitglieder des Jagdbeirats und je ein Stellvertreter werden durch die<br />
Jagdbehörde für fünf Jagdjahre widerruflich bestellt. 2 Sie sind<br />
ehrenamtlich tätig. 3 Sie erhalten auf Antrag Ersatz der ihnen bei der<br />
Ausübung der Beiratstätigkeit entstandenen notwendigen Auslagen. 4 Ein<br />
Verdienstausfall wird nicht ersetzt. 5 Das gleiche gilt für den nach Absatz 5<br />
zugezogenen Sachkundigen. 6 Das Nähere, insbesondere Bestellung,<br />
Aufgaben und Aufwandsentschädigung der Beiräte, regelt das<br />
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten durch Rechtsverordnung<br />
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.<br />
Bay JG Art. 51 Vereinigungen der Jäger<br />
Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung die Mitwirkung von Vereinigungen der Jäger für die Fälle<br />
vorzusehen, in denen Jagdscheininhaber gegen die Grundsätze der<br />
Weidgerechtigkeit verstoßen (§ 1 Abs. 3, § 37 Abs. 2 des
Bundesjagdgesetzes), ferner Voraussetzungen und Verfahren für die<br />
Anerkennung von Vereinigungen der Jäger zu bestimmen und diesen über<br />
Art. 39 Abs. 3 hinaus weitere nichthoheitliche Aufgaben auf dem Gebiet des<br />
Jagdwesens zu übertragen.<br />
Bay JG Art. 52 Sachliche Zuständigkeit<br />
(1) Die oberste Jagdbehörde ist zuständig für<br />
1. die Anerkennung von Fachinstituten nach § 19 Abs. 3 des<br />
Bundesjagdgesetzes,<br />
2. die Genehmigung zum Aussetzen oder Ansiedeln fremder Tierarten<br />
nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1, soweit es sich um Tierarten handelt, die dem<br />
Jagdrecht unterliegen; bei anderen Tierarten im Sinn des Art. 34 Abs. 1<br />
entscheidet das Staatsministerium für Landesentwicklung und<br />
Umweltfragen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft und Forsten,<br />
3. die Bestellung ihres Jagdberaters nach Art. 49 Abs. 3 und ihres<br />
Jagdbeirats nach Art. 50 Abs. 4 und 6.<br />
(2) Die höheren Jagdbehörden sind zuständig für<br />
1. weggefallen<br />
2. die Anerkennung von Wildgehegen als Wildpark nach Art. 24 Abs. 1<br />
Satz 1,<br />
3. die Zulassung von Ausnahmen nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 und für die<br />
Einzelanordnungen nach Art. 31 Abs. 3,<br />
4. die Zulassung von Ausnahmen nach Art. 32 Abs. 6 Satz 1,<br />
5. die Bestellung ihrer Jagdberater nach Art. 49 Abs. 3 und ihrer<br />
Jagdbeiräte nach Art. 50 Abs. 3 und 6.<br />
(3) Die unteren Jagdbehörden sind für die übrigen staatlichen Aufgaben auf<br />
dem Gebiet des Jagdwesens zuständig, soweit nicht ausdrücklich etwas<br />
anderes bestimmt ist.<br />
(4) 1 Die oberste Jagdbehörde kann einzelne der ihr oder den höheren<br />
Jagdbehörden zustehenden Verwaltungsbefugnisse durch<br />
Rechtsverordnung auf nachgeordnete Jagdbehörden übertragen. 2 Die<br />
oberste Jagdbehörde bestimmt durch Rechtsverordnung das für die<br />
Abnahme der Jäger- und Falknerprüfung nach § 15 Abs. 5 Satz 1 und<br />
Abs. 7 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes zuständige Amt für Landwirtschaft<br />
und Forsten.<br />
Bay JG Art. 53 Örtliche Zuständigkeit<br />
Die für die Erteilung von Jagdscheinen zuständige Jagdbehörde nimmt auch die<br />
Eintragungen nach § 11 Abs. 7 des Bundesjagdgesetzes vor.<br />
Bay JG Art. 54 (weggefallen)<br />
Bay JG Art. 55 Vorläufige Anordnung<br />
Die Jagdbehörde kann die Ausübung der Jagd und des Jagdschutzes regeln,<br />
insbesondere durch einen bestätigten Jagdaufseher für Rechnung der<br />
Jagdgenossenschaft, des Jagdberechtigten oder des Revierinhabers vornehmen<br />
lassen und die Jagdausübung durch andere verbieten, wenn und solang<br />
1. für ein Gebiet der verantwortliche Revierinhaber (Art. 7 Abs. 1 Satz 2) nicht
festgestellt werden kann oder eine verantwortliche jagdpachtfähige Person<br />
nicht benannt wird (Art. 7 Abs. 2 und 3, Art. 20),<br />
2. der Revierinhaber durch ein Verbot nach § 41a des Bundesjagdgesetzes<br />
oder Art. 57 gehindert ist, die Jagd auszuüben, oder wenn und solang der<br />
Revierinhaber oder die an seiner Stelle verantwortliche Person der<br />
Verantwortung nach Art. 7 Abs. 1 trotz wiederholter Aufforderung weiterhin<br />
zuwiderhandelt,<br />
3. im Fall des Art. 7 Abs. 4 nach zweimaliger Aufforderung der Jagdbehörde ein<br />
Mitpächter oder eine verantwortliche Person im Sinn von Art. 7 Abs. 2 nicht als<br />
Bevollmächtigter benannt wird und die Mitpächter oder die verantwortlichen<br />
Personen ihren Verpflichtungen gegenüber der Jagdbehörde gemeinsam nicht<br />
nachkommen; mit der Ausübung der Jagd und des Jagdschutzes kann auch ein<br />
Mitpächter oder eine verantwortliche Person beauftragt werden,<br />
4. ein bestätigter Jagdaufseher oder Berufsjäger auf Verlangen der<br />
Jagdbehörde nicht angestellt wird (Art. 41 Abs. 5),<br />
5. nach Beendigung eines Jagdpachtvertrags die Jagd oder der Jagdschutz<br />
nicht ausgeübt wird,<br />
6. während eines Beanstandungsverfahrens der Jagdpächter die Jagd nach<br />
§ 12 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes nicht ausüben darf,<br />
7. über die Rechtsgültigkeit oder Beendigung des Jagdpachtvertrags ein<br />
Rechtsstreit anhängig ist oder trotz befristeter Aufforderung der<br />
Vertragsparteien durch die Jagdbehörde nicht anhängig gemacht wird; die<br />
Aufforderung ist ohne Rücksicht darauf zulässig, ob zwischen den<br />
Vertragsparteien Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit des<br />
Jagdpachtvertrags bestehen.<br />
XI. ABSCHNITT Ahndungsvorschriften<br />
Bay JG Art. 56 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, wer<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 21<br />
Abs. 4 zuwiderhandelt,<br />
- entgegen Art. 22 Abs. 3 Satz 1 die Nester und Gelege des Federwildes<br />
beschädigt, wegnimmt oder zerstört,<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4<br />
Sätze 2 bis 4, Art. 25 Satz 2 Wildgehege oder Wintergatter errichtet,<br />
erweitert oder betreibt,<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig die Jagd mit Fallen ausübt, ohne den<br />
erforderlichen Nachweis der Kenntnisse über die Ausübung der Jagd mit<br />
Fallen zu besitzen,<br />
- entgegen Art. 29 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 2 bis 7 und Art. 29 a Abs. 1<br />
Satz 2, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3<br />
- als Jagdausübender eine zeitgerechte und fachgemäße Nachsuche auf<br />
krankgeschossenes Wild weder selbst durchführt noch veranlaßt,<br />
- die Jagd auf Wild mit Fanggeräten oder Fangvorrichtungen ausübt,<br />
- die Jagd auf sonstiges Haarwild zur Nachtzeit ausübt,
- die Jagd auf Schalenwild, mit Ausnahme von Schwarzwild, als Treibjagd<br />
ausübt,<br />
- das Wild durch Lappen oder sonstige Mittel hindert, aus seinen oder in<br />
seine Tageseinstände zu wechseln,<br />
- die Jagd auf Wild ausübt, das durch Naturkatastrophen in Not geraten<br />
oder zum Verlassen der Einstände gezwungen worden ist,<br />
- die Jagd unter Verwendung von Betäubungs- oder Lähmungsmitteln,<br />
Sprengstoffen, Gasen, elektrischem Strom oder von Schußwaffen mit<br />
Schalldämpfern ausübt oder<br />
- Fangeisen verwendet, deren Betriebssicherheit nicht überprüft ist oder<br />
die nicht dauerhaft gekennzeichnet sind, Fangeisen außerhalb<br />
geschlossener Räume oder Fangbunker oder Fanggärten aufstellt oder<br />
nicht ordnungsgemäß verblendet oder die Verwendung von Schlagfallen<br />
nicht der Jagdbehörde anzeigt,<br />
- entgegen Art. 31 Abs. 2 Satz 1 Schalenwild in Wintergattern erlegt,<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 32 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 oder<br />
5<br />
- den Abschußplan für Schalenwild nicht ordnungsgemäß erfüllt,<br />
- die schriftliche Abschußmeldung oder die Streckenliste nicht<br />
ordnungsgemäß erstattet oder führt oder diese der Jagdbehörde auf<br />
Verlangen nicht vorzeigt oder<br />
- der Jagdbehörde den Abschuß von krankem Wild über den Abschußplan<br />
hinaus oder während der Schonzeit nicht unverzüglich mitteilt oder ihr<br />
oder einem von ihr Beauftragten das erlegte Wild auf Verlangen nicht<br />
vorzeigt,<br />
- weggefallen<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 37 Abs. 1, 2 oder 3<br />
- es unterläßt, das Überwechseln von krankgeschossenem Wild dem<br />
Inhaber des Nachbarreviers oder dessen Vertreter unverzüglich<br />
anzuzeigen oder<br />
- beim Überschreiten der Grenze geladene Langwaffen mit sich führt,<br />
Wild fortschafft, das Erlegen nicht unverzüglich anzeigt oder Wild dem<br />
Inhaber des Nachbarreviers nicht abliefert,<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 39 Abs. 1 bei der Such-,<br />
Drück-, Riegel- oder Treibjagd oder bei der Jagd auf Wasserwild sowie<br />
bei der Nachsuche auf krankgeschossenes Wild brauchbare Jagdhunde<br />
nicht verwendet,<br />
- weggefallen<br />
- ohne Begleitung oder schriftliche Erlaubnis des Revierinhabers<br />
aufsichtslosen Hunden oder Katzen mit der Schußwaffe nachstellt oder<br />
solche erlegt,<br />
- weggefallen<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 43 Abs. 3 Satz 1 seiner<br />
Verpflichtung, in der Notzeit für angemessene Wildfütterung zu sorgen
und die dazu erforderlichen Fütterungsanlagen zu unterhalten, nicht<br />
nachkommt,<br />
- einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 55 über die Ausübung der<br />
Jagd und des Jagdschutzes zuwiderhandelt,<br />
- vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften einer auf Grund der Art. 21,<br />
22a, 23 Abs. 7, Art. 29 Abs. 5 Satz 1, Art. 29 a Abs. 4 Satz 1, Art. 31<br />
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, Art. 32 Abs. 7, Art. 33 Abs. 1 Nr. 4, Art. 34<br />
Abs. 3, Art. 43 Abs. 2 Satz 2, Art. 47 Nr. 3 und Art. 48 erlassenen<br />
Rechtsverordnung, die für einen bestimmten Tatbestand auf diese<br />
Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt,<br />
- weggefallen<br />
(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. weggefallen<br />
2. entgegen Art. 16 Abs. 3, auch in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 Satz 1,<br />
der Jagdbehörde beim Erwerb des Jagdscheins unrichtige Angaben macht,<br />
3. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 17 Abs. 3 als Jagdgast ohne<br />
Begleitung eines Revierinhabers, eines angestellten Jägers oder<br />
Jagdaufsehers die Jagd ausübt, ohne den Erlaubnisschein bei sich zu<br />
führen, oder diesen dem Jagdschutzberechtigten auf Verlangen nicht zur<br />
Prüfung aushändigt,<br />
4. weggefallen<br />
5. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 32 Abs. 4 Satz 2 über den<br />
körperlichen Nachweis der Erfüllung des Abschußplans zuwiderhandelt,<br />
6. entgegen Art. 35 Abs. 2 bei der Benutzung eines Jägernotwegs<br />
geladene Langwaffen oder nichtangeleinte Hunde mitführt,<br />
7. trotz Aufforderung des Berechtigten Jagdeinrichtungen nicht verläßt,<br />
8. trotz Abmahnung durch den Berechtigten die Jagdausübung dadurch<br />
vereitelt, daß er, ohne die Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft<br />
auszuüben, das Wild vergrämt,<br />
9. Hunde in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen läßt,<br />
10. entgegen Art. 41 Abs. 6 Satz 1 als Revierinhaber oder bestätigter<br />
Jagdaufseher bei Ausübung des Jagdschutzes auf Verlangen des<br />
Betroffenen sich nicht ausweist,<br />
11. entgegen Art. 42 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3, auch in Verbindung mit<br />
Art. 43 Abs. 3 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes, der<br />
Aufforderung eines für das Jagdrevier zuständigen<br />
Jagdschutzberechtigten, Angaben über die Person zu machen, nicht oder<br />
nicht richtig nachkommt, soweit die Tat nicht nach § 111 des <strong>Gesetze</strong>s<br />
über Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße bedroht ist,<br />
12.<br />
a) vorsätzlich oder fahrlässig an Orten, an denen ihm die Ausübung des<br />
Jagdrechts nicht zusteht, Besitz an lebendem oder verendetem Wild oder<br />
an Fallwild und Abwurfstangen sowie Eiern des dem Jagdrecht<br />
unterliegenden Federwildes erlangt und diese Gegenstände nicht binnen<br />
drei Tagen entweder dem Revierinhaber (Art. 7 Abs. 1) oder der<br />
nächsterreichbaren Polizeidienststelle abliefert oder den Sachverhalt<br />
anzeigt,<br />
b) als Führer eines Fahrzeugs Schalenwild (§ 2 Abs. 3 des<br />
Bundesjagdgesetzes) durch An- oder Überfahren verletzt oder tötet und
dies nicht unverzüglich einer der in Buchstabe a genannten Stellen<br />
anzeigt.<br />
Bay JG Art. 57 Verbot der Jagdausübung<br />
(1) Wird gegen jemanden wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Art. 56, die<br />
er unter grober oder beharrlicher Verletzung der Pflichten bei der<br />
Jagdausübung begangen hat, eine Geldbuße festgesetzt, so kann ihm in<br />
der Entscheidung für die Dauer von einem Monat bis zu sechs Monaten<br />
verboten werden, die Jagd auszuüben.<br />
(2) 1 Das Verbot der Jagdausübung wird mit der Rechtskraft der Entscheidung<br />
wirksam. 2 Für seine Dauer wird ein erteilter Jagdschein amtlich verwahrt.<br />
3<br />
Wird er nicht freiwillig herausgegeben, so ist er zu beschlagnahmen.<br />
(3) 1 Ist ein Jagdschein amtlich zu verwahren, so wird die Verbotsfrist erst von<br />
dem Tag an gerechnet, an dem dies geschieht. 2 In die Verbotsfrist wird<br />
die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche<br />
Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird.<br />
(4) Über den Beginn der Verbotsfrist nach Absatz 3 Satz 1 ist der Täter im<br />
Anschluß an die Verkündung der Entscheidung oder bei deren Zustellung<br />
zu belehren.<br />
Bay JG Art. 58 Einziehung<br />
1 Die durch eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 56 gewonnenen oder erlangten<br />
oder die zu ihrer Begehung gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstände<br />
einschließlich der bei der Ordnungswidrigkeit verwendeten Verpackungs- und<br />
Beförderungsmittel können eingezogen werden. 2 Es können auch Gegenstände<br />
eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht. 3 § 23 des<br />
<strong>Gesetze</strong>s über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.<br />
XII. ABSCHNITT Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay JG Art. 59 Enteignende Maßnahmen<br />
(1) Hat eine Behörde auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s eine Maßnahme getroffen,<br />
die eine Enteignung darstellt oder einer solchen gleichkommt,<br />
insbesondere weil sie eine wesentliche Nutzungsbeschränkung darstellt, so<br />
ist dem Eigentümer oder dem sonstigen Berechtigten nach den<br />
Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige<br />
Enteignung Entschädigung in Geld zu leisten.<br />
(2) 1 Der Grundstückseigentümer kann verlangen, daß der<br />
Entschädigungspflichtige das Grundstück übernimmt, soweit es ihm<br />
infolge der enteignenden Maßnahme wirtschaftlich nicht mehr zumutbar<br />
ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder in einer<br />
anderen zulässigen Art zu nutzen. 2 Kommt eine Einigung über die<br />
Übernahme des Grundstücks nicht zustande, kann der Eigentümer das<br />
Enteignungsverfahren beantragen; im übrigen gelten die Vorschriften des<br />
Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige Enteignung<br />
sinngemäß.
Bay JG Art. 60 Überleitungsvorschrift<br />
(1) Ein vor dem Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s rechtswirksam geschlossener<br />
oder verlängerter Jagdpachtvertrag bleibt bis zum Ablauf der<br />
Vertragsdauer gültig, wenn er den im Zeitpunkt seines Abschlusses oder<br />
seiner Verlängerung geltenden Vorschriften entsprochen hat.<br />
(2) In Fällen, in denen vor Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s Personen als<br />
Jagdaufseher bestätigt wurden, die nicht Inhaber eines gültigen<br />
Jahresjagdscheins waren, findet ein Widerruf der Bestätigung nach Art. 41<br />
Abs. 2 Satz 3 aus diesem Grund nicht statt.<br />
Bay JG Art. 61 Ausführungsvorschriften<br />
Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten erläßt im Einvernehmen<br />
mit den beteiligten Staatsministerien die zum Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
erforderlichen Ausführungsvorschriften und die Rechtsverordnungen, die das<br />
Bundesjagdgesetz und seine Ausführungsvorschriften den Ländern<br />
vorbehalten.<br />
Bay JG Art. 62 Verweisungen auf aufgehobene Vorschriften<br />
Soweit in anderen <strong>Gesetze</strong>n und Verordnungen auf durch dieses Gesetz<br />
aufgehobene Vorschriften verwiesen wird, treten die entsprechenden<br />
Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s an ihre Stelle.<br />
Bay JG Art. 63 (Änderungsbestimmung)<br />
Bay JG Art. 64 Inkrafttreten; Aufhebung von Vorschriften<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1979 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Oktober 1978 (GVBl S. 678).<br />
(2) gegenstandslos<br />
(3) Das Gesetz über das Verfahren in Wild- und Jagdschadenssachen vom<br />
12. August 1953 (BayBS IV S. 575) tritt mit Inkrafttreten der<br />
Rechtsverordnung nach Art. 47 Nr. 3 außer Kraft.<br />
(4) Die zum bisherigen Bayerischen Jagdgesetz erlassenen<br />
Ausführungsvorschriften und Rechtsverordnungen bleiben, soweit sie nicht<br />
im Widerspruch zu den Vorschriften des Bundesjagdgesetzes und dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s stehen, bis zum Erlaß neuer entsprechender Vorschriften in<br />
Kraft.
Kommunalabgabengesetz (Bay KAG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 24. Dezember 1993 (GVBl. S. 1063), vom 8. Juli 1994 (GVBl. S. 553), vom 26. April 1996<br />
(GVBl. S. 152), vom 27. Dezember 1996 (GVBl. S. 541), vom 9. Juni 1998 (GVBl. S. 293), vom 24.<br />
Juli 1998 (GVBl. S. 424), vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 25. Juli 2002 (GVBl. S. 322), vom<br />
26. Juli 2004 (GVBl. S. 272), vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 460, ber. S. 580) (FN BayRS 2024-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
I. ABSCHNITT Abgaben nach diesem Gesetz<br />
Art. 1 Abgabenberechtigte<br />
Art. 2 Abgabesatzung<br />
Art. 3 Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern<br />
Art. 4<br />
Art. 5 Beiträge<br />
Art. 5 a Erschließungsbeitrag<br />
Art. 6 Fremdenverkehrsbeitrag<br />
Art. 7 Kurbeitrag<br />
Art. 8 Benutzungsgebühren<br />
Art. 9 Erstattung von Kosten für Grundstücksanschlüsse<br />
II. ABSCHNITT Allgemeine Vorschriften für Kommunalabgaben<br />
Art. 10 Geltungsbereich<br />
Art. 11 Verpflichtung Dritter<br />
Art. 12 Abgabebescheide<br />
Art. 13 Anwendung von Vorschriften der Abgabenordnung (AO 1977)<br />
Art. 14 Abgabehinterziehung<br />
Art. 15 Leichtfertige Abgabeverkürzung<br />
Art. 16 Abgabegefährdung
Art. 17 Geldbußen<br />
III. ABSCHNITT Verwaltung der kommunalen Steuern<br />
Art. 18 Zuständigkeit<br />
IV. ABSCHNITT Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 19 Übergangsvorschriften<br />
Art. 20 Einschränkung von Grundrechten<br />
Art. 21 Ausführungsvorschriften<br />
Art. 22 Inkrafttreten<br />
I. ABSCHNITT Abgaben nach diesem Gesetz<br />
Bay KAG Art. 1 Abgabenberechtigte<br />
Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sind berechtigt, nach diesem Gesetz<br />
Abgaben zu erheben, soweit nicht Bundesrecht oder <strong>Landesrecht</strong> etwas<br />
anderes bestimmen.<br />
Bay KAG Art. 2 Abgabesatzung<br />
Art. 2 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes gilt nicht für diejenige Satzung, mit der erstmalig in<br />
Bayern die Zweitwohnungssteuer eingeführt wird; vgl. § 11 Abs. 1 des G vom 26. Juli 2004 (GVBl.<br />
S. 272).<br />
(1) 1 Die Abgaben werden auf Grund einer besonderen Abgabesatzung<br />
erhoben. 2 Die Satzung muß die Schuldner, den die Abgabe begründenden<br />
Tatbestand, den Maßstab, den Satz der Abgabe sowie die Entstehung und<br />
die Fälligkeit der Abgabeschuld bestimmen.<br />
(2) Das Staatsministerium des Innern kann Mustersatzungen erlassen, die im<br />
Allgemeinen Ministerialblatt veröffentlicht werden.<br />
(3) 1 Satzungen nach Art. 3 bedürfen der Genehmigung durch die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde, wenn durch die Satzung erstmalig eine in Bayern<br />
bisher nicht erhobene kommunale Steuer eingeführt wird. 2 Die<br />
Genehmigung bedarf der Zustimmung des Staatsministeriums des Innern.<br />
3<br />
Genehmigung und Zustimmung dürfen nur versagt werden, wenn die<br />
Satzung höherrangigem Recht widerspricht oder wenn die Steuer<br />
öffentliche Belange, insbesondere volkswirtschaftliche oder steuerliche<br />
Interessen des Staates, beeinträchtigt.<br />
Bay KAG Art. 3 Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern<br />
(1) Die Gemeinden können örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern erheben,<br />
solange und soweit diese nicht bundesrechtlich geregelten Steuern<br />
gleichartig sind.
(2) 1 Die Landkreise können örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, die<br />
bundesrechtlich geregelten Steuern nicht gleichartig sind, dort erheben,<br />
wo die kreisangehörige Gemeinde diese Steuern nicht selbst erhebt. 2 Die<br />
kreisangehörigen Gemeinden dürfen Steuern, die der Landkreis erhebt,<br />
nur vom Beginn eines Jahres an selbst erheben.<br />
(3) 1 Eine Getränkesteuer, eine Jagdsteuer, eine Speiseeissteuer und eine<br />
Vergnügungssteuer dürfen nicht erhoben werden. 2 Eine Steuer auf das<br />
Innehaben einer Wohnung wird nicht erhoben, wenn die Summe der<br />
positiven Einkünfte des Steuerpflichtigen nach § 2 Abs. 1, 2 und 5 a des<br />
Einkommensteuergesetzes (EStG) im vorletzten Jahr vor Entstehen der<br />
Steuerpflicht 25 000 € nicht überschritten hat. 3 Bei nicht dauernd<br />
getrennt lebenden Ehegatten und Lebenspartnern beträgt die Summe der<br />
positiven Einkünfte 33 000 €. 4 Bezieht der Steuerpflichtige Leistungen<br />
nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a oder Nr. 5 Satz 2 Buchst. a EStG, ist den<br />
positiven Einkünften der nicht steuerpflichtige Anteil der Leistungen<br />
hinzuzurechnen. 5 Ist die Summe der positiven Einkünfte im Steuerjahr<br />
voraussichtlich niedriger, so ist von den Einkommensverhältnissen dieses<br />
Jahres auszugehen. 6 Die Steuer wird nicht höher festgesetzt als ein Drittel<br />
des Betrags, um den die Summe der positiven Einkünfte 25 000 € bzw.<br />
33 000 € übersteigt. 7 Entscheidungen nach den Sätzen 2 bis 6 setzen<br />
einen Antrag voraus, der bis zum Ende des Kalendermonats, der auf das<br />
Steuerjahr folgt, gestellt sein muss. 8 Sie stehen in den Fällen des<br />
Satzes 5 unter dem Vorbehalt der Nachforderung.<br />
(4) 1 Vereinbarungen mit einem Steuerschuldner über die Abrechnung,<br />
Fälligkeit, Erhebung und Pauschalierung örtlicher Verbrauch- und<br />
Aufwandsteuern sind zulässig, soweit sie die Besteuerung vereinfachen<br />
und das steuerliche Ergebnis im Einzelfall voraussichtlich nicht wesentlich<br />
verändern. 2 Die Vereinbarungen sind jederzeit widerruflich.<br />
Bay KAG Art. 4 (weggefallen)<br />
Bay KAG Art. 5 Beiträge<br />
(1) 1 Die Gemeinden und Landkreise können zur Deckung des Aufwands für<br />
die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung ihrer<br />
öffentlichen Einrichtungen (Investitionsaufwand) Beiträge von den<br />
Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten erheben, denen die<br />
Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtungen besondere Vorteile<br />
bietet. 2 Der Investitionsaufwand umfaßt auch den Wert der von der<br />
Gebietskörperschaft aus ihrem Vermögen bereitgestellten Sachen und<br />
Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung. 3 Für die Verbesserung oder<br />
Erneuerung von Ortsstraßen und beschränkt-öffentlichen Wegen sollen<br />
solche Beiträge erhoben werden, soweit nicht Erschließungsbeiträge nach<br />
dem Baugesetzbuch (BauGB) zu erheben sind. 4 Bei der Ermittlung von<br />
Beiträgen für die Herstellung und Anschaffung leitungsgebundener<br />
Einrichtungen kann der durchschnittliche Investitionsaufwand für die<br />
gesamte Einrichtung veranschlagt und zugrunde gelegt werden. 5 Bei<br />
leitungsgebundenen Einrichtungen kann der Aufwand, unbeschadet der<br />
Art. 21 Abs. 2 der Gemeindeordnung, Art. 15 Abs. 2 der Landkreisordnung<br />
und Art. 15 Abs. 2 der Bezirksordnung nicht für bestimmte Abschnitte der<br />
Einrichtung ermittelt werden; bei nicht leitungsgebundenen Einrichtungen
kann der Aufwand für mehrere Einrichtungen, die für die Erschließung der<br />
Grundstücke eine Einheit bilden, insgesamt ermittelt werden. 6 Der Beitrag<br />
kann für den Grunderwerb, die Freilegung und für Teile der<br />
nichtleitungsgebundenen Einrichtung selbständig erhoben werden<br />
(Kostenspaltung).<br />
(2) 1 Sind die Vorteile der Beitragspflichtigen verschieden hoch, so sind die<br />
Beiträge entsprechend abzustufen. 2 Beitragsmaßstäbe sind insbesondere<br />
1. die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung,<br />
2. die Grundstücksflächen,<br />
sowie Kombinationen hieraus. 3 In der Beitragssatzung kann bestimmt<br />
werden, daß Grundstücke bis zu ihrer Bebauung oder gewerblichen<br />
Nutzung nur mit dem auf die Grundstücksfläche entfallenden Beitrag<br />
herangezogen werden. 4 In der Beitragssatzung für leitungsgebundene<br />
Einrichtungen soll bestimmt werden, daß Gebäude oder selbständige<br />
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluß<br />
an die gemeindliche Einrichtung auslösen oder nicht angeschlossen<br />
werden dürfen, nicht zum Beitrag herangezogen werden; das gilt nicht für<br />
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich angeschlossen sind. 5 Stellt<br />
der Beitragsmaßstab von Beitragssatzungen für leitungsgebundene<br />
Einrichtungen nicht auf die vorhandene Bebauung ab, soll bestimmt<br />
werden, dass der auf solche Gebäude oder Gebäudeteile entfallende<br />
Beitragsteil als Abzugsposten Berücksichtigung findet. 6 Für übergroße<br />
Grundstücke in unbeplanten Gebieten ist in der Beitragssatzung für<br />
leitungsgebundene Einrichtungen eine Begrenzung der beitragspflichtigen<br />
Grundstücksfläche vorzunehmen.<br />
(2 a) Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände<br />
nachträglich und erhöht sich dadurch der Vorteil, so entsteht damit ein<br />
zusätzlicher Beitrag.<br />
(3) 1 Kommt die Einrichtung neben den Beitragspflichtigen nicht nur<br />
unbedeutend auch der Allgemeinheit zugute, so ist in der Abgabesatzung<br />
(Art. 2) eine Eigenbeteiligung vorzusehen. 2 Die Eigenbeteiligung muß die<br />
Vorteile für die Allgemeinheit angemessen berücksichtigen. 3 Satzungen<br />
nach Art. 5 Abs. 1 Satz 3 haben eine vorteilsgerecht abgestufte<br />
Eigenbeteiligung einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet vorzusehen.<br />
4 5<br />
Ergänzender Einzelsatzungen bedarf es nicht. Die Festlegung eines<br />
Beitragssatzes ist dabei weder für das gesamte Gemeindegebiet noch für<br />
einzelne Straßen erforderlich.<br />
(4) Steht im Zeitpunkt des Satzungserlasses der Aufwand nach Absatz 1 noch<br />
nicht fest, so kann in Abweichung von Art. 2 Abs. 1 davon abgesehen<br />
werden, den Abgabesatz festzulegen; es müssen aber die wesentlichen<br />
Bestandteile der einzelnen Einrichtung in der Satzung nach Art und<br />
Umfang bezeichnet und der umzulegende Teil der Gesamtkosten bestimmt<br />
sein.<br />
(5) 1 Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in<br />
vollem Umfang entstanden ist, können Vorauszahlungen auf den Beitrag<br />
verlangt werden, wenn mit der Herstellung der Einrichtung begonnen<br />
worden ist. 2 Die Vorauszahlung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu<br />
verrechnen, auch wenn der Vorauszahlende nicht beitragspflichtig ist. 3 Ist<br />
die Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlaß des Vorauszahlungsbescheids
noch nicht entstanden, kann die Vorauszahlung zurückverlangt werden,<br />
wenn die Einrichtung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist.<br />
4<br />
Die Rückzahlungsschuld ist ab Erhebung der Vorauszahlung für jeden<br />
vollen Monat mit einhalb vom Hundert zu verzinsen. 5 Ist eine<br />
Beitragspflicht bereits entstanden, können Vorschüsse auf den Beitrag<br />
erhoben werden, sofern die endgültige Beitragsschuld noch nicht<br />
berechnet werden kann.<br />
(6) 1 Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld<br />
Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 2 Mehrere<br />
Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum<br />
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem<br />
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.<br />
(7) 1 Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück oder dem<br />
Erbbaurecht, im Fall des Absatzes 6 Satz 2 auf dem Wohnungs- oder dem<br />
Teileigentum; die öffentliche Last erlischt nicht, solange die persönliche<br />
Schuld besteht. 2 Der Duldungsbescheid, mit dem die öffentliche Last<br />
geltend gemacht wird, ist wie ein Leistungsbescheid zu vollstrecken.<br />
(8) Ein Beitrag kann auch für öffentliche Einrichtungen erhoben werden, die<br />
vor Inkrafttreten der Abgabesatzung hergestellt, angeschafft, erweitert<br />
oder verbessert wurden.<br />
(9) 1 Der Beitragsberechtigte kann die Ablösung des Beitrags vor Entstehung<br />
der Beitragspflicht gegen eine angemessene Gegenleistung zulassen. 2 Das<br />
Nähere ist in der Beitragssatzung (Art. 2) zu bestimmen. 3 Die vertragliche<br />
Übernahme beitragsfähiger Aufwendungen ist auch im Rahmen<br />
städtebaulicher Verträge möglich; § 11 BauGB gilt entsprechend.<br />
Bay KAG Art. 5 a Erschließungsbeitrag<br />
(1) In Bayern werden Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch<br />
(BauGB) mit der Maßgabe erhoben, daß Grünanlagen zur Erschließung der<br />
Baugebiete im Sinn des § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht notwendig sind,<br />
1. wenn sie über die unmittelbare Bedeutung und den unmittelbaren<br />
Nutzen für das Baugebiet hinausgehen, in dem sie ausgewiesen werden<br />
sollen; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Grünflächen wegen der<br />
Schaffung stadt- bzw. ortsteilübergreifender Grünzüge oder der<br />
Vernetzung vorhandener Grün- und Freizeitflächen sowohl von ihrer Größe<br />
als auch von ihrem Ausbau her baugebietsübergreifende Bedeutung<br />
haben,<br />
2. wenn sie in einer ausreichenden Größe vorhanden sind und in ihrer<br />
bisherigen Beschaffenheit den Ansprüchen der anwohnenden Bevölkerung<br />
genügt haben, oder<br />
3. wenn wegen des vorhandenen innerörtlichen Grüns ein städtebauliches<br />
Bedürfnis nach weiterer Begrünung nicht zu erkennen ist.<br />
(2) Die vertragliche Übernahme erschließungsbeitragsfähiger Aufwendungen<br />
ist auch im Rahmen städtebaulicher Verträge möglich; § 11 BauGB gilt<br />
entsprechend.
Bay KAG Art. 6 Fremdenverkehrsbeitrag<br />
(1) Gemeinden, in denen die Zahl der Fremdenübernachtungen im Jahr in der<br />
Regel das Siebenfache der Einwohnerzahl übersteigt, können zur Deckung<br />
des gemeindlichen Aufwands für die Fremdenverkehrsförderung von den<br />
selbständig tätigen, natürlichen und den juristischen Personen, den<br />
offenen Handelsgesellschaften und den Kommanditgesellschaften, denen<br />
durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar oder mittelbar<br />
wirtschaftliche Vorteile erwachsen, einen Fremdenverkehrsbeitrag<br />
erheben.<br />
(2) Die Abgabe bemißt sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen,<br />
die dem einzelnen Abgabepflichtigen aus dem Fremdenverkehr erwachsen.<br />
(3) Die Gemeinden können auf die Beitragsschuld eines Kalenderjahres<br />
bereits während dieses Jahres Vorauszahlungen verlangen.<br />
(4) Art. 3 Abs. 4 gilt entsprechend.<br />
Bay KAG Art. 7 Kurbeitrag<br />
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Heilbad, Kneippheilbad,<br />
Kneippkurort, Schrothheilbad, Schrothkurort, heilklimatischer Kurort,<br />
Luftkurort oder Erholungsort anerkannt sind, können im Rahmen der<br />
Anerkennung zur Deckung ihres Aufwands für ihre Einrichtungen und<br />
Veranstaltungen, die Kur- oder Erholungszwecken dienen, einen Beitrag<br />
erheben.<br />
(2) 1 Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem nach Absatz 1<br />
anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erholungszwecken aufhalten, ohne dort<br />
ihre Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben, und denen die<br />
Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den<br />
Veranstaltungen geboten ist. 2 Sind die Vorteile, die den<br />
Beitragspflichtigen aus den Einrichtungen und Veranstaltungen erwachsen<br />
können, verschieden groß, so ist das durch entsprechende Abstufung der<br />
Beitragshöhe zu berücksichtigen. 3 Die Beitragssatzung kann aus wichtigen<br />
Gründen vollständige oder teilweise Befreiung von der Beitragspflicht<br />
vorsehen. 4 In der Beitragssatzung können die in Satz 1 bezeichneten<br />
Personen verpflichtet werden, der Gemeinde unverzüglich die für die<br />
Feststellung der Beitragspflicht notwendigen Angaben zu machen; Inhaber<br />
von Zweitwohnungen können verpflichtet werden, über die Benutzung der<br />
Zweitwohnung der Gemeinde Auskunft zu geben. 5 Die Gemeinden können<br />
für Inhaber von Zweitwohnungen in der Abgabesatzung eine pauschale<br />
Abgeltung des Kurbeitrags vorschreiben, die sich an der durchschnittlichen<br />
Aufenthaltsdauer der Zweitwohnungsinhaber in der Gemeinde zu<br />
orientieren hat. 6 Die Pauschalierung entfällt, wenn der<br />
Zweitwohnungsinhaber nachweist, daß er sich im Veranlagungszeitraum<br />
nicht in der Gemeinde aufgehalten hat.<br />
(3) Art. 3 Abs. 4 gilt entsprechend.<br />
(4) 1 Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum überläßt, kann in der<br />
Satzung verpflichtet werden, diese Personen der Gemeinde zu melden,<br />
ferner den Beitrag einzuheben und an die Gemeinde abzuführen.<br />
2<br />
Dieselben Verpflichtungen können den Inhabern von Campingplätzen<br />
auferlegt werden. 3 Die Satzung kann bestimmen, daß die in den Sätzen 1
und 2 Genannten neben den Beitragspflichtigen als Gesamtschuldner<br />
haften. 4 Die Sätze 1 und 3 gelten auch für die Inhaber von Kuranstalten,<br />
soweit der Kurbeitrag von Personen erhoben wird, welche die Kuranstalten<br />
benutzen, ohne in der Gemeinde zu übernachten. 5 Ist der Kurbeitrag im<br />
Preis für eine Gesellschaftsreise enthalten, so kann die Satzung die<br />
Reiseunternehmer verpflichten, den Beitrag an die Gemeinde abzuführen;<br />
Satz 3 gilt entsprechend.<br />
(5) 1 Zuständig für die Anerkennung nach Absatz 1 ist das Staatsministerium<br />
des Innern im Einvernehmen mit den Staatsministerien für Wirtschaft,<br />
Infrastruktur, Verkehr und Technologie und für Umwelt, Gesundheit und<br />
Verbraucherschutz. 2 Die Anerkennung kann erteilt werden, wenn<br />
natürliche und sonstige Gegebenheiten sowie zweckentsprechende<br />
Einrichtungen, die der Erholung, der Heilung und Linderung von<br />
Krankheiten, ihrer Nachbehandlung oder ihrer Vorbeugung dienen,<br />
vorhanden sind. 3 Die Anerkennung kann aufgehoben werden. 4 Vor der<br />
Entscheidung über die Anerkennung oder deren Aufhebung ist der<br />
Bayerische Fachausschuß für Kurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen<br />
gutachtlich zu hören. 5 Das Staatsministerium des Innern trifft im<br />
Einvernehmen mit den Staatsministerien für Wirtschaft, Infrastruktur,<br />
Verkehr und Technologie und für Umwelt, Gesundheit und<br />
Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die<br />
näheren Voraussetzungen für die Anerkennung, die Aufhebung der<br />
Anerkennung und das Verfahren, über die Verwendung der gemäß<br />
Absatz 1 verliehenen Prädikate und über den Bayerischen Fachausschuß<br />
für Kurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen, insbesondere dessen Bildung<br />
und Zusammensetzung.<br />
Bay KAG Art. 8 Benutzungsgebühren<br />
(1) 1 Gemeinden, Landkreise und Bezirke können für die Benutzung ihrer<br />
öffentlichen Einrichtungen und ihres Eigentums Benutzungsgebühren<br />
erheben. 2 Benutzungsgebühren sollen erhoben werden, wenn und soweit<br />
eine Einrichtung überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder<br />
Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert<br />
wird. 3 Das Nehmen eines Anschlusses ist keine Benutzung im Sinn dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s.<br />
(2) 1 Das Gebührenaufkommen soll die nach betriebswirtschaftlichen<br />
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Kosten für die<br />
Ermittlung und Anforderung von einrichtungsbezogenen Abgaben decken.<br />
2<br />
Sind die Schuldner zur Benutzung verpflichtet, so soll das Aufkommen<br />
die Kosten nach Satz 1 nicht übersteigen. 3 Zur Deckung der<br />
verbrauchsunabhängigen Kosten (Vorhaltekosten) kann eine Grundgebühr<br />
erhoben werden, die – unter besonderer Beachtung des Absatzes 5 – so<br />
zu bemessen ist, daß neben ihr in der Mehrzahl der Fälle noch eine<br />
angemessene Abrechnung nach der tatsächlichen Benutzung stattfindet;<br />
die Erhebung einer Mindestgebühr ist bei der Wasserversorgung und der<br />
Abwasserbeseitigung unzulässig.<br />
(3) 1 Zu den Kosten im Sinn des Absatzes 2 Satz 1 gehören insbesondere<br />
angemessene Abschreibungen von den Anschaffungs- und<br />
Herstellungskosten und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals.
2<br />
Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der durch Beiträge und<br />
ähnliche Entgelte sowie der aus Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil<br />
außer Betracht; das gilt für Zuwendungen nur insoweit, als es Zweck der<br />
Zuwendung ist, die Gebührenschuldner zu entlasten. 3 Den<br />
Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde<br />
zu legen, gekürzt um Beiträge und ähnliche Entgelte. 4 Auf<br />
Zuwendungsfinanzierte Anschaffungs- und Herstellungskosten kann<br />
abgeschrieben werden. 5 Hierauf entfallende Abschreibungserlöse<br />
einschließlich einer angemessenen Verzinsung sind der Einrichtung wieder<br />
zuzuführen; künftige Anschaffungs- und Herstellungskosten sind um<br />
diesen Betrag zu kürzen.<br />
(4) Die Gebühren sind nach dem Ausmaß zu bemessen, in dem die<br />
Gebührenschuldner die öffentliche Einrichtung oder das kommunale<br />
Eigentum benutzen; sonstige Merkmale können zusätzlich berücksichtigt<br />
werden, wenn öffentliche Belange das rechtfertigen.<br />
(5) 1 Die Gebührenbemessung bei der Wasserversorgung und der<br />
Abwasserbeseitigung hat dem schonenden und sparsamen Umgang mit<br />
Wasser zu dienen. 2 Sie erfolgt grundsätzlich linear. 3 Wassergebühren und<br />
Abwassergebühren können für gewerbliche Betriebe degressiv bemessen<br />
werden, wenn der Betrieb Sparvorkehrungen trifft. 4 Eine degressive<br />
Gebührenbemessung ist bei der Abwasserbeseitigung außerdem insoweit<br />
zulässig, als sie der Vermeidung einer unangemessenen<br />
Gebührenbelastung für die Niederschlagswasserbeseitigung dient.<br />
(6) 1 Bei der Gebührenbemessung können die Kosten für einen mehrjährigen<br />
Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens vier Jahre<br />
umfassen soll. 2 Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des<br />
Bemessungszeitraums ergeben, sind innerhalb des folgenden<br />
Bemessungszeitraums auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in<br />
diesem Zeitraum ausgeglichen werden.<br />
(7) Auf die Gebührenschuld aus einem Dauerbenutzungsverhältnis können<br />
vom Beginn des Erhebungszeitraums an angemessene Vorauszahlungen<br />
verlangt werden.<br />
Bay KAG Art. 9 Erstattung von Kosten für Grundstücksanschlüsse<br />
(1) Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke können bestimmen, daß ihnen der<br />
Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung,<br />
Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung des Teils eines<br />
Grundstücksanschlusses an Versorgungs- und<br />
Entwässerungseinrichtungen, der sich nicht im öffentlichen Straßengrund<br />
befindet, in der tatsächlichen Höhe oder nach Einheitssätzen (§ 130<br />
BauGB) erstattet wird.<br />
(2) 1 Zahlungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des<br />
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder<br />
Erbbauberechtigter ist. 2 Mehrere Zahlungspflichtige sind<br />
Gesamtschuldner.<br />
(3) Die Art der Ermittlung des Aufwands sowie die Höhe des Einheitssatzes<br />
sind in der Satzung festzulegen.
(4) 1 Der Abgabeberechtigte kann die Ablösung des Erstattungsanspruchs vor<br />
dessen Entstehung gegen eine angemessene Gegenleistung zulassen.<br />
2 3<br />
Das Nähere ist in der Abgabesatzung (Art. 2) zu bestimmen. Die<br />
vertragliche Übernahme erstattungsfähiger Aufwendungen ist auch im<br />
Rahmen städtebaulicher Verträge möglich; § 11 BauGB gilt entsprechend.<br />
(5) 1 Ortsrechtliche Regelungen auf Grund eines Anschluss- und<br />
Benutzungszwangs, wonach die Bewirtschaftung des<br />
Grundstücksanschlusses einschließlich der in Absatz 1 genannten<br />
Maßnahmen auch im öffentlichen Straßengrund vom Anlieger in eigener<br />
Regie und auf eigene Kosten vorzunehmen ist, werden durch dieses<br />
Gesetz nicht beschränkt.<br />
II. ABSCHNITT Allgemeine Vorschriften für Kommunalabgaben<br />
Bay KAG Art. 10 Geltungsbereich<br />
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten<br />
1. für Abgaben nach dem I. Abschnitt dieses <strong>Gesetze</strong>s,<br />
2. für Abgaben und Umlagen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke, die auf<br />
Grund anderer <strong>Gesetze</strong> erhoben werden, soweit gesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist.<br />
Bay KAG Art. 11 Verpflichtung Dritter<br />
Die Steuersatzung kann Dritte, die zwar nicht Steuerschuldner sind, aber in<br />
engen rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen zum Steuergegenstand<br />
oder zu einem Sachverhalt stehen, an den die Steuerpflicht oder der<br />
Steuergegenstand anknüpft, verpflichten, die Steuer einzuheben, abzuführen<br />
und Nachweise darüber zu führen, und ferner bestimmen, daß sie für die<br />
Steuer neben dem Steuerschuldner haften.<br />
Bay KAG Art. 12 Abgabebescheide<br />
(1) 1 Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke können in Bescheiden über<br />
Abgaben, die für einen Zeitabschnitt erhoben werden, bestimmen, daß<br />
diese Bescheide auch für die folgenden Zeitabschnitte gelten. 2 Dabei ist<br />
anzugeben, an welchen Tagen und mit welchen Beträgen die Abgaben<br />
jeweils fällig werden.<br />
(2) Bescheide, die für mehrere Zeitabschnitte gelten, sind<br />
1. von Amts wegen oder auf Antrag durch einen neuen Bescheid zu<br />
ersetzen, wenn sich die Berechnungsgrundlagen ändern,<br />
2. auf Antrag des Schuldners für die nach der Antragstellung beginnenden<br />
neuen Zeitabschnitte zu ändern, wenn sie sachlich unrichtig sind.<br />
Bay KAG Art. 13 Anwendung von Vorschriften der Abgabenordnung<br />
(AO 1977)<br />
(1) Soweit gesetzlich nicht anders bestimmt, sind in ihrer jeweils geltenden<br />
Fassung vorbehaltlich Absatz 6 folgende Bestimmungen der<br />
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden:<br />
1. aus dem Ersten Teil – Einleitende Vorschriften –<br />
a) über den Anwendungsbereich:
§ 1 Abs. 3 und § 2,<br />
b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen:<br />
§ 3 Abs. 1, Abs. 4 ohne die Worte und Hinweise “Zwangsgelder (§ 329)<br />
und Kosten (§ 178, §§ 337 bis 345)”, Abs. 5, §§ 4, 5, 7 bis 15,<br />
c) über das Steuergeheimnis:<br />
§ 30 mit folgenden Maßgaben:<br />
aa) die Vorschrift gilt nur für kommunale Steuern, die Feuerschutzabgabe<br />
und den Fremdenverkehrsbeitrag,<br />
bb) die Entscheidung nach Absatz 4 Nr. 5 Buchst. c trifft die Körperschaft,<br />
der die Abgabe zusteht,<br />
§§ 30 a und 31 a,<br />
d) über die Haftungsbeschränkung für Amtsträger:<br />
§ 32,<br />
2. aus dem Zweiten Teil – Steuerschuldrecht –<br />
a) über die Steuerpflichtigen:<br />
§§ 33 bis 36,<br />
b) über das Steuerschuldverhältnis:<br />
§§ 37 bis 50,<br />
c) über die Haftung:<br />
§§ 69 bis 71, 73 bis 75, 77,<br />
3. aus dem Dritten Teil – Allgemeine Verfahrensvorschriften –<br />
a) über die Verfahrensgrundsätze:<br />
§§ 78 bis 81, § 82 Abs. 1 und 2, § 83 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß in den<br />
Fällen des Satzes 2 beim ersten Bürgermeister und bei den weiteren<br />
Bürgermeistern der Gemeinderat und beim Landrat und seinem gewählten<br />
Stellvertreter der Kreistag die Anordnung trifft, §§ 85 bis 93, § 96 Abs. 1<br />
bis Abs. 7 Satz 2, §§ 97, 98, § 99 mit der Maßgabe, daß im<br />
Kurbeitragsrecht von einer vorhergehenden Verständigung des<br />
Betroffenen abgesehen werden kann, § 101 Abs. 1, §§ 102 bis 109, § 111<br />
Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, §§ 112 bis 115, § 117 Abs. 1, 2 und 4,<br />
b) über die Verwaltungsakte:<br />
§§ 118 bis 133 mit der Maßgabe, daß in § 122 Abs. 5 Satz 2 das Wort<br />
“Verwaltungszustellungsgesetzes”, durch die Worte “Bayerischen<br />
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes” und in § 132 das<br />
Wort “finanzgerichtlichen” durch das Wort “verwaltungsgerichtlichen”<br />
ersetzt werden,<br />
4. aus dem Vierten Teil – Durchführung der Besteuerung –<br />
a) über die Mitwirkungspflichten:<br />
§ 140 ohne die Worte “als den Steuergesetzen”, §§ 145 bis 149, § 150<br />
Abs. 1 bis 5, §§ 151 bis 153,<br />
b) über das Festsetzungs- und Feststellungsverfahren:<br />
aa) §§ 155, 156 Abs. 2, §§ 157 bis 162, § 163 Abs. 1 Sätze 1 und 3,<br />
§ 165 Abs. 1, §§ 166, 167,<br />
bb) § 169 mit der Maßgabe,<br />
– daß in Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 die Worte “§ 15 Abs. 2 des<br />
Verwaltungszustellungsgesetzes” durch die Worte “Art. 15 Abs. 2 des<br />
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes” ersetzt<br />
werden und<br />
– daß die Festsetzungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 einheitlich vier Jahre<br />
beträgt,
cc) § 170 Abs. 1 mit der Maßgabe,<br />
– daß die Festsetzungsfrist dann, wenn die Forderung im Zeitpunkt des<br />
Entstehens aus tatsächlichen Gründen noch nicht berechnet werden kann,<br />
erst mit Ablauf des Kalenderjahres beginnt, in dem die Berechnung<br />
möglich ist und<br />
– daß im Fall der Ungültigkeit einer Satzung die Festsetzungsfrist erst mit<br />
Ablauf des Kalenderjahres zu laufen beginnt, in dem die gültige Satzung<br />
bekanntgemacht worden ist,<br />
und § 170 Abs. 3,<br />
dd) § 171 mit der Maßgabe, daß in Absatz 3 a die Bezugnahmen “§ 100<br />
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, § 101 der Finanzgerichtsordnung” durch die<br />
Bezugnahmen Ҥ 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung” ersetzt werden,<br />
ee) §§ 191 bis 194, § 195 Satz 1 mit der Maßgabe, daß auch Organe der<br />
überörtlichen Rechnungsprüfung mit der Prüfung betraut werden können,<br />
§§ 196 bis 203 mit der Maßgabe, daß in § 196 der Klammerzusatz entfällt,<br />
5. aus dem Fünften Teil – Erhebungsverfahren –<br />
a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von<br />
Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis:<br />
§§ 218, 219, 221, 222, § 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, § 227 Abs. 1,<br />
§§ 228 bis 232,<br />
b) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge:<br />
aa) § 233, § 234 Abs. 1 und 2, § 235,<br />
bb) § 236 mit der Maßgabe,<br />
– daß in Absatz 1 nach den Worten “durch eine rechtskräftige gerichtliche<br />
Entscheidung” die Worte “oder eine bestandskräftige<br />
Widerspruchsentscheidung”, nach den Worten “vorbehaltlich des<br />
Absatzes 3 vom” die Worte “Tag der Einlegung des Widerspruchs, oder<br />
wenn ein Widerspruchsverfahren nicht vorausgegangen ist, vom” und<br />
nach den Worten “der zu erstattende Betrag erst” die Worte “nach<br />
Einlegung des Widerspruchs, wenn ein Widerspruchsverfahren nicht<br />
vorausgegangen ist” einzufügen sind,<br />
– daß in Absatz 2 nach den Worten “oder Nr. 2” die Worte “eine<br />
bestandskräftige Widerspruchsentscheidung”, einzufügen sind und<br />
– daß in Absatz 3 an die Stelle der Bezugsnahme “§ 137 Satz 1 der<br />
Finanzgerichtsordnung” die Bezugnahme “§ 155 Abs. 5 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung” tritt,<br />
cc) § 237 Abs. 1, 2 und 4 mit der Maßgabe,<br />
– daß in Absatz 1 die Worte “eine Einspruchsentscheidung” durch die<br />
Worte “einen Widerspruchsbescheid”<br />
– sowie in Absatz 4 die Worte “und 3 gelten” durch das Wort “gilt” ersetzt<br />
werden,<br />
dd) §§ 238 bis 240,<br />
c) über die Sicherheitsleistung:<br />
§§ 241 bis 248,<br />
6. aus dem Sechsten Teil – Vollstreckung –<br />
a) über die allgemeinen Vorschriften:<br />
§ 251 Abs. 2 und 3 und § 254 Abs. 2,<br />
b) über die Niederschlagung:<br />
§ 261.
(2) Bei der Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften tritt jeweils<br />
an die Stelle<br />
a) der Finanzbehörde oder des Finanzamts die Körperschaft, der die<br />
Abgabe zusteht,<br />
b) des Worts “Steuer (n)” – allein oder in Wortzusammensetzungen – das<br />
Wort “Abgabe (n)”,<br />
c) des Worts “Besteuerung” die Worte “Heranziehung zu Abgaben”.<br />
(3) 1 Eine erhebliche Härte im Sinn des § 222 AO (Stundung) kann bei<br />
Beitragsforderungen insbesondere für unbebaute beitragspflichtige<br />
Grundstücke sowie für Grundstücke, die nur mit landwirtschaftlich<br />
genutzten Gebäuden zur überdachten Pflanzenproduktion bebaut sind,<br />
vorliegen, wenn deren landwirtschaftliche Nutzung weiterhin notwendig ist<br />
oder deren Nichtbebauung im Interesse der Erhaltung der<br />
charakteristischen Siedlungsstruktur oder der Erhaltung des Ortsbildes<br />
liegt. 2 Das Gleiche gilt auch bei Beitragsforderungen zu<br />
leitungsgebundenen Einrichtungen für bebaute Grundstücke, deren<br />
landwirtschaftliche Nutzung weiterhin notwendig ist, jedoch nicht<br />
hinsichtlich des auf das Wohnen entfallenden Beitragsteils. 3 Grundstücke<br />
im Sinn der Sätze 1 und 2 sind auch abgrenzbare, selbständig nutzbare<br />
Grundstücksteile. 4 In den Fällen des Satzes 1 soll, in den Fällen des<br />
Satzes 2 kann auf die Erhebung von Zinsen ganz oder teilweise verzichtet<br />
werden. 5 Die Regelung gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlassung<br />
und Betriebsübergabe an Familienangehörige im Sinn des § 15 AO.<br />
(4) 1 Wenn eine Gemeinde von Art. 5 Abs. 2 Sätze 4 und 5 Gebrauch macht,<br />
kann hinsichtlich der bereits entstandenen Beiträge für Gebäude oder<br />
selbständige Gebäudeteile im Sinn dieser Regelung eine erhebliche Härte<br />
im Sinn des § 222 der Abgabenordnung (Stundung) vorliegen. 2 In diesen<br />
Fällen soll auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden.<br />
(5) 1 Die Gemeinde kann in der Erschließungsbeitragssatzung bestimmen,<br />
dass Erschließungsbeiträge bis zur Hälfte des nachzuerhebenden Betrags<br />
erlassen werden, wenn ein für diese Erschließungsmaßnahme ergangener<br />
endgültiger Straßenausbaubeitragsbescheid bestandskräftig geworden ist.<br />
2<br />
Ein weitergehender Erlass nach § 227 AO bleibt unberührt.<br />
(6) 1 Bei der Hundesteuer findet auf die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung<br />
personenbezogener Daten das Bayerische Datenschutzgesetz Anwendung.<br />
2<br />
In Schadensfällen darf Auskunft über Namen und Anschrift des<br />
Hundehalters an Behörden und Schadensbeteiligte gegeben werden. 3 Bei<br />
Kampfhunden im Sinn des Art. 37 Abs. 1 Satz 2 des Landesstraf- und<br />
Verordnungsgesetzes dürfen die Gemeinden Namen und Anschrift der<br />
Halter sowie die Hunderasse auch zum Vollzug der Vorschriften über<br />
Kampfhunde speichern, verändern, nutzen und an andere zum Vollzug<br />
dieser Vorschriften zuständige Behörden übermitteln. 4 Weitergehende<br />
Befugnisse bleiben unberührt.<br />
Bay KAG Art. 14 Abgabehinterziehung<br />
(1) 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,<br />
wer<br />
1. der Körperschaft, der die Abgabe zusteht, oder einer anderen Behörde<br />
über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige
Angaben macht oder<br />
2. die Körperschaft, der die Abgabe zusteht, pflichtwidrig über<br />
abgaberechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis läßt<br />
und dadurch Abgaben verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht<br />
gerechtfertigte Abgabevorteile erlangt. 2 § 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 AO<br />
1977 sind in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.<br />
(2) Der Versuch ist strafbar.<br />
Bay KAG Art. 15 Leichtfertige Abgabeverkürzung<br />
1 Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer als<br />
Abgabepflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines<br />
Abgabepflichtigen eine der in Art. 14 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Taten<br />
leichtfertig begeht. 2 § 370 Abs. 4 und § 378 Abs. 3 AO 1977 sind in ihrer<br />
jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.<br />
Bay KAG Art. 16 Abgabegefährdung<br />
Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann, wenn die Handlung nicht nach<br />
Art. 15 geahndet werden kann, belegt werden, wer vorsätzlich oder leichtfertig<br />
1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder<br />
2. den Vorschriften zur Sicherung oder Erleichterung der Abgabeerhebung,<br />
insbesondere zur Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur Führung von<br />
Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder Vorlegung von<br />
Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt,<br />
und es dadurch ermöglicht, eine Abgabe zu verkürzen oder nicht<br />
gerechtfertigte Abgabevorteile zu erlangen.<br />
Bay KAG Art. 17 Geldbußen<br />
Die Geldbuße fließt in die Kasse der Körperschaft, der die Abgabe, auf die sich<br />
die Ordnungswidrigkeit bezieht, zusteht.<br />
III. ABSCHNITT Verwaltung der kommunalen Steuern<br />
Bay KAG Art. 18 Zuständigkeit<br />
Die Verwaltung der Realsteuern mit Ausnahme des Meßbetrags- und des<br />
Zerlegungsverfahrens und die Verwaltung der örtlichen Verbrauch- und<br />
Aufwandsteuern obliegen den steuerberechtigten Gemeinden und Landkreisen.<br />
IV. ABSCHNITT Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay KAG Art. 19 Übergangsvorschriften<br />
(1) 1 Gebührensatzungen, die eine gemäß Art. 8 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2<br />
unzulässige Mindestgebühr enthalten, sind bis 1. Januar 1997 der<br />
geänderten Rechtslage anzupassen. 2 Nach Ablauf dieser Frist treten sie<br />
außer Kraft.<br />
(2) 1 Gebührensatzungen, die eine Gebührendegression enthalten, sind bis<br />
1. Januar 1997 der geänderten Rechtslage anzupassen; dabei hat die<br />
Gemeinde zu entscheiden, ob und in welchem Umfang sie von der
Möglichkeit der Degression (Art. 8 Abs. 5) Gebrauch macht. 2 Spätestens<br />
nach Ablauf der Frist nach Satz 1 tritt eine Gebührensatzung, die eine<br />
Degression enthält, außer Kraft.<br />
(3) 1 Satzungsregelungen, die einen Erstattungsanspruch gemäß Art. 9 in der<br />
Fassung des Kommunalabgabengesetzes vom 4. Februar 1977 (GVBl.<br />
S. 82) beinhalten, sind bis 1. Januar 1997 der geänderten Rechtslage<br />
anzupassen; geschieht das nicht, entfalten sie nach Ablauf dieser Frist nur<br />
noch insoweit Rechtswirkungen, als sie von Art. 9 in der Fassung dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s gedeckt sind. 2 Die Einbeziehung der Grundstücksanschlüsse im<br />
öffentlichen Straßengrund in eine öffentliche Einrichtung mit Anschlussund<br />
Benutzungszwang und damit ihre Bewirtschaftung durch den<br />
Einrichtungsträger sind von den Eigentümern und sonst Berechtigten<br />
unentgeltlich zu dulden, wenn es in der Benutzungssatzung angeordnet<br />
wird.<br />
(4) 1 Die Verpflichtungen des Art. 5 Abs. 2 Sätze 4 und 6 gelten nur für<br />
Satzungen, die nach dem 1. Januar 1994 erlassen oder hinsichtlich des<br />
Beitragsmaßstabs geändert werden. 2 Die Verpflichtung des Art. 5 Abs. 2<br />
Satz 5 gilt nur für Satzungen, die nach dem 31. Juli 2002 erlassen oder<br />
hinsichtlich des Beitragsmaßstabs geändert werden. 3 Die Möglichkeit,<br />
entsprechende Regelungen auch in andere Satzungen zu übernehmen,<br />
bleibt hiervon unberührt.<br />
(5) Abschreibungen nach Art. 8 Abs. 3 Sätze 4 und 5 können auch für solche<br />
Anlagenteile geltend gemacht werden, die vor dem 1. Januar 2000 mit<br />
Zuwendungen finanziert worden sind.<br />
(6) Art. 5 Abs. 5 Satz 3 ist in der ab 1. August 2002 geltenden Fassung<br />
anzuwenden, wenn der Vorauszahlungsbescheid nach diesem Zeitpunkt<br />
bekannt gegeben wird.<br />
Bay KAG Art. 20 Einschränkung von Grundrechten<br />
Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s können die Grundrechte auf Freiheit der Person und<br />
der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2,<br />
Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 102 und 106 Abs. 3 der Verfassung).<br />
Bay KAG Art. 21 Ausführungsvorschriften<br />
Das Staatsministerium des Innern erläßt die zur Ausführung dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
erforderlichen Vorschriften.<br />
Bay KAG Art. 22 Inkrafttreten<br />
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1974 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. März 1974 (GVBl<br />
S. 109). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen<br />
Änderungsgesetzen.
Kostengesetz (Bay KG)<br />
vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43), geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 10. Mai 1999 (GVBl. S. 230),<br />
vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 554), vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 23. November<br />
2001 (GVBl. S. 739), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 937), vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 287),<br />
vom 9. Mai 2006 (GVBl. S. 193), vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 951), vom 14. April 2009<br />
(GVBl. S. 86) (FN BayRS 2013-1-1-F)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER ABSCHNITT Kosten für Amtshandlungen<br />
Art. 1 Amtshandlungen, Kostengläubiger<br />
Art. 2 Kostenschuldner<br />
Art. 3 Sachliche Kostenfreiheit<br />
Art. 4 Persönliche Gebührenfreiheit<br />
Art. 5 Kostenverzeichnis<br />
Art. 6 Gebührenbemessung<br />
Art. 7 Mehrere Amtshandlungen<br />
Art. 8 Kosten bei Ablehnung, Zurücknahme oder Erledigung eines Antrags<br />
Art. 9 Kosten im Rechtsbehelfsverfahren, Nachprüfungsverfahren<br />
Art. 10 Auslagen<br />
Art. 11 Entstehung des Kostenanspruchs<br />
Art. 12 Kostenentscheidung, Rechtsbehelf<br />
Art. 13 Festsetzungsverjährung<br />
Art. 14 Kostenvorschuß, Zurückbehaltung, Zahlungsrückstände<br />
Art. 15 Fälligkeit<br />
Art. 16 Billigkeitsmaßnahmen, Niederschlagung<br />
Art. 17 Zinsen<br />
Art. 18 Säumniszuschläge
Art. 19 Zahlungsverjährung<br />
Art. 20 Kostenerhebung durch kommunale Körperschaften des öffentlichen<br />
Rechts<br />
ZWEITER ABSCHNITT Benutzungsgebühren, Entschädigungen und Beiträge<br />
Art. 21 Benutzungsgebühren<br />
Art. 22 Entschädigungen<br />
Art. 23 Gebühren- und Auslagenfreiheit<br />
Art. 24 Kurtaxe<br />
DRITTER ABSCHNITT Sonstige Vorschriften<br />
Art. 25 Kostenverwaltung<br />
Art. 26 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 27 Erhebung von Kosten in anderen Fällen<br />
Art. 28 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
ERSTER ABSCHNITT Kosten für Amtshandlungen<br />
Bay KG Art. 1 Amtshandlungen, Kostengläubiger<br />
(1) 1 Die Behörden des Staates erheben für Tätigkeiten, die sie in Ausübung<br />
hoheitlicher Gewalt vornehmen (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und<br />
Auslagen) nach den Vorschriften dieses Abschnitts. 2 Eine Amtshandlung<br />
im Sinn des Satzes 1 liegt auch vor, wenn ein Einverständnis der Behörde,<br />
insbesondere eine Zustimmung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung<br />
oder Gestattung, nach Ablauf einer bestimmten Frist auf Grund einer<br />
Rechtsvorschrift als erteilt gilt. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten für andere<br />
Behörden und Stellen, die Amtshandlungen im staatlichen Auftrag<br />
vornehmen, entsprechend.<br />
(2) 1 Die Kosten für Amtshandlungen der Behörden des Staates fließen dem<br />
Staat zu. 2 Die Kosten für Amtshandlungen, die andere Behörden und<br />
Stellen im staatlichen Auftrag vornehmen, fließen dem jeweiligen<br />
Rechtsträger zu.<br />
Bay KG Art. 2 Kostenschuldner<br />
(1) 1 Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer die Amtshandlung veranlaßt,<br />
im übrigen diejenige Person, in deren Interesse die Amtshandlung<br />
vorgenommen wird. 2 In Rechtsbehelfsverfahren schuldet die Kosten
diejenige Person, der die Kosten auferlegt werden. 3 In<br />
streitentscheidenden Verfahren ist neben dem Veranlasser<br />
Kostenschuldner auch diejenige Person, der die Kosten auferlegt werden.<br />
(2) Kostenschuldner ist ferner, wer die Kosten einer Behörde gegenüber<br />
schriftlich übernommen hat oder für die Kostenschuld einer anderen<br />
Person kraft <strong>Gesetze</strong>s haftet.<br />
(3) Auslagen im Sinn des Art. 10 Abs. 1, die durch unbegründete<br />
Einwendungen Beteiligter oder durch Verschulden Beteiligter oder Dritter<br />
entstanden sind, können diesen auferlegt werden.<br />
(4) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.<br />
Bay KG Art. 3 Sachliche Kostenfreiheit<br />
(1) Kosten werden nicht erhoben für<br />
1. Maßnahmen der Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den unter der<br />
Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften und Anstalten des<br />
öffentlichen Rechts;<br />
2. Amtshandlungen, die überwiegend im öffentlichen Interesse von Amts<br />
wegen vorgenommen werden; sind sie von einem Beteiligten veranlaßt, so<br />
sind ihm dafür die Kosten aufzuerlegen, soweit dies der Billigkeit nicht<br />
widerspricht;<br />
3. Auskünfte einfacher Art; dies gilt nicht für Auskünfte aus Registern und<br />
Dateien;<br />
4. das Verfahren über die Stundung, den Erlaß oder die Erstattung<br />
öffentlicher Abgaben;<br />
5.<br />
a) die Anforderung von Kosten, Kostenvorschüssen, Benutzungsgebühren<br />
und Beiträgen;<br />
b) die Anforderung von Zinsen oder Säumniszuschlägen;<br />
c) die Festsetzung von Entschädigungen im Sinn des Art. 22 und die<br />
Festsetzung der in einem Vorverfahren nach § 68 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur zweckentsprechenden<br />
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen;<br />
6. das Verfahren über Anträge auf Unterstützung, Beihilfen, Zuschüsse,<br />
Stipendien, Freiplätze und ähnliche Vergünstigungen sowie auf Erteilung<br />
von Zeugnissen zur Festsetzung von Ruhe-, Witwen- und Waisengeld;<br />
7. das Verfahren in Gnadensachen;<br />
8. Amtshandlungen im Rahmen eines bestehenden oder früheren<br />
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses einschließlich eines<br />
Widerspruchsverfahrens;<br />
9. das Verfahren wegen Ablehnung eines Beamten;<br />
10. Amtshandlungen, die von der Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach<br />
Art. 2 des Polizeiaufgabengesetzes vorgenommen werden, soweit nichts<br />
anderes bestimmt ist. 2 Abweichend davon gilt folgendes:<br />
a) Soweit Amtshandlungen beantragt oder sonst veranlaßt sind und nicht<br />
überwiegend im öffentlichen Interesse vorgenommen werden, sind die<br />
Amtshandlungen kostenpflichtig;<br />
b) Kosten werden auch erhoben für Einsätze der Polizei auf Grund des<br />
Alarms einer Überfall- und Einbruchmeldeanlage; derartige Einsätze<br />
bleiben aber kostenfrei, wenn der Betreiber der Anlage nachweist, daß
kein Falschalarm vorlag;<br />
c) Kosten werden ferner erhoben für Einsätze der Polizei, die durch eine<br />
vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschalarmierung oder eine<br />
vorgetäuschte Gefahr oder Straftat veranlasst wurden.<br />
3<br />
Von der Erhebung der Kosten kann abgesehen werden, wenn sie der<br />
Billigkeit widerspricht;<br />
11. die Entscheidung über Gegenvorstellungen, Aufsichtsbeschwerden,<br />
Dienstaufsichtsbeschwerden und Petitionen;<br />
12. Amtshandlungen bei der Durchführung von Wahlen und<br />
Abstimmungen;<br />
13.<br />
a) Amtshandlungen der Hochschulen, der Studienkollegs bei den<br />
Universitäten und Fachhochschulen des Freistaates Bayern, von Schulen<br />
im Sinn des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über das Erziehungs- und<br />
Unterrichtswesen und von Schulaufsichtsbehörden zur Begründung oder<br />
im Rahmen eines bestehenden Studien- oder Schulverhältnisses;<br />
b) Amtshandlungen anläßlich des Besuchs von Schulen und der Teilnahme<br />
an Lehrgängen, die der Aus- und Weiterbildung von Angehörigen des<br />
öffentlichen Dienstes und von im Vorbereitungsdienst hierzu befindlichen<br />
Personen dienen;<br />
c) Entscheidungen über Anträge auf Erhebungen in Schulen;<br />
d) Amtshandlungen in Prüfungsverfahren, wenn für die Abnahme der<br />
Prüfung eine Prüfungsgebühr nicht erhoben wird;<br />
14. das Verfahren über die Anordnung der sofortigen Vollziehung und über<br />
die Aussetzung der Vollziehung nach §§ 80 und 80 a VwGO.<br />
(2) Von der Kostenfreiheit werden nicht erfasst<br />
1. das Rechtsbehelfsverfahren, soweit in Abs. 1 oder in anderen<br />
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist,<br />
2. das Nachprüfungsverfahren nach der Ausbildungs- und<br />
Prüfungsordnung für Juristen sowie<br />
3. die Entscheidung über die Überlassung von Kopien, beglaubigten<br />
Abschriften, Zweitschriften sowie von Ausfertigungen in fremder Sprache,<br />
soweit die Entscheidung durch einen Antrag Beteiligter veranlasst ist.<br />
(3) Auch bei Kostenfreiheit nach Absatz 1 können Auslagen im Sinn des<br />
Art. 10 Abs. 1, die durch unbegründete Einwendungen Beteiligter oder<br />
durch Verschulden Beteiligter oder Dritter entstanden sind, diesen<br />
auferlegt werden.<br />
Bay KG Art. 4 Persönliche Gebührenfreiheit<br />
1<br />
Von der Zahlung der Gebühren sind befreit<br />
1. der Freistaat Bayern,<br />
2. die bayerischen Gemeinden, Landkreise, Bezirke und Zweckverbände, die<br />
sonstigen bayerischen kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts<br />
und nichtwirtschaftliche kommunale Unternehmen in der Rechtsform einer<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) sowie<br />
3. die nach den Haushaltsplänen der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten<br />
Körperschaften für ihre Rechnung verwalteten juristischen Personen des<br />
öffentlichen Rechts.<br />
2<br />
Nicht befreit sind die Sondervermögen und die kaufmännisch eingerichteten
Staatsbetriebe des Freistaates Bayern, die wirtschaftlichen kommunalen<br />
Unternehmen sowie die Unternehmen, die der Abfall- oder<br />
Abwasserentsorgung dienen.<br />
Bay KG Art. 5 Kostenverzeichnis<br />
(1) 1 Das Staatsministerium der Finanzen erläßt im Benehmen mit den<br />
beteiligten Staatsministerien, der Staatskanzlei und den Mitgliedern der<br />
Staatsregierung, denen Sonderaufgaben nach Art. 50 der Verfassung<br />
übertragen worden sind, das Kostenverzeichnis als Rechtsverordnung.<br />
2<br />
Gebühren sind<br />
1. durch feste Sätze (Festgebühren) oder<br />
2. nach dem Wert des Gegenstands der Amtshandlung (Wertgebühren)<br />
oder<br />
3. nach dem durch die Amtshandlung verursachten Zeitaufwand<br />
(Zeitgebühren) oder<br />
4. innerhalb eines Rahmens (Rahmengebühren)<br />
zu bestimmen.<br />
(2) 1 Im Kostenverzeichnis ist die Höhe der Gebühr nach dem<br />
Verwaltungsaufwand aller an der Amtshandlung beteiligten Behörden und<br />
Stellen und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten<br />
festzulegen. 2 Dabei können mehrere Amtshandlungen innerhalb eines<br />
Verfahrens mit einer Gebühr bewertet werden. 3 Die Gebühren und<br />
Auslagen für die Inanspruchnahme von staatlichen öffentlichen<br />
Einrichtungen, die mit einer Amtshandlung in engem Zusammenhang<br />
steht, können mit der Amtshandlungsgebühr abgegolten werden.<br />
(3) 1 Bei der Ermittlung des Verwaltungsaufwands hat das Staatsministerium<br />
der Finanzen Ergebnisse von Kosten-/Leistungsrechnungen zu<br />
berücksichtigen. 2 Die Gebührensätze sind regelmäßig daraufhin zu<br />
überprüfen, inwieweit sie noch den Ergebnissen der Kosten-<br />
/Leistungsrechnung entsprechen, und gegebenenfalls anzupassen.<br />
(4) 1 Wertgebühren können für Amtshandlungen vorgesehen werden, bei<br />
denen der Verwaltungsaufwand oder die Bedeutung der Angelegenheit<br />
maßgeblich vom Wert des Gegenstands der Amtshandlung abhängen.<br />
2<br />
Dieser Wert kann durch einen Geldbetrag oder durch eine andere<br />
geeignete Bemessungsgrundlage bestimmt werden. 3 Die Höhe der Gebühr<br />
kann sich aus einem Prozent- oder Promillesatz des Gegenstandswerts<br />
oder aus einem festen, auf den Gegenstand bezogenen Betrag ergeben.<br />
(5) 1 Sieht ein Bundesgesetz, eine darauf beruhende Rechtsvorschrift oder ein<br />
Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaft neben der Erhebung von Kosten<br />
(Gebühren und Auslagen) im Sinn des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 auch die<br />
Erhebung von Gebühren und Auslagen für Prüfungen, Untersuchungen<br />
oder eine andere Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung des<br />
Staates im Sinn des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 vor, können diese Gebühren<br />
und Auslagen abweichend von Art. 21 Abs. 1 Satz 1 oder von<br />
entsprechenden Ermächtigungen nach anderen Rechtsvorschriften im<br />
Kostenverzeichnis festgelegt werden. 2 Enthält eine Rechtsnorm oder ein<br />
Rechtsakt im Sinn des Satzes 1 Vorgaben für die Bemessung von<br />
Gebühren und Auslagen, so sind die Gebühren und Auslagen nach<br />
Maßgabe dieser Vorschriften festzulegen.
(6) Im Kostenverzeichnis kann auch bestimmt werden, dass Kosten nicht<br />
erhoben werden, soweit ihre Erhebung unbillig wäre.<br />
Bay KG Art. 6 Gebührenbemessung<br />
(1) 1 Die Höhe der Gebühren bemißt sich nach dem Kostenverzeichnis. 2 Für<br />
Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine<br />
Gebühr erhoben, die nach im Kostenverzeichnis bewerteten<br />
vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. 3 Fehlt eine<br />
vergleichbare Amtshandlung, beträgt die Gebühr fünf bis<br />
fünfundzwanzigtausend Euro.<br />
(2) 1 Bei der Ermittlung der Gebühr innerhalb eines Rahmens sind der mit der<br />
Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand aller beteiligten Behörden<br />
und Stellen und die Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten zu<br />
berücksichtigen. 2 Soweit Behörden über eine Kosten-/Leistungsrechnung<br />
verfügen, sind deren Ergebnisse der Ermittlung des Verwaltungsaufwands<br />
zugrunde zu legen. 3 Art. 5 Abs. 5 gilt entsprechend.<br />
Bay KG Art. 7 Mehrere Amtshandlungen<br />
(1) Die Gebühr wird für jede Amtshandlung erhoben, auch wenn diese mit<br />
anderen zusammen vorgenommen wird; sie wird ohne Rücksicht auf die<br />
Zahl der beteiligten Personen nur einmal erhoben.<br />
(2) Mehrere Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens können durch eine<br />
Gebühr abgegolten werden, wenn keine dieser Amtshandlungen im<br />
Kostenverzeichnis oder in einer anderen Vorschrift bewertet ist.<br />
Bay KG Art. 8 Kosten bei Ablehnung, Zurücknahme oder Erledigung<br />
eines Antrags<br />
(1) 1 Bei Ablehnung eines Antrags kann die für die beantragte Amtshandlung<br />
festzusetzende Gebühr bis auf ein Zehntel ermäßigt werden. 2 Erfordert<br />
die Ablehnung der Amtshandlung einen unverhältnismäßig hohen<br />
Verwaltungsaufwand, kann die Gebühr bis zum doppelten Betrag der für<br />
die beantragte Amtshandlung festzusetzenden Gebühr erhöht werden.<br />
3<br />
Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt, kann die Gebühr<br />
ermäßigt oder erlassen werden.<br />
(2) 1 Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Weise,<br />
bevor die Amtshandlung beendet ist, sind eine Gebühr von einem Zehntel<br />
bis zu drei Viertel der für die beantragte Amtshandlung festzusetzenden<br />
Gebühr je nach dem Fortgang der Sachbehandlung und die Auslagen zu<br />
erheben. 2 Die Mindestgebühr beträgt fünfzehn Euro, höchstens jedoch die<br />
für die Amtshandlung vorgesehene Gebühr.<br />
(3) 1 Von der Festsetzung der Kosten ist in den Fällen des Absatzes 2<br />
abzusehen, soweit durch die Zurücknahme des Antrags oder seine<br />
Erledigung auf andere Weise das Verfahren besonders rasch und mit<br />
geringem Verwaltungsaufwand abgeschlossen werden kann, wenn dies der<br />
Billigkeit nicht widerspricht. 2 Dies gilt auch im Fall der Zurückweisung<br />
eines Nachprüfungsantrags nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung<br />
für Juristen.
Bay KG Art. 9 Kosten im Rechtsbehelfsverfahren,<br />
Nachprüfungsverfahren<br />
(1) 1 Die Gebühr beträgt im Rechtsbehelfsverfahren das Eineinhalbfache der<br />
vollen Amtshandlungsgebühr. 2 Ist die Amtshandlung nur teilweise<br />
angefochten, verringert sich die Gebühr entsprechend. 3 Art. 8 Abs. 1<br />
findet entsprechende Anwendung. 4 Ist für die Amtshandlung eine Gebühr<br />
nicht angefallen oder hat ein Dritter Widerspruch eingelegt, ist eine<br />
Gebühr bis zu fünftausend Euro zu erheben. 5 Die Mindestgebühr beträgt<br />
fünfundzwanzig Euro. 6 Bei einem Widerspruch, der sich allein gegen die<br />
Festsetzung öffentlicher Abgaben, insbesondere gegen eine Entscheidung<br />
über Kosten, Benutzungsgebühren oder Beiträge, richtet, beträgt die<br />
Gebühr bis zur Hälfte des angefochtenen Betrags, mindestens aber zehn<br />
Euro.<br />
(2) 1 Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere<br />
Weise, werden eine Gebühr von einem Zehntel bis zu drei Viertel der nach<br />
Absatz 1 festzusetzenden Gebühr je nach dem Fortgang des Verfahrens<br />
und die Auslagen erhoben. 2 Die Mindestgebühr beträgt fünfzehn Euro; im<br />
Fall eines Widerspruchs, der sich allein gegen die Festsetzung öffentlicher<br />
Abgaben, insbesondere gegen eine Entscheidung über Kosten,<br />
Benutzungsgebühren oder Beiträge, richtet, beträgt sie zehn Euro. 3 Art. 8<br />
Abs. 3 gilt entsprechend.<br />
(3) 1 Hat ein Rechtsbehelf Erfolg, so werden keine Kosten, hat er zum Teil<br />
Erfolg, werden entsprechend ermäßigte Kosten erhoben. 2 Unberührt bleibt<br />
jedoch die Erhebung der für eine Amtshandlung vorgeschriebenen Kosten,<br />
wenn diese auf einen Rechtsbehelf hin vorgenommen wird; dies gilt auch<br />
für die Ablehnung eines Antrags.<br />
(4) Abs. 3 gilt für das Nachprüfungsverfahren nach der Ausbildungs- und<br />
Prüfungsordnung für Juristen entsprechend.<br />
Bay KG Art. 10 Auslagen<br />
(1) An Auslagen der an der Amtshandlung beteiligten Behörden und Stellen<br />
werden, soweit im Kostenverzeichnis nicht Ausnahmen vorgesehen sind,<br />
erhoben<br />
1. die Zeugen und Sachverständigen zustehenden Entschädigungen;<br />
2. Entgelte für Telekommunikationsdienstleisungen sowie Entgelte für<br />
Postzustellungsaufträge und Einschreibe- und Nachnahmeverfahren; wird<br />
durch Behördenangehörige förmlich oder unter Einhebung von<br />
Geldbeträgen außerhalb der Dienststelle zugestellt, so ist derjenige Betrag<br />
zu erheben, der bei der förmlichen Zustellung mit Postzustellungsauftrag<br />
durch die Post oder bei Erhebung im Nachnahmeverfahren entstanden<br />
wäre;<br />
3. die durch Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen<br />
entstehenden Aufwendungen;<br />
4. die Reisekosten im Sinn der Reisekostenvorschriften und sonstige<br />
Aufwendungen bei Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der<br />
Dienststelle;<br />
5. die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit<br />
zustehenden Beträge.
(2) 1 Für die auf besonderen Antrag erteilten Ausfertigungen und Kopien<br />
werden Schreibauslagen erhoben. 2 Die Höhe der Schreibauslagen, die<br />
sich nach dem Verwaltungsaufwand bemißt, wird im Kostenverzeichnis<br />
bestimmt.<br />
(3) Auslagen im Sinn des Absatzes 1 werden auch dann erhoben, wenn die<br />
kostenerhebende Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, der<br />
Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die anderen<br />
Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.<br />
(4) Können nach besonderen Rechtsvorschriften Auslagen erhoben werden,<br />
die nicht besonders bezeichnet sind, gilt Absatz 1 entsprechend.<br />
Bay KG Art. 11 Entstehung des Kostenanspruchs<br />
1 Der Kostenanspruch entsteht mit der Beendigung der kostenpflichtigen<br />
Amtshandlung, in den Fällen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 und des Art. 7 Abs. 2 mit<br />
der Beendigung der letzten gebührenpflichtigen Amtshandlung, in den Fällen<br />
des Art. 8 Abs. 2 und des Art. 9 Abs. 2 mit der Zurücknahme oder Erledigung<br />
des Antrags oder Rechtsbehelfs. 2 Bedarf die Amtshandlung einer Zustellung,<br />
Eröffnung oder sonstigen Bekanntgabe, so ist sie damit beendet.<br />
Bay KG Art. 12 Kostenentscheidung, Rechtsbehelf<br />
(1) Die Kostenentscheidung ist von Amts wegen nachzuholen, wenn sie bei<br />
der Vornahme der kostenpflichtigen Amtshandlung unterblieben ist.<br />
(2) Fehlerhafte Kostenentscheidungen können von Amts wegen von der<br />
Kostenfestsetzungsbehörde, von den übergeordneten Behörden oder auf<br />
Weisung der Fachaufsichtsbehörden geändert werden.<br />
(3) Die Kostenentscheidung kann zusammen mit dem Verwaltungsakt oder<br />
selbständig nach Maßgabe der Vorschriften über die<br />
Verwaltungsgerichtsbarkeit angefochten werden.<br />
Bay KG Art. 13 Festsetzungsverjährung<br />
1 Eine Kostenentscheidung, ihre Aufhebung oder ihre Änderung sind nicht mehr<br />
zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist (Festsetzungsverjährung).<br />
2 Die Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre, sie beginnt mit Ablauf des<br />
Kalenderjahres, in dem der Kostenanspruch entstanden ist. 3 Die<br />
Festsetzungsfrist läuft nicht ab, solange<br />
1. über einen vor Ablauf der Frist gestellten Antrag auf Aufhebung oder<br />
Änderung der Festsetzung nicht unanfechtbar entschieden ist;<br />
2. der Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der<br />
Verjährungsfrist nicht verfolgt werden kann.<br />
Bay KG Art. 14 Kostenvorschuß, Zurückbehaltung, Zahlungsrückstände<br />
(1) 1 Die Behörde kann eine Amtshandlung, die auf Antrag vorgenommen<br />
wird, von der Zahlung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig<br />
machen. 2 Dabei ist eine angemessene Frist zur Zahlung des<br />
Kostenvorschusses zu setzen. 3 Wird der Kostenvorschuß nicht binnen<br />
dieser Frist eingezahlt, so kann die Behörde den Antrag als<br />
zurückgenommen behandeln; darauf ist bei der Anforderung des
Kostenvorschusses hinzuweisen. 4 Satz 3 gilt nicht in<br />
Widerspruchsverfahren.<br />
(2) 1 Ein Kostenvorschuß ist nicht anzufordern, wenn der antragstellenden<br />
oder einer dritten Person dadurch ein wesentlicher Nachteil entstehen<br />
würde oder wenn es aus sonstigen Gründen der Billigkeit entspricht. 2 Bei<br />
Personen, die außerstande sind, ohne Beeinträchtigung des für sie und<br />
ihre Familien notwendigen Unterhalts die Kosten vorzuschießen, darf ein<br />
Kostenvorschuß nur gefordert werden, wenn der Antrag keine<br />
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig erscheint.<br />
(3) Urkunden oder sonstige Schriftstücke können bis zur Bezahlung der<br />
geschuldeten Kosten zurückbehalten oder unter Nachnahme übersandt<br />
werden.<br />
(4) 1 Die Behörde kann außerdem eine Amtshandlung, die auf Antrag<br />
vorgenommen wird, von der Zahlung rückständiger Kosten aus<br />
vorausgegangenen Verwaltungsverfahren gleicher Art abhängig machen,<br />
soweit dies der Billigkeit nicht widerspricht. 2 Abs. 1 bis 3 gelten<br />
sinngemäß.<br />
Bay KG Art. 15 Fälligkeit<br />
Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung fällig, wenn nicht<br />
die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt.<br />
Bay KG Art. 16 Billigkeitsmaßnahmen, Niederschlagung<br />
(1) 1 Die Behörde kann die festgesetzten Kosten ganz oder teilweise stunden,<br />
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den<br />
Kostenschuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung<br />
nicht gefährdet erscheint. 2 Die Stundung soll in der Regel nur auf Antrag<br />
und gegen Sicherheitsleistung gewährt werden.<br />
(2) 1 Die Behörde kann von der Festsetzung der Kosten absehen, den<br />
Kostenanspruch erlassen oder bereits entrichtete Kosten erstatten, wenn<br />
die Einziehung der Beträge nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre.<br />
2<br />
Die Entscheidung kann auch auf Teile des Anspruchs oder der Kosten<br />
beschränkt werden.<br />
(3) Die Behörde kann von der Festsetzung der Kosten absehen oder den<br />
Kostenanspruch niederschlagen, wenn feststeht, daß die Einziehung<br />
keinen Erfolg haben wird, oder wenn der mit der Einziehung verbundene<br />
Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zu dem einzuziehenden Betrag<br />
steht.<br />
(4) Ist eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen worden, ohne<br />
daß diejenige Person, an die sich die Amtshandlung gerichtet hat, dies zu<br />
vertreten hat, kann die Behörde die für die zurückgenommene oder<br />
widerrufene Amtshandlung festgesetzten Kosten ganz oder teilweise<br />
erlassen oder bereits entrichtete Kosten erstatten, wenn dies der Billigkeit<br />
entspricht.<br />
(5) Kosten, die bei richtiger Sachbehandlung durch die Behörde nicht<br />
entstanden wären, sowie Auslagen, die durch eine von Amts wegen<br />
veranlaßte Verlegung eines Termins oder einer Verhandlung entstanden<br />
sind, werden nicht erhoben.
Bay KG Art. 17 Zinsen<br />
(1) Für die Dauer einer gewährten Stundung werden Zinsen erhoben.<br />
(2) Für den geschuldeten Betrag, hinsichtlich dessen nach den §§ 80 und 80 a<br />
VwGO aufschiebende Wirkung besteht oder die Vollziehung ausgesetzt<br />
war, sind Zinsen für die Dauer der aufschiebenden Wirkung bzw. der<br />
Aussetzung festzusetzen, soweit ein förmlicher Widerspruch oder eine<br />
Anfechtungsklage gegen die Hauptsache bzw. die Kostenfestsetzung<br />
endgültig ohne Erfolg geblieben ist.<br />
(3) 1 Die Zinsen betragen für jeden Monat einhalb v. H. 2 Sie sind von dem<br />
Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu zahlen;<br />
angefangene Monate bleiben außer Ansatz. 3 Für die Berechnung der<br />
Zinsen wird der zu verzinsende Betrag auf volle fünf Euro abgerundet.<br />
4<br />
Zinsen werden nur festgesetzt, wenn sie mindestens zehn Euro<br />
betragen.<br />
(4) Die Vorschriften über die Kostenbescheide gelten für Zinsbescheide<br />
entsprechend.<br />
Bay KG Art. 18 Säumniszuschläge<br />
(1) 1 Werden Kosten nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist<br />
für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins<br />
v. H. des rückständigen auf fünfzig Euro abgerundeten Kostenbetrags zu<br />
entrichten. 2 Die Kosten gelten als entrichtet<br />
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln am Tag des<br />
Eingangs bei der zuständigen Kasse,<br />
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der zuständigen Kasse<br />
an dem Tag, an dem der Betrag der Kasse gutgeschrieben wird,<br />
3. bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung am Fälligkeitstag.<br />
3 Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu fünf Tagen nicht<br />
erhoben.<br />
(2) 1 In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge gegenüber<br />
jedem säumigen Gesamtschuldner. 2 Insgesamt ist jedoch kein höherer<br />
Säumniszuschlag zu entrichten als verwirkt worden wäre, wenn die<br />
Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner eingetreten wäre.<br />
(3) Art. 16 gilt sinngemäß.<br />
Bay KG Art. 19 Zahlungsverjährung<br />
(1) 1 Ein festgesetzter Kostenanspruch erlischt durch Verjährung<br />
(Zahlungsverjährung). 2 Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre; sie<br />
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch erstmals<br />
fällig geworden ist.<br />
(2) Die Zahlungsverjährung ist gehemmt, solange der Anspruch wegen<br />
höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist<br />
nicht verfolgt werden kann.<br />
(3) Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch<br />
1. schriftliche Geltendmachung des Anspruchs;<br />
2. Stundung;<br />
3. Sicherheitsleistung;
4. Aussetzung der Vollziehung;<br />
5. eine Vollstreckungsmaßnahme;<br />
6. Anmeldung im Konkurs;<br />
7. Ermittlungen der Behörde nach dem Wohnsitz oder dem Aufenthaltsort<br />
des Kostenschuldners.<br />
(4) Die Unterbrechung gemäß Absatz 3 dauert fort, bis<br />
1. bei schriftlicher Geltendmachung des Anspruchs der Leistungsbescheid<br />
bestandskräftig geworden ist;<br />
2. bei Stundung oder Aussetzung der Vollziehung die Maßnahme<br />
abgelaufen ist;<br />
3. bei Sicherheitsleistung, Pfändungspfandrecht, Zwangshypothek oder<br />
einem sonstigen Vorzugsrecht auf Befriedigung das entsprechende Recht<br />
erloschen ist;<br />
4. das Konkursverfahren beendet ist.<br />
(5) Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbrechung geendet hat,<br />
beginnt die Frist nach Absatz 1 erneut.<br />
(6) Die Frist nach Absatz 1 wird nur in Höhe des Betrags unterbrochen, auf<br />
den sich die Unterbrechungshandlung bezieht.<br />
(7) Für Erstattungsansprüche gilt Absatz 1 entsprechend.<br />
Bay KG Art. 20 Kostenerhebung durch kommunale Körperschaften des<br />
öffentlichen Rechts<br />
(1) Die Gemeinden, Landkreise, Bezirke, Zweckverbände und sonstigen<br />
kommunalen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts<br />
können für ihre Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis Kosten<br />
erheben, die in ihre Kassen fließen; die Erhebung der Kosten ist durch<br />
Kostensatzungen zu regeln.<br />
(2) Das Staatsministerium des Innern kann für kommunale Körperschaften<br />
Mustersatzungen erlassen.<br />
(3) Die Art. 2, 3, 4 und 5 Abs. 2 bis 6 sowie die Art. 6 bis 19 und Art. 21<br />
Abs. 3 Satz 2 finden entsprechende Anwendung.<br />
ZWEITER ABSCHNITT Benutzungsgebühren, Entschädigungen<br />
und Beiträge<br />
Bay KG Art. 21 Benutzungsgebühren<br />
(1) 1 Soweit nicht besondere Vorschriften entgegenstehen, können die<br />
zuständigen Staatsministerien im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen Rechtsverordnungen erlassen über die<br />
Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme öffentlicher<br />
Einrichtungen des Staates und anderer Stellen, die Aufgaben im<br />
staatlichen Auftrag wahrnehmen (Benutzungsgebühren). 2 Sind alle<br />
Staatsministerien zuständig, so wird die Rechtsverordnung durch die<br />
Staatsregierung erlassen.<br />
(2) 1 Die Benutzungsgebühren schuldet, wer die Einrichtung in Anspruch<br />
nimmt; in den Rechtsverordnungen kann bestimmt werden, daß auch<br />
diejenige Person Schuldner ist, in deren Interesse die Inanspruchnahme
erfolgt, und diejenige, die die Schuld gegenüber der Einrichtung schriftlich<br />
übernimmt. 2 Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.<br />
(3) 1 Die Höhe der Gebühren ist nach dem Verwaltungsaufwand der in<br />
Anspruch genommenen Einrichtung und nach der Bedeutung der Leistung<br />
für die Benutzer zu bemessen; Art. 5 Abs. 3, 5 und 6 gelten entsprechend.<br />
2<br />
Amtshandlungen, die mit der Inanspruchnahme von staatlichen<br />
öffentlichen Einrichtungen in engem Zusammenhang stehen, können mit<br />
der Benutzungsgebühr abgegolten werden.<br />
(4) 1 In den Rechtsverordnungen kann bestimmt werden, daß Behörden des<br />
Freistaates Bayern von der Zahlung von Benutzungsgebühren befreit sind.<br />
2<br />
Ferner kann in den Rechtsverordnungen für bestimmte Arten von Fällen<br />
vorgesehen werden, daß Gebühren und Auslagen nach Absatz 1 nicht<br />
erhoben werden, soweit ihre Erhebung unbillig wäre. Soweit in den<br />
Rechtsverordnungen nichts anderes bestimmt ist, gelten Art. 10 bis 19<br />
entsprechend.<br />
(5) Die Befugnis der juristischen Personen des öffentlichen Rechts,<br />
Gebührenordnungen zu erlassen, bleibt unberührt.<br />
Bay KG Art. 22 Entschädigungen<br />
1 Soweit nicht besondere Vorschriften entgegenstehen, können die zuständigen<br />
Staatsministerien im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen<br />
Rechtsverordnungen erlassen über die angemessene Entschädigung der in<br />
Verwaltungssachen oder in sonstigen öffentlichen Angelegenheiten tätigen<br />
Sachverständigen, Prüfer und zu vernehmenden Zeugen. 2 Sind alle<br />
Staatsministerien zuständig, so wird die Rechtsverordnung durch die<br />
Staatsregierung erlassen.<br />
Bay KG Art. 23 Gebühren- und Auslagenfreiheit<br />
(1) Gebühren und Auslagen im Sinn des Art. 21 Abs. 1 und<br />
Sachverständigenentschädigungen im Sinn des Art. 22 werden nicht<br />
erhoben, soweit bayerische Gemeinden, Landkreise, Bezirke,<br />
Zweckverbände oder sonstige bayerische kommunale Körperschaften des<br />
öffentlichen Rechts bei der Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen<br />
Wirkungskreis oder bayerische Landratsämter bei der Wahrnehmung von<br />
Staatsaufgaben staatliche öffentliche Einrichtungen in Anspruch nehmen<br />
und nicht berechtigt sind, die Gebühren und Auslagen oder die<br />
Sachverständigenentschädigung Dritten aufzuerlegen oder sie von Dritten<br />
nicht einziehen können.<br />
(2) 1 Für den Besuch von staatlichen Schulen im Sinn des Bayerischen<br />
<strong>Gesetze</strong>s über das Erziehungs- und Unterrichtswesen sowie für den<br />
Besuch staatlicher Schulen und die Teilnahme an staatlichen Lehrgängen,<br />
die der Aus- und Weiterbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes<br />
und von im Vorbereitungsdienst hierzu befindlichen Personen dienen,<br />
werden Gebühren und Auslagen im Sinn des Art. 21 Abs. 1 nicht erhoben.<br />
2<br />
Das gleiche gilt für die Abnahme staatlicher Prüfungen durch diese<br />
Einrichtungen. 3 Die Erhebung von Gebühren und Auslagen im Sinn des<br />
Art. 21 Abs. 1 für Sonderleistungen dieser Einrichtungen bleibt unberührt.
(3) Für die Abnahme beamtenrechtlicher Prüfungen werden, soweit nicht<br />
bereits Absatz 2 einschlägig ist, Gebühren und Auslagen im Sinn des<br />
Art. 21 Abs. 1 nicht erhoben.<br />
(4) Abweichend von Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 können für die Wiederholung<br />
staatlicher oder beamtenrechtlicher Prüfungen zur Notenverbesserung<br />
Gebühren und Auslagen nach Maßgabe des Art. 21 erhoben werden.<br />
Bay KG Art. 24 Kurtaxe<br />
(1) 1 Für die Bereitstellung von Einrichtungen, die in den Staatsbädern zu<br />
Kurzwecken unterhalten werden, kann auf Grund einer Kurtaxordnung<br />
eine Kurtaxe zugunsten der Staatsbäder erhoben werden. 2 Das Verfahren<br />
zur Festsetzung und Einziehung der Kurtaxe kann auf juristische Personen<br />
des Privatrechts übertragen werden. 3 Die Kurtaxen dürfen höchstens so<br />
bemessen sein, daß die einmaligen und laufenden Aufwendungen für die<br />
Einrichtungen gedeckt werden können. 4 Sind die Vorteile, die den<br />
Abgabeschuldnern aus den Einrichtungen erwachsen können, verschieden<br />
groß, so ist das durch entsprechende Abstufung der Abgabenhöhe zu<br />
berücksichtigen.<br />
(2) 1 Schuldner der Kurtaxe ist, wer im Kurbezirk Unterkunft nimmt oder<br />
Kureinrichtungen oder -veranstaltungen der Staatsbäder in Anspruch<br />
nimmt, ohne dort seine Hauptwohnung im Sinn des Melderechts oder<br />
seinen ständigen Aufenthalt zu haben. 2 Inhaber von Zweitwohnungen<br />
können verpflichtet werden, der Gemeinde über die Benutzung der<br />
Zweitwohnung Auskunft zu geben. 3 Für die Inhaber von Zweitwohnungen<br />
kann in der Kurtaxordnung eine pauschale Abgeltung der Kurtaxe<br />
vorgeschrieben werden, die sich an der durchschnittlichen<br />
Aufenthaltsdauer der Zweitwohnungsinhaber im jeweiligen Staatsbad zu<br />
orientieren hat. 4 Die Pauschalierung entfällt, wenn der<br />
Zweitwohnungsinhaber nachweist, daß er sich im Abgeltungszeitraum<br />
nicht im Staatsbad aufgehalten hat.<br />
(3) 1 Die Kurtaxordnungen für die einzelnen Staatsbäder erläßt das<br />
Staatsministerium der Finanzen als Rechtsverordnungen. 2 Die<br />
Kurtaxordnungen haben insbesondere die Festlegung der Kurbezirke, die<br />
Höhe der Kurtaxen, den Kreis der Abgabenpflichtigen und das Entstehen<br />
der Abgabeschuld zu bestimmen. 3 Sie können auch nähere<br />
Bestimmungen über völlige oder teilweise Befreiungen von der<br />
Abgabepflicht aus sozialen oder sonstigen wichtigen Gründen und über die<br />
Erhebung und Verwendung der Kurtaxen sowie Durchführungsvorschriften<br />
enthalten. 4 Es kann ferner bestimmt werden, daß die Vermieter von<br />
Unterkünften, Reiseunternehmer von Gesellschaftsreisen und Inhaber von<br />
Kurmittelanstalten zur Meldung von Kurgästen und zur Einhebung und<br />
Abführung der Kurtaxe verpflichtet sind und neben dem Schuldner als<br />
Gesamtschuldner für die Zahlung der Kurtaxe haften. 5 In den<br />
Kurtaxordnungen kann bestimmt werden, dass für Meldeformulare, die in<br />
Zusammenhang mit der Kurtaxerhebung ausgegeben und nicht<br />
zurückgegeben wurden, ein pauschaler Ersatz zu leisten ist, der den Zwei-<br />
Monats-Betrag des jeweils geltenden Kurtaxsatzes nicht überschreiten<br />
darf. 6 Die Erhebung des pauschalen Ersatzes unterbleibt, soweit sie der
Billigkeit widerspricht. 7 Soweit in den Kurtaxordnungen nichts anderes<br />
bestimmt ist, gelten Art. 11 bis 19 entsprechend.<br />
(4) 1 Zur Ermittlung der für die Heranziehung zur Kurtaxe maßgeblichen<br />
Verhältnisse ist eine Außenprüfung bei den Abgabepflichtigen sowie den in<br />
Abs. 3 Satz 4 genannten Personen zulässig. 2 Für Außenprüfungen sind die<br />
Einhebungsberechtigten nach Abs. 1 Sätze 1 und 2 zuständig. 3 §§ 194,<br />
196 bis 203 der Abgabenordnung sind entsprechend anzuwenden mit der<br />
Maßgabe, dass in § 196 der Abgabenordnung der Klammerzusatz entfällt.<br />
(5) 1 Der Kurtaxpflichtige ist zur Zahlung eines erhöhten Kurtaxsatzes von<br />
fünfzig Euro verpflichtet, wenn er ohne gültige Gastkarte im Kurbezirk<br />
angetroffen wird, sofern nicht das Beschaffen der Gastkarte aus Gründen<br />
unterblieben ist, die weder der Kurgast noch der Vermieter zu vertreten<br />
hat. 2 Der erhöhte Kurtaxsatz wird zurückerstattet, wenn der Kurgast<br />
nachweist, dass er im Zeitpunkt der Kontrolle Inhaber einer gültigen<br />
Gastkarte war. 3 Abs. 3 Satz 4 gilt für den erhöhten Kurtaxsatz<br />
sinngemäß.<br />
DRITTER ABSCHNITT Sonstige Vorschriften<br />
Bay KG Art. 25 Kostenverwaltung<br />
(1) Die Kostenverwaltung steht unter der Leitung des Staatsministeriums der<br />
Finanzen.<br />
(2) Das Staatsministerium der Finanzen erläßt im Einvernehmen mit den<br />
beteiligten Staatsministerien die näheren Bestimmungen zur Ausführung<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s, insbesondere die Kostenverwaltungsvorschriften.<br />
Bay KG Art. 26 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) 1 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig der<br />
Kostenfestsetzungsbehörde oder anderen Behörden über kostenrechtlich<br />
erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder<br />
sie pflichtwidrig über kostenrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis<br />
läßt, und dadurch Kosten verkürzt oder für sich oder eine andere Person<br />
nicht gerechtfertigte Kostenvorteile erlangt. 2 Satz 1 gilt in den Fällen des<br />
Art. 21 Abs. 1 sowie der Art. 22 und 24 Abs. 1 entsprechend. 3 In den<br />
Fällen der Sätze 1 und 2 stellt auch der Versuch eine Ordnungswidrigkeit<br />
dar.<br />
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall der vorsätzlichen Begehung mit einer<br />
Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, im Fall der leichtfertigen<br />
Begehung mit einer Geldbuße bis zu zwölftausendfünfhundert Euro<br />
geahndet werden.<br />
(3) Eine Geldbuße wird nicht festgesetzt, soweit der Täter unrichtige oder<br />
unvollständige Angaben bei einer Behörde im Sinn des Absatzes 1<br />
berichtigt oder ergänzt oder unterlassene Angaben nachholt, bevor ihm<br />
die Einleitung eines Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekanntgegeben<br />
wurde.<br />
(4) Die Geldbuße fließt in die Kasse der Körperschaft, der die Abgaben, auf<br />
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, zustehen.
(5) Zuständige Verwaltungsbehörde zur Verfolgung und Ahndung der<br />
Ordnungswidrigkeiten ist im Fall des Art. 24 das Landesamt für Finanzen.<br />
Bay KG Art. 27 Erhebung von Kosten in anderen Fällen<br />
(1) Dieses Gesetz findet auf die Erhebung von Kosten nach anderen<br />
Vorschriften entsprechende Anwendung, soweit dort nichts Abweichendes<br />
bestimmt ist.<br />
(2) Für den Bereich der Justizverwaltung findet der Erste Abschnitt dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s nur insoweit Anwendung, als dies in <strong>Gesetze</strong>n oder<br />
Rechtsverordnungen ausdrücklich bestimmt ist.<br />
(3) In Fällen, in denen der Bund von seiner Ermächtigung zum Erlass einer<br />
Regelung von Gebühren und Auslagen keinen Gebrauch macht und in<br />
denen die Landesregierungen zum Erlass entsprechender Vorschriften<br />
ermächtigt sind, gilt Art. 5 entsprechend, soweit nichts Abweichendes<br />
bestimmt ist.<br />
Bay KG Art. 28 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
(1) 1 Dieses Gesetz tritt am 1. März 1998 in Kraft. 2 Es gilt für alle Kosten, die<br />
nach diesem Zeitpunkt entstehen.<br />
(2) Gleichzeitig tritt das Kostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 25. Juni 1969 (BayRS 2013-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 9 des<br />
<strong>Gesetze</strong>s vom 26. Juli 1995 (GVBl S. 353), außer Kraft.<br />
(3) Die Verordnung über das Zufließen und die Überlassung von Kosten<br />
(Gebühren und Auslagen) nach Art. 1 Abs. 2 Satz 2 des Kostengesetzes<br />
(ZuflÜV) vom 9. August 1996 (GVBl S. 388, ber. S. 477, BayRS 2013-1-<br />
15-F) wird aufgehoben.
Gesetz über die kommunale<br />
Zusammenarbeit (Bay KommZG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, ber. 1995 S. 98), geändert<br />
durch <strong>Gesetze</strong> vom 10. August 1994 (GVBl. S. 761), vom 26. Juli 1995 (GVBl. S. 376), vom 28.<br />
Juni 1996 (GVBl. S. 223), vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 344), vom 24. Juli 1998 (GVBl. S. 424), vom<br />
24. Dezember 2002 (GVBl. S. 962), vom 26. Juli 2004 (GVBl. S. 272), vom 10. April 2007 (GVBl.<br />
S. 271), vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 400) (FN BayRS 2020-6-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften<br />
Art. 1 Anwendungsbereich<br />
Art. 2 Rechtsformen der kommunalen Zusammenarbeit<br />
Art. 3 Voraussetzungen der kommunalen Zusammenarbeit<br />
ZWEITER TEIL Kommunale Arbeitsgemeinschaften<br />
Art. 4 Einfache Arbeitsgemeinschaften<br />
Art. 5 Besondere Arbeitsgemeinschaften<br />
Art. 6 Aufhebung und Kündigung besonderer Arbeitsgemeinschaften<br />
DRITTER TEIL Zweckvereinbarungen<br />
Art. 7 Beteiligte und Aufgaben<br />
Art. 8 Übergang der Befugnisse<br />
Art. 9<br />
Art. 10 Inhalt<br />
Art. 11 Satzungs- und Verordnungsrecht<br />
Art. 12 Anzeige und Genehmigung<br />
Art. 13 Amtliche Bekanntmachung und Wirksamwerden<br />
Art. 14 Änderung, Aufhebung und Kündigung<br />
Art. 15 Wegfall von Beteiligten
Art. 16 Pflichtvereinbarung<br />
VIERTER TEIL Zweckverbände<br />
1. ABSCHNITT Bildung und grundsätzliche Bestimmungen<br />
Art. 17 Beteiligte und Aufgaben<br />
Art. 18 Bildung des Zweckverbands<br />
Art. 19 Inhalt der Verbandssatzung<br />
Art. 20 Genehmigung der Verbandssatzung<br />
Art. 21 Amtliche Bekanntmachung der Verbandssatzung, Zeitpunkt des<br />
Entstehens des Zweckverbands<br />
Art. 22 Übergang von Aufgaben und Befugnissen, Satzungs- und<br />
Verordnungsrecht<br />
Art. 23 Dienstherrneigenschaft<br />
Art. 24 Amtliche Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen des<br />
Zweckverbands<br />
Art. 25 Wappenführung<br />
Art. 26 Anzuwendende Vorschriften<br />
Art. 27 Ausgleich<br />
Art. 28 Pflichtverband<br />
2. ABSCHNITT Verfassung und Verwaltung<br />
Art. 29 Organe<br />
Art. 30 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der übrigen<br />
Verbandsräte<br />
Art. 31 Zusammensetzung der Verbandsversammlung<br />
Art. 32 Einberufung der Verbandsversammlung, Öffentlichkeit<br />
Art. 33 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung
Art. 34 Zuständigkeit der Verbandsversammlung<br />
Art. 35 Wahl des Verbandsvorsitzenden<br />
Art. 36 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden<br />
Art. 37 Form der Vertretung nach außen<br />
Art. 38 Dienstkräfte<br />
Art. 39 Geschäftsstelle und Geschäftsleiter<br />
3. ABSCHNITT Verbandswirtschaft<br />
Art. 40 Anzuwendende Vorschriften<br />
Art. 41 Haushaltssatzung<br />
Art. 42 Deckung des Finanzbedarfs<br />
Art. 43 Prüfungswesen<br />
4. ABSCHNITT Änderung der Verbandssatzung und Auflösung<br />
Art. 44 Änderung der Verbandssatzung, Kündigung aus wichtigem Grund<br />
Art. 45 Wegfall von Verbandsmitgliedern<br />
Art. 46 Auflösung<br />
Art. 47 Abwicklung<br />
Art. 48 Genehmigung, Anzeige und Bekanntmachung<br />
FÜNFTER TEIL Gemeinsame Kommunalunternehmen<br />
Art. 49 Entstehung<br />
Art. 50 Vorschriften für gemeinsame Kommunalunternehmen<br />
SECHSTER TEIL Aufsicht und Rechtsbehelfe<br />
1. ABSCHNITT Aufsicht<br />
Art. 51 Grundsatz
Art. 52 Aufsichtsbehörden<br />
2. ABSCHNITT Schlichtung von Streitigkeiten, Rechtsbehelfe<br />
Art. 53 Schlichtung von Streitigkeiten<br />
Art. 54 Erlaß des Widerspruchsbescheids (§ 73 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)<br />
SIEBTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 55 Inkrafttreten<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften<br />
Bay KommZG Art. 1 Anwendungsbereich<br />
(1) 1 Dieses Gesetz regelt die kommunale Zusammenarbeit von Gemeinden,<br />
Landkreisen und Bezirken. 2 Verwaltungsgemeinschaften stehen für ihren<br />
Aufgabenbereich Gemeinden gleich; das gilt auch für die Eigentümer<br />
gemeindefreier Grundstücke, soweit sie öffentliche Aufgaben zu erfüllen<br />
haben, die im Gemeindegebiet der Gemeinde obliegen. 3 Andere<br />
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, ferner<br />
natürliche Personen und juristische Personen des Privatrechts können sich<br />
nur nach den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s an der Zusammenarbeit<br />
beteiligen.<br />
(2) 1 Für die Beteiligung von Zweckverbänden an der kommunalen<br />
Zusammenarbeit gelten die gleichen Vorschriften wie für die ihnen<br />
angehörenden Gemeinden, Landkreise oder Bezirke. 2 Für die Beteiligung<br />
selbständiger Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts sind die für<br />
ihre Gewährträger geltenden Vorschriften maßgebend.<br />
(3) 1 Vorschriften anderer <strong>Gesetze</strong> über die kommunale Zusammenarbeit oder<br />
die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben in privatrechtlicher Form<br />
bleiben unberührt. 2 Auf Planungsverbände nach § 205 des<br />
Baugesetzbuchs sind unbeschadet des § 205 Abs. 2 bis 5 des<br />
Baugesetzbuchs die für die Zweckverbände geltenden Vorschriften dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s einschließlich des Art. 20 entsprechend anzuwenden.<br />
(4) 1 Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, wenn es gesetzlich ausgeschlossen<br />
ist, Aufgaben oder Befugnisse gemeinsam wahrzunehmen. 2 Das Recht,<br />
Steuern zu erheben und eine eigene Polizei zu errichten, kann nicht<br />
übertragen werden.<br />
Bay KommZG Art. 2 Rechtsformen der kommunalen Zusammenarbeit<br />
(1) Für die kommunale Zusammenarbeit können kommunale<br />
Arbeitsgemeinschaften gegründet, Zweckvereinbarungen geschlossen und<br />
Zweckverbände sowie gemeinsame Kommunalunternehmen gebildet<br />
werden.<br />
(2) Durch kommunale Arbeitsgemeinschaften und Zweckvereinbarungen<br />
entstehen keine neuen Rechtspersönlichkeiten.
(3) 1 Die Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 2 Sie<br />
verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der <strong>Gesetze</strong> unter eigener<br />
Verantwortung.<br />
(4) Gemeinsame Kommunalunternehmen sind selbständige Unternehmen in<br />
der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts, die von mehreren<br />
kommunalen Gebietskörperschaften getragen werden.<br />
Bay KommZG Art. 3 Voraussetzungen der kommunalen<br />
Zusammenarbeit<br />
(1) 1 Gemeinden, Landkreise und Bezirke können nach den Vorschriften dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s zusammenarbeiten, um Aufgaben, zu deren Wahrnehmung sie<br />
berechtigt oder verpflichtet sind, gemeinsam zu erfüllen. 2 Das gilt nicht<br />
für Gemeinden, die der gleichen Verwaltungsgemeinschaft angehören,<br />
wenn die Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe ebenso wirkungsvoll und<br />
wirtschaftlich erfüllen kann.<br />
(2) Sieht dieses Gesetz eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit vor (Art. 16<br />
und 28), so kann sie nur zwischen Gebietskörperschaften gleicher Art<br />
angeordnet werden, ferner zwischen kreisfreien und kreisangehörigen<br />
Gemeinden und zwischen Landkreisen und kreisfreien Gemeinden, wenn<br />
diese Gebietskörperschaften gleiche Pflichtaufgaben zu erfüllen haben.<br />
ZWEITER TEIL Kommunale Arbeitsgemeinschaften<br />
Bay KommZG Art. 4 Einfache Arbeitsgemeinschaften<br />
(1) 1 Gemeinden, Landkreise und Bezirke können durch öffentlich-rechtlichen<br />
Vertrag eine Arbeitsgemeinschaft bilden. 2 An ihr können sich auch<br />
sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,<br />
ferner natürliche Personen und juristische Personen des Privatrechts<br />
beteiligen.<br />
(2) 1 Die Arbeitsgemeinschaft befaßt sich mit Angelegenheiten, welche die an<br />
ihr Beteiligten gemeinsam berühren. 2 Sie dient insbesondere dazu,<br />
Planungen der einzelnen Beteiligten und das Tätigwerden von<br />
Einrichtungen aufeinander abzustimmen, gemeinsame<br />
Flächennutzungspläne vorzubereiten und die gemeinsame wirtschaftliche<br />
und zweckmäßige Erfüllung der Aufgaben in einem größeren nachbarlichen<br />
Gebiet sicherzustellen.<br />
(3) Durch die Beteiligung an einer Arbeitsgemeinschaft werden die Rechte und<br />
Pflichten der Beteiligten als Träger von Aufgaben und Befugnissen<br />
gegenüber Dritten nicht berührt.<br />
(4) 1 In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag sind die Aufgaben der<br />
Arbeitsgemeinschaft und, soweit das erforderlich ist, die<br />
Geschäftsordnung und die Deckung des Finanzbedarfs zu regeln. 2 Der<br />
Vertrag wird wirksam, sobald er von allen Beteiligten beschlossen und<br />
unterschrieben ist. 3 In dem Vertrag kann ein anderer Zeitpunkt für sein<br />
Wirksamwerden bestimmt werden.<br />
(5) weggefallen
Bay KommZG Art. 5 Besondere Arbeitsgemeinschaften<br />
(1) 1 Es kann vereinbart werden, daß die Beteiligten an Beschlüsse der<br />
Arbeitsgemeinschaft gebunden sind, wenn die zuständigen Organe aller<br />
Beteiligten diesen Beschlüssen zugestimmt haben. 2 Ferner kann<br />
vereinbart werden, daß die Beteiligten an Beschlüsse über<br />
Angelegenheiten der Geschäftsführung und des Finanzbedarfs,<br />
Verfahrensfragen und den Erlaß von Richtlinien für die Planung und<br />
Durchführung einzelner Aufgaben gebunden sind, wenn die Mehrheit der<br />
zuständigen Organe der beteiligten Gebietskörperschaften diesen<br />
Beschlüssen zugestimmt hat.<br />
(2) Es kann vereinbart werden, daß die zuständigen Organe der Beteiligten<br />
verpflichtet sind, binnen drei Monaten über Anregungen der<br />
Arbeitsgemeinschaft zu beschließen; in der Vereinbarung kann eine<br />
andere Frist festgelegt werden.<br />
(3) weggefallen<br />
Bay KommZG Art. 6 Aufhebung und Kündigung besonderer<br />
Arbeitsgemeinschaften<br />
(1) 1 Wird eine besondere Arbeitsgemeinschaft aufgehoben, so hat eine<br />
Auseinandersetzung stattzufinden, soweit dies erforderlich ist. 2 Der<br />
Vertrag soll hierüber das Nähere bestimmen.<br />
(2) 1 Wird eine besondere Arbeitsgemeinschaft auf unbestimmte Zeit oder auf<br />
mehr als 20 Jahre gebildet, so ist in der Vereinbarung über ihre Bildung zu<br />
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, innerhalb welcher Frist und<br />
in welcher Form sie von den Beteiligten gekündigt werden kann<br />
(ordentliche Kündigung). 2 Eine besondere Arbeitsgemeinschaft kann auch<br />
aus wichtigem Grund gekündigt werden (außerordentliche Kündigung).<br />
DRITTER TEIL Zweckvereinbarungen<br />
Bay KommZG Art. 7 Beteiligte und Aufgaben<br />
(1) Gemeinden, Landkreise und Bezirke können durch öffentlich-rechtlichen<br />
Vertrag eine Zweckvereinbarung schließen.<br />
(2) 1 Auf Grund einer Zweckvereinbarung können die beteiligten<br />
Gebietskörperschaften einer von ihnen einzelne oder alle mit einem<br />
bestimmten Zweck zusammenhängenden Aufgaben übertragen; eine<br />
Gebietskörperschaft kann dabei insbesondere gestatten, daß die übrigen<br />
eine von ihr betriebene Einrichtung mitbenutzen. 2 Der Umfang der<br />
übertragenen Aufgaben soll im Verhältnis zum Umfang der<br />
entsprechenden eigenen Aufgaben der übernehmenden<br />
Gebietskörperschaft nachrangig sein.<br />
(3) Auf Grund einer Zweckvereinbarung können die beteiligten<br />
Gebietskörperschaften einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck<br />
zusammenhängenden Aufgaben gemeinschaftlich durchführen und hierzu<br />
gemeinschaftliche Einrichtungen schaffen oder betreiben.<br />
(4) In einer Zweckvereinbarung kann auch geregelt werden, daß eine<br />
Gebietskörperschaft den beteiligten anderen Gebietskörperschaften<br />
Dienstkräfte zur Erfüllung ihrer Aufgaben zeitanteilig zur Verfügung stellt.
(5) 1 Ein Zweckverband kann eine Zweckvereinbarung abschließen, soweit das<br />
der Erfüllung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben<br />
dient. 2 Darüber hinaus kann er mit Zustimmung einer Mehrheit von zwei<br />
Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung<br />
durch eine Zweckvereinbarung Aufgaben anderer Gebietskörperschaften<br />
übernehmen, wenn<br />
1. diese Aufgaben seinen Aufgaben gleichartig sind,<br />
2. der Umfang der Aufgaben im Verhältnis zum Umfang der dem<br />
Zweckverband von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben nachrangig<br />
ist,<br />
3. die anderen Gebietskörperschaften sich in der Zweckvereinbarung das<br />
Recht zur Steuerung der Aufgabenerfüllung vorbehalten,<br />
4. in der Zweckvereinbarung ein angemessener Kostenersatz vereinbart<br />
wird und<br />
5. die Übernahme der Aufgaben dem öffentlichen Wohl entspricht, z. B.<br />
der Verwaltungsvereinfachung oder Kostensenkung im Rahmen<br />
nachbarschaftlicher Zusammenarbeit dient.<br />
Bay KommZG Art. 8 Übergang der Befugnisse<br />
(1) Wird einer Gebietskörperschaft durch Zweckvereinbarung eine Aufgabe<br />
übertragen (Art. 7 Abs. 2), so gehen auch die zur Erfüllung dieser Aufgabe<br />
notwendigen Befugnisse auf sie über, es sei denn, daß in der<br />
Zweckvereinbarung ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.<br />
(2) Die übrigen Beteiligten werden durch die Zweckvereinbarung von ihrer<br />
gesetzlichen Pflicht insoweit befreit, als gesetzliche Aufgaben auf eine<br />
andere Gebietskörperschaft übertragen werden oder Befugnisse auf sie<br />
übergehen.<br />
(3) Im Fall des Art. 7 Abs. 3 verbleiben die Befugnisse bei den Beteiligten; sie<br />
können nicht gemeinschaftlich ausgeübt werden.<br />
(4) Gebietskörperschaften, denen gemäß Art. 7 Abs. 4 Dienstkräfte zur<br />
Verfügung gestellt werden, können ihnen wie eigenen Bediensteten<br />
Befugnisse übertragen.<br />
Bay KommZG Art. 9 (weggefallen)<br />
Bay KommZG Art. 10 Inhalt<br />
(1) Die Zweckvereinbarung muß die Aufgaben aufführen, die einer der<br />
beteiligten Gebietskörperschaften übertragen oder die gemeinschaftlich<br />
durchgeführt werden sollen.<br />
(2) Werden Aufgaben übertragen, so kann den übrigen Beteiligten durch die<br />
Zweckvereinbarung das Recht auf Anhörung oder Zustimmung in<br />
bestimmten Angelegenheiten eingeräumt werden.<br />
(3) In der Zweckvereinbarung kann ein angemessener Kostenersatz für die<br />
Erfüllung der übertragenen Aufgaben vorgesehen werden; er darf<br />
höchstens so bemessen sein, daß der nach den Grundsätzen einer<br />
ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung berechnete Aufwand gedeckt wird.
(4) Werden Aufgaben gemeinschaftlich durchgeführt, so muß die<br />
Zweckvereinbarung bestimmen, nach welchem Maßstab der Aufwand<br />
unter den Beteiligten verteilt wird.<br />
Bay KommZG Art. 11 Satzungs- und Verordnungsrecht<br />
(1) 1 Durch die Zweckvereinbarung kann der Gebietskörperschaft, auf die<br />
Aufgaben übergehen, das Recht übertragen werden, zur Erfüllung dieser<br />
Aufgaben Satzungen und Verordnungen auch für das Gebiet der übrigen<br />
Beteiligten zu erlassen. 2 Bereits geltende Satzungen und Verordnungen<br />
der Gebietskörperschaft können auch durch die Zweckvereinbarung auf<br />
dieses Gebiet erstreckt werden; sie sind in der Zweckvereinbarung unter<br />
Angabe ihrer Fundstelle genau zu bezeichnen. 3 Die übrigen Beteiligten<br />
haben in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form<br />
auf die Veröffentlichung der Satzungen oder Verordnungen hinzuweisen.<br />
(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann in der Zweckvereinbarung bestimmt<br />
werden, daß die Gebietskörperschaft im Geltungsbereich der von ihr<br />
erlassenen Satzungen oder Verordnungen alle zu deren Durchführung<br />
erforderlichen Maßnahmen wie im eigenen Gebiet treffen kann.<br />
Bay KommZG Art. 12 Anzeige und Genehmigung<br />
(1) Eine Zweckvereinbarung, nach der nur Aufgaben übertragen oder<br />
gemeinschaftlich durchgeführt werden, ist der Aufsichtsbehörde<br />
anzuzeigen.<br />
(2) 1 Eine Zweckvereinbarung, durch die eine beteiligte Gebietskörperschaft<br />
auch Befugnisse erhält, bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.<br />
2<br />
Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn dem Abschluß der<br />
Zweckvereinbarung Gründe des öffentlichen Wohls entgegenstehen, der<br />
Abschluß der Vereinbarung nicht zulässig ist oder die Vereinbarung den<br />
gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht. 3 Sollen durch die<br />
Zweckvereinbarung Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises<br />
wahrgenommen werden, so entscheidet die Aufsichtsbehörde nach<br />
Anhörung der Fachaufsichtsbehörde über die Genehmigung nach<br />
pflichtgemäßem Ermessen. 4 Äußert sich die Fachaufsichtsbehörde nicht<br />
binnen eines Monats nach Eingang der Anfrage, kann die Aufsichtsbehörde<br />
davon ausgehen, dass die von der Fachaufsichtsbehörde zu vertretenden<br />
Belange von der Zweckvereinbarung nicht berührt werden.<br />
(3) Ist für die Durchführung einer Angelegenheit, zu deren Erfüllung eine<br />
Zweckvereinbarung abgeschlossen werden soll, eine besondere<br />
Genehmigung erforderlich, so kann die Vereinbarung nicht genehmigt<br />
werden, wenn zu erwarten ist, daß die besondere Genehmigung versagt<br />
wird.<br />
(4) weggefallen<br />
Bay KommZG Art. 13 Amtliche Bekanntmachung und Wirksamwerden<br />
(1) 1 Die Aufsichtsbehörde hat eine genehmigungspflichtige<br />
Zweckvereinbarung und ihre Genehmigung in ihrem Amtsblatt amtlich<br />
bekanntzumachen. 2 Die Zweckvereinbarung wird am Tag nach der<br />
amtlichen Bekanntmachung wirksam.
(2) Teile einer genehmigungspflichtigen Zweckvereinbarung, die nur das<br />
Verhältnis der Beteiligten untereinander betreffen, ohne daß Rechte oder<br />
Pflichten Dritter berührt werden, brauchen nicht amtlich bekanntgemacht<br />
zu werden.<br />
(3) Eine anzeigepflichtige Zweckvereinbarung wird ohne amtliche<br />
Bekanntmachung wirksam, sobald sie von allen Beteiligten beschlossen<br />
und unterschrieben ist.<br />
(4) In der Zweckvereinbarung kann ein Zeitpunkt für ihr Wirksamwerden<br />
abweichend von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bestimmt werden.<br />
Bay KommZG Art. 14 Änderung, Aufhebung und Kündigung<br />
(1) War die Zweckvereinbarung anzeigepflichtig, so ist auch ihre Änderung<br />
oder Aufhebung der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.<br />
(2) 1 War die Zweckvereinbarung genehmigungspflichtig, so bedarf auch ihre<br />
Änderung oder Aufhebung der Genehmigung. 2 Die Vorschriften des<br />
Art. 12 über die Genehmigung einer Zweckvereinbarung gelten<br />
entsprechend. 3 Der Genehmigung zur Aufhebung oder zur Änderung auf<br />
Grund einer Kündigung können Gründe des öffentlichen Wohls nur<br />
entgegenstehen, wenn die Voraussetzungen für eine Pflichtvereinbarung<br />
vorliegen.<br />
(3) 1 Ist die Zweckvereinbarung nicht befristet oder auf mehr als 20 Jahre<br />
geschlossen, so muß sie bestimmen, unter welchen Voraussetzungen,<br />
innerhalb welcher Frist und in welcher Form sie von einem Beteiligten<br />
gekündigt werden kann (ordentliche Kündigung). 2 Jede<br />
Zweckvereinbarung kann auch aus wichtigem Grund gekündigt werden<br />
(außerordentliche Kündigung).<br />
(4) 1 Wird eine Zweckvereinbarung aufgehoben, so hat eine<br />
Auseinandersetzung stattzufinden, soweit das erforderlich ist. 2 Die<br />
Zweckvereinbarung soll hierüber das Nähere bestimmen.<br />
(5) Wird die Zweckvereinbarung geändert oder aufgehoben, so gilt Art. 13<br />
entsprechend.<br />
Bay KommZG Art. 15 Wegfall von Beteiligten<br />
(1) 1 Wird eine Gebietskörperschaft, die an einer Zweckvereinbarung beteiligt<br />
ist, in eine andere Gebietskörperschaft eingegliedert oder mit einer<br />
anderen zusammengeschlossen, so tritt die Gebietskörperschaft, in welche<br />
die an der Zweckvereinbarung beteiligte Körperschaft eingegliedert oder<br />
zu der sie zusammengeschlossen wird, an die Stelle der früheren. 2 Das<br />
gleiche gilt, wenn eine Gebietskörperschaft auf mehrere andere aufgeteilt<br />
wird oder wenn ihre Aufgaben oder Befugnisse, die Gegenstand der<br />
Zweckvereinbarung sind, auf eine oder mehrere andere<br />
Gebietskörperschaften übergehen.<br />
(2) 1 Wenn Gründe des öffentlichen Wohls nicht entgegenstehen, kann jeder<br />
Beteiligte die Zweckvereinbarung bis zum Ablauf von drei Monaten nach<br />
dem Eintritt der neuen Körperschaft kündigen. 2 Die Art. 13 und 14 Abs. 1<br />
und 2 gelten entsprechend.
Bay KommZG Art. 16 Pflichtvereinbarung<br />
(1) Ist der Abschluß einer Zweckvereinbarung zur Erfüllung von<br />
Pflichtaufgaben einer Gebietskörperschaft aus zwingenden Gründen des<br />
öffentlichen Wohls geboten, so kann die Aufsichtsbehörde den beteiligten<br />
Gebietskörperschaften eine angemessene Frist setzen, die<br />
Zweckvereinbarung zu schließen.<br />
(2) 1 Kommt innerhalb der Frist die Zweckvereinbarung nicht zustande, so<br />
trifft die Aufsichtsbehörde eine Regelung, die wie eine Vereinbarung<br />
zwischen den Beteiligten gilt (Pflichtvereinbarung). 2 Ehe die<br />
Aufsichtsbehörde hierüber entscheidet, muß sie den beteiligten<br />
Gebietskörperschaften Gelegenheit geben, ihre Auffassung darzulegen.<br />
3<br />
Die Erörterung kann in einer gemeinsamen Besprechung nach Art. 9<br />
Abs. 2 Satz 2 stattfinden.<br />
(3) 1 Die Art. 8, 10, 11 und 13 bis 15 gelten entsprechend. 2 Die<br />
Pflichtvereinbarung kann jedoch von den Beteiligten nur mit Genehmigung<br />
der Aufsichtsbehörde geändert werden. 3 Für die Genehmigung gelten<br />
Art. 12 Abs. 2 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 entsprechend.<br />
(4) 1 Die Beteiligten können eine Pflichtvereinbarung nicht von sich aus<br />
aufheben. 2 Sind die Gründe für eine Pflichtvereinbarung weggefallen, so<br />
hat die Aufsichtsbehörde das den Beteiligten schriftlich zu erklären. 3 Die<br />
Pflichtvereinbarung gilt in diesem Fall als einfache Zweckvereinbarung<br />
weiter; sie kann von jedem Beteiligten innerhalb einer Frist von sechs<br />
Monaten seit dem Zugang der Erklärung gekündigt werden.<br />
VIERTER TEIL Zweckverbände<br />
1. ABSCHNITT Bildung und grundsätzliche Bestimmungen<br />
Bay KommZG Art. 17 Beteiligte und Aufgaben<br />
(1) Gemeinden, Landkreise und Bezirke können sich zu einem Zweckverband<br />
(Freiverband) zusammenschließen und ihm einzelne Aufgaben oder alle<br />
mit einem bestimmten Zweck zusammenhängenden Aufgaben übertragen.<br />
(2) 1 Neben einer der in Absatz 1 genannten Gebietskörperschaften können<br />
auch andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen<br />
Rechts Mitglieder eines Zweckverbands sein, wenn nicht die für sie<br />
geltenden besonderen Vorschriften die Beteiligung ausschließen. 2 Ebenso<br />
können natürliche Personen und juristische Personen des Privatrechts<br />
Mitglieder eines Zweckverbands sein, wenn die Erfüllung der<br />
Verbandsaufgaben dadurch gefördert wird und Gründe des öffentlichen<br />
Wohls nicht entgegenstehen.<br />
(3) 1 Die Mitgliedschaft einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands<br />
außerhalb des Freistaates Bayern oder einer sonstigen nicht der Aufsicht<br />
des Freistaates Bayern unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung<br />
des öffentlichen Rechts in einem Zweckverband, der innerhalb des<br />
Freistaates Bayern seinen Sitz hat, bedarf der Genehmigung des<br />
Staatsministeriums des Innern. 2 Das gleiche gilt, wenn eine Gemeinde,<br />
ein Landkreis, ein Bezirk oder eine sonstige der Aufsicht des Freistaates<br />
Bayern unterstehende Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen
Rechts in einem Zweckverband Mitglied werden will, der seinen Sitz<br />
außerhalb des Freistaates Bayern hat.<br />
Bay KommZG Art. 18 Bildung des Zweckverbands<br />
Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbands werden im Rahmen dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s durch eine von den Beteiligten zu vereinbarende Verbandssatzung<br />
geregelt.<br />
Bay KommZG Art. 19 Inhalt der Verbandssatzung<br />
(1) Die Verbandssatzung muß enthalten<br />
1. den Namen und den Sitz des Zweckverbands,<br />
2. die Verbandsmitglieder und den räumlichen Wirkungsbereich des<br />
Zweckverbands,<br />
3. die Aufgaben des Zweckverbands,<br />
4. die Sitz- und Stimmenverteilung in der Verbandsversammlung,<br />
5. den Maßstab, nach dem die Verbandsmitglieder zur Deckung des<br />
Finanzbedarfs des Zweckverbands beizutragen haben<br />
(Umlegungsschlüssel).<br />
(2) Die Verbandssatzung kann darüber hinaus weitere Vorschriften enthalten<br />
über<br />
1. die Verfassung und Verwaltung,<br />
2. die Verbandswirtschaft,<br />
3. die Abwicklung im Fall der Auflösung des Zweckverbands,<br />
4. die Schlichtung von Streitigkeiten durch ein besonderes<br />
Schiedsverfahren,<br />
5. sonstige Rechtsverhältnisse des Zweckverbands,<br />
soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält oder die Regelung in der<br />
Verbandssatzung zuläßt.<br />
Bay KommZG Art. 20 Genehmigung der Verbandssatzung<br />
(1) 1 Die Verbandssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.<br />
2<br />
Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn der Bildung des<br />
Zweckverbands Gründe des öffentlichen Wohls entgegenstehen, die<br />
Bildung des Verbands unzulässig ist oder die Satzung den gesetzlichen<br />
Vorschriften nicht entspricht. 3 Sollen durch den Zweckverband Aufgaben<br />
des übertragenen Wirkungskreises wahrgenommen werden, so<br />
entscheidet die Aufsichtsbehörde nach Anhörung der<br />
Fachaufsichtsbehörde über die Genehmigung nach pflichtgemäßem<br />
Ermessen. 4 Äußert sich die Fachaufsichtsbehörde nicht binnen eines<br />
Monats nach Eingang der Anfrage, kann die Aufsichtsbehörde davon<br />
ausgehen, dass die von der Fachaufsichtsbehörde zu vertretenden<br />
Belange von der Bildung des Zweckverbands nicht berührt werden.<br />
(2) Ist für die Übernahme oder Durchführung einer Aufgabe, für die der<br />
Zweckverband gebildet werden soll, eine besondere Genehmigung<br />
erforderlich, so kann die Verbandssatzung nicht genehmigt werden, wenn<br />
zu erwarten ist, daß die besondere Genehmigung versagt wird.<br />
(3) weggefallen
Bay KommZG Art. 21 Amtliche Bekanntmachung der Verbandssatzung,<br />
Zeitpunkt des Entstehens des Zweckverbands<br />
(1) 1 Die Aufsichtsbehörde hat die Verbandssatzung und ihre Genehmigung in<br />
ihrem Amtsblatt amtlich bekanntzumachen. 2 Der Zweckverband entsteht<br />
am Tag nach dieser Bekanntmachung, wenn nicht in der Verbandssatzung<br />
ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 3 Nach der ordnungsgemäßen<br />
Bekanntmachung können Rechtsverstöße bei der Gründung des<br />
Zweckverbands nur mit Wirkung für die Zukunft geltend gemacht werden.<br />
(2) Verbandsmitglieder, die Gebietskörperschaften sind, sollen in der für die<br />
Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die<br />
Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 1 hinweisen.<br />
Bay KommZG Art. 22 Übergang von Aufgaben und Befugnissen,<br />
Satzungs- und Verordnungsrecht<br />
(1) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband<br />
übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die dazu notwendigen Befugnisse<br />
auszuüben, gehen auf den Zweckverband über.<br />
(2) Der Zweckverband kann an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und<br />
Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet erlassen.<br />
(3) Die Verbandssatzung kann den Übergang einzelner Befugnisse und das<br />
Recht, Satzungen und Verordnungen zu erlassen, ausschließen; das gilt<br />
nicht, wenn der Übergang nach der Natur der übertragenen Aufgaben<br />
zwingend erforderlich ist.<br />
(4) Hat der Zweckverband nach den ihm in der Verbandssatzung<br />
übertragenen Aufgaben an Stelle der Verbandsmitglieder deren<br />
Beteiligung an Unternehmen oder deren Mitgliedschaft an Verbänden zu<br />
übernehmen, so sind die einzelnen Verbandsmitglieder zu den<br />
entsprechenden Rechtsgeschäften und Verwaltungsmaßnahmen<br />
verpflichtet.<br />
Bay KommZG Art. 23 Dienstherrneigenschaft<br />
(1) 1 Den Zweckverbänden steht das Recht zu, Dienstherr von Beamten zu<br />
sein, wenn ihnen nur Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des<br />
öffentlichen Rechts angehören, die selbst Dienstherrneigenschaft besitzen.<br />
2<br />
Anderen Zweckverbänden kann das Recht, Dienstherr von Beamten zu<br />
sein, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde durch die Verbandssatzung<br />
verliehen werden.<br />
(2) 1 Gehen Aufgaben eines Zweckverbands wegen Auflösung oder aus<br />
anderen Gründen ganz oder teilweise auf andere juristische Personen des<br />
öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit über, so gelten für die<br />
Übernahme und die Rechtsstellung der Beamten und<br />
Versorgungsempfänger des Zweckverbands Art. 51 bis 54 und 69 des<br />
Bayerischen Beamtengesetzes, bei länderübergreifendem<br />
Aufgabenübergang §§ 16 bis 19 des Beamtenstatusgesetzes. 2 Die<br />
Verbandssatzung eines Zweckverbands, der Dienstherr von Beamten<br />
werden soll, muß Bestimmungen darüber enthalten, wer die Beamten und<br />
Versorgungsempfänger zu übernehmen hat, wenn der Zweckverband
aufgelöst wird, ohne daß seine bisherigen Aufgaben auf andere juristische<br />
Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen.<br />
Bay KommZG Art. 24 Amtliche Bekanntmachung von Satzungen und<br />
Verordnungen des Zweckverbands<br />
(1) 1 Der Zweckverband macht seine Satzungen und Verordnungen in seinem<br />
Amtsblatt amtlich bekannt. 2 Unterhält er kein eigenes Amtsblatt, werden<br />
die Satzungen und Verordnungen im Amtsblatt des Landratsamts oder des<br />
Landkreises oder den Amtsblättern aller Beteiligten, wenn sich der<br />
räumliche Wirkungskreis des Zweckverbands über den Landkreis hinaus<br />
erstreckt, im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde oder den Amtsblättern aller<br />
Beteiligten bekannt gemacht.<br />
(2) Verbandsmitglieder, die Gebietskörperschaften sind, sollen in der für die<br />
Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die<br />
Veröffentlichung nach Absatz 1 hinweisen.<br />
Bay KommZG Art. 25 Wappenführung<br />
1 Der Zweckverband führt weder Fahne noch eigenes Wappen. 2 Mit<br />
Zustimmung eines Verbandsmitglieds kann er dessen Wappen führen. 3 Die<br />
Führung des kleinen Staatswappens regelt sich nach den hierfür geltenden<br />
besonderen Vorschriften.<br />
Bay KommZG Art. 26 Anzuwendende Vorschriften<br />
(1) 1 Soweit nicht dieses Gesetz oder in seinem Rahmen die Verbandssatzung<br />
besondere Vorschriften enthalten, sind auf den Zweckverband die für<br />
Gemeinden geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 2 Gehören<br />
einem Zweckverband als kommunale Gebietskörperschaft nur Landkreise<br />
oder nur Landkreise und Bezirke an, so sind die für Landkreise, gehören<br />
ihm nur Bezirke an, so sind die für Bezirke geltenden Vorschriften<br />
entsprechend anzuwenden. 3 Die Verbandssatzung kann mit Genehmigung<br />
der Aufsichtsbehörde vorschreiben, daß abweichend von den Sätzen 1 und<br />
2 die Vorschriften entsprechend anzuwenden sind, die für andere dem<br />
Zweckverband angehörende Gebietskörperschaften gelten.<br />
(2) In Satzungen des Zweckverbands können Zuwiderhandlungen als<br />
Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße bedroht werden, soweit dies nach den<br />
Vorschriften, die gemäß Absatz 1 entsprechend anwendbar sind, zulässig<br />
ist (bewehrte Satzungen).<br />
(3) 1 Für die Voraussetzungen und das Verfahren zum Erlaß von<br />
Verordnungen, deren Übertretung mit Strafe oder als Ordnungswidrigkeit<br />
mit Geldbuße bedroht ist, gelten die Vorschriften des Landesstraf- und<br />
Verordnungsgesetzes entsprechend; Art. 24 bleibt unberührt. 2 Die<br />
Genehmigungspflicht gemäß Art. 47 Abs. 1 des Landesstraf- und<br />
Verordnungsgesetzes besteht nur für Zweckverbände, denen als<br />
Gebietskörperschaften ausschließlich Gemeinden oder Landkreise<br />
angehören. 3 Die Vorlagepflicht gemäß Art. 47 Abs. 2 des Landesstraf- und<br />
Verordnungsgesetzes besteht nur für Zweckverbände, denen als<br />
Gebietskörperschaften ausschließlich kreisangehörige Gemeinden<br />
angehören.
(4) Verordnungen, zu deren Erlaß die Zweckverbände ermächtigt sind,<br />
werden von der Verbandsversammlung, dringliche Verordnungen vom<br />
Verbandsvorsitzenden, als Verbandsverordnung erlassen.<br />
Bay KommZG Art. 27 Ausgleich<br />
(1) 1 Neben der Verbandssatzung können die Beteiligten schriftliche<br />
Abmachungen über den Ausgleich von Vorteilen und Nachteilen treffen,<br />
die sich aus der Bildung des Zweckverbands ergeben. 2 Entsprechendes<br />
gilt für den Ausgleich von Vor- und Nachteilen aus der Tätigkeit des<br />
Zweckverbands, wenn eine Regelung in der Verbandssatzung oder durch<br />
die Festsetzung der Verbandsumlage nicht möglich oder nicht zweckmäßig<br />
ist. 3 Die Abmachungen sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.<br />
(2) 1 Auf Antrag sämtlicher Beteiligter, für die ein Ausgleich in Betracht<br />
kommt, regelt die Aufsichtsbehörde diesen Ausgleich. 2 Für einen<br />
Pflichtverband kann die Aufsichtsbehörde den Ausgleich auch dann regeln,<br />
wenn sie einen solchen für erforderlich hält und die betroffenen Beteiligten<br />
sich nicht innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde gesetzten<br />
angemessenen Frist einigen.<br />
Bay KommZG Art. 28 Pflichtverband<br />
(1) Ist die Bildung eines Zweckverbands zur Erfüllung von Pflichtaufgaben<br />
einer Gebietskörperschaft aus zwingenden Gründen des öffentlichen Wohls<br />
geboten, so kann die Aufsichtsbehörde den Beteiligten eine angemessene<br />
Frist setzen, den Zweckverband zu bilden.<br />
(2) 1 Kommt innerhalb der Frist der Zweckverband nicht zustande, so bildet<br />
ihn die Aufsichtsbehörde dadurch, daß sie die Verbandssatzung erläßt<br />
(Pflichtverband). 2 Ehe die Aufsichtsbehörde hierüber entscheidet, muß sie<br />
den beteiligen Gebietskörperschaften Gelegenheit geben, ihre Auffassung<br />
zur Bildung des Zweckverbands und zur Verbandssatzung darzulegen; die<br />
Erörterung kann in einer gemeinsamen Besprechung nach Art. 18 Abs. 3<br />
Satz 2 stattfinden. 3 Art. 21 gilt entsprechend.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn aus den in Absatz 1<br />
genannten Gründen eine weitere Gebietskörperschaft an einen<br />
bestehenden Zweckverband angeschlossen werden muß.<br />
(4) 1 Die Vorschriften über den Inhalt der Verbandssatzung (Art. 19) gelten<br />
auch für Pflichtverbände. 2 Soweit erforderlich, muß die Verbandssatzung<br />
die Ausstattung des Zweckverbands mit Dienstkräften regeln.<br />
2. ABSCHNITT Verfassung und Verwaltung<br />
Bay KommZG Art. 29 Organe<br />
1 Notwendige Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und<br />
die Person, die den Verbandsvorsitz führt (Verbandsvorsitzender). 2 Die<br />
Verbandssatzung kann regeln, ob und wie ein Verbandsausschuß und weitere<br />
beschließende Ausschüsse gebildet werden.
Bay KommZG Art. 30 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und<br />
der übrigen Verbandsräte<br />
(1) Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder<br />
der Verbandsversammlung (Verbandsräte) sind ehrenamtlich tätig.<br />
(2) 1 Der Zweckverband entschädigt die Verbandsräte entsprechend den<br />
Vorschriften der Gemeindeordnung über die Entschädigung ehrenamtlich<br />
tätiger Gemeindebürger. 2 Verbandsräte gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1<br />
haben, soweit sie nicht Verbandsvorsitzende, Ausschußvorsitzende oder<br />
deren Stellvertreter sind, nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.<br />
3<br />
Art. 20 a Abs. 4 der Gemeindeordnung gilt entsprechend: er gilt nicht für<br />
Verbandsräte kraft Amtes, die kommunale Wahlbeamte auf Zeit sind; für<br />
sie gelten die Ablieferungsregelungen nach dem beamtenrechtlichen<br />
Nebentätigkeitsrecht.<br />
(3) 1 Die wählbaren Bürger jener Gemeinden, Landkreise und Bezirke, die<br />
Verbandsmitglieder sind, können die Übernahme oder die weitere<br />
Ausübung des Amts eines Verbandsrats nur aus wichtigen Gründen<br />
ablehnen. 2 Als wichtiger Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der<br />
Verpflichtete durch sein Alter, seine Berufs- oder Familienverhältnisse,<br />
seinen Gesundheitszustand oder sonstige in seiner Person liegende<br />
Umstände an der Übernahme oder weiteren Ausübung des Amts<br />
verhindert ist. 3 Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die<br />
Gebietskörperschaft, die den Verbandsrat bestellt.<br />
(4) 1 Verbandsräte können nicht sein:<br />
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte des<br />
Zweckverbands,<br />
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen<br />
oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an<br />
denen der Zweckverband mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine<br />
Beteiligung am Stimmrecht genügt,<br />
3. Beamte und Angestellte der Aufsichtsbehörde, die unmittelbar mit<br />
Aufgaben der Aufsicht über Zweckverbände befaßt sind, ausgenommen<br />
die für die Stellvertretung des Landrats gewählte Person.<br />
2<br />
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Beamte während der Dauer des<br />
Ehrenamts ohne Dienstbezüge beurlaubt sind oder wenn ihre Rechte und<br />
Pflichten aus dem Dienstverhältnis wegen der Wahl in eine gesetzgebende<br />
Körperschaft ruhen; das gilt für Angestellte entsprechend.<br />
Bay KommZG Art. 31 Zusammensetzung der Verbandsversammlung<br />
(1) 1 Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und<br />
den übrigen Verbandsräten. 2 Jedes Verbandsmitglied entsendet<br />
mindestens einen Verbandsrat in die Verbandsversammlung. 3 Die<br />
Verbandssatzung kann bestimmen, daß einzelne oder alle<br />
Verbandsmitglieder mehrere Vertreter in die Verbandsversammlung<br />
entsenden oder daß die Vertreter einzelner Verbandsmitglieder ein<br />
mehrfaches Stimmrecht haben; außerdem kann bestimmt werden, daß die<br />
Stimmen mehrerer Vertreter eines Verbandsmitglieds nur einheitlich<br />
abgegeben werden können. 4 Sind natürliche Personen oder juristische<br />
Personen des Privatrechts Verbandsmitglieder, so dürfen ihre Stimmen<br />
insgesamt zwei Fünftel der in der Verbandssatzung festgelegten
Stimmenzahl nicht erreichen; dies gilt nicht für juristische Personen des<br />
Privatrechts, deren Kapital sich ganz oder überwiegend in öffentlicher<br />
Hand befindet. 5 Die Vertretung einer kommunalen Gebietskörperschaft in<br />
der Verbandsversammlung soll in einem angemessenen Verhältnis zu<br />
ihrem Anteil an der gemeinsamen Erfüllung der Aufgaben stehen.<br />
(2) 1 Eine Gemeinde wird in der Verbandsversammlung durch den ersten<br />
Bürgermeister, ein Landkreis durch den Landrat, ein Bezirk durch den<br />
Bezirkstagspräsidenten kraft Amtes vertreten. 2 Mit Zustimmung der in<br />
Satz 1 Genannten und ihrer gewählten Stellvertreter kann eine beteiligte<br />
Gebietskörperschaft andere Personen als ihre Vertreter bestellen. 3 Die<br />
weiteren Vertreter einer Gebietskörperschaft in der Verbandsversammlung<br />
werden durch die Beschlußorgane der Gebietskörperschaften bestellt.<br />
(3) 1 Die Verbandsräte kraft Amtes werden im Fall ihrer Verhinderung durch<br />
ihre Stellvertreter vertreten; mit deren Zustimmung können die<br />
Gebietskörperschaften auch andere Stellvertreter bestellen. 2 Für die<br />
anderen Verbandsräte bestellen die entsendenden Verbandsmitglieder<br />
jeweils Stellvertreter. 3 Verbandsräte können sich nicht untereinander<br />
vertreten.<br />
(4) 1 Die Amtszeit der bestellten Verbandsräte und Stellvertreter dauert sechs<br />
Jahre. 2 Abweichend hiervon endet sie<br />
1. bei Mitgliedern der Vertretungskörperschaft eines Verbandsmitglieds<br />
mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus der<br />
Vertretungskörperschaft,<br />
2. bei berufsmäßigen Gemeinderatsmitgliedern mit der Beendigung des<br />
Beamtenverhältnisses.<br />
3<br />
Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum<br />
Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus.<br />
Bay KommZG Art. 32 Einberufung der Verbandsversammlung,<br />
Öffentlichkeit<br />
(1) 1 Die Verbandsversammlung wird, wenn noch kein Verbandsvorsitzender<br />
gewählt ist, durch die Aufsichtsbehörde, sonst durch den<br />
Verbandsvorsitzenden schriftlich einberufen. 2 Die Einladung muß<br />
Tageszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben und den<br />
Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. 3 In<br />
dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf<br />
24 Stunden abkürzen.<br />
(2) 1 Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen.<br />
2<br />
Sie muß außerdem einberufen werden, wenn es ein Drittel der<br />
Verbandsräte unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt. 3 Die<br />
Verbandssatzung kann den Antrag einer anderen Zahl von Verbandsräten<br />
oder weitere Antragsberechtigte vorsehen.<br />
(3) 1 Die Vertreter der Aufsichtsbehörden haben das Recht, an der<br />
Verbandsversammlung teilzunehmen. 2 Auf Antrag ist ihnen das Wort zu<br />
erteilen.<br />
(4) Die Vorschriften der Gemeindeordnung über die Öffentlichkeit gelten<br />
entsprechend, soweit nicht nach Maßgabe von Art. 26 Abs. 1 Sätze 2 und<br />
3 die Vorschriften für die Landkreise oder die Bezirke anzuwenden sind.
Bay KommZG Art. 33 Beschlüsse und Wahlen in der<br />
Verbandsversammlung<br />
(1) 1 Die Verbandsversammlung ist beschlußfähig, wenn sämtliche<br />
Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die anwesenden<br />
stimmberechtigten Verbandsräte die Mehrheit der von der<br />
Verbandssatzung vorgesehenen Stimmenzahl erreichen. 2 Dabei dürfen die<br />
Stimmen von Verbandsmitgliedern gemäß Art. 31 Abs. 1 Satz 4 nicht<br />
überwiegen. 3 Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlußunfähigkeit,<br />
die nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte<br />
beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweitenmal zur Verhandlung über<br />
denselben Gegenstand einberufen, so ist sie, unbeschadet des Satzes 2,<br />
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig; auf diese<br />
Folge ist in der zweiten Einladung ausdrücklich hinzuweisen.<br />
(2) 1 Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, soweit das<br />
Gesetz oder die Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreibt. 2 Bei<br />
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 3 Es wird offen abgestimmt.<br />
4<br />
Die Verbandsmitglieder können ihre Verbandsräte anweisen, wie sie in<br />
der Verbandsversammlung abzustimmen haben. 5 Die Abstimmung<br />
entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit des Beschlusses der<br />
Verbandsversammlung nicht.<br />
(3) 1 Für Wahlen gilt Absatz 1 entsprechend. 2 Es wird geheim abgestimmt.<br />
3<br />
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen<br />
erhält. 4 Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet<br />
eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten<br />
Stimmenzahlen statt. 5 Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet<br />
das Los. 6 Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche<br />
Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewerber in<br />
die Stichwahl kommen. 7 Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr<br />
Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet<br />
das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der<br />
höchsten Stimmenzahl kommt.<br />
(4) 1 Die Vorschriften der Gemeindeordnung über den Ausschluß wegen<br />
persönlicher Beteiligung sind entsprechend anzuwenden. 2 Sie gelten<br />
jedoch nicht für die Teilnahme von Verbandsräten<br />
1. an Wahlen,<br />
2. an der Beratung und Abstimmung bei Beschlüssen, die einem<br />
Verbandsmitglied einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen können.<br />
Bay KommZG Art. 34 Zuständigkeit der Verbandsversammlung<br />
(1) Die Aufgaben des Zweckverbands werden von der Verbandsversammlung<br />
wahrgenommen, soweit nicht nach diesem Gesetz, der Verbandssatzung<br />
oder besonderen Beschlüssen der Verbandsversammlung der<br />
Verbandsvorsitzende, der Verbandsausschuß, ein anderer beschließender<br />
Ausschuß oder ein Geschäftsleiter selbständig entscheidet.<br />
(2) Folgende Angelegenheiten können nicht auf den Verbandsvorsitzenden,<br />
den Verbandsausschuß, einen anderen beschließenden Ausschuß oder<br />
einen Geschäftsleiter übertragen werden:<br />
1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung
der den Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen,<br />
2. die Beschlußfassung über den Erlaß, die Änderung oder die Aufhebung<br />
von Satzungen und Verordnungen,<br />
3. die Beschlußfassung über die Haushaltssatzung, die<br />
Nachtragshaushaltssatzungen und die Aufnahme von zusätzlichen<br />
Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung,<br />
4. die Beschlußfassung über den Finanzplan,<br />
5. die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses und<br />
die Entlastung,<br />
6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, die<br />
Bestellung der Mitglieder des Verbandsausschusses und die Festsetzung<br />
von Entschädigungen,<br />
7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse,<br />
8. der Erlaß, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für<br />
die Verbandsversammlung,<br />
9. der Erlaß, die Änderung oder die Aufhebung der Betriebssatzung für<br />
einen Eigenbetrieb oder der Unternehmenssatzung für ein<br />
Kommunalunternehmen des Zweckverbands,<br />
10. die Entscheidung über die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung<br />
sowie die Veräußerung einer solchen Beteiligung eines Zweckverbands an<br />
einem Unternehmen in Privatrechtsform,<br />
11. die Beschlußfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die<br />
Auflösung des Zweckverbands und die Bestellung von Abwicklern.<br />
Bay KommZG Art. 35 Wahl des Verbandsvorsitzenden<br />
(1) 1 Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der<br />
Verbandsversammlung aus ihrer Mitte nach Art. 33 Abs. 3 gewählt; die<br />
Verbandsversammlung kann einen weiteren Stellvertreter wählen. 2 Der<br />
Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter einer Gemeinde oder<br />
eines Landkreises oder der Bezirkstagspräsident eines Bezirks sein, die<br />
dem Zweckverband angehören.<br />
(2) 1 Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden auf die Dauer<br />
von sechs Jahren, sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamts eines<br />
Verbandsmitglieds, auf die Dauer dieses Amts gewählt. 2 Sie üben ihr Amt<br />
nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des<br />
neugewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus.<br />
(3) Die Verbandssatzung kann von den Vorschriften der Absätze 1 und 2<br />
abweichen.<br />
Bay KommZG Art. 36 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden<br />
(1) 1 Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. 2 Er<br />
bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung vor und<br />
führt in ihr den Vorsitz.<br />
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht ferner die Beschlüsse der<br />
Verbandsversammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit alle<br />
Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft <strong>Gesetze</strong>s dem<br />
ersten Bürgermeister zukommen.
(3) Durch besonderen Beschluß der Verbandsversammlung können dem<br />
Verbandsvorsitzenden unbeschadet des Art. 34 Abs. 2 weitere<br />
Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen werden.<br />
(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinen<br />
Stellvertretern und in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung<br />
Dienstkräften des Zweckverbands oder mit Zustimmung des<br />
Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder dessen<br />
Dienstkräften übertragen.<br />
Bay KommZG Art. 37 Form der Vertretung nach außen<br />
(1) 1 Erklärungen, durch welche der Zweckverband verpflichtet werden soll,<br />
bedürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer Form mit einer<br />
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur versehen<br />
sein. 2 Die Erklärungen sind durch den Verbandsvorsitzenden oder seinen<br />
Stellvertreter unter Angabe der Amtsbezeichnung zu unterzeichnen. 3 Sie<br />
können auf Grund einer den vorstehenden Erfordernissen entsprechenden<br />
Vollmacht auch von Bediensteten des Zweckverbands unterzeichnet<br />
werden.<br />
(2) Absatz 1 Satz 1 findet keine Anwendung auf ständig wiederkehrende<br />
Geschäfte des täglichen Lebens, die finanziell von unerheblicher<br />
Bedeutung sind.<br />
Bay KommZG Art. 38 Dienstkräfte<br />
(1) Die Verbandsversammlung ist zuständig,<br />
1. die Beamten des Zweckverbands zu ernennen, zu einem anderen<br />
Dienstherrn abzuordnen oder zu versetzen, in den Ruhestand zu versetzen<br />
und zu entlassen,<br />
2. die Angestellten des Zweckverbands einzustellen, höherzugruppieren<br />
und zu kündigen.<br />
(2) Die Verbandsversammlung kann die Befugnisse nach Absatz 1 ganz oder<br />
teilweise dem Verbandsausschuß oder einem anderen beschließenden<br />
Ausschuß übertragen.<br />
(3) 1 Die Arbeiter des Zweckverbands werden durch den<br />
Verbandsvorsitzenden eingestellt, höhergruppiert und entlassen. 2 Die<br />
Verbandsversammlung kann dem Verbandsvorsitzenden durch Beschluß<br />
Befugnisse nach Absatz 1 übertragen<br />
1. für Beamte des einfachen und des mittleren Dienstes und für<br />
Angestellte, deren Vergütung mit der Besoldung dieser Beamten<br />
vergleichbar sind,<br />
2. für Beamte des gehobenen Dienstes und der ersten beiden Ämter des<br />
höheren Dienstes und für Angestellte mit vergleichbarer Vergütung, wenn<br />
der Stellenplan des Zweckverbands im Zeitpunkt des Beschlusses mehr<br />
als 400 Planstellen ausweist.<br />
3<br />
Art. 36 Abs. 4 findet Anwendung.<br />
(4) 1 Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Dienstkräfte<br />
des Zweckverbands. 2 Er ist Dienstvorgesetzter der Beamten.<br />
(5) Zweckverbände, die versorgungsberechtigte Beamte und Angestellte<br />
haben, sind Mitglieder des Bayerischen Versorgungsverbands.
Bay KommZG Art. 39 Geschäftsstelle und Geschäftsleiter<br />
(1) 1 Der Zweckverband muß eine Geschäftsstelle unterhalten, wenn das für<br />
den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte erforderlich ist. 2 Die<br />
Geschäftsstelle unterstützt den Verbandsvorsitzenden nach seinen<br />
Weisungen bei den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung.<br />
(2) 1 Die Geschäftsstelle wird durch eine leitende Person geführt<br />
(Geschäftsleiter); wird kein Geschäftsleiter bestellt, durch den<br />
Verbandsvorsitzenden. 2 Die Verbandsversammlung kann dem<br />
Geschäftsleiter durch Beschluß mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden<br />
1. Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach Art. 36 Abs. 2,<br />
2. weitere Angelegenheiten unbeschadet des Art. 34 Abs. 2<br />
zur selbständigen Erledigung übertragen. 3 Soweit die<br />
Verbandsversammlung dem Geschäftsleiter Aufgaben übertragen hat, ist<br />
er zur Vertretung des Zweckverbands nach außen berechtigt. 4 Der<br />
Geschäftsleiter nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung<br />
beratend teil.<br />
3. ABSCHNITT Verbandswirtschaft<br />
Bay KommZG Art. 40 Anzuwendende Vorschriften<br />
(1) 1 Soweit nicht dieses Gesetz etwas anderes vorschreibt, gelten für die<br />
Verbandswirtschaft die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft oder<br />
nach Art. 26 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 die Vorschriften über die<br />
Landkreiswirtschaft oder die Bezirkswirtschaft entsprechend. 2 Die<br />
Verbandssatzung kann vorschreiben, daß die Aufgaben eines<br />
Werkausschusses von der Verbandsversammlung und die Aufgaben einer<br />
Werkleitung vom Verbandsvorsitzenden oder vom Geschäftsleiter<br />
wahrgenommen werden.<br />
(2) 1 Ist Hauptaufgabe des Zweckverbands der Betrieb eines Unternehmens,<br />
das nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt wird, kann<br />
die Verbandssatzung vorschreiben, daß diese Vorschriften auch auf die<br />
Haushaltswirtschaft, die Vermögenswirtschaft sowie das Kassen- und<br />
Rechnungswesen des Zweckverbands selbst anzuwenden sind. 2 In diesem<br />
Fall ist durch die Haushaltssatzung der Wirtschaftsplan an Stelle des<br />
Haushaltsplans festzusetzen.<br />
(3) 1 Ist Hauptaufgabe eines Zweckverbands der Betrieb eines<br />
Krankenhauses, das nach den Vorschriften der Krankenhaus-<br />
Buchführungsverordnung sowie der Verordnung über die<br />
Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser zu führen ist, kann<br />
die Verbandssatzung vorschreiben, daß für die Verbandswirtschaft diese<br />
Vorschriften entsprechend gelten. 2 Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung.<br />
Bay KommZG Art. 41 Haushaltssatzung<br />
(1) Der Verbandsvorsitzende gibt den Entwurf der Haushaltssatzung<br />
rechtzeitig, jedoch mindestens einen Monat vor dem Beschluß über die<br />
Haushaltssatzung, den Verbandsmitgliedern bekannt.<br />
(2) Die Verbandsversammlung kann beschließen, daß eine Finanzplanung<br />
nicht erstellt wird.
Bay KommZG Art. 42 Deckung des Finanzbedarfs<br />
(1) 1 Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage,<br />
soweit seine Einnahmen aus besonderen Entgelten für die von ihm<br />
erbrachten Leistungen und seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen,<br />
um seinen Finanzbedarf zu decken. 2 Die Umlagepflicht einzelner<br />
Verbandsmitglieder kann durch die Verbandssatzung auf einen<br />
Höchstbetrag beschränkt oder ausgeschlossen werden.<br />
(2) 1 Die Umlage soll nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen werden, den<br />
die einzelnen Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des<br />
Zweckverbands haben und die Leistungskraft der einzelnen<br />
Verbandsmitglieder berücksichtigen. 2 Ein anderer Maßstab (z. B. Größe,<br />
Einwohnerzahl, Umlagegrundlagen, Aufwand für die einzelnen<br />
Verbandsmitglieder) kann zugrundegelegt werden, wenn das angemessen<br />
ist. 3 Wird die Umlage nach den Umlagegrundlagen bemessen, so gelten<br />
die Vorschriften über die Kreisumlage, für Zweckverbände, denen als<br />
Gebietskörperschaften nur Bezirke angehören, die Vorschriften über die<br />
Bezirksumlage entsprechend.<br />
(3) 1 Die Höhe der Umlage ist in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr<br />
festzusetzen. 2 Art. 19 des <strong>Gesetze</strong>s über den Finanzausgleich zwischen<br />
Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden ist entsprechend<br />
anzuwenden; im Umlagebescheid kann die Fälligkeit abweichend von<br />
dieser Vorschrift bestimmt werden.<br />
(4) Auf die Erhebung von Kommunalabgaben sind die Vorschriften des<br />
Kommunalabgabenrechts entsprechend anzuwenden; Art. 1 Abs. 4 Satz 2<br />
bleibt unberührt.<br />
Bay KommZG Art. 43 Prüfungswesen<br />
(1) Die Verbandssatzung kann vorschreiben, daß das Rechnungsprüfungsamt<br />
eines Verbandsmitglieds als Sachverständiger zur Prüfung der<br />
Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses umfassend heranzuziehen ist.<br />
(2) Überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfungen werden bei den Mitgliedern<br />
des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands durch diesen Verband,<br />
bei den übrigen Zweckverbänden durch die staatlichen<br />
Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter durchgeführt (überörtliche<br />
Prüfungsorgane).<br />
4. ABSCHNITT Änderung der Verbandssatzung und Auflösung<br />
Bay KommZG Art. 44 Änderung der Verbandssatzung, Kündigung aus<br />
wichtigem Grund<br />
(1) 1 Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Austritt von<br />
Verbandsmitgliedern und deren Ausschluß bedürfen einer Mehrheit von<br />
zwei Dritteln, sonstige Änderungen der Verbandssatzung der einfachen<br />
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der<br />
Verbandsversammlung. 2 Die Verbandssatzung kann größere Mehrheiten<br />
oder die Notwendigkeit der Zustimmung bestimmter oder aller<br />
Verbandsmitglieder vorschreiben.
(2) 1 Der Beschluß über eine Übernahme weiterer Aufgaben oder über eine<br />
Änderung der Verbandssatzung im Fall des Art. 23 Abs. 2 Satz 2 setzt das<br />
Einverständnis der betroffenen Verbandsmitglieder voraus. 2 Der Beschluß<br />
über einen Beitritt oder Austritt setzt einen Antrag des Beteiligten voraus.<br />
3 Ein Ausschluß ist nur aus wichtigem Grund zulässig.<br />
(3) Ohne Rücksicht auf Absatz 1 kann jedes Verbandsmitglied seine<br />
Mitgliedschaft aus wichtigem Grund kündigen.<br />
Bay KommZG Art. 45 Wegfall von Verbandsmitgliedern<br />
(1) 1 Wird eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Verbandsmitglied ist,<br />
in eine andere Körperschaft eingegliedert oder mit einer anderen<br />
zusammengeschlossen, so tritt die Körperschaft des öffentlichen Rechts,<br />
in die das Verbandsmitglied eingegliedert oder zu der es<br />
zusammengeschlossen wird, an die Stelle des früheren Verbandsmitglieds.<br />
2<br />
Das gleiche gilt, wenn eine Körperschaft auf mehrere andere<br />
Körperschaften aufgeteilt wird oder wenn ihre Aufgaben und Befugnisse<br />
auf eine oder mehrere andere Körperschaften übergehen.<br />
(2) 1 Der Zweckverband kann bis zum Ablauf von drei Monaten nach dem<br />
Wirksamwerden der Änderung die neue Körperschaft mit einfacher<br />
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl ausschließen. 2 Im gleichen<br />
Zeitraum kann die Körperschaft ihren Austritt aus dem Zweckverband<br />
einseitig erklären.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für andere Verbandsmitglieder entsprechend.<br />
Bay KommZG Art. 46 Auflösung<br />
(1) 1 Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von zwei<br />
Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung.<br />
2<br />
Art. 44 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.<br />
(2) 1 Die Beteiligten können einen Pflichtverband nicht von sich aus auflösen.<br />
2<br />
Sind die Gründe für seine zwangsweise Bildung weggefallen, so hat dies<br />
die Aufsichtsbehörde dem Pflichtverband gegenüber schriftlich zu erklären.<br />
3<br />
Der Fortbestand des Zweckverbands als Freiverband wird dadurch nicht<br />
berührt. 4 Der Zweckverband hat die Erklärung den Verbandsmitgliedern in<br />
einer alsbald einzuberufenden Verbandsversammlung bekanntzugeben.<br />
5<br />
Innerhalb von sechs Monaten vom Zeitpunkt der Verbandsversammlung<br />
ab kann jedes Verbandsmitglied seinen Austritt erklären.<br />
(3) 1 Der Zweckverband ist aufgelöst, wenn seine Aufgaben durch ein Gesetz<br />
oder auf Grund einer besonderen gesetzlichen Regelung vollständig auf<br />
andere juristische Personen des öffentlichen Rechts übergehen. 2 Er ist<br />
auch aufgelöst, wenn er nur noch aus einem Mitglied besteht; in diesem<br />
Fall tritt das Mitglied an die Stelle des Zweckverbands.<br />
Bay KommZG Art. 47 Abwicklung<br />
(1) 1 Wird der Zweckverband aufgelöst, so hat er seine Geschäfte<br />
abzuwickeln. 2 Das gilt auch, wenn er nach Art. 46 Abs. 3 Satz 1 aufgelöst<br />
ist, aber eine Gesamtrechtsnachfolge nicht eingetreten ist. 3 Der<br />
Zweckverband gilt bis zum Ende der Abwicklung als fortbestehend, soweit<br />
es der Zweck der Abwicklung erfordert.
(2) Abwickler ist der Verbandsvorsitzende, wenn nicht die<br />
Verbandsversammlung etwas anderes beschließt.<br />
(3) 1 Der Abwickler beendigt die laufenden Geschäfte und zieht die<br />
Forderungen ein. 2 Um schwebende Geschäfte zu beenden, kann er auch<br />
neue Geschäfte eingehen. 3 Er fordert die bekannten Gläubiger besonders,<br />
andere Gläubiger durch öffentliche Bekanntmachung auf, ihre Ansprüche<br />
anzumelden.<br />
(4) 1 Der Abwickler befriedigt die Ansprüche der Gläubiger. 2 Im übrigen ist<br />
das Verbandsvermögen nach dem Umlegungsschlüssel im Zeitpunkt der<br />
Auflösung auf die Verbandsmitglieder zu verteilen.<br />
(5) 1 Die Verbandssatzung kann für die Abwicklung etwas anderes<br />
vorschreiben. 2 Die Abwicklung eines Zweckverbands mit überwiegend<br />
wirtschaftlichen Aufgaben soll die Verbandssatzung dem Handelsrecht<br />
anpassen.<br />
(6) 1 Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, so findet<br />
keine Abwicklung statt. 2 Die Verbandssatzung kann vorschreiben, daß mit<br />
dem ausscheidenden Verbandsmitglied eine Auseinandersetzung<br />
stattzufinden hat; die Verbandssatzung eines Pflichtverbands muß<br />
Bestimmungen über die Auseinandersetzung enthalten.<br />
Bay KommZG Art. 48 Genehmigung, Anzeige und Bekanntmachung<br />
(1) 1 Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen<br />
1. die Änderung der Verbandsaufgabe, der Beitritt und der Ausschluß von<br />
Verbandsmitgliedern und deren Austritt in den Fällen der Art. 44 Abs. 1<br />
und 45 Abs. 2 Satz 2,<br />
2. die Kündigung aus wichtigem Grund,<br />
3. die Auflösung des Zweckverbands gemäß Art. 46 Abs. 1,<br />
4. jede Änderung der Satzung eines Pflichtverbands.<br />
2 3<br />
Für die Genehmigung gilt Art. 20 entsprechend. Der Genehmigung des<br />
Ausschlusses, des Austritts, der Kündigung aus wichtigem Grund und der<br />
Auflösung können Gründe des öffentlichen Wohls nur entgegenstehen,<br />
wenn die Voraussetzungen für einen Pflichtverband vorliegen.<br />
(2) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nicht genannte Änderungen der Verbandssatzung<br />
und der Austritt im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 5 sind der<br />
Aufsichtsbehörde anzuzeigen.<br />
(3) 1 Die Aufsichtsbehörde hat die genehmigungs- und anzeigepflichtigen<br />
Maßnahmen einschließlich erforderlicher Genehmigungen in ihrem<br />
Amtsblatt amtlich bekanntzumachen. 2 Die Maßnahmen werden am Tag<br />
nach der Bekanntmachung wirksam, wenn nicht in der Verbandssatzung<br />
oder im Auflösungsbeschluß ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 3 Bei<br />
einer Auflösung des Zweckverbands gemäß Art. 46 Abs. 3 hat die<br />
Aufsichtsbehörde in ihrem Amtsblatt auf die Auflösung und den Übergang<br />
der Aufgaben hinzuweisen. 4 Verbandsmitglieder, die<br />
Gebietskörperschaften sind, sollen in der für die Bekanntmachung ihrer<br />
Satzungen vorgesehenen Form auf die Veröffentlichungen der<br />
Aufsichtsbehörde hinweisen.
FÜNFTER TEIL Gemeinsame Kommunalunternehmen<br />
Bay KommZG Art. 49 Entstehung<br />
(1) 1 Gemeinden, Landkreise und Bezirke können ein gemeinsames<br />
Kommunalunternehmen durch Vereinbarung einer Unternehmenssatzung<br />
errichten. 2 Sie können auch einem bestehenden Kommunalunternehmen<br />
oder einem bestehenden gemeinsamen Kommunalunternehmen beitreten;<br />
der Beitritt erfolgt durch die zwischen den Beteiligten zu vereinbarende<br />
Änderung der Unternehmenssatzung. 3 Die Zulässigkeit der Errichtung<br />
oder des Beitritts richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des<br />
kommunalen Unternehmensrechts. 4 Die Beteiligten können bestehende<br />
Regie- und Eigenbetriebe auf das gemeinsame Kommunalunternehmen im<br />
Weg der Gesamtrechtsnachfolge ausgliedern. 5 Die Vereinbarung über die<br />
Ausgliederung ist in die Unternehmenssatzung aufzunehmen.<br />
(2) Ein Kommunalunternehmen kann mit einem anderen durch Vereinbarung<br />
einer entsprechenden Änderung der Unternehmenssatzung des<br />
aufnehmenden Unternehmens im Weg der Gesamtrechtsnachfolge zu<br />
einem gemeinsamen Kommunalunternehmen verschmolzen werden.<br />
(3) 1 Das Kommunalunternehmen eines Zweckverbands, dem nur kommunale<br />
Körperschaften angehören, kann als gemeinsames<br />
Kommunalunternehmen der Verbandsmitglieder fortgeführt werden, wenn<br />
diese die Verschmelzung des Zweckverbands mit dem<br />
Kommunalunternehmen im Weg der Gesamtrechtsnachfolge zu einem<br />
gemeinsamen Kommunalunternehmen und eine entsprechende Änderung<br />
der Unternehmenssatzung vereinbaren. 2 Ein Zweckverband im Sinn des<br />
Satzes 1, der Träger eines Eigenbetriebs oder Regiebetriebs ist, kann im<br />
Weg der Gesamtrechtsnachfolge in ein gemeinsames<br />
Kommunalunternehmen umgewandelt werden, wenn seine Mitglieder die<br />
Umwandlung und die Unternehmenssatzung vereinbaren.<br />
3<br />
Entscheidungen nach den Sätzen 1 und 2 sind der für den Zweckverband<br />
zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen; soweit sie Pflichtverbände<br />
betreffen, bedürfen sie der Genehmigung.<br />
(4) 1 Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem<br />
ausschließlich mehrere kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts<br />
beteiligt sind, kann durch Formwechsel in ein gemeinsames<br />
Kommunalunternehmen umgewandelt werden. 2 Die Umwandlung ist nur<br />
zulässig, wenn keine Sonderrechte im Sinn des § 23 des<br />
Umwandlungsgesetzes (UmwG) und keine Rechte Dritter an den Anteilen<br />
der formwechselnden Rechtsträger bestehen. 3 Der Formwechsel setzt<br />
voraus:<br />
1. die Vereinbarung der Unternehmenssatzung des gemeinsamen<br />
Kommunalunternehmens durch die beteiligten kommunalen<br />
Körperschaften,<br />
2. einen sich darauf beziehenden einstimmigen Umwandlungsbeschluss<br />
der Anteilsinhaber der formwechselnden Gesellschaft.<br />
4<br />
Die §§ 193 bis 195, 197 bis 199, 200 Abs. 1 und § 201 UmwG sind<br />
entsprechend anzuwenden. 5 Die Anmeldung zum Handelsregister<br />
entsprechend § 198 UmwG erfolgt durch das vertretungsberechtigte<br />
Organ der Kapitalgesellschaft. 6 Ist bei der Kapitalgesellschaft ein
Betriebsrat eingerichtet, bleibt dieser nach dem Wirksamwerden der<br />
Umwandlung als Personalrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens<br />
bis zu den nächsten regelmäßigen Personalratswahlen bestehen.<br />
(5) 1 Die in den Abs. 1 bis 3 genannten Entscheidungen werden am Tag nach<br />
der Bekanntmachung der Unternehmenssatzung oder ihrer Änderung<br />
wirksam, wenn nicht in der Unternehmenssatzung ein späterer Zeitpunkt<br />
bestimmt ist. 2 Art. 21 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 3 Die Umwandlung<br />
einer Kapitalgesellschaft in ein gemeinsames Kommunalunternehmen wird<br />
mit dessen Eintragung oder, wenn es nicht eingetragen wird, mit der<br />
Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister wirksam; § 202 Abs. 1<br />
und Abs. 3 UmwG ist entsprechend anzuwenden.<br />
Bay KommZG Art. 50 Vorschriften für gemeinsame<br />
Kommunalunternehmen<br />
(1) Soweit nachstehend nichts Abweichendes geregelt ist, sind die für<br />
Kommunalunternehmen von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken<br />
geltenden Vorschriften nach Maßgabe des Art. 26 Abs. 1 entsprechend<br />
anzuwenden.<br />
(2) 1 Die Unternehmenssatzung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens<br />
muss auch Angaben enthalten über<br />
1. die Träger des Unternehmens (Beteiligte),<br />
2. den Sitz des Unternehmens,<br />
3. den Betrag der von jedem Beteiligten auf das Stammkapital zu<br />
leistenden Einlage (Stammeinlage),<br />
4. den räumlichen Wirkungsbereich, wenn dem Unternehmen hoheitliche<br />
Befugnisse oder das Recht, Satzungen und Verordnungen zu erlassen,<br />
übertragen werden,<br />
5. die Sitz- und Stimmenverteilung im Verwaltungsrat.<br />
2<br />
Art. 23 Abs. 2 Satz 2 gilt für die Unternehmenssatzung eines<br />
gemeinsamen Kommunalunternehmens entsprechend. 3 Sollen<br />
Sacheinlagen geleistet werden, müssen der Gegenstand der Sacheinlage<br />
und der Betrag der Stammeinlage, auf die sich die Sacheinlage bezieht, in<br />
der Unternehmenssatzung festgesetzt werden.<br />
(3) 1 Die Unternehmenssatzung ist im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde amtlich<br />
bekanntzumachen. 2 Für die amtliche Bekanntmachung von Satzungen<br />
und Verordnungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens gilt Art. 24<br />
Abs. 1 entsprechend.<br />
(4) 1 Für die Vertretung der Träger des gemeinsamen<br />
Kommunalunternehmens im Verwaltungsrat gelten Art. 31 Abs. 1 Sätze 2,<br />
3 und 5 und Abs. 2 entsprechend. 2 Das vorsitzende Mitglied des<br />
Verwaltungsrats wird von diesem gewählt; Art. 35 Abs. 1 und Abs. 3 gilt<br />
entsprechend. 3 Für den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gilt<br />
Art. 33 Abs. 4 entsprechend.<br />
(5) 1 Soweit die Träger für die Verbindlichkeiten des gemeinsamen<br />
Kommunalunternehmens einzutreten haben, haften sie als<br />
Gesamtschuldner. 2 Der Ausgleich im Innenverhältnis richtet sich<br />
vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der Unternehmenssatzung<br />
nach dem Verhältnis der Stammeinlagen zueinander.
(6) 1 Über Änderungen der Unternehmenssatzung und die Auflösung des<br />
gemeinsamen Kommunalunternehmens beschließt der Verwaltungsrat.<br />
2<br />
Die Änderung der Unternehmensaufgabe, der Beitritt zur Trägerschaft<br />
und der Austritt, die Erhöhung des Stammkapitals, die Verschmelzung und<br />
die Auflösung bedürfen der Zustimmung aller Träger. 3 Art. 44 Abs. 2<br />
Sätze 1 und 2, Abs. 3 und Art. 45 sind entsprechend anzuwenden. 4 Die<br />
Abwicklung des gemeinsamen Kommunalunternehmens besorgen die<br />
Vorstandsmitglieder als Abwickler; im Übrigen gilt Art. 47 entsprechend.<br />
(7) Art. 25 gilt entsprechend.<br />
(8) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch<br />
Rechtsverordnung zu regeln<br />
1. das Verfahren bei der Errichtung eines gemeinsamen<br />
Kommunalunternehmens und in den in Art. 49 Abs. 3 und 4 genannten<br />
Fällen,<br />
2. den Aufbau und die Verwaltung des gemeinsamen<br />
Kommunalunternehmens.<br />
SECHSTER TEIL Aufsicht und Rechtsbehelfe<br />
1. ABSCHNITT Aufsicht<br />
Bay KommZG Art. 51 Grundsatz<br />
(1) 1 Die Zweckverbände und die gemeinsamen Kommunalunternehmen<br />
unterstehen staatlicher Aufsicht. 2 Soweit sie Angelegenheiten des eigenen<br />
Wirkungskreises erfüllen, unterstehen sie der Rechtsaufsicht, soweit sie<br />
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises erfüllen, auch der<br />
Fachaufsicht. 3 Art. 26 Abs. 1 findet Anwendung; Vorschriften durch die<br />
Verbandssatzung oder die Unternehmenssatzung sind ausgeschlossen.<br />
(2) 1 Die Aufsicht über Gebietskörperschaften erstreckt sich auch auf die ihnen<br />
durch Zweckvereinbarungen übertragenen Aufgaben und Befugnisse.<br />
2<br />
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.<br />
Bay KommZG Art. 52 Aufsichtsbehörden<br />
(1) 1 Aufsichtsbehörde ist<br />
1. das Staatsministerium des Innern,<br />
a) wenn ein Bezirk oder der Freistaat Bayern beteiligt ist,<br />
b) wenn ein anderes Land, eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband<br />
eines anderen Landes oder der Bund beteiligt ist;<br />
2. die Regierung, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Gemeinde<br />
beteiligt ist;<br />
3. im übrigen die Kreisverwaltungsbehörde.<br />
2 Gehören die Beteiligten im Fall der Nr. 2 mehreren Regierungsbezirken<br />
oder im Fall der Nr. 3 mehreren Landkreisen an, so ist die<br />
Aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich der Zweckverband oder das<br />
gemeinsame Kommunalunternehmen seinen Sitz hat oder die<br />
Körperschaft liegt, der durch Zweckvereinbarung die Aufgabe übertragen<br />
ist.
(2) 1 Wenn eine Gemeinde, ein Landkreis, ein Bezirk oder eine sonstige der<br />
Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehende Körperschaft, Anstalt oder<br />
Stiftung des öffentlichen Rechts in einem Zweckverband Mitglied wird, der<br />
seinen Sitz außerhalb des Freistaates Bayern hat, so kann das<br />
Staatsministerium des Innern durch Vereinbarung mit der für den Sitz des<br />
Zweckverbands zuständigen obersten Aufsichtsbehörde die zuständige<br />
Aufsichtsbehörde bestimmen. 2 Für die Beteiligung einer Gemeinde, eines<br />
Landkreises oder eines Bezirks an einem gemeinsamen<br />
Kommunalunternehmen mit Sitz außerhalb des Freistaates Bayerns gilt<br />
Entsprechendes.<br />
(3) 1 Wenn das Staatsministerium des Innern oder die Regierung<br />
Aufsichtsbehörden sind, können sie eine unmittelbar nachgeordnete<br />
Behörde zur Aufsichtsbehörde bestimmen. 2 Die Bestimmung kann sich<br />
auch auf einzelne aufsichtliche Maßnahmen beschränken. 3 Die<br />
Bestimmung einer anderen Behörde zur Aufsichtsbehörde und der Umfang<br />
der Bestimmung ist den Beteiligten schriftlich mitzuteilen.<br />
(4) Die Zuständigkeit der Fachaufsichtsbehörden bleibt unberührt.<br />
2. ABSCHNITT Schlichtung von Streitigkeiten, Rechtsbehelfe<br />
Bay KommZG Art. 53 Schlichtung von Streitigkeiten<br />
Bei Streitigkeiten<br />
1. über Rechte und Pflichten der Beteiligten aus einer Zweckvereinbarung,<br />
2. zwischen einem Zweckverband und seinen Verbandsmitgliedern, wenn sie<br />
sich gleichgeordnet gegenüberstehen,<br />
3. der Mitglieder eines Zweckverbands untereinander aus dem<br />
Verbandsverhältnis,<br />
4. der Träger eines gemeinsamen Kommunalunternehmens untereinander aus<br />
der Beteiligung an der Trägerschaft.<br />
soll die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung angerufen werden, wenn nicht die<br />
Beteiligten in der Zweckvereinbarung oder in der Verbandssatzung oder in der<br />
Unternehmenssatzung ein besonderes Schiedsverfahren vorgesehen haben.<br />
Bay KommZG Art. 54 Erlaß des Widerspruchsbescheids (§ 73 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)<br />
Wird gegen den Verwaltungsakt eines Zweckverbands Widerspruch erhoben, so<br />
erläßt den Widerspruchsbescheid<br />
1. in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises die Aufsichtsbehörde, die<br />
dabei auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit beschränkt ist; zuvor hat der<br />
Zweckverband nach § 72 VwGO auch die Zweckmäßigkeit zu überprüfen; ist<br />
die Aufsichtsbehörde das Staatsministerium des Innern, so erläßt den<br />
Widerspruchsbescheid der Zweckverband;<br />
2. in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises die<br />
Fachaufsichtsbehörde; ist Fachaufsichtsbehörde eine oberste Landesbehörde,<br />
so entscheidet der Zweckverband.
SIEBTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay KommZG Art. 55 Inkrafttreten<br />
(1) 1 Dieses Gesetz ist dringlich. 2 Es tritt am 1. Juli 1966 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ursprünglichen Fassung vom 12. Juli 1966 (GVBl S. 218, ber. S. 314). Der Zeitpunkt des<br />
Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(2) Ist in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf das Zweckverbandsgesetz<br />
vom 7. Juni 1939 (RGBl I S. 979) oder einzelne seiner Vorschriften<br />
verwiesen, so treten an die Stelle dieser Verweisungen dieses Gesetz oder<br />
seine entsprechenden Vorschriften.
<strong>Bayerisches</strong> Katastrophenschutzgesetz<br />
(Bay KSG)<br />
vom 24. Juli 1996 (GVBl. S. 282), geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 12. April 1999 (GVBl. S. 130), vom<br />
24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 24. Mai 2007 (GVBl. S. 342), vom 6. Mai 2008 (GVBl. S. 160),<br />
vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 392) (FN BayRS 215-4-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
I. ABSCHNITT Aufgaben und Zuständigkeiten<br />
Art. 1 Aufgabe<br />
Art. 2 Zuständigkeiten<br />
II. ABSCHNITT Maßnahmen im Katastrophenschutz<br />
Art. 3 Vorbereitende Maßnahmen der Katastrophenschutzbehörden<br />
Art. 3 a Externe Notfallpläne<br />
Art. 3 b Externe Notfallpläne für Abfallentsorgungseinrichtungen<br />
Art. 4 Feststellung des Vorliegens einer Katastrophe<br />
Art. 5 Einsatzleitung<br />
Art. 6 Örtliche Einsatzleitung<br />
III. ABSCHNITT Mitwirkung im Katastrophenschutz<br />
Art. 7 Katastrophenhilfe<br />
Art. 7 a Rechtsverhältnisse der Helfer<br />
Art. 7 b Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Ersatzansprüche von Helfern<br />
der freiwilligen Hilfsorganisationen und Erstattungsansprüche der Arbeitgeber<br />
Art. 8 Sonstige Mitwirkung im Katastrophenschutz<br />
IV. ABSCHNITT Besondere Befugnisse gegenüber Dritten<br />
Art. 9 Inanspruchnahme Dritter<br />
Art. 10 Platzverweisung und Räumung
V. ABSCHNITT Kosten und Entschädigung<br />
Art. 11 Kostentragung<br />
Art. 12 Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes<br />
Art. 13 Aufwendungsersatz<br />
Art. 14 Entschädigung<br />
VI. ABSCHNITT Schlußvorschriften<br />
Art. 15 Örtliche Einsatzleitung bei Schadensereignissen unterhalb der<br />
Katastrophenschwelle<br />
Art. 16 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 17 Änderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes<br />
Art. 18 Einschränkung von Grundrechten<br />
Art. 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
I. ABSCHNITT Aufgaben und Zuständigkeiten<br />
Bay KSG Art. 1 Aufgabe<br />
(1) Die Katastrophenschutzbehörden haben die Aufgabe, Katastrophen<br />
abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu<br />
treffen (Katastrophenschutz).<br />
(2) Eine Katastrophe im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist ein Geschehen, bei dem<br />
Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen<br />
Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem<br />
Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden und die Gefahr nur abgewehrt<br />
oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn unter<br />
Leitung der Katastrophenschutzbehörde die im Katastrophenschutz<br />
mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die<br />
eingesetzten Kräfte zusammenwirken.<br />
(3) Die für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen<br />
und Hilfsorganisationen sonst geltenden gesetzlichen Bestimmungen<br />
bleiben unberührt, soweit dieses Gesetz keine entgegenstehenden<br />
Regelungen enthält.<br />
Bay KSG Art. 2 Zuständigkeiten<br />
(1) 1 Katastrophenschutzbehörden sind die Kreisverwaltungsbehörden, die<br />
Regierungen und das Staatsministerium des Innern. 2 Kreisangehörige<br />
Gemeinden, die während einer Katastrophe ohne Verbindung mit der
Kreisverwaltungsbehörde sind, nehmen in dieser Zeit die Aufgaben der<br />
Katastrophenschutzbehörde wahr.<br />
(2) 1 Befindet sich eine Anlage oder Einrichtung auf dem Gebiet mehrerer<br />
Kreisverwaltungsbehörden, so kann die Regierung oder das<br />
Staatsministerium des Innern eine der betroffenen<br />
Kreisverwaltungsbehörden als örtlich zuständige<br />
Katastrophenschutzbehörde bestimmen. 2 Dies gilt auch, wenn zu<br />
besorgen ist, daß eine Katastrophe Auswirkungen auf das Gebiet mehrerer<br />
Kreisverwaltungsbehörden hätte.<br />
(3) 1 Unbeschadet des Absatzes 2 können die Regierung oder das<br />
Staatsministerium des Innern die Leitung des Katastropheneinsatzes ganz<br />
oder teilweise übernehmen oder einer anderen nachgeordneten<br />
Katastrophenschutzbehörde übertragen. 2 Sie können sich auch darauf<br />
beschränken, das Vorliegen oder das Ende einer Katastrophe (Art. 4<br />
Abs. 1) festzustellen.<br />
II. ABSCHNITT Maßnahmen im Katastrophenschutz<br />
Bay KSG Art. 3 Vorbereitende Maßnahmen der<br />
Katastrophenschutzbehörden<br />
(1) Die Kreisverwaltungsbehörden haben als Vorbereitungsmaßnahmen<br />
insbesondere<br />
1. allgemeine Katastrophenschutzpläne und, soweit erforderlich,<br />
insbesondere für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem<br />
Gefahrenpotential (Art. 8 Abs. 2) Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen und<br />
fortzuschreiben,<br />
2. die Katastropheneinsatzleitung zu regeln und dabei auf eine<br />
ausreichende Aus- und Fortbildung zu achten,<br />
3. durch geeignete organisatorische Vorkehrungen die rasche Alarmierung<br />
der an der Gefahrenabwehr Beteiligten sicherzustellen und die für die<br />
Einsatzleitung notwendige Ausstattung vorzuhalten,<br />
4. in angemessenem Umfang Katastrophenschutzübungen unter<br />
Beteiligung der zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten<br />
durchzuführen.<br />
(2) Die Regierungen und das Staatsministerium des Innern haben, soweit<br />
erforderlich, Vorbereitungsmaßnahmen entsprechend Absatz 1 zu treffen.<br />
Bay KSG Art. 3 a Externe Notfallpläne<br />
(1) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde hat Alarm- und Einsatzpläne (Art. 3 Abs. 1<br />
Nr. 1) als externe Notfallpläne für solche Betriebe zu erstellen, für die<br />
gemäß Art. 9 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2<br />
sowie Art. 4 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur<br />
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen<br />
(ABl EG 1997 Nr. L 10/13 ff.) vom Betreiber ein Sicherheitsbericht zu<br />
erstellen ist. 2 Der Betreiber hat der Kreisverwaltungsbehörde den<br />
Sicherheitsbericht, die internen Notfallpläne sowie weitere für die<br />
Erstellung externer Notfallpläne erforderliche Informationen vor<br />
Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen. 3 Die Kreisverwaltungsbehörde
kann auf Grund der Informationen in dem Sicherheitsbericht entscheiden,<br />
dass sich die Erstellung eines externen Notfallplans erübrigt; die<br />
Entscheidung ist zu begründen.<br />
(2) Der externe Notfallplan wird erstellt, um<br />
1. Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die<br />
Folgen möglichst gering gehalten und Schäden für Mensch, natürliche<br />
Lebensgrundlagen und Sachen begrenzt werden können;<br />
2. Maßnahmen zum Schutz von Menschen und den natürlichen<br />
Lebensgrundlagen vor den Folgen schwerer Unfälle einzuleiten;<br />
3. notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie betroffene<br />
Behörden oder Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben;<br />
4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der<br />
natürlichen Lebensgrundlagen nach einem schweren Unfall einzuleiten.<br />
(3) Der externe Notfallplan muss Angaben enthalten über:<br />
1. Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von<br />
Sofortmaßnahmen sowie zur Durchführung und Koordinierung von<br />
Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes ermächtigt sind;<br />
2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur<br />
Alarmauslösung und zur Benachrichtigung der Einsatzkräfte;<br />
3. Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen<br />
Notfallplans notwendigen Einsatzmittel;<br />
4. Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem<br />
Betriebsgelände;<br />
5. Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes;<br />
6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Unfall<br />
sowie über das richtige Verhalten;<br />
7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte anderer<br />
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften im Fall eines schweren<br />
Unfalls mit möglichen grenzüberschreitenden Folgen.<br />
(4) 1 Externe Notfallpläne sind bei der Erstellung oder Fortschreibung zur<br />
Anhörung der Öffentlichkeit auf die Dauer eines Monats bei der<br />
Kreisverwaltungsbehörde öffentlich auszulegen. 2 Ort und Dauer der<br />
Auslegung sind mindestens eine Woche vorher öffentlich mit dem Hinweis<br />
bekannt zu machen, dass während der Auslegungszeit Anregungen<br />
vorgebracht werden können. 3 Die Auslegung erfolgt mit den<br />
Funktionsbezeichnungen der erfassten Personen; sonstige<br />
personenbezogene Daten wie Namen und private Telefonnummern sind<br />
unkenntlich zu machen. 4 Auf Antrag des Betreibers, dem der Entwurf des<br />
externen Notfallplans mindestens eine Woche vor der Bekanntgabe nach<br />
Satz 2 zu übermitteln ist, sind bisher unveröffentlichte Angaben über den<br />
Betrieb unkenntlich zu machen, soweit das Interesse des Betreibers daran<br />
das Interesse der Öffentlichkeit an der Offenbarung überwiegt. 5 Die<br />
fristgemäß vorgebrachten Anregungen sind zu prüfen; das Ergebnis ist<br />
mitzuteilen. 6 Haben mehr als 50 Personen Anregungen mit im<br />
Wesentlichen gleichem Inhalt vorgebracht, kann die Mitteilung dadurch<br />
ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis<br />
ermöglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung während der<br />
Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich bekannt zu<br />
machen.
(5) 1 Wird der Entwurf des externen Notfallplans nach der Auslegung geändert<br />
oder ergänzt, ist er erneut auszulegen. 2 Bei der erneuten Auslegung kann<br />
bestimmt werden, dass Anregungen nur zu den geänderten oder<br />
ergänzten Teilen vorgebracht werden können; hierauf ist in der erneuten<br />
Bekanntmachung nach Abs. 4 Satz 2 hinzuweisen. 3 Die Dauer der<br />
erneuten Auslegung kann bis auf zwei Wochen verkürzt werden. 4 Werden<br />
durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge der<br />
Planung nicht berührt oder sind die Änderungen oder Ergänzungen im<br />
Umfang geringfügig oder von geringer Bedeutung, kann von einer<br />
erneuten öffentlichen Auslegung abgesehen werden.<br />
(6) Die Kreisverwaltungsbehörden wenden den externen Notfallplan<br />
unverzüglich an, wenn es zu einem schweren Unfall (Art. 3 Nr. 5 der<br />
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996) kommt oder ein<br />
solcher zu erwarten ist.<br />
(7) 1 Könnte ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften von<br />
den grenzüberschreitenden Wirkungen eines Betriebs im Sinn von<br />
Absatz 1 Satz 1 betroffen werden, macht die Kreisverwaltungsbehörde<br />
den von dem Mitgliedstaat benannten Behörden ausreichende<br />
Informationen zugänglich, damit sie gegebenenfalls die Bestimmungen der<br />
Art. 11 bis 13 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996<br />
anwenden können. 2 Bei einem nahe am Hoheitsgebiet eines anderen<br />
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften gelegenen Betrieb<br />
unterrichtet die Kreisverwaltungsbehörde die von dem Mitgliedstaat<br />
benannten Behörden über Entscheidungen gemäß Absatz 1 Satz 3. 3 Wenn<br />
der andere Mitgliedstaat die zu beteiligenden Behörden nicht benannt hat,<br />
ist jeweils die oberste für Katastrophenschutz zuständige Behörde des<br />
anderen Mitgliedstaats zu unterrichten.<br />
(8) 1 Die externen Notfallpläne sind in angemessenen Abständen von<br />
höchstens drei Jahren durch die Kreisverwaltungsbehörde unter<br />
Beteiligung des Betreibers zu überprüfen, zu erproben und unter<br />
Berücksichtigung von Veränderungen und neuen Erkenntnissen<br />
fortzuschreiben.<br />
Bay KSG Art. 3 b Externe Notfallpläne für<br />
Abfallentsorgungseinrichtungen<br />
(1) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde hat Alarm- und Einsatzpläne (Art. 3 Abs. 1<br />
Nr. 1) als externe Notfallpläne für Abfallentsorgungseinrichtungen der<br />
Kategorie A gemäß Anhang III der Richtlinie 2006/21/EG des<br />
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die<br />
Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und<br />
zur Anderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABl L 102 S. 15) zu erstellen.<br />
2<br />
Satz 1 gilt nicht für Abfallentsorgungseinrichtungen, für die gemäß<br />
Art. 3 a Abs. 1 Satz 1 ein externer Notfallplan zu erstellen ist. 3 Art. 3 a<br />
Abs. 4 und 5 finden entsprechende Anwendung.<br />
(2) 1 Die externen Notfallpläne müssen die im Notfall im Umkreis des<br />
jeweiligen <strong>Stand</strong>orts zu ergreifenden Maßnahmen enthalten. 2 Mit den<br />
externen Notfallplänen werden folgende Ziele verfolgt:<br />
1. die Begrenzung und Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen<br />
und anderen Vorfällen mit dem Ziel, deren Auswirkungen zu minimieren
und insbesondere Schäden für die menschliche Gesundheit und die<br />
natürlichen Lebensgrundlagen einzuschränken;<br />
2. die Durchführung der Maßnahmen, die für den Schutz der menschlichen<br />
Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen vor den Folgen<br />
schwerer Unfälle und sonstiger Vorfälle erforderlich sind;<br />
3. die Unterrichtung der Öffentlichkeit und der relevanten Stellen oder<br />
Behörden im gebotenen Umfang;<br />
4. die Sicherstellung der Sanierung, Wiederherstellung und Säuberung der<br />
natürlichen Lebensgrundlagen nach einem schweren Unfall.<br />
Bay KSG Art. 4 Feststellung des Vorliegens einer Katastrophe<br />
(1) 1 Die Katastrophenschutzbehörde stellt das Vorliegen (Art. 1 Abs. 2) und<br />
das Ende einer Katastrophe fest. 2 Die Feststellung soll unverzüglich der<br />
Öffentlichkeit bekanntgegeben werden.<br />
(2) Die Katastrophenschutzbehörde hat die Aufsichtsbehörde und, soweit<br />
notwendig, auch die benachbarten Katastrophenschutzbehörden<br />
unverzüglich zu unterrichten.<br />
Bay KSG Art. 5 Einsatzleitung<br />
(1) 1 Die Katastrophenschutzbehörde leitet den Einsatz und stellt dabei sicher,<br />
daß alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind. 2 Sie kann allen für<br />
den Einsatzbereich zuständigen staatlichen Behörden und Dienststellen<br />
der gleichen oder einer niedrigeren Stufe, mit Ausnahme der obersten<br />
Landesbehörden, Weisungen erteilen. 3 Das gleiche gilt gegenüber den<br />
sonstigen zur Katastrophenhilfe Verpflichteten (Art. 7 Abs. 3 Nrn. 2 bis 6)<br />
und den eingesetzten Kräften. 4 Das Sachweisungsrecht übergeordneter<br />
Fachbehörden bleibt unberührt.<br />
(2) Leisten Kräfte des Bundes oder anderer Länder Katastrophenhilfe, so<br />
unterstehen auch sie für die Dauer ihrer Mitwirkung den Weisungen der<br />
Katastrophenschutzbehörde.<br />
Bay KSG Art. 6 Örtliche Einsatzleitung<br />
(1) 1 Die Katastrophenschutzbehörde soll für die Wahrnehmung ihrer<br />
Aufgaben am Schadensort eine den Einsatz dort leitende Person (Örtlicher<br />
Einsatzleiter) bestellen. 2 Diese leitet im Rahmen des Auftrags und der<br />
Weisungen der Katastrophenschutzbehörde alle Einsatzmaßnahmen vor<br />
Ort und kann allen eingesetzten Kräften Weisungen erteilen.<br />
(2) 1 Die Katastrophenschutzbehörde soll vorab fachlich geeignete Personen<br />
als Örtliche Einsatzleiter benennen. 2 Sie soll bestimmen, daß diese bei<br />
Katastrophen bereits vor einer Bestellung nach Absatz 1 Satz 1 die<br />
Einsatzleitung wahrnehmen dürfen, jedoch die Entscheidung der<br />
Katastrophenschutzbehörde nach Absatz 1 Satz 1 unverzüglich<br />
herbeizuführen haben.
III. ABSCHNITT Mitwirkung im Katastrophenschutz<br />
Bay KSG Art. 7 Katastrophenhilfe<br />
(1) 1 Katastrophenhilfe ist die auf Ersuchen der Katastrophenschutzbehörden<br />
zu leistende Mitwirkung im Katastrophenschutz. 2 Sie muß geleistet<br />
werden, wenn nicht durch die Hilfeleistung die Erfüllung dringender<br />
eigener Aufgaben ernstlich gefährdet wird.<br />
(2) Bei der Vorbereitung der Katastrophenabwehr erstreckt sich die Pflicht zur<br />
Katastrophenhilfe darauf,<br />
1. die Katastrophenschutzbehörden bei der Erstellung und Fortschreibung<br />
von allgemeinen Katastrophenschutzplänen und von Alarm- und<br />
Einsatzplänen (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1) zu unterstützen,<br />
2. auf Anforderung geeignete Personen für die Mitwirkung in der<br />
Katastropheneinsatzleitung zu benennen sowie<br />
3. an Katastrophenschutzübungen mitzuwirken.<br />
(3) Zur Katastrophenhilfe sind verpflichtet<br />
1. die Behörden und Dienststellen des Freistaates Bayern,<br />
2. die Gemeinden, die Landkreise und die Bezirke,<br />
3. die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden<br />
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,<br />
4. die Feuerwehren,<br />
5. die freiwilligen Hilfsorganisationen,<br />
6. die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege,<br />
auch wenn sie ihren Sitz oder <strong>Stand</strong>ort nicht im Zuständigkeitsgebiet der<br />
Katastrophenschutzbehörde haben.<br />
(4) 1 Das Ersuchen um Katastrophenhilfe stellt die Katastrophenschutzbehörde<br />
für ihr Gebiet. 2 Braucht sie Hilfe von auswärts, so stellt sie das Ersuchen<br />
über die für den Sitz oder den <strong>Stand</strong>ort der Verpflichteten zuständige<br />
Katastrophenschutzbehörde. 3 Ist Gefahr im Verzug, so kann diese Hilfe<br />
unter Benachrichtigung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde<br />
unmittelbar angefordert werden.<br />
(5) 1 Die nach Absatz 3 Verpflichteten leisten Katastrophenhilfe auch auf<br />
Anforderung durch andere Länder. 2 Absatz 4 Sätze 2 und 3 gelten<br />
entsprechend.<br />
Bay KSG Art. 7 a Rechtsverhältnisse der Helfer<br />
Rechte und Pflichten der nach diesem Gesetz mitwirkenden Helfer richten sich<br />
nach den Vorschriften der Organisationen, denen sie angehören, soweit nichts<br />
anderes durch Gesetz geregelt ist.<br />
Bay KSG Art. 7 b Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und<br />
Ersatzansprüche von Helfern der freiwilligen Hilfsorganisationen und<br />
Erstattungsansprüche der Arbeitgeber<br />
Bei Einsätzen zur Katastrophenabwehr von Helfern der freiwilligen<br />
Hilfsorganisationen gelten Art. 9 Abs. 1 bis 3 und Art. 10 des Bayerischen<br />
Feuerwehrgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass sich Ansprüche auf<br />
Ersatz von Verdientsausfall und Erstattungsansprüche der Arbeitgeber gegen<br />
die freiwillige Hilfsorganisation richten.
Bay KSG Art. 8 Sonstige Mitwirkung im Katastrophenschutz<br />
(1) 1 Träger von Krankenhäusern im Sinn von § 108 Nrn. 1 und 2 des<br />
Sozialgesetzbuchs, Fünftes Buch, die zur Bewältigung eines Massenanfalls<br />
von Verletzten geeignet sind, haben Alarm- und Einsatzpläne, die<br />
insbesondere organisatorische Maßnahmen zur Ausweitung der Aufnahmeund<br />
Behandlungskapazität vorsehen, aufzustellen und fortzuschreiben.<br />
2<br />
Die Pläne sind mit der Katastrophenschutzbehörde und den Trägern<br />
benachbarter Krankenhäuser abzustimmen; sie sind diesen und der<br />
Rettungsleitstelle zur Verfügung zu stellen. 3 Die<br />
Katastrophenschutzbehörde kann von der Verpflichtung nach Satz 1<br />
Ausnahmen zulassen; sie stellt in Zweifelsfällen auch die Eignung eines<br />
Krankenhauses im Sinn von Satz 1 fest. 4 Krankenhausträger sind darüber<br />
hinaus verpflichtet, für Schadensereignisse innerhalb der Krankenhäuser<br />
Notfallpläne aufzustellen.<br />
(2) Die Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, von denen besondere<br />
Brand-, Explosions- oder sonstige schwerwiegende Gefahren ausgehen<br />
können und die infolgedessen eine Vielzahl von Menschen oder die<br />
natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte zu gefährden<br />
geeignet sind, sind verpflichtet, die Katastrophenschutzbehörden bei der<br />
Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und bei<br />
Katastrophenschutzübungen zu unterstützen.<br />
(3) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wirkt gemäß ihrer<br />
Aufgabenzuweisung nach dem THW-Helferrechtsgesetz im<br />
Katastrophenschutz mit.<br />
IV. ABSCHNITT Besondere Befugnisse gegenüber Dritten<br />
Bay KSG Art. 9 Inanspruchnahme Dritter<br />
(1) 1 Die Katastrophenschutzbehörde kann zur Katastrophenabwehr von jeder<br />
Person die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen verlangen<br />
sowie die Inanspruchnahme von Sachen anordnen. 2 Art. 7 Abs. 4 gilt<br />
entsprechend.<br />
(2) Bei Gefahr in Verzug dürfen die eingesetzten Kräfte Sachen unmittelbar in<br />
Anspruch nehmen.<br />
Bay KSG Art. 10 Platzverweisung und Räumung<br />
1 Die Katastrophenschutzbehörde kann das Betreten des Katastrophengebiets<br />
verbieten, Personen von dort verweisen und das Katastrophengebiet sperren<br />
und räumen, wenn das zur Katastrophenabwehr erforderlich ist. 2 Von der<br />
Katastrophenschutzbehörde hierzu beauftragte eingesetzte Kräfte haben diese<br />
Befugnis bei Gefahr im Verzug, soweit Polizei nicht zur Verfügung steht.<br />
V. ABSCHNITT Kosten und Entschädigung<br />
Bay KSG Art. 11 Kostentragung<br />
(1) Die Katastrophenschutzbehörden und die zur Katastrophenhilfe<br />
Verpflichteten (Art. 7 Abs. 3) sowie die in Art. 8 Genannten tragen
unbeschadet des Absatzes 2 die sich aus der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
nach diesem Gesetz ergebenden Aufwendungen selbst.<br />
(2) Die für die Katastrophenabwehr zuständige Katastrophenschutzbehörde<br />
trägt die Kosten, die durch den Einsatz von Kräften<br />
1. des Bundes oder anderer Länder oder<br />
2. einer Werkfeuerwehr entstanden sind; die Pflicht zum Ersatz der<br />
Aufwendungen einer Werkfeuerwehr besteht nicht, wenn der Einsatz im<br />
Interesse des Betriebs oder der Einrichtung erfolgte, für die die<br />
Werkfeuerwehr besteht.<br />
(3) 1 Sind mehrere Katastrophenschutzbehörden an der Erfüllung der<br />
Aufgaben des Katastrophenschutzes beteiligt, so trägt jede die Kosten für<br />
die von ihr getroffenen Maßnahmen. 2 Die Kreisverwaltungsbehörde, die<br />
nach Art. 2 Abs. 2 als zuständige Katastrophenschutzbehörde bestimmt<br />
worden ist oder der die Einsatzleitung nach Art. 2 Abs. 3 übertragen<br />
wurde, kann von den anderen betroffenen Kreisverwaltungsbehörden<br />
Ersatz der ihr dadurch entstandenen Aufwendungen verlangen.<br />
Bay KSG Art. 12 Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes<br />
(1) 1 Das Staatsministerium des Innern unterhält einen Fonds zur Förderung<br />
des Katastrophenschutzes. 2 Der Fonds ist ein staatliches, vom<br />
Staatsministerium des Innern verwaltetes Sondervermögen ohne eigene<br />
Rechtspersönlichkeit.<br />
(2) Aus dem Fonds können<br />
1. Aufwendungen der Katastrophenschutzbehörden und der zur<br />
Katastrophenhilfe Verpflichteten für Maßnahmen zur Vorbereitung der<br />
Katastrophenabwehr gefördert werden;<br />
2. den Katastrophenschutzbehörden und den zur Katastrophenhilfe<br />
Verpflichteten für Maßnahmen, die der Abwehr einer Katastrophe dienen,<br />
Zuschüsse gewährt werden, um unzumutbare Belastungen des Trägers<br />
der Aufwendungen abzuwenden, wenn dies nicht durch Inanspruchnahme<br />
anderer Leistungen möglich ist.<br />
(3) 1 Der Staat, die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden leisten jährlich<br />
Beiträge zum Fonds. 2 Die Beiträge dürfen nicht höher sein, als<br />
erforderlich ist, um den Zweck des Fonds (Absatz 2) zu erfüllen. 3 Der<br />
Staat leistet das Doppelte des Beitrags, den die Landkreise und die<br />
kreisfreien Gemeinden zusammen erbringen.<br />
(4) 1 Die Beiträge der Landkreise und der kreisfreien Gemeinden werden nach<br />
dem Verhältnis der Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage zu dem von<br />
den Landkreisen und den kreisfreien Gemeinden insgesamt<br />
aufzubringenden Betrag festgesetzt. 2 Das Staatsministerium des Innern<br />
bestimmt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen<br />
durch Rechtsverordnung die Höhe der jährlichen Beiträge und die<br />
Einzelheiten des Berechnungs- und Erhebungsverfahrens; es kann<br />
vorgesehen werden, daß das Landesamt für Statistik und<br />
Datenverarbeitung die Beiträge ermittelt und festsetzt.
Bay KSG Art. 13 Aufwendungsersatz<br />
(1) 1 Die nach Art. 11 Abs. 1 zur Kostentragung Verpflichteten können Ersatz<br />
der notwendigen Aufwendungen verlangen, die ihnen durch Einsätze bei<br />
Katastrophen entstanden sind. 2 Ansprüche auf Grund anderer gesetzlicher<br />
Regelungen, insbesondere auch des bürgerlichen Rechts, bleiben hiervon<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Zum Aufwendungsersatz sind diejenigen verpflichtet, die die zum Einsatz<br />
führende Gefahr verursacht haben. 2 Geht die zum Einsatz führende<br />
Gefahr von einer Sache aus, sind auch die Inhaber der tatsächlichen<br />
Gewalt, die Eigentümer und sonst dinglich Verfügungsberechtigte zum<br />
Ersatz verpflichtet. 3 Zum Aufwendungsersatz verpflichtet sind auch die<br />
übrigen in Art. 9 Abs. 1 und 2 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes<br />
genannten Personen. 4 Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.<br />
(3) 1 Auf Aufwendungsersatz auf Grund Absatz 1 Satz 1 kann verzichtet<br />
werden, soweit eine Inanspruchnahme der Billigkeit widerspräche. 2 Ob<br />
und inwieweit ein Aufwendungsersatz der Billigkeit widerspräche,<br />
entscheidet die für die Katastrophenabwehr zuständige<br />
Katastrophenschutzbehörde.<br />
Bay KSG Art. 14 Entschädigung<br />
(1) Wer zu Dienst-, Sach- oder Werkleistungen nach Art. 9 herangezogen<br />
wird, die über verkehrsübliche Hilfeleistungen oder über die außerhalb<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s bestehenden Rechtspflichten hinausgehen, oder auf<br />
Grund von Maßnahmen nach Art. 9 oder 10 einen nicht zumutbaren<br />
Schaden erleidet, ist angemessen in Geld zu entschädigen, wenn er nicht<br />
anderweitig Ersatz zu erlangen vermag.<br />
(2) Zur Entschädigung verpflichtet ist der Träger der für die<br />
Katastrophenabwehr zuständigen Katastrophenschutzbehörde.<br />
(3) Im Fall der Tötung ist den Unterhaltsberechtigten in entsprechender<br />
Anwendung von § 844 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
Entschädigung zu leisten.<br />
(4) 1 Entschädigung nach den Absätzen 1 und 3 wird nur für<br />
Vermögensschäden gewährt. 2 Dabei sind Vermögensvorteile, die aus der<br />
zur Entschädigung verpflichtenden Maßnahme zufließen, sowie ein<br />
mitwirkendes Verschulden von Berechtigten zu berücksichtigen.<br />
(5) Entsprechend den Absätzen 1 bis 4 kann Entschädigung gewährt werden,<br />
wenn jemand, ohne daß er nach Art. 9 in Anspruch genommen worden ist,<br />
Leistungen erbringt, die zur Katastrophenabwehr erforderlich sind.<br />
VI. ABSCHNITT Schlußvorschriften<br />
Bay KSG Art. 15 Örtliche Einsatzleitung bei Schadensereignissen<br />
unterhalb der Katastrophenschwelle<br />
(1) 1 Zur Bewältigung von Schadensereignissen, die keine Katastrophen im<br />
Sinn von Art. 1 Abs. 2 sind, kann die Kreisverwaltungsbehörde fachlich<br />
geeignete Personen als Örtliche Einsatzleiter bestellen, soweit wegen des<br />
Ausmaßes des Schadensereignisses dadurch das geordnete
Zusammenwirken am Einsatzort wesentlich erleichtert wird. 2 Art. 6 Abs. 1<br />
Satz 2 findet insoweit entsprechende Anwendung; die Stellung der Polizei<br />
nach dem Polizeiaufgabengesetz bleibt unberührt.<br />
(2) 1 Soweit gemäß Art. 6 Abs. 2 vorab fachlich geeignete Personen als<br />
Örtliche Einsatzleiter benannt sind, soll die Kreisverwaltungsbehörde<br />
bestimmen, daß diese Personen die Einsatzleitung entsprechend<br />
Art. 6 Abs. 1 bereits vor einer Entscheidung über eine Bestellung nach<br />
Absatz 1 Satz 1 wahrnehmen dürfen. 2 Die nach Satz 1 genannten<br />
Personen sind verpflichtet, die Entscheidung der Kreisverwaltungsbehörde<br />
unverzüglich herbeizuführen.<br />
Bay KSG Art. 16 Ordnungswidrigkeiten<br />
Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder<br />
fahrlässig<br />
1. entgegen Art. 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 einer vollziehbaren Anordnung<br />
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt oder<br />
deren Durchführung stört oder<br />
2. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 10 zuwiderhandelt.<br />
Bay KSG Art. 17 Änderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (Nicht<br />
abgedruckt; die Änderung ist dort berücksichtigt.)<br />
Bay KSG Art. 18 Einschränkung von Grundrechten<br />
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die<br />
Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung<br />
(Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 11, 13 des Grundgesetzes,<br />
Art. 102, 106 Abs. 3, Art. 109, 113 der Verfassung) können auf Grund dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s eingeschränkt werden.<br />
Bay KSG Art. 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.<br />
(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Art. 8 Abs. 1 am 1. Januar 1999 in Kraft.<br />
(3) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt das Bayerische<br />
Katastrophenschutzgesetz (BayKSG) vom 31. Juli 1970 (BayRS 215-4-1-I)<br />
außer Kraft.<br />
(4) Art. 3 b gilt nicht für Abfallentsorgungseinrichtungen, die<br />
1. die Annahme von Abfällen vor dem 1. Mai 2006 eingestellt haben,<br />
2. im Begriff sind, die Stilllegungsverfahren gemäß den anzuwendenden<br />
Vorschriften oder nach den von der zuständigen Behörde genehmigten<br />
Programmen abzuschließen, und<br />
3. bis zum 31. Dezember 2010 tatsächlich stillgelegt werden.
Gesetz über kommunale Wahlbeamte<br />
(Bay KWBG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 20. Dezember 1985 (GVBl. S. 814), vom 3. August 1986 (GVBl.<br />
S. 205), vom 23. März 1989 (GVBl. S. 89), vom 25. April 1989 (GVBl. S. 104), vom 27. Dezember<br />
1991 (GVBl. S. 496), vom 7. August 1992 (GVBl. S. 306), vom 23. Juli 1994 (GVBl. S. 611), vom<br />
10. August 1994 (GVBl. S. 747), vom 26. Juli 1995 (GVBl. S. 371), vom 24. Juli 1998 (GVBl.<br />
S. 424), vom 22. Juli 1999 (GVBl. S. 300), vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 24. Dezember<br />
2002 (GVBl. S. 962), vom 25. Juni 2003 (GVBl. S. 374), vom 9. Juli 2003 (GVBl. S. 416), vom 7.<br />
August 2003 (GVBl. S. 497), vom 24. März 2004 (GVBl. S. 84), vom 26. Juli 2004 (GVBl. S. 272),<br />
vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 659), vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 665), vom 26. Juli<br />
2006 (GVBl. S. 405), vom 9. Juli 2007 (GVBl. S. 442), Anlagen neu gefasst durch Bekanntmachung<br />
vom 23. Januar 2008 (GVBl. S. 36), geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 400),<br />
Anlagen neu gefasst durch Bekanntmachung vom 17. August 2009 (GVBl. S. 478)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ABSCHNITT I Einleitende Vorschriften<br />
Art. 1<br />
Art. 2<br />
Art. 3<br />
ABSCHNITT II Beamtenverhältnis der kommunalen Wahlbeamten<br />
1. Allgemeines<br />
Art. 4<br />
Art. 5<br />
Art. 6<br />
Art. 7<br />
Art. 8<br />
Art. 9<br />
Art. 10<br />
Art. 11<br />
Art. 12<br />
Art. 13
2. Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfänger nach Auflösung<br />
oder Umbildung von Gemeinden und Landkreisen<br />
Art. 14<br />
3. Beendigung des Beamtenverhältnisses<br />
a) Allgemeines<br />
Art. 15<br />
b) Entlassung<br />
Art. 16<br />
Art. 17<br />
Art. 18<br />
Art. 19<br />
Art. 20<br />
Art. 21<br />
c) Verlust der Beamtenrechte<br />
Art. 22<br />
Art. 23<br />
Art. 24<br />
Art. 25<br />
d) Eintritt in den Ruhestand<br />
Art. 26<br />
Art. 27<br />
Art. 27 a<br />
Art. 28<br />
Artikel 29<br />
Art. 30<br />
e) Dienstunfähigkeit
Art. 31<br />
Art. 32<br />
f) Übernahme von Beamten durch ihre früheren Dienstherrn<br />
Art. 33<br />
Art. 33 a<br />
ABSCHNITT III Rechtliche Stellung der Beamten<br />
1. Pflichten der Beamten<br />
a) Allgemeines<br />
Art. 34<br />
Art. 35<br />
Art. 36<br />
b) Diensteid<br />
Art. 37<br />
c) Beschränkungen bei der Vornahme von Amtshandlungen<br />
Art. 38<br />
Art. 39<br />
d) Amtsverschwiegenheit<br />
Art. 40<br />
Art. 41<br />
Art. 42<br />
e) Nebentätigkeit<br />
Art. 43<br />
f) Annahme von Belohnungen
Art. 44<br />
g) Arbeitszeit<br />
Art. 45<br />
Art. 46<br />
h) Wohnung<br />
Art. 47<br />
2. Folgen der Nichterfüllung von Pflichten<br />
a) Verfolgung von Dienstvergehen<br />
Art. 48<br />
b) Haftung<br />
Art. 49<br />
3. Rechte der Beamten<br />
a) Fürsorge und Schutz<br />
Art. 50<br />
Art. 51<br />
Art. 52<br />
Art. 53<br />
Art. 54<br />
b) Amtsbezeichnung<br />
Art. 55<br />
c) Besoldung, Versorgungsbezüge und sonstige Bezüge der Beamten<br />
auf Zeit; Leistungen an Ehrenbeamte<br />
Art. 56<br />
Art. 56 a
Art. 57<br />
Art. 58<br />
Art. 59<br />
Art. 60<br />
Art. 61<br />
d) Reise- und Umzugskosten<br />
Art. 62<br />
e) Urlaub der Beamten auf Zeit<br />
Art. 63<br />
f) Personalakten und Dienstzeugnisse<br />
Art. 64<br />
Art. 65<br />
g) Vereinigungsfreiheit<br />
Art. 66<br />
h) Beamtenvertretung<br />
Art. 67<br />
ABSCHNITT IV Dienstbezüge, Zuwendungen und Beihilfen für die Beamten<br />
auf Zeit<br />
Art. 68 und 69<br />
Art. 70<br />
Art. 71<br />
Art. 72<br />
Art. 73
ABSCHNITT V Versorgung der Beamten auf Zeit<br />
Art. 74<br />
Art. 75 und 76<br />
Art. 77<br />
Art. 77 a<br />
Art. 78 bis 84<br />
Art. 85 bis 119<br />
Art. 120<br />
Art. 121 und 122<br />
Art. 123<br />
Art. 124 und 125<br />
Art. 126 bis 126 b<br />
Art. 127<br />
Art. 128 bis 130<br />
Art. 131<br />
Art. 132 und 133<br />
ABSCHNITT VI Leistungen an Ehrenbeamte; Ehrensold<br />
1. Entschädigung<br />
Art. 134<br />
Art. 135<br />
Art. 136<br />
Art. 136 a<br />
2. (gegenstandslos)
Art. 137<br />
3. Überbrückungshilfe<br />
Art. 137 a<br />
4. Ehrensold<br />
Art. 138<br />
Art. 138 a<br />
Art. 138 b<br />
ABSCHNITT VII Beschwerdeweg und Rechtsschutz<br />
Art. 139<br />
Art. 140<br />
Art. 141<br />
ABSCHNITT VIII Übergangs-, Änderungs- und Schlußvorschriften<br />
1. Übergangsvorschriften<br />
Art. 142<br />
Art. 143<br />
Art. 144<br />
Art. 145<br />
Art. 146<br />
Art. 147<br />
Art. 148<br />
Art. 149 bis 155<br />
2. Änderungen von Vorschriften<br />
Art. 156 bis 162<br />
3. Schlußvorschriften<br />
Art. 163
Art. 164<br />
Art. 165<br />
Art. 166<br />
Anlage 1<br />
Anlage 2<br />
ABSCHNITT I Einleitende Vorschriften<br />
Bay KWBG Art. 1<br />
Beamte im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s (kommunale Wahlbeamte) sind<br />
1. die ersten Bürgermeister und die weiteren Bürgermeister,<br />
2. die Landräte und ihre gewählten Stellvertreter<br />
3. die Bezirkstagspräsidenten und ihre gewählten Stellvertreter,<br />
4. die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder.<br />
Bay KWBG Art. 2<br />
Die Beamten stehen zu ihren Dienstherren in einem öffentlich-rechtlichen<br />
Dienst- und Treueverhältnis (Beamtenverhältnis).<br />
Bay KWBG Art. 3<br />
(1) 1 Dienstherr der Bürgermeister und der berufsmäßigen<br />
Gemeinderatsmitglieder ist die Gemeinde. 2 Dienstherr des Landrats und<br />
seines gewählten Stellvertreters ist der Landkreis; Dienstherr des<br />
Bezirkstagspräsidenten und seines gewählten Stellvertreters ist der<br />
Bezirk.<br />
(2) 1 Dienstvorgesetzter der berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder ist der<br />
erste Bürgermeister. 2 Vorgesetzter ist, wer auf Grund der<br />
Gemeindeordnung (GO) dem berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied für<br />
seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen kann.<br />
(3) Zuständigkeiten, die nach diesem Gesetz dem Dienstherrn des<br />
kommunalen Wahlbeamten übertragen sind, nimmt das nach dem<br />
Kommunalrecht jeweils zuständige Organ des Dienstherrn wahr.<br />
ABSCHNITT II Beamtenverhältnis der kommunalen Wahlbeamten<br />
1. Allgemeines<br />
Bay KWBG Art. 4<br />
Wer zum Bürgermeister, Landrat, Bezirkstagspräsidenten oder zum<br />
Stellvertreter des Landrats oder des Bezirkstagspräsidenten gewählt ist und die<br />
Wahl schriftlich, aber nicht in elektronischer Form, angenommen hat, wird mit<br />
dem Beginn der Amtszeit kommunaler Wahlbeamter, und zwar nach den<br />
kommunalrechtlichen Vorschriften Beamter auf Zeit oder Ehrenbeamter; eine<br />
Ernennung entfällt.
Bay KWBG Art. 5<br />
(1) Bewerber für das Amt eines berufsmaßigen Gemeinderatsmitglieds sind<br />
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu ermitteln, wenn<br />
nötig durch Stellenausschreibung.<br />
(2) Berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied kann werden, wer zum<br />
berufsmäßigen ersten Bürgermeister wählbar ist und entweder<br />
a) die für eine Laufbahn, die seinem künftigen Aufgabengebiet entspricht,<br />
vorgeschriebenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat oder<br />
b) mindestens drei Jahre seinem künftigen Aufgabengebiet entsprechend<br />
in verantwortlicher Stellung tätig gewesen ist.<br />
(3) Soweit in Fällen des Absatzes 2 Buchst. a nach allgemeinem Beamtenrecht<br />
Ausnahmen von den Vorschriften über Laufbahnprüfungen zulässig sind,<br />
können sie von den nach dem allgemeinen Beamtenrecht zuständigen<br />
Stellen unter den gleichen Voraussetzungen auch Bewerbern für das Amt<br />
eines berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds erteilt werden.<br />
Bay KWBG Art. 6<br />
(1) Wer zum berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied gewählt ist und die Wahl<br />
angenommen hat, ist zum Beamten auf Zeit zu ernennen.<br />
(2) 1 Die Ernennung wird durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde<br />
vollzogen. 2 In der Urkunde müssen die Worte “unter Berufung in das<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit” und die Angabe der Zeitdauer der Berufung<br />
enthalten sein. 3 Eine Ernennung in elektronischer Form ist<br />
ausgeschlossen.<br />
(3) 1 Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der in Absatz 2<br />
vorgeschriebenen Form, so liegt keine Ernennung vor. 2 Fehlt nur der<br />
Zusatz “auf Zeit”, so beeinträchtigt das die Wirksamkeit der Ernennung<br />
nicht. 3 Ist die Zeitdauer der Berufung nicht angegeben, so endet das<br />
Beamtenverhältnis sechs Jahre nach der Ernennung; das gleiche gilt,<br />
wenn ein längerer Zeitraum als sechs Jahre angegeben ist.<br />
(4) 1 Die Ernennung wird mit dem Tag der Aushändigung der<br />
Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein<br />
späterer Tag bestimmt ist. 2 Eine Ernennung auf einen zurückliegenden<br />
Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.<br />
Bay KWBG Art. 7<br />
(1) Mit dem Beginn der Amtszeit ist der Beamte auf Zeit aus einem bereits<br />
bestehenden Beamtenverhältnis beim gleichen Dienstherrn entlassen; ein<br />
privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum gleichen Dienstherrn erlischt.<br />
(2) Ein nach Art. 4 begründetes Ehrenbeamtenverhältnis kann nicht in ein<br />
Beamtenverhältnis anderer Art, ein anderes Beamtenverhältnis nicht in ein<br />
Ehrenbeamtenverhältnis umgewandelt werden.<br />
(3) Ein Beamter auf Zeit kann nicht gleichzeitig Ehrenbeamter bei demselben<br />
Dienstherrn werden.
Bay KWBG Art. 8<br />
(1) Ist die Wahl eines ersten Bürgermeisters oder eines Landrats für ungültig<br />
erklärt, so ist kein Beamtenverhältnis begründet worden.<br />
(2) 1 Ist die Wahl eines Bezirkstagspräsidenten, eines weiteren Bürgermeisters<br />
oder des Stellvertreters des Landrats oder des Bezirkstagspräsidenten als<br />
nichtig festgestellt oder aufgehoben, so ist kein Beamtenverhältnis<br />
begründet worden. 2 Ist die Wahl fehlerhaft aus Gründen, die nicht in der<br />
Person des Gewählten liegen, so kann die Wahl nur innerhalb von vier<br />
Monaten seit ihrer Vornahme rechtsaufsichtlich beanstandet oder vom<br />
Dienstherrn von Amts wegen aufgehoben werden.<br />
(3) 1 Verliert ein Bürgermeister, der Landrat, der Bezirkstagspräsident oder<br />
der gewählte Stellvertreter des Landrats oder des Bezirkstagspräsidenten<br />
nach der Wahl bis zum Beginn der Amtszeit die Wählbarkeit, so wird kein<br />
Beamtenverhältnis begründet. 2 Der Dienstherr stellt den Verlust der<br />
Wählbarkeit fest.<br />
(4) Verliert der Gewählte nach dem Beginn der Amtszeit die Wählbarkeit, so<br />
gelten die Vorschriften über die Beendigung des Beamtenverhältnisses.<br />
Bay KWBG Art. 9<br />
(1) 1 Die Ernennung eines berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds ist nichtig,<br />
wenn sie von einer sachlich unzuständigen Behörde ausgesprochen wurde.<br />
2<br />
Die Ernennung ist als von Anfang an wirksam anzusehen, wenn sie von<br />
der sachlich zuständigen Behörde schriftlich bestätigt wird.<br />
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn die Ernennung von einer anderen als der nach<br />
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung zuständigen Stelle einer<br />
Gemeinde ausgesprochen wurde.<br />
(3) 1 Wenn es für eine Ernennung der durch Gesetz bestimmten Mitwirkung<br />
einer Aufsichtsbehörde oder des Landespersonalausschusses bedarf, ist<br />
eine ohne diese Mitwirkung ausgesprochene Ernennung nichtig. 2 Der<br />
Mangel der Ernennung gilt als geheilt, wenn die Aufsichtsbehörde oder der<br />
Landespersonalausschuß nachträglich zustimmt.<br />
(4) 1 Die Ernennung eines berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds ist ferner<br />
nichtig,<br />
1. wenn seine Wahl als nichtig festgestellt oder aufgehoben ist; Art. 8<br />
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden;<br />
2. wenn der Gewählte bis zu dem Zeitpunkt, in dem nach Art. 6 Abs. 4 die<br />
Ernennung wirksam geworden wäre, die Wählbarkeit verloren hat; der<br />
Dienstherr stellt den Verlust der Wählbarkeit fest.<br />
2<br />
Verliert ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied die Wählbarkeit nach<br />
dem in Nummer 2 genannten Zeitpunkt, so gelten die Vorschriften über<br />
die Beendigung des Beamtenverhältnisses.<br />
Bay KWBG Art. 10<br />
(1) Die Ernennung eines berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds ist<br />
zurückzunehmen,<br />
1. wenn sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung<br />
herbeigeführt wurde oder<br />
2. wenn nicht bekannt war, daß der Ernannte ein Verbrechen oder
Vergehen begangen hatte, das ihn der Berufung in das Beamtenverhältnis<br />
unwürdig erscheinen läßt und er deswegen rechtskräftig zu einer Strafe<br />
verurteilt worden war oder verurteilt wird.<br />
(2) Eine Ernennung kann zurückgenommen werden, wenn nicht bekannt war,<br />
daß der Ernannte in einem Disziplinarverfahren aus dem<br />
Beamtenverhältnis entfernt oder gegen ihn auf Aberkennung des<br />
Ruhegehalts erkannt worden war.<br />
(3) 1 Die Rücknahme hat die Wirkung, daß die Ernennung von Anfang an nicht<br />
zustande gekommen ist. 2 Die Rücknahme der Ernennung ist auch nach<br />
Beendigung des Beamtenverhältnisses zulässig.<br />
Bay KWBG Art. 11<br />
1 Kann eine nach Art. 9 nichtige Ernennung nicht geheilt werden, so hat der<br />
Dienstvorgesetzte dem Ernannten unverzüglich die Weiterführung der<br />
Dienstgeschäfte zu verbieten. 2 In den anderen Fällen des Art. 9 ist die<br />
Weiterführung der Dienstgeschäfte zu verbieten, sobald feststeht, daß die<br />
Ernennung nicht bestätigt oder daß ihr nachträglich nicht zugestimmt wird.<br />
Bay KWBG Art. 12<br />
1 In den Fällen des Art. 10 kann die Ernennung nur innerhalb einer Frist von<br />
sechs Monaten zurückgenommen werden, nachdem die in beamtenrechtlichen<br />
Angelegenheiten zur Vertretung nach außen berechtigte Stelle von dem<br />
Rücknahmegrund Kenntnis erlangt hat. 2 Vor der Rücknahme sind der Beamte<br />
oder seine versorgungsberechtigten Hinterbliebenen, wenn möglich, zu hören.<br />
3 Die Rücknahme wird vom Dienstherrn erklärt; die Erklärung ist dem Beamten<br />
oder seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen zuzustellen.<br />
Bay KWBG Art. 13<br />
(1) Ist ein Beamtenverhältnis nicht zustande gekommen (Art. 8 Abs. 1 bis 3,<br />
Art. 9), so sind auf das zwischen dem Dienstherrn und dem Gewählten<br />
entstandene öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis und, wenn der Gewählte<br />
in den Ruhestand tritt, auch für den Ruhestand die Vorschriften dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s über die Rechte und Pflichten der kommunalen Wahlbeamten<br />
und die für diese geltenden Vorschriften des Bayerischen<br />
Disziplinargesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nachfolgend nichts<br />
anderes bestimmt ist.<br />
(2) 1 Das Dienstverhältnis endet in dem Zeitpunkt, in dem unanfechtbar<br />
feststeht, daß ein Beamtenverhältnis nicht zustande gekommen ist; wenn<br />
der Gewählte vor diesem Zeitpunkt nach den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
entlassen war oder entlassen wurde, bleibt es dabei. 2 War der Gewählte<br />
bereits in den Ruhestand versetzt, so endet der Ruhestand.<br />
(3) 1 Beträge, die als Dienstbezüge, Versorgungsbezüge,<br />
Dienstaufwandsentschädigungen und Entschädigungen bis zu dem in<br />
Absatz 2 genannten Zeitpunkt auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s gezahlt wurden,<br />
sind zu belassen. 2 An Versorgungsbezügen erhält der Gewählte<br />
Unfallfürsorge und, wenn die Gründe, die das Zustandekommen des<br />
Beamtenverhältnisses verhindert haben, nicht in seiner Person liegen,<br />
auch Übergangsgeld; sonstige Versorgungsbezüge werden nicht gewährt.
(4) Art. 7 Abs. 1 ist nicht anzuwenden; die Rechte und Pflichten aus dem<br />
bestehenden Beamtenverhältnis ruhen jedoch für die Dauer eines<br />
Dienstverhältnisses nach Absatz 1.<br />
(5) 1 Amtshandlungen des Gewählten, die bis zu dem in Absatz 2 genannten<br />
Zeitpunkt vorgenommen wurden, bleiben in gleicher Weise gültig, wie<br />
wenn sie ein Beamter vorgenommen hätte. 2 Ist einem berufsmäßigen<br />
Gemeinderatsmitglied die Weiterführung der Dienstgeschäfte verboten<br />
worden (Art. 11), so gilt Satz 1 entsprechend für Amtshandlungen, die es<br />
bis zum Zeitpunkt des Verbots vorgenommen hat.<br />
2. Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfänger nach<br />
Auflösung oder Umbildung von Gemeinden und Landkreisen<br />
Bay KWBG Art. 14<br />
(1) 1 Werden Gemeinden oder Landkreise umgebildet, so gelten für die<br />
Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfänger Art. 51 bis 54<br />
und 69 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG). 2 Ein Beamter auf<br />
Zeit, der in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist und der nicht<br />
nach Art. 69 Abs. 1 Satz 4 BayBG als dauernd in den Ruhestand versetzt<br />
gilt, ist mit dem Ablauf der Amtszeit, für die er gewählt ist, entlassen.<br />
(2) 1 Wird eine Gemeinde oder ein Landkreis vollständig in eine oder mehrere<br />
andere Gebietskörperschaften gleicher Art eingegliedert oder wird eine<br />
Gemeinde oder ein Landkreis unter völliger Einbeziehung einer<br />
bestehenden Gebietskörperschaft gleicher Art umgebildet, so sind die<br />
Ehrenbeamten mit dem Tag der Eingliederung oder Umbildung entlassen.<br />
2<br />
Wird eine Entscheidung über eine Eingliederung oder Umbildung<br />
angefochten, so tritt die Entlassung am Tag der Unanfechtbarkeit,<br />
frühestens jedoch mit dem für die Eingliederung oder Neubildung<br />
bestimmten Tag ein. 3 Für Bürgermeister und deren Angehörige, denen<br />
Überbrückungshilfe oder Ehrensold bewilligt worden ist, gilt Art. 54 Abs. 1<br />
BayBG entsprechend; dabei tritt im Fall der Anfechtung an die Stelle des<br />
in Art. 51 Abs. 1 BayBG bestimmten Zeitpunkts der in Satz 2 genannte<br />
Zeitpunkt.<br />
(3) 1 Wird bei einer nach Art. 13 Abs. 1 der Gemeindeordnung angeordneten<br />
Neuwahl der erste Bürgermeister einer von einer Gebietsänderung<br />
betroffenen fortbestehenden Gemeinde, der Beamter auf Zeit ist, in dieser<br />
Funktion nicht wiedergewählt, tritt er mit Beginn der Amtszeit des neuen<br />
ersten Bürgermeisters für den Rest seiner Amtszeit in den einstweiligen<br />
Ruhestand. 2 Wird bei einer nach Art. 13 Abs. 1 der Gemeindeordnung<br />
angeordneten Neuwahl der ehrenamtliche erste Bürgermeister der<br />
fortbestehenden Gemeinde in dieser Funktion nicht wiedergewählt, ist er<br />
mit Beginn der Amtszeit des neuen Bürgermeisters entlassen.
3. Beendigung des Beamtenverhältnisses<br />
a) Allgemeines<br />
Bay KWBG Art. 15<br />
(1) Das Beamtenverhältnis endet außer durch Tod durch<br />
1. Entlassung (Art. 16 bis 21),<br />
2. Verlust der Beamtenrechte (Art. 22 bis 25),<br />
3. Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nach den Vorschriften des<br />
Bayerischen Disziplinargesetzes.<br />
(2) Das Beamtenverhältnis auf Zeit endet ferner durch Eintritt in den<br />
Ruhestand (Art. 26 bis 30 und 33 a) unter Berücksichtigung der die<br />
beamtenrechtliche Stellung der Ruhestandsbeamten regelnden<br />
Vorschriften.<br />
b) Entlassung<br />
Bay KWBG Art. 16<br />
(1) Der Beamte ist mit dem Ende der Amtszeit entlassen, wenn er nicht in den<br />
Ruhestand tritt.<br />
(2) Der Beamte ist ferner entlassen, wenn er<br />
1. ohne vorherige Zustimmung des Dienstherrn seinen Wohnsitz oder<br />
seinen dauernden Aufenthalt im Ausland nimmt oder<br />
2. auf Grund eines Wahlvorschlags einer Partei gewählt worden ist, die<br />
das Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 21 des Grundgesetzes für<br />
verfassungswidrig erklärt, oder wenn er der für verfassungswidrig<br />
erklärten Partei zur Zeit der Verkündung der Entscheidung angehört,<br />
soweit nicht in der Entscheidung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.<br />
(3) 1 Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist der Beamte auch<br />
entlassen, wenn er eine Wählbarkeitsvoraussetzung verliert. 2 Das gilt<br />
nicht,<br />
1. wenn der Verlust der Wählbarkeit auf Art. 2 Nr. 2 des Gemeinde- und<br />
Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) beruht;<br />
2. gegenstandslos<br />
3. wenn der Beamte nicht mehr die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit<br />
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des<br />
Grundgesetzes und der Verfassung eintritt (Art. 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5<br />
GLKrWG).<br />
(4) Der Beamte auf Zeit ist auch entlassen, wenn er in ein öffentlichrechtliches<br />
Dienst- oder Amtsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn<br />
tritt, es sei denn, daß gesetzlich etwas anderes bestimmt ist oder daß er<br />
als Ehrenbeamter berufen wird.<br />
(5) Ein ehrenamtlicher Bürgermeister ist entlassen, wenn er Beamter oder<br />
Angestellter im Sinn des Art. 31 Abs. 3 Sätze 1 und 4 GO wird.<br />
(6) Ein ehrenamtlicher Bürgermeister, der zum Landrat gewählt ist, ist mit<br />
Beginn seiner Amtszeit als Landrat aus dem Ehrenbeamtenverhältnis<br />
entlassen.
(7) Ein weiterer Bürgermeister ist auch entlassen, wenn er aus dem<br />
Gemeinderat ausscheidet, ein gewählter Stellvertreter des Landrats, wenn<br />
er aus dem Kreistag ausscheidet, ein Bezirkstagspräsident oder sein<br />
gewählter Stellvertreter, wenn er aus dem Bezirkstag ausscheidet.<br />
(8) Art. 31 Abs. 3 GO bleibt unberührt.<br />
Bay KWBG Art. 17<br />
1 Das Beamtenverhältnis endet im Fall des Art. 16 Abs. 2 Nr. 2 mit der<br />
Verkündung der Entscheidung, soweit nicht in dieser ausdrücklich etwas<br />
anderes bestimmt ist; in den Fällen des Art. 16 Abs. 4 und 5 endet es mit dem<br />
Beginn des neuen Dienstverhältnisses. 2 Ob ein Beamter die Eigenschaft als<br />
Deutscher im Sinn des Art. 116 des Grundgesetzes verloren hat, entscheidet<br />
das Staatsministerium des Innern; es stellt den Tag der Beendigung des<br />
Beamtenverhältnisses fest. 3 In den übrigen Fällen des Art. 16 Abs. 2 und 3<br />
stellt der Dienstherr fest, daß die Voraussetzung für die Entlassung gegeben ist<br />
und an welchem Tag das Beamtenverhältnis endet.<br />
Bay KWBG Art. 18<br />
(1) Der Beamte ist zu entlassen, wenn er<br />
1. sich weigert, den gesetzlich vorgeschriebenen Diensteid zu leisten oder<br />
ein an dessen Stelle vorgeschriebenes Gelöbnis abzulegen, oder<br />
2. dienstunfähig ist und das Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den<br />
Ruhestand endet.<br />
(2) 1 Bei der Entlassung nach Absatz 1 Nr. 2 sind folgende Fristen einzuhalten:<br />
bei einer Beschäftigungszeit<br />
bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluß,<br />
von mehr als drei Monaten ein Monat zum Monatsschluß,<br />
von mindestens einem Jahr sechs Wochen zum Schluß eines<br />
Kalendervierteljahres.<br />
2<br />
Als Beschäftigungszeit gilt die beim gleichen Dienstherrn im gleichen Amt<br />
verbrachte Zeit.<br />
Bay KWBG Art. 19<br />
(1) 1 Der Beamte auf Zeit ist zu entlassen, wenn er es beantragt, der<br />
Ehrenbeamte, wenn er es aus wichtigem Grund beantragt. 2 Als wichtiger<br />
Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der Verpflichtete die Tätigkeit<br />
nicht ordnungsgemäß ausüben kann.<br />
(2) 1 Der Antrag, entlassen zu werden, muß schriftlich, aber nicht in<br />
elektronischer Form bei dem Dienstherrn gestellt werden. 2 Solange die<br />
Entlassungsverfügung dem Beamten nicht zugegangen ist, kann der<br />
Antrag innerhalb zweier Wochen nach Zugang bei dem Dienstherrn<br />
schriftlich zurückgenommen werden, mit dessen Zustimmung auch nach<br />
Ablauf dieser Frist.<br />
(3) 1 Ist dem Antrag stattzugeben, so ist die Entlassung zum beantragten<br />
Zeitpunkt auszusprechen. 2 Die Entlassung kann so lange<br />
hinausgeschoben werden, bis der Beamte seine Amtsgeschäfte<br />
ordnungsgemäß erledigt hat, längstens jedoch drei Monate; die Frist
eginnt mit dem Tag, an dem das Entlassungsgesuch beim Dienstherrn<br />
eingeht.<br />
Bay KWBG Art. 20<br />
(1) 1 Wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, wird die Entlassung vom<br />
Dienstherrn verfügt. 2 Die Entlassungsverfügung ist dem Beamten unter<br />
Angabe des Grundes und des Zeitpunkts der Entlassung zuzustellen.<br />
(2) Die Entlassung wird wirksam<br />
1. im Fall des Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 mit der Zustellung der<br />
Entlassungsverfügung,<br />
2. in den Fällen des Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 und des Art. 19 mit dem in der<br />
Entlassungsverfügung bezeichneten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit dem<br />
auf die Zustellung der Entlassungsverfügung folgenden Tag,<br />
3. sonst mit dem Ende des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die<br />
Entlassungsverfügung dem Beamten zugestellt worden ist; Art. 30 Abs. 4<br />
und Art. 32 Abs. 6 Satz 3 bleiben unberührt.<br />
Bay KWBG Art. 21<br />
(1) 1 Nach der Entlassung hat der frühere Beamte keinen Anspruch auf<br />
Dienstbezüge und Versorgung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt<br />
ist. 2 Er darf die frühere Amtsbezeichnung oder die Ehrenbezeichnung nach<br />
Art. 55 Abs. 4 nur führen, wenn ihm die Erlaubnis nach Art. 55 Abs. 3<br />
oder 4 erteilt ist.<br />
(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist ein berufsmäßiges<br />
Gemeinderatsmitglied verpflichtet, nach dem Ende der Amtszeit das Amt<br />
erneut zu übernehmen, wenn das Gemeinderatsmitglied unter mindestens<br />
gleich günstigen Bedingungen für wenigstens die gleiche Zeit wieder<br />
ernannt werden soll und das 62. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.<br />
c) Verlust der Beamtenrechte<br />
Bay KWBG Art. 22<br />
1 Das Beamtenverhältnis eines Beamten, der im ordentlichen Strafverfahren<br />
durch das Urteil eines deutschen Gerichts im Bundesgebiet<br />
1. wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr<br />
oder<br />
2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über<br />
Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates<br />
oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, zu<br />
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten<br />
verurteilt wird, endet mit der Rechtskraft des Urteils. 2 Entsprechendes gilt,<br />
wenn dem Beamten die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt<br />
wird oder wenn der Beamte auf Grund einer Entscheidung des<br />
Bundesverfassungsgerichts gemäß Art. 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht<br />
verwirkt hat.<br />
Bay KWBG Art. 23<br />
1 Endet das Beamtenverhältnis nach Art. 22, so hat der frühere Beamte keinen<br />
Anspruch auf Dienstbezüge und Versorgung oder Entschädigung, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 2 Er darf die frühere Amtsbezeichnung<br />
oder die Ehrenbezeichnung Altbürgermeister nicht führen, einen Ehrensold darf<br />
er nicht erhalten.<br />
Bay KWBG Art. 24<br />
(1) 1 Wird eine Entscheidung, die den Verlust der Beamtenrechte bewirkt hat,<br />
im Wiederaufnahmeverfahren durch eine Entscheidung ersetzt, die diese<br />
Wirkung nicht hat, so gilt das Beamtenverhältnis als nicht durch die<br />
ursprüngliche Entscheidung beendet. 2 Ist die Amtszeit noch nicht<br />
abgelaufen, so kann der Beamte sein Amt nicht mehr ausüben, wenn es<br />
inzwischen neu besetzt worden ist. 3 Auf Dienstbezüge, die dem Beamten<br />
auf Zeit nach Satz 1 zustehen, können ein anderes Arbeitseinkommen des<br />
Beamten oder Leistungen des Dienstherrn an ihn angerechnet werden;<br />
darüber entscheidet der Dienstherr. 4 Der Beamte ist zur Auskunft über<br />
dieses Einkommen verpflichtet.<br />
(2) Wird auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten<br />
Sachverhalts ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus<br />
dem Beamtenverhältnis eingeleitet, so verliert der Beamte die ihm nach<br />
Absatz 1 zustehenden Ansprüche, wenn auf Entfernung aus dem<br />
Beamtenverhältnis erkannt wird; bis zum rechtskräftigen Abschluß des<br />
Disziplinarverfahrens können die Ansprüche nicht geltend gemacht<br />
werden.<br />
(3) 1 Rechtfertigt der im Wiederaufnahmeverfahren festgestellte Sachverhalt<br />
die Einleitung eines Disziplinarverfahrens, mit dem Ziel der Entfernung des<br />
Beamten aus dem Beamtenverhältnis nicht, wird aber auf Grund eines<br />
rechtskräftigen Strafurteils, das nach der früheren Entscheidung ergangen<br />
ist, ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem<br />
Beamtenverhältnis eingeleitet, so gilt Absatz 2 entsprechend; der Beamte<br />
erhält jedoch in diesem Fall die Dienstbezüge nachgezahlt, die ihm bis zur<br />
Rechtskraft des Strafurteils aus seinem bisherigen Amt zugestanden<br />
hätten. 2 Absatz 1 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.<br />
Bay KWBG Art. 25<br />
(1) 1 Der Ministerpräsident kann durch einen Gnadenerweis den Verlust der<br />
Beamtenrechte aufheben. 2 Geschieht das in vollem Umfang, so gilt von<br />
diesem Zeitpunkt ab Art. 24 entsprechend.<br />
(2) Auf Unterhaltsbeiträge, die im Gnadenweg bewilligt werden, findet Art. 74<br />
Abs. 3 <strong>Bayerisches</strong> Disziplinargesetz entsprechende Anwendung, soweit<br />
die Gnadenentscheidung nichts anderes bestimmt.<br />
d) Eintritt in den Ruhestand<br />
Amtliche Fußnote: Vgl. jedoch § 2 des <strong>Gesetze</strong>s zur Änderung des <strong>Gesetze</strong>s über kommunale<br />
Wahlbeamte, BayRS 2022-1-1-I, der am 1. Juni 1982 in Kraft getreten ist und wie folgt lautet:Ҥ 2<br />
Übergangsvorschriften (1) ¹Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses <strong>Gesetze</strong>s vorhandene<br />
Beamte auf Zeit regeln sich Eintritt und Versetzung in den Ruhestand nach den bis zu diesem<br />
Zeitpunkt geltenden Vorschriften. ²Das gilt auch, wenn ein Beamter im Anschluß an die bei<br />
Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s laufende Amtszeit erneut in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen<br />
wird. (2) Für Beamte auf Zeit, die sich bei Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s im einstweiligen Ruhestand<br />
befinden, gilt Absatz 1 entsprechend.”
aa) Einstweiliger Ruhestand<br />
Bay KWBG Art. 26<br />
(1) In den Fällen des Art. 14 Abs. 1 beginnt der einstweilige Ruhestand für<br />
berufsmäßige Bürgermeister und für Landräte mit dem Zeitpunkt der<br />
Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Umbildung der<br />
Gebietskörperschaft, frühestens jedoch mit dem für die Eingliederung oder<br />
Neubildung bestimmten Tag.<br />
(2) 1 Für berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder beginnt der einstweilige<br />
Ruhestand, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt<br />
festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in dem die Verfügung über die<br />
Versetzung in den einstweiligen Ruhestand zugestellt wird, spätestens<br />
jedoch mit dem Ende der drei Monate, die auf den Monat der Zustellung<br />
folgen. 2 Die Verfügung kann bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestands<br />
zurückgenommen werden.<br />
Bay KWBG Art. 27<br />
(1) weggefallen<br />
(2) 1 Beamte auf Zeit im einstweiligen Ruhestand gelten mit dem Ende der<br />
Amtszeit, für die sie gewählt waren, als dauernd im Ruhestand befindlich,<br />
wenn sie zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand versetzt worden wären.<br />
2<br />
Andernfalls sind sie zu dem gleichen Zeitpunkt entlassen.<br />
bb) Ruhestand<br />
Bay KWBG Art. 27 a<br />
1 Der Eintritt in den Ruhestand richtet sich nach den Art. 28 bis 30 und 33 a.<br />
2 Sind bei einem Beamten auf Zeit, dessen Dienstverhältnis nach dem<br />
31. Dezember 1976 begründet worden ist, die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1<br />
des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) nicht erfüllt, so endet das<br />
Beamtenverhältnis statt durch Eintritt in den Ruhestand durch Entlassung.<br />
Bay KWBG Art. 28<br />
(1) 1 Der Beamte auf Zeit tritt mit dem Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand,<br />
wenn er<br />
1. für die folgende Amtszeit nicht wieder für das gleiche Amt gewählt wird<br />
oder die Wiederwahl nicht annimmt und<br />
2. eine Amtszeit von mindestens zehn Jahren (Wartezeit) zurückgelegt<br />
hat.<br />
2<br />
Satz 1 gilt nicht für ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied, das der<br />
Pflicht zur erneuten Übernahme seines Amts (Art. 21 Abs. 2) nicht<br />
nachkommt.<br />
(2) 1 Auf die Wartezeit werden angerechnet<br />
1. die Zeit, in der ein berufsmäßiger Bürgermeister oder ein Landrat<br />
früher als ehrenamtlicher erster Bürgermeister seinem Amt seine<br />
überwiegende Arbeitskraft gewidmet hat,<br />
2. die Zeit, in welcher der Beamte als gewählter Stellvertreter die<br />
Geschäfte des Landrats oder als ehrenamtlicher weiterer Bürgermeister<br />
die Geschäfte eines berufsmäßigen ersten Bürgermeisters ununterbrochen
länger als sechs Monate geführt und seine volle Arbeitskraft darauf<br />
verwendet hat,<br />
3. die Zeit, die ein berufsmäßiger kommunaler Wahlbeamter im<br />
einstweiligen Ruhestand zurückgelegt hat,<br />
4. die Zeit, die der Beamte als berufsmäßiger kommunaler Wahlbeamter<br />
in einem anderen als dem letzten Amt zurückgelegt hat.<br />
2 In den Fällen des Art. 42 Abs. 3 GLKrWG gilt die Wartezeit von zehn<br />
Jahren (Absatz 1 Nr. 2) auch dann als erfüllt, wenn das zehnte Jahr noch<br />
nicht abgelaufen, sondern erst angebrochen ist.<br />
Bay KWBG Artikel 29 (weggefallen)<br />
Bay KWBG Art. 30<br />
(1) 1 Wird die Dienstunfähigkeit des Beamten auf Zeit festgestellt, so hat der<br />
Dienstherr ihn in den Ruhestand zu versetzen, wenn er<br />
1. eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamten-,<br />
Richter- oder Soldatenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder<br />
2. wegen Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die er sich<br />
ohne grobes Verschulden bei der Ausübung oder aus Veranlassung des<br />
Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig geworden ist oder<br />
3. aus einem Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit in das<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen worden ist.<br />
2<br />
Auf die Dienstzeit nach Satz 1 Nr. 1 werden die in Art. 28 Abs. 2 Satz 1<br />
Nrn. 1 bis 3 und Satz 2 genannten Zeiten angerechnet; Art. 146 und 147<br />
gelten entsprechend.<br />
(2) Erfüllt ein dienstunfähiger Beamter auf Zeit keine der Voraussetzungen<br />
des Absatzes 1, so kann er in den Ruhestand versetzt werden.<br />
(3) 1 Der Ruhestand beginnt mit dem Ende der drei Monate, die auf den Monat<br />
folgen, in welchem ihm die Entscheidung des Dienstherrn zugestellt<br />
worden ist, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit. 2 Auf Antrag oder<br />
mit ausdrücklicher Zustimmung des Beamten kann der Dienstherr einen<br />
früheren Zeitpunkt festsetzen.<br />
(4) Tritt der Beamte auf Zeit nicht in den Ruhestand, so ist er zu dem in<br />
Absatz 3 genannten Zeitpunkt zu entlassen (Art. 18 Abs. 1 Nr. 2).<br />
e) Dienstunfähigkeit<br />
Bay KWBG Art. 31<br />
1 Der Beamte ist dienstunfähig, wenn er wegen seines körperlichen Zustands<br />
oder aus gesundheitlichen Gründen dauernd unfähig ist, seine Dienstpflichten<br />
zu erfüllen. 2 Als dienstunfähig kann der Beamte auch dann angesehen werden,<br />
wenn er wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate<br />
keinen Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, daß er innerhalb weiterer<br />
sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. 3 Bestehen Zweifel über die<br />
Dienstunfähigkeit des Beamten, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung des<br />
Dienstherrn ärztlich untersuchen und, falls ein Amtsarzt es für erforderlich hält,<br />
beobachten zu lassen. 4 Entzieht sich der Beamte trotz einmal wiederholter,<br />
ihm zugestellter Aufforderung ohne hinreichenden Grund der Verpflichtung,<br />
sich nach Weisung des Dienstherrn untersuchen oder beobachten zu lassen, so
kann er so behandelt werden, wie wenn seine Dienstunfähigkeit amtsärztlich<br />
festgestellt worden wäre.<br />
Bay KWBG Art. 32<br />
(1) Beantragt der Beamte, seine Dienstunfähigkeit festzustellen, so<br />
entscheidet der Dienstherr auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens, ob<br />
der Beamte dauernd unfähig ist, seine Dienstpflichten zu erfüllen.<br />
(2) 1 Hält der Dienstherr den Beamten für dienstunfähig und beantragt dieser<br />
nicht, seine Dienstunfähigkeit festzustellen, so teilt der Dienstherr dem<br />
Beamten oder seinem Vertreter schriftlich mit, daß die Feststellung der<br />
Dienstunfähigkeit beabsichtigt sei; die Gründe hierfür sind anzugeben.<br />
2<br />
Die Mitteilung ist zuzustellen.<br />
(3) Erhebt der Beamte oder sein Vertreter innerhalb eines Monats keine<br />
Einwendungen gegen die Feststellung der Dienstunfähigkeit, so ist<br />
Absatz 1 entsprechend anzuwenden.<br />
(4) 1 Werden Einwendungen erhoben, so entscheidet der Dienstherr, ob das<br />
Verfahren einzustellen oder fortzuführen ist. 2 Die Entscheidung ist dem<br />
Beamten oder seinem Vertreter zuzustellen.<br />
(5) 1 Wird das Verfahren fortgeführt, so wird ein Beamter, der zum Richteramt<br />
oder zum höheren Verwaltungsdienst befähigt ist, mit der Ermittlung des<br />
Sachverhalts beauftragt; er hat die Rechte und Pflichten des<br />
Dienstvorgesetzten und der Disziplinarbehörde im behördlichen<br />
Disziplinarverfahren. 2 Verfügt der Dienstherr nicht selbst über einen<br />
hierfür geeigneten Beamten, so hat er bei der Rechtsaufsichtsbehörde zu<br />
beantragen, daß ein geeigneter Beamter dieser Behörde mit den<br />
Ermittlungen beauftragt wird. 3 Der kommunale Wahlbeamte oder sein<br />
Vertreter ist zu den Vernehmungen zu laden. 4 Nach Abschluß der<br />
Ermittlungen ist der Beamte oder sein Vertreter zu dem Ergebnis der<br />
Ermittlungen zu hören.<br />
(6) 1 Wird hiernach die Dienstfähigkeit des Beamten festgestellt, so ist das<br />
Verfahren einzustellen. 2 Die Entscheidung ist dem Beamten oder seinem<br />
Vertreter zuzustellen. 3 Wird die Dienstunfähigkeit festgestellt, so ist der<br />
Beamte zum Ende des Monats, in dem die Entscheidung zugestellt wird,<br />
zu entlassen oder in den Ruhestand zu versetzen (Art. 18 Abs. 1 Nr. 2,<br />
Art. 30 Abs. 1 und 2).<br />
f) Übernahme von Beamten durch ihre früheren Dienstherrn<br />
Bay KWBG Art. 33<br />
(1) 1 Führt ein Beamter auf Zeit im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s nach Ablauf seiner<br />
Amtszeit das Amt nicht weiter und ist er aus einem Beamten- oder<br />
Richterverhältnis auf Lebenszeit oder auf Probe oder aus einem<br />
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen<br />
Dienstherrn im Geltungsbereich dieses <strong>Gesetze</strong>s Beamter auf Zeit<br />
geworden, so ist er auf seinen Antrag wieder in das frühere Dienst- oder<br />
Arbeitsverhältnis zu übernehmen, wenn er die dafür geltenden<br />
Voraussetzungen noch erfüllt; Vorschriften, welche die Ernennung eines<br />
Beamten oder Richters von einem bestimmten Lebensalter ab nicht mehr<br />
zulassen, sind nicht anzuwenden. 2 Der Antrag auf Übernahme ist
innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Beamtenverhältnisses<br />
auf Zeit zu stellen. 3 Der Übernahmeanspruch erlischt, wenn die Frist nicht<br />
eingehalten wird.<br />
(2) 1 Das dem Beamten zu übertragende Amt muß derselben oder einer<br />
gleichwertigen Laufbahn angehören und mit mindestens demselben<br />
Endgrundgehalt verbunden sein wie das Amt, das er im Zeitpunkt der<br />
Beendigung des früheren Beamten- oder Richterverhältnisses innehatte.<br />
2<br />
Dabei sind die in der Zwischenzeit versäumten Beförderungen in der<br />
früheren Dienststellung zu berücksichtigen.<br />
(3) 1 Der frühere Beamte oder Richter auf Lebenszeit und der frühere Beamte<br />
oder Richter auf Probe mit Versorgungsrechten erhält von dem Beginn des<br />
Monats an, in dem er den Antrag nach Absatz 1 gestellt hat, frühestens<br />
jedoch von dem auf die Entlassung folgenden Tag, bis zur Übertragung<br />
des neuen Amts von dem zur Übernahme verpflichteten Dienstherrn einen<br />
Bezug in Höhe des bei seiner Entlassung aus dem früheren Beamten- oder<br />
Richterverhältnis erdienten Ruhegehalts, nach Ablauf von sechs Monaten<br />
in Höhe der vollen Dienstbezüge, die ihm bei seinem Ausscheiden aus dem<br />
früheren Beamten- oder Richterverhältnis zugestanden haben. 2 Die im<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit verbrachte Dienstzeit gilt hierbei als Dienstzeit<br />
im Sinn des Besoldungs- und Versorgungsrechts. 3 Neben einem<br />
Ruhegehalt oder einem Übergangsgeld, das aus dem Beamtenverhältnis<br />
auf Zeit gewährt wird, gelten die Bezüge nach Satz 1 als frühere<br />
Versorgungsbezüge im Sinn des § 54 BeamtVG.<br />
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäß für Beamte auf Zeit, die aus einem<br />
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen<br />
Dienstherrn Beamte geworden sind.<br />
(5) 1 Ist eine Gebietskörperschaft, gegen die sich eine Rückübernahme richtet,<br />
aufgelöst worden, so ist die Gebietskörperschaft, in die ihr Gebiet<br />
eingegliedert oder einbezogen ist, verpflichtet, den Übernahmeanspruch<br />
zu erfüllen. 2 Ist ihr Gebiet in mehrere Gebietskörperschaften eingegliedert<br />
oder einbezogen worden, so kann der Beamte gegen jede von ihnen den<br />
Übernahmeanspruch geltend machen. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten<br />
entsprechend, soweit Aufgaben einer Körperschaft ganz oder teilweise auf<br />
eine oder mehrere Körperschaften übergehen.<br />
(6) 1 Ist ein früherer Dienstherr zur Übernahme nicht verpflichtet und nicht<br />
bereit, so kann der letzte kommunale Dienstherr den Beamten<br />
übernehmen. 2 Die Absätze 1 und 2 Satz 1 gelten entsprechend. 3 Dabei<br />
sollen die in der Zwischenzeit versäumten Beförderungen in der früheren<br />
Dienststellung nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 4 Ein<br />
Laufbahnwechsel bedarf nicht der Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses.<br />
Bay KWBG Art. 33 a<br />
Ist eine Übernahme in das frühere Dienstverhältnis nach Art. 33 nicht mehr<br />
möglich, weil die dafür maßgebliche gesetzliche Altersgrenze (Art. 62 BayBG)<br />
am Tag nach der Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Zeit überschritten<br />
ist, so tritt ein Beamter auf Zeit abweichend von Art. 28 mit Ablauf der Zeit,<br />
für die er gewählt oder ernannt ist, in den Ruhestand.
ABSCHNITT III Rechtliche Stellung der Beamten<br />
1. Pflichten der Beamten<br />
a) Allgemeines<br />
Bay KWBG Art. 34<br />
(1) 1 Der Beamte dient dem ganzen Volk, nicht einer Partei oder Gruppe. 2 Er<br />
hat die <strong>Gesetze</strong> zu beachten, seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu<br />
erfüllen und bei seiner Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit<br />
Bedacht zu nehmen.<br />
(2) 1 Der Beamte muß sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen<br />
demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und der<br />
Verfassung bekennen und für ihre Erhaltung eintreten. 2 Mit dieser<br />
Verpflichtung des Beamten ist insbesondere unvereinbar jede Verbindung<br />
mit einer Partei, Vereinigung oder Einrichtung, welche die freiheitliche<br />
demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und der<br />
Verfassung ablehnt oder bekämpft, oder die Unterstützung anderer<br />
verfassungsfeindlicher Bestrebungen.<br />
Bay KWBG Art. 35<br />
(1) 1 Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem Amt zu widmen. 2 Er hat<br />
es uneigennützig nach bestem Gewissen zu verwalten. 3 Sein Verhalten<br />
innerhalb und außerhalb des Dienstes muß der Achtung und dem<br />
Vertrauen gerecht werden, die sein Amt erfordert.<br />
(2) 1 Ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied hat seine Vorgesetzten zu<br />
beraten und zu unterstützen. 2 Es ist verpflichtet, ihre dienstlichen<br />
Anordnungen auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien zu befolgen;<br />
das gilt nicht, soweit der Beamte nach besonderen gesetzlichen<br />
Vorschriften an Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz<br />
unterworfen ist.<br />
Bay KWBG Art. 36<br />
(1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen<br />
die persönliche Verantwortung.<br />
(2) 1 Ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied hat Bedenken gegen die<br />
Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen unverzüglich bei seinem<br />
unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. 2 Wird die Anordnung<br />
aufrechterhalten, so hat sich der Beamte, wenn seine Bedenken gegen<br />
ihre Rechtmäßigkeit fortbestehen, an den nächsthöheren Vorgesetzten zu<br />
wenden. 3 Bestätigt dieser die Anordnung, so muß der Beamte sie<br />
ausführen und ist von der eigenen Verantwortung befreit; das gilt nicht,<br />
wenn das dem Beamten aufgetragene Verhalten strafbar oder<br />
ordnungswidrig und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für ihn<br />
erkennbar ist oder das ihm aufgetragene Verhalten die Würde des<br />
Menschen verletzt. 4 Die Bestätigung ist auf Verlangen schriftlich zu<br />
erteilen.<br />
(3) Verlangt der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige Ausführung der<br />
Anordnung, weil Gefahr im Verzug besteht und die Entscheidung des
nächsthöheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann,<br />
so gelten Absatz 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.<br />
(4) Hat der Landrat oder sein gewählter Stellvertreter Bedenken gegen die<br />
Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen, die ihm im Vollzug der<br />
Staatsaufgaben erteilt werden (Art. 37 Abs. 6 der Landkreisordnung), so<br />
gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend; an die Stelle des unmittelbaren<br />
Vorgesetzten tritt hierbei der Leiter der anordnenden Behörde und an die<br />
Stelle des nächsthöheren Vorgesetzten der Leiter der Behörde, die der<br />
anordnenden Behörde vorgesetzt ist.<br />
b) Diensteid<br />
Bay KWBG Art. 37<br />
(1) Der Beamte hat spätestens zu Beginn der ersten Sitzung, die der<br />
Gemeinderat, der Kreistag oder der Bezirkstag nach Aufnahme der<br />
Amtstätigkeit des Beamten abhält, folgenden Diensteid zu leisten: “Ich<br />
schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und<br />
der Verfassung des Freistaates Bayern. Ich schwöre, den <strong>Gesetze</strong>n<br />
gehorsam zu sein und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich<br />
schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten<br />
nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.”<br />
(2) 1 Der Eid kann auch ohne die Worte “so wahr mir Gott helfe” geleistet<br />
werden. 2 Erklärt ein Beamter, daß er aus Glaubens- oder<br />
Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat er an Stelle der Worte<br />
“ich schwöre” die Worte “ich gelobe” zu sprechen oder das Gelöbnis mit<br />
einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung<br />
seiner Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden gleichwertigen<br />
Beteuerungsformel einzuleiten.<br />
(3) Den Eid des ersten Bürgermeisters nimmt das älteste anwesende<br />
Gemeinderatsmitglied, den des Landrats der älteste anwesende Kreisrat<br />
und den des Bezirkstagspräsidenten der älteste anwesende Bezirksrat ab;<br />
in den übrigen Fällen nimmt den Eid ab, wer berechtigt ist, den<br />
Dienstherrn nach außen zu vertreten.<br />
(4) Die Eidesleistung entfällt, wenn der Beamte im Anschluß an seine Amtszeit<br />
wieder in ein Amt beim gleichen Dienstherrn gewählt wird.<br />
c) Beschränkungen bei der Vornahme von Amtshandlungen<br />
Bay KWBG Art. 38<br />
(1) 1 Der Beamte darf keine Amtshandlungen vornehmen, die ihm selbst,<br />
einem Angehörigen oder einer von ihm vertretenen natürlichen Person<br />
oder juristischen Person des Privatrechts einen unmittelbaren Vorteil oder<br />
Nachteil verschaffen würden. 2 Angehörige sind alle, zu deren Gunsten<br />
dem Beamten wegen familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren<br />
das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 3 Gesetzliche Vorschriften, nach<br />
denen der Beamte von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen ist,<br />
bleiben unberührt.<br />
(2) Ein Bürgermeister einer kreisangehörigen Gemeinde, der zugleich<br />
Stellvertreter des Landrats ist, darf den Landrat bei Amtshandlungen nicht
vertreten, die seiner Gemeinde einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil<br />
bringen können.<br />
(3) Ein Beamter, dessen Wahlrecht ruht, darf während dieser Zeit sein Amt<br />
nicht ausüben.<br />
Bay KWBG Art. 39<br />
(1) Die Regierung kann einen kommunalen Wahlbeamten von der Behandlung<br />
von Angelegenheiten entbinden, die im Interesse der Bundesrepublik oder<br />
eines ihrer Länder geheimzuhalten sind, wenn die begründete Besorgnis<br />
besteht, daß sonst die notwendige Sicherheit nicht gewährleistet ist oder<br />
daß dem Beamten oder nahen Angehörigen erhebliche Nachteile<br />
entstehen.<br />
(2) 1 Die Maßnahme ist unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe dafür<br />
weggefallen sind. 2 Sie endet spätestens mit dem Ablauf von drei Monaten,<br />
es sei denn, daß bis dahin aus dem gleichen Anlaß gegen den Beamten ein<br />
gerichtliches Disziplinarverfahren, ein Verfahren zur Prüfung der Wahl<br />
oder der Ernennung oder ein sonstiges auf Beendigung des<br />
Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist.<br />
(3) Der Beamte ist vor einer Maßnahme nach Absatz 1 zu hören, wenn es die<br />
Umstände zulassen.<br />
(4) weggefallen<br />
d) Amtsverschwiegenheit<br />
Bay KWBG Art. 40<br />
(1) 1 Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, über<br />
die ihm bei seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen<br />
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2 Das gilt nicht für<br />
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig<br />
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.<br />
(2) 1 Der Beamte darf ohne Genehmigung über Angelegenheiten, über die er<br />
Verschwiegenheit zu bewahren hat, weder vor Gericht noch<br />
außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 2 Die Genehmigung<br />
erteilt der Dienstherr oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, der<br />
letzte Dienstherr. 3 Hat sich der Vorgang, den die Äußerung betrifft, bei<br />
einem früheren Dienstherrn ereignet, so darf die Genehmigung nur mit<br />
dessen Zustimmung erteilt werden. 4 In Angelegenheiten des<br />
Staatsschutzes und der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens<br />
und des Schutzes der Zivilbevölkerung, ferner in Angelegenheiten, die von<br />
einer dazu berechtigten Behörde oder Stelle als Verschlußsachen<br />
gekennzeichnet sind, und in Angelegenheiten des staatlichen<br />
Aufgabenbereichs der Landratsämter erteilt der Leiter der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung nach Satz 1.<br />
(3) Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht des Beamten, Straftaten<br />
anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen demokratischen<br />
Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und der Verfassung für ihre<br />
Erhaltung einzutreten.
Bay KWBG Art. 41<br />
(1) 1 Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn<br />
die Aussage dem Wohl des Bundes, des Freistaates Bayern oder eines<br />
anderen deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung<br />
öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren<br />
würde. 2 Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt<br />
werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen nachteilig wäre.<br />
(2) 1 Ist der Beamte Partei oder Beschuldigter in einem gerichtlichen<br />
Verfahren oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung seiner berechtigten<br />
Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, wenn die<br />
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt sind, nur versagt werden,<br />
wenn die dienstlichen Rücksichten es unabweisbar erfordern. 2 Wird sie<br />
versagt, so ist dem Beamten der Schutz zu gewähren, den die dienstlichen<br />
Rücksichten zulassen.<br />
(3) Über die Versagung der Aussagegenehmigung entscheidet das<br />
Staatsministerium des Innern oder die von ihm durch Rechtsverordnung<br />
bestimmte Behörde.<br />
Bay KWBG Art. 42<br />
1 Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, auf<br />
Verlangen des Dienstherrn oder des letzten Dienstherrn amtliche Schriftstücke,<br />
Zeichnungen, bildliche Darstellungen sowie Aufzeichnungen jeder Art über<br />
dienstliche Vorgänge herauszugeben, auch soweit es sich um Wiedergaben<br />
handelt. 2 Eine Herausgabe privater Aufzeichnungen über dienstliche Vorgänge<br />
kann nur verlangt werden, wenn ein öffentliches Interesse an der<br />
Geheimhaltung dieser Vorgänge besteht. 3 Die Verpflichtung zur Herausgabe<br />
trifft gegen angemessene Entschädigung auch die Hinterbliebenen und die<br />
Erben des Beamten.<br />
e) Nebentätigkeit<br />
Bay KWBG Art. 43<br />
(1) Der Beamte auf Zeit ist verpflichtet, auf Verlangen des Dienstherrn eine<br />
Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung) im öffentlichen Dienst zu<br />
übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit seiner Vorbildung<br />
oder Berufsausbildung entspricht und ihn nicht über Gebühr in Anspruch<br />
nimmt.<br />
(2) Der Beamte auf Zeit bedarf, soweit er nicht nach Absatz 1 dazu<br />
verpflichtet ist, zur Übernahme einer Nebentätigkeit der vorherigen<br />
Genehmigung des Dienstherrn. 1 Art. 81 bis 84 und 86 BayBG sind<br />
anzuwenden; dabei tritt an die Stelle der obersten Dienstbehörde und des<br />
Dienstvorgesetzten der Dienstherr.<br />
(3) 1 Die zur Ausführung der Absätze 1 und 2 notwendigen Vorschriften über<br />
die Nebentätigkeit der Beamten auf Zeit erläßt die Staatsregierung durch<br />
Rechtsverordnung. 2 In ihr kann die Staatsregierung Vorschriften im<br />
gleichen Umfang erlassen wie für die Beamten im Sinn des Bayerischen<br />
Beamtengesetzes.
f) Annahme von Belohnungen<br />
Bay KWBG Art. 44<br />
Der Beamte darf, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses,<br />
Belohnungen oder Geschenke, die sich auf sein Amt beziehen, nur mit<br />
Zustimmung des Dienstherrn annehmen.<br />
g) Arbeitszeit<br />
Bay KWBG Art. 45<br />
1 Der Beamte auf Zeit ist verpflichtet, ohne Entschädigung über die<br />
regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche<br />
Verhältnisse es erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle<br />
beschränkt. 2 Wird er dadurch erheblich mehr beansprucht, so ist ihm<br />
entsprechende Dienstbefreiung innerhalb eines Jahres zu gewähren.<br />
Bay KWBG Art. 46<br />
(1) Verliert der Beamte auf Zeit wegen unentschuldigten Fernbleibens vom<br />
Dienst nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) seinen Anspruch auf<br />
Bezüge, so wird dadurch eine disziplinarische Verfolgung nicht<br />
ausgeschlossen.<br />
(2) 1 Ein berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied darf dem Dienst nicht ohne<br />
Genehmigung seines Dienstvorgesetzten fernbleiben. 2 Dienstunfähigkeit<br />
wegen Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. 3 Will der Beamte<br />
während seiner Krankheit seinen Wohnort verlassen. so hat er das vorher<br />
seinem Dienstvorgesetzten anzuzeigen und seinen Aufenthaltsort<br />
anzugeben.<br />
(3) 1 In allen übrigen Fällen, in denen der Beamte außer Dienst gestellt<br />
worden ist, kann ein anderes Einkommen oder ein beamtenrechtlicher<br />
Unterhaltsbeitrag, die der Beamte infolge der unterbliebenen<br />
Dienstleistung für diesen Zeitraum erzielen konnte, auf die Dienstbezüge<br />
angerechnet werden, wenn die Nichtanrechnung zu einem<br />
ungerechtfertigten Vorteil führen würde; der Beamte ist zur Auskunft<br />
verpflichtet. 2 In den Fällen einer vorläufigen Dienstenthebung auf Grund<br />
eines Disziplinarverfahrens finden die besonderen Vorschriften des<br />
Disziplinarrechts Anwendung.<br />
h) Wohnung<br />
Bay KWBG Art. 47<br />
(1) Der Beamte auf Zeit hat seine Wohnung so zu nehmen, daß er in der<br />
ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Dienstgeschäfte nicht<br />
beeinträchtigt wird.<br />
(2) Der Dienstherr kann ihn anweisen, seine Wohnung innerhalb einer<br />
bestimmten Entfernung von der Dienststelle zu nehmen oder eine<br />
Dienstwohnung zu beziehen, wenn die dienstlichen Verhältnisse es<br />
erfordern.<br />
(3) Wenn besondere Verhältnisse es dringend erfordern, kann der Beamte auf<br />
Zeit vom Dienstherrn, ein Landrat und ein Oberbürgermeister auch von
der Regierung angewiesen werden, sich während der dienstfreien Zeit<br />
erreichbar in Nähe seines Dienstorts aufzuhalten.<br />
2. Folgen der Nichterfüllung von Pflichten<br />
a) Verfolgung von Dienstvergehen<br />
Bay KWBG Art. 48<br />
(1) 1 Der Beamte begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft seine<br />
Pflichten verletzt. 2 Ein Verhalten des Beamten außerhalb des Dienstes ist<br />
ein Dienstvergehen, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in<br />
besonderem Maß geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für sein<br />
Amt oder das Ansehen des Beamtentums bedeutsamen Weise zu<br />
beeinträchtigen.<br />
(2) Bei einem Ruhestandsbeamten oder früheren Beamten mit<br />
Versorgungsbezügen gilt es als Dienstvergehen, wenn er<br />
1. sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des<br />
Grundgesetzes und der Verfassung betätigt oder<br />
2. an Bestrebungen teilnimmt, die darauf abzielen, den Bestand oder die<br />
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaates Bayern zu<br />
beeinträchtigen oder<br />
3. gegen Art. 40 (Amtsverschwiegenheit) oder gegen Art. 44 (Annahme<br />
von Belohnungen) verstößt oder<br />
4. gegen die Anzeigepflicht nach Art. 43 Abs. 2 Satz 2 dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
(Nebentätigkeit) in Verbindung mit § 41 Satz 1 des<br />
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) verstößt oder einer Untersagung nach<br />
Art. 43 Abs. 2 Satz 2 dieses <strong>Gesetze</strong>s in Verbindung mit § 41 Satz 2<br />
BeamtStG zuwiderhandelt.<br />
(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regelt das Bayerische<br />
Disziplinargesetz.<br />
b) Haftung<br />
Bay KWBG Art. 49<br />
(1) 1 Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden<br />
Pflichten, so hat er dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenommen<br />
hat, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 2 Haben mehrere<br />
Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, so haften sie als<br />
Gesamtschuldner.<br />
(2) 1 Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an,<br />
in dem der Dienstherr von dem Schaden und der Person des<br />
Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis<br />
in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. 2 Hat der Dienstherr<br />
einem Dritten Schadenersatz geleistet, so tritt an die Stelle des<br />
Zeitpunkts, in dem der Dienstherr von dem Schaden Kenntnis erlangt, der<br />
Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber vom<br />
Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig<br />
festgestellt wird.
(3) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen<br />
Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den<br />
Beamten über.<br />
3. Rechte der Beamten<br />
a) Fürsorge und Schutz<br />
Bay KWBG Art. 50<br />
1 Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses und nach<br />
Maßgabe dieses <strong>Gesetze</strong>s für das Wohl des Beamten und seiner<br />
versorgungsberechtigten Angehörigen zu sorgen. 2 Er schützt ihn bei seiner<br />
amtlichen Tätigkeit und in seiner Stellung als Beamter.<br />
Bay KWBG Art. 51<br />
Die rechtliche Stellung des Beamten kann unter anderen Voraussetzungen oder<br />
in anderen Formen als denen, die in diesem Gesetz bestimmt oder zugelassen<br />
sind, nicht verändert werden.<br />
Bay KWBG Art. 52<br />
Die Staatsregierung regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des<br />
öffentlichen Dienstes entsprechende Anwendung<br />
1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beamtinnen auf Zeit,<br />
2. der Vorschriften des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes über die<br />
Elternzeit auf Beamte auf Zeit,<br />
3. der Vorschriften des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch auf schwerbehinderte<br />
Beamte auf Zeit.<br />
Bay KWBG Art. 53<br />
1 Den Beamten soll bei Dienstjubiläen eine Jubiläumszuwendung gewährt<br />
werden. 2 Das Nähere regelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung.<br />
Bay KWBG Art. 54 (weggefallen)<br />
b) Amtsbezeichnung<br />
Bay KWBG Art. 55<br />
(1) 1 Männer und Frauen führen im Dienst die Amtsbezeichnung der ihnen<br />
übertragenen Ämter: Erster oder weiterer “Bürgermeister” oder erste oder<br />
weitere “Bürgermeisterin”, “Oberbürgermeister” oder<br />
“Oberbürgermeisterin”, “Landrat” oder “Landrätin”, “Bezirkstagspräsident”<br />
oder “Bezirkstagspräsidentin”. 2 Diese Amtsbezeichnungen dürfen auch<br />
außerhalb des Dienstes geführt werden.<br />
(2) Der Ruhestandsbeamte darf die ihm beim Eintritt in den Ruhestand<br />
zustehende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz “außer Dienst (a.D.)”<br />
weiterführen.<br />
(3) 1 Einem entlassenen Beamten auf Zeit kann der Dienstherr die Erlaubnis<br />
erteilen, die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz “außer Dienst (a.D.)” zu
führen. 2 Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn der frühere<br />
Beamte sich ihrer nicht würdig erweist.<br />
(4) 1 Früheren kommunalen Wahlbeamten können die Ehrenbezeichnungen<br />
“Altbürgermeister” oder “Altbürgermeisterin”, “Altoberbürgermeister” oder<br />
“Altoberbürgermeisterin”, “Altlandrat” oder “Altlandrätin”,<br />
“Altbezirkstagspräsident” oder “Altbezirkstagspräsidentin” verliehen<br />
werden; für frühere Beamte auf Zeit tritt in diesen Fällen die<br />
Ehrenbezeichnung an die Stelle der in den Absätzen 2 und 3<br />
vorgesehenen Bezeichnung. 2 Die Erlaubnis kann zurückgenommen<br />
werden, wenn der frühere Beamte sich ihrer nicht würdig erweist.<br />
c) Besoldung, Versorgungsbezüge und sonstige Bezüge der Beamten<br />
auf Zeit; Leistungen an Ehrenbeamte<br />
Bay KWBG Art. 56<br />
(1) Die Besoldung der Beamten auf Zeit wird durch das<br />
Bundesbesoldungsgesetz und das Bayerische Besoldungsgesetz geregelt,<br />
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) Die Versorgung des Beamten auf Zeit und seiner Hinterbliebenen richtet<br />
sich nach Abschnitt V.<br />
Amtliche Fußnote: “und nach dem Beamtenversorgungsgesetz”, BGBl FN 2030-2.<br />
(3) 1 Der Ehrenbeamte hat Anspruch auf Entschädigung. 2 Das Nähere über<br />
die Entschädigung und andere Leistungen an den Ehrenbeamten regelt<br />
Abschnitt VI.<br />
Bay KWBG Art. 56 a (weggefallen)<br />
Bay KWBG Art. 57<br />
(1) Der Beamte kann auf die laufende Entschädigung weder ganz noch<br />
teilweise verzichten.<br />
(2) weggefallen<br />
Bay KWBG Art. 58<br />
(1) Der Beamte auf Zeit kann, wenn bundesgesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist, Ansprüche auf die mit Rücksicht auf das Amt gewährten<br />
Leistungen, die nicht Bezüge im Sinn des Bundesbesoldungsgesetzes sind,<br />
nur insoweit abtreten oder verpfänden, als sie der Pfändung unterliegen.<br />
Amtliche Fußnote: “und des Beamtenversorgungsgesetzes”, BGBl FN 2030-2.<br />
(2) Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht<br />
gegenüber Ansprüchen auf die mit Rücksicht auf das Amt gewährten<br />
Leistungen, die nicht Bezüge im Sinn des Bundesbesoldungsgesetzes sind,<br />
nur insoweit geltend machen, als sie pfändbar sind; diese Einschränkung<br />
gilt nicht, soweit gegen den Empfänger ein Anspruch auf Schadensersatz<br />
wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.<br />
Amtliche Fußnote: “und des Beamtenversorgungsgesetzes”, BGBl FN 2030-2.
Bay KWBG Art. 59<br />
Für die Rückforderung einer ohne rechtlichen Grund geleisteten Entschädigung<br />
oder sonstiger, mit Rücksicht auf das Amt gewährter Leistungen, die nicht<br />
Bezüge im Sinn des Bundesbesoldungsgesetzes oder Versorgung im Sinn des<br />
Beamtenversorgungsgesetzes sind, gilt § 12 BBesG entsprechend.<br />
Bay KWBG Art. 60<br />
1 Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Ehrenbeamten eine<br />
über dieses Gesetz hinausgehende Entschädigung verschaffen sollen, sind<br />
unwirksam. 2 Das gleiche gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zweck<br />
geschlossen werden.<br />
Bay KWBG Art. 61<br />
1 Wird ein Beamter körperlich verletzt oder getötet, so geht ein gesetzlicher<br />
Schadensersatzanspruch, der dem Beamten oder seinen Hinterbliebenen<br />
infolge der Körperverletzung oder der Tötung gegen einen Dritten zusteht,<br />
insoweit auf den Dienstherrn über, als dieser<br />
1. während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der<br />
Dienstfähigkeit zur Gewährung von Dienstbezügen oder<br />
2. infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur Gewährung einer<br />
Versorgung oder einer anderen Leistung<br />
verpflichtet ist. 2 Ist eine Versorgungskasse zur Gewährung der Versorgung<br />
verpflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. 3 Der Übergang des Anspruchs<br />
kann nicht zum Nachteil des Beamten oder der Hinterbliebenen geltend<br />
gemacht werden.<br />
d) Reise- und Umzugskosten<br />
Bay KWBG Art. 62<br />
Die Reisekostenvergütung der kommunalen Wahlbeamten wird durch das<br />
Bayerische Reisekostengesetz und die Umzugskostenvergütung der Beamten<br />
auf Zeit durch das Bayerische Umzugskostengesetz geregelt.<br />
e) Urlaub der Beamten auf Zeit<br />
Bay KWBG Art. 63<br />
(1) 1 Die für die Beamten des Staates geltenden Rechtsvorschriften über den<br />
Urlaub gelten für die Beamten auf Zeit entsprechend; für Beamte, die<br />
keinen Dienstvorgesetzten haben, tritt an die Stelle des<br />
Dienstvorgesetzten und der vorgesetzten Dienststelle der Dienstherr. 2 Ein<br />
zusammenhängender Sonderurlaub von mehr als drei Monaten während<br />
einer Amtszeit ist unzulässig.<br />
(2) Beamte auf Zeit, die sich um das Amt eines berufsmäßigen ersten<br />
Bürgermeisters oder eines Landrats bewerben, erhalten in entsprechender<br />
Anwendung des Art. 28 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes<br />
Wahlvorbereitungsurlaub.
f) Personalakten und Dienstzeugnisse<br />
Bay KWBG Art. 64<br />
Die für die Beamten des Staates geltenden Rechtsvorschriften über die<br />
Personalakten gelten für die kommunalen Wahlbeamten entsprechend.<br />
Bay KWBG Art. 65<br />
1 Dem berufsmäßigen Gemeinderatsmitglied wird nach Beendigung des<br />
Beamtenverhältnisses auf Antrag von seinem letzten Dienstvorgesetzten ein<br />
Dienstzeugnis über Art und Dauer des von ihm bekleideten Amts erteilt. 2 Das<br />
Dienstzeugnis muß auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit, die<br />
Führung und die Leistung Auskunft geben.<br />
g) Vereinigungsfreiheit<br />
Bay KWBG Art. 66<br />
(1) 1 Die kommunalen Wahlbeamten haben das Recht, sich in Gewerkschaften<br />
oder Berufsverbänden zusammenzuschließen. 2 Sie können ihre<br />
Gewerkschaften oder Berufsverbände mit ihrer Vertretung beauftragen,<br />
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) Der kommunale Wahlbeamte darf wegen Betätigung für seine<br />
Gewerkschaft oder seinen Berufsverband nicht dienstlich gemaßregelt,<br />
benachteiligt oder bevorzugt werden.<br />
h) Beamtenvertretung<br />
Bay KWBG Art. 67<br />
Die kommunalen Wahlbeamten sind Beamte im Sinn des Bayerischen<br />
Personalvertretungsgesetzes.<br />
ABSCHNITT IV Dienstbezüge, Zuwendungen und Beihilfen für die<br />
Beamten auf Zeit<br />
Bay KWBG Art. 68 und 69 (weggefallen)<br />
Bay KWBG Art. 70<br />
(1) Das Grundgehalt des Beamten auf Zeit wird durch Beschluß festgesetzt.<br />
(2) Kommt innerhalb von zwei Monaten nach dem Beginn der Amtszeit des<br />
Beamten kein Beschluß nach Absatz 1 zustande, dann setzt die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde die Höhe des Grundgehalts fest.<br />
Bay KWBG Art. 71 (weggefallen)<br />
Bay KWBG Art. 72<br />
(1) 1 Der Beamte auf Zeit erhält für die durch das Amt bedingten<br />
Mehraufwendungen in der Lebensführung eine angemessene<br />
Dienstaufwandsentschädigung. 2 Sie muß sich innerhalb der in Anlage 2<br />
bestimmten Beträge halten. 3 Der anzuwendende Rahmensatz bestimmt
sich nach der letzten fortgeschriebenen Einwohnerzahl, die vom<br />
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung früher als drei Monate vor<br />
der Wahl veröffentlicht wurde.<br />
(2) 1 Die Dienstaufwandsentschädigung wird durch Beschluß festgesetzt.<br />
2 3<br />
Art. 70 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Die den Landräten<br />
zustehende Reisekostenvergütung für Reisen innerhalb des Landkreises ist<br />
mit der Dienstaufwandsentschädigung abgegolten; das gilt nicht für die<br />
Fahrkostenerstattung und die Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung.<br />
(3) 1 Für die Rahmensätze der Anlage 2 und für die nach Abs. 2 festgesetzten<br />
Dienstaufwandsentschädigungen gelten bei Beamten auf Zeit mit einer<br />
Besoldung nach der Besoldungsordnung A einheitliche Änderungen aller<br />
Grundgehälter der Besoldungsordnung A, bei Beamten auf Zeit mit einer<br />
Besoldung nach der Besoldungsordnung B einheitliche Änderungen aller<br />
Grundgehälter der Besoldungsordnung B jeweils mit dem gleichen<br />
Vomhundertsatz und ab dem gleichen Zeitpunkt unmittelbar. 2 Das<br />
Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, in diesem Fall die Anlage<br />
neu bekanntzumachen. 3 Bei der Neuberechnung sind Beträge, die<br />
geringer sind als ein halber Cent, abzurunden, Beträge von einem halben<br />
Cent und mehr sind aufzurunden.<br />
(4) 1 Ist der Beamte auf Zeit verhindert, seine Dienstgeschäfte<br />
wahrzunehmen, so wird die Dienstaufwandsentschädigung zwei Monate<br />
weitergezahlt. 2 Der Dienstherr kann durch Beschluß bestimmen, daß im<br />
Fall längerer Verhinderung die Entschädigung auch für einen über zwei<br />
Monate hinausgehenden Zeitraum ganz oder teilweise gewährt wird.<br />
Bay KWBG Art. 73 (weggefallen)<br />
ABSCHNITT V Versorgung der Beamten auf Zeit<br />
1. (gegenstandslos)<br />
Bay KWBG Art. 74 (weggefallen)<br />
2. Ruhegehalt<br />
a) und b) (gegenstandslos)<br />
Bay KWBG Art. 75 und 76 (weggefallen)<br />
c) Ruhegehaltfähige Dienstzeit<br />
Bay KWBG Art. 77<br />
(1) gegenstandslos<br />
(2) Ruhegehaltfähig ist ferner die Zeit, in welcher der Beamte auf Zeit<br />
1. als gewählter Stellvertreter die Geschäfte des Landrats oder<br />
2. als ehrenamtlicher weiterer Bürgermeister die Geschäfte eines<br />
berufsmäßigen ersten Bürgermeisters<br />
ununterbrochen länger als sechs Monate geführt und seine volle<br />
Arbeitskraft darauf verwendet hat.
Amtliche Fußnote: Siehe § 105 Satz 2 Nr. 2 BeamtVG, BGBl FN 2030-2.<br />
(3) bis (5) gegenstandslos<br />
Bay KWBG Art. 77 a<br />
Ist ein früherer ehrenamtlicher erster Bürgermeister oder ein früherer<br />
ehrenamtlicher Landrat zum berufsmäßigen Bürgermeister oder Landrat<br />
gewählt worden, so sind seine Dienstzeiten als ehrenamtlicher erster<br />
Bürgermeister oder ehrenamtlicher Landrat als ruhegehaltfähig anzuerkennen,<br />
wenn er seinem Amt seine überwiegende Arbeitskraft gewidmet hat.<br />
Bay KWBG Art. 78 bis 84 (weggefallen)<br />
3. bis 7. (gegenstandslos)<br />
Bay KWBG Art. 85 bis 119 (weggefallen)<br />
8. Gemeinsame Vorschriften<br />
a) Festsetzung, Regelung und Zahlung der Versorgungsbezüge<br />
Bay KWBG Art. 120<br />
(1) gegenstandslos<br />
(2) 1 Entscheidungen über das Ruhen von Versorgungsbezügen auf Grund von<br />
Kannvorschriften dürfen erst beim Eintritt des Versorgungsfalls getroffen<br />
werden; vorherige Zusicherungen sind unwirksam. 2 Fällt der Eintritt des<br />
Versorgungsfalls mit dem Ende der Wahlperiode des Gemeinderats oder<br />
Kreistags zusammen, so dürfen Entscheidungen nach Satz 1 frühestens<br />
drei Monate vor diesem Zeitpunkt getroffen werden.<br />
(3) und (4) gegenstandslos<br />
Bay KWBG Art. 121 und 122 (weggefallen)<br />
b) Ruhen der Versorgungsbezüge<br />
Bay KWBG Art. 123<br />
(1) Der Dienstherr kann anordnen, daß der Anspruch auf die dem<br />
Ruhestandsbeamten zustehenden Geldleistungen oder einen bewilligten<br />
Unterhaltsbeitrag bis längstens zur Vollendung des 62. Lebensjahres ruht,<br />
wenn sich der Beamte ohne wichtigen Grund nicht zur Wiederwahl für sein<br />
Amt stellen ließ oder die Wahl nicht angenommen hat, obwohl er<br />
dienstfähig war.<br />
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Beamte durch Auflösung oder Umbildung<br />
einer Gebietskörperschaft sein Amt verliert oder wenn ihm Unfallfürsorge<br />
zu gewähren ist.
Bay KWBG Art. 124 und 125 (weggefallen)<br />
c) gegenstandslos<br />
Bay KWBG Art. 126 bis 126 b (weggefallen)<br />
d) Verteilung der Versorgungslast<br />
Bay KWBG Art. 127<br />
(1) 1 Wurde das Beamtenverhältnis auf Zeit im Anschluß an ein anderes<br />
Beamten- oder ein Richterverhältnis begründet, so tragen die beteiligten<br />
Dienstherren die Versorgungsbezüge anteilig nach den Dienstzeiten, die<br />
der Beamte bei ihnen abgeleistet hat, soweit diese ruhegehaltfähig sind.<br />
2<br />
Bei der Berechnung der Dienstzeiten werden nur volle Jahre<br />
zugrundegelegt.<br />
(2) Sind die an den Beamten auf Zeit zu zahlenden Versorgungsbezüge aus<br />
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen zu berechnen, die höher sind als die<br />
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge eines früheren Amts bei einem anderen<br />
Dienstherrn, so bemißt sich der Anteil des anderen Dienstherrn so, wie<br />
wenn der Beamte in dem früheren Amt verblieben wäre.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beamter in den<br />
Ruhestand tritt, der auf Grund des Art. 33 Abs. 1 wieder in das frühere<br />
Dienstverhältnis übernommen worden war.<br />
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Beamte im Anschluß an<br />
ein Dienstverhältnis als dienstordnungsmäßiger Angestellter eines<br />
Sozialversicherungsträgers oder als Angestellter mit Versorgungsrechten<br />
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen Beamter auf Zeit geworden war.<br />
e) und f) gegenstandslos<br />
Bay KWBG Art. 128 bis 130 (weggefallen)<br />
g) Geltungsbereich<br />
Bay KWBG Art. 131<br />
Für die Anwendung des Unterabschnitts 8 gilt<br />
- bis 4. gegenstandslos<br />
- ein Unterhaltsbeitrag nach Art. 25 als Ruhegehalt, Witwen- oder<br />
Waisengeld,<br />
- gegenstandslos<br />
die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten als Ruhestandsbeamte,<br />
Witwen oder Waisen.<br />
Bay KWBG Art. 132 und 133 (weggefallen)
ABSCHNITT VI Leistungen an Ehrenbeamte; Ehrensold<br />
1. Entschädigung<br />
Bay KWBG Art. 134<br />
(1) 1 Der Ehrenbeamte hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung.<br />
2 Sie wird vom Dienstherrn festgesetzt und ist monatlich im voraus zu<br />
zahlen.<br />
(2) 1 Die Entschädigung für den ehrenamtlichen ersten Bürgermeister muß<br />
sich innerhalb der in der Anlage 1 bestimmten Beträge halten; sie ist nach<br />
pflichtgemäßem Ermessen festzusetzen, wobei besonders Inhalt und<br />
Umfang des einzelnen Amts und die Schwierigkeit der<br />
Verwaltungsverhältnisse in der Gemeinde zu berücksichtigen sind. 2 Der<br />
anzuwendende Rahmensatz bestimmt sich nach der letzten<br />
fortgeschriebenen Einwohnerzahl, die vom Landesamt für Statistik und<br />
Datenverarbeitung früher als drei Monate vor der Festsetzung der<br />
Entschädigung veröffentlicht wurde.<br />
(3) Die Entschädigung für den Bezirkstagspräsidenten ist nach<br />
pflichtgemäßem Ermessen festzusetzen, wobei besonders der Umfang des<br />
einzelnen Amts und die Größe des Bezirks zu berücksichtigen sind.<br />
(4) 1 Ein ehrenamtlicher weiterer Bürgermeister, der gewählte Stellvertreter<br />
des Landrats und der gewählte Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten<br />
erhalten neben den ihnen als Gemeinderat, Kreisrat oder Bezirksrat<br />
gewährten Entschädigungen eine weitere Entschädigung nach dem Maß<br />
ihrer besonderen Inanspruchnahme als kommunale Wahlbeamte. 2 Die<br />
Entschädigungen dürfen zusammen nicht mehr betragen als die<br />
Entschädigung oder die Summe von Grundgehalt, Familienzuschlag<br />
Stufe 1 und Dienstaufwandsentschädigung des Vertretenen.<br />
(5) 1 Ist der Ehrenbeamte ganz oder teilweise verhindert, seine<br />
Dienstgeschäfte auszuüben, so wird die Entschädigung zwei Monate<br />
weitergezahlt. 2 Ist er länger ganz oder teilweise verhindert, so kann der<br />
Dienstherr die Entschädigung auch für eine über zwei Monate<br />
hinausgehende Zeit ganz oder teilweise gewähren.<br />
Bay KWBG Art. 135<br />
(1) Die Höhe der Entschädigung wird gemäß Art. 134 Abs. 1 bis 4 durch<br />
Beschluß festgesetzt, der im Einvernehmen mit dem Beamten ergehen<br />
muß.<br />
(2) Kommt innerhalb von zwei Monaten nach dem Beginn der Amtszeit des<br />
Beamten kein Beschluß nach Absatz 1 zustande, dann setzt die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde die Höhe der Entschädigung fest.<br />
Bay KWBG Art. 136<br />
1 Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Besoldungsordnung A gelten<br />
mit dem gleichen Vomhundertsatz und ab dem gleichen Zeitpunkt unmittelbar<br />
für die Rahmensätze der Anlage 1 und für die nach Art. 135 festgesetzten<br />
Entschädigungen. 2 Art. 72 Abs. 3 Sätze 2 und 3 sind anzuwenden.
Bay KWBG Art. 136 a<br />
1 Der Ehrenbeamte erhält eine jährliche Sonderzahlung. 2 Das Gesetz über eine<br />
bayerische Sonderzahlung (<strong>Bayerisches</strong> Sonderzahlungsgesetz – BaySZG) gilt<br />
mit Ausnahme des Art. 5 entsprechend. 3 Dabei steht den Bezügen die<br />
Entschädigung nach Art. 134 Abs. 2 und 3 oder die weitere Entschädigung<br />
nach Art. 134 Abs. 4 gleich; dem für den Sonderbetrag für Kinder<br />
maßgeblichen Familienzuschlag steht das im jeweiligen Monat des<br />
Kalenderjahres tatsächlich oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des<br />
Einkommensteuergesetzes zustehende Kindergeld gleich. 4 Für den<br />
Grundbetrag der jährlichen Sonderzahlung gilt ein Vomhundertsatz von<br />
70 v. H., wenn die in Satz 3 genannte Entschädigung im Kalendermonat einen<br />
Betrag von 3 436,08 €Laut Bekanntmachung vom 11. August 2009 (AllMBl.<br />
S. 288). nicht übersteigt; im Übrigen gilt ein Vomhundertsatz von 65 v. H.<br />
5 Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Besoldungsordnung A gelten<br />
mit dem gleichen Vomhundertsatz und ab dem gleichen Zeitpunkt unmittelbar<br />
für den in Satz 4 genannten Betrag; Art. 72 Abs. 3 Satz 3 ist anzuwenden.<br />
2. (gegenstandslos)<br />
Bay KWBG Art. 137 (weggefallen)<br />
3. Überbrückungshilfe<br />
Bay KWBG Art. 137 a<br />
(1) 1 Wird ein ehrenamtlicher erster Bürgermeister auf Grund des Art. 14<br />
Abs. 2 oder 3, des Art. 16 Abs. 1 oder des Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 entlassen,<br />
so erhält er als Überbrückungshilfe die Hälfte der Entschädigung nach<br />
Art. 134 Abs. 2 monatlich im voraus so viele Monate weiter, wie er ohne<br />
Unterbrechung volle Jahre in seinem Amt zurückgelegt hat, mindestens<br />
jedoch drei und höchstens zwölf Monate. 2 Überbrückungshilfe wird nicht<br />
gewährt, wenn der frühere erste Bürgermeister für die folgende Amtszeit<br />
in sein Amt wiedergewählt wird. 3 Stirbt der Empfänger, so steht der noch<br />
nicht ausgezahlte Betrag, mindestens jedoch das Dreifache des<br />
Monatsbetrags nach Satz 1, seinem Ehegatten, seinen minderjährigen<br />
leiblichen oder an Kindes Statt angenommenen Kindern zu.<br />
(2) Einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Art. 53 Abs. 8<br />
BeamtVG) wird auf die Überbrückungshilfe nach Absatz 1 Satz 1<br />
angerechnet.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bezirkstagspräsidenten und ihre<br />
Hinterbliebenen entsprechend.<br />
(4) 1 Scheidet ein ehrenamtlicher erster Bürgermeister oder ein<br />
Bezirkstagspräsident durch Tod aus dem Amt, so erhalten die<br />
Berechtigten nach Absatz 1 Satz 3 als Überbrückungshilfe das Sechsfache<br />
der Entschädigung nach Art. 134 in einer Summe. 2 Entsprechendes gilt<br />
für ehrenamtliche weitere Bürgermeister und für den gewählten<br />
Stellvertreter des Landrats oder des Bezirkstagspräsidenten, wenn sie im<br />
Zeitpunkt ihres Ablebens den ersten Bürgermeister, den Landrat oder den<br />
Bezirkstagspräsidenten ohne Unterbrechung länger als sechs Monate<br />
vertreten haben.
4. Ehrensold<br />
Bay KWBG Art. 138<br />
(1) 1 Einem Bürgermeister kann für die Zeit nach seinem Ausscheiden<br />
Ehrensold bewilligt werden, wenn er außer einem Übergangsgeld keine<br />
Versorgung aus dieser Tätigkeit erhält, sein Amt in derselben Gemeinde<br />
mindestens zehn Jahre, in Fällen des Art. 41 Abs. 2 GLKrWG mehr als acht<br />
Jahre, bekleidet und entweder das sechzigste Lebensjahr vollendet hat<br />
oder dienstunfähig ist. 2 Einem ersten Bürgermeister ist Ehrensold zu<br />
gewähren, wenn er mindestens zwölf Jahre lang das Amt des ersten<br />
Bürgermeisters in derselben Gemeinde bekleidet hat oder aus diesem Amt<br />
nach mindestens zehn Jahren wegen Dienstunfähigkeit ausscheidet und<br />
wenn die weiteren Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. 3 Ein Rest von<br />
mehr als sechs Monaten zählt als volles Jahr.<br />
(2) 1 Nach dem Tod eines Bürgermeisters oder früheren Bürgermeisters kann<br />
dem Ehegatten und den minderjährigen leiblichen und von ihm an Kindes<br />
Statt angenommenen Kindern Ehrensold gewährt werden, wenn er nach<br />
Absatz 1 gewährt worden ist oder hätte gewährt werden können oder<br />
müssen. 2 Nach dem Tod eines ersten Bürgermeisters oder früheren ersten<br />
Bürgermeisters ist seinem Ehegatten Ehrensold zu gewähren, wenn dem<br />
ersten Bürgermeister Ehrensold nach Absatz 1 Satz 2 gewährt wurde oder<br />
hätte gewährt werden müssen; die Zahlung endet, wenn der Ehegatte<br />
wieder heiratet.<br />
(3) 1 Soweit Ehrensold nach Absatz 1 Satz 2 zu gewähren ist, beträgt er ein<br />
Drittel der zuletzt bezogenen Entschädigung (Art. 134 Abs. 2). 2 Im<br />
übrigen darf der Ehrensold monatlich 852,66 €Laut Bekanntmachung vom<br />
11. August 2009 (AllMBl. S. 288). nicht übersteigen. 3 Der Ehrensold des<br />
Ehegatten nach Absatz 2 Satz 2 beträgt 60 v. H. des sich nach Satz 1<br />
ergebenden Betrages. 4 Der Ehrensold des Ehegatten nach Absatz 2 Satz 1<br />
darf 60 v. H. des Betrags nach Satz 2 nicht übersteigen.511,60 € laut<br />
Bekanntmachung vom 11. August 2009 (AllMBl. S. 288). 5 Übergangsgeld<br />
oder Überbrückungshilfe werden auf den Ehrensold angerechnet. 6 Art. 60<br />
gilt entsprechend. 7 Der Ehrensold ist monatlich im voraus zu zahlen.<br />
(4) Die Bewilligung kann zurückgenommen werden, wenn sich ein Empfänger<br />
des Ehrensolds nicht würdig erweist.<br />
(5) Ist ein weiterer Bürgermeister innerhalb dreier Monate nach dem<br />
Zusammentritt des neu gewählten Gemeinderats in sein Amt gewählt<br />
worden, so gilt als Beginn seiner Amtszeit der Beginn der Wahlzeit des<br />
Gemeinderats.<br />
(6) Ist ein ehrenamtlicher Bürgermeister in einer Gemeinde wiedergewählt<br />
worden, die unter vollständiger oder teilweiser Einbeziehung seiner<br />
früheren Gemeinde neu gebildet oder mit seiner früheren Gemeinde<br />
zusammengelegt worden ist, so werden auf die Fristen des Absatzes 1 die<br />
Zeiten angerechnet, die der Bürgermeister in der früheren Gemeinde im<br />
Amt war.<br />
(7) 1 Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Besoldungsordnung A<br />
gelten mit dem gleichen Vomhundertsatz und ab dem gleichen Zeitpunkt<br />
unmittelbar für den Ehrensold und für die Höchstgrenzen des Abs. 3;
Art. 72 Abs. 3 Satz 3 ist anzuwenden. 2 Wird der Ehrensold nicht im<br />
unmittelbaren Anschluß an das Ausscheiden gezahlt, so ist bei der<br />
Berechnung nach Absatz 3 Satz 1 so zu verfahren, als hätte die zuletzt<br />
bezogene Entschädigung an den nachfolgenden allgemeinen Änderungen<br />
entsprechend Satz 1 teilgenommen.<br />
(8) Art. 136 a gilt entsprechend.<br />
Bay KWBG Art. 138 a<br />
1 Der gewählte Stellvertreter des Landrats und seine Hinterbliebenen können<br />
Ehrensold entsprechend Art. 138 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 erhalten.<br />
2 Amtszeiten sind die als gewählter Stellvertreter des Landrats im<br />
Ehrenbeamtenverhältnis zurückgelegten Zeiten. 3 Im Übrigen gilt Art. 138<br />
entsprechend.Laut Bekanntmachung vom 11. August 2009 (AllMBl. S. 288)<br />
beträgt die monatliche Höchstgrenze des Ehrensolds 852,66 €, für den<br />
Ehegatten 511,60 €.<br />
Bay KWBG Art. 138 b<br />
1 Die Bestimmungen über den Ehrensold nach Art. 138 gelten für<br />
Bezirkstagspräsidenten im Ehrenbeamtenverhältnis und ihre Hinterbliebenen<br />
mit der Maßgabe entsprechend, daß an die Stelle des in Art. 138 Abs. 3 Satz 2<br />
genannten Betrags der Betrag von 1 258,40 €Laut Bekanntmachung vom<br />
11. August 2009 (AllMBl. S. 288); die monatliche Höchstgrenze des Ehrensolds<br />
für den Ehegatten nach Art. 138 b Satz 1 i.V.m. Art. 138 Abs. 3 Satz 4 beträgt<br />
laut dieser Bekanntmachung 755,04 €. tritt. 2 Amtszeiten sind die als<br />
Bezirkstagspräsident im Ehrenbeamtenverhältnis zurückgelegten Zeiten.<br />
3 Zeiten, die nach dem 8. Mai 1945 und vor dem 1. Oktober 1978 auf Grund<br />
einer Wahl als ehrenamtlicher Bezirkstagspräsident in demselben Bezirk<br />
zurückgelegt wurden, sind zu berücksichtigen. 4 Ist ein Bezirkstagspräsident<br />
innerhalb dreier Monate nach dem Zusammentritt des neugewählten<br />
Bezirkstags in sein Amt gewählt worden, so gilt als Beginn seiner Amtszeit der<br />
Beginn der Wahlzeit des Bezirkstags.<br />
ABSCHNITT VII Beschwerdeweg und Rechtsschutz<br />
Bay KWBG Art. 139<br />
(1) 1 Das berufsmäßige Gemeinderatsmitglied kann Anträge stellen und<br />
Beschwerden vorbringen; es hat hierbei den Dienstweg einzuhalten. 2 Der<br />
Beschwerdeweg zum ersten Bürgermeister und zum Gemeinderat steht<br />
offen.<br />
(2) Richtet sich die Beschwerde gegen den unmittelbaren Vorgesetzten (Art. 3<br />
Abs. 2), so kann sie bei dem nächsthöheren Vorgesetzten eingereicht<br />
werden.<br />
Bay KWBG Art. 140<br />
1 Das Verfahren vor der Erhebung der Klage, der Rechtsweg und das<br />
gerichtliche Verfahren für Klagen aus dem Beamtenverhältnis richten sich nach<br />
den §§ 126, 127 und 137 BRRG. 2 Erläßt auf Grund des Art. 47 die Regierung<br />
oder auf Grund des Art. 70 Abs. 2 oder Art. 135 Abs. 2 die
Rechtsaufsichtsbehörde einen Verwaltungsakt, so erläßt den<br />
Widerspruchsbescheid die Regierung, im Fall der Festsetzung der<br />
Entschädigung des Bezirkstagspräsidenten und seines gewählten<br />
Stellvertreters das Staatsministerium des Innern.<br />
Bay KWBG Art. 141<br />
1 Verfügungen und Entscheidungen, die dem Beamten oder<br />
Versorgungsberechtigten nach den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
bekanntzugeben sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf<br />
gesetzt wird oder Rechte des Beamten oder Versorgungsberechtigten berührt<br />
werden. 2 Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, richtet sich die<br />
Zustellung nach dem Bayerischen Verwaltungszustellungs- und<br />
Vollstreckungsgesetz.<br />
ABSCHNITT VIII Übergangs-, Änderungs- und Schlußvorschriften<br />
1. Übergangsvorschriften<br />
Bay KWBG Art. 142 (weggefallen)<br />
Bay KWBG Art. 143<br />
(1) gegenstandslos<br />
(2) weggefallen<br />
Bay KWBG Art. 144 (weggefallen)<br />
Bay KWBG Art. 145<br />
(1) bis (3) gegenstandslos<br />
(4) weggefallen<br />
(5) gegenstandslos<br />
(6) In den Fällen des Art. 14 Abs. 1, 2 und 3 gilt für die in Art. 138 Abs. 1<br />
genannten Fristen die gesamte laufende Wahlzeit als zurückgelegte<br />
Amtszeit.<br />
(7) 1 Auf die in Art. 138 Abs. 1 bestimmten Fristen sind die Amtszeiten<br />
anzurechnen, die der Ehrenbeamte nach dem 8. Mai 1945 und vor dem<br />
Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s auf Grund einer Wahl als ehrenamtlicher<br />
Bürgermeister in derselben Gemeinde zurückgelegt hat. 2 Art. 138 gilt<br />
entsprechend für ehrenamtliche erste Bürgermeister, deren gesamte<br />
Amtszeit in den im Satz 1 genannten Zeitraum fällt. 3 Art. 147 gilt<br />
entsprechend.<br />
Bay KWBG Art. 146<br />
(1) weggefallen<br />
(2) weggefallen
Bay KWBG Art. 147<br />
1 Die Wahlperiode vom 1. Juni 1948 (Wahl der Landräte) oder vom 1. Juli 1948<br />
(Wahl der Bürgermeister) bis zum 30. April 1952 gilt für die Wartezeit als<br />
Wahlperiode von vollen vier Jahren. 2 Die Wahlperiode vom 1. Juli 1972 bis<br />
zum 30. April 1978 (Gesetz über die Kommunalwahlen 1972 vom<br />
27. Juli 1971, GVBl S. 251) gilt für die Wartezeit als Wahlperiode von vollen<br />
sechs Jahren.<br />
Bay KWBG Art. 148<br />
(1) bis (6) gegenstandslos<br />
(7) weggefallen<br />
Bay KWBG Art. 149 bis 155 (weggefallen)<br />
2. Änderungen von Vorschriften<br />
Bay KWBG Art. 156 bis 162 (weggefallen)<br />
3. Schlußvorschriften<br />
Bay KWBG Art. 163<br />
(1) Die Staatsregierung erläßt die zum Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlichen<br />
Ausführungsverordnungen.<br />
(2) gegenstandslos<br />
Bay KWBG Art. 164 (weggefallen)<br />
Bay KWBG Art. 165<br />
Frauen, denen die Führung einer männlichen Amtsbezeichnung nach Art. 55<br />
Abs. 4 erlaubt worden ist, sind berechtigt, diese Amtsbezeichnung künftig in<br />
der weiblichen Form zu führen.<br />
Bay KWBG Art. 166<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1964 in Kraft mit Ausnahme der Art. 53<br />
und 54; diese treten am 1. Juli 1962 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. Juni 1964 (GVBl. S. 113).<br />
(2) gegenstandslos
Anlage 1<br />
Entschädigungen für die ehrenamtlichen ersten Bürgermeister<br />
(gültig ab 1. März 2009)<br />
Einwohner der Gemeinde monatliche Entschädigung<br />
bis 1 000 425,38 bis 1 885,26 €<br />
1 001 bis 3 000 1 808,40 bis 3 268,29 €<br />
3 001 bis 5 000 2 807,25 bis 3 882,98 €<br />
Anlage 2<br />
über 5 000 3 268,29 bis 4 190,31 €<br />
Monatliche Dienstaufwandsentschädigungen für die Beamten auf Zeit<br />
(gültig ab 1. März 2009)<br />
A. Erste Bürgermeister<br />
1.kreisangehöriger Gemeinden 171,69 bis 563,02 €<br />
2.kreisfreier Gemeinden und<br />
Großer Kreisstädte<br />
a)bis 50 000 Einwohner 302,06 bis 823,87 €<br />
b)von 50 001 bis 100 000 Einwohner 432,53 bis 954,34 €<br />
c)über 100 000 Einwohner 563,02 bis 1 084,78 €<br />
B. Weitere Bürgermeister und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder<br />
1.kreisangehöriger Gemeinden 145,57 bis 458,67 €<br />
2.kreisfreier Gemeinden und<br />
Großer Kreisstädte<br />
a)bis 50 000 Einwohner 249,93 bis 667,34 €<br />
b)von 50 001 bis 100 000 Einwohner 354,27 bis 771,71 €<br />
c)über 100 000 Einwohner 458,67 bis 876,04 €<br />
C. Landräte 693,46 bis 954,34 €
Verordnung über die Laufbahnen der<br />
bayerischen Beamtinnen und Beamten<br />
(Bay LbV)<br />
vom 1. April 2009 (GVBl. S. 51) (FN BayRS 2030-2-1-1-F)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Teil 1 Allgemeines [§§ 1 - 13 ]<br />
Teil 2 Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber<br />
Abschnitt 1 Gemeinsame Vorschriften [§§ 14 - 20 ]<br />
Abschnitt 2 Befähigung von Bewerberinnen und Bewerbern aus Mitgliedstaaten<br />
der Europäischen Union [§§ 21 - 30 ]<br />
Abschnitt 3 Öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis [§§ 31 - 34 ]<br />
Abschnitt 4 Einfacher Dienst [§§ 35 - 37 ]<br />
Abschnitt 5 Mittlerer Dienst [§§ 38 - 41 ]<br />
Abschnitt 6 Gehobener Dienst [§§ 42 - 46 ]<br />
Abschnitt 7 Höherer Dienst [§§ 47 - 51 ]<br />
Teil 3 Laufbahnen besonderer Fachrichtungen [§§ 52 - 54 ]<br />
Teil 4 Andere Bewerberinnen und Bewerber [§§ 55 - 56 ]<br />
Teil 5 Dienstliche Beurteilung [§§ 57 - 66 ]<br />
Teil 6 Fortbildung [§ 67 ]<br />
Teil 7 Übernahme von Beamtinnen und Beamten [§§ 68 - 69 ]<br />
Teil 8 Landespersonalausschuss [§§ 70 - 71 ]<br />
Teil 9 Übergangs- und Schlussvorschriften [§§ 72 - 75 ]<br />
Anlage 1 (zu § 28)<br />
Anlage 2 (zu § 53)<br />
Anlage 3 (zu § 53)
Auf Grund von Art. 26 Abs. 1, Art. 30 Abs. 1, Art. 35 Abs. 3, Art. 41 Abs. 2<br />
Satz 2 und Abs. 3, Art. 44, Art. 99 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Art. 115 Abs. 2 des<br />
Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500,<br />
BayRS 2030-1-1-F) erlässt die Bayerische Staatsregierung folgende<br />
Verordnung:<br />
[§§ 1 - 13] Teil 1 Allgemeines<br />
Bay LbV § 1 Geltungsbereich<br />
(1) 1 Diese Verordnung gilt für die Beamtinnen und Beamten des Staates, der<br />
Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen unter der Aufsicht<br />
des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des<br />
öffentlichen Rechts, soweit sich aus ihr nichts anderes ergibt. 2 Sie gilt für<br />
Richterinnen und Richter entsprechend, soweit durch besondere<br />
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist.<br />
(2) Diese Verordnung gilt nicht für<br />
1. Professorinnen und Professoren, ausgenommen § 58,<br />
2. Beamtinnen und Beamte auf Zeit, mit Ausnahme der Beamtinnen und<br />
Beamten in Ämtern mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf Zeit<br />
(Art. 45 BayBG) und<br />
3. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte.<br />
(3) Mit Ausnahme der Teile 5 und 6 gilt diese Verordnung nicht für die<br />
Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes, soweit die Verordnung über die<br />
Laufbahnen der bayerischen Polizeivollzugsbeamten oder eine sonstige<br />
Verordnung nach Art. 126 BayBG etwas anderes bestimmt.<br />
Bay LbV § 2 Ausschreibung<br />
(1) 1 Bewerberinnen und Bewerber sind durch Stellenausschreibung zu<br />
ermitteln, wenn dies im besonderen dienstlichen Interesse liegt. 2 Ein<br />
besonderes dienstliches Interesse liegt insbesondere dann vor, wenn für<br />
die Besetzung freier Stellen geeignete Laufbahnbewerberinnen und<br />
Laufbahnbewerber beim Dienstherrn nicht zur Verfügung stehen.<br />
(2) 1 Die Stellenausschreibung muss für die Bewerbung eine Frist von<br />
mindestens zwei Wochen vorsehen. 2 Auf gesetzliche Vorschriften, nach<br />
denen bestimmte Personengruppen bevorzugt einzustellen sind (§ 3<br />
Abs. 1), soll besonders hingewiesen werden.<br />
Bay LbV § 3 Begriffsbestimmungen<br />
(1) Einstellung ist eine Ernennung, durch die ein Beamtenverhältnis begründet<br />
wird.<br />
(2) 1 Beförderung ist eine Ernennung, durch die ein anderes Amt mit höherem<br />
Endgrundgehalt verliehen wird; Amtszulagen gelten als Bestandteil des<br />
Grundgehalts. 2 Einer Beförderung steht es gleich, wenn ein anderes Amt<br />
mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe<br />
verliehen wird.
Bay LbV § 4 Erwerb der Laufbahnbefähigung<br />
(1) 1 Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber erwerben die Befähigung<br />
für eine Laufbahn durch<br />
1. Ableisten des Vorbereitungsdienstes und Bestehen der<br />
Laufbahnprüfung,<br />
2. Einführung und Bestehen der Laufbahnprüfung nach den §§ 41 und 45,<br />
3. Feststellung der erfolgreichen Einführung in die Aufgaben des<br />
gehobenen Dienstes nach § 46 und Feststellung der Befähigung für den<br />
höheren Dienst nach § 51,<br />
4. Anerkennung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union<br />
erworbenen Qualifikationsnachweises gemäß §§ 21 bis 30,<br />
5. Erwerb der Vorbildung und hauptberufliche Tätigkeit in einer Laufbahn<br />
besonderer Fachrichtungen nach den §§ 52 bis 54,<br />
6. Anerkennung nach § 5 Abs. 2, 3 und 4 und § 69 Abs. 3 oder<br />
7. Feststellung des Landespersonalausschusses nach § 70.<br />
2<br />
In den Laufbahnen des einfachen Dienstes entfällt die Laufbahnprüfung.<br />
(2) 1 Andere Bewerberinnen und Bewerber erwerben die Befähigung durch<br />
Lebens- und Berufserfahrung innerhalb oder außerhalb des öffentlichen<br />
Dienstes. 2 Die Befähigung ist vor der Einstellung durch den<br />
Landespersonalausschuss festzustellen (§ 55).<br />
Bay LbV § 5 Laufbahnwechsel, Anerkennung der Befähigung<br />
(1) Ein Laufbahnwechsel ist zulässig, wenn die Beamtin oder der Beamte die<br />
Befähigung für die neue Laufbahn besitzt.<br />
(2) 1 Die oberste Dienstbehörde kann die von einer Laufbahnbewerberin oder<br />
von einem Laufbahnbewerber im Geltungsbereich des Bayerischen<br />
Beamtengesetzes durch Bestehen der Laufbahnprüfung erworbene<br />
Befähigung als Befähigung für eine gleichwertige Laufbahn anerkennen.<br />
2<br />
Laufbahnen gelten als einander gleichwertig, wenn<br />
1. sie zu derselben Laufbahngruppe gehören und<br />
2.<br />
a) die Befähigung für die neue Laufbahn eine im Wesentlichen gleiche Vorund<br />
Ausbildung voraussetzt oder<br />
b) die Befähigung für die neue Laufbahn auch auf Grund der Vorbildung,<br />
Ausbildung und Tätigkeit in der bisherigen Laufbahn durch Unterweisung<br />
erworben werden kann.<br />
3<br />
Die Anerkennung ist ausgeschlossen, wenn für die neue Laufbahn eine<br />
bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch besondere<br />
Rechtsvorschrift vorgeschrieben oder nach ihrer Eigenart zwingend<br />
erforderlich ist. 4 Die Anerkennung bedarf in den Laufbahnen des<br />
gehobenen und höheren Dienstes der Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses. 5 Der Landespersonalausschuss kann die<br />
Zustimmung auch von dem Nachweis abhängig machen, dass geeignete<br />
Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber mit der einschlägigen<br />
Laufbahnbefähigung nicht zu gewinnen sind; dies gilt nicht in den Fällen<br />
des Art. 48 Abs. 2 BayBG, § 26 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 3 oder § 29 Abs. 2<br />
des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG). 6 Er kann über die Art der<br />
Unterweisung besondere Regelungen treffen.
(3) 1 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte mit der<br />
Laufbahnprüfung für den mittleren oder gehobenen Polizeivollzugsdienst,<br />
die nach Art. 48 Abs. 2, Art. 128 Abs. 3 BayBG in Verbindung mit § 26<br />
Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 3 oder § 29 Abs. 2 BeamtStG in eine Laufbahn des<br />
mittleren oder gehobenen Verwaltungsdienstes übernommen werden<br />
sollen, erwerben die Befähigung für die neue Laufbahn durch<br />
Unterweisung und eine mindestens einjährige Tätigkeit in einem Amt der<br />
neuen Laufbahn. 2 Über die Anerkennung der Befähigung entscheidet die<br />
für das Amt der neuen Laufbahn zuständige oberste Dienstbehörde.<br />
(4) 1 Wer nach Art. 48 Abs. 2 BayBG, § 26 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 3 oder § 29<br />
Abs. 2 BeamtStG in eine andere als eine entsprechende (Art. 27 Abs. 4<br />
Sätze 1 und 2 BayBG) oder gleichwertige Laufbahn übernommen werden<br />
soll, erwirbt die Befähigung für die neue Verwendung durch Unterweisung<br />
und eine mindestens einjährige Tätigkeit in der neuen Verwendung, wenn<br />
auf Grund der Vorbildung, Ausbildung und Tätigkeit in der bisherigen<br />
Laufbahn zu erwarten ist, dass die Befähigung für die neue Verwendung<br />
auf diese Weise erworben werden kann. 2 Über die Anerkennung der<br />
Befähigung entscheidet die für das Amt der neuen Laufbahn zuständige<br />
oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des Landespersonalausschusses.<br />
3<br />
Der Landespersonalausschuss kann über die Art der Unterweisung<br />
besondere Regelungen treffen. 4 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.<br />
Bay LbV § 6 Probezeit im Sinn des § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG<br />
(1) 1 Probezeit im Sinn des § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG ist die Zeit im<br />
Beamtenverhältnis auf Probe, während der sich die Beamtin oder der<br />
Beamte nach Erwerb der Laufbahnbefähigung für das Beamtenverhältnis<br />
auf Lebenszeit in dieser Laufbahn bewähren soll. 2 Die Probezeit soll<br />
insbesondere unter Berücksichtigung der Arbeitsergebnisse zeigen, ob die<br />
Beamtin oder der Beamte nach Eignung, Befähigung und fachlicher<br />
Leistung in der Lage ist, die Aufgaben der Laufbahn zu erfüllen. 3 Während<br />
der Probezeit soll der Einsatz auf verschiedenen Dienstposten erfolgen,<br />
soweit es die dienstlichen Verhältnisse zulassen. 4 Bei der Berechnung der<br />
Probezeit ist § 12 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.<br />
(2) 1 Zeiten von Beurlaubungen unter vollständiger oder teilweiser<br />
Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn gelten als Probezeit. 2 Die<br />
Probezeit verlängert sich um Zeiten einer Beurlaubung unter Fortfall des<br />
Anspruchs auf Leistungen des Dienstherrn. 3 Auf die Probezeit können<br />
solche Zeiten angerechnet werden, die nach § 12 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 bis<br />
4 als Dienstzeit gelten. 4 Bei einer Anrechnung ist § 12 Abs. 2<br />
entsprechend anzuwenden. 5 Es ist jedoch eine Probezeit im Umfang der<br />
für die jeweilige Laufbahn festgelegten Mindestprobezeit abzuleisten.<br />
6 7<br />
Über die Anrechnung entscheidet die oberste Dienstbehörde. Die<br />
oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses ausnahmsweise von der Mindestprobezeit<br />
absehen, wenn an der Beurlaubung ein besonderes dienstliches Interesse<br />
besteht.<br />
(3) 1 Hat sich die Beamtin oder der Beamte bis zum Ablauf der Probezeit noch<br />
nicht bewährt oder ist sie oder er noch nicht geeignet, kann die Probezeit
is zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren verlängert werden. 2 Die<br />
Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.<br />
(4) Beamtinnen und Beamte, die sich nicht bewährt haben oder nicht geeignet<br />
sind, werden entlassen.<br />
Bay LbV § 7 Einstellung<br />
(1) Die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt im<br />
Eingangsamt der jeweiligen Laufbahn.<br />
(2) Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses die Einstellung in einem höheren Amt als dem<br />
Eingangsamt zulassen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber für das zu<br />
übertragende Amt geeignet erscheint, durch berufliche Tätigkeiten<br />
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes eine den<br />
Anforderungen entsprechende Erfahrung erworben hat und an der<br />
Gewinnung ein besonderes dienstliches Interesse besteht.<br />
Bay LbV § 8 Übertragung höherwertiger Dienstposten<br />
(1) 1 Bei der Übertragung höherwertiger Dienstposten ist ausschließlich nach<br />
dem Leistungsgrundsatz zu verfahren. 2 Es muss zu erwarten sein, dass<br />
die Beamtin oder der Beamte den Anforderungen des höherwertigen<br />
Dienstpostens nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung<br />
gewachsen ist. 3 Grundlagen für diese Einschätzung können neben der<br />
dienstlichen Beurteilung auch Personalauswahlgespräche, strukturierte<br />
Interviews, Assessment-Center oder andere wissenschaftlich fundierte<br />
Auswahlverfahren sein.<br />
(2) 1 Der Übertragung eines höheren Amtes im Weg der Beförderung muss<br />
eine Bewährung in den Dienstgeschäften dieses Amtes vorangegangen<br />
sein. 2 Die Bewährungszeit beträgt mindestens drei Monate<br />
(Erprobungszeit gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BayBG). 3 Die<br />
Bewährungszeit kann über die Zeit nach Satz 2 hinausgehen; sie soll<br />
sechs Monate nicht überschreiten. 4 Die Bewährungszeit nach den<br />
Sätzen 1 und 2 entfällt, soweit sich die Beamtin oder der Beamte auf<br />
einem gleichwertigen Dienstposten bereits bewährt hat. 5 Die<br />
Bewährungszeit nach Satz 3 entfällt auch, wenn sie aus sonstigen<br />
dienstlichen Gründen nicht mehr erforderlich ist. 6 Sätze 1 bis 5 finden<br />
keine Anwendung in den Fällen der Art. 45 und 46 BayBG.<br />
(3) 1 Der Übertragung eines höheren Amtes im Weg des Aufstiegs muss eine<br />
Bewährung in den Dienstgeschäften dieses Amtes vorangegangen sein.<br />
2<br />
Die Bewährungszeit beträgt mindestens drei Monate (Erprobungszeit<br />
gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BayBG). 3 Sie soll sechs Monate nicht<br />
unterschreiten und längstens ein Jahr dauern. 4 Bewährt sich die Beamtin<br />
oder der Beamte nicht, so sind ihr oder ihm die Dienstgeschäfte der<br />
bisherigen Laufbahn zu übertragen.<br />
Bay LbV § 9 Probezeit im Sinn des § 4 Abs. 3 Buchst. b BeamtStG in<br />
Ämtern mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe<br />
(1) 1 Für Ämter mit leitender Funktion, die auf Grund von Art. 46 BayBG<br />
zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe vergeben werden, beträgt die
Probezeit zwei Jahre. 2 Eine Verkürzung der Probezeit kann zugelassen<br />
werden; die Mindestprobezeit beträgt ein Jahr. 3 § 12 Abs. 2 gilt<br />
entsprechend. 4 Zeiten, in denen die leitende Funktion nach Satz 1 bereits<br />
übertragen worden ist, werden auf die Probezeit angerechnet. 5 Über die<br />
Verkürzung der Probezeit entscheidet die zuständige oberste<br />
Dienstbehörde. 6 An Stelle der zuständigen obersten Dienstbehörde<br />
entscheiden im Rahmen ihrer Ernennungszuständigkeit über die<br />
Verkürzung der Probezeit die Staatsregierung (Art. 18 Abs. 1 BayBG) und<br />
für die Beamtinnen und Beamten des Landtags das Präsidium des<br />
Landtags.<br />
(2) Die Entscheidung über das Ergebnis der Probezeit trifft die oberste<br />
Dienstbehörde durch schriftliche Feststellung; Abs. 1 Satz 6 gilt<br />
entsprechend.<br />
Bay LbV § 10 Beförderungen<br />
(1) 1 Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen sind, dürfen nicht übersprungen<br />
werden. 2 Die oberste Dienstbehörde bestimmt mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses, ob ein in einer Besoldungsordnung<br />
aufgeführtes Amt der Laufbahn nicht regelmäßig zu durchlaufen ist.<br />
(2) 1 Eine Beförderung ist unzulässig<br />
1. während der Probezeit,<br />
2. vor Ablauf einer Dienstzeit von einem Jahr nach allgemeinem<br />
Dienstzeitbeginn (§ 12 Abs. 1 Satz 1),<br />
3. vor Ablauf einer Erprobungszeit von drei Monaten auf einem höher<br />
bewerteten Dienstposten,<br />
4. vor Ablauf einer Dienstzeit von drei Jahren, in Laufbahnen des<br />
einfachen und des mittleren Dienstes von zwei Jahren nach der letzten<br />
Beförderung oder nach Dienstzeitbeginn bei Einstellung in einem<br />
Beförderungsamt, es sei denn, dass das bisherige Amt nicht durchlaufen<br />
zu werden brauchte.<br />
2<br />
Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 gelten nicht, wenn ein einer höheren<br />
Besoldungsgruppe angehörendes Eingangsamt einer Laufbahn derselben<br />
Laufbahngruppe oder ein Eingangsamt der nächst höheren<br />
Laufbahngruppe nach Erwerb der Befähigung für diese Laufbahn<br />
übertragen wird.<br />
(3) 1 Ausnahmen von Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 sind zulässig zum<br />
Ausgleich beruflicher Verzögerungen, die durch die Geburt oder die<br />
tatsächliche Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren eintreten<br />
würden. 2 Verzögerungen werden jedoch nur insoweit ausgeglichen, als<br />
dies nicht bereits gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 oder Satz 2 Nr. 1 oder 2<br />
oder Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 erfolgt ist. 3 Es werden nur Zeiten im Umfang von<br />
24 Monaten bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes<br />
berücksichtigt.<br />
(4) 1 Ausnahmen von Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 sind zulässig, soweit das<br />
Arbeitsplatzschutzgesetz, das Zivildienstgesetz, das Entwicklungshelfer-<br />
Gesetz oder das Soldatenversorgungsgesetz die Vornahme eines<br />
Nachteilsausgleichs zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen, die durch<br />
die im jeweiligen Dienstverhältnis verbrachten Zeiten eintreten würden,
anordnen. 2 Eine Ausnahme ist nur insoweit zulässig, als nicht bereits<br />
gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ein Ausgleich erfolgt ist.<br />
(5) 1 Ausnahmen von Abs. 1 Satz 1 können nur zugelassen werden, wenn<br />
zwingende Belange der Verwaltung es erfordern. 2 Ausnahmen von Abs. 2<br />
Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 können, unbeschadet des Abs. 3, ferner nur unter<br />
den Voraussetzungen des Satzes 1 sowie dann zugelassen werden, wenn<br />
sich eine Ernennung aus Gründen, die nicht in der Person liegen, erheblich<br />
verzögert hat. 3 Ausnahmen bewilligt der Landespersonalausschuss auf<br />
Antrag der obersten Dienstbehörde. 4 An Stelle des<br />
Landespersonalausschusses bewilligen Ausnahmen von Abs. 2 Satz 1<br />
Nr. 4, soweit eine Dienstzeit von einem Jahr nicht unterschritten wird,<br />
jeweils im Rahmen ihrer Ernennungszuständigkeit die Staatsregierung<br />
(Art. 18 Abs. 1 BayBG) oder der Ministerpräsident (Art. 5 Abs. 1 und 2 des<br />
Rechnungshofgesetzes) und für die Beamtinnen und Beamten des<br />
Landtags bei Ernennungen in Ämter der Besoldungsgruppe A 16 und<br />
höher das Präsidium des Landtags.<br />
Bay LbV § 11 Sonderregelung für Beförderungen<br />
(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 darf in Laufbahnen, deren<br />
Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 9 angehört, frühestens nach einer<br />
Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von acht Jahren übertragen werden.<br />
(2) 1 Ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 darf frühestens nach einer<br />
Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von vier Jahren übertragen werden. 2 Ein<br />
höheres Amt der Besoldungsordnung A als ein Amt der<br />
Besoldungsgruppe 15 darf frühestens nach einer Dienstzeit (§ 12 Abs. 1<br />
Satz 1) von sieben Jahren übertragen werden.<br />
(3) 1 Einer Richterin oder einem Richter oder einer Staatsanwältin oder einem<br />
Staatsanwalt, die oder der ein Amt der Besoldungsgruppe R 1 innehat,<br />
darf ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 frühestens nach einer Dienstzeit<br />
(§ 12 Abs. 1 Satz 1) von einem Jahr, ein Amt der Besoldungsgruppe A 15<br />
frühestens nach einer Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von vier Jahren<br />
übertragen werden. 2 Einer Richterin oder einem Richter oder einer<br />
Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt, die oder der ein Amt der<br />
Besoldungsgruppe R 2 innehat, darf ein Amt der Besoldungsgruppe A 15<br />
übertragen werden, ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 und höher jedoch<br />
frühestens nach einer Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von sieben Jahren.<br />
3<br />
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 findet insoweit keine Anwendung.<br />
(4) 1 Ein Amt der Besoldungsgruppe R 2 darf einer Richterin oder einem<br />
Richter, einer Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt sowie einer<br />
Beamtin oder einem Beamten, die oder der ein Amt der<br />
Besoldungsgruppe A 14 oder höher innehat, frühestens nach einer<br />
Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von vier Jahren übertragen werden. 2 Ein<br />
höheres Amt der Besoldungsordnung R als ein Amt der<br />
Besoldungsgruppe 2 darf einer Richterin oder einem Richter oder einer<br />
Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt, die oder der ein Amt der<br />
Besoldungsgruppe R 2 innehat, oder einer Beamtin oder einem Beamten,<br />
die oder der ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 innehat, frühestens nach<br />
einer Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von sieben Jahren verliehen werden.<br />
3<br />
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 findet insoweit keine Anwendung.
(5) 1 Der Landespersonalausschuss kann auf Antrag der obersten<br />
Dienstbehörde Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4 zulassen. 2 Im Rahmen<br />
ihrer Ernennungszuständigkeit bewilligt die Staatsregierung Ausnahmen.<br />
3 Gleiches gilt für das Präsidium des Landtags, wenn es sich um<br />
Ernennungen in Ämter der Besoldungsgruppe A 16 und höher handelt.<br />
Bay LbV § 12 Dienstzeiten<br />
(1) 1 Dienstzeiten, die Voraussetzung für eine Beförderung oder für den<br />
Aufstieg sind, rechnen von der Begründung eines Beamtenverhältnisses<br />
auf Lebenszeit in der Laufbahngruppe (allgemeiner Dienstzeitbeginn).<br />
2 Nach erfolgtem Aufstieg rechnet die Dienstzeit ab der ersten Verleihung<br />
eines Amtes in der höheren Laufbahngruppe.<br />
(2) Zeiten einer Beschäftigung mit einer ermäßigten Arbeitszeit werden bei<br />
der Berechnung der Dienstzeit in vollem Umfang berücksichtigt.<br />
(3) 1 Der allgemeine Dienstzeitbeginn wird vorverlagert um<br />
1. Zeiten einer Beschäftigung nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung,<br />
die vor der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe in einem<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit ausgeübt wurden,<br />
2. Zeiten des Wehr- oder Zivildienstes sowie gleichgestellter Zeiten,<br />
soweit das Arbeitsplatzschutzgesetz, das Zivildienstgesetz, das<br />
Entwicklungshelfer-Gesetz oder das Soldatenversorgungsgesetz die<br />
Vornahme eines Nachteilsausgleichs zum Ausgleich beruflicher<br />
Verzögerungen, die durch die im jeweiligen Dienstverhältnis verbrachten<br />
Zeiten eintreten würden, anordnen,<br />
3. Zeiten der Inanspruchnahme von Elternzeit während der Probezeit.<br />
2<br />
Der allgemeine Dienstzeitbeginn soll vorverlagert werden<br />
1. um Zeiten der Beurlaubung nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 oder Art. 90<br />
Abs. 1 Nr. 1 BayBG während der Probezeit, wenn eine Beamtin oder ein<br />
Beamter ein Kind, für das ihr oder ihm die Personensorge zusteht und das<br />
in ihrem oder seinem Haushalt lebt, sowie ein Kind im Sinn des § 1 Abs. 3<br />
des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) überwiegend selbst<br />
betreut und erzieht,<br />
2. wenn eine Beamtin oder ein Beamter während der Schulausbildung,<br />
einer für die künftige Beamten- oder Richterlaufbahn vorgeschriebenen<br />
Ausbildung (Hochschul-, Fachhochschul-, Fachschul- oder andere<br />
berufliche Ausbildung), einer vorgeschriebenen hauptberuflichen Tätigkeit<br />
oder während der in § 4 Abs. 1 Nrn. 1 und 5 genannten Zeiten ein Kind,<br />
für das ihr oder ihm die Personensorge zusteht und das in ihrem oder<br />
seinem Haushalt lebt, sowie ein Kind im Sinn des § 1 Abs. 3 BEEG<br />
überwiegend selbst betreut und erzogen hat.<br />
3<br />
Zeiten nach Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 werden im Umfang von 24 Monaten<br />
bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes berücksichtigt.<br />
4<br />
Unbeschadet der Sätze 1 und 2 kann die oberste Dienstbehörde den<br />
allgemeinen Dienstzeitbeginn ausnahmsweise um bis zu drei Jahre<br />
vorverlagern, wenn ein besonderes dienstliches Interesse besteht. 5 Soll<br />
der allgemeine Dienstzeitbeginn um mehr als drei Jahre vorverlagert<br />
werden, bedarf es der Zustimmung des Landespersonalausschusses.<br />
(4) 1 Als Dienstzeit gelten auch<br />
1. die Zeiten von Beurlaubungen unter vollständiger oder teilweiser
Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn,<br />
2. die Zeiten von Beurlaubungen unter Fortfall des Anspruchs auf<br />
Leistungen des Dienstherrn bei einer Verwendung im öffentlichen Dienst<br />
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, für Aufgaben<br />
der Entwicklungshilfe oder an einer deutschen Schule im Ausland oder<br />
einer europäischen Schule oder an einer staatlich genehmigten oder<br />
anerkannten privaten Schule oder als DAAD-Lektorin oder DAAD-Lektor an<br />
einer Universität im Ausland,<br />
3. die Zeiten von Beurlaubungen unter Fortfall des Anspruchs auf<br />
Leistungen des Dienstherrn zur Ausübung einer Tätigkeit bei Fraktionen<br />
des Europaparlaments, des Deutschen Bundestags und des Bayerischen<br />
Landtags bis zur Dauer von insgesamt acht Jahren, für eine Tätigkeit bei<br />
kommunalen Vertretungskörperschaften oder bei kommunalen<br />
Spitzenverbänden sowie bei Gesellschaften und Unternehmungen, deren<br />
Kapital überwiegend in öffentlicher Hand ist, und bei juristischen Personen<br />
des öffentlichen Rechts bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren,<br />
4. im Übrigen die Zeiten von Beurlaubungen unter Fortfall des Anspruchs<br />
auf Leistungen des Dienstherrn, die überwiegend dienstlichen Interessen<br />
oder öffentlichen Belangen dienen, bis zur Dauer von insgesamt fünf<br />
Jahren,<br />
5. Zeiten einer Elternzeit oder einer Beurlaubung nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1<br />
oder Art. 90 Abs. 1 Nr. 1 BayBG, wenn eine Beamtin oder ein Beamter ein<br />
Kind, für das ihr oder ihm die Personensorge zusteht und das in ihrem<br />
oder seinem Haushalt lebt, sowie ein Kind im Sinn des § 1 Abs. 3 BEEG<br />
überwiegend selbst betreut und erzieht; Zeiten werden im Umfang von<br />
24 Monaten bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes –<br />
vermindert um Zeiten, um die der Dienstzeitbeginn nach Abs. 3 Satz 1<br />
Nr. 3 oder Satz 2 vorverlagert wurde – berücksichtigt.<br />
2 Treffen bei einer Person Zeiten von Beurlaubungen nach Satz 1 Nrn. 3<br />
und 4 zusammen, so werden sie insgesamt nur bis zur Dauer der für<br />
diejenige Beurlaubung mit der höchsten Anrechnungsgrenze geltenden<br />
Obergrenze berücksichtigt. 3 Bei Beurlaubungen nach Satz 1 Nr. 3 kann in<br />
besonders gelagerten Fällen die oberste Dienstbehörde mit Zustimmung<br />
des Landespersonalausschusses weitere Zeiten einer Beurlaubung als<br />
Dienstzeit berücksichtigen.<br />
Bay LbV § 13 Schwerbehinderte Menschen<br />
(1) 1 Von schwerbehinderten Menschen darf bei der Einstellung nur das<br />
Mindestmaß körperlicher Eignung für die vorgesehene Tätigkeit verlangt<br />
werden. 2 Entsprechendes gilt bei der Übertragung von Dienstposten und<br />
bei Beförderungen, soweit es die Anforderungen des Dienstpostens<br />
zulassen. 3 Schwerbehinderte Menschen haben bei der Einstellung Vorrang<br />
vor gesetzlich nicht bevorrechtigten Personen gleicher Eignung,<br />
Befähigung und fachlicher Leistung.<br />
(2) Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehinderter Beamtinnen und<br />
Beamter ist die Minderung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit durch<br />
ihre Behinderung zu berücksichtigen.
(3) Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend beim Laufbahnwechsel von<br />
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die<br />
polizeidienstunfähig sind (Art. 128 Abs. 2 BayBG).<br />
Teil 2 Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber<br />
[§§ 14 - 20] Abschnitt 1 Gemeinsame Vorschriften<br />
Bay LbV § 14 Grundsätze<br />
Auf die Einstellung besteht kein Rechtsanspruch, soweit der<br />
Vorbereitungsdienst keine allgemeine Ausbildungsstätte nach Art. 12 Abs. 1<br />
Satz 1 des Grundgesetzes ist.<br />
Bay LbV § 15 Einstellungsprüfung, besonderes Auswahlverfahren<br />
(1) 1 Die Einstellung setzt das Bestehen einer Einstellungsprüfung oder die<br />
erfolgreiche Teilnahme an einem besonderen Auswahlverfahren voraus.<br />
2<br />
Für einzelne Laufbahnen kann durch Verordnung nach Art. 26 Abs. 2<br />
BayBG von einer Einstellungsprüfung und von einem besonderen<br />
Auswahlverfahren abgesehen werden. 3 Satz 1 gilt nicht für die<br />
Laufbahnen des einfachen Dienstes.<br />
(2) 1 Die Einstellungsprüfungen und die besonderen Auswahlverfahren dienen<br />
der Auslese. 2 Die Dienstherren haben ihren voraussichtlichen Bedarf an<br />
Bewerberinnen und Bewerbern unter Angabe der<br />
Einstellungsvoraussetzungen öffentlich bekanntzugeben. 3 Die Prüfungen<br />
sind rechtzeitig vor dem Beginn der Prüfung öffentlich auszuschreiben.<br />
4<br />
Das Nähere regeln die Prüfungsordnungen.<br />
(3) Die Einstellungsprüfungen und die besonderen Auswahlverfahren werden<br />
für die einzelnen Laufbahnen oder für Gruppen von Laufbahnen im Auftrag<br />
des Landespersonalausschusses von der Geschäftsstelle des<br />
Landespersonalausschusses oder von der Stelle durchgeführt, der der<br />
Landespersonalausschuss die Durchführung der Prüfung überträgt.<br />
(4) 1 Die ersten Staatsprüfungen, die Erste Juristische Prüfung, die<br />
Hochschulprüfungen und die ersten Lehramtsprüfungen gelten als<br />
Einstellungsprüfungen, soweit durch Verordnung nach Art. 26 Abs. 2<br />
BayBG für einen Vorbereitungsdienst, der keine allgemeine<br />
Ausbildungsstätte nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes ist, nichts<br />
anderes bestimmt ist. 2 Der Landespersonalausschuss kann auch andere<br />
Prüfungen als Einstellungsprüfungen oder als Ersatz für ein<br />
Auswahlverfahren anerkennen.<br />
Bay LbV § 16 Einstellung in den Vorbereitungsdienst<br />
(1) 1 Die Auswahl wird nach dem Bedarf und nach dem Gesamtergebnis, das<br />
in der Einstellungsprüfung oder in einem besonderen Auswahlverfahren<br />
erzielt wurde, vorgenommen, soweit der Vorbereitungsdienst nicht<br />
allgemeine Ausbildungsstätte nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 des<br />
Grundgesetzes ist. 2 Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst der<br />
betreffenden Laufbahn erfolgt als Beamtin oder als Beamter auf Widerruf.
(2) Die Beamtin oder der Beamte auf Widerruf führt während des<br />
Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung “Anwärterin” oder<br />
“Anwärter”, in Laufbahnen des höheren Dienstes und soweit das<br />
Eingangsamt für die spätere Laufbahn der Besoldungsgruppe A 13<br />
angehört, die Dienstbezeichnung “Referendarin” oder “Referendar”, je mit<br />
einem die Fachrichtung oder die Laufbahn bezeichnenden Zusatz.<br />
Bay LbV § 17 Gestaltung des Vorbereitungsdienstes<br />
(1) Die Gestaltung des Vorbereitungsdienstes wird unter Beachtung der für<br />
die einzelnen Laufbahngruppen vorgeschriebenen Voraussetzungen in den<br />
Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen nach Art. 26 Abs. 2,<br />
Art. 41 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BayBG geregelt.<br />
(2) Die oberste Dienstbehörde kann den Vorbereitungsdienst um höchstens<br />
drei Monate auf Antrag kürzen, wenn besondere dienstliche Gründe<br />
vorliegen und zu erwarten ist, dass die Ausbildung erfolgreich<br />
abgeschlossen wird.<br />
(3) 1 Auf den Vorbereitungsdienst können auf Antrag angerechnet werden<br />
1. ein früherer Vorbereitungsdienst für dieselbe Laufbahn, der jedoch nicht<br />
länger als fünf Jahre zurückliegen darf,<br />
2. Zeiten einer praktischen Tätigkeit, die dem Ziel des<br />
Vorbereitungsdienstes dienen, sowie Zeiten einer gastweisen Teilnahme<br />
am Vorbereitungsdienst (Hospitation),<br />
3. Zeiten eines förderlichen Studiums an einer Fachhochschule oder einer<br />
wissenschaftlichen Hochschule.<br />
2<br />
In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3 ist durch Verordnung nach<br />
Art. 26 Abs. 2 BayBG festzulegen, in welchem Umfang die Anrechnung<br />
vorgenommen werden kann.<br />
(4) Bei unzureichendem <strong>Stand</strong> der Ausbildung kann der Vorbereitungsdienst<br />
durch die für die Ernennung zuständige Behörde verlängert werden.<br />
(5) Auf Antrag kann die für die Ernennung zuständige Behörde Beamtinnen<br />
und Beamte bei erstmaligem Nichtbestehen der Laufbahnprüfung zu<br />
einem ergänzenden Vorbereitungsdienst zulassen, wenn die bisherigen<br />
Leistungen erwarten lassen, dass sie die Wiederholungsprüfung bestehen<br />
werden.<br />
(6) Der Vorbereitungsdienst gilt als entsprechend verlängert, wenn die<br />
Laufbahnprüfung erst nach Ablauf des vorgeschriebenen<br />
Vorbereitungsdienstes beendet wird.<br />
Bay LbV § 18 Übernahme in die nächstniedrigere Laufbahn<br />
1 Entsprechen die Leistungen während des Vorbereitungsdienstes nicht den für<br />
die Laufbahn zu stellenden Anforderungen, ist aber die Eignung für die<br />
nächstniedrigere Laufbahn derselben Fachrichtung anzunehmen, so kann die<br />
oder der Betroffene mit ihrer oder seiner Zustimmung in den<br />
Vorbereitungsdienst dieser Laufbahn übernommen werden, wenn hierfür ein<br />
dienstliches Interesse besteht. 2 Der bereits abgeleistete Vorbereitungsdienst<br />
kann auf den in der niedrigeren Laufbahn abzuleistenden Vorbereitungsdienst<br />
angerechnet werden. 3 Das Gleiche gilt für Beamtinnen und Beamte, die die
Laufbahnprüfung endgültig nicht bestehen oder auf die Wiederholungsprüfung<br />
verzichten.<br />
Bay LbV § 19 Laufbahnprüfung, Einstellung in das Beamtenverhältnis<br />
auf Probe<br />
(1) 1 Nach erfolgreicher Ableistung des vorgeschriebenen<br />
Vorbereitungsdienstes ist die Laufbahnprüfung für die Laufbahn<br />
abzulegen. 2 Einzelne Prüfungsleistungen dürfen bereits während des<br />
Vorbereitungsdienstes abgenommen werden. 3 Beamtinnen und Beamte,<br />
die den vorgeschriebenen Vorbereitungsdienst erst zwischen Beginn und<br />
Ende der Laufbahnprüfung beenden, können von der für die Zulassung<br />
zuständigen Stelle vorzeitig zur Laufbahnprüfung zugelassen werden.<br />
4<br />
Laufbahnprüfungen für die Laufbahnen des höheren Dienstes sind die<br />
zweiten oder Großen Staatsprüfungen.<br />
(2) 1 Wer die vorgeschriebene Laufbahnprüfung für eine Laufbahn bestanden<br />
hat, kann bei Vorliegen der sonstigen beamtenrechtlichen<br />
Voraussetzungen in das Beamtenverhältnis auf Probe gemäß § 4 Abs. 3<br />
Buchst. a BeamtStG berufen werden. 2 Das Bestehen der Laufbahnprüfung<br />
begründet keinen Anspruch auf Begründung eines Beamtenverhältnisses<br />
auf Probe. 3 Ist der Vorbereitungsdienst keine allgemeine<br />
Ausbildungsstätte nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes, so sollen<br />
die Personen, deren Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe<br />
beabsichtigt ist, spätestens mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses<br />
ernannt werden.<br />
Bay LbV § 20 Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf<br />
(1) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet<br />
1. durch Entlassung nach § 23 Abs. 4 BeamtStG,<br />
2. mit der Ablegung der Laufbahnprüfung nach Abs. 2,<br />
3. nach näherer Regelung durch Verordnung nach Art. 26 Abs. 2 BayBG,<br />
wenn die Laufbahnprüfung nicht binnen einer angemessenen Frist nach<br />
Beendigung des vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes abgelegt worden<br />
ist,<br />
4. mit dem endgültigen Nichtbestehen einer vorgeschriebenen<br />
Zwischenprüfung.<br />
(2) 1 Die Laufbahnprüfung oder eine Zwischenprüfung ist, soweit die<br />
Prüfungsordnung keinen früheren Zeitpunkt bestimmt, mit der<br />
Aushändigung (Zustellung) des Prüfungszeugnisses oder der schriftlichen<br />
Mitteilung über das Nichtbestehen der Prüfung abgelegt. 2 Beamtinnen und<br />
Beamte, die die Laufbahnprüfung erstmals nicht bestanden haben, sollen<br />
auf ihren Antrag mit der Mitteilung des Prüfungsergebnisses erneut in das<br />
Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen werden, wenn die<br />
Voraussetzungen des § 17 Abs. 5 vorliegen.
[§§ 21 - 30] Abschnitt 2 Befähigung von Bewerberinnen und<br />
Bewerbern aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union<br />
Bay LbV § 21 Anwendungsbereich<br />
(1) 1 §§ 22 bis 30 gelten für die von Bewerberinnen und Bewerbern aus<br />
anderen Mitgliedstaaten beantragte Anerkennung ihrer<br />
Berufsqualifikationen als Laufbahnbefähigung entsprechend der Richtlinie<br />
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom<br />
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl<br />
L 255 S. 22, ber. 2007 L 271 S. 18, ber. 2008 L 93 S. 28, ber. 2009 L 33<br />
S. 49) in der jeweils geltenden Fassung. 2 Unberührt bleibt der Grundsatz<br />
der automatischen Anerkennung auf Grund der Regelungen in den<br />
Art. 21 ff. der Richtlinie 2005/36/EG, die Möglichkeit der Befreiung von<br />
Ausgleichsmaßnahmen auf Grundlage gemeinsamer Plattformen gemäß<br />
Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG und der Grundsatz der Anerkennung<br />
von Berufserfahrung nach Titel III Kapitel II der Richtlinie 2005/36/EG.<br />
(2) Mitgliedstaat im Sinn dieser Verordnung ist<br />
1. jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union,<br />
2. jeder andere Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen<br />
Wirtschaftsraum und<br />
3. jeder andere Vertragsstaat, dem Deutschland und die Europäische<br />
Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich<br />
einen Rechtsanspruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen<br />
eingeräumt haben.<br />
Bay LbV § 22 Anerkennungsvoraussetzungen<br />
(1) 1 Die Qualifikationsnachweise, die in einem anderen Mitgliedstaat<br />
erforderlich sind, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme<br />
oder Ausübung eines reglementierten Berufs zu erhalten, sind auf Antrag<br />
als Laufbahnbefähigung, die der Fachrichtung des<br />
Qualifikationsnachweises entspricht, anzuerkennen, wenn<br />
1. sie in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und<br />
Verwaltungsvorschriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt<br />
worden sind,<br />
2. sie bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau der Inhaberin<br />
oder des Inhabers Abs. 2 entspricht,<br />
3. der Ausbildungsnachweis im Vergleich zu dem entsprechenden<br />
deutschen Schulabschluss, Berufsabschluss oder der hauptberuflichen<br />
Tätigkeit weder ein zeitliches noch ein inhaltliches Defizit im Sinn des § 24<br />
Abs. 3 aufweist.<br />
2<br />
Reglementiert ist ein Beruf dann, wenn dessen Aufnahme oder Ausübung<br />
oder eine der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch staatliche<br />
Rechtsvorschriften an das Vorliegen bestimmter Berufsqualifikationen<br />
gebunden ist.<br />
(2) 1 Für die Laufbahnen des einfachen und mittleren Dienstes bedarf es eines<br />
Befähigungsnachweises, der ausgestellt wurde auf Grund<br />
1. einer allgemeinen Schulbildung von Primär- und Sekundarniveau,<br />
wodurch Allgemeinkenntnisse bescheinigt werden,<br />
2. einer sonstigen Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinn
des Art. 11 Buchst. b bis e der Richtlinie 2005/36/EG erteilt wird,<br />
3. einer spezifischen Prüfung ohne vorherige Ausbildung oder<br />
4. der Ausübung des Berufs als Vollzeitbeschäftigung in einem<br />
Mitgliedstaat während drei aufeinander folgender Jahre oder als<br />
Teilzeitbeschäftigung während eines entsprechenden Zeitraums in den<br />
letzten zehn Jahren.<br />
2<br />
Für die Laufbahn des gehobenen Dienstes bedarf es eines Zeugnisses,<br />
das erteilt wird<br />
1. nach Abschluss einer allgemeinbildenden Sekundarausbildung, die<br />
durch eine Fach- oder Berufsausbildung, die keine Fach- oder<br />
Berufsausbildung im Sinn des Art. 11 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG<br />
ist, und gegebenenfalls durch ein neben dem Ausbildungsgang<br />
erforderliches Berufspraktikum oder eine solche Berufspraxis ergänzt wird,<br />
oder<br />
2. nach einer technischen oder berufsbildenden Sekundarausbildung, die<br />
gegebenenfalls durch ein neben dem Ausbildungsgang erforderliches<br />
Berufspraktikum oder einer solchen Berufspraxis ergänzt wird.<br />
3<br />
Für die Laufbahn des höheren Dienstes bedarf es eines Diploms, welches<br />
1. nach Abschluss einer postsekundären Ausbildung von mindestens drei<br />
und höchstens vier Jahren an einer Universität oder einer Hochschule oder<br />
in einer anderen Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem<br />
Ausbildungsniveau sowie der Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben<br />
dem Studium gefordert wird, erteilt wird, oder<br />
2. nach einer Teilzeitausbildung von entsprechender Dauer an einer<br />
Universität oder einer Hochschule oder an einer anderen<br />
Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau sowie der<br />
Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben dem Studium gefordert wird,<br />
erteilt wird.<br />
(3) 1 Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem Mitgliedstaat, der<br />
die Berufsausübung nicht reglementiert hat, zwei Jahre innerhalb der<br />
letzten zehn Jahre den Beruf vollzeitlich ausgeübt, so gelten Abs. 1 und 2<br />
entsprechend, wenn die Qualifikationsnachweise bescheinigen, dass die<br />
Inhaberin oder der Inhaber auf die Ausübung des betreffenden Berufs<br />
vorbereitet wurde. 2 Die zweijährige Berufserfahrung darf nicht gefordert<br />
werden, wenn der vorgelegte Qualifikationsnachweis eine reglementierte<br />
Ausbildung gemäß eines der Qualifikationsniveaus des Art. 11 Buchst. b,<br />
c, d oder e der Richtlinie 2005/36/EG abschließt.<br />
Bay LbV § 23 Antrag<br />
(1) 1 Der Antrag auf Anerkennung ist an die zuständige Stelle zu richten.<br />
2 Zuständige Stelle ist die oberste Dienstbehörde, in deren<br />
Geschäftsbereich die Begründung eines Beamtenverhältnisses angestrebt<br />
wird. 3 An die Stelle der obersten Dienstbehörde tritt bei kommunalen<br />
Körperschaften das Staatsministerium des Innern, bei sonstigen der<br />
Aufsicht des Staates unterstehenden Körperschaften, rechtsfähigen<br />
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts die Aufsichtsbehörde.<br />
4 Die nach den Sätzen 2 und 3 zuständige Stelle kann die Zuständigkeit<br />
auf den Landespersonalausschuss übertragen. 5 Bei nicht geregelten<br />
Laufbahnen ist der Landespersonalausschuss zuständige Stelle.
(2) Dem Antrag sind beizufügen:<br />
1. ein Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates,<br />
2. Qualifikationsnachweise,<br />
3. Bescheinigungen oder Urkunden des Heimat- oder Herkunftsstaates<br />
darüber, dass keine Straftaten, schwerwiegende berufliche Verfehlungen<br />
oder sonstige, die Eignung in Frage stellenden Umstände bekannt sind;<br />
die Bescheinigungen oder Urkunden dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als<br />
drei Monate sein,<br />
4. eine Bescheinigung des Heimat- oder Herkunftsstaates, aus der<br />
hervorgeht, zu welcher Berufsausübung der Qualifikationsnachweis<br />
berechtigt,<br />
5. Bescheinigungen über die Art und Dauer der nach Erwerb des<br />
Qualifikationsnachweises in einem Mitgliedstaat ausgeübten Tätigkeiten in<br />
der Fachrichtung des Qualifikationsnachweises,<br />
6. Nachweis über Inhalte und Dauer der Studien und Ausbildungen, in<br />
Form von Studienordnungen, Prüfungsordnungen, Studienbuch oder in<br />
anderer geeigneter Weise; aus den Nachweisen müssen die<br />
Anforderungen, die zur Erlangung des Abschlusses geführt haben,<br />
hervorgehen, sowie<br />
7. eine Erklärung, welche Tätigkeit auf der Grundlage des<br />
Qualifikationsnachweises in der öffentlichen Verwaltung angestrebt wird.<br />
Bay LbV § 24 Bewertung der Qualifikationsnachweise<br />
(1) 1 Die zuständige Behörde (§ 23 Abs. 1) stellt fest, ob der<br />
Qualifikationsnachweis einer deutschen Laufbahnbefähigung zuordenbar<br />
ist. 2 Anhand eines Vergleichs zwischen den Vor- und<br />
Ausbildungsvoraussetzungen der Laufbahnbefähigung und der<br />
Qualifikationsnachweise stellt sie fest, ob ein inhaltliches oder zeitliches<br />
Defizit im Sinn des Abs. 3 besteht.<br />
(2) Ist beabsichtigt, der Antragstellerin oder dem Antragsteller einen<br />
Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, ist<br />
zunächst zu prüfen, ob die im Rahmen der bisherigen Berufspraxis<br />
erworbenen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied ganz oder teilweise<br />
ausgleichen können.<br />
(3) 1 Ausgleichsmaßnahmen können verlangt werden, wenn<br />
1. die nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der für<br />
den Erwerb der Laufbahnbefähigung geforderten fachtheoretischen Dauer<br />
liegt (zeitliches Defizit),<br />
2. die bisherige Ausbildung und der dazu gehörige Ausbildungsnachweis<br />
sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die<br />
im Freistaat Bayern vorgeschrieben sind (inhaltliches Defizit),<br />
3. die Laufbahnbefähigung die Wahrnehmung eines umfangreicheren<br />
Aufgabenfeldes ermöglicht als der reglementierte Beruf im Mitgliedstaat<br />
der Antragstellerin oder des Antragstellers, und wenn dieser Unterschied<br />
in einer besonderen Ausbildung besteht, die für den Erwerb der<br />
Laufbahnbefähigung vorgeschrieben wird und sich auf Fächer bezieht, die<br />
sich wesentlich von denen unterscheiden, die von den<br />
Qualifikationsnachweisen abgedeckt werden, die die Antragstellerin oder<br />
der Antragsteller vorlegt.
2 Fächer unterscheiden sich wesentlich, wenn deren Kenntnis eine<br />
wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs ist und die<br />
bisherige Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers<br />
diesbezüglich bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt<br />
gegenüber der für die Laufbahnbefähigung geforderten fachtheoretischen<br />
Ausbildung aufweist.<br />
Bay LbV § 25 Entscheidung<br />
(1) Die zuständige Behörde bestätigt der Antragstellerin oder dem<br />
Antragsteller binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt<br />
ihr oder ihm gegebenenfalls gleichzeitig mit, welche Unterlagen fehlen.<br />
(2) 1 Die Entscheidung über den Antrag ist der Antragstellerin oder dem<br />
Antragsteller innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der vollständigen<br />
Unterlagen schriftlich mitzuteilen. 2 In den Fällen einer automatischen<br />
Anerkennung nach Art. 21 ff. der Richtlinie 2005/36/EG beträgt die Frist<br />
drei Monate. 3 Festgestellte Defizite werden der Antragstellerin oder dem<br />
Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 4 Die Mitteilung muss auch<br />
Informationen zu den möglichen Ausgleichsmaßnahmen gemäß §§ 26 bis<br />
28 enthalten, insbesondere zu den Prüfungsgebieten im Fall einer<br />
Eignungsprüfung, sowie eine Aufforderung zur Ausübung eines<br />
bestehenden Wahlrechts.<br />
(3) Im Fall einer Anerkennung ist in der schriftlichen Mitteilung darauf<br />
hinzuweisen, dass die Anerkennung keinen Anspruch auf Einstellung<br />
begründet.<br />
(4) Die Anerkennung ist insbesondere zu versagen, wenn<br />
1. die Voraussetzungen des § 22 nicht erfüllt sind,<br />
2. die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen trotz Aufforderung<br />
nicht in angemessener Frist vollständig vorgelegt wurden,<br />
3. die festgelegten Ausgleichsmaßnahmen nicht erfolgreich abgeschlossen<br />
worden sind oder die Antragstellerin oder der Antragsteller sich ihnen aus<br />
von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen innerhalb von sechs Monaten<br />
nicht unterzogen hat oder<br />
4. die Antragstellerin oder der Antragsteller wegen schwerwiegender<br />
beruflicher Verfehlungen, Straftaten oder sonstiger Gründe für den<br />
Zugang zum Beamtenverhältnis nicht geeignet ist.<br />
Bay LbV § 26 Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen<br />
(1) Ist eine der Alternativen des § 24 Abs. 3 gegeben, so ist die Anerkennung<br />
von einer Eignungsprüfung (§ 27) oder von der Teilnahme an einem<br />
Anpassungslehrgang (§ 28) nach Wahl der Bewerberin oder des<br />
Bewerbers abhängig zu machen.<br />
(2) Abweichend von Abs. 1 ist ein Qualifikationsnachweis für<br />
Laufbahnbefähigungen, deren Ausübung eine genaue Kenntnis des<br />
deutschen Rechts erfordern und bei denen Beratung oder Beistand in<br />
Bezug auf das deutsche Recht ein wesentlicher und beständiger Teil der<br />
Berufsausübung ist, als Befähigung für eine Laufbahn des gehobenen oder<br />
höheren Dienstes nur anzuerkennen, wenn mit Erfolg eine<br />
Eignungsprüfung abgelegt wurde.
Bay LbV § 27 Eignungsprüfung<br />
(1) Die Eignungsprüfung ist eine ausschließlich die beruflichen Kenntnisse<br />
betreffende staatliche Prüfung, mit der die Fähigkeiten, die Aufgaben der<br />
angestrebten Laufbahn auszuüben, beurteilt werden.<br />
(2) 1 Bei Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst führt die Eignungsprüfung die<br />
für die Durchführung der Laufbahnprüfung zuständige Behörde durch.<br />
2<br />
Bei Laufbahnen besonderer Fachrichtungen wird die Eignungsprüfung<br />
von der für die Gestaltung der Laufbahnen zuständigen obersten<br />
Dienstbehörde durchgeführt. 3 Die Zuständigkeiten nach den Sätzen 1 und<br />
2 können durch die oberste Dienstbehörde auf eine andere Behörde oder<br />
den Landespersonalausschuss übertragen werden. 4 Bei nicht geregelten<br />
Laufbahnen ist der Landespersonalausschuss für die Durchführung der<br />
Eignungsprüfung zuständig, bei Bedarf unter sachgerechter Beteiligung<br />
einer obersten Dienstbehörde.<br />
(3) 1 Bei geregelten Laufbahnen gelten die in den jeweiligen Ausbildungs- und<br />
Prüfungsordnungen genannten Prüfungsgebiete als für die Laufbahn<br />
notwendige Sachgebiete. 2 Bei Laufbahnen besonderer Fachrichtungen und<br />
bei nicht geregelten Laufbahnen sind die Prüfungsgebiete auf Grund eines<br />
Vergleichs mit den der Laufbahnbefähigung zugrunde liegenden<br />
Prüfungsgebieten der Abschlüsse festzulegen.<br />
(4) 1 Die zuständige Behörde vergleicht die für die Laufbahnbefähigung für<br />
unverzichtbar angesehenen Sachgebiete aus den Ausbildungs- und<br />
Prüfungsordnungen mit den Qualifikationen und den Erfahrungen der<br />
Antragstellerin oder des Antragstellers, die bereits in einem anderen<br />
Mitgliedstaat erworben wurden. 2 Anschließend legt die Behörde im<br />
Einzelfall, abhängig von den festgestellten Defiziten, den konkreten Inhalt<br />
und Umfang der Prüfung fest, insbesondere die Prüfungsgebiete.<br />
(5) 1 Die Eignungsprüfung muss dem Umstand Rechnung tragen, dass im<br />
Heimat- oder Herkunftsstaat bereits eine entsprechende berufliche<br />
Qualifikation vorliegt. 2 Für die Durchführung der Prüfung und die<br />
Bewertung der Prüfungsleistungen gelten die für die jeweilige Laufbahn<br />
geltenden Prüfungsbestimmungen und die Allgemeine Prüfungsordnung<br />
(APO) entsprechend.<br />
Bay LbV § 28 Anpassungslehrgang<br />
(1) 1 Während des Anpassungslehrgangs werden Aufgaben der angestrebten<br />
Laufbahn unter der Verantwortung einer qualifizierten Inhaberin oder<br />
eines qualifizierten Inhabers der angestrebten Laufbahnbefähigung<br />
ausgeübt. 2 Der Anpassungslehrgang kann mit einer Zusatzausbildung<br />
einhergehen.<br />
(2) 1 Für die Durchführung und Organisation des Anpassungslehrgangs ist bei<br />
Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst und bei Laufbahnen besonderer<br />
Fachrichtungen die oberste Dienstbehörde zuständig, in deren<br />
Geschäftsbereich die Begründung eines Beamtenverhältnisses angestrebt<br />
wird. 2 Diese kann eine andere Behörde oder den<br />
Landespersonalausschuss mit der Durchführung und Organisation<br />
beauftragen. 3 Bei nicht geregelten Laufbahnen ist der<br />
Landespersonalausschuss in Abstimmung mit der obersten Dienstbehörde,
in deren Geschäftsbereich die Begründung eines Beamtenverhältnisses<br />
angestrebt wird, für die Durchführung und Organisation des<br />
Anpassungslehrgangs zuständig. 4 § 23 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.<br />
5<br />
Mit der gegebenenfalls notwendigen Zusatzausbildung können die in § 27<br />
Abs. 2 genannten Stellen beauftragt werden.<br />
(3) 1 Der Anpassungslehrgang dient dazu, die im Vergleich zwischen<br />
vorhandener und geforderter Ausbildung fehlenden Qualifikationen zu<br />
erwerben. 2 Er darf höchstens drei Jahre dauern. 3 Die konkreten Inhalte<br />
und die konkrete Dauer werden unter Berücksichtigung des festgestellten<br />
Defizits in Hinblick auf die Erfordernisse der jeweiligen Laufbahn von der<br />
zuständigen Behörde festgelegt. 4 Bei Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst<br />
darf der Anpassungslehrgang die Dauer des Vorbereitungsdienstes nicht<br />
überschreiten.<br />
(4) 1 Die Rechte und Pflichten während des Anpassungslehrgangs werden<br />
durch Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Antragstellerin oder<br />
dem Antragsteller festgelegt. 2 Die Antragstellerin oder der Antragsteller<br />
befindet sich während des Anpassungslehrgangs in einem öffentlichrechtlichen<br />
Vertragsverhältnis, welches durch das als Anlage 1 beigefügte<br />
Vertragsmuster näher geregelt wird. 3 Der Anpassungslehrgang endet<br />
außer mit Ablauf der festgesetzten Zeit vorzeitig auf Antrag oder wenn<br />
schwerwiegende Pflichtverletzungen der Antragstellerin oder des<br />
Antragstellers der Fortführung entgegenstehen. 4 Wenn schwerwiegende<br />
Pflichtverletzungen der Fortführung des Anpassungslehrgangs<br />
entgegenstehen, wird der Vertrag schriftlich und mit sofortiger Wirkung<br />
durch die zuständige Behörde nach Abs. 2 gekündigt.<br />
(5) 1 Der Lehrgang ist Gegenstand einer Bewertung. 2 Zur Bewertung wird die<br />
Notenskala des § 28 Abs. 6 APO herangezogen. 3 Werden die Leistungen<br />
nicht mindestens mit der Gesamtnote “ausreichend” bewertet, ist der<br />
Anpassungslehrgang nicht bestanden.<br />
Bay LbV § 29 Abschluss des Anerkennungsverfahrens<br />
Mit erfolgreichem Abschluss des Anerkennungsverfahrens wird die<br />
Laufbahnbefähigung erworben.<br />
Bay LbV § 30 Berufsbezeichnung<br />
Sofern mit Erwerb der Laufbahnbefähigung nach den allgemeinen gesetzlichen<br />
Bestimmungen die Befugnis verbunden ist, eine Bezeichnung zu führen, wird<br />
diese als Berufsbezeichnung geführt.<br />
[§§ 31 - 34] Abschnitt 3 Öffentlich-rechtliches<br />
Ausbildungsverhältnis<br />
Bay LbV § 31 Zulassung<br />
(1) Bewerberinnen und Bewerber für die Laufbahnen des einfachen und des<br />
mittleren Dienstes können vor dem Vorbereitungsdienst in einem<br />
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigt werden.
(2) 1 In das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis als Dienstanfängerin<br />
oder Dienstanfänger kann nur aufgenommen werden, wer die für die<br />
angestrebte Laufbahn erforderliche Vorbildung nachweist und die für die<br />
Laufbahn vorgeschriebene Einstellungsprüfung bestanden oder an dem für<br />
die Laufbahn vorgeschriebenen besonderen Auswahlverfahren mit Erfolg<br />
teilgenommen hat. 2 § 16 Abs. 1 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.<br />
Bay LbV § 32 Begründung des öffentlich-rechtlichen<br />
Ausbildungsverhältnisses<br />
Das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis wird durch die schriftliche<br />
Aufnahme als Dienstanfängerin oder Dienstanfänger durch die Stelle<br />
begründet, die für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf im<br />
Vorbereitungsdienst der angestrebten Laufbahn zuständig wäre.<br />
Bay LbV § 33 Dienstpflichten<br />
1 Für das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis als Dienstanfängerin oder<br />
Dienstanfänger gelten die Vorschriften des Bayerischen Beamtengesetzes über<br />
die beamtenrechtlichen Pflichten sinngemäß, soweit sich aus der Natur des<br />
Ausbildungsverhältnisses nichts anderes ergibt. 2 An Stelle des Diensteides<br />
wird folgendes Gelöbnis abgelegt:“Ich gelobe, meine Dienstpflichten<br />
gewissenhaft zu erfüllen.”<br />
Bay LbV § 34 Beendigung des öffentlich-rechtlichen<br />
Ausbildungsverhältnisses<br />
(1) 1 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger können jederzeit nach Maßgabe<br />
des Art. 35 Abs. 2 BayBG entlassen werden. 2 Die Dienstanfängerin oder<br />
der Dienstanfänger kann jederzeit seine Entlassung beantragen; Art. 57<br />
Abs. 1 und 2 Satz 1 BayBG sind entsprechend anzuwenden. 3 Für die<br />
Entlassung ist die in § 32 genannte Stelle zuständig.<br />
(2) Eine Dienstanfängerin oder ein Dienstanfänger, die oder der sich während<br />
des Ausbildungsverhältnisses bewährt hat, soll bei Vorliegen der sonstigen<br />
beamtenrechtlichen Voraussetzungen als Beamtin oder Beamter auf<br />
Widerruf in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden.<br />
[§§ 35 - 37] Abschnitt 4 Einfacher Dienst<br />
Bay LbV § 35 Einstellung in den Vorbereitungsdienst<br />
(1) In den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des einfachen Dienstes kann<br />
eingestellt werden, wer mindestens den erfolgreichen Besuch einer<br />
Hauptschule oder einen nach Anhörung des Landespersonalausschusses<br />
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus als gleichwertig<br />
anerkannten Bildungsstand nachweisen kann.<br />
(2) 1 Bewerberinnen und Bewerber für die Laufbahnen des technischen<br />
Dienstes müssen außerdem die für die Laufbahn erforderlichen fachlichen<br />
(handwerklichen) Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten nachweisen. 2 In<br />
die Laufbahn der Betriebswartinnen und Betriebswarte (Eingangsamt der<br />
Besoldungsgruppe A 4) können nur Personen eingestellt werden, die eine
Abschlussprüfung in einem gesetzlich geregelten, der Verwendung<br />
entsprechenden Ausbildungsberuf abgelegt haben.<br />
Bay LbV § 36 Vorbereitungsdienst<br />
(1) 1 Der Vorbereitungsdienst dauert mindestens sechs Monate. 2 Er umfasst<br />
eine theoretische und eine praktische Ausbildung.<br />
(2) 1 Dienstzeiten im öffentlichen Dienst können auf Antrag auf den<br />
Vorbereitungsdienst angerechnet werden, soweit sie dem Ziel der<br />
Ausbildung förderlich sind. 2 Über die Anrechnung entscheidet die oberste<br />
Dienstbehörde.<br />
(3) Beamtinnen und Beamte, die das Ziel des Vorbereitungsdienstes nicht<br />
erreichen, werden entlassen.<br />
Bay LbV § 37 Probezeit<br />
(1) 1 Die Probezeit dauert ein Jahr. 2 Die oberste Dienstbehörde kann die<br />
Probezeit für einzelne Laufbahnen auf höchstens zwei Jahre festsetzen,<br />
wenn die besonderen Verhältnisse der Laufbahnen es erfordern.<br />
(2) Die oberste Dienstbehörde kann die Probezeit bei erheblich über dem<br />
Durchschnitt liegenden Leistungen bis auf sechs Monate kürzen.<br />
(3) 1 Die oberste Dienstbehörde soll Zeiten einer Tätigkeit im öffentlichen<br />
Dienst, die beim Erwerb der Laufbahnbefähigung noch nicht berücksichtigt<br />
worden sind, auf die Probezeit anrechnen. 2 § 12 Abs. 2 ist entsprechend<br />
anzuwenden.<br />
(4) In jedem Fall ist mindestens eine Probezeit von sechs Monaten<br />
abzuleisten.<br />
[§§ 38 - 41] Abschnitt 5 Mittlerer Dienst<br />
Bay LbV § 38 Einstellung in den Vorbereitungsdienst<br />
(1) 1 In den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des mittleren Dienstes kann<br />
eingestellt werden, wer<br />
1. den mittleren Schulabschluss, den qualifizierenden Hauptschulabschluss<br />
oder einen nach Anhörung des Landespersonalausschusses vom<br />
Staatsministerium für Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannten<br />
Bildungsstand nachweist und<br />
2. die Einstellungsprüfung bestanden oder am besonderen<br />
Auswahlverfahren mit Erfolg teilgenommen hat.<br />
2<br />
Art. 32 Abs. 3 BayBG bleibt unberührt.<br />
(2) 1 Abweichend von Abs. 1 kann in den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn<br />
des mittleren technischen Dienstes eingestellt werden, wer<br />
1. den erfolgreichen Besuch einer Fachakademie oder einer öffentlichen<br />
oder staatlich anerkannten Technikerschule in einer entsprechenden<br />
Fachrichtung,<br />
2. die Meisterinnen- oder Meisterprüfung in einem der Fachrichtung<br />
förderlichen Handwerk oder eine entsprechende Industriemeisterprüfung,<br />
3. eine Abschlussprüfung in einem gesetzlich geregelten, der<br />
vorgesehenen Verwendung entsprechenden Ausbildungsberuf und in der
Regel eine förderliche praktische Tätigkeit von fünf Jahren nach<br />
Beendigung der Berufsausbildung oder<br />
4. eine in einer Ausbildungsordnung vorgeschriebene, im öffentlichen<br />
Dienst abgelegte Abschlussprüfung nachweist.<br />
2 Die Anforderungen für die einzelnen Laufbahnen werden durch<br />
Verordnung nach Art. 26 Abs. 2 BayBG näher festgelegt.<br />
Bay LbV § 39 Vorbereitungsdienst<br />
(1) 1 Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 2 Durch Verordnung nach<br />
Art. 26 Abs. 2 BayBG kann die Dauer des Vorbereitungsdienstes höchstens<br />
auf ein Jahr herabgesetzt werden, wenn<br />
1. für die Einstellung eine abgeschlossene Berufsausbildung innerhalb oder<br />
außerhalb des öffentlichen Dienstes, die die notwendigen fachlichen<br />
Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, oder eine förderliche zusätzliche<br />
Schulbildung erforderlich ist oder<br />
2. die besonderen Verhältnisse der Laufbahn es erfordern.<br />
(2) Der Vorbereitungsdienst kann auf die Ausbildung in fachbezogenen<br />
Schwerpunktbereichen der Laufbahn, verbunden mit praxisbezogenen<br />
Lehrveranstaltungen, beschränkt werden, wenn die Voraussetzungen des<br />
Abs. 1 Satz 2 erfüllt sind.<br />
(3) 1 Der Vorbereitungsdienst besteht aus einer fachtheoretischen Ausbildung<br />
von in der Regel sechs Monaten und einer berufspraktischen Ausbildung<br />
von in der Regel 18 Monaten. 2 Ist die Dauer des Vorbereitungsdienstes<br />
nach Abs. 1 Satz 2 herabgesetzt worden, so ist ein angemessenes<br />
Verhältnis zwischen fachtheoretischer und berufspraktischer Ausbildung<br />
sicherzustellen.<br />
Bay LbV § 40 Probezeit<br />
(1) Die Probezeit dauert zwei Jahre.<br />
(2) 1 Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses bei erheblich über dem Durchschnitt<br />
liegenden Leistungen die Probezeit bis auf ein Jahr und sechs Monate<br />
kürzen. 2 Der Zustimmung des Landespersonalausschusses bedarf es<br />
nicht, wenn in der Laufbahnprüfung eine Platzziffer erreicht wurde, die im<br />
ersten Fünftel der festgesetzten Platzziffern liegt; dabei darf die<br />
Gesamtnote “befriedigend” nicht unterschritten werden.<br />
(3) 1 Die oberste Dienstbehörde soll Zeiten einer Tätigkeit im öffentlichen<br />
Dienst, die beim Erwerb der Laufbahnbefähigung noch nicht berücksichtigt<br />
worden sind und die nach Art und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in<br />
einem Amt der betreffenden Laufbahn entsprechen, im Umfang von<br />
höchstens einem Jahr auf die Probezeit anrechnen. 2 § 12 Abs. 2 ist<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
(4) In jedem Fall ist mindestens eine Probezeit von sechs Monaten<br />
abzuleisten.<br />
Bay LbV § 41 Aufstieg<br />
(1) 1 Beamtinnen und Beamte des einfachen Dienstes können zum Aufstieg in<br />
eine Laufbahn des mittleren Dienstes derselben Fachrichtung zugelassen
werden, wenn<br />
1. sie sich in einer Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von mindestens drei<br />
Jahren bewährt haben und<br />
2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht länger als vier<br />
Jahre zurückliegen darf, die Eignung zum Aufstieg zuerkannt worden ist.<br />
2<br />
Die obersten Dienstbehörden können die Zulassung ferner vom Ergebnis<br />
eines Zulassungsverfahrens nach Abs. 2 abhängig machen.<br />
(2) 1 In einem Zulassungsverfahren kann festgestellt werden, ob die Beamtin<br />
oder der Beamte nach dem allgemeinen Bildungsstand und den fachlichen<br />
Kenntnissen für den Aufstieg geeignet ist. 2 Das Zulassungsverfahren führt<br />
die oberste Dienstbehörde für ihren Bereich oder die von ihr beauftragte<br />
Stelle bei Bedarf durch. 3 Die näheren Einzelheiten sind durch Verordnung<br />
nach Art. 26 Abs. 2 BayBG zu regeln.<br />
(3) 1 Nach der Zulassung zum Aufstieg wird die Beamtin oder der Beamte in<br />
die Aufgaben der neuen Laufbahn eingeführt. 2 Die Einführung entspricht<br />
der Ausbildung für die neue Laufbahn und dauert in der Regel zwei Jahre.<br />
3<br />
Sie kann um höchstens sechs Monate gekürzt werden, wenn die Beamtin<br />
oder der Beamte während ihrer oder seiner bisherigen Tätigkeit schon<br />
hinreichende Kenntnisse erworben hat, wie sie für die neue Laufbahn<br />
gefordert werden.<br />
(4) 1 Nach erfolgreicher Einführung ist die Laufbahnprüfung für den mittleren<br />
Dienst abzulegen. 2 Wird die Laufbahnprüfung endgültig nicht bestanden,<br />
sind wieder Dienstgeschäfte der bisherigen Laufbahn zu übertragen.<br />
(5) 1 Ist für eine Laufbahn des mittleren Dienstes keine Laufbahnprüfung<br />
vorgesehen, so bedarf die Verleihung eines Amtes dieser Laufbahn an eine<br />
Beamtin oder einen Beamten des einfachen Dienstes der Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses; dies gilt besonders bei einem Aufstieg in eine<br />
Laufbahn des mittleren nichttechnischen Dienstes für besondere<br />
Dienstleistungsbereiche. 2 Der Landespersonalausschuss legt die an die<br />
Befähigung für die neue Laufbahn zu stellenden Anforderungen fest. 3 Er<br />
kann auch darauf abstellen, dass sich die Beamtin oder der Beamte über<br />
eine längere Zeit auf einem herausgehobenen Dienstposten des einfachen<br />
Dienstes bewährt hat.<br />
[§§ 42 - 46] Abschnitt 6 Gehobener Dienst<br />
Bay LbV § 42 Einstellung in den Vorbereitungsdienst<br />
(1) In den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des gehobenen Dienstes kann<br />
eingestellt werden, wer<br />
1. die Fachhochschulreife, eine andere Hochschulreife oder einen nach<br />
Anhörung des Landespersonalausschusses vom Staatsministerium für<br />
Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannten Bildungsstand<br />
nachweist und<br />
2. am besonderen Auswahlverfahren mit Erfolg teilgenommen hat.<br />
(2) 1 In den Laufbahnen des technischen Dienstes, in denen kein<br />
Vorbereitungsdienst im Sinn des Art. 33 Abs. 2 BayBG eingerichtet ist, ist<br />
abweichend von Abs. 1 die erfolgreich bestandene Abschlussprüfung einer<br />
Fachhochschule oder einer Hochschule in einem
Fachhochschulstudiengang oder ein Bachelorabschluss in der<br />
entsprechenden Fachrichtung nachzuweisen. 2 In technischen Laufbahnen<br />
mit Vorbereitungsdienst im Sinn des Art. 33 Abs. 2 BayBG kann vom<br />
Auswahlverfahren nach Abs. 1 Nr. 2 abgesehen werden.<br />
(3) Art. 33 Abs. 5 BayBG bleibt unberührt.<br />
Bay LbV § 43 Vorbereitungsdienst<br />
(1) Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre.<br />
(2) 1 Der Vorbereitungsdienst für die Laufbahnen des nichttechnischen<br />
Dienstes vermittelt in einem Studiengang an der Fachhochschule für<br />
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern die wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse und Methoden und in berufspraktischen Studienzeiten die<br />
entsprechenden praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung<br />
der Aufgaben der Laufbahn erforderlich sind. 2 Die Fachstudien betragen<br />
mindestens 18 Monate, die berufspraktischen Studienzeiten mindestens<br />
15 Monate; insgesamt drei Monate der berufspraktischen Studienzeiten<br />
können auf praxisbezogene Lehrveranstaltungen entfallen, die höchstens<br />
400 Unterrichtsstunden umfassen dürfen.<br />
(3) 1 Durch Verordnung nach Art. 26 Abs. 2 BayBG kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses die Dauer des Vorbereitungsdienstes<br />
höchstens auf ein Jahr herabgesetzt werden, wenn für die Einstellung ein<br />
mit einer Prüfung abgeschlossenes Studium nach § 42 Abs. 2 erforderlich<br />
ist, in dem die zur Erfüllung der Laufbahnaufgaben notwendigen<br />
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden vermittelt werden. 2 Der<br />
Vorbereitungsdienst vermittelt insoweit, besonders bei den Laufbahnen<br />
des technischen Dienstes, in fachbezogenen Schwerpunktbereichen der<br />
Laufbahn, verbunden mit praxisbezogenen Lehrveranstaltungen, die für<br />
die Laufbahn erforderlichen berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse.<br />
Bay LbV § 44 Probezeit<br />
(1) Die Probezeit dauert zwei Jahre und sechs Monate.<br />
(2) 1 Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses bei erheblich über dem Durchschnitt<br />
liegenden Leistungen die Probezeit bis auf ein Jahr und sechs Monate<br />
kürzen. 2 Der Zustimmung des Landespersonalausschusses bedarf es<br />
nicht, wenn in der Laufbahnprüfung eine Platzziffer erreicht wurde, die im<br />
ersten Fünftel der festgesetzten Platzziffern liegt; dabei darf die<br />
Gesamtnote “befriedigend” nicht unterschritten werden.<br />
(3) 1 Die oberste Dienstbehörde soll Zeiten einer Tätigkeit im öffentlichen<br />
Dienst nach Erwerb der Laufbahnbefähigung, die nach Art und Bedeutung<br />
mindestens der Tätigkeit in einem Amt der betreffenden Laufbahn<br />
entsprechen, im Umfang von höchstens einem Jahr und sechs Monaten,<br />
mit Zustimmung des Landespersonalausschusses im Umfang von<br />
höchstens zwei Jahren auf die Probezeit anrechnen. 2 § 12 Abs. 2 ist<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
(4) 1 Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses Zeiten einer Tätigkeit außerhalb des<br />
öffentlichen Dienstes nach Erwerb der Laufbahnbefähigung, die nach Art
und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt der betreffenden<br />
Laufbahn entsprechen, im Umfang von höchstens einem Jahr auf die<br />
Probezeit anrechnen. 2 § 12 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.<br />
(5) In jedem Fall ist mindestens eine Probezeit von sechs Monaten<br />
abzuleisten.<br />
Bay LbV § 45 Aufstieg<br />
(1) Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes können zum Aufstieg in<br />
eine Laufbahn des gehobenen Dienstes derselben Fachrichtung zugelassen<br />
werden, wenn<br />
1. sie sich in einer Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von mindestens vier<br />
Jahren bewährt haben,<br />
2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht länger als vier<br />
Jahre zurückliegen darf, die Eignung zum Aufstieg zuerkannt worden ist<br />
und<br />
3. sie nach dem Ergebnis des Zulassungsverfahrens nach Abs. 2 erkennen<br />
lassen, dass sie den Anforderungen der neuen Laufbahn gewachsen sein<br />
werden.<br />
(2) 1 In dem Zulassungsverfahren ist festzustellen, ob die Beamtin oder der<br />
Beamte nach dem allgemeinen Bildungsstand und den fachlichen<br />
Kenntnissen für den Aufstieg geeignet ist. 2 Das Zulassungsverfahren führt<br />
das Staatsministerium, das nach Art. 26 Abs. 2 BayBG für den Erlass der<br />
jeweiligen Zulassungs- und Ausbildungsordnung federführend zuständig<br />
ist, oder die von ihm beauftragte Stelle bei Bedarf durch. 3 Die näheren<br />
Einzelheiten sind durch Verordnung nach Art. 26 Abs. 2 BayBG zu regeln.<br />
(3) 1 Nach der Zulassung zum Aufstieg wird die Beamtin oder der Beamte in<br />
die Aufgaben der neuen Laufbahn eingeführt. 2 Die Einführung entspricht<br />
der Ausbildung für die neue Laufbahn und dauert in der Regel drei Jahre.<br />
3<br />
Sie kann in ihrem berufspraktischen Teil um höchstens ein Jahr gekürzt<br />
werden, wenn während der bisherigen Tätigkeit schon hinreichend<br />
Kenntnisse erworben wurden, wie sie für die neue Laufbahn gefordert<br />
werden.<br />
(4) 1 Nach erfolgreicher Einführung ist die Laufbahnprüfung für den<br />
gehobenen Dienst abzulegen. 2 Wird die Laufbahnprüfung endgültig nicht<br />
bestanden, sind wieder Dienstgeschäfte der bisherigen Laufbahn zu<br />
übertragen.<br />
(5) 1 Ist für eine Laufbahn des gehobenen Dienstes keine Laufbahnprüfung<br />
vorgesehen, so bedarf die Verleihung eines Amtes dieser Laufbahn an eine<br />
Beamtin oder an einen Beamten des mittleren Dienstes der Zustimmung<br />
des Landespersonalausschusses. 2 Dieser legt dabei die an die Befähigung<br />
für die neue Laufbahn zu stellenden Anforderungen fest. 3 Das in § 43<br />
festgelegte Bildungsziel ist zu berücksichtigen.<br />
Bay LbV § 46 Aufstieg für besondere Verwendungen<br />
(1) 1 Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes, die<br />
1. geeignet sind,<br />
2. mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 8 erreicht haben und<br />
3. sich in einer Dienstzeit (§ 12 Abs. 1 Satz 1) von mindestens fünfzehn
Jahren bewährt haben,<br />
kann ein Amt der Laufbahn des gehobenen Dienstes verliehen werden,<br />
sofern sie die Befähigung für die Laufbahn nach den Abs. 2 bis 5 erworben<br />
haben. 2 § 8 Abs. 3 bleibt unberührt. 3 Die Befähigung gilt für den nach<br />
Abs. 2 und 5 Satz 4 festgelegten Verwendungsbereich.<br />
(2) 1 Der Verwendungsbereich umfasst Aufgaben, deren fachliche<br />
Anforderungen die Beamtin oder der Beamte durch eine nach Abs. 4 auf<br />
Grund fachverwandter Tätigkeiten und entsprechender beruflicher<br />
Erfahrung zu erwerbende Befähigung erfüllen kann. 2 Diese können<br />
höchstens einem Amt der Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet sein. 3 Die<br />
oberste Dienstbehörde legt die für den Aufstieg für besondere<br />
Verwendungen geeigneten Verwendungsbereiche fest.<br />
(3) Die Zulassung zum Aufstieg setzt voraus, dass ein dienstliches Bedürfnis<br />
den Einsatz der Beamtin oder des Beamten in dem Verwendungsbereich<br />
rechtfertigt.<br />
(4) 1 Die zum Aufstieg zugelassenen Beamtinnen und Beamten werden in die<br />
Aufgaben der neuen Laufbahn eingeführt. 2 Maßgebend sind die<br />
Anforderungen des Verwendungsbereichs. 3 Die Einführungszeit dauert<br />
sechs Monate. 4 Während der Einführung sollen die Beamtinnen und<br />
Beamten an geeigneten Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 5 Soweit<br />
sie während ihrer bisherigen Tätigkeit schon hinreichend Kenntnisse<br />
erworben haben, wie sie für den Verwendungsbereich in der neuen<br />
Laufbahn gefordert werden, kann die Einführungszeit bis auf drei Monate<br />
gekürzt werden.<br />
(5) 1 Der Landespersonalausschuss stellt auf Antrag der obersten<br />
Dienstbehörde fest, dass die Einführung erfolgreich abgeschlossen ist.<br />
2 3<br />
Hierzu kann er sich eines begutachtenden Ausschusses bedienen. Das<br />
Verfahren zur Feststellung regelt der Landespersonalausschuss durch<br />
Verwaltungsvorschrift. 4 In der Feststellung wird der Verwendungsbereich<br />
bezeichnet.<br />
[§§ 47 - 51] Abschnitt 7 Höherer Dienst<br />
Bay LbV § 47 Einstellung in den Vorbereitungsdienst<br />
1<br />
In den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des höheren Dienstes kann<br />
eingestellt werden, wer<br />
1. eine Erste Staatsprüfung oder die Erste Juristische Prüfung erfolgreich<br />
abgelegt hat,<br />
2. einen Master-, Diplom- oder vergleichbaren Abschluss an einer<br />
wissenschaftlichen Hochschule oder Kunsthochschule erworben hat, oder<br />
3. einen Master-Abschluss an einer Fachhochschule in einem Studiengang<br />
erworben hat, der in einem förmlichen Verfahren als laufbahnrechtlich<br />
gleichwertig anerkannt wurde.<br />
2<br />
Die jeweilige Prüfung oder der jeweilige Abschluss muss in Verbindung mit<br />
dem Vorbereitungsdienst die Laufbahnbefähigung vermitteln können.<br />
Bay LbV § 48 Vorbereitungsdienst<br />
(1) Der Vorbereitungsdienst dauert mindestens zwei Jahre.
(2) Der Vorbereitungsdienst vermittelt durch eine Ausbildung auf<br />
wissenschaftlicher Grundlage in fachbezogenen Schwerpunktbereichen der<br />
Laufbahnaufgaben, verbunden mit praxisbezogenen Lehrveranstaltungen,<br />
die für die Laufbahn erforderlichen berufspraktischen Fähigkeiten und<br />
Kenntnisse.<br />
(3) Nach näherer Bestimmung durch Verordnung nach Art. 26 Abs. 2 BayBG<br />
können auf Antrag<br />
1. Zeiten einer berufspraktischen Tätigkeit, die Voraussetzung für die<br />
Ablegung der für die Einstellung erforderlichen Prüfung sind, im Umfang<br />
von höchstens einem Jahr,<br />
2. Zeiten einer förderlichen berufspraktischen Tätigkeit, die nach Bestehen<br />
der für die Einstellung erforderlichen Prüfung abgeleistet worden sind, im<br />
Umfang von höchstens sechs Monaten,<br />
3. Zeiten einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung für eine Laufbahn<br />
des gehobenen Dienstes im Umfang von höchstens sechs Monaten,<br />
4. Zeiten einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung für das Lehramt an<br />
Realschulen im Umfang von höchstens einem Jahr bei der Ausbildung für<br />
das Lehramt an Gymnasien, wenn die gleiche Fächerverbindung vorliegt,<br />
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden; § 12 Abs. 2 ist<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
Bay LbV § 49 Probezeit<br />
(1) Die Probezeit dauert drei Jahre.<br />
(2) 1 Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses bei erheblich über dem Durchschnitt<br />
liegenden Leistungen die Probezeit bis auf ein Jahr und sechs Monate<br />
kürzen. 2 Der Zustimmung des Landespersonalausschusses bedarf es<br />
nicht, wenn in der Laufbahnprüfung eine Platzziffer erreicht wurde, die im<br />
ersten Fünftel der festgesetzten Platzziffern liegt; dabei darf die<br />
Gesamtnote “befriedigend” nicht unterschritten werden.<br />
(3) 1 Die oberste Dienstbehörde soll Zeiten einer Tätigkeit im öffentlichen<br />
Dienst nach Erwerb der Laufbahnbefähigung, die nach Art und Bedeutung<br />
mindestens der Tätigkeit in einem Amt der betreffenden Laufbahn<br />
entspricht, im Umfang von höchstens einem Jahr und sechs Monaten, mit<br />
Zustimmung des Landespersonalausschusses im Umfang von höchstens<br />
zwei Jahren auf die Probezeit anrechnen. 2 Zeiten, die in einem dem<br />
Hochschulpersonalgesetz unterliegenden Beamtenverhältnis auf Widerruf<br />
oder auf Zeit abgeleistet wurden, können mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses in vollem Umfang angerechnet werden, soweit<br />
die Tätigkeit funktionell der Tätigkeit während der Probezeit entspricht.<br />
3<br />
§ 12 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.<br />
(4) 1 Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses Zeiten einer Tätigkeit außerhalb des<br />
öffentlichen Dienstes nach Erwerb der Laufbahnbefähigung, die nach Art<br />
und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt der betreffenden<br />
Laufbahn entspricht, im Umfang von höchstens einem Jahr auf die<br />
Probezeit anrechnen. 2 § 12 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.<br />
(5) Außer im Fall des Abs. 3 Satz 2 ist mindestens eine Probezeit von sechs<br />
Monaten abzuleisten.
Bay LbV § 50 Dienstposten an obersten Landesbehörden<br />
(1) 1 Dienstposten an obersten Landesbehörden sollen auf Dauer nur an<br />
Beamtinnen oder Beamte oder Richterinnen oder Richter übertragen<br />
werden, die sich bereits auf verschiedenen Dienstposten bewährt haben.<br />
2<br />
§ 8 ist anzuwenden.<br />
(2) 1 Bei einer obersten Landesbehörde darf ein Amt der<br />
Besoldungsgruppe A 16 und höher nur an Beamtinnen und Beamte oder<br />
Richterinnen und Richter verliehen werden, die nach ihrer Ernennung zur<br />
Beamtin oder zum Beamten oder zur Richterin oder zum Richter auf Probe<br />
1. mindestens zwei Jahre bei einer anderen Behörde als einer obersten<br />
Landes- oder Bundesbehörde oder einem Gericht eines Landes und<br />
2. mindestens ein Jahr bei einer obersten Landes- oder Bundesbehörde<br />
tätig gewesen sind. 2 Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit im<br />
öffentlichen Dienst, die vor der Berufung in das Beamtenverhältnis auf<br />
Probe oder in das Richterverhältnis auf Probe, aber nach Bestehen der<br />
Laufbahnprüfung oder dem sonstigen Erwerb der Befähigung bei einer<br />
anderen Behörde als einer obersten Landes- oder Bundesbehörde<br />
abgeleistet wurden, können auf die Dienstzeit nach Satz 1 Nr. 1<br />
angerechnet werden, wenn sie nach Art und Bedeutung mindestens der<br />
Tätigkeit in einem Amt der betreffenden Laufbahn entsprechen;<br />
Entsprechendes gilt bei Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten für<br />
Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach dem<br />
Erwerb der Befähigung für den gehobenen Dienst. 3 Satz 1 Nr. 2 ist auf die<br />
Mitglieder des Obersten Rechnungshofs und auf Beamtinnen und Beamte,<br />
denen bereits ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 und höher an einer<br />
anderen Behörde als einer obersten Landes- oder Bundesbehörde<br />
verliehen ist, nicht anzuwenden.<br />
(3) 1 Der Landespersonalausschuss kann für Beamtinnen und Beamte des<br />
Obersten Rechnungshofs Ausnahmen von Abs. 2 Satz 1 zulassen. 2 Für die<br />
Beamtinnen und Beamten des Landtags bewilligt die Ausnahmen das<br />
Präsidium des Landtags. 3 Im Übrigen bewilligt die Ausnahmen die<br />
Staatsregierung.<br />
Bay LbV § 51 Aufstieg<br />
(1) Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes können zum Aufstieg in<br />
eine Laufbahn des höheren Dienstes derselben Fachrichtung zugelassen<br />
werden, wenn<br />
1. sie mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 erreicht haben und<br />
2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht länger als vier<br />
Jahre zurückliegen darf, die Eignung zum Aufstieg zuerkannt worden ist.<br />
(2) 1 Die Zulassung zum Aufstieg ist schriftlich mitzuteilen. 2 Mit der<br />
schriftlichen Mitteilung beginnt die Einführung in die Aufgaben der neuen<br />
Laufbahn. 3 Während der Einführung sollen die Beamtinnen oder Beamten<br />
bereits in den Aufgaben der neuen Laufbahn beschäftigt werden. 4 Sie<br />
sollen an geeigneten Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen.<br />
(3) 1 Die Einführung dauert mindestens zwei Jahre und sechs Monate.<br />
2<br />
Während der Zeit einer Beurlaubung findet eine Einführung nicht statt.<br />
3<br />
Die Einführung kann um bis zu ein Jahr, im Ausnahmefall mit
Zustimmung des Landespersonalausschusses um bis zu zwei Jahre<br />
gekürzt werden, wenn vor der Zulassung zum Aufstieg schon hinreichend<br />
Kenntnisse und Fähigkeiten, wie sie für die neue Laufbahn gefordert<br />
werden, erworben wurden. 4 Sie soll gekürzt werden, wenn ein<br />
fortbildendes Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, an<br />
der Hochschule für Politik München oder an einer vergleichbaren<br />
Einrichtung mit Erfolg abgeschlossen wurde und in der dienstlichen<br />
Bewährung hinreichende Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis gestellt<br />
wurden.<br />
(4) 1 Hält die oberste Dienstbehörde die Einführung für erfolgreich<br />
abgeschlossen, stellt der Landespersonalausschuss auf deren Antrag fest,<br />
ob die Beamtin oder der Beamte die für die Laufbahn des höheren<br />
Dienstes erforderliche Befähigung besitzt. 2 Das Verfahren zur Feststellung<br />
regelt der Landespersonalausschuss durch Verwaltungsvorschrift.<br />
(5) 1 Der Aufstieg ist ausgeschlossen, wenn für die höhere Laufbahn eine<br />
bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch besondere<br />
Rechtsvorschriften vorgeschrieben oder nach ihrer Eigenart zwingend<br />
erforderlich ist.<br />
[§§ 52 - 54] Teil 3 Laufbahnen besonderer Fachrichtungen<br />
Bay LbV § 52 Gestaltungsgrundsätze<br />
(1) 1 Laufbahnen besonderer Fachrichtungen können eingerichtet werden,<br />
sofern dafür neben den Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst und<br />
Laufbahnprüfung ein dienstliches Bedürfnis besteht. 2 In diesen<br />
Laufbahnen kann auf einen Vorbereitungsdienst verzichtet werden; an<br />
Stelle des Vorbereitungsdienstes und der Prüfungen können auch andere<br />
Befähigungsvoraussetzungen vorgeschrieben werden. 3 Die<br />
Befähigungsvoraussetzungen müssen den für die betreffende<br />
Laufbahngruppe allgemein vorgeschriebenen Voraussetzungen für den<br />
Erwerb der Laufbahnbefähigung gleichwertig sein.<br />
(2) Die Voraussetzungen für die Einstellung bestimmen sich nach<br />
1. § 53,<br />
2. näherer Regelung durch Verordnung nach Art. 26 Abs. 2 BayBG, die der<br />
Zustimmung des Landespersonalausschusses bedarf, oder<br />
3. § 70 Abs. 2.<br />
Bay LbV § 53 Befähigungsvoraussetzungen<br />
(1) Die Befähigung für eine Laufbahn besonderer Fachrichtungen im<br />
gehobenen Dienst nach Anlage 2 wird erworben durch<br />
1. das mit der vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossene Studium an<br />
einer Fachhochschule oder Hochschule in einem<br />
Fachhochschulstudiengang oder einen Bachelorabschluss in einer der<br />
Fachrichtungen nach Anlage 2 oder einen nach Anhörung des<br />
Landespersonalausschusses vom Staatsministerium für Wissenschaft,<br />
Forschung und Kunst als gleichwertig anerkannten Bildungsstand und<br />
2. eine hauptberufliche Tätigkeit (Abs. 3) nach Abschluss des Studiums<br />
von mindestens drei Jahren.
(2) Die Befähigung für eine Laufbahn besonderer Fachrichtungen im höheren<br />
Dienst nach Anlage 3 wird erworben durch<br />
1. das mit der vorgeschriebenen Prüfung (Master-, Diplom- oder<br />
vergleichbarer Abschluss) abgeschlossene Studium an einer<br />
wissenschaftlichen Hochschule oder das Studium an einer Fachhochschule,<br />
das in einem förmlichen Verfahren als laufbahnrechtlich gleichwertig<br />
anerkannt ist, in einer der Fachrichtungen nach Anlage 3 und<br />
2. eine hauptberufliche Tätigkeit (Abs. 3) nach Abschluss des Studiums<br />
von mindestens drei Jahren, bei zusätzlichem Nachweis der Promotion von<br />
mindestens zwei Jahren nach der Promotion.<br />
(3) 1 Die hauptberufliche Tätigkeit muss<br />
1. nach ihrer Fachrichtung der für den Befähigungserwerb geforderten<br />
Bildungsvoraussetzung und den Anforderungen der Laufbahn entsprechen,<br />
2. nach Bedeutung und Schwierigkeit der Tätigkeit in einem Amt<br />
derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn entsprechen und<br />
3. im Hinblick auf die Aufgaben der künftigen Laufbahn die Fähigkeit zu<br />
fachlich selbständiger Berufsausübung erwiesen haben.<br />
2<br />
Ein Jahr der hauptberuflichen Tätigkeit soll auf eine Beschäftigung im<br />
öffentlichen Dienst entfallen. 3 § 12 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.<br />
4<br />
Abweichende Regelungen können in den Anlagen 2 und 3 vorgesehen<br />
werden.<br />
Bay LbV § 54 Feststellung der Befähigung<br />
1 Die zuständige oberste Dienstbehörde stellt schriftlich fest, ob auf Grund der<br />
nach § 53 zu fordernden Nachweise die Laufbahnbefähigung erworben wurde.<br />
2 Dabei legt sie den Zeitpunkt des Befähigungserwerbs und die Fachrichtung<br />
fest.<br />
[§§ 55 - 56] Teil 4 Andere Bewerberinnen und Bewerber<br />
Bay LbV § 55 Befähigungsvoraussetzungen<br />
(1) 1 Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen durch ihre Lebens- und<br />
Berufserfahrung befähigt sein, die Aufgaben der künftigen Laufbahn<br />
wahrzunehmen. 2 Die für Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber<br />
für den Erwerb der Laufbahnbefähigung (§ 4 Abs. 1) erforderlichen<br />
Voraussetzungen dürfen von ihnen nicht gefordert werden.<br />
(2) In einer Laufbahn, für die eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung und<br />
Prüfung durch besondere Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist oder die<br />
ihrer Eigenart nach eine besondere laufbahnmäßige Vorbildung und<br />
Fachausbildung zwingend erfordert, können andere Bewerberinnen und<br />
Bewerber nicht eingestellt werden.<br />
(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber dürfen nur eingestellt werden, wenn<br />
1. keine geeigneten Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber zur<br />
Verfügung stehen,<br />
2. ein besonderes dienstliches Interesse an der Gewinnung als Beamtin<br />
oder Beamter besteht und<br />
3. die Befähigung durch den Landespersonalausschuss auf Antrag der<br />
obersten Dienstbehörde festgestellt worden ist.
(4) 1 Bei der Feststellung der Befähigung dürfen keine geringeren<br />
Anforderungen gestellt werden, als sie von Laufbahnbewerberinnen und<br />
Laufbahnbewerbern gefordert werden. 2 In der Entscheidung des<br />
Landespersonalausschusses ist anzugeben, für welche Laufbahn die<br />
Befähigung festgestellt wird. 3 Die Feststellung der Befähigung gilt nur für<br />
die Laufbahn bei dem Dienstherrn, bei dem die andere Bewerberin oder<br />
der andere Bewerber eingestellt werden soll.<br />
(5) Das Verfahren zur Feststellung der Befähigung regelt der<br />
Landespersonalausschuss durch Verwaltungsvorschrift.<br />
Bay LbV § 56 Probezeit<br />
(1) Die Probezeit dauert in den Laufbahnen<br />
1. des einfachen und des mittleren Dienstes drei Jahre,<br />
2. des gehobenen Dienstes vier Jahre und<br />
3. des höheren Dienstes fünf Jahre.<br />
(2) 1 Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst, die nach<br />
Art und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt der<br />
betreffenden Laufbahn entsprechen, können auf die Probezeit angerechnet<br />
werden. 2 Es ist jedoch mindestens eine Probezeit von sechs Monaten, in<br />
den Laufbahnen des gehobenen und des höheren Dienstes von einem Jahr<br />
und sechs Monaten abzuleisten. 3 § 12 Abs. 2 ist entsprechend<br />
anzuwenden.<br />
(3) In besonderen Ausnahmefällen kann die Probezeit auf sechs Monate<br />
gekürzt werden.<br />
(4) 1 Die Entscheidung nach den Abs. 2 und 3 trifft der<br />
Landespersonalausschuss auf Antrag der obersten Dienstbehörde oder die<br />
Staatsregierung im Rahmen ihrer Ernennungszuständigkeit nach Art. 18<br />
Abs. 1 BayBG.<br />
[§§ 57 - 66] Teil 5 Dienstliche Beurteilung<br />
Bay LbV § 57 Dienstliche Beurteilung<br />
(1) 1 Dienstliche Beurteilungen sind die Probezeitbeurteilung, die periodische<br />
Beurteilung und die Zwischenbeurteilung. 2 Der Landespersonalausschuss<br />
kann auf Antrag der obersten Dienstbehörde weitere dienstliche<br />
Beurteilungen zulassen.<br />
(2) Keine dienstlichen Beurteilungen sind die Zwischen- und<br />
Abschlusszeugnisse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im<br />
Vorbereitungsdienst.<br />
Bay LbV § 58 Probezeitbeurteilung<br />
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind mindestens bis zum Ablauf<br />
der Probezeit zu beurteilen.<br />
Bay LbV § 59 Periodische Beurteilung<br />
(1) 1 Fachliche Leistung, Eignung und Befähigung sind mindestens alle vier<br />
Jahre dienstlich zu beurteilen (periodische Beurteilung). 2 Dies gilt nicht
für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und<br />
während der Probezeit.<br />
(2) 1 Die periodische Beurteilung kann zurückgestellt werden, wenn<br />
1. gegen die Beamtin oder den Beamten ein gerichtliches Strafverfahren,<br />
ein Disziplinarverfahren, Vorermittlungen oder ein strafrechtliches<br />
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist oder<br />
2. ein sonstiger in der Person liegender wichtiger Grund besteht.<br />
2<br />
Nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, der Einstellung der<br />
Ermittlungen oder dem Wegfall des sonstigen wichtigen Grundes ist die<br />
periodische Beurteilung nachzuholen.<br />
(3) 1 Nicht periodisch beurteilt werden<br />
1. Beamtinnen und Beamte in einem Amt der Besoldungsgruppe A 16 mit<br />
Amtszulage und höher,<br />
2. Beamtinnen und Beamte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben,<br />
3. weitere Personengruppen nach Anordnung der obersten Dienstbehörde<br />
mit Zustimmung des Landespersonalausschusses.<br />
2<br />
Die oberste Dienstbehörde kann die periodische Beurteilung der in Satz 1<br />
genannten Gruppen anordnen. 3 Beamtinnen und Beamte im Sinn des<br />
Satzes 1 Nr. 2 sind auf schriftlichen Antrag in die periodische Beurteilung<br />
einzubeziehen.<br />
Bay LbV § 60 Zwischenbeurteilung<br />
Eine Zwischenbeurteilung ist zu erstellen, wenn Beamtinnen oder Beamte<br />
mindestens ein Jahr nach dem Ende des der letzten dienstlichen Beurteilung<br />
zugrunde liegenden Zeitraums oder der Probezeit die Behörde wechseln,<br />
beurlaubt oder vom Dienst freigestellt werden.<br />
Bay LbV § 61 Inhalt der dienstlichen Beurteilung<br />
(1) Der dienstlichen Beurteilung ist eine Beschreibung der Aufgaben, die im<br />
Beurteilungszeitraum wahrgenommen wurden, voranzustellen.<br />
(2) Die dienstliche Beurteilung hat die fachliche Leistung in Bezug auf die<br />
Funktion und im Vergleich zu den anderen Beamtinnen und Beamten<br />
derselben Besoldungsgruppe der Laufbahn objektiv darzustellen und<br />
außerdem von Eignung und Befähigung ein zutreffendes Bild zu geben.<br />
(3) 1 Die fachliche Leistung ist nach dem Arbeitserfolg, der praktischen<br />
Arbeitsweise und für Beamtinnen und Beamte, die bereits Vorgesetzte<br />
sind, nach dem Führungsverhalten zu beurteilen. 2 Die Eignung ist nach<br />
den geistigen Anlagen und der physischen und psychischen Belastbarkeit,<br />
die Befähigung nach den beruflichen Fachkenntnissen und dem sonstigen<br />
fachlichen Können zu beurteilen.<br />
(4) 1 Die periodische Beurteilung ist mit einer detaillierten Aussage zur<br />
Verwendungseignung abzuschließen. 2 Dabei ist bei Beamtinnen und<br />
Beamten, die für den Aufstieg geeignet erscheinen, ein entsprechender<br />
Vermerk aufzunehmen. 3 Sofern eine Verwendung in Führungspositionen<br />
in Betracht kommt, ist bei der Verwendungseignung eine differenzierte<br />
Aussage zur Führungsqualifikation zu treffen. 4 Schließlich ist hier<br />
darzulegen, für welche dienstlichen Aufgaben die Beamtin oder der
Beamte in Betracht kommt und welche Einschränkungen gegebenenfalls<br />
bestehen.<br />
(5) 1 Bei der Probezeitbeurteilung kann von den Abs. 1 bis 3 abgewichen<br />
werden. 2 Sie kann auf die Feststellung beschränkt werden, ob sich die<br />
Beamtin oder der Beamte während der Probezeit bewährt hat und für die<br />
Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit geeignet ist.<br />
(6) 1 Die nähere Ausgestaltung der dienstlichen Beurteilung wird durch<br />
Verwaltungsvorschriften gemäß Art. 15 BayBG geregelt. 2 Hierbei können<br />
vereinfachte Beurteilungen für bestimmte Beamtengruppen zugelassen<br />
werden.<br />
Bay LbV § 62 Bewertung und Gesamturteil<br />
(1) 1 Die Bewertung erfolgt in einem Punktesystem mit einer Punkteskala von<br />
1 bis 16 Punkten bezüglich der einzelnen Leistungs-, Eignungs- und<br />
Befähigungsmerkmale sowie bezüglich des Gesamturteils. 2 Für die<br />
Bewertung der einzelnen Leistungs-, Eignungs- und Befähigungsmerkmale<br />
bei der Beurteilung der Richterinnen und Richter sowie der<br />
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kann durch Verwaltungsvorschriften<br />
gemäß § 61 Abs. 6 Satz 1 eine abweichende Regelung getroffen werden.<br />
3<br />
Verbale Hinweise oder Erläuterungen zu den einzelnen Merkmalen sind<br />
zulässig. 4 Sie sind bei denjenigen Einzelmerkmalen vorzunehmen, die sich<br />
aus mehreren Komponenten zusammensetzen oder deren Bewertung sich<br />
gegenüber der letzten periodischen Beurteilung wesentlich verschlechtert<br />
hat oder bei denen sich die Bewertung auf bestimmte Vorkommnisse<br />
gründet. 5 Die Beurteilung enthält daneben ergänzende Bemerkungen und<br />
nach dem Gesamturteil abschließend Äußerungen über die<br />
Verwendungseignung.<br />
(2) 1 Bei der Bildung des Gesamturteils sind die bei den Einzelmerkmalen<br />
vergebenen Wertungen unter Berücksichtigung ihrer an den<br />
Erfordernissen des Amtes und der Funktion zu messenden Bedeutung in<br />
einer Gesamtschau zu bewerten und zu gewichten. 2 Die für die Bildung<br />
des Gesamturteils wesentlichen Gründe sind in den ergänzenden<br />
Bemerkungen darzulegen.<br />
Bay LbV § 63 Zuständigkeit<br />
(1) 1 Die dienstliche Beurteilung wird, soweit die Dienstaufsicht nicht<br />
anderweitig geregelt ist, von der Leitung der Behörde erstellt, der die<br />
Beamtin oder der Beamte im Zeitpunkt der dienstlichen Beurteilung<br />
angehört. 2 Abgeordnete Beamtinnen und Beamte werden im<br />
Einvernehmen mit der Leitung der Behörde beurteilt, an die sie<br />
abgeordnet sind; besteht die Abordnung zu einer Dienststelle eines<br />
anderen Dienstherrn, erfolgt die Beurteilung im Benehmen mit der Leitung<br />
der Behörde, an die sie abgeordnet sind. 3 Die Leiterinnen und Leiter von<br />
Behörden werden von der Leitung der vorgesetzten Dienststelle beurteilt.<br />
4 Die oberste Dienstbehörde kann eine abweichende Regelung treffen,<br />
soweit ein dringendes dienstliches Bedürfnis gegeben ist. 5 Bei den<br />
Behörden, die den obersten Dienstbehörden unmittelbar nachgeordnet<br />
sind, kann die Leiterin oder der Leiter der Behörde die Befugnis zur<br />
Beurteilung auf ihre oder seine allgemeine Vertretung übertragen. 6 Im
Bereich der kommunalen Dienstherren kann die Behördenleitung die<br />
Befugnis zur Beurteilung übertragen, wenn sichergestellt ist, dass die<br />
Beurteilung von einer Person erstellt wird, die zumindest die gleiche<br />
Qualifikation besitzt wie die zu beurteilende Person.<br />
(2) 1 Die dienstliche Beurteilung wird von den vorgesetzten Dienstbehörden<br />
überprüft. 2 Die Überprüfung soll spätestens nach einer Frist von sechs<br />
Monaten nach der ersten Eröffnung abgeschlossen sein. 3 Ist die<br />
vorgesetzte Dienstbehörde eine oberste Dienstbehörde, kann sie die<br />
Überprüfung der dienstlichen Beurteilungen auf eine nachgeordnete<br />
Behörde übertragen oder auf die Fälle beschränken, in denen gegen die<br />
Beurteilung Einwendungen erhoben wurden. 4 Die Probezeitbeurteilungen<br />
in den Laufbahnen des einfachen und des mittleren Dienstes bedürfen der<br />
Überprüfung nicht, wenn die vorgesetzte Dienstbehörde eine oberste<br />
Dienstbehörde ist.<br />
Bay LbV § 64 Eröffnung der dienstlichen Beurteilung<br />
(1) 1 Die dienstliche Beurteilung ist der Beamtin oder dem Beamten vor der<br />
Überprüfung zu eröffnen. 2 Sie soll besprochen werden. 3 Die Eröffnung der<br />
dienstlichen Beurteilung kann auf Vorgesetzte delegiert werden, die an der<br />
Erstellung der Beurteilung wesentlich mitgewirkt haben. 4 Einwendungen<br />
sind der vorgesetzten Dienstbehörde mit vorzulegen. 5 Ist die dienstliche<br />
Beurteilung durch die vorgesetzte Dienstbehörde abgeändert worden, ist<br />
die dienstliche Beurteilung unverzüglich, spätestens aber drei Monate nach<br />
der Überprüfung, nochmals zu eröffnen.<br />
(2) Die Beurteilung ist mit einem Vermerk über ihre Eröffnung zu den<br />
Personalakten zu nehmen.<br />
Bay LbV § 65 Ausnahmegenehmigungen<br />
Das Staatsministerium des Innern kann im Interesse der Weiterentwicklung<br />
der kommunalen Selbstverwaltung zur Erprobung neuer Modelle der<br />
dienstlichen Beurteilung von § 62 abweichende Beurteilungssysteme zeitlich<br />
befristet zulassen, ausgenommen solche Bereiche, in denen staatliche und<br />
kommunale Beamtinnen und Beamte gleichzeitig tätig sind.<br />
Bay LbV § 66 Dienstliche Beurteilung von Lehrkräften<br />
1 Das zuständige Staatsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium der Finanzen für die Beurteilung der staatlichen<br />
Lehrkräfte eigene Richtlinien zu erlassen, die von den Vorschriften dieses Teils<br />
abweichen können. 2 Die Richtlinien nach Satz 1 können für Lehrkräfte an<br />
kommunalen Schulen entsprechend angewendet werden.<br />
[§ 67] Teil 6 Fortbildung<br />
Bay LbV § 67 Fortbildung<br />
(1) 1 Die dienstliche Fortbildung wird von der obersten Dienstbehörde<br />
gefördert und geregelt. 2 Die einzelnen Fortbildungsmaßnahmen werden<br />
regelmäßig durch die obersten Dienstbehörden und durch die von ihnen<br />
beauftragten Behörden oder Stellen durchgeführt. 3 Die Gelegenheit zur<br />
Fortbildung soll möglichst gleichmäßig gegeben werden.
(2) 1 Die Beamtinnen und Beamten sind verpflichtet, an Maßnahmen der<br />
Einführungs-, Anpassungs- und Förderungsfortbildung teilzunehmen. 2 Sie<br />
sind außerdem verpflichtet, sich selbst fortzubilden, damit sie den<br />
Änderungen der Aufgaben und der Anforderungen gewachsen sind<br />
(Anpassungsfortbildung).<br />
(3) Wer seine Fähigkeiten und fachlichen Kenntnisse durch Fortbildung<br />
nachweislich wesentlich gesteigert hat, ist zu fördern und soll unter<br />
Beachtung der Grundsätze des § 8 Gelegenheit erhalten, Fähigkeiten und<br />
fachliche Kenntnisse auf einem höherwertigen Dienstposten anzuwenden<br />
und hierbei die besondere Eignung zu beweisen.<br />
(4) Als Nachweis besonderer fachlicher Kenntnisse nach Abs. 3 sind<br />
insbesondere das Diplom einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie,<br />
das Diplom der Hochschule für Politik München und andere<br />
Bildungsabschlüsse anzusehen.<br />
[§§ 68 - 69] Teil 7 Übernahme von Beamtinnen und Beamten<br />
Bay LbV § 68 Übernahme von Beamtinnen und Beamten und<br />
Wiedereinstellung früherer Beamtinnen und Beamter von Dienstherren<br />
innerhalb des Geltungsbereichs des Bayerischen Beamtengesetzes<br />
(1) 1 Bei der Einstellung von Beamtinnen und Beamten von Dienstherren<br />
innerhalb des Geltungsbereichs des Bayerischen Beamtengesetzes kann<br />
von der vorgeschriebenen Probezeit abgesehen werden, wenn sie bereits<br />
in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit in einer Laufbahn derselben<br />
Laufbahngruppe berufen worden sind. 2 Die Probezeit gilt als abgeleistet,<br />
soweit sie nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung in der<br />
entsprechenden oder einer gleichwertigen Laufbahn zurückgelegt wurde.<br />
3<br />
Von einer erneuten Probezeit kann auch dann abgesehen werden, wenn<br />
eine Beamtin oder ein Beamter auf Lebenszeit die Befähigung für eine<br />
Laufbahn einer höheren Laufbahngruppe außerhalb des Aufstiegs<br />
erworben hat und in die neue Laufbahn übernommen wird. 4 Die<br />
Übertragung eines Amtes der neuen Laufbahn kann von einer höchstens<br />
einjährigen Bewährungszeit abhängig gemacht werden; während der<br />
Bewährungszeit bleibt die bisherige Rechtsstellung unverändert.<br />
(2) 1 Bei der Übernahme von Beamtinnen und Beamten von Dienstherren<br />
innerhalb des Geltungsbereichs des Bayerischen Beamtengesetzes ist die<br />
Einstellung in einem höheren Amt als dem Eingangsamt zulässig, wenn die<br />
Übernahme in einem der letzten Dienststellung gleichwertigen Amt erfolgt.<br />
2<br />
Erfolgt die Übernahme in einem höheren Amt als dem bisherigen Amt, so<br />
sind die Vorschriften über Beförderungen anzuwenden.<br />
(3) Abs. 1 und 2 sind bei der Wiedereinstellung früherer Beamtinnen und<br />
Beamter von Dienstherren innerhalb des Geltungsbereichs des<br />
Bayerischen Beamtengesetzes entsprechend anzuwenden.<br />
Bay LbV § 69 Übernahme von Beamtinnen und Beamten und<br />
Wiedereinstellung früherer Beamtinnen und Beamter von Dienstherren<br />
außerhalb des Geltungsbereichs des Bayerischen Beamtengesetzes<br />
(1) 1 Bei der Übernahme von Beamtinnen und Beamten und der<br />
Wiedereinstellung früherer Beamtinnen und Beamter von Dienstherren
außerhalb des Geltungsbereichs des Bayerischen Beamtengesetzes ist<br />
diese Verordnung anzuwenden; dies gilt nicht, wenn die Übernahme kraft<br />
<strong>Gesetze</strong>s oder auf Grund eines Rechtsanspruchs in ihrer bisherigen<br />
Rechtsstellung erfolgt.<br />
(2) 1 Wer als Laufbahnbewerberin oder Laufbahnbewerber die Befähigung für<br />
eine Laufbahn bei einem Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs des<br />
Bayerischen Beamtengesetzes durch Bestehen der Laufbahnprüfung<br />
erworben hat, besitzt auch die Befähigung für die entsprechende Laufbahn<br />
im Geltungsbereich des Bayerischen Beamtengesetzes. 2 Wer bei einem<br />
Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs des Bayerischen<br />
Beamtengesetzes die Befähigung für eine Laufbahn ohne Ableistung eines<br />
Vorbereitungsdienstes und Bestehen einer Laufbahnprüfung erworben hat,<br />
besitzt auch die Befähigung für eine in gleicher Weise geregelte<br />
entsprechende Laufbahn im Geltungsbereich des Bayerischen<br />
Beamtengesetzes. 3 Welcher Laufbahn die Befähigung entspricht, stellt die<br />
oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des Landespersonalausschusses<br />
fest; die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Befähigung für eine<br />
Laufbahn besonderer Fachrichtung festgestellt werden soll, die nach § 52<br />
Abs. 2 Nrn. 1 und 2 geregelt worden ist. 4 Die Zustimmung ist bei einer<br />
Versetzung vor der Einverständniserklärung des aufnehmenden<br />
Dienstherrn einzuholen.<br />
(3) 1 Für die Anerkennung der bei einem Dienstherrn außerhalb des<br />
Geltungsbereichs des Bayerischen Beamtengesetzes als<br />
Laufbahnbewerberin oder Laufbahnbewerber erworbenen Befähigung als<br />
Befähigung für eine gleichwertige Laufbahn im Geltungsbereich des<br />
Bayerischen Beamtengesetzes gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. 2 Über die<br />
Anerkennung der Befähigung entscheidet die oberste Dienstbehörde mit<br />
Zustimmung des Landespersonalausschusses. 3 Die Zustimmung ist bei<br />
einer Versetzung vor der Einverständniserklärung des aufnehmenden<br />
Dienstherrn einzuholen.<br />
[§§ 70 - 71] Teil 8 Landespersonalausschuss<br />
Bay LbV § 70 Feststellung der Laufbahnbefähigung<br />
(1) 1 Soweit die Gestaltung des Vorbereitungsdienstes und die Prüfungen nicht<br />
nach § 17 Abs. 1 geregelt sind, kann der Landespersonalausschuss auf<br />
Antrag der obersten Dienstbehörde den Erwerb der Laufbahnbefähigung<br />
im Einzelfall feststellen. 2 Die Befähigungsvoraussetzungen müssen den<br />
für die betreffende Laufbahngruppe allgemein vorgeschriebenen<br />
Voraussetzungen für den Erwerb der Laufbahnbefähigung gleichwertig<br />
sein.<br />
(2) Abs. 1 ist für Laufbahnen besonderer Fachrichtungen entsprechend<br />
anzuwenden, soweit die Voraussetzungen für die Einstellung nicht nach<br />
§ 52 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 festgelegt worden sind.<br />
Bay LbV § 71 Allgemeine Ausnahmen<br />
Soweit eine Zuständigkeit des Landespersonalausschusses nach dem<br />
Bayerischen Beamtengesetz oder nach dieser Verordnung begründet ist, kann<br />
dieser seine Beschlüsse in Einzelfällen oder in Gruppen von Fällen fassen.
[§§ 72 - 75] Teil 9 Übergangs- und Schlussvorschriften<br />
Bay LbV § 72 Zuständigkeit der obersten Dienstbehörden<br />
1 Entscheidungen nach dieser Verordnung trifft die oberste Dienstbehörde,<br />
wenn nichts anderes geregelt ist. 2 Für den staatlichen Bereich kann sie ihre<br />
Zuständigkeit durch Verordnung auf die für die Ernennung zuständigen<br />
Behörden übertragen. 3 Für den kommunalen Bereich finden Art. 34 der<br />
Bezirksordnung, Art. 38 der Landkreisordnung und Art. 43 der<br />
Gemeindeordnung Anwendung. 4 Satz 2 gilt nicht in den Fällen des § 37 Abs. 1<br />
Satz 2, des § 41 Abs. 1 Satz 2, des § 63 Abs. 1 Satz 4 und soweit eine<br />
Antragstellung beim Landespersonalausschuss erforderlich ist.<br />
Bay LbV § 73 Erlass von Verwaltungsvorschriften<br />
(1) Der Erlass von ergänzenden Verwaltungsvorschriften bestimmt sich nach<br />
Art. 15 BayBG.<br />
(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus bzw. das<br />
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst regelt nach<br />
Anhörung des Landespersonalausschusses durch Verwaltungsvorschrift,<br />
welche Bildungsstände den nach dieser Verordnung vorgesehenen<br />
Bildungsvoraussetzungen gleichwertig sind.<br />
Bay LbV § 74 Übergangsregelungen<br />
(1) 1 Für Beamtinnen und Beamte, die noch vor dem 1. April 2009 angestellt<br />
wurden, rechnet die Dienstzeit weiterhin ab dem Zeitpunkt der Anstellung;<br />
für diese Beamtinnen und Beamten ist an Stelle des § 10 Abs. 2 Satz 1<br />
Nr. 2 die Vorschrift des § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Laufbahnverordnung<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1996 (GVBl S. 99, ber.<br />
S. 220, BayRS 2030-2-1-2-F), zuletzt geändert durch § 3 des <strong>Gesetze</strong>s<br />
vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 931), weiterhin anzuwenden. 2 Für<br />
Beamtinnen und Beamte, die am 1. April 2009 noch zur Anstellung<br />
anstünden, ist ab dem 1. April 2009 diese Verordnung anzuwenden.<br />
(2) 1 Der Zustimmung des Landespersonalausschusses nach § 5 Abs. 2 Satz 4<br />
bedarf es nicht bei Beamtinnen und Beamten des gehobenen und des<br />
höheren Dienstes, deren Laufbahnbefähigung durch die oberste<br />
Dienstbehörde, nach dem 1. Dezember 1977 mit Zustimmung des<br />
Landespersonalausschusses, als gleichwertige Laufbahnbefähigung<br />
anerkannt wurde, wenn die Beamtin oder der Beamte später in eine<br />
entsprechende Laufbahn bei einem anderen Dienstherrn übernommen<br />
wird. 2 Dies gilt entsprechend im Fall des § 69 Abs. 3 Satz 2.<br />
(3) Für die Anrechnung von Erziehungszeiten für vor dem 1. Januar 2008<br />
geborene Kinder findet § 62 Abs. 4 der Laufbahnverordnung in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1996 (GVBl S. 99, ber. S. 220,<br />
BayRS 2030-2-1-2-F), zuletzt geändert durch § 3 des <strong>Gesetze</strong>s vom<br />
20. Dezember 2007 (GVBl. S. 931), Anwendung.<br />
(4) 1 § 12 Abs. 2 gilt nur für Zeiten einer Beschäftigung nach dem 31. März<br />
2009. 2 Zeiten vor dem 1. April 2009 berechnen sich nach dem jeweils zu<br />
dieser Zeit geltenden Rechtsstand.
(5) Beamtinnen und Beamte, die bis zum Ablauf des 31. März 2009 zum<br />
Aufstieg für besondere Verwendung nach § 37 a der Laufbahnverordnung<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1996 (GVBl S. 99, ber.<br />
S. 220, BayRS 2030-2-1-2-F), zuletzt geändert durch § 3 des <strong>Gesetze</strong>s<br />
vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 931), zugelassen wurden, führen ihn<br />
nach den dort geltenden Voraussetzungen fort.<br />
Bay LbV § 75 Inkrafttreten, Außerkrafttreten<br />
(1) 1 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 2009 in Kraft.<br />
2 Abweichend von Satz 1 treten die §§ 21 bis 30 mit Wirkung vom<br />
1. Oktober 2007 in Kraft.<br />
(2) Mit Ablauf des 31. März 2009 tritt die Verordnung über die Laufbahnen der<br />
bayerischen Beamten (Laufbahnverordnung – LbV) in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 4. März 1996 (GVBl S. 99, ber. S. 220,<br />
BayRS 2030-2-1-2-F), zuletzt geändert durch § 3 des <strong>Gesetze</strong>s vom<br />
20. Dezember 2007 (GVBl S. 931), außer Kraft.
Anlage 1<br />
(zu § 28)<br />
Vertrag<br />
zwischen<br />
dem Freistaat Bayern<br />
- vertreten durch<br />
-<br />
und<br />
Frau/Herrn<br />
geboren am<br />
wohnhaft<br />
wird folgender Vertrag geschlossen:<br />
§ 1<br />
Frau/Herrn<br />
wird für die Zeit vom bis zum Gelegenheit gegeben, in einem<br />
Anpassungslehrgang im Sinn von Art. 3 Abs. 1 Buchst. g, Art. 14 der Richtlinie<br />
2005/36/EG und im Sinn des § 28 LbV die Kenntnisse und Fähigkeiten für die<br />
Laufbahnbefähigung<br />
zu erwerben, die ihr/ihm nach den festgestellten Defiziten noch fehlen.<br />
§ 2<br />
(1) Der Anpassungslehrgang besteht aus einer berufspraktischen Ausbildung<br />
in den Aufgaben der oben genannten Laufbahn unter Anleitung und<br />
Verantwortung einer qualifizierten Inhaberin oder eines qualifizierten<br />
Inhabers der Laufbahnbefähigung (Ausbildungsleitung).<br />
(2) Der Anpassungslehrgang umfasst eine Zusatzausbildung in Form von<br />
Fortbildungsmaßnahmen, wenn die vorhandenen Defizite nicht im Rahmen<br />
der berufspraktischen Tätigkeit ausgeglichen werden können.<br />
(3) Folgende Defizite wurden bei Frau/Herrn<br />
festgestellt.<br />
Das Ziel des Anpassungslehrgangs ist die Beseitigung dieser Defizite. Die<br />
Ausbildungsleitung legt die weiteren Einzelheiten des Anpassungslehrgangs<br />
fest. Dabei stellt sie durch geeignete Maßnahmen sicher, dass sich<br />
Frau/Herr<br />
die Kenntnissse und Fähigkeiten der in § 1 genannten Laufbahnbefähigung in<br />
sachgerechter Form aneignen kann.<br />
(4) Sie/Er kann sich in allen Fragen der Durchführung des<br />
Anpassungslehrgangs an die Ausbildungsleitung wenden.<br />
§ 3<br />
Dienstobliegenheiten werden nicht übertragen.
§ 4<br />
Der Anpassungslehrgang endet außer durch Ablauf der festgesetzten Zeit<br />
vorzeitig auf Antrag. Er kann außerdem vorzeitig von Amts wegen beendet<br />
werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen von Frau/Herrn der<br />
Fortführung entgegenstehen.<br />
§ 5<br />
Frau/Herr<br />
hat den Anweisungen der Ausbildungsleitung zu folgen; sie/er wird zu Beginn<br />
des Anpassungslehrgangs auf die Pflicht zur Verschwiegenheit hingewiesen.<br />
§ 6<br />
Eine Vergütung oder ein sonstiges Entgelt wird nicht gewährt.<br />
, den<br />
Unterschrift der Teilnehmerin oder<br />
Vertreterin/Vertreter des<br />
des Teilnehmers<br />
Freistaates Bayern<br />
des Anpassungslehrgangs
Anlage 2<br />
(zu § 53)<br />
Gehobener Dienst<br />
Besondere Fachrichtung des<br />
gehobenen Dienstes (ohne<br />
Schulen und Hochschulen)<br />
1.Gartenbaulicher Dienst (ohne<br />
staatlichen Bereich, mit<br />
Ausnahme der Botanischen<br />
Gärten)<br />
2.Weinbaulicher Dienst<br />
3.Technischer Weinkontrolldienst<br />
4.Milchwirtschaftlicher Dienst<br />
oder Dienst als<br />
Lebensmitteltechnologin oder<br />
Lebensmitteltechnologe<br />
5.Dienst in den Bereichen<br />
Sozialarbeit und Sozialpädagogik<br />
6.Technischer Werkdienst<br />
(Betriebsdienst)<br />
7.Dienst als Chemikerin oder<br />
Chemiker<br />
8.Dienst als Physikerin oder<br />
Physiker<br />
9.Bergverwaltungsdienst<br />
10.Technischer Dienst im Bereich<br />
der Informationstechniken<br />
Einschlägige Ausbildung (Fachhochschulstudiengänge) mit<br />
Abschlussbezeichnung – Sonderregelungen nach § 53 Abs. 3<br />
Satz 4 in Klammern –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengang Gartenbau –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengänge Weinbau und Kellerwirtschaft oder<br />
Getränketechnologie –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengänge Weinbau und Kellerwirtschaft oder<br />
Getränketechnologie –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengang Lebensmitteltechnologie –<br />
Diplom-Sozialpädagogin (FH), Diplom-Sozialpädagoge (FH),<br />
Diplom-Sozialarbeiterin (FH), Diplom-Sozialarbeiter (FH),<br />
(Die hauptberufliche Tätigkeit nach § 53 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3<br />
beträgt mindestens zwei Jahre nach Abschluss des Studiums<br />
oder Erwerb der staatlichen Anerkennung, wenn eine<br />
Bewerberin oder ein Bewerber ein vorgeschriebenes Studium<br />
von mindestens acht Semestern an einer Fachhochschule<br />
absolviert hat oder die staatliche Berufsanerkennung<br />
erhalten hat. Als hauptberufliche Tätigkeit gilt nur eine<br />
Beschäftigung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter im<br />
öffentlichen Dienst; eine gleichwertige Tätigkeit außerhalb<br />
des öffentlichen Dienstes kann bis zu einem Jahr<br />
angerechnet werden.)<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– in dem jeweiligen Studiengang –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengänge Chemie oder Technische Chemie –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengänge Physik oder Physikalische Technik –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengänge Bergbau oder verwandte Studiengänge<br />
(Steine und Erden, Erdöl-, Tiefbohr-, Bergmaschinen-,<br />
Bergelektro- und Markscheidewesen) sowie die<br />
Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH)<br />
– Studiengänge Elektrotechnik oder<br />
Wirtschaftsingenieurwesen –<br />
– Diplom-Informatikerin (FH), Diplom-Informatiker (FH)<br />
– Studiengang Informatik –<br />
– Diplom-Mathematikerin (FH), Diplom-Mathematiker (FH)<br />
– Studiengang Mathematik –<br />
– Diplom-Wirtschaftsinformatikerin, Diplom-<br />
Wirtschaftsinformatiker<br />
– Studiengang Wirtschaftsinformatik –
Besondere Fachrichtung des<br />
gehobenen Dienstes (ohne<br />
Schulen und Hochschulen)<br />
11.Technischer<br />
Futtermittelkontrolldienst<br />
Einschlägige Ausbildung (Fachhochschulstudiengänge) mit<br />
Abschlussbezeichnung – Sonderregelungen nach § 53 Abs. 3<br />
Satz 4 in Klammern –<br />
Diplom-Ingenieurin (FH), Diplom-Ingenieur (FH),<br />
– Studiengänge Landwirtschaft, Agrarwirtschaft,<br />
Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelwirtschaft,<br />
Lebensmitteltechnik, Ernährungswissenschaft,<br />
Ernährungswirtschaft, Ernährungs- und<br />
Versorgungsmanagement –<br />
– Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH), Diplom-<br />
Wirtschaftsingenieur (FH),<br />
– Studiengänge Lebensmittelwirtschaft, Agrarwirtschaft,<br />
Agrarmarketing und Agrarmanagement –
Anlage 3<br />
(zu § 53)<br />
Höherer Dienst<br />
Besondere Fachrichtungen im höheren Berufe bzw. Berufsabschlussbezeichnungen –<br />
Dienst (ohne Schulen und Hochschulen) Sonderregelungen nach § 53 Abs. 3 Satz 4 in<br />
Klammern –<br />
1.Ärztlicher Dienst – ohne<br />
Gesundheitsämter und Regierungen<br />
Ärztin, Arzt<br />
(Die Dauer der hauptberuflichen Tätigkeit beträgt in<br />
jedem Fall drei Jahre. Für die hauptberufliche Tätigkeit<br />
rechnet die Zeit nach der Approbation oder nach der<br />
Erteilung der Erlaubnis nach § 10 BÄO außer im Fall<br />
des § 10 Abs. 5 BÄO.)<br />
2.Dienst als Biologin oder Biologe Diplom-Biologin Univ., Diplom-Biologe Univ.<br />
3.Dienst als Chemikerin oder Chemiker<br />
– auch in den Fachrichtungen<br />
Physikalische Chemie, Bio- und<br />
Geochemie<br />
4.Gartenbaulicher Dienst<br />
– ohne Geschäftsbereich des<br />
Staatsministeriums für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Forsten<br />
5.Dienst als Lebensmittelchemikerin<br />
oder Lebensmittelchemiker<br />
6.Dienst als Mathematikerin oder<br />
Mathematiker<br />
Diplom-Chemikerin Univ., Diplom-Chemiker Univ.<br />
Diplom-Ingenieurin Univ., Diplom-Ingenieur Univ<br />
– Studiengang Chemie-Ingenieurwesen –<br />
Diplom-Agraringenieurin Univ., Diplom-Agraringenieur<br />
Univ.<br />
– Studiengang Gartenbauwissenschaften –<br />
Staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin, Staatlich<br />
geprüfter Lebensmittelchemiker<br />
(Die zusätzlich vorgeschriebene Ausbildung rechnet<br />
als hauptberufliche Tätigkeit.)<br />
Diplom-Mathematikerin Univ., Diplom-Mathematiker<br />
Univ.<br />
Diplom-Informatikerin Univ., Diplom-Informatiker<br />
Univ.<br />
7.Pharmazeutischer Dienst Apothekerin, Apotheker<br />
8.Dienst als Physikerin oder Physiker Diplom-Physikerin Univ., Diplom-Physiker Univ.<br />
– auch in der Fachrichtung Geophysik<br />
und Biophysik –<br />
9.Dienst als Psychologin oder<br />
Diplom-Psychologin Univ., Diplom-Psychologe Univ.<br />
Psychologe<br />
10.Dienst als Geologin oder Geologe Diplom-Geologin Univ., Diplom-Geologe Univ.<br />
11.Dienst im Umweltschutz und in der Diplom-Ingenieurin Univ., Diplom-Ingenieur Univ.<br />
Umweltgestaltung in fachspezifischen – Studiengang Landespflege –<br />
Aufgaben<br />
Diplom-Geographin Univ., Diplom-Geograph Univ.<br />
Diplom-Agraringenieurin Univ., Diplom-Agraringenieur<br />
Univ.<br />
12.Wirtschaftsverwaltungsdienst a)im Diplom-Ökonomin Univ., Diplom-Ökonom Univ.<br />
Geschäftsbereich des<br />
Diplom-Kauffrau Univ., Diplom-Kaufmann Univ.<br />
Staatsministeriums für Wirtschaft, Diplom-Volkswirtin Univ., Diplom-Volkswirt Univ.<br />
Infrastruktur, Verkehr und Technologie Diplom-Wirtschaftsingenieurin Univ., Diplom-<br />
Wirtschaftsingenieur Univ.<br />
b)in den übrigen Verwaltungen nur in Diplom-Geopraphin Univ., Diplom-Geograph Univ.<br />
den Bereichen mit fachspezifischen<br />
Aufgaben
Besondere Fachrichtungen im höheren Berufe bzw. Berufsabschlussbezeichnungen –<br />
Dienst (ohne Schulen und Hochschulen) Sonderregelungen nach § 53 Abs. 3 Satz 4 in<br />
Klammern –<br />
13.Dienst bei den Museen und<br />
Sammlungen, beim Bayerischen<br />
Landesamt für Denkmalpflege sowie in<br />
der Bayerischen Verwaltung der<br />
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen<br />
14.Technischer Dienst im Bereich der<br />
Informationstechniken<br />
15.Dienst als Statistikerin oder<br />
Statistiker<br />
16.Dienst als Lebensmitteltechnologin<br />
oder Lebensmitteltechnologe<br />
Ägyptologin, Ägyptologe<br />
Altertumskundlerin, Altertumskundler<br />
Amerikanistikerin, Amerikanistiker<br />
Archäologin, Archäologe<br />
Ethnologin, Ethnologe<br />
Historikerin, Historiker<br />
Indologin, Indologe<br />
Kulturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftler<br />
Kunsthistorikerin, Kunsthistoriker<br />
Musikwissenschaftlerin, Musikwissenschaftler<br />
Prähistorikerin, Prähistoriker<br />
Sinologin, Sinologe<br />
Theaterwissenschaftlerin und Volkskundlerin,<br />
Theaterwissenschaftler und Volkskundler<br />
(jeweils mit abgeschlossener Doktorprüfung)<br />
Diplom-Biologin Univ., Diplom-Biologe Univ.<br />
Diplom-Chemikerin Univ., Diplom-Chemiker Univ.<br />
Diplom-Geologin Univ., Diplom-Geologe Univ.<br />
Diplom-Geophysikerin Univ., Diplom-Geophysiker<br />
Univ.<br />
Diplom-Ingenieurin Univ., Diplom-Ingenieur Univ.<br />
– Studiengang Architektur, Bergbau, Elektrotechnik,<br />
Maschinenbau, Technische Physik –<br />
Diplom-Mineralogin, Diplom-Mineraloge<br />
Diplom-Physikerin, Diplom-Physiker<br />
Diplom-Restauratorin Univ., Diplom-Restaurator Univ.<br />
(Auf die hauptberufliche Tätigkeit nach § 53 Abs. 2<br />
Nr. 2 kann angerechnet werden eine Tätigkeit als<br />
1.Volontärin oder Volontär an öffentlichen Museen und<br />
Sammlungen sowie beim Landesamt für<br />
Denkmalpflege,2.Wissenschaftliche<br />
Assistentin/Wissenschaftlicher Assistent oder<br />
Hochschulassistentin/Hochschulassistent an einer<br />
wissenschaftlichen Hochschule sowie als Akademische<br />
Rätin/Akademischer Rat oder Akademische<br />
Oberrätin/Akademischer Oberrat im<br />
Beamtenverhältnis auf Zeit,3.Stipendiatin/Stipendiat<br />
der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder anderer<br />
wissenschaftlicher Organisationen)<br />
Diplom-Mathematikerin Univ., Diplom-Mathematiker<br />
Univ.<br />
Diplom-Informatikerin Univ., Diplom-Informatiker<br />
Univ.<br />
Diplom-Ingenieurin Univ., Diplom-Ingenieur Univ.<br />
– Studiengang Elektrotechnik, Schwerpunkt<br />
Nachrichtentechnik –<br />
Diplom-Wirtschaftsinformatikerin Univ., Diplom-<br />
Wirtschaftsinformatiker Univ.<br />
Diplom-Statistikerin Univ., Diplom-Statistiker Univ.<br />
Diplom-Ingenieurin Univ., Diplom-Ingenieur Univ.<br />
– Studiengang Lebensmitteltechnologie –
Landkreisordnung für den Freistaat<br />
Bayern (Bay LKrO)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 26. März 1999 (GVBl. S. 86), vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 542), vom 28. März 2000<br />
(GVBl. S. 136), vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 962), vom<br />
26. Juli 2004 (GVBl. S. 272), vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 659), vom 24. Dezember 2005<br />
(GVBl. S. 665), vom 26. Juli 2006 (GVBl. S. 405), vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 975), vom 22.<br />
Juli 2008 (GVBl. S. 461), vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 400) (FN BayRS 2020-3-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Wesen und Aufgaben des Landkreises<br />
1. ABSCHNITT Begriff; Benennung und Hoheitszeichen<br />
Art. 1 Begriff<br />
Art. 2 Name; Sitz der Kreisverwaltung<br />
Art. 3 Wappen und Fahnen; Dienstsiegel<br />
2. ABSCHNITT Wirkungskreis<br />
Art. 4 Wirkungskreis im allgemeinen<br />
Art. 5 Eigene Angelegenheiten<br />
Art. 6 Übertragene Angelegenheiten<br />
3. ABSCHNITT Kreisgebiet<br />
Art. 7 Gebietsumfang<br />
Art. 8 Änderungen und Zuständigkeit<br />
Art. 9 Folgen der Änderungen<br />
Art. 10 Bekanntmachung; Gebühren<br />
4. ABSCHNITT Kreisangehörige<br />
Art. 11 Kreiseinwohner und Kreisbürger<br />
Art. 12 Wahlrecht
Art. 12 a Bürgerbegehren und Bürgerentscheid<br />
Art. 12 b Bürgerantrag<br />
Art. 13 Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
Art. 14 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht<br />
Art. 14 a Entschädigung<br />
Art. 15 Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der Kreislasten<br />
5. ABSCHNITT Kreishoheit<br />
Art. 16 Umfang der Kreishoheit<br />
Art. 17 Kreisrecht<br />
Art. 18 Inhalt der Satzungen<br />
Artikel 19<br />
Art. 20 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung<br />
Art. 21 Verwaltungsverfügungen, Zwangsmaßnahmen<br />
ZWEITER TEIL Verfassung und Verwaltung des Landkreises<br />
1. ABSCHNITT Kreisorgane und ihre Hilfskräfte<br />
Art. 22 Hauptorgane<br />
Art. 23 Rechtsstellung, Aufgaben des Kreistags<br />
Art. 24 Zusammensetzung des Kreistags<br />
Art. 25 Einberufung des Kreistags<br />
Art. 26 Aufgaben des Kreisausschusses<br />
Art. 27 Zusammensetzung<br />
Art. 28 Einberufung<br />
Art. 29 Weitere Ausschüsse
Art. 30 Dem Kreistag vorbehaltene Angelegenheiten<br />
Art. 31 Der Landrat<br />
Art. 32 Der gewählte Stellvertreter des Landrats<br />
Art. 33 Vorsitz im Kreistag; Vollzug der Beschlüsse<br />
Art. 34 Zuständigkeit des Landrats<br />
Art. 35 Vertretung des Landkreises nach außen; Verpflichtungsgeschäfte<br />
Art. 36 Weitere Stellvertreter des Landrats<br />
Art. 37 Landratsamt<br />
Art. 38 Kreisbedienstete<br />
Art. 39 Stellenplan<br />
2. ABSCHNITT Geschäftsgang<br />
Art. 40 Geschäftsordnung<br />
Art. 41 Sitzungszwang; Beschlußfähigkeit<br />
Art. 42 Teilnahme- und Abstimmungspflicht; Ordnungsgeld gegen Säumige<br />
Art. 43 Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung<br />
Art. 44 Einschränkung des Vertretungsrechts<br />
Art. 45 Form der Beschlußfassung; Wahlen<br />
Art. 46 Öffentlichkeit<br />
Art. 47 Handhabung der Ordnung<br />
Art. 48 Niederschrift<br />
Art. 49 Geschäftsgang der Ausschüsse<br />
3. ABSCHNITT Verwaltungsgrundsätze und Verwaltungsaufgaben<br />
Art. 50 Gesetzmäßigkeit; Unparteilichkeit
Art. 50 a Geheimhaltung<br />
Art. 51 Aufgaben des eigenen Wirkungskreises<br />
Art. 52 Übernahme von Gemeindeaufgaben<br />
Art. 53 Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br />
Art. 54 Zuständigkeit für den <strong>Gesetze</strong>svollzug<br />
DRITTER TEIL Landkreiswirtschaft<br />
1. ABSCHNITT Haushaltswirtschaft<br />
Art. 55 Allgemeine Haushaltsgrundsätze<br />
Art. 56 Grundsätze der Einnahmebeschaffung<br />
Art. 57 Haushaltssatzung<br />
Art. 58 Haushaltsplan<br />
Art. 59 Erlaß der Haushaltssatzung<br />
Art. 60 Planabweichungen<br />
Art. 61 Verpflichtungsermächtigungen<br />
Art. 62 Nachtragshaushaltssatzungen<br />
Art. 63 Vorläufige Haushaltsführung<br />
Art. 64 Mittelfristige Finanzplanung<br />
2. ABSCHNITT Kreditwesen<br />
Art. 65 Kredite<br />
Art. 66 Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten<br />
Art. 67 Kassenkredite<br />
3. ABSCHNITT Vermögenswirtschaft<br />
Art. 68 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze
Art. 69 Veräußerung von Vermögen<br />
Art. 70 Rücklagen, Rückstellungen<br />
Art. 71 Zwangsvollstreckung in Landkreisvermögen wegen einer<br />
Geldforderung<br />
Art. 72 Begriff; Verwaltung<br />
Art. 73 Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebungder Zweckbestimmung<br />
4. ABSCHNITT Unternehmen des Landkreises<br />
Art. 74 Rechtsformen<br />
Art. 75 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen<br />
Art. 76 Eigenbetriebe<br />
Art. 77 Selbständige Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts<br />
Art. 78 Organe des Kommunalunternehmens, Personal<br />
Art. 79 Sonstige Vorschriften für Kommunalunternehmen<br />
Art. 80 Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 81 Vertretung des Landkreises in Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 82 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in Privatrechtsform<br />
Art. 83 Grundsätze für die Führung von Unternehmen des Landkreises<br />
Art. 84 Anzeigepflichten<br />
Artikel 85<br />
5. ABSCHNITT Kassen- und Rechnungswesen<br />
Art. 86 Kreiskasse<br />
Art. 87 Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften<br />
Art. 88 Rechnungslegung, Jahresabschluss
Art. 88 a Konsolidierter Jahresabschluss<br />
6. ABSCHNITT Prüfungswesen<br />
Art. 89 Örtliche Prüfungen<br />
Art. 90 Rechnungsprüfungsamt<br />
Art. 91 Überörtliche Prüfungen<br />
Art. 92 Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen<br />
Art. 93 Abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen<br />
VIERTER TEIL Staatliche Aufsicht und Rechtsmittel<br />
1. ABSCHNITT Rechtsaufsicht und Fachaufsicht<br />
Art. 94 Sinn der staatlichen Aufsicht<br />
Art. 95 Inhalt und Grenzen der Aufsicht<br />
Art. 96 Rechtsaufsichtsbehörden<br />
Art. 97 Informationsrecht<br />
Art. 98 Beanstandungsrecht<br />
Art. 99 Recht der Ersatzvornahme<br />
Art. 100 Bestellung eines Beauftragten<br />
Art. 101 Fachaufsichtsbehörden<br />
Art. 102 Befugnisse der Fachaufsicht<br />
Art. 103 Genehmigungsbehörde<br />
Art. 103 a Ausnahmegenehmigungen<br />
2. ABSCHNITT Rechtsmittel<br />
Artikel 104
Art. 105 Erlaß des Widerspruchsbescheids (§ 73 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)<br />
Artikel 106<br />
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 107 Einwohnerzahl<br />
Art. 108 Inkrafttreten<br />
Art. 109 Ausführungsvorschriften<br />
Art. 110 Einschränkung von Grundrechten<br />
ERSTER TEIL Wesen und Aufgaben des Landkreises<br />
1. ABSCHNITT Begriff; Benennung und Hoheitszeichen<br />
Bay LKrO Art. 1 Begriff<br />
1 Die Landkreise sind Gebietskörperschaften mit dem Recht, überörtliche<br />
Angelegenheiten, deren Bedeutung über das Kreisgebiet nicht hinausgeht, im<br />
Rahmen der <strong>Gesetze</strong> zu ordnen und zu verwalten. 2 Ihr Gebiet bildet zugleich<br />
den Bereich der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.<br />
Bay LKrO Art. 2 Name; Sitz der Kreisverwaltung<br />
1 Der Sitz der Kreisverwaltung und der Name des Landkreises werden nach<br />
Anhörung des Kreistags mit Zustimmung des Landtags durch<br />
Rechtsverordnung der Staatsregierung bestimmt. 2 Namensänderungen, die<br />
nur die Schreibweise betreffen, bedürfen nicht der Zustimmung des Landtags.<br />
Bay LKrO Art. 3 Wappen und Fahnen; Dienstsiegel<br />
(1) 1 Die Landkreise können ihre geschichtlichen Wappen und Fahnen führen.<br />
2<br />
Sie sind verpflichtet, sich bei der Änderung bestehender und der<br />
Annahme neuer Wappen und Fahnen von der Generaldirektion der<br />
Staatlichen Archive Bayerns beraten zu lassen und, soweit sie deren<br />
Stellungnahme nicht folgen wollen, den Entwurf der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.<br />
(2) 1 Landkreise mit eigenem Wappen führen dieses in ihrem Dienstsiegel.<br />
2<br />
Die übrigen Landkreise führen in ihrem Dienstsiegel das kleine<br />
Staatswappen.<br />
(3) Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen des Landkreises nur mit dessen<br />
Genehmigung verwendet werden.
2. ABSCHNITT Wirkungskreis<br />
Bay LKrO Art. 4 Wirkungskreis im allgemeinen<br />
(1) Den Landkreisen steht die Erfüllung der auf das Kreisgebiet beschränkten<br />
öffentlichen Aufgaben zu, die über die Zuständigkeit oder das<br />
Leistungsvermögen der kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen, soweit<br />
es sich nicht um Staatsaufgaben handelt.<br />
(2) Die Aufgaben der Landkreise sind eigene oder übertragene<br />
Angelegenheiten.<br />
Bay LKrO Art. 5 Eigene Angelegenheiten<br />
(1) Der eigene Wirkungskreis der Landkreise umfaßt die Angelegenheiten der<br />
durch das Kreisgebiet begrenzten überörtlichen Gemeinschaft.<br />
(2) 1 In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises handeln die Landkreise<br />
nach eigenem Ermessen. 2 Sie sind nur an die gesetzlichen Vorschriften<br />
gebunden.<br />
Bay LKrO Art. 6 Übertragene Angelegenheiten<br />
(1) Der übertragene Wirkungskreis der Landkreise umfaßt die staatlichen<br />
Aufgaben, die das Gesetz den Landkreisen zur Besorgung im Auftrag des<br />
Staates zuweist.<br />
(2) Für die Erledigung übertragener Angelegenheiten können die zuständigen<br />
Staatsbehörden den Landkreisen Weisungen erteilen.<br />
(3) 1 Den Landkreisen können Angelegenheiten auch zur selbständigen<br />
Besorgung übertragen werden. 2 Art. 5 Abs. 2 ist hierbei sinngemäß<br />
anzuwenden.<br />
(4) Bei der Zuweisung von Angelegenheiten sind gleichzeitig die notwendigen<br />
Mittel zur Verfügung zu stellen.<br />
3. ABSCHNITT Kreisgebiet<br />
Bay LKrO Art. 7 Gebietsumfang<br />
Die Gesamtfläche der dem Landkreis zugeteilten Gemeinden und<br />
gemeindefreien Gebiete bildet das Kreisgebiet.<br />
Bay LKrO Art. 8 Änderungen und Zuständigkeit<br />
(1) 1 Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Landkreise in ihrem Bestand<br />
oder Gebiet geändert werden. 2 Änderungen im Gebiet müssen<br />
insbesondere auf die Leistungsfähigkeit der beteiligten Landkreise<br />
Rücksicht nehmen. 3 Art. 5 Abs. 3 und Art. 5 a Abs. 1 der<br />
Gemeindeordnung (GO) bleiben unberührt.<br />
(2) Änderungen im Bestand von Landkreisen werden mit Zustimmung des<br />
Landtags durch Rechtsverordnung der Staatsregierung vorgenommen.<br />
(3) 1 Änderungen im Gebiet von Landkreisen werden mit Zustimmung des<br />
Landtags durch Rechtsverordnung der Staatsregierung vorgenommen,<br />
wenn mindestens eine ganze Gemeinde oder ein ganzes gemeindefreies
Gebiet umgegliedert wird. 2 Sonstige Gebietsänderungen werden durch<br />
Rechtsverordnung der Regierung, wenn sie mit einer Änderung im Gebiet<br />
von Bezirken verbunden sind, durch Rechtsverordnung des<br />
Staatsministeriums des Innern vorgenommen.<br />
(4) Im Verfahren nach Absatz 2 oder 3 können Änderungen nach Art. 11 GO,<br />
die mit Änderungen im Bestand oder Gebiet von Landkreisen rechtlich<br />
oder sachlich zusammenhängen, miterledigt werden, soweit die<br />
Änderungen gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GO durch Rechtsverordnung<br />
vorgenommen werden können.<br />
(5) 1 Vor der Änderung sind die beteiligten Landkreise sowie die Gemeinden<br />
und die Eigentümer der gemeindefreien Grundstücke im Änderungsgebiet<br />
zu hören. 2 Den Kreisbürgern, deren Kreiszugehörigkeit wechselt, soll<br />
Gelegenheit gegeben werden, zu der Änderung in geheimer Abstimmung<br />
Stellung zu nehmen.<br />
Bay LKrO Art. 9 Folgen der Änderungen<br />
(1) 1 Bei Änderungen im Bestand von Landkreisen ist die Fortgeltung von<br />
Kreisrecht in der Rechtsverordnung gemäß Art. 8 Abs. 2 zu regeln. 2 Bei<br />
Gebietsänderungen erstreckt sich das Recht des aufnehmenden<br />
Landkreises auf das aufgenommene Gebiet, wenn nicht in der Vorschrift<br />
über die Gebietsänderung etwas Abweichendes bestimmt ist. 3 Satz 2 gilt<br />
entsprechend für das Recht der durch die Änderung betroffenen<br />
Gemeinden.<br />
(2) 1 Soweit nicht das Staatsministerium des Innern gemäß Art. 9 Abs. 2 der<br />
Bezirksordnung zuständig ist, regelt die Regierung die mit der Änderung<br />
zusammenhängenden weiteren Rechts- und Verwaltungsfragen. 2 Sie kann<br />
insbesondere eine Neuwahl oder Ergänzung des Kreistags für den Rest der<br />
Wahlzeit anordnen. 3 Die Regierung trifft auch entsprechende Regelungen<br />
für die durch die Änderung betroffenen Gemeinden oder kann damit für<br />
kreisangehörige Gemeinden die Landratsämter beauftragen.<br />
(3) 1 Bei Änderungen im Gebiet werden die vermögensrechtlichen Verhältnisse<br />
durch Übereinkunft der beteiligten Landkreise und kreisfreien Gemeinden<br />
geregelt. 2 Der Übereinkunft kommt in dem in ihr bestimmten Zeitpunkt,<br />
frühestens jedoch mit Rechtswirksamkeit der Änderung, unmittelbar<br />
rechtsbegründende Wirkung zu. 3 Kommt eine Übereinkunft nicht<br />
zustande, so entscheiden das Verwaltungsgericht und in der<br />
Berufungsinstanz der Verwaltungsgerichtshof als Schiedsgerichte.<br />
(4) 1 Bei Änderungen im Bestand wird in der Rechtsverordnung nach Art. 8<br />
Abs. 2 ein Landkreis als Gesamtrechtsnachfolger bestimmt. 2 Die<br />
Bestimmung hat unmittelbar rechtsbegründende Wirkung. 3 Wird das<br />
Gebiet eines Landkreises auf mehrere Landkreise oder kreisfreie<br />
Gemeinden aufgeteilt, so findet zwischen dem Gesamtrechtsnachfolger<br />
und den anderen Landkreisen oder kreisfreien Gemeinden, denen Gebiet<br />
des aufgeteilten Landkreises zugeteilt wurde, eine Auseinandersetzung<br />
nach besonderen gesetzlichen Vorschriften statt.<br />
(5) Soweit der Aufenthalt Voraussetzung für Rechte und Pflichten ist, gilt der<br />
vor der Änderung liegende Aufenthalt im Änderungsgebiet als Aufenthalt<br />
im neuen Landkreis.
Bay LKrO Art. 10 Bekanntmachung; Gebühren<br />
(1) Rechtsverordnungen der Regierung nach Art. 8 Abs. 3 Satz 2 und nach<br />
Art. 9 Abs. 1 Satz 1 sind im Amtsblatt der Regierung bekanntzumachen.<br />
(2) Für Änderungen nach Art. 8 und Rechtshandlungen, die aus Anlaß solcher<br />
Änderungen erforderlich sind, werden landesrechtlich geregelte Abgaben<br />
nicht erhoben.<br />
4. ABSCHNITT Kreisangehörige<br />
Bay LKrO Art. 11 Kreiseinwohner und Kreisbürger<br />
(1) 1 Kreisangehörige sind alle Kreiseinwohner. 2 Sie haben gegenüber dem<br />
Landkreis die gleichen Rechte und Pflichten. 3 Ausnahmen bedürfen eines<br />
besonderen Rechtstitels.<br />
(2) Kreisbürger sind alle Kreisangehörigen, die das Wahlrecht für die<br />
Kreiswahlen besitzen.<br />
Bay LKrO Art. 12 Wahlrecht<br />
Die Kreisbürger wählen den Kreistag und den Landrat.<br />
Bay LKrO Art. 12 a Bürgerbegehren und Bürgerentscheid<br />
(1) Die Kreisbürger können über Angelegenheiten des eigenen<br />
Wirkungskreises des Landkreises einen Bürgerentscheid beantragen<br />
(Bürgerbegehren).<br />
(2) Der Kreistag kann beschließen, daß über eine Angelegenheit des eigenen<br />
Wirkungskreises des Landkreises ein Bürgerentscheid stattfindet.<br />
(3) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über Angelegenheiten, die kraft<br />
Gesetz dem Landrat obliegen, über Fragen der inneren Organisation der<br />
Kreisverwaltung, über die Rechtsverhältnisse der Kreisräte, des Landrats<br />
und der Kreisbediensteten und über die Haushaltssatzung.<br />
(4) 1 Das Bürgerbegehren muss beim Landkreis eingereicht werden und eine<br />
mit Ja oder Nein zu entscheidende Fragestellung und eine Begründung<br />
enthalten sowie bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die<br />
Unterzeichnenden zu vertreten. 2 Für den Fall ihrer Verhinderung oder<br />
ihres Ausscheidens können auf den Unterschriftenlisten zusätzlich<br />
stellvertretende Personen benannt werden.<br />
(5) 1 Das Bürgerbegehren kann nur von Personen unterzeichnet werden, die<br />
am Tage der Einreichung des Bürgerbegehrens Kreisbürger sind. 2 Für die<br />
Feststellung der Zahl der gültigen Unterschriften sind die von den<br />
Gemeinden zum <strong>Stand</strong> dieses Tages anzulegenden Bürgerverzeichnisse<br />
maßgebend. 3 Die Unterschriften für ein Bürgerbegehren müssen getrennt<br />
nach Gemeinden gesammelt werden. 4 Enthält eine Liste auch<br />
Unterschriften von Kreisbürgern aus einer anderen Gemeinde, sind diese<br />
Unterschriften ungültig.<br />
(6) Ein Bürgerbegehren muss in Landkreisen bis zu 100 000 Einwohnern von<br />
mindestens 6 v. H., im übrigen von mindestens 5 v. H. der Kreisbürger<br />
unterschrieben sein.
(7) 1 Ist eine kreisangehörige Gemeinde von einer Maßnahme des Landkreises<br />
besonders betroffen, so kann ein Bürgerentscheid über diese Maßnahme<br />
auch von den Bürgern dieser Gemeinde beantragt werden. 2 Dieses<br />
Bürgerbegehren muß von mindestens 25 vom Hundert der<br />
Gemeindebürger unterzeichnet sein. 3 Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5<br />
finden entsprechend Anwendung.<br />
(8) 1 Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der Kreistag<br />
unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung des<br />
Bürgerbegehrens. 2 Gegen die Entscheidung können die<br />
vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens ohne<br />
Vorverfahren Klage erheben.<br />
(9) Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur<br />
Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren<br />
entgegenstehende Entscheidung der Kreisorgane nicht mehr getroffen<br />
oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen<br />
werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche<br />
Verpflichtungen des Landkreises hierzu bestanden.<br />
(10) 1 Der Bürgerentscheid ist an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten<br />
nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens<br />
durchzuführen; der Kreistag kann die Frist im Einvernehmen mit den<br />
vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens um höchstens<br />
drei Monate verlängern. 2 Die Kosten des Bürgerentscheids trägt der<br />
Landkreis. 3 Stimmberechtigt ist jeder Kreisbürger. 4 Die Möglichkeit der<br />
brieflichen Abstimmung ist zu gewährleisten.<br />
(11) 1 Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinn<br />
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der abgegebenen gültigen<br />
Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit in Landkreisen<br />
bis zu 100 000 Einwohnern mindestens 15 v. H.,<br />
mit mehr als 100 000 Einwohnern mindestens 10 v. H.<br />
der Stimmberechtigten beträgt. 2 Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als<br />
mit Nein beantwortet. 3 Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide<br />
stattfinden, hat der Kreistag eine Stichfrage für den Fall zu beschließen,<br />
dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer<br />
miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden<br />
(Stichentscheid). 4 Es gilt dann diejenige Entscheidung, für die sich im<br />
Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen<br />
ausspricht. 5 Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der<br />
Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl<br />
mehrheitlich beantwortet worden ist.<br />
(12) 1 Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses des Kreistages.<br />
2<br />
Der Bürgerentscheid kann innerhalb eines Jahres nur durch einen neuen<br />
Bürgerentscheid abgeändert werden, es sei denn, dass sich die dem<br />
Bürgerentscheid zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage wesentlich<br />
geändert hat.<br />
(13) 1 Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Kreistag die Durchführung der<br />
mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. 2 Für einen<br />
Beschluss nach Satz 1 gilt die Bindungswirkung des Absatzes 12 Satz 2<br />
entsprechend.
(14) 1 Die im Kreistag und die von den vertretungsberechtigten Personen des<br />
Bürgerbegehrens vertretenen Auffassungen zum Gegenstand des<br />
Bürgerentscheids dürfen in Veröffentlichungen und Veranstaltungen des<br />
Landkreises nur in gleichem Umfang dargestellt werden. 2 Zur Information<br />
der Bürgerinnen und Bürger werden vom Landkreis den Beteiligten die<br />
gleichen Möglichkeiten wie bei Kreistagswahlen eröffnet.<br />
(15) Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist im Landkreis in der ortsüblichen<br />
Weise bekanntzumachen.<br />
(16) 1 Die Gemeinden wirken im erforderlichen Umfang bei der Überprüfung<br />
von Bürgerbegehren und bei der Durchführung von Bürgerentscheiden<br />
mit. 2 Der Landkreis erstattet den Gemeinden die dadurch entstehenden<br />
besonderen Aufwendungen.<br />
(17) 1 Die Landkreise können das Nähere durch Satzung regeln. 2 Das Recht auf<br />
freies Unterschriftensammeln darf nicht eingeschränkt werden.<br />
(18) Art. 3 a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine<br />
Anwendung.<br />
Bay LKrO Art. 12 b Bürgerantrag<br />
(1) 1 Die Kreisbürger können beantragen, dass das zuständige Kreisorgan eine<br />
Kreisangelegenheit behandelt (Bürgerantrag). 2 Ein Bürgerantrag darf<br />
nicht Angelegenheiten zum Gegenstand haben, für die innerhalb eines<br />
Jahres vor Antragseinreichung bereits ein Bürgerantrag gestellt worden<br />
ist.<br />
(2) 1 Der Bürgerantrag muss beim Landkreis eingereicht werden, eine<br />
Begründung enthalten und bis zu drei Personen benennen, die berechtigt<br />
sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. 2 Für den Fall ihrer Verhinderung<br />
oder ihres Ausscheidens können auf den Unterschriftenlisten zusätzlich<br />
stellvertretende Personen benannt werden.<br />
(3) 1 Der Bürgerantrag muss von mindestens 1 v. H. der Kreiseinwohner<br />
unterschrieben sein. 2 Unterschriftsberechtigt sind die Kreisbürger.<br />
(4) Über die Zulässigkeit eines Bürgerantrags entscheidet das für die<br />
Behandlung der Angelegenheit zuständige Kreisorgan innerhalb eines<br />
Monats seit der Einreichung des Bürgerantrags.<br />
(5) Ist die Zulässigkeit des Bürgerantrags festgestellt, hat ihn das zuständige<br />
Kreisorgan innerhalb von drei Monaten zu behandeln.<br />
(6) Art. 3 a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine<br />
Anwendung.<br />
Bay LKrO Art. 13 Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
(1) 1 Die Kreisbürger sind zur Übernahme von Ehrenämtern des Landkreises<br />
verpflichtet. 2 Sie können nur aus wichtigem Grund die Übernahme von<br />
Ehrenämtern ablehnen oder ein Ehrenamt niederlegen. 3 Als wichtiger<br />
Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der Verpflichtete die Tätigkeit<br />
nicht ordnungsgemäß ausüben kann. 4 Wer ohne wichtigen Grund die<br />
Übernahme eines Ehrenamts ablehnt oder ein Ehrenamt niederlegt, kann<br />
mit Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro belegt werden.
(2) 1 Ehrenamtlich tätige Personen können von der Stelle, die sie berufen hat,<br />
abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2 Ein solcher liegt<br />
auch dann vor, wenn die ehrenamtlich tätige Person ihre Pflichten gröblich<br />
verletzt oder sich als unwürdig erwiesen hat.<br />
(3) Die besonderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.<br />
Bay LKrO Art. 14 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht<br />
(1) Ehrenamtlich tätige Kreisbürger sind verpflichtet, ihre Obliegenheiten<br />
gewissenhaft wahrzunehmen.<br />
(2) 1 Sie haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit<br />
bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren; das<br />
gilt nicht für Mitteilungen im amtlichen Verkehr oder über Tatsachen, die<br />
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung<br />
bedürfen. 2 Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheimzuhaltenden<br />
Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. 3 Sie haben auf Verlangen des<br />
Kreistags amtliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen und<br />
Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge herauszugeben, auch<br />
soweit es sich um Wiedergaben handelt. 4 Diese Verpflichtungen bestehen<br />
auch nach Beendigung des Ehrenamts fort. 5 Die Herausgabepflicht trifft<br />
auch die Hinterbliebenen und Erben.<br />
(3) 1 Ehrenamtlich tätige Kreisbürger dürfen ohne Genehmigung über<br />
Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu bewahren haben,<br />
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen<br />
abgeben. 2 Die Genehmigung erteilt der Landrat. 3 Über die Versagung der<br />
Genehmigung, als Zeuge auszusagen, entscheidet die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde; im übrigen gelten Art. 84 Abs. 3 und 4 des<br />
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.<br />
(4) 1 Wer den Verpflichtungen der Absätze 1, 2 oder 3 Satz 1 schuldhaft<br />
zuwiderhandelt, kann im Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu<br />
zweihundertfünfzig Euro, bei unbefugter Offenbarung personenbezogener<br />
Daten bis zu fünfhundert Euro, belegt werden; die Verantwortlichkeit nach<br />
anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. 2 Die Haftung<br />
gegenüber dem Landkreis richtet sich nach den für den Landrat geltenden<br />
Vorschriften und tritt nur ein, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur<br />
Last liegt. 3 Der Landkreis stellt die Verantwortlichen von der Haftung frei,<br />
wenn sie von Dritten unmittelbar in Anspruch genommen werden und der<br />
Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden ist.<br />
(5) Für den gewählten Stellvertreter des Landrats gelten die besonderen<br />
gesetzlichen Vorschriften.<br />
Bay LKrO Art. 14 a Entschädigung<br />
(1) 1 Ehrenamtlich tätige Bürger des Landkreises haben Anspruch auf<br />
angemessene Entschädigung. 2 Das Nähere wird durch Satzung bestimmt.<br />
3 4<br />
Auf die Entschädigung kann nicht verzichtet werden. Der Anspruch ist<br />
nicht übertragbar.<br />
(2) Ehrenamtlich tätige Kreisbürger erhalten ferner für die nach Maßgabe<br />
näherer Bestimmung in der Satzung zur Wahrnehmung des Ehrenamts<br />
notwendige Teilnahme an Sitzungen und Besprechungen oder anderen
Veranstaltungen folgende Ersatzleistungen:<br />
1. Angestellten und Arbeitern wird der ihnen entstandene nachgewiesene<br />
Verdienstausfall ersetzt.<br />
2. Selbständig Tätige können für die ihnen entstehende Zeitversäumnis<br />
eine Verdienstausfallentschädigung erhalten. Die Entschädigung wird auf<br />
der Grundlage eines satzungsmäßig festgelegten Pauschalsatzes gewährt.<br />
Wegezeiten können in angemessenem Umfang berücksichtigt werden.<br />
3. Personen, die keine Ersatzansprüche nach Nummern 1 und 2 haben,<br />
denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht,<br />
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die<br />
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, können eine<br />
Entschädigung erhalten. Die Entschädigung wird auf der Grundlage eines<br />
satzungsmäßig festgelegten Pauschalsatzes gewährt. Der Pauschalsatz<br />
darf nicht höher sein als der Pauschalsatz nach Nummer 2. Wegezeiten<br />
können in angemessenem Umfang berücksichtigt werden.<br />
(3) 1 Vergütungen für Tätigkeiten, die ehrenamtlich tätige Kreisbürger kraft<br />
Amtes oder auf Vorschlag oder Veranlassung des Landkreises in einem<br />
Aufsichtsrat, Vorstand oder sonstigen Organ oder Gremium eines<br />
privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmens<br />
wahrnehmen, sind an den Landkreis abzuführen, soweit sie insgesamt<br />
einen Betrag von 4 908 Euro im Kalenderjahr übersteigen. 2 Vom<br />
Landkreis veranlasst sind auch Tätigkeiten, die von einem Unternehmen,<br />
an dem er unmittelbar oder mittelbar ganz oder mehrheitlich beteiligt ist,<br />
einem ehrenamtlich tätigen Kreisbürger übertragen werden. 3 Der Betrag<br />
verdoppelt sich für Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eines<br />
vergleichbaren Organs der in Satz 1 genannten Unternehmen und erhöht<br />
sich für deren Stellvertreter um 50 v. H. 4 Bei der Festsetzung des<br />
abzuführenden Betrags sind von den Vergütungen Aufwendungen<br />
abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich<br />
entstanden sind. 5 Die Ablieferungsregelungen nach dem<br />
beamtenrechtlichen Nebentätigkeitsrecht finden keine Anwendung.<br />
Bay LKrO Art. 15 Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Tragung der<br />
Kreislasten<br />
(1) Alle Kreisangehörigen sind nach den bestehenden allgemeinen<br />
Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen des Landkreises zu<br />
benutzen, und verpflichtet, die Kreislasten zu tragen.<br />
(2) 1 Mehrere technisch selbständige Anlagen des Landkreises, die demselben<br />
Zweck dienen, können eine Einrichtung oder einzelne rechtlich<br />
selbständige Einrichtungen bilden. 2 Der Landkreis entscheidet das durch<br />
Satzung; trifft er keine Regelung, liegt nur eine Einrichtung vor.<br />
(3) Auswärts wohnende Personen haben für ihren Grundbesitz oder ihre<br />
gewerblichen Niederlassungen im Kreisgebiet gegenüber dem Landkreis<br />
die gleichen Rechte und Pflichten wie im Landkreis wohnende<br />
Grundbesitzer und Gewerbetreibende.<br />
(4) Die Vorschriften in den Absätzen 1 und 3 finden auf juristische Personen<br />
und auf Personenvereinigungen entsprechende Anwendung.
(5) Die Benutzung der öffentlichen, dem Gemeingebrauch dienenden<br />
Einrichtungen steht nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften<br />
jedermann zu.<br />
5. ABSCHNITT Kreishoheit<br />
Bay LKrO Art. 16 Umfang der Kreishoheit<br />
(1) Die Hoheitsgewalt des Landkreises umfaßt das Kreisgebiet und seine<br />
gesamte Bevölkerung (Kreishoheit).<br />
(2) 1 Die Landkreise haben das Recht, ihr Finanzwesen im Rahmen der<br />
gesetzlichen Bestimmungen selbst zu regeln. 2 Sie sind insbesondere<br />
befugt, zur Deckung des für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen<br />
Finanzbedarfs Abgaben nach Maßgabe der <strong>Gesetze</strong> zu erheben, soweit<br />
ihre sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. 3 Zu diesem Zweck ist ihnen<br />
das Recht zur Erhebung eigener Steuern und sonstiger Abgaben in<br />
ausreichendem Maß zu gewährleisten.<br />
(3) Der Staat hat den Landkreisen zur Erfüllung ihrer Aufgaben weitere Mittel<br />
im Rahmen des Staatshaushalts zuzuweisen.<br />
Bay LKrO Art. 17 Kreisrecht<br />
1 Die Landkreise können zur Regelung ihrer Angelegenheiten Satzungen<br />
erlassen. 2 Satzungen zur Regelung übertragener Angelegenheiten, bewehrte<br />
Satzungen (Art. 18 Abs. 2) und Verordnungen sind nur in den gesetzlich<br />
bestimmten Fällen zulässig. 3 In solchen Satzungen und in Verordnungen soll<br />
ihre besondere Rechtsgrundlage angegeben werden.<br />
Bay LKrO Art. 18 Inhalt der Satzungen<br />
(1) In den Satzungen können die Landkreise insbesondere<br />
1. die Benutzung ihres Eigentums und ihrer öffentlichen Einrichtungen<br />
regeln,<br />
2. aus Gründen des öffentlichen Wohls, insbesondere zur Abwehr von<br />
Gefahren für die Sicherheit oder Gesundheit der Kreisangehörigen, den<br />
Anschluß- und Benutzungszwang für Einrichtungen des Landkreises<br />
anordnen,<br />
3. bestimmen, daß bei öffentlichen Notständen, insbesondere wenn es die<br />
Sicherheit des Verkehrs erfordert, Hand- und Spanndienste unter<br />
angemessener Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der<br />
Pflichtigen angeordnet werden können.<br />
(2) 1 In den Satzungen kann die Ersatzvornahme auf Kosten säumiger<br />
Verpflichteter für zulässig erklärt werden. 2 In den Fällen des Absatzes 1<br />
Nrn. 1 und 2 können in der Satzung Zuwiderhandlungen als<br />
Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro<br />
bedroht werden (bewehrte Satzung).<br />
(3) In Satzungen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 und in Satzungen, die auf Grund<br />
anderer <strong>Gesetze</strong>, die auf diesen Artikel verweisen, erlassen werden, kann<br />
bestimmt werden, daß die vom Landkreis mit dem Vollzug dieser<br />
Satzungen beauftragten Personen berechtigt sind, zur Überwachung der<br />
Pflichten, die sich nach diesen Satzungen und <strong>Gesetze</strong>n ergeben, zu
angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen,<br />
Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten.<br />
Bay LKrO Artikel 19 (weggefallen)<br />
Bay LKrO Art. 20 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung<br />
(1) 1 Satzungen treten eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2 In<br />
der Satzung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt werden, in bewehrten<br />
Satzungen und anderen Satzungen, die nicht mit rückwirkender Kraft<br />
erlassen werden dürfen, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung<br />
folgende Tag.<br />
(2) Satzungen sind auszufertigen und im Amtsblatt des Landkreises oder des<br />
Landratsamts, sonst im Amtsblatt der Regierung oder des Bezirks oder im<br />
Staatsanzeiger bekanntzumachen.<br />
Bay LKrO Art. 21 Verwaltungsverfügungen, Zwangsmaßnahmen<br />
(1) Die Landkreise können im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis die<br />
zur Durchführung von <strong>Gesetze</strong>n, Rechtsverordnungen und Satzungen<br />
notwendigen Einzelverfügungen erlassen und unter Anwendung der<br />
gesetzlichen Zwangsmittel vollziehen.<br />
(2) 1 Verwaltungsakte, Ladungen oder sonstige Mitteilungen, die auf Grund<br />
von Rechtsvorschriften außerhalb dieses <strong>Gesetze</strong>s amtlich, öffentlich oder<br />
ortsüblich bekanntzumachen sind, hat der Landkreis oder das Landratsamt<br />
wie Satzungen des Landkreises bekanntzumachen. 2 Sind Pläne, Karten<br />
oder sonstige Nachweise Bestandteil einer Mitteilung nach Satz 1, so kann<br />
die Bekanntmachung unbeschadet anderer Vorschriften auch dadurch<br />
bewirkt werden, daß die Mitteilung mit den Nachweisen auf die Dauer von<br />
zwei Wochen im Landratsamt ausgelegt wird; der Gegenstand der<br />
Mitteilung sowie Ort und Zeit der Auslegung sind mindestens eine Woche<br />
vorher nach Satz 1 bekanntzumachen.<br />
(3) Geldbußen und Verwarnungsgelder, die auf Grund bewehrter Satzungen<br />
und Verordnungen festgesetzt werden, fließen in die Kreiskasse.<br />
ZWEITER TEIL Verfassung und Verwaltung des Landkreises<br />
1. ABSCHNITT Kreisorgane und ihre Hilfskräfte<br />
Bay LKrO Art. 22 Hauptorgane<br />
Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag<br />
bestellte Ausschüsse (Art. 26 ff.) über Kreisangelegenheiten beschließen oder<br />
der Landrat selbständig entscheidet (Art. 34).<br />
a) Der Kreistag<br />
Bay LKrO Art. 23 Rechtsstellung, Aufgaben des Kreistags<br />
(1) 1 Der Kreistag ist die Vertretung der Kreisbürger. 2 Er entscheidet im<br />
Rahmen des Art. 22 über alle wichtigen Angelegenheiten der<br />
Kreisverwaltung.
(2) 1 Der Kreistag überwacht die gesamte Kreisverwaltung, insbesondere auch<br />
die Ausführung seiner Beschlüsse. 2 Jedem Kreisrat muß durch das<br />
Landratsamt Auskunft erteilt werden.<br />
Bay LKrO Art. 24 Zusammensetzung des Kreistags<br />
(1) Der Kreistag besteht aus dem Landrat und den Kreisräten.<br />
(2) 1 Die Zahl der Kreisräte beträgt in Landkreisen<br />
mit bis zu 75 000 Einwohnern 50,<br />
mit mehr als 75 000 bis 150 000 Einwohnern 60,<br />
mit mehr als 150 000 Einwohnern 70.<br />
2<br />
Sinkt die Einwohnerzahl in einem Landkreis unter eine der in Satz 1<br />
genannten Einwohnergrenzen, so ist die Zahl der Kreisräte erst in der<br />
übernächsten Wahlzeit auf die gesetzlich vorgeschriebene Zahl zu<br />
verringern. 3 Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig.<br />
(3) 1 Kreisräte können nicht sein:<br />
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte des Landkreises<br />
und des Landratsamts,<br />
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen<br />
oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an<br />
denen der Landkreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine Beteiligung<br />
am Stimmrecht genügt,<br />
3. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörden, die unmittelbar<br />
mit Aufgaben der Rechtsaufsicht befaßt sind,<br />
4. der Landrat eines anderen Kreises,<br />
5. der Oberbürgermeister einer kreisfreien Gemeinde.<br />
2<br />
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Beamte während der Dauer des<br />
Ehrenamts ohne Dienstbezüge beurlaubt ist oder wenn seine Rechte und<br />
Pflichten aus dem Dienstverhältnis wegen der Wahl in eine gesetzgebende<br />
Körperschaft ruhen; dies gilt für Angestellte entsprechend.<br />
(4) 1 Alle Kreisräte sind alsbald nach ihrer Berufung in feierlicher Form zu<br />
vereidigen. 2 Die Eidesformel lautet:“Ich schwöre Treue dem Grundgesetz<br />
für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates<br />
Bayern. Ich schwöre, den <strong>Gesetze</strong>n gehorsam zu sein und meine<br />
Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der<br />
Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr<br />
mir Gott helfe.” 3 Der Eid kann auch ohne die Worte “so wahr mir Gott<br />
helfe” geleistet werden. 4 Erklärt ein Kreisrat, daß er aus Glaubens- oder<br />
Gewissensgründen keinen Eid leisten könne, so hat er an Stelle der Worte<br />
“ich schwöre” die Worte “ich gelobe” zu sprechen oder das Gelöbnis mit<br />
einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung<br />
seiner Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden gleichwertigen<br />
Beteuerungsformel einzuleiten. 5 Den Eid nimmt der Landrat ab. 6 Die<br />
Eidesleistung entfällt für die Kreisräte, die im Anschluß an ihre Amtszeit<br />
wieder zum Kreisrat des gleichen Landkreises gewählt wurden.<br />
Bay LKrO Art. 25 Einberufung des Kreistags<br />
(1) Der Kreistag wird vom Landrat, erstmals binnen vier Wochen nach der<br />
Wahl, einberufen.
(2) 1 In dringenden Fällen kann der Kreistag zu außerordentlichen Sitzungen<br />
einberufen werden. 2 Er ist einzuberufen, wenn es der Kreisausschuß oder<br />
ein Drittel der Kreisräte unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstands<br />
beantragt.<br />
b) Der Kreisausschuß und die weiteren Ausschüsse<br />
Bay LKrO Art. 26 Aufgaben des Kreisausschusses<br />
1 Der Kreisausschuß ist ein vom Kreistag bestellter ständiger Ausschuß. 2 Er<br />
bereitet die Verhandlungen des Kreistags vor und erledigt an seiner Stelle die<br />
ihm vom Kreistag übertragenen Angelegenheiten. 3 In der Geschäftsordnung<br />
(Art. 40) kann bestimmt werden, dass der Kreistag Empfehlungen der<br />
Fachausschüsse auch ohne Vorbereitung durch den Kreisausschuss behandeln<br />
kann.<br />
Bay LKrO Art. 27 Zusammensetzung<br />
(1) 1 Der Kreisausschuß besteht aus dem Landrat und den Kreisräten. 2 Die<br />
Zahl der Kreisräte beträgt in Landkreisen<br />
mit bis zu 75 000 Einwohnern 10,<br />
mit mehr als 75 000 bis 150 000 Einwohnern 12,<br />
mit mehr als 150 000 Einwohnern 14.<br />
(2) 1 Die Mitglieder des Kreisausschusses werden vom Kreistag für die Dauer<br />
der Wahlzeit aus seiner Mitte bestellt. 2 Hierbei hat der Kreistag dem<br />
Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen<br />
Rechnung zu tragen. 3 Haben dabei mehrere Parteien oder Wählergruppen<br />
gleichen Anspruch auf einen Sitz, so ist statt eines Losentscheids auch der<br />
Rückgriff auf die Zahl der bei der Wahl auf diese Parteien oder<br />
Wählergruppen abgegebenen Stimmen zulässig. 4 Die Bestellung anderer<br />
als der von den Parteien und Wählergruppen vorgeschlagenen Personen<br />
ist nicht zulässig. 5 Kreisräte können sich zur Entsendung gemeinsamer<br />
Vertreter in den Kreisausschuß zusammenschließen.<br />
(3) 1 Während der Wahlzeit im Kreistag eintretende Änderungen des<br />
Stärkeverhältnisses der Parteien und Wählergruppen sind auszugleichen.<br />
2<br />
Scheidet ein Mitglied aus der von ihm vertretenen Partei oder<br />
Wählergruppe aus, so verliert es seinen Sitz im Kreisausschuß.<br />
Bay LKrO Art. 28 Einberufung<br />
1 Der Kreisausschuß wird vom Landrat nach Bedarf einberufen. 2 Er muß<br />
einberufen werden, wenn es die Hälfte der Mitglieder unter Angabe des<br />
Beratungsgegenstands schriftlich beantragt.<br />
Bay LKrO Art. 29 Weitere Ausschüsse<br />
(1) 1 Der Kreistag kann im Bedarfsfall weitere vorberatende und<br />
beschließende Ausschüsse bilden. 2 Die Zusammensetzung der Ausschüsse<br />
regelt der Kreistag in der Geschäftsordnung (Art. 40). 3 Art. 27 Abs. 2 und<br />
3 und Art. 28 gelten entsprechend.
(2) Ausschüsse nach Absatz 1 können vom Kreistag jederzeit aufgelöst<br />
werden.<br />
Bay LKrO Art. 30 Dem Kreistag vorbehaltene Angelegenheiten<br />
(1) Der Kreistag kann dem Kreisausschuß und den weiteren beschließenden<br />
Ausschüssen folgende in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten nicht<br />
übertragen:<br />
1. die Beschlußfassung über den Sitz der Kreisverwaltung und den Namen<br />
des Landkreises (Art. 2 Abs. 1),<br />
2. weggefallen<br />
3. die Annahme und Änderung von Wappen und Fahnen (Art. 3 Abs. 1),<br />
4. die Beschlußfassung über Änderungen von bewohntem Kreisgebiet,<br />
5. die Entscheidung über die Übernahme und die Niederlegung von<br />
Ehrenämtern und über die Erhebung von Ordnungsgeld wegen<br />
unbegründeter Ablehnung von Ehrenämtern (Art. 13),<br />
6. die Erhebung von Ordnungsgeld bei Verstößen ehrenamtlich tätiger<br />
Kreisbürger gegen die Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht (Art. 14<br />
Abs. 3),<br />
7. die Festsetzung der Entschädigung für ehrenamtlich tätige Kreisbürger<br />
(Art. 14 a),<br />
8. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und Gebühren,<br />
9. den Erlaß, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen, bewehrten<br />
Satzungen und Verordnungen,<br />
10. die Bestellung des Kreisausschusses und die Übertragung von<br />
Aufgaben auf den Kreisausschuß (Art. 26 und 27),<br />
11. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse (Art. 29),<br />
12. die Beschlußfassung in beamten-, besoldungs-, versorgungs- und<br />
disziplinarrechtlichen Angelegenheiten des Landrats und des gewählten<br />
Stellvertreters des Landrats, soweit nicht das Gesetz über kommunale<br />
Wahlbeamte oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas anderes<br />
bestimmen,<br />
13. die Aufstellung der Richtlinien über die laufenden Angelegenheiten<br />
(Art. 34 Abs. 1),<br />
14. die Wahl des Stellvertreters des Landrats und die Regelung der<br />
weiteren Stellvertretung (Art. 32 und 36),<br />
15. den Erlaß der Geschäftsordnung für den Kreistag (Art. 40),<br />
16. die Übernahme von Selbstverwaltungsaufgaben kreisangehöriger<br />
Gemeinden (Art. 52 Abs. 2),<br />
17. die Beschlußfassung über die Haushaltssatzung, über die<br />
Nachtragshaushaltssatzungen sowie die Beschlußfassung über die<br />
Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen<br />
Haushaltsführung (Art. 59, 62 und 63 Abs. 2),<br />
18. die Beschlußfassung über den Finanzplan (Art. 64),<br />
19. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen sowie die Beschlußfassung über die Entlastung (Art. 88),<br />
20. Entscheidungen über Unternehmen der Landkreise im Sinn von<br />
Art. 84,<br />
21. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Kreistag im übrigen<br />
vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 76),
22. die Bestellung und die Abberufung des Leiters des<br />
Rechnungsprüfungsamts sowie seines Stellvertreters.<br />
(2) Alle übrigen in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten können vom<br />
Kreistag dem Kreisausschuß oder weiteren beschließenden Ausschüssen<br />
übertragen werden.<br />
c) Der Landrat und sein Stellvertreter<br />
Bay LKrO Art. 31 Der Landrat<br />
1 Der Landrat ist Beamter des Landkreises; er ist Beamter auf Zeit. 2 Das<br />
Nähere über das Beamtenverhältnis des Landrats bestimmt das Gesetz über<br />
kommunale Wahlbeamte.<br />
Bay LKrO Art. 32 Der gewählte Stellvertreter des Landrats<br />
(1) 1 Der Kreistag wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Wahlzeit den<br />
Stellvertreter des Landrats. 2 Der gewählte Stellvertreter des Landrats ist<br />
Ehrenbeamter des Landkreises.<br />
(2) 1 Zum Stellvertreter des Landrats sind die Kreisräte wählbar, welche die<br />
Voraussetzungen für die Wahl zum Landrat erfüllen; abweichend hiervon<br />
ist auch wählbar, wer am Tag des Beginns der Amtszeit das<br />
65. Lebensjahr vollendet hat. 2 Für die Wahl des Stellvertreters des<br />
Landrats gilt Art. 45 Abs. 3.<br />
(3) Das Nähere über das Beamtenverhältnis des gewählten Stellvertreters des<br />
Landrats bestimmt das Gesetz über kommunale Wahlbeamte.<br />
(4) Endet das Beamtenverhältnis eines gewählten Stellvertreters des Landrats<br />
während der Wahlzeit des Kreistags, so findet für den Rest der Wahlzeit<br />
innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl statt.<br />
Bay LKrO Art. 33 Vorsitz im Kreistag; Vollzug der Beschlüsse<br />
1 Der Landrat führt den Vorsitz im Kreistag, im Kreisausschuß und in den<br />
weiteren Ausschüssen. 2 Er vollzieht die gefaßten Beschlüsse. 3 Ist der Landrat<br />
verhindert oder persönlich beteiligt, so handelt sein Vertreter.<br />
Bay LKrO Art. 34 Zuständigkeit des Landrats<br />
(1) 1 Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit<br />
1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Landkreis keine<br />
grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen<br />
erwarten lassen,<br />
2. die Angelegenheiten des Landkreises, die im Interesse der Sicherheit<br />
der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheimzuhalten sind.<br />
2<br />
Für die laufenden Angelegenheiten nach Satz 1 Nr. 1, die nicht unter<br />
Nummer 2 fallen, kann der Kreistag Richtlinien aufstellen.<br />
(2) 1 Der Kreistag kann dem Landrat durch die Geschäftsordnung weitere<br />
Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen. 2 Das gilt nicht<br />
für Angelegenheiten, die nach Art. 30 Abs. 1 nicht auf beschließende<br />
Ausschüsse übertragen werden können. 3 Der Kreistag kann dem Landrat<br />
übertragene Angelegenheiten im Einzelfall nicht wieder an sich ziehen;
das Recht des Kreistags, die Übertragung allgemein zu widerrufen, bleibt<br />
unberührt.<br />
(3) 1 Der Landrat ist befugt, an Stelle des Kreistags, des Kreisausschusses und<br />
der weiteren Ausschüsse dringliche Anordnungen zu treffen und<br />
unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. 2 Hiervon hat er dem Kreistag<br />
oder dem Ausschuß in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.<br />
Bay LKrO Art. 35 Vertretung des Landkreises nach außen;<br />
Verpflichtungsgeschäfte<br />
(1) Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen.<br />
(2) 1 Erklärungen, durch welche der Landkreis verpflichtet werden soll,<br />
bedürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer Form mit einer<br />
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur versehen<br />
sein; das gilt nicht für ständig wiederkehrende Geschäfte des täglichen<br />
Lebens, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. 2 Die Erklärungen<br />
sind durch den Landrat oder seinen Stellvertreter unter Angabe der<br />
Amtsbezeichnung zu unterzeichnen. 3 Sie können auf Grund einer diesen<br />
Erfordernissen entsprechenden Vollmacht auch von Bediensteten des<br />
Landratsamts unterzeichnet werden.<br />
(3) 1 Verletzt der Landrat in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen<br />
Gewalt schuldhaft die ihm einem anderen gegenüber obliegende<br />
Amtspflicht, so haftet für die Folgen der Staat, wenn es sich um reine<br />
Staatsangelegenheiten handelt. 2 Im übrigen haftet der Landkreis.<br />
Bay LKrO Art. 36 Weitere Stellvertreter des Landrats<br />
Die weitere Stellvertretung des Landrats regelt der Kreistag durch Beschluß; es<br />
können nur Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes bestellt<br />
werden.<br />
d) Das Landratsamt und die Kreisbediensteten<br />
Bay LKrO Art. 37 Landratsamt<br />
(1) 1 Das Landratsamt ist Kreisbehörde. 2 Soweit es rein staatliche Aufgaben,<br />
insbesondere die staatliche Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden<br />
und über sonstige Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des<br />
öffentlichen Rechts wahrnimmt, ist es Staatsbehörde.<br />
(2) Geeignete staatliche Aufgaben sind mit Ausnahme der staatlichen Aufsicht<br />
durch Einzelgesetze auf die Kreisverwaltung zu übertragen.<br />
(3) 1 Jedem Landratsamt wird mindestens ein Staatsbeamter mit der<br />
Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst oder für das Richteramt<br />
zugeteilt. 2 Er soll als juristischer Sachverständiger zu den Sitzungen des<br />
Kreistags, des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse zugezogen<br />
werden. 3 Nach Bedarf werden Staatsbeamte des gehobenen, des<br />
mittleren und des einfachen Dienstes zugewiesen. 4 Die Staatsbeamten<br />
unterstehen der Dienstaufsicht des Landrats.<br />
(4) Der Landrat kann seine Befugnisse in Angelegenheiten der laufenden<br />
Verwaltung teilweise den Staatsbediensteten oder den Kreisbediensteten<br />
übertragen und hierbei entsprechende Zeichnungsvollmacht erteilen; eine
darüber hinausgehende Übertragung bedarf der Zustimmung des<br />
Kreistags.<br />
(5) Für die Haftung der Staats- und Kreisbediensteten gegenüber Dritten gilt<br />
Art. 35 Abs. 3 entsprechend.<br />
(6) Im Vollzug der Staatsaufgaben wird der Landrat als Organ des Staates<br />
tätig und untersteht lediglich den Weisungen seiner vorgesetzten<br />
Dienststellen.<br />
Bay LKrO Art. 38 Kreisbedienstete<br />
(1) 1 Der Kreistag ist zuständig<br />
1. die Beamten des Landkreises zu ernennen, zu befördern, zu einem<br />
anderen Dienstherrn abzuordnen oder zu versetzen, in den Ruhestand zu<br />
versetzen und zu entlassen,<br />
2. die Angestellten des Landkreises einzustellen, höherzugruppieren und<br />
zu entlassen.<br />
2<br />
Der Kreistag kann diese Befugnisse dem Kreisausschuß oder einem<br />
weiteren beschließenden Ausschuß übertragen.<br />
(2) 1 Die Arbeiter des Landkreises werden durch den Landrat eingestellt,<br />
höhergruppiert und entlassen. 2 Befugnisse nach Abs. 1 Satz 1 kann der<br />
Kreistag auf den Landrat übertragen für<br />
1. Beamte des einfachen, mittleren und gehobenen Dienstes und für<br />
Beamte der ersten beiden Ämter des höheren Dienstes,<br />
2. Angestellte, deren Vergütung mit der Besoldung der in Nr. 1 genannten<br />
Beamten vergleichbar ist.<br />
3<br />
Ein solcher Beschluß bedarf der Mehrheit der stimmberechtigten<br />
Mitglieder des Kreistags; falls der Beschluß nicht mit dieser Mehrheit<br />
wieder aufgehoben wird, gilt er bis zum Ende der Wahlzeit des Kreistags.<br />
4<br />
Art. 37 Abs. 4 findet Anwendung.<br />
(3) 1 Dienstvorgesetzter der Kreisbeamten ist der Landrat. 2 Er führt die<br />
Dienstaufsicht über die Kreisbediensteten.<br />
(4) Die Arbeitsbedingungen, Vergütungen (Gehälter und Löhne) der<br />
Angestellten und Arbeiter müssen angemessen sein.<br />
Bay LKrO Art. 39 Stellenplan<br />
1 Der Stellenplan (Art. 58 Abs. 2 Satz 2) ist einzuhalten. 2 Abweichungen sind<br />
nur im Rahmen des Art. 62 Abs. 3 Nr. 2 zulässig.<br />
2. ABSCHNITT Geschäftsgang<br />
Bay LKrO Art. 40 Geschäftsordnung<br />
(1) Der Kreistag gibt sich eine Geschäftsordnung.<br />
(2) Die Geschäftsordnung muß Bestimmungen über die Frist und Form der<br />
Einladung zu den Sitzungen sowie über den Geschäftsgang des Kreistags,<br />
des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse enthalten.<br />
(3) Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet und verteilt der Landrat die<br />
Geschäfte.
Bay LKrO Art. 41 Sitzungszwang; Beschlußfähigkeit<br />
(1) Der Kreistag beschließt in Sitzungen.<br />
(2) Er ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen<br />
sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.<br />
(3) 1 Wird der Kreistag zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben<br />
Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der<br />
Erschienenen beschlußfähig. 2 Bei der zweiten Einladung muß auf diese<br />
Bestimmung hingewiesen werden.<br />
Bay LKrO Art. 42 Teilnahme- und Abstimmungspflicht; Ordnungsgeld<br />
gegen Säumige<br />
(1) 1 Die Kreisräte sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen<br />
teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen. 2 Im<br />
Kreistag darf sich niemand der Stimme enthalten.<br />
(2) 1 Gegen Kreisräte, die sich diesen Verpflichtungen ohne genügende<br />
Entschuldigung entziehen, kann der Kreistag Ordnungsgeld bis zu<br />
zweihundertfünfzig Euro im Einzelfall verhängen. 2 Das Ordnungsgeld fließt<br />
in die Kreiskasse.<br />
Bay LKrO Art. 43 Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung<br />
(1) 1 Mitglieder des Kreistags können an der Beratung und Abstimmung nicht<br />
teilnehmen, wenn der Beschluß ihnen selbst, ihren Ehegatten, ihren<br />
Lebenspartnern, einem Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten<br />
Grad oder einer von ihnen kraft <strong>Gesetze</strong>s oder Vollmacht vertretenen<br />
natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder<br />
Nachteil bringen kann. 2 Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Kreistags in<br />
anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat.<br />
(2) Absatz 1 gilt nicht<br />
1. für Wahlen,<br />
2. für Beschlüsse, mit denen der Kreistag eine Person zum Mitglied eines<br />
Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des<br />
Landkreises in eine andere Einrichtung entsendet, dafür vorschlägt oder<br />
daraus abberuft.<br />
(3) Ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, entscheidet der<br />
Kreistag ohne Mitwirkung des persönlich Beteiligten.<br />
(4) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen<br />
Mitglieds hat die Ungültigkeit des Beschlusses nur zur Folge, wenn sie für<br />
das Abstimmungsergebnis entscheidend war.<br />
Bay LKrO Art. 44 Einschränkung des Vertretungsrechts<br />
Mitglieder des Kreistags dürfen Ansprüche Dritter gegen den Landkreis nur als<br />
gesetzliche Vertreter geltend machen.<br />
Bay LKrO Art. 45 Form der Beschlußfassung; Wahlen<br />
(1) 1 Beschlüsse des Kreistags werden in offener Abstimmung mit Mehrheit<br />
der Abstimmenden gefaßt. 2 Bei Stimmengleichheit ist der Antrag<br />
abgelehnt.
(2) 1 Kein Kreisrat darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung<br />
gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Kreistags zur<br />
Verantwortung gezogen werden. 2 Die Haftung gegenüber dem Landkreis<br />
ist nicht ausgeschlossen, wenn das Abstimmungsverhalten eine<br />
vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt. 3 Die Verantwortlichkeit nach<br />
bundesrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt.<br />
(3) 1 Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. 2 Sie sind nur<br />
gültig, wenn sämtliche Mitglieder unter Angabe des Gegenstands geladen<br />
sind und die Mehrheit von ihnen anwesend und stimmberechtigt ist.<br />
3<br />
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen<br />
erhält. 4 Neinstimmen und leere Stimmzettel sind ungültig. 5 Ist<br />
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu<br />
wiederholen. 6 Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und<br />
erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen<br />
Stimmen, so tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten<br />
Stimmenzahlen ein. 7 Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet<br />
das Los.<br />
(4) Absatz 3 gilt für alle Entscheidungen des Kreistags, die in diesem Gesetz<br />
oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden.<br />
Bay LKrO Art. 46 Öffentlichkeit<br />
(1) Zeitpunkt und Ort der Sitzungen des Kreistags sind unter Angabe der<br />
Tagesordnung, spätestens am fünften Tag vor der Sitzung, öffentlich<br />
bekanntzumachen.<br />
(2) 1 Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der<br />
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen.<br />
2<br />
Über den Ausschluß der Öffentlichkeit wird in geheimer Sitzung beraten<br />
und entschieden. 3 Durch die Geschäftsordnung kann festgelegt werden,<br />
daß bestimmte Angelegenheiten grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung<br />
behandelt werden.<br />
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit<br />
bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen<br />
sind.<br />
Bay LKrO Art. 47 Handhabung der Ordnung<br />
(1) 1 Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. 2 Er<br />
ist berechtigt, Zuhörer, welche die Ordnung stören, entfernen zu lassen.<br />
3<br />
Er kann mit Zustimmung des Kreistags Kreisräte, welche die Ordnung<br />
fortgesetzt erheblich stören, von der Sitzung ausschließen.<br />
(2) Wird durch einen bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenen<br />
Kreisrat die Ordnung innerhalb von zwei Monaten neuerdings erheblich<br />
gestört, so kann ihm der Kreistag für zwei weitere Sitzungen die<br />
Teilnahme untersagen.<br />
Bay LKrO Art. 48 Niederschrift<br />
(1) 1 Die Verhandlungen des Kreistags sind niederzuschreiben. 2 Die<br />
Niederschrift muß Tag und Ort der Sitzung, die anwesenden Kreisräte, die<br />
behandelten Gegenstände, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis
ersehen lassen. 3 Jedes Mitglied kann verlangen, daß in der Niederschrift<br />
festgehalten wird, wie es abgestimmt hat.<br />
(2) 1 Die Kreisräte können jederzeit die Niederschrift einsehen und sich<br />
Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse erteilen lassen.<br />
2 Die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen steht allen<br />
Kreisbürgern frei.<br />
Bay LKrO Art. 49 Geschäftsgang der Ausschüsse<br />
Die Vorschriften der Art. 41 bis 48 finden auf den Geschäftsgang des<br />
Kreisausschusses und der weiteren beschließenden Ausschüsse entsprechende<br />
Anwendung.<br />
3. ABSCHNITT Verwaltungsgrundsätze und Verwaltungsaufgaben<br />
Bay LKrO Art. 50 Gesetzmäßigkeit; Unparteilichkeit<br />
1 Die Verwaltungstätigkeit des Landkreises muß mit der Verfassung und den<br />
<strong>Gesetze</strong>n in Einklang stehen. 2 Sie darf nur von sachlichen Gesichtspunkten<br />
geleitet sein.<br />
Bay LKrO Art. 50 a Geheimhaltung<br />
(1) 1 Alle Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer<br />
wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten<br />
nicht bekannt werden dürfen, sind von den Landkreisen geheimzuhalten.<br />
2<br />
Die in anderen Rechtsvorschriften geregelte Verpflichtung zur<br />
Verschwiegenheit bleibt unberührt.<br />
(2) 1 Zur Geheimhaltung der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten<br />
haben die Landkreise die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 2 Sie<br />
haben insoweit auch die für die Behörden des Freistaates Bayern<br />
geltenden Verwaltungsvorschriften zu beachten. 3 Das Staatsministerium<br />
des Innern kann hierzu Richtlinien aufstellen und Weisungen erteilen, die<br />
nicht der Einschränkung nach Art. 95 Abs. 2 Satz 2 unterliegen.<br />
(3) 1 Der Landrat ist zu Beginn seiner Amtszeit durch die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde schriftlich besonders zu verpflichten, die in<br />
Absatz 1 Satz 1 genannten Angelegenheiten geheimzuhalten und die<br />
hierfür geltenden Vorschriften zu beachten. 2 In gleicher Weise hat der<br />
Landrat seinen Stellvertreter zu verpflichten. 3 Kreisbedienstete hat er zu<br />
verpflichten, bevor sie mit den in Absatz 1 Satz 1 genannten<br />
Angelegenheiten befaßt werden. 4 Art. 3 a des Bayerischen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.<br />
Bay LKrO Art. 51 Aufgaben des eigenen Wirkungskreises<br />
(1) Im eigenen Wirkungskreis sollen die Landkreise in den Grenzen ihrer<br />
Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das<br />
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den<br />
Verhältnissen des Kreisgebiets erforderlich sind; hierbei sind die Belange<br />
des Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigen.
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 sind die Landkreise, unbeschadet bestehender<br />
Verbindlichkeiten Dritter, verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen<br />
Vorschriften die erforderlichen Maßnahmen auf den Gebieten der<br />
Straßenverwaltung, der Feuersicherheit, des Gesundheitswesens sowie<br />
der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrtspflege zu treffen oder die nötigen<br />
Leistungen für solche Maßnahmen aufzuwenden.<br />
(3) 1 Die Landkreise sind, unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter,<br />
in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet,<br />
1. die erforderlichen Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten und<br />
die Hebammenhilfe für die Bevölkerung sicherzustellen,<br />
2. die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen<br />
zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten, soweit<br />
eine solche Aufgabe überörtlicher Natur ist und daher aus tatsächlichen<br />
oder wirtschaftlichen Gründen die Errichtung einer zentralen Einrichtung<br />
für das gesamte oder überwiegende Kreisgebiet geboten ist,<br />
3. Gartenkultur und Landespflege unbeschadet anderer gesetzlicher<br />
Vorschriften zu fördern.<br />
2<br />
Sonstige gesetzlich festgelegte Verpflichtungen der Landkreise bleiben<br />
unberührt.<br />
(4) Übersteigt eine Pflichtaufgabe die Leistungsfähigkeit eines Landkreises, so<br />
ist diese Aufgabe in kommunaler Zusammenarbeit zu erfüllen.<br />
Bay LKrO Art. 52 Übernahme von Gemeindeaufgaben<br />
(1) Auf Antrag kreisangehöriger Gemeinden können die Landkreise deren<br />
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Art. 57 GO) übernehmen, wenn<br />
und solange diese das Leistungsvermögen der beteiligten Gemeinden<br />
übersteigen.<br />
(2) Der Beschluß bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen<br />
Mitgliederzahl des Kreistags.<br />
Bay LKrO Art. 53 Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br />
(1) 1 Im übertragenen Wirkungskreis haben die Landkreise die staatlichen<br />
Verwaltungsaufgaben, die auf die Kreisverwaltung nach Art. 37 Abs. 2<br />
durch Einzelgesetze übertragen werden, zu erfüllen. 2 Unberührt bleibt die<br />
Zuständigkeit des Landratsamts als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 Satz 2)<br />
und die Zuständigkeit von Sonderbehörden.<br />
(2) 1 Zur Erledigung der staatlichen Aufgaben stellen die Landkreise die<br />
erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung. 2 Für Mehrbelastungen im<br />
Sinn des Art. 83 Abs. 3 der Verfassung ist ein entsprechender finanzieller<br />
Ausgleich nach dessen Grundsätzen zu leisten.<br />
Bay LKrO Art. 54 Zuständigkeit für den <strong>Gesetze</strong>svollzug<br />
(1) Der Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im übertragenen<br />
Wirkungskreis und die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen und<br />
Weisungen der Staatsbehörden obliegen dem Kreistag oder dem<br />
Kreisausschuß, in den Fällen des Art. 34 dem Landrat.<br />
(2) Hält der Landrat Entscheidungen des Kreistags oder seiner Ausschüsse für<br />
rechtswidrig, so hat er sie zu beanstanden, ihren Vollzug auszusetzen und,
soweit erforderlich, die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 96)<br />
herbeizuführen.<br />
DRITTER TEIL Landkreiswirtschaft<br />
1. ABSCHNITT Haushaltswirtschaft<br />
Bay LKrO Art. 55 Allgemeine Haushaltsgrundsätze<br />
(1) 1 Der Landkreis hat seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen,<br />
daß die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. 2 Die dauernde<br />
Leistungsfähigkeit des Landkreises ist sicherzustellen, eine Überschuldung<br />
ist zu vermeiden. 3 Dabei ist den Erfordernissen des<br />
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und dem § 51 a des<br />
Haushaltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen, insbesondere der<br />
Verantwortung zur Einhaltung der Bestimmungen in Art. 104 des<br />
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des<br />
europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes nachzukommen.<br />
(2) 1 Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu<br />
führen. 2 Aufgaben sollen in geeigneten Fällen daraufhin untersucht<br />
werden, ob und in welchem Umfang sie durch nichtkommunale Stellen,<br />
insbesondere durch private Dritte oder unter Heranziehung Dritter,<br />
mindestens ebenso gut erledigt werden können.<br />
(3) 1 Bei der Führung der Haushaltswirtschaft hat der Landkreis finanzielle<br />
Risiken zu minimieren. 2 Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn besondere<br />
Umstände, vor allem ein grobes Missverhältnis bei der Risikoverteilung zu<br />
Lasten des Landkreises, die Gefahr eines erheblichen Vermögensschadens<br />
begründen.<br />
(4) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten<br />
kommunalen Buchführung oder nach den Grundsätzen der Kameralistik zu<br />
führen.<br />
Bay LKrO Art. 56 Grundsätze der Einnahmebeschaffung<br />
(1) Der Landkreis erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.<br />
(2) Er hat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen<br />
1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von<br />
ihm erbrachten Leistungen,<br />
2. im übrigen aus Steuern und durch die Kreisumlage<br />
zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.<br />
(3) Der Landkreis darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung<br />
nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.<br />
Bay LKrO Art. 57 Haushaltssatzung<br />
(1) 1 Der Landkreis hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu<br />
erlassen. 2 Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei<br />
Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt enthalten.<br />
(2) 1 Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung<br />
1. des Haushaltsplans unter Angabe
a) des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres<br />
sowie des sich daraus ergebenden Saldos des Ergebnishaushalts, des<br />
Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der<br />
Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres sowie des sich daraus<br />
ergebenden Saldos des Finanzhaushalts bei Haushaltswirtschaft nach den<br />
Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
b) des Gesamtbetrags der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres<br />
bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik,<br />
2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für<br />
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
(Kreditermächtigungen),<br />
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen<br />
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen<br />
beziehungsweise Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten<br />
(Verpflichtungsermächtigungen),<br />
4. der Kreisumlage (Umlagesoll und Umlagesätze) und der Abgabesätze,<br />
die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,<br />
5. des Höchstbetrags der Kassenkredite.<br />
2<br />
Die Angaben nach Satz 1 Nrn. 2, 3 und 5 sind getrennt für das<br />
Haushaltswesen des Landkreises und die Wirtschaftsführung von<br />
Eigenbetrieben zu machen. 3 Die Haushaltssatzung kann weitere<br />
Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Einzahlungen sowie<br />
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise auf die Einnahmen<br />
und Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.<br />
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt<br />
für das Haushaltsjahr.<br />
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch<br />
Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.<br />
Bay LKrO Art. 58 Haushaltsplan<br />
(1) 1 Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der<br />
Aufgaben des Landkreises voraussichtlich<br />
1. anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden<br />
Aufwendungen sowie zu leistenden Auszahlungen bei Haushaltswirtschaft<br />
nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
2. zu erwartenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben bei<br />
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik,<br />
3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.<br />
2<br />
Die Vorschriften über die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge<br />
und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen, Ausgaben und<br />
Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe des Landkreises bleiben<br />
unberührt.<br />
(2) 1 Der Haushaltsplan ist bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
doppelten kommunalen Buchführung in einen Ergebnishaushalt und einen<br />
Finanzhaushalt, bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt<br />
zu gliedern. 2 Der Stellenplan für die Beamten und Angestellten des
Landkreises ist Teil des Haushaltsplans. 3 Die bei der Sparkasse<br />
beschäftigten Beamten und Angestellten sind in diesem Stellenplan nicht<br />
auszuweisen, wenn und soweit nach Sparkassenrecht ein verbindlicher<br />
Stellenplan aufzustellen ist.<br />
(3) 1 Der Haushaltsplan muß ausgeglichen sein. 2 Er ist Grundlage für die<br />
Haushaltswirtschaft des Landkreises und nach Maßgabe dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
und der auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen Vorschriften für die<br />
Haushaltsführung verbindlich. 3 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter<br />
werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.<br />
Bay LKrO Art. 59 Erlaß der Haushaltssatzung<br />
(1) Der Kreistag beschließt über die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen in<br />
öffentlicher Sitzung.<br />
(2) Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor<br />
Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.<br />
(3) 1 Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Bestandteilen sind<br />
sogleich nach der Genehmigung amtlich bekanntzumachen.<br />
2<br />
Haushaltssatzungen ohne solche Bestandteile sind frühestens einen<br />
Monat nach der Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde amtlich<br />
bekanntzumachen, sofern nicht die Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung<br />
beanstandet. 3 Gleichzeitig ist der Haushaltsplan eine Woche lang<br />
öffentlich aufzulegen; darauf ist in der amtlichen Bekanntmachung der<br />
Haushaltssatzung hinzuweisen.<br />
Bay LKrO Art. 60 Planabweichungen<br />
(1) 1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen<br />
beziehungsweise Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind<br />
und die Deckung gewährleistet ist. 2 Sind sie erheblich, sind sie vom<br />
Kreistag zu beschließen.<br />
(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die im<br />
Haushaltsplan nicht vorgesehene Verpflichtungen zu Leistungen des<br />
Landkreises entstehen können.<br />
(3) Art. 62 Abs. 2 bleibt unberührt.<br />
(4) 1 Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind<br />
überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise<br />
Ausgaben in nicht erheblichem Umfang auch dann zulässig, wenn ihre<br />
Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlaß einer<br />
Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden<br />
Jahr gewährleistet ist. 2 Hierüber entscheidet der Kreistag.<br />
(5) Der Kreistag kann Richtlinien über die Abgrenzungen aufstellen.<br />
Bay LKrO Art. 61 Verpflichtungsermächtigungen<br />
(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen beziehungsweise<br />
Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in<br />
künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen werden,<br />
wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem<br />
Haushaltsjahr folgenden drei Jahre vorgesehen werden, in Ausnahmefällen<br />
bis zum Abschluß einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie<br />
der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.<br />
(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des<br />
Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende<br />
Haushaltsjahr nicht rechtzeitig amtlich bekannt gemacht wird, bis zum<br />
Erlaß dieser Haushaltssatzung.<br />
(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bedarf im Rahmen der<br />
Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten<br />
sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.<br />
(5) 1 Verpflichtungen im Sinn des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder<br />
außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis<br />
besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der<br />
Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. 2 Art. 60 Abs. 1<br />
Satz 2 gilt entsprechend.<br />
Bay LKrO Art. 62 Nachtragshaushaltssatzungen<br />
(1) 1 Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres<br />
durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 2 Für die<br />
Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die<br />
Haushaltssatzung entsprechend.<br />
(2) Der Landkreis hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu<br />
erlassen, wenn<br />
1. sich zeigt, daß trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag<br />
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der<br />
Haushaltssatzung erreicht werden kann,<br />
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen und<br />
Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben in einem im Verhältnis zu den<br />
Gesamtaufwendungen und -auszahlungen beziehungsweise<br />
Gesamtausgaben des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet<br />
werden müssen,<br />
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts beziehungsweise Ausgaben des<br />
Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,<br />
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder in eine höhere<br />
Vergütungsgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die<br />
entsprechenden Stellen nicht enthält.<br />
(3) Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf<br />
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und<br />
Baumaßnahmen, soweit die Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben<br />
nicht erheblich und unabweisbar sind,<br />
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer<br />
Personalausgaben, die auf Grund des Beamten- oder Tarifrechts oder für<br />
die Erfüllung neuer Aufgaben notwendig werden.
Bay LKrO Art. 63 Vorläufige Haushaltsführung<br />
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht<br />
bekanntgemacht, so darf der Landkreis<br />
1. finanzielle Leistungen erbringen, zu denen er rechtlich verpflichtet ist<br />
oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar<br />
sind; er darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen<br />
des Finanzhaushalts beziehungsweise des Vermögenshaushalts, für die im<br />
Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen,<br />
2. die in der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den<br />
Sätzen des Vorjahres erheben,<br />
3. Kredite umschulden,<br />
4. Kassenkredite bis zu dem zuletzt in einer Haushaltssatzung<br />
festgelegten Höchstbetrag oder, wenn besondere Umstände im Einzelfall<br />
eine Erhöhung rechtfertigen, auch darüber hinaus aufnehmen.<br />
(2) 1 Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der<br />
Beschaffungen und der sonstigen Leistungen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus,<br />
darf der Landkreis Kredite für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel des<br />
durchschnittlichen Betrags der für die vier Vorjahre festgesetzten Kredite<br />
aufnehmen. 2 Eine angemessene Erhöhung dieser Kreditaufnahme ist<br />
zulässig, wenn besondere Umstände im Einzelfall die Erhöhung<br />
rechtfertigen.<br />
(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das<br />
neue Jahr erlassen ist.<br />
(4) 1 Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 und Abs. 2 bedürfen der<br />
Genehmigung. 2 Der Landkreis hat im Antrag darzulegen, wie und bis<br />
wann er den Erlass einer Haushaltssatzung sicherstellen kann. 3 Die<br />
Genehmigung darf den Zielen der Wiederherstellung einer geordneten<br />
Haushaltswirtschaft und der dauernden Leistungsfähigkeit nicht<br />
widersprechen; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.<br />
Bay LKrO Art. 64 Mittelfristige Finanzplanung<br />
(1) 1 Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige<br />
Finanzplanung zugrunde zu legen. 2 Das erste Planungsjahr der<br />
Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.<br />
(2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm<br />
aufzustellen.<br />
(3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen<br />
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben und die<br />
Deckungsmöglichkeiten darzustellen.<br />
(4) Der Finanzplan ist dem Kreistag spätestens mit dem Entwurf der<br />
Haushaltssatzung vorzulegen.<br />
(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der<br />
Entwicklung anzupassen und fortzuführen.
2. ABSCHNITT Kreditwesen<br />
Bay LKrO Art. 65 Kredite<br />
(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des Art. 56 Abs. 3 nur im<br />
Finanzhaushalt beziehungsweise im Vermögenshaushalt und nur für<br />
Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und zur<br />
Umschuldung aufgenommen werden.<br />
(2) 1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen<br />
und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der<br />
Haushaltssatzung der Genehmigung (Gesamtgenehmigung). 2 Die<br />
Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten<br />
Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter<br />
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 3 Sie ist in der Regel zu<br />
versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden<br />
Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht im Einklang stehen.<br />
(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr<br />
folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste<br />
Jahr nicht rechtzeitig amtlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlaß dieser<br />
Haushaltssatzung.<br />
(4) 1 Die Aufnahme der einzelnen Kredite bedarf der Genehmigung<br />
(Einzelgenehmigung), sobald die Kreditaufnahmen für die Landkreise nach<br />
§ 19 des <strong>Gesetze</strong>s zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der<br />
Wirtschaft beschränkt worden sind. 2 Die Einzelgenehmigung kann nach<br />
Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden.<br />
(5) 1 Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit den<br />
Staatsministerien der Finanzen und für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr<br />
und Technologie durch Rechtsverordnung die Aufnahme von Krediten von<br />
der Genehmigung (Einzelgenehmigung) abhängig machen, wenn der<br />
Konjunkturrat für die öffentliche Hand nach § 18 Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s zur<br />
Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft eine<br />
Beschränkung der Kreditaufnahme durch die Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände empfohlen hat. 2 Die Genehmigung ist zu versagen,<br />
wenn dies zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen<br />
Gleichgewichts geboten ist oder wenn die Kreditbedingungen wirtschaftlich<br />
nicht vertretbar sind. 3 Solche Rechtsverordnungen sind auf längstens ein<br />
Jahr zu befristen.<br />
(6) 1 Der Landkreis darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten<br />
bestellen. 2 Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn<br />
die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.<br />
Bay LKrO Art. 66 Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten<br />
(1) Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich<br />
gleichkommen, bedarf der Genehmigung.<br />
(2) 1 Der Landkreis darf Bürgschaften, Gewährverträge und Verpflichtungen<br />
aus verwandten Rechtsgeschäften, die ein Einstehen für fremde Schuld<br />
oder für den Eintritt oder Nichteintritt bestimmter Umstände zum<br />
Gegenstand haben, nur zur Erfüllung seiner Aufgaben übernehmen. 2 Die
Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung, wenn sie nicht im Rahmen<br />
der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.<br />
(3) Der Landkreis bedarf zur Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter<br />
der Genehmigung.<br />
(4) 1 Für die Genehmigung gelten Art. 65 Abs. 2 Sätze 2 und 3, im Fall der<br />
vorläufigen Haushaltsführung Art. 63 Abs. 4 Sätze 2 und 3 entsprechend.<br />
2<br />
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn das Rechtsgeschäft nicht eine<br />
Investition zum Gegenstand hat, sondern auf die Erzielung wirtschaftlicher<br />
Vorteile dadurch gerichtet ist, dass der Landkreis einem Dritten<br />
inländische steuerliche Vorteile verschafft.<br />
(5) Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung Rechtsgeschäfte<br />
von der Genehmigung freistellen,<br />
1. die die Landkreise zur Erfüllung bestimmter Aufgaben eingehen oder<br />
2. die für die Landkreise keine besondere Belastung bedeuten oder<br />
3. die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren.<br />
Bay LKrO Art. 67 Kassenkredite<br />
(1) Zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen beziehungsweise<br />
Ausgaben kann der Landkreis Kassenkredite bis zu dem in der<br />
Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die<br />
Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.<br />
(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag soll für die<br />
Haushaltswirtschaft ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten<br />
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beziehungsweise ein<br />
Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmmen und für<br />
den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge<br />
nicht übersteigen.<br />
3. ABSCHNITT Vermögenswirtschaft<br />
a) Allgemeines<br />
Bay LKrO Art. 68 Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze<br />
(1) Der Landkreis soll Vermögensgegenstände nur erwerben, wenn das zur<br />
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.<br />
(2) 1 Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten<br />
und ordnungsgemäß nachzuweisen. 2 Bei Geldanlagen ist auf eine<br />
ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag<br />
bringen.<br />
(3) 1 Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder<br />
Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.<br />
2<br />
Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen<br />
nur in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung<br />
notwendig ist.
Bay LKrO Art. 69 Veräußerung von Vermögen<br />
(1) 1 Der Landkreis darf Vermögensgegenstände, die er zur Erfüllung seiner<br />
Aufgaben nicht braucht, veräußern. 2 Vermögensgegenstände dürfen in<br />
der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.<br />
(2) 1 Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands gilt<br />
Absatz 1 entsprechend. 2 Ausnahmen sind insbesondere zulässig bei der<br />
Vermietung von Gebäuden zur Sicherung preiswerten Wohnens und zur<br />
Sicherung der Existenz kleiner und ertragsschwacher Gewerbebetriebe.<br />
(3) 1 Die Verschenkung und die unentgeltliche Überlassung von<br />
Landkreisvermögen sind unzulässig (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 der<br />
Verfassung). 2 Die Veräußerung oder Überlassung von Landkreisvermögen<br />
in Erfüllung von Kreisaufgaben oder herkömmlicher Anstandspflichten fällt<br />
nicht unter dieses Verbot.<br />
(4) Landkreisvermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung des<br />
Landkreises und nur dann in Stiftungsvermögen eingebracht werden,<br />
wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht<br />
werden kann.<br />
Bay LKrO Art. 70 Rücklagen, Rückstellungen<br />
(1) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten<br />
kommunalen Buchführung hat der Landkreis seine stetige<br />
Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 2 Überschüsse der Ergebnisrechnung<br />
sind den Rücklagen zuzuführen, soweit nicht Fehlbeträge aus Vorjahren<br />
auszugleichen sind.<br />
(2) Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen<br />
Buchführung sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unterlassene<br />
Aufwendungen für Instandhaltung Rückstellungen zu bilden.<br />
(3) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik hat der<br />
Landkreis für Zwecke des Vermögenshaushalts und zur Sicherung der<br />
Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden.<br />
2<br />
Rücklagen für andere Zwecke sind zulässig.<br />
Bay LKrO Art. 71 Zwangsvollstreckung in Landkreisvermögen wegen<br />
einer Geldforderung<br />
(1) 1 Der Gläubiger einer bürgerlich-rechtlichen Geldforderung gegen den<br />
Landkreis muß, soweit er nicht dingliche Rechte verfolgt, vor der<br />
Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen dieser Forderung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde eine beglaubigte Abschrift des vollstreckbaren<br />
Titels zustellen. 2 Die Zwangsvollstreckung darf erst einen Monat nach der<br />
Zustellung an die Rechtsaufsichtsbehörde beginnen.<br />
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für öffentlich-rechtliche Geldforderungen,<br />
soweit nicht Sondervorschriften bestehen.<br />
(3) Über das Vermögen des Landkreises findet ein Insolvenz-, Konkurs- oder<br />
gerichtliches Vergleichsverfahren nicht statt.
) Vom Landkreis verwaltete nichtrechtsfähige<br />
(fiduziarische) Stiftungen<br />
Bay LKrO Art. 72 Begriff; Verwaltung<br />
(1) Vermögenswerte, die der Landkreis von Dritten unter der Auflage<br />
entgegennimmt, sie zu einem bestimmten öffentlichen Zweck zu<br />
verwenden, ohne daß eine rechtsfähige Stiftung entsteht, sind ihrer<br />
Zweckbestimmung gemäß nach den für das Kreisvermögen geltenden<br />
Vorschriften zu verwalten.<br />
(2) 1 Die Vermögenswerte sind in ihrem Bestand ungeschmälert zu erhalten.<br />
2<br />
Sie sind vom übrigen Kreisvermögen getrennt zu verwalten und so<br />
anzulegen, daß sie für ihren Verwendungszweck verfügbar sind.<br />
(3) 1 Der Ertrag darf nur für den Stiftungszweck verwendet werden. 2 Ist eine<br />
Minderung eingetreten, so sollen die Vermögensgegenstände aus dem<br />
Ertrag wieder ergänzt werden.<br />
Bay LKrO Art. 73 Änderung des Verwendungszwecks; Aufhebung<br />
der Zweckbestimmung<br />
1 Soweit eine Änderung des Verwendungszwecks oder die Aufhebung der<br />
Zweckbestimmung zulässig ist, beschließt hierüber der Kreistag. 2 Der Beschluß<br />
bedarf der Genehmigung.<br />
4. ABSCHNITT Unternehmen des Landkreises<br />
Bay LKrO Art. 74 Rechtsformen<br />
Der Landkreis kann Unternehmen außerhalb seiner allgemeinen Verwaltung in<br />
folgenden Rechtsformen betreiben:<br />
1. als Eigenbetrieb,<br />
2. als selbständiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts,<br />
3. in den Rechtsformen des Privatrechts.<br />
Bay LKrO Art. 75 Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und<br />
Beteiligungen<br />
(1) 1 Der Landkreis darf ein Unternehmen im Sinn von Art. 74 nur errichten,<br />
übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn<br />
1. ein öffentlicher Zweck das Unternehmen erfordert, insbesondere wenn<br />
der Landkreis mit ihm gesetzliche Verpflichtungen oder seine Aufgaben<br />
gemäß Art. 51 erfüllen will,<br />
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen<br />
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum<br />
voraussichtlichen Bedarf steht,<br />
3. die dem Unternehmen zu übertragenden Aufgaben für die<br />
Wahrnehmung außerhalb der allgemeinen Verwaltung geeignet sind,<br />
4. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der<br />
Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird<br />
oder erfüllt werden kann.<br />
2 Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen der Landkreis oder<br />
seine Unternehmen an dem vom Wettbewerb beherrschten
Wirtschaftsleben teilnehmen, um Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem<br />
öffentlichen Zweck. 3 Soweit Unternehmen entgegen Satz 2 vor dem<br />
1. September 1998 errichtet oder übernommen wurden, dürfen sie<br />
weitergeführt, jedoch nicht erweitert werden.<br />
(2) Der Landkreis darf mit seinen Unternehmen außerhalb des Kreisgebiets<br />
nur tätig werden, wenn dafür die Voraussetzungen des Absatzes 1<br />
vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen<br />
Gebietskörperschaften gewahrt sind.<br />
(3) 1 Für die Beteiligung des Landkreises an einem Unternehmen gilt Absatz 1<br />
entsprechend. 2 Absatz 2 gilt entsprechend, wenn sich der Landkreis an<br />
einem auch außerhalb seines Gebiets tätigen Unternehmen in einem<br />
Ausmaß beteiligt, das den auf das Kreisgebiet entfallenden Anteil an den<br />
Leistungen des Unternehmens erheblich übersteigt.<br />
(4) 1 Bankunternehmen darf der Landkreis weder errichten noch sich an ihnen<br />
beteiligen. 2 Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den<br />
besonderen Vorschriften.<br />
Bay LKrO Art. 76 Eigenbetriebe<br />
(1) Eigenbetriebe sind Unternehmen des Landkreises, die außerhalb der<br />
allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene<br />
Rechtspersönlichkeit geführt werden.<br />
(2) Für Eigenbetriebe bestellt der Kreistag eine Werkleitung und einen<br />
Werkausschuß.<br />
(3) 1 Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs. 2 Sie ist<br />
insoweit zur Vertretung nach außen befugt; der Kreistag kann ihr mit<br />
Zustimmung des Landrats weitere Vertretungsbefugnisse übertragen. 3 Die<br />
Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im Eigenbetrieb und führt<br />
die Dienstaufsicht über sie und die im Eigenbetrieb tätigen Angestellten<br />
und Arbeiter. 4 Der Kreistag kann mit Zustimmung des Landrats der<br />
Werkleitung für Beamte, Angestellte und Arbeiter im Eigenbetrieb<br />
personalrechtliche Befugnisse in entsprechender Anwendung von Art. 38<br />
Abs. 2 übertragen.<br />
(4) 1 Im übrigen beschließt über die Angelegenheiten des Eigenbetriebs der<br />
Werkausschuß, soweit nicht der Kreistag sich die Entscheidung allgemein<br />
vorbehält oder im Einzelfall an sich zieht. 2 Der Werkausschuß ist ein<br />
beschließender Ausschuß im Sinn der Art. 29 und 49. 3 Im Fall des Art. 38<br />
Abs. 1 Satz 2 sollen Befugnisse gegenüber Beamten, Angestellten und<br />
Arbeitern im Eigenbetrieb auf den Werkausschuß übertragen werden.<br />
(5) 1 Die Art. 55, 56, 61, 63 bis 66, 67 Abs. 1, Art. 68, 69, 71, 86 Abs. 4 und<br />
Art. 87 gelten entsprechend. 2 Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften<br />
werden die Angelegenheiten des Eigenbetriebs durch eine Betriebssatzung<br />
geregelt.<br />
(6) 1 Der Landkreis kann Einrichtungen innerhalb der allgemeinen Verwaltung<br />
(Regiebetriebe) ganz oder teilweise nach den Vorschriften über die<br />
Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe führen, wenn die Abweichung von<br />
den allgemeinen kommunalwirtschaftlichen Vorschriften nach Art und<br />
Umfang der Einrichtung zweckmäßig ist. 2 Hierbei können auch
Regelungen getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetriebe<br />
geltenden Vorschriften abweichen.<br />
Bay LKrO Art. 77 Selbständige Kommunalunternehmen des<br />
öffentlichen Rechts<br />
(1) 1 Der Landkreis kann selbständige Unternehmen in der Rechtsform einer<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) errichten oder<br />
bestehende Regie- und Eigenbetriebe im Weg der Gesamtrechtsnachfolge<br />
in Kommunalunternehmen umwandeln. 2 Das Kommunalunternehmen<br />
kann sich nach Maßgabe der Unternehmenssatzung und in entsprechender<br />
Anwendung der für den Landkreis geltenden Vorschriften an anderen<br />
Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient.<br />
(2) 1 Der Landkreis kann dem Kommunalunternehmen einzelne oder alle mit<br />
einem bestimmten Zweck zusammenhängende Aufgaben ganz oder<br />
teilweise übertragen. 2 Er kann nach Maßgabe des Art. 18 durch<br />
gesonderte Satzung einen Anschluß- und Benutzungszwang zugunsten des<br />
Kommunalunternehmens festlegen und das Unternehmen zur<br />
Durchsetzung entsprechend Art. 21 ermächtigen. 3 Er kann ihm auch das<br />
Recht einräumen, an seiner Stelle Satzungen und, soweit <strong>Landesrecht</strong> zu<br />
deren Erlaß ermächtigt, auch Verordnungen für das übertragene<br />
Aufgabengebiet zu erlassen; Art. 20 gilt sinngemäß.<br />
(2 a) 1 Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem<br />
ausschließlich der Landkreis beteiligt ist, kann durch Formwechsel in ein<br />
Kommunalunternehmen umgewandelt werden. 2 Die Umwandlung ist nur<br />
zulässig, wenn keine Sonderrechte im Sinn des § 23 des<br />
Umwandlungsgesetzes (UmwG) und keine Rechte Dritter an den Anteilen<br />
des Landkreises bestehen. 3 Der Formwechsel setzt den Erlass der<br />
Unternehmenssatzung durch den Landkreis und einen sich darauf<br />
beziehenden Umwandlungsbeschluss der formwechselnden Gesellschaft<br />
voraus. 4 Die §§ 193 bis 195, 197 bis 199, 200 Abs. 1 und § 201 UmwG<br />
sind entsprechend anzuwenden. 5 Die Anmeldung zum Handelsregister<br />
entsprechend § 198 UmwG erfolgt durch das Vertretungsorgan der<br />
Kapitalgesellschaft. 6 Abweichend von Abs. 3 Satz 4 wird die Umwandlung<br />
einer Kapitalgesellschaft in ein Kommunalunternehmen mit dessen<br />
Eintragung oder, wenn es nicht eingetragen wird, mit der Eintragung der<br />
Umwandlung in das Handelsregister wirksam; § 202 Abs. 1 und Abs. 3<br />
UmwG ist entsprechend anzuwenden. 7 Ist bei der Kapitalgesellschaft ein<br />
Betriebsrat eingerichtet, bleibt dieser nach dem Wirksamwerden der<br />
Umwandlung als Personalrat des Kommunalunternehmens bis zu den<br />
nächsten regelmäßigen Personalratswahlen bestehen.<br />
(3) 1 Der Landkreis regelt die Rechtsverhältnisse des Kommunalunternehmens<br />
durch eine Unternehmenssatzung. 2 Die Unternehmenssatzung muß<br />
Bestimmungen über den Namen und die Aufgaben des Unternehmens, die<br />
Anzahl der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats und die<br />
Höhe des Stammkapitals enthalten. 3 Der Landkreis hat die<br />
Unternehmenssatzung und deren Änderungen gemäß Art. 20 Abs. 2<br />
bekanntzumachen. 4 Das Kommunalunternehmen entsteht am Tag nach<br />
der Bekanntmachung, wenn nicht in der Unternehmenssatzung ein<br />
späterer Zeitpunkt bestimmt ist.
(4) Der Landkreis haftet für die Verbindlichkeiten des<br />
Kommunalunternehmens unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus<br />
dessen Vermögen zu erlangen ist (Gewährträgerschaft).<br />
Bay LKrO Art. 78 Organe des Kommunalunternehmens, Personal<br />
(1) 1 Das Kommunalunternehmen wird von einem Vorstand in eigener<br />
Verantwortung geleitet, soweit nicht gesetzlich oder durch die<br />
Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist. 2 Der Vorstand vertritt<br />
das Kommunalunternehmen nach außen. 3 Der Landkreis hat darauf<br />
hinzuwirken, daß jedes Vorstandsmitglied vertraglich verpflichtet wird, die<br />
ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9<br />
Buchst. a des Handelsgesetzbuchs dem Landkreis jährlich zur<br />
Veröffentlichung mitzuteilen.<br />
(2) 1 Die Geschäftsführung des Vorstands wird von einem Verwaltungsrat<br />
überwacht. 2 Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf höchstens fünf<br />
Jahre; eine erneute Bestellung ist zulässig. 3 Er entscheidet außerdem<br />
über<br />
1. den Erlaß von Satzungen und Verordnungen gemäß Art. 77 Abs. 2<br />
Satz 3,<br />
2. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,<br />
3. die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die<br />
Leistungsnehmer,<br />
4. die Beteiligung des Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen,<br />
5. die Bestellung des Abschlußprüfers,<br />
6. die Ergebnisverwendung.<br />
4<br />
Im Fall des Satzes 3 Nr. 1 unterliegen die Mitglieder des Verwaltungsrats<br />
den Weisungen des Kreistags. 5 Die Unternehmenssatzung kann vorsehen,<br />
daß der Kreistag den Mitgliedern des Verwaltungsrats auch in bestimmten<br />
anderen Fällen Weisungen erteilen kann. 6 Die Abstimmung entgegen der<br />
Weisung berührt die Gültigkeit des Beschlusses des Verwaltungsrats nicht.<br />
7<br />
Für den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gilt Art. 43<br />
entsprechend.<br />
(3) 1 Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und den<br />
übrigen Mitgliedern. 2 Den Vorsitz führt der Landrat; mit seiner<br />
Zustimmung kann der Kreistag eine andere Person zum vorsitzenden<br />
Mitglied bestellen. 3 Das vorsitzende Mitglied nach Satz 2 Halbsatz 2 und<br />
die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Kreistag für sechs<br />
Jahre bestellt. 4 Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die<br />
dem Kreistag angehören, endet mit dem Ende der Wahlzeit oder dem<br />
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Kreistag. 5 Die Mitglieder des<br />
Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder<br />
weiter aus. 6 Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht sein:<br />
1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Angestellte des<br />
Kommunalunternehmens,<br />
2. leitende Beamte und leitende Angestellte von juristischen Personen<br />
oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an<br />
denen das Kommunalunternehmen mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine<br />
Beteiligung am Stimmrecht genügt,
3. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar<br />
mit Aufgaben der Aufsicht über das Kommunalunternehmen befaßt sind.<br />
(4) 1 Das Kommunalunternehmen hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu<br />
sein, wenn es auf Grund einer Aufgabenübertragung nach Art. 77 Abs. 2<br />
hoheitliche Befugnisse ausübt. 2 Wird es aufgelöst, hat der Landkreis die<br />
Beamten und Versorgungsempfänger zu übernehmen. 3 Wird das<br />
Unternehmensvermögen ganz oder teilweise auf andere juristische<br />
Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übertragen, so<br />
gelten für die Übernahme und die Rechtsstellung der Beamten und<br />
Versorgungsempfänger des Kommunalunternehmens Art. 51 bis 54 und<br />
69 des Bayerischen Beamtengesetzes, bei länderübergreifendem<br />
Vermögensübergang §§ 16 bis 19 des Beamtenstatusgesetzes.<br />
(5) 1 Beamten in einem Regie- oder Eigenbetrieb, der nach Art. 77 Abs. 1<br />
Satz 1 ganz oder teilweise in ein Kommunalunternehmen umgewandelt<br />
wird, kann im dienstlichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer<br />
Zustimmung eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit bei dem<br />
Kommunalunternehmen zugewiesen werden. 2 Die Zuweisung bedarf nicht<br />
der Zustimmung des Beamten, wenn dringende öffentliche Interessen sie<br />
erfordern. 3 Die Rechtsstellung des Beamten bleibt unberührt. 4 Über die<br />
Zuweisung entscheidet die oberste Dienstbehörde.<br />
Bay LKrO Art. 79 Sonstige Vorschriften für Kommunalunternehmen<br />
(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht werden nach den für große<br />
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs<br />
aufgestellt und geprüft, sofern nicht weitergehende gesetzliche<br />
Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.<br />
(2) Die Organe der Rechnungsprüfung der Landkreise haben das Recht, sich<br />
zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach Art. 92 Abs. 4 Sätze 2<br />
und 3 auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck den<br />
Betrieb, die Bücher und Schriften des Kommunalunternehmens<br />
einzusehen.<br />
(3) Die Art. 3 Abs. 2, Art. 55, 56, 63, 64, 68, 69, 71 und 87 und die<br />
Vorschriften des Vierten Teils über die staatliche Aufsicht und die<br />
Rechtsmittel sind sinngemäß anzuwenden.<br />
(4) Das Unternehmen ist zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in<br />
demselben Umfang berechtigt wie der Landkreis, wenn es auf Grund einer<br />
Aufgabenübertragung nach Art. 77 Abs. 2 hoheitliche Befugnisse ausübt<br />
und bei der Aufgabenübertragung nichts Abweichendes geregelt wird.<br />
Bay LKrO Art. 80 Unternehmen in Privatrechtsform<br />
(1) 1 Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform und Beteiligungen des<br />
Landkreises an Unternehmen in Privatrechtsform sind nur zulässig, wenn<br />
1. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sichergestellt ist, daß das<br />
Unternehmen den öffentlichen Zweck gemäß Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1<br />
erfüllt,<br />
2. der Landkreis angemessenen Einfluß im Aufsichtsrat oder in einem<br />
entsprechenden Gremium erhält,<br />
3. die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten, seiner
Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird; die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde kann von der Haftungsbegrenzung befreien.<br />
2<br />
Zur Sicherstellung des öffentlichen Zwecks von Gesellschaften mit<br />
beschränkter Haftung soll im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung<br />
bestimmt werden, daß die Gesellschafterversammlung auch über den<br />
Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen und<br />
über den Abschluß und die Änderung von Unternehmensverträgen<br />
beschließt. 3 In der Satzung von Aktiengesellschaften soll bestimmt<br />
werden, daß zum Erwerb und zur Veräußerung von Unternehmen und<br />
Beteiligungen die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig ist.<br />
(2) Der Landkreis darf dem Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen durch<br />
Unternehmen in Privatrechtsform, an denen er unmittelbar oder mittelbar<br />
beteiligt ist, nur unter entsprechender Anwendung der für ihn selbst<br />
geltenden Vorschriften zustimmen.<br />
Bay LKrO Art. 81 Vertretung des Landkreises in Unternehmen in<br />
Privatrechtsform<br />
(1) 1 Der Landrat vertritt den Landkreis in der Gesellschafterversammlung<br />
oder einem entsprechenden Organ. 2 Mit Zustimmung des Landrats und<br />
seines gewählten Stellvertreters kann der Kreistag eine andere Person zur<br />
Vertretung widerruflich bestellen.<br />
(2) 1 Der Landkreis soll bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder<br />
der Satzung darauf hinwirken, daß ihm das Recht eingeräumt wird,<br />
Mitglieder in einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu<br />
entsenden, soweit das zur Sicherung eines angemessenen Einflusses<br />
notwendig ist. 2 Vorbehaltlich entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften<br />
haben Personen, die vom Landkreis entsandt oder auf seine Veranlassung<br />
gewählt wurden, den Landkreis über alle wichtigen Angelegenheiten<br />
möglichst frühzeitig zu unterrichten und ihm auf Verlangen Auskunft zu<br />
erteilen. 3 Soweit zulässig, soll sich der Landkreis ihnen gegenüber<br />
Weisungsrechte im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung vorbehalten.<br />
(3) 1 Wird die Person, die den Landkreis vertritt, oder werden die in Absatz 2<br />
genannten Personen aus ihrer Tätigkeit haftbar gemacht, stellt der<br />
Landkreis sie von der Haftung frei. 2 Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit<br />
kann der Landkreis Rückgriff nehmen, es sei denn, das schädigende<br />
Verhalten beruhte auf seiner Weisung. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten<br />
entsprechend für Personen, die auf Veranlassung des Landkreises als<br />
nebenamtliche Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans<br />
bestellt sind.<br />
Bay LKrO Art. 82 Sonstige Vorschriften für Unternehmen in<br />
Privatrechtsform<br />
(1) 1 Gehören dem Landkreis Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53<br />
des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) bezeichneten Umfang, so hat er<br />
1. darauf hinzuwirken, daß in sinngemäßer Anwendung der für<br />
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein<br />
Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige<br />
Finanzplanung zugrunde gelegt wird,<br />
2. dafür Sorge zu tragen, daß der Jahresabschluß und der Lagebericht
nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des<br />
Handelsgesetzbuchs aufgestellt und geprüft werden, sofern nicht<br />
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche<br />
Vorschriften entgegenstehen,<br />
3. die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG auszuüben,<br />
4. darauf hinzuwirken, daß ihm und dem Bayerischen Kommunalen<br />
Prüfungsverband die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt<br />
werden,<br />
5. darauf hinzuwirken, daß jedes Mitglied des geschäftsführenden<br />
Unternehmensorgans vertraglich verpflichtet wird, die ihm im<br />
Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9<br />
Buchst. a des Handelsgesetzbuchs dem Landkreis jährlich zur<br />
Veröffentlichung entsprechend Absatz 3 Satz 2 mitzuteilen.<br />
2<br />
Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.<br />
(2) 1 Ist eine Beteiligung des Landkreises an einem Unternehmen keine<br />
Mehrheitsbeteiligung im Sinn des § 53 HGrG, so soll der Landkreis, soweit<br />
sein Interesse das erfordert, darauf hinwirken, daß in der Satzung oder im<br />
Gesellschaftsvertrag dem Landkreis die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG und<br />
dem Landkreis und dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband die<br />
Befugnisse nach § 54 HGrG eingeräumt werden. 2 Bei mittelbaren<br />
Beteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der<br />
Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der der Landkreis<br />
allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften oder deren<br />
Zusammenschlüssen mit Mehrheit im Sinn des § 53 HGrG beteiligt ist.<br />
(3) 1 Der Landkreis hat jährlich einen Bericht über seine Beteiligungen an<br />
Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihm<br />
mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört.<br />
2<br />
Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des<br />
öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung<br />
der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des<br />
geschäftsführenden Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5, die<br />
Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. 3 Haben die Mitglieder des<br />
geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis mit der<br />
Veröffentlichung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, sind ihre Gesamtbezüge<br />
so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften<br />
des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluß<br />
aufgenommen werden. 4 Der Bericht ist dem Kreistag vorzulegen. 5 Der<br />
Landkreis weist ortsüblich darauf hin, daß jeder Einsicht in den Bericht<br />
nehmen kann.<br />
Bay LKrO Art. 83 Grundsätze für die Führung von Unternehmen des<br />
Landkreises<br />
(1) 1 Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen sind unter Beachtung<br />
betriebswirtschaftlicher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit so zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt wird.<br />
2 Entsprechendes gilt für die Steuerung und Überwachung von<br />
Unternehmen in Privatrechtsform, an denen der Landkreis mit mehr als<br />
50 v. H. beteiligt ist; bei einer geringeren Beteiligung soll der Landkreis<br />
darauf hinwirken.
(2) Unternehmen des Landkreises dürfen keine wesentliche Schädigung und<br />
keine Aufsaugung selbständiger Betriebe in Landwirtschaft, Handwerk,<br />
Handel, Gewerbe und Industrie bewirken.<br />
Bay LKrO Art. 84 Anzeigepflichten<br />
(1) 1 Entscheidungen des Landkreises über<br />
1. die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung sowie die<br />
Änderung der Rechtsform oder der Aufgaben von Unternehmen des<br />
Landkreises,<br />
2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des Landkreises an<br />
Unternehmen,<br />
3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung von Unternehmen oder<br />
Beteiligungen des Landkreises,<br />
4. die Auflösung von Kommunalunternehmen<br />
sind der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig, mindestens aber sechs<br />
Wochen vor ihrem Vollzug vorzulegen. 2 In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2<br />
und 3 besteht keine Anzeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als<br />
den zwanzigsten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft. 3 Aus der<br />
Vorlage muß zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt<br />
sind. 4 Die Unternehmenssatzung von Kommunalunternehmen ist der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde stets vorzulegen.<br />
(2) Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 und die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für<br />
die Entscheidungen des Verwaltungsrats eines Kommunalunternehmens.<br />
Bay LKrO Artikel 85 (weggefallen)<br />
5. ABSCHNITT Kassen- und Rechnungswesen<br />
Bay LKrO Art. 86 Kreiskasse<br />
(1) Die Kreiskasse erledigt alle Kassengeschäfte des Landkreises.<br />
(2) 1 Der Landkreis hat einen Kassenverwalter und einen Stellvertreter zu<br />
bestellen. 2 Diese Verpflichtung entfällt, wenn er seine Kassengeschäfte<br />
ganz durch eine Stelle außerhalb der Landkreisverwaltung besorgen läßt.<br />
3<br />
Die Anordnungsbefugten der Landkreisverwaltung, der Leiter und die<br />
Prüfer des Rechnungsprüfungsamts können nicht gleichzeitig die Aufgaben<br />
eines Kassenverwalters oder seines Stellvertreters wahrnehmen.<br />
(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen weder miteinander<br />
noch mit den Anordnungsbefugten der Landkreisverwaltung, dem Leiter<br />
und den Prüfern des Rechnungsprüfungsamts durch ein<br />
Angehörigenverhältnis im Sinn des Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes verbunden sein.<br />
(4) 1 Sonderkassen sollen mit der Kreiskasse verbunden werden. 2 Ist eine<br />
Sonderkasse nicht mit der Kreiskasse verbunden, gelten für den Verwalter<br />
der Sonderkasse und dessen Stellvertreter die Absätze 2 und 3<br />
entsprechend.
Bay LKrO Art. 87 Übertragung von Kassen- und Rechnungsgeschäften<br />
Der Landkreis kann das Ermitteln von Ansprüchen und von<br />
Zahlungsverpflichtungen, das Vorbereiten der entsprechenden<br />
Kassenanordnungen, die Kassengeschäfte und das Rechnungswesen ganz oder<br />
zum Teil von einer Stelle außerhalb der Landkreisverwaltung besorgen lassen,<br />
wenn die ordnungsgemäße und sichere Erledigung und die Prüfung nach den<br />
für den Landkreis geltenden Vorschriften gewährleistet sind.<br />
Bay LKrO Art. 88 Rechnungslegung, Jahresabschluss<br />
(1) 1 Im Jahresabschluss beziehungsweise in der Jahresrechnung ist das<br />
Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des <strong>Stand</strong>s des Vermögens<br />
und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres<br />
nachzuweisen. 2 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
doppelten kommunalen Buchführung besteht der Jahresabschluss aus der<br />
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz)<br />
und dem Anhang. 3 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der<br />
Kameralistik besteht die Jahresrechnung aus dem kassenmäßigen<br />
Abschluss und der Haushaltsrechnung. 4 Der Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht<br />
zu erläutern.<br />
(2) Der Jahresabschluss beziehungsweise die Jahresrechnung ist innerhalb<br />
von sechs Monaten, der konsolidierte Jahresabschluss (Art. 88 a)<br />
innerhalb von zehn Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres<br />
aufzustellen und sodann dem Kreisausschuss vorzulegen.<br />
(3) 1 Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der<br />
Jahresabschlüsse (Art. 89) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt<br />
der Kreistag alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das<br />
Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres den Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und<br />
beschließt über die Entlastung. 2 Ist ein konsolidierter Jahresabschluss<br />
aufzustellen (Art. 88 a), tritt an die Stelle des 30. Juni der 31. Dezember<br />
des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres. 3 Verweigert<br />
der Kreistag die Entlastung oder spricht er sie mit Einschränkung aus, hat<br />
er die dafür maßgebenden Gründe anzugeben.<br />
(4) Die Kreisräte können jederzeit die Berichte über die Prüfungen einsehen.<br />
Bay LKrO Art. 88 a Konsolidierter Jahresabschluss<br />
(1) 1 Mit dem Jahresabschluss des Landkreises sind die Jahresabschlüsse<br />
1. der außerhalb der allgemeinen Verwaltung geführten Sondervermögen<br />
ohne eigene Rechtspersönlichkeit,<br />
2. der rechtlich selbstständigen Organisationseinheiten und<br />
Vermögensmassen mit Nennkapital oder variablen Kapitalanteilen,<br />
3. der Zweckverbände mit kaufmännischer Rechnungslegung und der<br />
gemeinsamen Kommunalunternehmen und<br />
4. der von dem Landkreis verwalteten kommunalen Stiftungen mit<br />
kaufmännischem Rechnungswesen<br />
zu konsolidieren. 2 Das gilt nicht für die Jahresabschlüsse der Sparkassen.
(2) 1 Aufgabenträger nach Abs. 1 sind entsprechend den §§ 300 bis 309 des<br />
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren (Vollkonsolidierung), wenn bei dem<br />
Landkreis die dem § 290 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs<br />
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. 2 Andere Aufgabenträger als<br />
nach Satz 1 sind entsprechend den §§ 311 und 312 des<br />
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren, es sei denn, sie sind für die<br />
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes<br />
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung.<br />
3<br />
Aufgabenträger nach Abs. 1 Nr. 3 können auch entsprechend § 310 des<br />
Handelsgesetzbuchs anteilsmäßig konsolidiert werden. 4 Für den Anteil an<br />
einem Zweckverband ist der Umlageschlüssel maßgebend.<br />
(3) Der konsolidierte Jahresabschluss ist durch eine Kapitalflussrechnung zu<br />
ergänzen und durch einen Konsolidierungsbericht zu erläutern.<br />
(4) Der Landkreis hat bei den in Abs. 1 Satz 1 genannten Aufgabenträgern,<br />
Organisationseinheiten und Vermögensmassen darauf hinzuwirken, dass<br />
ihm das Recht eingeräumt wird, von diesen alle Informationen und<br />
Unterlagen zu erhalten, die er für die Konsolidierung der Jahresabschlüsse<br />
für erforderlich hält.<br />
6. ABSCHNITT Prüfungswesen<br />
Bay LKrO Art. 89 Örtliche Prüfungen<br />
(1) 1 Der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung sowie die Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen werden von einem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft<br />
(örtliche Rechnungsprüfung). 2 Über die Beratungen sind Niederschriften<br />
aufzunehmen.<br />
(2) Der Kreistag bildet aus seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuß<br />
mit mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern und bestimmt ein<br />
Ausschußmitglied zum Vorsitzenden; Art. 33 Satz 1 findet keine<br />
Anwendung.<br />
(3) 1 Zur Prüfung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten<br />
Jahresabschlusses sowie der Jahresrechnung können Sachverständige<br />
zugezogen werden. 2 Das Rechnungsprüfungsamt ist umfassend als<br />
Sachverständiger heranzuziehen.<br />
(4) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse ist<br />
innerhalb von zwölf Monaten, die des konsolidierten Jahresabschlusses<br />
innerhalb von 18 Monaten nach Abschluß des Haushaltsjahres<br />
durchzuführen.<br />
(5) 1 Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem Landrat. 2 Er bedient sich des<br />
Rechnungsprüfungsamts.<br />
Bay LKrO Art. 90 Rechnungsprüfungsamt<br />
(1) Landkreise müssen ein Rechnungsprüfungsamt einrichten.<br />
(2) 1 Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der örtlichen Rechnungsprüfung dem<br />
Kreistag und bei den örtlichen Kassenprüfungen dem Landrat unmittelbar
verantwortlich. 2 Der Kreistag und der Landrat können besondere Aufträge<br />
zur Prüfung der Verwaltung erteilen. 3 Das Rechnungsprüfungsamt ist bei<br />
der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz<br />
unterworfen. 4 Im übrigen bleiben die Befugnisse des Landrats unberührt,<br />
dem das Rechnungsprüfungsamt unmittelbar untersteht.<br />
(3) 1 Der Kreistag bestellt den Leiter, seinen Stellvertreter und die Prüfer des<br />
Rechnungsprüfungsamts und beruft sie ab. 2 Der Kreistag kann den Leiter<br />
des Rechnungsprüfungsamts und seinen Stellvertreter gegen ihren Willen<br />
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der<br />
Mitglieder des Kreistags abberufen, wenn sie ihre Aufgabe nicht<br />
ordnungsgemäß erfüllen. 3 Die Abberufung von Prüfern des<br />
Rechnungsprüfungsamts gegen ihren Willen bedarf einer Mehrheit von<br />
zwei Dritteln der stimmberechtigten Kreisräte.<br />
(4) 1 Der Leiter des Rechnungsprüfungsamts muß Beamter auf Lebenszeit<br />
sein. 2 Er muß mindestens die Befähigung für den gehobenen<br />
nichttechnischen Verwaltungsdienst und die für sein Amt erforderliche<br />
Erfahrung und Eignung besitzen.<br />
(5) 1 Der Leiter, sein Stellvertreter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts<br />
dürfen eine andere Stellung in dem Landkreis nur innehaben, wenn das<br />
mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 2 Sie dürfen Zahlungen für den<br />
Landkreis weder anordnen noch ausführen. 3 Für den Leiter des<br />
Rechnungsprüfungsamts und seinen Stellvertreter gilt außerdem Art. 86<br />
Abs. 3 entsprechend.<br />
Bay LKrO Art. 91 Überörtliche Prüfungen<br />
(1) Die überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfungen werden vom<br />
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (überörtliches Prüfungsorgan)<br />
durchgeführt.<br />
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung findet alsbald nach der Feststellung<br />
des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses<br />
beziehungsweise der Jahresrechnung sowie der Jahresabschlüsse der<br />
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen statt.<br />
Bay LKrO Art. 92 Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen<br />
(1) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die<br />
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere<br />
darauf, ob<br />
1. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten worden sind,<br />
2. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen<br />
beziehungsweise die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind<br />
sowie der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss<br />
beziehungsweise die Jahresrechnung sowie die Vermögensnachweise<br />
ordnungsgemäß aufgestellt sind,<br />
3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,<br />
4. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf<br />
andere Weise wirksamer erfüllt werden können.
(2) 1 Die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser einschließlich der<br />
Jahresabschlüsse unterliegen der Rechnungsprüfung. 2 Absatz 1 gilt<br />
entsprechend.<br />
(3) 1 Die Rechnungsprüfung umfaßt auch die Wirtschaftsführung der<br />
Eigenbetriebe unter entsprechender Anwendung des Absatzes 1. 2 Dabei<br />
ist auf das Ergebnis der Abschlußprüfung (Art. 93) mit abzustellen.<br />
(4) 1 Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird die Betätigung des Landkreises<br />
bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der<br />
Landkreis unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung<br />
kaufmännischer Grundsätze mitgeprüft. 2 Entsprechendes gilt bei Erwerbsund<br />
Wirtschaftsgenossenschaften, in denen der Landkreis Mitglied ist,<br />
sowie bei Kommunalunternehmen. 3 Die Rechnungsprüfung umfaßt ferner<br />
die Buch-, Betriebs- und sonstigen Prüfungen, die sich der Landkreis bei<br />
der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat.<br />
(5) Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsmäßige Erledigung der<br />
Kassengeschäfte, die ordnungsmäßige Einrichtung der Kassen und das<br />
Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft.<br />
(6) 1 Die Organe der Rechnungsprüfung des Landkreises und das überörtliche<br />
Prüfungsorgan können verlangen, dass ihnen oder ihren beauftragten<br />
Prüfern Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben für erforderlich<br />
halten, vorgelegt oder innerhalb einer bestimmten Frist übersandt werden.<br />
2 3<br />
Auskünfte sind ihnen oder ihren beauftragten Prüfern zu erteilen. Die<br />
Auskunftspflicht nach den Sätzen 1 und 2 besteht auch, soweit hierfür in<br />
anderen Bestimmungen eine besondere Rechtsvorschrift gefordert wird,<br />
und umfasst auch elektronisch gespeicherte Daten sowie deren<br />
automatisierten Abruf.<br />
Bay LKrO Art. 93 Abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und<br />
Kommunalunternehmen<br />
(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht eines Eigenbetriebs und eines<br />
Kommunalunternehmens sollen spätestens innerhalb von neun Monaten<br />
nach Schluß des Wirtschaftsjahres durch einen sachverständigen Prüfer<br />
(Abschlußprüfer) geprüft sein.<br />
(2) Die Abschlußprüfung wird vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband<br />
oder von einem Wirtschaftsprüfer oder von einer<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt.<br />
(3) 1 Die Abschlußprüfung erstreckt sich auf die Vollständigkeit und<br />
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der<br />
Buchführung und des Lageberichts. 2 Dabei werden auch geprüft<br />
1. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,<br />
2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität<br />
und Rentabilität,<br />
3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn<br />
diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von<br />
Bedeutung waren,<br />
4. die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen<br />
Jahresfehlbetrags.
VIERTER TEIL Staatliche Aufsicht und Rechtsmittel<br />
1. ABSCHNITT Rechtsaufsicht und Fachaufsicht<br />
Bay LKrO Art. 94 Sinn der staatlichen Aufsicht<br />
Die Aufsichtsbehörden sollen die Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
verständnisvoll beraten, fördern und schützen sowie die Entschlußkraft und die<br />
Selbstverantwortung der Kreisorgane stärken.<br />
Bay LKrO Art. 95 Inhalt und Grenzen der Aufsicht<br />
(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Art. 5) beschränkt<br />
sich die staatliche Aufsicht darauf, die Erfüllung der gesetzlich<br />
festgelegten und übernommenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben und<br />
Verpflichtungen der Landkreise und die Gesetzmäßigkeit ihrer<br />
Verwaltungstätigkeit zu überwachen (Rechtsaufsicht).<br />
(2) 1 In den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises (Art. 6)<br />
erstreckt sich die staatliche Aufsicht auch auf die Handhabung des<br />
Verwaltungsermessens der Landkreise (Fachaufsicht). 2 Eingriffe in das<br />
Verwaltungsermessen sind auf die Fälle zu beschränken, in denen<br />
1. das Gemeinwohl oder öffentlich-rechtliche Ansprüche einzelner eine<br />
Weisung oder Entscheidung erfordern oder<br />
2. die Bundesregierung nach Art. 84 Abs. 5 oder Art. 85 Abs. 3 des<br />
Grundgesetzes eine Weisung erteilt.<br />
Bay LKrO Art. 96 Rechtsaufsichtsbehörden<br />
1 Die Rechtsaufsicht über die Landkreise obliegt der Regierung. 2 Das<br />
Staatsministerium des Innern ist obere Rechtsaufsichtsbehörde der Landkreise.<br />
Bay LKrO Art. 97 Informationsrecht<br />
1 Die Rechtsaufsichtsbehörde ist befugt, sich jederzeit über alle<br />
Angelegenheiten des Landkreises zu unterrichten. 2 Sie kann insbesondere<br />
Anstalten und Einrichtungen des Landkreises besichtigen, die Geschäfts- und<br />
Kassenführung prüfen sowie Berichte und Akten einfordern.<br />
Bay LKrO Art. 98 Beanstandungsrecht<br />
1 Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechtswidrige Beschlüsse und Verfügungen<br />
des Landkreises beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung verlangen.<br />
2 Bei Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben oder Verpflichtungen kann<br />
die Rechtsaufsichtsbehörde den Landkreis zur Durchführung der notwendigen<br />
Maßnahmen auffordern.<br />
Bay LKrO Art. 99 Recht der Ersatzvornahme<br />
1 Kommt der Landkreis binnen einer ihm gesetzten angemessenen Frist den<br />
Anordnungen der Rechtsaufsichtsbehörde nicht nach, so kann diese die<br />
notwendigen Maßnahmen an Stelle des Landkreises verfügen und vollziehen.<br />
2 Die Kosten trägt der Landkreis.
Bay LKrO Art. 100 Bestellung eines Beauftragten<br />
(1) Ist der geordnete Gang der Verwaltung durch Beschlußunfähigkeit des<br />
Kreistags oder durch seine Weigerung, gesetzmäßige Anordnungen der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde auszuführen, ernstlich behindert, so kann die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde den Landrat ermächtigen, bis zur Behebung des<br />
gesetzwidrigen Zustands für den Landkreis zu handeln.<br />
(2) 1 Weigert sich der Landrat oder ist er aus tatsächlichen oder rechtlichen<br />
Gründen verhindert, die Aufgaben nach Absatz 1 wahrzunehmen, so<br />
beauftragt die Rechtsaufsichtsbehörde den gewählten Stellvertreter des<br />
Landrats, für den Landkreis zu handeln, solange es erforderlich ist. 2 Ist<br />
kein gewählter Stellvertreter des Landrats vorhanden oder ist auch er<br />
verhindert oder nicht handlungswillig, so handelt die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde für den Landkreis.<br />
(3) Die Staatsregierung kann ferner, wenn sich der gesetzwidrige Zustand<br />
anders nicht beheben lässt, den Kreistag auflösen und dessen Neuwahl<br />
anordnen.<br />
Bay LKrO Art. 101 Fachaufsichtsbehörden<br />
1 Die Zuständigkeit zur Führung der Fachaufsicht auf den einzelnen Gebieten<br />
des übertragenen Wirkungskreises bestimmt sich nach den hierfür geltenden<br />
besonderen Vorschriften. 2 Soweit solche Vorschriften nicht bestehen, obliegt<br />
den Rechtsaufsichtsbehörden auch die Führung der Fachaufsicht.<br />
Bay LKrO Art. 102 Befugnisse der Fachaufsicht<br />
(1) 1 Die Fachaufsichtsbehörden können sich über Angelegenheiten des<br />
übertragenen Wirkungskreises in gleicher Weise wie die<br />
Rechtsaufsichtsbehörden unterrichten (Art. 97). 2 Sie können ferner dem<br />
Landkreis für die Behandlung übertragener Angelegenheiten unter<br />
Beachtung des Art. 95 Abs. 2 Satz 2 Weisungen erteilen. 3 Zu<br />
weitergehenden Eingriffen in die Landkreisverwaltung sind die<br />
Fachaufsichtsbehörden unbeschadet der Entscheidung über Widersprüche<br />
(Art. 105 Nr. 2) nicht befugt.<br />
(2) 1 Die Rechtsaufsichtsbehörden sind verpflichtet, die Fachaufsichtsbehörden<br />
bei der Durchführung ihrer gesetzlichen Aufgaben nötigenfalls unter<br />
Anwendung der in den Art. 99 und 100 festgelegten Befugnisse zu<br />
unterstützen. 2 Bei der Ersatzvornahme tritt die Weisung der<br />
Fachaufsichtsbehörde an die Stelle der Anordnung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde.<br />
Bay LKrO Art. 103 Genehmigungsbehörde<br />
(1) Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Genehmigungen erteilt, soweit<br />
nicht anderes bestimmt ist, die Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 96).<br />
(2) Beschlüsse sowie Geschäfte des bürgerlichen Rechts erlangen<br />
Rechtswirksamkeit erst mit der Erteilung der nach diesem Gesetz<br />
erforderlichen Genehmigung.<br />
(3) Die Anträge auf Erteilung der Genehmigungen sind ohne schuldhafte<br />
Verzögerung zu verbescheiden.
Bay LKrO Art. 103 a Ausnahmegenehmigungen<br />
1 Das Staatsministerium des Innern kann im Interesse der Weiterentwicklung<br />
der kommunalen Selbstverwaltung zur Erprobung neuer Modelle der Steuerung<br />
und des Haushalts- und Rechnungswesens, der Verfahrensvereinfachung und<br />
der Verwaltungsführung auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen von Regelungen<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s und der nach Art. 109 erlassenen Vorschriften genehmigen.<br />
2 Die Genehmigung ist zu befristen. 3 Bedingungen und Auflagen sind<br />
insbesondere zulässig, um die Vergleichbarkeit des Kommunalrechtsvollzugs<br />
auch im Rahmen einer Erprobung möglichst zu wahren und die Ergebnisse der<br />
Erprobung für Gemeinden, für andere Landkreise und für Bezirke nutzbar zu<br />
machen.<br />
2. ABSCHNITT Rechtsmittel<br />
Bay LKrO Artikel 104 (weggefallen)<br />
Bay LKrO Art. 105 Erlaß des Widerspruchsbescheids<br />
(§ 73 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)<br />
Den Widerspruchsbescheid erläßt<br />
1. in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises die<br />
Rechtsaufsichtsbehörde, die dabei auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit<br />
beschränkt ist; zuvor hat die Selbstverwaltungsbehörde nach § 72 VwGO auch<br />
die Zweckmäßigkeit zu überprüfen,<br />
2. in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises die<br />
Fachaufsichtsbehörde; ist Fachaufsichtsbehörde eine oberste Landesbehörde,<br />
so entscheidet die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat; Art. 95<br />
Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung.<br />
Bay LKrO Artikel 106 (weggefallen)<br />
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay LKrO Art. 107 Einwohnerzahl<br />
Soweit nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen<br />
Rechtsverordnung die Einwohnerzahl von rechtlicher Bedeutung ist, ist die<br />
Einwohnerzahl maßgebend, die bei der letzten Wahl der Kreisräte zugrunde<br />
gelegt wurde.<br />
Bay LKrO Art. 108 Inkrafttreten<br />
(1) 1 Dieses Gesetz ist dringlich. 2 Es tritt am 14. Februar 1952 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ursprünglichen Fassung vom 16. Februar 1952 (GVBl S. 39). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens<br />
der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(2) gegenstandslos<br />
Bay LKrO Art. 109 Ausführungsvorschriften<br />
(1) 1 Das Staatsministerium des Innern erläßt die zum Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
erforderlichen Ausführungsvorschriften. 2 Es wird insbesondere ermächtigt,<br />
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch
Rechtsverordnung zu regeln:<br />
1. den Inhalt und die Gestaltung des Haushaltsplans einschließlich des<br />
Stellenplans, der mittelfristigen Finanzplanung und des<br />
Investitionsprogramms, ferner die Veranschlagung von Einzahlungen,<br />
Auszahlungen, Erträgen und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen,<br />
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einen vom Haushaltsjahr<br />
abweichenden Wirtschaftszeitraum,<br />
2. die Ausführung des Haushaltsplans, die Anordnung von Zahlungen, die<br />
Haushaltsüberwachung, die Stundung, die Niederschlagung und den Erlaß<br />
von Ansprüchen und die Behandlung von Kleinbeträgen,<br />
3. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen und die Vergabe von<br />
Aufträgen,<br />
4. die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme und Verwendung von<br />
Rücklagen und deren Mindesthöhe,<br />
5. die Bildung und Auflösung von Rückstellungen,<br />
6. die Geldanlagen und ihre Sicherung,<br />
7. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und die Abschreibung der<br />
Vermögensgegenstände; dabei kann die Bewertung und Abschreibung auf<br />
einzelne Bereiche beschränkt werden,<br />
8. die Aufstellung der Eröffnungsbilanz auch unter Abweichung von Art. 68<br />
Abs. 3 und der folgenden Bilanzen,<br />
9. die Kassenanordnungen, die Aufgaben und die Organisation der<br />
Kreiskasse und der Sonderkassen, den Zahlungsverkehr, die Verwaltung<br />
der Kassenmittel, der Wertgegenstände und anderer Gegenstände, die<br />
Buchführung sowie die Möglichkeit, daß die Buchführung und die<br />
Verwahrung von Wertgegenständen von den Kassengeschäften abgetrennt<br />
werden können,<br />
10. den Inhalt und die Gestaltung der Jahresrechnung und die Abwicklung<br />
der Vorjahresergebnisse,<br />
11. den Inhalt und die Gestaltung des Jahresabschlusses und des<br />
konsolidierten Jahresabschlusses; dabei können auch Ausnahmen von der<br />
und Übergangsfristen für die Konsolidierungspflicht vorgesehen werden,<br />
12. den Inhalt und die Gestaltung des Rechenschaftsberichts zur<br />
Jahresrechnung beziehungsweise zum Jahresabschluss, des Anhangs zum<br />
Jahresabschluss sowie des Konsolidierungsberichts zum konsolidierten<br />
Jahresabschluss,<br />
13. den Aufbau und die Verwaltung, die Wirtschaftsführung, das<br />
Rechnungswesen und die Prüfung der Eigenbetriebe,<br />
14. die Prüfung der Jahresrechnungen, der Jahresabschlüsse und der<br />
konsolidierten Jahresabschlüsse, die Prüfung der Kreiskasse und der<br />
Sonderkassen, die Abschlußprüfung und die Freistellung von der<br />
Abschlußprüfung, die Prüfung von Verfahren der automatisierten<br />
Datenverarbeitung im Bereich des Finanzwesens der Landkreise, die<br />
Rechte und Pflichten der Prüfer, die über Prüfungen zu erstellenden<br />
Berichte und deren weitere Behandlung sowie die Organisation der<br />
staatlichen Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter,<br />
15. das Verfahren bei der Errichtung der Kommunalunternehmen sowie<br />
der Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Kommunalunternehmen und<br />
den Aufbau, die Verwaltung, die Wirtschaftsführung sowie das Rechnungs-<br />
und Prüfungswesen der Kommunalunternehmen.
3<br />
Das Staatsministerium des Innern wird weiter ermächtigt, im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,<br />
Familie, Frauen und Gesundheit und mit dem Staatsministerium der<br />
Finanzen die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser und der<br />
Pflegeeinrichtungen der Landkreise durch Rechtsverordnung zu regeln.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium des Innern erläßt die erforderlichen<br />
Verwaltungsvorschriften und gibt Muster, insbesondere für<br />
1. die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung,<br />
2. die Darstellung des Haushaltsplans und des mittelfristigen Finanzplans<br />
insbesondere<br />
a) die Konten und Produkte bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen<br />
der doppelten kommunalen Buchführung,<br />
b) die Gliederung und die Gruppierung bei Haushaltswirtschaft nach den<br />
Grundsätzen der Kameralistik,<br />
3. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen, des mittelfristigen<br />
Finanzplans und des Investitionsprogramms,<br />
4. die Gliederung und die Form des Jahresabschlusses und des<br />
konsolidierten Jahresabschlusses,<br />
5. die Darstellung und die Form der Vermögensnachweise,<br />
6. die Kassenanordnungen, die Buchführung, die Jahresrechnung und ihre<br />
Anlagen,<br />
7. die Gliederung und die Form des Wirtschaftsplans und seiner Anlagen,<br />
des mittelfristigen Finanzplans und des Investitionsprogramms, des<br />
Jahresabschlusses, der Anlagenachweise und der Erfolgsübersicht für<br />
Eigenbetriebe und für Krankenhäuser mit kaufmännischem<br />
Rechnungswesen<br />
im Allgemeinen Ministerialblatt bekannt. 2 Es kann solche Muster für<br />
verbindlich erklären. 3 Die Zuordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle zu<br />
den Darstellungen gemäß Satz 1 Nrn. 2 bis 5 kann durch<br />
Verwaltungsvorschrift in gleicher Weise verbindlich festgelegt werden.<br />
4<br />
Die Verwaltungsvorschriften zur Darstellung des Haushaltsplans und des<br />
mittelfristigen Finanzplans sind im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen zu erlassen.<br />
Bay LKrO Art. 110 Einschränkung von Grundrechten<br />
Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s können die Grundrechte auf Freiheit der Person und<br />
der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2,<br />
Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 102 und 106 Abs. 3 der Verfassung).
Ladenschlussverordnung (Bay LSchlV)<br />
vom 21. Mai 2003 (GVBl. S. 340), geändert durch Verordnungen vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 302),<br />
vom 31. Januar 2006 (GVBl. S. 96), vom 17. September 2007 (GVBl. S. 648) (FN BayRS 8050-20-<br />
1-A)<br />
Auf Grund von § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 1 und 2 des <strong>Gesetze</strong>s über den<br />
Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl I S. 875), zuletzt geändert durch<br />
Gesetz vom 15. Mai 2003 (BGBl I S. 658), erlässt die Bayerische<br />
Staatsregierung folgende Verordnung:<br />
Bay LSchlV § 1<br />
In den in der Anlage aufgeführten Gemeinden oder Gemeindeteilen dürfen<br />
Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch<br />
und Milcherzeugnisse im Sinn des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes,<br />
Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie Waren, die für diese<br />
Orte kennzeichnend sind, abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1<br />
des <strong>Gesetze</strong>s über den Ladenschluss an jährlich höchstens 40 Sonn- und<br />
Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden verkauft werden.<br />
Bay LSchlV § 2<br />
(1) 1 Die Öffnungszeiten werden von den Gemeinden durch Rechtsverordnung<br />
festgesetzt; dabei ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu<br />
nehmen. 2 Die Gemeinden bestimmen auch, an welchen Sonn- und<br />
Feiertagen im Rahmen von § 1 offengehalten werden darf.<br />
Bay LSchlV § 3<br />
Die Offenhaltung ist auf diejenigen Verkaufsstellen beschränkt, in denen eine<br />
oder mehrere der genannten Waren im Verhältnis zum Gesamtumsatz in<br />
erheblichem Umfang geführt werden.<br />
Bay LSchlV § 4<br />
(1) Auf den Flughäfen München und Nürnberg dürfen in den Verkaufsstellen<br />
Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel während<br />
der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3 des <strong>Gesetze</strong>s über den<br />
Ladenschluss) auch an andere Personen als an Reisende abgegeben<br />
werden.<br />
(2) 1 Die Verkaufsfläche darf auf dem Flughafen München insgesamt<br />
10 000 m 2 nicht übersteigen. 2 Auf dem Flughafen Nürnberg darf die<br />
Verkaufsfläche insgesamt 2 000 m 2 nicht übersteigen. 3 Die Verkaufsfläche<br />
einer einzelnen Verkaufsstelle soll in der Regel nicht mehr als 100 m 2<br />
betragen, sofern nicht bauliche oder bedarfsbedingte Besonderheiten<br />
Abweichungen erfordern. 4 Die Errichtung von Großverkaufsstellen ist nicht<br />
zulässig.
Bay LSchlV § 4 a (weggefallen)<br />
Bay LSchlV § 5<br />
(1) 1 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2003 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1<br />
tritt § 4 Abs. 2 Satz 2 am 1. Januar 2005 in Kraft.<br />
(2) 1 Mit Ablauf des 31. Mai 2003 tritt die Ladenverschlussverordnung vom<br />
29. Juli 1997 (GVBl S. 386, ber. S. 486, BayRS 8050–20–1–A) außer<br />
Kraft. 2 Abweichend von Satz 1 tritt § 4 Abs. 2 Satz 1 der<br />
Ladenschlussverordnung vom 29. Juli 1997 mit Ablauf des 31. Dezember<br />
2004 außer Kraft, soweit darin die Verkaufsfläche auf dem Flughafen<br />
Nürnberg auf höchstens 600 m 2 festgelegt wird.<br />
(3) Mit Ablauf des 31. Juli 2006 tritt § 4 a außer Kraft.
Anlage<br />
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Oberbayern<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Lkr. Altötting Stadt Altötting<br />
Stadt Burghausen<br />
(nur Altstadt, bestehend<br />
aus den Nummern 1 bis 285 der Burg und der<br />
Curastraße)<br />
Markt Marktl<br />
(nur Marktplatz, Pfarrstraße, Schulstraße bis Einmündung<br />
Lederergasse, Bahnhofstraße bis Einmündung Kapellenweg)<br />
Lkr. Bad Tölz-<br />
Wolfratshausen<br />
Lkr. Berchtesgadener<br />
Land<br />
Gemeinde Bad Heilbrunn<br />
Stadt Bad Tölz<br />
Gemeinde Benediktbeuern<br />
Gemeinde Bichl<br />
Gemeinde Dietramszell<br />
(nur Gemeindeteile Dietramszell und Schönegg)<br />
Gemeinde Gaißach<br />
Stadt Geretsried<br />
Gemeinde Jachenau<br />
Gemeinde Kochel a. See<br />
(nur Gemeindeteile Altjoch, Kochel a. See, Ried, Urfeld und<br />
Walchensee)<br />
Gemeinde Königsdorf<br />
Gemeinde Lenggries<br />
Gemeinde Münsing<br />
Gemeinde Sachsenkam<br />
Gemeinde Schlehdorf<br />
Gemeinde Wackersberg<br />
Stadt Wolfratshausen<br />
Gemeinde Ainring<br />
Gemeinde Anger<br />
Große Kreisstadt Bad Reichenhall<br />
Gemeinde Bayerisch Gmain<br />
Markt Berchtesgaden<br />
Gemeinde Bischofswiesen<br />
Stadt Laufen<br />
Markt Marktschellenberg<br />
Gemeinde Piding<br />
Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden<br />
Gemeinde Saaldorf<br />
Gemeinde Schneizlreuth<br />
Gemeinde Schönau a. Königssee<br />
Markt Teisendorf<br />
Lkr. Dachau Große Kreisstadt Dachau<br />
(nur Altstadt und Dauchau Ost,<br />
jeweis begrenzt durch folgende Straßenzüge:<br />
Altstadt innerhalb der Mittermayerstraße,<br />
Ludwig-Thoma-Straße,<br />
Martin-Huber-Straße,<br />
Frühlingstraße, Bahnhofsplatz,<br />
Münchner Straße,<br />
Rotkreuzplatz,<br />
Schlossstraße,<br />
Augsburger Straße,
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Lkr. Ebersberg Stadt Ebersberg<br />
Markt Glonn<br />
Dachau Ost innerhalb der Schleißheimer Straße,<br />
Theodor-Heuss-Straße,<br />
Sudentenlandstraße,<br />
Straße der KZ-Opfer,<br />
Pater-Roth-Straße,<br />
Alte-Römer-Straße<br />
Markt Altomünster (nur Marktplatz und St.-Altohof))<br />
Lkr. Eichstätt Markt Altmannstein<br />
Stadt Beilngries<br />
Markt Dollnstein<br />
Große Kreisstadt Eichstätt<br />
Markt Kinding<br />
Markt Kipfenberg<br />
Markt Kösching<br />
(nur Gemeindeteil Bettbrunn)<br />
Markt Mörnsheim<br />
Markt Pförring<br />
Markt Wellheim<br />
Lkr. Erding Gemeinde Fraunberg<br />
(nur Gemeindeteil Thalheim)<br />
Markt Wartenberg<br />
Lkr. Fürstenfeldbruck Stadt Fürstenfeldbruck (nur Klosterbereich Fürstenfeld)<br />
Lkr. Garmisch-<br />
Partenkirchen<br />
Gemeinde Bad Kohlgrub<br />
Gemeinde Bayersoien<br />
Gemeinde Eschenlohe<br />
Gemeinde Ettal<br />
Gemeinde Farchant<br />
Markt Garmisch-Partenkirchen<br />
Gemeinde Grainau<br />
Gemeinde Großweil<br />
Gemeinde Krün<br />
Markt Mittenwald<br />
Markt Murnau a. Staffelsee<br />
Gemeinde Oberammergau<br />
Gemeinde Oberau<br />
Gemeinde Ohlstadt<br />
Gemeinde Riegsee<br />
Gemeinde Saulgrub<br />
Gemeinde Seehausen a. Staffelsee<br />
Gemeinde Spatzenhausen<br />
Gemeinde Uffing a. Staffelsee<br />
Gemeinde Unterammergau<br />
Gemeinde Wallgau<br />
Lkr. Landsberg a. Lech Markt Dießen a. Ammersee (ausgenommen Dettenhofen,<br />
Dettenschwang und Obermühlhausen)<br />
Gemeinde Eresing (nur Gemeindeteil Sankt Ottilien)<br />
Große Kreisstadt Landsberg am Lech<br />
Gemeinde Schondorf a. Ammersee<br />
Gemeinde Utting a. Ammersee<br />
Lkr. Miesbach Gemeinde Bad Wiessee<br />
Gemeinde Bayrischzell
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Landeshauptstadt<br />
München<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Gemeinde Fischbachau<br />
Gemeinde Gmund a. Tegernsee<br />
Gemeinde Kreuth<br />
Gemeinde Rottach-Egern<br />
Markt Schliersee<br />
Stadt Tegernsee<br />
Gemeinde Waakirchen<br />
Gemeinde Weyarn (nur Gemeindeteile Großseeham, Holzolling und<br />
Weyarn)<br />
Stadt München (nur Olympiapark und Fußballstadion Fröttmaning)<br />
Lkr. München Gemeinde Grünwald<br />
Gemeinde Planegg (nur Gemeindeteil Maria Eich)<br />
Gemeinde Ismaning<br />
Gemeinde Schäftlarn (nur Gemeindeteile Ebenhausen und Kloster<br />
Schäftlarn)<br />
Lkr. Pfaffenhofen a. d.<br />
Ilm<br />
Gemeinde Scheyern<br />
Lkr. Rosenheim Gemeinde Amerang<br />
Gemeinde Aschau i. Chiemgau<br />
Stadt Bad Aibling (nur Stadtteile Bad Aibling, Harthausen, Thürham<br />
und Zell)<br />
Gemeinde Bad Feilnbach<br />
Gemeinde Bernau a. Chiemsee<br />
Gemeinde Brannenburg<br />
Gemeinde Breitbrunn a. Chiemsee<br />
Markt Bruckmühl (nur Klosterbereich)<br />
Gemeinde Chiemsee<br />
Gemeinde Eggstätt<br />
Markt Bad Endorf i. OB<br />
Gemeinde Flintsbach a. Inn<br />
Gemeinde Frasdorf<br />
Gemeinde Gstadt a. Chiemsee<br />
Gemeinde Höslwang<br />
Gemeinde Kiefersfelden<br />
Markt Neubeuern<br />
Gemeinde Nussdorf a. Inn<br />
Gemeinde Oberaudorf<br />
Markt Prien a. Chiemsee<br />
Gemeinde Riedering (nur Gemeindeteile Neukirchen a. Simssee,<br />
Pietzing und Riedering)<br />
Gemeinde Rimsting<br />
Gemeinde Rott a. Inn (nur Bereich Kaiserhof)<br />
Gemeinde Samerberg<br />
Gemeinde Stephanskirchen (nur Gemeindeteil Baierbach)<br />
Gemeinde Tuntenhausen (nur Gemeindeteil Tuntenhausen)<br />
Stadt Wasserburg a. Inn (nur Stadtteil Wasserburg a. Inn)<br />
Lkr. Starnberg Gemeinde Andechs (nur Gemeindeteil Erling)<br />
Gemeinde Berg<br />
Gemeinde Feldafing<br />
Gemeinde Herrsching a. Ammersee<br />
Gemeinde Inning a. Ammersee<br />
Gemeinde Seefeld<br />
Gemeinde Pöcking
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Stadt Starnberg<br />
Gemeinde Tutzing<br />
Gemeinde Weßling<br />
Gemeinde Wörthsee<br />
Lkr. Traunstein Gemeinde Bergen (ohne die Gemeindeteile Holzhausen, Leiten und<br />
Irlach)<br />
Gemeinde Chieming<br />
Gemeinde Grabenstätt<br />
Markt Grassau<br />
Gemeinde Inzell<br />
Gemeinde Marquartstein<br />
Gemeinde Reit i. Winkl<br />
Gemeinde Ruhpolding<br />
Gemeinde Schleching<br />
Gemeinde Seeon-Seebruck<br />
Gemeinde Siegsdorf<br />
Gemeinde Übersee<br />
Gemeinde Unterwössen<br />
Markt Waging a. See<br />
Lkr. Weilheim-<br />
Schongau<br />
Niederbayern<br />
Gemeinde Bernried<br />
Gemeinde Hohenpeißenberg<br />
Gemeinde Iffeldorf<br />
Gemeinde Rottenbuch<br />
Gemeinde Seeshaupt<br />
Gemeinde Steingaden<br />
Gemeinde Wessobrunn<br />
Lkr. Deggendorf Gemeinde Bernried<br />
Große Kreisstadt Deggendorf (nur Stadtteile Greising und Halbmeile)<br />
Gemeinde Grattersdorf (nur Gemeindeteil Kerschbaum)<br />
Gemeinde Iggensbach (nur Gemeindeteil Handlab)<br />
Gemeinde Lalling<br />
Gemeinde Niederalteich<br />
Gemeinde Stephansposching<br />
(nur Gemeindeteil Loh)<br />
Lkr. Freyung-Grafenau Stadt Freyung<br />
Stadt Grafenau<br />
Gemeinde Haidmühle<br />
Gemeinde Hohenau<br />
Gemeinde Mauth<br />
Gemeinde Neureichenau<br />
Gemeinde Neuschönau<br />
Markt Perlesreuth (nur Gebiet des ehemaligen Marktes Perlesreuth<br />
ohne die eingegliederten Gebiete der ehemaligen Gemeinden Haus i.<br />
Wald und Kummreut)<br />
Gemeinde Philippsreut (nur Gemeindeteile Mitterfirmiansreut und<br />
Philippsreut)<br />
Markt Röhrnbach<br />
Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte (nur Gemeindeteile Sankt Oswald-<br />
Riedlhütte und Reichenberg)<br />
Markt Schönberg<br />
Gemeinde Spiegelau<br />
Gemeinde Thurmansbang (nur Gemeindeteil Thurmansbang)<br />
Stadt Waldkirchen
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Lkr. Kelheim Markt Bad Abbach (nur Gemeindeteil Bad Abbach)<br />
Markt Essing (nur Gemeindeteil Schulerloch)<br />
Stadt Kelheim (nur die Stadtteile Gronsdorf, Hohenpfahl, Kelheim,<br />
Klösterl, Michelsberg – Befreiungshalle – Stausacker, Weltenburg)<br />
Stadt Neustadt a. d. Donau (nur Stadtteil Bad Gögging)<br />
Stadt Riedenburg (nur Stadtteile Prunn und Riedenburg)<br />
Markt Rohr i. NB (nur Bereich um die Asamkirche)<br />
Stadt Passau Stadt Passau (nur Bereich der Altstadt vom Paulusbogen bis<br />
Ortsspitze, vom Ilzstadtbereich nur Oberhausseite und Oberhaus sowie<br />
der östlich des Inns gelegene Teil des Bereichs Innstadt)<br />
Lkr. Passau Markt Aidenbach (nur Gemeindeteil Aidenbach)<br />
Gemeinde Aldersbach<br />
Markt Eging a. See<br />
Gemeinde Bad Füssing (nur Gemeindeteile Aigen a. Inn, Bad Füssing,<br />
Egglfing a. Inn, Riedenburg, Safferstetten, Würding) Stadt Griesbach i.<br />
Rottal (nur Stadtteile Griesbach i. Rottal, Karpfham, Bad Griesbach,<br />
Singham, Schwaim und Parzham)<br />
Gemeinde Haarbach (nur Gemeindeteil Haarbach mit den Orten<br />
Oberuttlau, Unteruttlau, Brunnwies und Holzhäuser)<br />
Stadt Hauzenberg<br />
Gemeinde Kirchham<br />
Markt Obernzell (nur Gemeindeteil Obernzell)<br />
Markt Ortenburg (nur Gemeindeteil Ortenburg)<br />
Markt Tittling<br />
Markt Untergriesbach (nur Gemeindeteile der ehemaligen Gemeinden<br />
Untergriesbach, Gottsdorf und Schwaibing)<br />
Stadt Vilshofen<br />
Markt Wegscheid (nur Gemeindeteil Wegscheid)<br />
Markt Windorf (ohne Ortsteil Besensandbach)<br />
Lkr. Regen Gemeinde Achslach<br />
Gemeinde Arnbruck<br />
Gemeinde Bayerisch Eisenstein<br />
Gemeinde Bischofsmais<br />
Markt Bodenmais<br />
Gemeinde Böbrach<br />
Gemeinde Drachselsried<br />
Gemeinde Frauenau<br />
Gemeinde Geiersthal<br />
Gemeinde Kirchberg<br />
Gemeinde Kollnburg (nur Gemeindeteil Kollnburg)<br />
Gemeinde Langdorf<br />
Gemeinde Lindberg (nur Gemeindeteil Ludwigsthal)<br />
Stadt Regen<br />
Gemeinde Rinchnach<br />
Markt Ruhmannsfelden<br />
Markt Teisnach<br />
Stadt Viechtach (nur Stadtteile Viechtach, Höllenstein, Pirka,<br />
Schnitzmühle, Waldfrieden)<br />
Stadt Zwiesel<br />
Lkr. Rottal-Inn Markt Bad Birnbach (nur Teil Bad Birnbach)<br />
Lkr. Straubing-Bogen Stadt Bogen<br />
Gemeinde Falkenfels<br />
Gemeinde Haibach<br />
Gemeinde Haselbach
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Oberpfalz<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Gemeinde Hunderdorf<br />
Gemeinde Konzell<br />
Markt Mitterfels<br />
Gemeinde Neukirchen<br />
Gemeinde Perasdorf<br />
Gemeinde Rattenberg<br />
Gemeinde Rattiszell<br />
Gemeinde Sankt Englmar<br />
Markt Schwarzach<br />
Gemeinde Wiesenfelden<br />
Gemeinde Windberg<br />
Stadt Amberg Stadt Amberg<br />
Lkr. Amberg-Sulzbach Stadt Schnaittenbach (nur Naturbad am Forst)<br />
Lkr. Cham Gemeinde Blaibach (nur Gemeindeteil Blaibach)<br />
Stadt Cham (nur Stadtteile Cham und Windischbergerdorf)<br />
Markt Falkenstein (nur Gemeindeteil Falkenstein)<br />
Stadt Furth i. Wald (nur Stadtteil Furth i. Wald)<br />
Gemeinde Gleißenberg<br />
Gemeinde Grafenwiesen (nur Gemeindeteil Grafenwiesen)<br />
Gemeinde Hohenwarth (nur Gemeindeteil Hohenwarth)<br />
Stadt Kötzting (nur Stadtteile Kötzting und Wettzell)<br />
Markt Lam (nur Gemeindeteil Lam)<br />
Gemeinde Lohberg<br />
Markt Neukirchen b. Hl. Blut (nur Gemeindeteil Neukirchen b. Hl. Blut)<br />
Gemeinde Reichenbach<br />
Gemeinde Rimbach (nur Gemeindeteil Rimbach)<br />
Stadt Roding (nur Stadtteile Roding und Neubäu)<br />
Stadt Rötz (nur Stadtteil Rötz)<br />
Markt Stamsried (nur Gemeindeteil Stamsried)<br />
Gemeinde Tiefenbach (nur Gemeindeteil Tiefenbach)<br />
Stadt Waldmünchen (nur Stadtteil Waldmünchen)<br />
Lkr. Neumarkt i. d.<br />
Oberpfalz<br />
Lkr. Neustadt a. d.<br />
Waldnaab<br />
Stadt Berching (nur Stadtteil Berching und Plankstetten)<br />
Markt Breitenbrunn (nur Gemeindeteil Breitenbrunn)<br />
Stadt Freystadt (nur Stadtteil Freystadt)<br />
Stadt Velburg (nur Stadtteile Velburg und Habsberg)<br />
Stadt Eschenbach i. d. OPf. (nur Stadtteil Eschenbach i. d. OPf.)<br />
Markt Eslarn (nur Gemeindeteil Eslarn)<br />
Gemeinde Flossenbürg (nur nordöstlicher Teil mit Burgruine und<br />
Geißweiher)<br />
Markt Leuchtenberg (nur Gemeindeteil Leuchtenberg)<br />
Markt Moosbach (nur Gemeindeteil Moosbach)<br />
Stadt Neustadt a. Kulm (nur Stadtteil Neustadt a. Kulm)<br />
Stadt Pleystein (nur Stadtteil Pleystein)<br />
Markt Tännesberg (nur Gemeindeteil Tännesberg)<br />
Stadt Vohenstrauß (nur Stadtteile Vohenstrauß und Böhmischbruck)<br />
Markt Waidhaus (nur Gemeindeteil Waidhaus)<br />
Markt Waldthurn (nur Gemeindeteil Waldthurn)<br />
Stadt Regensburg Stadt Regensburg (nur Altstadt südlich der Donau innerhalb des<br />
Grüngürtels, Stadtamhof, Oberer und Unterer Wöhrd)<br />
Lkr. Regensburg Markt Donaustauf (nur Gemeindeteil Donaustauf)<br />
Markt Kallmünz (nur Gemeindeteil Kallmünz)<br />
Gemeinde Wolfsegg
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Lkr. Schwandorf Gemeinde Bodenwöhr (nur Gemeindeteil Bodenwöhr)<br />
Stadt Nabburg<br />
Stadt Oberviechtach (nur Stadtteil Oberviechtach)<br />
Lkr. Tirschenreuth Markt Neualbenreuth (nur Gemeindeteil Neualbenreuth)<br />
Markt Plößberg (nur Gemeindeteil Plößberg)<br />
Stadt Waldsassen (nur Stadtteil Waldsassen)<br />
Oberfranken<br />
Stadt Bamberg Stadt Bamberg (nur Domplatz, Karolinenstraße vom Domplatz bis zum<br />
Alten Rathaus, Untere Brückenstraße links des linken Regnitzarms,<br />
Dominikanerstraße, Am Leinritt – von der Kasernstraße bis zur<br />
Markusbrücke –, Balthasargässchen, Elisabethenstraße,<br />
Geyerswörthplatz, Grünhundsbrunnen, Herrenstraße, Judenstraße,<br />
Kasernstraße, Katzenberg, Lugbank, Obere Sandstraße,<br />
Pfahlplätzchen, Ringsleingasse, Sandbad, Schranne, Untere Sandstraße<br />
– Kreuzung Elisabethenstraße bis zur Höhe Markusbrücke – Straßen<br />
Obstmarkt und Michelsbrücke)<br />
Lkr. Bamberg Markt Ebrach<br />
Markt Heiligenstadt i. OFr.<br />
Markt Hirschaid (nur Ortskern östlich durch Bahnlinie, westlich durch<br />
Rhein-Main-Donau-Kanal, südlich und nördlich durch Ortsende<br />
begrenzt)<br />
Gemeinde Pommersfelden<br />
Stadt Schlüsselfeld (nur Stadtteile Aschbach und Schlüsselfeld)<br />
Stadt Bayreuth Stadt Bayreuth<br />
(nur Innenstadt im Bereich der Fußgängerzone und der weiteren<br />
Bereiche der Ludwigstraße, Opernstraße und Richard-Wagner-Straße<br />
sowie der Friedrichstraße bis zur Einmündung der Jean-Paul-Straße, An<br />
der Bürgerreuth und Siegfried-Wagner-Allee im Anliegerbereich des<br />
Festspielhauses, Bahnhofstraße, Stadtteil St. Johannis im<br />
Anliegerbereich der Eremitage)<br />
Lkr. Bayreuth Gemeinde Aufseß<br />
Stadt Bad Berneck i. Fichtelgebirge<br />
Stadt Betzenstein<br />
Gemeinde Bischofsgrün<br />
Gemeinde Fichtelberg<br />
Stadt Goldkronach<br />
Stadt Hollfeld<br />
Gemeinde Mehlmeisel<br />
Stadt Pegnitz<br />
Markt Plech<br />
Stadt Pottenstein<br />
Stadt Waischenfeld<br />
Gemeinde Warmensteinach<br />
Markt Weidenberg<br />
Stadt Coburg Stadt Coburg (nur Marktplatz, Schlossplatz und Veste)<br />
Lkr. Coburg Stadt Bad Rodach<br />
Stadt Seßlach (nur Altstadt innerhalb der Stadtmauern)<br />
Lkr. Forchheim Stadt Ebermannstadt<br />
Markt Egloffstein<br />
Markt Gößweinstein<br />
Gemeinde Gräfenberg<br />
Gemeinde Heroldsbach<br />
Gemeinde Obertrubach
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Markt Pretzfeld<br />
Gemeinde Unterleinleiter<br />
Markt Wiesenttal (nur Gemeindeteile Muggendorf und Streitberg)<br />
Lkr. Hof Markt Bad Steben<br />
Stadt Lichtenberg<br />
Stadt Naila (nur Stadtteil Hölle)<br />
Stadt Schwarzenbach a. Wald<br />
Markt Zell<br />
Lkr. Kronach Stadt Kronach<br />
Markt Küps (nur Gemeindeteil Oberlangenstadt)<br />
Stadt Ludwigsstadt (nur Stadtteil Lauenstein)<br />
Markt Marktrodach<br />
Markt Mitwitz<br />
Markt Nordhalben<br />
Gemeinde Steinbach a. Wald<br />
Markt Steinwiesen<br />
Markt Tettau<br />
Stadt Wallenfels<br />
Lkr. Kulmbach Markt Kasendorf<br />
Stadt Kulmbach (nur Innenstadt und Plassenburg)<br />
Markt Marktleugast (nur Gemeindeteil Marienweiher)<br />
Markt Marktschorgast<br />
Stadt Stadtsteinach<br />
Markt Thurnau<br />
Markt Wirsberg<br />
Markt Wonsees<br />
Lkr. Lichtenfels Stadt Bad Staffelstein<br />
Stadt Weismain<br />
Lkr. Wunsiedel i.<br />
Fichtelgebirge<br />
Gemeinde Bad Alexandersbad<br />
Stadt Hohenberg a. d. Eger<br />
Gemeinde Nagel<br />
Stadt Selb<br />
(nur Innenstadt im Bereich der Ludwigstraße, Schillerstraße, Vielitzer<br />
Straße, Wittelsbacherstraße und am Christian-Höfer-Ring)<br />
Gemeinde Tröstau<br />
Stadt Weißenstadt<br />
Stadt Wunsiedel<br />
Mittelfranken<br />
Lkr. Ansbach Gemeinde Aurach<br />
Markt Dietenhofen (nur Gemeindeteile Dietenhofen und Kleinhaslach)<br />
Stadt Dinkelsbühl (nur Stadtteil Dinkelsbühl)<br />
Stadt Feuchtwangen (nur Stadtteil Feuchtwangen)<br />
Stadt Leutershausen (nur Stadtteil Leutershausen)<br />
Große Kreisstadt Rothenburg ob der Tauber (nur Stadtteile Rothenburg<br />
ob der Tauber und Detwang)<br />
Stadt Schillingsfürst (nur Stadtteil Schillingsfürst)<br />
Gemeinde Schnelldorf (nur Gemeindeteile Schnelldorf und Wildenholz)<br />
Stadt Wolframs-Eschenbach (nur Stadtteil Wolframs-Eschenbach)<br />
Stadt Erlangen Stadt Erlangen (nur Stadtteil Dechsendorf)<br />
Lkr. Erlangen-<br />
Höchstädt<br />
Markt Eckental (nur Gebiet des früheren Marktes Eschenau)<br />
Markt Heroldsberg<br />
Gemeinde Kalchreuth
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Lkr. Fürth Markt Cadolzburg (nur Gemeindeteil Cadolzburg)<br />
Lkr. Neustadt a. d.<br />
Aisch-Bad Windsheim<br />
Stadt Bad Windsheim (nur Stadtteil Bad Windsheim)<br />
Stadt Burgbernheim (nur Stadtteile Burgbernheim und Wildbad)<br />
Gemeinde Münchsteinach (nur Gemeindeteil Münchsteinach)<br />
Stadt Nürnberg Stadt Nürnberg (nur Burg und Umgebung, begrenzt durch folgende<br />
Straßenzüge einschließlich der durch diese Straßenzüge unmittelbar<br />
erschlossenen Grundstücke: Burg, Obere Söldnergasse, Panierplatz,<br />
Schildgasse, Burgstraße, Obere Krämergasse, Untere Schmiedgasse,<br />
Albrecht-Dürer-Platz, Bergstraße einschließlich des Altstadthofes (Fl.<br />
Nr. 431, 434 und 435 der Gemarkung Seeteich), Tiergärtnertor, Burg,<br />
Winklerstraße – nördlicher Teil, Augustinerstraße – südliche<br />
Straßenseite, Waaggasse, Rathausplatz, Burgstraße, Hauptmarkt (nur<br />
umschließende Gebäude ohne Marktfläche)<br />
einschließlich Verlängerung bis Bischof-Meiser-Straße,<br />
Plobenhofstraße, Bischof-Meiser-Straße, zwischen Plobenhofstraße und<br />
Spitalgasse – südliche Straßenseite bis einschließlich Heilig-Geist-<br />
Spital)<br />
Lkr. Nürnberger Land Gemeinde Alfeld (nur Gemeindeteil Regelsmühle)<br />
Stadt Altdorf b. Nürnberg (nur Stadtteil Altdorf b. Nürnberg)<br />
Gemeinde Happurg<br />
Gemeinde Hartenstein<br />
Gemeinde Kirchensittenbach (nur Gemeindeteil Algersdorf)<br />
Markt Neuhaus a. d. Pegnitz (nur Gemeindeteil Neuhaus a. d. Pegnitz)<br />
Gemeinde Pommelsbrunn<br />
Gemeinde Schwarzenbruck (nur Gemeindeteil Gsteinach)<br />
Stadt Velden<br />
Gemeinde Vorra<br />
Lkr. Roth Stadt Abenberg (nur Stadtteil Abenberg)<br />
Stadt Spalt (nur Stadtteile Spalt, Enderndorf, Großweingarten und<br />
Wernfels)<br />
Markt Allersberg (nur Gemeindeteile Allersberg, Appelhof, Fischhof,<br />
Polsdorf, Grashof, Kronmühle und Göggelsbuch)<br />
Lkr. Weißenburg-<br />
Gunzenhausen<br />
Markt Absberg<br />
Stadt Ellingen<br />
Stadt Gunzenhausen<br />
Gemeinde Haundorf<br />
Markt Heidenheim (nur Gemeindeteil Hechtlingen am See)<br />
Gemeinde Muhr am See<br />
Stadt Pappenheim (nur Stadtteil Pappenheim)<br />
Gemeinde Pfofeld (nur Gemeindeteil Langlau)<br />
Markt Pleinfeld<br />
Gemeinde Solnhofen<br />
Stadt Treuchtlingen<br />
Unterfranken<br />
Lkr. Aschaffenburg Stadt Alzenau i. UFr. (nur Gebiet der früheren Gemeinde Kälberau)<br />
Gemeinde Dammbach<br />
Gemeinde Heigenbrücken<br />
Gemeinde Heimbuchenthal<br />
Markt Hösbach (nur Gemeindeteil Schmerlenbach)<br />
Gemeinde Johannesberg (ohne Gemeindeteil Steinbach)<br />
Gemeinde Mespelbrunn<br />
Gemeinde Rothenbuch<br />
Gemeinde Waldaschaff<br />
Gemeinde Weibersbrunn
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Lkr. Bad. Kissingen Markt Bad Bocklet (ohne Gemeindeteil Steinach a. d. Saale)<br />
Stadt Bad Brückenau<br />
Große Kreisstadt Bad Kissingen<br />
Markt Geroda<br />
Gemeinde Motten (nur Gemeindeteil Kothen)<br />
Lkr. Hassberge Stadt Eltmann (nur Stadtteile Eltmann und Limbach)<br />
Stadt Hofheim i. UFr. (nur Stadtteil Hofheim)<br />
Stadt Königsberg i. Bay.<br />
Markt Maroldsweisach (nur Gemeindeteile Maroldsweisach, Pfaffendorf<br />
und Altenstein)<br />
Stadt Zeil a. Main (nur Stadtteil Zeil a. Main und Platz um die<br />
Wallfahrtskirche “Käppele”)<br />
Lkr. Kitzingen Stadt Dettelbach (nur Stadtteil Dettelbach)<br />
Markt Geiselwind (nur Stadtteil Geiselwind)<br />
Stadt Iphofen (nur Stadtteile Dornheim, Iphofen, Mönchsondheim und<br />
Nenzenhofen)<br />
Große Kreisstadt Kitzingen<br />
Stadt Prichsenstadt (nur Stadtteil Prichsenstadt)<br />
Markt Schwarzach a. Main (nur Gemeindeteil Münsterschwarzach)<br />
Stadt Volkach (ohne die Stadtteile Dimbach, Fahr, Gaibach, Krautheim,<br />
Obervolkach, Rimbach)<br />
Lkr. Main-Spessart Markt Frammersbach<br />
Stadt Gemünden a. Main (ohne die Stadtteile Langenprozelten und<br />
Wernfeld)<br />
Gemeinde Gräfendorf (ohne die Gemeindeteile Michelau a. d. Saale,<br />
Schonderfeld, Weickersgrüben – jedoch nicht Gebietsteil Rossmühle<br />
Wolfsmünster)<br />
Stadt Lohr a. Main (nur Wallfahrtsort Maria Buchen)<br />
Stadt Rieneck<br />
Stadt Rothenfels<br />
Markt Triefenstein (nur Kiosk am Campingplatz)<br />
Markt Zellingen (nur Gebiet des früheren Marktes Retzbach)<br />
Lkr. Miltenberg Stadt Amorbach (ohne Stadtteil Reichartshausen)<br />
Markt Großheubach<br />
Stadt Klingenberg a. Main<br />
Stadt Miltenberg (ohne die Stadtteile Mainbullau, Schippach,<br />
Wenschdorf)<br />
Markt Mönchberg<br />
Stadt Stadtprozelten<br />
Lkr. Rhön-Grabfeld Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld (ohne die Stadtteile Aub und<br />
Merkershausen)<br />
Stadt Bad Neustadt a. d. Saale (ohne Stadtteil Brendlorenzen)<br />
Stadt Bischofsheim a. d. Rhön (nur Altstadt innerhalb des<br />
Stadtmauerrings und Weiler Kreuzberg)<br />
Stadt Fladungen<br />
Gemeinde Hausen<br />
Markt Oberelsbach<br />
Stadt Ostheim v.d. Rhön (nur Stadtteile Ostheim v.d. Rhön,<br />
Johannismühle, Kupfermühle, Lichtenburg, Lohmühle, Scheermühle,<br />
Walkmühle)<br />
Gemeinde Sulzdorf a. d. Lederhecke (nur die Gemeindeteile Sternberg<br />
i. Grabfeld und Zimmerau)<br />
Gemeinde Sulzfeld (ohne Gemeindeteil Kleinbardorf)<br />
Lkr. Schweinfurt Stadt Gerolzhofen (nur Stadtteil Gerolzhofen)
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Markt Stadtlauringen<br />
Stadt Würzburg Stadt Würzburg (nur Stadtteile Festung Marienberg und “Käppele”,<br />
Platz um die Kirche)<br />
Lkr. Würzburg Gemeinde Hausen b. Würzburg (nur Gemeindeteil Fährbrück)<br />
Gemeinde Veitshöchheim (ohne Gemeindeteil Gadheim)<br />
Schwaben<br />
Lkr. Donau-Ries Stadt Harburg (Schwaben)<br />
Gemeinde Mönchsdeggingen<br />
Große Kreisstadt Nördlingen<br />
Stadt Oettingen i. Bayern<br />
Stadt Wernding<br />
Lkr. Günzburg Große Kreisstadt Günzburg (nur das für zahlende Besucher zugängliche<br />
Gelände des Freizeitparks “Legoland Deutschland” und Altstadtbereich<br />
begrenzt durch folgende Straßenzüge: Augsburger Straße (teilweise) –<br />
Schützenstraße (teilweise) – Frauenplatz – Institutsstraße – Postgasse<br />
– Webergasse – Hockergasse – Wagnergasse – Stadtberg (teilweise) –<br />
Ichenhauser Straße (teilweise) – Am Stadtgraben – Kapuzinerpassage<br />
– Lannionplatz – Jahnstraße (teilweise) – Bürgermeister-Landmann-<br />
Platz – Wilhelm-Lorenz-Weg)<br />
Markt Ziemetshausen (nur Gemeindeteil Maria Vesperbild)<br />
Stadt Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren (nur Altstadtbereich begrenzt durch folgende<br />
Straßenzüge: Schraderstraße – Am Graben – Josef-Landes-Straße –<br />
Kemptener Tor bis zur Einmündung Schießstattweg – Unter dem Berg<br />
– Am Breiten Bach – Innere Buchleuthenstraße bis zur Einmündung<br />
Schraderstraße)<br />
Lkr. Lindau (Bodensee) Gemeinde Gestratz<br />
Gemeinde Grünenbach<br />
Große Kreisstadt Lindau (Bodensee)<br />
Stadt Lindenberg i. Allgäu<br />
Gemeinde Maierhöfen<br />
Gemeinde Nonnenhorn<br />
Gemeinde Oberreute<br />
Gemeinde Opfenbach (nur Gemeindeteil Wigratzbad)<br />
Gemeinde Röthenbach (Allgäu)<br />
Markt Scheidegg<br />
Gemeinde Stiefenhofen<br />
Gemeinde Wasserburg (Bodensee)<br />
Markt Weiler-Simmerberg<br />
Lkr. Neu-Ulm Gemeinde Roggenburg<br />
Lkr. Oberallgäu Gemeinde Balderschwang<br />
Gemeinde Blaichach (nur Gemeindeteil Gunzesried)<br />
Gemeinde Bolsterlang<br />
Markt Buchenberg<br />
Gemeinde Burgberg i. Allgäu (ohne den Gemeindeteil Häuser)<br />
Gemeinde Fischen i. Allgäu<br />
Markt Bad Hindelang<br />
Stadt Immenstadt i. Allgäu<br />
Gemeinde Missen-Wilhams<br />
Gemeinde Obermaiselstein<br />
Gemeinde Oy-Mittelberg (nur Gemeindeteil Mittelberg)<br />
Markt Oberstaufen<br />
Markt Oberstdorf<br />
Gemeinde Ofterschwang
Regierungsbezirk,<br />
Landkreis, kreisfreie<br />
Gemeinde<br />
Gemeinde bzw. Gemeindeteil<br />
Gemeinde Rettenberg<br />
Stadt Sonthofen<br />
Gemeinde Waltenhofen<br />
Markt Weitnau<br />
Markt Wertach<br />
Lkr. Ostallgäu Gemeinde Eisenberg<br />
Stadt Füssen<br />
Gemeinde Görisried<br />
Gemeinde Halblech<br />
Gemeinde Hopferau<br />
Gemeinde Lechbruck<br />
Markt Nesselwang<br />
Gemeinde Pfronten<br />
Gemeinde Rieden am Forggensee<br />
Gemeinde Roßhaupten<br />
Gemeinde Rückholz<br />
Gemeinde Schwangau<br />
Gemeinde Seeg<br />
Lkr. Unterallgäu Stadt Bad Wörishofen<br />
Markt Grönenbach<br />
Markt Ottobeuren
Gesetz über das Landesstrafrecht und<br />
das Verordnungsrecht auf dem Gebiet<br />
der öffentlichen Sicherheit und<br />
Ordnung (Bay LStVG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 27. Dezember 1991 (GVBl. S. 496), vom 10. Juni 1992 (GVBl.<br />
S. 152), vom 25. Juni 1996 (GVBl. S. 222), vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 311), vom 26. Juli 1997<br />
(GVBl. S. 323), vom 12. April 1999 (GVBl. S. 130), vom 16. Dezember 1999 (GVBl. S. 521), vom<br />
24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 27. Dezember 2004 (GVBl. S. 540), vom 10. Dezember 2007<br />
(GVBl. S. 864), vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 958), vom 10. Juni 2008 (GVBl. S. 319), vom 8.<br />
Juli 2008 (GVBl. S. 364), vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 421), vom 8. Dezember 2009 (GVBl. S. 604)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften über Straftaten und<br />
Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 1 Einteilung der Tatbestände<br />
Art. 2 Straftaten<br />
Art. 3 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 4 Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften oder Anordnungen für<br />
den Einzelfall<br />
Art. 5 Vollstreckung des Bußgeldbescheids<br />
ZWEITER TEIL Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsbehörden;<br />
Entschädigung<br />
Art. 6 Aufgaben der Sicherheitsbehörden<br />
Art. 7 Befugnisse der Sicherheitsbehörden<br />
Art. 8 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
Art. 9 Richtung der Maßnahmen<br />
Art. 10 Sicherheitsbehörden und Polizei<br />
Art. 11 Entschädigung<br />
DRITTER TEIL Einzelne Ermächtigungen und Ordnungswidrigkeiten
1. ABSCHNITT Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit<br />
Art. 12 Übertragbare Krankheiten<br />
Art. 13 und 14<br />
Art. 15 Reinlichkeit in Betrieben<br />
Art. 16 Bekämpfung verwildeter Tauben<br />
Art. 17<br />
Art. 18 Halten von Hunden<br />
2. ABSCHNITT Vergnügungen<br />
Art. 19 Veranstaltung von Vergnügungen<br />
3. ABSCHNITT Weitere Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Sicherheit<br />
und Ordnung<br />
Art. 20 Staatliche Parkanlagen<br />
Art. 21 Unerlaubter Verkehr mit Verwahrten<br />
Art. 22 Notzeichen<br />
Art. 23 Menschenansammlungen<br />
Art. 23 a Uniform- und politisches Kennzeichenverbot<br />
Art. 24 Ski- und Skibobfahren, Rodeln<br />
Art. 25 Zelten, Aufstellen von Wohnwagen<br />
Art. 26 Betreten und Befahren von Grundstücken<br />
Art. 27 Baden; Betreten und Befahren von Eisflächen<br />
Art. 28 Öffentliche Anschläge<br />
Art. 29 Fliegende Verkaufsanlagen<br />
Art. 30
Art. 31 Gifte, Giftwaren, Arzneien<br />
Art. 32 Hochgiftige Stoffe<br />
Art. 33 Überwachung<br />
Art. 34 bis 36<br />
Art. 37 Halten gefährlicher Tiere<br />
Art. 37 a Zucht und Ausbildung von Kampfhunden<br />
Art. 38 Verhütung von Bränden<br />
4. ABSCHNITT Schutz von Feld und Flur<br />
Art. 39 Feld und Flur<br />
Art. 40 Weidefrevel<br />
Art. 41 Feldgefährdung<br />
VIERTER TEIL Verfahren beim Erlaß von Verordnungen<br />
Art. 42 Verordnungen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke<br />
Art. 43 Vollzug der Verordnungen<br />
Art. 44 Zuständigkeit verschiedener Behörden oder Stellen<br />
Art. 45 Rechtmäßigkeit und Angabe der Rechtsgrundlage<br />
Art. 46 Pflicht zum Erlaß von Verordnungen<br />
Art. 47<br />
Art. 48 Änderung und Aufhebung von Verordnungen<br />
Art. 49 Allgemeine Aufsichtspflicht<br />
Art. 50 Geltungsdauer<br />
Art. 51 Amtliche Bekanntmachung<br />
Art. 52 Hinweis auf die Bekanntmachung
Art. 53 Mitteilungen<br />
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 54 Zuständigkeit aus Ermächtigungen vor Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
Art. 55 Zuständigkeiten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz<br />
Art. 56 Zuständigkeit für gemeindefreie Gebiete<br />
Art. 57 Ausführungsvorschriften<br />
Art. 58 Einschränkung von Grundrechten<br />
Art. 59 Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten<br />
nach § 112 des <strong>Gesetze</strong>s über Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 60 Fortbestand alten Verordnungsrechts<br />
Art. 61 Einstweilige Vorschriften über die Stillegung und Beseitigung von<br />
Anlagen und Geräten<br />
Art. 62 Inkrafttreten; Außerkrafttreten<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften über Straftaten und<br />
Ordnungswidrigkeiten<br />
Bay LStVG Art. 1 Einteilung der Tatbestände<br />
(1) Die im <strong>Landesrecht</strong> mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedrohten<br />
Handlungen sind Straftaten.<br />
(2) Die im <strong>Landesrecht</strong> mit Geldbuße bedrohten Handlungen sind<br />
Ordnungswidrigkeiten.<br />
Bay LStVG Art. 2 Straftaten<br />
Auf die Straftaten des <strong>Landesrecht</strong>s sind die im Allgemeinen Teil des<br />
Strafgesetzbuchs enthaltenen Vorschriften sowie die Vorschriften des<br />
Jugendgerichtsgesetzes, der Strafprozeßordnung und des<br />
Gerichtsverfassungsgesetzes anzuwenden, soweit gesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist.<br />
Bay LStVG Art. 3 Ordnungswidrigkeiten<br />
Für die Ordnungswidrigkeiten des <strong>Landesrecht</strong>s gilt das Gesetz über<br />
Ordnungswidrigkeiten (OWiG), soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Bay LStVG Art. 4 Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften oder<br />
Anordnungen für den Einzelfall<br />
(1) Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften im Rang unter dem Gesetz<br />
können auf Grund eines Landesgesetzes mit Strafe oder Geldbuße nur<br />
geahndet werden, wenn die Rechtsvorschrift für einen bestimmten<br />
Tatbestand auf die zugrundeliegende gesetzliche Straf- oder<br />
Bußgeldvorschrift verweist.<br />
(2) Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen der Verwaltungsbehörden für den<br />
Einzelfall können nach <strong>Landesrecht</strong> mit Strafe oder Geldbuße nur<br />
geahndet werden, wenn die Anordnung nicht mehr mit ordentlichen<br />
Rechtsbehelfen angefochten werden kann oder ihre Vollziehung<br />
angeordnet ist.<br />
Bay LStVG Art. 5 Vollstreckung des Bußgeldbescheids<br />
Der Bußgeldbescheid wird nach den Vorschriften des Bayerischen<br />
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes vollstreckt, soweit nicht<br />
das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten etwas anderes bestimmt.<br />
ZWEITER TEIL Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsbehörden;<br />
Entschädigung<br />
Bay LStVG Art. 6 Aufgaben der Sicherheitsbehörden<br />
Die Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das Staatsministerium des<br />
Innern haben als Sicherheitsbehörden die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit<br />
und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und durch Unterbindung und<br />
Beseitigung von Störungen aufrechtzuerhalten.<br />
Bay LStVG Art. 7 Befugnisse der Sicherheitsbehörden<br />
(1) Anordnungen und sonstige Maßnahmen, die in Rechte anderer eingreifen,<br />
dürfen nur getroffen werden, wenn die Sicherheitsbehörden durch Gesetz<br />
oder auf Grund eines <strong>Gesetze</strong>s dazu besonders ermächtigt sind.<br />
(2) Soweit eine solche gesetzliche Ermächtigung nicht in Vorschriften dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s oder in anderen Rechtsvorschriften enthalten ist, können die<br />
Sicherheitsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben für den Einzelfall<br />
Anordnungen nur treffen, um<br />
1. rechtswidrige Taten, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer<br />
Ordnungswidrigkeit verwirklichen, oder verfassungsfeindliche Handlungen<br />
zu verhüten oder zu unterbinden,<br />
2. durch solche Handlungen verursachte Zustände zu beseitigen,<br />
3. Gefahren abzuwehren oder Störungen zu beseitigen, die Leben,<br />
Gesundheit oder die Freiheit von Menschen oder Sachwerte, deren<br />
Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten erscheint, bedrohen oder<br />
verletzen.<br />
(3) Sind Anordnungen nach Absatz 2 nicht möglich, nicht zulässig oder<br />
versprechen sie keinen Erfolg, so können die Sicherheitsbehörden die<br />
Gefahr oder Störung selbst, durch die Polizei oder durch vertraglich<br />
Beauftragte abwehren oder beseitigen.
(4) Die Freiheit der Person und die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 2<br />
Abs. 2 Satz 2 und Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 102 Abs. 1 und<br />
Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) dürfen durch Maßnahmen auf Grund der<br />
Absätze 2 und 3 nicht eingeschränkt werden.<br />
(5) Verfassungsfeindlich im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist eine Handlung, die darauf<br />
gerichtet ist, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik<br />
Deutschland oder eines ihrer Länder auf verfassungswidrige Weise zu<br />
stören oder zu ändern, ohne den Tatbestand eines Strafgesetzes oder<br />
einer Ordnungswidrigkeit zu verwirklichen.<br />
Bay LStVG Art. 8 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu<br />
treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit am wenigsten<br />
beeinträchtigt.<br />
(2) Ein durch die Maßnahme zu erwartender Schaden darf nicht erkennbar<br />
außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg stehen.<br />
(3) Maßnahmen sind zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt,<br />
daß er nicht erreicht werden kann.<br />
Bay LStVG Art. 9 Richtung der Maßnahmen<br />
(1) 1 Macht das Verhalten oder der Zustand einer Person Maßnahmen nach<br />
diesem Gesetz notwendig, so sind diese gegen die Person zu richten, die<br />
die Gefahr oder die Störung verursacht hat. 2 Hat ein strafunmündiges<br />
Kind oder eine Person, für die wegen einer psychischen Krankheit oder<br />
einer geistigen oder seelischen Behinderung zur Besorgung aller ihrer<br />
Angelegenheiten ein Betreuer bestellt ist, die Gefahr oder die Störung<br />
verursacht, so können die Sicherheitsbehörden ihre Maßnahmen auch<br />
gegen den richten, dem die Aufsicht über eine solche Person obliegt.<br />
3<br />
Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896<br />
Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten<br />
Angelegenheiten nicht erfaßt. 4 Hat eine Person, die zu einer Verrichtung<br />
bestellt ist, in Ausführung dieser Verrichtung die Gefahr oder die Störung<br />
verursacht, so kann die Maßnahme auch gegen den gerichtet werden, der<br />
die Person zu der Verrichtung bestellt hat.<br />
(2) 1 Macht das Verhalten oder der Zustand eines Tieres oder der Zustand<br />
einer anderen Sache Maßnahmen nach diesem Gesetz notwendig, so sind<br />
diese gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten. 2 Die<br />
Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder den sonst dinglich<br />
Verfügungsberechtigten gerichtet werden; das gilt nicht, wenn der<br />
Inhaber der tatsächlichen Gewalt diese gegen den Willen des Eigentümers<br />
oder sonst dinglich Verfügungsberechtigten ausübt. 3 Soweit auf Grund<br />
besonderer Vorschriften eine andere Person verantwortlich ist, sind die<br />
Maßnahmen in erster Linie gegen diese zu richten.<br />
(3) 1 Zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr oder<br />
zur Beseitigung einer erheblichen Störung können Maßnahmen auch<br />
gegen eine Person gerichtet werden, die nicht nach Absatz 1 oder<br />
Absatz 2 verantwortlich ist; insbesondere kann sie zur Hilfeleistung<br />
angehalten werden, wenn und soweit weder Maßnahmen gegen die
verantwortliche Person noch Maßnahmen nach Art. 7 Abs. 3 möglich,<br />
ausreichend oder zulässig sind. 2 Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nicht<br />
getroffen werden, wenn die nicht verantwortliche Person dadurch selbst<br />
an Leben oder Gesundheit gefährdet oder an der Erfüllung überwiegender<br />
anderweitiger Pflichten gehindert würde.<br />
Bay LStVG Art. 10 Sicherheitsbehörden und Polizei<br />
1 Maßnahmen der Sicherheitsbehörden nach diesem Gesetz schließen<br />
widersprechende Maßnahmen der Polizei aus. 2 Das Recht der<br />
Sicherheitsbehörden, der Polizei Weisungen zu erteilen, und die Vorschriften<br />
über die Strafverfolgung und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bleiben<br />
unberührt.<br />
Bay LStVG Art. 11 Entschädigung<br />
(1) 1 Soweit Maßnahmen auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s getroffen werden, ist<br />
Art. 70 des Polizeiaufgabengesetzes sinngemäß anzuwenden. 2 Zur<br />
Entschädigung verpflichtet ist der Träger der Behörde, die die Maßnahme<br />
getroffen hat; hat das Landratsamt die Maßnahme getroffen, so ist der<br />
Landkreis verpflichtet, soweit nicht der Staat nach Art. 35 Abs. 3 oder<br />
Art. 37 Abs. 5 der Landkreisordnung haftet.<br />
(2) Stellen Maßnahmen auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s eine Enteignung dar, so ist<br />
nach den Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
entschädigungspflichtige Enteignung Entschädigung in Geld zu leisten.<br />
DRITTER TEIL Einzelne Ermächtigungen und Ordnungswidrigkeiten<br />
1. ABSCHNITT Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit<br />
Bay LStVG Art. 12 Übertragbare Krankheiten<br />
(1) Zur Verhütung übertragbarer Krankheiten können die kreisfreien<br />
Gemeinden, die Landkreise, die Bezirke und das Staatsministerium für<br />
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit durch<br />
Verordnung<br />
1. die Beschäftigungsverbote des § 17 des Bundes-Seuchengesetzes auch<br />
dort nicht genannten Personen auferlegen, die andere anstecken können,<br />
2. diesen und den in § 17 des Bundes-Seuchengesetzes bezeichneten<br />
Personen die Tätigkeit<br />
a) in Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, verarbeitet oder<br />
abgegeben werden,<br />
b) im Friseurhandwerk,<br />
c) in Leihbüchereien oder<br />
d) in anderen Betrieben oder Einrichtungen, in denen im besonderen Maß<br />
die Gefahr besteht, daß die dort beschäftigten Personen andere<br />
anstecken,<br />
verbieten oder von besonderen Voraussetzungen abhängig machen,<br />
welche die Eignung dieser Personen für die Tätigkeit oder die<br />
Beschäftigung in solchen Betrieben oder Einrichtungen betreffen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von Anordnungen für den<br />
Einzelfall durch die kreisfreien Gemeinden, die Landratsämter, die<br />
Regierungen und das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,<br />
Familie, Frauen und Gesundheit.<br />
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. entgegen einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung<br />
jemanden beschäftigt oder eine Tätigkeit ausübt oder besondere<br />
Voraussetzungen für eine Tätigkeit oder Beschäftigung nicht beachtet,<br />
2. einer auf Grund des Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung<br />
zuwiderhandelt.<br />
Bay LStVG Art. 13 und 14 (weggefallen)<br />
Bay LStVG Art. 15 Reinlichkeit in Betrieben<br />
(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für die Gesundheit können, soweit nicht<br />
bundesrechtliche Vorschriften bestehen, die kreisfreien Gemeinden, die<br />
Landkreise, die Bezirke und das Staatsministerium für Arbeit und<br />
Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit Verordnungen über die<br />
Reinlichkeit in gewerblichen Betrieben erlassen. 2 Die Vorschriften über<br />
den Arbeitsschutz bleiben unberührt.<br />
(2) Wer einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung<br />
zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt werden, wenn die Tat nicht<br />
nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.<br />
Bay LStVG Art. 16 Bekämpfung verwildeter Tauben<br />
(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für das Eigentum und zum Schutz der<br />
öffentlichen Reinlichkeit können die Gemeinden Verordnungen über die<br />
Bekämpfung verwildeter Tauben erlassen. 2 In den Verordnungen kann<br />
insbesondere bestimmt werden, daß<br />
1. das Füttern von verwilderten Tauben verboten ist,<br />
2. die Eigentümer von Grundstücken, die Nutzungsberechtigten und ihre<br />
Vertreter Maßnahmen der Gemeinde oder deren Beauftragter zur<br />
Beseitigung der Nistplätze und Vergrämung verwildeter Tauben zu dulden<br />
haben.<br />
(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf<br />
Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung oder einer vollziehbaren<br />
Anordnung, die auf Grund einer solchen Verordnung getroffen wurde,<br />
zuwiderhandelt.<br />
Bay LStVG Art. 17 (weggefallen)<br />
Bay LStVG Art. 18 Halten von Hunden<br />
(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die<br />
öffentliche Reinlichkeit können die Gemeinden durch Verordnung das freie<br />
Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden im Sinn des Art. 37<br />
Abs. 1 Satz 2 in öffentlichen Anlagen sowie auf öffentlichen Wegen,<br />
Straßen oder Plätzen einschränken. 2 Der räumliche und zeitliche<br />
Geltungsbereich der Verordnung ist auf die örtlichen Verhältnisse
abzustimmen, wobei auch dem Bewegungsbedürfnis der Hunde<br />
ausreichend Rechnung zu tragen ist.<br />
(2) Zum Schutz der in Absatz 1 genannten Rechtsgüter können die<br />
Gemeinden Anordnungen für den Einzelfall zur Haltung von Hunden<br />
treffen.<br />
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf<br />
Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung oder einer auf Grund des<br />
Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.<br />
2. ABSCHNITT Vergnügungen<br />
Bay LStVG Art. 19 Veranstaltung von Vergnügungen<br />
(1) 1 Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, hat das der Gemeinde<br />
unter Angabe der Art, des Orts und der Zeit der Veranstaltung und der<br />
Zahl der zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine Woche vorher<br />
schriftlich anzuzeigen. 2 Für regelmäßig wiederkehrende, gleichartige<br />
öffentliche Vergnügungen genügt eine einmalige Anzeige.<br />
(2) Absatz 1 gilt nicht für Vergnügungen, die vorwiegend religiösen,<br />
künstlerischen, kulturellen, wissenschaftlichen, belehrenden oder<br />
erzieherischen Zwecken oder der Wirtschaftswerbung dienen, sofern die<br />
Vergnügungen in Räumen stattfinden, die für Veranstaltungen der<br />
beabsichtigten Art bestimmt sind.<br />
(3) 1 Die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen bedarf der Erlaubnis, wenn<br />
1. die nach Absatz 1 erforderliche Anzeige nicht fristgemäß erstattet wird,<br />
2. es sich um eine motorsportliche Veranstaltung handelt oder<br />
3. zu einer Veranstaltung, die außerhalb dafür bestimmter Anlagen<br />
stattfinden soll, mehr als eintausend Besucher zugleich zugelassen werden<br />
sollen.<br />
2<br />
Zuständig sind die Gemeinden, für motorsportliche Veranstaltungen die<br />
kreisfreien Gemeinden und Landratsämter.<br />
(4) 1 Die Erlaubnis nach Absatz 3 ist zu versagen, wenn es zur Verhütung von<br />
Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter oder zum Schutz vor<br />
erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die<br />
Allgemeinheit oder Nachbarschaft oder vor erheblichen<br />
Beeinträchtigungen der Natur oder Landschaft erforderlich erscheint. 2 Das<br />
gleiche gilt, sofern andere öffentlich-rechtliche Vorschriften<br />
entgegenstehen.<br />
(5) 1 Die Gemeinden, für motorsportliche Veranstaltungen die kreisfreien<br />
Gemeinden und Landratsämter, können zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1<br />
bezeichneten Rechtsgüter Anordnungen für den Einzelfall für die<br />
Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen und sonstiger Vergnügungen<br />
treffen. 2 Reichen Anordnungen nach Satz 1 nicht aus oder stehen andere<br />
öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen, so kann die Veranstaltung<br />
untersagt werden.<br />
(6) weggefallen<br />
(7) 1 Die Gemeinden können durch Verordnung<br />
1. die Veranstaltung von Vergnügungen bestimmter Art von der
Anzeigepflicht nach Absatz 1 oder von der Erlaubnispflicht nach Absatz 3<br />
ausnehmen, soweit die Gemeinden nach Absatz 3 Satz 2 zuständig sind<br />
und diese Pflichten zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten<br />
Rechtsgüter nicht erforderlich erscheinen,<br />
2. zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter die<br />
Anzeigepflicht nach Absatz 1 auf die Veranstaltung bestimmter Arten<br />
öffentlicher Vergnügungen im Sinn des Absatzes 2 erstrecken und<br />
Anforderungen an die Veranstaltung öffentlicher oder sonstiger<br />
Vergnügungen stellen,<br />
3. zum Schutz der in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Rechtsgüter eine<br />
Sperrzeit für die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen oder<br />
bestimmter Arten öffentlicher Vergnügungen festsetzen; in der<br />
Verordnung kann bestimmt werden, daß die Sperrzeit bei Vorliegen eines<br />
öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse für den<br />
Einzelfall verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden kann.<br />
2<br />
Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung gleiches<br />
für das gesamte Staatsgebiet bestimmen.<br />
(8) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. eine öffentliche Vergnügung ohne die erforderliche Anzeige oder<br />
Erlaubnis veranstaltet,<br />
2. als Veranstalter einer Vergnügung die mit der Erlaubnis verbundenen<br />
vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt oder einer vollziehbaren Anordnung<br />
nach Absatz 5 nicht Folge leistet oder<br />
3. einer Verordnung nach Absatz 7 Nrn. 2 oder 3 zuwiderhandelt.<br />
(9) Die Absätze 1 bis 5, 7 und 8 sind nicht anzuwenden, soweit<br />
bundesrechtliche oder besondere landesrechtliche Vorschriften bestehen.<br />
3. ABSCHNITT Weitere Vorschriften zum Schutz der öffentlichen<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Bay LStVG Art. 20 Staatliche Parkanlagen<br />
(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit,<br />
Eigentum oder die öffentliche Reinlichkeit, zur Sicherung der Erholung in<br />
der freien Natur, zum Schutz der Natur und Landschaft sowie zum Schutz<br />
vor erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die<br />
Allgemeinheit kann das Staatsministerium der Finanzen Verordnungen<br />
über die Benutzung der Grünanlagen und Grünflächen, die im Eigentum<br />
des Freistaates Bayern stehen und von der Verwaltung der staatlichen<br />
Schlösser, Gärten und Seen verwaltet werden (staatliche Parkanlagen),<br />
erlassen. 2 Die Regelungen sind auf die örtlichen Verhältnisse<br />
abzustimmen. 3 Das Staatsministerium der Finanzen kann die<br />
Ermächtigung nach Satz 1 durch Verordnung auf die Verwaltung der<br />
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen übertragen; Verordnungen der<br />
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen sind im Amtsblatt<br />
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen amtlich bekannt zu<br />
machen. 4 Der Vollzug der Anlagenverordnungen obliegt der Verwaltung<br />
der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.
(2) Zur Verhütung von Verstößen gegen auf Grund des Abs. 1 erlassene<br />
Verordnungen können das Staatsministerium der Finanzen und die<br />
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen Anordnungen für<br />
den Einzelfall treffen.<br />
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. einer auf Grund des Abs. 1 erlassenen Verordnung oder<br />
2. einer auf Grund des Abs. 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung<br />
zuwiderhandelt.<br />
Bay LStVG Art. 21 Unerlaubter Verkehr mit Verwahrten<br />
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer unbefugt<br />
1. einem Verwahrten Sachen oder Nachrichten übermittelt oder sich von<br />
ihm übermitteln läßt,<br />
2. sich mit einem Verwahrten, der sich innerhalb einer Anstalt befindet,<br />
von außen durch Worte oder Zeichen verständigt.<br />
(2) Verwahrter im Sinn des Absatzes 1 ist, wer sich in behördlichem<br />
Gewahrsam befindet, ohne Gefangener im Sinn des § 115 OWiG zu sein.<br />
(3) Der Versuch der Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße belegt werden.<br />
Bay LStVG Art. 22 Notzeichen<br />
(1) Das Staatsministerium des Innern kann, soweit bundesrechtliche<br />
Vorschriften nicht bestehen, durch Verordnung vorschreiben, daß<br />
bestimmte Schallzeichen, die der Warnung vor Gefahren, dem Rufen von<br />
Hilfsdiensten oder anderen öffentlichen Zwecken dienen (öffentliche<br />
Schallzeichen), nur durch bestimmte Stellen für diese Zwecke gegeben<br />
werden dürfen.<br />
(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. entgegen einer nach Absatz 1 erlassenen Verordnung öffentliche<br />
Schallzeichen gibt,<br />
2. öffentlich vernehmbar Schallzeichen gibt, die mit öffentlichen<br />
Schallzeichen verwechselt werden können,<br />
3. ohne berechtigten Grund um Hilfe ruft oder ein anderes Notzeichen<br />
gibt.<br />
Bay LStVG Art. 23 Menschenansammlungen<br />
(1) 1 Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit,<br />
ungestörte Religionsausübung, Eigentum oder Besitz können die<br />
Gemeinden für Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen,<br />
insbesondere bei religiösen Feiern, Volksfesten und Sportveranstaltungen,<br />
Verordnungen und Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 2 Dies gilt<br />
nicht für Versammlungen im Sinn des Bayerischen<br />
Versammlungsgesetzes; die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts<br />
bleiben unberührt.<br />
(2) Für Ansammlungen, die über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen,<br />
kann auch die gemeinsame höhere Behörde Anordnungen für den<br />
Einzelfall erlassen.<br />
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund der Absätze 1 oder<br />
2 erlassenen Verordnung oder vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.
Bay LStVG Art. 23 a Uniform- und politisches Kennzeichenverbot<br />
Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer außerhalb von<br />
Versammlungen öffentlich Uniformen, Uniformteile oder gleichartige<br />
Kleidungsstücke als Ausdruck einer politischen Gesinnung trägt, sofern damit<br />
eine einschüchternde Wirkung verbunden ist.<br />
Bay LStVG Art. 24 Ski- und Skibobfahren, Rodeln<br />
(1) Die Gemeinden können durch Verordnung ein Gelände außerhalb<br />
öffentlicher Wege und Plätze, das zum Skifahren, Skibobfahren oder<br />
Rodeln der Allgemeinheit zur Verfügung steht, zur Hauptabfahrt für solche<br />
Sportarten oder zum Hauptskiwanderweg erklären.<br />
(2) 1 Die Gemeinden können durch Anordnung für den Einzelfall den<br />
Sportbetrieb auf einer Hauptabfahrt oder auf einer sonstigen Skiabfahrt,<br />
Rodelbahn oder einem Skiwanderweg vorübergehend untersagen oder<br />
beschränken, wenn es zur Verhütung von Gefahren oder sonst aus<br />
wichtigen Gründen erforderlich ist. 2 Sie können für den Einzelfall<br />
zulassen, daß Hauptabfahrten und Hauptskiwanderwege zur Zeit des<br />
Sportbetriebs zur Pistenpflege, zur Versorgung von Einrichtungen oder für<br />
land- und forstwirtschaftliche Zwecke benützt werden, soweit dadurch<br />
keine Gefahren für die Sicherheit der Sporttreibenden entstehen. 3 Eine<br />
Erlaubnis nach Satz 2 ist nicht erforderlich, soweit für den Betrieb<br />
motorisierter Schneefahrzeuge eine Ausnahme nach Art. 12 Abs. 2 des<br />
Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) zugelassen worden<br />
ist.<br />
(3) Das Staatsministerium des Innern kann durch Verordnung zur Verhütung<br />
von Gefahren für Leben oder Gesundheit oder zum Schutz vor erheblichen<br />
Nachteilen<br />
1. das Verhalten beim Skifahren, Skibobfahren und Rodeln regeln,<br />
2. bestimmen, wie<br />
a) Hauptabfahrten und sonstige Skiabfahrten, Rodelbahnen und<br />
Skiwanderwege,<br />
b) die Untersagung oder Beschränkung des Sportbetriebs auf solchem<br />
Gelände und<br />
c) Fahrzeuge, die sich auf Abfahrten befinden,<br />
gekennzeichnet sein müssen.<br />
(4) 1 Die Kennzeichnung nach Absatz 3 Nr. 2 obliegt den Gemeinden, soweit<br />
es sich um Fahrzeuge handelt, dem Halter des Fahrzeugs. 2 Die<br />
Gemeinden können ihre Kosten der Kennzeichnung von demjenigen<br />
erstattet verlangen, der die Kosten für die Instandhaltung des<br />
Sportgeländes trägt.<br />
(5) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer auf einer Hauptabfahrt oder einem<br />
Hauptskiwanderweg, die in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet<br />
sind,<br />
1. sich zur Zeit des Sportbetriebs zu anderen Zwecken als der Ausübung<br />
der Sportart, für die die Abfahrt oder der Wanderweg bestimmt ist, ohne<br />
Erlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 oder ohne Ausnahmegenehmigung nach<br />
Art. 12 Abs. 2 BayImSchG aufhält,<br />
2. zur Zeit des Sportbetriebs ein Tier laufen läßt,
3. zur Zeit des Sportbetriebs mit einem Fahrzeug fährt, das nicht nach der<br />
auf Grund des Absatzes 3 Nr. 2 erlassenen Verordnung gekennzeichnet<br />
ist,<br />
4. sonst ein Hindernis bereitet, ohne es der Gemeinde so rechtzeitig<br />
anzuzeigen, daß Gefahren für die Sicherheit der Skifahrer, Skibobfahrer<br />
oder Rodelfahrer verhütet werden können.<br />
(6) Mit Geldbuße kann ferner belegt werden, wer als Skifahrer, Skibobfahrer<br />
oder Rodelfahrer<br />
1. gegen eine auf Grund des Absatzes 2 Satz 1 erlassene vollziehbare<br />
Anordnung oder<br />
2. gegen eine auf Grund des Absatzes 3 Nr. 1 erlassene Verordnung<br />
verstößt,<br />
3. grob rücksichtslos Leib oder Leben eines anderen gefährdet oder<br />
4. sich als Beteiligter an einem Unfall vom Unfallort entfernt, bevor er<br />
a) zugunsten der anderen Unfallbeteiligten und der Geschädigten die<br />
Feststellung seiner Person und der Art seiner Beteiligung durch seine<br />
Anwesenheit und durch die Angabe, daß er an dem Unfall beteiligt ist,<br />
ermöglicht hat oder<br />
b) eine nach den Umständen angemessene Zeit gewartet hat, ohne daß<br />
jemand bereit war, die Feststellungen zu treffen.<br />
Bay LStVG Art. 25 Zelten, Aufstellen von Wohnwagen<br />
(1) Zur Sicherung der Erholung in der freien Natur, zum Schutz der Natur und<br />
Landschaft, zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum<br />
oder Besitz, zum Schutz der Jagdausübung und zur Aufrechterhaltung der<br />
öffentlichen Ruhe können die Gemeinden, Landkreise und das<br />
Staatsministerium des Innern durch Verordnung den Betrieb und die<br />
Benutzung von Plätzen, die zum Aufstellen und Bewohnen von mehr als<br />
drei Zelten oder Wohnwagen bestimmt sind (Campingplätze), regeln.<br />
(2) 1 Wer einen Campingplatz errichten und betreiben will, bedarf der<br />
Erlaubnis der Gemeinde. 2 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn<br />
Rechtsgüter im Sinn des Absatzes 1 nicht gefährdet werden.<br />
3<br />
Versagungsgründe, die sich aus anderen Rechtsvorschriften,<br />
insbesondere des Naturschutzrechts, ergeben, bleiben unberührt. 4 Die<br />
Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Campingplätze, die einer Genehmigung nach<br />
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bedürfen.<br />
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt<br />
oder<br />
2. ohne die nach Absatz 2 erforderliche Erlaubnis einen Campingplatz<br />
errichtet oder betreibt oder einer mit einer solchen Erlaubnis verbundenen<br />
vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt.<br />
Bay LStVG Art. 26 Betreten und Befahren von Grundstücken<br />
(1) 1 Zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben oder Gesundheit können<br />
die Gemeinden und die Landkreise durch Verordnung das Betreten und<br />
Befahren bewohnter oder unbewohnter Grundstücke oder bestimmter<br />
Gebiete auf die voraussichtliche Dauer der Gefahr verbieten. 2 Für
öffentliche Wege, Straßen und Plätze gelten jedoch die Vorschriften des<br />
Straßen- und des Straßenverkehrsrechts.<br />
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Erlaß von Anordnungen für den<br />
Einzelfall durch die Gemeinden und die Landratsämter.<br />
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung;<br />
2. einer auf Grund des Absatzes 2 erlassenen vollziehbaren Anordnung<br />
zuwiderhandelt.<br />
Bay LStVG Art. 27 Baden; Betreten und Befahren von Eisflächen<br />
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit können die<br />
Gemeinden durch Verordnung das Baden an bestimmten Orten sowie das<br />
Betreten und Befahren von Eisflächen verbieten.<br />
(2) 1 Zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zur Verhütung von Gefahren<br />
für Leben oder Gesundheit können die Gemeinden und das<br />
Staatsministerium des Innern durch Verordnung Vorschriften über das<br />
Verhalten beim öffentlichen Baden und über Sicherheitsvorkehrungen in<br />
Badeanstalten erlassen. 2 In solchen Verordnungen kann auch bestimmt<br />
werden, daß der Badebetrieb in Badeanstalten durch geprüfte<br />
Schwimmeistergehilfen, Schwimmeister oder andere dafür ausgebildete<br />
Personen zu beaufsichtigen ist.<br />
(3) Die Vorschriften des Bayerischen Wassergesetzes bleiben unberührt.<br />
(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. einem durch Verordnung nach Absatz 1 angeordneten Verbot des<br />
Badens an bestimmten Orten oder des Betretens oder Befahrens von<br />
Eisflächen zuwiderhandelt,<br />
2. einer Verordnung nach Absatz 2 über das Verhalten beim Baden<br />
zuwiderhandelt,<br />
3. vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaber oder Verantwortlicher einer<br />
Badeanstalt entgegen einer Verordnung nach Absatz 2 nicht für die<br />
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen sorgt oder den Badebetrieb nicht<br />
genügend beaufsichtigt.<br />
Bay LStVG Art. 28 Öffentliche Anschläge<br />
(1) 1 Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds oder eines Natur-, Kunstoder<br />
Kulturdenkmals können die Gemeinden durch Verordnung Anschläge,<br />
insbesondere Plakate, und Darstellungen durch Bildwerfer in der<br />
Öffentlichkeit auf bestimmte Flächen beschränken. 2 Dies gilt nicht für<br />
Werbeanlagen, die von der Bayerischen Bauordnung erfaßt werden.<br />
(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen<br />
Verordnung zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt werden.<br />
(3) Die Gemeinde kann die Beseitigung von Anschlägen, insbesondere<br />
Plakaten, und von Darstellungen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit<br />
anordnen, wenn sie Rechtsgüter im Sinn des Absatzes 1 beeinträchtigen.<br />
Bay LStVG Art. 29 Fliegende Verkaufsanlagen<br />
(1) 1 Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, eines Natur-, Kunst- oder<br />
Kulturdenkmals sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit
können die Gemeinden durch Verordnung oder Anordnung für den<br />
Einzelfall das Aufstellen fliegender Verkaufsanlagen an bestimmten Orten<br />
außerhalb der öffentlichen Wege, Straßen und Plätze verbieten oder davon<br />
abhängig machen, daß Störungen durch geeignete Vorkehrungen verhütet<br />
werden. 2 Fliegende Verkaufsanlagen sind vorübergehend aufgestellte,<br />
dem Vertrieb von Waren dienende Stände oder ähnliche Verkaufsstellen.<br />
3<br />
Art. 72 BayBO bleibt unberührt.<br />
(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen<br />
Verordnung oder vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, kann mit<br />
Geldbuße belegt werden.<br />
Bay LStVG Art. 30 (weggefallen)<br />
Bay LStVG Art. 31 Gifte, Giftwaren, Arzneien<br />
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit kann das<br />
Staatsministerium des Innern, soweit nicht bundesrechtliche Vorschriften<br />
bestehen, Verordnungen erlassen über<br />
1. die Erlaubnispflicht für das Zubereiten, Feilhalten, Verkaufen oder<br />
sonstige Überlassen von Giftwaren, insbesondere von Giften selbst,<br />
2. das Aufbewahren und Befördern von Giftwaren,<br />
3. die Erlaubnispflicht für das Zubereiten, Feilhalten, Verkaufen oder<br />
sonstige Überlassen von Arzneien sowie die Ausübung einer erteilten<br />
Erlaubnis zum Zubereiten oder Feilhalten von Arzneien.<br />
(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. ohne die erforderliche Erlaubnis Gifte oder Giftwaren zubereitet, feilhält,<br />
verkauft oder sonst an andere überläßt oder<br />
2. einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Verordnung über das<br />
Aufbewahren oder Befördern von Giftwaren oder über die Ausübung der<br />
Erlaubnis zum Zubereiten oder Feilhalten von Arzneien zuwiderhandelt.<br />
Bay LStVG Art. 32 Hochgiftige Stoffe<br />
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit kann das<br />
Staatsministerium des Innern durch Verordnung Giftwaren, die<br />
bestimmungsgemäß zur Bekämpfung schädlicher Tiere und Pflanzen<br />
verwendet werden und durch deren Verwendung neben den daran<br />
Beteiligten auch andere Menschen oder Tiere in lebensbedrohender Weise<br />
gefährdet werden können, zu hochgiftigen Stoffen erklären und<br />
bestimmen, daß<br />
1. hochgiftige Stoffe nur mit Erlaubnis angewendet werden dürfen oder<br />
ihre Anwendung vorher anzuzeigen ist,<br />
2. hochgiftige Stoffe nur anwenden darf, wer eine bestimmte Ausbildung<br />
nachweist,<br />
3. die Erlaubnis im Sinn der Nummer 1 mit Auflagen verbunden und auf<br />
Grund einer Anzeige im Sinn der Nummer 1 Anordnungen für den<br />
Einzelfall erlassen werden können,<br />
4. hochgiftige Stoffe nur unter bestimmten Schutzvorkehrungen<br />
angewendet werden dürfen,<br />
5. das Anwenden hochgiftiger Stoffe zu überwachen ist.
(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund des Absatzes 1<br />
Nrn. 1 bis 4 erlassenen Verordnung oder einer vollziehbaren Anordnung<br />
oder Auflage, die auf einer solchen Verordnung beruht, zuwiderhandelt.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit bundesrechtliche Vorschriften<br />
bestehen.<br />
Bay LStVG Art. 33 Überwachung<br />
(1) 1 Wer eine der in Art. 31 Abs. 1 oder Art. 32 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 genannten<br />
Tätigkeiten ausübt, hat den Beauftragten der kreisfreien Gemeinden, der<br />
Landratsämter, der Gesundheitsämter, der Regierungen und des<br />
Staatsministeriums des Innern und den von diesen zugezogenen<br />
Sachverständigen die Betriebsstätten, in denen die Tätigkeiten ausgeübt<br />
werden, zugänglich zu machen, Auskünfte zu erteilen und Unterlagen<br />
vorzulegen, verschlossene Behälter zu öffnen, Untersuchungen und gegen<br />
angemessene Entschädigung die Entnahme von Proben zu gestatten,<br />
ferner Arbeitskräfte und Hilfsmittel bereitzustellen, wenn das erforderlich<br />
ist, um den Vollzug der nach Art. 31 Abs. 1 oder Art. 32 Abs. 1 erlassenen<br />
Verordnungen zu überwachen. 2 Der zur Auskunft Verpflichtete kann die<br />
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst<br />
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung<br />
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder<br />
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen<br />
würde.<br />
(2) Wer einer Pflicht nach Absatz 1 zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße belegt<br />
werden.<br />
Bay LStVG Art. 34 bis 36 (weggefallen)<br />
Bay LStVG Art. 37 Halten gefährlicher Tiere<br />
(1) 1 Wer ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art oder einen Kampfhund<br />
halten will, bedarf der Erlaubnis der Gemeinde, soweit das Bundesrecht<br />
nichts anderes vorschreibt. 2 Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf<br />
Grund rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von einer<br />
gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder<br />
Tieren auszugehen ist; das Staatsministerium des Innern kann durch<br />
Verordnung Rassen, Kreuzungen und sonstige Gruppen von Hunden<br />
bestimmen, für welche die Eigenschaft als Kampfhunde vermutet wird.<br />
(2) 1 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller ein<br />
berechtigtes Interesse nachweist, gegen seine Zuverlässigkeit keine<br />
Bedenken bestehen und Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder<br />
Besitz nicht entgegenstehen; ein berechtigtes Interesse zur Haltung von<br />
Hunden im Sinn des Absatzes 1 Satz 2 kann insbesondere vorliegen, wenn<br />
diese der Bewachung eines gefährdeten Besitztums dient. 2 Die Erlaubnis<br />
kann vom Nachweis des Bestehens einer besonderen<br />
Haftpflichtversicherung abhängig gemacht werden. 3 Versagungsgründe,<br />
die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben unberührt.<br />
(3) Die Erlaubnispflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für die Haltung von<br />
Diensthunden der Polizei, des Strafvollzugs, des Bundesgrenzschutzes und<br />
der Zollverwaltung.
(4) 1 Wer zum 1. Juni 1992 Kampfhunde im Sinn des Absatzes 1 Satz 2 hält,<br />
bedarf für die Haltung dieser Hunde abweichend von Absatz 1 Satz 1<br />
keiner Erlaubnis, wenn er bis zum 31. Oktober 1992 der Gemeinde unter<br />
Angabe seiner Personalien die Haltung sowie Rasse, Anzahl und Alter der<br />
Hunde schriftlich anzeigt. 2 In den Fällen des Satzes 1 ist die Haltung von<br />
der Gemeinde zu untersagen, wenn Bedenken gegen die Zuverlässigkeit<br />
des Halters oder Gefahren für die in Absatz 2 genannten Rechtsgüter<br />
bestehen. 3 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten<br />
entsprechend für Nachkömmlinge der in Satz 1 genannten Hunde, wenn<br />
sie bis zum 31. Oktober 1992 geboren wurden.<br />
(5) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer<br />
vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art oder einen Kampfhund ohne<br />
die erforderliche Erlaubnis hält,<br />
2. die mit der Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt<br />
oder<br />
3. einer auf Grund des Absatzes 4 Satz 2 erlassenen vollziehbaren<br />
Anordnung zuwiderhandelt.<br />
Bay LStVG Art. 37 a Zucht und Ausbildung von Kampfhunden<br />
(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
Kampfhunde im Sinn des Art. 37 Abs. 1 Satz 2 züchtet oder kreuzt.<br />
(2) 1 Wer Hunde mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität und<br />
Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren ausbildet, bedarf der<br />
Erlaubnis der Kreisverwaltungsbehörde, soweit das Bundesrecht nichts<br />
anderes vorschreibt. 2 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der<br />
Antragsteller die erforderliche Sachkunde besitzt, gegen seine<br />
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und die Ausbildung<br />
Schutzzwecken dient. 3 Die Erlaubnis darf nicht erteilt werden für Hunde<br />
im Sinn des Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2. 4 Art. 37 Abs. 3 gilt<br />
entsprechend.<br />
(3) 1 Wer zum 1. Juni 1992 Hunde mit dem Ziel einer gesteigerten<br />
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren<br />
ausbildet, bedarf abweichend von Absatz 2 Satz 1 keiner Erlaubnis, wenn<br />
er bis zum 31. Oktober 1992 der Kreisverwaltungsbehörde unter Angabe<br />
seiner Personalien diese Tätigkeit schriftlich anzeigt. 2 In den Fällen des<br />
Satzes 1 ist die Ausbildung von der Kreisverwaltungsbehörde zu<br />
untersagen, wenn der Anzeigende nicht die erforderliche Sachkunde<br />
besitzt, gegen seine Zuverlässigkeit Bedenken bestehen oder die<br />
Ausbildung nicht Schutzzwecken dient.<br />
(4) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. einen Hund ohne die erforderliche Erlaubnis ausbildet,<br />
2. die mit der Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt<br />
oder<br />
3. einer auf Grund des Absatz 3 Satz 2 erlassenen vollziehbaren<br />
Anordnung zuwiderhandelt.
Bay LStVG Art. 38 Verhütung von Bränden<br />
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz<br />
durch Brand kann, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere<br />
landesrechtliche Vorschriften bestehen, das Staatsministerium des Innern<br />
Verordnungen erlassen über<br />
1. die der Feuerbeschau unterliegenden Gebäude, Feuerungsanlagen und<br />
sonstigen Anlagen und Gegenstände, von denen Brandgefahren ausgehen<br />
können, die Ausübung der Feuerbeschau und die Beseitigung der bei der<br />
Feuerbeschau festgestellten Mängel; dabei kann bestimmt werden, dass<br />
die zuständige Behörde die Durchführung der Feuerbeschau auf Betriebe<br />
oder sonstige Einrichtungen, für die nach Art. 15 des Bayerischen<br />
Feuerwehrgesetzes Werkfeuerwehren bestehen, auf deren Kosten<br />
übertragen kann,<br />
2. Lichtspielvorführungen und die Einrichtung von Lichtspieltheatern,<br />
insbesondere der Zuschauer- und Bildwerferräume, sowie die<br />
Ausbildungs- und Bedienungsvorschriften für Filmvorführer,<br />
3. Theateraufführungen und sonstige Schaustellungen, die Einrichtung von<br />
Theatern und sonstigen Versammlungsstätten, insbesondere die<br />
Zuschauer- und Bühnenräume, ferner über die Ausbildung und Prüfung<br />
der technischen Bühnenvorstände,<br />
4. die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen.<br />
(2) In den Verordnungen nach Absatz 1 kann zugelassen werden, daß<br />
bestimmte Gemeinden abweichende Vorschriften erlassen.<br />
(3) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz<br />
durch Brand können ferner, soweit nicht bundesrechtliche oder besondere<br />
landesrechtliche Vorschriften bestehen, die Gemeinden und das<br />
Staatsministerium des Innern Verordnungen erlassen über<br />
1. die Verwendung von Feuer und offenem Licht in Gebäuden oder in der<br />
Nähe von Gebäuden oder brandgefährlichen Stoffen,<br />
2. Herstellung, Abgabe, Lagerung und Verwendung von Brennstoffen und<br />
brandgefährlichen Stoffen,<br />
3. Auflagen und Schutzmaßnahmen für die Errichtung, die Einrichtung und<br />
den Betrieb brandgefährlicher Anlagen, die nicht unter Absatz 1 fallen,<br />
4. Blitzableiter, Feuerlöscheinrichtungen und andere Schutzmaßnahmen<br />
zur Verhütung oder Beseitigung feuergefährlicher Zustände sowie zur<br />
Bekämpfung von Bränden.<br />
(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund der Absätze 1 bis 3<br />
erlassenen Verordnung oder einer vollziehbaren Anordnung, die auf Grund<br />
einer solchen Verordnung getroffen wurde, vorsätzlich oder fahrlässig<br />
zuwiderhandelt.<br />
(5) 1 Die Eigentümer und Besitzer von Gebäuden, Anlagen oder<br />
Gegenständen, auf die sich Verordnungen nach den Absätzen 1 bis 3<br />
beziehen, haben gegenüber den Beauftragten der Gemeinden und<br />
Landratsämter die in Art. 33 Abs. 1 Satz 1 genannten Pflichten, wenn das<br />
zur Prüfung der Brandgefährlichkeit erforderlich ist. 2 Art. 33 Abs. 1 Satz 2<br />
gilt entsprechend.<br />
(6) Wer den Pflichten nach Absatz 5 zuwiderhandelt, kann mit Geldbuße<br />
belegt werden.
4. ABSCHNITT Schutz von Feld und Flur<br />
Bay LStVG Art. 39 Feld und Flur<br />
(1) Feld und Flur im Sinn dieses Abschnitts sind<br />
1. alle Grundstücke außerhalb eines Forstes, die der Gewinnung von<br />
Feldfrüchten, Gartenfrüchten, Bäumen, Sträuchern oder anderen<br />
Bodenerzeugnissen dienen, insbesondere Äcker, Wiesen, Weiden, Gärten,<br />
Obstanlagen, Baumschulen und Weinberge,<br />
2. die Wege, Gräben und Böschungen, die mit den in Nummer 1<br />
genannten Grundstücken räumlich zusammenhängen und ihrer<br />
Bewirtschaftung dienen,<br />
3. die Ödflächen.<br />
(2) Anpflanzungen in öffentlichen Anlagen und in Friedhöfen fallen nicht unter<br />
Absatz 1.<br />
Bay LStVG Art. 40 Weidefrevel<br />
Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig in Feld und<br />
Flur Vieh oder Hausgeflügel unbefugt auf fremden Grundstücken weiden läßt,<br />
soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.<br />
Bay LStVG Art. 41 Feldgefährdung<br />
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer das Eigentum anderer in Feld und<br />
Flur dadurch gefährdet, daß er<br />
1. Vieh oder Hausgeflügel außerhalb genügend umschlossener<br />
Grundstücke ohne ausreichende Aufsicht oder Sicherung läßt,<br />
2. Tauben, ausgenommen Brieftauben, zur Saat- oder Erntezeit nicht<br />
eingeschlossen hält,<br />
3. vor beendeter Ernte über bestellte Grundstücke Vieh treibt,<br />
4. fremde Grundstücke abgräbt oder abpflügt.<br />
(2) Die Gemeinden und Landkreise können die Saat- und Erntezeit durch<br />
Verordnung näher bestimmen.<br />
VIERTER TEIL Verfahren beim Erlaß von Verordnungen<br />
Bay LStVG Art. 42 Verordnungen der Gemeinden, Landkreise und<br />
Bezirke<br />
(1) 1 Verordnungen, zu deren Erlaß die Gemeinden, die Landkreise oder die<br />
Bezirke durch dieses Gesetz oder durch andere Rechtsvorschriften<br />
ermächtigt sind, werden vom Gemeinderat, vom Kreistag, vom Bezirkstag<br />
erlassen. 2 Der Erlaß solcher Verordnungen ist Angelegenheit des<br />
übertragenen Wirkungskreises, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes<br />
bestimmt ist.<br />
(2) 1 Ist der Erlaß einer Verordnung dringlich und duldet er keinen Aufschub<br />
bis zum Zusammentritt des nach Absatz 1 zuständigen<br />
Vertretungskörpers, so erläßt an dessen Stelle der erste Bürgermeister,<br />
der Landrat oder der Bezirkstagspräsident die Verordnung (dringliche<br />
Verordnung). 2 Hiervon ist dem Vertretungskörper in der nächsten Sitzung<br />
Kenntnis zu geben.
Bay LStVG Art. 43 Vollzug der Verordnungen<br />
Soweit nicht durch Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist, werden<br />
1. Verordnungen der Gemeinde durch die Gemeinde,<br />
2. Verordnungen der Landkreise durch den Landkreis oder, wenn die<br />
Verordnung das bestimmt, durch die Gemeinden oder diejenigen Gemeinden,<br />
denen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen sind,<br />
3. Verordnungen der Bezirke durch den Bezirk oder, wenn die Verordnung das<br />
bestimmt, durch die Landratsämter und kreisfreien Gemeinden oder diejenigen<br />
Gemeinden, denen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen<br />
sind,<br />
4. Verordnungen der Staatsministerien oder der Staatsregierung durch die<br />
Landratsämter und die kreisfreien Gemeinden oder, wenn die Verordnung das<br />
bestimmt, durch die Regierung oder die Gemeinden oder diejenigen<br />
Gemeinden, denen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen<br />
sind,<br />
vollzogen.<br />
Bay LStVG Art. 44 Zuständigkeit verschiedener Behörden oder Stellen<br />
(1) 1 Sind verschiedene Behörden oder Stellen zum Erlaß von Verordnungen<br />
zuständig, so soll die höhere Behörde oder Stelle von ihrer Befugnis nur<br />
Gebrauch machen, wenn eine einheitliche Regelung für ihren Bereich oder<br />
einen Teilbereich erforderlich oder zweckmäßig ist. 2 Sie kann insoweit in<br />
der Verordnung entgegenstehende oder gleichlautende Vorschriften der<br />
unteren Behörde oder Stelle außer Kraft setzen.<br />
(2) Ist eine Verordnung für den örtlichen Bereich mehrerer ermächtigter<br />
Behörden oder Stellen der gleichen Verwaltungsebene erforderlich, so<br />
kann die gemeinsame höhere Behörde die Verordnung erlassen.<br />
Bay LStVG Art. 45 Rechtmäßigkeit und Angabe der Rechtsgrundlage<br />
(1) Verordnungen dürfen dem geltenden Recht, insbesondere den <strong>Gesetze</strong>n<br />
sowie den Verordnungen einer höheren Behörde oder Stelle, nicht<br />
widersprechen.<br />
(2) In jeder Verordnung soll ihre besondere Rechtsgrundlage angegeben<br />
werden.<br />
Bay LStVG Art. 46 Pflicht zum Erlaß von Verordnungen<br />
(1) Erläßt eine Gemeinde, ein Landkreis oder ein Bezirk eine Verordnung, zu<br />
der diese Gebietskörperschaft ermächtigt ist, nicht, obwohl es das Wohl<br />
der Allgemeinheit zwingend erfordert, so kann die Rechtsaufsichtsbehörde<br />
die Verordnung erlassen, wenn die Gebietskörperschaft der Aufforderung<br />
der Rechtsaufsichtsbehörde, die erforderliche Verordnung binnen<br />
angemessener Frist zu erlassen, nicht nachkommt.<br />
(2) Eine nach Absatz 1 erlassene Verordnung kann nur von der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde, die sie erlassen hat, oder mit deren Zustimmung<br />
aufgehoben werden.
Bay LStVG Art. 47 (weggefallen)<br />
Bay LStVG Art. 48 Änderung und Aufhebung von Verordnungen<br />
1 Die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s über den Erlaß von Verordnungen gelten<br />
sinngemäß auch für die Änderung und – mit Ausnahme des Art. 50 Abs. 2 – für<br />
die Aufhebung solcher Verordnungen. 2 Besteht im geltenden Recht keine<br />
Ermächtigung mehr für den Erlaß einer Verordnung, so kann die Stelle, die<br />
früher für den Erlaß der Verordnung zuständig war, die Verordnung aufheben.<br />
3 Besteht die Stelle nicht mehr und ist die Aufgabe auch nicht einer anderen<br />
Stelle übertragen worden, so kann das fachlich zuständige Staatsministerium<br />
die Verordnung aufheben oder die dafür zuständigen Stellen durch Verordnung<br />
bestimmen.<br />
Bay LStVG Art. 49 Allgemeine Aufsichtspflicht<br />
(1) 1 Die Rechtsaufsichtsbehörden haben auch bereits bekanntgemachte<br />
Verordnungen, die mit dem geltenden Recht, insbesondere mit <strong>Gesetze</strong>n<br />
oder mit Verordnungen einer höheren Behörde, in Widerspruch stehen, zu<br />
beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung zu verlangen. 2 Das<br />
gleiche gilt, wenn die Verordnung nicht in der genehmigten Fassung<br />
bekanntgemacht worden ist.<br />
(2) Kommt die Gemeinde, der Landkreis oder der Bezirk binnen einer von der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde gesetzten angemessenen Frist dem Verlangen<br />
nicht nach, so hebt die Rechtsaufsichtsbehörde die beanstandete<br />
Verordnung auf.<br />
Bay LStVG Art. 50 Geltungsdauer<br />
(1) 1 Bewehrte Verordnungen treten eine Woche nach ihrer Bekanntmachung<br />
in Kraft. 2 In der Verordnung kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt<br />
werden, frühestens jedoch der auf die Bekanntmachung folgende Tag.<br />
3<br />
Eine nach Art. 51 Abs. 4 bekanntgemachte Verordnung tritt, wenn in ihr<br />
nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit der Notbekanntmachung in<br />
Kraft.<br />
(2) 1 Eine bewehrte Verordnung soll ihre Geltungsdauer festsetzen, jedoch in<br />
keinem Fall auf mehr als 20 Jahre. 2 Setzt sie keine oder eine längere<br />
Geltungsdauer fest, so gilt sie 20 Jahre, sofern sie nicht aus einem<br />
anderen Grund vorher außer Kraft tritt. 3 Die Vorschriften des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs über die Berechnung von Fristen gelten entsprechend.<br />
(3) Absatz 2 gilt nicht für Rechtsvorschriften, die auf Bundesrecht, dem<br />
Bayerischen Naturschutzgesetz oder dem Bayerischen Wassergesetz<br />
beruhen.<br />
Bay LStVG Art. 51 Amtliche Bekanntmachung<br />
(1) Für die amtliche Bekanntmachung von Verordnungen der Gemeinden,<br />
Landkreise, Landratsämter, Bezirke und Regierungen gelten die<br />
Vorschriften über die Bekanntmachung kommunaler Satzungen<br />
entsprechend.<br />
(2) Bewehrte Verordnungen der Staatsministerien und der Staatsregierung<br />
sind im Gesetz- und Verordnungsblatt amtlich bekanntzumachen.
(3) 1 Lassen sich die Grenzen des Geltungsbereichs einer Verordnung oder die<br />
Grenzen des Bereichs, in dem einzelne ihrer Vorschriften gelten, nicht<br />
hinreichend deutlich und anschaulich beschreiben oder durch Abdruck<br />
einer genauen Karte festlegen, so genügt es, wenn die Verordnung die<br />
Grenzen des Bereichs grob umschreibt und im übrigen auf Karten<br />
(Maßstab mindestens 1 : 25 000) oder Verzeichnisse Bezug nimmt.<br />
2<br />
Diese Unterlagen müssen von der in der Verordnung bezeichneten<br />
Behörde archivmäßig verwahrt werden und allgemein zugänglich sein.<br />
(4) 1 Ist es zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben, Gesundheit oder<br />
zum Schutz von Sachgütern erforderlich, eine Verordnung sofort<br />
bekanntzumachen und ist eine Bekanntmachung nach Absatz 1 oder<br />
Absatz 2 nicht rechtzeitig möglich, so kann die Verordnung im Rundfunk,<br />
im Fernsehfunk, durch Lautsprecher oder in ortsüblicher Art amtlich<br />
bekanntgemacht werden (Notbekanntmachung). 2 Die Verordnung ist<br />
sodann unverzüglich nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu veröffentlichen;<br />
hierbei ist auf Zeit und Art der Notbekanntmachung hinzuweisen.<br />
Bay LStVG Art. 52 Hinweis auf die Bekanntmachung<br />
Die Gemeinden haben auf die Bekanntmachung ihrer Verordnungen und von<br />
Verordnungen des Landkreises oder Landratsamts, die im Gemeindegebiet<br />
gelten, in ortsüblicher Art hinzuweisen, sofern die Verordnungen nicht in einem<br />
Amtsblatt amtlich bekanntgemacht werden.<br />
Bay LStVG Art. 53 Mitteilungen<br />
Verordnungen der Gemeinden, Landkreise und Landratsämter sind, wenn sie<br />
nicht in Amtsblättern amtlich bekanntgemacht werden, in amtlich beglaubigter<br />
Abschrift dem Amtsgericht, der Staatsanwaltschaft und der örtlichen<br />
Polizeidienststelle mitzuteilen, in deren Bezirk oder Dienstbereich die<br />
Verordnung gilt.<br />
FÜNFTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay LStVG Art. 54 Zuständigkeit aus Ermächtigungen vor Inkrafttreten<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
(1) Ermächtigen Rechtsvorschriften, die vor dem 1. Januar 1957 erlassen<br />
worden sind, zu Vorschriften, deren Übertretung mit Strafe oder als<br />
Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht ist, so werden künftig erlassen<br />
1. Ortsvorschriften, insbesondere ortspolizeiliche Vorschriften, durch die<br />
Gemeinden,<br />
2. Kreisvorschriften, insbesondere distrikts-, bezirks- und kreispolizeiliche<br />
Vorschriften, durch die kreisfreien Gemeinden oder die Landkreise,<br />
3. Bezirks- (Regierungs-)vorschriften durch die Bezirke,<br />
4. oberpolizeiliche Vorschriften durch die fachlich zuständigen<br />
Staatsministerien oder mit Ermächtigung des fachlich zuständigen<br />
Staatsministeriums durch die Bezirke.<br />
(2) 1 Absatz 1 gilt nicht<br />
1. für Vorschriften, die auf bundesrechtlicher Ermächtigung beruhen,<br />
sofern durch Bundesrecht andere Zuständigkeiten vorgesehen sind,<br />
2. für Satzungen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke,
3. für Anordnungen durch amtliche Verkehrszeichen.<br />
2 Sind durch <strong>Landesrecht</strong> andere Behörden oder Stellen als Gemeinden,<br />
Landkreise, Bezirke, Landratsämter, Regierungen oder Staatsministerien<br />
zu Vorschriften im Sinn des Absatzes 1 ermächtigt, so bleibt deren<br />
Zuständigkeit unberührt.<br />
Bay LStVG Art. 55 Zuständigkeiten nach dem Schornsteinfeger-<br />
Handwerksgesetz<br />
Das Staatsministerium des Innern kann durch Verordnung die zuständigen<br />
Behörden nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz bestimmen.<br />
Bay LStVG Art. 56 Zuständigkeit für gemeindefreie Gebiete<br />
(1) Für die im Kreisgebiet gelegenen gemeindefreien Gebiete können die<br />
Landkreise Verordnungen in den gleichen Fällen erlassen, in denen die<br />
Gemeinden zum Erlaß von Gemeindeverordnungen ermächtigt sind.<br />
(2) 1 Soweit die Gemeinden zu einer Erlaubnis, zu Anordnungen für den<br />
Einzelfall oder zu sonstigen Maßnahmen ermächtigt oder verpflichtet sind,<br />
treten in gemeindefreien Gebieten die Landratsämter an die Stelle der<br />
Gemeinden. 2 Das gilt sinngemäß für Anzeigen, die an die Gemeinde zu<br />
richten sind.<br />
Bay LStVG Art. 57 Ausführungsvorschriften<br />
Das Staatsministerium des Innern erläßt die zur Ausführung des Vierten und<br />
Fünften Teils dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlichen Vorschriften.<br />
Bay LStVG Art. 58 Einschränkung von Grundrechten<br />
1 Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s können die Grundrechte der Freiheit der Person,<br />
der Versammlungsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung und des<br />
Eigentums eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 13, 14 des<br />
Grundgesetzes, Art. 102, 103, 106 Abs. 3, Art. 113 der Verfassung). 2 Art. 7<br />
Abs. 4 bleibt unberührt.<br />
Bay LStVG Art. 59 Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von<br />
Ordnungswidrigkeiten nach § 112 des <strong>Gesetze</strong>s über<br />
Ordnungswidrigkeiten<br />
Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von<br />
Ordnungswidrigkeiten nach § 112 OWiG ist bei Zuwiderhandlungen gegen<br />
Anordnungen des Landtags oder seines Präsidenten der Direktor des<br />
Landtagsamts.<br />
Bay LStVG Art. 60 Fortbestand alten Verordnungsrechts<br />
(1) 1 Die auf Grund des bisherigen Rechts erlassenen orts-, distrikts-, bezirks-<br />
, kreis- und oberpolizeilichen Vorschriften sowie die anderen auf<br />
gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Vorschriften des <strong>Landesrecht</strong>s,<br />
deren Übertretung mit Strafe oder als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße<br />
bedroht ist, treten ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung 20 Jahre nach<br />
dem Tag ihres Inkrafttretens, frühestens jedoch am 31. Dezember 1960,<br />
außer Kraft, wenn sie nicht aus einem anderen Grund ihre Geltung vorher<br />
verlieren. 2 Bis zu ihrem Außerkrafttreten gilt Art. 49.
(2) Absatz 1 gilt nicht<br />
1. für Vorschriften, die auf einer fortgeltenden Ermächtigung des<br />
Bundesrechts beruhen,<br />
2. für Satzungen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke,<br />
3. für Anordnungen durch amtliche Verkehrszeichen,<br />
4. für Rechtsvorschriften, die auf dem Naturschutzrecht beruhen.<br />
Bay LStVG Art. 61 Einstweilige Vorschriften über die Stillegung und<br />
Beseitigung von Anlagen und Geräten<br />
(1) 1 Werden Anlagen oder Geräte unter Zuwiderhandlung gegen ein Gesetz,<br />
eine Verordnung oder eine Anordnung für den Einzelfall errichtet,<br />
aufgestellt, verändert, betrieben oder in einem ordnungswidrigen Zustand<br />
erhalten und verwirklicht die rechtswidrige Tat den Tatbestand eines<br />
Strafgesetzes oder einer Ordnungswidrigkeit, so können die kreisfreien<br />
Gemeinden und die Landratsämter die Vornahme notwendiger Sicherungsoder<br />
Ausbesserungsarbeiten oder die Stillegung anordnen. 2 Sie können<br />
auch die teilweise oder gänzliche Beseitigung der Anlage oder des Geräts<br />
anordnen, wenn Gefahr im Verzug oder ein dringendes öffentliches<br />
Interesse an einem sofortigen Vollzug besteht oder ein Straf- oder<br />
Bußgeldverfahren nicht durchgeführt werden kann. 3 Liegen diese<br />
Voraussetzungen nicht vor, so kann die Beseitigung der Anlage oder des<br />
Geräts nur angeordnet werden, wenn die Zuwiderhandlung rechtskräftig<br />
festgestellt ist. 4 Im Fall einer Genehmigungspflicht für die Anlage oder<br />
das Gerät darf die Beseitigung nach Satz 2 oder Satz 3 nur angeordnet<br />
werden, wenn die nachträgliche Genehmigung nach den Vorschriften des<br />
geltenden Rechts nicht erteilt werden kann.<br />
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit Rechtsvorschriften außerhalb dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
besondere Bestimmungen über die Stillegung und Beseitigung von<br />
Anlagen oder Geräten enthalten.<br />
Bay LStVG Art. 62 Inkrafttreten; Außerkrafttreten<br />
1 2<br />
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1957 in Kraft. Mit Ablauf des 31. Dezember<br />
2012 tritt Art. 20 außer Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. November 1956 (Nr. 25 des Gesetz-<br />
und Verordnungsblattes vom 29. November 1956, S. 261).
Gesetz über Landtagswahl,<br />
Volksbegehren und Volksentscheid<br />
(Bay LWG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 GVBl. S. 277, ber. S. 620 , geändert durch<br />
<strong>Gesetze</strong> vom 9. Juli 2003 GVBl. S. 419 , vom 26. Juli 2006 GVBl. S. 367 (FN BayRS 111-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Bestimmungen<br />
1. Stimmrecht<br />
Art. 1 Voraussetzungen des Stimmrechts<br />
Art. 2 Ausschluss vom Stimmrecht<br />
Art. 3 Ausübung des Stimmrechts<br />
Art. 4 Wählerverzeichnis und Wahlschein<br />
2. Räumliche Gliederung und Wahlorgane<br />
Art. 5 Wahlkreis, Stimmkreis, Stimmbezirk<br />
Art. 6 Wahlorgane<br />
Art. 7 Bildung der Wahlorgane<br />
Art. 8 Tätigkeit der Wahlausschüsse und Wahlvorstände<br />
Art. 9 Ehrenämter<br />
3. Durchführung der Abstimmung<br />
Art. 10 Tag der Abstimmung<br />
Art. 11 Öffentlichkeit der Abstimmung<br />
Art. 12 Unzulässige Beeinflussung der Abstimmenden, unzulässige<br />
Veröffentlichung von Befragungen zur Stimmabgabe<br />
Art. 13 Abstimmungsgeheimnis<br />
Art. 14 Stimmzettel, Stimmenzählgeräte
Art. 15 Briefwahl<br />
Art. 16 Entscheidungen des Wahlvorstands<br />
Art. 17 Kosten der Abstimmung<br />
Art. 18 Dienstbefreiung ohne Lohnabzug<br />
ZWEITER TEIL Besondere Bestimmungen für die Landtagswahl<br />
1. Grundsätze für die Wahl der Abgeordneten<br />
Art. 19 Wahlrechtsgrundsätze und Wahldauer<br />
Art. 20 Festsetzung des Wahltags<br />
Art. 21 Zahl der Abgeordneten<br />
Art. 22 Wählbarkeit<br />
2. Wahlvorschläge<br />
Art. 23 Wahlvorschlagsrecht<br />
Art. 24 Beteiligungsanzeige<br />
Art. 25 Mängelbeseitigung, Feststellung des Landeswahlausschusses<br />
Art. 26 Einreichung der Wahlkreisvorschläge<br />
Art. 27 Inhalt und Form der Wahlkreisvorschläge<br />
Art. 28 Aufstellung der Stimmkreisbewerber<br />
Art. 29 Aufstellung der Wahlkreisliste<br />
Art. 30 Beauftragte für die Wahlkreisvorschläge<br />
Art. 31 Rücknahme von Wahlkreisvorschlägen<br />
Art. 32 Änderung von Wahlkreisvorschlägen<br />
Art. 33 Beseitigung von Mängeln<br />
Art. 34 Zulassung der Wahlkreisvorschläge
Art. 35 Bekanntmachung der Wahlkreisvorschläge<br />
3. Abstimmung<br />
Art. 36 Stimmen<br />
Art. 37 Stimmzettel<br />
Art. 38 Stimmabgabe<br />
4. Feststellung des Wahlergebnisses<br />
Art. 39 Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk<br />
Art. 40 Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahlbriefen<br />
Art. 41 Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmkreis<br />
Art. 42 Feststellung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis<br />
Art. 43 Wahl der Vertreter der Stimmkreise<br />
Art. 44 Wahl der Abgeordneten aus den Wahlkreislisten<br />
Art. 45 Verteilung der Sitze an die sich bewerbenden Personen<br />
Art. 46 Listennachfolger<br />
Art. 47 Ungültigkeitserklärung von Stimmen durch den Landeswahlausschuss<br />
Art. 48 Verständigung der Gewählten<br />
Art. 49 Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag<br />
Art. 50 Bekanntmachung der Namen der Gewählten<br />
5. Wahlprüfung<br />
Art. 51 Zuständigkeit<br />
Art. 52 Umfang der Wahlprüfung<br />
Art. 53 Frist für Wahlbeanstandungen<br />
Art. 54 Nachwahl
Art. 55 Wiederholungswahl<br />
6. Verlust und Ruhen der Mitgliedschaft<br />
Art. 56 Verlust der Mitgliedschaft beim Landtag<br />
Art. 57 Ruhen der Mitgliedschaft eines Abgeordneten<br />
Art. 58 Feststellung der Listennachfolger<br />
Art. 59 Folgen eines Parteiverbots<br />
7. Staatliche Mittel für Träger von Wahlvorschlägen<br />
Art. 60 Leistungen an Parteien<br />
Art. 61 Leistungen an sonstige organisierte Wählergruppen<br />
DRITTER TEIL Besondere Bestimmungen über Volksbegehren und<br />
Volksentscheid<br />
ABSCHNITT I Das unmittelbare Gesetzgebungsrecht des Volkes<br />
Art. 62 Volksgesetzgebung<br />
Art. 63 Zulassungsantrag<br />
Art. 64 Entscheidung über den Zulassungsantrag<br />
Art. 65 Bekanntmachung des Volksbegehrens und der Eintragungsfrist<br />
Art. 66 Änderung und Rücknahme des Zulassungsantrags<br />
Art. 67 Eintragungsbezirke<br />
Art. 68 Auslegung der Eintragungslisten<br />
Art. 69 Eintragungsberechtigung, Inhalt der Eintragung, Eintragungsschein<br />
Art. 70 Ungültige Eintragungen<br />
Art. 71 Feststellung des Ergebnisses des Volksbegehrens<br />
Art. 72 Vorlage des Volksbegehrens an den Landtag
Art. 73 Behandlung des Volksbegehrens im Landtag<br />
Art. 74 Kosten<br />
Art. 75 Bekanntmachung von Tag und Gegenstand des Volksentscheids<br />
Art. 76 Stimmzettel, Stimmabgabe<br />
Art. 77 Ungültige Stimmen<br />
Art. 78 Feststellung des Abstimmungsergebnisses<br />
Art. 79 Ergebnis des Volksentscheids<br />
Art. 80 Prüfung des Volksentscheids<br />
Art. 81 Ausfertigung und Verkündung der <strong>Gesetze</strong><br />
Art. 82 Beteiligung des Beauftragten des Volksbegehrens in Verfahren vor<br />
dem Verfassungsgerichtshof<br />
ABSCHNITT II Die Abberufung des Landtags durch das Volk<br />
Art. 83 Abberufung des Landtags durch das Volk<br />
Art. 84 Volksbegehren<br />
Art. 85 Volksentscheid<br />
Art. 86 Ergebnis des Volksentscheids<br />
Art. 87 Vollzug der Abberufung<br />
ABSCHNITT III Volksentscheid über Beschlüsse des Landtags auf Änderung<br />
der Verfassung<br />
Art. 88 Volksentscheid über Beschlüsse des Landtags auf Änderung der<br />
Verfassung<br />
VIERTER TEIL Schlussbestimmungen<br />
Art. 89 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 90 Fristen und Termine
Art. 91 Wahlstatistik<br />
Art. 92 Landeswahlordnung<br />
Art. 93 In-Kraft-Treten<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Bestimmungen<br />
1. Stimmrecht<br />
Bay LWG Art. 1 Voraussetzungen des Stimmrechts<br />
(1) Stimmberechtigt bei den Wahlen zum Landtag, bei Volksbegehren und<br />
Volksentscheiden sind alle Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des<br />
Grundgesetzes, die am Tag der Abstimmung, bei Volksbegehren<br />
spätestens am letzten Tag der Eintragungsfrist,<br />
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,<br />
2. seit mindestens drei Monaten in Bayern ihre Wohnung, bei mehreren<br />
Wohnungen ihre Hauptwohnung, haben oder sich sonst in Bayern<br />
gewöhnlich aufhalten,<br />
3. nicht nach Art. 2 vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.<br />
(2) 1 Stimmberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch<br />
Beamte, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst, die ihre<br />
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, aus beruflichen<br />
Gründen aus Bayern in einen Ort im Ausland nahe der Landesgrenze<br />
verlegen mussten, sowie die Angehörigen ihres Hausstands. 2 Bei<br />
Rückkehr nach Bayern gilt die Dreimonatsfrist des Absatzes 1 Nr. 2 nicht.<br />
(3) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach Absatz 1 Nr. 2 wird der Tag<br />
der Wohnungs- oder Aufenthaltsnahme in die Frist einbezogen.<br />
Bay LWG Art. 2 Ausschluss vom Stimmrecht<br />
Ausgeschlossen vom Stimmrecht ist,<br />
1. wer infolge Richterspruchs das Stimmrecht nicht besitzt,<br />
2. derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer<br />
nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der<br />
Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,<br />
3. wer sich auf Grund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des<br />
Strafgesetzbuchs in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet.<br />
Bay LWG Art. 3 Ausübung des Stimmrechts<br />
(1) Abstimmen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder<br />
einen Wahlschein hat.<br />
(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Stimmbezirk<br />
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.<br />
(3) 1 Wer einen Wahlschein hat, kann sein Stimmrecht in dem Stimmkreis, in<br />
dem der Wahlschein ausgestellt ist,<br />
1. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses
Stimmkreises oder<br />
2. durch Briefwahl<br />
ausüben. 2 Beim Volksentscheid kann der Inhaber eines Wahlscheins sein<br />
Stimmrecht in einem beliebigen Stimmbezirk innerhalb der kreisfreien<br />
Gemeinde oder des Landkreises ausüben, sofern der Volksentscheid nicht<br />
zusammen mit einer Landtagswahl durchgeführt wird.<br />
(4) Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur<br />
persönlich ausüben.<br />
Bay LWG Art. 4 Wählerverzeichnis und Wahlschein<br />
(1) 1 Die Gemeinden legen für jeden Stimmbezirk ein Verzeichnis der<br />
Stimmberechtigten an. 2 Jede stimmberechtigte Person hat das Recht, an<br />
den Werktagen, außer Samstagen, vom 20. bis 16. Tag vor der<br />
Abstimmung während der allgemeinen Dienststunden die Richtigkeit oder<br />
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen<br />
Daten zu überprüfen. 3 Zur Überprüfung der Richtigkeit oder<br />
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis<br />
eingetragenen Personen haben Stimmberechtigte während des in Satz 2<br />
genannten Zeitraums nur dann ein Recht auf Einsicht in das<br />
Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich<br />
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses<br />
ergeben kann. 4 Das Recht zur Überprüfung gemäß Satz 3 besteht nicht<br />
hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister ein<br />
Sperrvermerk gemäß Art. 34 Abs. 5 des Meldegesetzes eingetragen ist.<br />
(2) Wer glaubhaft macht, dass er verhindert ist, in dem Stimmbezirk<br />
abzustimmen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist, oder wer<br />
aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis<br />
nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.<br />
2. Räumliche Gliederung und Wahlorgane<br />
Bay LWG Art. 5 Wahlkreis, Stimmkreis, Stimmbezirk<br />
(1) Jeder Regierungsbezirk bildet einen Wahlkreis.<br />
(2) 1 Jeder Landkreis und jede kreisfreie Gemeinde bildet einen Stimmkreis.<br />
2<br />
Soweit es der Grundsatz der Wahlgleichheit erfordert, sind räumlich<br />
zusammenhängende Stimmkreise abweichend von Satz 1 zu bilden; das<br />
Gebiet kreisangehöriger Gemeinden und der räumliche Wirkungsbereich<br />
von Verwaltungsgemeinschaften dürfen nicht durchschnitten werden. 3 Die<br />
Einwohnerzahl eines Stimmkreises soll von der durchschnittlichen<br />
Einwohnerzahl der Stimmkreise im jeweiligen Wahlkreis nicht um mehr als<br />
15 v. H. nach oben oder unten abweichen; beträgt die Abweichung mehr<br />
als 25 v. H. ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen.<br />
(3) 1 Wird eine Gemeinde oder ein Gemeindeteil in eine Gemeinde<br />
eingegliedert, die einem anderen Stimmkreis angehört, so fällt sie diesem<br />
Stimmkreis zu. 2 Wird eine neue Gemeinde oder eine<br />
Verwaltungsgemeinschaft aus Gemeinden verschiedener Stimmkreise<br />
gebildet, so fällt sie dem Stimmkreis zu, dem der größere Teil der<br />
Einwohner bisher angehört hat. 3 Dies gilt jedoch nicht, wenn hierdurch
die Einwohnerzahl eines der Stimmkreise von der durchschnittlichen<br />
Einwohnerzahl der Stimmkreise in dem jeweiligen Wahlkreis um mehr als<br />
25 v. H. nach oben oder unten abweicht; in diesem Fall fällt sie dem<br />
Stimmkreis zu, dem der nächstgrößere Teil der Einwohner bisher angehört<br />
hat. 4 Die Feststellungen trifft der Landeswahlleiter.<br />
(4) 1 Die sich hieraus ergebende Einteilung regelt die Anlage (hier nicht<br />
wiedergegeben) zu diesem Gesetz. 2 Berichtigungen der Anlage nach Absatz 3<br />
gibt das Staatsministerium des Innern bekannt.<br />
(5) 1 Die Staatsregierung erstattet dem Landtag spätestens 30 Monate nach<br />
dem Tag, an dem der Landtag gewählt worden ist, einen schriftlichen<br />
Bericht über die Veränderung der Einwohnerzahlen in den Wahl- und den<br />
Stimmkreisen. 2 Der Bericht hat Vorschläge zur Änderung der Zahl der auf<br />
die Wahlkreise entfallenden Abgeordnetensitze und zur Änderung der<br />
Stimmkreiseinteilung zu enthalten, soweit das durch die Veränderung der<br />
Einwohnerzahlen geboten ist.<br />
(6) Jeder Stimmkreis wird für die Stimmabgabe in Stimmbezirke eingeteilt.<br />
Bay LWG Art. 6 Wahlorgane<br />
Wahlorgane sind<br />
1. der Landeswahlleiter und der Landeswahlausschuss für das Staatsgebiet,<br />
2. bei Landtagswahlen ein Wahlkreisleiter und ein Wahlkreisausschuss für<br />
jeden Wahlkreis,<br />
3. bei Landtagswahlen ein Stimmkreisleiter und ein Stimmkreisausschuss für<br />
jeden Stimmkreis, bei Volksentscheiden ein Abstimmungsleiter und ein<br />
Abstimmungsausschuss für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Gemeinde,<br />
4. ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für jeden Stimmbezirk und<br />
5. mindestens ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für jede Gemeinde zur<br />
Feststellung des Briefwahlergebnisses (Briefwahlvorstand); das Landratsamt<br />
kann anordnen, dass für mehrere Gemeinden ein gemeinsamer<br />
Briefwahlvorstand zu bilden ist, und eine dieser Gemeinden mit der<br />
Durchführung der Briefwahl betrauen.<br />
Bay LWG Art. 7 Bildung der Wahlorgane<br />
(1) Der Landeswahlleiter und sein Stellvertreter sowie die Wahlkreisleiter und<br />
ihre Stellvertreter werden vom Staatsministerium des Innern, die<br />
Stimmkreisleiter und die Abstimmungsleiter sowie ihre Stellvertreter von<br />
der Regierung, die Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter von der<br />
Gemeinde ernannt.<br />
(2) 1 Der Landeswahlausschuss, die Wahlkreisausschüsse, die<br />
Stimmkreisausschüsse und die Abstimmungsausschüsse<br />
(Wahlausschüsse) bestehen jeweils aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem<br />
und sechs von ihm berufenen Stimmberechtigten als Beisitzern. 2 Die<br />
Wahlvorstände bestehen aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem,<br />
seinem Stellvertreter und weiteren drei bis sieben von der Gemeinde<br />
berufenen Beisitzern. 3 Bei der Berufung der Beisitzer sind die in dem<br />
jeweiligen Gebiet vertretenen Parteien und sonstigen organisierten<br />
Wählergruppen nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
(3) 1 Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein.<br />
2<br />
Wahlbewerber, Beauftragte für Wahlkreisvorschläge und ihre<br />
Stellvertreter dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans bestellt<br />
werden.<br />
(4) 1 Die Gemeinden sind befugt, personenbezogene Daten von<br />
Stimmberechtigten zum Zweck ihrer Berufung zu Mitgliedern von<br />
Wahlvorständen zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. 2 Zu diesem<br />
Zweck dürfen personenbezogene Daten von Stimmberechtigten, die zur<br />
Tätigkeit in Wahlvorständen geeignet sind, auch für künftige<br />
Abstimmungen verarbeitet und genutzt werden, sofern die betroffene<br />
Person der Verarbeitung oder Nutzung nicht widersprochen hat. 3 Die<br />
betroffene Person ist über das Widerspruchsrecht zu unterrichten. 4 Im<br />
Einzelnen dürfen folgende Daten erhoben, verarbeitet und genutzt<br />
werden: Name, Vorname, akademische Grade, Geburtsdatum,<br />
Anschriften, Telefonnummern, Zahl der Berufungen zu einem Mitglied der<br />
Wahlvorstände und die dabei ausgeübte Funktion.<br />
(5) 1 Auf Ersuchen der Gemeinde sind zur Sicherstellung der Durchführung der<br />
Abstimmung die Behörden des Freistaates Bayern, der Gemeinden, der<br />
Landkreise und der Bezirke sowie der sonstigen der Aufsicht des<br />
Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen<br />
Rechts verpflichtet, aus dem Kreis ihrer Bediensteten unter Angabe von<br />
Name, Vorname, akademischen Graden, Geburtsdatum, Anschriften und<br />
Telefonnummern zum Zweck der Berufung als Mitglieder der<br />
Wahlvorstände stimmberechtigte Personen zu benennen, die im Gebiet<br />
der ersuchenden Gemeinde wohnen. 2 Die ersuchte Stelle hat die<br />
Betroffenen über die übermittelten Daten und den Empfänger zu<br />
benachrichtigen.<br />
Bay LWG Art. 8 Tätigkeit der Wahlausschüsse und Wahlvorstände<br />
(1) 1 Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände verhandeln, beraten und<br />
entscheiden in öffentlicher Sitzung. 2 Soweit nicht in diesem Gesetz etwas<br />
anderes bestimmt ist, entscheidet bei den Abstimmungen<br />
Stimmenmehrheit. 3 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des<br />
Vorsitzenden.<br />
(2) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellvertreter und die Schriftführer<br />
sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amts und zur<br />
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt<br />
gewordenen Angelegenheiten verpflichtet.<br />
Bay LWG Art. 9 Ehrenämter<br />
1 Die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mitglieder der Wahlvorstände üben<br />
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 2 Zur Übernahme des Ehrenamts ist jede<br />
stimmberechtigte Person verpflichtet. 3 Das Ehrenamt darf nur aus wichtigem<br />
Grund abgelehnt werden.
3. Durchführung der Abstimmung<br />
Bay LWG Art. 10 Tag der Abstimmung<br />
Die Abstimmungen finden an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag statt.<br />
Bay LWG Art. 11 Öffentlichkeit der Abstimmung<br />
1 Die Durchführung der Abstimmung und die Ermittlung des<br />
Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. 2 Der Wahlvorstand kann Personen,<br />
die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Abstimmungsraum verweisen.<br />
3 Stimmberechtigten ist zuvor Gelegenheit zur Stimmabgabe zu geben.<br />
Bay LWG Art. 12 Unzulässige Beeinflussung der Abstimmenden,<br />
unzulässige Veröffentlichung von Befragungen zur Stimmabgabe<br />
(1) Während der Abstimmungszeit ist in und an dem Gebäude, in dem sich<br />
der Abstimmungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu<br />
dem Gebäude jede Beeinflussung der Abstimmenden durch Wort, Ton,<br />
Schrift, Bild oder auf andere Weise, insbesondere durch Umfragen oder<br />
Unterschriftensammlungen, sowie jede Behinderung oder erhebliche<br />
Belästigung der Abstimmenden verboten.<br />
(2) Vor Ablauf der Abstimmungszeit dürfen Ergebnisse von Befragungen nach<br />
der Stimmabgabe über den Inhalt der Abstimmungsentscheidung nicht<br />
veröffentlicht werden.<br />
(3) Den Behörden des Staates und den Gemeinden ist es untersagt, die<br />
Abstimmung in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder das<br />
Abstimmungsgeheimnis zu verletzen.<br />
Bay LWG Art. 13 Abstimmungsgeheimnis<br />
(1) 1 Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass die abstimmende Person die<br />
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen kann. 2 Für die Aufnahme der<br />
Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden, die die Wahrung des<br />
Abstimmungsgeheimnisses sicherstellen.<br />
(2) Eine abstimmende Person, die des Lesens unkundig ist oder wegen einer<br />
körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die Stimmzettel zu<br />
kennzeichnen, dem Wahlvorsteher zu übergeben oder selbst in die<br />
Wahlurne zu legen, kann sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens<br />
bedienen.<br />
Bay LWG Art. 14 Stimmzettel, Stimmenzählgeräte<br />
(1) Für die Stimmabgabe werden amtliche Stimmzettel verwendet.<br />
(2) Das Staatsministerium des Innern kann zulassen, dass an Stelle von<br />
Stimmzetteln amtlich zugelassene Stimmenzählgeräte verwendet werden.<br />
Bay LWG Art. 15 Briefwahl<br />
(1) 1 Bei der Briefwahl hat die abstimmende Person der Gemeinde, die den<br />
Wahlschein ausgestellt hat, im verschlossenen Wahlbriefumschlag<br />
1. ihren Wahlschein,<br />
2. in einem besonderen verschlossenen Umschlag (Wahlumschlag) ihre<br />
Stimmzettel
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Tag der<br />
Abstimmung bis zum Ende der Abstimmungszeit eingeht. 2 Art. 13 Abs. 2<br />
gilt entsprechend.<br />
(2) Auf dem Wahlschein hat die abstimmende Person oder die Person ihres<br />
Vertrauens an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich<br />
oder gemäß dem erklärten Willen der abstimmenden Person<br />
gekennzeichnet worden sind.<br />
Bay LWG Art. 16 Entscheidungen des Wahlvorstands<br />
1 Der Wahlvorstand leitet die Durchführung der Abstimmung. 2 Vorbehaltlich<br />
einer Nachprüfung durch den Stimmkreisausschuss oder den<br />
Abstimmungsausschuss entscheidet er über die Gültigkeit der abgegebenen<br />
Stimmen und stellt das Abstimmungsergebnis fest.<br />
Bay LWG Art. 17 Kosten der Abstimmung<br />
(1) Der Freistaat Bayern erstattet den Gemeinden und den<br />
Verwaltungsgemeinschaften die durch die Abstimmung veranlassten<br />
notwendigen Ausgaben durch einen festen Betrag je stimmberechtigte<br />
Person.<br />
(2) 1 Der Betrag wird vom Staatsministerium des Innern festgesetzt. 2 Bei der<br />
Festsetzung werden laufende persönliche und sächliche Kosten sowie<br />
Kosten für die Bereitstellung von Räumen und Einrichtungen der<br />
Gemeinden und der Verwaltungsgemeinschaften nicht berücksichtigt.<br />
(3) Blindenvereinen, die ihre Bereitschaft zur Herstellung von<br />
Stimmzettelschablonen erklärt haben, werden die durch die Herstellung<br />
und Verteilung der Stimmzettelschablonen veranlassten notwendigen<br />
Ausgaben erstattet.<br />
Bay LWG Art. 18 Dienstbefreiung ohne Lohnabzug<br />
Stimmberechtigten in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis muss die freie Zeit,<br />
die sie zur Stimmabgabe und zur Ausübung von Ehrenämtern bei den<br />
Abstimmungen benötigen, ohne Abzug an Lohn oder Gehalt gewährt werden.<br />
ZWEITER TEIL Besondere Bestimmungen für die Landtagswahl<br />
1. Grundsätze für die Wahl der Abgeordneten<br />
Bay LWG Art. 19 Wahlrechtsgrundsätze und Wahldauer<br />
Die Abgeordneten des Bayerischen Landtags werden auf die Dauer von fünf<br />
Jahren in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach einem<br />
verbesserten Verhältniswahlrecht gewählt.<br />
Bay LWG Art. 20 Festsetzung des Wahltags<br />
1 Die Staatsregierung setzt spätestens fünf Monate vor dem Wahltag den Tag<br />
für die Wahl vom Landtag fest. 2 Die Neuwahl findet frühestens 59 Monate,<br />
spätestens 62 Monate nach dem Tag, an dem der vorausgegangene Landtag<br />
gewählt worden ist (Art. 16 Abs. 1 Satz 3 der Verfassung), bzw. spätestens am
sechsten Sonntag nach der Auflösung oder Abberufung (Art. 18 Abs. 4 der<br />
Verfassung) statt.<br />
Bay LWG Art. 21 Zahl der Abgeordneten<br />
Amtliche Fußnote: Für den am 13. September 1998 gewählten Landtag gilt Art. 23 in der Fassung<br />
der Bekanntmachung vom 9. März 1994, GVBl S. 135.<br />
(1) 1 Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten. 2 Die 180<br />
Abgeordnetenmandate werden auf die Wahlkreise nach dem Verhältnis<br />
ihrer Einwohnerzahl aufgeteilt. 3 Einwohnerzahl des Wahlkreises ist die<br />
Zahl der Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes mit<br />
Hauptwohnung im Wahlkreis.<br />
(2) Hiervon treffen<br />
auf den Wahlkreis Oberbayern 58,<br />
auf den Wahlkreis Niederbayern 18,<br />
auf den Wahlkreis Oberpfalz 17,<br />
auf den Wahlkreis Oberfranken 17,<br />
auf den Wahlkreis Mittelfranken 24,<br />
auf den Wahlkreis Unterfranken 20,<br />
auf den Wahlkreis Schwaben 26.<br />
(3) Für die Wahl der Abgeordneten als Vertreter ihres Stimmkreises werden<br />
91 Stimmkreise gebildet, und zwar<br />
im Wahlkreis Oberbayern 29,<br />
im Wahlkreis Niederbayern 9,<br />
im Wahlkreis Oberpfalz 9,<br />
im Wahlkreis Oberfranken 9,<br />
im Wahlkreis Mittelfranken 12,<br />
im Wahlkreis Unterfranken 10,<br />
im Wahlkreis Schwaben 13.<br />
(4) Die übrigen Abgeordneten werden in den Wahlkreisen aus den<br />
Wahlkreislisten der einzelnen Wahlkreisvorschläge gewählt.<br />
Bay LWG Art. 22 Wählbarkeit<br />
1 Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die am Wahltag das<br />
18. Lebensjahr vollendet hat. 2 Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die<br />
Wählbarkeit nicht besitzt.<br />
2. Wahlvorschläge<br />
Bay LWG Art. 23 Wahlvorschlagsrecht<br />
Wahlvorschläge können von politischen Parteien und sonstigen organisierten<br />
Wählergruppen eingereicht werden.
Bay LWG Art. 24 Beteiligungsanzeige<br />
(1) Politische Parteien und sonstige organisierte Wählergruppen, die im<br />
Bayerischen Landtag oder im Deutschen Bundestag seit deren letzter Wahl<br />
nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten waren,<br />
können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie<br />
spätestens am 90. Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr – bei einer Wahl nach<br />
Auflösung oder Abberufung des Landtags spätestens am 31. Tag vor dem<br />
Wahltag, 18 Uhr – dem Landeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl<br />
schriftlich angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihr<br />
Wahlvorschlagsrecht festgestellt hat.<br />
(2) 1 Die Anzeige muss den Namen der Partei oder Wählergruppe, sofern eine<br />
Kurzbezeichnung verwendet wird, auch diese enthalten. 2 Name und<br />
Kurzbezeichnung einer Wählergruppe werden von dem satzungsgemäß zur<br />
Vertretung berufenen Organ bestimmt; sie müssen sich von der<br />
Bezeichnung einer bereits bestehenden politischen Partei oder sonstigen<br />
organisierten Wählergruppe deutlich unterscheiden.<br />
(3) 1 Die Anzeige politischer Parteien muss von mindestens drei<br />
Vorstandsmitgliedern des Landesverbands, darunter dem Vorsitzenden<br />
oder seinem Stellvertreter, oder, wenn ein Landesverband nicht besteht,<br />
der nächstniedrigen Gebietsverbände, die Anzeige sonstiger organisierter<br />
Wählergruppen vom Vorstand der Wählergruppe persönlich unterzeichnet<br />
sein. 2 Politische Parteien haben der Anzeige ihre Satzung und ihr<br />
Programm sowie einen Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des<br />
Vorstands, sonstige organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis<br />
über ihre Gründung, ihre Satzung und einen Nachweis, dass ihr Vorstand<br />
nach demokratischen Grundsätzen bestellt worden ist, beizufügen.<br />
Bay LWG Art. 25 Mängelbeseitigung, Feststellung des<br />
Landeswahlausschusses<br />
(1) 1 Der Landeswahlleiter hat die Anzeige nach Art. 24 unverzüglich nach<br />
Eingang zu prüfen. 2 Stellt er Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die<br />
Partei oder Wählergruppe und fordert sie auf, behebbare Mängel<br />
rechtzeitig zu beseitigen. 3 Nach Ablauf der Anzeigefrist können nur noch<br />
Mängel an sich gültiger Anzeigen behoben werden. 4 Eine gültige Anzeige<br />
liegt nicht vor, wenn<br />
1. die Schriftform oder Frist des Art. 24 Abs. 1 nicht gewahrt ist,<br />
2. der Name und die Kurzbezeichnung fehlen,<br />
3. die nach Art. 24 Abs. 3 erforderlichen gültigen Unterschriften oder die<br />
der Anzeige beizufügenden Anlagen fehlen.<br />
5<br />
Nach der Entscheidung über das Wahlvorschlagsrecht ist jede<br />
Mängelbeseitigung ausgeschlossen.<br />
(2) Der Landeswahlausschuss stellt spätestens am 79. Tag vor dem Wahltag –<br />
bei einer Wahl nach Auflösung oder Abberufung des Landtags spätestens<br />
am 27. Tag vor dem Wahltag – für alle Wahlorgane verbindlich fest,<br />
1. welche politischen Parteien oder sonstigen organisierten Wählergruppen<br />
im Bayerischen Landtag oder im Deutschen Bundestag seit deren letzter<br />
Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten waren,<br />
2. welche Vereinigungen, die nach Art. 24 ihre Beteiligung angezeigt<br />
haben, sonst zur Einreichung von Wahlvorschlägen berechtigt sind; die
Ablehnung des Wahlvorschlagsrechts bedarf der Mehrheit von zwei<br />
Dritteln der abgegebenen Stimmen.<br />
Bay LWG Art. 26 Einreichung der Wahlkreisvorschläge<br />
(1) 1 Die Wahlvorschläge sind für die Wahlkreise aufzustellen<br />
(Wahlkreisvorschläge). 2 Eine politische Partei oder sonstige organisierte<br />
Wählergruppe kann in einem Wahlkreis nur einen Wahlkreisvorschlag<br />
einreichen.<br />
(2) Die Wahlkreisvorschläge sind beim Wahlkreisleiter spätestens am 73. Tag<br />
vor dem Wahltag, 18 Uhr – bei einer Wahl nach Auflösung oder<br />
Abberufung des Landtags spätestens am 24. Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr<br />
– schriftlich einzureichen.<br />
Bay LWG Art. 27 Inhalt und Form der Wahlkreisvorschläge<br />
(1) Die Wahlkreisvorschläge müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:<br />
1. Wahlkreisvorschläge müssen den Namen der Partei oder Wählergruppe,<br />
sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch diese tragen.<br />
2. 1 Jeder Wahlkreisvorschlag muss alle sich bewerbenden Personen für die<br />
Stimmkreise (Stimmkreisbewerber) und die in der Wahlkreisliste<br />
aufgestellten sich bewerbenden Personen (Wahlkreisbewerber) enthalten.<br />
3<br />
Er darf höchstens so viele sich bewerbende Personen enthalten, als im<br />
Wahlkreis Abgeordnete zu wählen sind. 5 Jede sich bewerbende Person<br />
kann nur in einem Wahlkreis aufgestellt und hier nur in einem<br />
Wahlkreisvorschlag benannt werden. 7 Als sich bewerbende Person kann<br />
nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt<br />
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.<br />
3. 9 Für mindestens einen Stimmkreis muss eine sich bewerbende Person<br />
benannt sein. 11 Jeder Stimmkreisbewerber kann nur für einen Stimmkreis<br />
aufgestellt werden. 13 Für jeden Stimmkreis darf in einem<br />
Wahlkreisvorschlag nur ein Stimmkreisbewerber benannt sein. 15 Bei<br />
jedem Stimmkreisbewerber ist anzugeben, für welchen Stimmkreis er<br />
aufgestellt ist.<br />
4. 17 Wahlkreisvorschläge politischer Parteien müssen vom Vorstand des<br />
Landesverbands oder, wenn ein Landesverband nicht besteht, von den<br />
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der<br />
Wahlkreis liegt, Wahlkreisvorschläge sonstiger organisierter<br />
Wählergruppen vom Vorstand persönlich unterzeichnet sein. 19 Sie müssen<br />
außerdem von 1 v. T. der Stimmberechtigten des Wahlkreises bei der<br />
letzten Abstimmung nach diesem Gesetz, jedoch höchstens von 2 000<br />
Stimmberechtigten, persönlich unterzeichnet sein, sofern nicht die Partei<br />
oder Wählergruppe bei der letzten Landtagswahl im gesamten Wahlgebiet<br />
mindestens 1,25 v. H. der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat;<br />
das Stimmrecht muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und<br />
ist bei Einreichung des Wahlkreisvorschlags nachzuweisen.<br />
(2) Mit dem Wahlkreisvorschlag sind beim Wahlkreisleiter einzureichen:<br />
1. die Niederschriften über die Versammlungen in den Stimmkreisen<br />
(Art. 28) und im Wahlkreis (Art. 29),<br />
2. die Zustimmungserklärungen der in den Wahlkreisvorschlag<br />
aufgenommenen sich bewerbenden Personen.
Bay LWG Art. 28 Aufstellung der Stimmkreisbewerber<br />
(1) 1 Die Stimmkreisbewerber werden in einer Mitgliederversammlung oder in<br />
einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung gewählt.<br />
2<br />
Mitgliederversammlung ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres<br />
Zusammentritts im Stimmkreis stimmberechtigten Mitglieder der<br />
politischen Partei oder sonstigen organisierten Wählergruppe. 3 Besondere<br />
Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen<br />
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter. 4 Allgemeine<br />
Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei oder<br />
Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen<br />
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte bestellte Versammlung.<br />
(2) 1 Die Stimmkreisbewerber und die Vertreter für die<br />
Vertreterversammlungen werden in geheimer Abstimmung gewählt.<br />
2<br />
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei<br />
vorschlagsberechtigt. 3 Den sich bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu<br />
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit<br />
vorzustellen. 4 Die Wahlen dürfen frühestens 46 Monate, für die<br />
Vertreterversammlungen frühestens 37 Monate nach dem Tag, an dem<br />
der Landtag gewählt worden ist, stattfinden; dies gilt nicht im Fall der<br />
Auflösung oder Abberufung des Landtags.<br />
(3) 1 Der Vorstand des Landesverbands oder, wenn ein Landesverband nicht<br />
besteht, die Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände der Partei, in<br />
deren Bereich der Stimmkreis liegt, oder ein anderes in der Parteisatzung<br />
hierfür vorgesehenes Organ sowie der Vorstand einer sonstigen<br />
organisierten Wählergruppe können gegen den Beschluss einer Mitgliederoder<br />
Vertreterversammlung Einspruch erheben. 2 Auf einen solchen<br />
Einspruch hin ist die Abstimmung zu wiederholen. 3 Ihr Ergebnis ist<br />
endgültig.<br />
(4) 1 Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung,<br />
über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder<br />
Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des<br />
Stimmkreisbewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre<br />
Satzung. 2 Sofern hierin keine Regelung getroffen ist, haben die im<br />
Stimmkreis vertretungsberechtigten Organe der politischen Partei oder<br />
sonstigen organisierten Wählergruppe die Mitglieder oder die Vertreter der<br />
Vertreterversammlung einzeln oder durch öffentliche Ankündigung<br />
mindestens drei Tage vor der Versammlung, von dem auf die Zustellung<br />
oder öffentliche Ankündigung folgenden Tag an gerechnet, zur Wahl des<br />
Stimmkreisbewerbers einzuladen. 3 Als Stimmkreisbewerber ist gewählt,<br />
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält.<br />
4<br />
Erlangt keine sich bewerbende Person diese Mehrheit, so findet eine<br />
Stichwahl unter den zwei sich bewerbenden Personen statt, die die<br />
meisten Stimmen erhalten haben. 5 Bei Stimmengleichheit in der<br />
Stichwahl entscheidet das Los.<br />
(5) 1 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des<br />
Stimmkreisbewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung,<br />
Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder und Gang der<br />
Abstimmung ist mit dem Wahlkreisvorschlag einzureichen. 2 Hierbei haben<br />
der Leiter der Versammlung und zwei weitere von dieser bestimmte
Teilnehmer gegenüber dem Wahlkreisleiter an Eides statt zu versichern,<br />
dass die Anforderungen, gemäß Absatz 2 Sätze 1 bis 3 beachtet worden<br />
sind. 3 Sich bewerbende Personen sollen nicht zur Abgabe der<br />
eidesstattlichen Versicherung bestimmt werden.<br />
Bay LWG Art. 29 Aufstellung der Wahlkreisliste<br />
(1) 1 Die Wahlkreisliste wird in einer Mitgliederversammlung oder in einer<br />
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung aufgestellt. 2 Art. 28<br />
Abs. 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.<br />
(2) 1 Die Wahlkreisliste besteht aus den nach Art. 28 gewählten<br />
Stimmkreisbewerbern und aus den gegebenenfalls von der Versammlung<br />
unmittelbar gewählten Wahlkreisbewerbern; die Stimmkreisbewerber<br />
können im eigenen Stimmkreis auf der Wahlkreisliste nicht zur Wahl<br />
aufgestellt werden. 2 Die Wahl der unmittelbar gewählten<br />
Wahlkreisbewerber erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl;<br />
gewählt sind die Wahlkreisbewerber in der Reihenfolge der auf sie<br />
entfallenden Stimmen.<br />
(3) 1 Die Versammlung bestimmt auch die Reihenfolge sämtlicher sich<br />
bewerbender Personen auf der Wahlkreisliste. 2 Trifft die Versammlung<br />
keine Bestimmung über die Reihenfolge, so sind die sich bewerbenden<br />
Personen in alphabetischer Reihenfolge auf der Wahlkreisliste aufzuführen.<br />
(4) 1 Nach Aufstellung der Wahlkreisliste ist die Wahl eines<br />
Stimmkreisbewerbers nur noch zulässig, wenn der bisher gewählte<br />
Stimmkreisbewerber gestorben ist, die Wählbarkeit verloren hat oder aus<br />
sonstigen wichtigen Gründen ersetzt werden soll. 2 Satz 1 gilt<br />
entsprechend, wenn ein Stimmkreisbewerber vor Aufstellung der<br />
Wahlkreisliste aus vergleichbar wichtigen Gründen nicht gewählt werden<br />
konnte. 3 Sofern die Wahlkreisversammlung nicht etwas anderes bestimmt<br />
hat, nimmt der nachträglich gewählte Stimmkreisbewerber die Stelle des<br />
bisherigen Stimmkreisbewerbers auf der Wahlkreisliste ein; weist die<br />
Wahlkreisliste eine alphabetische Reihenfolge auf, ist er entsprechend<br />
einzureihen. 4 Im Fall des Satzes 2 schließen sich die Stimmkreisbewerber<br />
in alphabetischer Reihenfolge am Ende der Wahlkreisliste an, sofern die<br />
Wahlkreisversammlung nicht etwas anderes bestimmt hat.<br />
(5) Art. 28 Abs. 2, Abs. 4 Sätze 1 und 2 und Abs. 5 gelten entsprechend mit<br />
der Maßgabe, dass die Versicherung an Eides statt nach Art. 28 Abs. 5<br />
Satz 2 sich auch darauf erstrecken muss, dass die Reihenfolge der sich<br />
bewerbenden Personen auf der Wahlkreisliste in geheimer Abstimmung<br />
festgelegt worden ist.<br />
Bay LWG Art. 30 Beauftragte für die Wahlkreisvorschläge<br />
(1) In jedem Wahlkreisvorschlag sollen ein Beauftragter und ein Stellvertreter<br />
bezeichnet werden; fehlt diese Bezeichnung, so gilt der erste<br />
Unterzeichner als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter.<br />
(2) 1 Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der<br />
Beauftragte und sein Stellvertreter, jeder für sich, berechtigt, verbindliche<br />
Erklärungen zum Wahlkreisvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.<br />
2<br />
Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten.
(3) Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche<br />
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlkreisvorschlags gemäß<br />
Art. 27 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 gegenüber dem Wahlkreisleiter abberufen und<br />
durch andere ersetzt werden.<br />
Bay LWG Art. 31 Rücknahme von Wahlkreisvorschlägen<br />
1 Ein Wahlkreisvorschlag kann ganz oder teilweise durch gemeinsame<br />
schriftliche Erklärung des Beauftragten und seines Stellvertreters<br />
zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden ist.<br />
2 Wahlkreisvorschläge, die nach Art. 27 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 von<br />
Stimmberechtigten unterzeichnet sein müssen, können bis zu diesem<br />
Zeitpunkt auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen<br />
persönlich unterzeichnete Erklärung zurückgenommen werden; die Rücknahme<br />
kann nicht auf einen Teil des Wahlkreisvorschlags beschränkt werden.<br />
Bay LWG Art. 32 Änderung von Wahlkreisvorschlägen<br />
1 Ein Wahlkreisvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist durch<br />
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten und seines Stellvertreters<br />
geändert werden, wenn eine sich bewerbende Person stirbt oder die<br />
Wählbarkeit verliert. 2 Das Verfahren nach Art. 28 und 29 braucht nicht<br />
eingehalten zu werden, der Unterschriften nach Art. 27 Abs. 1 Nr. 4 bedarf es<br />
nicht. 3 Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlkreisvorschlags<br />
(Art. 34 Abs. 1 Satz 1) ist jede Änderung ausgeschlossen.<br />
Bay LWG Art. 33 Beseitigung von Mängeln<br />
(1) 1 Der Wahlkreisleiter hat die Wahlkreisvorschläge unverzüglich nach<br />
Eingang zu prüfen. 2 Stellt er Mängel fest, so benachrichtigt er sofort den<br />
Beauftragten und fordert ihn auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu<br />
beseitigen.<br />
(2) 1 Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich<br />
gültiger Wahlkreisvorschläge behoben werden. 2 Ein gültiger<br />
Wahlkreisvorschlag liegt nicht vor, wenn<br />
1. nach Art. 24 Abs. 1 kein Wahlvorschlagsrecht besteht,<br />
2. die Form oder Frist des Art. 26 nicht gewahrt ist,<br />
3. die nach Art. 27 Abs. 1 Nr. 4 erforderlichen gültigen Unterschriften mit<br />
dem Nachweis des Stimmrechts der Unterzeichner fehlen, es sei denn, der<br />
Nachweis kann infolge von Umständen, die die Partei oder Wählergruppe<br />
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,<br />
4. die Herkunft des Wahlkreisvorschlags nicht ausreichend erkennbar ist,<br />
5. die Niederschrift über die Versammlung im Wahlkreis fehlt.<br />
3<br />
Hinsichtlich einzelner sich bewerbender Personen liegt ein gültiger<br />
Wahlkreisvorschlag nicht vor, wenn<br />
1. eine sich bewerbende Person mangelhaft bezeichnet ist, so dass ihre<br />
Person nicht feststeht,<br />
2. die Zustimmungserklärung der sich bewerbenden Person fehlt oder<br />
3. die Niederschrift über die Versammlung im Stimmkreis fehlt.<br />
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlkreisvorschlags<br />
(Art. 34 Abs. 1 Satz 1) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen.
Bay LWG Art. 34 Zulassung der Wahlkreisvorschläge<br />
(1) 1 Der Wahlkreisausschuss entscheidet am 58. Tag vor dem Wahltag – bei<br />
einer Wahl nach Auflösung oder Abberufung des Landtags am 16. Tag vor<br />
dem Wahltag – über die Zulassung der Wahlkreisvorschläge. 2 Er hat<br />
Wahlkreisvorschläge zurückzuweisen, wenn sie<br />
1. verspätet eingereicht sind oder<br />
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die<br />
Landeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in diese<br />
Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.<br />
3<br />
Sind die Anforderungen nur hinsichtlich einzelner sich bewerbender<br />
Personen nicht erfüllt oder sind über die zulässige Zahl hinaus sich<br />
bewerbende Personen vorgeschlagen, so werden nur diese sich<br />
bewerbenden Personen zurückgewiesen. 4 Die Entscheidung ist in der<br />
Sitzung des Wahlkreisausschusses bekannt zu geben.<br />
(2) 1 Weist der Wahlkreisausschuss einen Wahlkreisvorschlag ganz oder<br />
teilweise zurück, so kann Beschwerde erhoben werden. 2 Sie muss beim<br />
Wahlkreisausschuss spätestens am 55. Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr –<br />
bei einer Wahl nach Auflösung oder Abberufung des Landtags spätestens<br />
am 13. Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr – eingelegt werden.<br />
3<br />
Beschwerdeberechtigt sind der Beauftragte für den Wahlkreisvorschlag,<br />
der Landeswahlleiter und der Wahlkreisleiter. 4 Der Landeswahlleiter und<br />
der Wahlkreisleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein<br />
Wahlkreisvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben.<br />
(3) 1 Zur Entscheidung über die Beschwerde wird beim Staatsministerium des<br />
Innern ein Beschwerdeausschuss gebildet. 2 Dieser setzt sich zusammen<br />
aus dem Staatsminister des Innern oder dem von ihm ernannten<br />
Stellvertreter als Vorsitzendem, aus einem dem Kreis der ordentlichen<br />
Gerichtsbarkeit angehörenden Mitglied des Verfassungsgerichtshofs und<br />
einem Richter des Verwaltungsgerichtshofs, die von den Präsidenten<br />
dieser Gerichte benannt werden, aus dem Landeswahlleiter und aus dem<br />
Wahlrechtsreferenten des Staatsministeriums des Innern. 3 Die<br />
Entscheidung über die Beschwerde muss spätestens am 52. Tag vor dem<br />
Wahltag – bei einer Wahl nach Auflösung oder Abberufung des Landtags<br />
spätestens am 12. Tag vor dem Wahltag – getroffen werden.<br />
Bay LWG Art. 35 Bekanntmachung der Wahlkreisvorschläge<br />
(1) Der Wahlkreisleiter macht die endgültig zugelassenen Wahlkreisvorschläge<br />
spätestens am 37. Tag vor dem Wahltag – bei einer Wahl nach Auflösung<br />
oder Abberufung des Landtags die vom Wahlkreisausschuss als gültig<br />
anerkannten Wahlkreisvorschläge am 9. Tag vor dem Wahltag – bekannt.<br />
(2) 1 Die Reihenfolge der Wahlkreisvorschläge in der Bekanntmachung richtet<br />
sich bei politischen Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen,<br />
die an der letzten Landtagswahl teilgenommen haben, nach den bei dieser<br />
Wahl im gesamten Wahlgebiet erreichten Stimmenzahlen.<br />
2<br />
Wahlkreisvorschläge neu hinzugekommener politischer Parteien und<br />
Wählergruppen schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen<br />
der Parteien oder Wählergruppen an.
3. Abstimmung<br />
Bay LWG Art. 36 Stimmen<br />
Jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine zur Wahl eines Stimmkreisabgeordneten<br />
und eine zur Wahl eines Wahlkreisabgeordneten.<br />
Bay LWG Art. 37 Stimmzettel<br />
(1) Der Stimmzettel für die Wahl eines Stimmkreisbewerbers enthält die<br />
Namen der für den Stimmkreis zugelassenen Stimmkreisbewerber mit<br />
Angabe des Namens der Partei oder Wählergruppe, sofern eine<br />
Kurzbezeichnung verwendet wird, auch diese.<br />
(2) Der Stimmzettel für die Wahl eines Wahlkreisbewerbers enthält in jedem<br />
Stimmkreis die Wahlkreislisten sämtlicher im Wahlkreis zugelassener<br />
Wahlkreisvorschläge; in den Wahlkreislisten werden die<br />
Stimmkreisbewerber im eigenen Stimmkreis nicht aufgeführt.<br />
(3) Die Reihenfolge der Stimmkreisbewerber und der Wahlkreislisten richtet<br />
sich nach Art. 35 Abs. 2.<br />
Bay LWG Art. 38 Stimmabgabe<br />
Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere eindeutige Weise<br />
auf dem Stimmzettel für die Wahl eines Stimmkreisabgeordneten, welchem<br />
Stimmkreisbewerber, und auf dem Stimmzettel für die Wahl eines<br />
Wahlkreisabgeordneten, welchem Wahlkreisbewerber er seine Stimme geben<br />
will.<br />
4. Feststellung des Wahlergebnisses<br />
Bay LWG Art. 39 Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk<br />
Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand fest, wie viele<br />
gültige Stimmen<br />
1. insgesamt,<br />
2. für jeden Stimmkreisbewerber,<br />
3. für jeden Wahlkreisbewerber,<br />
4. für jede Wahlkreisliste nach Art. 40 Abs. 2,<br />
5. für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt<br />
abgegeben worden sind.<br />
Bay LWG Art. 40 Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahlbriefen<br />
(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel<br />
1. nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Stimmkreis gültig ist,<br />
2. nicht gekennzeichnet ist,<br />
3. den Willen der wählenden Person nicht zweifelsfrei erkennen lässt,<br />
4. mit einem besonderen Merkmal versehen ist, einen Zusatz oder<br />
Vorbehalt enthält.<br />
(2) Wird auf dem Stimmzettel für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten ohne<br />
Kennzeichnung einer besonderen sich bewerbenden Person nur eine<br />
bestimmte Partei oder Wählergruppe angekreuzt oder werden innerhalb
einer Wahlkreisliste mehrere sich bewerbende Personen angekreuzt, so ist<br />
die Stimme der Wahlkreisliste der betreffenden Partei oder Wählergruppe<br />
zuzurechnen.<br />
(3) Sind bei der Briefwahl mehrere gleichartige Stimmzettel in einem<br />
Wahlumschlag enthalten, gelten sie als ein Stimmzettel, wenn sie gleich<br />
lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; sonst zählen sie als<br />
ein Stimmzettel mit einer ungültigen Stimme.<br />
(4) Wird bei der Briefwahl ein Wahlumschlag leer abgegeben, so gelten beide<br />
Stimmen als ungültig.<br />
(5) 1 Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn<br />
1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,<br />
2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigefügt ist<br />
oder die Versicherung an Eides statt nicht unterschrieben ist,<br />
3. dem Wahlbriefumschlag kein Wahlumschlag beigefügt ist,<br />
4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Wahlumschlag verschlossen ist,<br />
5. der Wahlbriefumschlag mehrere Wahlumschläge, aber nicht eine<br />
gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an<br />
Eides statt versehener Wahlscheine enthält,<br />
6. kein amtlicher Wahlumschlag benutzt worden ist,<br />
7. ein Wahlumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das<br />
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen<br />
deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.<br />
2<br />
Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als wählende<br />
Personen gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.<br />
(6) Die Stimmen einer wählenden Person, die an der Briefwahl teilgenommen<br />
hat, werden nicht dadurch ungültig, dass sie vor dem oder am Wahltag<br />
stirbt, aus dem Wahlgebiet wegzieht oder sonst ihr Stimmrecht verliert.<br />
Bay LWG Art. 41 Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmkreis<br />
(1) Der Stimmkreisausschuss stellt fest, wie viele gültige Stimmen im<br />
Stimmkreis<br />
1. insgesamt,<br />
2. für jeden Stimmkreisbewerber,<br />
3. für jeden Wahlkreisbewerber,<br />
4. für jede Wahlkreisliste nach Art. 40 Abs. 2,<br />
5. für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt<br />
abgegeben worden sind.<br />
Bay LWG Art. 42 Feststellung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis<br />
(1) Der Landeswahlausschuss stellt für jeden Wahlkreis fest, wie viele gültige<br />
Stimmen<br />
1. insgesamt,<br />
2. für jeden Stimmkreisbewerber,<br />
3. für jeden Wahlkreisbewerber,<br />
4. für jede Wahlkreisliste nach Art. 40 Abs. 2,<br />
5. für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt<br />
abgegeben worden sind.
(2) 1 Für die Sitzeverteilung wird die Gesamtzahl der auf den Wahlkreis<br />
treffenden Sitze, vervielfacht mit der Zahl der Stimmen, die für einen<br />
Wahlkreisvorschlag insgesamt abgegeben worden sind, durch die<br />
Gesamtzahl der für alle Wahlkreisvorschläge insgesamt abgegebenen<br />
Stimmen geteilt. 2 Jeder Wahlkreisvorschlag erhält zunächst so viele Sitze,<br />
wie ganze Zahlen auf ihn entfallen. 3 Die weiteren zu vergebenden Sitze<br />
werden den Wahlkreisvorschlägen in der Reihenfolge der höchsten<br />
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 1 ergeben,<br />
zugeteilt.<br />
(3) 1 Haben mehrere Wahlkreisvorschläge gleichen Anspruch auf einen Sitz<br />
und würde bei voller Befriedigung der sämtlichen Ansprüche die<br />
verfügbare Zahl der Sitze überschritten, so wird der Sitz dem<br />
Wahlkreisvorschlag angerechnet, dessen in Betracht kommende sich<br />
bewerbende Person die größte Stimmenzahl aufweist. 2 Bei<br />
Stimmengleichheit entscheidet das Los.<br />
(4) 1 Wahlvorschläge, auf die im Land nicht mindestens fünf v. H. der<br />
insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen entfallen, erhalten keinen Sitz<br />
zugeteilt (Art. 14 Abs. 4 der Verfassung). 2 Die auf diese Wahlvorschläge<br />
entfallenden Stimmen scheiden bei der Ermittlung der Sitze nach Absatz 2<br />
aus.<br />
(5) 1 Erhält ein Wahlvorschlag, auf den im Land mehr als die Hälfte der für die<br />
zu berücksichtigenden Wahlvorschläge insgesamt abgegebenen gültigen<br />
Stimmen entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte aller<br />
Abgeordnetenmandate, so werden ihm so viele weitere Sitze zugeteilt, bis<br />
er über mehr als die Hälfte der Abgeordnetenmandate verfügt. 2 Die Sitze<br />
erhalten die nach den Vorschriften der Art. 43 bis 45 nicht gewählten sich<br />
bewerbenden Personen in der Reihenfolge der auf sie landesweit<br />
entfallenden höchsten Stimmenzahlen.<br />
Bay LWG Art. 43 Wahl der Vertreter der Stimmkreise<br />
(1) 1 Im Stimmkreis ist diejenige sich bewerbende Person gewählt, die die<br />
meisten Stimmen erhalten hat. 2 Bei Gleichheit zweier sich bewerbender<br />
Personen entscheidet das Los.<br />
(2) 1 Kann die nach Absatz 1 gewählte sich bewerbende Person gemäß Art. 14<br />
Abs. 4 der Verfassung keinen Sitz zugeteilt erhalten, so scheiden die auf<br />
sie entfallenden Stimmen aus. 2 Als gewählt gilt in diesem Fall der<br />
Stimmkreisbewerber mit der nächsthohen Stimmenzahl.<br />
Bay LWG Art. 44 Wahl der Abgeordneten aus den Wahlkreislisten<br />
(1) Jeder Wahlkreisvorschlag erhält zur Verteilung an die Wahlkreisbewerber<br />
so viele Sitze zugeteilt, als der Unterschied zwischen den nach Art. 42<br />
Abs. 2 ermittelten Sitzen und den nach Art. 43 gewählten<br />
Stimmkreisbewerbern des betreffenden Wahlkreisvorschlags ergibt.<br />
(2) 1 In den Stimmkreisen errungene Sitze verbleiben dem Wahlkreisvorschlag<br />
auch dann, wenn sie die nach Art. 42 Abs. 2 ermittelte Zahl der Sitze<br />
übersteigen (Überhangmandate). 2 Die Zahl der auf den Wahlkreis<br />
treffenden Sitze (Art. 21 Abs. 2) wird so lange erhöht, bis sich bei ihrer
Verteilung nach Art. 42 Abs. 2 für diesen Wahlkreisvorschlag die Zahl der<br />
für ihn in den Stimmkreisen errungenen Sitze ergibt.<br />
Bay LWG Art. 45 Verteilung der Sitze an die sich bewerbenden<br />
Personen<br />
(1) 1 Innerhalb der Wahlkreisliste werden die nach Art. 42 Abs. 2 und Art. 44<br />
festgestellten Sitze an die sich bewerbenden Personen nach der Zahl der<br />
auf sie entfallenden Stimmen verteilt. 2 Hierbei werden die Stimmen, die<br />
ein Stimmkreisbewerber in seinem Stimmkreis und jene, die er auf der<br />
Wahlkreisliste erhalten hat, zusammengezählt.<br />
(2) Haben in einem Wahlkreisvorschlag mehrere sich bewerbende Personen<br />
die gleiche Stimmenzahl erhalten und reicht die verfügbare Zahl der Sitze<br />
nicht für alle aus, dann entscheidet das Los.<br />
(3) Entfallen auf einen Wahlkreisvorschlag mehr Sitze als er wählbare sich<br />
bewerbende Personen enthält, so bleiben diese Sitze unbesetzt.<br />
Bay LWG Art. 46 Listennachfolger<br />
(1) 1 Die nicht gewählten sich bewerbenden Personen eines<br />
Wahlkreisvorschlags sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen<br />
Listennachfolger für ausscheidende Abgeordnete. 2 Bei gleicher<br />
Stimmenzahl ist die Reihenfolge durch das Los festzustellen.<br />
(2) 1 Eine nicht gewählte sich bewerbende Person verliert ihre Anwartschaft<br />
als Listennachfolger, wenn sie dem Landeswahlleiter schriftlich ihren<br />
Verzicht erklärt. 2 Der Verzicht kann nicht widerrufen werden.<br />
Bay LWG Art. 47 Ungültigkeitserklärung von Stimmen durch den<br />
Landeswahlausschuss<br />
1 Ergibt sich bei der Feststellung des Ergebnisses, dass eine sich bewerbende<br />
Person in mehreren Wahlkreisvorschlägen aufgestellt worden ist, so hat der<br />
Landeswahlausschuss die sämtlichen für diese sich bewerbende Person<br />
abgegebenen Stimmen für ungültig zu erklären. 2 Das Wahlergebnis ist<br />
hiernach gegebenenfalls neu festzustellen.<br />
Bay LWG Art. 48 Verständigung der Gewählten<br />
Der Landeswahlleiter verständigt sofort die Gewählten und fordert sie auf,<br />
binnen einer Woche schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.<br />
Bay LWG Art. 49 Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag<br />
1 Eine gewählte sich bewerbende Person erwirbt die Rechtsstellung eines<br />
Abgeordneten mit dem Eingang der Annahmeerklärung beim Landeswahlleiter,<br />
jedoch nicht vor Ablauf der Wahlperiode des letzten Landtags und im Fall des<br />
Art. 55 Abs. 5 nicht vor Ausscheiden des nach dem ursprünglichen<br />
Wahlergebnis gewählten Abgeordneten. 2 Gibt der Gewählte bis zum Ablauf der<br />
gesetzten Frist keine Erklärung ab, so gilt die Wahl zu diesem Zeitpunkt als<br />
angenommen. 3 Eine Erklärung unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. 4 Eine<br />
Ablehnung kann nicht widerrufen werden.
Bay LWG Art. 50 Bekanntmachung der Namen der Gewählten<br />
Sobald die Namen aller Abgeordneten feststehen, hat der Landeswahlleiter die<br />
Namen der Gewählten und die Namen der Listennachfolger in ihrer Reihenfolge<br />
bekannt zu machen.<br />
5. Wahlprüfung<br />
Bay LWG Art. 51 Zuständigkeit<br />
Die Wahlprüfung obliegt dem Landtag.<br />
Bay LWG Art. 52 Umfang der Wahlprüfung<br />
Bei der Wahlprüfung unterliegen alle während des Wahlverfahrens ergangenen<br />
Entscheidungen einer Nachprüfung, auch wenn sie nach diesem Gesetz für die<br />
Durchführung der Wahl als endgültig erklärt sind.<br />
Bay LWG Art. 53 Frist für Wahlbeanstandungen<br />
Wahlbeanstandungen durch Stimmberechtigte müssen binnen eines Monats<br />
nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses beim Landtag eingehen.<br />
Bay LWG Art. 54 Nachwahl<br />
(1) Eine Nachwahl findet statt, wenn in einem Stimmkreis oder in einem<br />
Stimmbezirk die Wahl nicht durchgeführt oder die Verhinderung der<br />
ordnungsgemäßen Wahlhandlung festgestellt worden ist.<br />
(2) 1 Die Nachwahl soll spätestens drei Wochen nach dem Tag der<br />
ausgefallenen Wahl stattfinden. 2 Den Tag der Nachwahl bestimmt das<br />
Staatsministerium des Innern. 3 Die Anordnung der Nachwahl unterliegt<br />
der Nachprüfung im Wahlprüfungsverfahren.<br />
(3) Die Nachwahl findet nach den für die ausgefallene Wahl maßgebenden<br />
Grundlagen und Vorschriften statt.<br />
Bay LWG Art. 55 Wiederholungswahl<br />
(1) Wird das Wahlergebnis in einem Wahlkreis oder in einem Stimmkreis für<br />
ungültig erklärt, so ist für diesen Wahlkreis oder für diesen Stimmkreis die<br />
Wahl in dem in der Entscheidung genannten Umfang zu wiederholen.<br />
(2) Wird das Wahlergebnis nur in einzelnen Stimmbezirken für ungültig erklärt<br />
und dabei festgestellt, dass es auf das Gesamtergebnis von Einfluss sein<br />
kann, so hat eine Wiederholungswahl in diesen Stimmbezirken<br />
stattzufinden.<br />
(3) Bei der Wiederholungswahl wird vorbehaltlich einer anderweitigen<br />
Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren nach denselben Wahlvorschlägen<br />
und, wenn seit der Hauptwahl noch nicht sechs Monate vergangen sind,<br />
auf Grund derselben Wählerverzeichnisse gewählt wie bei der für ungültig<br />
erklärten Wahl.<br />
(4) 1 Die Wiederholungswahl muss spätestens 60 Tage nach Rechtskraft der<br />
Entscheidung stattfinden, durch die die Wahl für ungültig erklärt worden<br />
ist. 2 Sie unterbleibt, wenn feststeht, dass innerhalb von sechs Monaten
ein neuer Landtag gewählt wird. 3 Den Tag der Wiederholungswahl<br />
bestimmt das Staatsministerium des Innern.<br />
(5) Auf Grund der Wiederholungswahl wird das Wahlergebnis vom<br />
Landeswahlausschuss neu festgestellt.<br />
6. Verlust und Ruhen der Mitgliedschaft<br />
Bay LWG Art. 56 Verlust der Mitgliedschaft beim Landtag<br />
(1) Ein Abgeordneter verliert seinen Sitz<br />
1. durch nicht mehr anfechtbare Ungültigkeitserklärung der Wahl oder<br />
sonstiges Ausscheiden beim Wahlprüfungsverfahren,<br />
2. durch nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses,<br />
3. durch Verlust der Wählbarkeit,<br />
4. durch Verzicht,<br />
5. durch Wegfall der Gründe für die Berufung als Listennachfolger.<br />
(2) 1 Der Verzicht ist zur Niederschrift des Landtagspräsidenten oder eines<br />
Notars, der seinen Sitz in Bayern hat, zu erklären; eine notarielle<br />
Verzichtserklärung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem der<br />
Abgeordnete sie dem Landtagspräsidenten übermittelt. 2 Der Verzicht<br />
kann nicht widerrufen werden. 3 Der Abgeordnete verliert seinen Sitz in<br />
dem Zeitpunkt, in dem der Landtagspräsident die Wirksamkeit der<br />
Verzichtserklärung feststellt.<br />
(3) Über den Verlust der Mitgliedschaft in den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1 bis<br />
3 und 5 beschließt der Landtag.<br />
Bay LWG Art. 57 Ruhen der Mitgliedschaft eines Abgeordneten<br />
(1) Die Mitgliedschaft eines Abgeordneten ruht, wenn<br />
1. gegen ihn nach Art. 61 der Verfassung Anklage zum<br />
Verfassungsgerichtshof erhoben wird,<br />
2. die Wahl eines Abgeordneten im Wahlprüfungsverfahren durch den<br />
Landtag für ungültig erklärt wird, solange der Beschluss des Landtags<br />
anfechtbar ist oder über ihn durch den Verfassungsgerichtshof noch nicht<br />
entschieden worden ist,<br />
3. das Ruhen durch den Verfassungsgerichtshof in einem dort anhängigen<br />
Wahlprüfungsverfahren besonders angeordnet wird,<br />
4. der Verlust der Mitgliedschaft beim Verfassungsgerichtshof angefochten<br />
wird.<br />
(2) Abgesehen von der Anordnung des Ruhens nach Absatz 1 Nr. 3 findet<br />
Art. 56 Abs. 3 entsprechende Anwendung.<br />
Bay LWG Art. 58 Feststellung der Listennachfolger<br />
(1) 1 Scheidet ein Abgeordneter durch Tod oder Verlust der Mitgliedschaft aus<br />
oder ruht seine Mitgliedschaft, so wird der Sitz mit dem nächstfolgenden<br />
Listennachfolger aus dem Wahlkreisvorschlag der politischen Partei oder<br />
sonstigen organisierten Wählergruppe besetzt, für die der Ausgeschiedene<br />
bei der Wahl aufgetreten war; ist die Liste erschöpft, so bleibt der Sitz<br />
unbesetzt. 2 Gleiches gilt, wenn eine gewählte sich bewerbende Person die<br />
Annahme der Wahl ablehnt oder nach der Entscheidung über die
Zulassung der Wahlkreisvorschläge verstorben ist oder ihre Wählbarkeit<br />
verloren hat.<br />
(2) 1 Die Feststellung und Einberufung des Listennachfolgers obliegt dem<br />
Landeswahlleiter. 2 Art. 48 und 49 finden entsprechende Anwendung.<br />
(3) Muss von der festgestellten Reihenfolge der Listennachfolger abgewichen<br />
werden, so entscheidet hierüber – vom Fall des Todes oder des Verzichts<br />
(Art. 46 Abs. 2) eines Listennachfolgers abgesehen – der<br />
Landeswahlausschuss.<br />
Bay LWG Art. 59 Folgen eines Parteiverbots<br />
(1) Erklärt das Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 21 des Grundgesetzes<br />
eine Partei für verfassungswidrig, so verlieren die Abgeordneten, die auf<br />
Grund eines Wahlvorschlags dieser Partei gewählt worden sind oder die<br />
der für verfassungswidrig erklärten Partei zur Zeit der Verkündung des<br />
Urteils angehören, mit Verkündung des Urteils ihren Sitz, soweit nicht in<br />
dem Urteil ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.<br />
(2) 1 Soweit Abgeordnete nach Absatz 1 ihren Sitz verloren haben, bleiben die<br />
Sitze unbesetzt. 2 Das gilt nicht, wenn die ausgeschiedenen Abgeordneten<br />
auf Grund eines Wahlvorschlags einer nicht für verfassungswidrig<br />
erklärten Partei gewählt waren; in diesem Fall werden die nächstfolgenden<br />
Listennachfolger dieses Wahlvorschlags einberufen, soweit nicht auch auf<br />
diese die Voraussetzungen des Absatzes 1 zutreffen. 3 Art. 58 Abs. 2 und<br />
3 gelten entsprechend.<br />
(3) 1 Im Fall des Absatzes 2 Satz 1 verringert sich die gesetzliche<br />
Mitgliederzahl des Landtags für den Rest der Wahldauer entsprechend.<br />
2<br />
Eine Neuverteilung der verbleibenden Sitze findet nicht statt.<br />
(4) 1 Den Verlust der Mitgliedschaft nach Absatz 1 stellt der Landtagspräsident<br />
fest. 2 Diese Feststellung steht einem Landtagsbeschluss im Sinn des<br />
Art. 48 Abs. 1 des <strong>Gesetze</strong>s über den Verfassungsgerichtshof gleich.<br />
7. Staatliche Mittel für Träger von Wahlvorschlägen<br />
Bay LWG Art. 60 Leistungen an Parteien<br />
(1) Die staatlichen Mittel nach dem Parteiengesetz für die bei Landtagswahlen<br />
erzielten Stimmen werden vom Präsidenten des Landtags festgesetzt und<br />
an die Landesverbände der Parteien ausgezahlt.<br />
(2) Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt des Freistaates Bayern in dem<br />
für den Landtag geltenden Einzelplan auszubringen.<br />
(3) Der Oberste Rechnungshof prüft, ob der Präsident des Landtags als<br />
mittelverwaltende Stelle die staatlichen Mittel entsprechend den<br />
Vorschriften des Parteiengesetzes ausgezahlt hat.<br />
Bay LWG Art. 61 Leistungen an sonstige organisierte Wählergruppen<br />
(1) Sonstige organisierte Wählergruppen, die sich mit eigenen<br />
Wahlvorschlägen an der Landtagswahl beteiligen und nach dem<br />
endgültigen Wahlergebnis mindestens 1,0 v. H. der abgegebenen gültigen
Gesamtstimmen erzielt haben, erhalten für jede erzielte gültige Stimme<br />
1,28 Euro.<br />
(2) 1 Die Mittel nach Absatz 1 werden vom Präsidenten des Landtags auf<br />
schriftlichen Antrag der Wählergruppe festgesetzt und ausgezahlt.<br />
2<br />
Anträge werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von zwei Monaten<br />
nach dem Zusammentritt des Landtags beim Präsidenten des Landtags<br />
eingehen.<br />
(3) Art. 60 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.<br />
DRITTER TEIL Besondere Bestimmungen über Volksbegehren und<br />
Volksentscheid<br />
ABSCHNITT I Das unmittelbare Gesetzgebungsrecht des Volkes<br />
Bay LWG Art. 62 Volksgesetzgebung<br />
(1) Das Volk übt das unmittelbare Recht der Gesetzgebung aus durch die<br />
Vorlage von <strong>Gesetze</strong>ntwürfen in Volksbegehren und durch die<br />
Abstimmung über <strong>Gesetze</strong> in Volksentscheiden.<br />
(2) 1 Über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt (Art. 73 der<br />
Verfassung). 2 Ebenso sind Volksbegehren und Volksentscheid auf<br />
Verfassungsänderungen, die dem demokratischen Grundgedanken der<br />
Verfassung widersprechen, unzulässig.<br />
1. Volksbegehren<br />
Bay LWG Art. 63 Zulassungsantrag<br />
(1) 1 Der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens ist schriftlich an das<br />
Staatsministerium des Innern zu richten. 2 Ihm muss der ausgearbeitete,<br />
mit Gründen versehene <strong>Gesetze</strong>ntwurf, der den Gegenstand des<br />
Volksbegehrens bilden soll, beigegeben sein. 3 Der Antrag bedarf der<br />
Unterschrift von 25 000 Stimmberechtigten; das Stimmrecht der<br />
Unterzeichner ist bei der Einreichung des Zulassungsantrags<br />
nachzuweisen. 4 Der Nachweis darf bei Einreichung des Zulassungsantrags<br />
nicht älter als zwei Jahre sein.<br />
(2) 1 In dem Zulassungsantrag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu<br />
benennen. 2 Der Beauftragte und sein Stellvertreter sind jeder für sich<br />
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Antrag abzugeben und<br />
entgegenzunehmen; im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten.<br />
3<br />
Für den Fall des Ausscheidens des Beauftragten oder seines<br />
Stellvertreters sind in dem Zulassungsantrag zusätzlich mindestens drei<br />
weitere Stellvertreter zu benennen.<br />
Bay LWG Art. 64 Entscheidung über den Zulassungsantrag<br />
(1) 1 Erachtet das Staatsministerium des Innern die gesetzlichen<br />
Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens nicht für gegeben,<br />
so hat es die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs herbeizuführen<br />
(Art. 67 der Verfassung). 2 Dies gilt insbesondere dann, wenn<br />
angenommen wird, dass der Antrag eine unzulässige
Verfassungsänderung (Art. 75 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung) oder eine<br />
verfassungswidrige Einschränkung eines Grundrechts (Art. 98 der<br />
Verfassung) enthält.<br />
(2) 1 Auf das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof finden die besonderen<br />
Verfahrensvorschriften über Verfassungsstreitigkeiten sinngemäß<br />
Anwendung. 2 Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs muss<br />
innerhalb eines Monats nach Schluss der mündlichen Verhandlung, bei<br />
Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach Beendigung der Anhörung<br />
der Verfahrensbeteiligten getroffen werden, spätestens jedoch drei<br />
Monate nach Anrufung durch das Staatsministerium des Innern. 3 Sie ist<br />
im Staatsanzeiger und im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu<br />
machen.<br />
Bay LWG Art. 65 Bekanntmachung des Volksbegehrens und der<br />
Eintragungsfrist<br />
(1) Wird dem Zulassungsantrag stattgegeben, so macht das<br />
Staatsministerium des Innern das Volksbegehren in der gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Form bekannt und setzt Beginn und Ende der Frist fest,<br />
während deren die Eintragungen für das Volksbegehren vorgenommen<br />
werden können (Eintragungsfrist).<br />
(2) Die Bekanntmachung hat spätestens sechs Wochen nach dem Eingang des<br />
vollständigen Zulassungsantrags beim Staatsministerium des Innern, im<br />
Fall des Art. 64 vier Wochen nach der Verkündung der dem<br />
Zulassungsantrag stattgebenden Entscheidung des<br />
Verfassungsgerichtshofs zu ergehen.<br />
(3) 1 Die Eintragungsfrist beträgt 14 Tage. 2 Sie beginnt frühestens acht,<br />
spätestens zwölf Wochen nach der Veröffentlichung im Staatsanzeiger.<br />
3<br />
Sind die Eintragungslisten aus Gründen, die die Unterzeichner des<br />
Zulassungsantrags nicht zu vertreten haben, nicht oder nicht<br />
ordnungsgemäß während der gesamten Eintragungsfrist zum Eintrag der<br />
Unterzeichnungserklärung bereitgehalten worden, so verlängert das<br />
Staatsministerium des Innern die Eintragungsfrist allgemein oder für<br />
einzelne Gemeinden entsprechend.<br />
Bay LWG Art. 66 Änderung und Rücknahme des Zulassungsantrags<br />
(1) 1 Nach der Bekanntmachung kann der Zulassungsantrag nicht mehr<br />
geändert, aber bis zum Ablauf der Eintragungsfrist jederzeit<br />
zurückgenommen werden. 2 Die Rücknahmeerklärung ist gültig, wenn sie<br />
von mehr als der Hälfte der Unterzeichner des Antrags abgegeben ist.<br />
(2) 1 Auf Antrag des Beauftragten und des Stellvertreters kann das<br />
Staatsministerium des Innern den Zulassungsantrag für erledigt erklären,<br />
wenn durch ein vom Landtag beschlossenes Gesetz die mit dem Antrag<br />
erstrebte <strong>Gesetze</strong>svorlage als überholt zu betrachten ist. 2 Diese<br />
Entscheidung kann von Unterzeichnern des Zulassungsantrags beim<br />
Verfassungsgerichtshof angefochten werden. 3 Auf das Verfahren vor<br />
diesem Gericht ist Art. 64 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.
(3) Das Volksbegehren ist durch das Staatsministerium des Innern<br />
einzustellen, wenn von den Antragstellern die ihnen obliegenden<br />
Maßnahmen nicht innerhalb einer angemessenen Frist getroffen werden.<br />
Bay LWG Art. 67 Eintragungsbezirke<br />
1 Die Gemeinden, in denen Eintragungslisten aufgelegt werden sollen,<br />
bestimmen die Anzahl der Eintragungsbezirke so, dass jede stimmberechtigte<br />
Person ausreichend Gelegenheit findet, sich an dem Volksbegehren zu<br />
beteiligen. 2 Jede Gemeinde bildet mindestens einen Eintragungsbezirk.<br />
Bay LWG Art. 68 Auslegung der Eintragungslisten<br />
(1) 1 Die Unterzeichner des Zulassungsantrags haben den kreisfreien<br />
Gemeinden, für die kreisangehörigen Gemeinden den Landratsämtern die<br />
erforderliche Anzahl vorschriftsmäßiger Eintragungslisten gegen<br />
Empfangsnachweis spätestens zwei Wochen vor Beginn der<br />
Eintragungsfrist zuzuleiten. 2 Diese müssen den vollen Inhalt des<br />
Volksbegehrens enthalten.<br />
(2) 1 Die Gemeinden sind verpflichtet, die Eintragungslisten für die Dauer der<br />
Eintragungsfrist zum Eintrag der Unterzeichnungserklärung<br />
bereitzuhalten. 2 Die Eintragungsräume und -stunden sind so zu<br />
bestimmen, dass jede stimmberechtigte Person ausreichend Gelegenheit<br />
findet, sich an dem Volksbegehren zu beteiligen.<br />
Bay LWG Art. 69 Eintragungsberechtigung, Inhalt der Eintragung,<br />
Eintragungsschein<br />
(1) 1 In eine Eintragungsliste kann sich nur eintragen, wer in ein<br />
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Eintragungsschein hat. 2 Wer<br />
im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann sich nur in dem<br />
Eintragungsbezirk eintragen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.<br />
3<br />
Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines<br />
beliebigen Eintragungsbezirks in Bayern eintragen.<br />
(2) Wer glaubhaft macht, dass er verhindert ist, sich in dem<br />
Eintragungsbezirk einzutragen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt<br />
wird, oder wer aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund in das<br />
Wählerverzeichnis nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen<br />
Eintragungsschein.<br />
(3) 1 Die Eintragung muss Vor- und Familienname sowie die Unterschrift<br />
enthalten. 2 Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. 3 Wer auf<br />
einem Eintragungsschein an Eides statt versichert, dass er wegen<br />
Krankheit oder körperlicher Behinderung während der gesamten<br />
Eintragungszeit nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der<br />
Lage ist, einen Eintragungsraum aufzusuchen, kann die Eintragung in<br />
diesem Fall dadurch bewirken, dass er auf dem Eintragungsschein seine<br />
Unterstützung des Volksbegehrens erklärt und eine von ihm beauftragte<br />
Hilfsperson die Eintragung im Eintragsungsraum für ihn vornimmt.<br />
(4) Die Eintragung kann nicht zurückgenommen werden.
Bay LWG Art. 70 Ungültige Eintragungen<br />
(1) Ungültig sind Eintragungen, wenn<br />
1. sie keine eigenhändige Unterschrift enthalten,<br />
2. sie die Person des Eingetragenen nicht deutlich erkennen lassen,<br />
3. der Eingetragene nicht stimmberechtigt ist,<br />
4. sie nicht auf vorschriftsmäßigen Eintragungslisten stehen,<br />
5. sie nicht rechtzeitig geleistet worden sind,<br />
6. sie außerhalb der amtlichen Eintragungsräume geleistet worden sind,<br />
7. der Eintragungsschein ungültig ist, die Erklärung der Unterstützung des<br />
Volksbegehrens oder die Versicherung an Eides statt nicht unterschrieben<br />
ist.<br />
(2) Mehrere Eintragungen einer Person gelten als eine Eintragung.<br />
(3) Die von einer beauftragten Hilfsperson gemäß Art. 69 Abs. 3<br />
vorgenommene Eintragung ist nicht unwirksam, wenn die<br />
stimmberechtigte Person vor der Eintragung gestorben oder aus dem<br />
Wahlgebiet weggezogen ist oder sonst ihr Stimmrecht verloren hat.<br />
Bay LWG Art. 71 Feststellung des Ergebnisses des Volksbegehrens<br />
(1) 1 Der Landeswahlausschuss stellt das Ergebnis des Volksbegehrens fest.<br />
2<br />
Er ist dabei an die Auffassung der Gemeinde oder des Landratsamts über<br />
die Gültigkeit der Eintragungen nicht gebunden.<br />
(2) Zur Rechtsgültigkeit des Volksbegehrens ist es erforderlich, dass das<br />
Verlangen nach Schaffung eines <strong>Gesetze</strong>s von mindestens einem Zehntel<br />
der Stimmberechtigten gestellt worden ist.<br />
(3) Der Landeswahlleiter macht das vom Landeswahlausschuss festgestellte<br />
Ergebnis des Volksbegehrens bekannt.<br />
Bay LWG Art. 72 Vorlage des Volksbegehrens an den Landtag<br />
(1) Der Ministerpräsident hat rechtsgültige Volksbegehren innerhalb von vier<br />
Wochen namens der Staatsregierung unter Darlegung ihrer<br />
Stellungnahme dem Landtag zu unterbreiten.<br />
(2) In den Fällen des Art. 73 Abs. 2 hat der Ministerpräsident sämtliche<br />
Volksbegehren dem Landtag gemeinsam vorzulegen; die Frist des<br />
Absatzes 1 beginnt hier mit der Feststellung des Ergebnisses des vom<br />
Landeswahlausschuss zuletzt behandelten Volksbegehrens.<br />
Bay LWG Art. 73 Behandlung des Volksbegehrens im Landtag<br />
(1) 1 Rechtsgültige Volksbegehren sind vom Landtag binnen drei Monaten<br />
nach Unterbreitung zu behandeln und – vorbehaltlich des Absatzes 3 –<br />
binnen weiterer drei Monate dem Volk zur Entscheidung vorzulegen. 2 Bei<br />
Ablauf dieser Fristen während einer Vertagung des Landtags hat der<br />
Präsident den Landtag zu einer außerordentlichen Tagung einzuberufen.<br />
(2) 1 Mehrere rechtsgültige Volksbegehren, die den gleichen Gegenstand<br />
betreffen, werden vom Landtag gemeinsam behandelt und dem Volk<br />
gemeinsam zur Entscheidung vorgelegt, wenn ihre Laufzeit<br />
zusammengefallen war oder sich überschnitten hatte. 2 Die Laufzeit im<br />
Sinn des Satzes 1 umfasst den Zeitraum vom Eingang des
Zulassungsantrags beim Staatsministerium des Innern (Art. 63 Abs. 1<br />
Satz 1) bis zur Feststellung des Ergebnisses des Volksbegehrens durch<br />
den Landeswahlausschuss (Art. 71 Abs. 1 Satz 1).<br />
(3) Nimmt der Landtag den begehrten <strong>Gesetze</strong>ntwurf unverändert an, so<br />
entfällt ein Volksentscheid vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 75<br />
Abs. 2 der Verfassung.<br />
(4) Lehnt der Landtag den im Volksbegehren unterbreiteten <strong>Gesetze</strong>santrag<br />
ab, so kann er dem Volk einen eigenen <strong>Gesetze</strong>ntwurf zur Entscheidung<br />
mit vorlegen.<br />
(5) 1 Wird durch den Landtag die Rechtsgültigkeit des Volksbegehrens<br />
bestritten, so ist der hierüber ergangene Beschluss durch das<br />
Staatsministerium des Innern öffentlich bekannt zu machen. 2 Auf Antrag<br />
von Unterzeichnern des Volksbegehrens entscheidet hierüber der<br />
Verfassungsgerichtshof (Art. 67 der Verfassung). 3 Art. 64 ist<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
Bay LWG Art. 74 Kosten<br />
1 Die Kosten der Herstellung der Eintragungslisten und deren Versendung an<br />
die kreisfreien Gemeinden und an die Landratsämter tragen die Antragsteller.<br />
2 Die Kosten der Feststellung des Ergebnisses des Volksbegehrens fallen dem<br />
Staat, die übrigen Kosten den Gemeinden zur Last.<br />
2. Volksentscheid<br />
Bay LWG Art. 75 Bekanntmachung von Tag und Gegenstand des<br />
Volksentscheids<br />
(1) 1 Die Staatsregierung setzt den Tag der Abstimmung fest. 2 Sie macht ihn<br />
mit dem Gegenstand des Volksentscheids bekannt.<br />
(2) Die Bekanntmachung hat zu enthalten:<br />
1. den Tag der Abstimmung,<br />
2. den Text des <strong>Gesetze</strong>ntwurfs,<br />
3. eine Erläuterung der Staatsregierung (Art. 74 Abs. 7 der Verfassung),<br />
die bündig und sachlich sowohl die Begründung der Antragsteller wie die<br />
Auffassung der Staatsregierung und des Landtags einschließlich des<br />
Abstimmungsergebnisses im Landtag über den Gegenstand darlegen soll.<br />
Bay LWG Art. 76 Stimmzettel, Stimmabgabe<br />
(1) 1 Inhalt und Form des Stimmzettels werden vom Staatsministerium des<br />
Innern bestimmt. 2 Der Stimmzettel hat den Text des zur Abstimmung<br />
vorgelegten <strong>Gesetze</strong>ntwurfs zu enthalten. 3 Vom Abdruck umfangreicher<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwürfe kann abgesehen werden; der <strong>Gesetze</strong>ntwurf ist dann den<br />
Stimmberechtigten vor der Abstimmung zu übermitteln.<br />
(2) 1 Stehen mehrere <strong>Gesetze</strong>ntwürfe, die den gleichen Gegenstand betreffen,<br />
inhaltlich aber miteinander nicht vereinbar sind, zur Abstimmung, so sind<br />
sie auf einem Stimmzettel gemeinsam aufzuführen; Absatz 1 Satz 3 gilt<br />
entsprechend. 2 Ihre Reihenfolge richtet sich nach der vom<br />
Landeswahlausschuss festgestellten Zahl der gültigen Eintragungen. 3 Hat<br />
der Landtag dem Volk einen eigenen <strong>Gesetze</strong>ntwurf mit zur Abstimmung
vorgelegt, so wird dieser vor den mit Volksbegehren gestellten<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwürfen aufgeführt.<br />
(3) Die abstimmende Person hat ihre Entscheidung, ob sie dem <strong>Gesetze</strong>ntwurf<br />
zustimmt (Ja-Stimme) oder diesen ablehnt (Nein-Stimme), auf dem<br />
Stimmzettel durch ein Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich zu<br />
machen.<br />
(4) 1 Stehen mehrere <strong>Gesetze</strong>ntwürfe, die den gleichen Gegenstand betreffen,<br />
inhaltlich aber miteinander nicht vereinbar sind, zur Abstimmung, so kann<br />
die abstimmende Person zu jedem einzelnen <strong>Gesetze</strong>ntwurf kenntlich<br />
machen, ob sie ihn dem geltenden Recht vorzieht (Ja-Stimme) oder nicht<br />
(Nein-Stimme). 2 Zusätzlich kann sie kenntlich machen, welchen der<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwürfe sie vorzieht für den Fall, dass zwei oder mehr<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwürfe jeweils die erforderliche Zustimmung (Art. 79 Abs. 1)<br />
erreichen (Stichfrage).<br />
Bay LWG Art. 77 Ungültige Stimmen<br />
1 Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt ist.<br />
2 Art. 40 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 und Abs. 3 bis 6 gelten entsprechend. 3 Stehen<br />
mehrere <strong>Gesetze</strong>ntwürfe, die den gleichen Gegenstand betreffen, inhaltlich<br />
aber miteinander nicht vereinbar sind, zur Abstimmung, so macht die<br />
Ungültigkeit der Stimmabgabe zu einer einzelnen Frage die Stimmabgabe zu<br />
den übrigen Fragen nicht ungültig.<br />
Bay LWG Art. 78 Feststellung des Abstimmungsergebnisses<br />
(1) Nach Beendigung der Abstimmung stellt der Wahlvorstand das<br />
Abstimmungsergebnis für den Stimmbezirk fest.<br />
(2) Im Anschluss daran stellt der Abstimmungsausschuss das<br />
Abstimmungsergebnis für den Landkreis oder die kreisfreie Gemeinde fest.<br />
(3) Der Landeswahlausschuss stellt das Ergebnis des Volksentscheids fest.<br />
Bay LWG Art. 79 Ergebnis des Volksentscheids<br />
(1) Ein <strong>Gesetze</strong>ntwurf erreicht die erforderliche Zustimmung durch<br />
Volksentscheid, wenn<br />
1. er mehr gültige Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhält und<br />
2. im Fall, dass der <strong>Gesetze</strong>ntwurf eine Verfassungsänderung beinhaltet,<br />
diese Ja-Stimmen mindestens 25 v. H. der Stimmberechtigten<br />
entsprechen (Quorum); beinhaltet der <strong>Gesetze</strong>ntwurf sowohl eine<br />
Verfassungsänderung als auch die Schaffung oder die Änderung einfachen<br />
Rechts, so unterliegt er insgesamt dem Quorum.<br />
(2) Steht ein einziger <strong>Gesetze</strong>ntwurf zur Abstimmung, so ist er durch<br />
Volksentscheid angenommen, wenn er die erforderliche Zustimmung<br />
(Absatz 1) erreicht.<br />
(3) 1 Hat von mehreren nach Art. 76 Abs. 4 zur Abstimmung stehenden<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwürfen nur ein <strong>Gesetze</strong>ntwurf die erforderliche Zustimmung<br />
(Absatz 1) erreicht, so ist dieser <strong>Gesetze</strong>ntwurf angenommen. 2 Haben<br />
zwei oder mehr <strong>Gesetze</strong>ntwürfe die erforderliche Zustimmung (Absatz 1)<br />
erreicht, so ist von diesen der <strong>Gesetze</strong>ntwurf angenommen, der bei der<br />
Stichfrage (Art. 76 Abs. 4 Satz 2) die Mehrheit der gültigen Stimmen
erhält. 3 Ergibt sich bei der Stichfrage Stimmengleichheit, so ist der<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwurf angenommen, der die meisten gültigen Ja-Stimmen<br />
(Art. 76 Abs. 4 Satz 1) erhalten hat. 4 Haben dabei zwei oder mehr<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwürfe die gleiche Zahl an gültigen Ja-Stimmen erhalten, so ist<br />
derjenige angenommen, der nach Abzug der auf ihn entfallenden Nein-<br />
Stimmen die größte Zahl an Ja-Stimmen auf sich vereinigt. 5 Ergibt sich<br />
auch danach Stimmengleichheit zwischen zwei oder mehr<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwürfen, so wird über diese <strong>Gesetze</strong>ntwürfe erneut abgestimmt.<br />
Bay LWG Art. 80 Prüfung des Volksentscheids<br />
(1) Für die Prüfung des Volksentscheids gelten Art. 51 bis 55 entsprechend.<br />
(2) 1 Gegen die Beschlüsse des Landtags im Rahmen der Prüfung des<br />
Volksentscheids können die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs<br />
beantragen<br />
1. Fraktionen des Landtags oder Minderheiten des Landtags, die<br />
wenigstens ein Zehntel der gesetzlichen Mitgliederzahl umfassen,<br />
2. Stimmberechtigte, deren Beanstandung des Volksentscheids vom<br />
Landtag verworfen worden ist, wenn ihnen mindestens einhundert<br />
Stimmberechtigte beitreten,<br />
3. die Beauftragten der dem Volksentscheid unterstellten Volksbegehren.<br />
2<br />
Für das Verfahren gelten Art. 48 Abs. 2 bis 5 des <strong>Gesetze</strong>s über den<br />
Verfassungsgerichtshof entsprechend.<br />
Bay LWG Art. 81 Ausfertigung und Verkündung der <strong>Gesetze</strong><br />
Wird ein durch Volksbegehren verlangtes Gesetz durch Volksentscheid<br />
angenommen, so ist es als Gesetz auszufertigen und bekannt zu machen.<br />
Bay LWG Art. 82 Beteiligung des Beauftragten des Volksbegehrens in<br />
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof<br />
Der Verfassungsgerichtshof soll dem Beauftragten eines Volksbegehrens<br />
(Art. 63 Abs. 2) Gelegenheit zur Äußerung geben, wenn Gegenstand des<br />
verfassungsgerichtlichen Verfahrens eine Rechtsvorschrift ist, die im Weg eines<br />
durch Volksbegehren verlangten <strong>Gesetze</strong>s durch Volksentscheid angenommen<br />
worden ist.<br />
ABSCHNITT II Die Abberufung des Landtags durch das Volk<br />
Bay LWG Art. 83 Abberufung des Landtags durch das Volk<br />
Auf Antrag von einer Million Stimmberechtigter ist ein Volksentscheid über die<br />
Abberufung des Landtags herbeizuführen.<br />
Bay LWG Art. 84 Volksbegehren<br />
Für die Durchführung des Volksbegehrens finden Art. 63 bis 70, 71 Abs. 1,<br />
Art. 72, 73 Abs. 1 und 5 und Art. 74 entsprechende Anwendung.<br />
Bay LWG Art. 85 Volksentscheid<br />
Für die Durchführung des Volksentscheids finden Art. 75, 76 Abs. 1 und 3,<br />
Art. 77 Sätze 1 und 2, Art. 78 und 80 entsprechende Anwendung.
Bay LWG Art. 86 Ergebnis des Volksentscheids<br />
Zur Abberufung des Landtags durch Volksentscheid ist die Mehrheit der<br />
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.<br />
Bay LWG Art. 87 Vollzug der Abberufung<br />
Die Abberufung des Landtags ist durch seinen Präsidenten umgehend zu<br />
vollziehen.<br />
ABSCHNITT III Volksentscheid über Beschlüsse des Landtags auf<br />
Änderung der Verfassung<br />
Bay LWG Art. 88 Volksentscheid über Beschlüsse des Landtags auf<br />
Änderung der Verfassung<br />
(1) Vom Landtag beschlossene Verfassungsänderungen sind dem Volk zur<br />
Entscheidung vorzulegen.<br />
(2) Für die Durchführung des Volksentscheids finden die Art. 75, 76 Abs. 1<br />
und 3, Art. 77 Sätze 1 und 2, Art. 78, 80 und 81 entsprechende<br />
Anwendung.<br />
(3) Eine vom Landtag beschlossene Verfassungsänderung ist durch<br />
Volksentscheid angenommen, wenn sie mehr gültige Ja-Stimmen als Nein-<br />
Stimmen erhält.<br />
VIERTER TEIL Schlussbestimmungen<br />
Bay LWG Art. 89 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. entgegen Art. 9 ohne wichtigen Grund ein Ehrenamt ablehnt oder sich<br />
ohne genügende Entschuldigung den Pflichten eines solchen entzieht,<br />
2. entgegen Art. 12 Abs. 1 Abstimmende beeinflusst, behindert oder<br />
belästigt.<br />
(2) Mit Geldbuße bis zu 50 000 Euro kann belegt werden, wer entgegen<br />
Art. 12 Abs. 2 vor Ablauf der Abstimmungszeit Ergebnisse von<br />
Befragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der<br />
Abstimmungsentscheidung veröffentlicht.<br />
Bay LWG Art. 90 Fristen und Termine<br />
1 Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder<br />
ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf<br />
einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag<br />
fällt. 2 Eine behördliche Verlängerung von Fristen ist ebenso ausgeschlossen<br />
wie eine Wiedereinsetzung in den vorigen <strong>Stand</strong>.<br />
Bay LWG Art. 91 Wahlstatistik<br />
(1) Das Ergebnis der Wahlen zum Landtag ist statistisch zu bearbeiten.<br />
(2) 1 In den vom Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem<br />
Landeswahlleiter zu bestimmenden Stimmbezirken sind auch Statistiken<br />
über Geschlechter- und Altersgliederung der Stimmberechtigten und
Wähler unter Berücksichtigung der Stimmabgabe für die einzelnen<br />
Wahlkreisvorschläge zu erstellen. 2 Die Trennung der Abstimmung nach<br />
Geschlechtern und Altersgruppen ist nur zulässig, wenn die Stimmabgabe<br />
der einzelnen Wähler dadurch nicht erkennbar wird.<br />
Bay LWG Art. 92 Landeswahlordnung<br />
(1) 1 Das Staatsministerium des Innern erlässt durch Rechtsverordnung die<br />
zum Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlichen Vorschriften. 2 Es trifft darin<br />
insbesondere Bestimmungen über<br />
1. die Ernennung der Wahlleiter und Wahlvorsteher, die Bildung der<br />
Wahlausschüsse und Wahlvorstände sowie ihre Tätigkeit,<br />
Beschlussfähigkeit und ihr Verfahren,<br />
2. Ablehnungsgründe und Auslagenersatz bei Ehrenämtern,<br />
3. die Bildung der Stimmbezirke,<br />
4. die Voraussetzungen für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis,<br />
dessen Form und Inhalt, Berichtigung und Abschluss, über die Einsicht in<br />
das Wählerverzeichnis, über den Einspruch und die Beschwerde gegen das<br />
Wählerverzeichnis sowie über die Benachrichtigung der<br />
Stimmberechtigten,<br />
5. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung von Wahlscheinen<br />
sowie den Einspruch und die Beschwerde gegen deren Ablehnung,<br />
6. den Nachweis von Stimmrechtsvoraussetzungen,<br />
7. das Verfahren nach Art. 24 und 25,<br />
8. Einreichung, Inhalt und Form der Wahlkreisvorschläge sowie der<br />
dazugehörigen Unterlagen, ihre Prüfung, die Beseitigung von Mängeln,<br />
ihre Zulassung, die Beschwerde gegen Entscheidungen des<br />
Wahlkreisausschusses sowie die Bekanntmachung der<br />
Wahlkreisvorschläge,<br />
9. Form und Inhalt der Stimmzettel,<br />
10. Bereitstellung und Einrichtung der Abstimmungsräume,<br />
11. Bekanntmachungen zur Vorbereitung der Abstimmung, wobei eine von<br />
den Bekanntmachungsvorschriften der Gemeindeordnung abweichende<br />
Regelung getroffen werden kann,<br />
12. die Abstimmungszeit,<br />
13. die Stimmabgabe,<br />
14. die Briefwahl,<br />
15. die Abgabe und die Aufnahme von Versicherungen an Eides statt,<br />
16. die Stimmabgabe in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Klöstern<br />
und Justizvollzugsanstalten,<br />
17. die Feststellung und Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses,<br />
18. die Durchführung von Nachwahlen und Wiederholungswahlen,<br />
19. das Zulassungs- und Eintragungsverfahren für Volksbegehren.<br />
Bay LWG Art. 93 In-Kraft-Treten<br />
1 Dieses Gesetz ist dringlich. 2 Es tritt am 15. August 1954 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten des <strong>Gesetze</strong>s in der ursprünglichen<br />
Fassung vom 11. August 1954 (GVBl S. 177). Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren<br />
Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.
Gesetz über das Meldewesen (Bay<br />
MeldeG)<br />
vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 990), geändert durch Gesetz vom 10. April 2007 (GVBl. S. 267)<br />
(FN BayRS 210-3-I)<br />
Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen<br />
Bay MeldeG Artikel 1 Meldebehörden<br />
1 Meldebehörden sind die Gemeinden. 2 Sie nehmen die Aufgaben nach diesem<br />
Gesetz im übertragenen Wirkungskreis wahr. 3 In bewohnten gemeindefreien<br />
Gebieten werden die Aufgaben der Meldebehörden von einer angrenzenden<br />
Gemeinde, die von der Regierung durch Rechtsverordnung bestimmt wird,<br />
wahrgenommen.<br />
Bay MeldeG Artikel 2 Aufgaben und Befugnisse der Meldebehörden<br />
(1) 1 Die Meldebehörden haben die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften<br />
Personen (Einwohner) zu registrieren, um deren Identität und Wohnungen<br />
feststellen und nachweisen zu können. 2 Sie erteilen<br />
Melderegisterauskünfte, wirken bei der Durchführung von Aufgaben<br />
anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen mit und übermitteln<br />
Daten. 3 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führen die Meldebehörden<br />
Melderegister. 4 Diese enthalten Daten, die von den Einwohnern erhoben,<br />
von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen übermittelt oder sonst<br />
amtlich bekannt werden.<br />
(2) 1 Die Meldebehörden dürfen personenbezogene Daten, die im<br />
Melderegister gespeichert werden, nur nach Maßgabe dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
oder sonstiger Rechtsvorschriften erheben, verarbeiten oder nutzen.<br />
2<br />
Daten nicht meldepflichtiger Einwohner dürfen auf Grund einer Art. 15<br />
Abs. 2 bis 4 des Bayerischen Datenschutzgesetzes entsprechenden<br />
Einwilligung erhoben, verarbeitet und genutzt werden.<br />
Bay MeldeG Artikel 3 Speicherung von Daten<br />
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Art. 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 speichern<br />
die Meldebehörden folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer<br />
Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:<br />
1. Familiennamen,<br />
2. Vornamen,<br />
3. frühere Namen,<br />
4. Doktorgrad,<br />
5. Ordensnamen/Künstlernamen,<br />
6. Tag und Ort der Geburt,<br />
7. Geschlecht,<br />
8. gesetzliche Vertreter (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Tag der<br />
Geburt, Anschrift, Sterbetag),<br />
9. Staatsangehörigkeiten,<br />
10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft,
11. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung,<br />
bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland,<br />
12. Tag des Ein- und Auszugs,<br />
13. Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern zusätzlich Tag<br />
und Ort der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft,<br />
14. Ehegatte oder Lebenspartner (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad,<br />
Tag der Geburt, Anschrift, Sterbetag),<br />
15. minderjährige Kinder (Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt,<br />
Sterbetag),<br />
16. Ausstellungsbehörde, -datum, Gültigkeitsdauer und Seriennummer<br />
des Personalausweises/Passes,<br />
17. Übermittlungssperren,<br />
18. Sterbetag und -ort.<br />
(2) Über die in Abs. 1 genannten Daten hinaus speichern die Meldebehörden<br />
im Melderegister folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer<br />
Richtigkeit erforderlichen Hinweise:<br />
1. für die Vorbereitung von Wahlen und Abstimmungen die Tatsache, dass<br />
der Betroffene<br />
a) von der Wahlberechtigung oder der Wählbarkeit ausgeschlossen ist,<br />
b) als Unionsbürger (§ 6 Abs. 3 Satz 1 des Europawahlgesetzes) bei der<br />
Wahl des Europäischen Parlaments von Amts wegen in ein<br />
Wählerverzeichnis im Inland einzutragen ist; ebenfalls zu speichern ist die<br />
Gebietskörperschaft oder der Wahlkreis im Herkunftsmitgliedstaat, wo der<br />
Unionsbürger zuletzt in ein Wählerverzeichnis eingetragen war,<br />
2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten steuerrechtliche Daten<br />
(Steuerklasse, Freibeträge, rechtliche Zugehörigkeit des Ehegatten zu<br />
einer Religionsgesellschaft, Rechtsstellung und Zuordnung der Kinder,<br />
Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Stiefeltern),<br />
3. für die Ausstellung von Personalausweisen und Pässen die Tatsache,<br />
dass Passversagungsgründe vorliegen, ein Pass versagt oder entzogen<br />
oder eine Anordnung nach § 2 Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s über Personalausweise<br />
getroffen worden ist,<br />
4. für staatsangehörigkeitsrechtliche Verfahren die Tatsache, dass nach<br />
§ 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein Verlust der deutschen<br />
Staatsangehörigkeit eintreten kann,<br />
5. für die Erfüllung ihrer Aufgaben auf Grund des Personenstandsgesetzes<br />
und für die Erteilung von Auskünften nach Art. 32 Abs. 2 den Tag und den<br />
Ort der Eheschließung sowie die Tatsache, dass ein Familienbuch auf<br />
Antrag angelegt worden ist,<br />
6. zur Beantwortung von Aufenthaltsanfragen anderer Behörden und<br />
sonstiger öffentlicher Stellen für die Dauer von zwei Jahren die Tatsache<br />
der Aufenthaltsanfrage (Datum der Anfrage, anfragende Stelle,<br />
Aktenzeichen),<br />
7. für waffenrechtliche Verfahren die Tatsache, dass eine waffenrechtliche<br />
Erlaubnis erteilt worden ist sowie die diese Tatsache mitteilende Behörde<br />
mit Angabe des Tags der erstmaligen Erteilung,<br />
8. für Zwecke des Suchdienstes die Anschrift vom 1. September 1939<br />
derjenigen Einwohner, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des<br />
Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten stammen,<br />
9. für die Mitwirkung bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem
Wohnungsbindungsrecht, dem Gesetz über den Abbau der<br />
Fehlsubventionierung im Wohnungswesen und dem Gesetz über den<br />
Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen in Bayern die<br />
Tatsache, dass der Einwohner in einer nach dem Zweiten<br />
Wohnungsbaugesetz, nach dem Wohnraumförderungsgesetz oder nach<br />
dem Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz geförderten und noch<br />
gebundenen Wohnung wohnt,<br />
10. für Zwecke der eindeutigen Identifizierung in Besteuerungsverfahren<br />
die Identifikationsnummer nach § 139 b der Abgabenordnung, bis der<br />
Meldebehörde diese mitgeteilt wird, ein vorläufiges Bearbeitungsmerkmal,<br />
11. für sprengstoffrechtliche Verfahren die Tatsache, dass eine<br />
sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 des<br />
Sprengstoffgesetzes erteilt worden ist sowie die diese Tatsache<br />
mitteilende Behörde mit Angabe des Tags der erstmaligen Erteilung.<br />
Bay MeldeG Artikel 4 Ordnungsmerkmale<br />
(1) 1 Die Meldebehörden dürfen die Melderegister mit Hilfe von<br />
Ordnungsmerkmalen führen. 2 Diese dürfen die in Art. 3 Abs. 1 genannten<br />
Daten enthalten.<br />
(2) 1 Ordnungsmerkmale dürfen im Rahmen von Datenübermittlungen an<br />
Behörden, sonstige öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche<br />
Religionsgesellschaften übermittelt werden. 2 Soweit Ordnungsmerkmale<br />
gemäß Abs. 1 Satz 2 personenbezogene Daten enthalten, dürfen sie nur<br />
übermittelt werden, wenn dem Empfänger auch die im Ordnungsmerkmal<br />
enthaltenen personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen.<br />
3<br />
Ordnungsmerkmale dürfen vom Empfänger der Daten nur an die<br />
jeweilige Meldebehörde übermittelt werden. 4 Art. 28 Abs. 7 Sätze 1 und 2<br />
gelten entsprechend.<br />
(3) 1 Die Übermittlung von Ordnungsmerkmalen nach Abs. 1 an nichtöffentliche<br />
Stellen ist unzulässig. 2 Nicht-öffentliche Stellen dürfen diese<br />
Ordnungsmerkmale nicht erheben, verarbeiten oder nutzen.<br />
(4) Behörden und sonstige öffentliche Stellen dürfen Ordnungsmerkmale nach<br />
Abs. 1 nicht erheben.<br />
Bay MeldeG Artikel 5 Zweckbindung der Daten<br />
1<br />
Die Meldebehörden dürfen die in Art. 3 Abs. 2 bezeichneten Daten nur im<br />
Rahmen der dort genannten Zwecke verarbeiten oder nutzen. 2 Sie haben<br />
diese Daten nach der jeweiligen Zweckbestimmung gesondert zu speichern<br />
oder auf andere Weise sicherzustellen, dass sie nur nach Maßgabe des<br />
Satzes 1 verarbeitet oder genutzt werden. 3 Diese Daten dürfen nur insoweit<br />
zusammen mit den in Art. 3 Abs. 1 bezeichneten Daten verarbeitet oder<br />
genutzt werden, als dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.<br />
4<br />
Die Regelungen über Datenübermittlungen nach Art. 28 Abs. 3 und 4 bleiben<br />
unberührt mit der Maßgabe, dass<br />
1. die in Art. 3 Abs. 2 Nr. 1 genannten Daten nur an die mit der Vorbereitung<br />
und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen zuständigen Stellen und<br />
2. die in Art. 3 Abs. 2 Nr. 10 genannte Angabe nur an das Bundeszentralamt<br />
für Steuern übermittelt werden dürfen.
5 Die nach Satz 4 Nrn. 1 und 2 genannten Daten dürfen auch nach Art. 27<br />
Abs. 1 übermittelt werden.<br />
Bay MeldeG Artikel 6 Meldegeheimnis<br />
(1) Den bei Meldebehörden oder anderen Stellen, die im Auftrag der<br />
Meldebehörden handeln, beschäftigten Personen ist es untersagt,<br />
personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu<br />
nutzen.<br />
(2) 1 Bei Personen, die bei Stellen beschäftigt sind, die im Auftrag der<br />
Meldebehörden handeln, ist sicherzustellen, dass sie nach Maßgabe von<br />
Abs. 1 verpflichtet werden. 2 Ihre Pflichten bestehen auch nach<br />
Beendigung ihrer Tätigkeit fort.<br />
(3) Die in Abs. 2 genannten Personen sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit über<br />
ihre Pflichten zu belehren und schriftlich auf die Einhaltung des<br />
Meldegeheimnisses zu verpflichten.<br />
Zweiter Abschnitt Schutzrechte<br />
Bay MeldeG Artikel 7 Schutzwürdige Interessen der Betroffenen<br />
1 Schutzwürdige Interessen der Betroffenen dürfen durch die Erhebung,<br />
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten nicht beeinträchtigt<br />
werden. 2 Schutzwürdige Interessen werden insbesondere beeinträchtigt, wenn<br />
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, gemessen an ihrer Eignung und<br />
ihrer Erforderlichkeit zu dem vorgesehenen Zweck, die Betroffenen<br />
unverhältnismäßig belastet. 3 Die Prüfung, ob schutzwürdige Interessen der<br />
Betroffenen beeinträchtigt werden, entfällt, wenn die Erhebung, Verarbeitung<br />
oder Nutzung durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist.<br />
Bay MeldeG Artikel 8 Rechte der Betroffenen<br />
Der Betroffene hat gegenüber der Meldebehörde nach Maßgabe dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s ein Recht auf kostenfreie<br />
1. Auskunft nach Art. 9,<br />
2. Berichtigung und Ergänzung nach Art. 10,<br />
3. Löschung nach Art. 11 Abs. 1 und 2,<br />
4. Unterrichtung nach Art. 31 Abs. 4 Satz 2,<br />
5. Speicherung von Übermittlungs- und Auskunftssperren nach Art. 29 Abs. 2<br />
Satz 3, Art. 31 Abs. 3 Satz 3, Abs. 7 und 8, Art. 32 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2<br />
Satz 1 und Abs. 3 Satz 2.<br />
Bay MeldeG Artikel 9 Auskunft an den Betroffenen<br />
(1) Die Meldebehörde hat dem Betroffenen auf Antrag Auskunft zu erteilen<br />
über<br />
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten und Hinweise, auch soweit sie<br />
sich auf deren Herkunft beziehen,<br />
2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von regelmäßigen<br />
Datenübermittlungen sowie die Arten der zu übermittelnden Daten,<br />
3. die Zwecke und die Rechtsgrundlagen der Speicherung und von<br />
regelmäßigen Datenübermittlungen.
(2) 1 Die Auskunft kann auch im Weg des automatisierten Abrufs über das<br />
Internet erteilt werden. 2 Dabei ist zu gewährleisten, dass dem jeweiligen<br />
<strong>Stand</strong> der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von<br />
Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die<br />
Vertraulichkeit und die Unversehrtheit der im Melderegister gespeicherten<br />
und an den Betroffenen übermittelten Daten gewährleisten. 3 Der<br />
Nachweis der Urheberschaft des Antrags ist durch eine qualifizierte<br />
elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz zu führen. 4 Art. 31<br />
Abs. 2 und Abs. 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.<br />
(3) Die Auskunft unterbleibt, soweit<br />
1. sie die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der<br />
Meldebehörde liegenden Aufgaben oder die öffentliche Sicherheit oder<br />
Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes<br />
Nachteile bereiten würde, oder<br />
2. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer<br />
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der<br />
überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten<br />
werden müssen<br />
und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung<br />
zurücktreten muss.<br />
(4) Die Auskunft unterbleibt ferner,<br />
1. soweit dem Betroffenen die Einsicht in einen Eintrag im Geburten- oder<br />
Familienbuch nach § 61 Abs. 2 des Personenstandsgesetzes nicht<br />
gestattet werden darf,<br />
2. in den Fällen des § 1758 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.<br />
(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf Daten, die der Meldebehörde von<br />
Verfassungsschutzbehörden, dem Bundesnachrichtendienst oder dem<br />
Militärischen Abschirmdienst übermittelt worden sind, ist sie nur mit<br />
Zustimmung dieser Stellen zulässig.<br />
(6) 1 Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit<br />
durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die<br />
Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte<br />
Zweck gefährdet würde. 2 In diesem Fall ist der Betroffene darauf<br />
hinzuweisen, dass er sich an die für die Kontrolle der Einhaltung der<br />
Datenschutzbestimmungen bei der Meldebehörde zuständige Stelle<br />
wenden kann.<br />
(7) 1 Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen<br />
der in Abs. 6 Satz 2 bezeichneten Stelle zu erteilen, soweit nicht das<br />
Staatsministerium des Innern im Einzelfall feststellt, dass dadurch die<br />
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. 2 Die Mitteilung<br />
der für die Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bei der<br />
Meldebehörde zuständigen Stelle an den Betroffenen darf keine<br />
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle<br />
zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.<br />
Bay MeldeG Artikel 10 Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters<br />
(1) 1 Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat es die<br />
Meldebehörde von Amts wegen oder auf Antrag des Betroffenen zu<br />
berichtigen oder zu ergänzen (Fortschreibung). 2 Dies gilt insbesondere,
wenn ein Einwohner seine Verpflichtungen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 oder<br />
Art. 15 Abs. 4 nicht erfüllt hat. 3 Von der Fortschreibung sind unverzüglich<br />
diejenigen Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten,<br />
denen im Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen unrichtige oder<br />
unvollständige Daten übermittelt worden sind.<br />
(2) 1 Die in Abs. 1 Satz 3 genannten Stellen haben, soweit sie nicht Aufgaben<br />
der amtlichen Statistik wahrnehmen oder öffentlich-rechtliche<br />
Religionsgesellschaften sind, die Meldebehörden unverzüglich zu<br />
unterrichten, wenn ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit<br />
oder Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. 2 Sonstige<br />
öffentliche Stellen, denen auf ihr Ersuchen hin Meldedaten übermittelt<br />
worden sind, dürfen die Meldebehörden bei Vorliegen solcher<br />
Anhaltspunkte unterrichten. 3 Gesetzliche Geheimhaltungspflichten,<br />
insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, und<br />
Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse stehen der Unterrichtung nach<br />
Sätze 1 und 2 nicht entgegen, soweit sie sich auf die Angabe beschränkt,<br />
dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit<br />
übermittelter Daten vorliegen.<br />
(3) Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 sind bei der Weitergabe von Daten und<br />
Hinweisen nach Art. 28 Abs. 7 entsprechend anzuwenden.<br />
Bay MeldeG Artikel 11 Löschung und Aufbewahrung von Daten und<br />
Meldescheinen<br />
(1) Die Meldebehörde hat gespeicherte Daten zu löschen, wenn sie zur<br />
Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden nicht mehr erforderlich sind<br />
oder ihre Speicherung unzulässig war.<br />
(2) 1 Daten eines weggezogenen oder verstorbenen Einwohners sind<br />
unverzüglich zu löschen, die Daten nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2<br />
Nr. 2 jedoch erst nach Ablauf des auf den Tod oder den Wegzug folgenden<br />
Kalenderjahres. 2 Daten nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 8 sind unverzüglich nach<br />
der Übermittlung an die Suchdienste zu löschen.<br />
(3) 1 Abweichend von Abs. 2 Satz 1 hat die Meldebehörde nach dem Wegzug<br />
oder dem Tod eines Einwohners die Daten nach Art. 3 Abs. 1, Abs. 2<br />
Nrn. 1 und 4 weiterhin zu speichern. 2 Nach Ablauf von fünf Jahren nach<br />
dem Wegzug oder dem Tod eines Einwohners sind sie für die Dauer von<br />
fünfzig Jahren gesondert aufzubewahren und durch technische und<br />
organisatorische Maßnahmen zu sichern. 3 Während dieser Zeit dürfen sie<br />
mit Ausnahme der Vor- und Familiennamen sowie etwaiger früherer<br />
Namen, des Tags und des Orts der Geburt, der gegenwärtigen und<br />
früheren Anschriften, des Auszugstags und des Sterbetags und -orts nicht<br />
mehr verarbeitet oder genutzt werden, es sei denn, dass dies zu<br />
wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot,<br />
zur Aufgabenerfüllung der in Art. 28 Abs. 4 genannten Behörden, für<br />
Wahlzwecke oder zur Feststellung der Tatsache nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 4<br />
unerlässlich ist oder die Person, deren Daten gespeichert sind, schriftlich<br />
eingewilligt hat. 4 Nach Ablauf dieser Frist sind die Daten zu löschen.<br />
(4) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung das<br />
Nähere über das Verfahren der Löschung, der gesonderten Aufbewahrung
und die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 3 sowie die<br />
Dauer der Aufbewahrung von Meldescheinen zu bestimmen.<br />
(5) Ist eine Löschung im Fall des Abs. 1 wegen der besonderen Art der<br />
Speicherung im Melderegister nicht oder nur mit unverhältnismäßig<br />
hohem Aufwand möglich, ist durch technische oder organisatorische<br />
Maßnahmen sicherzustellen, dass die Daten nicht mehr verarbeitet oder<br />
genutzt werden.<br />
Bay MeldeG Artikel 12 Archive<br />
(1) In den Fällen des Art. 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 4 kann die<br />
Meldebehörde die Daten und die zum Nachweis ihrer Richtigkeit<br />
gespeicherten Hinweise vor der Löschung dem zuständigen Archiv zur<br />
Übernahme anbieten, soweit dort ausreichende Datenschutzmaßnahmen<br />
getroffen sind.<br />
(2) An Stelle der gesonderten Aufbewahrung gemäß Art. 11 Abs. 3 Satz 2<br />
kann die Meldebehörde die Daten dem zuständigen Archiv zur Verwahrung<br />
anbieten, soweit dort ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen<br />
sind und die Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden im Rahmen des<br />
Art. 11 Abs. 3 Satz 3 gewährleistet bleibt.<br />
Dritter Abschnitt Meldepflichten<br />
Bay MeldeG Artikel 13 Allgemeine Meldepflicht<br />
(1) Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb einer Woche bei der<br />
Meldebehörde anzumelden.<br />
(2) Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Wohnung im Inland<br />
bezieht, hat sich innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde<br />
abzumelden.<br />
(3) 1 Die Pflicht zur An- oder Abmeldung obliegt demjenigen, der eine<br />
Wohnung bezieht oder aus einer Wohnung auszieht. 2 Für Personen bis<br />
zum vollendeten 16. Lebensjahr obliegt die Pflicht den gesetzlichen<br />
Vertretern; bei Beziehen der Wohnung eines Personensorgeberechtigten<br />
genügt es, wenn dieser die An- oder Abmeldung vornimmt. 3 Für<br />
Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, der den Aufenthalt bestimmen<br />
kann, obliegt die Meldepflicht dem Betreuer. 4 Eine Person kann sich bei<br />
der An- oder Abmeldung durch eine hierzu bevollmächtigte Person<br />
vertreten lassen; in diesem Fall muss die Vollmacht öffentlich oder nach<br />
§ 6 Abs. 2 des Betreuungsbehördengesetzes durch die Urkundsperson bei<br />
der Betreuungsbehörde beglaubigt sein.<br />
(4) Neugeborene, die in der Bundesrepublik Deutschland geboren werden,<br />
sind nur anzumelden, wenn sie in eine andere als in die Wohnung der<br />
Eltern oder der Mutter aufgenommen werden.<br />
Bay MeldeG Artikel 14 Begriff der Wohnung<br />
1 Wohnung im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist jeder umschlossene Raum, der zum<br />
Wohnen oder Schlafen benutzt wird. 2 Als Wohnung gilt auch die Unterkunft an<br />
Bord eines Schiffs der Bundeswehr. 3 Wohnwagen und Wohnschiffe sind nur
dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich<br />
fortbewegt werden. 4 Art. 20 bleibt unberührt.<br />
Bay MeldeG Artikel 15 Mehrere Wohnungen<br />
(1) Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Inland, so ist eine dieser<br />
Wohnungen seine Hauptwohnung.<br />
(2) 1 Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners.<br />
2<br />
Hauptwohnung eines verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft<br />
führenden Einwohners, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie oder<br />
seinem Lebenspartner lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der<br />
Familie oder der Lebenspartner. 3 Hauptwohnung eines minderjährigen<br />
Einwohners ist die Wohnung der Personensorgeberechtigten; leben diese<br />
getrennt, ist Hauptwohnung die Wohnung des Personensorgeberechtigten,<br />
die von dem Minderjährigen vorwiegend benutzt wird. 4 Auf Antrag eines<br />
Einwohners, der in einer Einrichtung für behinderte Menschen<br />
untergebracht ist, bleibt die Wohnung nach Satz 3 bis zur Vollendung des<br />
27. Lebensjahres seine Hauptwohnung. 5 In Zweifelsfällen ist die<br />
vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der<br />
Lebensbeziehungen des Einwohners liegt. 6 Kann der Wohnungsstatus<br />
eines verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft führenden Einwohners<br />
nach den Sätzen 2 und 5 nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ist die<br />
Hauptwohnung die Wohnung nach Satz 1.<br />
(3) Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners.<br />
(4) 1 Der Einwohner hat bei jeder An- oder Abmeldung mitzuteilen, welche<br />
weiteren Wohnungen er hat und welche Wohnung seine Hauptwohnung<br />
ist. 2 Er hat der Meldebehörde der neuen Hauptwohnung jede Änderung<br />
der Hauptwohnung mitzuteilen.<br />
Bay MeldeG Artikel 16 Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht<br />
(1) 1 Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, hat der Meldepflichtige<br />
einen Meldeschein (Art. 17) auszufüllen, zu unterschreiben und der<br />
Meldebehörde zuzuleiten. 2 Hat die Meldebehörde für die Anmeldung einen<br />
Internet-Zugang eröffnet, kann sich der Meldepflichtige unter den<br />
Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 2 Sätze 2 und 3 über diesen Zugang<br />
anmelden.<br />
(2) 1 Der Meldepflichtige kann die Meldebehörde des neuen Wohnorts<br />
(Zuzugsmeldebehörde) bei einer Anmeldung ermächtigen, die über ihn bei<br />
der Meldebehörde des bisherigen Wohnorts (Wegzugsmeldebehörde)<br />
gespeicherten Daten des Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 10 elektronisch<br />
anzufordern (vorausgefüllter Meldeschein), sofern Zuzugs- und<br />
Wegzugsmeldebehörde eine Anmeldung durch vorausgefüllten<br />
Meldeschein zugelassen haben. 2 Dazu gibt der Meldepflichtige Namen,<br />
Vornamen, Geburtsdatum und -ort sowie die letzte Wohnanschrift an, die<br />
die Zuzugsmeldebehörde der Wegzugsmeldebehörde übermittelt. 3 Die<br />
Wegzugsmeldebehörde stellt die Daten des Meldepflichtigen der<br />
Zuzugsmeldebehörde elektronisch unverzüglich zur Verfügung, wenn sie<br />
dazu technisch in der Lage und daran nicht aus rechtlichen Gründen<br />
gehindert ist. 4 Art. 9 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 5 Der<br />
Meldepflichtige hat die übermittelten Angaben auf ihre Richtigkeit zu
prüfen, zu korrigieren oder zu ergänzen und den so berichtigten<br />
vorausgefüllten Meldeschein unterschrieben oder mit einer qualifizierten<br />
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen der<br />
Zuzugsmeldebehörde zu übermitteln. 6 Zieht der Meldepflichtige aus<br />
Bayern weg, gelten Sätze 1 und 3 entsprechend, wenn das <strong>Landesrecht</strong><br />
der Zuzugsmeldebehörde die Anmeldung durch vorausgefüllten<br />
Meldeschein zulässt und die Zuzugsmeldebehörde die Daten nach § 2<br />
Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes anfordert. 7 Zieht der<br />
Meldepflichtige nach Bayern, gelten Sätze 1, 2 und 5 mit der Maßgabe<br />
entsprechend, dass die Zuzugsmeldebehörde die Daten nach § 2 Abs. 1<br />
des Melderechtsrahmengesetzes bei der außerbayerischen<br />
Wegzugsmeldebehörde anfordert, falls das <strong>Landesrecht</strong> der<br />
Wegzugsmeldebehörde dieses Anmeldeverfahren zulässt und die<br />
Wegzugsmeldebehörde es anbietet.<br />
(3) Wird das Melderegister automatisch geführt, kann von dem Ausfüllen des<br />
Meldescheins abgesehen werden, wenn der Meldepflichtige persönlich bei<br />
der Meldebehörde erscheint und einen Ausdruck der Daten erhält, die von<br />
ihm erhoben werden.<br />
(4) 1 Ehegatten, Eltern, Kinder und Lebenspartner mit denselben bisherigen<br />
und künftigen Wohnungen sollen gemeinsam einen Meldeschein<br />
verwenden; es genügt, wenn einer der Meldepflichtigen den Meldeschein<br />
unterschreibt oder die Angaben mit einer qualifizierten elektronischen<br />
Signatur nach dem Signaturgesetz versieht. 2 Abs. 2 findet entsprechende<br />
Anwendung, wenn der Meldepflichtige versichert, zum Empfang der Daten<br />
der übrigen Meldepflichtigen berechtigt zu sein. 3 Er ist darüber zu<br />
belehren, dass der unberechtigte Empfang unter Vorspiegelung einer<br />
Berechtigung nach § 202 a des Strafgesetzbuchs strafbewehrt ist.<br />
(5) Der Meldepflichtige erhält eine kostenfreie schriftliche oder elektronische<br />
Anmeldebestätigung.<br />
Bay MeldeG Artikel 17 Meldeschein<br />
(1) Bei der An- oder Abmeldung oder der Änderung des Wohnungsstatus<br />
dürfen vom Meldepflichtigen die Daten des Art. 3 Abs. 1 Nrn. 1 bis 17,<br />
Abs. 2 Nrn. 2, 4, 5 und 8 erhoben werden.<br />
(2) Die amtliche Meldebestätigung (Art. 16 Abs. 5) darf folgende Daten<br />
enthalten:<br />
1. Familiennamen,<br />
2. Vornamen,<br />
3. Doktorgrad,<br />
4. Anschrift,<br />
5. Tag des Ein- und Auszugs.<br />
(3) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung die<br />
Muster der Meldescheine für die Meldungen nach Art. 13 Abs. 1 und 2, die<br />
Anzahl der Ausfertigungen sowie die Muster der Meldebestätigungen zu<br />
bestimmen.
Bay MeldeG Artikel 18 Auskunftspflicht des Meldepflichtigen<br />
Der Meldepflichtige hat der Meldebehörde auf Verlangen die zur<br />
ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters (Art. 3) erforderlichen<br />
Auskünfte zu erteilen, die zum Nachweis der Angaben erforderlichen<br />
Unterlagen vorzulegen und persönlich zu erscheinen; im Fall des Art. 13 Abs. 3<br />
Satz 4 trifft die Pflicht den Bevollmächtigten, soweit die Vollmacht reicht.<br />
Bay MeldeG Artikel 19 Auskunftspflicht und Auskunftsrecht des<br />
Wohnungsgebers<br />
(1) 1 Die Meldebehörde kann vom Wohnungsgeber oder seinem Beauftragten<br />
Auskunft darüber verlangen, welche Personen bei ihm wohnen oder<br />
gewohnt haben. 2 Der Wohnungsgeber ist nicht verpflichtet, besondere<br />
Aufzeichnungen zu führen oder Nachforschungen anzustellen. 3 Für die in<br />
Art. 20 genannten Personen kann die Meldebehörde die Auskunft vom<br />
Schiffseigner oder Reeder verlangen.<br />
(2) Die Meldebehörde hat dem Eigentümer der Wohnung und, wenn dieser<br />
nicht Wohnungsgeber ist, auch dem Wohnungsgeber Auskunft über Vorund<br />
Familiennamen sowie Doktorgrade der in seiner Wohnung gemeldeten<br />
Personen zu erteilen, wenn Eigentümer und Wohnungsgeber hierfür ein<br />
rechtliches Interesse glaubhaft machen.<br />
Bay MeldeG Artikel 20 Binnenschiffer und Seeleute<br />
(1) 1 Wer auf ein Binnenschiff zieht, das in einem Schiffsregister in der<br />
Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist, hat sich bei der<br />
Meldebehörde des Heimatorts des Schiffs anzumelden. 2 Die Vorschriften<br />
zur allgemeinen Meldepflicht sowie zur Auskunftspflicht des<br />
Meldepflichtigen gelten entsprechend. 3 Die Meldepflicht besteht nicht,<br />
solange die Person im Inland für eine Wohnung nach Art. 13 Abs. 1<br />
gemeldet ist.<br />
(2) 1 Der Reeder eines Seeschiffs, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu<br />
führen, hat den Kapitän und die Besatzungsmitglieder des Schiffs bei<br />
Beginn des Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses<br />
anzumelden. 2 Er hat diese Personen bei Beendigung des Anstellungs-,<br />
Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses abzumelden. 3 Zuständig ist die<br />
Meldebehörde am Sitz des Reeders. 4 Die Meldepflicht besteht nicht für<br />
Personen, die im Inland für eine Wohnung nach Art. 13 Abs. 1 gemeldet<br />
sind. 5 Die zu meldenden Personen haben dem Reeder die erforderlichen<br />
Auskünfte zu geben.<br />
Bay MeldeG Artikel 21 Befreiung von der Meldepflicht<br />
1 Von der Meldepflicht nach Art. 13 Abs. 1 und 2 sind befreit<br />
1. Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission oder einer<br />
ausländischen konsularischen Vertretung und die mit ihnen im gemeinsamen<br />
Haushalt lebenden Familienmitglieder, falls die genannten Personen weder die<br />
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen noch im Inland ständig ansässig sind<br />
noch dort eine private Erwerbstätigkeit ausüben,<br />
2. Personen, für die diese Befreiung in völkerrechtlichen Übereinkünften<br />
festgelegt ist.
2 Die Befreiung von der Meldepflicht nach Satz 1 Nr. 1 tritt nur ein, wenn die<br />
Gegenseitigkeit besteht.<br />
Bay MeldeG Artikel 22 Ausnahmen von der Meldepflicht<br />
(1) Eine Meldepflicht nach Art. 13 Abs. 1 und 2 wird nicht begründet für<br />
1. Einwohner, die für eine Wohnung im Inland gemeldet sind, wenn sie<br />
eine Gemeinschaftsunterkunft oder eine andere dienstlich bereitgestellte<br />
Unterkunft beziehen, um Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder<br />
Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz zu leisten oder um eine<br />
Dienstleistung nach dem Soldatengesetz zu erbringen,<br />
2. Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Beamte der Bundespolizei, die<br />
aus dienstlichen Gründen für eine Dauer von bis zu sechs Monaten eine<br />
Gemeinschaftsunterkunft oder eine andere dienstlich bereitgestellte<br />
Unterkunft beziehen und für eine andere Wohnung im Inland gemeldet<br />
sind,<br />
3. Angehörige der Polizei, die, ohne aus der bisherigen Wohnung<br />
auszuziehen, eine Gemeinschaftsunterkunft beziehen,<br />
4. Angehörige des öffentlichen Dienstes, die zum Zweck der Aus- und<br />
Fortbildung an Lehrgängen oder Fachstudien teilnehmen und, ohne aus<br />
der bisherigen Wohnung auszuziehen, eine vom Dienstherrn oder von der<br />
Aus- oder Fortbildungsstelle bereitgestellte Unterkunft beziehen.<br />
(2) 1 Einer Meldepflicht nach Art. 13 Abs. 1 und 2 unterliegt nicht, wer<br />
1. in der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 13 oder nach Art. 20<br />
gemeldet ist und zum Zweck eines nicht länger als zwei Monate<br />
dauernden Aufenthalts eine weitere Wohnung bezieht, oder<br />
2. sonst im Ausland wohnt und sich als ausländischer Saisonarbeitnehmer<br />
nicht länger als zwei Monate in Deutschland aufhält.<br />
2<br />
Nach Ablauf der in Satz 1 bestimmten Fristen, hat sich der Betroffene<br />
innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde anzumelden (Art. 13 Abs. 1).<br />
3<br />
Satz 1 gilt nicht für Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen, soweit<br />
sie nach § 8 des Bundesvertriebenengesetzes mitverteilt werden, und<br />
Ausländer, soweit sie in einer Aufnahmeeinrichtung oder einer sonstigen<br />
Durchgangsunterkunft wohnen.<br />
(3) 1 Meldepflichten nach Art. 13 Abs. 1 und 2 werden ferner nicht begründet<br />
durch den Vollzug einer richterlichen Entscheidung über die<br />
Freiheitsentziehung, solange der Meldepflichtige für eine andere Wohnung<br />
in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet oder der Aufenthalt nur von<br />
kurzer Dauer ist. 2 Für Personen, die nicht für eine solche Wohnung<br />
gemeldet sind, hat der Leiter der Anstalt der für den Sitz der Anstalt<br />
zuständigen Meldebehörde die Aufnahme und die Entlassung mitzuteilen.<br />
3<br />
Die Mitteilung enthält die in den Meldescheinen (Art. 17 Abs. 3)<br />
vorgesehenen Daten, soweit sie der Anstalt bekannt sind. 4 Sätze 1 bis 3<br />
gelten nicht, wenn die Voraussetzungen des Art. 25 vorliegen. 5 Die<br />
Meldebehörde darf Daten nach den Sätzen 2 und 3 nur übermitteln, wenn<br />
sie durch Prüfung im Einzelfall festgestellt hat, dass durch die<br />
Übermittlung keine schutzwürdigen Interessen des Betroffenen<br />
beeinträchtigt werden; Art. 27 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 6 Vor<br />
Melderegisterauskünften ist der Betroffene zu hören.
Bay MeldeG Artikel 23 Beherbergungsstätten<br />
(1) 1 Wer in Einrichtungen, die der gewerbs- oder geschäftsmäßigen<br />
Beherbergung von fremden Personen dienen (Beherbergungsstätten), für<br />
nicht länger als zwei Monate aufgenommen wird, unterliegt nicht den<br />
Meldepflichten nach Art. 13 Abs. 1 und 2. 2 Sobald der Aufenthalt die<br />
Dauer von zwei Monaten überschreitet, hat der Betreffende sich innerhalb<br />
einer Woche bei der Meldebehörde anzumelden.<br />
(2) 1 Die nach Abs. 1 Satz 1 beherbergten Personen haben am Tag der<br />
Ankunft einen besonderen Meldeschein (Art. 24) handschriftlich<br />
auszufüllen und zu unterschreiben. 2 Mitreisende Ehegatten oder<br />
Lebenspartner können auf dem Meldeschein gemeinsam aufgeführt<br />
werden, der von einem von ihnen auszufüllen und zu unterschreiben ist.<br />
3<br />
Minderjährige Kinder in Begleitung eines Elternteils sind nur der Zahl<br />
nach anzugeben. 4 Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen<br />
trifft die Verpflichtung nach Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die<br />
Mitreisenden der Zahl nach unter Angabe ihrer Staatsangehörigkeit<br />
anzugeben. 5 Nimmt eine Person, die bereits einen besonderen<br />
Meldeschein nach Satz 1 ausgefüllt hatte, innerhalb von zwei Jahren<br />
erneut Unterkunft in der Beherbergungsstätte, genügt es, wenn sie einen<br />
mit den Angaben des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 versehenen besonderen<br />
Meldeschein handschriftlich unterschreibt, sofern die Verantwortlichen der<br />
Beherbergungsstätte auch den von der beherbergten Person<br />
handschriftlich ausgefüllten und unterschriebenen besonderen Meldeschein<br />
bereit halten; Gleiches gilt für weitere Aufnahmen, sofern sie jeweils<br />
innerhalb von weiteren zwei Jahren erfolgen.<br />
(3) Beherbergte Ausländer, die nach Abs. 2 namentlich auf dem Meldeschein<br />
aufzuführen sind, haben sich bei der Anmeldung gegenüber den Leitern<br />
der Beherbergungsstätte oder ihren Beauftragten durch die Vorlage eines<br />
gültigen Identitätsdokuments (Pass, Personalausweis oder ein anderes<br />
Passersatzpapier) auszuweisen.<br />
(4) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn Personen in Zelten, Wohnwagen<br />
oder Wasserfahrzeugen auf Plätzen übernachten, die gewerbs- oder<br />
geschäftsmäßig überlassen werden.<br />
(5) Abs. 2 und 3 gelten nicht für<br />
1. Einrichtungen mit Heimunterbringung, die der Erwachsenenbildung, der<br />
Ausbildung oder der Fortbildung dienen,<br />
2. Betriebs- oder Vereinsheime, wenn dort nur Betriebs- oder<br />
Vereinsmitglieder und deren Familienangehörige beherbergt werden,<br />
3. Jugendherbergen des “Deutschen Jugendherbergswerks e. V.” und<br />
Berghütten, ferner zeitweilig belegte Einrichtungen der öffentlichen oder<br />
öffentlich anerkannten Träger der Jugendarbeit,<br />
4. Niederlassungen von Orden, Kongregationen, Gemeinschaften ohne<br />
kirchenamtliche Gelübde und Säkularinstituten der öffentlich-rechtlichen<br />
Religionsgesellschaften sowie deren Exerzitienhäuser.
Bay MeldeG Artikel 24 Besondere Meldescheine für<br />
Beherbergungsstätten<br />
(1) 1 Die Leiter von Beherbergungsstätten oder ihre Beauftragten haben auf<br />
die Erfüllung der Meldepflichten ihrer Gäste hinzuwirken und besondere<br />
Meldescheine nach Abs. 2 bereitzuhalten. 2 Legen beherbergte Gäste<br />
entgegen Art. 23 Abs. 3 kein oder kein gültiges Identitätsdokument vor,<br />
so ist dies auf dem Meldeschein zu vermerken.<br />
(2) 1 Die besonderen Meldescheine müssen Angaben enthalten über<br />
1. den Tag der Ankunft und den der voraussichtlichen Abreise,<br />
2. den Familiennamen,<br />
3. den gebräuchlichen Vornamen (Rufnamen),<br />
4. den Tag der Geburt,<br />
5. die Anschrift,<br />
6. die Staatsangehörigkeiten.<br />
2<br />
Die Leiter von Beherbergungsstätten oder ihre Beauftragten haben in<br />
den Fällen des Art. 23 Abs. 3 die im Meldeschein gemachten Angaben mit<br />
denen des Identitätsdokuments zu vergleichen. 3 Ergeben sich hierbei<br />
Abweichungen, ist dies auf dem Meldeschein zu vermerken.<br />
(3) 1 Soweit es zur Erhebung des Fremdenverkehrs- oder Kurbeitrags gemäß<br />
Art. 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes oder der Kurtaxe gemäß<br />
Art. 24 des Kostengesetzes erforderlich ist, haben die Leiter der<br />
Beherbergungsstätten oder ihre Beauftragten auf dem Meldeschein den<br />
Tag der tatsächlichen Abreise zu vermerken. 2 Sie können ferner die für<br />
Zwecke der Beherbergungs- und Fremdenverkehrsstatistiken<br />
erforderlichen Angaben auf dem Meldeschein vermerken.<br />
(4) Die Meldescheine sind von der Beherbergungsstätte ein Jahr<br />
aufzubewahren, für die Polizei und die Meldebehörde zur Einsichtnahme<br />
bereitzuhalten sowie ihnen auf Verlangen auszuhändigen, vor unbefugter<br />
Einsichtnahme zu sichern und nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer<br />
binnen angemessener Frist zu vernichten, soweit sie nicht nach Art. 23<br />
Abs. 2 Satz 5 oder Art. 26 Abs. 1 Satz 3 genutzt werden.<br />
(5) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung das<br />
Nähere über die Muster der besonderen Meldescheine, die Zahl der<br />
Ausfertigungen sowie über ihre Bereithaltung für die Polizei und die<br />
Meldebehörde zu bestimmen.<br />
Bay MeldeG Artikel 25 Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen<br />
(1) 1 Wer in Krankenhäuser, Pflegeheime oder sonstige Einrichtungen, die der<br />
Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen, der<br />
Rehabilitation oder der Heimerziehung dienen, aufgenommen wird,<br />
braucht sich nicht anzumelden, solange er für eine andere Wohnung im<br />
Inland gemeldet ist. 2 Wer nicht für eine solche Wohnung gemeldet ist, hat<br />
sich innerhalb einer Woche anzumelden, sobald sein Aufenthalt die Dauer<br />
von zwei Monaten überschreitet. 3 Für Personen, die ihrer Meldepflicht<br />
wegen Gebrechlichkeit nicht nachkommen können, sind die Leiter der<br />
Einrichtungen oder ihre Beauftragten meldepflichtig. 4 Art. 13 Abs. 3<br />
Sätze 3 und 4 bleiben unberührt. 5 Die Meldebehörden dürfen die Daten
der nach Satz 2 meldepflichtigen Personen nur nach Maßgabe des Art. 22<br />
Abs. 3 Sätze 5 und 6 übermitteln.<br />
(2) 1 Die in Einrichtungen nach Abs. 1 aufgenommenen Personen haben den<br />
Leitern dieser Einrichtungen oder ihren Beauftragten die erforderlichen<br />
Angaben über ihre Identität zu machen. 2 Die Leiter der Einrichtungen<br />
oder ihre Beauftragten sind verpflichtet, diese Angaben unverzüglich in ein<br />
Verzeichnis aufzunehmen. 3 Der Polizei und den Staatsanwaltschaften ist<br />
hieraus Auskunft zu erteilen, wenn dies nach ihrer Feststellung zur Abwehr<br />
einer erheblichen und gegenwärtigen Gefahr, zur Verfolgung von<br />
Straftaten oder zur Aufklärung des Schicksals von Vermissten und<br />
Unfallopfern im Einzelfall erforderlich ist.<br />
(3) Das Verzeichnis muss Angaben enthalten über<br />
1. den Familiennamen,<br />
2. den gebräuchlichen Vornamen (Rufnamen),<br />
3. den Tag und den Ort der Geburt,<br />
4. die Anschrift.<br />
(4) An die Stelle eines Verzeichnisses nach Abs. 2 können sonstige Unterlagen<br />
der dort genannten Einrichtungen treten, wenn sie die Daten des Abs. 3<br />
enthalten.<br />
(5) 1 Die Verzeichnisse nach Abs. 2 sind nach der Entlassung der<br />
aufgenommenen Personen ein Jahr aufzubewahren und dann zu<br />
vernichten. 2 Die Aufbewahrungsfrist gilt für sonstige Unterlagen nach<br />
Abs. 4 entsprechend.<br />
(6) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung<br />
Muster der Verzeichnisse nach Abs. 2 zu bestimmen und vorzuschreiben,<br />
dass Einrichtungen im Sinn des Abs. 1 Satz 1 die Gesamtzahl der<br />
aufgenommenen Personen, deren Aufenthalt zwei Monate überschreitet,<br />
der Meldebehörde am Sitz der Anstalt regelmäßig mitzuteilen haben.<br />
Bay MeldeG Artikel 26 Nutzungsbeschränkungen<br />
(1) 1 Die nach Art. 23 Abs. 2 erhobenen und die gemäß Art. 24 Abs. 2 Satz 3<br />
und Abs. 3 vermerkten Angaben dürfen nur von den in Art. 28 Abs. 4<br />
genannten Behörden für Zwecke der Gefahrenabwehr oder der<br />
Strafverfolgung sowie zur Aufklärung der Schicksale von Vermissten und<br />
Unfallopfern ausgewertet und verarbeitet werden. 2 Die Daten dürfen<br />
darüber hinaus zur Erhebung des Fremdenverkehrs- und Kurbeitrags<br />
gemäß Art. 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes, der Kurtaxe gemäß<br />
Art. 24 des Kostengesetzes und für Zwecke der Beherbergungs- und<br />
Fremdenverkehrsstatistiken ausgewertet und verarbeitet werden.<br />
3<br />
Beherbergungsbetriebe dürfen die Daten nach Maßgabe des<br />
Bundesdatenschutzgesetzes auch für eigene Zwecke verwenden.<br />
(2) Die nach Art. 25 Abs. 2 erhobenen Angaben dürfen von der Polizei und<br />
den Staatsanwaltschaften nur für die in Art. 25 Abs. 2 Satz 3 genannten<br />
Zwecke ausgewertet und verarbeitet werden.
Vierter Abschnitt Datenübermittlungen<br />
Bay MeldeG Artikel 27 Datenübermittlungen zwischen den<br />
Meldebehörden<br />
(1) 1 Die Zuzugsmeldebehörde hat der Wegzugsmeldebehörde und den für<br />
weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden unverzüglich, spätestens<br />
jedoch drei Werktage nach der Anmeldung die in Art. 3 Abs. 1 Nrn. 1 bis<br />
17 genannten Daten des Betroffenen durch Datenübertragung zu<br />
übermitteln (Rückmeldung). 2 Die Wegzugsmeldebehörde hat die<br />
übermittelten Daten unverzüglich zu verarbeiten und die<br />
Zuzugsmeldebehörde über die in Art. 3 Abs. 2 Nrn. 1, 3, 4, 7, 10 und 11<br />
genannten Tatsachen sowie dann zu unterrichten, wenn die in Satz 1<br />
bezeichneten Daten von den bisherigen Angaben abweichen. 3 Bei einem<br />
Zuzug aus dem Ausland ist die für den letzten Wohnort im Inland<br />
zuständige Meldebehörde zu unterrichten. 4 Für die Datenübermittlung<br />
zwischen den bayerischen Meldebehörden gilt § 2 der Ersten<br />
Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV) vom 21. Juni<br />
2005 (BGBl I S. 1689), geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 13. Juli<br />
2005 (BGBl I S. 2171), entsprechend. 5 Sind von einer Rückmeldung<br />
Meldebehörden betroffen, die einen § 2 der Ersten<br />
Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vergleichbaren<br />
Sicherheitsstandard erfüllen, können sie abweichend von Satz 4 ihr<br />
Verfahren der Datenübermittlung verwenden; Art. 9 Abs. 2 Satz 2 gilt<br />
entsprechend.<br />
(2) Werden die in Art. 3 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 1, 7 und 11 bezeichneten Daten<br />
fortgeschrieben, so sind die für weitere Wohnungen des Einwohners<br />
zuständigen Meldebehörden zu unterrichten, soweit die Daten zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.<br />
(3) 1 In den Fällen des Art. 31 Abs. 7 und 8 hat die zuständige Meldebehörde<br />
unverzüglich die für die vorherige Wohnung und die für weitere<br />
Wohnungen zuständigen Meldebehörden zu unterrichten. 2 Dies gilt auch<br />
für die Aufhebung einer Auskunftssperre.<br />
(4) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung für<br />
Datenübermittlungen nach den Abs. 1 bis 3 das Nähere über das<br />
Verfahren, insbesondere die Art und Form der zu übermittelnden Daten zu<br />
regeln.<br />
(5) Soweit auf Grund von völkerrechtlichen Übereinkünften ein<br />
meldebehördliches Rückmeldeverfahren mit Stellen des Auslands<br />
vorgesehen ist, gehen die darin getroffenen Vereinbarungen den<br />
Regelungen nach Abs. 1 bis 4 vor.<br />
Bay MeldeG Artikel 28 Datenübermittlungen an andere Behörden oder<br />
sonstige öffentliche Stellen<br />
(1) 1 Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen<br />
öffentlichen Stelle im Inland aus dem Melderegister folgende Daten von<br />
Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer<br />
Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden<br />
Aufgaben erforderlich ist:<br />
1. Familiennamen,
2. frühere Namen,<br />
3. Vornamen,<br />
4. Doktorgrad,<br />
5. Ordensnamen/Künstlernamen,<br />
6. Tag und Ort der Geburt,<br />
7. Geschlecht,<br />
8. gesetzlicher Vertreter (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift,<br />
Tag der Geburt, Sterbetag),<br />
9. Staatsangehörigkeiten einschließlich der nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 4<br />
gespeicherten Daten,<br />
10. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung,<br />
bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland,<br />
11. Tag des Ein- und Auszugs,<br />
12. Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern zusätzlich Tag<br />
und Ort der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft,<br />
13. Übermittlungssperren sowie<br />
14. Sterbetag und -ort.<br />
2<br />
Für Übermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen<br />
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,<br />
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen<br />
Wirtschaftsraum oder<br />
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften<br />
im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den<br />
Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen,<br />
gilt Satz 1 nach den für diese Übermittlungen geltenden <strong>Gesetze</strong>n und<br />
Vereinbarungen. 3 Werden Daten über eine Vielzahl nicht namentlich<br />
bezeichneter Einwohner übermittelt, so dürfen für die Zusammensetzung<br />
der Personengruppe nur die in Satz 1 genannten Daten zugrunde gelegt<br />
werden. 4 Den in Abs. 4 bezeichneten Behörden darf die Meldebehörde<br />
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 über die dort genannten Daten<br />
hinaus auch die Angaben nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 übermitteln.<br />
(2) 1 Die Daten dürfen auch auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern,<br />
durch Datenübertragung oder nach Maßgabe des Abs. 5 durch<br />
automatisierte Abrufverfahren übermittelt werden, wenn über die Identität<br />
der anfragenden Stelle kein Zweifel besteht und keine<br />
Übermittlungssperre nach Art. 29 Abs. 2 Satz 3 vorliegt; ein<br />
automatisierter Abruf nach Abs. 5 ist ferner ausgeschlossen, wenn eine<br />
Auskunftssperre nach Art. 31 Abs. 7 und 8 vorliegt, es sei denn, der Abruf<br />
erfolgt durch eine in Abs. 4 Satz 1 genannte Stelle. 2 Art. 9 Abs. 2 Satz 2<br />
gilt entsprechend.<br />
(3) Die Übermittlung weiterer als der in Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten<br />
oder die Übermittlung der in Art. 3 Abs. 1 oder Abs. 2 genannten Hinweise<br />
im Melderegister an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen ist<br />
nur dann zulässig, wenn der Empfänger<br />
1. ohne Kenntnis der Daten zur Erfüllung einer ihm durch Rechtsvorschrift<br />
übertragenen Aufgabe nicht in der Lage wäre und<br />
2. die Daten beim betroffenen Einwohner nur mit unverhältnismäßig<br />
hohem Aufwand erheben könnte oder von einer Datenerhebung beim<br />
betroffenen Einwohner nach der Art der Aufgabe, zu der die Daten<br />
erforderlich sind, abgesehen werden muss.
(4) 1 Wird die Meldebehörde von der Polizei, den Staatsanwaltschaften, den<br />
Gerichten, den Justizvollzugsanstalten, dem Landesamt für<br />
Verfassungsschutz, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem<br />
Bundesnachrichtendienst, dem Militärischen Abschirmdienst, dem<br />
Bundeskriminalamt, der Bundespolizei, dem Zollfahndungsdienst, dem<br />
Generalbundesanwalt oder den Steuerfahndungs-, Bußgeld- und<br />
Strafsachenstellen der Finanzämter um Übermittlung von Daten oder<br />
Hinweisen nach Abs. 3 zur Erfüllung der in der Zuständigkeit dieser<br />
Behörden liegenden Aufgaben ersucht, so entfällt die Prüfung durch die<br />
Meldebehörde, ob die Voraussetzungen nach Abs. 3 und Art. 7 vorliegen.<br />
2<br />
Die ersuchende Behörde hat den Namen und die Anschrift des<br />
Betroffenen unter Hinweis auf den Anlass der Übermittlung aufzuzeichnen.<br />
3<br />
Die Aufzeichnungen sind gesondert aufzubewahren, durch technische<br />
und organisatorische Maßnahmen zu sichern und am Ende des<br />
Kalenderjahres, das dem Jahr der Aufzeichnung folgt, zu vernichten.<br />
(5) 1 Daten dürfen regelmäßig, insbesondere im Wege automatisierter<br />
Abrufverfahren, an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen<br />
übermittelt werden, soweit dies durch Bundes- oder <strong>Landesrecht</strong><br />
zugelassen ist, Anlass und Zweck der Übermittlungen festgelegt sowie<br />
Datenempfänger und zu übermittelnde Daten bestimmt sind. 2 Die<br />
Übermittlung von Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften<br />
bestimmter Einwohner mittels automatisierter Abrufverfahren ist zulässig,<br />
soweit die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung der Aufgaben der<br />
abrufenden Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle erforderlich ist.<br />
3<br />
Für die Bezeichnung von Vor- und Familiennamen oder früheren Namen<br />
kann eine phonetisch mögliche Schreibweise genügen. 4 Das<br />
Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung die<br />
regelmäßige Datenübermittlung der in Abs. 1 und 3 genannten Daten<br />
zuzulassen und vorzuschreiben; es hat hierbei Anlass und Zweck der<br />
Übermittlung, die Datenempfänger, die zu übermittelnden Daten, ihre<br />
Form sowie das Nähere über das Verfahren der Übermittlung und den<br />
Übermittlungsweg festzulegen.<br />
(6) 1 Die Datenempfänger dürfen die Daten und Hinweise, soweit gesetzlich<br />
nichts anderes bestimmt ist, nur für die Zwecke verarbeiten oder nutzen,<br />
zu deren Erfüllung sie ihnen übermittelt oder weitergegeben wurden. 2 In<br />
den Fällen des Art. 31 Abs. 7 und 8 ist eine Verarbeitung oder Nutzung<br />
der übermittelten Daten und Hinweise nur zulässig, wenn die<br />
Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen<br />
ausgeschlossen werden kann.<br />
(7) 1 Innerhalb einer Gemeinde dürfen unter den in Abs. 1 genannten<br />
Voraussetzungen sämtliche der in Art. 3 Abs. 1 aufgeführten Daten und<br />
Hinweise weitergegeben werden. 2 Satz 1 gilt für die Datenweitergabe<br />
zwischen Verwaltungsgemeinschaften und ihren Mitgliedsgemeinden<br />
entsprechend. 3 Für die Weitergabe und Einsichtnahme von Daten und<br />
Hinweisen nach Art. 3 Abs. 2 gelten Abs. 3 und 6 entsprechend.
Bay MeldeG Artikel 29 Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche<br />
Religionsgesellschaften<br />
(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft<br />
unter den in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Daten ihrer Mitglieder übermitteln:<br />
1. Familiennamen,<br />
2. frühere Namen,<br />
3. Vornamen,<br />
4. Doktorgrad,<br />
5. Ordensnamen/Künstlernamen,<br />
6. Tag und Ort der Geburt,<br />
7. Geschlecht,<br />
8. Staatsangehörigkeiten,<br />
9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung,<br />
bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift im Inland,<br />
10. Tag des Ein- und Auszugs,<br />
11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine<br />
Lebenspartnerschaft führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder<br />
Lebenspartnern: Tag der Eheschließung oder der Begründung der<br />
Lebenspartnerschaft,<br />
12. Zahl der minderjährigen Kinder,<br />
13. Übermittlungssperren sowie<br />
14. Sterbetag und -ort.<br />
(2) 1 Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner<br />
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die<br />
Meldebehörde folgende Daten übermitteln:<br />
1. Familiennamen,<br />
2. Vornamen,<br />
3. Tag der Geburt,<br />
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft,<br />
5. Übermittlungssperren sowie<br />
6. Sterbetag.<br />
2<br />
Familienangehörige im Sinn des Satzes 1 sind der Ehegatte,<br />
minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder. 3 Der<br />
Betroffene kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden; er<br />
ist hierauf bei der Anmeldung nach Art. 13 Abs. 1 hinzuweisen. 4 Satz 3<br />
gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der<br />
jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden.<br />
(3) 1 Eine Datenübermittlung nach Abs. 1 und 2 ist nur dann zulässig, wenn<br />
sichergestellt ist, dass bei dem Datenempfänger ausreichende<br />
Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 2 Das Staatsministerium des<br />
Innern kann feststellen, ob der Datenempfänger die Voraussetzungen des<br />
Satzes 1 erfüllt.<br />
(4) Art. 28 Abs. 2 gilt entsprechend.<br />
Bay MeldeG Artikel 30 Datenübermittlungen an den Suchdienst<br />
Die Meldebehörde übermittelt dem Suchdienst zur Erfüllung seiner Aufgaben<br />
folgende Daten der Einwohner, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des<br />
Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten stammen:
1. Familienname,<br />
2. frühere Namen,<br />
3. Vornamen,<br />
4. Tag und Ort der Geburt,<br />
5. gegenwärtige Anschrift,<br />
6. Anschrift am 1. September 1939.<br />
Bay MeldeG Artikel 31 Melderegisterauskunft<br />
(1) 1 Personen, die nicht Betroffene sind, und andere als die in Art. 28 Abs. 1<br />
bezeichneten Stellen können von den Meldebehörden Auskunft über<br />
1. Vor- und Familiennamen,<br />
2. Doktorgrad und<br />
3. Anschriften<br />
einzelner bestimmter Einwohner verlangen (einfache<br />
Melderegisterauskunft). 2 Dies gilt auch, wenn jemand Auskunft über<br />
Daten einer Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner begehrt.<br />
(2) 1 Einfache Melderegisterauskünfte können auf automatisiert verarbeitbaren<br />
Datenträgern oder durch Datenübertragung erteilt werden, wenn<br />
1. der Antrag in der amtlich vorgeschriebenen Form gestellt worden ist,<br />
2. der Antragsteller den Betroffenen mit Vor- und Familiennamen sowie<br />
mindestens zwei weiteren der nach Art. 3 Abs. 1, ausgenommen Nrn. 7<br />
und 9, gespeicherten Daten bezeichnet hat, wobei für den Vor- und<br />
Familiennamen oder frühere Namen eine phonetisch mögliche<br />
Schreibweise genügen kann, und<br />
3. die Identität des Betroffenen durch einen automatisierten Abgleich der<br />
im Antrag angegebenen mit den im Melderegister gespeicherten Daten<br />
des Betroffenen eindeutig festgestellt worden ist.<br />
2<br />
Die der Meldebehörde überlassenen Datenträger oder übermittelten<br />
Daten sind nach Erledigung des Antrags unverzüglich zurückzugeben, zu<br />
löschen oder zu vernichten.<br />
(3) 1 Einfache Melderegisterauskünfte können unter den Voraussetzungen des<br />
Abs. 2 Satz 1 auch durch automatisierten Abruf über das Internet erteilt<br />
werden; Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 2 Die Eröffnung des Zugangs ist<br />
öffentlich bekannt zu machen. 3 Ein Abruf ist nicht zulässig, wenn der<br />
Betroffene dieser Form der Auskunftserteilung widersprochen hat; die<br />
Meldepflichtigen sind spätestens einen Monat vor der Eröffnung des<br />
Zugangs durch Bekanntmachung auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen.<br />
4<br />
Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch Verordnung<br />
das Nähere über das Verfahren des Abrufs und den Abrufweg festzulegen.<br />
(4) 1 Soweit jemand ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, darf ihm<br />
zusätzlich zu den in Abs. 1 Satz 1 genannten Daten eines einzelnen<br />
bestimmten Einwohners eine erweiterte Melderegisterauskunft erteilt<br />
werden über<br />
1. frühere Vor- und Familiennamen,<br />
2. Tag und Ort der Geburt,<br />
3. gesetzliche Vertreter,<br />
4. Staatsangehörigkeiten,<br />
5. frühere Anschriften,<br />
6. Tag des Ein- und Auszugs,
7. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine<br />
Lebenspartnerschaft führend oder nicht,<br />
8. Vor- und Familiennamen sowie Anschrift des Ehegatten oder<br />
Lebenspartners sowie<br />
9. Sterbetag und -ort.<br />
2<br />
Die Meldebehörde hat den Betroffenen über die Erteilung einer<br />
erweiterten Melderegisterauskunft unter Angabe des Datenempfängers<br />
unverzüglich zu unterrichten; dies gilt nicht, wenn der Datenempfänger<br />
ein rechtliches Interesse, insbesondere zur Geltendmachung von<br />
Rechtsansprüchen glaubhaft gemacht hat.<br />
(5) 1 Melderegisterauskunft über eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter<br />
Einwohner (Gruppenauskunft) darf nur erteilt werden, soweit sie im<br />
öffentlichen Interesse liegt. 2 Für die Zusammensetzung der<br />
Personengruppe dürfen die folgenden Daten herangezogen werden:<br />
1. Tag der Geburt,<br />
2. Geschlecht,<br />
3. Staatsangehörigkeiten,<br />
4. Anschriften,<br />
5. Tag des Ein- und Auszugs,<br />
6. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine<br />
Lebenspartnerschaft führend oder nicht.<br />
3<br />
Außer der Tatsache der Zugehörigkeit zu der Gruppe dürfen folgende<br />
Daten mitgeteilt werden:<br />
1. Familiennamen,<br />
2. Vornamen,<br />
3. Doktorgrad,<br />
4. Alter,<br />
5. Geschlecht,<br />
6. gesetzlicher Vertreter minderjähriger Kinder (Vor- und Familiennamen,<br />
Anschrift),<br />
7. Staatsangehörigkeiten sowie<br />
8. Anschriften.<br />
(6) Bei Melderegisterauskünften nach Abs. 4 und 5 darf der Empfänger die<br />
Daten nur für den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm<br />
übermittelt wurden.<br />
(7) 1 Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass dem<br />
Betroffenen oder einer anderen Person durch eine Melderegisterauskunft<br />
eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche<br />
schutzwürdige Interessen erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf<br />
Antrag oder von Amts wegen eine Auskunftssperre im Melderegister<br />
einzutragen. 2 Eine Melderegisterauskunft ist in diesen Fällen unzulässig,<br />
es sei denn, dass nach Anhörung des Betroffenen eine Gefahr im Sinn von<br />
Satz 1 ausgeschlossen werden kann. 3 Die Auskunftssperre endet mit<br />
Ablauf des zweiten auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres; sie<br />
kann auf Antrag verlängert werden.<br />
(8) Die Melderegisterauskunft ist ferner unzulässig,<br />
1. soweit die Einsicht in einen Eintrag im Geburten- oder Familienbuch<br />
nach § 61 Abs. 2 und 3 des Personenstandsgesetzes nicht gestattet
werden darf,<br />
2. in den Fällen des § 1758 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.<br />
(9) Die Erteilung von Melderegisterauskünften nach Abs. 4 und 5 kann unter<br />
Bedingungen erfolgen oder mit Auflagen verbunden werden, die die<br />
Einhaltung der Bestimmungen dieses <strong>Gesetze</strong>s beim Auskunftsempfänger<br />
sicherstellen.<br />
Bay MeldeG Artikel 32 Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen<br />
(1) 1 Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern<br />
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und<br />
Abstimmungen auf staatlicher oder kommunaler Ebene in den sechs der<br />
Stimmabgabe vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister<br />
über die in Art. 31 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von<br />
Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter<br />
der Betroffenen bestimmend ist. 2 Die Geburtstage der Wahlberechtigten<br />
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 3 Die Betroffenen haben das Recht,<br />
der Weitergabe ihrer Daten nach Satz 1 zu widersprechen. 4 Hierauf sind<br />
sie bei der Anmeldung und spätestens acht Monate vor Wahlen zum<br />
Deutschen Bundestag, zum Europäischen Parlament, zum Landtag oder<br />
zum Bezirkstag sowie bei Gemeinde- und Landkreiswahlen im Sinn des<br />
Art. 9 Abs. 2 Satz 1 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes durch<br />
öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. 5 Der Empfänger hat die Daten<br />
spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen.<br />
(2) 1 Begehren Parteien, Wählergruppen, Mitglieder parlamentarischer<br />
Vertretungskörperschaften und Bewerber für diese sowie Presse und<br />
Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- oder Ehejubiläen von<br />
Einwohnern, so darf die Meldebehörde die Auskunft nur dann erteilen,<br />
wenn die Betroffenen der Auskunftserteilung nicht widersprochen haben.<br />
2<br />
Die Betroffenen sind bei der Anmeldung auf ihr Widerspruchsrecht nach<br />
Satz 1 hinzuweisen. 3 Wird die Auskunft erteilt, so darf sie nur die in<br />
Art. 31 Abs. 1 Satz 1 genannten Daten der Betroffenen sowie Tag und Art<br />
des Jubiläums umfassen.<br />
(3) 1 Adressbuchverlagen darf Auskunft über die in Art. 31 Abs. 1 Satz 1<br />
bezeichneten Daten sämtlicher Einwohner, die das 18. Lebensjahr<br />
vollendet haben, erteilt werden. 2 Die Betroffenen haben das Recht, der<br />
Weitergabe ihrer Daten nach Satz 1 zu widersprechen. 3 Hierauf sind sie<br />
bei der Anmeldung hinzuweisen.<br />
(4) Art. 31 Abs. 6, 7 und 9 gelten entsprechend.<br />
Fünfter Abschnitt Automatisierte Datenverarbeitung<br />
Bay MeldeG Artikel 33 Zulässigkeit der Datenverarbeitung im Auftrag<br />
(1) 1 Für die Zulässigkeit der Meldedatenverarbeitung im Auftrag der<br />
Meldebehörden gilt Art. 6 des Bayerischen Datenschutzgesetzes.<br />
2 Unbeschadet der Rechte und Pflichten aus dem Auftragsverhältnis haben<br />
die beauftragten Stellen insoweit die Pflichten der Meldebehörden zu<br />
erfüllen.
(2) 1 Verarbeitet die mit der Datenverarbeitung nach Abs. 1 beauftragte Stelle<br />
Daten eines Einwohners für mehrere Meldebehörden, so kann sie die<br />
Daten eines Einwohners in einem Datensatz speichern. 2 Dabei muss<br />
sichergestellt sein, dass die Meldebehörden auf diesen Datensatz nur im<br />
Rahmen ihrer Zuständigkeit zugreifen können.<br />
(3) Werden die Daten des Einwohners nach Abs. 2 gespeichert, so kann<br />
hierbei ein gemeinsames Ordnungsmerkmal (Art. 4) verwendet werden.<br />
(4) Auf die bei einer beauftragten Stelle gespeicherten Daten eines<br />
Einwohners und die Hinweise zum Nachweis ihrer Richtigkeit können alle<br />
Meldebehörden, die diese Stelle beauftragt haben und bei denen sich der<br />
Einwohner angemeldet hat, zugreifen, soweit dies zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben erforderlich ist.<br />
(5) Gesonderte Datenübermittlungen nach Art. 27 finden in den Fällen des<br />
Abs. 1 nicht statt.<br />
Bay MeldeG Artikel 34 Zulässigkeit der Übertragung von Aufgaben der<br />
Datenverarbeitung<br />
(1) Die Meldebehörden können Aufgaben der Meldedatenverarbeitung, die<br />
über eine Auftragsdatenverarbeitung nach Art. 33 hinaus gehen, auf<br />
andere Meldebehörden, Zweckverbände und gemeinsame<br />
Kommunalunternehmen nach Art. 2 Abs. 3 und 4 des <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
Kommunale Zusammenarbeit oder auf die Anstalt für Kommunale<br />
Datenverarbeitung in Bayern übertragen.<br />
(2) Dabei muss sichergestellt sein, dass die Meldebehörden auf den Datensatz<br />
eines Einwohners nur im Rahmen ihrer Zuständigkeit zugreifen können.<br />
(3) Art. 33 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 und Abs. 5 gelten entsprechend.<br />
Sechster Abschnitt Ordnungswidrigkeiten<br />
Bay MeldeG Artikel 35 Ordnungswidrigkeiten<br />
Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. sich für eine Wohnung anmeldet, die er nicht bezieht, oder sich für eine<br />
Wohnung abmeldet, in der er weiterhin wohnt,<br />
2. entgegen Art. 6 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2, Daten bekannt gibt,<br />
zugänglich macht oder selbst nutzt,<br />
3. den Meldepflichten nach Art. 13 Abs. 1 oder 2, Art. 20 Abs. 1 Satz 1 oder<br />
Abs. 2 Satz 1, Art. 22 Abs. 2 Satz 2, Art. 23 Abs. 1 Satz 2 oder Art. 25 Abs. 1<br />
Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, nicht, nicht richtig, nicht vollständig<br />
oder nicht rechtzeitig nachkommt,<br />
4. entgegen Art. 23 Abs. 2 Sätze 1 oder 4 den besonderen Meldeschein nicht,<br />
nicht richtig oder nicht vollständig ausfüllt oder sich entgegen Art. 23 Abs. 3<br />
nicht oder nicht richtig ausweist,<br />
5. entgegen Art. 24 Abs. 4 einen Meldeschein nicht oder nicht für die<br />
vorgeschriebene Dauer aufbewahrt,<br />
6. entgegen Art. 25 Abs. 2 Satz 2 Angaben nicht oder nicht rechtzeitig in ein<br />
Verzeichnis einträgt.
Bay MeldeG Artikel 36 Ordnungswidrigkeiten bei<br />
Melderegisterauskünften<br />
Mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
1. unrichtige oder unvollständige Angaben tatsächlicher Art macht oder<br />
benutzt, um für sich oder einen anderen die Erteilung einer Auskunft gemäß<br />
Art. 31 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 zu erschleichen,<br />
2. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 31 Abs. 6 Daten für einen anderen<br />
Zweck verwendet.<br />
Siebter Abschnitt Schlussbestimmungen<br />
Bay MeldeG Artikel 37 Elektronische Verfahren<br />
Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, die Einzelheiten des<br />
Verfahrens<br />
1. der elektronischen Anmeldung,<br />
2. der elektronischen Selbstauskunft,<br />
3. der elektronischen Melderegisterauskunft und<br />
4. regelmäßiger Datenübermittlungen<br />
durch Verordnung festzulegen.<br />
Bay MeldeG Artikel 38 Form von Verordnungen<br />
1 Soweit in Verordnungen auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s Form und Umfang von<br />
Datenübermittlungen zu bestimmen sind, kann hierbei auf jedermann<br />
zugängliche Bekanntmachungen des Staatsministeriums des Innern oder<br />
sachverständiger Stellen verwiesen werden. 2 Hierbei ist<br />
1. in der Verordnung das Datum der Bekanntmachung anzugeben und die<br />
Bezugsquelle genau zu bezeichnen und<br />
2. die Bekanntmachung beim Bayerischen Staatsarchiv zu hinterlegen und in<br />
der Verordnung darauf hinzuweisen.<br />
Bay MeldeG Artikel 39 Übergangsbestimmung<br />
Abweichend von Art. 27 Abs. 1 Satz 1 ist die Rückmeldung bis zum<br />
31. Dezember 2006 auch in papiergebundener Form oder auf automatisiert<br />
verarbeitbaren Datenträgern zulässig, sofern bei der Meldebehörde die<br />
technischen Voraussetzungen für eine Datenübertragung noch nicht vorliegen.
Gesetz über die Entwicklung,<br />
Förderung und Veranstaltung privater<br />
Rundfunkangebote und anderer<br />
Telemedien in Bayern (Bay MG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 (GVBl. S. 799), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 11. Dezember 2006 (GVBl. S. 1008), vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 903), vom 22.<br />
Dezember 2008 (GVBl. S. 975), vom 2. April 2009 (GVBl. S. 50), vom 8. Dezember 2009 (GVBl.<br />
S. 609) (FN BayRS 2251-4-S)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften<br />
Art. 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen<br />
Art. 2 Öffentlich-rechtliche Trägerschaft, Organisation<br />
Art. 3 Programme<br />
Art. 4 Ausgewogenheit des Gesamtangebots, Meinungsvielfalt<br />
Art. 5 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen, Drittsenderechte<br />
Art. 6 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz<br />
Art. 7 Kurzberichterstattung, Übertragung von Großereignissen<br />
Art. 8 Werbung, Teleshopping<br />
Art. 9 Sponsoring, Gewinnspiele<br />
Zweiter Abschnitt Bayerische Landeszentrale für neue Medien<br />
Art. 10 Rechtsform, Organe<br />
Art. 11 Aufgaben<br />
Art. 12 Medienrat<br />
Art. 13 Mitglieder des Medienrats<br />
Art. 14 Verwaltungsrat
Art. 15 Präsident<br />
Art. 16 Anordnungen<br />
Art. 17 Beschwerderecht<br />
Art. 18 Gegendarstellung<br />
Art. 19 Rechtsaufsicht<br />
Art. 20 Datenschutz<br />
Art. 21 Finanzierung, Haushaltsführung, Rechnungsprüfung<br />
Art. 22 Kosten<br />
Dritter Abschnitt Förderung von lokalen und regionalen Fernsehangeboten,<br />
Organisation und Genehmigung von Rundfunkprogrammen<br />
Art. 23 Förderung von lokalen und regionalen Fernsehangeboten<br />
Art. 24 Anbieter<br />
Art. 25 Inhalt der Angebote, Organisationsverfahren<br />
Art. 26 Genehmigung des Angebots<br />
Art. 27 Fernsehtext, Radiotext<br />
Art. 28 Programmänderungen<br />
Art. 29 Auskunftspflicht, Aufzeichnungspflicht, Archivierung<br />
Vierter Abschnitt Pilotprojekte, Betriebsversuche<br />
Art. 30 Pilotprojekte, Betriebsversuche<br />
Fünfter Abschnitt Zuordnung technischer Übertragungskapazitäten<br />
Art. 31 Genutzte Übertragungskapazitäten<br />
Art. 32 Zuordnung neuer Übertragungskapazitäten<br />
Art. 33 Betrieb von Kabelanlagen
Sechster Abschnitt Kabelanlagen<br />
Art. 34<br />
Art. 35 Weiterverbreitung<br />
Art. 36 Kanalbelegung in Breitbandkabelnetzen<br />
Siebter Abschnitt Übergangs- und Schlussbestimmungen<br />
Art. 37 Strafbestimmung, Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 38 Verjährung<br />
Art. 39 Keine aufschiebende Wirkung<br />
Art. 40 Verweisungen<br />
Art. 41 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen,<br />
Zuständigkeitsregelung<br />
Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften<br />
Bay MG Art. 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen<br />
(1) Dieses Gesetz ist Grundlage für die Entwicklung, Förderung und<br />
Veranstaltung von Rundfunk, die Durchführung von Pilotprojekten und<br />
Betriebsversuchen nach dem Vierten Abschnitt sowie für die<br />
Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen und Telemedien in<br />
Kabelanlagen in Bayern.<br />
(2) 1 Es gelten die Begriffsbestimmungen des § 2 des<br />
Rundfunktstaatsvertrags. 2 Nicht unter den Rundfunkbegriff im Sinn des<br />
Rundfunkstaatsvertrags fallen Angebote, die sich auf ein Gebäude oder<br />
einen zusammengehörigen Gebäudekomplex beschränken und in einem<br />
funktionellen Zusammenhang mit den dort zu erfüllenden Aufgaben<br />
stehen.<br />
(3) Für den Bayerischen Rundfunk, das Zweite Deutsche Fernsehen und<br />
andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten findet dieses Gesetz nur<br />
Anwendung, soweit dies ausdrücklich bestimmt ist.<br />
(4) weggefallen<br />
Bay MG Art. 2 Öffentlich-rechtliche Trägerschaft, Organisation<br />
(1) Rundfunk im Rahmen dieses <strong>Gesetze</strong>s wird in öffentlicher Verantwortung<br />
und in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft der Bayerischen Landeszentrale<br />
für neue Medien (Landeszentrale) betrieben.<br />
(2) 1 Im Rahmen dieses <strong>Gesetze</strong>s organisiert die Landeszentrale<br />
Rundfunkprogramme aus von Rundfunkanbietern (Anbieter) gestalteten
Beiträgen. 2 Dabei ist auf eine qualitätvolle Programmgestaltung<br />
hinzuwirken.<br />
(3) weggefallen<br />
Bay MG Art. 3 Programme<br />
(1) Die der Landeszentrale zugeordneten drahtlosen Fernsehfrequenzen<br />
werden zur Verbreitung bundesweiter, landesweiter und regionaler oder<br />
lokaler Programme genutzt.<br />
(2) 1 Die der Landeszentrale zugeordneten drahtlosen UKW-<br />
Hörfunkfrequenzen werden für eine landesweite Hörfunksenderkette und<br />
für lokale oder regionale Hörfunkprogramme genutzt. 2 Darüber hinaus<br />
kann die Landeszentrale drahtlose UKW-Hörfunkfrequenzen für die<br />
Verbreitung von Hörfunkprogrammen vorsehen, die zur landesweiten oder<br />
bundesweiten Verbreitung über Satellit oder in Breitbandkabelnetzen<br />
bestimmt sind.<br />
(3) 1 In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten<br />
Fernsehvollprogrammen sind unabhängig von der Art ihrer Verbreitung im<br />
Rahmen der technischen Möglichkeiten landesweite und regionale oder<br />
lokale Fensterprogramme zu schalten, deren Finanzierung durch die<br />
Anbieter oder Veranstalter der bundesweiten Programme sicherzustellen<br />
ist. 2 Es gilt § 25 Abs. 4 des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
(4) 1 Rundfunkprogramme können auch Zulieferungen von Programmteilen<br />
(Zulieferungsprogramme) enthalten, die in der medienrechtlichen<br />
Verantwortung der Anbieter eingebracht werden.<br />
2<br />
Zulieferungsprogramme, deren Inhalte einen Bezug zu Bayern haben,<br />
sind vorrangig zu berücksichtigen.<br />
(5) 1 Die Befugnisse der Landeszentrale, die Nutzung verfügbarer Sende- und<br />
Übertragungskapazitäten für weitere Voll- oder Spartenprogramme unter<br />
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit zu genehmigen,<br />
bleiben unberührt. 2 Die Nutzung verfügbarer Sende- und<br />
Übertragungskapazitäten kann auch für Zwecke der Aus- und Fortbildung<br />
genehmigt werden.<br />
Bay MG Art. 4 Ausgewogenheit des Gesamtangebots, Meinungsvielfalt<br />
1 Die nach diesem Gesetz in Bayern verbreiteten Rundfunkprogramme in ihrer<br />
Gesamtheit tragen zur Unterrichtung, Bildung, Kultur und Unterhaltung bei und<br />
müssen die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen<br />
Gruppen angemessen zu Wort kommen lassen. 2 Die Gesamtheit der<br />
Rundfunkprogramme eines Verbreitungsgebiets darf nicht einseitig eine Partei,<br />
eine Interessengruppe oder eine Weltanschauung begünstigen. 3 Für die<br />
Sicherung der Meinungsvielfalt in bundesweit verbreiteten Fernsehprogrammen<br />
gelten §§ 26 bis 34 des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
Bay MG Art. 5 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen,<br />
Drittsenderechte<br />
(1) 1 Die nach diesem Gesetz an der Veranstaltung von Rundfunk Beteiligten<br />
sind an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. 2 Die Sendungen<br />
haben die Würde des Menschen, die sittlichen, religiösen und
weltanschaulichen Überzeugungen anderer sowie Ehe und Familie zu<br />
achten. 3 Sie dürfen sich nicht gegen die Völkerverständigung richten.<br />
4<br />
Die allgemeinen <strong>Gesetze</strong> und die gesetzlichen Bestimmungen zum<br />
Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten.<br />
(2) 1 Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten<br />
journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu<br />
entsprechen. 2 Sie müssen unabhängig und sachlich sein. 3 Alle<br />
Nachrichten und Berichte sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den<br />
Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen.<br />
4<br />
Entstellungen durch Verzerrung der Sachverhalte sind zu unterlassen.<br />
5<br />
Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen und<br />
unter Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen.<br />
(3) Für bundesweit verbreitete Rundfunkprogramme gelten die<br />
Programmgrundsätze nach §§ 3, 41 des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
(4) Für Meinungsumfragen, die von Anbietern durchgeführt werden, gilt § 10<br />
Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
(5) 1 Politische Parteien und Wählergruppen können Wahlwerbung nach<br />
Maßgabe des § 5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes einbringen. 2 Bei<br />
Wahlen zum Bayerischen Landtag, zum Deutschen Bundestag und zum<br />
Europäischen Parlament kann in Programme, die nicht zur bundesweiten<br />
Verbreitung bestimmt sind, nur Wahlwerbung solcher Parteien und<br />
Wählergruppen eingebracht werden, die in Bayern mit einem<br />
Wahlvorschlag zugelassen sind. 3 Bei Wahlen auf Gemeinde-, Kreis- oder<br />
Bezirksebene kann nur Wahlwerbung solcher Parteien und Wählergruppen<br />
im lokalen/regionalen Rundfunk eingebracht werden, die mit einem<br />
Wahlvorschlag zu der entsprechenden Wahl in dem jeweiligen Sendegebiet<br />
zugelassen sind. 4 Räumt ein Anbieter einer politischen Partei oder<br />
Wählergruppe Sendezeit zur Vorbereitung einer Wahl ein, muss er allen<br />
anderen Parteien und Wählergruppen, welche die Voraussetzungen für die<br />
Einbringung von Wahlwerbung für den jeweiligen Wahlanlass erfüllen, auf<br />
Wunsch angemessene, nach der Bedeutung der Partei oder Wählergruppe<br />
abgestufte Sendezeit zur Verfügung stellen. 5 Einzelheiten über die<br />
Wahlwerbung, insbesondere über Dauer und Aufteilung der Sendezeiten<br />
sowie die Kostenerstattung, regelt die Landeszentrale durch Satzung.<br />
(6) Für Wahlwerbung und religiöse Sendungen in bundesweit verbreiteten<br />
privaten Rundfunkangeboten gilt § 42 des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
(7) 1 In landesweit, regional und lokal verbreiteten Rundfunkprogrammen<br />
kann Werbung aus Anlass eines zugelassenen Volksbegehrens und eines<br />
Volksentscheids eingebracht werden. 2 Räumt ein Anbieter Sendezeit für<br />
die Werbung aus Anlass eines zugelassenen Volksbegehrens und eines<br />
Volksentscheids ein, muss er auch Vertretern einer anderen Auffassung zu<br />
dem zugelassenen Volksbegehren und zu dem Volksentscheid auf Wunsch<br />
Sendezeit in einem angemessenen Verhältnis zur Verfügung stellen.<br />
3<br />
Einzelheiten, insbesondere die Werbeberechtigung und die Dauer der<br />
Werbung, regelt die Landeszentrale durch Satzung.<br />
(8) 1 Die Mitglieder der Staatsregierung und die von ihnen Beauftragten haben<br />
das Recht, amtliche Verlautbarungen und andere wichtige, im öffentlichen<br />
Interesse gelegene Mitteilungen über den Rundfunk bekannt zu geben
oder bekannt geben zu lassen. 2 Darüber hinaus haben die Anbieter in<br />
Katastrophenfällen oder bei anderen Gefahren für die öffentliche<br />
Sicherheit den zuständigen Behörden und Stellen unverzüglich die<br />
erforderliche Sendezeit für amtliche Durchsagen einzuräumen. 3 Für Inhalt<br />
und Gestaltung der Sendezeit ist derjenige verantwortlich, dem die<br />
Sendezeit zur Verfügung gestellt worden ist.<br />
Bay MG Art. 6 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz<br />
1 Die für Rundfunk geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-<br />
Staatsvertrags finden Anwendung. 2 § 19 des Jugendmedienschutz-<br />
Staatsvertrags gilt für lokale, regionale und landesweite Rundfunkangebote<br />
entsprechend.<br />
Bay MG Art. 7 Kurzberichterstattung, Übertragung von<br />
Großereignissen<br />
1<br />
Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung im Fernsehen über<br />
Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von allgemeinem<br />
Informationsinteresse sind, richtet sich nach § 5 des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
2<br />
Für die Übertragung von Großereignissen gilt § 4 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags.<br />
Bay MG Art. 8 Werbung, Teleshopping<br />
(1) 1 Für Werbung und Teleshopping gelten § 1 Abs. 3 und § 7 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags und § 6 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags.<br />
2<br />
Die §§ 44 bis 45 b des Rundfunkstaatsvertrags gelten entsprechend.<br />
(2) 1 Für regionale und lokale Fernsehprogramme gilt Abs. 1 mit folgenden<br />
Maßgaben:<br />
1. § 7 Abs. 4 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrags findet keine Anwendung;<br />
2. § 44 Abs. 3 bis 5 des Rundfunkstaatsvertrags findet keine Anwendung;<br />
bei der Einfügung von Werbung und Teleshopping-Spots in Sendungen<br />
sind natürliche Unterbrechungen im Ablauf der Sendungen und die Länge<br />
der Sendungen zu berücksichtigen; der gesamte Zusammenhang und der<br />
Charakter der Sendung dürfen nicht beeinträchtigt werden; es darf nicht<br />
gegen die Rechte von Rechteinhabern verstoßen werden;<br />
3. §§ 45, 45 a des Rundfunkstaatsvertrags finden keine Anwendung;<br />
Teleshopping-Fenster müssen klar als solche gekennzeichnet sein.<br />
2<br />
Einzelheiten, insbesondere zur Anwendung von Satz 1 bei<br />
Fensterprogrammen nach Art. 3 Abs. 3, regelt die Landeszentrale durch<br />
Satzung.<br />
Bay MG Art. 9 Sponsoring, Gewinnspiele<br />
1 Die Zulässigkeit von Sponsoring richtet sich nach § 8 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags. 2 Für Gewinnspiele gilt § 8 a des<br />
Rundfunkstaatsvertrags.
Zweiter Abschnitt Bayerische Landeszentrale für neue Medien<br />
Bay MG Art. 10 Rechtsform, Organe<br />
(1) 1 Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien ist eine rechtsfähige<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in München. 2 Sie hat das<br />
Recht der Selbstverwaltung. 3 Sie ist auch Landesmedienanstalt im Sinn<br />
des Rundfunkstaatsvertrags und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags.<br />
(2) Organe der Landeszentrale sind unbeschadet § 35 Abs. 2 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags und § 14 Abs. 2 Sätze 1 und 2 des<br />
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags<br />
1. der Medienrat,<br />
2. der Verwaltungsrat,<br />
3. der Präsident.<br />
(3) 1 Medienrat und Verwaltungsrat geben sich je eine Geschäftsordnung.<br />
2 Diese müssen Bestimmungen über die Frist und Form der Einladungen zu<br />
den Sitzungen sowie über den Geschäftsgang enthalten.<br />
Bay MG Art. 11 Aufgaben<br />
1 Die Landeszentrale regelt die Verbreitung von Rundfunkprogrammen<br />
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 2 Zur Erfüllung ihrer Funktion nach<br />
Art. 2 hat sie vor allem folgende Aufgaben:<br />
1. Sie sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen einschließlich<br />
der Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrags und des Jugendmedienschutz-<br />
Staatsvertrags,<br />
2. sie entwickelt unter Beachtung der Vorschriften des Art. 3 Konzepte für<br />
Programme privater Anbieter in Bayern und setzt diese technisch um,<br />
3. sie entwickelt ein technisches Konzept für eine landesweite, regionale und<br />
lokale Rundfunkstruktur in Bayern und legt die Versorgungsgebiete unter<br />
Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten, der vorhandenen<br />
Wirtschafts-, Kultur- und Kommunikationsräume sowie der wirtschaftlichen<br />
Tragfähigkeit für die Veranstaltung von Rundfunk fest,<br />
4. sie schließt mit Netzbetreibern, Betreibern von Kabelanlagen, dem<br />
Bayerischen Rundfunk und anderen Stellen Vereinbarungen über die<br />
Bereitstellung von technischen Einrichtungen, Dienstleistungen, Frequenzen<br />
und Kanälen sowie deren Nutzungsmerkmale. Sie entscheidet über die<br />
Zuweisung technischer Übertragungskapazitäten und nimmt die hierfür<br />
notwendigen Maßnahmen vor,<br />
5. sie arbeitet mit den zuständigen Stellen der Länder und des Bundes bei der<br />
Nutzung der für die unmittelbare Verteilung und die Heranführung von<br />
Rundfunksendungen bestimmten Satelliten nach den Maßgaben der<br />
Staatsregierung zusammen,<br />
6. sie stellt im Zusammenwirken mit den Landesmedienanstalten der anderen<br />
Länder sicher, dass in Bayern verbreitete bundesweite Rundfunkprogramme<br />
dem Rundfunkstaatsvertrag und dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag<br />
entsprechen und wirkt darauf hin, dass die in Bayern organisierten<br />
bundesweiten Rundfunkprogramme bei der Vergabe von<br />
Übertragungsmöglichkeiten in anderen Ländern angemessen berücksichtigt<br />
werden,<br />
7. sie wirkt nach den Maßgaben der Staatsregierung und unter
Berücksichtigung der örtlichen Belange auf eine den Erfordernissen der<br />
Raumordnungs- und Strukturpolitik entsprechende Versorgung Bayerns mit<br />
Frequenzen, Kabelanlagen und den für die Zuführung und Verbreitung von<br />
Rundfunksendungen notwendigen technischen Einrichtungen hin, insbesondere<br />
auf eine angemessene Versorgung des ländlichen Raums, strukturschwacher<br />
Gebiete und des Grenzlandes,<br />
8. sie wirkt darauf hin, dass der Meinungsvielfalt, vor allem kulturellen,<br />
kirchlichen, sozialen und wirtschaftlichen Anliegen, Rechnung getragen wird<br />
und dass unter Beachtung der Grundsätze des Art. 25 Abs. 3 die Beteiligung<br />
neuer, insbesondere mittelständischer Anbieter gestärkt wird; sie wirkt ferner<br />
darauf hin, dass die von ihr organisierten Rundfunkprogramme einen<br />
angemessenen Anteil von Beiträgen mit kulturellen, kirchlichen, sozialen und<br />
wirtschaftlichen Inhalten aufweisen. Sie betraut lokale und regionale<br />
Fernsehanbieter mit der öffentlichen Aufgabe und fördert deren<br />
Fernsehangebote nach Maßgabe von Art. 23. Sie wirkt außerdem darauf hin,<br />
dass die Fernsehvollprogramme und, wenn dies nach ihren inhaltlichen<br />
Schwerpunkten möglich ist, die Fernsehspartenprogramme auch einen<br />
wesentlichen Anteil an Produktionen sowie Auftrags- und<br />
Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutschsprachigen und europäischen<br />
Raum enthalten; hierüber verlangt sie von den Anbietern Nachweise und<br />
Berichte,<br />
9. sie fördert unter Beachtung der Grundsätze des Art. 25 Abs. 3 die Vielfalt<br />
und die Qualität der Rundfunkprogramme einschließlich der technischen<br />
Voraussetzungen für ihre Verbreitung; gemeinnützige Anbieter und Zulieferer<br />
sind dabei besonders zu berücksichtigen,<br />
10. sie stellt eine ausgewogene landesweite Rundfunkstruktur sicher. Zur<br />
Erreichung dieses Ziels fördert sie lokale und regionale Rundfunkanbieter unter<br />
Beachtung der Grundsätze des Art. 25 Abs. 3 und unter Berücksichtigung der<br />
Möglichkeiten, die Angebote mit selbst erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren;<br />
im Aufbau befindliche Rundfunkangebote und gemeinnützige Anbieter und<br />
Zulieferer sind dabei besonders zu berücksichtigen,<br />
11. sie fördert unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 8 und in Abstimmung<br />
mit den Maßnahmen im Rahmen der Richtlinien für die bayerische Film- und<br />
Fernsehförderung freie mittelständische Film- und Fernsehproduktionen,<br />
12. sie führt Untersuchungen und Erhebungen zu Fragen der Programminhalte,<br />
insbesondere der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Akzeptanz von<br />
Rundfunkprogrammen durch,<br />
13. sie leistet einen Beitrag zur Aus- und Fortbildung von Fachkräften für den<br />
Medienbereich,<br />
14. sie wirkt auf die Archivierung von Programmen privater Anbieter hin und<br />
15. sie leistet einen Beitrag zur Vermittlung eines verantwortungsbewussten<br />
Gebrauchs der Medien, insbesondere zur Medienerziehung und<br />
Medienpädagogik.<br />
Bay MG Art. 12 Medienrat<br />
(1) Die Aufgaben der Landeszentrale werden durch den Medienrat<br />
wahrgenommen, soweit nicht der Verwaltungsrat oder der Präsident<br />
selbstständig entscheiden.<br />
(2) 1 Der Medienrat wahrt die Interessen der Allgemeinheit, sorgt für<br />
Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt und überwacht die Einhaltung der
Programmgrundsätze. 2 Er entscheidet im Rahmen dieses <strong>Gesetze</strong>s vor<br />
allem über<br />
1. die Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung,<br />
2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats,<br />
3. die Wahl des Präsidenten nach Anhörung des Verwaltungsrats,<br />
4. die Zustimmung zum Haushalts- und zum Finanzplan sowie zum<br />
Jahresabschluss,<br />
5. den Erlass von Satzungen nach Maßgabe dieses <strong>Gesetze</strong>s, soweit nicht<br />
der Verwaltungsrat zuständig ist, nach Maßgabe des § 53 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags und nach Maßgabe der §§ 9, Abs. 2, 14 Abs. 7<br />
und 15 Abs. 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags,<br />
6. die Genehmigung von Angeboten,<br />
7. den Erlass von Satzungen oder die Aufstellung von Richtlinien nach<br />
Maßgabe der §§ 33 und 46 des Rundfunkstaatsvertrags und nach<br />
Maßgabe des § 15 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags,<br />
8. die Zustimmung zu dem vom Präsidenten bestimmten Geschäftsführer<br />
(Art. 15 Abs. 4 Satz 2),<br />
9. die Fördermaßnahmen nach Art. 11 Satz 2 Nrn. 9 und 10 einschließlich<br />
der Aufstellung von Förderrichtlinien und die Maßnahmen nach Art. 11<br />
Satz 2 Nr. 13,<br />
10. die Zustimmung zu den Satzungen nach Art. 22 Abs. 2, Art. 23<br />
Abs. 12, nach § 35 Abs. 10 und 11 des Rundfunkstaatsvertrags und nach<br />
Art. 5 Abs. 1 des <strong>Gesetze</strong>s zur Ausführung des Rundfunkstaatsvertrags<br />
und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags.<br />
(3) 1 Der Medienrat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder<br />
seine Befugnisse mit Ausnahme derjenigen nach Abs. 2 Satz 2 Nrn. 2 bis<br />
5 sowie 7, 8 und 10 beschließenden Ausschüssen oder dem Präsidenten<br />
übertragen; soweit für die Wahrnehmung dieser Befugnisse Satzungen<br />
oder Richtlinien bestehen, kann er Befugnisse in Einzelfällen auf den<br />
Präsidenten übertragen. 2 Diese Beschlüsse können von der Mehrheit der<br />
Mitglieder des Medienrats widerrufen werden. 3 Von den auf Grund<br />
übertragener Befugnisse getroffenen Entscheidungen sind die Mitglieder<br />
des Medienrats zu unterrichten.<br />
(4) 1 Zur Vorbereitung seiner Beratungen soll der Medienrat beratende<br />
Ausschüsse bilden. 2 Die Ausschüsse und der Medienrat können die vom<br />
jeweiligen Verhandlungsgegenstand betroffenen Anbieter anhören.<br />
Bay MG Art. 13 Mitglieder des Medienrats<br />
(1) 1 Der Medienrat setzt sich zusammen aus<br />
1. zwölf Vertretern des Landtags,<br />
Amtliche Fußnote: Die Änderungen durch das Gesetz zur Änderung des Bayerischen<br />
Rundfunkgesetzes und des Bayerischen Mediengesetzes vom 25. Juli 2000 (GVBl S. 488)<br />
gelten nach § 3 Abs. 2 dieses <strong>Gesetze</strong>s nicht für die Vertreter des 14. Landtags im Medienrat.<br />
die dieser entsprechend dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen<br />
Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen nach dem Verfahren<br />
Sainte-Laguë/Schepers bestimmt; jede Partei und sonstige organisierte<br />
Wählergruppe stellt mindestens einen Vertreter,<br />
2. einem Vertreter der Staatsregierung,<br />
3. je einem Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der<br />
Israelitischen Kultusgemeinden,
4. je einem Vertreter der Gewerkschaften, des Bayerischen<br />
Bauernverbands, der Industrie- und Handelskammern und der<br />
Handwerkskammern,<br />
5. je einem Vertreter des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen<br />
Landkreistags und des Bayerischen Gemeindetags,<br />
6. einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen Landesverband Bayern,<br />
7. fünf Frauen, von denen je eine von den Gewerkschaften, vom<br />
Bauernverband, von den katholischen und evangelischen kirchlichen<br />
Frauenorganisationen und vom Bayerischen Landessportverband zu<br />
benennen ist,<br />
8. einem Vertreter des Bayerischen Jugendrings,<br />
9. einem Vertreter des Bayerischen Landessportverbands,<br />
10. je einem Vertreter der Schriftsteller-, der Komponisten- und der<br />
Musikorganisationen,<br />
11. einem Vertreter der Intendanzen (Direktionen) der Bayerischen<br />
Staatstheater und einem Vertreter der Leiter der Bayerischen<br />
Schauspielbühnen,<br />
12. je einem Vertreter des Bayerischen Journalistenverbands und des<br />
Bayerischen Zeitungsverlegerverbands,<br />
13. einem Vertreter der bayerischen Hochschulen,<br />
14. je einem Vertreter der Lehrerverbände, der Elternvereinigungen und<br />
der Organisationen der Erwachsenenbildung,<br />
15. einem Vertreter des Bayerischen Heimattags,<br />
16. einem Vertreter der Familienverbände,<br />
17. einem Vertreter der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft,<br />
18. einem Vertreter des Bundes Naturschutz in Bayern,<br />
19. einem Vertreter des Verbandes der freien Berufe.<br />
2<br />
Die entsendungsberechtigten Organisationen oder Stellen haben bei der<br />
Auswahl ihrer Vertreter auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen<br />
und Männern hinzuwirken.<br />
(2) 1 Die Mitglieder des Medienrats dürfen keine Sonderinteressen vertreten,<br />
die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gefährden; sie sind an<br />
Aufträge nicht gebunden. 2 Sie dürfen nicht zugleich Mitglied eines Organs<br />
einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die unter Abs. 1 Nrn. 1, 3 bis<br />
19 genannten Vertreter auch nicht Mitglieder der Staatsregierung sein.<br />
(3) 1 Die Mitglieder des Medienrats werden jeweils für fünf Jahre entsandt.<br />
2<br />
Die Staatsregierung kann durch Rechtsverordnung das Auswahl- und<br />
Entsendungsverfahren in den Fällen regeln, in denen die Entsendung eines<br />
Mitglieds des Medienrats mehreren Organisationen oder Stellen obliegt.<br />
3 4<br />
Die Amtszeit beginnt unbeschadet des Satzes 5 am 1. Mai. Die<br />
entsendende Organisation oder Stelle kann das von ihr benannte Mitglied<br />
bei seinem Ausscheiden aus dieser Organisation oder Stelle abberufen.<br />
5<br />
Die Amtszeit der vom Landtag entsandten Mitglieder beginnt mit dem<br />
Zeitpunkt der Entsendung; sie endet mit der Entsendung der neuen<br />
Vertreter zu Beginn der nächsten Legislaturperiode. 6 Der Landtag kann<br />
ein von ihm entsandtes Mitglied des Medienrats auf Vorschlag der<br />
Vertreter der Partei im Landtag, welche das Mitglied nominiert hat,<br />
abberufen, wenn das Mitglied nicht mehr dieser Partei angehört, und<br />
einen neuen Vertreter entsenden. 7 Scheidet ein Mitglied während der<br />
Amtszeit aus, so wird der Nachfolger für den Rest der Amtszeit entsandt.
(4) 1 Die Mitglieder des Medienrats sind ehrenamtlich tätig. 2 Die Einzelheiten<br />
ihrer Aufwandsentschädigung regelt die Landeszentrale durch Satzung.<br />
Bay MG Art. 14 Verwaltungsrat<br />
(1) 1 Der Verwaltungsrat ist für die wirtschaftlichen Angelegenheiten der<br />
Anstalt zuständig. 2 Ihm obliegt vor allem<br />
1. die Beschlussfassung über den Haushalts- und den Finanzplan sowie<br />
über den Jahresabschluss,<br />
2. der Erlass der Satzungen nach Art. 22 Abs. 2, Art. 23 Abs. 12, nach<br />
§ 35 Abs. 10 und 11 des Rundfunkstaatsvertrags und nach Art. 5 Abs. 1<br />
des <strong>Gesetze</strong>s zur Ausführung des Rundfunkstaatsvertrags und des<br />
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags,<br />
3. die Zustimmung zu der Satzung nach Art. 13 Abs. 4,<br />
4. der Abschluss der Dienstverträge mit dem Präsidenten,<br />
5. die Aufstellung einer Geschäftsanweisung nach Anhörung des<br />
Medienrats.<br />
(2) 1 Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus<br />
1. zwei Mitgliedern, die Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
sind,<br />
2. zwei Mitgliedern, die als Anbieter tätig sind, einem Organ eines<br />
Anbieters angehören oder in einem Beschäftigungsverhältnis zu einem<br />
Anbieter stehen,<br />
3. fünf weiteren Mitgliedern, die nicht den in den Nrn. 1 und 2 genannten<br />
Personenkreisen angehören.<br />
2<br />
Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Medienrat in geheimer<br />
Einzelabstimmung gewählt. 3 Wählbar sind auch Mitglieder des Medienrats.<br />
4<br />
In den Fällen des Satz 1 Nr. 1 können der Bayerische Städtetag, der<br />
Bayerische Gemeindetag und der Bayerische Landkreistag, in den Fällen<br />
des Satz 1 Nr. 2 die Anbieter Wahlvorschläge einreichen.<br />
(3) 1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils für fünf Jahre gewählt.<br />
2<br />
Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und dürfen keine Sonderinteressen<br />
vertreten, die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gefährden;<br />
sie sind an Aufträge nicht gebunden. 3 Sie dürfen nicht gleichzeitig dem<br />
Medienrat oder einem Organ einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt<br />
angehören.<br />
(4) Die Fragen der Aufwandsentschädigung sowie Einzelheiten des Vorschlags,<br />
der Wahl und der Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats regelt<br />
die Landeszentrale durch Satzung.<br />
Bay MG Art. 15 Präsident<br />
(1) 1 Der Präsident trägt die Verantwortung für die Geschäftsführung und<br />
vertritt die Landeszentrale gerichtlich und außergerichtlich. 2 Er wird auf<br />
die Dauer von fünf Jahren vom Medienrat nach Anhörung des<br />
Verwaltungsrats gewählt und darf nicht gleichzeitig Mitglied des<br />
Verwaltungsrats, des Medienrats oder eines Organs einer öffentlichrechtlichen<br />
Rundfunkanstalt sein.<br />
(2) 1 Der Präsident hat das Recht, im Medienrat und im Verwaltungsrat<br />
Anträge zu stellen. 2 Er erledigt in eigener Zuständigkeit<br />
1. die laufenden Angelegenheiten, die keine grundsätzliche Bedeutung
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen,<br />
2. den Vollzug der Beschlüsse des Medienrats und des Verwaltungsrats<br />
und die ihm nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 übertragenen Aufgaben,<br />
3. den Erlass dringlicher Anordnungen und die Besorgung<br />
unaufschiebbarer Geschäfte an Stelle der anderen Organe der<br />
Landeszentrale,<br />
4. Personalangelegenheiten nach Maßgabe der Geschäftsanweisung.<br />
3<br />
Von dringlichen Anordnungen und von der Besorgung unaufschiebbarer<br />
Geschäfte im Fall des Satzes 2 Nr. 3 unterrichtet der Präsident das<br />
zuständige Organ der Landeszentrale.<br />
(3) Der Präsident kann aus wichtigem Grund vom Medienrat mit der Mehrheit<br />
von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder abberufen werden.<br />
(4) 1 Die Vertretung des Präsidenten erfolgt durch den Geschäftsführer. 2 Der<br />
Präsident bestimmt den Geschäftsführer mit Zustimmung des Medienrats.<br />
3<br />
Legt der Präsident sein Amt nieder, wird er abberufen oder scheidet er<br />
aus sonstigen Gründen vor Ablauf der regulären Amtszeit aus dem Amt,<br />
kann der Medienrat bis zur Wahl eines neuen Präsidenten abweichend von<br />
Satz 1 eine andere Person mit der Wahrnehmung der Aufgaben des<br />
Präsidenten beauftragen.<br />
Bay MG Art. 16 Anordnungen<br />
(1) 1 Die Landeszentrale kann gegenüber Anbietern, Betreibern von<br />
Kabelanlagen, Netzbetreibern und sonstigen technischen Dienstleistern<br />
zur Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags, des<br />
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags, dieses <strong>Gesetze</strong>s und der nach<br />
diesem Gesetz erlassenen Satzungsbestimmungen, Richtlinien und<br />
Bescheide die erforderlichen Anordnungen treffen. 2 Sie kann verlangen,<br />
dass ihr Anbieter Beiträge vor der Sendung vorlegen.<br />
(2) 1 Tritt die Landeszentrale an einen landesweiten, regionalen oder lokalen<br />
Rundfunkanbieter mit dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestimmungen<br />
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags verstoßen, und weist der<br />
Anbieter nach, dass er die Sendung vor ihrer Ausstrahlung einer<br />
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinn des<br />
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags vorgelegt und deren Vorgaben<br />
beachtet hat, so sind Maßnahmen durch die Landeszentrale im Hinblick<br />
auf die Einhaltung der Bestimmungen zum Jugendschutz durch den<br />
Anbieter nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder die Unterlassung<br />
einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen<br />
Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums<br />
überschreitet. 2 Bei nichtvorlagefähigen Sendungen ist vor Maßnahmen bei<br />
behaupteten Verstößen gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme von<br />
Verstößen gegen § 4 Abs. 1 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags,<br />
durch die Landeszentrale die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen<br />
Selbstkontrolle, der der Anbieter angeschlossen ist, zu befassen; Satz 1<br />
gilt entsprechend. 3 Für Entscheidungen nach den §§ 8 und 9<br />
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag gilt Satz 1 entsprechend.<br />
(3) Hat ein Anbieter in einer bereits verbreiteten Rundfunksendung gegen die<br />
Grundsätze des Art. 5 oder gegen Art. 6 verstoßen, kann die<br />
Landeszentrale auch anordnen, dass zu Lasten der Sendezeit dieses
Anbieters auf dessen Kosten ein Beitrag verbreitet wird, der geeignet ist,<br />
den Verstoß auszugleichen.<br />
Bay MG Art. 17 Beschwerderecht<br />
Jeder hat das Recht, sich mit einer Beschwerde an die Landeszentrale zu<br />
wenden.<br />
Bay MG Art. 18 Gegendarstellung<br />
(1) 1 Die Gegendarstellung einer Person oder Stelle, die durch eine in einer<br />
Rundfunksendung aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, ist vom<br />
Anbieter dieser Sendung auf seine Kosten zu verbreiten. 2 Die<br />
Gegendarstellung muss die beanstandete Sendung bezeichnen, sich auf<br />
tatsächliche Angaben beschränken, vom Betroffenen unterzeichnet sein<br />
und dem Anbieter oder der Landeszentrale unverzüglich, spätestens<br />
innerhalb von zwei Monaten zugehen. 3 Der Anbieter muss die<br />
Gegendarstellung unverzüglich mit einer Stellungnahme an die<br />
Landeszentrale weiterleiten, die über die Verbreitung umgehend<br />
entscheidet. 4 Wurde die Gegendarstellung unmittelbar der Landeszentrale<br />
zugeleitet, holt diese vor der Entscheidung über die Verbreitung eine<br />
Stellungnahme des Anbieters ein. 5 Eine ablehnende Entscheidung der<br />
Landeszentrale ist unter Angabe der Gründe unverzüglich schriftlich zu<br />
verbescheiden und dem Anbieter und dem Antragsteller zuzustellen. 6 Ein<br />
zweites Verlangen ist zulässig, wenn es den Gründen der Ablehnung<br />
Rechnung trägt und dem Anbieter oder der Landeszentrale spätestens<br />
innerhalb eines Monats nach Zustellung der ablehnenden Entscheidung<br />
zugeht.<br />
(2) 1 Die Gegendarstellung muss unverzüglich zu einer gleichwertigen<br />
Sendezeit und in der gleichen Angebotsform wie die beanstandete<br />
Sendung, auch bei jeder Wiederholung der Sendung, ohne Einschaltungen<br />
und Weglassungen verbreitet werden. 2 Eine Erwiderung auf die<br />
Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken.<br />
(3) Eine Verpflichtung zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht,<br />
wenn<br />
1. Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Gegendarstellung haben,<br />
2. ihr Umfang unangemessen über den der beanstandeten Sendung<br />
hinausgeht oder<br />
3. die Gegendarstellung einen strafbaren Inhalt hat.<br />
(4) 1 Der Anspruch auf Verbreitung der Gegendarstellung kann auch im<br />
Zivilrechtsweg, jedoch nur gegenüber der Landeszentrale und dem<br />
betroffenen Anbieter gemeinsam verfolgt werden. 2 Auf dieses Verfahren<br />
sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf<br />
Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. 3 Eine<br />
Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden.<br />
4<br />
Ein Hauptsacheverfahren findet nicht statt.<br />
(5) 1 Art. 29 Abs. 2 gilt für die Gegendarstellung entsprechend. 2 Führt die<br />
journalistisch-redaktionelle Verwendung personenbezogener Daten durch<br />
einen Anbieter zur Veröffentlichung von Gegendarstellungen des<br />
Betroffenen, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten
Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die<br />
Daten selbst.<br />
Bay MG Art. 19 Rechtsaufsicht<br />
1 Die Landeszentrale unterliegt der Rechtsaufsicht des Staatsministeriums für<br />
Wissenschaft, Forschung und Kunst. 2 Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst<br />
zulässig, wenn die zuständigen Organe der Landeszentrale die ihnen<br />
obliegenden Pflichten in angemessener Frist nicht oder nicht hinreichend<br />
erfüllen. 3 Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ist<br />
berechtigt, der Landeszentrale im Einzelfall eine angemessene Frist zur<br />
Wahrnehmung ihrer Pflichten zu setzen.<br />
Bay MG Art. 20 Datenschutz<br />
(1) Soweit in den Abs. 2 bis 6 nichts anderes bestimmt ist, ist für die<br />
Landeszentrale und für die Anbieter § 47 des Rundfunkstaatsvertrags<br />
anzuwenden.<br />
(2) Für die ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken<br />
erfolgende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener<br />
Daten gelten von den Vorschriften des Bayerischen Datenschutzgesetzes<br />
(BayDSG) nur die Art. 5 bis 8.<br />
(3) 1 Der Präsident der Landeszentrale beruft mit Zustimmung des<br />
Verwaltungsrats einen Beauftragten für den Datenschutz bei der<br />
Landeszentrale. 2 Dieser überwacht die Einhaltung der Vorschriften dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der<br />
Landeszentrale und den Anbietern. 3 Dies gilt auch, soweit es sich um<br />
Verwaltungsangelegenheiten handelt. 4 Art. 9, 25 Abs. 2 bis 4 und Art. 29<br />
bis 33 BayDSG finden keine Anwendung. 5 Art. 26 und 27 BayDSG finden<br />
mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des behördlichen<br />
Datenschutzbeauftragten der Beauftragte für den Datenschutz bei der<br />
Landeszentrale tritt. 6 Dieser ist in Ausübung seines Amts unabhängig und<br />
nur dem Gesetz unterworfen. 7 Im Übrigen untersteht er der<br />
Dienstaufsicht des Verwaltungsrats.<br />
(4) 1 Landeszentrale und Anbieter haben dem Beauftragten für den<br />
Datenschutz bei der Landeszentrale auf Verlangen die für die Erfüllung<br />
seiner Aufgaben nach Abs. 3 erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu<br />
erteilen; Anbieter sind verpflichtet, dem Beauftragten zur Erfüllung seiner<br />
Aufgaben jederzeit die kostenlose Kontrolle von Angeboten zu<br />
gewährleisten. 2 Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche<br />
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383<br />
Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der<br />
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem<br />
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 3 Der<br />
Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen. 4 Der Beauftragte ist befugt,<br />
zur Überwachung des Datenschutzes Geschäftsräume der in Satz 1<br />
genannten Stellen zu betreten, dort die notwendigen Prüfungen<br />
vorzunehmen und geschäftliche Unterlagen, Daten und<br />
Datenverarbeitungsprogramme einzusehen. 5 Das Grundrecht der<br />
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106<br />
Abs. 3 der Verfassung) sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10
des Grundgesetzes, Art. 112 Abs. 1 der Verfassung) werden insoweit<br />
eingeschränkt.<br />
(5) Jeder kann sich an den Beauftragten für den Datenschutz bei der<br />
Landeszentrale mit dem Vorbringen wenden, bei der Erhebung,<br />
Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch die<br />
Landeszentrale oder einen Anbieter in seinen Rechten verletzt worden zu<br />
sein.<br />
(6) 1 Bei Beanstandungen verständigt der Beauftragte für den Datenschutz bei<br />
der Landeszentrale den Präsidenten und den Verwaltungsrat. 2 Er erstattet<br />
den Organen der Landeszentrale mindestens alle zwei Jahre einen Bericht<br />
über seine Tätigkeit. 3 Auf Beschluss eines Organs der Landeszentrale<br />
erstattet er darüber hinaus besondere Berichte.<br />
Bay MG Art. 21 Finanzierung, Haushaltsführung, Rechnungsprüfung<br />
(1) Die Landeszentrale finanziert ihre Aufgaben nach Art. 11 aus<br />
1. Entgelten,<br />
2. dem Anteil an der Rundfunkgebühr nach § 40 in Verbindung mit § 63<br />
des Rundfunkstaatsvertrags, §§ 10 und 11 des<br />
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags,<br />
3. sonstigen Einnahmen.<br />
(2) 1 Die Haushaltsführung, Rechnungslegung, Prüfung und Entlastung richten<br />
sich nach Art. 105 Abs. 1 der Bayerischen Haushaltsordnung; Art. 108 und<br />
109 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 der Bayerischen Haushaltsordnung finden<br />
keine Anwendung. 2 Der Oberste Rechnungshof prüft gemäß Art. 111<br />
Abs. 1 der Bayerischen Haushaltsordnung die Haushalts- und<br />
Wirtschaftsführung. 3 Er unterrichtet die Rechtsaufsichtsbehörde, den<br />
Bayerischen Landtag und den Verwaltungsrat der Landeszentrale über die<br />
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und die finanzielle Entwicklung der<br />
Landeszentrale.<br />
(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind entsprechend den handelsund<br />
aktienrechtlichen Bilanzierungsvorschriften für große<br />
Aktiengesellschaften aufzustellen und unter Einbeziehung der Buchführung<br />
durch einen unabhängigen Abschlussprüfer zu prüfen.<br />
(4) 1 Der Oberste Rechnungshof prüft entsprechend Art. 111 Abs. 1 der<br />
Bayerischen Haushaltsordnung die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei<br />
solchen Unternehmen des privaten Rechts, an denen die Landeszentrale<br />
unmittelbar, mittelbar oder zusammen mit anderen Anstalten oder<br />
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der Mehrheit beteiligt ist und<br />
deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen durch den<br />
Obersten Rechnungshof vorsieht. 2 Die Landeszentrale ist verpflichtet, für<br />
die Aufnahme der erforderlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag<br />
oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen.<br />
(5) Bei der Unterrichtung über die Ergebnisse von Prüfungen nach Abs. 4<br />
achtet der Oberste Rechnungshof darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der geprüften Unternehmen nicht beeinträchtigt wird und insbesondere<br />
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden.
Bay MG Art. 22 Kosten<br />
(1) 1 Für Amtshandlungen im Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s, des<br />
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags und des Rundfunkstaatsvertrags<br />
erhebt die Landeszentrale unbeschadet des § 35 Abs. 11 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe<br />
einer Gebührensatzung. 2 Die Kosten fließen der Landeszentrale zu.<br />
(2) 1 Die Landeszentrale wird ermächtigt, die gebührenpflichtigen Tatbestände<br />
und die Höhe der Gebühren durch Satzung zu bestimmen. 2 Die Höhe der<br />
Gebühr bemisst sich nach dem Verwaltungsaufwand und der Bedeutung<br />
der Angelegenheit, insbesondere dem wirtschaftlichen oder sonstigen<br />
Interesse des Gebührenschuldners. 3 Die Mindestgebühr beträgt 50 €, die<br />
Höchstgebühr 100 000 €.<br />
(3) 1 Für Amtshandlungen, die nicht in der Satzung bewertet sind, gelten<br />
Abs. 2 Sätze 2 und 3 entsprechend. 2 Art. 2 und 7 bis 19 des<br />
Kostengesetzes finden entsprechende Anwendung.<br />
(4) 1 Die Kosten werden durch Leistungsbescheid geltend gemacht. 2 Die<br />
Landeszentrale ist zur Anbringung der Vollstreckungsklausel befugt.<br />
Dritter Abschnitt Förderung von lokalen und regionalen<br />
Fernsehangeboten, Organisation und Genehmigung von<br />
Rundfunkprogrammen<br />
Bay MG Art. 23 Förderung von lokalen und regionalen<br />
Fernsehangeboten<br />
(1) 1 Die in Erfüllung der öffentlichen Aufgabe nach den Abs. 2 bis 4<br />
hergestellten und verbreiteten lokalen und regionalen Fernsehangebote<br />
werden nach Maßgabe der Abs. 6 bis 12 gefördert. 2 Damit soll<br />
sichergestellt werden, dass die Bevölkerung Bayerns flächendeckend und<br />
gleichwertig mit hochwertigen lokalen und regionalen Fernsehangeboten<br />
neben bestehenden lokalen und regionalen Hörfunkangeboten, sonstigen<br />
elektronischen Medien und Druckwerken versorgt wird.<br />
(2) 1 Die Landeszentrale kann nach Art. 26 genehmigte lokale und regionale<br />
Fernsehanbieter mit der öffentlichen Aufgabe, die bestehende Vielfalt der<br />
Meinungen im jeweiligen Versorgungsgebiet durch qualitätvolle<br />
Fernsehprogramme in gleichgewichtiger Weise zum Ausdruck zu bringen,<br />
betrauen. 2 Weitere Voraussetzung für die Betrauung ist eine plurale<br />
gesellschaftsrechtliche Zusammensetzung des Anbieters, die keinem<br />
Gesellschafter einen beherrschenden Einfluss in den Organen der<br />
Gesellschaft ermöglicht, oder die Einrichtung eines Programmausschusses.<br />
3<br />
Der Programmausschuss wird vom Medienrat aus seiner Mitte bestellt.<br />
4<br />
Unbeschadet der Trägerschaftsbefugnisse der Landeszentrale hat der<br />
Programmausschuss alle Rechte eines Programmbeirats im Sinn des § 32<br />
des Rundfunkstaatsvertrags; das Nähere regelt die Landeszentrale durch<br />
Satzung. 5 Mit der Betrauung sind die Anbieter unbeschadet der Vorgaben<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s für Rundfunkangebote verpflichtet<br />
1. zur Herstellung und Verbreitung jeweils eines aktuellen und<br />
authentischen Nachrichten- und Informationsprogramms von Montag bis<br />
Freitag mit einem täglichen zeitlichen Produktionsumfang von 20 Minuten
ohne Hinzurechnung der Sendezeit für Werbung. Das Programm setzt sich<br />
zusammen aus Beiträgen zum örtlichen Geschehen, insbesondere aus den<br />
Bereichen Politik, Kultur, Kirche, Wirtschaft und Soziales und dient den<br />
Kommunikationsinteressen aller Fernsehzuschauer in dem lokalen oder<br />
regionalen Versorgungsgebiet. In dem Programm wird über die in dem<br />
jeweiligen Versorgungsgebiet relevanten gesellschaftlichen und politischen<br />
Kräfte mit der gebotenen journalistischen Sorgfalt berichtet. Diese Kräfte<br />
sollen auch in angemessenem Umfang in dem Programm zu Wort<br />
kommen.<br />
2. zur Herstellung und Verbreitung eines zusätzlichen authentischen<br />
lokalen oder regionalen Programms bis zu einem gesamten zeitlichen<br />
Produktionsumfang von 100 Minuten in der Woche ohne Hinzurechnung<br />
der Sendezeit für Werbung. Das Programm setzt sich zusammen aus<br />
Beiträgen zu besonderen lokalen oder regionalen Ereignissen und aus<br />
Beiträgen aus den Bereichen Bildung, Heimatgeschichte, Kunst,<br />
Brauchtum, Information, Beratung, Sport und Unterhaltung, jeweils mit<br />
engem lokalen oder regionalen Bezug. Die Verpflichtung kann auch durch<br />
die Aufnahme eines lokalen oder regionalen Spartenprogramms erfüllt<br />
werden.<br />
3. zur mehrfach wiederholten Ausstrahlung der in den Nrn. 1 und 2<br />
genannten Programme entsprechend den Informationsinteressen und<br />
Sehgewohnheiten der Zuschauer.<br />
(3) 1 Die Landeszentrale kann Anbieter in Ballungsräumen über die Vorgaben<br />
des Abs. 2 hinaus mit der Herstellung und Verbreitung eines weiteren<br />
Programms im Sinn von Abs. 2 Satz 5 Nr. 2 betrauen. 2 Die<br />
Landeszentrale kann insbesondere bei Anbietern in kleineren<br />
Versorgungsgebieten von der Verpflichtung nach Abs. 2 Satz 5 Nr. 2<br />
absehen.<br />
(4) Ein Anbieter kann auch mit der Herstellung und Verbreitung eines lokalen<br />
oder regionalen Spartenprogramms betraut werden, wenn dieses<br />
Programm einen in Abs. 2 Satz 5 Nrn. 1 und 2 genannten Bereich betrifft,<br />
einen lokalen und regionalen Bezug hat und zusätzlich zur<br />
Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet beiträgt.<br />
(5) 1 Die Betrauung ist befristet auszusprechen. 2 Sie kann mit einer<br />
Neugenehmigung oder mit der Verlängerung einer Genehmigung<br />
verbunden werden. 3 Rechtsansprüche auf finanzielle oder sonstige<br />
Fördermaßnahmen werden mit der Betrauung nicht begründet.<br />
(6) 1 Die Landeszentrale sorgt dafür, dass die lokalen und regionalen<br />
Fernsehangebote nach den Abs. 2 bis 4 im Rahmen der technischen und<br />
finanziellen Möglichkeiten insgesamt flächendeckend über die für<br />
Fernsehen allgemein üblichen technischen Wege verbreitet werden.<br />
2<br />
Dabei ist die fortschreitende Digitalisierung, die Eignung des jeweiligen<br />
Verbreitungswegs für lokales und regionales Fernsehen und das Verhältnis<br />
der möglichen Reichweite zu den Kosten zu berücksichtigen.<br />
(7) 1 Die Förderung lokaler und regionaler Fernsehangebote nach den Abs. 2<br />
bis 4 erfolgt aus staatlichen Mitteln nach Maßgabe des Staatshaushalts<br />
und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 2 Im Rahmen<br />
der Förderung erhält die Landeszentrale als Erstempfänger eine<br />
Zuwendung. 3 Die Landeszentrale leitet die Mittel an die
Zuwendungsberechtigten weiter. 4 Dabei entscheidet sie in eigener<br />
Verantwortung über das Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen. 5 Die<br />
Landeszentrale fördert die lokalen und regionalen Fernsehangebote auf<br />
Antrag in Form von Zuwendungsbescheiden. 6 Dabei ist sicherzustellen,<br />
dass die Ziele dieses <strong>Gesetze</strong>s jeweils mit dem geringsten Aufwand<br />
erreicht werden. 7 Rechtsansprüche auf finanzielle oder sonstige<br />
Fördermaßnahmen werden nicht begründet.<br />
(8) Bei der Festlegung der Höhe der Förderung berücksichtigt die<br />
Landeszentrale insbesondere die Größe des jeweiligen<br />
Versorgungsgebiets, den Aufwand zur technischen Verbreitung des<br />
Programms sowie die Möglichkeit des Anbieters, das Programm selbst zu<br />
finanzieren.<br />
(9) Die Förderung darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um<br />
die durch die Erfüllung der Aufgaben nach den Abs. 2 bis 4 und 6<br />
verursachten Ausgaben unter Berücksichtigung der dabei erzielten<br />
Einnahmen und sonstiger Förderungen abzudecken.<br />
(10) Wenn die Erfüllung der Aufgaben nach den Abs. 2 bis 4 nur einen Teil der<br />
Tätigkeiten eines Anbieters ausmacht, müssen die Einnahmen und<br />
Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgabe und der<br />
Ausführung von anderweitigen Leistungen in den Büchern getrennt<br />
ausgewiesen werden.<br />
(11) Die Anbieter und die Landeszentrale halten sämtliche Unterlagen, anhand<br />
derer sich feststellen lässt, ob eine Förderung nach den Abs. 2 bis 10<br />
ordnungsgemäß durchgeführt wurde, mindestens für einen Zeitraum von<br />
zehn Jahren vor.<br />
(12) Weitere Einzelheiten der Förderung nach dieser Vorschrift regelt die<br />
Landeszentrale durch Satzung.<br />
Bay MG Art. 24 Anbieter<br />
(1) Nach diesem Gesetz können Rundfunkprogramme und -sendungen<br />
anbieten<br />
1. natürliche Personen,<br />
2. auf Dauer angelegte nicht rechtsfähige Personenvereinigungen des<br />
Privatrechts,<br />
3. juristische Personen des Privatrechts,<br />
4. juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht einer<br />
Fachaufsicht oder sonstigem staatlichen oder kommunalen Einfluss<br />
unterliegen oder wenn sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im<br />
privatwirtschaftlichen Wettbewerb stehen,<br />
5. öffentlich-rechtliche Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften.<br />
(2) 1 Staatliche Stellen können nur Aufführungen ihrer Theater und Orchester<br />
anbieten. 2 Kommunale Gebietskörperschaften und ihre<br />
Zusammenschlüsse sowie sonstige juristische Personen des öffentlichen<br />
Rechts können darüber hinaus auch andere kulturelle Veranstaltungen<br />
ihrer Einrichtungen anbieten.<br />
(3) 1 Politische Parteien oder Wählergruppen und Unternehmen und<br />
Vereinigungen, an denen politische Parteien und Wählergruppen<br />
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, dürfen keine
Rundfunkprogramme und -sendungen anbieten. 2 Das Gleiche gilt für<br />
Treuhandverhältnisse und stille Beteiligungen von politischen Parteien und<br />
Wählergruppen. 3 Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf<br />
geringfügige mittelbare Beteiligungen ohne Stimm- und Kontrollrecht.<br />
Bay MG Art. 25 Inhalt der Angebote, Organisationsverfahren<br />
(1) 1 Die Verbreitung von Rundfunkangeboten bedarf der Genehmigung der<br />
Landeszentrale. 2 Der Antrag auf Genehmigung ist bei der Landeszentrale<br />
einzureichen. 3 Er ist mit einer Programmbeschreibung, einem<br />
Programmschema, einem Finanzplan und einer Aufstellung der<br />
personellen und technischen Ausstattung zu verbinden. 4 Der Antragsteller<br />
hat die Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse gemäß Art. 29 Abs. 1<br />
Sätze 2 und 3 mitzuteilen. 5 Die Landeszentrale kann weitere Auskünfte<br />
verlangen, die zur Organisation der Programme erforderlich sind.<br />
(2) Mit der Genehmigung regelt die Landeszentrale Einzelheiten des Angebots,<br />
insbesondere der Beteiligung an der Nutzung von<br />
Übertragungskapazitäten und der Verantwortung des Anbieters für die<br />
Urheberrechte.<br />
(3) 1 Bei der Organisation lokaler und regionaler Rundfunkangebote achtet die<br />
Landeszentrale auf Programmvielfalt und auf tragfähige wirtschaftliche<br />
Rahmenbedingungen. 2 Bei der herkömmlichen Rundfunkverbreitung<br />
solcher Programme über Terrestrik, Kabel oder Satellit sollen<br />
geschlossene Gesamtprogramme entstehen.<br />
(4) 1 Kann auf einer Frequenz ein Gesamtprogramm unter wirtschaftlich<br />
tragfähigen Rahmenbedingungen nicht mit allen Antragstellern<br />
durchgeführt werden, ist eine Auswahl vorzunehmen. 2 Bei der Auswahl ist<br />
die inhaltliche Ausrichtung des Angebots, die organisatorische und<br />
finanzielle Ausstattung des Antragstellers sowie seine Bereitschaft zur<br />
programmlichen, technischen, organisatorischen und finanziellen<br />
Zusammenarbeit zu würdigen. 3 Dabei sollen vor allem solche<br />
Antragsteller berücksichtigt werden, die einen örtlichen Bezug zum<br />
Sendegebiet haben und deren Angebote einen Beitrag zur Meinungsvielfalt<br />
und Ausgewogenheit des Gesamtprogramms erwarten lassen, sowie<br />
Antragsteller, die Beiträge mit kulturellen, kirchlichen, sozialen oder<br />
wirtschaftlichen Inhalten in das Gesamtprogramm einbringen. 4 Für jede<br />
Frequenz soll eine Anbietergesellschaft oder -gemeinschaft gebildet<br />
werden. 5 Hierauf kann verzichtet werden, wenn auf andere Weise die<br />
Zusammenarbeit der Anbieter sichergestellt werden kann. 6 Mit<br />
Genehmigung der Landeszentrale können die Anbieter Vereinbarungen<br />
auch über die Zusammenarbeit benachbarter Sendestandorte und an<br />
Mehrfrequenzstandorten über eine frequenzübergreifende<br />
Zusammenarbeit schließen.<br />
(5) 1 Niemand darf durch seine Beteiligung an Rundfunkprogrammen einen in<br />
hohem Maße ungleichgewichtigen Einfluss auf die Bildung der öffentlichen<br />
Meinung im Versorgungsgebiet (vorherrschende Meinungsmacht) erhalten.<br />
2<br />
Zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht im Einzelfall kommen<br />
einzeln oder in Kombination insbesondere folgende Vorkehrungen in<br />
Betracht:<br />
1. eine plurale gesellschaftsrechtliche Zusammensetzung des Anbieters,
die keinem Gesellschafter einen beherrschenden Einfluss in den Organen<br />
der Gesellschaft ermöglicht,<br />
2. Stimmrechtsbeschränkungen in Programmfragen,<br />
3. ein verbindliches Programmschema und Programmrichtlinien, die der<br />
Vielfalt der Meinungen und Belange im Versorgungsgebiet Rechnung<br />
tragen,<br />
4. die Einrichtung eines Programmbeirats.<br />
3<br />
Für den Programmbeirat gelten die Grundsätze des § 32 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags entsprechend.<br />
(6) 1 Ein Anbieter eines Hörfunk- oder eines Fernsehprogramms im<br />
Versorgungsgebiet kann sich an weiteren entsprechenden Programmen,<br />
die im überwiegenden Teil des Versorgungsgebiets empfangbar sind,<br />
beteiligen, wenn mindestens ein Rundfunkprogramm eines anderen<br />
Anbieters für den überwiegenden Teil des Versorgungsgebiets genehmigt<br />
ist, es sei denn, es ist zu erwarten, dass er entgegen Abs. 5<br />
vorherrschende Meinungsmacht erhalten würde. 2 Ist kein<br />
Rundfunkprogramm eines anderen Anbieters für den überwiegenden Teil<br />
des Versorgungsgebiets genehmigt, kann sich ein Anbieter an weiteren<br />
entsprechenden Programmen nach Satz 1 beteiligen, wenn ausreichende<br />
Vorkehrungen gegen das Entstehen vorherrschender Meinungsmacht nach<br />
Abs. 5 Satz 2 getroffen werden.<br />
(7) Ein Unternehmen, das mehr als 50 v. H. der Gesamtauflage der im<br />
Versorgungsgebiet periodisch erscheinenden Druckwerke mit<br />
meinungsrelevantem Inhalt verbreitet, kann sich an<br />
Rundfunkprogrammen beteiligen, wenn die in Abs. 6 Satz 1 genannten<br />
Bedingungen vorliegen oder wenn ausreichende Vorkehrungen gegen das<br />
Entstehen vorherrschender Meinungsmacht nach Abs. 5 Satz 2 getroffen<br />
werden.<br />
(8) Die Landeszentrale kann auch Höchstgrenzen für die Beteiligung eines<br />
Anbieters an mehreren Sendestandorten festlegen, wenn dies veranlasst<br />
ist, um der Gefahr vorzubeugen, dass durch eine derartige<br />
Mehrfachbeteiligung vorherrschende Meinungsmacht entsteht.<br />
(9) 1 Ein Anbieter darf nur entweder an einem landesweiten UKW-<br />
Hörfunkprogramm oder an lokalen oder regionalen Hörfunkprogrammen<br />
maßgeblich beteiligt sein. 2 Die Landeszentrale kann in begründeten<br />
Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn gesichert ist, dass dadurch die<br />
Meinungsvielfalt nicht beeinträchtigt wird.<br />
(10) Wer zu einem Anbieter oder zu einem Unternehmen nach Abs. 7 im<br />
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens entsprechend § 15 des<br />
Aktiengesetzes steht oder in anderer Weise auf das Angebot des Anbieters<br />
oder des Unternehmens nach Abs. 7 maßgeblichen Einfluss nehmen kann,<br />
steht bezüglich der Anwendung der Abs. 5 bis 9 dem Anbieter oder dem<br />
Unternehmen nach Abs. 7 gleich.<br />
(11) Für bundesweite Fernsehprogramme gelten an Stelle der Abs. 5 bis 10 die<br />
Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
(12) Für nach Abs. 4 Satz 4 gebildete Anbietergesellschaften und -<br />
gemeinschaften gelten die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s über Anbieter<br />
entsprechend.
(13) Die Landeszentrale kann Einzelheiten des Verfahrens, Fragen der<br />
Programmorganisation, des Inhalts der Genehmigungen sowie der<br />
einzubringenden Angebote durch Satzung regeln.<br />
Bay MG Art. 26 Genehmigung des Angebots<br />
(1) 1 Die Landeszentrale genehmigt die Verbreitung des Angebots nur, wenn<br />
1. der Anbieter seinen Sitz oder Wohnsitz in der Bundesrepublik<br />
Deutschland hat und der Anbieter oder die zu seiner Vertretung<br />
berechtigten Personen gerichtlich unbeschränkt zur Verantwortung<br />
gezogen werden können,<br />
2. der Anbieter erwarten lässt, dass er die rechtlichen Bestimmungen<br />
sowie die Auflagen der Landeszentrale einhalten wird,<br />
3. der Anbieter erwarten lässt, dass er auf Grund seiner finanziellen,<br />
organisatorischen, personellen und technischen Ausstattung in der Lage<br />
ist, sein Angebot für den Genehmigungszeitraum aufrecht zu erhalten,<br />
4. zu erwarten ist, dass die Gesamtheit der im jeweiligen<br />
Verbreitungsgebiet empfangbaren Rundfunkprogramme bei Einbeziehung<br />
der erwarteten Beiträge des Anbieters den Erfordernissen der<br />
Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt nach Art. 4 genügen wird und<br />
5. auf Grund der Beteiligungsverhältnisse nicht zu besorgen ist, dass der<br />
Anbieter einem mit dem Gebot der Staatsferne des Rundfunks nicht zu<br />
vereinbarenden staatlichen oder kommunalen Einfluss unterliegt.<br />
2 3<br />
Die Genehmigung wird in der Regel für acht Jahre erteilt. Auf Antrag<br />
des Anbieters kann sie verlängert werden, wenn nicht wichtige Gründe für<br />
eine Neuverteilung der Sendezeiten sprechen. 4 Die sonstigen Vorschriften<br />
des Rundfunkstaatsvertrags über die Zulassung und das<br />
Zulassungsverfahren in ihrer jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Die Genehmigung für die terrestrische Verbreitung bundesweit<br />
empfangbarer Rundfunkprogramme privater Anbieter oder Veranstalter<br />
wird für längstens vier Jahre erteilt. 2 Für die Verlängerung gilt Abs. 1<br />
Satz 3 entsprechend.<br />
(3) 1 Die Genehmigung für die terrestrische Verbreitung von<br />
Rundfunkprogrammen wird ab 1. Januar 2002 nur erteilt, wenn diese<br />
Programme in digitaler Technik verbreitet werden. 2 Satz 1 gilt nicht für<br />
Rundfunkprogramme, die<br />
1. Übertragungskapazitäten gemäß Art. 31 nutzen oder<br />
2. Übertragungskapazitäten nutzen, für die das in Art. 32 geregelte<br />
Verfahren bereits vor dem 31. Dezember 2001 eingeleitet worden ist.<br />
3<br />
Die Landeszentrale kann im Einzelfall die Genehmigung abweichend von<br />
Satz 1 erteilen, wenn dies auf Grund regionaler oder lokaler<br />
Besonderheiten im Versorgungsgebiet erforderlich ist, um eine<br />
ausreichende Angebots- und Meinungsvielfalt sicherzustellen.<br />
(4) Werden bisher in analoger Technik genutzte terrestrische<br />
Übertragungskapazitäten für die Übertragung von Rundfunkprogrammen<br />
in digitaler Technik genutzt, sind diejenigen Anbieter vorrangig zu<br />
berücksichtigen, die ihr Programm auf diesen Übertragungskapazitäten<br />
bislang in analoger Technik verbreitet haben.<br />
(5) Die Genehmigung muss widerrufen oder eingeschränkt werden, wenn und<br />
soweit nachträglich die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Satz 1 entfallen
sind und auch durch Anordnungen nach Art. 16 nicht sichergestellt werden<br />
können.<br />
(6) 1 Bei der Genehmigung von Sendungen, die von den in Art. 24 Abs. 1 und<br />
2 genannten Anbietern<br />
1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung und im zeitlichen<br />
Zusammenhang damit veranstaltet und verbreitet werden oder<br />
2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese für gleiche Zwecke<br />
genutzt und die Sendungen nur dort empfangen werden können und im<br />
funktionellen Zusammenhang mit den in diesen Einrichtungen zu<br />
erfüllenden Aufgaben stehen,<br />
finden Art. 3, Art. 5 Abs. 7 und Art. 25 Abs. 5 bis 10 keine Anwendung.<br />
2 Art. 25 Abs. 1 Sätze 2 bis 5, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 gelten<br />
entsprechend. 3 Die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften sind<br />
von der Genehmigung zu unterrichten.<br />
Bay MG Art. 27 Fernsehtext, Radiotext<br />
Die Genehmigung umfasst auch das Recht des Anbieters, die Leerzeilen seines<br />
Fernsehsignals für Fernsehtext und den Datenkanal seines Hörfunksignals für<br />
Radiotext zu nutzen.<br />
Bay MG Art. 28 Programmänderungen<br />
1 Änderungen des Programmschemas sowie Abweichungen von einem<br />
festgelegten programminhaltlichen Schwerpunkt bedürfen einer Genehmigung<br />
der Landeszentrale. 2 Aus Gründen der Aktualität sowie bei Unglücks- und<br />
Katastrophenfällen kann von dem genehmigten Programm kurzfristig<br />
abgewichen werden. 3 Abweichungen nach Satz 2 sind der Landeszentrale<br />
anzuzeigen.<br />
Bay MG Art. 29 Auskunftspflicht, Aufzeichnungspflicht, Archivierung<br />
(1) 1 Jeder Anbieter von Rundfunksendungen hat am Ende seiner Sendezeit<br />
Namen und Anschrift des Anbieters und den verantwortlichen Redakteur<br />
zu benennen; der verantwortliche Redakteur muss seinen Wohnsitz in der<br />
Bundesrepublik Deutschland haben und gerichtlich unbeschränkt zur<br />
Verantwortung gezogen werden können. 2 Unbeschadet der<br />
Informationspflicht nach § 9 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrags sind die<br />
unmittelbaren und mittelbaren Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse des<br />
Anbieters der Landeszentrale mitzuteilen und von dieser bei berechtigtem<br />
Interesse auf schriftliches Verlangen bekannt zu geben; dies gilt auch für<br />
die Beteiligung stiller Gesellschafter und bestehende Treuhandverträge.<br />
3 Mitzuteilen ist auch, wenn ein Anbieter mit einem anderen Unternehmen<br />
im Sinn von § 15 des Aktiengesetzes verbunden ist oder eine dritte<br />
natürliche oder juristische Person auf das Angebot des Anbieters<br />
maßgeblichen Einfluss nehmen kann. 4 Jede beabsichtigte Änderung der<br />
nach den Sätzen 2 und 3 genannten Verhältnisse ist der Landeszentrale<br />
unaufgefordert mitzuteilen. 5 Zur Mitteilung nach den Sätzen 2 bis 4 sind<br />
der Anbieter und die jeweils Beteiligten verpflichtet. 6 Werden die<br />
Verpflichtungen aus den Sätzen 2 bis 4 nicht erfüllt, kann die<br />
Landeszentrale unbeschadet der Möglichkeit des Art. 26 Abs. 5 die<br />
Einstellung des Sendebetriebs anordnen. 7 Zum Nachweis der Angaben
nach den Sätzen 2 und 3 kann die Landeszentrale im Rahmen des<br />
Erforderlichen die Vorlage von Unterlagen verlangen. 8 Auf Verlangen sind<br />
die Angaben nach den Sätzen 2 und 3 der Landeszentrale gegenüber<br />
eidesstattlich zu versichern.<br />
(2) Jeder Anbieter hat seine Beiträge in Ton und Bild vollständig<br />
aufzuzeichnen und aufzubewahren; sie sind der Landeszentrale auf<br />
Verlangen kostenfrei zur Verfügung zu stellen.<br />
(3) 1 Der Anbieter kann Aufzeichnungen nach Ablauf von zwei Monaten seit<br />
dem Tag der letzten Verbreitung löschen, wenn ihm keine Beanstandung<br />
oder Beschwerde gegen den Beitrag bekannt geworden ist. 2 Die<br />
Landeszentrale kann Abweichungen vorsehen.<br />
(4) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinem Recht berührt zu sein, kann<br />
beim Anbieter Einsicht in die Aufzeichnungen verlangen und auf eigene<br />
Kosten Mehrfertigungen herstellen.<br />
(5) Auf Verlangen sind der Landeszentrale die Aufzeichnungen zum Zweck der<br />
Archivierung gegen Erstattung der Material- und Arbeitskosten zu<br />
überlassen.<br />
Vierter Abschnitt Pilotprojekte, Betriebsversuche<br />
Bay MG Art. 30 Pilotprojekte, Betriebsversuche<br />
1 Die Durchführung zeitlich befristeter Pilotprojekte und Betriebsversuche mit<br />
neuen Techniken, Programmen und Telemedien ist zulässig. 2 Die<br />
Landeszentrale kann hierfür Übertragungskapazitäten zur Nutzung zuweisen.<br />
3 Sie kann zur Durchführung des Pilotprojekts oder des Betriebsversuchs<br />
abweichend von Art. 25 Abs. 1 mit der durchführenden Stelle des Pilotprojekts<br />
oder des Betriebsversuchs oder mit den Anbietern von Programmen,<br />
rundfunkähnlichen Diensten und anderen Telemedien Vereinbarungen<br />
abschließen. 4 Im Rahmen von Pilotprojekten oder Betriebsversuchen gelten für<br />
Rundfunkprogramme die Art. 4 Satz 2, Art. 5 Abs. 1 bis 4, Art. 6 bis 9, 16 bis<br />
18, 20, 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 13, Art. 28 und 29 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s, für Telemedien die Bestimmungen des<br />
Rundfunkstaatsvertrags und des Telemediengesetzes entsprechend.<br />
Fünfter Abschnitt Zuordnung technischer<br />
Übertragungskapazitäten<br />
Bay MG Art. 31 Genutzte Übertragungskapazitäten<br />
1 Der Landeszentrale stehen die technischen Übertragungskapazitäten<br />
(Frequenzen und Kanäle), die ihr bei Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s zur<br />
Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen zugestanden haben, auch weiterhin<br />
zur Nutzung zu. 2 Sie kann mit anderen Rundfunkveranstaltern Vereinbarungen<br />
über die Übertragung der Nutzungsrechte schließen.<br />
Bay MG Art. 32 Zuordnung neuer Übertragungskapazitäten<br />
(1) Über die Zuordnung von dem Freistaat Bayern zustehenden neuen<br />
Übertragungskapazitäten, deren Zuordnung bei Inkrafttreten dieses
<strong>Gesetze</strong>s nicht geregelt war, einigt sich die Landeszentrale mit dem<br />
Bayerischen Rundfunk und dem ZDF sowie dem Deutschlandradio.<br />
(2) 1 Kommt eine Einigung nach Abs. 1 Satz 1 nicht zustande, entscheidet die<br />
Staatsregierung über die Zuordnung. 2 Maßgebende Gesichtspunkte für<br />
diese Entscheidung sind<br />
1. die Sicherung der Grundversorgung durch die Fernsehhauptprogramme<br />
der ARD und des ZDF sowie durch das Fernsehprogramm und durch<br />
Hörfunkprogramme des Bayerischen Rundfunks,<br />
2. die flächendeckende Versorgung im jeweiligen Verbreitungsgebiet mit<br />
den landesweiten und lokalen oder regionalen Rundfunkprogrammen<br />
unter Trägerschaft der Landeszentrale,<br />
3. die Vielfalt des Programmangebots, insbesondere die Förderung von<br />
Meinungsvielfalt und publizistischem Wettbewerb sowie die<br />
Berücksichtigung der Interessen von Minderheiten, deren<br />
Informationsmöglichkeiten auf Grund von Behinderungen oder<br />
sprachlichen Umständen eingeschränkt sind, durch das jeweilige<br />
Programm.<br />
Bay MG Art. 33 Betrieb von Kabelanlagen<br />
(1) Betreiber einer Kabelanlage ist, wer berechtigt ist, über die Kabelanlage,<br />
insbesondere über die Signalaufbereitungsanlage, zu verfügen.<br />
(2) 1 Der Betreiber einer Kabelanlage, die der Verbreitung oder<br />
Weiterverbreitung von Rundfunk oder Telemedien in 10 oder mehr<br />
Wohneinheiten dient, hat der Landeszentrale den Betrieb einen Monat vor<br />
Betriebsbeginn anzuzeigen. 2 Der Betreiber einer Kabelanlage mit einer<br />
Kapazität von mehr als 15 Fernsehkanälen, an die mehr als<br />
5 000 Wohneinheiten angeschlossen sind, hat auf Anforderung der<br />
Landeszentrale einen analogen Fernsehkanal, bei digitaler Verbreitung<br />
wahlweise die digitale Übertragungskapazität für ein Fernsehprogramm<br />
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 3 Der Betreiber einer Kabelanlage<br />
mit einer Kapazität von mindestens 20 Hörfunkkanälen, an die mehr als<br />
50 000 Wohneinheiten angeschlossen sind, hat auf Anforderung der<br />
Landeszentrale einen analogen Hörfunkkanal, bei digitaler Verbreitung<br />
wahlweise die digitale Übertragungskapazität für ein Hörfunkprogramm<br />
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 4 Die Unentgeltlichkeit gilt nicht für<br />
die Heranführung. 5 Kanäle oder Übertragungskapazitäten nach den<br />
Sätzen 2 und 3 sind für Angebote nach Art. 3 Abs. 5 Satz 2 sowie für<br />
lokale oder regionale Angebote zu nutzen.<br />
(3) bis (7) weggefallen<br />
Sechster Abschnitt Kabelanlagen<br />
Bay MG Art. 34 (weggefallen)<br />
Bay MG Art. 35 Weiterverbreitung<br />
(1) Unbeschadet der Regelungen in § 51 b Abs. 1 und 2 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags ist die zeitgleiche und unveränderte<br />
Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen in Kabelanlagen zulässig bei
1. terrestrisch verbreiteten Rundfunkprogrammen, soweit sie im gesamten<br />
Bereich einer Kabelanlage oder im gesamten Bereich eines technisch<br />
abgrenzbaren Teils einer Kabelanlage mit durchschnittlichem<br />
Antennenaufwand allgemein empfangen werden können (ortsübliche<br />
Empfangbarkeit),<br />
2. bundesweit herangeführten inländischen Rundfunkprogrammen, die<br />
rechtmäßig veranstaltet werden,<br />
3. Fernsehprogrammen, die in einem anderen Mitgliedstaat der<br />
Europäischen Union rechtmäßig veranstaltet werden,<br />
4. Fernsehprogrammen, die in Europa rechtmäßig und entsprechend den<br />
Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über das<br />
grenzüberschreitende Fernsehen veranstaltet werden,<br />
5. ausländischen Programmen, die nicht unter die Nrn. 3 und 4 fallen,<br />
nicht der Umgehung der Grundsätze dieses <strong>Gesetze</strong>s dienen und die<br />
Ausgewogenheit der inländischen Programme nicht erheblich stören sowie<br />
den Betroffenen eine ausreichende Gegendarstellungsmöglichkeit oder ein<br />
ähnliches Recht eingeräumt ist und sachgerechte, umfassende und<br />
wahrheitsgemäße Information gewährleistet ist.<br />
(2) Eine Weiterverbreitung nach Abs. 1 ist nur dann zulässig, wenn der<br />
Veranstalter oder Anbieter des Programms oder der Betreiber der<br />
Kabelanlage glaubhaft macht, dass der Weiterverbreitung Urheberrechte<br />
Dritter nicht entgegenstehen und die Landeszentrale von<br />
Urheberansprüchen Dritter freistellt.<br />
(3) 1 Der Betreiber der Kabelanlage hat die Weiterverbreitung einen Monat vor<br />
Beginn der Landeszentrale schriftlich anzuzeigen. 2 Die Weiterverbreitung<br />
nach Abs. 1 Nr. 5 bedarf der Genehmigung durch die Landeszentrale. 3 Sie<br />
kann vom Veranstalter des Rundfunkprogramms oder vom Betreiber der<br />
Kabelanlage beantragt werden. 4 Die Genehmigung wird erteilt, wenn die<br />
Voraussetzungen von Abs. 1 Nr. 5 erfüllt sind.<br />
(4) Die Landeszentrale kann die zeitversetzte oder unvollständige<br />
Weiterverbreitung eines Programms mit Zustimmung des Veranstalters<br />
oder Anbieters genehmigen, wenn die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2<br />
erfüllt sind.<br />
Bay MG Art. 36 Kanalbelegung in Breitbandkabelnetzen<br />
(1) 1 Solange in einer Kabelanlage Fernsehprogramme oder Telemedien in<br />
analoger Technik verbreitet werden, sind jedenfalls die auf gesetzlicher<br />
Grundlage für Bayern veranstalteten öffentlich-rechtlichen<br />
Fernsehprogramme, die beiden bundesweit verbreiteten<br />
reichweitenstärksten privaten Fernsehvollprogramme jeweils mit dem<br />
Fensterprogramm nach Art. 3 Abs. 3, ein lokales oder regionales<br />
Fernsehangebot, vier weitere private Fernsehprogramme und wahlweise<br />
ein Teleshoppingprogramm oder ein Telemedium einzuspeisen. 2 Die<br />
Belegung mit den in Satz 1 genannten vier weiteren privaten<br />
Fernsehprogrammen und mit wahlweise einem Teleshoppingprogramm<br />
oder einem Telemedium insbesondere unter Berücksichtigung<br />
1. des Beitrags des jeweiligen Programms oder Telemediums zur Vielfalt,<br />
2. des lokalen und regionalen Bezugs des Programms oder Telemediums<br />
und des Bezugs zu Bayern,
3. der Interessen der Teilnehmer<br />
sowie weitere Einzelheiten regelt die Landeszentrale durch Satzung. 3 Im<br />
Übrigen entscheidet der Betreiber der Kabelanlage über die Belegung<br />
unter Beachtung der in Satz 2 Nrn. 1 bis 3 genannten Kriterien. 4 Hält der<br />
Betreiber der Kabelanlage nach Feststellung der Landeszentrale die<br />
vorgegebenen Kriterien nicht ein oder verletzt er infolge der Umwandlung<br />
eines analog genutzten Kanals Belange des Rundfunks, entscheidet die<br />
Landeszentrale nach Setzung einer angemessenen Frist unmittelbar.<br />
(2) 1 Solange in einer Kabelanlage Hörfunkprogramme in analoger Technik<br />
verbreitet werden, sind jedenfalls die auf gesetzlicher Grundlage für<br />
Bayern veranstalteten Programme in ihrem jeweiligen<br />
bestimmungsgemäßen Versorgungsgebiet einzuspeisen. 2 Die<br />
Landeszentrale teilt dem Betreiber die jeweiligen Programme mit. 3 Im<br />
Übrigen trifft der Betreiber die Belegungsentscheidung nach Maßgabe der<br />
allgemeinen <strong>Gesetze</strong>. 4 Art. 16 Abs. 1 bleibt unberührt.<br />
(3) Die Übertragungspflichten werden regelmäßig alle drei Jahre, erstmals<br />
zum 30. Juni 2009 entsprechend Art. 31 Abs. 1 der Richtlinie 2002/22/EG<br />
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den<br />
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen<br />
Kommunikationsnetzen und -diensten – Universaldienstrichtlinie (ABl EG<br />
Nr. L 108 S. 51) überprüft.<br />
Siebter Abschnitt Übergangs- und Schlussbestimmungen<br />
Bay MG Art. 37 Strafbestimmung, Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) 1 Für Anbieter bundesweit verbreiteter Programme findet § 49 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags Anwendung. 2 Mit Geldbuße bis zu<br />
fünfhunderttausend Euro kann belegt werden, wer als Anbieter landesweit,<br />
regional oder lokal verbreiteter Programme vorsätzlich oder fahrlässig<br />
einen der in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 10, Nr. 16 erster Halbsatz und<br />
Nrn. 19 bis 24 des Rundfunkstaatsvertrags in Verbindung mit Art. 7, 8 und<br />
20 bezeichneten Verstöße begeht, wer als Anbieter landesweit, regional<br />
oder lokal verbreiteter Programme einen in § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des<br />
Rundfunkstaatsvertrags in Verbindung mit Art. 9 bezeichneten Verstoß<br />
begeht, wer als Anbieter landesweit verbreiteter Fernsehprogramme<br />
vorsätzlich oder fahrlässig einen der in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 16 zweiter<br />
und dritter Halbsatz, Nrn. 17 und 18 des Rundfunkstaatsvertrags<br />
bezeichneten Verstöße begeht und wer als Anbieter landesweiter,<br />
regionaler oder lokaler Hörfunkprogramme vorsätzlich oder fahrlässig den<br />
in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 des Rundfunkstaatsvertrags bezeichneten<br />
Verstoß begeht. 3 Mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro kann<br />
belegt werden, wer als Anbieter regional und lokal verbreiteter<br />
Fernsehprogramme vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 8 Abs. 2<br />
Satz 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz bei der Einfügung von Werbung und<br />
Teleshopping-Spots in Sendungen natürliche Unterbrechungen im Ablauf<br />
der Sendung und die Länge der Sendung nicht berücksichtigt und<br />
entgegen Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 zweiter Halbsatz Teleshopping-Fenster<br />
nicht klar als solche kennzeichnet. 4 Die §§ 23 und 24 des<br />
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags finden Anwendung.
(2) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. ohne Genehmigung der Landeszentrale nach Art. 26<br />
Rundfunkprogramme veranstaltet oder verbreitet,<br />
2. entgegen Art. 25 Abs. 1 Satz 4 oder Art. 29 Abs. 1 Sätze 2 und 3 oder<br />
entgegen Art. 29 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 Sätze 2<br />
und 3 Mitteilungen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht,<br />
3. entgegen Art. 29 Abs. 2 seine Beiträge nicht vollständig in Ton und Bild<br />
aufzeichnet oder Aufzeichnungen entgegen Art. 29 Abs. 3 löscht,<br />
4. entgegen Art. 33 Abs. 2 Satz 1 den Betrieb einer Kabelanlage nicht<br />
oder nicht rechtzeitig der Landeszentrale anzeigt oder<br />
5. entgegen Art. 35 Abs. 3 Satz 1 die Weiterverbreitung nicht oder nicht<br />
rechtzeitig der Landeszentrale anzeigt oder ohne Genehmigung der<br />
Landeszentrale nach Art. 35 Abs. 3 Satz 2 Rundfunkprogramme<br />
weiterverbreitet.<br />
(3) Geldbußen, die nach den Abs. 1 und 2 festgesetzt werden, stehen der<br />
Landeszentrale für ihre Aufgaben nach Art. 11 Satz 2 Nrn. 9 bis 11, 13<br />
und 15 zu.<br />
Bay MG Art. 38 Verjährung<br />
1 Für die Verjährung der Verfolgung von Taten, die durch Sendungen<br />
strafbaren Inhalts im Rundfunk begangen werden, gelten Art. 14 Abs. 1<br />
Sätze 1 und 2 Nrn. 1 und 3 des Bayerischen Pressegesetzes sinngemäß. 2 Die<br />
Verfolgung der in Art. 37 Abs. 1 bis 3 genannten Ordnungswidrigkeiten<br />
verjährt in sechs Monaten.<br />
Bay MG Art. 39 Keine aufschiebende Wirkung<br />
Anfechtungsklagen gegen den Erlass dringlicher Anordnungen des Präsidenten<br />
nach Art. 15 Abs. 2 Nr. 3 haben keine aufschiebende Wirkung.<br />
Bay MG Art. 40 Verweisungen<br />
Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen betreffen die genannten<br />
Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung.<br />
Bay MG Art. 41 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen,<br />
Zuständigkeitsregelung<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1992 in Kraft. Gleichzeitig tritt das<br />
Gesetz über die Erprobung und Entwicklung neuer Rundfunkangebote und<br />
anderer Mediendienste in Bayern (Medienerprobungs- und -<br />
entwicklungsgesetz – MEG) in der Fassung der Bekanntmachung vom<br />
8. Dezember 1987 (GVBl S. 431, BayRS 2251–4–K) außer Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten des <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ursprünglichen Fassung vom 24. November 1992 (GVBl S. 584). Der Zeitpunkt des In-Kraft-<br />
Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(2) 1 Nach dem Medienerprobungs- und -entwicklungsgesetz erteilte<br />
Genehmigungen für Anbieter bleiben bestehen. 2 Laufende<br />
Genehmigungsverfahren sind nach neuem Recht fortzusetzen. 3 Die<br />
Landeszentrale kann die Genehmigungsdauer von Vereinbarungen über<br />
die Nutzung solcher Frequenzen, über deren Nutzung bereits nach altem
Recht zum zweiten Mal entschieden worden ist, auf die Dauer von bis zu<br />
acht Jahren verlängern.<br />
(3) Zuständige Behörde nach § 9 Abs. 2 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrags<br />
für den Bereich dieses <strong>Gesetze</strong>s ist die Staatskanzlei.<br />
(4) Art. 24 Abs. 3 findet bis zum Ablauf der jeweiligen Genehmigung,<br />
jedenfalls bis zum 1. August 2005 keine Anwendung auf die am 1. August<br />
2003 genehmigten Beteiligungen von politischen Parteien und<br />
Wählergruppen an einem Anbieter und auf bestehende<br />
Treuhandverhältnisse und stille Beteiligungen von politischen Parteien und<br />
Wählergruppen.
Gesetz über den Schutz der Natur, die<br />
Pflege der Landschaft und die Erholung<br />
in der freien Natur (Bay NatSchG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 2005 GVBl. 2006 S. 2 (FN BayRS 791-1-<br />
UG)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften<br />
Art. 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
Art. 1 a Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
Art. 2 Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur<br />
Art. 2 a Aufgaben der Behörden; Beratung; Vereinbarungen<br />
Art. 2 b Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft<br />
Art. 2 c Begriffe<br />
II. Abschnitt Landschaftsplanung und Landschaftspflege<br />
Art. 3 Landschaftsplanung<br />
Art. 3 a Biosphärenreservate<br />
Art. 4 Durchführung der Landschaftspflege<br />
Art. 5 Duldungspflicht<br />
Art. 6 Eingriffe in Natur und Landschaft<br />
Art. 6 a Untersagung; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen<br />
Art. 6 b Zuständigkeit und Verfahren bei Eingriffen; landschaftspflegerischer<br />
Begleitplan; Meldung der Ausgleichs- und Ersatzflächen<br />
Art. 6 c (weggefallen)<br />
Art. 6 d Grabenfräsen<br />
Art. 6 e Wegebau im Alpengebiet
Art. 6 f Pisten<br />
III. Abschnitt Schutz von Flächen und einzelnen Bestandteilen der Natur<br />
Art. 7 Naturschutzgebiete<br />
Art. 8 Nationalparke<br />
Art. 9 Naturdenkmäler<br />
Art. 10 Landschaftsschutzgebiete<br />
Art. 11 Naturparke<br />
Art. 12 Landschaftsbestandteile und Grünbestände<br />
Art. 13 Schutz von Kennzeichnungen; Registrierung<br />
Art. 13 a Vollzug von Schutzverordnungen<br />
III a. Abschnitt Schutz des Europäischen ökologischen Netzes “Natura 2000”,<br />
gesetzlicher Schutz von Biotopen, Biotopverbund<br />
Art. 13 b Auswahl; besonderer Schutz der Gebiete<br />
Art. 13 c Schutzvorschriften<br />
Art. 13 d Gesetzlich geschützte Biotope<br />
Art. 13 e Schutz der Lebensstätten<br />
Art. 13 f Biotopverbund; Arten- und Biotopschutzprogramm<br />
IV. Abschnitt Schutz von Pflanzen und Tieren<br />
Art. 14 Allgemeine Vorschriften<br />
Art. 14 a (weggefallen)<br />
Art. 15 Allgemeiner Schutz<br />
Art. 16 (weggefallen)<br />
Art. 17 Aussetzen und Ansiedeln von Tieren und Pflanzen
Art. 18 Ermächtigungen der obersten Naturschutzbehörde<br />
Art. 19 (weggefallen)<br />
Art. 20 Kennzeichnung wildlebender Tiere; Ermächtigung<br />
IVa. Abschnitt Tiergehege, Zoos<br />
Art. 20 a Tiergehege<br />
Art. 20 b Zoos<br />
V. Abschnitt Erholung in der freien Natur<br />
Art. 21 Recht auf Naturgenuss und Erholung<br />
Art. 22 Betretungsrecht; Gemeingebrauch an Gewässern<br />
Art. 23 Benutzung von Wegen; Markierungen<br />
Art. 24 Sportliche Betätigung<br />
Art. 25 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen<br />
Art. 26 Beschränkungen der Erholung in der freien Natur<br />
Art. 27 Durchführung von Veranstaltungen<br />
Art. 28 Aneignung wild wachsender Pflanzen und Früchte<br />
Art. 29 Zulässigkeit von Sperren<br />
Art. 30 Verfahren<br />
Art. 31 Durchgänge<br />
Art. 32 Eigentumsbindung und Enteignung<br />
Art. 33 Pflichten des Freistaates Bayern und der Gebietskörperschaften<br />
Art. 33 a Sauberhaltung der freien Natur<br />
VI. Abschnitt Vorkaufsrecht, Enteignung und Erschwernisausgleich<br />
Art. 34 Vorkaufsrecht
Art. 35 Förmliche Enteignung<br />
Art. 36 Enteignende Maßnahmen<br />
Art. 36 a Erschwernisausgleich; Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in<br />
der Land- und Forstwirtschaft<br />
VII. Abschnitt Organisation, Zuständigkeit und Verfahren<br />
Art. 37 Behörden<br />
Art. 38 Grundsatzaufgaben<br />
Art. 39 <strong>Bayerisches</strong> Landesamt für Umwelt<br />
Art. 40 Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Art. 41 Naturschutzbeiräte<br />
Art. 42 Mitwirkung von Vereinen<br />
Art. 43 Naturschutzwacht<br />
Art. 43 a Bayerischer Naturschutzfonds<br />
Art. 44 Zuständigkeit<br />
Art. 45 Zuständigkeit für den Erlass von Rechtsverordnungen<br />
Art. 46 Verfahren zur Inschutznahme<br />
Art. 47 Kennzeichnung der Schutzgegenstände<br />
Art. 48 Zutrittsrecht; einstweilige Sicherstellung und Veränderungssperre<br />
Art. 48 a Datenschutz<br />
Art. 49 Befreiungen<br />
Art. 49 a Zulässigkeit von Projekten und Plänen mit Auswirkungen auf das<br />
Europäische ökologische Netz “Natura 2000”<br />
Art. 50 Anzeigepflichten<br />
Art. 51 Grundbesitz der öffentlichen Hand; Haushaltsplanung
VIII. Abschnitt Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 52 Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 53 Einziehung<br />
IX. Abschnitt Übergangs- und Schlussvorschriften Art. 54 (weggefallen)<br />
Art. 55 Überleitungsvorschrift<br />
Art. 56 Abgrenzung zum Landwirtschaftsförderungsgesetz<br />
Art. 57 und 58 (weggefallen)<br />
Art. 59 Aufhebung von Vorschriften<br />
Art. 60 In-Kraft-Treten<br />
I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften<br />
Bay NatSchG Art. 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
Aus der Verantwortung des Menschen für die natürlichen Lebensgrundlagen,<br />
auch für die künftigen Generationen, sind Natur und Landschaft auf Grund<br />
ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen im besiedelten<br />
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und,<br />
soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass<br />
1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,<br />
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der<br />
Naturgüter,<br />
3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und<br />
Lebensräume sowie<br />
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und<br />
Landschaft<br />
auf Dauer gesichert sind.<br />
Bay NatSchG Art. 1 a Grundsätze des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege<br />
(1) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind insbesondere<br />
nach Maßgabe der in Abs. 2 genannten Grundsätze zu verwirklichen,<br />
soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung erforderlich, möglich und unter<br />
Abwägung aller sich aus den Zielen nach Art. 1 ergebenden<br />
Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der<br />
Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.<br />
(2) 1 Die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben<br />
sich aus § 2 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).<br />
2<br />
Weitere Grundsätze sind:<br />
1. Landschaftsteile, die für einen ausgewogenen Naturhaushalt
erforderlich sind oder sich durch ihre Schönheit, Eigenart, Seltenheit oder<br />
ihren Erholungswert auszeichnen, sollen von einer Bebauung freigehalten<br />
werden.<br />
2. Die Bebauung soll sich Natur und Landschaft anpassen.<br />
Verkehrsanlagen und Versorgungsleitungen sollen landschaftsgerecht<br />
angelegt und gestaltet werden. Alleen sind soweit möglich zu schützen<br />
und zu erhalten sowie in geeigneten Fällen herzustellen.<br />
3. Die Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen sollen vernetzt<br />
werden. Sie sollen nach Lage, Größe und Beschaffenheit den Austausch<br />
zwischen verschiedenen Populationen von Tieren und Pflanzen und deren<br />
Ausbreitung gemäß ihren artspezifischen Bedürfnissen ermöglichen.<br />
Geeignete Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen<br />
bleiben.<br />
4. Die bayerischen Alpen mit ihrer natürlichen Vielfalt an wild lebenden<br />
Tier- und Pflanzenarten einschließlich ihrer Lebensräume sind als<br />
Landschaft von einzigartiger Schönheit in ihren Naturräumen von<br />
herausragender Bedeutung zu erhalten.<br />
5. Auwälder und Moore sind zu schützen, zu erhalten und, soweit<br />
erforderlich, wiederherzustellen.<br />
6. Die natürliche oder naturnahe Bodenvegetation in Talauen sowie die<br />
auentypischen Strukturen sind zu erhalten, zu entwickeln und, soweit<br />
erforderlich, wiederherzustellen.<br />
7. Eine naturschutzbezogene Bildungsarbeit ist als wichtige Voraussetzung<br />
für das Verständnis natürlicher Abläufe zu fördern.<br />
8. Nachhaltige Landnutzungssysteme sind anzustreben.<br />
Bay NatSchG Art. 2 Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur<br />
(1) 1 Naturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat und Gesellschaft sowie<br />
für jeden einzelnen Bürger. 2 Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und<br />
sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, ihre<br />
Grundstücke im Sinn der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege zu bewirtschaften. 3 Die jeweilige Zweckbestimmung<br />
eines Grundstücks bleibt unberührt. 4 Ökologisch besonders wertvolle<br />
Grundstücke im Eigentum von Staat, Gemeinden, Landkreisen, Bezirken<br />
und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts dienen<br />
vorrangig Naturschutzzwecken. 5 Bei Überlassung von ökologisch<br />
besonders wertvollen Grundstücken an Dritte ist die Beachtung der<br />
Verpflichtung nach Satz 4 sicherzustellen.<br />
(2) Jeder hat nach seinen Möglichkeiten in Verantwortung für die natürlichen<br />
Lebensgrundlagen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege beizutragen und sich so zu<br />
verhalten, dass die Lebensgrundlagen für wild lebende Tiere und Pflanzen<br />
soweit wie möglich erhalten, nicht mehr als nach den Umständen<br />
unvermeidbar beeinträchtigt und gegebenenfalls wiederhergestellt<br />
werden.<br />
(3) Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger sind aufgefordert, über die<br />
Bedeutung von Natur und Landschaft sowie über die Ziele, Grundsätze<br />
und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu<br />
informieren, das Verantwortungsbewusstsein für ein pflegliches Verhalten
gegenüber Natur und Landschaft zu wecken und für einen<br />
verantwortungsvollen Umgang mit Naturgütern zu werben.<br />
Bay NatSchG Art. 2 a Aufgaben der Behörden; Beratung;<br />
Vereinbarungen<br />
(1) Behörden und öffentliche Stellen haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die<br />
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege zu unterstützen.<br />
(2) 1 Zu den Aufgaben der staatlichen Behörden gehört im Rahmen ihrer<br />
Zuständigkeit die Beratung über die Ziele und Grundsätze des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege. 2 Die Beratung soll dazu<br />
beitragen, dass die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
auch ohne hoheitliche Maßnahmen verwirklicht werden können.<br />
(3) 1 Die Naturschutzbehörden sollen zur Erreichung der Ziele und Grundsätze<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege die Formen der kooperativen<br />
Zusammenarbeit, insbesondere vertragliche Vereinbarungen und<br />
Förderprogramme (Vertragsnaturschutz) nutzen. 2 Die sonstigen<br />
Befugnisse der Naturschutzbehörden nach diesem Gesetz bleiben hiervon<br />
unberührt.<br />
(4) Auch andere Behörden können durch vertragliche Vereinbarungen und<br />
Förderprogramme zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen.<br />
Bay NatSchG Art. 2 b Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft<br />
(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die<br />
besondere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-,<br />
Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und<br />
Erholungslandschaft zu berücksichtigen.<br />
(2) 1 Die Land- und Fischereiwirtschaft hat im Rahmen der guten fachlichen<br />
Praxis die Anforderungen der für sie geltenden Vorschriften, des § 17<br />
Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dieses <strong>Gesetze</strong>s zu<br />
beachten. 2 Die Forstwirtschaft hat die Anforderungen der für sie<br />
geltenden Vorschriften und dieses <strong>Gesetze</strong>s zu beachten.<br />
(3) 1 Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf<br />
<strong>Stand</strong>orten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten soll<br />
Grünland erhalten bleiben. 2 Dazu sollen vorrangig vertragliche<br />
Vereinbarungen und Förderprogramme genutzt werden. 3 Art. 6 a Abs. 5<br />
gilt entsprechend.<br />
(4) 1 Die Landwirtschaft trägt zur Strukturvielfalt in der landwirtschaftlich<br />
genutzten Kulturlandschaft durch die Erhaltung für den Naturhaushalt<br />
bedeutsamer linearer und punktförmiger Landschaftselemente<br />
(Saumstrukturen, insbesondere Feldgehölze, Hecken, Raine und andere<br />
Trittsteinbiotope) bei. 2 Eine ausreichende naturraumbezogene<br />
Ausstattung mit solchen Landschaftselementen soll angestrebt werden.<br />
3<br />
Dazu dienen vorrangig langfristige Vereinbarungen und<br />
Förderprogramme.
Bay NatSchG Art. 2 c Begriffe<br />
Die Begriffsbestimmungen des § 10 Abs. 1 bis 5 BNatSchG finden Anwendung.<br />
II. Abschnitt Landschaftsplanung und Landschaftspflege<br />
Bay NatSchG Art. 3 Landschaftsplanung<br />
(1) Die überörtlichen raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen zur<br />
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
werden<br />
1. im Landschaftsprogramm als Teil des Landesentwicklungsprogramms,<br />
2. in Landschaftsrahmenplänen als Teilen der Regionalpläne<br />
dargestellt.<br />
(2) 1 Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden in<br />
Landschaftsplänen als Bestandteilen der Flächennutzungspläne dargestellt<br />
und in Grünordnungsplänen als Bestandteilen der Bebauungspläne<br />
festgesetzt. 2 Die Gemeinden stellen flächendeckend Landschaftspläne auf.<br />
3 4<br />
§ 5 Abs. 1 Satz 3 und § 244 Abs. 4 BauGB gelten entsprechend. In<br />
Teilen eines Gemeindegebiets kann von der Aufstellung eines<br />
Landschaftsplans abgesehen werden, soweit die vorherrschende Nutzung<br />
den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
entspricht und dies planungsrechtlich gesichert ist. 5 Grünordnungspläne<br />
sind von der Gemeinde aufzustellen, sobald und soweit dies aus Gründen<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist; sie können<br />
dabei auf Teile des Bebauungsplans beschränkt werden.<br />
(3) Die Landschaftsplanung hat die Ziele des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege zu verwirklichen.<br />
(4) 1 Soweit erforderlich, sind darzustellen oder festzusetzen<br />
1. der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft und seine<br />
Bewertung nach den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege,<br />
2. der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft und die zu seiner<br />
Erreichung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere<br />
a) die allgemeinen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen,<br />
b) die Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich oder zum Ersatz der zu<br />
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft,<br />
c) die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung<br />
bestimmter Flächen und einzelner Bestandteile der Natur im Sinn der<br />
Abschnitte III und III a,<br />
d) die Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege wild lebender Tiere und<br />
Pflanzen sowie die Maßnahmen zum Aufbau und Erhalt eines<br />
Biotopverbunds,<br />
e) die Maßnahmen zur Erholung in der freien Natur im Sinn des<br />
V. Abschnitts,<br />
f) die Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer,<br />
g) die Maßnahmen zum Schutz, zur Verbesserung der Qualität und zur<br />
Regeneration von Böden, Gewässern, Luft und Klima.<br />
2<br />
Die erforderlichen Darstellungen und Festsetzungen sind insbesondere zu<br />
treffen für Bereiche,
1. die erheblichen Landschaftsveränderungen ausgesetzt sind,<br />
2. die als Erholungsgebiete dienen oder als solche vorgesehen sind,<br />
3. in denen Landschaftsschäden vorhanden oder zu befürchten sind,<br />
4. die an oberirdische Gewässer angrenzen,<br />
5. die aus Gründen der Wasserversorgung, unbeschadet wasserrechtlicher<br />
Vorschriften, zu schützen und zu pflegen sind.<br />
(5) 1 Ist ein Bauleitplan nicht erforderlich, hat die Gemeinde einen<br />
Landschaftsplan und Grünordnungspläne aufzustellen und fortzuschreiben,<br />
sobald und soweit es aus Gründen des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege erforderlich ist. 2 Für das Verfahren zur Aufstellung und<br />
die Genehmigung gelten die Vorschriften für Bauleitpläne entsprechend.<br />
3<br />
Der Landschaftsplan hat die Rechtswirkung eines Flächennutzungsplans;<br />
der Grünordnungsplan hat die Rechtswirkung eines Bebauungsplans.<br />
(6) 1 Bei der Landschaftsplanung ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die<br />
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege in benachbarten Ländern und im Bundesgebiet in seiner<br />
Gesamtheit sowie die Verwirklichung der Belange des Naturschutzes und<br />
der Landschaftspflege in benachbarten Staaten nicht erschwert werden.<br />
2<br />
Bei grenzüberschreitenden Planungen sollen die Erfordernisse und<br />
Maßnahmen mit den benachbarten Ländern abgestimmt werden.<br />
Bay NatSchG Art. 3 a Biosphärenreservate<br />
(1) 1 Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
kann großflächige, repräsentative Ausschnitte von Kulturlandschaften<br />
nach Anerkennung durch die Organisation der Vereinten Nationen für<br />
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu Biosphärenreservaten erklären.<br />
2<br />
Biosphärenreservate dienen in beispielhafter Weise insbesondere<br />
1. dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Kulturlandschaften,<br />
2. der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die den<br />
Ansprüchen von Mensch und Natur gleichermaßen gerecht wird,<br />
3. der Umweltbildung, der ökologischen Umweltbeobachtung und<br />
Forschung.<br />
(2) Biosphärenreservate sollen entsprechend dem Einfluss menschlicher<br />
Tätigkeit in Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen gegliedert werden.<br />
(3) Der Begriff Biosphärenreservat darf nur für die nach Abs. 1 erklärten<br />
Gebiete verwendet werden.<br />
Bay NatSchG Art. 4 Durchführung der Landschaftspflege<br />
1 Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege, insbesondere zum Vollzug der Programme und Pläne nach<br />
Art. 3, können die unteren Naturschutzbehörden auf der Grundlage des<br />
Landschaftspflegekonzepts Bayern und des Arten- und Biotopschutzprogramms<br />
landschaftspflegerische und -gestalterische Maßnahmen durchführen. 2 Mit der<br />
Ausführung sollen nach Möglichkeit land- und forstwirtschaftliche Betriebe,<br />
Zusammenschlüsse solcher Betriebe, die sich zum Zweck der<br />
gemeinschaftlichen Bodenbewirtschaftung bilden, und Selbsthilfeeinrichtungen<br />
der Land- und Forstwirtschaft beauftragt werden. 3 Die Ausführung kann auch<br />
Vereinen übertragen werden, in denen kommunale Gebietskörperschaften,<br />
Landwirte und anerkannte Naturschutzverbände sich gleichberechtigt für den
Naturschutz und die Landschaftspflege einsetzen (Landschaftspflegeverbände).<br />
4 Die unteren Naturschutzbehörden können ferner öffentlich-rechtliche<br />
Körperschaften, Träger von Naturparken sowie Vereine und Verbände, die sich<br />
satzungsgemäß dem Naturschutz, der Landschaftspflege oder den<br />
Angelegenheiten der Erholung in der freien Natur widmen, beauftragen. 5 Die<br />
Beauftragung erfolgt nur mit Einverständnis der Beauftragten. 6 Hoheitliche<br />
Befugnisse können dadurch nicht übertragen werden.<br />
Bay NatSchG Art. 5 Duldungspflicht<br />
Die Grundeigentümer und die sonstigen Berechtigten haben, soweit die<br />
bisherige wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks nicht wesentlich<br />
beeinträchtigt wird, landschaftspflegerische und -gestalterische Maßnahmen,<br />
die der Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege dienen, durch Beauftragte der unteren Naturschutzbehörde<br />
zu dulden<br />
1. in Naturschutzgebieten, in Nationalparken, für Naturdenkmäler, für<br />
geschützte Landschaftsbestandteile sowie für gesetzlich geschützte Biotope<br />
und für geschützte Lebensstätten,<br />
2. in sonstigen Fällen, wenn<br />
a) der Naturhaushalt oder das Landschaftsbild durch den Zustand des<br />
Grundstücks, insbesondere bei Unterlassung einer ordnungsgemäßen<br />
Bewirtschaftung, beeinträchtigt oder gefährdet wird,<br />
b) mit einer nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen behördlichen<br />
Gestattung (Genehmigung, Erlaubnis, Planfeststellung u.ä.) nicht die zum<br />
Schutz und zur Pflege der Landschaft sowie zur Einbindung in das<br />
Landschaftsbild einschließlich der Eingrünung notwendigen Auflagen verbunden<br />
wurden und nachträgliche Auflagen nicht mehr zulässig sind.<br />
Bay NatSchG Art. 6 Eingriffe in Natur und Landschaft<br />
(1) Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder<br />
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten<br />
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die<br />
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das<br />
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.<br />
(2) 1 Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist<br />
ordnungsgemäß und nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele<br />
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br />
berücksichtigt werden. 2 Die den in Art. 2 b Abs. 2 genannten<br />
Anforderungen sowie den Regeln der guten fachlichen Praxis, die sich aus<br />
dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und § 17 Abs. 2 des<br />
Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, entsprechende land-, forst- und<br />
fischereiwirtschaftliche Bodennutzung widerspricht in der Regel nicht den<br />
in Satz 1 genannten Zielen und Grundsätzen. 3 Als ordnungsgemäß gilt die<br />
nach dem Waldgesetz für Bayern zulässige und vorgeschriebene<br />
Waldbewirtschaftung.<br />
(3) Die Wiederaufnahme der ausgeübten land-, forst- oder<br />
fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, die auf Grund vertraglicher<br />
Vereinbarungen oder der Teilnahme an Förderprogrammen über<br />
Bewirtschaftungsbeschränkungen zeitweise eingeschränkt oder
unterbrochen war, gilt nicht als Eingriff, soweit sie innerhalb einer Frist<br />
von 15 Jahren nach Beendigung des Vertrags oder des Förderprogramms<br />
erfolgt.<br />
(4) Für Vorhaben, die<br />
1. den Naturgenuss erheblich beeinträchtigen oder<br />
2. den Zugang zur freien Natur ausschließen oder erheblich<br />
beeinträchtigen,<br />
gelten die Regelungen für Eingriffe entsprechend.<br />
Bay NatSchG Art. 6 a Untersagung; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen<br />
(1) 1 Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare<br />
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie<br />
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes<br />
und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen<br />
(Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren<br />
(Ersatzmaßnahmen), soweit es zur Verwirklichung der Ziele des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. 2 Voraussetzung<br />
einer derartigen Verpflichtung ist, dass für den Eingriff eine behördliche<br />
Bewilligung, Erlaubnis, Genehmigung, Zustimmung, Planfeststellung,<br />
sonstige Entscheidung oder eine Anzeige an eine Behörde vorgeschrieben<br />
ist. 3 Beeinträchtigungen sind auch vermeidbar, wenn das mit dem Eingriff<br />
verfolgte Ziel auf andere zumutbare, die Natur und Umwelt schonendere<br />
Weise erreicht werden kann. 4 Eine Beeinträchtigung ist ausgeglichen,<br />
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts<br />
wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht<br />
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 5 In sonstiger Weise kompensiert<br />
ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten<br />
Funktionen des Naturhaushalts möglichst in dem vom Eingriff betroffenen<br />
Landschaftsraum in gleichwertiger Weise ersetzt sind und das<br />
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.<br />
(2) 1 Der Eingriff ist zu untersagen, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu<br />
vermeiden oder nicht im erforderlichen Maß in angemessener Frist<br />
auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und die<br />
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung<br />
aller Anforderungen an Natur und Landschaft im Rang vorgehen. 2 Werden<br />
als Folge eines Eingriffs Biotope zerstört, die für dort wild lebende Tiere<br />
und Pflanzen der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind, ist der<br />
Eingriff nur zulässig, wenn er aus zwingenden Gründen des<br />
überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist. 3 Sofern eine Art<br />
nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG betroffen ist, muss außerdem<br />
ein günstiger Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem<br />
natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleistet und es darf keine zumutbare<br />
Alternative vorhanden sein.<br />
(3) 1 Ist der Eingriff weder ausgleichbar noch in sonstiger Weise<br />
kompensierbar und gehen die Belange des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege nicht vor, kann vom Verursacher eine Ersatzzahlung<br />
verlangt werden. 2 Die Ersatzzahlung bemisst sich nach den Gesamtkosten<br />
einer geeigneten Ersatzmaßnahme. 3 Sind diese nicht feststellbar, bemisst<br />
sie sich nach Dauer und Schwere des Eingriffs; bei erheblichen
Landschaftsbildbeeinträchtigungen ist auch die Fernwirkung des<br />
Vorhabens zu berücksichtigen 4 Die Ersatzzahlung ist an den Bayerischen<br />
Naturschutzfonds zu entrichten und von diesem im Bereich der vom<br />
Eingriff räumlich betroffenen unteren Naturschutzbehörde nach deren<br />
näherer Bestimmung für Maßnahmen des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege zu verwenden. 5 Die untere Naturschutzbehörde hat zu<br />
prüfen, ob das angestrebte Ziel auch durch Verträge erreicht werden<br />
kann.<br />
(3 a) 1 Kompensationsmaßnahmen können bereits vor einem Eingriff<br />
durchgeführt werden. 2 Dies setzt voraus, dass eine ausreichende<br />
Dokumentation des Ausgangszustands der Fläche vorliegt und die untere<br />
Naturschutzbehörde die grundsätzliche Eignung der Fläche und der<br />
vorgesehenen Maßnahmen bestätigt. 3 Die Wiederherstellung des<br />
Ausgangszustands bleibt bis zur Entscheidung durch die nach Art. 6 b<br />
Abs. 1 Satz 1 zuständige Behörde möglich.<br />
(4) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen schließen Maßnahmen zur Sicherung<br />
des angestrebten Zustands ein.<br />
(5) 1 Werden Eingriffe im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften<br />
begonnen oder durchgeführt, kann die Einstellung angeordnet werden.<br />
2<br />
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands kann verlangt<br />
werden, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt<br />
werden können. 3 Soweit eine Wiederherstellung des ursprünglichen<br />
Zustands nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist,<br />
können der Ausgleich von Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege, Ersatzmaßnahmen oder<br />
Ersatzzahlungen verlangt werden.<br />
(6) 1 Bei Eingriffen, die keiner behördlichen Gestattung oder keiner Anzeige an<br />
eine Behörde bedürfen, kann der Ausgleich von Beeinträchtigungen durch<br />
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verlangt<br />
werden; für bestehende Anlagen sind auch nachträgliche Anordnungen<br />
zulässig. 2 Der Eingriff kann untersagt werden, wenn Beeinträchtigungen<br />
nicht im erforderlichen Maß auszugleichen sind und die Belange des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller<br />
Anforderungen an Natur und Landschaft im Rang vorgehen. 3 Wird der<br />
Eingriff entgegen der Untersagung durchgeführt, können die<br />
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands oder, soweit sie nicht oder<br />
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, Ersatzmaßnahmen<br />
oder Ersatzzahlungen verlangt werden.<br />
(7) Bei Eingriffen in Natur und Landschaft durch Behörden, denen keine<br />
behördliche Entscheidung nach Abs. 1 vorausgeht, gelten die Abs. 1 bis 3<br />
entsprechend.<br />
Bay NatSchG Art. 6 b Zuständigkeit und Verfahren bei Eingriffen;<br />
landschaftspflegerischer Begleitplan; Meldung der Ausgleichs- und<br />
Ersatzflächen<br />
(1) 1 Die Entscheidungen und Maßnahmen nach Art. 6 a Abs. 1 bis 3 und 5<br />
trifft die für die Gestattung oder Anzeige zuständige Behörde. 2 Die<br />
Entscheidungen und Maßnahmen werden im Benehmen mit der<br />
Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwaltungsstufe getroffen,
soweit nicht eine weitergehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist;<br />
dies gilt nicht für Entscheidungen, die auf Grund eines Bebauungsplans<br />
getroffen werden.<br />
(2) Die Beurteilung einer land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen<br />
Bodennutzung als Eingriff in Natur und Landschaft bedarf des<br />
Einvernehmens mit der jeweiligen Fachbehörde der vergleichbaren<br />
Verwaltungsstufe.<br />
(3) Die Vorlage zusätzlicher geeigneter Unterlagen kann verlangt werden,<br />
wenn die mit einem Antrag oder mit einer Anzeige vorzulegenden<br />
Unterlagen für die Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen im Sinn des<br />
Art. 6 nicht ausreichen und wenn die Behörde die Unterlagen nicht selbst<br />
oder nur mittels höheren Aufwands als der Verursacher beschaffen<br />
könnte.<br />
(4) 1 Bei einem Eingriff in Natur und Landschaft, der auf Grund eines nach<br />
öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden soll,<br />
hat der Planungsträger die zum Ausgleich dieses Eingriffs erforderlichen<br />
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder die<br />
Ersatzmaßnahmen im Einzelnen im Fachplan oder in einem<br />
landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte darzustellen; der<br />
Begleitplan ist Bestandteil des Fachplans. 2 Dies gilt auch in den Fällen des<br />
Art. 6 a Abs. 7.<br />
(5) 1 Bei anderen Eingriffen als den in Abs. 4 genannten kann ein<br />
landschaftspflegerischer Begleitplan verlangt werden. 2 Der<br />
landschaftspflegerische Begleitplan ist Gegenstand des<br />
Gestattungsverfahrens und ist entsprechend dessen Ergebnis zum Inhalt<br />
des Bescheids zu machen.<br />
(6) 1 Die nach Abs. 1 Satz 1 zuständige Behörde kann die Leistung einer<br />
Sicherheit verlangen, um die Erfüllung der Verpflichtungen nach Art. 6 a<br />
Abs. 1 und 3 zu gewährleisten. 2 In den Fällen der Abs. 4 und 5 kann die<br />
in Abs. 1 Satz 1 genannte Behörde vom Verursacher verlangen, die<br />
Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen fristgerecht durch<br />
die Bestätigung eines privaten Sachverständigen nachzuweisen; sie<br />
unterrichtet die zuständige Naturschutzbehörde. 3 Aus der Bestätigung<br />
muss sich ergeben, dass die Maßnahmen entsprechend dem Bescheid<br />
ausgeführt oder welche Abweichungen von den festgesetzten Maßnahmen<br />
vorgenommen worden sind. 4 Die Staatsregierung regelt die<br />
Anforderungen an die Zulassung, Fachkenntnis und Zuverlässigkeit von<br />
privaten Sachverständigen durch Rechtsverordnung. 5 Die Sätze 1 bis 4<br />
gelten nicht für Eingriffe durch Behörden.<br />
(7) 1 Die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzten Flächen sowie<br />
Flächen im Sinn des Art. 6 a Abs. 3 a werden im Ökoflächenkataster<br />
erfasst. 2 Hierzu übermitteln die nach Abs. 1 Satz 1 zuständigen Behörden<br />
dem Bayerischen Landesamt für Umwelt rechtzeitig die für die Erfassung<br />
und Kontrolle der Flächen erforderlichen Angaben in aufbereitbarer Form.<br />
3<br />
Die untere Naturschutzbehörde übermittelt in den Fällen des Art. 6 a<br />
Abs. 3 Satz 4 und Abs. 3 a, die Behörden übermitteln in den Fällen des<br />
Art. 6 a Abs. 7 die erforderlichen Angaben. 4 Die Gemeinden übermitteln<br />
die erforderlichen Angaben, wenn Flächen oder Maßnahmen zum<br />
Ausgleich im Sinn des § 1 a Abs. 3 des Baugesetzbuchs in einem
gesonderten Bebauungsplan festgesetzt sind oder Maßnahmen auf von der<br />
Gemeinde bereitgestellten Flächen durchgeführt werden.<br />
Bay NatSchG Art. 6 c (weggefallen)<br />
Bay NatSchG Art. 6 d Grabenfräsen<br />
1 Der Einsatz von Grabenfräsen ist der unteren Naturschutzbehörde mindestens<br />
einen Monat vorher anzuzeigen. 2 Anordnungen nach Art. 6 a Abs. 1 bis 3 sind<br />
nur innerhalb von zwei Wochen nach der Anzeige zulässig. 3 In<br />
wasserführenden Gräben ist der Einsatz von Grabenfräsen nicht zulässig. 4 Eine<br />
Ausnahme kann für wasserführende Gräben auf Antrag zugelassen werden,<br />
wenn durch die Grabenräumung keine erheblichen Beeinträchtigungen für den<br />
Naturhaushalt, insbesondere für die Tierwelt, eintreten. 5 Art. 6 a Abs. 5 gilt<br />
entsprechend.<br />
Bay NatSchG Art. 6 e Wegebau im Alpengebiet<br />
1 Im Alpengebiet im Sinn der Verordnung über das<br />
Landesentwicklungsprogramm Bayern ist die Errichtung oder wesentliche<br />
Änderung von Straßen und befahrbaren Wegen, die keiner öffentlichrechtlichen<br />
Gestattung bedarf, mindestens drei Monate vorher der unteren<br />
Naturschutzbehörde anzuzeigen. 2 Anordnungen nach Art. 6 a Abs. 1 bis 3 sind<br />
nur innerhalb von drei Monaten nach der Anzeige zulässig.<br />
Bay NatSchG Art. 6 f Pisten<br />
(1) 1 Das erstmalige dauerhafte Herrichten eines durch eine mechanische<br />
Aufstiegshilfe erschlossenen Geländes zum Zweck des Abfahrens mit Ski,<br />
Skibobs oder Rodeln (Skipiste) oder mit anderen Sportgeräten und seine<br />
wesentliche Änderung oder Erweiterung bedürfen der Erlaubnis. 2 Die<br />
Erlaubnispflicht für Skipisten tritt ab den in Abs. 2 genannten<br />
Schwellenwerten ein. 3 In der Erlaubnis ist über die Zulässigkeit von<br />
zugehörigen Einrichtungen mit zu entscheiden. 4 Die Entscheidung über<br />
die Erlaubnis ersetzt die Entscheidung über eine nach anderen<br />
Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung; die Entscheidung wird<br />
im Benehmen mit der für die andere Gestattung zuständigen Behörde<br />
getroffen, soweit nicht eine weitergehende Form der Beteiligung gesetzlich<br />
vorgeschrieben ist. 5 Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn dem<br />
Vorhaben keine Belange des Allgemeinwohls entgegenstehen. 6 Die<br />
Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen versehen sowie befristet<br />
werden.<br />
(2) 1 Betrifft das Vorhaben eine Skipiste von mehr als 10 ha, in Gebieten von<br />
gemeinschaftlicher Bedeutung oder in Europäischen Vogelschutzgebieten,<br />
in Nationalparken, Naturschutzgebieten oder Biotopen im Sinn des<br />
Art. 13 d Abs. 1 von mehr als 5 ha Fläche oder soll es ganz oder zu<br />
wesentlichen Teilen in einer Höhe von über 1 800 m üNN verwirklicht<br />
werden, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Maßgabe des Fünften<br />
Teils Abschnitt III des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes<br />
durchzuführen. 2 Bei Änderung oder Erweiterung von Skipisten ist eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn<br />
1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil für sich betrachtet oder<br />
2. das durch die Änderung oder Erweiterung entstehende Vorhaben bei
einheitlicher Betrachtung erstmals<br />
die in Satz 1 genannten Schwellenwerte erfüllt. 3 Im Fall des Satzes 2<br />
Nr. 2 ist dem geänderten oder erweiterten Vorhaben derjenige Teil des<br />
Bestandes nicht mehr zuzurechnen, der früher als zwei Jahre vor dem<br />
Antrag auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungsvorhabens in<br />
Betrieb genommen worden ist.<br />
III. Abschnitt Schutz von Flächen und einzelnen Bestandteilen<br />
der Natur<br />
Bay NatSchG Art. 7 Naturschutzgebiete<br />
(1) Als Naturschutzgebiete können Gebiete festgesetzt werden, in denen ein<br />
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in<br />
einzelnen Teilen<br />
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von<br />
Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter wild lebender Tieroder<br />
Pflanzenarten,<br />
2. aus ökologischen, wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder<br />
landeskundlichen Gründen oder<br />
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden<br />
Schönheit<br />
erforderlich ist.<br />
(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung<br />
des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer erheblichen<br />
Störung führen können, sind verboten.<br />
(3) 1 Naturschutzgebiete werden durch Rechtsverordnung festgesetzt.<br />
2<br />
Naturschutzgebiete sind allgemein zugänglich; soweit es der<br />
Schutzzweck erfordert, kann in der Rechtsverordnung der Zugang<br />
untersagt, beschränkt oder das Verhalten im Naturschutzgebiet geregelt<br />
werden. 3 In der Rechtsverordnung können Ausnahmen von den Verboten<br />
nach Absatz 2, insbesondere zum Schutz und zur Pflege bestimmt werden.<br />
4<br />
In der Rechtsverordnung sind ferner die Handlungen zu nennen, die mit<br />
Geldbuße bedroht werden sollen.<br />
Bay NatSchG Art. 8 Nationalparke<br />
(1) 1 Landschaftsräume, die eine Mindestfläche von 10 000 ha haben sollen,<br />
und die<br />
1. wegen ihres ausgeglichenen Naturhaushalts, ihrer Bodengestaltung,<br />
ihrer Vielfalt oder ihrer Schönheit überragende Bedeutung besitzen,<br />
2. im überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines<br />
Naturschutzgebiets erfüllen und<br />
3. sich in einem vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand<br />
befinden oder geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder in<br />
einen Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst ungestörten<br />
Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet,<br />
können durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtags zu<br />
Nationalparken erklärt werden. 2 Im Fall eines grenzüberschreitenden<br />
Nationalparks kann die jenseits der Grenze liegende Fläche in die
Mindestfläche eingerechnet werden, wenn sie nach den dort geltenden<br />
Vorschriften zum Nationalpark erklärt wird.<br />
(2) 1 Nationalparke haben zum Ziel, im überwiegenden Teil ihres Gebiets den<br />
möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen<br />
Dynamik zu gewährleisten. 2 Sie dienen vornehmlich der Erhaltung und<br />
wissenschaftlichen Beobachtung natürlicher und naturnaher<br />
Lebensgemeinschaften sowie eines möglichst artenreichen heimischen<br />
Tier- und Pflanzenbestands. 3 Nationalparke bezwecken keine<br />
wirtschaftsbestimmte Nutzung.<br />
(3) Nationalparke sind der Bevölkerung zu Bildungs- und Erholungszwecken<br />
zu erschließen, soweit es der Schutzzweck erlaubt.<br />
(4) Durch Rechtsverordnung werden neben den zu Schutz und Pflege sowie<br />
zur Verwirklichung der Abs. 2 und 3 erforderlichen Vorschriften<br />
Bestimmungen über die Verwaltung des Nationalparks und über die<br />
erforderlichen Lenkungsmaßnahmen einschließlich der Regelung der<br />
Jagdausübung, des Wildbestands und der Fischerei getroffen.<br />
Bay NatSchG Art. 9 Naturdenkmäler<br />
(1) 1 Als Naturdenkmäler können Einzelschöpfungen der Natur geschützt<br />
werden, deren Erhaltung wegen ihrer hervorragenden Schönheit,<br />
Seltenheit oder Eigenart oder ihrer ökologischen, wissenschaftlichen,<br />
geschichtlichen, volks- oder heimatkundlichen Bedeutung im öffentlichen<br />
Interesse liegt. 2 Dazu gehören insbesondere charakteristische<br />
Bodenformen, Felsbildungen, erdgeschichtliche Aufschlüsse,<br />
Wanderblöcke, Gletscherspuren, Quellen, Wasserläufe, Wasserfälle, alte<br />
oder seltene Bäume und besondere Pflanzenvorkommen.<br />
(2) Soweit es zur Sicherung einer Einzelschöpfung der Natur erforderlich ist,<br />
kann auch ihre Umgebung geschützt werden.<br />
(3) Naturdenkmäler werden durch Rechtsverordnung unter Schutz gestellt.<br />
(4) Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung in der Rechtsverordnung ist es<br />
verboten, ein Naturdenkmal zu entfernen, zu zerstören, zu beschädigen<br />
oder zu verändern; die Handlungen, die mit Geldbuße bedroht werden<br />
sollen, sind in der Rechtsverordnung nach Abs. 3 zu nennen.<br />
(5) Auch ohne Erlass einer Rechtsverordnung kann durch Einzelanordnung<br />
verboten werden, Gegenstände, die die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2<br />
erfüllen, zu entfernen, zu zerstören oder zu verändern.<br />
Bay NatSchG Art. 10 Landschaftsschutzgebiete<br />
(1) Als Landschaftsschutzgebiete können Gebiete festgesetzt werden, in<br />
denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft oder besondere<br />
Pflegemaßnahmen<br />
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und<br />
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit<br />
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,<br />
2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbilds oder<br />
der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder<br />
3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung<br />
erforderlich sind.
(2) 1 Landschaftsschutzgebiete werden durch Rechtsverordnung festgesetzt.<br />
2 In der Rechtsverordnung werden unter besonderer Beachtung des<br />
Art. 2 b Abs. 1 alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets<br />
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 3 Art. 6<br />
Abs. 2 gilt entsprechend, soweit die Rechtsverordnung nicht im Einzelnen<br />
entgegenstehende Verbote enthält.<br />
Bay NatSchG Art. 11 Naturparke<br />
(1) Großräumige, der naturräumlichen Gliederung entsprechende Gebiete von<br />
in der Regel mindestens 20 000 ha Fläche, die<br />
1. überwiegend als Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete<br />
festgesetzt sind,<br />
2. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für<br />
umweltverträgliche Erholungsformen besonders eignen,<br />
3. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch<br />
vielfältige Nutzungsformen geprägten Landschaft und ihrer Arten- und<br />
Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck eine dauerhaft<br />
umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und<br />
4. durch einen Träger entsprechend ihrem Naturschutz- und<br />
Erholungszweck entwickelt und gepflegt werden,<br />
können von der obersten Naturschutzbehörde zu Naturparken erklärt<br />
werden.<br />
(2) Naturparkverordnungen der obersten Naturschutzbehörde gelten<br />
hinsichtlich der Festsetzung von Schutzzonen mit Verboten im Sinn des<br />
Art. 10 Abs. 2 Sätze 2 und 3 als Rechtsverordnungen über<br />
Landschaftsschutzgebiete weiter.<br />
Bay NatSchG Art. 12 Landschaftsbestandteile und Grünbestände<br />
(1) 1 Durch Rechtsverordnung können Teile von Natur und Landschaft, die<br />
nicht die Voraussetzungen des Art. 9 erfüllen, aber im Interesse des<br />
Naturhaushalts, insbesondere der Tier- und Pflanzenwelt oder wegen ihrer<br />
Bedeutung für die Entwicklung oder Erhaltung von<br />
Biotopverbundsystemen, erforderlich sind oder zur Belebung des<br />
Landschaftsbilds beitragen, als Landschaftsbestandteile geschützt werden.<br />
2<br />
Dazu gehören insbesondere Bäume, Baum- und Gebüschgruppen, Raine,<br />
Alleen, Hecken, Feldgehölze, Schutzpflanzungen, Schilf- und<br />
Rohrbestände, Moore, Streuwiesen, Parke und kleinere Wasserflächen.<br />
(2) 1 In gleicher Weise kann auch der Bestand an Bäumen und Sträuchern<br />
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ganz oder teilweise<br />
geschützt werden. 2 In der Verordnung können die Grundeigentümer oder<br />
sonstigen Berechtigten zu Ersatzpflanzungen oder zweckgebundenen<br />
Ausgleichszahlungen an die Gemeinde für den Fall der Bestandsminderung<br />
verpflichtet werden.<br />
(3) Art. 9 Abs. 4 und 5 sind entsprechend anzuwenden.<br />
Bay NatSchG Art. 13 Schutz von Kennzeichnungen; Registrierung<br />
(1) Die Schutzbegriffe “Naturschutzgebiet”, “Nationalpark”, “Naturdenkmal”,<br />
“geschützter Landschaftsbestandteil”, “Landschaftsschutzgebiet” und
“Naturpark” dürfen nur für die nach den Bestimmungen dieses Abschnitts<br />
ausgewiesenen Gebiete und Gegenstände verwendet werden.<br />
(2) 1 Die nach diesem Abschnitt geschützten Flächen und einzelnen<br />
Bestandteile der Natur sind in Verzeichnisse einzutragen. 2 Die<br />
Verzeichnisse für Nationalparke, Naturschutzgebiete, Naturparke und<br />
Landschaftsschutzgebiete werden beim Bayerischen Landesamt für<br />
Umwelt, die sonstigen Verzeichnisse bei den unteren Naturschutzbehörden<br />
geführt.<br />
Bay NatSchG Art. 13 a Vollzug von Schutzverordnungen<br />
(1) Im Rahmen behördlicher Gestattungsverfahren nach Schutzverordnungen<br />
im Sinn dieses Abschnitts sind die Vorschriften des Art. 6 a Abs. 1 und 3<br />
über Ersatzmaßnahmen und Ersatzzahlungen entsprechend anzuwenden.<br />
(2) Eine auf Grund einer Schutzverordnung erforderliche behördliche<br />
Gestattung wird durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche<br />
behördliche Gestattung ersetzt; diese Gestattung darf nur erteilt werden,<br />
wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der nach der<br />
Schutzverordnung erforderlichen Gestattung vorliegen und die nach<br />
Naturschutzrecht zuständige Behörde ihr Einvernehmen erklärt.<br />
(3) Werden Veränderungen oder Störungen von geschützten oder einstweilig<br />
sichergestellten Gegenständen oder von geplanten Naturschutzgebieten<br />
im Sinn des Art. 48 Abs. 3 im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften begonnen oder durchgeführt, sind die Vorschriften des<br />
Art. 6 a Abs. 5 entsprechend anzuwenden.<br />
III a. Abschnitt Schutz des Europäischen ökologischen Netzes<br />
“Natura 2000”, gesetzlicher Schutz von Biotopen, Biotopverbund<br />
Bay NatSchG Art. 13 b Auswahl; besonderer Schutz der Gebiete<br />
(1) 1 Die Staatsregierung wählt die Gebiete im Sinn des Art. 4 Abs. 1 der<br />
Richtlinie 92/43/EWG und die Europäischen Vogelschutzgebiete unter<br />
Beteiligung der Betroffenen aus. 2 Die oberste Naturschutzbehörde wird<br />
ermächtigt, die Europäischen Vogelschutzgebiete gemäß Art. 4 Abs. 1 und<br />
2 der Richtlinie 79/409/EWG sowie die Gebietsbegrenzungen und die<br />
Erhaltungsziele dieser Gebiete durch Rechtsverordnung festzulegen; die<br />
Rechtsverordnung ergeht im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für<br />
Landwirtschaft und Forsten.<br />
(2) 1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische<br />
Vogelschutzgebiete werden nach den Maßgaben des III. Abschnitts als<br />
besondere Schutzgebiete geschützt. 2 In der Schutzverordnung werden<br />
der Schutzzweck entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen sowie die<br />
dafür erforderlichen Gebote, Verbote und Gebietsbegrenzungen unter<br />
Berücksichtigung der Einwirkungen von außen festgelegt. 3 In der<br />
Schutzverordnung soll dargestellt werden, ob prioritäre Arten oder<br />
prioritäre natürliche Lebensraumtypen geschützt werden sollen. 4 Soweit<br />
für Europäische Vogelschutzgebiete eine Rechtsverordnung nach Abs. 1<br />
Satz 2 besteht, hat die Schutzverordnung die darin enthaltenen<br />
Festlegungen zu beachten. 5 Die Inschutznahme nach Satz 1 kann
unterbleiben, wenn nach diesem Gesetz, anderen Rechtsvorschriften,<br />
durch die zivilrechtliche Verfügungsbefugnis eines gemeinnützigen<br />
Trägers, durch Verträge oder Förderprogramme ein gleichwertiger Schutz<br />
gewährleistet ist.<br />
Bay NatSchG Art. 13 c Schutzvorschriften<br />
(1) 1 Veränderungen oder Störungen, die Gebiete von gemeinschaftlicher<br />
Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete in den für ihre<br />
Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen<br />
können, sind verboten. 2 In Konzertierungsgebieten sind die in Satz 1<br />
genannten Handlungen verboten, sofern sie deren prioritäre Biotope oder<br />
prioritäre Arten erheblich beeinträchtigen können.<br />
(2) Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten<br />
oder Plänen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische<br />
Vogelschutzgebiete in den für ihren Schutzzweck oder für ihre<br />
Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen<br />
können, sind unzulässig.<br />
(3) Pläne, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder<br />
Projekten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische<br />
Vogelschutzgebiete erheblich beeinträchtigen können, haben Schutzzweck<br />
und Erhaltungsziele dieser Gebiete zu berücksichtigen.<br />
(4) 1 Weitergehende Schutzvorschriften bleiben unberührt. 2 Art. 6 a Abs. 5 ist<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
Bay NatSchG Art. 13 d Gesetzlich geschützte Biotope<br />
(1) Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen<br />
Beeinträchtigung folgender, ökologisch besonders wertvoller Biotope<br />
führen können, sind unzulässig:<br />
1. Moore und Sümpfe, Röhrichte, seggen- oder binsenreiche Nass- und<br />
Feuchtwiesen, Pfeifengraswiesen und Quellbereiche,<br />
2. Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auwälder,<br />
3. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender<br />
Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen<br />
uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer<br />
natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und<br />
regelmäßig überschwemmten Bereiche; dies gilt nicht für regelmäßig<br />
erforderliche Maßnahmen zur Unterhaltung der künstlichen, zum Zweck<br />
der Fischereiwirtschaft angelegten geschlossenen Gewässer,<br />
4. Magerrasen, Heiden, Borstgrasrasen, offene Binnendünen,<br />
wärmeliebende Säume, Lehm- und Lösswände, offene natürliche Block-,<br />
Schutt- und Geröllhalden,<br />
5. Wälder und Gebüsche trockenwarmer <strong>Stand</strong>orte, Schluchtwälder,<br />
Block- und Hangschuttwälder,<br />
6. offene Felsbildungen, alpine Rasen und Schneetälchen,<br />
Krummholzgebüsche und Hochstaudengesellschaften.<br />
(2) 1 Für eine Maßnahme kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden,<br />
wenn die Beeinträchtigungen der jeweiligen <strong>Stand</strong>orteigenschaften für<br />
wild lebende Tiere und Pflanzen ausgeglichen werden können oder wenn<br />
die Maßnahme aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig
ist. 2 Die Entscheidung über die Ausnahme wird durch die Entscheidung<br />
über eine nach anderen Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung<br />
ersetzt; diese Entscheidung wird im Benehmen mit der zuständigen<br />
Naturschutzbehörde getroffen.<br />
(3) Die Sicherung von Brut-, Nahrungs- und Aufzuchtsbiotopen des Großen<br />
Brachvogels, der Uferschnepfe, des Rotschenkels, der Bekassine, des<br />
Weißstorchs oder des Wachtelkönigs in feuchten Wirtschaftswiesen und -<br />
weiden soll in geeigneter Weise, insbesondere durch privatrechtliche<br />
Vereinbarungen angestrebt werden.<br />
(4) 1 Maßnahmen auf Grund der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur<br />
Unterhaltung der Gewässer bedürfen keiner Ausnahme vom Verbot des<br />
Abs. 1. 2 Sie dürfen nur unter den Voraussetzungen des Abs. 2 Satz 1<br />
durchgeführt werden.<br />
(5) 1 Werden Maßnahmen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen<br />
Vorschriften begonnen oder durchgeführt, kann die Einstellung angeordnet<br />
werden. 2 Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands kann<br />
verlangt werden, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände<br />
hergestellt werden können. 3 Soweit eine Wiederherstellung des<br />
ursprünglichen Zustands nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand<br />
möglich ist, kann der Ausgleich der nachteiligen Veränderungen durch<br />
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verlangt<br />
werden.<br />
(6) Abs. 1 findet keine Anwendung für den Fall, dass ein dort genanntes<br />
Biotop während der Laufzeit eines Vertrags oder der Teilnahme an einem<br />
Förderprogramm über Bewirtschaftungsbeschränkungen entstanden ist,<br />
soweit dieses innerhalb einer Frist von fünfzehn Jahren nach Beendigung<br />
des Vertrags oder des Förderprogramms wieder einer land-, forst- oder<br />
fischereiwirtschaftlichen Nutzung zugeführt wird.<br />
(7) 1 Für Maßnahmen nach Abs. 1, die der Verwendung der Biotope zu<br />
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung dienen, ist eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Maßgabe des Fünften Teils Abschnitt<br />
III des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes durchzuführen, wenn<br />
die Gesamtfläche der betroffenen Biotope mehr als 3 ha beträgt. 2 Bei<br />
Änderung oder Erweiterung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung<br />
der Biotope ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn<br />
1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil für sich betrachtet oder<br />
2. das durch die Änderung oder Erweiterung entstehende Vorhaben bei<br />
einheitlicher Betrachtung erstmals<br />
den in Satz 1 genannten Schwellenwert erfüllt. 3 Im Fall des Satzes 2 Nr. 2<br />
ist dem geänderten oder erweiterten Vorhaben derjenige Teil des<br />
Bestandes nicht mehr zuzurechnen, der früher als zwei Jahre vor dem<br />
Antrag auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungsvorhabens in<br />
Betrieb genommen worden ist.<br />
Bay NatSchG Art. 13 e Schutz der Lebensstätten<br />
(1) Es ist verboten, in der freien Natur<br />
1. Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche zu roden,<br />
abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige Weise zu beeinträchtigen,<br />
2. Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche in der Zeit vom
1. März bis 30. September zurückzuschneiden oder auf den Stock zu<br />
setzen,<br />
3. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen, ungenutztem<br />
Gelände, an Hecken oder Hängen abzubrennen,<br />
4. Rohr- und Schilfbestände in der Zeit vom 1. März bis 30. September zu<br />
mähen,<br />
5. Höhlen, ökologisch oder geomorphologisch bedeutsame Dolinen,<br />
Toteislöcher, aufgelassene, künstliche unterirdische Hohlräume,<br />
Trockenmauern oder Lesesteinwälle sowie Tümpel und Kleingewässer zu<br />
beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen.<br />
(2) 1 Die Verbote nach Abs. 1 gelten nicht für die ordnungsgemäße Nutzung<br />
im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, die den Bestand erhält. 2 Das<br />
Verbot nach Abs. 1 Nr. 4 gilt nicht in künstlichen, zum Zweck der<br />
Fischereiwirtschaft angelegten geschlossenen Gewässern.<br />
(3) Art. 13 d Abs. 2 und Art. 6 a Abs. 5 gelten entsprechend.<br />
Bay NatSchG Art. 13 f Biotopverbund; Arten- und<br />
Biotopschutzprogramm<br />
(1) Auf mindestens 10 v. H. der Landesfläche soll ein Netz verbundener<br />
Biotope eingerichtet und dauerhaft erhalten werden, um die Populationen<br />
wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume zu<br />
sichern und die hierfür erforderlichen funktionsfähigen ökologischen<br />
Wechselbeziehungen zu bewahren, wiederherzustellen und zu entwickeln.<br />
(2) 1 Das landesweite Netz verbundener Biotope besteht aus Kernflächen,<br />
Verbindungsflächen und Verbindungselementen<br />
(Biotopverbundbestandteile). 2 Biotopverbundbestandteile sind:<br />
1. Nationalparke und Naturschutzgebiete,<br />
2. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische<br />
Vogelschutzgebiete,<br />
3. gesetzlich geschützte Biotope,<br />
4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich Teilen von<br />
Landschaftsschutzgebieten,<br />
wenn sie geeignet sind, die Zielsetzung des Biotopverbunds zu<br />
verwirklichen. 3 Die oberirdischen Gewässer einschließlich ihrer<br />
Gewässerrandstreifen, Uferzonen und Auenbereiche sind als Lebensräume<br />
heimischer Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und so weiter zu<br />
entwickeln, dass sie ihre großräumige Vernetzungsfunktion auf Dauer<br />
erfüllen können.<br />
(3) Die Biotopverbundbestandteile sind durch langfristige Vereinbarungen,<br />
Förderprogramme, Schutzgebietsausweisungen, planungsrechtliche<br />
Festlegungen, die Verfügungsbefugnis eines öffentlichen oder<br />
gemeinnützigen Trägers oder andere geeignete Maßnahmen dauerhaft zu<br />
sichern.<br />
(4) 1 Fachliche Grundlage für die Auswahl der Biotopverbundbestandteile ist<br />
insbesondere das Arten- und Biotopschutzprogramm. 2 Es enthält<br />
1. die Darstellung und Bewertung der unter dem Gesichtspunkt des Artenund<br />
Biotopschutzes bedeutsamen Populationen, Lebensgemeinschaften<br />
und Biotope wild lebender Tier- und Pflanzenarten, insbesondere der in<br />
ihrem Bestand gefährdeten Arten und Lebensräume,
2. die zu deren Schutz, Pflege und Entwicklung erforderlichen Ziele und<br />
Maßnahmen sowie Wege zu ihrer Verwirklichung.<br />
3<br />
Das Arten- und Biotopschutzprogramm unterliegt als Fachkonzept der<br />
ständigen Fortentwicklung.<br />
IV. Abschnitt Schutz von Pflanzen und Tieren<br />
Bay NatSchG Art. 14 Allgemeine Vorschriften<br />
(1) 1 Die Vorschriften dieses Abschnitts dienen dem Schutz und der Pflege der<br />
wild lebenden Tiere und Pflanzen, ihrer Entwicklungsformen,<br />
Lebensstätten, Lebensräume und Lebensgemeinschaften als Teil des<br />
Naturhaushalts (Artenschutz). 2 Der Artenschutz schließt auch die<br />
Ansiedlung verdrängter oder in ihrem Bestand bedrohter Pflanzen- und<br />
Tierarten an geeigneten Lebensstätten innerhalb ihres natürlichen<br />
Verbreitungsgebiets ein.<br />
(2) 1 Um dem Aussterben geschützter Tiere und Pflanzen entgegenzuwirken,<br />
sind auch die ihnen als Nahrungsquellen, Brut- und Nistgelegenheiten<br />
dienenden Lebensbereiche (Biotope) wie Tümpel, Sumpfgebiete, Riede,<br />
Hecken und Feldgehölze nach Möglichkeit zu erhalten. 2 Im besonderen ist<br />
die Verwendung von Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln<br />
einzuschränken.<br />
(3) Die Vorschriften des Pflanzenschutzrechts, des Tierseuchenrechts, des<br />
Tierschutzrechts sowie des Forst-, Jagd- und Fischereirechts bleiben<br />
unberührt.<br />
Bay NatSchG Art. 14 a (weggefallen)<br />
Bay NatSchG Art. 15 Allgemeiner Schutz<br />
(1) Es ist verboten, wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem<br />
<strong>Stand</strong>ort zu entnehmen, zu nutzen, ihre Bestände niederzuschlagen oder<br />
auf sonstige Weise zu verwüsten.<br />
(2) Wild lebende Tiere dürfen nicht mutwillig beunruhigt, belästigt oder ohne<br />
vernünftigen Grund gefangen, verletzt oder getötet werden.<br />
(3) Lebensstätten dürfen nicht ohne vernünftigen Grund beeinträchtigt oder<br />
zerstört werden.<br />
(4) Die Verbote des Abs. 1 stehen der ordnungsgemäßen Nutzung oder<br />
Verbesserung des Bodens und der Unkrautbekämpfung nicht entgegen,<br />
soweit diese ohne Störung des Naturhaushalts durchgeführt werden.<br />
Bay NatSchG Art. 16 (weggefallen)<br />
Bay NatSchG Art. 17 Aussetzen und Ansiedeln von Tieren und Pflanzen<br />
(1) 1 Wer in der freien Natur Pflanzen gebietsfremder Arten oder Tiere<br />
aussetzen oder ansiedeln will, bedarf der Genehmigung der höheren<br />
Naturschutzbehörde. 2 Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten<br />
nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen bei der<br />
Genehmigungsbehörde zu entscheiden. 3 Ist der Antrag unvollständig oder<br />
weist er sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die Behörde den<br />
Antragsteller zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen
Frist auf. 4 Werden die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben, gilt der<br />
Antrag als zurückgenommen. 5 Die Genehmigung gilt vorbehaltlich des<br />
Satzes 4 als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist nach Satz 2 versagt<br />
wird.<br />
(2) Bei der Genehmigung sind die Vorschriften des Art. 22 der Richtlinie<br />
92/43/EWG und des Art. 11 der Richtlinie 79/409/EWG sowie des Art. 8<br />
Buchst. h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt vom 5. Juni<br />
1992 (BGBl 1993 II S. 1471) zu beachten.<br />
(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der<br />
Tier- oder Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten oder eine Gefährdung des<br />
Bestands oder der Verbreitung wild lebender Tier- oder Pflanzenarten der<br />
Mitgliedstaaten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen<br />
ist.<br />
(4) Ausgenommen von der Genehmigungspflicht nach Abs. 1 ist<br />
1. der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft,<br />
2. das Einsetzen von Tieren<br />
a) nicht gebietsfremder Arten,<br />
b) gebietsfremder Arten, sofern das Einsetzen einer<br />
pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, bei der die Belange des<br />
Artenschutzes berücksichtigt sind,<br />
zum Zwecke des biologischen Pflanzenschutzes,<br />
3. das Ansiedeln von dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegenden Tieren<br />
nicht gebietsfremder Arten.<br />
(5) Soweit in der freien Natur ungenehmigt angesiedelte Tiere oder Pflanzen<br />
gebietsfremder Arten eine erhebliche Gefahr für den Bestand oder die<br />
Verbreitung wild lebender Tier- oder Pflanzenarten im Inland oder im<br />
Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union darstellen, kann die<br />
höhere Naturschutzbehörde die aus Gründen des Artenschutzes zwingend<br />
erforderlichen Maßnahmen anordnen.<br />
Bay NatSchG Art. 18 Ermächtigungen der obersten<br />
Naturschutzbehörde<br />
(1) 1 Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung<br />
bestimmte, nicht unter § 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG fallende und nicht<br />
nach § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegende<br />
Tier- und Pflanzenarten oder Populationen solcher Arten, insbesondere in<br />
Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten, unter besonderen<br />
Schutz stellen, soweit es sich um wild lebende heimische Tier- und<br />
Pflanzenarten handelt und dies<br />
1. wegen der Gefährdung des Bestands durch den menschlichen Zugriff<br />
oder<br />
2. zur Sicherung der in Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG genannten<br />
Zwecke<br />
im Geltungsbereich dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlich ist. 2 Bestimmte nach<br />
Satz 1 besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten kann die oberste<br />
Naturschutzbehörde durch Rechtsverordnung unter strengen Schutz<br />
stellen, soweit diese im Geltungsbereich dieses <strong>Gesetze</strong>s vom Aussterben<br />
bedroht sind. 3 Für die nach den Sätzen 1 und 2 geschützten Arten gelten<br />
§ 10 Abs. 2 und 3, §§ 42, 43, 49 und 62 BNatSchG sowie die auf der
Grundlage von § 52 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG erlassenen Vorschriften. 4 Die<br />
oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmte<br />
nach Satz 1 besonders geschützte Arten von Verboten des § 42 BNatSchG<br />
ganz, teilweise oder unter bestimmten Voraussetzungen ausnehmen.<br />
(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung<br />
1. Bezeichnungen für Einrichtungen mit Tieren und Pflanzen festlegen, die<br />
aus Gründen des Artenschutzes nur mit Zustimmung der obersten<br />
Naturschutzbehörde geführt werden dürfen,<br />
2. Handlungen verbieten oder einschränken, die geeignet sind, die<br />
Ausrottung der Bestände wild lebender Tiere oder Pflanzen zu fördern,<br />
3. das Abbrennen der Bodendecke und des Pflanzenwuchses verbieten<br />
oder einschränken,<br />
4. zur Verwirklichung des Artenschutzes außerhalb der land- und<br />
forstwirtschaftlichen Nutzflächen die Verwendung von chemischen Mitteln<br />
zur Bekämpfung und zur Abwehr von Pflanzen und Tieren sowie die<br />
Verwendung von Wirkstoffen, die den Entwicklungsablauf von Pflanzen<br />
und Tieren beeinträchtigen können, verbieten oder einschränken,<br />
5. zum Schutz und zur Reinhaltung der einheimischen Pflanzenwelt<br />
Vorschriften über das Aussäen oder das Anpflanzen standortfremder<br />
Gewächse in der freien Natur erlassen,<br />
6. zur Verwirklichung des Artenschutzes Vorschriften über das<br />
gewerbsmäßige Sammeln und Be- und Verarbeiten wild wachsender<br />
Pflanzen oder Teile davon und wild lebender Tiere oder ihrer Eier, Larven,<br />
Puppen oder Nester erlassen,<br />
7. zur Verwirklichung des Artenschutzes ganz oder teilweise verbieten,<br />
a) bestimmte Geräte oder Vorrichtungen zum Fang, zur Bekämpfung oder<br />
zur Abwehr von Tieren herzustellen, aufzubewahren, anzubieten,<br />
feilzuhalten, anderen zu überlassen, zu erwerben oder bei solchen<br />
Handlungen mitzuwirken,<br />
b) Fischreusen zum Trocknen aufzustellen oder aufzuhängen.<br />
(3) Rechtsverordnungen nach Abs. 2 Nrn. 2, 3, 5 und 7 ergehen im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten.<br />
Bay NatSchG Art. 19 (weggefallen)<br />
Bay NatSchG Art. 20 Kennzeichnung wildlebender Tiere; Ermächtigung<br />
(1) Wild lebende Tiere dürfen nur zu wissenschaftlichen Zwecken<br />
gekennzeichnet werden.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
kann durch Rechtsverordnung im Interesse der Forschung unter<br />
Berücksichtigung des Artenschutzes nähere Vorschriften über die<br />
Kennzeichnung erlassen, insbesondere über die Erlaubnispflicht und die<br />
Ausübung einer erteilten Erlaubnis, über Kennzeichnungsverbote und über<br />
die Zuständigkeit und das Verfahren. 2 In der Rechtsverordnung können<br />
Ausnahmen von einzelnen Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s zugelassen<br />
werden, soweit das für die wissenschaftliche Kennzeichnung erforderlich<br />
ist.
IVa. Abschnitt Tiergehege, Zoos<br />
Bay NatSchG Art. 20 a Tiergehege<br />
(1) 1 Tiergehege sind eingefriedete Grundflächen, auf denen Tiere wild<br />
lebender Arten ganz oder teilweise im Freien gehalten werden. 2 Als<br />
Tiergehege gelten auch Anlagen zur Haltung von Vögeln. 3 Die<br />
Zweckänderung steht der Errichtung oder Erweiterung gleich.<br />
(2) 1 Die Errichtung, die Erweiterung und der Betrieb von Tiergehegen sind der<br />
unteren Naturschutzbehörde mindestens einen Monat vorher anzuzeigen.<br />
2<br />
Anträge auf Erteilung der jagdrechtlichen Genehmigung oder der<br />
Zoogenehmigung gelten als Anzeige; dies gilt auch für die<br />
tierschutzrechtliche Anzeige. 3 Die untere Naturschutzbehörde kann<br />
innerhalb von drei Monaten nach der Anzeige Anordnungen treffen um<br />
sicherzustellen, dass<br />
1. eine artgemäße und verhaltensgerechte Unterbringung sowie<br />
fachgerechte Betreuung erfolgen,<br />
2. durch die Anlage weder der Naturhaushalt oder das Landschaftsbild<br />
beeinträchtigt noch der Zugang zur freien Natur in unangemessener Weise<br />
eingeschränkt wird,<br />
3. das Tiergehege so gesichert ist, dass die Tiere nicht entweichen<br />
können;<br />
sie kann das Vorhaben untersagen, sofern die Einhaltung der<br />
Anforderungen nach Nrn. 1 bis 3 nicht auf andere Weise sichergestellt<br />
werden kann. 4 Die Beseitigung eines Tiergeheges kann angeordnet<br />
werden, sofern nicht anderweitig rechtmäßige Zustände geschaffen<br />
werden können.<br />
(3) Ist bereits nach anderen Vorschriften eine Gestattung für die Errichtung,<br />
die Erweiterung oder den Betrieb des Tiergeheges erforderlich, trifft die<br />
für die anderweitige Gestattung zuständige Behörde die Entscheidungen<br />
nach Abs. 2 Sätze 3 und 4 im Benehmen mit der unteren<br />
Naturschutzbehörde.<br />
Bay NatSchG Art. 20 b Zoos<br />
(1) Zoos haben unbeschadet tierschutz- und tierseuchenrechtlicher<br />
Bestimmungen die in Art. 3 der Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom<br />
29. März 1999 (Abl EG L 94 S. 24) über die Haltung von Wildtieren in<br />
Zoos (Zoo-Richtlinie) in der jeweils geltenden Fassung genannten<br />
Betreiberpflichten zu erfüllen.<br />
(2) 1 Die Errichtung, wesentliche Änderung und der Betrieb bedürfen der<br />
Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde. 2 Die Genehmigung<br />
darf nur erteilt werden, wenn die Einhaltung der in Abs. 1 genannten<br />
Anforderungen gewährleistet ist. 3 Die Genehmigung kann mit<br />
Nebenbestimmungen versehen werden. 4 Die Genehmigung wird durch<br />
eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erforderliche behördliche<br />
Gestattung ersetzt; die behördliche Gestattung ergeht im Einvernehmen<br />
mit der unteren Naturschutzbehörde und darf nur erteilt werden, wenn die<br />
in Abs. 1 genannten Voraussetzungen vorliegen. 5 Auf die<br />
Ersetzungswirkung soll in der behördlichen Gestattung ausdrücklich<br />
hingewiesen werden.
(3) 1 Werden Zoos im Widerspruch zu den Anforderungen nach Abs. 1 und 2<br />
errichtet, wesentlich geändert oder betrieben, trifft die<br />
Genehmigungsbehörde die erforderlichen Anordnungen, die die Einhaltung<br />
dieser Vorschriften innerhalb angemessener Frist sicherstellen. 2 Die<br />
Genehmigungsbehörde kann während dieser Frist auch anordnen, den Zoo<br />
ganz oder teilweise für die Öffentlichkeit zu schließen.<br />
(4) 1 Kommt der Betreiber des Zoos den Anordnungen nach Abs. 3 nicht nach,<br />
so ist innerhalb eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach dem<br />
Erlass der Anordnung die Schließung des Zoos oder eines Teils des Zoos<br />
zu verfügen und die Genehmigung insoweit zu widerrufen. 2 In diesem Fall<br />
ist durch Anordnungen sicherzustellen, dass mit den betroffenen Tieren im<br />
Einklang mit den Bestimmungen des Arten- und Tierschutzrechts<br />
verfahren wird.<br />
(5) Die Einhaltung der in Abs. 1 und 2 genannten Anforderungen wird durch<br />
die untere Naturschutzbehörde insbesondere durch regelmäßige<br />
Inspektionen überwacht.<br />
(6) Die Vorschriften über das Auskunfts- und Zutrittsrecht gemäß § 50<br />
BNatSchG gelten entsprechend.<br />
V. Abschnitt Erholung in der freien Natur<br />
Bay NatSchG Art. 21 Recht auf Naturgenuss und Erholung<br />
(1) 1 Jedermann hat das Recht auf den Genuss der Naturschönheiten und auf<br />
die Erholung in der freien Natur. 2 Dieses Recht wird nach Maßgabe der<br />
folgenden Bestimmungen dieses Abschnitts gewährleistet; weitergehende<br />
Rechte auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Bei der Ausübung des Rechts nach Abs. 1 ist jedermann verpflichtet, mit<br />
Natur und Landschaft pfleglich umzugehen. 2 Bei der Ausübung des Rechts<br />
nach Abs. 1 ist auf die Belange der Grundstückseigentümer und<br />
Nutzungsberechtigten Rücksicht zu nehmen. 3 Die Rechtsausübung<br />
anderer darf nicht verhindert oder mehr als nach den Umständen<br />
unvermeidbar beeinträchtigt werden (Gemeinverträglichkeit).<br />
(3) 1 Die Ausübung des Rechts nach Abs. 1 erfolgt grundsätzlich auf eigene<br />
Gefahr. 2 Vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften werden dadurch<br />
besondere Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten der betroffenen<br />
Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten nicht begründet. 3 Dies gilt<br />
insbesondere für Viehweiden und ortsübliche land- und forstwirtschaftliche<br />
Bewirtschaftungseinrichtungen.<br />
Bay NatSchG Art. 22 Betretungsrecht; Gemeingebrauch an Gewässern<br />
(1) Alle Teile der freien Natur, insbesondere Wald, Bergweide, Fels, Ödungen,<br />
Brachflächen, Auen, Uferstreifen und landwirtschaftlich genutzte Flächen,<br />
können von jedermann unentgeltlich betreten werden.<br />
(2) 1 Das Betretungsrecht umfasst auch die Befugnisse nach den Art. 23 und<br />
24. 2 Es ist beschränkt durch die allgemeinen <strong>Gesetze</strong> sowie durch die<br />
Art. 25 bis 27 dieses <strong>Gesetze</strong>s.
(3) 1 Das Betretungsrecht kann vom Grundeigentümer oder sonstigen<br />
Berechtigten nur unter den Voraussetzungen des Art. 29 verweigert<br />
werden. 2 Das Betretungsrecht kann nicht ausgeübt werden, soweit der<br />
Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte das Betreten seines<br />
Grundstücks durch für die Allgemeinheit geltende, deutlich sichtbare<br />
Sperren, insbesondere durch Einfriedungen, andere tatsächliche<br />
Hindernisse oder Beschilderungen untersagt hat. 3 Beschilderungen sind<br />
jedoch nur wirksam, wenn sie auf einen gesetzlichen Grund hinweisen, der<br />
eine Beschränkung des Betretungsrechts rechtfertigt.<br />
(4) 1 Der Gemeingebrauch an Gewässern bestimmt sich nach § 23 des<br />
Wasserhaushaltsgesetzes und den Art. 21 bis 23 des Bayerischen<br />
Wassergesetzes. 2 Der Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen bestimmt<br />
sich nach Art. 14 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes und § 7<br />
des Bundesfernstraßengesetzes.<br />
Bay NatSchG Art. 23 Benutzung von Wegen; Markierungen<br />
(1) 1 Jedermann darf auf Privatwegen in der freien Natur wandern und, soweit<br />
sich die Wege dafür eignen, reiten und mit Fahrzeugen ohne Motorkraft<br />
sowie Krankenfahrstühlen fahren. 2 Dem Fußgänger gebührt der Vorrang.<br />
(2) 1 Markierungen und Wegetafeln müssen ohne Beeinträchtigung des<br />
Landschaftsbilds deutlich, aussagekräftig und unter Beachtung örtlicher<br />
und überörtlicher Wanderwegenetze einheitlich gestaltet sein. 2 Genügen<br />
Markierungen und Wegetafeln diesen Anforderungen nicht, kann ihre<br />
Beseitigung angeordnet werden.<br />
(3) 1 Der Eigentümer oder sonstige Berechtigte hat Markierungen und<br />
Wegetafeln zu dulden, die Gemeinden oder Organisationen, die sich<br />
satzungsgemäß vorwiegend der Förderung des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege widmen, mit Genehmigung der unteren<br />
Naturschutzbehörde anbringen. 2 Auf die Grundstücksnutzung ist Rücksicht<br />
zu nehmen. 3 Der Eigentümer oder sonstige Berechtigte ist vor der<br />
Anbringung zu benachrichtigen.<br />
(4) Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts und des<br />
Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt.<br />
Bay NatSchG Art. 24 Sportliche Betätigung<br />
Zum Betreten im Sinn dieses Abschnitts gehören auch das Skifahren, das<br />
Schlittenfahren, das Reiten, das Ballspielen und ähnliche sportliche<br />
Betätigungen in der freien Natur.<br />
Bay NatSchG Art. 25 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen<br />
(1) 1 Landwirtschaftlich genutzte Flächen (einschließlich Sonderkulturen) und<br />
gärtnerisch genutzte Flächen dürfen während der Nutzzeit nur auf<br />
vorhandenen Wegen betreten werden. 2 Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen<br />
Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses.<br />
(2) 1 Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten ist im<br />
Wald nur auf Straßen und geeigneten Wegen zulässig. 2 Die Vorschriften<br />
des Straßen- und Wegerechts und des Straßenverkehrsrechts bleiben<br />
unberührt.
Bay NatSchG Art. 26 Beschränkungen der Erholung in der freien Natur<br />
(1) Die untere oder höhere Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung<br />
oder Einzelanordnung die Erholung in Teilen der freien Natur im<br />
erforderlichen Umfang aus Gründen des Naturschutzes, zur Durchführung<br />
von landschaftspflegerischen Vorhaben, zur Regelung des<br />
Erholungsverkehrs oder aus anderen zwingenden Gründen des<br />
Gemeinwohls untersagen oder beschränken.<br />
(2) Inhalt von Beschränkungen für das Reiten kann insbesondere sein,<br />
1. das Reiten nur auf den durch die Behörde besonders dafür<br />
ausgewiesenen Wegen oder Flächen zu erlauben,<br />
2. das Reiten nur zu bestimmten Zeiten zu gestatten,<br />
3. für die Benutzung von Wegen und Flächen durch Reiter eine<br />
behördliche Genehmigung vorzusehen.<br />
(3) Die untere oder höhere Naturschutzbehörde kann zum Schutz des<br />
Erholungsverkehrs und des Eigentums durch Rechtsverordnung eine<br />
Kennzeichnung der Reitpferde vorschreiben.<br />
Bay NatSchG Art. 27 Durchführung von Veranstaltungen<br />
Teilnehmern einer organisierten Veranstaltung steht das Betretungsrecht nur<br />
zu, wenn nach Art und Umfang der Veranstaltung und nach den örtlichen<br />
Gegebenheiten eine Beeinträchtigung der betroffenen Grundstücke nicht zu<br />
erwarten ist.<br />
Bay NatSchG Art. 28 Aneignung wild wachsender Pflanzen und Früchte<br />
(1) Jedermann hat das Recht, sich wild wachsende Waldfrüchte (Pilze, Beeren,<br />
Tee- und Heilkräuter, Nüsse) in ortsüblichem Umfang anzueignen und von<br />
wild wachsenden Pflanzen Blüten, Zweige oder Blätter in Mengen, die<br />
nicht über einen Handstrauß hinausgehen, zu entnehmen.<br />
(2) 1 Dieses Recht besteht jedoch nur vorbehaltlich der Regelungen des<br />
IV. Abschnitts. 2 Andere Rechtsvorschriften bleiben unberührt.<br />
Bay NatSchG Art. 29 Zulässigkeit von Sperren<br />
Der Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte darf der Allgemeinheit das<br />
Betreten von Grundstücken in der freien Natur durch Sperren im Sinn des<br />
Art. 22 Abs. 3 Satz 2 nur unter folgenden Voraussetzungen verwehren:<br />
1. Sperren können errichtet werden, wenn andernfalls die zulässige Nutzung<br />
des Grundstücks nicht unerheblich behindert oder eingeschränkt würde. Das<br />
gilt insbesondere, wenn die Beschädigung von Forstkulturen, Sonderkulturen<br />
oder sonstigen Nutzpflanzen zu erwarten ist, oder wenn das Grundstück<br />
regelmäßig von einer Vielzahl von Personen betreten und dadurch in seinem<br />
Ertrag erheblich gemindert oder in unzumutbarer Weise beschädigt oder<br />
verunreinigt wird.<br />
2. Bei Wohngrundstücken ist eine Beschränkung nur für den Wohnbereich<br />
zulässig, der sich nach den berechtigten Wohnbedürfnissen und nach den<br />
örtlichen Gegebenheiten bestimmt.<br />
3. Flächen können aus Gründen des Naturschutzes, zur Durchführung von<br />
landschaftspflegerischen Vorhaben oder forstwirtschaftlichen Maßnahmen, von<br />
Jagden, ferner zur Vorbereitung und Durchführung sportlicher Wettkämpfe in
der freien Natur sowie aus anderen zwingenden Gründen des Gemeinwohls<br />
kurzzeitig gesperrt werden.<br />
Bay NatSchG Art. 30 Verfahren<br />
(1) 1 Bedarf die Errichtung einer Sperre im Sinn des Art. 22 Abs. 3 Satz 2<br />
einer behördlichen Gestattung nach anderen Vorschriften, so ergeht diese<br />
im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde, sofern Bundesrecht<br />
nicht entgegensteht. 2 Ist eine Gestattung nach anderen Vorschriften nicht<br />
erforderlich, so darf eine Sperre in der freien Natur nur errichtet werden,<br />
wenn dies der unteren Naturschutzbehörde mindestens einen Monat<br />
vorher angezeigt wurde. 3 Sperren von Forstpflanzgärten, Forstkulturen<br />
und Sonderkulturen mit einer Fläche bis zu 5 ha bedürfen keiner Anzeige.<br />
4<br />
Für kurzzeitige Sperrungen genügt eine unverzügliche Anzeige an die<br />
untere Naturschutzbehörde.<br />
(2) 1 Die Errichtung der Sperre ist zu untersagen, wenn dies im gegenwärtigen<br />
oder absehbaren zukünftigen Interesse der erholungsuchenden<br />
Bevölkerung erforderlich ist und die Sperre den Voraussetzungen des<br />
Art. 29 widerspricht. 2 Die Untersagung ist nur innerhalb von einem Monat<br />
nach der Anzeige zulässig.<br />
(3) Unbeschadet sonstiger Vorschriften über die Rücknahme und den Widerruf<br />
der Gestattung oder über eine Beseitigungsanordnung kann die untere<br />
Naturschutzbehörde die Beseitigung einer bereits bestehenden Sperre<br />
anordnen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach Abs. 2<br />
die Errichtung der Sperre untersagt werden müsste.<br />
Bay NatSchG Art. 31 Durchgänge<br />
1 Der Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte muss auf einem Grundstück,<br />
das nach vorstehenden Vorschriften nicht frei betreten werden kann, für die<br />
Allgemeinheit einen Durchgang offenhalten, wenn andere Teile der freien<br />
Natur, insbesondere Erholungsflächen, Naturschönheiten, Wald oder Gewässer,<br />
in anderer zumutbarer Weise nicht zu erreichen sind, und wenn er dadurch in<br />
sinngemäßer Anwendung der Grundsätze des Art. 29 nicht übermäßig in seinen<br />
Rechten beeinträchtigt wird. 2 Die untere Naturschutzbehörde kann die<br />
entsprechenden Anordnungen treffen.<br />
Bay NatSchG Art. 32 Eigentumsbindung und Enteignung<br />
(1) Der Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte hat Beeinträchtigungen,<br />
die sich aus vorstehenden Vorschriften und unter Beachtung der<br />
Grundsätze des Art. 29 aus behördlichen Maßnahmen nach Art. 30 und 31<br />
ergeben, als Eigentumsbindung im Sinn von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 und<br />
Abs. 2 des Grundgesetzes und von Art. 103 Abs. 2 und Art. 158 Satz 1 der<br />
Verfassung entschädigungslos zu dulden.<br />
(2) 1 Darüber hinaus können im Einzelfall auch dann die Errichtung von<br />
Sperren untersagt und Anordnungen nach Art. 30 Abs. 3 und Art. 31<br />
Satz 2 getroffen werden, wenn die Absperrung eines Grundstücks nicht<br />
gegen Art. 29 verstößt, wenn aber seine unbeschränkte oder beschränkte<br />
Zugänglichkeit im überwiegenden Interesse einer Vielzahl<br />
Erholungsuchender geboten ist. 2 Dem Grundeigentümer oder sonstigen<br />
Berechtigten ist eine Entschädigung zu gewähren; Art. 36 ist anzuwenden.
(3) Die Beseitigung rechtmäßig errichteter baulicher Anlagen ist nach den<br />
Vorschriften dieses Abschnitts nur gegen Entschädigung zulässig; Art. 36<br />
ist anzuwenden.<br />
(4) 1 Die Entschädigungspflicht nach den Abs. 2 und 3 trifft den durch die<br />
Maßnahme Begünstigten. 2 Bei Maßnahmen von überwiegend örtlicher<br />
Bedeutung sind die betroffenen Gebietskörperschaften, bei Maßnahmen<br />
von überwiegend überörtlicher Bedeutung ist der Freistaat Bayern<br />
begünstigt.<br />
(5) 1 Soweit über die Entschädigung nach den Abs. 2 und 3 keine Einigung<br />
zustande kommt, wird darüber auf Antrag eines Beteiligten durch die<br />
Behörde entschieden, auf deren Maßnahme die Entschädigungspflicht<br />
beruht. 2 Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. 3 Im Übrigen<br />
gelten für das Verfahren die Art. 30 Abs. 4, Art. 44 Abs. 1 und Art. 45 des<br />
Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige Enteignung<br />
(BayEG) sinngemäß. 4 Ergeht in angemessener Frist keine Entscheidung,<br />
so ist die Klage spätestens innerhalb eines Jahres nach Eingang des<br />
Antrags bei der Behörde zu erheben. 5 Aus einer nicht mehr anfechtbaren<br />
behördlichen Entscheidung findet wegen der darin festgesetzten<br />
Entschädigung die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der<br />
Zivilprozessordnung über die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen<br />
Rechtsstreitigkeiten statt; Art. 38 Abs. 2 BayEG gilt sinngemäß.<br />
Bay NatSchG Art. 33 Pflichten des Freistaates Bayern und der<br />
Gebietskörperschaften<br />
(1) Der Freistaat Bayern, die Bezirke, die Landkreise und die Gemeinden<br />
haben die Ausübung des Rechts nach Art. 21 zu gewährleisten und<br />
Voraussetzungen für die Rechtsausübung zu schaffen.<br />
(2) 1 In Erfüllung dieser Pflichten haben sie der Allgemeinheit die Zugänge zu<br />
landschaftlichen Schönheiten und Erholungsflächen freizuhalten und,<br />
soweit erforderlich, durch Einschränkungen des Eigentumsrechts<br />
freizumachen sowie Uferwege, Wanderwege, Erholungsparke und<br />
Spielflächen anzulegen. 2 Sie stellen in ihrem Eigentum oder Besitz<br />
stehende geeignete Grundstücke in angemessenem Umfang für die<br />
Erholung zur Verfügung. 3 Außerdem sollen geeignete Wege und Flächen<br />
für den Reitsport bereitgestellt werden. 4 Grundsätzlich sollen dabei<br />
Gemeinden örtliche, Landkreise, Bezirke und der Freistaat Bayern<br />
überörtliche Maßnahmen durchführen.<br />
(3) 1 Zum Zweck der Erfüllung ihrer Pflichten stellen die Verpflichtungsträger<br />
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit öffentliche Mittel in ihren Haushalten<br />
bereit. 2 Der Freistaat Bayern gewährt Gemeinden, Landkreisen und<br />
Bezirken sowie kommunalen Einrichtungen, die sich die Sicherung und<br />
Bereitstellung von Erholungsflächen zur Aufgabe gemacht haben,<br />
Zuschüsse im Rahmen des Haushalts, wenn und soweit diese Träger<br />
überörtliche Aufgaben der Erholungsvorsorge wahrnehmen.<br />
Bay NatSchG Art. 33 a Sauberhaltung der freien Natur<br />
(1) 1 Bei der Ausübung des Rechts nach Art. 21 dürfen bewegliche Sachen in<br />
der freien Natur außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen nicht<br />
zurückgelassen werden. 2 Werden Sachen entgegen Satz 1
zurückgelassen, kann die zuständige Naturschutzbehörde Anordnungen<br />
gegen den Verursacher treffen. 3 Sie kann zurückgelassene Sachen in<br />
Verwahrung nehmen und verwerten. 4 Für die Verwahrung, Verwertung<br />
und Herausgabe der verwahrten Sachen sowie für die Herausgabe des<br />
Erlöses finden Art. 26 bis 28 Abs. 2, Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 des<br />
Polizeiaufgabengesetzes sinngemäß Anwendung. 5 Die abfallrechtlichen<br />
Vorschriften bleiben unberührt.<br />
(2) 1 Soweit Verursacher nicht herangezogen werden können, soll die<br />
Gemeinde unbeschadet anderer Vorschriften im Rahmen ihrer<br />
Leistungsfähigkeit Beschädigungen oder Verunreinigungen, die bei<br />
Ausübung des Rechts nach Art. 21 vorgenommen wurden, oder Sachen,<br />
die entgegen der Vorschrift in Abs. 1 zurückgelassen wurden, beseitigen.<br />
2<br />
Abs. 1 Sätze 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.<br />
(3) 1 Der Grundstückseigentümer oder sonstige Berechtigte hat Maßnahmen<br />
im Sinn der Abs. 1 und 2 durch die untere Naturschutzbehörde, die<br />
Gemeinde oder deren Beauftragte zu dulden. 2 Auf die<br />
Grundstücksnutzung ist Rücksicht zu nehmen.<br />
VI. Abschnitt Vorkaufsrecht, Enteignung und<br />
Erschwernisausgleich<br />
Bay NatSchG Art. 34 Vorkaufsrecht<br />
(1) 1 Dem Freistaat Bayern sowie den Bezirken, Landkreisen, Gemeinden und<br />
kommunalen Zweckverbänden stehen Vorkaufsrechte zu beim Verkauf<br />
von Grundstücken,<br />
1. auf denen sich oberirdische Gewässer einschließlich von<br />
Verlandungsflächen, ausgenommen Be- und Entwässerungsgräben,<br />
befinden oder die daran angrenzen,<br />
2. die ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten, Nationalparken, als<br />
solchen einstweilig sichergestellten Gebieten oder in geplanten<br />
Naturschutzgebieten ab Eintritt der Veränderungsverbote nach Art. 48<br />
Abs. 3 liegen,<br />
3. auf denen sich Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile<br />
oder als solche einstweilig sichergestellte Schutzgegenstände befinden.<br />
2<br />
Dies gilt auch bei Vertragsgestaltungen, die in ihrer Gesamtheit einem<br />
Kaufvertrag nahezu gleichkommen. 3 Liegen die Merkmale der Nrn. 1 bis 3<br />
nur bei einem Teil des Grundstücks vor, so erstreckt sich das<br />
Vorkaufsrecht nur auf diese Teilfläche. 4 Ist die Restfläche für den<br />
Eigentümer nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder<br />
wirtschaftlich verwertbar, so kann er verlangen, dass der Vorkauf auf das<br />
gesamte Grundstück erstreckt wird.<br />
(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn dies gegenwärtig oder<br />
zukünftig die Belange des Naturschutzes oder der Landschaftspflege oder<br />
das Bedürfnis der Allgemeinheit nach Naturgenuss und Erholung in der<br />
freien Natur rechtfertigen.<br />
(3) 1 Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch den Freistaat Bayern,<br />
vertreten durch die Kreisverwaltungsbehörde. 2 Soweit der Freistaat<br />
Bayern das Vorkaufsrecht in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wegen des
Bedürfnisses der Allgemeinheit nach Naturgenuss und Erholung in der<br />
freien Natur für sich ausübt, vertritt ihn die Bayerische Verwaltung der<br />
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen an den von ihr verwalteten<br />
oberirdischen Gewässern. 3 Die Mitteilung gemäß § 469 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs über die in Abs. 1 Sätze 1 und 2 genannten Verträge ist in<br />
allen Fällen gegenüber der Kreisverwaltungsbehörde abzugeben. 4 Der<br />
Freistaat Bayern hat jedoch das Vorkaufsrecht zugunsten eines anderen<br />
Vorkaufsberechtigten nach Abs. 1 auszuüben, wenn dieser es verlangt.<br />
5<br />
Wollen mehrere Vorkaufsberechtigte nach Abs. 1 von ihrem Recht<br />
Gebrauch machen, so geht das Vorkaufsrecht des Freistaates Bayern den<br />
übrigen Vorkaufsrechten vor. 6 Innerhalb der Gebietskörperschaften<br />
einschließlich der kommunalen Zweckverbände bestimmt sich das<br />
Vorkaufsrecht nach den geplanten Maßnahmen, wobei überörtliche den<br />
örtlichen Vorhaben vorgehen. 7 In Zweifelsfällen entscheidet das<br />
Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen mit der obersten<br />
Naturschutzbehörde.<br />
(4) 1 Die Vorkaufsrechte gehen -- unbeschadet bundesrechtlicher<br />
anderweitiger Regelungen -- allen anderen Vorkaufsrechten im Rang vor,<br />
rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten jedoch nur, wenn diese nach In-<br />
Kraft-Treten dieses <strong>Gesetze</strong>s bestellt werden. 2 Sie bedürfen nicht der<br />
Eintragung in das Grundbuch. 3 Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der<br />
Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche<br />
Vorkaufsrechte.<br />
(5) 1 Die Vorkaufsrechte können auch zugunsten eines überörtlichen<br />
gemeinnützigen Erholungsflächenvereins oder zugunsten von<br />
gemeinnützigen Naturschutz-, Fremdenverkehrs- und Wandervereinen, in<br />
den Fällen des Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 auch zugunsten des<br />
Bayerischen Naturschutzfonds ausgeübt werden, wenn diese<br />
einverstanden sind. 2 Wird das Vorkaufsrecht zugunsten der in Satz 1<br />
genannten Vereine ausgeübt, ist das Einvernehmen des Landesamts für<br />
Finanzen erforderlich. 3 Äußert sich dieses nicht innerhalb eines Monats, ist<br />
davon auszugehen, dass gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts keine<br />
Bedenken bestehen.<br />
(6) 1 In den Fällen der Abs. 3 und 5 kommt der Kauf zwischen dem<br />
Begünstigten und dem Verpflichteten zustande. 2 Im Fall des Abs. 5 haftet<br />
der ausübende Vorkaufsberechtigte für die Verpflichtungen aus dem Kauf<br />
neben dem Begünstigten als Gesamtschuldner.<br />
(7) 1 Das Vorkaufsrecht kann nur innerhalb von zwei Monaten nach der<br />
Mitteilung der in Abs. 1 Sätze 1 und 2 genannten Verträge ausgeübt<br />
werden. 2 §§ 463 bis 468, 469 Abs. 1, §§ 471, 1098 Abs. 2, §§ 1099 bis<br />
1102 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden.<br />
(8) 1 Abweichend von Abs. 7 Satz 2 kann der Vorkaufsberechtigte den zu<br />
zahlenden Betrag nach dem Verkehrswert des Grundstücks im Zeitpunkt<br />
des Kaufs bestimmen, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert<br />
in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich überschreitet. 2 In<br />
diesem Fall ist der Verpflichtete berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats<br />
nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts über die Ausübung des<br />
Vorkaufsrechts vom Vertrag zurückzutreten. 3 Auf das Rücktrittsrecht sind
die §§ 346 bis 349 und 351 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend<br />
anzuwenden.<br />
(9) Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer das<br />
Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person veräußert, die mit<br />
ihm in gerader Linie verwandt ist.<br />
Bay NatSchG Art. 35 Förmliche Enteignung<br />
Zugunsten des Freistaates Bayern, der Bezirke, Landkreise, Gemeinden und<br />
der kommunalen Zweckverbände, die sich den Belangen des Naturschutzes,<br />
der Landschaftspflege und der öffentlichen Erholung widmen, kann enteignet<br />
werden<br />
1. zur Schaffung oder Änderung freier Zugänge zu Bergen, Gewässern und<br />
sonstigen landschaftlichen Schönheiten, von Wanderwegen, Erholungsparken,<br />
Ski- und Rodelabfahrten, Rad- und Reitwegen, Skiwanderwegen und Loipen,<br />
zur Bereitstellung von Gewässer- und Hinterliegergrundstücken für öffentliche<br />
Badeanlagen oder Uferwege, zur Anlage von Schutzhütten, Naturlehrpfaden,<br />
Spiel-, Park-, Rast- und Aussichtsplätzen, sanitären Einrichtungen oder<br />
2. wenn Gründe des Naturschutzes und der Landschaftspflege es zwingend<br />
erfordern.<br />
Bay NatSchG Art. 36 Enteignende Maßnahmen<br />
(1) Hat eine Behörde auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s eine Maßnahme getroffen,<br />
die eine Enteignung darstellt oder einer solchen gleichkommt,<br />
insbesondere weil sie eine wesentliche Nutzungsbeschränkung darstellt, so<br />
ist dem Eigentümer oder dem sonstigen Berechtigten nach den<br />
Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige<br />
Enteignung Entschädigung in Geld zu leisten.<br />
(2) 1 Der Grundstückseigentümer kann verlangen, dass der<br />
Entschädigungspflichtige das Grundstück übernimmt, soweit es ihm<br />
infolge der enteignenden Maßnahme wirtschaftlich nicht mehr zumutbar<br />
ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder in einer<br />
anderen zulässigen Art zu nutzen. 2 Kommt eine Einigung über die<br />
Übernahme des Grundstücks nicht zustande, kann der Eigentümer das<br />
Enteignungsverfahren beantragen; im Übrigen gelten die Vorschriften des<br />
Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige Enteignung<br />
sinngemäß.<br />
Bay NatSchG Art. 36 a Erschwernisausgleich;<br />
Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land- und<br />
Forstwirtschaft<br />
(1) 1 Wird dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten durch eine Versagung<br />
der Ausnahme nach Art. 13 d Abs. 2 die bestehende land-, forst- oder<br />
fischereiwirtschaftliche Bewirtschaftung einer Feuchtfläche (z. B.<br />
Streuwiese) wesentlich erschwert, wird ihm dafür nach Maßgabe der<br />
verfügbaren Haushaltsmittel ein angemessener Geldausgleich gewährt.<br />
2 Dieser Geldausgleich wird auch im Rahmen von vertraglichen<br />
Vereinbarungen oder der Teilnahme an Förderprogrammen gewährt,<br />
soweit der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte durch naturschonende<br />
Bewirtschaftung den ökologischen Wert der Feuchtfläche erhält.
(2) 1 Werden in Rechtsvorschriften nach dem III. Abschnitt, die nach dem<br />
19. Juli 1995 in Kraft getreten sind, oder in nach diesem Zeitpunkt<br />
erlassenen Anordnungen nach Art. 9 Abs. 5 oder Art. 12 Abs. 3 erhöhte<br />
Anforderungen festgesetzt, die die ausgeübte, im Sinn des Art. 6 Abs. 2<br />
ordnungsgemäße land-, forst- oder fischereiwirtschaftliche Bodennutzung<br />
eines Grundstücks beschränken, so ist für die dadurch verursachten<br />
wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Geldausgleich zu gewähren,<br />
soweit nicht eine Entschädigungspflicht nach Art. 36 besteht. 2 Bei<br />
Beschränkungen durch Anordnungen nach Art. 13 c Abs. 4 Satz 2 in<br />
Verbindung mit Art. 6 a Abs. 5 kann unter den Voraussetzungen von<br />
Satz 1 ein Geldausgleich gewährt werden. 3 Das Nähere regelt die<br />
Staatsregierung durch Rechtsverordnung.<br />
VII. Abschnitt Organisation, Zuständigkeit und Verfahren<br />
Bay NatSchG Art. 37 Behörden<br />
(1) Die Durchführung des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses <strong>Gesetze</strong>s und<br />
der auf Grund beider <strong>Gesetze</strong> erlassenen Rechtsvorschriften ist<br />
grundsätzlich Aufgabe des Staates.<br />
(2) Behörden für den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die<br />
Erholung in der freien Natur im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
(Naturschutzbehörden) sind<br />
1. das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
als oberste Naturschutzbehörde,<br />
2. die Regierungen als höhere Naturschutzbehörden,<br />
3. die Kreisverwaltungsbehörden als untere Naturschutzbehörden.<br />
(3) Die unteren und höheren Naturschutzbehörden werden mit<br />
hauptamtlichen Fachkräften ausgestattet, die von nebenamtlichen und<br />
ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt werden können.<br />
(4) 1 Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Behörden zu bestimmen, die<br />
zum Vollzug von Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder des<br />
Bundes im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuständig<br />
sind. 2 Die Rechtsverordnung ergeht im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium, dessen Geschäftsbereich berührt wird.<br />
Bay NatSchG Art. 38 Grundsatzaufgaben<br />
1 Die Naturschutzbehörden und das Bayerische Landesamt für Umwelt<br />
ermitteln und bewerten den Zustand des Naturhaushalts und seine<br />
Veränderungen. 2 Sie erfassen Lebensräume und Arten und erstellen Schutz-,<br />
Pflege- und Entwicklungskonzepte zu ihrer Sicherung und Entwicklung.<br />
Bay NatSchG Art. 39 <strong>Bayerisches</strong> Landesamt für Umwelt<br />
Unbeschadet sonstiger Vorschriften hat das Bayerische Landesamt für Umwelt<br />
die Aufgabe,<br />
1. die Naturschutzbehörden fachlich zu beraten,<br />
2. bei der Durchführung von Schutz-, Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen<br />
mitzuwirken,
3. den Vogelschutz als staatliche Vogelschutzwarte wahrzunehmen,<br />
4. erhaltenswerte Biotope sowie Arten und deren Lebensräume zu erfassen<br />
und zu bewerten, die geeigneten Biotopverbundbestandteile und die für die<br />
Naturräume ausreichende Ausstattung mit Landschaftselementen zu ermitteln,<br />
Untersuchungen ökologisch bedeutsamer Flächen durchzuführen, Schutz- und<br />
Entwicklungskonzepte des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf Grund<br />
von Bestandserfassungen wild lebender Tier- und Pflanzenarten eines<br />
bestimmten Gebiets zu erarbeiten und fortzuschreiben,<br />
5. Verzeichnisse der Schutzgebiete nach Art. 13 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 sowie<br />
der ökologisch bedeutsamen Flächen (Ökoflächenkataster), die laufend<br />
fortzuschreiben sind, zu führen,<br />
6. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Naturschutzes zu<br />
fördern,<br />
7. die Grundlagen und Daten für die Umweltbeobachtung zusammenzuführen,<br />
8. die Verbindung mit Naturschutzorganisationen und Institutionen des In- und<br />
Auslands zu pflegen,<br />
9. in Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz und<br />
Landschaftspflege die Forschung auf dem Gebiet des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege zu fördern,<br />
10. bei der Aufstellung von Programmen und Plänen nach dem Bayerischen<br />
Landesplanungsgesetz, die der Verwirklichung der Zielsetzungen dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s dienen, mitzuwirken,<br />
11. Artenhilfsprogramme zu entwickeln,<br />
12. in geeigneten Zeitabständen den <strong>Stand</strong> der wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse über ausgestorbene oder gefährdete heimische Tier- und<br />
Pflanzenarten (Rote Listen) darzustellen.<br />
Bay NatSchG Art. 40 Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
(1) Es besteht eine Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege.<br />
(2) Die Akademie hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit den Hochschulen,<br />
dem Bayerischen Landesamt für Umwelt und anderen geeigneten<br />
Einrichtungen<br />
1. die Durchführung von Forschungsaufgaben bei den dazu geeigneten<br />
wissenschaftlichen Einrichtungen anzuregen und zu unterstützen,<br />
2. durch Lehrgänge, Fortbildungskurse und Öffentlichkeitsarbeit den<br />
neuesten <strong>Stand</strong> der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich<br />
Naturschutz und Landschaftspflege zu vermitteln,<br />
3. den Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zu betreiben,<br />
4. anwendungsorientierte ökologische Forschung zu betreiben.<br />
(3) 1 Die Akademie untersteht der Aufsicht des Staatsministeriums für<br />
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. 2 Das Nähere, insbesondere<br />
Rechtsform und Organisation, wird durch Rechtsverordnung der<br />
Staatsregierung geregelt.<br />
Bay NatSchG Art. 41 Naturschutzbeiräte<br />
(1) 1 Zur wissenschaftlichen und fachlichen Beratung sind bei den<br />
Naturschutzbehörden Beiräte aus sachverständigen Personen zu bilden.<br />
2 Das Nähere, insbesondere Zusammensetzung, Stellung, Aufgabe und<br />
Entschädigung der Beiräte, regelt das Staatsministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung im<br />
Einvernehmen mit den Staatsministerien der Finanzen, des Innern und für<br />
Landwirtschaft und Forsten.<br />
(2) Will eine Naturschutzbehörde abweichend von einem Beschluss des bei ihr<br />
gebildeten Naturschutzbeirats entscheiden, so hat sie die Zustimmung der<br />
nächsthöheren Naturschutzbehörde einzuholen.<br />
Bay NatSchG Art. 42 Mitwirkung von Vereinen<br />
(1) 1 Einem nach Abs. 2 anerkannten rechtsfähigen Verein ist Gelegenheit zur<br />
Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen<br />
Sachverständigengutachten zu geben<br />
1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang unter<br />
dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften der für Naturschutz und<br />
Landschaftspflege zuständigen Behörden,<br />
2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen im Sinn des Art. 3<br />
Abs. 1 und 2,<br />
3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinn des § 35 Satz 1 Nr. 2<br />
BNatSchG,<br />
4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger<br />
öffentlicher Stellen zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen<br />
verdrängter wild lebender Arten in der freien Natur,<br />
5. vor Befreiungen von Verboten und Geboten in Schutzverordnungen für<br />
Naturschutzgebiete, Nationalparke, Gebiete von gemeinschaftlicher<br />
Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete,<br />
6. in Planfeststellungsverfahren von Landesbehörden, soweit es sich um<br />
Vorhaben handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden<br />
sind,<br />
soweit er durch das Vorhaben in seinem satzungsgemäßen<br />
Aufgabenbereich berührt wird. 2 Die Behörden räumen den Vereinen zur<br />
Abgabe der Stellungnahme eine angemessene Frist ein. 3 Sind keine oder<br />
nur geringfügige Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwarten,<br />
kann von einer Mitwirkung abgesehen werden. 4 Art. 28 Abs. 2 Nrn. 1 und<br />
2, Abs. 3 und Art. 29 Abs. 2 BayVwVfG gelten sinngemäß. 5 Wird von einer<br />
Mitwirkung abgesehen, ist dies zu begründen.<br />
(2) 1 Die Anerkennung wird auf Antrag erteilt. 2 Sie ist zu erteilen, wenn der<br />
Verein<br />
1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die<br />
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert,<br />
2. nach seiner Satzung einen Tätigkeitsbereich hat, der das Gebiet des<br />
Freistaates Bayern umfasst,<br />
3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf Jahre besteht und in<br />
diesem Zeitraum im Sinn der Nr. 1 tätig gewesen ist,<br />
4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind<br />
Art und Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die<br />
Leistungsfähigkeit des Vereins zu berücksichtigen,<br />
5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des<br />
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit ist und<br />
6. den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung volles<br />
Stimmrecht hat, jedermann ermöglicht, der die Ziele des Vereins
unterstützt; bei Vereinen, deren Mitglieder ausschließlich juristische<br />
Personen sind, ist es ausreichend, wenn die Mehrzahl der juristischen<br />
Personen diese Voraussetzung erfüllt.<br />
3 Zuständig für die Anerkennung der Vereine ist die oberste<br />
Naturschutzbehörde. 4 In der Anerkennung ist der satzungsgemäße<br />
Aufgabenbereich, für den die Anerkennung gilt, zu bezeichnen.<br />
Bay NatSchG Art. 43 Naturschutzwacht<br />
(1) 1 Zur Unterstützung der Naturschutzbehörden und der Polizei können bei<br />
der unteren Naturschutzbehörde Hilfskräfte eingesetzt werden. 2 Sie sind<br />
während der Ausübung ihres Dienstes Angehörige der unteren<br />
Naturschutzbehörde im Außendienst und dürfen Amtshandlungen nur in<br />
deren Gebiet vornehmen.<br />
(2) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte haben die Aufgabe,<br />
Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften, die den Schutz der Natur,<br />
die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur regeln und<br />
deren Übertretung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, festzustellen, zu<br />
verhüten, zu unterbinden sowie bei der Verfolgung solcher<br />
Zuwiderhandlungen mitzuwirken.<br />
(3) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte können zur Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
1. eine Person zur Feststellung ihrer Personalien anhalten,<br />
2. die angehaltene Person zu einer Polizeidienststelle bringen, wenn die<br />
Feststellung ihrer Personalien an Ort und Stelle nicht vorgenommen<br />
werden kann oder wenn der Verdacht besteht, dass ihre Angaben<br />
unrichtig sind,<br />
3. eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr<br />
vorübergehend das Betreten eines Orts verbieten (Platzverweis),<br />
4. das unberechtigt entnommene Gut und Gegenstände sicherstellen, die<br />
bei Zuwiderhandlungen nach Abs. 2 verwendet wurden oder verwendet<br />
werden sollen.<br />
(4) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte müssen bei Ausübung ihrer Tätigkeit<br />
ein Dienstabzeichen tragen und einen Dienstausweis mit sich führen, der<br />
bei Vornahme einer Amtshandlung auf Verlangen vorzuzeigen ist.<br />
(5) Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
kann im Einvernehmen mit den Staatsministerien des Innern, der<br />
Finanzen und der Justiz durch Rechtsverordnung die Begründung, die<br />
Ausgestaltung und den Umfang des Dienstverhältnisses regeln sowie<br />
Vorschriften über den Dienstausweis und die Dienstabzeichen erlassen.<br />
Bay NatSchG Art. 43 a Bayerischer Naturschutzfonds<br />
(1) Unter dem Namen “Bayerischer Naturschutzfonds” besteht seit dem<br />
1. September 1982 eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit<br />
dem Sitz in München.<br />
(2) 1 Die Stiftung fördert die Bestrebungen für die Erhaltung der natürlichen<br />
Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen und trägt zur Aufbringung<br />
der benötigten Mittel bei. 2 Sie hat insbesondere nachstehende Aufgaben:<br />
1. Förderung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung<br />
von Natur und Landschaft,
2. Förderung von Maßnahmen zum Aufbau eines landesweiten<br />
Biotopverbundsystems einschließlich der erforderlichen Vorbereitung und<br />
Abwicklung,<br />
3. Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege im Rahmen der Umsetzung der gemeindlichen<br />
Landschaftsplanung,<br />
4. Förderung der Pacht, des Erwerbs und der sonstigen zivilrechtlichen<br />
Sicherung von Grundstücken zu Zwecken des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege durch Gebietskörperschaften und Organisationen, die<br />
sich satzungsgemäß überwiegend der Förderung des Naturschutzes und<br />
der Landschaftspflege widmen,<br />
5. Pacht, Erwerb und sonstige zivilrechtliche Sicherung von Grundstücken<br />
zu Zwecken des Naturschutzes und der Landschaftspflege,<br />
6. Verwendung der Ersatzzahlungen nach Art. 6 a Abs. 3.<br />
3<br />
Die Stiftung soll sich vorrangig bestehender Einrichtungen, Stellen oder<br />
Behörden bedienen. 4 Aufgaben des Freistaates Bayern, der Bezirke, der<br />
Landkreise und der Gemeinden werden durch die Stiftung nicht berührt.<br />
(3) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus<br />
1. dem Ertrag des Stiftungsvermögens,<br />
2. Zuwendungen,<br />
3. Erträgnissen von Ausspielungen, Ausstellungen, Veranstaltungen und<br />
Sammlungen,<br />
4. Ersatzzahlungen nach Art. 6 a Abs. 3.<br />
(4) Der Freistaat Bayern bringt in das Vermögen der Stiftung eine<br />
Grundausstattung ein.<br />
(5) 1 Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand. 2 Der<br />
Stiftungsrat besteht aus<br />
1. dem Staatsminister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
oder dessen Beauftragten als Vorsitzenden,<br />
2. dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz<br />
des Landtags,<br />
3. je einem Vertreter der Staatsministerien der Finanzen und für<br />
Landwirtschaft und Forsten,<br />
4. einem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände,<br />
5. einem Vertreter der bayerischen Landschaftspflegeverbände,<br />
6. drei vom Naturschutzbeirat beim Staatsministerium für Umwelt,<br />
Gesundheit und Verbraucherschutz aus seiner Mitte zu wählenden<br />
Vertretern.<br />
3<br />
Die Berufung der Mitglieder des Stiftungsrats nach Satz 2 Nrn. 4 und 5<br />
erfolgt auf Vorschlag des jeweiligen Bereichs durch den Staatsminister für<br />
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. 4 Stellvertreter können<br />
benannt werden. 5 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des<br />
Vorsitzenden. 6 Der Vorstand wird vom Staatsministerium für Umwelt,<br />
Gesundheit und Verbraucherschutz im Benehmen mit dem Stiftungsrat<br />
bestellt.<br />
(6) Das Nähere regelt das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und<br />
Verbraucherschutz durch Satzung, bezüglich der Grundausstattung im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.
(7) Die Stiftung untersteht unmittelbar der Aufsicht des Staatsministeriums<br />
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz.<br />
Bay NatSchG Art. 44 Zuständigkeit<br />
Der Vollzug dieses <strong>Gesetze</strong>s und der auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen<br />
Rechtsverordnungen obliegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, den unteren<br />
Naturschutzbehörden; der Vollzug der nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 5 erlassenen<br />
Gemeindeverordnungen obliegt den Gemeinden.<br />
Bay NatSchG Art. 45 Zuständigkeit für den Erlass von<br />
Rechtsverordnungen<br />
(1) Zuständig sind<br />
1. die Staatsregierung für den Erlass von Rechtsverordnungen über<br />
Nationalparke,<br />
2. die höheren Naturschutzbehörden für den Erlass von<br />
Rechtsverordnungen über Naturschutzgebiete,<br />
3. die Landkreise und kreisfreien Gemeinden für den Erlass von<br />
Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete,<br />
4. die unteren Naturschutzbehörden für den Erlass von<br />
Rechtsverordnungen nach Art. 9 und 12,<br />
5. die Gemeinden für den Erlass von Rechtsverordnungen nach Art. 12<br />
Abs. 2, soweit die untere Naturschutzbehörde nicht von ihrem<br />
Verordnungsrecht Gebrauch gemacht hat.<br />
(2) 1 Die Rechtsverordnungen erlassen die Gemeinden, Landkreise und<br />
Naturschutzbehörden, in deren Bereich der Schutzgegenstand liegt.<br />
2<br />
Erstreckt sich ein Schutzgegenstand im Fall des Abs. 1 Nr. 2 über den<br />
Bereich mehrerer höherer Naturschutzbehörden, im Fall des Abs. 1 Nr. 4<br />
über den Bereich mehrerer unterer Naturschutzbehörden, so wird die<br />
Rechtsverordnung von derjenigen Naturschutzbehörde erlassen, in deren<br />
Gebiet die größte Teilfläche des Schutzgegenstands liegt; die<br />
Rechtsverordnung ergeht im Einvernehmen mit den anderen betroffenen<br />
Naturschutzbehörden und ist auch von diesen amtlich bekannt zu machen.<br />
3<br />
Im Fall des Abs. 1 Nr. 3 erlässt der Bezirk die Rechtsverordnung, wenn<br />
sich der Schutzgegenstand über den Bereich mehrerer Landkreise oder<br />
kreisfreier Gemeinden erstreckt; für Änderungen von Verordnungen, die<br />
sich ausschließlich auf das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien<br />
Gemeinde beziehen, ist der betroffene Landkreis oder die betroffene<br />
kreisfreie Gemeinde allein zuständig; die Änderungen sind auch vom<br />
Bezirk amtlich bekannt zu machen.<br />
Bay NatSchG Art. 46 Verfahren zur Inschutznahme<br />
(1) Die Entwürfe der Rechtsverordnungen nach dem III. Abschnitt sind mit<br />
Karten, aus denen sich die Grenzen des Schutzgegenstands ergeben, den<br />
beteiligten Stellen, Gemeinden und Landkreisen zur Stellungnahme<br />
zuzuleiten.<br />
(2) 1 Die Entwürfe der Rechtsverordnungen sind mit den Karten auf die Dauer<br />
eines Monats öffentlich in den davon betroffenen Gemeinden und<br />
Landkreisen auszulegen. 2 Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens<br />
eine Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen mit dem Hinweis, dass
Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht<br />
werden können.<br />
(3) 1 Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen zum Schutz von<br />
Naturdenkmälern (Art. 9) und Landschaftsbestandteilen (Art. 12 Abs. 1)<br />
sind die betroffenen Grundeigentümer und sonstigen Berechtigten zu<br />
hören. 2 Im Übrigen kann das Verfahren nach den Abs. 1 und 2 durch<br />
Anhörung der Gemeinde und der betroffenen Fachbehörden und -stellen<br />
ersetzt werden.<br />
(4) Die für den Erlass der Rechtsverordnung zuständige Naturschutzbehörde<br />
oder Körperschaft prüft die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und<br />
Anregungen und teilt das Ergebnis den Betroffenen mit.<br />
(5) Wird der Umfang einer Rechtsverordnung räumlich oder sachlich nicht<br />
unerheblich erweitert, so ist das Verfahren nach den Abs. 1 bis 4 zu<br />
wiederholen.<br />
(6) 1 Für das Verfahren zur Inschutznahme können auch Karten in<br />
unveränderlicher digitaler Form verwendet werden. 2 Eine ausreichende<br />
Möglichkeit zur Einsichtnahme muss gewährleistet sein.<br />
(7) 1 Eine Verletzung der Vorschriften der Abs. 1 bis 6 ist unbeachtlich, wenn<br />
sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der<br />
Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die<br />
Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde<br />
geltend gemacht wird. 2 Bei der Bekanntmachung der Verordnung ist auf<br />
die Rechtsfolge nach Satz 1 hinzuweisen.<br />
Bay NatSchG Art. 47 Kennzeichnung der Schutzgegenstände<br />
(1) 1 Die Schutzgegenstände sollen durch die unteren Naturschutzbehörden in<br />
der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht werden. 2 Neben der<br />
Anbringung des von der obersten Naturschutzbehörde bestimmten<br />
amtlichen Schilds soll nach Möglichkeit auf die Bedeutung des<br />
Schutzgegenstands und auf die wichtigsten Bestimmungen der<br />
Rechtsverordnung hingewiesen werden. 3 Der Grundeigentümer oder<br />
sonstige Berechtigte hat die Aufstellung von Schildern zu dulden. 4 Bei der<br />
Aufstellung ist auf die Grundstücksnutzung Rücksicht zu nehmen.<br />
(2) Für Rechtsverordnungen nach Art. 26 gelten Abs. 1 Sätze 1, 3 und 4<br />
sinngemäß.<br />
Bay NatSchG Art. 48 Zutrittsrecht; einstweilige Sicherstellung und<br />
Veränderungssperre<br />
(1) 1 Den Bediensteten und Beauftragten der Naturschutzbehörden, des<br />
Bayerischen Landesamts für Umwelt und der Gemeinden ist der Zutritt zu<br />
einem Grundstück zum Zweck von Erhebungen, die zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich sind, gestattet; dies gilt auch<br />
für die Mitglieder der Naturschutzbeiräte bei der Vorbereitung und<br />
Durchführung von Sitzungen. 2 Dies gilt insbesondere zur Vorbereitung<br />
und Durchführung der nach diesem Gesetz zu treffenden Maßnahmen<br />
sowie zur Ausführung von Vermessungen, Bodenuntersuchungen und<br />
ähnlichen Vorhaben. 3 Das Grundrecht nach Art. 13 des Grundgesetzes<br />
wird hierdurch eingeschränkt. 4 Die Eigentümer und Besitzer der
etroffenen Grundstücke sollen vor dem Betreten in geeigneter Weise<br />
benachrichtigt werden. 5 Die Ergebnisse der Biotopkartierung sind den<br />
Eigentümern bekanntzugeben.<br />
(2) 1 Bis zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem III. Abschnitt können<br />
die nach Art. 45 zuständigen Naturschutzbehörden oder Körperschaften<br />
zur einstweiligen Sicherstellung von Schutzgebieten und<br />
Schutzgegenständen durch Rechtsverordnung oder Einzelanordnung für<br />
eine Dauer bis zu zwei Jahren die im III. Abschnitt vorgesehenen<br />
Veränderungsverbote aussprechen, wenn zu befürchten ist, dass durch<br />
Veränderungen der Zweck der beabsichtigten Inschutznahme<br />
beeinträchtigt würde; wenn besondere Umstände es erfordern, kann die<br />
Frist bis zu einem weiteren Jahr verlängert werden. 2 Die Maßnahme darf<br />
nicht ergehen, wenn die zuständige Naturschutzbehörde oder Körperschaft<br />
nicht gleichzeitig oder unmittelbar darauf das Verfahren für die endgültige<br />
Inschutznahme betreibt.<br />
(3) 1 In geplanten Naturschutzgebieten sind ab der Bekanntmachung der<br />
Auslegung (Art. 46 Abs. 2 Satz 2) bis zum In-Kraft-Treten der<br />
Schutzverordnung, längstens ein Jahr lang, alle Veränderungen verboten,<br />
soweit nicht in Rechtsverordnungen oder Einzelanordnungen nach<br />
Absatz 2 abweichende Regelungen getroffen werden. 2 Die im Zeitpunkt<br />
der Bekanntmachung ausgeübte rechtmäßige Bodennutzung bleibt<br />
unberührt. 3 In der Bekanntmachung ist auf diese Wirkung hinzuweisen.<br />
Bay NatSchG Art. 48 a Datenschutz<br />
(1) Die Naturschutzbehörden, das Bayerische Landesamt für Umwelt und der<br />
Bayerische Naturschutzfonds dürfen personenbezogene Daten erheben,<br />
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz oder nach<br />
anderen Rechtsvorschriften erforderlich ist.<br />
(2) Abweichend von Art. 16 Abs. 2 des Bayerischen Datenschutzgesetzes<br />
dürfen bei Erhebungen mit einer Vielzahl von betroffenen<br />
Grundstückseigentümern personenbezogene Daten auch ohne deren<br />
Kenntnis erhoben werden, wenn die Tatsache der Erhebung in der<br />
Gemeinde ortsüblich bekanntgemacht ist.<br />
(3) Das Bayerische Datenschutzgesetz findet Anwendung, soweit dieses<br />
Gesetz oder andere Rechtsvorschriften keine besonderen Regelungen<br />
enthalten.<br />
Bay NatSchG Art. 49 Befreiungen<br />
(1) 1 Von den Geboten, Verboten und Beschränkungen dieses <strong>Gesetze</strong>s und<br />
der auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen Rechtsverordnungen kann im<br />
Einzelfall Befreiung erteilt werden, wenn<br />
1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Befreiung erfordern<br />
oder<br />
2. der Vollzug der Bestimmung zu einer offenbar nicht beabsichtigten<br />
Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen im<br />
Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s vereinbar ist oder<br />
3. die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten<br />
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde.<br />
2 Satz 1 gilt auch für Verordnungen und Anordnungen, die nach Art. 55
weiter gelten; er tritt an die Stelle von Regelungen über die Erteilung von<br />
Ausnahmegenehmigungen in diesen Verordnungen und Anordnungen.<br />
(2) Wird die Befreiung mit Nebenbestimmungen erteilt, kann eine<br />
Sicherheitsleistung verlangt werden.<br />
(3) 1 Die Befreiung wird von der in der Rechtsverordnung bestimmten<br />
Naturschutzbehörde erteilt; fehlt eine Bestimmung, wird sie von der<br />
Naturschutzbehörde, die die Rechtsverordnung erlassen hat, bei<br />
Rechtsverordnungen über Naturschutzgebiete von der Regierung, bei<br />
Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete von der unteren<br />
Naturschutzbehörde erteilt; bei Gemeindeverordnungen wird sie von der<br />
Gemeinde erteilt; im Übrigen wird sie von der Regierung erteilt; bei<br />
Vorhaben der Landesverteidigung und des Zivilschutzes entscheidet über<br />
die Befreiung die oberste Naturschutzbehörde. 2 Die Befreiung wird durch<br />
eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erforderliche behördliche<br />
Gestattung ersetzt, soweit nicht Bundesrecht entgegensteht; die<br />
behördliche Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen<br />
des Abs. 1 vorliegen und die nach Satz 1 sonst zuständige Behörde ihr<br />
Einvernehmen erklärt. 3 Auf die Ersetzungswirkung soll in der behördlichen<br />
Gestattung ausdrücklich hingewiesen werden.<br />
(4) Die Vorschriften des Art. 6 a Abs. 1 und 3 über Ersatzmaßnahmen und<br />
Ersatzzahlungen sind entsprechend anzuwenden.<br />
(5) Art. 49 gilt nicht für den IV. Abschnitt des <strong>Gesetze</strong>s.<br />
Bay NatSchG Art. 49 a Zulässigkeit von Projekten und Plänen mit<br />
Auswirkungen auf das Europäische ökologische Netz “Natura 2000”<br />
(1) Projekte im Sinn des Art. 13 c Abs. 2 sind vor der Entscheidung nach<br />
Art. 49 auf ihre Verträglichkeit mit den für das Gebiet festgelegten<br />
Erhaltungszielen zu prüfen.<br />
(2) 1 Von den Verboten nach Art. 13 c Abs. 2 darf eine Befreiung unbeschadet<br />
des Art. 49 nur erteilt werden, wenn das Vorhaben aus zwingenden<br />
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses die Befreiung<br />
erfordert. 2 Zu den Gründen des öffentlichen Interesses zählen auch solche<br />
sozialer oder wirtschaftlicher Art. 3 Falls das Vorhaben einen prioritären<br />
Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art erheblich beeinträchtigt, zählen<br />
dazu nur die menschliche Gesundheit und die öffentliche Sicherheit oder<br />
maßgebliche günstige Umweltauswirkungen; andere zwingende Gründe<br />
des überwiegenden öffentlichen Interesses dürfen nur berücksichtigt<br />
werden, wenn zuvor über das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit<br />
und Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission<br />
eingeholt wurde.<br />
(3) Pläne im Sinn des Art. 13 c Abs. 3 dürfen nur unter den Voraussetzungen<br />
der Abs. 1 und 2 aufgestellt werden.<br />
(4) Die festzusetzenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen haben dazu<br />
beizutragen, dass der Zusammenhang des Europäischen ökologischen<br />
Netzes “Natura 2000” sichergestellt wird.
Bay NatSchG Art. 50 Anzeigepflichten<br />
(1) 1 Die Eigentümer und Besitzer von Naturdenkmälern haben erhebliche<br />
Schäden und Mängel an diesen unverzüglich der unteren<br />
Naturschutzbehörde anzuzeigen. 2 Die Anzeige kann auch bei der<br />
Gemeinde abgegeben werden. 3 Diese ist verpflichtet, die Anzeige<br />
unverzüglich an die untere Naturschutzbehörde weiterzuleiten.<br />
(2) 1 Werden bisher unbekannte Einzelschöpfungen der Natur entdeckt, die<br />
des Schutzes oder der Pflege im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s bedürfen, so ist der<br />
Fund unverzüglich der unteren Naturschutzbehörde oder der Gemeinde<br />
anzuzeigen und so lang, höchstens jedoch bis zum Ablauf einer Woche<br />
nach Erstattung der Anzeige, in seinem bisherigen Zustand zu belassen,<br />
bis die untere Naturschutzbehörde die notwendigen Schutzmaßnahmen<br />
getroffen oder den Fund freigegeben hat. 2 Die Anzeige ist vom Entdecker<br />
zu erstatten.<br />
(3) Wird einer Gemeinde bekannt, dass gegen die Vorschriften dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s oder der auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen<br />
Rechtsverordnungen verstoßen wird, so hat sie die untere<br />
Naturschutzbehörde unverzüglich zu unterrichten.<br />
(4) Die untere Naturschutzbehörde soll einmal im Jahr die in ihrem Gebiet<br />
befindlichen Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützten<br />
Landschaftsbestandteile begehen lassen.<br />
(5) Abs. 1 gilt auch für Eigentümer und Besitzer von Grundstücken in<br />
Naturschutzgebieten und Nationalparken, soweit ihnen Schäden oder<br />
Mängel auf ihren Grundstücken bekannt werden.<br />
Bay NatSchG Art. 51 Grundbesitz der öffentlichen Hand;<br />
Haushaltsplanung<br />
Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen des<br />
öffentlichen Rechts sollen in ihrem Eigentum befindliche geeignete<br />
Grundstücke im Tauschweg zur Verfügung stellen, wenn Beschränkungen der<br />
Nutzung privater Grundstücke aus Gründen des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege für den privaten Eigentümer eine unbillige Härte darstellen;<br />
dies gilt nicht für Grundstücke, die in absehbarer Zeit zur Erfüllung von<br />
Aufgaben des Staates, der Gemeinde, des Landkreises, des Bezirks oder<br />
sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts benötigt werden.<br />
VIII. Abschnitt Ordnungswidrigkeiten<br />
Bay NatSchG Art. 52 Ordnungswidrigkeiten<br />
(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. entgegen einer vollziehbaren Einzelanordnung nach Art. 6 a Abs. 5<br />
Satz 1 einen Eingriff nicht einstellt oder entgegen einer vollziehbaren<br />
Einzelanordnung nach Art. 6 a Abs. 6 Satz 2 einen Eingriff vornimmt oder<br />
fortsetzt,<br />
2. entgegen Art. 13 d Abs. 1 eine Maßnahme vornimmt oder einer<br />
vollziehbaren Anordnung nach Art. 13 d Abs. 5 Satz 1 nicht oder nicht<br />
rechtzeitig nachkommt,
3. den Vorschriften einer nach Art. 7, 8 Abs. 1 und 4, Art. 9 Abs. 1 bis 4,<br />
Art. 10 Abs. 2, Art. 11 Abs. 2, Art. 12 oder 48 Abs. 2 erlassenen<br />
Rechtsverordnung, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese<br />
Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt,<br />
4. einer vollziehbaren Einzelanordnung nach Art. 9 Abs. 5, Art. 12 Abs. 3<br />
in Verbindung mit Art. 9 Abs. 5, Art. 48 Abs. 2 oder einer vollziehbaren<br />
Einstellungsanordnung nach Art. 13 a Abs. 3 zuwiderhandelt,<br />
5. entgegen Art. 48 Abs. 3 Veränderungen in einem geplanten<br />
Naturschutzgebiet vornimmt oder<br />
6. einer vollziehbaren Nebenbestimmung in Form der Auflage zu einer<br />
Gestattung, wenn die Auflage auf diesem Gesetz oder einer auf Grund<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen Rechtsverordnung beruht, nicht nachkommt.<br />
(2) Mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro kann belegt werden, wer<br />
1. entgegen Art. 6 d Satz 1 den Einsatz von Grabenfräsen nicht oder nicht<br />
rechtzeitig anzeigt oder entgegen Art. 6 d Satz 3 Grabenfräsen einsetzt,<br />
2. den Vorschriften des Art. 13 e Abs. 1 zuwiderhandelt,<br />
3. den in Art. 15 Abs. 1 bis 3 zum Schutz von Pflanzen und Tieren<br />
erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt,<br />
4. entgegen Art. 17 Abs. 1 Pflanzen gebietsfremder Arten oder Tiere<br />
aussetzt oder ansiedelt,<br />
5. den für nach Art. 18 Abs. 1 besonders geschützte Arten geltenden<br />
Verboten zuwiderhandelt,<br />
6. den Vorschriften einer auf Grund des Art. 18 Abs. 2 oder Art. 26<br />
erlassenen Rechtsverordnung, die für einen bestimmten Tatbestand auf<br />
diese Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt,<br />
7. entgegen Art. 20 a Abs. 2 Satz 1 die Errichtung, die Erweiterung oder<br />
den Betrieb eines Tiergeheges nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder<br />
einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 20 a Abs. 2 Satz 3 oder 4<br />
zuwiderhandelt,<br />
8. entgegen Art. 20 b Abs. 2 einen Zoo errichtet, wesentlich ändert oder<br />
betreibt oder einer vollziehbaren nachträglichen Anordnung nach Art. 20 b<br />
Abs. 3 oder 4 zuwiderhandelt,<br />
9. bei Ausübung des Rechts nach Art. 21<br />
a) Grundstücke verunreinigt oder beschädigt oder<br />
b) entgegen Art. 33 a Abs. 1 Sachen zurücklässt,<br />
10. einer vollziehbaren Einzelanordnung nach Art. 26 zuwiderhandelt,<br />
11. die Errichtung von Sperren im Sinn des Art. 22 Abs. 3 Satz 2 entgegen<br />
Art. 30 Abs. 1 Satz 2 oder 4 nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder durch<br />
sonstige Maßnahmen die Ausübung des Betretungsrechts nach Art. 22<br />
Abs. 1 und 2 beeinträchtigt.<br />
(3) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer in den<br />
Fällen des Abs. 2 Nrn. 1, 2, 4 bis 8, 9 Buchst. a fahrlässig handelt.<br />
(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer<br />
1. entgegen Art. 25 Abs. 2 unbefugt im Wald außerhalb von Straßen und<br />
Wegen reitet,<br />
2. auf Privatwegen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen<br />
Verkehr freigegeben sind, unbefugt mit Fahrzeugen mit Motorkraft,<br />
ausgenommen Krankenfahrstühle, fährt oder parkt oder, soweit die Wege<br />
dafür ungeeignet sind, unbefugt reitet oder mit Fahrzeugen ohne
Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, fährt,<br />
3. auf Flächen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen Verkehr<br />
freigegeben sind, mit Fahrzeugen mit Motorkraft, ausgenommen<br />
Krankenfahrstühle, ohne Notwendigkeit fährt oder parkt oder mit<br />
Fahrzeugen ohne Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, unbefugt<br />
fährt,<br />
4. gesperrte Forstkulturen oder Forstpflanzgärten betritt,<br />
5. entgegen Art. 50 Abs. 1 oder 5 nicht unverzüglich Anzeige erstattet,<br />
6. entgegen Art. 50 Abs. 2 als Grundstückseigentümer, sonstiger<br />
Nutzungsberechtigter oder Unternehmer von Maßnahmen zur<br />
Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen nicht<br />
unverzüglich Anzeige erstattet oder den Fund nicht in seinem bisherigen<br />
Zustand belässt.<br />
(5) Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Parkverstoßes nach Art. 52<br />
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 Nr. 2 oder 3 der Führer des Kraftfahrzeugs, der den<br />
Parkverstoß begangen hat, nicht ermittelt werden, findet § 25 a des<br />
Straßenverkehrsgesetzes entsprechende Anwendung.<br />
(6) Soweit Rechtsverordnungen und Anordnungen für einen bestimmten<br />
Tatbestand auf Bußgeldvorschriften des Art. 52 des Bayerischen<br />
Naturschutzgesetzes, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Oktober<br />
1978 (GVBl S. 678), verweisen, treten die entsprechenden<br />
Bußgeldvorschriften der Abs. 1 bis 4 an deren Stelle.<br />
(7) Sind Rechtsverordnungen oder Anordnungen über Naturschutzgebiete,<br />
Naturdenkmäler, Landschaftsbestandteile und Grünbestände auf Grund<br />
der bisher geltenden Vorschriften erlassen worden, so können vorsätzliche<br />
oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Art. 7 Abs. 2, Art. 9 Abs. 4<br />
und Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4 mit Geldbuße bis zu<br />
fünfzigtausend Euro belegt werden, auch wenn eine Verweisung auf eine<br />
dem Abs. 1 Nr. 3 entsprechende frühere Bußgeldvorschrift fehlt; Art. 55<br />
Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.<br />
Bay NatSchG Art. 53 Einziehung<br />
1 Die durch eine Ordnungswidrigkeit gewonnenen oder erlangten oder die zu<br />
ihrer Begehung gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstände einschließlich<br />
der bei der Ordnungswidrigkeit verwendeten Verpackungs- und<br />
Beförderungsmittel können eingezogen werden. 2 Es können auch Gegenstände<br />
eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht. 3 § 23 des<br />
<strong>Gesetze</strong>s über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.<br />
IX. Abschnitt Übergangs- und Schlussvorschriften<br />
Bay NatSchG Art. 54 (weggefallen)<br />
Bay NatSchG Art. 55 Überleitungsvorschrift<br />
(1) 1 Die auf Grund der bisher geltenden naturschutzrechtlichen<br />
Bestimmungen erlassenen Verordnungen und Anordnungen im Sinn des<br />
III. Abschnitts dieses <strong>Gesetze</strong>s bleiben bis zu ihrer ausdrücklichen<br />
Aufhebung oder bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer in Kraft. 2 Für die<br />
Aufhebung gelten die Zuständigkeitsvorschriften des VII. Abschnitts
entsprechend. 3 Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen und<br />
Anordnungen im Sinn des Satzes 1 werden nach Art. 52 mit einer<br />
Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in besonders schweren Fällen mit<br />
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet. 4 Art. 53 ist<br />
anzuwenden.<br />
(2) 1 Eine Genehmigung nach Art. 20 b Abs. 2 ist spätestens ein Jahr nach In-<br />
Kraft-Treten dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlich. 2 Verfügt ein Zoo bereits über<br />
eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 a bzw. § 11 Abs. 1 Nr. 3 d des<br />
Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai<br />
1998 (BGBl. I S. 1105, 1818), zuletzt geändert durch Art. 7 b des<br />
<strong>Gesetze</strong>s vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1666), gelten Art. 20 b Abs. 2<br />
Sätze 4 und 5 mit der Maßgabe, dass die zuständige Behörde im<br />
Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde durch nachträgliche<br />
Anordnungen sicherstellt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen nach<br />
Art. 20 b Abs. 1 auf Dauer erfüllt werden. 3 Hierzu haben die Betreiber von<br />
Zoos innerhalb von sechs Monaten nach In-Kraft-Treten dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
Unterlagen vorzulegen, aus denen sich die Erfüllung der<br />
Genehmigungsvoraussetzungen nach Art. 20 b Abs. 1 ergibt.<br />
(3) Die bisherigen Anerkennungen von Vereinen nach § 29 Abs. 2 in der bis<br />
zum 3. April 2002 geltenden Fassung des Bundesnaturschutzgesetzes<br />
gelten als Anerkennungen gemäß Art. 42 Abs. 2.<br />
Bay NatSchG Art. 56 Abgrenzung zum<br />
Landwirtschaftsförderungsgesetz<br />
Unberührt bleibt die Zuständigkeit des Staatsministeriums für Landwirtschaft<br />
und Forsten für fachliche Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft, die dazu<br />
dienen, den ländlichen Raum als Kulturlandschaft zu sanieren, zu erhalten, zu<br />
pflegen und dabei zu gestalten (Art. 21 des <strong>Gesetze</strong>s zur Förderung der<br />
bayerischen Landwirtschaft).<br />
Bay NatSchG Art. 57 und 58 (weggefallen)<br />
Bay NatSchG Art. 59 Aufhebung von Vorschriften<br />
Das Gesetz zum Schutz der wildwachsenden Pflanzen und der nicht jagdbaren<br />
wildlebenden Tiere (Naturschutz-Ergänzungsgesetz) vom 29. Juni 1962 (BayRS<br />
791-2-U), in seiner jeweils geltenden Fassung tritt, soweit es den Vorschriften<br />
des IV. Abschnitts dieses <strong>Gesetze</strong>s nicht widerspricht, erst mit In-Kraft-Treten<br />
einer Rechtsverordnung nach Art. 18 außer Kraft.<br />
Bay NatSchG Art. 60 In-Kraft-Treten<br />
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1973 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Juli 1973 (GVBl S. 437, ber. S. 562).<br />
Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen<br />
Änderungsgesetzen.
Gesetz über die Aufgaben und<br />
Befugnisse der Bayerischen Staatlichen<br />
Polizei (Bay PAG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 (GVBl. S. 397), geändert durch<br />
<strong>Gesetze</strong> vom 27. Dezember 1991 (GVBl. S. 496), vom 23. Juli 1993 (GVBl. S. 498), vom 23.<br />
Dezember 1994 (GVBl. S. 1050), vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 342), vom 10. Juli 1998 (GVBl.<br />
S. 383), vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 541), vom 25. Oktober 2000 (GVBl. S. 752), vom 24.<br />
April 2001 (GVBl. S. 140), vom 24. Juli 2001 (GVBl. S. 348), vom 24. Dezember 2005 (GVBl.<br />
S. 641), vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 866), vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 944), vom 10.<br />
Juni 2008 (GVBl. S. 315), vom 8. Juli 2008 (GVBl. S. 365), vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 421), vom<br />
27. Juli 2009 (GVBl. S. 380), vom 27. Juli 2009 (GVBl. S. 400) (FN BayRS 2012-1-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
I. ABSCHNITT Allgemeine Vorschriften<br />
Art. 1 Begriff der Polizei<br />
Art. 2 Aufgaben der Polizei<br />
Art. 3 Verhältnis zu anderen Behörden<br />
Art. 4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
Art. 5 Ermessen, Wahl der Mittel<br />
Art. 6 Ausweispflicht des Polizeibeamten<br />
Art. 7 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen<br />
Art. 8 Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen<br />
Art. 9 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme<br />
Art. 10 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen<br />
II. ABSCHNITT Befugnisse der Polizei<br />
Art. 11 Allgemeine Befugnisse<br />
Art. 12 Auskunftspflicht<br />
Art. 13 Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen<br />
Art. 14 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
Art. 15 Vorladung<br />
Art. 16 Platzverweisung<br />
Art. 17 Gewahrsam<br />
Art. 18 Richterliche Entscheidung<br />
Art. 19 Behandlung festgehaltener Personen<br />
Art. 20 Dauer der Freiheitsentziehung<br />
Art. 21 Durchsuchung von Personen<br />
Art. 22 Durchsuchung von Sachen<br />
Art. 23 Betreten und Durchsuchen von Wohnungen<br />
Art. 24 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen<br />
Art. 25 Sicherstellung<br />
Art. 26 Verwahrung<br />
Art. 27 Verwertung, Vernichtung<br />
Art. 28 Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten<br />
Art. 29 Befugnisse für Aufgaben der Grenzkontrolle und Sicherung von<br />
Anlagen<br />
III. ABSCHNITT Datenerhebung und -verarbeitung<br />
1. Unterabschnitt Datenerhebung<br />
Art. 30 Grundsätze der Datenerhebung<br />
Art. 31 Datenerhebung<br />
Art. 32 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen<br />
sowie an besonders gefährdeten Objekten<br />
Art. 33 Besondere Mittel der Datenerhebung
Art. 34 Besondere Bestimmungen über den Einsatz technischer Mittel in<br />
Wohnungen<br />
Art. 34 a Datenerhebung und Eingriffe in den Telekommunikationsbereich<br />
Art. 34 b Mitwirkungspflichten der Diensteanbieter<br />
Art. 34 c Verfahrensregelungen, Verwendungsverbote, Zweckbindung,<br />
Benachrichtigung und Löschung<br />
Art. 34 d Verdeckter Zugriff auf informationstechnische Systeme<br />
Art. 34 e<br />
Art. 35 Besondere Bestimmungen über den Einsatz Verdeckter Ermittler<br />
Art. 36 Polizeiliche Beobachtung<br />
2. Unterabschnitt Datenverarbeitung<br />
Art. 37 Allgemeine Regeln der Datenspeicherung, Datenveränderung und<br />
Datennutzung<br />
Art. 38 Speicherung, Veränderung und Nutzung von Daten<br />
Art. 39 Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung<br />
Art. 40 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs<br />
Art. 41 Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des<br />
öffentlichen Bereichs<br />
Art. 42 Datenübermittlung an die Polizei<br />
Art. 43 Datenabgleich innerhalb der Polizei<br />
Art. 44 Rasterfahndung<br />
Art. 45 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten<br />
Art. 46 Automatisiertes Abrufverfahren<br />
Art. 47 Errichtungsanordnung für Dateien<br />
Art. 48 Auskunftsrecht
3. Unterabschnitt Anwendung des Bayerischen Datenschutzgesetzes<br />
Art. 49<br />
IV. ABSCHNITT Vollzugshilfe<br />
Art. 50 Vollzugshilfe<br />
Art. 51 Verfahren<br />
Art. 52 Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung<br />
V. ABSCHNITT Zwang<br />
1. Unterabschnitt Erzwingung von Handlungen, Duldungen und<br />
Unterlassungen<br />
Art. 53 Zulässigkeit des Verwaltungszwangs<br />
Art. 54 Zwangsmittel<br />
Art. 55 Ersatzvornahme<br />
Art. 56 Zwangsgeld<br />
Art. 57 Ersatzzwangshaft<br />
Art. 58 Unmittelbarer Zwang<br />
Art. 59 Androhung der Zwangsmittel<br />
2. Unterabschnitt Anwendung unmittelbaren Zwangs<br />
Art. 60 Rechtliche Grundlagen<br />
Art. 61 Begriffsbestimmung<br />
Art. 62 Handeln auf Anordnung<br />
Art. 63 Hilfeleistung für Verletzte<br />
Art. 64 Androhung unmittelbaren Zwangs<br />
Art. 65 Fesselung von Personen
Art. 66 Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch<br />
Art. 67 Schußwaffengebrauch gegen Personen<br />
Art. 68 Schußwaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge<br />
Art. 69 Besondere Waffen, Sprengmittel<br />
VI. ABSCHNITT Entschädigungs-, Erstattungs- und Ersatzansprüche<br />
Art. 70 Entschädigungsanspruch<br />
Art. 71 Erstattungsanspruch<br />
Art. 72 Ersatzanspruch<br />
Art. 73 Rechtsweg<br />
VII. ABSCHNITT Schlußbestimmungen<br />
Art. 74 Einschränkung von Grundrechten<br />
Art. 75<br />
Art. 76 Verhältnis zum Kostengesetz<br />
Art. 77 Begriff der Polizeibehörde<br />
Art. 78 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift<br />
I. ABSCHNITT Allgemeine Vorschriften<br />
Bay PAG Art. 1 Begriff der Polizei<br />
Polizei im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind die im Vollzugsdienst tätigen Dienstkräfte<br />
der Polizei des Freistaates Bayern.<br />
Bay PAG Art. 2 Aufgaben der Polizei<br />
(1) Die Polizei hat die Aufgabe, die allgemein oder im Einzelfall bestehenden<br />
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.<br />
(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur<br />
dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn<br />
ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder<br />
wesentlich erschwert werden würde.<br />
(3) Die Polizei leistet anderen Behörden und den Gerichten Vollzugshilfe<br />
(Art. 50 bis 52).
(4) Die Polizei hat ferner die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch andere<br />
Rechtsvorschriften übertragen sind.<br />
Bay PAG Art. 3 Verhältnis zu anderen Behörden<br />
Die Polizei wird tätig, soweit ihr die Abwehr der Gefahr durch eine andere<br />
Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint.<br />
Bay PAG Art. 4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei<br />
diejenige zu treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit am<br />
wenigsten beeinträchtigt.<br />
(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem<br />
erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.<br />
(3) Eine Maßnahme ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder<br />
sich zeigt, daß er nicht erreicht werden kann.<br />
Bay PAG Art. 5 Ermessen, Wahl der Mittel<br />
(1) Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.<br />
(2) 1 Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so genügt<br />
es, wenn eines davon bestimmt wird. 2 Dem Betroffenen ist auf Antrag zu<br />
gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die<br />
Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.<br />
Bay PAG Art. 6 Ausweispflicht des Polizeibeamten<br />
1 Auf Verlangen des von einer Maßnahme Betroffenen hat der Polizeibeamte<br />
sich auszuweisen, soweit der Zweck der Maßnahme dadurch nicht<br />
beeinträchtigt wird. 2 Das Nähere wird durch Dienstvorschrift geregelt.<br />
Bay PAG Art. 7 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen<br />
(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen sie zu<br />
richten.<br />
(2) 1 Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt oder ist für sie wegen einer<br />
psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung<br />
zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt, können<br />
Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die zur Aufsicht<br />
über sie verpflichtet ist. 2 Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des<br />
Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt.<br />
(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in<br />
Ausführung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen die<br />
Person gerichtet werden, die die andere zu der Verrichtung bestellt hat.<br />
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s oder andere Rechtsvorschriften bestimmen, gegen wen<br />
eine Maßnahme zu richten ist.
Bay PAG Art. 8 Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen<br />
(1) Geht von einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den<br />
Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten.<br />
(2) 1 Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen<br />
Berechtigten gerichtet werden. 2 Das gilt nicht, wenn der Inhaber der<br />
tatsächlichen Gewalt diese ohne den Willen des Eigentümers oder<br />
Berechtigten ausübt.<br />
(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die<br />
Maßnahmen gegen denjenigen gerichtet werden, der das Eigentum an der<br />
Sache aufgegeben hat.<br />
(4) Art. 7 Abs. 4 gilt entsprechend.<br />
Bay PAG Art. 9 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme<br />
(1) 1 Die Polizei kann eine Maßnahme selbst oder durch einen Beauftragten<br />
ausführen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme der<br />
nach den Art. 7 oder 8 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig<br />
erreicht werden kann. 2 Der von der Maßnahme Betroffene ist unverzüglich<br />
zu unterrichten.<br />
(2) 1 Für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme werden von den nach<br />
Art. 7 oder 8 Verantwortlichen Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.<br />
2<br />
Im übrigen gilt das Kostengesetz.<br />
Bay PAG Art. 10 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen<br />
(1) Die Polizei kann Maßnahmen gegen andere Personen als die nach den<br />
Art. 7 oder 8 Verantwortlichen richten, wenn<br />
1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,<br />
2. Maßnahmen gegen die nach den Art. 7 oder 8 Verantwortlichen nicht<br />
oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,<br />
3. die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch<br />
Beauftragte abwehren kann und<br />
4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung<br />
höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden können.<br />
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrechterhalten werden,<br />
solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.<br />
(3) Art. 7 Abs. 4 gilt entsprechend.<br />
II. ABSCHNITT Befugnisse der Polizei<br />
Bay PAG Art. 11 Allgemeine Befugnisse<br />
(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im<br />
einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder<br />
Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die Art. 12 bis 48 die<br />
Befugnisse der Polizei besonders regeln.<br />
(2) 1 Eine Maßnahme im Sinn des Absatzes 1 kann die Polizei insbesondere<br />
dann treffen, wenn sie notwendig ist, um<br />
1. Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder verfassungsfeindliche
Handlungen zu verhüten oder zu unterbinden,<br />
2. durch solche Handlungen verursachte Zustände zu beseitigen oder<br />
3. Gefahren abzuwehren oder Zustände zu beseitigen, die Leben,<br />
Gesundheit oder die Freiheit der Person oder die Sachen, deren Erhaltung<br />
im öffentlichen Interesse geboten erscheint, bedrohen oder verletzen.<br />
2<br />
Straftaten im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind rechtswidrige Taten, die den<br />
Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichen. 3 Ordnungswidrigkeiten im<br />
Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind rechtswidrige Taten, die den Tatbestand einer<br />
Ordnungswidrigkeit verwirklichen. 4 Verfassungsfeindlich im Sinn des<br />
Satzes 1 Nr. 1 ist eine Handlung, die darauf gerichtet ist, die<br />
verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland oder eines<br />
ihrer Länder auf verfassungswidrige Weise zu stören oder zu ändern, ohne<br />
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit zu verwirklichen.<br />
(3) 1 Zur Erfüllung der Aufgaben, die der Polizei durch andere<br />
Rechtsvorschriften zugewiesen sind (Art. 2 Abs. 4), hat sie die dort<br />
vorgesehenen Befugnisse. 2 Soweit solche Rechtsvorschriften Befugnisse<br />
der Polizei nicht regeln, hat sie die Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz<br />
zustehen.<br />
Bay PAG Art. 12 Auskunftspflicht<br />
1 Auf Befragen durch die Polizei ist eine Person verpflichtet, Name, Vorname,<br />
Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit anzugeben,<br />
wenn anzunehmen ist, daß sie sachdienliche Angaben machen kann, die zur<br />
Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. 2 Zu<br />
weiteren Auskünften gegenüber der Polizei ist die Person nur verpflichtet,<br />
soweit für sie gesetzliche Handlungspflichten bestehen. 3 Für die Dauer der<br />
Befragung kann die Person angehalten werden.<br />
Bay PAG Art. 13 Identitätsfeststellung und Prüfung von<br />
Berechtigungsscheinen<br />
(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen<br />
1. zur Abwehr einer Gefahr,<br />
2. wenn die Person sich an einem Ort aufhält,<br />
a) von dem auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, daß<br />
dort<br />
aa) Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben,<br />
bb) sich Personen ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen, oder<br />
cc) sich Straftäter verbergen, oder<br />
b) an dem Personen der Prostitution nachgehen,<br />
3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -<br />
einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem<br />
anderen besonders gefährdeten Objekt oder in unmittelbarer Nähe<br />
hiervon aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in oder an<br />
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die in oder<br />
an diesen Objekten befindliche Personen oder diese Objekte selbst<br />
unmittelbar gefährdet sind,<br />
4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden ist, um<br />
Straftaten im Sinn von § 100 a der Strafprozeßordnung (StPO) oder<br />
Art. 20 Abs. 1 Nrn. 1 und 3, Abs. 2 Nrn. 10 bis 12 des Bayerischen
Versammlungsgesetzes (BayVersG) zu verhindern,<br />
5. im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 km sowie auf<br />
Durchgangsstraßen (Bundesautobahnen, Europastraßen und andere<br />
Straßen von erheblicher Bedeutung für den grenzüberschreitenden<br />
Verkehr) und in öffentlichen Einrichtungen des internationalen Verkehrs<br />
zur Verhütung oder Unterbindung der unerlaubten Überschreitung der<br />
Landesgrenze oder des unerlaubten Aufenthalts und zur Bekämpfung der<br />
grenzüberschreitenden Kriminalität oder<br />
6. zum Schutz privater Rechte (Art. 2 Abs. 2).<br />
(2) 1 Die Polizei kann zur Feststellung der Identität die erforderlichen<br />
Maßnahmen treffen. 2 Sie kann den Betroffenen insbesondere anhalten,<br />
ihn nach seinen Personalien befragen und verlangen, daß er mitgeführte<br />
Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt. 3 Der Betroffene kann<br />
festgehalten werden, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur<br />
unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 4 Unter den<br />
Voraussetzungen von Satz 3 können der Betroffene sowie die von ihm<br />
mitgeführten Sachen durchsucht werden.<br />
(3) Die Polizei kann verlangen, daß ein Berechtigungsschein zur Prüfung<br />
ausgehändigt wird, wenn der Betroffene auf Grund einer Rechtsvorschrift<br />
verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen.<br />
Bay PAG Art. 14 Erkennungsdienstliche Maßnahmen<br />
(1) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen, wenn<br />
1. eine nach Art. 13 zulässige Identitätsfeststellung auf andere Weise<br />
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist oder<br />
2. dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist, weil<br />
der Betroffene verdächtig ist, eine Tat begangen zu haben, die mit Strafe<br />
bedroht ist und wegen der Art und Ausführung der Tat die Gefahr der<br />
Wiederholung besteht.<br />
(2) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 entfallen, kann der Betroffene die<br />
Vernichtung der erkennungsdienstlichen Unterlagen verlangen.<br />
(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere<br />
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrucken,<br />
2. die Aufnahme von Lichtbildern,<br />
3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,<br />
4. Messungen.<br />
Bay PAG Art. 15 Vorladung<br />
(1) Die Polizei kann eine Person schriftlich oder mündlich vorladen, wenn<br />
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person sachdienliche<br />
Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer bestimmten<br />
polizeilichen Aufgabe erforderlich sind, oder<br />
2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforderlich<br />
ist.<br />
(2) 1 Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben werden. 2 Bei der<br />
Festsetzung des Zeitpunkts soll auf den Beruf und die sonstigen<br />
Lebensverhältnisse des Betroffenen Rücksicht genommen werden.
(3) Leistet ein Betroffener der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine<br />
Folge, so kann sie zwangsweise durchgesetzt werden,<br />
1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder<br />
Freiheit einer Person erforderlich sind, oder<br />
2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen (Absatz 1 Nr. 2).<br />
(4) § 136 a StPO gilt entsprechend.<br />
Bay PAG Art. 16 Platzverweisung<br />
1 Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von<br />
einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Orts<br />
verbieten. 2 Die Platzverweisung kann ferner gegen Personen angeordnet<br />
werden, die den Einsatz der Feuerwehr oder von Hilfs- oder Rettungsdiensten<br />
behindern.<br />
Bay PAG Art. 17 Gewahrsam<br />
(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn<br />
1. das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben<br />
erforderlich ist, insbesondere weil die Person sich erkennbar in einem die<br />
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser<br />
Lage befindet oder<br />
2. das unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder<br />
Fortsetzung einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher<br />
Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern; die Annahme, daß eine<br />
Person eine solche Tat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird,<br />
kann sich insbesondere darauf stützen, daß<br />
a) sie die Begehung der Tat angekündigt oder dazu aufgefordert hat oder<br />
Transparente oder sonstige Gegenstände mit einer solchen Aufforderung<br />
mit sich führt; dies gilt auch für Flugblätter solchen Inhalts, soweit sie in<br />
einer Menge mitgeführt werden, die zur Verteilung geeignet ist, oder<br />
b) bei ihr Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände aufgefunden<br />
werden, die ersichtlich zur Tatbegehung bestimmt sind oder<br />
erfahrungsgemäß bei derartigen Taten verwendet werden, oder ihre<br />
Begleitperson solche Gegenstände mit sich führt und sie den Umständen<br />
nach hiervon Kenntnis haben mußte, oder<br />
c) sie bereits in der Vergangenheit mehrfach aus vergleichbarem Anlaß bei<br />
der Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher<br />
Bedeutung für die Allgemeinheit als Störer betroffen worden ist und nach<br />
den Umständen eine Wiederholung dieser Verhaltensweise zu erwarten<br />
ist;<br />
oder<br />
3. das unerläßlich ist, um eine Platzverweisung nach Art. 16<br />
durchzusetzen.<br />
(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberechtigten<br />
entzogen haben oder sich an Orten aufhalten, an denen ihnen eine<br />
sittliche Gefahr oder Verwahrlosung droht, in Gewahrsam nehmen, um sie<br />
den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt zuzuführen.<br />
(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von Untersuchungshaft,<br />
Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und<br />
Sicherung entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der
Vollzugsanstalt aufhält, in Gewahrsam nehmen und in die Anstalt<br />
zurückbringen.<br />
Bay PAG Art. 18 Richterliche Entscheidung<br />
(1) 1 Wird eine Person auf Grund von Art. 13 Abs. 2 Satz 3, Art. 15 Abs. 3<br />
oder Art. 17 festgehalten, hat die Polizei unverzüglich eine richterliche<br />
Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung<br />
herbeizuführen. 2 Der Herbeiführung der richterlichen Entscheidung bedarf<br />
es nicht, wenn anzunehmen ist, daß die Entscheidung des Richters erst<br />
nach Wegfall des Grundes der polizeilichen Maßnahme ergehen würde.<br />
(2) 1 Ist die Freiheitsentziehung vor Erlaß einer gerichtlichen Entscheidung<br />
beendet, kann die festgehaltene Person, bei Minderjährigkeit auch ihr<br />
gesetzlicher Vertreter, innerhalb eines Monats nach Beendigung der<br />
Freiheitsentziehung die Feststellung beantragen, daß die<br />
Freiheitsentziehung rechtswidrig gewesen ist, wenn hierfür ein<br />
berechtigtes Interesse besteht. 2 Der Antrag kann bei dem nach Absatz 3<br />
Satz 2 zuständigen Amtsgericht schriftlich oder durch Erklärung zu<br />
Protokoll der Geschäftsstelle dieses Gerichts gestellt werden.<br />
(3) 1 Für die Entscheidung nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in<br />
dessen Bezirk die Freiheitsentziehung vollzogen wird. 2 Für die<br />
Entscheidung nach Absatz 2 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen<br />
Bezirk die Person von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. 3 Das<br />
Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des <strong>Gesetze</strong>s über das<br />
Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen<br />
Gerichtsbarkeit; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.<br />
Bay PAG Art. 19 Behandlung festgehaltener Personen<br />
(1) 1 Wird eine Person auf Grund von Art. 13 Abs. 2 Satz 3, Art. 15 Abs. 3<br />
oder Art. 17 festgehalten, ist ihr unverzüglich der Grund bekanntzugeben;<br />
sie ist über die ihr zustehenden Rechtsmittel zu belehren. 2 Zu der<br />
Belehrung gehört der Hinweis, daß eine etwaige Aussage freiwillig erfolgt.<br />
(2) 1 Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, einen<br />
Angehörigen oder eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit<br />
dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird.<br />
2<br />
Unberührt bleibt die Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen<br />
Freiheitsentziehung. 3 Die Polizei hat die Benachrichtigung zu übernehmen,<br />
wenn die festgehaltene Person nicht in der Lage ist, von dem Recht nach<br />
Satz 1 Gebrauch zu machen und die Benachrichtigung ihrem<br />
mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. 4 Ist die festgehaltene Person<br />
minderjährig oder ist für sie ein Betreuer mit dem Aufgabenkreis der<br />
Personensorge oder der Aufenthaltsbestimmung bestellt, so ist in jedem<br />
Fall unverzüglich der Betreuer oder derjenige zu benachrichtigen, dem die<br />
Sorge für die Person obliegt.<br />
(3) 1 Die festgehaltene Person soll gesondert, insbesondere ohne ihre<br />
Einwilligung nicht in demselben Raum mit Straf- oder<br />
Untersuchungsgefangenen untergebracht werden. 2 Männer und Frauen<br />
sollen getrennt untergebracht werden. 3 Der festgehaltenen Person dürfen<br />
nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck der<br />
Freiheitsentziehung oder die Ordnung im Gewahrsam erfordert.
Bay PAG Art. 20 Dauer der Freiheitsentziehung<br />
Die festgehaltene Person ist zu entlassen,<br />
1. sobald der Grund für die Maßnahme der Polizei weggefallen ist,<br />
2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung<br />
für unzulässig erklärt wird,<br />
3. in jedem Fall spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen, wenn<br />
nicht vorher die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche<br />
Entscheidung angeordnet ist. In der richterlichen Entscheidung ist die<br />
höchstzulässige Dauer der Freiheitsentziehung zu bestimmen; sie darf nicht<br />
mehr als zwei Wochen betragen.<br />
Bay PAG Art. 21 Durchsuchung von Personen<br />
(1) Die Polizei kann, außer in den Fällen des Art. 13 Abs. 2 Satz 4 eine Person<br />
durchsuchen, wenn<br />
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Sachen mit sich führt,<br />
die sichergestellt werden dürfen,<br />
2. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung<br />
ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet,<br />
3. sie sich an einem der in Art. 13 Abs. 1 Nrn. 2 oder 5 genannten Ort<br />
aufhält oder<br />
4. sie sich in einem Objekt im Sinn des Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen<br />
unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß<br />
in oder an Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen.<br />
(2) Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach diesem Gesetz oder<br />
anderen Rechtsvorschriften festgestellt werden soll oder die nach diesem<br />
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten werden kann, nach<br />
Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosionsmitteln<br />
durchsuchen, wenn dies nach den Umständen zum Schutz des<br />
Polizeibeamten oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben<br />
erforderlich ist.<br />
(3) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten<br />
durchsucht werden; dies gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum<br />
Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.<br />
Bay PAG Art. 22 Durchsuchung von Sachen<br />
(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des Art. 13 Abs. 2 Satz 4 eine Sache<br />
durchsuchen, wenn<br />
1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach Art. 21 durchsucht<br />
werden darf,<br />
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Person<br />
befindet, die<br />
a) in Gewahrsam genommen werden darf,<br />
b) widerrechtlich festgehalten wird oder<br />
c) hilflos ist,<br />
3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine andere Sache<br />
befindet, die sichergestellt werden darf,<br />
4. sie sich an einem der in Art. 13 Abs. 1 Nrn. 2 oder 5 genannten Ort<br />
befindet oder<br />
5. sie sich in einem Objekt im Sinn des Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen
unmittelbarer Nähe befindet und Tatsachen die Annahme rechtfertigen,<br />
daß Straftaten in oder an Objekten dieser Art begangen werden sollen,<br />
6. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich<br />
eine Person befindet, deren Identität nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 festgestellt<br />
werden darf; die Durchsuchung kann sich auch auf die in dem Fahrzeug<br />
enthaltenen Sachen erstrecken.<br />
(2) 1 Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tatsächlichen<br />
Gewalt das Recht, anwesend zu sein. 2 Ist er abwesend, so sollen sein<br />
Vertreter oder ein anderer Zeuge hinzugezogen werden. 3 Dem Inhaber<br />
der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die<br />
Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen.<br />
Bay PAG Art. 23 Betreten und Durchsuchen von Wohnungen<br />
(1) 1 Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers betreten<br />
und durchsuchen, wenn<br />
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Person<br />
befindet, die nach Art. 15 Abs. 3 vorgeführt oder nach Art. 17 in<br />
Gewahrsam genommen werden darf,<br />
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Sache<br />
befindet, die nach Art. 25 Nr. 1 sichergestellt werden darf, oder<br />
3. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder<br />
Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich<br />
ist.<br />
2<br />
Die Wohnung umfaßt die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebsund<br />
Geschäftsräume sowie anderes befriedetes Besitztum.<br />
(2) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 StPO) ist das Betreten und<br />
Durchsuchen einer Wohnung in den Fällen des Absatzes 1 nur zur Abwehr<br />
einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person<br />
oder für Sachen von bedeutendem Wert zulässig.<br />
(3) Wohnungen dürfen jedoch zur Abwehr dringender Gefahren jederzeit<br />
betreten werden, wenn<br />
1. aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, daß dort<br />
a) Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben,<br />
b) sich Personen ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen oder<br />
c) sich Straftäter verbergen, oder<br />
2. sie der Prostitution dienen.<br />
(4) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und<br />
Grundstücke, die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren<br />
und den Anwesenden zum weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen,<br />
dürfen zum Zweck der Gefahrenabwehr (Art. 2 Abs.1) während der<br />
Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeit betreten werden.<br />
Bay PAG Art. 24 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen<br />
(1) 1 Durchsuchungen von Wohnungen dürfen, außer bei Gefahr im Verzug,<br />
nur durch den Richter angeordnet werden. 2 Zuständig ist das<br />
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. 3 Für das Verfahren<br />
gelten die Vorschriften des <strong>Gesetze</strong>s über das Verfahren in Familiensachen<br />
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend; die<br />
Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.
(2) 1 Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der Wohnungsinhaber das<br />
Recht, anwesend zu sein. 2 Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein<br />
Vertreter oder ein erwachsener Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar<br />
zuzuziehen.<br />
(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist der Grund der<br />
Durchsuchung unverzüglich bekanntzugeben, soweit dadurch der Zweck<br />
der Maßnahme nicht gefährdet wird.<br />
(4) 1 Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. 2 Sie muß die<br />
verantwortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und<br />
ihr Ergebnis enthalten. 3 Die Niederschrift ist von einem durchsuchenden<br />
Beamten und dem Wohnungsinhaber oder der zugezogenen Person zu<br />
unterzeichnen. 4 Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein<br />
Vermerk aufzunehmen. 5 Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist<br />
auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen.<br />
(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift<br />
nach den besonderen Umständen des Falls nicht möglich oder würde sie<br />
den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind dem Betroffenen<br />
lediglich die Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen Dienststelle<br />
sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen.<br />
Bay PAG Art. 25 Sicherstellung<br />
Die Polizei kann eine Sache sicherstellen<br />
1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren,<br />
2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen<br />
Gewalt vor Verlust oder Beschädigung einer Sache zu schützen, oder<br />
3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz oder<br />
anderen Rechtsvorschriften festgehalten wird, und diese Person die Sache<br />
verwenden kann, um<br />
a) sich zu töten oder zu verletzen,<br />
b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,<br />
c) fremde Sachen zu beschädigen oder<br />
d) sich oder anderen die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern.<br />
Bay PAG Art. 26 Verwahrung<br />
(1) 1 Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. 2 Läßt die<br />
Beschaffenheit der Sachen das nicht zu oder erscheint die Verwahrung bei<br />
der Polizei unzweckmäßig, sind die Sachen auf andere geeignete Weise<br />
aufzubewahren oder zu sichern. 3 In diesem Fall kann die Verwahrung<br />
auch einem Dritten übertragen werden.<br />
(2) 1 Dem Betroffenen ist eine Bescheinigung auszustellen, die den Grund der<br />
Sicherstellung erkennen läßt und die sichergestellten Sachen bezeichnet.<br />
2<br />
Kann nach den Umständen des Falls eine Bescheinigung nicht ausgestellt<br />
werden, so ist über die Sicherstellung eine Niederschrift aufzunehmen, die<br />
auch erkennen läßt, warum eine Bescheinigung nicht ausgestellt worden<br />
ist. 3 Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen<br />
Gewalt ist unverzüglich zu unterrichten.
(3) 1 Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so hat die Polizei nach<br />
Möglichkeit Wertminderungen vorzubeugen. 2 Das gilt nicht, wenn die<br />
Sache durch den Dritten auf Verlangen eines Berechtigten verwahrt wird.<br />
(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu kennzeichnen, daß<br />
Verwechslungen vermieden werden.<br />
Bay PAG Art. 27 Verwertung, Vernichtung<br />
(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn<br />
1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht,<br />
2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen<br />
Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist,<br />
3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, daß<br />
weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung<br />
ausgeschlossen sind,<br />
4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an einen Berechtigten<br />
herausgegeben werden kann, ohne daß die Voraussetzungen der<br />
Sicherstellung erneut eintreten würden, oder<br />
5. der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausreichend bemessenen Frist<br />
abholt, obwohl ihm eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis<br />
zugestellt worden ist, daß die Sache verwertet wird, wenn sie nicht<br />
innerhalb der Frist abgeholt wird.<br />
(2) 1 Der Betroffene, der Eigentümer und andere Personen, denen ein Recht<br />
an der Sache zusteht, sollen vor der Verwertung gehört werden. 2 Die<br />
Anordnung sowie Zeit und Ort der Verwertung sind ihnen mitzuteilen,<br />
soweit die Umstände und der Zweck der Maßnahme es erlauben.<br />
(3) 1 Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1<br />
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. 2 Bleibt die Versteigerung<br />
erfolglos, erscheint sie von vornherein aussichtslos oder würden die<br />
Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu erwartenden Erlös<br />
übersteigen, so kann die Sache freihändig verkauft werden. 3 Der Erlös<br />
tritt an die Stelle der verwerteten Sache. 4 Läßt sich innerhalb<br />
angemessener Frist kein Käufer finden, so kann die Sache einem<br />
gemeinnützigen Zweck zugeführt werden.<br />
(4) 1 Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder vernichtet<br />
werden, wenn<br />
1. im Fall einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung<br />
berechtigten, fortbestehen oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen<br />
würden, oder<br />
2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist.<br />
2<br />
Absatz 2 gilt sinngemäß.<br />
Bay PAG Art. 28 Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses,<br />
Kosten<br />
(1) 1 Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, sind<br />
die Sachen an denjenigen herauszugeben, bei dem sie sichergestellt<br />
worden sind. 2 Ist die Herausgabe an ihn nicht möglich, können sie an<br />
einen anderen herausgegeben werden, der seine Berechtigung glaubhaft<br />
macht. 3 Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die<br />
Voraussetzungen für eine Sicherstellung eintreten würden.
(2) 1 Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. 2 Ist ein<br />
Berechtigter nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach<br />
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu hinterlegen. 3 Der<br />
Anspruch des Berechtigten auf Herausgabe des Erlöses erlischt drei Jahre<br />
nach Ablauf des Jahres, in dem die Sache verwertet worden ist.<br />
(3) 1 Für die Sicherstellung, Verwertung und für Maßnahmen nach Art. 27<br />
Abs. 4 werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 2 Die Kosten<br />
und die Benutzungsgebühren für die Verwahrung haben die nach Art. 7<br />
oder 8 Verantwortlichen zu tragen. 3 Die Herausgabe der Sache kann von<br />
der Zahlung der geschuldeten Beträge abhängig gemacht werden; ist eine<br />
Sache verwertet worden, so können die geschuldeten Beträge aus dem<br />
Erlös gedeckt werden. 4 Im übrigen gilt das Kostengesetz.<br />
(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.<br />
Bay PAG Art. 29 Befugnisse für Aufgaben der Grenzkontrolle und<br />
Sicherung von Anlagen<br />
(1) Soweit es zur Erfüllung der grenzpolizeilichen Aufgaben nach Art. 4 Abs. 3<br />
des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) erforderlich ist, kann die Polizei<br />
1. Grundstücke mit Ausnahme von Gebäuden betreten und befahren,<br />
2. verlangen, daß Grundstückseigentümer und -besitzer einen Grenzpfad<br />
freilassen, an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, oder<br />
Wassergräben überbrücken,<br />
3. auf eigene Kosten Grenzpfade, Durchlässe, Übergänge oder Brücken<br />
einrichten oder verbessern.<br />
(2) Die im grenzüberschreitenden Reiseverkehr tätigen Verkehrsunternehmen<br />
einschließlich der Verkehrsverwaltungen sind verpflichtet,<br />
1. den mit der polizeilichen Kontrolle ihres grenzüberschreitenden<br />
Verkehrs betrauten Beamten den Zutritt zu ihren Anlagen und<br />
Beförderungsmitteln unentgeltlich zu gestatten,<br />
2. sie bei dieser Tätigkeit unentgeltlich zu befördern,<br />
3. den für die polizeiliche Kontrolle ihres grenzüberschreitenden Verkehrs<br />
zuständigen Dienststellen Fahr- und Flugpläne rechtzeitig mitzuteilen,<br />
4. den in Nummer 3 genannten Dienststellen und den mit der Sicherung<br />
von Verkehrsanlagen betrauten Beamten die erforderlichen Diensträume<br />
und Parkplätze für die Dienstkraftfahrzeuge der Polizei zur Verfügung zu<br />
stellen. Die Unternehmen und Verkehrsverwaltungen können verlangen,<br />
daß ihnen ihre Selbstkosten vergütet werden, soweit sie diese<br />
Einrichtungen nicht ohnehin benötigen. Soweit ein Aufwand über das Maß<br />
hinausgeht, das für polizeieigene Einrichtungen üblich ist, wird er nicht<br />
vergütet.
III. ABSCHNITT Datenerhebung und -verarbeitung<br />
1. Unterabschnitt Datenerhebung<br />
Bay PAG Art. 30 Grundsätze der Datenerhebung<br />
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten nur erheben, soweit dies durch<br />
dieses Gesetz oder besondere Rechtsvorschriften über die Datenerhebung<br />
der Polizei zugelassen ist.<br />
(2) 1 Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei dem Betroffenen zu<br />
erheben. 2 Personenbezogene Daten des Betroffenen können auch bei<br />
Behörden, öffentlichen Stellen oder bei Dritten erhoben werden, wenn die<br />
Datenerhebung beim Betroffenen nicht oder nur mit unverhältnismäßig<br />
hohem Aufwand möglich ist oder die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben<br />
gefährden würde.<br />
(3) 1 Personenbezogene Daten sind von der Polizei grundsätzlich offen zu<br />
erheben. 2 Eine Datenerhebung, die nicht als polizeiliche Maßnahme<br />
erkennbar sein soll, ist zulässig, wenn die Erfüllung polizeilicher Aufgaben<br />
auf andere Weise gefährdet oder erheblich erschwert würde oder wenn<br />
anzunehmen ist, daß dies den überwiegenden Interessen des Betroffenen<br />
entspricht.<br />
(4) 1 Werden Daten beim Betroffenen oder bei Dritten offen erhoben, sind<br />
diese auf Verlangen in geeigneter Weise hinzuweisen auf<br />
1. die Rechtsgrundlage der Datenerhebung,<br />
2. eine im Einzelfall bestehende gesetzliche Auskunftspflicht oder die<br />
Freiwilligkeit der Auskunft.<br />
2<br />
Der Hinweis kann zunächst unterbleiben, wenn hierdurch die Erfüllung<br />
der polizeilichen Aufgabe oder die schutzwürdigen Belange Dritter<br />
beeinträchtigt oder gefährdet würden.<br />
(5) 1 Schwerwiegende Straftaten im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind<br />
1. Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und der Gefährdung<br />
des demokratischen Rechtsstaates oder des Landesverrats und der<br />
Gefährdung der äußeren Sicherheit<br />
(§§ 80, 81, 82; §§ 94, 96 Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit § 97 b;<br />
§§ 97 a, 98 Abs. 1 Satz 2, § 99 Abs. 2, §§ 100, 100 a Abs. 4 StGB),<br />
2. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung<br />
(§ 129 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4, §§ 129 a, 129 b StGB),<br />
3. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§ 176 Abs. 1 und 2,<br />
§§ 176 a, 177, 184 b Abs. 1 bis 3 StGB),<br />
4. Straftaten gegen das Leben<br />
(§§ 211, 212 StGB, § 6 Völkerstrafgesetzbuch),<br />
5. Straftaten gegen die persönliche Freiheit<br />
(§§ 232, 233, 233 a Abs. 2, §§ 234, 234 a Abs. 1, §§ 239a, 239 b StGB),<br />
6. gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306 b, 307<br />
Abs. 1 und 2, § 308 Abs. 1, § 309 Abs. 1, § 310 Abs. 1, § 313 Abs. 1,<br />
§ 314 Abs. 1, § 315 Abs. 3, § 315 b Abs. 3, §§ 316 a, 316 c StGB,<br />
7. Verbrechen gegen die Menschlichkeit<br />
(§ 7 Völkerstrafgesetzbuch), Kriegsverbrechen (§§ 8 bis 12<br />
Völkerstrafgesetzbuch),<br />
8. Straftaten nach § 51 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, § 52 Abs. 1 Nr. 1
in Verbindung mit Abs. 5 des Waffengesetzes oder nach § 19 Abs. 2, § 20<br />
Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit § 21 des <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
Kontrolle von Kriegswaffen,<br />
9. Straftaten nach § 22 a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s<br />
über die Kontrolle von Kriegswaffen, soweit offensichtlich ist, dass keine<br />
Genehmigung oder behördliche Erlaubnis erteilt werden kann, und<br />
10. Straftaten nach § 30 a des Betäubungsmittelgesetzes oder § 30 b des<br />
Betäubungsmittelgesetzes in Verbindung mit § 129 Abs. 4 StGB, soweit<br />
offensichtlich ist, dass keine Genehmigung oder behördliche Erlaubnis<br />
erteilt werden kann,<br />
unter der Voraussetzung, dass die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt.<br />
2 Straftaten von erheblicher Bedeutung sind über die in Satz 1 Halbsatz 1<br />
genannten hinaus insbesondere Verbrechen, die in § 138 StGB genannten<br />
Vergehen sowie die gewerbs- oder bandenmäßig begangenen Vergehen<br />
nach<br />
1. den §§ 243, 244, 253, 260, 263 a, 265 b, 266, 283, 283 a, 291 oder<br />
§§ 324 bis 330 a StGB,<br />
2. § 52 Abs. 1 Nr. 1 des Waffengesetzes,<br />
3. § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder § 29 a Abs. 1 Nr. 2 des<br />
Betäubungsmittelgesetzes,<br />
4. § 96 des Aufenthaltsgesetzes.<br />
Bay PAG Art. 31 Datenerhebung<br />
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten über die in Art. 7, 8 und 10<br />
genannten Personen und über andere Personen erheben, wenn dies<br />
erforderlich ist<br />
1. zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämpfung von<br />
Straftaten (Art. 2 Abs. 1),<br />
2. zum Schutz privater Rechte (Art. 2 Abs. 2),<br />
3. zur Vollzugshilfe (Art. 2 Abs. 3) oder<br />
4. zur Erfüllung ihr durch andere Rechtsvorschriften übertragener<br />
Aufgaben (Art. 2 Abs. 4)<br />
und die Art. 11 bis 48 die Befugnisse der Polizei nicht besonders regeln.<br />
(2) Die Polizei kann ferner über<br />
1. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine<br />
erhebliche Gefahr ausgehen kann,<br />
2. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen,<br />
3. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit,<br />
4. Personen, deren besondere Kenntnisse und Fähigkeiten zur<br />
Gefahrenabwehr benötigt werden,<br />
Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern<br />
und andere Informationen über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben<br />
über die Zugehörigkeit zu einer der genannten Personengruppen erheben,<br />
soweit dies zur Vorbereitung für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen<br />
erforderlich ist.
Bay PAG Art. 32 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und<br />
Ansammlungen sowie an besonders gefährdeten Objekten<br />
(1) 1 Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen<br />
Veranstaltungen oder Ansammlungen personenbezogene Daten auch<br />
durch den Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und<br />
Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen über die für eine Gefahr<br />
Verantwortlichen erheben, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme<br />
rechtfertigen, daß dabei Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung<br />
oder Straftaten begangen werden. 2 Die Maßnahmen dürfen auch<br />
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.<br />
(2) 1 Die Polizei kann<br />
1. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr<br />
2. an den in Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 genannten Orten, wenn sie öffentlich<br />
zugänglich sind, oder<br />
3. an Orten, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme<br />
rechtfertigen, dass dort Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung<br />
begangen werden, wenn diese Orte öffentlich zugänglich sind,<br />
offen Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen<br />
anfertigen. 2 In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3 soll in geeigneter<br />
Weise auf die Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen hingewiesen<br />
werden.<br />
(3) Die Polizei kann an oder in den in Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 genannten Objekten<br />
Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen anfertigen,<br />
soweit tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, daß an oder<br />
in Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die<br />
Personen, diese Objekte oder andere darin befindliche Sachen gefährdet<br />
sind.<br />
(4) Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen und daraus gefertigte<br />
Unterlagen sind spätestens drei Wochen nach der Datenerhebung zu<br />
löschen oder zu vernichten, soweit diese nicht zur Verfolgung von<br />
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten benötigt<br />
werden.<br />
(5) Für Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen durch die Polizei bei<br />
oder im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen und Aufzügen<br />
gilt Art. 9 BayVersG.<br />
Bay PAG Art. 33 Besondere Mittel der Datenerhebung<br />
(1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind<br />
1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchgehend<br />
länger als 24 Stunden oder an mehr als zwei Tagen durchgeführt werden<br />
soll (längerfristige Observation),<br />
2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel<br />
a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen,<br />
b) zur Feststellung des <strong>Stand</strong>ortes oder der Bewegungen einer Person<br />
oder einer beweglichen Sache,<br />
c) zum Abhören oder zur Aufzeichnung des nichtöffentlich gesprochenen<br />
Wortes,
3. der Einsatz von Polizeibeamten unter einer Legende (Verdeckte<br />
Ermittler).<br />
(2) 1 Die längerfristige Observation oder der verdeckte Einsatz technischer<br />
Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen ist<br />
zulässig, wenn die Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe auf andere Weise<br />
gefährdet oder erheblich erschwert würde. 2 Darüber hinaus kann die<br />
Polizei unbeschadet des Art. 30 Abs. 3 Satz 2 durch den verdeckten<br />
Einsatz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme bei Vorliegen<br />
entsprechender Lageerkenntnisse in den Fällen des Art. 13 Abs. 1 Nrn. 1<br />
bis 5 Kennzeichen von Kraftfahrzeugen sowie Ort, Datum, Uhrzeit und<br />
Fahrtrichtung erfassen. 3 Zulässig ist der Abgleich der Kennzeichen mit<br />
polizeilichen Fahndungsbeständen, die erstellt wurden<br />
1. über Kraftfahrzeuge oder Kennzeichen, die durch Straftaten oder sonst<br />
abhanden gekommen sind,<br />
2. über Personen, die ausgeschrieben sind<br />
a) zur polizeilichen Beobachtung, gezielten Kontrolle oder verdeckten<br />
Registrierung,<br />
b) aus Gründen der Strafverfolgung, Strafvollstreckung, Auslieferung oder<br />
Überstellung,<br />
c) zum Zweck der Durchführung ausländerrechtlicher Maßnahmen,<br />
d) wegen gegen sie veranlasster polizeilicher Maßnahmen der<br />
Gefahrenabwehr.<br />
4<br />
Ein Abgleich mit polizeilichen Dateien, die zur Abwehr von im Einzelfall<br />
oder im Hinblick auf bestimmte Ereignisse allgemein bestehenden<br />
Gefahren errichtet wurden, ist nur zulässig, wenn dies zur Abwehr einer<br />
solchen Gefahr erforderlich ist und diese Gefahr Anlass für die<br />
Kennzeichenerfassung war. 5 Die Kennzeichenerfassung darf nicht<br />
flächendeckend eingesetzt werden.<br />
(3) Die Polizei kann durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur<br />
Feststellung des <strong>Stand</strong>ortes oder der Bewegungen einer Person oder einer<br />
beweglichen Sache oder zum Abhören und zur Aufzeichnung des<br />
nichtöffentlich gesprochenen Wortes oder durch Verdeckte Ermittler<br />
personenbezogene Daten erheben<br />
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den<br />
Voraussetzungen des Art. 10 über die dort genannten Personen, wenn<br />
dies erforderlich ist zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die<br />
Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leben, Gesundheit oder<br />
Freiheit einer Person oder für Sachen, deren Erhaltung im öffentlichen<br />
Interesse geboten erscheint, oder<br />
2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß diese<br />
Personen eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen wollen, sowie<br />
über deren Kontakt- und Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung zur<br />
vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.<br />
(4) Datenerhebungen nach den Absätzen 2 und 3 dürfen auch durchgeführt<br />
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.<br />
(5) 1 Der Einsatz von Mitteln nach Abs. 1, ausgenommen die Anfertigung von<br />
Bildaufnahmen, darf nur vom Leiter eines Präsidiums der Landespolizei<br />
oder des Landeskriminalamts angeordnet werden. 2 Die<br />
Anordnungsbefugnis kann auf Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes
übertragen werden. 3 Der verdeckte Einsatz technischer Mittel<br />
ausschließlich zum Schutz der bei einem Einsatz tätigen Personen kann<br />
bei Gefahr im Verzug auch durch einen vom Leiter eines Präsidiums der<br />
Landespolizei oder des Landeskriminalamts bestellten Beauftragten der<br />
Behörde angeordnet werden. 4 Die Anordnung hat schriftlich unter Angabe<br />
der für sie maßgeblichen Gründe zu erfolgen und ist zu befristen. 5 Die<br />
Verlängerung der Maßnahme bedarf einer neuen Anordnung.<br />
(6) Für den Einsatz der in Abs. 1 genannten Mittel gilt Art. 34 c Abs. 4 Sätze 3<br />
bis 5 und Abs. 6 entsprechend.<br />
(7) 1 Von Maßnahmen nach Abs. 1 sind<br />
1. die Adressaten der Maßnahme sowie<br />
2. diejenigen, deren personenbezogene Daten im Rahmen einer solchen<br />
Maßnahme erhoben und verwendet wurden,<br />
zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme,<br />
der eingesetzten nicht offen ermittelnden Beamten oder der in Abs. 3<br />
genannten Rechtsgüter geschehen kann. 2 Ist wegen desselben<br />
Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den<br />
Betroffenen eingeleitet worden, ist die Unterrichtung in Abstimmung mit<br />
der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der <strong>Stand</strong> des<br />
Ermittlungsverfahrens zulässt. 3 Erfolgt die Benachrichtigung nicht binnen<br />
eines Jahres nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die weitere<br />
Zurückstellung der richterlichen Zustimmung. 4 Art. 34 Abs. 6 Sätze 4 bis<br />
6 gelten entsprechend.<br />
Bay PAG Art. 34 Besondere Bestimmungen über den Einsatz<br />
technischer Mittel in Wohnungen<br />
(1) 1 Die Polizei kann durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder<br />
aus Wohnungen (Art. 23 Abs. 1 Satz 2) personenbezogene Daten über die<br />
für eine Gefahr Verantwortlichen erheben, wenn dies erforderlich ist zur<br />
Abwehr einer dringenden Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des<br />
Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person.<br />
2 Eine Maßnahme nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn und soweit<br />
1. die dort genannten Gefahren nicht anders abgewehrt werden können<br />
und<br />
2. für den Fall, dass zu privaten Wohnzwecken genutzte Räumlichkeiten<br />
betroffen sind, in denen sich die Person, gegen die sich die Maßnahme<br />
richtet, allein oder ausschließlich mit engsten Familienangehörigen, mit in<br />
gleicher Weise Vertrauten oder mit Berufsgeheimnisträgern nach §§ 53,<br />
53 a StPO aufhält,<br />
a) tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass Gespräche<br />
geführt werden, die einen unmittelbaren Bezug zu den in Satz 1<br />
genannten Gefahren haben, ohne dass über ihren Inhalt das Zeugnis als<br />
Geistlicher, Verteidiger, Rechtsanwalt, Arzt, Berater für Fragen der<br />
Betäubungsmittelabhängigkeit, Psychologischer Psychotherapeut oder<br />
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nach §§ 53, 53 a StPO<br />
verweigert werden könnte, oder<br />
b) die Maßnahme sich auch gegen die Familienangehörigen, Vertrauten<br />
oder Berufsgeheimnisträger richtet, und<br />
3. für den Fall, dass sich die Maßnahme gegen einen
Berufsgeheimnisträger nach §§ 53, 53 a StPO selbst richtet und die zu<br />
seiner Berufsausübung bestimmten Räumlichkeiten betroffen sind, die<br />
Voraussetzungen der Nr. 2 Buchst. a vorliegen.<br />
(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 ist eine nur automatische<br />
Aufzeichnung nicht zulässig; wird bei einer Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1<br />
erkennbar, dass Gespräche geführt werden, die dem Kernbereich der<br />
privaten Lebensgestaltung zuzurechnen sind, und bestehen keine<br />
Anhaltspunkte dafür, dass sie dem Zweck der Herbeiführung eines<br />
Erhebungsverbots dienen sollen, ist die Datenerhebung unverzüglich und<br />
so lange erforderlich zu unterbrechen.<br />
(3) 1 Die Maßnahme darf nur in den Wohnungen des Adressaten durchgeführt<br />
werden. 2 In Wohnungen anderer Personen ist die Maßnahme zulässig,<br />
wenn es nicht Wohnungen von Berufsgeheimnisträgern nach §§ 53, 53 a<br />
StPO sind und auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass<br />
1. der in der Anordnung bezeichnete Adressat sich dort aufhält und<br />
2. die Maßnahme in Wohnungen des Adressaten allein zur Abwehr der<br />
Gefahr oder der Straftat nicht möglich oder nicht ausreichend ist.<br />
3<br />
Die Erhebung personenbezogener Daten über andere als die in Satz 1<br />
genannten Personen ist zulässig, soweit sie unvermeidliche Folge einer<br />
Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 ist.<br />
(4) 1 Eine Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 darf nur durch den Richter<br />
angeordnet werden, bei Gefahr im Verzug auch durch die in Art. 33 Abs. 5<br />
Satz 1 genannten Dienststellenleiter; in diesem Fall ist unverzüglich eine<br />
Bestätigung der Maßnahme durch einen Richter einzuholen. 2 Für die<br />
richterliche Anordnung ist Art. 24 Abs. 1 Satz 3 entsprechend<br />
anzuwenden; zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die<br />
beantragende Polizeidienststelle ihren Sitz hat. 3 In der schriftlichen<br />
Anordnung sind Adressat, Art, Umfang und Dauer der Maßnahme zu<br />
bestimmen und die wesentlichen Gründe anzugeben. 4 Die Maßnahme ist<br />
auf höchstens einen Monat zu befristen und kann um jeweils nicht mehr<br />
als einen Monat verlängert werden. 5 Ungeachtet des in der Anordnung<br />
genannten Zeitraums ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden, wenn<br />
die in Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht mehr fortbestehen;<br />
die Beendigung ist dem Richter mitzuteilen.<br />
(5) 1 Die durch eine Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 erlangten<br />
personenbezogenen Daten sind besonders zu kennzeichnen. 2 Sie dürfen<br />
nur verwendet werden<br />
1. zu den in Abs. 1 Satz 1 genannten Zwecken sowie<br />
2. zu Zwecken der Strafverfolgung, wenn sie nach § 100 d Abs. 5 Nr. 3<br />
StPO verwendet werden dürfen; eine Zweckänderung ist festzustellen und<br />
zu dokumentieren.<br />
3<br />
Daten, bei denen sich nach Auswertung herausstellt, dass<br />
1. die Voraussetzungen für ihre Erhebung nicht vorgelegen haben oder<br />
2. sie Inhalte betreffen, über die das Zeugnis als Geistlicher, Verteidiger,<br />
Rechtsanwalt, Arzt, Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit,<br />
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und<br />
Jugendlichenpsychotherapeut nach §§ 53, 53 a StPO verweigert werden<br />
könnte oder<br />
3. sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem
Vertrauensverhältnis mit anderen Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen<br />
sind und keinen unmittelbaren Bezug zu den in Abs. 1 Satz 1 genannten<br />
Gefahren haben,<br />
dürfen nicht verwendet werden, es sei denn, ihre Verwendung ist zur<br />
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer<br />
Person erforderlich und Daten im Sinn der Nr. 2 oder 3 sind nicht<br />
betroffen. 4 Vor einer Verwendung der Daten ist über deren Zulässigkeit<br />
eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. 5 Bei Gefahr im Verzug<br />
kann die Entscheidung auch eine in Art. 33 Abs. 5 Sätze 1 und 2 genannte<br />
Stelle treffen; in diesem Fall ist eine richterliche Entscheidung<br />
unverzüglich nachzuholen. 6 Für die richterliche Entscheidung ist Abs. 4<br />
Satz 2 entsprechend anzuwenden.<br />
(6) 1 Die Betroffenen sind von Maßnahmen nach Abs. 1 Satz 1 zu unterrichten,<br />
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme, der<br />
eingesetzten nicht offen ermittelnden Beamten oder der in Abs. 1 Satz 1<br />
genannten Rechtsgüter geschehen kann. 2 Ist wegen desselben<br />
Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den<br />
Betroffenen eingeleitet worden, ist die Unterrichtung in Abstimmung mit<br />
der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der <strong>Stand</strong> des<br />
Ermittlungsverfahrens zulässt. 3 Erfolgt die Benachrichtigung nicht binnen<br />
sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die weitere<br />
Zurückstellung der richterlichen Zustimmung. 4 Die richterliche<br />
Entscheidung ist vorbehaltlich einer anderen richterlichen Anordnung<br />
jeweils nach einem Jahr erneut einzuholen. 5 Eine Unterrichtung kann mit<br />
richterlicher Zustimmung auf Dauer unterbleiben, wenn<br />
1. überwiegende Interessen eines Betroffenen entgegenstehen oder<br />
2. die Identität oder der Aufenthaltsort eines Betroffenen nur mit<br />
unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann.<br />
6<br />
Die gerichtliche Zuständigkeit und das Verfahren richten sich im Fall des<br />
Satzes 2 nach den Regelungen der Strafprozessordnung, im Übrigen gilt<br />
Abs. 4 Satz 2 entsprechend.<br />
(7) 1 Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind<br />
und nicht verwendet werden dürfen, sind unverzüglich zu löschen; die<br />
Löschung ist zu dokumentieren. 2 Die durch eine Maßnahme nach Abs. 1<br />
Satz 1 erlangten personenbezogenen Daten,<br />
1. deren Verwendung zu den in Abs. 5 Satz 2 genannten Zwecken nicht<br />
erforderlich ist oder<br />
2. für die ein Verwendungsverbot besteht,<br />
sind zu sperren, wenn sie zum Zweck der Information der Betroffenen und<br />
zur gerichtlichen Überprüfung der Erhebung oder Verwendung der Daten<br />
noch benötigt werden; andernfalls sind sie zu löschen. 3 Im Fall der<br />
Unterrichtung des Betroffenen sind die Daten zu löschen, wenn der<br />
Betroffene sich nicht innerhalb eines Monats nach seiner Benachrichtigung<br />
mit Rechtsbehelf gegen die Maßnahme gewendet hat; auf diese Frist ist in<br />
der Benachrichtigung hinzuweisen. 4 Im Fall eines Rechtsbehelfs nach<br />
Satz 2 sind die Daten nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens zu<br />
löschen.<br />
(8) 1 Die Anordnung eines verdeckten Einsatzes technischer Mittel in oder aus<br />
Wohnungen ausschließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz
tätigen Personen obliegt den in Art. 33 Abs. 5 Sätze 1 bis 3 genannten<br />
Stellen. 2 Eine anderweitige Verwendung der hierbei erlangten<br />
Erkenntnisse zu Zwecken der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung ist<br />
nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich<br />
festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung<br />
unverzüglich nachzuholen. 3 Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende<br />
Anwendung. 4 Die Abs. 5 bis 7 gelten im Fall der Verwendung der Daten<br />
entsprechend. 5 Aufzeichnungen aus einem solchen Einsatz sind<br />
unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu löschen, soweit sie nicht<br />
zur Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr benötigt werden.<br />
(9) 1 Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag jährlich über den nach<br />
Abs. 1 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Abs. 8 erfolgten<br />
Einsatz technischer Mittel. 2 Ein vom Landtag gewähltes Gremium übt auf<br />
der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus.<br />
(10) Das Brief- und das Postgeheimnis bleiben unberührt.<br />
Bay PAG Art. 34 a Datenerhebung und Eingriffe in den<br />
Telekommunikationsbereich<br />
(1) 1 Die Polizei kann durch die Überwachung und Aufzeichnung der<br />
Telekommunikation personenbezogene Daten erheben<br />
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen, soweit dies zur Abwehr einer<br />
dringenden Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder<br />
eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für<br />
Sachen, soweit eine gemeine Gefahr besteht, erforderlich ist, oder<br />
2. über Personen, soweit bestimmte Tatsachen die begründete Annahme<br />
rechtfertigen, dass<br />
a) sie für Personen nach Nr. 1 bestimmte oder von diesen herrührende<br />
Mitteilungen entgegennehmen, ohne insoweit das Recht zur Verweigerung<br />
des Zeugnisses nach §§ 53, 53 a StPO zu haben, oder weitergeben oder<br />
b) die unter Nr. 1 genannten Personen ihre Kommunikationseinrichtungen<br />
benutzen werden.<br />
2<br />
Datenerhebungen nach Satz 1 dürfen nur durchgeführt werden, wenn die<br />
Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe auf andere Weise aussichtslos oder<br />
wesentlich erschwert wäre. 3 Wird erkennbar, dass in ein durch ein<br />
Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinn der §§ 53,<br />
53 a StPO eingegriffen wird, ist die Datenerhebung insoweit unzulässig, es<br />
sei denn, die Maßnahme richtet sich gegen den Berufsgeheimnisträger<br />
selbst. 4 Wird erkennbar, dass dem Kernbereich privater Lebensgestaltung<br />
zuzurechnende Daten betroffen sind und bestehen keine Anhaltspunkte<br />
dafür, dass diese Daten dem Zweck der Herbeiführung eines<br />
Erhebungsverbots dienen sollen, ist die Datenerhebung insoweit<br />
unzulässig.<br />
(2) 1 Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 auch technische<br />
Mittel einsetzen, um<br />
1. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Abs. 1 spezifische Kennungen,<br />
insbesondere die Geräte- und Kartennummer von Mobilfunkendgeräten,<br />
sowie<br />
2. den <strong>Stand</strong>ort eines Mobilfunkendgerätes zu ermitteln.<br />
2<br />
Personenbezogene Daten Dritter dürfen dabei nur erhoben werden, wenn
dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. 3 Nach Beendigung der<br />
Maßnahme sind diese unverzüglich zu löschen.<br />
(3) 1 Die Polizei kann bei Gefahr für Leben oder Gesundheit einer Person<br />
1. durch die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation<br />
personenbezogene Daten über diese Person erheben oder<br />
2. technische Mittel einsetzen, um den <strong>Stand</strong>ort eines von ihr<br />
mitgeführten Mobilfunkendgerätes zu ermitteln.<br />
2<br />
Weitergehende Maßnahmen nach Art. 34 b Abs. 1 und 2 bleiben<br />
unberührt.<br />
(4) 1 Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1<br />
Kommunikationsverbindungen der dort genannten Personen durch den<br />
Einsatz technischer Mittel unterbrechen oder verhindern.<br />
2<br />
Kommunikationsverbindungen Dritter dürfen nur unterbrochen oder<br />
verhindert werden, wenn eine gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben oder<br />
Freiheit einer Person durch andere Mittel nicht abgewehrt werden kann.<br />
Bay PAG Art. 34 b Mitwirkungspflichten der Diensteanbieter<br />
(1) Ist eine Datenerhebung nach Art. 34 a Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 1 Nr. 1<br />
angeordnet, hat jeder, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste<br />
erbringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), nach Maßgabe der<br />
Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der darauf beruhenden<br />
Rechtsverordnungen zur technischen und organisatorischen Umsetzung<br />
von Überwachungsmaßnahmen in der jeweils geltenden Fassung der<br />
Polizei die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation zu<br />
ermöglichen.<br />
(2) 1 Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des Art. 34 a Abs. 1 Satz 1<br />
oder Abs. 3 Satz 1 Diensteanbieter verpflichten,<br />
1. ihr vorhandene Telekommunikationsverkehrsdaten der in Art. 34 a<br />
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 genannten Personen zu übermitteln,<br />
2. Auskunft über deren zukünftige Telekommunikationsverkehrsdaten zu<br />
erteilen oder<br />
3. ihr die für die Ermittlung des <strong>Stand</strong>ortes eines Mobilfunkendgerätes<br />
dieser Personen erforderlichen spezifischen Kennungen, insbesondere die<br />
Geräte und Kartennummer mitzuteilen.<br />
2<br />
Die Übermittlung von Daten über Telekommunikationsverbindungen, die<br />
zu diesen Personen hergestellt worden sind, darf nur angeordnet werden,<br />
wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung ihres<br />
Aufenthaltsorts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert<br />
wäre. 3 Die Daten sind der Polizei unverzüglich zu übermitteln.<br />
(3) Telekommunikationsverkehrsdaten sind alle nicht inhaltsbezogenen Daten,<br />
die im Zusammenhang mit einer Telekommunikation auch unabhängig von<br />
einer konkreten Telekommunikationsverbindung technisch erhoben und<br />
erfasst werden, einschließlich der nach § 113 a des<br />
Telekommunikationsgesetzes gespeicherten Daten, insbesondere<br />
1. Berechtigungskennung, Kartennummer, <strong>Stand</strong>ortkennung sowie<br />
Rufnummer oder Kennung des anrufenden und angerufenen Anschlusses<br />
oder der Endeinrichtung,<br />
2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit,<br />
3. vom Kunden in Anspruch genommene
Telekommunikationsdienstleistung,<br />
4. Endpunkte fest geschalteter Verbindungen, ihr Beginn und Ende nach<br />
Datum und Uhrzeit.<br />
(4) Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergütungsund<br />
-entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht<br />
eine Entschädigung nach dem Telekommunikationsgesetz zu gewähren ist.<br />
Bay PAG Art. 34 c Verfahrensregelungen, Verwendungsverbote,<br />
Zweckbindung, Benachrichtigung und Löschung<br />
(1) Für Maßnahmen nach Art. 34 a und Art. 34 b gilt Art. 34 Abs. 4 Sätze 1<br />
und 2 entsprechend; bei Gefahr im Verzug sind die in Art. 33 Abs. 5<br />
Sätze 1 und 2 genannten Stellen anordnungsbefugt.<br />
(2) 1 Soweit eine Maßnahme nach Art. 34 a Abs. 3 ausschließlich dazu dient,<br />
den Aufenthaltsort einer dort genannten Person zu ermitteln, darf sie auch<br />
durch die Dienststellenleiter der in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 POG<br />
genannten Dienststellen oder des Landeskriminalamts angeordnet werden.<br />
2<br />
Diese können die Anordnungsbefugnis auf besonders Beauftragte<br />
übertragen.<br />
(3) 1 Anordnungen nach den Abs. 1 und 2 sind schriftlich zu erlassen und zu<br />
begründen. 2 Die Anordnung muss Namen und Anschrift des Betroffenen,<br />
gegen den sich die Maßnahme richtet, sowie die Rufnummer oder eine<br />
andere Kennung des Telekommunikationsanschlusses oder des Endgerätes<br />
enthalten; im Falle einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder<br />
Freiheit einer Person genügt eine räumlich und zeitlich hinreichende<br />
Bezeichnung der Telekommunikation. 3 In der Anordnung sind Art, Umfang<br />
und Dauer der Maßnahme zu bestimmen. 4 Die Anordnung ist auf den<br />
nachfolgend genannten Zeitraum zu befristen:<br />
1. im Fall des Art. 34 a Abs. 4 Satz 1 höchstens zwei Wochen,<br />
2. im Fall des Art. 34 a Abs. 4 Satz 2 höchstens drei Tage,<br />
3. in allen anderen Fällen höchstens ein Monat.<br />
5<br />
Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als den in Satz 4 genannten<br />
Zeitraum ist möglich, soweit die Voraussetzungen fortbestehen.<br />
6<br />
Bestehen die in Art. 34 a und 34 b bezeichneten Voraussetzungen nicht<br />
fort, ist die Maßnahme unverzüglich zu beendigen; die Beendigung ist<br />
dem Richter mitzuteilen.<br />
(4) 1 Die durch eine Maßnahme nach Art. 34 a und 34 b erlangten<br />
personenbezogenen Daten sind besonders zu kennzeichnen. 2 Sie dürfen<br />
nur verwendet werden<br />
1. zu den Zwecken, zu denen sie erhoben wurden, sowie<br />
2. zu Zwecken der Strafverfolgung, wenn sie zur Verfolgung von<br />
Straftaten im Sinn des § 100 a Abs. 2 StPO benötigt werden; eine<br />
Zweckänderung ist festzustellen und zu dokumentieren.<br />
3<br />
Daten, bei denen sich nach Auswertung herausstellt, dass<br />
1. die Voraussetzungen für ihre Erhebung nicht vorgelegen haben oder<br />
2. sie Inhalte betreffen, über die das Zeugnis als Geistlicher, Verteidiger,<br />
Rechtsanwalt, Arzt, Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit,<br />
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und<br />
Jugendlichenpsychotherapeut nach §§ 53, 53 a StPO verweigert werden<br />
könnte oder
3. sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem<br />
Vertrauensverhältnis mit anderen Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen<br />
sind und keinen unmittelbaren Bezug zu den in Art. 34 a Abs. 1 Satz 1<br />
Nr. 1 genannten Gefahren haben,<br />
dürfen nicht verwendet werden. 4 Dies gilt nicht, wenn ihre Verwendung<br />
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit<br />
erforderlich ist und Daten im Sinn der Nr. 2 oder 3 nicht betroffen sind.<br />
5<br />
In diesen Fällen ist eine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit<br />
der Verwendung unverzüglich nachzuholen; Art. 34 Abs. 4 Satz 2 findet<br />
entsprechende Anwendung.<br />
(5) 1 Von Maßnahmen nach Art. 34 a Abs. 1, 2 und 4 sowie Art. 34 b sind<br />
1. die Personen zu unterrichten, gegen die die Maßnahme gerichtet war,<br />
sowie<br />
2. diejenigen, deren personenbezogene Daten im Rahmen einer solchen<br />
Maßnahme erhoben und zu den Zwecken des Abs. 4 Satz 2 verwendet<br />
wurden.<br />
2<br />
Die Unterrichtung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der<br />
Maßnahme, der eingesetzten nicht offen ermittelnden Beamten oder der in<br />
Art. 34 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 genannten Rechtsgüter geschehen kann.<br />
3<br />
Art. 34 Abs. 6 Sätze 2 bis 6 gelten entsprechend.<br />
(6) 1 Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind<br />
und nicht verwendet werden dürfen, sind unverzüglich zu löschen; die<br />
Löschung ist zu dokumentieren. 2 Die durch eine Maßnahme nach Art. 34 a<br />
oder 34 b erlangten personenbezogenen Daten,<br />
1. deren Verwendung zu den in Abs. 4 Satz 2 genannten Zwecken nicht<br />
erforderlich ist oder<br />
2. für die ein Verwendungsverbot besteht,<br />
sind zu sperren, wenn sie zum Zweck der Information der Betroffenen und<br />
zur gerichtlichen Überprüfung der Erhebung oder Verwendung der Daten<br />
noch benötigt werden; andernfalls sind sie zu löschen. 3 Art. 34 Abs. 7<br />
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.<br />
Bay PAG Art. 34 d Verdeckter Zugriff auf informationstechnische<br />
Systeme<br />
(1) 1 Die Polizei kann mit technischen Mitteln verdeckt auf<br />
informationstechnische Systeme zugreifen, um Zugangsdaten und<br />
gespeicherte Daten zu erheben von Personen,<br />
1. die für eine Gefahr verantwortlich sind, soweit dies zur Abwehr einer<br />
dringenden Gefahr für<br />
a) den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes,<br />
b) Rechtsgüter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der<br />
Existenz der Menschen berührt, oder<br />
c) Leib, Leben oder Freiheit einer Person<br />
erforderlich ist, oder<br />
2. soweit bestimmte Tatsachen die begründete Annahme rechtfertigen,<br />
dass<br />
a) sie für Personen nach Nr. 1 bestimmte oder von diesen herrührende<br />
Mitteilungen entgegennehmen oder entgegengenommen haben, ohne<br />
insoweit das Recht zur Verweigerung des Zeugnisses nach §§ 53, 53 a
StPO zu haben, oder solche Mitteilungen weitergeben oder weitergegeben<br />
haben oder<br />
b) die unter Nr. 1 genannten Personen ihre informationstechnischen<br />
Systeme benutzen oder benutzt haben.<br />
2<br />
Eine Maßnahme nach Satz 1 darf nur durchgeführt werden, wenn die<br />
Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe auf andere Weise aussichtslos oder<br />
wesentlich erschwert wäre. 3 Daten dürfen unter den Voraussetzungen des<br />
Satzes 1 gelöscht werden, wenn eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder<br />
Leben nicht anders abgewehrt werden kann. 4 Wird erkennbar, dass in ein<br />
durch ein Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinn der<br />
§§ 53, 53 a StPO eingegriffen wird, ist die Maßnahme insoweit unzulässig,<br />
es sei denn, sie richtet sich gegen den Berufsgeheimnisträger selbst.<br />
5<br />
Soweit dies informationstechnisch und ermittlungstechnisch möglich ist,<br />
hat die Polizei durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass die<br />
Erhebung von Daten unterbleibt, die dem Kernbereich der privaten<br />
Lebensgestaltung zuzurechnen sind. 6 Wird erkennbar, dass solche Daten<br />
betroffen sind und bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Daten<br />
dem Zweck der Herbeiführung eines Erhebungsverbots dienen sollen, ist<br />
die Maßnahme insoweit unzulässig. 7 Maßnahmen nach den Sätzen 1 und<br />
3 sind zu dokumentieren.<br />
(2) 1 Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 auch technische<br />
Mittel einsetzen, um<br />
1. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Abs. 1 spezifische Kennungen<br />
sowie<br />
2. den <strong>Stand</strong>ort eines informationstechnischen Systems zu ermitteln.<br />
2<br />
Personenbezogene Daten Dritter dürfen dabei nur erhoben werden, wenn<br />
dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. 3 Nach Beendigung der<br />
Maßnahme sind diese unverzüglich zu löschen.<br />
(3) 1 Art. 34 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. 2 Für die richterliche Anordnung<br />
ist Art. 24 Abs. 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden. 3 Zuständig ist das in<br />
§ 74 a Abs. 4 GVG bezeichnete Gericht, in dessen Bezirk die beantragende<br />
Polizeidienststelle ihren Sitz hat; über Beschwerden entscheidet das in<br />
§ 120 Abs. 4 Satz 2 GVG bezeichnete Gericht. 4 Die Anordnung von<br />
Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 ist schriftlich zu erlassen und zu<br />
begründen. 5 Die Anordnung muss, soweit möglich, Namen und Anschrift<br />
des Betroffenen, gegen den sich die Maßnahme richtet, sowie die<br />
Bezeichnung des informationstechnischen Systems, auf das zugegriffen<br />
werden soll, enthalten. 6 In der Anordnung sind Art, Umfang und Dauer<br />
der Maßnahme zu bestimmen. 7 Die Anordnung ist auf höchstens drei<br />
Monate zu befristen. 8 Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als einen<br />
Monat ist möglich, soweit die Voraussetzungen fortbestehen. 9 Bestehen<br />
die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen nicht fort, ist die<br />
Maßnahme unverzüglich zu beendigen; die Beendigung ist dem Richter<br />
mitzuteilen.<br />
(4) 1 Bestehen bei der Durchsicht der Daten Anhaltspunkte dafür, dass Daten<br />
1. dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen sind oder<br />
2. Inhalte betreffen, über die das Zeugnis als Geistlicher, Verteidiger,<br />
Rechtsanwalt, Arzt, Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit,<br />
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut nach §§ 53, 53 a StPO verweigert werden<br />
könnte, oder<br />
3. einem Vertrauensverhältnis mit anderen Berufsgeheimnisträgern<br />
zuzuordnen sind,<br />
sind diese unverzüglich zu löschen oder dem für die Anordnung nach<br />
Abs. 1 zuständigen Richter zur Entscheidung über ihre weitere<br />
Verwendung vorzulegen. 2 Bei Gefahr im Verzug kann die Entscheidung<br />
auch eine in Art. 33 Abs. 5 Satz 1 genannte Stelle treffen; in diesem Fall<br />
ist eine richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 3 Die<br />
Löschung ist zu dokumentieren.<br />
(5) 1 Die durch eine Maßnahme nach den Abs. 1 und 2 erlangten<br />
personenbezogenen Daten sind besonders zu kennzeichnen. 2 Sie dürfen<br />
nur zu den Zwecken verwendet werden. zu denen sie erhoben wurden.<br />
3<br />
Daten, bei denen sich nach der Auswertung herausstellt, dass<br />
1. die Voraussetzungen für ihre Erhebung nicht vorgelegen haben oder<br />
2. sie Inhalte betreffen, über die das Zeugnis als Geistlicher, Verteidiger,<br />
Rechtsanwalt, Arzt, Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit,<br />
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und<br />
Jugendlichenpsychotherapeut nach §§ 53, 53 a StPO verweigert werden<br />
könnte, oder<br />
3. sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem<br />
Vertrauensverhältnis mit anderen Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen<br />
sind und keinen unmittelbaren Bezug zu den in Abs. 1 Satz 1 Nr. 1<br />
genannten Gefahren haben,<br />
dürfen nicht verwendet werden. 4 Dies gilt nicht, wenn ihre Verwendung<br />
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer<br />
Person erforderlich ist und Daten im Sinn der Nr. 2 oder 3 nicht betroffen<br />
sind. 5 In diesen Fällen ist eine richterliche Entscheidung über die<br />
Zulässigkeit der Verwendung unverzüglich nachzuholen; Abs. 3 Satz 2<br />
findet entsprechende Anwendung.<br />
(6) 1 Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind<br />
und nicht verwendet werden dürfen, sind unverzüglich zu löschen; die<br />
Löschung ist zu dokumentieren. 2 Die durch eine Maßnahme nach den<br />
Abs. 1 und 2 erlangten personenbezogenen Daten,<br />
1. deren Verwendung zu den in Abs. 5 Satz 2 genannten Zwecken nicht<br />
erforderlich ist, oder<br />
2. für die ein Verwendungsverbot besteht,<br />
sind zu sperren, wenn sie zum Zweck der Information der Betroffenen und<br />
zur gerichtlichen Überprüfung der Erhebung oder Verwendung der Daten<br />
noch benötigt werden; andernfalls sind sie zu löschen. 3 Art. 34 Abs. 7<br />
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.<br />
(7) 1 Von Maßnahmen nach den Abs. 1 und 2 sind<br />
1. die Personen zu unterrichten, gegen die die Maßnahme gerichtet war,<br />
sowie<br />
2. diejenigen, deren personenbezogene Daten im Rahmen einer solchen<br />
Maßnahme erhoben oder gelöscht und zu den Zwecken des Abs. 5 Satz 2<br />
verwendet wurden.<br />
2<br />
Die Unterrichtung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der<br />
Maßnahme, der eingesetzten nicht offen ermittelnden Beamten oder der in
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 genannten Rechtsgüter geschehen kann. 3 Ist wegen<br />
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen<br />
den Betroffenen eingeleitet worden, ist die Unterrichtung in Abstimmung<br />
mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der <strong>Stand</strong> des<br />
Ermittlungsverfahrens zulässt. 4 Art. 34 Abs. 6 Sätze 3 bis 5 gelten<br />
entsprechend. 5 Die gerichtliche Zuständigkeit und das Verfahren richten<br />
sich im Fall des Satzes 3 nach den Regelungen der Strafprozessordnung,<br />
im Übrigen gelten Abs. 3 Sätze 2 und 3.<br />
(8) 1 Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag jährlich über die erfolgte<br />
Erhebung von Daten nach Abs. 1 Satz 1 mit Ausnahme von Zugangsdaten<br />
sowie die Löschung solcher Daten nach Abs. 1 Satz 3. 2 Art. 34 Abs. 9<br />
Satz 2 gilt entsprechend. 3 In dem Bericht sind anzugeben:<br />
1. die Anzahl der den Maßnahmen zu Grunde liegenden Anordnungen,<br />
unterschieden nach<br />
a) Erstanordnungen,<br />
b) Verlängerungsanordnungen,<br />
2. die jeweilige Anordnungsdauer,<br />
3. die Anzahl der Maßnahmen, unterschieden nach<br />
a) Erhebungen von Daten,<br />
b) Löschungen von Daten,<br />
4. die gesetzlichen Grundlagen der Maßnahmen.<br />
Bay PAG Art. 34 e (weggefallen)<br />
Bay PAG Art. 35 Besondere Bestimmungen über den Einsatz<br />
Verdeckter Ermittler<br />
(1) 1 Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Legende<br />
erforderlich ist, dürfen entsprechende Urkunden hergestellt, verändert<br />
oder gebraucht werden. 2 Ein Verdeckter Ermittler darf zur Erfüllung seines<br />
Auftrags unter der Legende am Rechtsverkehr teilnehmen.<br />
(2) 1 Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende mit Einverständnis des<br />
Berechtigten dessen Wohnung betreten. 2 Im übrigen richten sich die<br />
Befugnisse eines Verdeckten Ermittlers nach den Bestimmungen dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s und der Strafprozeßordnung.<br />
Bay PAG Art. 36 Polizeiliche Beobachtung<br />
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, insbesondere die Personalien<br />
einer Person sowie das amtliche Kennzeichen des von ihr benutzten<br />
Kraftfahrzeugs, zur polizeilichen Beobachtung ausschreiben, wenn<br />
1. die Gesamtwürdigung der Person und ihrer bisher begangenen<br />
Straftaten erwarten lassen, daß sie auch künftig Straftaten von<br />
erheblicher Bedeutung begehen wird oder<br />
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person Straftaten von<br />
erheblicher Bedeutung begehen wird,<br />
und die polizeiliche Beobachtung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser<br />
Straftaten erforderlich ist.<br />
(2) Im Fall eines Antreffens der Person oder des Kraftfahrzeugs können<br />
Erkenntnisse über das Antreffen sowie über Kontakt- und Begleitpersonen
und mitgeführte Sachen an die ausschreibende Polizeidienststelle<br />
übermittelt werden.<br />
(3) 1 Die Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung darf nur durch eine in<br />
Art. 33 Abs. 5 Sätze 1 und 2 genannte Stelle angeordnet werden. 2 Die<br />
Anordnung ist auf höchstens ein Jahr zu befristen. 3 Zur Verlängerung der<br />
Laufzeit bedarf es einer neuen Anordnung.<br />
(4) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr vor, ist der<br />
Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß er nicht erreicht<br />
werden kann, ist die Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung<br />
unverzüglich zu löschen.<br />
(5) 1 Von Maßnahmen nach Abs. 1 sind<br />
1. die Personen zu unterrichten, gegen die die Maßnahme gerichtet war,<br />
sowie<br />
2. diejenigen, deren personenbezogene Daten gemeldet worden sind.<br />
2<br />
Die Unterrichtung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der<br />
Maßnahme oder der eingesetzten nicht offen ermittelnden Beamten<br />
geschehen kann. 3 Ist wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches<br />
Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet worden, ist die<br />
Unterrichtung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen,<br />
sobald dies der <strong>Stand</strong> der Ermittlungen zulässt. 4 Erfolgt die<br />
Benachrichtigung nicht binnen zwölf Monaten nach Beendigung der<br />
Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der richterlichen<br />
Zustimmung. 5 Art. 34 Abs. 6 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 6 Die<br />
gerichtliche Zuständigkeit und das Verfahren richten sich im Fall des<br />
Satzes 3 nach den Regeln der Strafprozessordnung, im Übrigen ist für die<br />
richterliche Entscheidung Art. 24 Abs. 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden;<br />
zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die ausschreibende<br />
Polizeidienststelle ihren Sitz hat.<br />
2. Unterabschnitt Datenverarbeitung<br />
Bay PAG Art. 37 Allgemeine Regeln der Datenspeicherung,<br />
Datenveränderung und Datennutzung<br />
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten in Akten oder Dateien<br />
speichern, verändern und nutzen, soweit dies durch dieses Gesetz oder<br />
andere Rechtsvorschriften zugelassen ist.<br />
(2) 1 Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung darf nur zu dem Zweck<br />
erfolgen, zu dem diese Daten erlangt worden sind. 2 Die Nutzung<br />
einschließlich einer erneuten Speicherung und einer Veränderung zu<br />
einem anderen polizeilichen Zweck ist zulässig, soweit die Polizei die<br />
Daten zu diesem Zweck erheben dürfte.<br />
(3) 1 Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.<br />
2<br />
Für automatisierte Dateien sind Termine festzulegen, an denen<br />
spätestens überprüft werden muß, ob die suchfähige Speicherung von<br />
Daten weiterhin erforderlich ist (Prüfungstermine). 3 Für<br />
nichtautomatisierte Dateien und Akten sind Prüfungstermine oder<br />
Aufbewahrungsfristen festzulegen. 4 Dabei sind der Speicherungszweck<br />
sowie Art und Bedeutung des Anlasses der Speicherung zu<br />
berücksichtigen.
(4) Anderweitige Rechtsvorschriften über die Datenspeicherung, -veränderung<br />
und -nutzung bleiben unberührt.<br />
Bay PAG Art. 38 Speicherung, Veränderung und Nutzung von Daten<br />
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten in Akten oder Dateien<br />
speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben, zu einer zeitlich befristeten Dokumentation oder zur<br />
Vorgangsverwaltung erforderlich ist.<br />
(2) 1 Die Polizei kann insbesondere personenbezogene Daten, die sie im<br />
Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsverfahren oder von Personen<br />
gewonnen hat, die verdächtig sind, eine Straftat begangen zu haben,<br />
speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur Gefahrenabwehr,<br />
insbesondere zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich<br />
ist. 2 Entfällt der der Speicherung zugrunde liegende Verdacht, sind die<br />
Daten zu löschen. 3 Die nach Art. 37 Abs. 3 festzulegenden<br />
Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen betragen in der Regel bei<br />
Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf Jahre und bei Kindern zwei<br />
Jahre (Regelfristen). 4 In Fällen von geringerer Bedeutung sind kürzere<br />
Fristen festzusetzen. 5 Die Frist beginnt regelmäßig mit dem Ende des<br />
Jahres, in dem das letzte Ereignis erfaßt worden ist, das zur Speicherung<br />
der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus<br />
einer Justizvollzugsanstalt oder der Beendigung einer mit<br />
Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung.<br />
6<br />
Werden innerhalb der Frist der Sätze 3 bis 5 weitere personenbezogene<br />
Daten über dieselbe Person gespeichert, so gilt für alle Speicherungen<br />
gemeinsam der Prüfungstermin, der als letzter eintritt, oder die<br />
Aufbewahrungsfrist, die als letzte endet.<br />
(3) 1 Die nach Art. 33 Abs. 2 Satz 2 erfassten Kennzeichen sind nach<br />
Durchführung des Datenabgleichs unverzüglich zu löschen. 2 Soweit ein<br />
Kennzeichen in den abgeglichenen Fahndungsbeständen oder Dateien<br />
enthalten und seine Speicherung oder Nutzung im Einzelfall zur Abwehr<br />
einer Gefahr oder für Zwecke, zu denen die Fahndungsbestände erstellt<br />
oder die Dateien errichtet wurden, erforderlich ist, gelten abweichend<br />
hiervon Abs. 1 und 2 sowie die Vorschriften der Strafprozessordnung.<br />
3<br />
Außer in den Fällen des Art. 33 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 Buchst. a dürfen<br />
Einzelerfassungen nicht zu einem Bewegungsbild verbunden werden.<br />
(4) 1 In den Fällen des Art. 36 Abs. 1 kann abweichend von Abs. 2 eine<br />
längere Frist festgelegt werden. 2 Wird nach Fristablauf die Aufbewahrung<br />
fortgesetzt, ist nach spätestens drei Jahren die Aussonderung erneut zu<br />
prüfen.<br />
(5) 1 Die Polizei kann personenbezogene Daten auch zur Aus- und Fortbildung<br />
nutzen. 2 Die Anonymisierung kann unterbleiben, wenn diese nicht mit<br />
vertretbarem Aufwand möglich ist oder dem Aus- und Fortbildungszweck<br />
entgegensteht und jeweils die berechtigten Interessen des Betroffenen an<br />
der Geheimhaltung der Daten nicht offensichtlich überwiegen.<br />
Bay PAG Art. 39 Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung<br />
(1) 1 Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der Datenübermittlung.<br />
2 Erfolgt die Datenübermittlung auf Grund eines Ersuchens des
Empfängers, hat dieser die zur Prüfung erforderlichen Angaben zu<br />
machen. 3 Bei Ersuchen von Polizeidienststellen sowie anderen Behörden<br />
und öffentlichen Stellen prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das<br />
Ersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt. 4 Erfolgt die<br />
Datenübermittlung durch automatisierten Abruf, trägt der Empfänger die<br />
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs.<br />
(2) 1 Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, soweit<br />
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verarbeiten und<br />
nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. 2 Behörden und sonstige<br />
Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, über- und<br />
zwischenstaatliche Stellen sowie Personen und Stellen außerhalb des<br />
öffentlichen Bereichs sind bei der Datenübermittlung darauf hinzuweisen.<br />
(3) 1 Unterliegen personenbezogene Daten einem Berufs- oder besonderen<br />
Amtsgeheimnis und sind sie der Polizei von der zur Verschwiegenheit<br />
verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht<br />
übermittelt worden, ist die Datenübermittlung durch die Polizei nur<br />
zulässig, wenn der Empfänger die Daten zur Erfüllung des gleichen<br />
Zwecks benötigt, zu dem die Polizei sie erlangt hat. 2 In die Übermittlung<br />
an Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs muß, außer<br />
bei Gefahr im Verzug, der Betroffene, oder soweit dies im Einzelfall nicht<br />
sachdienlich ist, die zur Verschwiegenheit verpflichtete Stelle einwilligen.<br />
(4) Die Datenübermittlung zwischen Polizeidienststellen und dem Landesamt<br />
für Verfassungsschutz erfolgt nach dem Bayerischen<br />
Verfassungsschutzgesetz.<br />
(5) Andere Rechtsvorschriften über die Datenübermittlung bleiben unberührt.<br />
Bay PAG Art. 40 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen<br />
Bereichs<br />
(1) 1 Die Polizei kann personenbezogene Daten an andere Polizeidienststellen<br />
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich<br />
ist. 2 Dies gilt auch für Datenübermittlungen an Polizeidienststellen<br />
anderer Länder oder des Bundes.<br />
(2) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene Daten an Behörden oder<br />
öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies zur Erfüllung polizeilicher<br />
Aufgaben erforderlich ist.<br />
(3) Sind andere Behörden oder öffentliche Stellen für die Abwehr von<br />
Gefahren zuständig, kann die Polizei von sich aus diesen Behörden oder<br />
öffentlichen Stellen die bei ihr vorhandenen personenbezogenen Daten<br />
übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung der Aufgaben<br />
des Empfängers erforderlich erscheint.<br />
(4) Im übrigen kann die Polizei auf Ersuchen personenbezogene Daten an<br />
Behörden oder öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies<br />
1. zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr durch den<br />
Empfänger,<br />
2. zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das<br />
Gemeinwohl oder<br />
3. zur Wahrung sonstiger schutzwürdiger Interessen<br />
erforderlich erscheint.
(5) 1 Die Polizei kann von sich aus oder auf Ersuchen personenbezogene<br />
Daten an Behörden und Stellen mit polizeilichen Aufgaben und sonstige<br />
Behörden und Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes<br />
sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit dies<br />
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist,<br />
2. zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers erforderlich erscheint und<br />
die Polizei hierzu auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen<br />
Union, völkerrechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger internationaler<br />
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland ermächtigt ist oder<br />
3. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch den Empfänger erforderlich<br />
erscheint.<br />
2 Die Datenübermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme<br />
besteht, dass sie gegen den Zweck eines Bundes- oder Landesgesetzes<br />
verstoßen würde oder schutzwürdige Interessen des Betroffenen<br />
beeinträchtigt würden.<br />
Bay PAG Art. 41 Datenübermittlung an Personen oder Stellen<br />
außerhalb des öffentlichen Bereichs<br />
(1) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene Daten an Personen oder<br />
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit dies<br />
erforderlich ist<br />
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben,<br />
2. zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das<br />
Gemeinwohl oder<br />
3. zur Wahrung schutzwürdiger Interessen Einzelner und kein Grund zur<br />
Annahme besteht, daß der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an<br />
dem Ausschluß der Übermittlung hat.<br />
(2) Die Polizei kann auf Antrag von Personen oder Stellen außerhalb des<br />
öffentlichen Bereichs personenbezogene Daten übermitteln, soweit der<br />
Auskunftsbegehrende<br />
1. ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten<br />
glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme besteht, daß der<br />
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß der<br />
Übermittlung hat oder<br />
2. ein berechtigtes Interesse geltend macht, offensichtlich ist, daß die<br />
Datenübermittlung im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu<br />
der Annahme besteht, daß er in Kenntnis der Sachlage seine Einwilligung<br />
verweigern würde.<br />
Bay PAG Art. 42 Datenübermittlung an die Polizei<br />
(1) 1 Öffentliche Stellen können, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt<br />
ist, von sich aus personenbezogene Daten an die Polizei übermitteln, wenn<br />
anzunehmen ist, daß die Übermittlung zur Erfüllung der Aufgaben der<br />
Polizei erforderlich sein kann. 2 Die Polizei hat die Daten zu vernichten,<br />
soweit diese zur polizeilichen Aufgabenerfüllung offensichtlich nicht mehr<br />
benötigt werden.<br />
(2) 1 Die Polizei kann an öffentliche Stellen Ersuchen um Übermittlung<br />
personenbezogener Daten stellen, soweit diese zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben erforderlich sind. 2 Die ersuchte öffentliche Stelle prüft die
Zulässigkeit der Datenübermittlung. 3 Wenn gesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist, prüft sie nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der<br />
Polizei liegt, es sei denn im Einzelfall besteht Anlaß zur Prüfung der<br />
Rechtmäßigkeit des Ersuchens. 4 Die Polizei hat die zur Prüfung<br />
erforderlichen Angaben zu machen. 5 Die ersuchte öffentliche Stelle hat<br />
die Daten an die Polizei zu übermitteln, soweit gesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist.<br />
(3) Die Polizei kann an Behörden und Stellen mit polizeilichen Aufgaben und<br />
sonstige Behörden und Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des<br />
Grundgesetzes sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen Ersuchen<br />
auf Übermittlung von personenbezogenen Daten richten, soweit dies zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich und gesetzlich nichts anderes<br />
bestimmt ist.<br />
Bay PAG Art. 43 Datenabgleich innerhalb der Polizei<br />
(1) 1 Die Polizei kann personenbezogene Daten der in Art. 7 und 8 genannten<br />
Personen mit dem Inhalt polizeilicher Dateien abgleichen.<br />
2<br />
Personenbezogene Daten anderer Personen kann die Polizei nur<br />
abgleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß dies zur<br />
Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich ist. 3 Die<br />
Polizei kann ferner im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangte<br />
personenbezogene Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen. 4 Der<br />
Betroffene kann außer in den Fällen des Art. 12 für die Dauer des<br />
Datenabgleichs angehalten werden. 5 Art. 13 bleibt unberührt.<br />
(2) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in anderen Fällen bleiben<br />
unberührt.<br />
Bay PAG Art. 44 Rasterfahndung<br />
(1) Die Polizei kann von öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen die<br />
Übermittlung von personenbezogenen Daten bestimmter Personengruppen<br />
aus Dateien zum Zweck des Abgleichs mit anderen Datenbeständen<br />
verlangen, soweit dies erforderlich ist zur Abwehr<br />
1. einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines<br />
Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen,<br />
soweit eine gemeine Gefahr besteht, oder<br />
2. einer schwerwiegenden Straftat, wenn konkrete<br />
Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit weiteren<br />
bestimmten Tatsachen die begründete Annahme rechtfertigen, dass eine<br />
solche begangen werden wird.<br />
(2) 1 Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschriften, Tag und Ort der<br />
Geburt und andere für den Einzelfall benötigte Daten zu beschränken.<br />
2<br />
Soweit die zu übermittelnden Daten von anderen Daten nicht oder nur<br />
mit unverhältnismäßigem Aufwand getrennt werden können, sind auf<br />
Anordnung auch die anderen Daten zu übermitteln; die Nutzung dieser<br />
Daten ist nicht zulässig. 3 Berufsgeheimnisträger nach §§ 53, 53 a StPO<br />
sind nicht verpflichtet, personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder<br />
besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, zu übermitteln; hierauf ist im<br />
Übermittlungsersuchen hinzuweisen.
(3) 1 Die Maßnahme darf nur durch den Richter angeordnet werden.<br />
2<br />
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die beantragende<br />
Polizeidienststelle ihren Sitz hat. 3 Art. 24 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.<br />
4 5<br />
Die Anordnung ist schriftlich zu erlassen und zu begründen. Sie muss<br />
den zur Übermittlung Verpflichteten bezeichnen und ist auf die Daten und<br />
Prüfungsmerkmale zu beschränken, die für den Einzelfall benötigt werden.<br />
6<br />
Von der Maßnahme ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz<br />
unverzüglich zu unterrichten.<br />
(4) 1 Die durch eine Maßnahme nach Abs. 1 erlangten personenbezogenen<br />
Daten sind besonders zu kennzeichnen. 2 Sie dürfen nur verwendet<br />
werden<br />
1. zu den in Abs. 1 genannten Zwecken sowie<br />
2. zu Zwecken der Strafverfolgung hinsichtlich solcher Straftaten, zu<br />
deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach der Strafprozessordnung<br />
hätte angeordnet werden dürfen; eine Zweckänderung ist festzustellen<br />
und zu dokumentieren.<br />
(5) 1 Von der Maßnahme nach Abs. 1 sind die Personen, gegen die nach<br />
Abschluss der Rasterfahndung weitere Maßnahmen durchgeführt werden,<br />
durch die Polizei zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefährdung des<br />
Zwecks der Maßnahme, der eingesetzten nicht offen ermittelnden<br />
Beamten oder der in Abs. 1 genannten Rechtsgüter geschehen kann. 2 Ist<br />
wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren<br />
gegen den Betroffenen eingeleitet worden, ist die Unterrichtung in<br />
Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der<br />
<strong>Stand</strong> des Ermittlungsverfahrens zulässt. 3 Erfolgt die Benachrichtigung<br />
nicht binnen 24 Monaten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die<br />
weitere Zurückstellung der richterlichen Zustimmung. 4 Art. 34 Abs. 6<br />
Sätze 4 bis 6 gelten entsprechend.<br />
(6) 1 Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht<br />
erreicht werden kann, sind die übermittelten und im Zusammenhang mit<br />
der Maßnahme zusätzlich angefallenen Daten zu löschen und die<br />
Unterlagen, soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten erforderlich<br />
sind und nach Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 verwendet werden dürfen, unverzüglich<br />
zu vernichten. 2 Die Löschung und Vernichtung ist zu dokumentieren.<br />
Bay PAG Art. 45 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten<br />
(1) 1 Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.<br />
2<br />
Sind Daten in nichtautomatisierten Dateien oder in Akten zu berichtigen,<br />
reicht es aus, in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu welchem<br />
Zeitpunkt und aus welchem Grund diese Daten unrichtig geworden sind.<br />
3<br />
Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung durch<br />
die Polizei als unrichtig, sind sie unverzüglich gegenüber dem Empfänger<br />
zu berichtigen, wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des<br />
Betroffenen erforderlich ist.<br />
(2) In Dateien suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten sind zu<br />
löschen und die zu dem Betroffenen geführten Akten zu vernichten, wenn<br />
1. ihre Speicherung unzulässig war, oder<br />
2. bei der zu bestimmten Fristen oder Terminen vorzunehmenden<br />
Überprüfung oder aus Anlaß einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird,
daß ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung der ihr<br />
obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. Art. 38 Abs. 2 Sätze 3<br />
bis 5 gelten entsprechend.<br />
(3) 1 Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn<br />
1. Grund zu der Annahme besteht, daß schutzwürdige Interessen des<br />
Betroffenen beeinträchtigt würden,<br />
2. die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerläßlich sind,<br />
3. die Nutzung der Daten zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist<br />
oder<br />
4. dies wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit<br />
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.<br />
2<br />
In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk<br />
zu versehen. 3 Sie dürfen nur zu den in Satz 1 Nrn. 2 und 3 genannten<br />
Zwecken oder mit Einwilligung des Betroffenen genutzt werden.<br />
(4) 1 Für die Archivierung gelten die Vorschriften des Bayerischen<br />
Archivgesetzes. 2 Die Anbietungspflicht bestimmt sich nach Maßgabe der<br />
nach Art. 6 Abs. 2 BayArchivG abzuschließenden Vereinbarung.<br />
Bay PAG Art. 46 Automatisiertes Abrufverfahren<br />
(1) 1 Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung<br />
personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit<br />
dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen<br />
der Betroffenen und der Erfüllung polizeilicher Aufgaben angemessen ist.<br />
2<br />
Der Abruf durch andere als Polizeidienststellen ist nur auf Grund<br />
besonderer Rechtsvorschriften zulässig.<br />
(2) 1 Protokollbestände, die nach Abfrage nach Absatz 1 eingerichtet worden<br />
sind, dürfen zu Zwecken der Kriminalitätsbekämpfung und der<br />
Datensicherung ausgewertet werden. 2 Die Auswertung für Zwecke der<br />
Kriminalitätsbekämpfung bedarf der Anordnung einer in Art. 33 Abs. 5<br />
Sätze 1 und 2 genannten Stelle. 3 Die Speicherungsdauer einer<br />
protokollierten Abfrage darf den Zeitraum eines Jahres nicht übersteigen.<br />
4<br />
Abfragen, die mittels automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme<br />
durchgeführt werden, dürfen nicht protokolliert werden.<br />
(3) Das Staatsministerium des Innern kann mit anderen Ländern und dem<br />
Bund einen Datenverbund vereinbaren, der eine automatisierte<br />
Datenübermittlung ermöglicht.<br />
Bay PAG Art. 47 Errichtungsanordnung für Dateien<br />
(1) 1 Für den erstmaligen Einsatz von automatisierten Verfahren, mit denen<br />
personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist in einer<br />
Errichtungsanordnung, die der Zustimmung des Staatsministeriums des<br />
Innern bedarf, festzulegen:<br />
1. speichernde Stelle,<br />
2. Bezeichnung der Datei,<br />
3. Zweck der Datei,<br />
4. betroffener Personenkreis,<br />
5. Art der zu speichernden Daten,<br />
6. Eingabeberechtigung,<br />
7. Zugangsberechtigung,
8. regelmäßige Datenübermittlungen,<br />
9. Überprüfungsfristen, Speicherungsdauer,<br />
10. Protokollierung des Abrufs.<br />
2<br />
Nach der Zustimmung des Staatsministeriums des Innern ist die<br />
Errichtungsanordnung dem Landesbeauftragten für den Datenschutz<br />
mitzuteilen. 3 Das gleiche gilt für wesentliche Änderungen des Verfahrens.<br />
(2) Die speichernde Stelle hat in angemessenem Abstand die Notwendigkeit<br />
der Weiterführung oder Änderung ihrer Dateien zu prüfen.<br />
(3) Das Staatsministerium des Innern kann hierzu Rahmenregelungen durch<br />
Verwaltungsvorschrift erlassen.<br />
Bay PAG Art. 48 Auskunftsrecht<br />
(1) 1 Die Polizei erteilt dem Betroffenen auf Antrag über die zu seiner Person<br />
gespeicherten Daten Auskunft. 2 In dem Antrag sollen die Art der<br />
personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, und der<br />
Grund des Auskunftsverlangens näher bezeichnet werden. 3 Die Polizei<br />
bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung<br />
nach pflichtgemäßem Ermessen.<br />
(2) Die Auskunft unterbleibt, soweit<br />
1. eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung,<br />
insbesondere eine Ausforschung der Polizei, zu besorgen ist,<br />
2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder<br />
dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde, oder<br />
3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer<br />
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der<br />
überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheimgehalten<br />
werden müssen, und das Interesse des Betroffenen an der<br />
Auskunftserteilung nicht überwiegt.<br />
(3) 1 Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung. 2 Wird<br />
die Auskunft verweigert, ist der Betroffene darauf hinzuweisen, daß er sich<br />
an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann.<br />
(4) 1 Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen<br />
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht das<br />
Staatsministerium des Innern im Einzelfall feststellt, daß dadurch die<br />
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. 2 Die Mitteilung<br />
des Landesbeauftragten an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf<br />
den Erkenntnisstand der Polizei zulassen, sofern diese nicht einer<br />
weitergehenden Auskunft zustimmt.<br />
3. Unterabschnitt Anwendung des Bayerischen Datenschutzgesetzes<br />
Bay PAG Art. 49<br />
Art. 8 Abs. 1, Art. 10 bis 13, 15 Abs. 5 bis 8, Art. 16 bis 22 und 26 bis 28 des<br />
Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) finden keine Anwendung;<br />
Art. 21 a BayDSG findet in Ausübung des Hausrechts Anwendung.
IV. ABSCHNITT Vollzugshilfe<br />
Bay PAG Art. 50 Vollzugshilfe<br />
(1) Die Polizei leistet anderen Behörden auf Ersuchen Vollzugshilfe, wenn<br />
unmittelbarer Zwang anzuwenden ist und die anderen Behörden nicht<br />
über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen<br />
nicht auf andere Weise selbst durchsetzen können.<br />
(2) Soweit Dienstkräfte der Justizverwaltung nicht oder nicht ausreichend zur<br />
Verfügung stehen, führt die Polizei Personen dem Gericht oder der<br />
Staatsanwaltschaft vor und unterstützt die Gerichtsvorsitzenden bei der<br />
Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung.<br />
(3) Die Grundsätze der Amtshilfe gelten entsprechend.<br />
(4) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt.<br />
Bay PAG Art. 51 Verfahren<br />
(1) 1 Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich zu stellen. 2 Sie haben den Grund<br />
und die Rechtsgrundlage der Maßnahme anzugeben.<br />
(2) 1 In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden. 2 Es ist jedoch auf<br />
Verlangen unverzüglich schriftlich zu bestätigen.<br />
(3) 1 Vollzugshilfeersuchen sollen an die unterste Polizeidienststelle gerichtet<br />
werden, deren Dienstbereich für den Vollzug des Ersuchens ausreicht.<br />
2<br />
Weisungen der Sicherheitsbehörden gehen dem Ersuchen anderer<br />
Verwaltungsbehörden vor.<br />
(4) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des Ersuchens zu<br />
verständigen.<br />
Bay PAG Art. 52 Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung<br />
(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, ist<br />
auch die richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit der<br />
Freiheitsentziehung vorzulegen oder in dem Ersuchen zu bezeichnen.<br />
(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergangen, hat die Polizei<br />
die festgehaltene Person zu entlassen, wenn die ersuchende Behörde<br />
diese nicht übernimmt oder die richterliche Entscheidung nicht<br />
unverzüglich nachträglich beantragt.<br />
(3) Die Art. 19 und 20 gelten entsprechend.<br />
V. ABSCHNITT Zwang<br />
1. Unterabschnitt Erzwingung von Handlungen, Duldungen und<br />
Unterlassungen<br />
Bay PAG Art. 53 Zulässigkeit des Verwaltungszwangs<br />
(1) Der Verwaltungsakt der Polizei, der auf die Vornahme einer Handlung oder<br />
auf Duldung oder Unterlassung gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln<br />
durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein<br />
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat.
(2) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt<br />
angewendet werden, wenn das zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist,<br />
insbesondere weil Maßnahmen gegen Personen nach den Art. 7 bis 10<br />
nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,<br />
und die Polizei hierbei innerhalb ihrer Befugnisse handelt.<br />
Bay PAG Art. 54 Zwangsmittel<br />
(1) Zwangsmittel sind:<br />
1. Ersatzvornahme (Art. 55),<br />
2. Zwangsgeld (Art. 56),<br />
3. unmittelbarer Zwang (Art. 58).<br />
(2) Sie sind nach Maßgabe der Art. 59 und 64 anzudrohen.<br />
(3) Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße<br />
angewandt und so lange wiederholt und gewechselt werden, bis der<br />
Verwaltungsakt befolgt worden ist oder sich auf andere Weise erledigt hat.<br />
Bay PAG Art. 55 Ersatzvornahme<br />
(1) 1 Wird die Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme<br />
durch einen anderen möglich ist (vertretbare Handlung), nicht erfüllt, so<br />
kann die Polizei die Handlung selbst ausführen oder einen anderen mit der<br />
Ausführung beauftragen. 2 Für die Ausführung der Ersatzvornahme werden<br />
vom Betroffenen Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 3 Im übrigen<br />
gilt das Kostengesetz.<br />
(2) 1 Es kann bestimmt werden, daß der Betroffene die voraussichtlichen<br />
Kosten der Ersatzvornahme im voraus zu bezahlen hat. 2 Zahlt der<br />
Betroffene die Kosten der Ersatzvornahme oder die voraussichtlich<br />
entstehenden Kosten der Ersatzvornahme nicht fristgerecht, so können<br />
die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 3 Die<br />
Beitreibung der voraussichtlichen Kosten unterbleibt, sobald der<br />
Betroffene die gebotene Handlung ausführt.<br />
Bay PAG Art. 56 Zwangsgeld<br />
(1) Das Zwangsgeld wird auf mindestens fünf und höchstens<br />
zweitausendfünfhundert Euro schriftlich festgesetzt.<br />
(2) Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist dem Betroffenen eine<br />
angemessene Frist zur Zahlung einzuräumen.<br />
(3) 1 Zahlt der Betroffene das Zwangsgeld nicht fristgerecht, so wird es im<br />
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 2 Die Beitreibung unterbleibt,<br />
sobald der Betroffene die gebotene Handlung ausführt oder die zu<br />
duldende Maßnahme gestattet.<br />
(4) 1 Für die Festsetzung des Zwangsgeldes werden vom Betroffenen Kosten<br />
(Gebühren und Auslagen) erhoben. 2 Im übrigen gilt das Kostengesetz.<br />
Bay PAG Art. 57 Ersatzzwangshaft<br />
(1) 1 Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht auf<br />
Antrag der Polizei die Ersatzzwangshaft anordnen, wenn bei Androhung<br />
des Zwangsgeldes hierauf hingewiesen worden ist. 2 Die Ersatzzwangshaft<br />
beträgt mindestens einen Tag, höchstens zwei Wochen.
(2) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Polizei von der Justizverwaltung<br />
nach den Bestimmungen der §§ 904 bis 910 der Zivilprozeßordnung zu<br />
vollstrecken.<br />
Bay PAG Art. 58 Unmittelbarer Zwang<br />
(1) 1 Die Polizei kann unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere<br />
Zwangsmittel nicht in Betracht kommen oder keinen Erfolg versprechen<br />
oder unzweckmäßig sind. 2 Für die Art und Weise der Anwendung<br />
unmittelbaren Zwangs gelten die Art. 60 ff.<br />
(2) Unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung ist ausgeschlossen.<br />
(3) 1 Für die Anwendung unmittelbaren Zwangs werden Kosten (Gebühren<br />
und Auslagen) erhoben. 2 Im übrigen gilt das Kostengesetz.<br />
Bay PAG Art. 59 Androhung der Zwangsmittel<br />
(1) 1 Zwangsmittel sind möglichst schriftlich anzudrohen. 2 Dem Betroffenen<br />
ist in der Androhung zur Erfüllung der Verpflichtung eine angemessene<br />
Frist zu bestimmen; eine Frist braucht nicht bestimmt zu werden, wenn<br />
eine Duldung oder Unterlassung erzwungen werden soll. 3 Von der<br />
Androhung kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht<br />
zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels<br />
zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist.<br />
(2) 1 Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch<br />
den die Handlung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben wird. 2 Sie soll<br />
mit ihm verbunden werden, wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende<br />
Wirkung hat.<br />
(3) 1 Die Androhung muß sich auf bestimmte Zwangsmittel beziehen.<br />
2<br />
Werden mehrere Zwangsmittel angedroht, ist anzugeben, in welcher<br />
Reihenfolge sie angewandt werden sollen.<br />
(4) Wird die Ersatzvornahme angedroht, so sollen in der Androhung die<br />
voraussichtlichen Kosten angegeben werden.<br />
(5) Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen.<br />
(6) 1 Die Androhung ist zuzustellen. 2 Das gilt auch dann, wenn sie mit dem<br />
zugrunde liegenden Verwaltungsakt verbunden ist und für ihn keine<br />
Zustellung vorgeschrieben ist.<br />
(7) 1 Für die Androhung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.<br />
2<br />
Dies gilt nicht, wenn nach Absatz 2 Satz 1 verfahren wird und der<br />
Verwaltungsakt, durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung<br />
aufgegeben wird, kostenfrei ist. 3 Im übrigen gilt das Kostengesetz.<br />
2. Unterabschnitt Anwendung unmittelbaren Zwangs<br />
Bay PAG Art. 60 Rechtliche Grundlagen<br />
(1) Ist die Polizei nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur<br />
Anwendung unmittelbaren Zwangs befugt, gelten für die Art und Weise<br />
der Anwendung die Art. 61 bis 69 und, soweit sich aus diesen nichts<br />
Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s.
(2) Die zivil- und strafrechtlichen Wirkungen nach den Vorschriften über<br />
Notwehr und Notstand bleiben unberührt.<br />
Bay PAG Art. 61 Begriffsbestimmung<br />
(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch<br />
körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waffen.<br />
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf<br />
Personen oder Sachen.<br />
(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln,<br />
Wasserwerfer, technische Sperren, Diensthunde, Dienstpferde,<br />
Dienstfahrzeuge, Reiz- und Betäubungsstoffe sowie zum Sprengen<br />
bestimmte explosionsfähige Stoffe (Sprengmittel).<br />
(4) 1 Als Waffen sind Schlagstock, Elektroimpulsgerät und vergleichbare<br />
Waffen, Pistole, Revolver, Gewehr, Maschinenpistole, Maschinengewehr<br />
und Handgranate zugelassen. 2 Waffen können auf Anordnung des<br />
Staatsministeriums des Innern zeitlich befristet als Einsatzmittel erprobt<br />
werden.<br />
Bay PAG Art. 62 Handeln auf Anordnung<br />
(1) 1 Die Polizeibeamten sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden,<br />
der von einem Weisungsberechtigten angeordnet wird. 2 Dies gilt nicht,<br />
wenn die Anordnung die Menschenwürde verletzt oder nicht zu<br />
dienstlichen Zwecken erteilt worden ist.<br />
(2) 1 Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat<br />
begangen würde. 2 Befolgt der Polizeibeamte die Anordnung trotzdem, so<br />
trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm<br />
bekannten Umständen offensichtlich ist, daß dadurch eine Straftat<br />
begangen wird.<br />
(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Polizeibeamte<br />
dem Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den<br />
Umständen möglich ist.<br />
(4) § 36 Abs. 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes sind nicht anzuwenden.<br />
Bay PAG Art. 63 Hilfeleistung für Verletzte<br />
Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und<br />
die Lage es zuläßt, Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen.<br />
Bay PAG Art. 64 Androhung unmittelbaren Zwangs<br />
(1) 1 Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. 2 Von der<br />
Androhung kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht<br />
zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels<br />
zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist. 3 Als Androhung des<br />
Schußwaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warnschusses.<br />
(2) Schußwaffen und Handgranaten dürfen nur dann ohne Androhung<br />
gebraucht werden, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für<br />
Leib oder Leben erforderlich ist.
(3) 1 Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren<br />
Zwangs möglichst so rechtzeitig anzudrohen, daß sich Unbeteiligte noch<br />
entfernen können. 2 Der Gebrauch von Schußwaffen gegen Personen in<br />
einer Menschenmenge ist stets anzudrohen; die Androhung ist vor dem<br />
Gebrauch durch Warnschuß zu wiederholen. 3 Beim Gebrauch von<br />
technischen Sperren und Dienstpferden kann von einer Androhung<br />
abgesehen werden.<br />
Bay PAG Art. 65 Fesselung von Personen<br />
Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften<br />
festgehalten wird, darf gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme<br />
rechtfertigen, daß sie<br />
1. Polizeibeamte oder Dritte angreifen, Widerstand leisten oder Sachen<br />
beschädigen wird,<br />
2. fliehen wird oder befreit werden soll oder<br />
3. sich töten oder verletzen wird.<br />
Bay PAG Art. 66 Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch<br />
(1) 1 Schußwaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen<br />
des unmittelbaren Zwangs erfolglos angewendet sind oder offensichtlich<br />
keinen Erfolg versprechen. 2 Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig,<br />
wenn der Zweck nicht durch Schußwaffengebrauch gegen Sachen erreicht<br />
werden kann.<br />
(2) 1 Schußwaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffsoder<br />
fluchtunfähig zu machen. 2 Ein Schuß, der mit an Sicherheit<br />
grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn<br />
er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder<br />
der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der<br />
körperlichen Unversehrtheit ist.<br />
(3) 1 Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt<br />
sind, dürfen Schußwaffen nicht gebraucht werden. 2 Das gilt nicht, wenn<br />
der Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer<br />
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben ist.<br />
(4) 1 Der Schußwaffengebrauch ist unzulässig, wenn für den Polizeibeamten<br />
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden.<br />
2<br />
Das gilt nicht, wenn der Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur<br />
Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.<br />
Bay PAG Art. 67 Schußwaffengebrauch gegen Personen<br />
(1) Schußwaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden,<br />
1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren,<br />
2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung eines<br />
Verbrechens oder eines Vergehens unter Anwendung oder Mitführung von<br />
Schußwaffen oder Explosivmitteln zu verhindern,<br />
3. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder<br />
Identitätsfeststellung durch Flucht zu entziehen versucht, wenn sie<br />
a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder<br />
b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme<br />
rechtfertigen, daß sie Schußwaffen oder Explosivmittel mit sich führt,
4. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, die in<br />
amtlichem Gewahrsam zu halten oder ihm zuzuführen ist<br />
a) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Verbrechens oder auf<br />
Grund des dringenden Verdachts eines Verbrechens oder<br />
b) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Vergehens oder auf<br />
Grund des dringenden Verdachts eines Vergehens, sofern Tatsachen die<br />
Annahme rechtfertigen, daß sie Schußwaffen oder Explosivmittel mit sich<br />
führt,<br />
5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam<br />
zu verhindern oder in sonstigen Fällen des Art. 107 des Bayerischen<br />
Strafvollzugsgesetzes.<br />
(2) Schußwaffen dürfen nach Absatz 1 Nr. 4 nicht gebraucht werden, wenn es<br />
sich um den Vollzug eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt<br />
oder wenn die Flucht aus einer offenen Anstalt verhindert werden soll.<br />
Bay PAG Art. 68 Schußwaffengebrauch gegen Personen in einer<br />
Menschenmenge<br />
(1) Schußwaffen dürfen gegen Personen in einer Menschenmenge nur<br />
gebraucht werden, wenn von ihr oder aus ihr heraus schwerwiegende<br />
Gewalttaten begangen werden oder unmittelbar bevorstehen und andere<br />
Maßnahmen keinen Erfolg versprechen.<br />
(2) Wer sich aus einer solchen Menschenmenge nach wiederholter Androhung<br />
des Schußwaffengebrauchs nicht entfernt, obwohl ihm das möglich ist, ist<br />
nicht als Unbeteiligter (Art. 66 Abs. 4) anzusehen.<br />
Bay PAG Art. 69 Besondere Waffen, Sprengmittel<br />
(1) Maschinengewehre und Handgranaten dürfen gegen Personen nur in den<br />
Fällen des Art. 67 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 5 und nur mit Zustimmung des<br />
Staatsministers des Innern oder eines von ihm im Einzelfall Beauftragten<br />
angewendet werden, wenn<br />
1. diese Personen von Schußwaffen oder Handgranaten oder ähnlichen<br />
Explosivmitteln Gebrauch gemacht haben und<br />
2. der vorherige Gebrauch anderer Waffen erfolglos geblieben ist.<br />
(2) 1 Maschinengewehre und Handgranaten dürfen nicht gebraucht werden,<br />
um fluchtunfähig zu machen. 2 Handgranaten dürfen gegen Personen in<br />
einer Menschenmenge nicht gebraucht werden.<br />
(3) Im übrigen sind die Vorschriften über den Schußwaffengebrauch<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
(4) Sprengmittel dürfen gegen Personen nicht angewendet werden.<br />
VI. ABSCHNITT Entschädigungs-, Erstattungs- und<br />
Ersatzansprüche<br />
Bay PAG Art. 70 Entschädigungsanspruch<br />
(1) Erleidet jemand, gegen den Maßnahmen nach Art. 10 getroffen worden<br />
sind, einen Schaden, so ist dem Geschädigten dafür Entschädigung zu<br />
leisten, soweit der Schaden durch die polizeiliche Maßnahme entstanden
ist und der Geschädigte nicht von einem anderen Ersatz zu erlangen<br />
vermag.<br />
(2) 1 Das gleiche gilt, wenn jemand, der nicht nach den Art. 7 oder 8<br />
verantwortlich ist und gegen den nicht Maßnahmen nach Art. 10 gerichtet<br />
worden sind, durch eine polizeiliche Maßnahme getötet oder verletzt wird<br />
oder einen nicht zumutbaren sonstigen Schaden erleidet. 2 Die<br />
Entschädigung ist auch zu leisten, soweit die Maßnahme auf einer<br />
richterlichen Anordnung beruht.<br />
(3) Im Fall der Tötung ist dem Unterhaltsberechtigten in entsprechender<br />
Anwendung von § 844 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
Entschädigung zu leisten.<br />
(4) Ein Entschädigungsanspruch nach den Absätzen 1 bis 3 besteht nicht,<br />
soweit die Maßnahme auch unmittelbar dem Schutz der Person oder des<br />
Vermögens des Geschädigten gedient hat.<br />
(5) Ist die Entschädigungspflicht aus Anlaß von Maßnahmen der Polizei in<br />
besonderen gesetzlichen Vorschriften geregelt, so gelten diese<br />
Vorschriften.<br />
(6) Entschädigungspflichtig ist der Träger der Polizei, welche die zur<br />
Entschädigung verpflichtende Maßnahme getroffen hat.<br />
(7) 1 Entschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 wird für Vermögensschäden<br />
gewährt; dabei sind Vermögensvorteile, die dem Berechtigten aus der zur<br />
Entschädigung verpflichtenden Maßnahme entstehen, zu berücksichtigen.<br />
2<br />
Bei Freiheitsentziehungen wird Entschädigung auch für<br />
Nichtvermögensschäden entsprechend § 7 Abs. 3 des <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) gewährt. 3 Ein<br />
mitwirkendes Verschulden des Berechtigten ist zu berücksichtigen. 4 Die<br />
Entschädigung wird in Geld gewährt.<br />
Bay PAG Art. 71 Erstattungsanspruch<br />
(1) Ist die Polizei auf Weisung oder Ersuchen einer nichtstaatlichen Behörde<br />
tätig geworden, so ist die Körperschaft, der die Behörde angehört, dem<br />
nach Art. 70 Abs. 6 Entschädigungspflichtigen erstattungspflichtig, soweit<br />
nicht der Schaden durch ein Verschulden der Polizei bei Durchführung der<br />
Maßnahme entstanden ist.<br />
(2) Die erstattungspflichtige Körperschaft hat dem entschädigungspflichtigen<br />
Polizeiträger die auf Grund des Art. 70 geleisteten notwendigen<br />
Aufwendungen zu erstatten.<br />
Bay PAG Art. 72 Ersatzanspruch<br />
(1) Hat der nach Art. 70 Abs. 6 entschädigungspflichtige Polizeiträger keinen<br />
Erstattungsanspruch nach Art. 71, so kann er von der nach Art. 7 oder 8<br />
verantwortlichen Person Ersatz der notwendigen Aufwendungen<br />
verlangen.<br />
(2) Hat die nach Art. 71 erstattungspflichtige Körperschaft ihre Verpflichtung<br />
erfüllt, so kann sie von dem nach Art. 7 oder 8 Verantwortlichen Ersatz<br />
der notwendigen Aufwendungen verlangen.
Bay PAG Art. 73 Rechtsweg<br />
(1) Über die Entschädigungsansprüche nach Art. 70 entscheiden im Streitfall<br />
die ordentlichen Gerichte.<br />
(2) Über die Erstattungsansprüche nach Art. 71 und die Ersatzansprüche nach<br />
Art. 72 entscheiden im Streitfall die Verwaltungsgerichte.<br />
VII. ABSCHNITT Schlußbestimmungen<br />
Bay PAG Art. 74 Einschränkung von Grundrechten<br />
Auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s können die Grundrechte auf Leben und körperliche<br />
Unversehrtheit, Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit und<br />
Unverletzlichkeit der Wohnung und das Fernmeldegeheimnis (Art. 2 Abs. 2<br />
Sätze 1 und 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 10, Art. 11 und Art. 13 des Grundgesetzes,<br />
Art. 102 Abs. 1, Art. 106 Abs. 3, Art. 112 Abs. 1, Art. 113 und Art. 109 der<br />
Verfassung) eingeschränkt werden.<br />
Bay PAG Art. 75 (weggefallen)<br />
Bay PAG Art. 76 Verhältnis zum Kostengesetz<br />
1 Art. 3 des Kostengesetzes ist nicht anzuwenden, soweit dieses Gesetz die<br />
Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt. 2 Die Gebühren sind<br />
abweichend von den Art. 6 und 8 des Kostengesetzes nach dem<br />
Verwaltungsaufwand und der Bedeutung der Amtshandlung zu bemessen.<br />
3 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit<br />
dem Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung die Gebühren zu<br />
bestimmen und die pauschale Abgeltung der Auslagen zu regeln. 4 Von der<br />
Erhebung der Kosten kann abgesehen werden, soweit sie der Billigkeit<br />
widerspricht.<br />
Bay PAG Art. 77 Begriff der Polizeibehörde<br />
1 Aufgaben und Befugnisse, die in bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften<br />
den “Polizeibehörden” übertragen sind, werden nur dann von der Polizei<br />
wahrgenommen, wenn das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit<br />
den sachlich beteiligten Staatsministerien es durch Verordnung bestimmt. 2 Im<br />
übrigen sind die Behörden der allgemeinen inneren Verwaltung zuständig,<br />
soweit nicht andere <strong>Gesetze</strong> eine besondere Regelung treffen.<br />
Bay PAG Art. 78 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s in der ursprünglichen<br />
Fassung vom 24. August 1978 (GVBl S. 561). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren<br />
Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1978 in Kraft.<br />
(2) Für die Präsidien Niederbayern/Oberpfalz, Oberbayern, Oberfranken und<br />
Schwaben gelten Art. 33 Abs. 5 und Art. 34 c Abs. 2 Satz 1 in der bis zum<br />
Ablauf des 31. Dezember 2007 geltenden Fassung fort, bis das<br />
Staatsministerium des Innern durch Verordnung nach Art. 14 Satz 1 POG<br />
die Gliederung nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 POG anordnet.
Gesetz über die Organisation der<br />
Bayerischen Staatlichen Polizei (Bay<br />
POG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 24. August 1990 (GVBl. S. 329), vom 23. Dezember 1994 (GVBl.<br />
S. 1050), vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 342), vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 541), vom 25.<br />
Oktober 2004 (GVBl. S. 400), vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 262), vom 26. Juli 2005 (GVBl. S. 287),<br />
vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 944)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
Art. 1 Begriff, Träger und Gliederung der Polizei<br />
Art. 2 Dienstkräfte der Polizei<br />
Art. 3 Zuständigkeit, Dienstbereiche<br />
Art. 4 Landespolizei<br />
Art. 5<br />
Art. 6 Bereitschaftspolizei<br />
Art. 7 Landeskriminalamt<br />
Art. 8 Polizeiverwaltungsamt<br />
Art. 9 Zusammenarbeit<br />
Art. 10 Besondere Zuständigkeiten<br />
Art. 11 Dienstkräfte anderer Länder sowie des Bundes oder anderer Staaten<br />
Art. 12 Rechtsbehelfe<br />
Art. 13<br />
Art. 14 Übergangsvorschrift<br />
Art. 15 Inkrafttreten
Bay POG Art. 1 Begriff, Träger und Gliederung der Polizei<br />
(1) Polizei im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist die gesamte Polizei des Freistaates<br />
Bayern.<br />
(2) Träger der Polizei ist der Freistaat Bayern.<br />
(3) 1 Die Polizei ist nach den Art. 4 bis 8 gegliedert. 2 Oberste Dienstbehörde<br />
und Führungsstelle der Polizei ist das Staatsministerium des Innern.<br />
Bay POG Art. 2 Dienstkräfte der Polizei<br />
(1) Als Dienstkräfte des polizeilichen Vollzugsdienstes dürfen nur Beamte<br />
verwendet werden.<br />
(2) Zur Verwarnung von Verkehrsteilnehmern nach § 57 des <strong>Gesetze</strong>s über<br />
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) wegen Zuwiderhandlungen gegen<br />
Vorschriften des Straßenverkehrsrechts können auch Angestellte<br />
ermächtigt werden.<br />
(3) 1 Dienstkräfte der Polizei dürfen sich während des Dienstes, in Dienstoder<br />
Unterkunftsräumen oder in Dienstkleidung parteipolitisch nicht<br />
betätigen. 2 In Dienstkleidung dürfen die Dienstkräfte politische<br />
Veranstaltungen nur dienstlich besuchen. 3 Politische Abzeichen dürfen<br />
während des Dienstes und an der Dienstkleidung nicht getragen werden.<br />
Bay POG Art. 3 Zuständigkeit, Dienstbereiche<br />
(1) Jeder im Vollzugsdienst tätige Beamte der Polizei ist zur Wahrnehmung<br />
der Aufgaben der Polizei im gesamten Staatsgebiet befugt.<br />
(2) 1 Die Beamten der Polizei werden unbeschadet des Absatzes 1 nach<br />
Maßgabe dieses <strong>Gesetze</strong>s in bestimmten örtlichen und sachlichen<br />
Dienstbereichen eingesetzt. 2 Beamte der Polizei werden jedoch im<br />
Einzelfall auch in Dienstbereichen, in denen sie nicht eingesetzt sind, tätig,<br />
wenn<br />
1. die dort eingesetzte Polizei nicht oder nicht rechtzeitig ausreichend zur<br />
Verfügung steht;<br />
2. das wegen des Zusammenhangs von Dienstverrichtungen im eigenen<br />
und in einem anderen Dienstbereich zweckmäßig ist;<br />
3. die für beide Dienstbereiche zuständige vorgesetzte Stelle sie dazu<br />
anweist oder<br />
4. das Gericht oder die Staatsanwaltschaft nach Feststellung<br />
schwerwiegender Gründe die Dienststelle der Beamten ersucht, in einem<br />
anderen örtlichen Dienstbereich an Stelle der dort eingesetzten Polizei<br />
strafverfolgend tätig zu werden.<br />
(3) weggefallen<br />
Bay POG Art. 4 Landespolizei<br />
(1) Die Bayerische Landespolizei wird im gesamten Staatsgebiet für alle der<br />
Polizei obliegenden Aufgaben eingesetzt, soweit nicht besondere örtliche<br />
und sachliche Dienstbereiche anderen Teilen der Polizei zugewiesen sind.<br />
(2) 1 Die Landespolizei gliedert sich in<br />
1. Präsidien, die dem Staatsministerium des Innern unmittelbar<br />
nachgeordnet sind,
2. Inspektionen und Kriminalfachdezernate, die den Präsidien unmittelbar<br />
nachgeordnet sind, und<br />
3. soweit erforderlich, den Inspektionen unmittelbar nachgeordnete<br />
Stationen.<br />
2<br />
Für bestimmte sachliche Dienstbereiche können besondere Inspektionen<br />
und Stationen der Landespolizei errichtet werden.<br />
(3) 1 Für die Wahrnehmung der grenzpolizeilichen Aufgaben der Landespolizei<br />
kann ein Präsidium zur Führungsstelle Grenze bestimmt werden. 2 Soweit<br />
Dienststellen der Landespolizei derartige Aufgaben wahrnehmen,<br />
unterliegen sie dessen fachlicher Weisung. 3 Grenzpolizeiliche Aufgaben<br />
sind<br />
1. die polizeiliche Überwachung der Landesgrenzen,<br />
2. die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs<br />
einschließlich<br />
a) der Überprüfung der Grenzübertrittspapiere und der Berechtigung zum<br />
Grenzübertritt sowie der beim Grenzübertritt mitgeführten Gegenstände<br />
und Transportmittel,<br />
b) der Grenzfahndung,<br />
c) der Beseitigung von Störungen und der Abwehr von Gefahren, die ihren<br />
Ursprung außerhalb des Bundesgebiets haben,<br />
3. im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 km die Beseitigung von<br />
Störungen und die Abwehr von Gefahren, die die Sicherheit der Grenzen<br />
beeinträchtigen.<br />
4<br />
Für Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit können durch<br />
das Staatsministerium des Innern Grenzbeauftragte bestellt werden.<br />
(4) Das Staatsministerium des Innern errichtet durch Verordnung die<br />
einzelnen Dienststellen der Landespolizei und bestimmt dabei<br />
insbesondere Bezeichnung, Sitz und Nachordnung.<br />
Bay POG Art. 5 (weggefallen)<br />
Bay POG Art. 6 Bereitschaftspolizei<br />
(1) 1 Die Bayerische Bereitschaftspolizei ist ein Polizeiverband, der<br />
insbesondere in geschlossenen Einheiten<br />
1. aus besonderem Anlaß zum Schutz oberster Staatsorgane und<br />
Behörden sowie lebenswichtiger Einrichtungen und Anlagen,<br />
2. zur Unterstützung anderer Teile der Polizei,<br />
3. zur Katastrophenhilfe<br />
eingesetzt wird. 2 Für diese Einsätze bedarf es der Weisung des<br />
Staatsministeriums des Innern.<br />
(2) Der Bereitschaftspolizei obliegt es ferner, Polizeibeamte für die Laufbahn<br />
des mittleren Dienstes auszubilden und unbeschadet der<br />
Fortbildungsveranstaltungen anderer Teile der Polizei Dienstkräfte der<br />
Polizei fortzubilden.<br />
(3) Bei der Bereitschaftspolizei besteht eine Hubschrauberstaffel, die nach<br />
Weisung des Staatsministeriums des Innern eingesetzt wird.<br />
(4) Die Bereitschaftspolizei gliedert sich in das Präsidium, das dem<br />
Staatsministerium des Innern unmittelbar nachgeordnet ist, und in<br />
Abteilungen, Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen.
(5) Das Staatsministerium des Innern errichtet durch Verordnung das<br />
Präsidium und die einzelnen Abteilungen und bestimmt deren Bezeichnung<br />
und Sitz.<br />
Bay POG Art. 7 Landeskriminalamt<br />
(1) 1 Das Bayerische Landeskriminalamt ist die zentrale Dienststelle für<br />
kriminalpolizeiliche Aufgaben. 2 Es ist dem Staatsministerium des Innern<br />
unmittelbar nachgeordnet. 3 Das Landeskriminalamt ist weiterhin zugleich<br />
zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei im Sinn des <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskriminalamtes),<br />
Zentralstelle für die polizeiliche Datenverarbeitung und Datenübermittlung<br />
und Fernmeldeleitstelle für die polizeiliche Nachrichtenübermittlung.<br />
(2) Dem Landeskriminalamt obliegt es insbesondere<br />
1. Nachrichten und Unterlagen für die Verhütung und polizeiliche<br />
Verfolgung von Straftaten zu sammeln und auszuwerten und über die<br />
Aufbewahrung solcher Unterlagen bei der Polizei für den Einzelfall zu<br />
entscheiden, soweit das Staatsministerium des Innern die Entscheidung<br />
nicht Dienststellen der Landespolizei übertragen hat;<br />
2. kriminalistische Methoden weiterzuentwickeln;<br />
3. andere Teile der Polizei über Maßnahmen zur Verhütung und<br />
polizeilichen Verfolgung von Straftaten zu beraten und die Beratung<br />
Dritter durch andere Teile der Polizei zu lenken, zu unterstützen sowie in<br />
besonderen Fällen selbst durchzuführen;<br />
4. Einrichtungen für erkennungsdienstliche, kriminaltechnische und<br />
kriminologische Untersuchungen und Forschungen zu unterhalten;<br />
5. auf Anforderung anderer Teile der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder<br />
auf Anordnung des Staatsministeriums des Innern oder des Gerichts<br />
erkennungsdienstliche und kriminaltechnische Untersuchungen<br />
durchzuführen sowie Gutachten zu erstatten und andere Teile der Polizei,<br />
soweit sie solche Aufgaben erfüllt, zu beraten und fachlich zu überwachen;<br />
6. mit Zustimmung des Staatsministeriums des Innern Richtlinien für die<br />
Durchführung kriminalpolizeilicher Aufgaben zu erlassen;<br />
7. als Zentralstelle Fahndungsmaßnahmen aufeinander abzustimmen<br />
sowie auf Weisung des Staatsministeriums des Innern zu lenken.<br />
(3) 1 Dem Landeskriminalamt obliegt die polizeiliche Verfolgung<br />
1. der Kernenergie-, Sprengstoff- und Strahlungsstraftaten in den Fällen<br />
der §§ 307, 308 Abs. 1 bis 4, §§ 309 bis 312, 326 Abs. 1 Nr. 3 dritte<br />
Alternative, auch in Verbindung mit Abs. 2, 4 und 5, § 326 Abs. 3, § 327<br />
Abs. 1 und 3 Nr. 1, §§ 328, 330 des Strafgesetzbuchs (StGB) und der<br />
Straftaten nach § 40 des Sprengstoffgesetzes und nach §§ 19, 20, 22 a<br />
des <strong>Gesetze</strong>s über die Kontrolle von Kriegswaffen;<br />
2. des unbefugten Handels mit Betäubungsmitteln in Fällen von<br />
präsidialübergreifender, landesweiter, bundesweiter oder internationaler<br />
Bedeutung;<br />
3. der Geld- und Wertzeichenfälschung (Achter Abschnitt StGB);<br />
4. des unbefugten Handels mit Schußwaffen und Munition;<br />
5. der Gründung politisch motivierter krimineller und terroristischer<br />
Vereinigungen und der Tätigkeit für solche Vereinigungen (§§ 129, 129 a,<br />
129 b StGB);
6. des Friedensverrats, Hochverrats, Landesverrats und der Gefährdung<br />
der äußeren Sicherheit (§§ 80, 80 a, 81 bis 83, 93 bis 101 a StGB, Art. 7<br />
des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes);<br />
7. der Straftaten, deren polizeiliche Verfolgung wegen der besonderen<br />
Gefährlichkeit, der räumlichen Ausdehnung oder wegen der besonderen<br />
Umstände der Begehung durch das Staatsministerium des Innern<br />
allgemein oder für den Einzelfall, im Bereich der Wirtschaftskriminalität<br />
und des Umweltschutzes auch durch das Gericht oder die<br />
Staatsanwaltschaft für den Einzelfall, dem Landeskriminalamt zugewiesen<br />
wird;<br />
8. der im Zusammenhang mit Straftaten in den Fällen der Nummern 1 bis<br />
7 stehenden anderen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.<br />
2<br />
In den Fällen des Satzes 1 obliegt dem Landeskriminalamt neben den<br />
Dienststellen der Landespolizei auch die Verhütung der jeweiligen<br />
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.<br />
(4) 1 Das Staatsministerium des Innern kann in den Fällen des Abs. 3 Satz 1<br />
Nrn. 1 bis 6 die Verhütung und polizeiliche Verfolgung für bestimmte<br />
Fallgruppen den Dienststellen der Landespolizei zuweisen. 2 Das<br />
Landeskriminalamt kann in den Fällen des Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und 8<br />
Dienststellen der Landespolizei je nach deren Dienstbereichen mit<br />
einzelnen Ermittlungshandlungen oder in den Fällen des Abs. 3 Satz 1<br />
Nrn. 1 bis 6 mit der Verhütung und polizeilichen Verfolgung von Straftaten<br />
insgesamt beauftragen. 3 Es kann der Landespolizei fachliche Weisungen<br />
erteilen, soweit es sich um die polizeiliche Verfolgung von Straftaten im<br />
Sinn des Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und 8 oder sonstiger Straftaten gegen<br />
die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die<br />
Sicherheit des Bundes oder eines Landes handelt.<br />
Bay POG Art. 8 Polizeiverwaltungsamt<br />
(1) 1 Das Bayerische Polizeiverwaltungsamt nimmt zentrale<br />
Verwaltungsaufgaben der Polizei wahr. 2 Es ist eine dem Staatsministerium<br />
des Innern unmittelbar nachgeordnete Dienststelle.<br />
(2) Das Polizeiverwaltungsamt kann durch Verordnung der Staatsregierung<br />
als Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 OWiG bestimmt werden,<br />
insbesondere wenn es sich um Ordnungswidrigkeiten nach § 24 oder<br />
§ 24 a des Straßenverkehrsgesetzes handelt.<br />
Bay POG Art. 9 Zusammenarbeit<br />
(1) Die Dienststellen der Polizei haben miteinander und mit anderen Stellen,<br />
denen die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
obliegt, zusammenzuarbeiten und die Sicherheitsbehörden über den<br />
Sicherheitszustand zu unterrichten.<br />
(2) Unbeschadet anderer Rechtsvorschriften, insbesondere des<br />
Gerichtsverfassungsgesetzes, der Strafprozeßordnung und des <strong>Gesetze</strong>s<br />
über Ordnungswidrigkeiten, können die Sicherheitsbehörden Dienststellen<br />
der Landespolizei Weisungen im polizeilichen Aufgabenbereich erteilen.<br />
(3) 1 Weisungen nach Absatz 2 sollen an die unterste Polizeidienststelle<br />
gerichtet werden, deren Dienstbereich für den Vollzug der Weisung
ausreicht. 2 Satz 1 gilt nicht für Weisungen des Staatsministeriums des<br />
Innern und der Regierungen.<br />
Bay POG Art. 10 Besondere Zuständigkeiten<br />
(1) Im Rahmen des Staatshaushaltsplans kann das Staatsministerium des<br />
Innern durch Verordnung einzelne Aufgaben der dem Staatsministerium<br />
des Innern unmittelbar nachgeordneten Dienststellen der Polizei einer<br />
dieser Dienststellen allein übertragen.<br />
(2) Die Polizei darf im Zuständigkeitsbereich eines anderen Landes der<br />
Bundesrepublik Deutschland oder des Bundes nur in den Fällen des Art. 11<br />
Abs. 3 dieses <strong>Gesetze</strong>s und des Art. 91 Abs. 2 des Grundgesetzes und nur<br />
dann tätig werden, wenn das jeweilige Landes- oder das Bundesrecht es<br />
vorsieht.<br />
(3) 1 Einer Anforderung von Polizei durch ein anderes Land oder den Bund ist<br />
zu entsprechen, soweit nicht die Verwendung der Polizei in Bayern<br />
dringender ist als die Unterstützung der Polizei des anderen Landes oder<br />
des Bundes. 2 Die Anforderung soll alle für die Entscheidung wesentlichen<br />
Merkmale des Einsatzauftrags enthalten.<br />
Bay POG Art. 11 Dienstkräfte anderer Länder sowie des Bundes oder<br />
anderer Staaten<br />
(1) Die Anforderung polizeilicher Dienstkräfte anderer Länder und des Bundes<br />
zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche<br />
demokratische Grundordnung des Bundes oder des Freistaates Bayern<br />
(Art. 91 Abs. 1 des Grundgesetzes) ist dem Bayerischen<br />
Ministerpräsidenten vorbehalten.<br />
(2) Zuständige Landesbehörde im Sinn von § 4 Abs. 2 Nr. 1 und § 17 Abs. 1<br />
Satz 1 des <strong>Gesetze</strong>s über das Bundeskriminalamt und die<br />
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen<br />
Angelegenheiten für Ersuchen an das Bundeskriminalamt,<br />
1. polizeiliche Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung in Einzelfällen<br />
wahrzunehmen, sind das Staatsministerium des Innern und die<br />
Generalstaatsanwälte bei den Oberlandesgerichten;<br />
2. Dienstkräfte zur Unterstützung polizeilicher<br />
Strafverfolgungsmaßnahmen zu Dienststellen der Polizei zu entsenden, ist<br />
das Staatsministerium des Innern.<br />
(3) 1 Polizeivollzugsbeamte eines anderen Landes der Bundesrepublik<br />
Deutschland können in Bayern Amtshandlungen vornehmen<br />
1. auf Anforderung oder mit Zustimmung des Staatsministeriums des<br />
Innern,<br />
2. in den Fällen des Art. 35 Abs. 2 und 3 und Art. 91 Abs. 1 des<br />
Grundgesetzes,<br />
3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung<br />
von Straftaten auf frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung<br />
Entwichener, wenn die zuständige Polizei die erforderlichen Maßnahmen<br />
nicht rechtzeitig treffen kann,<br />
4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten oder<br />
5. zur Erfüllung ihrer Aufgaben in den durch Verwaltungsabkommen des<br />
Staatsministeriums des Innern mit anderen Ländern geregelten Fällen.
2 In den Fällen der Nummern 3 und 5 ist die zuständige Polizeidienststelle<br />
unverzüglich zu unterrichten.<br />
(4) 1 Werden Polizeivollzugsbeamte eines anderen Landes nach Absatz 3 tätig,<br />
haben sie die gleichen Befugnisse wie die Bayerische Staatliche Polizei.<br />
2<br />
Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen derjenigen Polizeidienststelle, in<br />
deren örtlichem und sachlichem Dienstbereich sie tätig geworden sind; sie<br />
unterliegen insoweit deren Weisungen.<br />
(5) 1 Die Absätze 3 und 4 gelten für Polizeivollzugsbeamte des Bundes und<br />
Zolldienstbeamte, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung<br />
des unmittelbaren Zwanges nach dem Gesetz über den unmittelbaren<br />
Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des<br />
Bundes gestattet ist, entsprechend. 2 Das gleiche gilt für Bedienstete<br />
ausländischer Polizeibehörden und -dienststellen, soweit völkerrechtliche<br />
Verträge dies vorsehen oder das Staatsministerium des Innern<br />
Amtshandlungen dieser Polizeibehörden oder -dienststellen allgemein oder<br />
im Einzelfall zustimmt; in Bezug auf Maßnahmen der Strafverfolgung<br />
gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend, soweit die auf Grund einer<br />
zwischenstaatlichen Vereinbarung oder sonst nach dem Recht der<br />
internationalen Rechtshilfe zuständige Behörde zustimmt oder eine<br />
derartige Zustimmung nach den genannten Vorschriften entbehrlich ist.<br />
Bay POG Art. 12 Rechtsbehelfe<br />
(1) Für Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen der Polizei gelten die Vorschriften<br />
der Verwaltungsgerichtsordnung, soweit eine Zuständigkeit nach § 23 des<br />
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz nicht gegeben ist.<br />
(2) Über Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen, deren Ablehnung oder<br />
Unterlassung oder gegen das sonstige Verhalten der Polizei entscheidet<br />
1. das Staatsministerium des Innern, wenn es die Beschwerde an sich<br />
zieht;<br />
2. im Übrigen die dem Staatsministerium des Innern unmittelbar<br />
nachgeordnete Polizeidienststelle, wenn die Maßnahme von einem<br />
Beamten getroffen worden ist, der dieser oder einer ihr nachgeordneten<br />
Dienststelle angehört; hat eine andere Polizeidienststelle die<br />
Einsatzleitung übernommen oder zu der Maßnahme angewiesen, so ist die<br />
Maßnahme dieser Stelle zuzurechnen.<br />
(3) 1 Abweichend von Abs. 2 entscheidet die Staatsanwaltschaft, wenn<br />
1. der Beschwerdeführer geltend macht, durch eine strafprozessuale<br />
Maßnahme, ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt<br />
zu sein, oder<br />
2. die Beschwerde sich gegen eine Maßnahme richtet, die auf einer<br />
Anordnung der Staatsanwaltschaft beruht.<br />
2<br />
Die Polizei kann der Beschwerde abhelfen, wenn die Maßnahme nicht auf<br />
einer Anordnung der Staatsanwaltschaft beruht. 3 Im übrigen hat die<br />
Polizei die Staatsanwaltschaft von Aufsichtsbeschwerden in<br />
Angelegenheiten der Strafverfolgung, die sich nicht lediglich gegen das<br />
Verhalten der Polizei richten, vor der Entscheidung zu unterrichten.<br />
Bay POG Art. 13<br />
(1) gegenstandslos
(2) und (3) Änderungsbestimmungen<br />
(4) bis (6) gegenstandslos<br />
Bay POG Art. 14 Übergangsvorschrift<br />
1 Für die Präsidien Niederbayern/Oberpfalz, Oberbayern, Oberfranken und<br />
Schwaben gilt Art. 4 Abs. 2 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2007<br />
geltenden Fassung fort, bis das Staatsministerium des Innern die Gliederung<br />
nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 durch Verordnung anordnet. 2 Solang dies nicht bei<br />
allen Präsidien angeordnet wurde, führen die Präsidien, deren örtliche<br />
Dienstbereiche bereits nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 gegliedert sind, den Zusatz “<br />
(neu)”.<br />
Bay POG Art. 15 Inkrafttreten<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1976 in Kraft.<br />
(2) Abweichend von Absatz 1 treten Art. 4 Abs. 3, Art. 5 Abs. 2 und 4, Art. 6<br />
Abs. 5 und Art. 10 Abs. 1 am 1. September 1976 in Kraft.
<strong>Bayerisches</strong> Pressegesetz (Bay PrG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2000 (GVBl. S. 340), geändert durch <strong>Gesetze</strong><br />
vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 982), vom 10. April 2007 (GVBl. S. 281), vom 22. Dezember<br />
2009 (GVBl. S. 630) (FN BayRS 2250-1-I)<br />
Bay PrG Art. 1<br />
(1) Das Recht der freien Meinungsäußerung und die Pressefreiheit werden<br />
durch die Art. 110, 111 und 112 der Verfassung gewährleistet.<br />
(2) Sondermaßnahmen jeder Art, die die Pressefreiheit beeinträchtigen, sind<br />
unstatthaft.<br />
(3) Berufsorganisationen der Presse mit Zwangsmitgliedschaft und staatlichen<br />
Machtbefugnissen sowie eine <strong>Stand</strong>esgerichtsbarkeit der Presse sind nicht<br />
zulässig.<br />
Bay PrG Art. 2<br />
(1) Die Errichtung eines Verlagsunternehmens oder eines sonstigen Betriebs<br />
des Pressegewerbes bedarf keiner gewerberechtlichen Zulassung.<br />
(2) Die für alle Gewerbebetriebe geltenden Vorschriften bleiben unberührt.<br />
Bay PrG Art. 3<br />
(1) Die Presse dient dem demokratischen Gedanken.<br />
(2) Sie hat in Erfüllung dieser Aufgabe die Pflicht zu wahrheitsgemäßer<br />
Berichterstattung und das Recht, ungehindert Nachrichten und<br />
Informationen einzuholen, zu berichten und Kritik zu üben.<br />
(3) Im Rahmen dieser Rechte und Pflichten nimmt sie in Angelegenheiten des<br />
öffentlichen Lebens berechtigte Interessen im Sinn des § 193 des<br />
Strafgesetzbuchs wahr.<br />
Bay PrG Art. 4<br />
(1) 1 Die Presse hat gegenüber Behörden ein Recht auf Auskunft. 2 Sie kann es<br />
nur durch Redakteure oder andere von ihnen genügend ausgewiesene<br />
Mitarbeiter von Zeitungen oder Zeitschriften ausüben.<br />
(2) 1 Das Recht auf Auskunft kann nur gegenüber dem Behördenleiter und den<br />
von ihm Beauftragten geltend gemacht werden. 2 Die Auskunft darf nur<br />
verweigert werden, soweit auf Grund beamtenrechtlicher oder sonstiger<br />
gesetzlicher Vorschriften eine Verschwiegenheitspflicht besteht.<br />
Bay PrG Art. 5<br />
(1) Bei jeder Zeitung muss mindestens ein verantwortlicher Redakteur bestellt<br />
werden.<br />
(2) Als verantwortlicher Redakteur darf nicht tätig sein und beschäftigt<br />
werden, wer<br />
1. seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der<br />
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens<br />
über den Europäischen Wirtschaftsraum hat,
2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter,<br />
die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, oder das<br />
Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht<br />
besitzt,<br />
3. nicht unbeschränkt geschäftsfähig ist.<br />
(3) Wer nur mit besonderer Zustimmung oder Genehmigung strafrechtlich<br />
verfolgt werden kann, darf nicht verantwortlicher Redakteur für den<br />
politischen Teil einer Zeitung oder Zeitschrift sein.<br />
(4) Absatz 2 Nr. 3 gilt nicht für Druckwerke, die von Jugendlichen für<br />
Jugendliche herausgegeben werden.<br />
Bay PrG Art. 6<br />
(1) Druckwerke im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind alle mittels der<br />
Buchdruckerpresse oder eines sonstigen Vervielfältigungsverfahrens<br />
hergestellten und zur Verbreitung in der Öffentlichkeit bestimmten<br />
Schriften, bildlichen Darstellungen mit und ohne Schrift und Musikalien mit<br />
Text oder Erläuterungen.<br />
(2) Periodische Druckwerke sind Druckwerke, die in Zwischenräumen von<br />
höchstens sechs Monaten erscheinen.<br />
(3) 1 Zeitungen und Zeitschriften im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s sind periodische<br />
Druckwerke, deren Auflage 500 Stück übersteigt. 2 Periodische<br />
Druckwerke, deren Auflage 500 Stück nicht übersteigt, gelten als<br />
Zeitungen und Zeitschriften nur dann, wenn ihr Bezug nicht an einen<br />
bestimmten Personenkreis gebunden ist.<br />
Bay PrG Art. 7<br />
(1) 1 Auf jedem in Bayern erscheinenden Druckwerk muss der Drucker und<br />
Verleger, beim Selbstverlag der Verfasser oder Herausgeber genannt sein.<br />
2<br />
Anzugeben sind Name oder Firma und Anschrift.<br />
(2) Ausgenommen sind Druckwerke, die ausschließlich Zwecken des<br />
Gewerbes oder Verkehrs oder des häuslichen oder geselligen Lebens<br />
dienen, wie Formblätter, Preislisten, Gebrauchsanweisungen, Fahrkarten,<br />
Familienanzeigen und dergleichen.<br />
(3) Ausgenommen sind weiter Stimmzettel für Wahlen, sofern sie lediglich<br />
Zweck, Zeit und Ort der Wahl und die Namen der Parteien und<br />
Wahlbewerber enthalten.<br />
Bay PrG Art. 8<br />
(1) 1 Zeitungen und Zeitschriften müssen auf jeder Nummer außerdem den<br />
Namen und die Anschrift des oder der verantwortlichen Redakteure<br />
enthalten. 2 Das gilt nicht für Amtsblätter öffentlicher Behörden.<br />
(2) 1 Sind mehrere verantwortliche Redakteure bestellt, so muss ersichtlich<br />
sein, für welches Sachgebiet ein jeder verantwortlich ist. 2 Auch für den<br />
Anzeigenteil muss eine verantwortliche Person benannt werden.<br />
(3) 1 Die Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse eines Verlags, der eine<br />
Zeitung oder eine Zeitschrift herausgibt, sind wie folgt bekannt zu geben:<br />
1. bei Herausgabe einer Zeitung oder einer wöchentlich erscheinenden
Zeitschrift in dem Impressum der ersten Ausgabe jedes<br />
Kalenderhalbjahres,<br />
2. bei Herausgabe einer anderen Zeitschrift in dem Impressum der ersten<br />
Ausgabe jedes Kalenderjahres.<br />
2<br />
Außerdem sind Änderungen der Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse<br />
unverzüglich im Impressum zu veröffentlichen.<br />
(4) Zeitungen und Anschlusszeitungen, die regelmäßig wesentliche Teile fertig<br />
übernehmen, haben im Impressum auch den für den übernommenen Teil<br />
verantwortlichen Redakteur und den Verleger des anderen Druckwerks zu<br />
benennen.<br />
Bay PrG Art. 9<br />
Bei Zeitungen und Zeitschriften müssen Teile, insbesondere Anzeigen- und<br />
Reklametexte, deren Abdruck gegen Entgelt erfolgt, kenntlich gemacht<br />
werden.<br />
Bay PrG Art. 10<br />
(1) 1 Der verantwortliche Redakteur und der Verleger einer Zeitung oder<br />
Zeitschrift sind verpflichtet, zu Tatsachen, die darin mitgeteilt wurden, auf<br />
Verlangen einer unmittelbar betroffenen Person oder Behörde deren<br />
Gegendarstellung abzudrucken. 2 Sie muss die beanstandeten Stellen<br />
bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben beschränken und vom<br />
Einsender unterzeichnet sein. 3 Ergeben sich begründete Zweifel an der<br />
Echtheit der Unterschrift einer Gegendarstellung, so kann die<br />
Beglaubigung der Unterschrift verlangt werden.<br />
(2) 1 Der Abdruck muss unverzüglich, und zwar in demselben Teil des<br />
Druckwerks und mit derselben Schrift wie der Abdruck des beanstandeten<br />
Textes ohne Einschaltungen und Weglassungen erfolgen. 2 Der Abdruck<br />
darf nur mit der Begründung verweigert werden, dass die<br />
Gegendarstellung einen strafbaren Inhalt habe. 3 Die Gegendarstellung soll<br />
den Umfang des beanstandeten Textes nicht wesentlich überschreiten.<br />
4<br />
Die Aufnahme erfolgt insoweit kostenfrei.<br />
(3) Der Anspruch auf Aufnahme der Gegendarstellung kann auch im<br />
Zivilrechtsweg verfolgt werden.<br />
Bay PrG Art. 10 a<br />
Soweit Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Presse personenbezogene<br />
Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen<br />
Zwecken unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen oder in oder aus<br />
nichtautomatisierten Dateien erheben, verarbeiten oder nutzen, gelten von den<br />
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes nur die §§ 5, 9 und 38 a sowie<br />
§ 7 mit der Maßgabe, dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch eine<br />
Verletzung des Datengeheimnisses im Sinn des § 5 des<br />
Bundesdatenschutzgesetzes oder durch unzureichende technische oder<br />
organisatorische Maßnahmen im Sinn des § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes<br />
eintreten.
Bay PrG Art. 11<br />
(1) Die Verantwortlichkeit für strafbare Handlungen, die mittels eines<br />
Druckwerks begangen werden, bestimmt sich nach den allgemeinen<br />
Strafgesetzen.<br />
(2) Zu Lasten des verantwortlichen Redakteurs eines periodischen Druckwerks<br />
wird vermutet, dass er den Inhalt eines unter seiner Verantwortung<br />
erschienenen Textes gekannt und den Abdruck gebilligt hat.<br />
(3) 1 Wer als verantwortlicher Redakteur, Verleger, Drucker oder Verbreiter<br />
am Erscheinen eines Druckwerks strafbaren Inhalts mitgewirkt hat, wird,<br />
wenn er nicht schon nach Absatz 1 als Täter oder Teilnehmer zu bestrafen<br />
ist, wegen fahrlässiger Veröffentlichung mit Freiheitsstrafe bis zu einem<br />
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, sofern er nicht die pflichtgemäße<br />
Sorgfalt angewandt hat. 2 Die Bestrafung des Vormanns schließt die des<br />
Nachmanns aus.<br />
Bay PrG Art. 12<br />
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, soweit die Tat nicht nach anderen<br />
Vorschriften mit Strafe bedroht ist:<br />
1. wer den in den Art. 7, 8 und 9 enthaltenen Vorschriften<br />
zuwiderhandelt;<br />
2. wer als Unternehmer Druckwerke vertreibt, in denen die in Art. 7<br />
vorgeschriebenen Angaben fehlen;<br />
3. wer als verantwortlicher Redakteur oder Verleger einer Zeitung oder<br />
Zeitschrift den Abdruck einer Gegendarstellung (Art. 10) verweigert. Die<br />
Verfolgung tritt nur auf Antrag der betroffenen Person oder Behörde ein.<br />
Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig. Bei der Ahndung ist der<br />
Abdruck der Gegendarstellung anzuordnen, wenn dies von dem<br />
Antragsberechtigten verlangt wird;<br />
4. wer wider besseres Wissen den Abdruck einer in wesentlichen Punkten<br />
unwahren Darstellung oder Gegendarstellung erwirkt. Die Verfolgung tritt<br />
nur auf Antrag des Betroffenen, des Redakteurs oder des Verlegers ein.<br />
Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig;<br />
5. wer einer gerichtlichen Anordnung zum Abdruck der Gegendarstellung<br />
nicht unverzüglich nachkommt.<br />
(2) 1 In den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1 und 2 kann auf Einziehung der<br />
Druckwerke und des zu ihrer Herstellung verwendeten Materials erkannt<br />
werden. 2 § 23 des <strong>Gesetze</strong>s über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.<br />
Bay PrG Art. 13<br />
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,<br />
1. wer als Verleger eine Person zum verantwortlichen Redakteur bestellt, die<br />
nicht den Bestimmungen des Art. 5 Abs. 2 entspricht;<br />
2. wer als verantwortlicher Redakteur zeichnet, obwohl ihm das nach Art. 5<br />
Abs. 2 und 3 untersagt ist;<br />
3. wer ein beschlagnahmtes Druckwerk in Kenntnis der Beschlagnahme<br />
verbreitet;<br />
4. wer in Kenntnis des strafbaren Inhalts einer Druckschrift den Vorschriften<br />
der Art. 7 und 8 zuwiderhandelt;
5. wer über die Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse (Art. 8 Abs. 3)<br />
wissentlich falsche Angaben macht.<br />
Bay PrG Art. 14<br />
(1) 1 Die Verfolgung der in diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Handlungen<br />
und derjenigen Taten, welche durch Verbreitung von Druckwerken<br />
strafbaren Inhalts begangen werden, verjährt in sechs Monaten. 2 Dies gilt<br />
nicht für Taten<br />
1. nach §§ 130, 131, §§ 184 a und 184 b des Strafgesetzbuchs ,<br />
2. nach §§ 86, 86 a, § 129 a Abs. 5 des Strafgesetzbuchs und § 20 des<br />
Vereinsgesetzes, die mittels eines nichtperiodischen Druckwerks begangen<br />
werden und<br />
3. nach § 264 a des Strafgesetzbuchs, § 38 des<br />
Wertpapierhandelsgesetzes und § 399 des Aktiengesetzes.<br />
(2) Die Verfolgung der in Art. 12 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in<br />
drei Monaten.<br />
(3) 1 Der Lauf der Frist beginnt mit dem Erscheinen des Druckwerks. 2 Mit dem<br />
Erscheinen einer neuen Auflage des Druckwerks beginnt die Frist von<br />
neuem.<br />
Bay PrG Art. 15<br />
(1) Die Anordnung der Beschlagnahme von Druckwerken steht abweichend<br />
von § 98 der Strafprozeßordnung nur dem Richter zu.<br />
(2) 1 Die Polizei ist berechtigt, gegen Art. 7 verstoßende Druckwerke und<br />
Druckwerke strafbaren Inhalts mit Ausnahme von Zeitungen und<br />
Zeitschriften dem Verbreiter vorläufig wegzunehmen. 2 Sie hat dieselben<br />
unverzüglich dem Richter vorzulegen, der innerhalb von 24 Stunden eine<br />
Entscheidung zu treffen hat.<br />
Bay PrG Art. 16<br />
(1) Die Beschlagnahme eines Druckwerks umfasst alle Stücke, die sich im<br />
Besitz des Verlegers, Herausgebers, Redakteurs, Verfassers, Druckers<br />
oder Händlers befinden sowie die öffentlich ausgelegten oder öffentlich<br />
angebotenen Stücke.<br />
(2) Die Beschlagnahme eines Druckwerks kann auf das zu seiner Herstellung<br />
verwandte Material (Drucksatz, Druckform, Platten, Klischees) erstreckt<br />
werden.<br />
(3) Trennbare Teile des Druckwerks, welche nichts Strafbares enthalten, sind<br />
von der Beschlagnahme auszuschließen.<br />
Bay PrG Art. 17<br />
Die Bestimmungen dieses <strong>Gesetze</strong>s gelten sinngemäß auch für<br />
Nachrichtenagenturen, Pressebüros und ähnliche Unternehmen.
Bay PrG Art. 18<br />
(1) 1 Dieses Gesetz ist dringlich. 2 Es tritt am 1. Juli 1949 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten des <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ursprünglichen Fassung vom 3. Oktober 1949 (GVBl S. 243). Der Zeitpunkt des In-Kraft-<br />
Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.<br />
(2) 1 Das Staatsministerium des Innern erlässt durch Rechtsverordnung die<br />
näheren Bestimmungen über die Bekanntgabe der Inhaber- und<br />
Beteiligungsverhältnisse (Art. 8 Abs. 3) sowie die zur Durchführung dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s erforderlichen Verwaltungsvorschriften.<br />
2<br />
Verwaltungsvorschriften, die nur den Geschäftsbereich eines anderen<br />
Staatsministeriums betreffen, erlässt dieses Staatsministerium im<br />
Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern.
<strong>Bayerisches</strong> Gesetz zur obligatorischen<br />
außergerichtlichen Streitschlichtung in<br />
Zivilsachen und zur Änderung<br />
gerichtsverfassungsrechtlicher<br />
Vorschriften (Bay SchlG)<br />
vom 25. April 2000 (GVBl. S. 268), geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 2. Januar 2002 (GVBl. S. 3, ber.<br />
S. 39), vom 25. Oktober 2004 (GVBl. S. 400), vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 655), vom 24.<br />
Mai 2007 (GVBl. S. 343), vom 22. Dezember 2008 (GVBl. S. 977) (FN BayRS 300-1-5-J)<br />
Abschnitt I Obligatorische Schlichtung als Prozessvoraussetzung<br />
Bay SchlG Art. 1 Sachlicher Umfang der obligatorischen Schlichtung<br />
Vor den Amtsgerichten kann in folgenden bürgerlichrechtlichen Streitigkeiten<br />
mit Ausnahme der in § 15 a Abs. 2 EGZPO genannten Streitigkeiten eine Klage<br />
erst erhoben werden, wenn die Parteien einen Versuch unternommen haben,<br />
die Streitigkeit vor einer in Art. 3 genannten Schlichtungs- oder Gütestelle<br />
gütlich beizulegen:<br />
1. weggefallen<br />
2. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen<br />
a) der in § 906 BGB geregelten Einwirkungen auf das Nachbargrundstück,<br />
sofern es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt,<br />
b) Überwuchses nach § 910 BGB,<br />
c) Hinüberfalls nach § 911 BGB,<br />
d) eines Grenzbaums nach § 923 BGB,<br />
e) der in den Art. 43 bis 54 AGBGB geregelten Nachbarrechte, sofern es sich<br />
nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt,<br />
3. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen der Verletzung der persönlichen<br />
Ehre, die nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden ist,<br />
4. in Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen<br />
Gleichbehandlungsgesetzes.<br />
Bay SchlG Art. 2 Örtlicher Umfang der obligatorischen Schlichtung<br />
1 Ein Schlichtungsversuch nach Art. 1 vor Erhebung der Klage ist nur<br />
erforderlich, wenn die Parteien ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder ihre<br />
Niederlassung im selben Landgerichtsbezirk haben. 2 Die Bezirke der<br />
Landgerichte München I und München II gelten insoweit als ein<br />
Landgerichtsbezirk.<br />
Bay SchlG Art. 3 Schlichtungsstellen<br />
(1) 1 Die Parteien können sich für einen Schlichtungsversuch einvernehmlich<br />
an jeden Rechtsanwalt, der nicht Parteivertreter ist, an jeden Notar oder<br />
an dauerhaft eingerichtete Schlichtungsstellen der Kammern, Innungen,<br />
Berufsverbände oder ähnliche Institutionen im Sinn von § 15 a Abs. 3<br />
EGZPO wenden. 2 Das Einvernehmen nach Satz 1 wird unwiderleglich
vermutet, wenn der Verbraucher eine branchengebundene<br />
Schlichtungsstelle, eine Schlichtungsstelle der Industrie- und<br />
Handelskammer, der Handwerkskammer oder der Innung angerufen hat.<br />
3 Fehlt es am Einvernehmen nach den Sätzen 1 und 2, ist der<br />
Schlichtungsversuch vor einem örtlich zuständigen Schlichter der<br />
Gütestellen nach Art. 5 durchzuführen.<br />
(2) Ein Schlichter ist von der Schlichtung ausgeschlossen, wenn die<br />
Voraussetzungen des § 41 ZPO vorliegen.<br />
Bay SchlG Art. 4 Bescheinigung über erfolglosen Schlichtungsversuch<br />
(1) 1 Bleibt der Schlichtungsversuch erfolglos, so ist dem Antragsteller darüber<br />
ein Zeugnis auszustellen, das dem Gericht bei Klageerhebung vorzulegen<br />
ist. 2 Das Zeugnis wird auf Antrag auch erteilt, wenn binnen einer Frist von<br />
drei Monaten das beantragte Schlichtungsverfahren nicht durchgeführt<br />
worden ist. 3 Die Frist beginnt nicht vor Einzahlung des Vorschusses<br />
gemäß Art. 14.<br />
(2) Das Zeugnis ist außerdem auszustellen, wenn der Schlichter den<br />
sachlichen Anwendungsbereich nach Art. 1 oder, soweit dies zwischen den<br />
Parteien strittig ist, den örtlichen Anwendungsbereich nach Art. 2 für nicht<br />
eröffnet oder die Angelegenheit für eine Schlichtung aus rechtlichen oder<br />
tatsächlichen Gründen von vorneherein für ungeeignet erachtet.<br />
(3) 1 Das Zeugnis hat auch die Namen und die Anschriften des Antragstellers<br />
und des Antragsgegners, eine kurze Darstellung des Streitgegenstands,<br />
Angaben zum Streitwert sowie den Zeitpunkt, zu dem das Verfahren<br />
beendet ist, zu enthalten. 2 Wird das Zeugnis ausgestellt, weil der<br />
Schlichter die Angelegenheit für eine Schlichtung für ungeeignet erachtet,<br />
sind die Gründe dafür im Zeugnis anzugeben.<br />
Abschnitt II Gütestellen nach § 15 a Abs. 1 EGZPO<br />
Bay SchlG Art. 5 Einrichtung der Gütestellen<br />
(1) Jeder Notar ist als Träger eines öffentlichen Amtes Gütestelle.<br />
(2) 1 Jeder Rechtsanwalt, der sich gegenüber der Rechtsanwaltskammer dazu<br />
verpflichtet hat, Schlichtung als dauerhafte Aufgabe zu betreiben, ist<br />
durch die Rechtsanwaltskammer als Gütestelle zuzulassen. 2 Die<br />
Zulassung kann widerrufen werden, wenn die Pflichten nach Art. 8<br />
gröblich vernachlässigt werden.<br />
(3) 1 Die Gütestellen nach den Absätzen 1 und 2 sind landesrechtlich<br />
anerkannte Gütestellen nach § 15 a Abs. 6 EGZPO. 2 Der Präsident des<br />
Oberlandesgerichts München kann weitere Gütestellen nach § 794 Abs. 1<br />
Nr. 1 ZPO unter den Voraussetzungen des Art. 22 AGGVG einrichten und<br />
anerkennen.<br />
Bay SchlG Art. 6 Auswahl unter den Gütestellen<br />
1 Unter mehreren Gütestellen des Landgerichtsbezirks hat die antragstellende<br />
Partei die Auswahl. 2 Bestehen in dem Amtsgerichtsbezirk, in dem der<br />
Antragsgegner seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder seine Niederlassung hat,
Gütestellen, so kann die antragstellende Partei nur unter diesen auswählen.<br />
3 Die zuerst angerufene Gütestelle ist auch für einen Gegenantrag zuständig.<br />
Bay SchlG Art. 7 Aufnahme des Schlichtungsantrags durch die<br />
Gütestelle<br />
1 Die Gütestelle nimmt den schriftlichen Schlichtungsantrag während der<br />
üblichen Geschäftszeiten entgegen und registriert ihn. 2 Der Schlichtungsantrag<br />
kann auch zu Protokoll der Gütestelle erklärt werden.<br />
Bay SchlG Art. 8 Schlichter, Pflichten aus dem Schlichteramt<br />
(1) 1 Schlichter der Gütestellen nach Art. 5 Abs. 1 und 2 sind Personen, die<br />
den Beruf des Notars oder des Rechtsanwalts ausüben. 2 Sie beachten bei<br />
Ausübung des Schlichteramts ihre allgemeinen Berufspflichten. 3 Sie üben<br />
ihr Amt unparteiisch und unabhängig aus. 4 Sie tragen für eine zügige<br />
Erledigung der Schlichtungsverfahren Sorge.<br />
(2) 1 Den Schlichtern steht hinsichtlich der Tatsachen, die Gegenstand des<br />
Schlichtungsverfahrens sind, ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. 2 Wer als<br />
Schlichter tätig war, kann in derselben Sache keine der Parteien im<br />
gerichtlichen Verfahren vertreten.<br />
(3) 1 Die Aufsicht über die Notare als Schlichter führt die Landesnotarkammer,<br />
die Aufsicht über die Rechtsanwälte als Schlichter die jeweils zuständige<br />
Rechtsanwaltskammer. 2 Die Aufsichtsbehörde kann die hierfür<br />
erforderlichen Verwaltungsanordnungen treffen. 3 Sie hat darauf zu<br />
achten, dass die Schlichter den ihnen nach diesem Gesetz obliegenden<br />
Verpflichtungen nachkommen. 4 Sie kann jederzeit Auskunft über alle die<br />
Geschäftsführung betreffenden Angelegenheiten verlangen.<br />
Abschnitt III Durchführung des Schlichtungsverfahrens vor dem<br />
Schlichter der Gütestelle nach Abschnitt II<br />
Bay SchlG Art. 9 Verfahrenseinleitung<br />
1 Das Schlichtungsverfahren wird auf Antrag eingeleitet. 2 Der Antrag muss<br />
Namen und ladungsfähige Anschrift der Parteien, eine kurze Darstellung der<br />
Streitsache und den Gegenstand des Begehrens enthalten. 3 Ihm sollen die für<br />
die förmliche Mitteilung erforderlichen Abschriften beigefügt werden.<br />
Bay SchlG Art. 10 Gang des Schlichtungsverfahrens<br />
(1) 1 Sobald dem Schlichter der Antrag vorliegt und der Vorschuss (Art. 14)<br />
eingezahlt worden ist, bestimmt er einen Schlichtungstermin, zu dem er<br />
die Parteien persönlich lädt. 2 Er erörtert mit den Parteien mündlich die<br />
Streitsache und die Konfliktlösungsvorschläge der Parteien. 3 Zur<br />
Aufklärung der Interessenlage kann er mit den Parteien in deren<br />
Einvernehmen auch Einzelgespräche führen. 4 Auf der Grundlage der<br />
Schlichtungsverhandlung kann er den Parteien einen Vorschlag zur<br />
Konfliktbeilegung unterbreiten. 5 In geeigneten Fällen sieht der Schlichter<br />
von einem Termin ab und verfährt schriftlich.<br />
(2) Die Schlichtungsverhandlung ist nicht öffentlich.
(3) 1 Der Schlichter lädt keine Zeugen und Sachverständigen. 2 Zeugen und<br />
Sachverständige, die von den Parteien auf deren Kosten herbeigeschafft<br />
werden, können angehört, und ein Augenschein kann eingenommen<br />
werden, wenn dadurch der Abschluss des Schlichtungsverfahrens nicht<br />
unverhältnismäßig verzögert wird.<br />
(4) Im Übrigen bestimmt der Schlichter das zur zügigen Erledigung der<br />
Streitsache zweckmäßige Verfahren nach seinem Ermessen.<br />
Bay SchlG Art. 11 Persönliches Erscheinen der Parteien<br />
(1) Die Parteien haben im Schlichtungstermin persönlich zu erscheinen.<br />
(2) Dies gilt nicht, wenn eine Partei zu dem Termin eine Vertretung<br />
entsendet, die zur Aufklärung des Sachverhalts in der Lage und zu einem<br />
unbedingten Vergleichsabschluss schriftlich ermächtigt ist, und der<br />
Schlichter dem Fernbleiben der Partei zustimmt.<br />
(3) Jede Partei kann sich im Termin eines Beistands oder eines Rechtsanwalts<br />
bedienen.<br />
(4) 1 Erscheint der Antragsteller unentschuldigt nicht zum Schlichtungstermin,<br />
gilt der Antrag als zurückgenommen; bei hinreichender Entschuldigung<br />
binnen 14 Tagen ist vom Schlichter ein neuer Schlichtungstermin zu<br />
bestimmen. 2 Der Antrag gilt auch als zurückgenommen, wenn der<br />
Vorschuss nach Art. 14 nicht in der vom Schlichter gesetzten Frist<br />
einbezahlt wurde. 3 Fehlt die Gegenpartei unentschuldigt, so ist dem<br />
Antragsteller frühestens nach 14 Tagen ein Zeugnis nach Art. 4<br />
auszustellen. 4 In der Ladung sind die Parteien auf die Folgen ihres<br />
Ausbleibens hinzuweisen.<br />
Bay SchlG Art. 12 Protokollierung der Konfliktbeilegung<br />
1 Wird vor dem Schlichter eine Vereinbarung zur Konfliktbeilegung geschlossen,<br />
so ist diese unter Angabe des Tages ihres Zustandekommens schriftlich<br />
niederzulegen und von den Parteien zu unterschreiben. 2 Der Schlichter<br />
bestätigt den Abschluss der Vereinbarung mit seiner Unterschrift. 3 Die<br />
Konfliktregelung muss auch eine Einigung der Parteien über die Kosten des<br />
Schlichtungsverfahrens enthalten. 4 Die Kosten des Schlichtungsverfahrens<br />
sind der Höhe nach auszuweisen. 5 Die Parteien erhalten vom Schlichter auf<br />
Antrag eine Abschrift der Vereinbarung.<br />
Abschnitt IV Vergütung für das Güteverfahren der Gütestellen<br />
nach Abschnitt II und deren Vollstreckung<br />
Bay SchlG Art. 13 Vergütung<br />
(1) 1 Die Schlichter nach Art. 5 Abs. 1 und 2 erheben für ihre Tätigkeit eine<br />
Vergütung (Gebühren und Auslagen) nur nach diesem Gesetz. 2 Sie<br />
erhalten Ersatz der auf die Vergütung entfallenden Umsatzsteuer, sofern<br />
diese nicht nach § 19 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt.<br />
(2) Die Gebühr für das Schlichtungsverfahren beträgt<br />
1. 50 Euro, wenn das Verfahren ohne Schlichtungsgespräch endet,<br />
2. 100 Euro, wenn ein Schlichtungsgespräch durchgeführt wurde.
(3) Werden Schlichter im Rahmen des Vollzugs der Vereinbarung zur<br />
Konfliktbewältigung im Auftrag beider Parteien tätig, entsteht eine weitere<br />
Gebühr in Höhe von 50 Euro.<br />
(4) 1 Mit der Gebühr werden die allgemeinen Geschäftsunkosten der Schlichter<br />
abgegolten. 2 Für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie<br />
Schreibauslagen können die Schlichter einen Pauschsatz von 20 Euro<br />
fordern.<br />
Bay SchlG Art. 14 Vorschuss für die Vergütung<br />
(1) Der Schlichter fordert vom Antragsteller vor Durchführung des<br />
Schlichtungsverfahrens einen Vorschuss in Höhe der Gebühr nach Art. 13<br />
Abs. 2 Nr. 2 zuzüglich der Auslagen nach Art. 13 Abs. 4.<br />
(2) Nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens rechnet der Schlichter<br />
gegenüber dem Antragsteller über den Vorschuss ab.<br />
Bay SchlG Art. 15 Vergütungsfreiheit<br />
(1) Eine Partei, die die Voraussetzungen für die Gewährung von<br />
Beratungshilfe nach den Vorschriften des Beratungshilfegesetzes erfüllt,<br />
ist von der Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung befreit.<br />
(2) § 4 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 bis 3, §§ 5 und 6 des Beratungshilfegesetzes<br />
finden entsprechende Anwendung.<br />
(3) 1 Ist die Partei nach Absatz 1 von der Verpflichtung zur Zahlung der<br />
Vergütung befreit, erstattet die Staatskasse dem Schlichter die ihm<br />
zustehende Vergütung. 2 Die Erstattung der Schlichtervergütung durch die<br />
Staatskasse ist in der Bescheinigung nach Art. 4 zu vermerken.<br />
Bay SchlG Art. 16 Beitreibung der Vergütung durch die Staatskasse<br />
(1) Ist dem Schlichter die Vergütung nach Art. 15 Abs. 3 erstattet worden, so<br />
geht der Anspruch auf Kostenerstattung, der sich aus der Verurteilung des<br />
Gegners in die Prozesskosten im nachfolgenden Gerichtsverfahren ergibt,<br />
insoweit auf die Staatskasse über.<br />
(2) 1 Der Vergütungsanspruch nach Absatz 1 ist von der Staatskasse nach den<br />
Vorschriften über die Einziehung der Kosten des gerichtlichen Verfahrens<br />
geltend zu machen. 2 Die Ansprüche werden bei dem Amtsgericht<br />
angesetzt, bei dem der nachfolgende Rechtsstreit geführt wurde. 3 Für die<br />
Entscheidung über eine gegen den Ansatz gerichtete Erinnerung und über<br />
die Beschwerde gilt § 5 Gerichtskostengesetz entsprechend.<br />
Bay SchlG Art. 17 Aufwendungen der Beteiligten<br />
1 Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten. 2 Kosten werden, vorbehaltlich einer<br />
anderen Regelung in der Vereinbarung zur Konfliktbeilegung, nicht erstattet.
Abschnitt V Vollstreckung aus dem Vergleich der Gütestellen und<br />
Klauselerteilung<br />
Bay SchlG Art. 18 Vollstreckung aus einem Vergleich<br />
Aus einem vor dem Schlichter der Gütestelle geschlossenen Vergleich findet<br />
die Zwangsvollstreckung nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statt.<br />
Bay SchlG Art. 19 Erteilung der Vollstreckungsklausel<br />
(1) Die Vollstreckungsklausel auf einem Vergleich einer Gütestelle nach Art. 5<br />
Abs. 1 erteilt der Notar.<br />
(2) Die Vollstreckungsklausel auf einem Vergleich einer Gütestelle nach Art. 5<br />
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 erteilt der Rechtspfleger des Amtsgerichts, in<br />
dessen Bezirk die Gütestelle eingerichtet ist.<br />
Abschnitt VI Änderung des AGGVG, In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-<br />
Treten und Übergangsvorschriften<br />
Bay SchlG Art. 20 (Änderung des AGGVG)<br />
Bay SchlG Art. 21 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten<br />
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2000 in Kraft.<br />
(2) 1 Art. 1 Nr. 1 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft. 2 Art. 1<br />
bis 19 und Art. 20 Nrn. 1 und 9 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2011<br />
außer Kraft.<br />
Bay SchlG Art. 22 Übergangsvorschrift<br />
Dieses Gesetz findet auf alle Klagen Anwendung, die<br />
1. in den Fällen des Art. 1 Nr. 1 vor dem 1. Januar 2006,<br />
2. in den Fällen des Art. 1 Nrn. 2 bis 4 vor dem 1. Januar 2012<br />
bei Gericht eingehen.
<strong>Bayerisches</strong> Straßen- und Wegegesetz<br />
(Bay StrWG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 16. Juli 1986 (GVBl. S. 135), vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 323), vom<br />
27. Dezember 1999 (GVBl. S. 532), vom 9. Juli 2003 (GVBl. S. 419), vom 26. Juli 2005 (GVBl.<br />
S. 287), vom 10. April 2007 (GVBl. S. 271), vom 24. Juli 2007 (GVBl. S. 499), vom 20. Dezember<br />
2007 (GVBl. S. 958)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften<br />
ABSCHNITT 1 Grundsatzvorschriften<br />
Art. 1 Geltungsbereich<br />
Art. 2 Bestandteile der Straßen<br />
Art. 3 Einteilung der Straßen<br />
Art. 4 Ortsdurchfahrten<br />
Art. 5<br />
Art. 6 Widmung<br />
Art. 7 Umstufung<br />
Art. 8 Einziehung<br />
Art. 9 Straßenbaulast<br />
Art. 10 Sicherheitsvorschriften<br />
ABSCHNITT 2 Eigentum<br />
Art. 11 Eigentumsübergang<br />
Art. 12 Grundbuchberichtigung und Vermessung<br />
Art. 13 Ausübung des Eigentums am Straßengrund und Erwerbspflicht<br />
ABSCHNITT 3 Gemeingebrauch und Sondernutzung<br />
Art. 14 Gemeingebrauch
Art. 15 Beschränkungen des Gemeingebrauchs<br />
Art. 16 Verunreinigung<br />
Art. 17 Straßenanlieger<br />
Art. 18 Sondernutzung nach öffentlichem Recht<br />
Art. 18 a Unerlaubte Sondernutzung<br />
Art. 19 Zufahrten<br />
Art. 20<br />
Art. 21 Vorrang anderer Genehmigungsverfahren<br />
Art. 22 Sondernutzung nach bürgerlichem Recht<br />
Art. 22 a Abweichende Regelungen<br />
ABSCHNITT 4 Anbau an Straßen und Schutzmaßnahmen<br />
Art. 23 Errichtung baulicher Anlagen<br />
Art. 24 Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen<br />
Art. 25<br />
Art. 26 Freihaltung von Sichtdreiecken<br />
Art. 27 Baubeschränkungen für geplante Straßen<br />
Art. 27 a Entschädigung wegen Baubeschränkungen<br />
Art. 27 b Veränderungssperre<br />
Art. 28<br />
Art. 29 Schutzmaßnahmen<br />
Art. 30 Bepflanzungen<br />
ABSCHNITT 5 Kreuzungen und Umleitungen<br />
Art. 31 Kreuzungen und Einmündungen öffentlicher Straßen
Art. 32 Kosten für Kreuzungen öffentlicher Straßen<br />
Art. 32 a Kreuzungen mit Gewässern<br />
Art. 33 Unterhaltung der Straßenkreuzungen<br />
Art. 33 a Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern<br />
Art. 34 Umleitungen<br />
ABSCHNITT 6 Planfeststellung und Enteignung<br />
Art. 35 Planungen<br />
Art. 36 Planfeststellung<br />
Art. 37 Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Art. 38 Verwaltungsverfahren<br />
Art. 39 Zuständigkeiten im Planfeststellungsverfahren<br />
Art. 40 Enteignung<br />
ZWEITER TEIL Träger der Straßenbaulast für Staatsstraßen und Kreisstraßen<br />
Art. 41 Träger der Straßenbaulast<br />
Art. 42 Träger der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten<br />
Art. 43<br />
Art. 44 Straßenbaulast Dritter<br />
Art. 45 Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder Straßenbaulast<br />
DRITTER TEIL Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen<br />
ABSCHNITT 1 Gemeindestraßen<br />
Art. 46 Einteilung der Gemeindestraßen<br />
Art. 47 Straßenbaulast für Gemeindestraßen<br />
Art. 48 Gemeindeaufgaben für Ortsdurchfahrten mit geteilter Straßenbaulast
Art. 49 Kostenausgleich bei Gemeindeverbindungsstraßen<br />
Art. 50<br />
Art. 51 Gemeindliche Beleuchtungs-, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht<br />
Art. 52 Straßennamen und Hausnummern<br />
ABSCHNITT 2 Sonstige öffentliche Straßen<br />
Art. 53 Einteilung der sonstigen öffentlichen Straßen<br />
Art. 54 Straßenbaulast und Eigentum an öffentlichen Feld- und Waldwegen<br />
Art. 54 a Straßenbaulast an beschränkt-öffentlichen Wegen<br />
Art. 55 Straßenbaulast für Eigentümerwege<br />
Art. 56 Gemeinsame Vorschriften für sonstige öffentliche Straßen<br />
ABSCHNITT 3 Straßen in gemeindefreien Gebieten<br />
Art. 57 Straßenbaulast in gemeindefreien Gebieten<br />
VIERTER TEIL Aufsicht und Zuständigkeiten<br />
Art. 58 Straßenbaubehörden<br />
Art. 59 Verwaltung der Kreisstraßen<br />
Art. 60 Fachtechnische Bedienstete<br />
Art. 61 Straßenaufsichtsbehörden<br />
Art. 62 Straßenaufsicht<br />
Art. 62 a Behörden nach dem Bundesfernstraßengesetz<br />
Art. 63 Straßenstatistik<br />
Art. 64 Technische Vorschriften<br />
FÜNFTER TEIL Ordnungswidrigkeiten<br />
Art. 65
Art. 66 Bußgeldvorschriften<br />
SECHSTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 67 Straßen- und Bestandsverzeichnis (Übergangsvorschrift zu Art. 3)<br />
Art. 68 Ortsdurchfahrten (Übergangsvorschrift zu Art. 4)<br />
Art. 69 Sondernutzung (Übergangsvorschrift zu Art. 18 ff.)<br />
Art. 70 Enteignungsverfahren (Übergangsvorschrift zu Art. 40)<br />
Art. 71<br />
Art. 72 Hoheitliche Wahrnehmung der Dienstaufgaben<br />
Art. 73 Eigentum an Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen<br />
Art. 74und 75<br />
Art. 76 Übernahme der Aufgaben aus der Straßenbaulast durch die Landkreise<br />
oder die Bezirke<br />
Art. 77und 78<br />
Art. 79<br />
Art. 80 Zeitpunkt des Inkrafttretens<br />
ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften<br />
ABSCHNITT 1 Grundsatzvorschriften<br />
Bay StrWG Art. 1 Geltungsbereich<br />
1 Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse an den dem öffentlichen Verkehr<br />
gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Straßen) mit Ausnahme<br />
der Bundesfernstraßen. 2 Für diese gilt das Gesetz nur, soweit das ausdrücklich<br />
bestimmt ist.<br />
Bay StrWG Art. 2 Bestandteile der Straßen<br />
Zu den Straßen gehören<br />
1. der Straßenkörper;<br />
das sind insbesondere<br />
a) der Straßengrund, der Straßenunterbau, die Fahrbahndecke, die Brücken,<br />
Tunnels, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen,<br />
Stützmauern und Lärmschutzanlagen,
) die Fahrbahnen (Richtungsfahrbahnen), die Trenn-, Seiten-, Rand- und<br />
Sicherheitsstreifen und die Omnibushaltebuchten, ferner die Gehwege und<br />
Radwege, soweit sie mit einer Fahrbahn in Zusammenhang stehen und mit<br />
dieser gleichlaufen (unselbständige Gehwege und Radwege),<br />
2. der Luftraum über dem Straßenkörper,<br />
3. das Zubehör;<br />
das sind die Verkehrszeichen, die Verkehrseinrichtungen und die<br />
Verkehrsanlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit des<br />
Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen, und die Bepflanzung,<br />
4. die Nebenanlagen;<br />
das sind solche Anlagen, die überwiegend den Aufgaben der<br />
Straßenbauverwaltung dienen, z. B. Straßenmeistereien, Gerätehöfe, Lager,<br />
Lagerplätze, Ablagerungs- und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -<br />
einrichtungen.<br />
Bay StrWG Art. 3 Einteilung der Straßen<br />
(1) Die Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in folgende Klassen<br />
eingeteilt:<br />
1. Staatsstraßen;<br />
das sind Straßen, die innerhalb des Staatsgebiets zusammen mit den<br />
Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr<br />
zu dienen bestimmt sind.<br />
2. Kreisstraßen;<br />
das sind Straßen, die dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines<br />
Landkreises, dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen und<br />
kreisfreien Gemeinden oder dem erforderlichen Anschluß von Gemeinden<br />
an das überörtliche Verkehrsnetz dienen oder zu dienen bestimmt sind;<br />
sie sollen mindestens an einem Ende an eine Bundesfernstraße,<br />
Staatsstraße oder andere Kreisstraße anschließen.<br />
3. Gemeindeverbindungsstraßen, Ortsstraßen<br />
(Gemeindestraßen nach Art.46).<br />
4. Öffentliche Feld- und Waldwege, beschränkt-öffentliche Wege,<br />
Eigentümerwege (sonstige öffentliche Straßen nach Art. 53).<br />
(2) 1 Für die Staatsstraßen und die Kreisstraßen werden Straßenverzeichnisse,<br />
für die Gemeindestraßen und die sonstigen öffentlichen Straßen<br />
Bestandsverzeichnisse geführt. 2 In die Verzeichnisse sind alle Straßen<br />
gemäß ihrer Straßenklasse aufzunehmen. 3 Die Straßenverzeichnisse<br />
werden von der obersten Straßenbaubehörde, die Bestandsverzeichnisse<br />
von den Straßenbaubehörden geführt. 4 Das Nähere über den Inhalt und<br />
die Führung der Verzeichnisse wird durch Rechtsverordnung des<br />
Staatsministeriums des Innern geregelt.<br />
Bay StrWG Art. 4 Ortsdurchfahrten<br />
(1) 1 Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Staatsstraße oder Kreisstraße, der<br />
innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt und auch zur Erschließung der<br />
anliegenden Grundstücke bestimmt ist oder der mehrfachen Verknüpfung<br />
des Ortsstraßennetzes dient. 2 Geschlossene Ortslage ist der Teil des<br />
Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener Bauweise<br />
zusammenhängend bebaut ist. 3 Einzelne unbebaute Grundstücke, zur
Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige<br />
Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.<br />
(2) 1 Die Regierung setzt nach Anhörung der Gemeinde und des Trägers der<br />
Straßenbaulast die Grenzen der Ortsdurchfahrt fest. 2 Sie kann dabei<br />
zugunsten der Gemeinde von den Vorschriften des Absatzes 1 abweichen,<br />
wenn die Länge der Ortsdurchfahrt wegen der Art der Bebauung in einem<br />
offensichtlichen Mißverhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde steht.<br />
Bay StrWG Art. 5 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 6 Widmung<br />
(1) Widmung ist die Verfügung, durch die eine Straße die Eigenschaft einer<br />
öffentlichen Straße erhält.<br />
(2) 1 Die Widmung wird von der Straßenbaubehörde, für Staatsstraßen von<br />
der obersten Straßenbaubehörde verfügt; ist die Straßenbaulast geteilt, so<br />
widmet die für die Fahrbahn zuständige Straßenbaubehörde. 2 Ist die<br />
widmende Straßenbaubehörde nicht Organ des Trägers der<br />
Straßenbaulast, so ist zur Widmung dessen schriftliche Zustimmung<br />
erforderlich. 3 Beschränkungen der Widmung auf bestimmte<br />
Benutzungsarten sind in der Verfügung festzulegen und vom Träger der<br />
Straßenbaulast kenntlich zu machen.<br />
(3) Die Widmung setzt voraus, daß der Träger der Straßenbaulast das<br />
dingliche Recht hat, über das der Straße dienende Grundstück zu<br />
verfügen, oder daß der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung dinglich<br />
Berechtigter der Widmung zugestimmt haben, oder daß der Träger der<br />
Straßenbaulast den Besitz des der Straße dienenden Grundstücks durch<br />
Vertrag, durch Einweisung oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten<br />
Verfahren erlangt hat.<br />
(4) Die Widmung von Kreisstraßen ist der das Straßenverzeichnis führenden<br />
Behörde mitzuteilen.<br />
(5) Durch bürgerlich-rechtliche Verfügungen oder durch Verfügungen im Weg<br />
der Zwangsvollstreckung oder der Enteignung über die der Straße<br />
dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen wird die Widmung nicht<br />
berührt.<br />
(6) 1 Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungsverfahren geregelt<br />
wird, kann die Widmung in diesem Verfahren mit der Maßgabe verfügt<br />
werden, daß sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die<br />
Voraussetzungen des Absatzes 3 in diesem Zeitpunkt vorliegen. 2 Der<br />
Träger der Straßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehrsübergabe sowie<br />
Beschränkungen der Widmung öffentlich bekanntzumachen und bei<br />
Kreisstraßen der das Straßenverzeichnis führenden Behörde mitzuteilen.<br />
3<br />
Eine Bekanntmachung ist entbehrlich, wenn die zur Widmung<br />
vorgesehenen Straßen in den im Planfeststellungsverfahren ausgelegten<br />
Plänen als solche kenntlich gemacht worden sind.<br />
(7) 1 Bei Straßen, deren Bau in einem Bebauungsplan geregelt wird und für<br />
die die Gemeinde Träger der Straßenbaulast ist, kann die Widmung in<br />
diesem Verfahren mit der Maßgabe verfügt werden, dass sie mit der
Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 in<br />
diesem Zeitpunkt vorliegen. 2 Abs. 6 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.<br />
(8) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergänzt,<br />
so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrsübergabe als gewidmet,<br />
sofern die Voraussetzungen des Absatzes 3 vorliegen.<br />
Bay StrWG Art. 7 Umstufung<br />
(1) 1 Hat sich die Verkehrsbedeutung einer Straße geändert, so ist sie in die<br />
entsprechende Straßenklasse (Art. 3) umzustufen (Aufstufung,<br />
Abstufung). 2 Das gleiche gilt, wenn eine Straße nicht in die ihrer<br />
Verkehrsbedeutung entsprechende Straßenklasse eingeordnet ist oder<br />
überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls für die Umstufung vorliegen.<br />
(2) 1 Die Aufstufung zur Staatsstraße und die Abstufung einer Staatsstraße<br />
verfügt die oberste Straßenbaubehörde. 2 Sind sich bei anderen Straßen<br />
die beteiligten Träger der Straßenbaulast über die Umstufung einer Straße<br />
einig und erhebt die für die künftige Straßenklasse zuständige<br />
Straßenaufsichtsbehörde binnen zwei Monaten nach Anzeige keine<br />
Erinnerung, so verfügt die für die künftige Straßenklasse zuständige<br />
Straßenbaubehörde die Umstufung. 3 Ist die Straßenbaulast geteilt, so<br />
stuft die für die Fahrbahn künftig zuständige Straßenbaubehörde um.<br />
4<br />
Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet über die Umstufung die<br />
für die beteiligte höhere Straßenklasse zuständige<br />
Straßenaufsichtsbehörde.<br />
(3) Die Umstufung von Kreisstraßen ist der das Straßenverzeichnis führenden<br />
Behörde mitzuteilen.<br />
(4) Die Umstufung soll nur zum Ende eines Haushaltsjahres ausgesprochen<br />
und drei Monate vorher angekündigt werden.<br />
(5) 1 Art. 6 Abs. 6 und 7 gelten entsprechend. 2 Die Umstufung wird mit der<br />
Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam.<br />
(6) Wird im Zusammenhang mit einer Maßnahme nach Art. 6 Abs. 8 ein Teil<br />
der Straße oder ein Teil einer anderen Straße in diese einbezogen, so gilt<br />
diese mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme für den neuen<br />
Verkehrszweck als umgestuft.<br />
Bay StrWG Art. 8 Einziehung<br />
(1) 1 Hat eine Straße jede Verkehrsbedeutung verloren oder liegen<br />
überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vor, so ist sie durch<br />
Verfügung der Straßenbaubehörde, eine Staatsstraße durch Verfügung der<br />
obersten Straßenbaubehörde, einzuziehen; ist die Straßenbaulast geteilt,<br />
so zieht die für die Fahrbahn zuständige Straßenbaubehörde nach<br />
Anhörung der Gemeinde ein. 2 Die Teileinziehung einer Straße kann<br />
angeordnet werden, wenn überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls<br />
für eine nachträgliche Beschränkung der Widmung auf bestimmte<br />
Benutzungsarten, -zwecke und -zeiten vorliegen.<br />
(2) 1 Die Absicht der Einziehung ist drei Monate vorher in den Gemeinden, die<br />
von der Straße berührt werden, ortsüblich bekanntzumachen. 2 Die<br />
Bekanntmachung kann unterbleiben, wenn Teile einer Straße im
Zusammenhang mit unwesentlichen Änderungen eingezogen werden<br />
sollen.<br />
(3) Die Einziehung von Kreisstraßen ist der das Straßenverzeichnis führenden<br />
Behörde mitzuteilen.<br />
(4) Mit der Einziehung einer Straße entfallen Gemeingebrauch (Art. 14) und<br />
widerrufliche Sondernutzungen (Art. 18 ff.).<br />
(5) 1 Art. 6 Abs. 6 und 7 gelten entsprechend. 2 Die Einziehung wird mit der<br />
Sperrung wirksam.<br />
(6) 1 Wird eine Straße begradigt, unerheblich verlegt oder in sonstiger Weise<br />
den verkehrlichen Bedürfnissen angepaßt und wird damit ein Teil der<br />
Straße dem Verkehr auf Dauer entzogen, so gilt dieser Teil mit der<br />
Sperrung als eingezogen. 2 Einer Ankündigung bedarf es nicht.<br />
Bay StrWG Art. 9 Straßenbaulast<br />
(1) 1 Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhaltung der<br />
Straße zusammenhängenden Aufgaben. 2 Die Träger der Straßenbaulast<br />
haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem<br />
gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen<br />
Sicherheit und Ordnung genügenden Zustand zu bauen und zu<br />
unterhalten. 3 Soweit sie hierzu unter Berücksichtigung ihrer<br />
Leistungsfähigkeit außerstande sind, haben sie auf den nicht<br />
verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maßnahmen der<br />
Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen hinzuweisen. 4 Beim Bau<br />
und bei der Unterhaltung der Straßen sind die Belange der älteren<br />
Menschen und Kinder zu berücksichtigen und der Naturhaushalt und das<br />
Landschaftsbild zu schonen. 5 Die Belange von Menschen mit Behinderung<br />
und von Menschen mit sonstigen Mobilitätsbeeinträchtigungen werden<br />
berücksichtigt mit dem Ziel, Barrierefreiheit ohne besondere Erschwernis<br />
zu ermöglichen, soweit nicht andere überwiegende öffentliche Belange,<br />
insbesondere solche der Verkehrssicherheit, entgegenstehen.<br />
(2) Beim Bau und der Unterhaltung der Straßen sind die allgemein<br />
anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu beachten.<br />
(3) 1 Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören nicht das Schneeräumen, das<br />
Streuen bei Schnee- oder Eisglätte, die Reinigung und die Beleuchtung.<br />
2<br />
Die Träger der Straßenbaulast sollen jedoch unbeschadet der<br />
Verkehrssicherungspflicht oder der Verpflichtung Dritter die Straßen bei<br />
Schnee und Eisglätte räumen und streuen.<br />
(4) 1 Wechselt die Straßenbaulast, so hat der bisherige Träger der<br />
Straßenbaulast dafür einzustehen, daß er ihr in dem durch die bisherige<br />
Straßenklasse gebotenen Umfang genügt, insbesondere den notwendigen<br />
Grunderwerb durchgeführt hat. 2 Ist eine abzustufende Straße nicht<br />
ordnungsgemäß ausgebaut, so hat er dafür nur insoweit einzustehen, als<br />
der Ausbauzustand hinter den Anforderungen der künftigen Straßenklasse<br />
zurückbleibt.
Bay StrWG Art. 10 Sicherheitsvorschriften<br />
(1) Die Straßenbaubehörde trägt die Verantwortung dafür, daß die öffentlichrechtlichen<br />
Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der<br />
Technik eingehalten werden.<br />
(2) 1 Die Straßenbaubehörde kann Prüfingenieure, Prüfämter und<br />
Prüfsachverständige in entsprechender Anwendung der auf Grund des<br />
Art. 80 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erlassenen<br />
Rechtsverordnungen heranziehen. 2 Art. 62 Abs. 4 Satz 2 BayBO gilt<br />
entsprechend.<br />
(3) Absatz 2 gilt auch für Bundesfernstraßen.<br />
ABSCHNITT 2 Eigentum<br />
Bay StrWG Art. 11 Eigentumsübergang<br />
(1) 1 Mit Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s geht das Eigentum an der Straße mit<br />
Ausnahme der Nebenanlagen mit den jeweiligen dinglichen Belastungen<br />
entschädigungslos auf den Träger der Straßenbaulast über, soweit es<br />
bisher bereits Gebietskörperschaften zustand. 2 Das gilt auch für die<br />
zugehörigen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. 3 Eine nach<br />
Art. 18 Abs. 1 erteilte Erlaubnis zur Sondernutzung bleibt unberührt.<br />
(2) 1 Hat der bisherige Eigentümer die Straße berechtigterweise über den<br />
Gemeingebrauch hinaus benutzt (Sondernutzung), so ist der neue<br />
Eigentümer verpflichtet, etwaige Anlagen in dem bisherigen Umfang<br />
weiterhin zu dulden. 2 Art. 18 Abs. 3 gilt entsprechend.<br />
(3) Verbindlichkeiten, die zur Durchführung früherer Bau- und<br />
Unterhaltungsmaßnahmen von dem bisherigen Träger der Straßenbaulast<br />
eingegangen wurden, sind vom Übergang ausgeschlossen.<br />
(4) 1 Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so gehen mit der<br />
Straßenbaulast das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast<br />
an den Straßenbestandteilen (Art. 2 Nrn. 1 bis 3), den ausschließlich zur<br />
Straße gehörenden Nebenanlagen (Art. 2 Nr. 4) und alle Rechte und<br />
Pflichten, die mit der Straße im Zusammenhang stehen, ohne<br />
Entschädigung auf den neuen Träger der Straßenbaulast über, soweit das<br />
Eigentum einer Gebietskörperschaft zustand. 2 Absatz 3 gilt entsprechend.<br />
(5) 1 Bei Einziehung einer Straße kann der frühere Eigentümer innerhalb eines<br />
Jahres verlangen, daß ihm das Eigentum an Straßengrundstücken mit den<br />
in Absatz 1 genannten Belastungen ohne Entschädigung übertragen wird,<br />
wenn es vorher nach Absatz 1 oder 4 übergegangen war. 2 Die Absätze 2<br />
und 3 gelten entsprechend.<br />
Bay StrWG Art. 12 Grundbuchberichtigung und Vermessung<br />
(1) 1 Beim Übergang des Eigentums an Straßen nach Art. 11 Abs. 1 und 4 ist<br />
der Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs von dem neuen Eigentümer<br />
zu stellen. 2 Das Eigentum wird gegenüber dem Grundbuchamt durch eine<br />
mit dem Amtssiegel oder Amtsstempel versehene Bestätigung<br />
nachgewiesen, die bei Staats- und Kreisstraßen, soweit sie in die Baulast<br />
des Freistaates Bayern, eines Landkreises oder einer kreisfreien Gemeinde
fallen, von der Straßenbaubehörde, bei den übrigen Straßen von der<br />
Straßenaufsichtsbehörde des neuen Eigentümers erteilt wird.<br />
(2) Der bisherige Träger der Straßenbaulast ist nicht verpflichtet, das<br />
übergehende Grundstück vorschriftsmäßig vermessen und vermarken zu<br />
lassen.<br />
Bay StrWG Art. 13 Ausübung des Eigentums am Straßengrund und<br />
Erwerbspflicht<br />
(1) Ist der Träger der Straßenbaulast für eine Straße nicht Eigentümer der<br />
Grundstücke, die für die Straße in Anspruch genommen sind, so steht ihm<br />
einschließlich der Befugnisse aus Art. 22 (Sondernutzungen nach<br />
bürgerlichem Recht) die Ausübung der Rechte und Pflichten des<br />
Eigentümers in dem Umfang zu, wie es die Aufrechterhaltung des<br />
Gemeingebrauchs erfordert.<br />
(2) 1 Der Träger der Straßenbaulast hat auf Antrag des Eigentümers oder<br />
eines sonst dinglich Berechtigten die für die Straße in Anspruch<br />
genommenen Grundstücke oder ein dingliches Recht daran binnen einer<br />
Frist von fünf Jahren seit Inbesitznahme zu erwerben. 2 Kommt eine<br />
Einigung nicht zustande oder kann ein dingliches Recht an dem<br />
Grundstück durch Rechtsgeschäft nicht übertragen werden, so kann der<br />
Eigentümer oder der sonst dinglich Berechtigte die Durchführung des<br />
Enteignungsverfahrens beantragen. 3 Im übrigen gelten die Vorschriften<br />
des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige Enteignung<br />
(BayEG) sinngemäß.<br />
(3) 1 Die Frist nach Absatz 2 ist gehemmt, solang der Berechtigte den Antrag<br />
nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt hat oder die Abwicklung des<br />
Grunderwerbs aus anderen Gründen verzögert wird, die der Träger der<br />
Straßenbaulast nicht zu vertreten hat. 2 Waren bei Inkrafttreten dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s bereits Grundstücke für eine Straße in Anspruch genommen, so<br />
beginnt die Frist mit Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s zu laufen.<br />
(4) 1 Soweit ein dinglich Berechtigter in dem Verfahren nach Art. 6 Abs. 3<br />
nicht beteiligt ist, hat der Träger der Straßenbaulast das dingliche Recht<br />
auf Antrag abzulösen, sobald der dinglich Berechtigte die Befriedigung aus<br />
dem Grundstück beanspruchen kann. 2 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3<br />
Satz 1 gelten entsprechend.<br />
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn und solang dem Träger der<br />
Straßenbaulast durch eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches<br />
Recht die Verfügungsbefugnis nach Art 6 Abs. 3 bei Inkrafttreten dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s eingeräumt war oder wenn er diese Verfügungsbefugnis nach<br />
Art. 67 Abs. 3 und 4 erlangt hat.<br />
ABSCHNITT 3 Gemeingebrauch und Sondernutzung<br />
Bay StrWG Art. 14 Gemeingebrauch<br />
(1) 1 Die Benutzung der Straßen im Rahmen ihrer Widmung für den Verkehr<br />
(Gemeingebrauch) ist jedermann gestattet. 2 Es ist kein Gemeingebrauch,<br />
wenn jemand die Straße nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu<br />
anderen Zwecken benutzt.
(2) Der Gemeingebrauch ist unentgeltlich und gebührenfrei, soweit nicht<br />
durch Gesetz Ausnahmen zugelassen sind.<br />
(3) Auf die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs besteht kein<br />
Rechtsanspruch.<br />
(4) 1 Muß eine Straße wegen der Art des Gebrauchs durch einen anderen<br />
aufwendiger hergestellt oder ausgebaut werden, als es dem regelmäßigen<br />
Verkehrsbedürfnis entspricht, so hat der andere dem Träger der<br />
Straßenbaulast die Mehrkosten für den Bau und die Unterhaltung zu<br />
vergüten. 2 Das gilt nicht für Haltestellenbuchten für den Linienverkehr.<br />
3<br />
Der Träger der Straßenbaulast kann angemessene Vorschüsse oder<br />
Sicherheiten verlangen.<br />
Bay StrWG Art. 15 Beschränkungen des Gemeingebrauchs<br />
1 Für Straßenbauarbeiten und zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der<br />
Straße, die durch deren baulichen Zustand bedingt sind, kann die<br />
Straßenbaubehörde den Gemeingebrauch vorübergehend beschränken. 2 Die<br />
Straßenverkehrsbehörde ist hiervon rechtzeitig zu unterrichten. 3 Der Träger<br />
der Straßenbaulast hat die Beschränkungen kenntlich zu machen.<br />
Bay StrWG Art. 16 Verunreinigung<br />
Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die<br />
Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen; andernfalls<br />
kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des<br />
Verursachers beseitigen.<br />
Bay StrWG Art. 17 Straßenanlieger<br />
(1) Den Eigentümern oder Besitzern von Grundstücken, die an einer Straße<br />
liegen (Straßenanlieger), steht kein Anspruch darauf zu, daß die Straße<br />
nicht geändert oder eingezogen wird.<br />
(2) 1 Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge durch die Änderung oder die<br />
Einziehung von Straßen unterbrochen oder wird ihre Benutzung erheblich<br />
erschwert, so hat der Träger der Straßenbaulast einen angemessenen<br />
Ersatz zu schaffen oder, soweit dies nicht zumutbar ist, nach den<br />
Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige<br />
Enteignung Entschädigung in Geld zu leisten. 2 Mehrere<br />
Anliegergrundstücke können durch eine gemeinsame Zufahrt<br />
angeschlossen werden, deren Unterhaltung (Art. 19 Abs. 5) den Anliegern<br />
gemeinsam obliegt. 3 Die Verpflichtung nach Satz 1 entsteht nicht, wenn<br />
die Grundstücke eine anderweitige ausreichende Verbindung zu dem<br />
öffentlichen Wegenetz besitzen oder wenn die Zufahrten auf einer<br />
widerruflichen Erlaubnis beruhen.<br />
(3) 1 Werden für längere Zeit Zufahrten oder Zugänge durch Straßenarbeiten<br />
unterbrochen oder wird ihre Benutzung erheblich erschwert, ohne daß von<br />
Behelfsmaßnahmen eine wesentliche Entlastung ausgeht, und wird<br />
dadurch die wirtschaftliche Existenz eines anliegenden Betriebs gefährdet,<br />
so kann dessen Inhaber eine Entschädigung in der Höhe des Betrags<br />
beanspruchen, der erforderlich ist, um das Fortbestehen des Betriebs bei<br />
Anspannung der eigenen Kräfte und unter Berücksichtigung der
gegebenen Anpassungsmöglichkeiten zu sichern. 2 Der Anspruch richtet<br />
sich gegen den, zu dessen Gunsten die Arbeiten im Straßenbereich<br />
erfolgen. 3 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.<br />
(4) Wird durch den Bau oder die Änderung einer Straße der Zutritt von Licht<br />
oder Luft zu einem Grundstück auf Dauer entzogen oder erheblich<br />
beeinträchtigt, so hat der Träger der Straßenbaulast für dadurch<br />
entstehende Vermögensnachteile nach den Vorschriften des Bayerischen<br />
<strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungpflichtige Enteignung Entschädigung in<br />
Geld zu gewähren.<br />
(5) 1 Soweit es die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erfordert, kann<br />
die Straßenbaubehörde anordnen, daß Zugänge oder Zufahrten geändert<br />
oder verlegt oder, wenn das Grundstück eine anderweitige ausreichende<br />
Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzt, geschlossen werden.<br />
2<br />
Die Befugnis zum Widerruf einer Erlaubnis nach Art. 18 Abs. 2 bleibt<br />
unberührt. 3 Absatz 2 gilt entsprechend.<br />
Bay StrWG Art. 18 Sondernutzung nach öffentlichem Recht<br />
(1) 1 Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus<br />
(Sondernutzung) bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in<br />
Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde, wenn durch die Benutzung<br />
der Gemeingebrauch beeinträchtigt werden kann. 2 Soweit die Gemeinde<br />
nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit<br />
Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen.<br />
(2) 1 Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt werden. 2 Soweit<br />
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich<br />
erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus<br />
Gründen des Straßenbaus oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des<br />
Verkehrs verlangt.<br />
(2 a) 1 Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben<br />
werden. 2 Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im übrigen dem<br />
Träger der Straßenbaulast zu. 3 Das Staatsministerium des Innern regelt<br />
die Erhebung und Höhe der Sondernutzungsgebühren durch<br />
Rechtsverordnung, soweit sie dem Freistaat Bayern als Träger der<br />
Straßenbaulast zustehen. 4 Die Landkreise und Gemeinden können dies<br />
durch Satzung regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren<br />
zustehen. 5 Für die Bemessung der Sondernutzungsgebühren sind Art und<br />
Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie<br />
das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners zu berücksichtigen.<br />
(3) 1 Der Erlaubnisnehmer hat dem Träger der Straßenbaulast alle Kosten zu<br />
ersetzen, die diesem durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen.<br />
2<br />
Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast angemessene Vorschüsse<br />
und Sicherheiten verlangen.<br />
(4) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die Sondernutzungsanlagen nach<br />
den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten.<br />
(5) Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine nach Absatz 1<br />
erteilte Erlaubnis bestehen.
(6) Der Erlaubnisnehmer hat bei Sperrung, Änderung, Umstufung oder<br />
Einziehung der Straße keinen Ersatzanspruch gegen den Träger der<br />
Straßenbaulast.<br />
Bay StrWG Art. 18 a Unerlaubte Sondernutzung<br />
(1) 1 Werden Autowracks oder andere Fahrzeuge verbotswidrig abgestellt oder<br />
wird sonst eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis nach Art. 18<br />
benutzt oder kommt der Erlaubnisnehmer seinen Pflichten nicht nach, so<br />
kann die Straßenbaubehörde die erforderlichen Anordnungen erlassen.<br />
2<br />
Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem<br />
Aufwand möglich oder nicht erfolgversprechend, so kann sie den<br />
rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen beseitigen oder<br />
beseitigen lassen.<br />
(2) Die Straßenbaubehörde kann von der Straße entfernte Gegenstände bis<br />
zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbehalten.<br />
(3) 1 Ist der Eigentümer oder Halter der von der Straße entfernten<br />
Gegenstände innerhalb angemessener Frist nicht zu ermitteln oder kommt<br />
er seinen Zahlungspflichten innerhalb von zwei Monaten nach<br />
Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt er die Gegenstände innerhalb<br />
einer ihm schriftlich gestellten angemessenen Frist nicht ab, so sind die<br />
Gegenstände auf Antrag der Straßenbaubehörde von der<br />
Kreisverwaltungsbehörde zu verwerten. 2 In der Aufforderung zur Zahlung<br />
oder Abholung ist auf die Möglichkeit der Verwertung hinzuweisen. 3 Im<br />
übrigen sind die Vorschriften des Polizeirechts über die Verwertung<br />
sichergestellter Gegenstände entsprechend anzuwenden.<br />
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die Bundesfernstraßen mit der<br />
Maßgabe, daß die Befugnis zur Zurückbehaltung nach Absatz 2 der für die<br />
Erteilung der Sondernutzungserlaubnis zuständigen Behörde zusteht.<br />
(5) Zu Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 4 ist auch die<br />
Kreisverwaltungsbehörde befugt.<br />
(6) Die Befugnisse nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.<br />
Bay StrWG Art. 19 Zufahrten<br />
(1) 1 Zufahrten zu Staats- und Kreisstraßen außerhalb der zur Erschließung<br />
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten sowie zu<br />
Gemeindeverbindungsstraßen (Art. 46 Nr. 1) gelten als Sondernutzungen<br />
im Sinn des Art. 18. 2 Art. 18 Abs. 2 a ist nicht anwendbar.<br />
(2) Art. 18 Abs. 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß die<br />
Straßenbaubehörde von dem Erlaubnisnehmer alle Maßnahmen<br />
hinsichtlich der örtlichen Lage, der Art und der Ausgestaltung der Zufahrt<br />
verlangen kann, die aus Gründen der Sicherheit oder Leichtigkeit des<br />
Verkehrs erforderlich sind.<br />
(3) Eine Erlaubnis nach Art. 18 ist auch einzuholen, bevor eine<br />
erlaubnisbedürftige Zufahrt geändert wird oder bevor sich der Verkehr auf<br />
der Zufahrt nach Art oder Dichte wesentlich vergrößert.<br />
(4) Der Erlaubnis nach Art. 18 Abs. 1 bedarf es nicht, wenn Zufahrten<br />
1. zu baulichen Anlagen geschaffen oder geändert werden, die dem<br />
Verfahren nach Art. 23 und 24 unterliegen,
2. in einem Flurbereinigungsverfahren mit Zustimmung der<br />
Straßenbaubehörde neu geschaffen oder geändert werden.<br />
(5) Für die Unterhaltung von Zufahrten, die keiner Erlaubnis nach Art. 18<br />
Abs. 1 bedürfen, sowie von Zugängen gilt Art. 18 Abs. 4 entsprechend.<br />
Bay StrWG Art. 20 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 21 Vorrang anderer Genehmigungsverfahren<br />
1 Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine<br />
übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich<br />
oder ist nach den Vorschriften des Baurechts eine Baugenehmigung<br />
erforderlich, bedarf es keiner Erlaubnis nach Art. 18 Abs. 1. 2 Vor ihrer<br />
Entscheidung hat die hierfür zuständige Behörde das Einvernehmen mit der<br />
sonst für die Sondernutzungserlaubnis zuständigen Behörde herzustellen. 3 Die<br />
von dieser geforderten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren<br />
sind dem Antragsteller in der Erlaubnis, Ausnahmegenehmigung oder<br />
Baugenehmigung aufzuerlegen.<br />
Bay StrWG Art. 22 Sondernutzung nach bürgerlichem Recht<br />
(1) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straßen über den<br />
Gemeingebrauch hinaus richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn durch<br />
die Benutzung der Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt werden kann.<br />
(2) Die Benutzung der Straßen für Zwecke der öffentlichen Versorgung regelt<br />
sich stets nach bürgerlichem Recht, es sei denn, daß der Gemeingebrauch<br />
nicht nur für kurze Dauer beeinträchtigt wird.<br />
Bay StrWG Art. 22 a Abweichende Regelungen<br />
1 Die Landkreise und Gemeinden können die Sondernutzungen an Straßen oder<br />
Teilen davon in ihrer Baulast auch abweichend von den Art. 18, 19 und 22<br />
Abs. 1 durch Satzung regeln und an Stelle eines privaten Entgelts Gebühren<br />
erheben. 2 Art. 18 Abs. 2 a Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 3 Art. 22 Abs. 2<br />
bleibt unberührt.<br />
ABSCHNITT 4 Anbau an Straßen und Schutzmaßnahmen<br />
Bay StrWG Art. 23 Errichtung baulicher Anlagen<br />
(1) 1 Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke<br />
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten dürfen bauliche Anlagen<br />
1. an Staatsstraßen in einer Entfernung bis zu 20 m,<br />
2. an Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 15 m,<br />
jeweils gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke, nicht errichtet<br />
werden. 2 Dies gilt nicht für Aufschüttungen und Abgrabungen geringeren<br />
Umfangs. 3 Sind besondere Fahrbahnen, wie Radwege, getrennt von der<br />
Hauptfahrbahn angelegt, dann werden die Entfernungen vom Rand der<br />
Decke der Hauptfahrbahn ab gerechnet.<br />
(2) 1 Ausnahmen von den Anbauverboten nach Absatz 1 können zugelassen<br />
werden, wenn dies die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, besonders<br />
wegen der Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung, Bebauungsabsichten
und Straßenbaugestaltung gestattet. 2 Die Entscheidung wird im<br />
Baugenehmigungsverfahren durch die untere Bauaufsichtsbehörde im<br />
Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde oder, wenn kein<br />
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird, in einem eigenen<br />
Verfahren durch die Straßenbaubehörde getroffen. 3 Soweit nach Art. 73<br />
Abs. 1 BayBO die Regierung zuständig ist, trifft diese die Entscheidung.<br />
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Bauvorhaben den Festsetzungen eines<br />
Bebauungsplans im Sinn des Bundesbaugesetzes entspricht, der<br />
mindestens die Begrenzung der Verkehrsflächen und die an diesen<br />
gelegenen überbaubaren Grundstücksflächen enthält und unter Mitwirkung<br />
der Straßenbaubehörde zustande gekommen ist.<br />
(4) 1 Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben, daß bestimmte<br />
Gemeindeverbindungsstraßen vom Anbau nach Absatz 1 freizuhalten sind,<br />
soweit dies für die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, besonders im<br />
Hinblick auf Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung, Bebauungsabsichten<br />
und Straßenbaugestaltung erforderlich ist. 2 Das Anbauverbot darf sich nur<br />
auf eine Entfernung bis zu 10 m, gemessen vom Rand der Fahrbahndecke,<br />
erstrecken.<br />
Bay StrWG Art. 24 Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen<br />
(1) 1 Unbeschadet der Vorschrift des Art. 23 dürfen baurechtliche oder nach<br />
anderen Vorschriften erforderliche Genehmigungen nur im Einvernehmen<br />
mit der Straßenbaubehörde erteilt werden, wenn bauliche Anlagen längs<br />
1. von Staatsstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m und<br />
2. von Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 30 m,<br />
jeweils gemessen vom Rand der Fahrbahndecke, errichtet, erheblich<br />
geändert oder so anders genutzt werden sollen, daß Auswirkungen auf die<br />
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten sind. 2 Das<br />
Einvernehmen darf nur verweigert oder von Auflagen abhängig gemacht<br />
werden, soweit dies für die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs,<br />
besonders wegen der Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung,<br />
Bebauungsabsichten und Straßenbaugestaltung erforderlich ist.<br />
(2) Das Einvernehmen ist auch erforderlich, wenn infolge der Errichtung,<br />
Änderung oder anderen Nutzung von baulichen Anlagen außerhalb der zur<br />
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der<br />
Ortsdurchfahrten<br />
1. Grundstücke eine Zufahrt (Art. 19 Abs. 1) zu einer Staatsstraße oder<br />
Kreisstraße erhalten sollen oder<br />
2. die Änderung einer bestehenden Zufahrt zu einer Staats- oder<br />
Kreisstraße erforderlich würde.<br />
(3) 1 Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 eine baurechtliche oder<br />
anderweitige Genehmigung nicht erforderlich, so entscheidet die<br />
Straßenbaubehörde. 2 Art. 23 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.<br />
(4) Art. 23 Abs. 3 gilt entsprechend.<br />
Bay StrWG Art. 25 (weggefallen)
Bay StrWG Art. 26 Freihaltung von Sichtdreiecken<br />
1<br />
Bauliche Anlagen dürfen nicht errichtet oder geändert werden, wenn die<br />
Sichtverhältnisse bei höhengleichen Kreuzungen von Straßen mit dem<br />
öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen dadurch beeinträchtigt werden.<br />
2<br />
Das gleiche gilt für höhengleiche Kreuzungen und Einmündungen von Straßen<br />
außerhalb der geschlossenen Ortslage.<br />
Bay StrWG Art. 27 Baubeschränkungen für geplante Straßen<br />
1 Für geplante Straßen gelten die Beschränkungen der Art. 23 bis 26 vom<br />
Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren an. 2 Wird auf<br />
die Auslegung verzichtet, so gelten sie von dem Zeitpunkt an, zu dem den<br />
Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen.<br />
Bay StrWG Art. 27 a Entschädigung wegen Baubeschränkungen<br />
(1) 1 Wird nach den Art. 23 bis 26 die bauliche Nutzung eines Grundstücks,<br />
auf deren Zulassung bisher ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder<br />
teilweise aufgehoben, so kann der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung<br />
Berechtigter insoweit nach den Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s<br />
über die entschädigungspflichtige Enteignung Entschädigung in Geld<br />
verlangen, als seine Vorbereitungen zur baulichen Nutzung des<br />
Grundstücks in dem bisher zulässigen Umfang für ihn an Wert verlieren<br />
oder eine wesentliche Wertminderung des Grundstücks eintritt. 2 Zur<br />
Entschädigung ist der Träger der Straßenbaulast verpflichtet, im Fall des<br />
Art. 26 Satz 1 unbeschadet seiner Ausgleichsansprüche nach dem<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz.<br />
(2) Im Fall des Art. 27 entsteht der Anspruch nach Absatz 1 erst, wenn der<br />
Plan unanfechtbar festgestellt oder mit der Ausführung begonnen worden<br />
ist, spätestens jedoch vier Jahre nach Auslegung der Pläne.<br />
Bay StrWG Art. 27 b Veränderungssperre<br />
(1) 1 Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder<br />
von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben<br />
wird, den Plan einzusehen, dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen<br />
bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich<br />
wertsteigernde oder das Straßenbauvorhaben erheblich erschwerende<br />
Veränderungen nicht vorgenommen werden. 2 Veränderungen, die in<br />
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind,<br />
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten<br />
Nutzung sind hiervon ausgenommen.<br />
(2) 1 Dauern diese Beschränkungen länger als vier Jahre, so können die<br />
Eigentümer und die sonst zur Nutzung Berechtigten für danach<br />
eintretende Vermögensnachteile vom Träger der Straßenbaulast nach den<br />
Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige<br />
Enteignung Entschädigung in Geld verlangen. 2 Der Eigentümer einer vom<br />
Plan betroffenen Fläche kann vom Träger der Straßenbaulast ferner<br />
verlangen, daß er die Fläche zu Eigentum übernimmt, wenn es dem<br />
Eigentümer wegen dieser Beschränkungen wirtschaftlich nicht mehr<br />
zuzumuten ist, die Fläche in der bisherigen oder einer anderen zulässigen<br />
Art zu nutzen. 3 Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zustande,
kann der Eigentümer das Enteignungsverfahren beantragen; im übrigen<br />
gelten die Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
entschädigungspflichtige Enteignung sinngemäß.<br />
(3) 1 Zur Sicherung der Planung neuer Staatsstraßen und Kreisstraßen können<br />
die Regierungen nach Anhörung der Gemeinden, deren Gebiet betroffen<br />
wird, Planungsgebiete festlegen. 2 Für diese gilt Absatz 1 entsprechend.<br />
3 4<br />
Die Festlegung ist auf höchstens zwei Jahre zu befristen. Die Frist kann,<br />
wenn besondere Umstände es erfordern, auf höchstens vier Jahre<br />
verlängert werden. 5 Sie tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne im<br />
Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den<br />
Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, außer Kraft.<br />
6<br />
Ihre Dauer ist auf die Vierjahresfrist nach Absatz 2 anzurechnen.<br />
(4) 1 Die Festlegung eines Planungsgebiets ist in den Gemeinden, deren<br />
Gebiet betroffen wird, auf ortsübliche Weise bekanntzumachen.<br />
2<br />
Planungsgebiete sind außerdem in Karten einzutragen, die in den<br />
Gemeinden während der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht<br />
auszulegen sind.<br />
(5) Die Regierungen können im Einzelfall Ausnahmen von den Absätzen 1 und<br />
3 zulassen, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange<br />
entgegenstehen.<br />
Bay StrWG Art. 28 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 29 Schutzmaßnahmen<br />
(1) Zum Schutz der Straßen vor nachteiligen Einwirkungen der Natur,<br />
insbesondere Schneeverwehungen, Steinschlag, Vermurungen,<br />
Überschwemmungen, haben die Eigentümer und Besitzer von<br />
benachbarten Grundstücken (Anlieger, Hinterlieger) die notwendigen<br />
Einrichtungen zu dulden.<br />
(2) 1 Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche<br />
mit dem Grundstück nicht festverbundene Gegenstände dürfen nicht<br />
angelegt werden, soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs<br />
beeinträchtigen können. 2 Soweit sie bereits vorhanden sind, haben die<br />
Eigentümer und Besitzer ihre Beseitigung zu dulden.<br />
(3) 1 Die Straßenbaubehörde hat den Betroffenen die Anlage von<br />
Einrichtungen nach Absatz 1 oder die Beseitigung von Anlagen nach<br />
Absatz 2 mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzukündigen, es sei denn,<br />
daß Gefahr im Verzug ist. 2 Die Betroffenen können diese Maßnahmen im<br />
Benehmen mit der Straßenbaubehörde selbst durchführen.<br />
(4) Der Träger der Straßenbaulast hat den Eigentümern und Besitzern die<br />
durch Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 verursachten<br />
Aufwendungen und Schäden angemessen zu vergüten.<br />
Bay StrWG Art. 30 Bepflanzungen<br />
1 Zur Bepflanzung des Straßenkörpers ist nur der Träger der Straßenbaulast<br />
befugt. 2 Dem Natur- und Landschaftsschutz ist Rechnung zu tragen.
ABSCHNITT 5 Kreuzungen und Umleitungen<br />
Bay StrWG Art. 31 Kreuzungen und Einmündungen öffentlicher Straßen<br />
(1) 1 Zu den Kreuzungen öffentlicher Straßen gehören höhengleiche<br />
Kreuzungen, Überführungen und Unterführungen. 2 Einmündungen<br />
öffentlicher Straßen stehen den Kreuzungen gleich. 3 Münden mehrere<br />
Straßen an einer Stelle in eine andere Straße ein, so gelten diese<br />
Einmündungen als Kreuzung aller beteiligten Straßen.<br />
(2) 1 Über den Bau neuer sowie über die wesentliche Änderung bestehender<br />
Kreuzungen zwischen Straßen verschiedener Baulastträger wird durch die<br />
Planfeststellung entschieden, wenn eine solche durchgeführt wird. 2 Dabei<br />
ist zugleich die Aufteilung der Kosten zu regeln, soweit die beteiligten<br />
Baulastträger keine Vereinbarung geschlossen haben.<br />
(3) 1 Der Bau oder die Änderung einer Kreuzung soll durch Vereinbarung<br />
einem der beteiligten Träger der Straßenbaulast übertragen werden.<br />
2<br />
Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet, falls nicht ein Plan<br />
festgestellt wird, die für die beteiligte höhere Straßenklasse zuständige<br />
Straßenaufsichtsbehörde; in Zweifelsfällen wird die zuständige<br />
Straßenaufsichtsbehörde durch die oberste Straßenaufsichtsbehörde<br />
bestimmt.<br />
(4) Ergänzungen an Kreuzungsanlagen sind wie Änderungen zu behandeln.<br />
Bay StrWG Art. 32 Kosten für Kreuzungen öffentlicher Straßen<br />
(1) 1 Beim Bau einer neuen Kreuzung hat der Träger der Straßenbaulast für<br />
die neu hinzukommende Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen. 2 Zu<br />
ihnen gehören auch die Kosten der Änderung, die durch die neue<br />
Kreuzung an den anderen öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung der<br />
übersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig sind. 3 Die Änderung einer<br />
bestehenden Kreuzung ist als neue Kreuzung zu behandeln, wenn eine<br />
Straße, die nach der Beschaffenheit ihrer Fahrbahn nicht geeignet und<br />
nicht dazu bestimmt war, einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr<br />
aufzunehmen, zu einer diesem Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird.<br />
(2) 1 Werden mehrere sich kreuzende Straßen gleichzeitig neu angelegt oder<br />
werden an bestehenden Kreuzungen neue Anschlußstellen geschaffen, so<br />
haben die Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzung in dem<br />
Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung beteiligten<br />
Straßenäste zu tragen. 2 Bei der Berechnung der Fahrbahnbreiten sind die<br />
Gehwege und Radwege, die Trennstreifen und die befestigten<br />
Seitenstreifen einzubeziehen.<br />
(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert, so fallen die dadurch<br />
entstehenden Kosten<br />
1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last, der die Änderung<br />
verlangt,<br />
2. den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zur Last, die die Änderung<br />
verlangen, und zwar im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der<br />
Kreuzung beteiligten Straßenäste nach der Änderung.<br />
(4) 1 Wird eine höhengleiche Kreuzung geändert, so gilt für die dadurch<br />
entstehenden Kosten der Änderung Absatz 2. 2 Beträgt der
durchschnittliche tägliche Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf einem der an<br />
der Kreuzung beteiligten Straßenäste nicht mehr als 20 v. H. des Verkehrs<br />
auf anderen beteiligten Straßenästen, so haben die Träger der<br />
Straßenbaulast der verkehrsstärkeren Straßenäste im Verhältnis der<br />
Fahrbahnbreiten den Anteil der Änderungskosten mitzutragen, der auf den<br />
Träger der Straßenbaulast des verkehrsschwächeren Straßenastes<br />
entfallen würde.<br />
(5) Zugunsten leistungsschwacher Träger der Straßenbaulast können<br />
Ausnahmen von der Kostenregelung der Absätze 1 bis 4 vereinbart<br />
werden.<br />
(6) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung näher<br />
regeln, welche Aufwendungen zu den in den Absätzen 1 bis 4 genannten<br />
Kosten gehören und für den mit solchen Baumaßnahmen verbundenen<br />
Verwaltungsaufwand Pauschalbeträge festsetzen.<br />
Bay StrWG Art. 32 a Kreuzungen mit Gewässern<br />
(1) 1 Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu<br />
Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführungen) hergestellt<br />
oder bestehende Kreuzungen geändert werden, so hat der Träger der<br />
Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. 2 Die<br />
Kreuzungsanlagen sind so auszuführen, daß unter Berücksichtigung der<br />
übersehbaren Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der<br />
Wasserabfluß nicht nachteilig beeinflußt wird.<br />
(2) 1 Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaushaltsgesetzes) und<br />
werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt oder bestehende<br />
Kreuzungen geändert, so hat der Träger des Ausbauvorhabens die<br />
dadurch entstehenden Kosten zu tragen. 2 Wird eine neue Kreuzung<br />
erforderlich, weil ein Gewässer hergestellt wird, so ist die übersehbare<br />
Verkehrsentwicklung auf der Straße zu berücksichtigen. 3 Wird die<br />
Herstellung oder Änderung einer Kreuzung erforderlich, weil das Gewässer<br />
wesentlich umgestaltet wird, so sind die gegenwärtigen<br />
Verkehrsbedürfnisse zu berücksichtigen. 4 Verlangt der Träger der<br />
Straßenbaulast weitergehende Änderungen, so hat er die Mehrkosten<br />
hierfür zu tragen.<br />
(3) 1 Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewässer aus<br />
anderen als straßenbaulichen Gründen hergestellt oder wesentlich<br />
umgestaltet, so daß eine neue Kreuzung entsteht, so haben der Träger<br />
der Straßenbaulast und der Unternehmer des Gewässerausbaus die<br />
Kosten der Kreuzung je zur Hälfte zu tragen. 2 Die Leistungsfähigkeit der<br />
Beteiligten ist bei der Kostenverteilung zu berücksichtigen.<br />
(4) 1 Werden eine Straße und ein Gewässer aus anderen als straßenbaulichen<br />
Gründen gleichzeitig ausgebaut und wird infolgedessen eine bestehende<br />
Kreuzungsanlage geändert oder durch einen Neubau ersetzt, so haben der<br />
Träger des Gewässerausbaus und der Träger der Straßenbaulast die<br />
dadurch entstehenden Kosten für die Kreuzungsanlage in dem Verhältnis<br />
zu tragen, in dem die Kosten bei getrennter Durchführung der Maßnahme<br />
zueinander stehen würden. 2 Gleichzeitigkeit im Sinn des Satzes 1 liegt<br />
vor, wenn baureife Pläne vorhanden sind, die eine gleichzeitige<br />
Baudurchführung ermöglichen.
(5) Kommt über die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten eine Einigung<br />
nicht zustande, so ist darüber durch Planfeststellung zu entscheiden.<br />
Bay StrWG Art. 33 Unterhaltung der Straßenkreuzungen<br />
(1) Bei höhengleichen Kreuzungen obliegt dem Träger der Straßenbaulast für<br />
die Straße der höheren Straßenklasse die Unterhaltung der Kreuzung in<br />
der Fahrbahnbreite seiner Straße und der kreuzungsbedingten<br />
Verkehrszeichen, -einrichtungen und -anlagen; im übrigen hat der Träger<br />
der Straßenbaulast für die kreuzende Straße die Kreuzung zu unterhalten.<br />
(2) Bei Über- oder Unterführungen unterhält der Träger der Straßenbaulast<br />
für die Straße der höheren Straßenklasse das Kreuzungsbauwerk; die<br />
übrigen Teile der Kreuzung unterhält der Träger der Straßenbaulast für die<br />
Straße, zu der sie gehören.<br />
(3) 1 In den Fällen des Art. 32 Abs. 1 hat der Träger der Straßenbaulast für<br />
die neu hinzukommende Straße dem Träger der Straßenbaulast für die<br />
vorhandene Straße die Mehrkosten der Unterhaltung zu erstatten, die ihm<br />
nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 entstehen. 2 Die Mehrkosten<br />
sind auf Verlangen eines Beteiligten abzulösen, wenn das dem anderen<br />
Beteiligten zumutbar ist.<br />
(4) 1 Nach einer Änderung einer bestehenden Kreuzung haben die Träger der<br />
Straßenbaulast ihre veränderten Unterhaltungskosten ohne Ausgleich zu<br />
tragen. 2 Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Aufwendungen für<br />
spätere Erneuerungen und für die Wiederherstellung, wenn die Kreuzung<br />
durch höhere Gewalt zerstört wird.<br />
(5) Bisherige Regelungen werden in dem Zeitpunkt hinfällig, in dem nach<br />
Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s eine Änderung der Kreuzung durchgeführt<br />
worden ist.<br />
(6) Die Vorschriften über die Unterhaltung von Kreuzungsbauwerken und über<br />
die Tragung der Kosten gelten nicht, soweit hierüber anderes vereinbart<br />
wird.<br />
(7) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung<br />
allgemein bestimmen,<br />
1. welcher Teil einer Kreuzungsanlage zu welcher Straße und welche Teile<br />
zum Kreuzungsbauwerk gehören,<br />
2. wie Ablösungsbeträge zu berechnen und zu entrichten sind.<br />
Bay StrWG Art. 33 a Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern<br />
(1) 1 Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlage auf seine Kosten<br />
zu unterhalten, soweit nichts anderes vereinbart oder durch<br />
Planfeststellung bestimmt wird. 2 Die Unterhaltungspflicht des Trägers der<br />
Straßenbaulast erstreckt sich nicht auf Leitwerke, Leitpfähle, Dalben,<br />
Absetzpfähle oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der Durchfahrt<br />
unter Brücken im Zug von Straßen für die Schiffahrt sowie auf<br />
Schiffahrtszeichen. 3 Soweit diese Einrichtungen auf Kosten des Trägers<br />
der Straßenbaulast herzustellen waren, hat dieser dem<br />
Unterhaltungspflichtigen die Unterhaltungskosten und die Kosten des<br />
Betriebs dieser Einrichtungen zu ersetzen oder auf Verlangen, soweit ihm<br />
dies zumutbar ist, abzulösen. 4 Art. 33 Abs. 7 gilt entsprechend.
(2) 1 Wird im Fall des Art. 32 a Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, hat der<br />
Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten für die Unterhaltung und den<br />
Betrieb der Kreuzungsanlage zu erstatten oder auf Verlangen, soweit ihm<br />
dies zumutbar ist, abzulösen. 2 Ersparte Unterhaltungskosten für den<br />
Fortfall vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 3 Art. 33 Abs. 7<br />
gilt entsprechend.<br />
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s die Kostentragung auf Grund eines bestehenden Rechts anders<br />
geregelt ist.<br />
Bay StrWG Art. 34 Umleitungen<br />
(1) Bei vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen nach Maßgabe des Art. 15<br />
sind die Träger der Straßenbaulast für andere öffentliche Straßen<br />
verpflichtet, eine Umleitung des Verkehrs auf ihre Straßen zu dulden.<br />
(2) Soweit eine Umleitung des Verkehrs möglich und zumutbar ist, sind die<br />
Träger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke vor Anordnung der<br />
Verkehrsbeschränkung zu unterrichten; der zuständigen<br />
Straßenverkehrsbehörde ist diese Umleitungsstrecke vorzuschlagen.<br />
(3) 1 Die Straßenbaubehörde hat ferner im Benehmen mit dem Träger der<br />
Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke festzustellen, welche<br />
Maßnahmen notwendig sind, um die Umleitungsstrecke für die Aufnahme<br />
des zusätzlichen Verkehrs verkehrssicher zu machen. 2 Die hierfür nötigen<br />
Mehraufwendungen sind dem Träger der Straßenbaulast für die<br />
Umleitungsstrecke zu erstatten. 3 Dies gilt auch für Aufwendungen, die der<br />
Träger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke zur Beseitigung der<br />
durch die Umleitung verursachten Schäden machen muß.<br />
(4) 1 Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über private Straßen und Wege<br />
geleitet werden, die dem öffentlichen Verkehr dienen, so ist der<br />
Eigentümer zur Duldung der Umleitung auf schriftliche Anforderung durch<br />
die Straßenbaubehörde verpflichtet. 2 Absatz 3 Sätze 1 und 2 gelten<br />
entsprechend. 3 Der Träger der Straßenbaulast der umgeleiteten Strecke<br />
hat die Umleitungsstrecke auf Antrag des Eigentümers in einen<br />
verkehrssicheren Zustand zu versetzen, während der Umleitung zu<br />
unterhalten und nach Aufhebung der Umleitung auf Antrag des<br />
Eigentümers den früheren Zustand wieder herzustellen.<br />
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn neue Staats- oder<br />
Kreisstraßen vorübergehend über andere öffentliche Straßen oder Wege<br />
an das Straßennetz angeschlossen werden müssen.<br />
ABSCHNITT 6 Planfeststellung und Enteignung<br />
Bay StrWG Art. 35 Planungen<br />
(1) 1 Bei örtlichen und überörtlichen Planungen, welche die Änderung<br />
bestehender oder den Bau neuer Staatsstraßen und Kreisstraßen zur Folge<br />
haben können, hat die Planungsbehörde das Einvernehmen mit der<br />
Straßenaufsichtsbehörde unbeschadet weitergehender gesetzlicher<br />
Vorschriften rechtzeitig herzustellen. 2 Bei den übrigen Straßen ist die<br />
Straßenbaubehörde rechtzeitig zu beteiligen.
(2) Bei Planungen, welche den Bau neuer oder die wesentliche Änderung<br />
bestehender Straßen von übergeordneter Bedeutung betreffen, sind die<br />
Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung zu beachten.<br />
(3) Beabsichtigte Neubauten von Staatsstraßen sind dem Staatsministerium<br />
für Wirtschaft und Verkehr mitzuteilen.<br />
(4) Die Landkreise und die Gemeinden haben beabsichtigte Neubauten oder<br />
wesentliche Änderungen ihrer Straßen der Regierung mitzuteilen.<br />
Bay StrWG Art. 36 Planfeststellung<br />
(1) 1 Neue Staatsstraßen dürfen nur gebaut werden, wenn vorher der Plan<br />
festgestellt ist. 2 Das gleiche gilt für wesentliche Änderungen.<br />
(2) Bei Kreisstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen ist die Planfeststellung<br />
durchzuführen, wenn es sich um Straßen von besonderer Bedeutung,<br />
insbesondere um Zubringerstraßen zu Bundesfernstraßen, handelt.<br />
(3) Unbeschadet der Regelungen der Absätze 1 und 2 ist bei Staats-, Kreis-,<br />
Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen, für die Art. 37 eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung vorschreibt, die Planfeststellung<br />
durchzuführen.<br />
(4) Wird es notwendig, von einer in einem Bebauungsplan aufgenommenen<br />
Planung für eine Staats- oder Kreisstraße abzuweichen oder diese Planung<br />
zu ergänzen, so ist insoweit ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen.<br />
(5) Ist nach diesem Gesetz oder nach dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG)<br />
ein Plan festzustellen, so kann in den Plan auch der Bau oder die<br />
Änderung anderer öffentlicher Straßen einbezogen werden, soweit solche<br />
Baumaßnahmen zwischen den Trägern der Straßenbaulast vereinbart sind<br />
oder straßenaufsichtlich gefordert werden könnten.<br />
Bay StrWG Art. 37 Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Bei Staats-, Kreis,- Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen ist eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn<br />
1. vier- oder mehrstreifige Straßen gebaut oder bestehende Straßen zu vieroder<br />
mehrstreifigen Straßen ausgebaut oder verlegt werden, soweit der neu<br />
gebaute, ausgebaute oder verlegte Straßenabschnitt<br />
a) eine durchgehende Länge von mindestens 10 km aufweist oder<br />
b) eine durchgehende Länge von mindestens 5 km aufweist und auf einer<br />
Länge von mehr als 5 v. H. Biotope (Art. 13 d Abs. 1 <strong>Bayerisches</strong><br />
Naturschutzgesetz – BayNatSchG) mit einer Fläche von mehr als 1 ha, gemäß<br />
der Richtlinie 92/43/EWG oder der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesene<br />
Schutzgebiete, Nationalparke (Art. 8 BayNatSchG) oder Naturschutzgebiete<br />
(Art. 7 BayNatSchG) durchschneidet oder<br />
2. ein-, zwei- oder dreistreifige Straßen gebaut werden, soweit der neu<br />
gebaute Straßenabschnitt eine durchgehende Länge von mindestens 10 km<br />
aufweist und auf einer Länge von mehr als 5 v. H. Gebiete oder Biotope nach<br />
Nummer 1 Buchst. b durchschneidet oder<br />
3. soweit nicht bereits von Nummer 1 erfasst, wenn Straßen durch Anbau<br />
mindestens eines weiteren Fahrstreifens auf einer durchgehenden Länge von<br />
mindestens 10 km geändert werden und der zu ändernde Straßenabschnitt auf
einer Länge von mehr als 5 v. H. Gebiete oder Biotope nach Nummer 1<br />
Buchst. b durchschneidet.<br />
Bay StrWG Art. 38 Verwaltungsverfahren<br />
(1) Für das Planfeststellungsverfahren gelten die Vorschriften der Art. 72 bis<br />
78 und für Verwaltungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung der<br />
Fünfte Teil Abschnitt III des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes,<br />
soweit sich aus den Absätzen 2 bis 4 nichts Abweichendes ergibt.<br />
(2) 1 An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung<br />
erteilt werden, wenn<br />
1. Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden oder<br />
die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines<br />
anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben und<br />
2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt<br />
wird, das Benehmen hergestellt worden ist.<br />
2 3<br />
Art. 37 bleibt unberührt. Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen<br />
der Planfeststellung; auf ihre Erteilung finden die Vorschriften über das<br />
Planfeststellungsverfahren keine Anwendung. 4 Vor Erhebung einer<br />
verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem<br />
Vorverfahren. 5 Art. 75 Abs. 4 BayVwVfG gilt entsprechend.<br />
(3) 1 Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen, soweit für das von der<br />
Baumaßnahme berührte Gebiet ein Bebauungsplan besteht, der den<br />
Anforderungen des Art. 23 Abs. 3 entspricht. 2 Art. 74 Abs. 7 BayVwVfG<br />
bleibt unberührt.<br />
(4) Die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses kann unterbleiben, wenn<br />
der Kreis der Betroffenen bekannt ist und nicht für das Vorhaben nach<br />
Art. 37 eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist.<br />
Bay StrWG Art. 39 Zuständigkeiten im Planfeststellungsverfahren<br />
(1) Die Regierung führt das Anhörungsverfahren (Art. 73 BayVwVfG) durch<br />
und stellt den Plan fest (Art. 74 BayVwVfG).<br />
(2) Die Regierung ist Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde im<br />
Planfeststellungsverfahren nach dem Bundesfernstraßengesetz.<br />
Bay StrWG Art. 40 Enteignung<br />
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben aus der Straßenbaulast kann nach den<br />
Vorschriften des Bayerischen <strong>Gesetze</strong>s über die entschädigungspflichtige<br />
Enteignung enteignet werden.<br />
(2) Der nach Art. 38 festgestellte oder genehmigte Plan ist dem<br />
Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde<br />
bindend.<br />
ZWEITER TEIL Träger der Straßenbaulast für Staatsstraßen und<br />
Kreisstraßen<br />
Bay StrWG Art. 41 Träger der Straßenbaulast<br />
1 Träger der Straßenbaulast sind:<br />
1. für die Staatsstraßen der Freistaat Bayern,
2. für die Kreisstraßen die Landkreise und kreisfreien Gemeinden.<br />
2 Dies gilt auch für die Ortsdurchfahrten, soweit nicht die Straßenbaulast für<br />
diese den Gemeinden obliegt (Art. 42).<br />
Bay StrWG Art. 42 Träger der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten<br />
(1) 1 Die Gemeinden mit mehr als 25 000 Einwohnern sind Träger der<br />
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zug von Staats- und<br />
Kreisstraßen. 2 Maßgebend ist die durch die jeweils letzte Volkszählung<br />
festgestellte Einwohnerzahl. 3 Das Ergebnis einer Volkszählung wird mit<br />
Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr verbindlich, in dem die<br />
Volkszählung stattgefunden hat. 4 Werden Gemeindegrenzen geändert<br />
oder neue Gemeinden gebildet, ist die bei der Volkszählung festgestellte<br />
Einwohnerzahl des neuen Gemeindegebiets maßgebend. 5 In diesen Fällen<br />
wechselt die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten mit Beginn des<br />
dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der Gebietsänderung, wenn sie<br />
bisher dem Freistaat Bayern oder einem Landkreis oblag, sonst mit der<br />
Gebietsänderung. 6 Die Gemeinde bleibt abweichend von den Sätzen 1 bis<br />
5 Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zug der Staatsund<br />
Kreisstraßen, wenn sie es mit Zustimmung der<br />
Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber dem Träger der Straßenbaulast erklärt.<br />
7<br />
Für die Gehwege dieser Ortsdurchfahrten und der Ortsdurchfahrten von<br />
Kreisstraßen in kreisfreien Gemeinden gilt Art. 47 Abs. 3 entsprechend.<br />
(2) Soweit die Gemeinden Träger der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten<br />
sind, bedürfen alle Straßenbauvorhaben, die die Planungen, insbesondere<br />
die Ausbauabsichten des Trägers der Straßenbaulast für die<br />
anschließenden freien Strecken berühren, der vorherigen Zustimmung der<br />
Straßenaufsichtsbehörde.<br />
(3) 1 Wenn dem Freistaat Bayern oder einem Landkreis die Straßenbaulast für<br />
eine Ortsdurchfahrt obliegt, erstreckt sie sich nicht auf Gehwege und<br />
Parkplätze. 2 Auf Radwege erstreckt sich die Straßenbaulast des<br />
Freistaates Bayern oder eines Landkreises nur, wenn solche auch auf den<br />
anschließenden freien Strecken vorhanden oder vorgesehen sind. 3 Führt<br />
die Ortsdurchfahrt über Straßen und Plätze, die erheblich breiter angelegt<br />
sind, als die Staatsstraße oder Kreisstraße es erfordert, so hat die<br />
Straßenbaubehörde die seitliche Begrenzung der Ortsdurchfahrt mit der<br />
Gemeinde besonders zu vereinbaren. 4 Kommt keine Vereinbarung<br />
zustande, so entscheidet die Regierung.<br />
(4) 1 Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen und nach Anhörung der kommunalen<br />
Spitzenverbände durch Rechtsverordnung bestimmen, wie bei<br />
gemeinsamen Maßnahmen die Kosten des Baus und der Unterhaltung<br />
unter den Trägern der Straßenbaulast aufzuteilen sind. 2 Hierbei ist zu<br />
berücksichtigen, inwieweit derartige Maßnahmen den Aufgaben des einen<br />
oder des anderen Trägers der Straßenbaulast zu dienen bestimmt sind.<br />
3<br />
Die Rechtsverordnung soll hiervon abweichende Vereinbarungen<br />
zwischen den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zulassen.
Bay StrWG Art. 43 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 44 Straßenbaulast Dritter<br />
(1) Die Art. 41 und 42 gelten nicht, soweit die Straßenbaulast auf Grund<br />
anderer gesetzlicher Vorschriften oder auf Grund öffentlich-rechtlicher<br />
Verpflichtungen anderen Trägern obliegt oder übertragen wird.<br />
(2) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dritter über die Erfüllung der<br />
Aufgaben aus der Straßenbaulast lassen die Straßenbaulast als solche<br />
unberührt.<br />
Bay StrWG Art. 45 Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder<br />
Straßenbaulast<br />
1 Obliegt nach Art. 44 Abs. 1 die Baulast für Straßenteile, die im Zug einer<br />
Staatsstraße oder Kreisstraße liegen, wie Brücken und Durchlässe, einem<br />
anderen als dem Träger der Straßenbaulast nach Art. 41 und 42, so ist dieser<br />
zum Zweck der Behebung eines Notstands berechtigt und verpflichtet, auf<br />
Kosten des anderen alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erhaltung der<br />
Verkehrssicherheit erforderlich sind. 2 Der nach Art. 44 Abs. 1 verpflichtete<br />
Träger der Straßenbaulast ist vorher tunlichst zu verständigen.<br />
DRITTER TEIL Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen<br />
ABSCHNITT 1 Gemeindestraßen<br />
Bay StrWG Art. 46 Einteilung der Gemeindestraßen<br />
Gemeindestraßen sind:<br />
1. Gemeindeverbindungsstraßen;<br />
das sind Straßen, die den nachbarlichen Verkehr der Gemeinden oder der<br />
Gemeindeteile untereinander oder deren Verbindung mit anderen<br />
Verkehrswegen vermitteln.<br />
2. Ortsstraßen;<br />
das sind Straßen, die dem Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslage oder<br />
innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans im Sinn des<br />
Bundesbaugesetzes dienen, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten von<br />
Bundesstraßen, Staatsstraßen und Kreisstraßen.<br />
Bay StrWG Art. 47 Straßenbaulast für Gemeindestraßen<br />
(1) Die Gemeinden sind Träger der Straßenbaulast für die erforderlichen<br />
Gemeindestraßen innerhalb des Gemeindegebiets.<br />
(2) Ist eine Gemeindestraße ordnungsgemäß hergestellt, so hat die<br />
Straßenbaubehörde sie unverzüglich zu widmen.<br />
(3) Die Gemeinden können durch Satzung die Eigentümer solcher<br />
Grundstücke, die über Ortsstraßen erschlossen werden, und die sonst zur<br />
Nutzung dinglich Berechtigten zur Unterhaltung der Gehwege verpflichten<br />
oder zu den Kosten nach dem Maß dieser Verpflichtung heranziehen,<br />
soweit der Gehweg überwiegend dem Grundstückseigentümer oder dem<br />
sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten dient.<br />
(4) Die Art. 44 und 45 gelten entsprechend.
Bay StrWG Art. 48 Gemeindeaufgaben für Ortsdurchfahrten mit<br />
geteilter Straßenbaulast<br />
(1) Die Gemeinden sind Träger der Straßenbaulast für Gehwege, Radwege<br />
und Parkplätze, die nicht nach Art. 42 Abs. 3 in der Straßenbaulast des<br />
Freistaates Bayern oder eines Landkreises stehen.<br />
(2) Für diese Bestandteile der Ortsdurchfahrten gelten die Art. 44 und 45, für<br />
die Gehwege auch Art. 47 Abs. 3 entsprechend.<br />
(3) Art. 47 Abs. 3 gilt für die Gehwege aller Ortsdurchfahrten von<br />
Bundesstraßen entsprechend.<br />
Bay StrWG Art. 49 Kostenausgleich bei Gemeindeverbindungsstraßen<br />
Wenn eine Gemeindeverbindungsstraße ausschließlich oder überwiegend dem<br />
Verkehrsbedürfnis anderer Gemeinden dient, sind diese verpflichtet, nach<br />
Maßgabe ihres Nutzens der Gemeinde, durch deren Gebiet die Straße verläuft,<br />
die im Rahmen der Straßenbaulast erforderlichen Aufwendungen zu erstatten.<br />
Bay StrWG Art. 50 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 51 Gemeindliche Beleuchtungs-, Reinigungs-, Räum-<br />
und Streupflicht<br />
(1) 1 Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die<br />
Gemeinden innerhalb der geschlossenen Ortslage nach ihrer<br />
Leistungsfähigkeit die öffentlichen Straßen zu beleuchten, zu reinigen, von<br />
Schnee zu räumen und alle gefährlichen Fahrbahnstellen, die<br />
Fußgängerüberwege und die Gehbahnen bei Glätte zu streuen, wenn das<br />
dringend erforderlich ist und nicht andere auf Grund sonstiger<br />
Rechtsvorschriften (insbesondere der Verkehrssicherungspflicht) hierzu<br />
verpflichtet sind. 2 Dabei sollen vorrangig umweltfreundliche Streumittel<br />
verwendet werden. 3 Die Verwendung von Streusalz und<br />
umweltschädlichen anderen Stoffen ist dabei auf das aus Gründen der<br />
Verkehrssicherheit notwendige Maß zu beschränken.<br />
(2) 1 Die Gemeinden sind verpflichtet, das Streuen an gefährlichen<br />
Fahrbahnstellen und Fußgängerüberwegen bei Glätte allgemein als eigene<br />
Aufgabe zu übernehmen, wenn ihnen dies zumutbar ist. 2 Im Zweifelsfall<br />
entscheidet hierüber die Aufsichtsbehörde.<br />
(3) Den Gemeinden werden die Kosten für das Schneeräumen und für das<br />
Streuen der gefährlichen Fahrbahnstellen und der Fußgängerüberwege<br />
von demjenigen ersetzt, der im allgemeinen für diese Straßenteile<br />
verkehrssicherungspflichtig wäre.<br />
(4) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit können die Gemeinden<br />
über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen<br />
Rechtsverordnungen erlassen und darin die Eigentümer von<br />
Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an öffentliche<br />
Straßen angrenzen oder über sie erschlossen werden, und die zur Nutzung<br />
dinglich Berechtigten auch zu Leistungen auf eigene Kosten verpflichten.<br />
(5) 1 Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder<br />
Besitz können die Gemeinden die in Abs. 4 genannten Personen durch<br />
Rechtsverordnung verpflichten, die Gehwege sowie die gemeinsamen
Geh- und Radwege der an ihr Grundstück angrenzenden oder ihr<br />
Grundstück erschließenden öffentlichen Straßen oder, wenn kein Gehweg<br />
oder gemeinsamer Geh- und Radweg besteht, diese öffentlichen Straßen<br />
in der für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite bei Schnee oder<br />
Glatteis auf eigene Kosten während der üblichen Verkehrszeiten in<br />
sicherem Zustand zu erhalten. 2 In solchen Rechtsverordnungen sind<br />
Beginn und Ende der üblichen Verkehrszeit zu bestimmen; der Beginn darf<br />
nicht vor 6 Uhr, das Ende nicht nach 22 Uhr liegen.<br />
(6) Straßen im Sinn dieser Vorschrift sind auch die Bundesstraßen.<br />
Bay StrWG Art. 52 Straßennamen und Hausnummern<br />
(1) Die Gemeinden können den öffentlichen Straßen Namen geben und<br />
Namensschilder anbringen.<br />
(2) Die Hausnumerierung und die Verpflichtung der Grundstückseigentümer,<br />
die Kosten hierfür zu tragen, regeln die Gemeinden durch Satzung nach<br />
Art. 23 der Gemeindeordnung, soweit nicht bundesrechtliche Vorschriften<br />
bestehen.<br />
ABSCHNITT 2 Sonstige öffentliche Straßen<br />
Bay StrWG Art. 53 Einteilung der sonstigen öffentlichen Straßen<br />
Sonstige öffentliche Straßen sind:<br />
1. die öffentlichen Feld- und Waldwege;<br />
das sind Straßen, die der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken<br />
dienen;<br />
2. die beschränkt-öffentlichen Wege;<br />
das sind Straßen, die einem beschränkt-öffentlichen Verkehr dienen und eine<br />
besondere Zweckbestimmung haben können. Hierzu zählen die Friedhof-,<br />
Kirchen- und Schulwege, die Wanderwege (Art. 141 Abs. 3 Satz 2 der<br />
Verfassung), die Geh- und Radwege, soweit diese nicht Bestandteile anderer<br />
Straßen sind (selbständige Geh- und Radwege), sowie die Fußgängerbereiche;<br />
3. die Eigentümerwege;<br />
das sind Straßen, die von den Grundstückseigentümern in unwiderruflicher<br />
Weise einem beschränkten oder unbeschränkten öffentlichen Verkehr zur<br />
Verfügung gestellt werden und keiner anderen Straßenklasse angehören.<br />
Bay StrWG Art. 54 Straßenbaulast und Eigentum an öffentlichen Feld-<br />
und Waldwegen<br />
(1) 1 Träger der Straßenbaulast für ausgebaute öffentliche Feld- und<br />
Waldwege sind die Gemeinden. 2 Träger der Straßenbaulast für nicht<br />
ausgebaute öffentliche Feld- und Waldwege sind diejenigen, deren<br />
Grundstücke über den Weg bewirtschaftet werden (Beteiligte). 3 Die<br />
Gemeinde kann durch Satzung auch nicht ausgebaute öffentliche Feldund<br />
Waldwege in ihre Baulast überführen.<br />
(2) 1 Werden bisher nicht ausgebaute öffentliche Feld- und Waldwege<br />
ausgebaut, so geht die Baulast auf die Gemeinde über,<br />
1. wenn der Ausbau im Rahmen der Flurbereinigung erfolgt, mit der<br />
Beendigung des Ausbaus,
2. in den übrigen Fällen mit dem Beginn des Ausbaus durch die Gemeinde.<br />
2<br />
Werden öffentliche Feld- und Waldwege neu gebaut, so wird die<br />
Gemeinde Träger der Baulast,<br />
1. wenn der Neubau im Rahmen der Flurbereinigung erfolgt, mit der<br />
Verkehrsübergabe,<br />
2. in den übrigen Fällen mit dem Beginn des Baus durch die Gemeinde.<br />
(3) 1 Obliegt die Baulast an öffentlichen Feld- und Waldwegen den Gemeinden,<br />
so können sie bis zu 75 v. H. ihrer nicht anderweitig gedeckten sächlichen<br />
Aufwendungen aus der Baulast auf die Beteiligten umlegen, und zwar im<br />
Verhältnis der Größen der in Absatz 1 Satz 2 genannten Grundstücke;<br />
forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind zu zwei Dritteln, minderwertige<br />
landwirtschaftliche Nutzflächen (insbesondere Hutungen, Streuwiesen und<br />
Ödländereien) zu einem Drittel anzurechnen. 2 Die Gemeinden können<br />
durch Satzung bestimmen, daß auch noch die durch die Bewirtschaftung<br />
bedingte Art und Häufigkeit der Wegebenutzung zu berücksichtigen ist.<br />
3 4<br />
Sie können angemessene Vorschüsse verlangen. Die Umlegung von<br />
Aufwendungen für den Ausbau und Neubau außerhalb eines<br />
Flurbereinigungsverfahrens ist nur zulässig, wenn eine nach den<br />
Grundstücksgrößen gemäß Satz 1 zu ermittelnde Mehrheit der Beteiligten<br />
der Baumaßnahme zugestimmt hat.<br />
(4) 1 Obliegt die Baulast den Beteiligten, so haben diese eine Einigung über<br />
die Art und den Umfang ihrer Verpflichtungen anzustreben. 2 Kommt keine<br />
Einigung zustande, so entscheidet die Gemeinde und, wenn sie selbst<br />
beteiligt ist, die Straßenaufsichtsbehörde unter Beachtung des Absatzes 3<br />
Satz 1.<br />
(5) Für öffentliche Feld- und Waldwege in der Baulast von Gemeinden gilt<br />
Art. 49 und für die hiernach erstattungspflichtigen Gemeinden auch<br />
Absatz 4 entsprechend.<br />
(6) Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durch<br />
Rechtsverordnung regeln, durch welche Merkmale ein ausgebauter<br />
öffentlicher Feld- und Waldweg (Absatz 1 Satz 1) bestimmt ist.<br />
(7) 1 Für öffentliche Feld- und Waldwege in der Baulast der Beteiligten ist<br />
Art. 13 nicht anzuwenden. 2 Die Gemeinde hat auf Kosten der Beteiligten<br />
das Eigentum an den Grundstücken zu erwerben, die einem solchen Feldund<br />
Waldweg dienen, wenn das ein nach Absatz 1 Satz 2 nicht beteiligter<br />
Eigentümer der Wegfläche verlangt. 3 Die Befugnisse nach Art. 40 kann<br />
auch in diesem Fall nur die Gemeinde wahrnehmen.<br />
Bay StrWG Art. 54 a Straßenbaulast an beschränkt-öffentlichen Wegen<br />
(1) Träger der Straßenbaulast für die beschränkt-öffentlichen Wege sind die<br />
Gemeinden.<br />
(2) Art. 49 gilt entsprechend.<br />
Bay StrWG Art. 55 Straßenbaulast für Eigentümerwege<br />
(1) 1 Träger der Straßenbaulast für Eigentümerwege sind die<br />
Grundstückseigentümer. 2 Die Straßenbaulast beschränkt sich auf die<br />
Unterhaltung dieser Wege in dem Umfang, in dem sie bei Inkrafttreten
dieses <strong>Gesetze</strong>s oder bei ihrer Errichtung für den Verkehr bestimmt<br />
waren, sofern nicht weitergehende öffentlich-rechtliche Verpflichtungen<br />
bestehen. 3 Die Grundstückseigentümer sind berechtigt, die Benutzung<br />
eines Eigentümerwegs von einem Entgelt abhängig zu machen. 4 Die Höhe<br />
des Entgelts bedarf der Genehmigung der Straßenaufsichtsbehörde. 5 Das<br />
Entgelt darf nicht höher angesetzt werden, als zur Deckung der<br />
Unterhaltskosten erforderlich ist.<br />
(2) Kreuzungen von Eigentümerwegen mit Staatsstraßen, Kreisstraßen oder<br />
Gemeindestraßen gelten als Sondernutzungen nach Art. 19 an diesen<br />
Straßen; Einmündungen stehen den Kreuzungen gleich.<br />
Bay StrWG Art. 56 Gemeinsame Vorschriften für sonstige öffentliche<br />
Straßen<br />
(1) Die Sondernutzung an sonstigen öffentlichen Straßen richtet sich<br />
ausschließlich nach bürgerlichem Recht.<br />
(2) Die Art. 44 und 45 sind entsprechend anzuwenden; dasselbe gilt für<br />
Art. 22 a, soweit eine Gemeinde Träger der Straßenbaulast ist.<br />
ABSCHNITT 3 Straßen in gemeindefreien Gebieten<br />
Bay StrWG Art. 57 Straßenbaulast in gemeindefreien Gebieten<br />
(1) In gemeindefreien Gebieten sind Träger der Straßenbaulast für solche<br />
Straßen, die innerhalb des Gemeindegebiets in der Straßenbaulast der<br />
Gemeinden stünden, die Eigentümer der gemeindefreien Grundstücke.<br />
(2) Die Art. 44, 45 und 49 gelten entsprechend.<br />
VIERTER TEIL Aufsicht und Zuständigkeiten<br />
Bay StrWG Art. 58 Straßenbaubehörden<br />
(1) 1 Oberste Straßenbaubehörde ist das Staatsministerium des Innern.<br />
2<br />
Werden Netzpläne für Staatsstraßen aufgestellt oder geändert, handelt<br />
es im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wirtschaft und<br />
Verkehr.<br />
(2) Straßenbaubehörden sind, soweit nicht in den folgenden Absätzen etwas<br />
anderes bestimmt ist,<br />
1. für Staatsstraßen mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten, die in der<br />
Straßenbaulast der Gemeinden stehen:<br />
die Staatlichen Bauämter,<br />
2. für Kreisstraßen mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten, die in der<br />
Straßenbaulast der Gemeinden stehen:<br />
die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden,<br />
3. für alle innerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Gemeindestraßen,<br />
öffentlichen Feld- und Waldwege und beschränkt-öffentlichen Wege und<br />
für Ortsdurchfahrten von Staatsstraßen und Kreisstraßen, die in der<br />
Straßenbaulast der Gemeinden stehen, und für Gehwege, Radwege und<br />
Parkplätze im Sinn des Art. 48:<br />
die Gemeinden,<br />
4. für die im gemeindefreien Gebiet gelegenen Gemeindestraßen,
öffentlichen Feld- und Waldwege und beschränkt-öffentlichen Wege, die in<br />
der alleinigen Straßenbaulast des Freistaates Bayern oder einer<br />
kommunalen Gebietskörperschaft stehen:<br />
diese Körperschaften, im übrigen die Kreisverwaltungsbehörden,<br />
5. für Eigentümerwege, die in der alleinigen Straßenbaulast des<br />
Freistaates Bayern, einer kommunalen Gebietskörperschaft oder eines<br />
Zweckverbands stehen:<br />
diese Körperschaften, im übrigen die Gemeinden.<br />
(3) Werden die Kreisstraßen nach Art. 59 von den Staatlichen Bauämtern<br />
verwaltet, so nehmen diese die den Straßenbaubehörden nach Art. 15, 18<br />
und 19 obliegenden Aufgaben und Befugnisse wahr.<br />
(4) 1 Die Straßenbaubehörden können für die Ortsdurchfahrten von<br />
Staatsstraßen in Gemeinden, die bei der nach Art. 42 Abs. 1 maßgeblichen<br />
Volkszählung mehr als 9 000, aber nicht mehr als 25 000 Einwohner<br />
hatten, ihre Befugnisse durch Vereinbarung ganz oder teilweise auf die<br />
Gemeinden übertragen. 2 Die Vereinbarung ist nach den für<br />
Gemeindesatzungen geltenden Vorschriften bekanntzumachen.<br />
(5) 1 Ist in den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 4 und 5 der Freistaat Bayern<br />
alleiniger Träger der Straßenbaulast, so ist Straßenbaubehörde die<br />
Behörde, welche das für die Straße in Anspruch genommene Grundstück<br />
verwaltet. 2 Das Staatsministerium des Innern kann in solchen Fällen im<br />
Einvernehmen mit den beteiligten anderen Staatsministerien die<br />
Befugnisse der Straßenbaubehörde ganz oder teilweise durch<br />
Rechtsverordnung auf eine andere staatliche Behörde übertragen.<br />
Bay StrWG Art. 59 Verwaltung der Kreisstraßen<br />
(1) 1 Die Landkreise können die Verwaltung ihrer Kreisstraßen mit Ausnahme<br />
der Ortsdurchfahrten in Gemeinden mit mehr als 25 000 Einwohnern den<br />
örtlich zuständigen Staatlichen Bauämtern übertragen. 2 Die Übertragung<br />
erfolgt durch Vereinbarung zwischen dem Staatlichen Bauamt und dem<br />
Landkreis. 3 Diese ist vom Kreistag zu beschließen, bedarf der Form des<br />
Art. 35 Abs. 2 der Landkreisordnung und ist vom Vorstand des Staatlichen<br />
Bauamts zu unterzeichnen.<br />
(2) 1 Das Staatliche Bauamt handelt bei der Verwaltung der Kreisstraßen im<br />
Auftrag des Landkreises; es wird gegenüber dem Landkreis von seinem<br />
Vorstand vertreten. 2 Das Staatliche Bauamt verwaltet die Kreisstraßen<br />
nach den in der Vereinbarung festgelegten Richtlinien. 3 Sein Vorstand<br />
vertritt insoweit den Landkreis nach außen; Art. 35 Abs. 2 der<br />
Landkreisordnung gilt entsprechend. 4 Bei der Verwaltung der Kreisstraßen<br />
untersteht das Staatliche Baumamt den technischen Weisungen der<br />
staatlichen Straßenbauverwaltung.<br />
(3) 1 Für die Verwaltung der Kreisstraßen haben die Landkreise eine<br />
angemessene Vergütung an den Freistaat Bayern zu entrichten. 2 Das<br />
Staatsministerium des Innern setzt im Einvernehmen mit dem<br />
Staatsministerium der Finanzen nach Anhörung des Landkreisverbands<br />
Bayern durch Rechtsverordnung die Höhe der Vergütung fest. 3 Diese<br />
Festsetzung darf nur zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres in Kraft<br />
gesetzt werden und ist jeweils sechs Monate vorher bekanntzugeben.
(4) 1 Vereinbarungen nach Absatz 1 können nur für den Zeitraum von<br />
mindestens acht Haushaltsjahren abgeschlossen werden. 2 Wenn eine<br />
Vereinbarung nicht spätestens zwei Jahre vor ihrem Ablauf schriftlich<br />
gekündigt wird, so verlängert sie sich jeweils um weitere vier<br />
Haushaltsjahre. 3 Eine vorzeitige Auflösung der Vereinbarung ist in<br />
gegenseitigem Einvernehmen möglich. 4 Bei einer Änderung des<br />
Vergütungssatzes für die Verwaltung der Kreisstraßen nach Absatz 3<br />
Satz 2 können die Landkreise die Vereinbarungen unverzüglich nach der<br />
Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 3 mit Wirkung für den Beginn des<br />
folgenden Haushaltsjahres kündigen.<br />
Bay StrWG Art. 60 Fachtechnische Bedienstete<br />
(1) Die Träger der Straßenbaulast haben sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
(Art. 9) der erforderlichen fachkundigen Personen zu bedienen.<br />
(2) 1 Die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden sind verpflichtet, für die<br />
ihnen obliegende Verwaltung von Straßen die notwendigen fachlich<br />
vorgebildeten und geeigneten Bediensteten einzustellen. 2 Hierzu gehört<br />
mindestens ein graduierter Ingenieur der Fachrichtung<br />
Bauingenieurwesen.<br />
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt auch für kreisangehörige Gemeinden oder<br />
Verwaltungsgemeinschaften.<br />
Bay StrWG Art. 61 Straßenaufsichtsbehörden<br />
(1) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das Staatsministerium des Innern.<br />
(2) Obere Straßenaufsichtsbehörden sind die Regierungen, soweit sie nicht<br />
Straßenaufsichtsbehörden sind.<br />
(3) Straßenaufsichtsbehörden sind<br />
1. für Staatsstraßen und Kreisstraßen und für Gemeindestraßen kreisfreier<br />
Gemeinden die Regierungen,<br />
2. im übrigen die Kreisverwaltungsbehörden.<br />
Bay StrWG Art. 62 Straßenaufsicht<br />
(1) Die Straßenaufsicht überwacht die Erfüllung der Aufgaben, die den<br />
Trägern der Straßenbaulast und den Straßenbaubehörden obliegen.<br />
(2) 1 Die Straßenaufsicht über die Gemeinden, Landkreise, Bezirke und<br />
Zweckverbände ist Rechtsaufsicht; sie beschränkt sich darauf, die<br />
Erfüllung der gesetzlich festgelegten und der übernommenen Pflichten aus<br />
der Straßenbaulast und die Gesetzmäßigkeit der Verwaltungstätigkeit zu<br />
überwachen. 2 Im übrigen gelten unbeschadet des Art. 61 die für die<br />
Rechtsaufsicht über die genannten Körperschaften maßgeblichen<br />
allgemeinen Vorschriften.<br />
(3) 1 Die Straßenaufsicht über andere Träger der Straßenbaulast erstreckt sich<br />
auch auf das Ermessen. 2 Die Straßenaufsichtsbehörden können in diesen<br />
Fällen uneingeschränkt Weisungen erteilen und alle nach Absatz 2 Satz 2<br />
zulässigen Maßnahmen ergreifen.
Bay StrWG Art. 62 a Behörden nach dem Bundesfernstraßengesetz<br />
(1) 1 Oberste Landesstraßenbaubehörde ist das Staatsministerium des Innern.<br />
Straßenbaubehörden sind<br />
1. für die Bundesautobahnen:<br />
die Autobahndirektionen,<br />
2. für die Bundesstraßen:<br />
a) die Staatlichen Bauämter,<br />
b) die Gemeinden, soweit sie Träger der Straßenbaulast sind.<br />
(2) 1 Oberste Straßenaufsichtsbehörde für die Bundesstraßen und<br />
Straßenaufsichtsbehörde für die Bundesautobahnen ist das<br />
Staatsministerium des Innern. 2 Straßenaufsichtsbehörden für die<br />
Bundesstraßen sind die Regierungen.<br />
(3) Höhere Verwaltungsbehörden sind die Regierungen.<br />
(4) Den Antrag nach § 6 Abs. 3 FStrG stellt die für die neue Straßenklasse<br />
zuständige Straßenbaubehörde.<br />
(5) 1 Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung die<br />
nach dem Bundesfernstraßengesetz in der jeweils geltenden Fassung der<br />
obersten Landesstraßenbaubehörde zustehenden Befugnisse ganz oder<br />
teilweise auf nachgeordnete Behörden übertragen. 2 In der<br />
Rechtsverordnung können auch die weiteren nach dem<br />
Bundesfernstraßengesetz in der jeweils geltenden Fassung für den Vollzug<br />
zuständigen Landesbehörden bestimmt werden. 3 In der Rechtsverordnung<br />
kann auch bestimmt werden, daß Entscheidungen nach dem<br />
Bundesfernstraßengesetz in einem auf Grund sonstiger Rechtsvorschriften<br />
durchzuführenden Verfahren zu treffen sind. 4 Ferner kann die<br />
entscheidende Behörde an das Einvernehmen mit einer anderen Behörde<br />
gebunden werden.<br />
Bay StrWG Art. 63 Straßenstatistik<br />
Die Träger der Straßenbaulast sind auf Verlangen der obersten<br />
Straßenaufsichtsbehörde oder der von ihr ermächtigten Behörde zu<br />
statistischen Angaben über ihre Straßen verpflichtet.<br />
Bay StrWG Art. 64 Technische Vorschriften<br />
Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung für jede<br />
Straßenklasse allgemeine technische Vorschriften über den Bau und über die<br />
Unterhaltung erlassen. 1<br />
FÜNFTER TEIL Ordnungswidrigkeiten<br />
Bay StrWG Art. 65 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 66 Bußgeldvorschriften<br />
Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig<br />
1. eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt (Art. 16) und diese<br />
Verunreinigung nicht unverzüglich beseitigt,<br />
2. eine Straße unbefugt zu Sondernutzungen gebraucht oder die mit der<br />
Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt oder der
Unterhaltungspflicht nach Art. 18 Abs. 4 zuwiderhandelt,<br />
3. entgegen Art. 23 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 bauliche Anlagen errichtet, ändert<br />
oder anders nutzt oder vollziehbaren Auflagen nicht nachkommt, unter denen<br />
die Straßenbaubehörde eine Ausnahme zugelassen oder eine Genehmigung<br />
erteilt hat,<br />
4. dem Art. 29 Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt,<br />
5. einer auf Grund des Art. 51 Abs. 4 oder 5 erlassenen Rechtsverordnung<br />
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese<br />
Bußgeldvorschrift verweist.<br />
SECHSTER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay StrWG Art. 67 Straßen- und Bestandsverzeichnis<br />
(Übergangsvorschrift zu Art. 3)<br />
(1) Die Straßen, die bisher als Landstraßen I. und II. Ordnung im<br />
Straßenverzeichnis eingetragen sind, werden Staatsstraßen und<br />
Kreisstraßen.<br />
(2) Straßen im Sinn der Art. 28 und 29 der Bayerischen Gemeindeordnung<br />
vom 17. Oktober 1927 (GVBl. S. 293) bleiben nach Maßgabe und in dem<br />
Umfang der bisherigen Vorschriften bis zur unanfechtbaren Entscheidung<br />
über ihre Aufnahme in das Bestandsverzeichnis öffentliche gemeindliche<br />
Straßen.<br />
(3) 1 Die Bestandsverzeichnisse sind von den Straßenbaubehörden innerhalb<br />
von drei Jahren seit Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s anzulegen. 2 Sie sind<br />
nach Anlegung sechs Monate lang in den Gemeinden, für gemeindefreie<br />
Gebiete bei der Kreisverwaltungsbehörde, zur öffentlichen Einsicht<br />
aufzulegen. 3 Die Straßenbaubehörden haben den Lauf dieser Frist vorher<br />
öffentlich bekanntzumachen. 4 Soweit die Beteiligten bekannt sind, sind sie<br />
gegen Zustellungsnachweis zu unterrichten. 5 Die Verwaltungsgerichte<br />
entscheiden auch über die bürgerlich-rechtlichen Fragen unter Ausschluß<br />
des Rechtswegs vor den ordentlichen Gerichten.<br />
(4) Wird eine Eintragung nach Absatz 3 im Bestandsverzeichnis unanfechtbar,<br />
so gilt eine nach Art. 6 Abs. 3 erforderliche Zustimmung als erteilt und die<br />
Widmung als verfügt.<br />
(5) 1 Ist eine Straße nicht im Straßenverzeichnis nach Absatz 1 eingetragen<br />
oder nach Absatz 3 nicht im Bestandsverzeichnis aufgenommen worden,<br />
so gilt sie nicht als öffentliche Straße. 2 Absatz 2 bleibt unberührt.<br />
Bay StrWG Art. 68 Ortsdurchfahrten (Übergangsvorschrift zu Art. 4)<br />
Beginn und Ende der Ortsdurchfahrten bemessen sich nach ihrer Festsetzung<br />
nach §§ 13 ff. der Verordnung zur Durchführung des <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung vom<br />
7. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1237), bis sie nach Art. 4 Abs. 2 neu festgesetzt<br />
werden.<br />
Bay StrWG Art. 69 Sondernutzung (Übergangsvorschrift zu Art. 18 ff.)<br />
(1) 1 Bei Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s bestehende unwiderrufliche<br />
Nutzungsrechte an öffentlichen Straßen können zur Beseitigung von
Beeinträchtigungen des Gemeingebrauchs durch Enteignung aufgehoben<br />
werden. 2 Art. 40 gilt entsprechend.<br />
(2) Für Sondernutzungen im Sinn der Art. 18 und 19, die bei Inkrafttreten<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s durch bürgerlich-rechtliche Verträge vereinbart sind,<br />
gelten die Vorschriften über Sondernutzungen von dem Zeitpunkt an, zu<br />
dem die Verträge erstmals nach Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s kündbar<br />
sind.<br />
(3) Für Nutzungen an Baumpflanzungen, die nach § 3 Abs. 2 des <strong>Gesetze</strong>s<br />
über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der<br />
Straßenverwaltung vom 26. März 1934 (RGBl. I S. 243) eingeräumt<br />
wurden, gelten die Vorschriften des bürgerlichen Rechts.<br />
Bay StrWG Art. 70 Enteignungsverfahren (Übergangsvorschrift zu<br />
Art. 40)<br />
Die bei Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s eingeleiteten und noch nicht<br />
abgeschlossenen Enteignungsverfahren sind nach den bisher geltenden<br />
Vorschriften zu Ende zu führen.<br />
Bay StrWG Art. 71 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 72 Hoheitliche Wahrnehmung der Dienstaufgaben<br />
Die aus dem Bau und der Unterhaltung der öffentlichen Straßen einschließlich<br />
der Bundesfernstraßen und die aus der Überwachung der Verkehrssicherheit<br />
dieser Straßen sich ergebenden Aufgaben werden von den Bediensteten der<br />
damit befaßten Körperschaften in Ausübung eines öffentlichen Amts<br />
wahrgenommen.<br />
Bay StrWG Art. 73 Eigentum an Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen<br />
1 Mit Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s geht das Eigentum an den Ortsdurchfahrten<br />
der Bundesstraßen auf die Gemeinden über, soweit sie Träger der<br />
Straßenbaulast für diese Ortsdurchfahrten nach dem Bundesfernstraßengesetz<br />
sind und das Eigentum bisher bereits einer Gebietskörperschaft mit Ausnahme<br />
der Bundesrepublik Deutschland zustand. 2 Art. 11 Abs. 1 bis 3 gelten<br />
entsprechend.<br />
Bay StrWG Art. 74und 75 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 76 Übernahme der Aufgaben aus der Straßenbaulast<br />
durch die Landkreise oder die Bezirke<br />
Soweit die Landkreise nach Art. 52 der Landkreisordnung Aufgaben aus der<br />
Straßenbaulast kreisangehöriger Gemeinden oder die Bezirke nach Art. 49 der<br />
Bezirksordnung solche Aufgaben der Landkreise und kreisfreien Gemeinden<br />
übernehmen, sind sie Dritte im Sinn des Art. 44 Abs. 1 und<br />
Straßenbaubehörde.
Bay StrWG Art. 77und 78 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 79 (weggefallen)<br />
Bay StrWG Art. 80 Zeitpunkt des Inkrafttretens<br />
Das Gesetz ist dringlich; es tritt am 1. September 1958 in Kraft.
Verfassung des Freistaates Bayern<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 GVBl. S. 991, geändert durch<br />
<strong>Gesetze</strong> vom 10. November 2003 GVBl. S. 816, vom 10. November 2003 GVBl. S. 817 (FN BayRS<br />
100-1-I)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER HAUPTTEIL Aufbau und Aufgaben des Staates<br />
1. ABSCHNITT Die Grundlagen des Bayerischen Staates<br />
Artikel 1<br />
Artikel 2<br />
Artikel 3<br />
Artikel 3 a<br />
Artikel 4<br />
Artikel 5<br />
Artikel 6<br />
Artikel 7<br />
Artikel 8<br />
Artikel 9<br />
Artikel 10<br />
Artikel 11<br />
Artikel 12<br />
2. ABSCHNITT Der Landtag<br />
Artikel 13<br />
Artikel 14<br />
Artikel 15
Artikel 16<br />
Artikel 16 a<br />
Artikel 17<br />
Artikel 18<br />
Artikel 19<br />
Artikel 20<br />
Artikel 21<br />
Artikel 22<br />
Artikel 23<br />
Artikel 24<br />
Artikel 25<br />
Artikel 25 a<br />
Artikel 26<br />
Artikel 27<br />
Artikel 28<br />
Artikel 29<br />
Artikel 30<br />
Artikel 31<br />
Artikel 32<br />
Artikel 33<br />
Artikel 33 a<br />
3. ABSCHNITT weggefallen<br />
4. ABSCHNITT Die Staatsregierung
Artikel 43<br />
Artikel 44<br />
Artikel 45<br />
Artikel 46<br />
Artikel 47<br />
Artikel 48<br />
Artikel 49<br />
Artikel 50<br />
Artikel 51<br />
Artikel 52<br />
Artikel 53<br />
Artikel 54<br />
Artikel 55<br />
Artikel 56<br />
Artikel 57<br />
Artikel 58<br />
Artikel 59<br />
5. ABSCHNITT Der Verfassungsgerichtshof<br />
Artikel 60<br />
Artikel 61<br />
Artikel 62<br />
Artikel 63<br />
Artikel 64
Artikel 65<br />
Artikel 66<br />
Artikel 67<br />
Artikel 68<br />
Artikel 69<br />
6. ABSCHNITT Die Gesetzgebung<br />
Artikel 70<br />
Artikel 71<br />
Artikel 72<br />
Artikel 73<br />
Artikel 74<br />
Artikel 75<br />
Artikel 76<br />
7. ABSCHNITT Die Verwaltung<br />
Artikel 77<br />
Artikel 78<br />
Artikel 79<br />
Artikel 80<br />
Artikel 81<br />
Artikel 82<br />
Artikel 83<br />
8. ABSCHNITT Die Rechtspflege<br />
Artikel 84
Artikel 85<br />
Artikel 86<br />
Artikel 87<br />
Artikel 88<br />
Artikel 89<br />
Artikel 90<br />
Artikel 91<br />
Artikel 92<br />
Artikel 93<br />
9. ABSCHNITT Die Beamten<br />
Artikel 94<br />
Artikel 95<br />
Artikel 96<br />
Artikel 97<br />
ZWEITER HAUPTTEIL Grundrechte und Grundpflichten<br />
Artikel 98<br />
Artikel 99<br />
Artikel 100<br />
Artikel 101<br />
Artikel 102<br />
Artikel 103<br />
Artikel 104<br />
Artikel 105
Artikel 106<br />
Artikel 107<br />
Artikel 108<br />
Artikel 109<br />
Artikel 110<br />
Artikel 111<br />
Artikel 111 a<br />
Artikel 112<br />
Artikel 113<br />
Artikel 114<br />
Artikel 115<br />
Artikel 116<br />
Artikel 117<br />
Artikel 118<br />
Artikel 118 a<br />
Artikel 119<br />
Artikel 120<br />
Artikel 121<br />
Artikel 122<br />
Artikel 123<br />
DRITTER HAUPTTEIL Das Gemeinschaftsleben<br />
1. ABSCHNITT Ehe, Familie und Kinder<br />
Artikel 124
Artikel 125<br />
Artikel 126<br />
Artikel 127<br />
2. ABSCHNITT Bildung und Schule, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen<br />
und der kulturellen Überlieferung<br />
Artikel 128<br />
Artikel 129<br />
Artikel 130<br />
Artikel 131<br />
Artikel 132<br />
Artikel 133<br />
Artikel 134<br />
Artikel 135<br />
Artikel 136<br />
Artikel 137<br />
Artikel 138<br />
Artikel 139<br />
Artikel 140<br />
Artikel 141<br />
3. ABSCHNITT Religion und Religionsgemeinschaften<br />
Artikel 142<br />
Artikel 143<br />
Artikel 144
Artikel 145<br />
Artikel 146<br />
Artikel 147<br />
Artikel 148<br />
Artikel 149<br />
Artikel 150<br />
VIERTER HAUPTTEIL Wirtschaft und Arbeit<br />
1. ABSCHNITT Die Wirtschaftsordnung<br />
Artikel 151<br />
Artikel 152<br />
Artikel 153<br />
Artikel 154<br />
Artikel 155<br />
Artikel 156<br />
Artikel 157<br />
2. ABSCHNITT Das Eigentum<br />
Artikel 158<br />
Artikel 159<br />
Artikel 160<br />
Artikel 161<br />
Artikel 162<br />
3. ABSCHNITT Die Landwirtschaft<br />
Artikel 163
Artikel 164<br />
Artikel 165<br />
4. ABSCHNITT Die Arbeit<br />
Artikel 166<br />
Artikel 167<br />
Artikel 168<br />
Artikel 169<br />
Artikel 170<br />
Artikel 171<br />
Artikel 172<br />
Artikel 173<br />
Artikel 174<br />
Artikel 175<br />
Artikel 176<br />
Artikel 177<br />
Schluß- und Übergangsbestimmungen<br />
Artikel 178<br />
Artikel 179<br />
Artikel 180<br />
Artikel 181<br />
Artikel 182<br />
Artikel 183<br />
Artikel 184
Artikel 185<br />
Artikel 186<br />
Artikel 187<br />
Artikel 188<br />
Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung<br />
ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die<br />
Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse,<br />
den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der<br />
Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische<br />
Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende<br />
demokratische Verfassung<br />
ERSTER HAUPTTEIL Aufbau und Aufgaben des Staates<br />
1. ABSCHNITT Die Grundlagen des Bayerischen Staates<br />
Bay Verfassung Artikel 1<br />
(1) Bayern ist ein Freistaat.<br />
(2) Die Landesfarben sind Weiß und Blau.<br />
(3) Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt.<br />
Bay Verfassung Artikel 2<br />
(1) Bayern ist ein Volksstaat. Träger der Staatsgewalt ist das Volk.<br />
(2) Das Volk tut seinen Willen durch Wahlen und Abstimmung kund. Mehrheit<br />
entscheidet.<br />
Bay Verfassung Artikel 3<br />
(1) Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl.<br />
(2) Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle<br />
Überlieferung.<br />
Bay Verfassung Artikel 3 a<br />
Bayern bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen,<br />
rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz<br />
der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und<br />
deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Bayern arbeitet mit<br />
anderen europäischen Regionen zusammen.<br />
Bay Verfassung Artikel 4<br />
Die Staatsgewalt wird ausgeübt durch die stimmberechtigten Staatsbürger<br />
selbst, durch die von ihnen gewählte Volksvertretung und durch die mittelbar<br />
oder unmittelbar von ihr bestellten Vollzugsbehörden und Richter.
Bay Verfassung Artikel 5<br />
(1) Die gesetzgebende Gewalt steht ausschließlich dem Volk und der<br />
Volksvertretung zu.<br />
(2) Die vollziehende Gewalt liegt in den Händen der Staatsregierung und der<br />
nachgeordneten Vollzugsbehörden.<br />
(3) Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige Richter ausgeübt.<br />
Bay Verfassung Artikel 6<br />
(1) Die Staatsangehörigkeit wird erworben<br />
1. durch Geburt;<br />
2. durch Legitimation;<br />
3. durch Eheschließung;<br />
4. durch Einbürgerung.<br />
(2) Die Staatsangehörigkeit kann nicht aberkannt werden.<br />
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz über die Staatsangehörigkeit.<br />
Bay Verfassung Artikel 7<br />
(1) Staatsbürger ist ohne Unterschied der Geburt, der Rasse, des Geschlechts,<br />
des Glaubens und des Berufs jeder Staatsangehörige, der das<br />
18. Lebensjahr vollendet hat.<br />
(2) Der Staatsbürger übt seine Rechte aus durch Teilnahme an Wahlen,<br />
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie Volksbegehren und<br />
Volksentscheiden.<br />
(3) Die Ausübung dieser Rechte kann von der Dauer eines Aufenthalts bis zu<br />
einem Jahr abhängig gemacht werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 8<br />
Alle deutschen Staatsangehörigen, die in Bayern ihren Wohnsitz haben,<br />
besitzen die gleichen Rechte und haben die gleichen Pflichten wie die<br />
bayerischen Staatsangehörigen.<br />
Bay Verfassung Artikel 9<br />
(1) Das Staatsgebiet gliedert sich in Kreise (Regierungsbezirke); die<br />
Abgrenzung erfolgt durch Gesetz.<br />
(2) Die Kreise sind in Bezirke eingeteilt; die kreisunmittelbaren Städte stehen<br />
den Bezirken gleich. Die Einteilung wird durch Rechtsverordnung der<br />
Staatsregierung bestimmt; hierzu ist die vorherige Genehmigung des<br />
Landtags einzuholen.<br />
Bay Verfassung Artikel 10<br />
(1) Für das Gebiet jedes Kreises und jedes Bezirks besteht ein<br />
Gemeindeverband als Selbstverwaltungskörper.<br />
(2) Der eigene Wirkungskreis der Gemeindeverbände wird durch die<br />
Gesetzgebung bestimmt.<br />
(3) Den Gemeindeverbänden können durch Gesetz weitere Aufgaben<br />
übertragen werden, die sie namens des Staates zu erfüllen haben. Sie
esorgen diese Aufgaben entweder nach den Weisungen der<br />
Staatsbehörden oder kraft besonderer Bestimmung selbständig.<br />
(4) Das wirtschaftliche und kulturelle Eigenleben im Bereich der<br />
Gemeindeverbände ist vor Verödung zu schützen.<br />
Bay Verfassung Artikel 11<br />
(1) Jeder Teil des Staatsgebiets ist einer Gemeinde zugewiesen. Eine<br />
Ausnahme hiervon machen bestimmte unbewohnte Flächen (ausmärkische<br />
Gebiete).<br />
(2) Die Gemeinden sind ursprüngliche Gebietskörperschaften des öffentlichen<br />
Rechts. Sie haben das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen<br />
der <strong>Gesetze</strong> selbst zu ordnen und zu verwalten, insbesonders ihre<br />
Bürgermeister und Vertretungskörper zu wählen.<br />
(3) Durch Gesetz können den Gemeinden Aufgaben übertragen werden, die<br />
sie namens des Staates zu erfüllen haben.<br />
(4) Die Selbstverwaltung der Gemeinden dient dem Aufbau der Demokratie in<br />
Bayern von unten nach oben.<br />
(5) Für die Selbstverwaltung in der Gemeinde gilt der Grundsatz der<br />
Gleichheit der politischen Rechte und Pflichten aller in der Gemeinde<br />
wohnenden Staatsbürger.<br />
Bay Verfassung Artikel 12<br />
(1) Die Grundsätze für die Wahl zum Landtag gelten auch für die Gemeinden<br />
und Gemeindeverbände.<br />
(2) Das Vermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände kann unter keinen<br />
Umständen zum Staatsvermögen gezogen werden. Die Vergabung solchen<br />
Vermögens ist unzulässig.<br />
(3) Die Staatsbürger haben das Recht, Angelegenheiten des eigenen<br />
Wirkungskreises der Gemeinden und Landkreise durch Bürgerbegehren<br />
und Bürgerentscheid zu regeln. Das Nähere regelt ein Gesetz.<br />
2. ABSCHNITT Der Landtag<br />
Bay Verfassung Artikel 13<br />
(1) Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten des bayerischen Volkes.<br />
Amtliche Fußnote: Für den 14. Landtag s. § 2 Nr. 2 des <strong>Gesetze</strong>s vom 20. Februar 1998 (GVBl<br />
S. 39).<br />
(2) Die Abgeordneten sind Vertreter des Volkes, nicht nur einer Partei. Sie<br />
sind nur ihrem Gewissen verantwortlich und an Aufträge nicht gebunden.<br />
Bay Verfassung Artikel 14<br />
(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und<br />
geheimer Wahl nach einem verbesserten Verhältniswahlrecht von allen<br />
wahlberechtigten Staatsbürgern in Wahlkreisen und Stimmkreisen<br />
gewählt. Jeder Regierungsbezirk bildet einen Wahlkreis. Jeder Landkreis<br />
und jede kreisfreie Gemeinde bildet einen Stimmkreis. Soweit es der<br />
Grundsatz der Wahlgleichheit erfordert, sind räumlich zusammenhängende
Stimmkreise abweichend von Satz 3 zu bilden. Je Wahlkreis darf<br />
höchstens ein Stimmkreis mehr gebildet werden als Abgeordnete aus der<br />
Wahlkreisliste zu wählen sind. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate,<br />
die in Anwendung dieser Grundsätze zugeteilt werden, kann die Zahl der<br />
Abgeordneten nach Art. 13 Abs. 1 überschritten werden.<br />
(2) Wählbar ist jeder wahlfähige Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr<br />
vollendet hat.<br />
(3) Die Wahl findet an einem Sonntag oder öffentlichen Ruhetag statt.<br />
(4) Wahlvorschläge, auf die im Land nicht mindestens fünf vom Hundert der<br />
insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen entfallen, erhalten keinen Sitz<br />
im Landtag zugeteilt.<br />
(5) Das Nähere bestimmt das Landeswahlgesetz.<br />
Bay Verfassung Artikel 15<br />
(1) Wählergruppen, deren Mitglieder oder Förderer darauf ausgehen, die<br />
staatsbürgerlichen Freiheiten zu unterdrücken oder gegen Volk, Staat oder<br />
Verfassung Gewalt anzuwenden, dürfen sich an Wahlen und<br />
Abstimmungen nicht beteiligen.<br />
(2) Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, trifft auf<br />
Antrag der Staatsregierung oder einer der im Landtag vertretenen<br />
politischen Parteien der Bayerische Verfassungsgerichtshof.<br />
Bay Verfassung Artikel 16<br />
(1) Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Seine Wahlperiode beginnt mit<br />
seinem ersten Zusammentritt und endet mit dem Zusammentritt eines<br />
neuen Landtags. Die Neuwahl findet frühestens 59 Monate, spätestens<br />
62 Monate nach dem Tag statt, an dem der vorausgegangene Landtag<br />
gewählt worden ist.<br />
(2) Der Landtag tritt spätestens am 22. Tag nach der Wahl zusammen.<br />
Bay Verfassung Artikel 16 a<br />
(1) Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil der<br />
parlamentarischen Demokratie.<br />
(2) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtags, welche die<br />
Staatsregierung nicht stützen, haben das Recht auf ihrer Stellung<br />
entsprechende Wirkungsmöglichkeiten in Parlament und Öffentlichkeit. Sie<br />
haben Anspruch auf eine zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben<br />
erforderliche Ausstattung.<br />
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.<br />
Bay Verfassung Artikel 17<br />
(1) Der Landtag tritt jedes Jahr im Herbst am Sitz der Staatsregierung<br />
zusammen.<br />
(2) Der Präsident kann ihn früher einberufen. Er muß ihn einberufen, wenn es<br />
die Staatsregierung oder mindestens ein Drittel der Landtagsmitglieder<br />
verlangt.
(3) Der Landtag bestimmt den Schluß der Tagung und den Zeitpunkt des<br />
Wiederzusammentritts.<br />
Bay Verfassung Artikel 18<br />
(1) Der Landtag kann sich vor Ablauf seiner Wahldauer durch<br />
Mehrheitsbeschluß seiner gesetzlichen Mitgliederzahl selbst auflösen.<br />
(2) Er kann im Falle des Art. 44 Abs. 5 vom Landtagspräsidenten aufgelöst<br />
werden.<br />
(3) Er kann auf Antrag von einer Million wahlberechtigter Staatsbürger durch<br />
Volksentscheid abberufen werden.<br />
(4) Die Neuwahl des Landtags findet spätestens am sechsten Sonntag nach<br />
der Auflösung oder Abberufung statt.<br />
Bay Verfassung Artikel 19<br />
Die Mitgliedschaft beim Landtag während der Wahldauer geht verloren durch<br />
Verzicht, Ungültigkeitserklärung der Wahl, nachträgliche Änderung des<br />
Wahlergebnisses und Verlust der Wahlfähigkeit.<br />
Bay Verfassung Artikel 20<br />
(1) Der Landtag wählt aus seiner Mitte ein Präsidium, bestehend aus einem<br />
Präsidenten, dessen Stellvertretern und den Schriftführern.<br />
(2) Zwischen zwei Tagungen führt das Präsidium die laufenden Geschäfte des<br />
Landtags fort.<br />
(3) Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung.<br />
Bay Verfassung Artikel 21<br />
(1) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im<br />
Landtagsgebäude aus.<br />
(2) Er führt die Hausverwaltung, verfügt über die Einnahmen und Ausgaben<br />
des Hauses und vertritt den Staat in allen Rechtsgeschäften und<br />
Rechtsstreitigkeiten dieser Verwaltung.<br />
Bay Verfassung Artikel 22<br />
(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. Auf Antrag von 50 Mitgliedern oder der<br />
Staatsregierung kann mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder<br />
die Öffentlichkeit für die Behandlung eines bestimmten Gegenstandes<br />
ausgeschlossen werden. Sie muß ausgeschlossen werden, wenn und<br />
solange es die Staatsregierung zur Begründung ihres Antrages auf<br />
Ausschluß der Öffentlichkeit verlangt. Der Landtag entscheidet darüber,<br />
ob und in welcher Art die Öffentlichkeit über solche Verhandlungen<br />
unterrichtet werden soll.<br />
(2) Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen<br />
Sitzungen des Landtags oder seiner Ausschüsse bleiben von jeder<br />
Verantwortlichkeit frei, es sei denn, daß es sich um die Wiedergabe von<br />
Ehrverletzungen handelt.
Bay Verfassung Artikel 23<br />
(1) Der Landtag beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen,<br />
sofern die Verfassung kein anderes Stimmverhältnis vorschreibt.<br />
(2) Zur Beschlußfähigkeit des Landtags ist die Anwesenheit der Mehrheit<br />
seiner Mitglieder erforderlich.<br />
(3) Die in der Verfassung vorgesehenen Ausnahmen bleiben unberührt.<br />
Bay Verfassung Artikel 24<br />
(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können das Erscheinen des<br />
Ministerpräsidenten und jedes Staatsministers und Staatssekretärs<br />
verlangen.<br />
(2) Die Mitglieder der Staatsregierung und die von ihnen bestellten<br />
Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Landtags und seiner<br />
Ausschüsse Zutritt. Sie müssen während der Beratung jederzeit, auch<br />
außerhalb der Tagesordnung, gehört werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 25<br />
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel seiner<br />
Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen.<br />
(2) Bei der Einsetzung jedes neuen Untersuchungsausschusses wechselt der<br />
Vorsitz unter den Fraktionen entsprechend ihrem Stärkeverhältnis im<br />
Landtag.<br />
(3) Diese Ausschüsse und die von ihnen ersuchten Behörden können in<br />
entsprechender Anwendung der Strafprozeßordnung alle erforderlichen<br />
Beweise erheben, auch Zeugen und Sachverständige vorladen,<br />
vernehmen, beeidigen und das Zeugniszwangsverfahren gegen sie<br />
durchführen. Das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis<br />
bleibt jedoch unberührt. Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind<br />
verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebung Folge<br />
zu leisten. Die Akten der Behörden sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.<br />
(4) Auf Antrag von einem Fünftel ihrer Mitglieder haben die Ausschüsse<br />
zulässigen Anträgen nach Absatz 3 stattzugeben. Hält die Mehrheit der<br />
Mitglieder dieses Ausschusses einen Antrag nach Absatz 3 für unzulässig,<br />
so entscheidet darüber der Landtag. Gegen dessen Entscheidung kann der<br />
Bayerische Verfassungsgerichtshof angerufen werden.<br />
(5) Die Untersuchungsausschüsse verhandeln öffentlich, doch wird die<br />
Öffentlichkeit auf Verlangen einer Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen.<br />
Art. 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.<br />
Bay Verfassung Artikel 25 a<br />
Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame<br />
Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Freistaates Bayern fallen, kann<br />
der Landtag eine Enquete-Kommission einsetzen. Auf Antrag eines Fünftels<br />
seiner Mitglieder ist er dazu verpflichtet. Der Antrag muß den Auftrag der<br />
Kommission bezeichnen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des<br />
Landtags.
Bay Verfassung Artikel 26<br />
(1) Der Landtag bestellt zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung<br />
gegenüber der Staatsregierung und zur Behandlung dringlicher<br />
Staatsangelegenheiten für die Zeit außerhalb der Tagung sowie nach der<br />
Auflösung oder der Abberufung des Landtags bis zum Zusammentritt des<br />
neuen Landtags einen Zwischenausschuß. Dieser Ausschuß hat die<br />
Befugnisse des Landtags, doch kann er nicht Ministeranklage erheben und<br />
nicht <strong>Gesetze</strong> beschließen oder Volksbegehren behandeln.<br />
(2) Für diesen Ausschuß gelten die Bestimmungen des Art. 25.<br />
Bay Verfassung Artikel 27<br />
Kein Mitglied des Landtags darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung<br />
gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur<br />
Verantwortung gezogen werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 28<br />
(1) Kein Mitglied des Landtags kann ohne dessen Genehmigung während der<br />
Tagung wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung<br />
gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß es bei Ausübung der Tat<br />
oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen worden ist.<br />
(2) Die gleiche Genehmigung ist erforderlich, wenn der Abgeordnete<br />
anderweitig in seiner persönlichen Freiheit beschränkt und dadurch in der<br />
Ausübung seines Abgeordnetenberufes beeinträchtigt wird.<br />
(3) Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des Landtags und jede Haft oder<br />
sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des<br />
Landtags für die Dauer der Tagung aufgehoben. Ein solches Verlangen<br />
kann jedoch nicht gestellt werden, wenn der Abgeordnete eines<br />
unpolitischen Verbrechens bezichtigt wird. Ob dieser Fall vorliegt,<br />
entscheidet der Landtag.<br />
Bay Verfassung Artikel 29<br />
(1) Die Mitglieder des Landtags sind berechtigt, über Personen, die ihnen in<br />
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anvertrauten oder denen sie<br />
in Ausübung ihres Abgeordnetenberufes Tatsachen anvertraut haben,<br />
sowie über diese Tatsachen selbst, das Zeugnis zu verweigern. Soweit<br />
dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von<br />
Schriftstücken bei ihnen unzulässig.<br />
(2) Eine Untersuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des Landtags<br />
nur mit Genehmigung des Präsidenten vorgenommen werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 30<br />
Abgeordnete bedürfen zur Ausübung ihres Amtes als Mitglied des Landtags<br />
keines Urlaubs von ihrem Arbeitgeber.<br />
Bay Verfassung Artikel 31<br />
Die Mitglieder des Landtags haben das Recht zur freien Fahrt auf allen<br />
staatlichen Verkehrseinrichtungen in Bayern sowie auf eine<br />
Aufwandsentschädigung.
Bay Verfassung Artikel 32<br />
(1) Die Art. 27 mit 31 gelten für das Präsidium des Landtags sowie für die<br />
Mitglieder des Zwischenausschusses und ihre ersten Stellvertreter.<br />
(2) In den Fällen des Art. 28 wird die Mitwirkung des Landtags durch die<br />
Mitwirkung des Zwischenausschusses ersetzt.<br />
Bay Verfassung Artikel 33<br />
Die Wahlprüfung obliegt dem Landtag. Wird die Gültigkeit einer Wahl<br />
bestritten, so entscheidet der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Er<br />
entscheidet auch über die Frage, ob ein Abgeordneter die Mitgliedschaft beim<br />
Landtag verloren hat.<br />
Bay Verfassung Artikel 33 a<br />
(1) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregierung einen<br />
Landesbeauftragten für den Datenschutz.<br />
(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert nach Maßgabe des<br />
<strong>Gesetze</strong>s bei den öffentlichen Stellen die Einhaltung der Vorschriften über<br />
den Datenschutz.<br />
(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amts<br />
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der<br />
Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten.<br />
(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wird auf sechs Jahre gewählt.<br />
Wiederwahl ist zulässig. Er kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf seiner<br />
Amtszeit nur mit Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl des Landtags<br />
abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung der Vorschriften<br />
über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt.<br />
(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.<br />
3. ABSCHNITT weggefallen<br />
4. ABSCHNITT Die Staatsregierung<br />
Bay Verfassung Artikel 43<br />
(1) Die Staatsregierung ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des<br />
Staates.<br />
(2) Sie besteht aus dem Ministerpräsidenten und bis zu 17 Staatsministern<br />
und Staatssekretären.<br />
Bay Verfassung Artikel 44<br />
(1) Der Ministerpräsident wird von dem neu gewählten Landtag spätestens<br />
innerhalb einer Woche nach seinem Zusammentritt auf die Dauer von fünf<br />
Jahren gewählt.<br />
(2) Wählbar ist jeder wahlberechtigte Bayer, der das 40. Lebensjahr vollendet<br />
hat.
(3) Der Ministerpräsident kann jederzeit von seinem Amt zurücktreten. Er<br />
muß zurücktreten, wenn die politischen Verhältnisse ein vertrauensvolles<br />
Zusammenarbeiten zwischen ihm und dem Landtag unmöglich machen.<br />
Der Rücktritt des Ministerpräsidenten hat den Rücktritt der<br />
Staatsregierung zur Folge. Bis zur Neuwahl eines Ministerpräsidenten geht<br />
die Vertretung Bayerns nach außen auf den Landtagspräsidenten über.<br />
Während dieser Zeit kann der Landtagspräsident vom Landtag nicht<br />
abberufen werden.<br />
(4) Bei Rücktritt oder Tod des Ministerpräsidenten während seiner Amtsdauer<br />
wird in der nächsten Sitzung des Landtags ein neuer Ministerpräsident für<br />
den Rest der laufenden Amtsdauer gewählt.<br />
(5) Kommt die Neuwahl innerhalb von vier Wochen nicht zustande, muß der<br />
Landtagspräsident den Landtag auflösen.<br />
Bay Verfassung Artikel 45<br />
Der Ministerpräsident beruft und entläßt mit Zustimmung des Landtags die<br />
Staatsminister und die Staatssekretäre.<br />
Bay Verfassung Artikel 46<br />
Der Ministerpräsident bestimmt mit Zustimmung des Landtags seinen<br />
Stellvertreter aus der Zahl der Staatsminister.<br />
Bay Verfassung Artikel 47<br />
(1) Der Ministerpräsident führt in der Staatsregierung den Vorsitz und leitet<br />
ihre Geschäfte.<br />
(2) Er bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung<br />
gegenüber dem Landtag.<br />
(3) Er vertritt Bayern nach außen.<br />
(4) Er übt in Einzelfällen das Begnadigungsrecht aus.<br />
(5) Er unterbreitet dem Landtag die Vorlagen der Staatsregierung.<br />
Bay Verfassung Artikel 48<br />
(1) Die Staatsregierung kann bei drohender Gefährdung der öffentlichen<br />
Sicherheit und Ordnung das Recht der öffentlichen freien<br />
Meinungsäußerung (Art. 110), die Pressefreiheit (Art. 111), das Brief-,<br />
Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis (Art. 112) und die<br />
Versammlungsfreiheit (Art. 113) zunächst auf die Dauer einer Woche<br />
einschränken oder aufheben.<br />
(2) Sie hat gleichzeitig die Einberufung des Landtags zu veranlassen, ihn von<br />
allen getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu verständigen und diese auf<br />
Verlangen des Landtags ganz oder teilweise aufzuheben. Bestätigt der<br />
Landtag mit der Mehrheit seiner gesetzlichen Mitgliederzahl die<br />
getroffenen Maßnahmen, so wird ihre Geltung um einen Monat verlängert.<br />
(3) Gegen die getroffenen Maßnahmen ist außerdem Beschwerde zum<br />
Bayerischen Verfassungsgerichtshof zulässig; dieser hat innerhalb einer<br />
Woche wenigstens eine vorläufige Entscheidung zu treffen.
Bay Verfassung Artikel 49<br />
Der Ministerpräsident bestimmt die Zahl und die Abgrenzung der<br />
Geschäftsbereiche (Staatsministerien). Dies bedarf der Bestätigung durch<br />
Beschluß des Landtags.<br />
Bay Verfassung Artikel 50<br />
Jedem Staatsminister wird durch den Ministerpräsidenten ein Geschäftsbereich<br />
oder eine Sonderaufgabe zugewiesen. Der Ministerpräsident kann sich selbst<br />
einen oder mehrere Geschäftsbereiche vorbehalten oder einem Staatsminister<br />
mehrere Geschäftsbereiche zuweisen.<br />
Bay Verfassung Artikel 51<br />
(1) Gemäß den vom Ministerpräsidenten bestimmten Richtlinien der Politik<br />
führt jeder Staatsminister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter<br />
eigener Verantwortung gegenüber dem Landtag.<br />
(2) Die Staatssekretäre sind an die Weisungen des Staatsministers, dem sie<br />
zugewiesen sind, gebunden. Im Falle der Verhinderung des<br />
Staatsministers handeln sie selbständig und unter eigener Verantwortung<br />
gegenüber dem Landtag.<br />
Bay Verfassung Artikel 52<br />
Zur Unterstützung des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung in ihren<br />
verfassungsmäßigen Aufgaben besteht eine Staatskanzlei.<br />
Bay Verfassung Artikel 53<br />
Die Staatsregierung gibt sich eine Geschäftsordnung. In dieser wird die<br />
Zuweisung der Geschäfte an die einzelnen Geschäftsbereiche geregelt. Jede<br />
Aufgabe der Staatsverwaltung ist einem Geschäftsbereich zuzuteilen.<br />
Bay Verfassung Artikel 54<br />
Die Staatsregierung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der<br />
Abstimmenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des<br />
Ministerpräsidenten. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit<br />
der Mitglieder erforderlich. Kein Mitglied darf sich der Stimme enthalten.<br />
Bay Verfassung Artikel 55<br />
Für die Geschäftsführung der Staatsregierung und der einzelnen<br />
Staatsministerien gelten folgende Grundsätze:<br />
1. Die Staatsverwaltung wird nach der Verfassung, den <strong>Gesetze</strong>n und dem<br />
Haushaltsplan geführt.<br />
2. Der Staatsregierung und den einzelnen Staatsministerien obliegt der Vollzug<br />
der <strong>Gesetze</strong> und Beschlüsse des Landtags. Zu diesem Zwecke können die<br />
erforderlichen Ausführungs- und Verwaltungsverordnungen von ihr erlassen<br />
werden. Rechtsverordnungen, die über den Rahmen einer<br />
Ausführungsverordnung hinausgehen, bedürfen besonderer gesetzlicher<br />
Ermächtigung.<br />
3. Die Staatsregierung beschließt über alle dem Landtag zu unterbreitenden<br />
Vorlagen. Die Unterrichtung des Landtags durch die Staatsregierung bleibt
einer Vereinbarung zwischen Landtag und Staatsregierung auf gesetzlicher<br />
Grundlage vorbehalten.<br />
4. Die Staatsregierung ernennt die leitenden Beamten der Staatsministerien<br />
und die Vorstände der den Ministerien unmittelbar untergeordneten Behörden.<br />
Die übrigen Beamten werden durch die zuständigen Staatsminister oder durch<br />
die von ihnen beauftragten Behörden ernannt.<br />
5. Die gesamte Staatsverwaltung ist der Staatsregierung und den zuständigen<br />
Staatsministerien untergeordnet. Den Staatsministerien obliegt auch im<br />
Rahmen der <strong>Gesetze</strong> die Aufsicht über die Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
sowie die sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts und die öffentlichrechtlichen<br />
Stiftungen.<br />
6. Jeder Staatsminister übt die Dienstaufsicht über die Behörden und Beamten<br />
seines Geschäftsbereichs aus.<br />
7. Jeder Staatsminister entscheidet über Verwaltungsbeschwerden im Rahmen<br />
seines Geschäftsbereichs.<br />
Bay Verfassung Artikel 56<br />
Sämtliche Mitglieder der Staatsregierung leisten vor ihrem Amtsantritt vor dem<br />
Landtag einen Eid auf die Staatsverfassung.<br />
Bay Verfassung Artikel 57<br />
Der Ministerpräsident, die Staatsminister und die Staatssekretäre dürfen ein<br />
anderes besoldetes Amt, einen Beruf oder ein Gewerbe nicht ausüben; sie<br />
dürfen nicht Mitglieder des Aufsichtsrats oder Vorstands einer privaten<br />
Erwerbsgesellschaft sein. Eine Ausnahme besteht für Gesellschaften, bei denen<br />
der überwiegende Einfluß des Staates sichergestellt ist.<br />
Bay Verfassung Artikel 58<br />
Gehalt, Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung der Mitglieder der<br />
Staatsregierung werden durch Gesetz geregelt.<br />
Bay Verfassung Artikel 59<br />
Der Landtag ist berechtigt, den Ministerpräsidenten, jeden Staatsminister und<br />
Staatssekretär vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof anzuklagen, daß<br />
sie vorsätzlich die Verfassung oder ein Gesetz verletzt haben.<br />
5. ABSCHNITT Der Verfassungsgerichtshof<br />
Bay Verfassung Artikel 60<br />
Als oberstes Gericht für staatsrechtliche Fragen besteht der Bayerische<br />
Verfassungsgerichtshof.<br />
Bay Verfassung Artikel 61<br />
(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über Anklagen gegen ein Mitglied<br />
der Staatsregierung oder des Landtags.<br />
(2) Die Anklage gegen ein Mitglied der Staatsregierung ist darauf gerichtet,<br />
daß die Verfassung oder ein Gesetz von ihm vorsätzlich verletzt worden<br />
ist.
(3) Die Anklage gegen ein Mitglied des Landtags ist darauf gerichtet, daß es in<br />
gewinnsüchtiger Absicht seinen Einfluß oder sein Wissen als Mitglied des<br />
Vertretungskörpers in einer das Ansehen der Volksvertretung gröblich<br />
gefährdenden Weise mißbraucht hat oder daß es vorsätzlich Mitteilungen,<br />
deren Geheimhaltung in einer Sitzung des Landtags oder einer seiner<br />
Ausschüsse beschlossen worden ist, in der Voraussicht, daß sie öffentlich<br />
bekannt werden, einem anderen zur Kenntnis gebracht hat.<br />
(4) Die Erhebung der Anklage erfolgt durch den Landtag auf Antrag von einem<br />
Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl und bedarf einer<br />
Zweidrittelmehrheit dieser Zahl. Jedes Mitglied der Staatsregierung oder<br />
des Landtags kann Antrag gegen sich selbst stellen.<br />
Bay Verfassung Artikel 62<br />
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über den Ausschluß von<br />
Wählergruppen von Wahlen und Abstimmungen (Art. 15 Abs. 2).<br />
Bay Verfassung Artikel 63<br />
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über die Gültigkeit der Wahl der<br />
Mitglieder des Landtags und den Verlust der Mitgliedschaft zum Landtag<br />
(Art. 33).<br />
Bay Verfassung Artikel 64<br />
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über Verfassungsstreitigkeiten<br />
zwischen den obersten Staatsorganen oder in der Verfassung mit eigenen<br />
Rechten ausgestatteten Teilen eines obersten Staatsorgans.<br />
Bay Verfassung Artikel 65<br />
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über die Verfassungsmäßigkeit von<br />
<strong>Gesetze</strong>n (Art. 92).<br />
Bay Verfassung Artikel 66<br />
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über Beschwerden wegen Verletzung<br />
der verfassungsmäßigen Rechte durch eine Behörde (Art. 48 Abs. 3, Art. 120).<br />
Bay Verfassung Artikel 67<br />
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet ferner in den besonderen ihm durch<br />
Gesetz zugewiesenen Fällen.<br />
Bay Verfassung Artikel 68<br />
(1) Der Verfassungsgerichtshof wird beim Oberlandesgericht in München<br />
gebildet.<br />
(2) Der Gerichtshof setzt sich zusammen:<br />
a) in den in Art. 61 geregelten Fällen aus einem der Präsidenten der<br />
Bayerischen Oberlandesgerichte, acht Berufsrichtern, von denen drei dem<br />
Verwaltungsgerichtshof angehören, sowie zehn weiteren Mitgliedern,<br />
welche vom Landtag gewählt werden;<br />
b) in den Fällen des Art. 65 aus dem Präsidenten und acht Berufsrichtern,<br />
von denen drei dem Verwaltungsgerichtshof angehören;
c) in den übrigen Fällen aus dem Präsidenten, drei Berufsrichtern, von<br />
denen zwei dem Verwaltungsgerichtshof angehören, und fünf vom<br />
Landtag gewählten Mitgliedern.<br />
(3) Der Präsident und die Berufsrichter werden vom Landtag gewählt. Sie<br />
können nicht Mitglieder des Landtags sein.<br />
Bay Verfassung Artikel 69<br />
Die weiteren Bestimmungen über die Organisation des Gerichtshofs und über<br />
das Verfahren vor ihm sowie über die Vollstreckung seiner Urteile werden<br />
durch Gesetz geregelt.<br />
6. ABSCHNITT Die Gesetzgebung<br />
Bay Verfassung Artikel 70<br />
(1) Die für alle verbindlichen Gebote und Verbote bedürfen der <strong>Gesetze</strong>sform.<br />
(2) Auch der Staatshaushalt muß vom Landtag durch formelles Gesetz<br />
festgestellt werden.<br />
(3) Das Recht der Gesetzgebung kann vom Landtag nicht übertragen werden,<br />
auch nicht auf seine Ausschüsse.<br />
Bay Verfassung Artikel 71<br />
Die <strong>Gesetze</strong>svorlagen werden vom Ministerpräsidenten namens der<br />
Staatsregierung, aus der Mitte des Landtags oder vom Volk (Volksbegehren)<br />
eingebracht.<br />
Bay Verfassung Artikel 72<br />
(1) Die <strong>Gesetze</strong> werden vom Landtag oder vom Volk (Volksentscheid)<br />
beschlossen.<br />
(2) Staatsverträge werden vom Ministerpräsidenten nach vorheriger<br />
Zustimmung des Landtags abgeschlossen.<br />
Bay Verfassung Artikel 73<br />
Über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt.<br />
Bay Verfassung Artikel 74<br />
(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Zehntel der<br />
stimmberechtigten Staatsbürger das Begehren nach Schaffung eines<br />
<strong>Gesetze</strong>s stellt.<br />
(2) Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter und mit Gründen versehener<br />
<strong>Gesetze</strong>ntwurf zugrundeliegen.<br />
(3) Das Volksbegehren ist vom Ministerpräsidenten namens der<br />
Staatsregierung unter Darlegung ihrer Stellungnahme dem Landtag zu<br />
unterbreiten.<br />
(4) Wenn der Landtag das Volksbegehren ablehnt, kann er dem Volk einen<br />
eigenen <strong>Gesetze</strong>ntwurf zur Entscheidung mit vorlegen.
(5) Rechtsgültige Volksbegehren sind von der Volksvertretung binnen drei<br />
Monaten nach Unterbreitung zu behandeln und binnen weiterer drei<br />
Monate dem Volk zur Entscheidung vorzulegen. Der Ablauf dieser Fristen<br />
wird durch die Auflösung des Landtags gehemmt.<br />
(6) Die Volksentscheide über Volksbegehren finden gewöhnlich im Frühjahr<br />
oder Herbst statt.<br />
(7) Jeder dem Volk zur Entscheidung vorgelegte <strong>Gesetze</strong>ntwurf ist mit einer<br />
Weisung der Staatsregierung zu begleiten, die bündig und sachlich sowohl<br />
die Begründung der Antragsteller wie die Auffassung der Staatsregierung<br />
über den Gegenstand darlegen soll.<br />
Bay Verfassung Artikel 75<br />
(1) Die Verfassung kann nur im Wege der Gesetzgebung geändert werden.<br />
Anträge auf Verfassungsänderungen, die den demokratischen<br />
Grundgedanken der Verfassung widersprechen, sind unzulässig.<br />
(2) Beschlüsse des Landtags auf Änderung der Verfassung bedürfen einer<br />
Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl. Sie müssen dem Volk zur<br />
Entscheidung vorgelegt werden.<br />
(3) Meinungsverschiedenheiten darüber, ob durch ein Gesetz die Verfassung<br />
geändert wird oder ob ein Antrag auf unzulässige Verfassungsänderung<br />
vorliegt, entscheidet der Bayerische Verfassungsgerichtshof.<br />
(4) Änderungen der Verfassung sind im Text der Verfassung oder in einem<br />
Anhang aufzunehmen.<br />
Bay Verfassung Artikel 76<br />
(1) Die verfassungsmäßig zustandegekommenen <strong>Gesetze</strong> werden vom<br />
Ministerpräsidenten ausgefertigt und auf seine Anordnung binnen<br />
Wochenfrist im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt<br />
bekanntgemacht.<br />
(2) In jedem Gesetz muß der Tag bestimmt sein, an dem es in Kraft tritt.<br />
7. ABSCHNITT Die Verwaltung<br />
Bay Verfassung Artikel 77<br />
(1) Die Organisation der allgemeinen Staatsverwaltung, die Regelung der<br />
Zuständigkeiten und der Art der Bestellung der staatlichen Organe<br />
erfolgen durch Gesetz. Die Einrichtung der Behörden im einzelnen obliegt<br />
der Staatsregierung und auf Grund der von ihr erteilten Ermächtigung den<br />
einzelnen Staatsministerien.<br />
(2) Für die Organisation der Behörden und die Regelung ihres Verfahrens hat<br />
als Richtschnur zu dienen, daß unter Wahrung der notwendigen<br />
Einheitlichkeit der Verwaltung alle entbehrliche Zentralisation vermieden,<br />
die Entschlußkraft und die Selbstverantwortung der Organe gehoben wird<br />
und die Rechte der Einzelperson genügend gewahrt werden.
Bay Verfassung Artikel 78<br />
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Jahr<br />
veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden.<br />
(2) Ausgaben, die zur Deckung der Kosten bestehender bereits bewilligter<br />
Einrichtungen und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen des Staates<br />
erforderlich sind, müssen in den Haushaltsplan eingestellt werden.<br />
(3) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Rechnungsjahrs durch Gesetz<br />
festgestellt.<br />
(4) Wird der Staatshaushalt im Landtag nicht rechtzeitig verabschiedet, so<br />
führt die Staatsregierung den Haushalt zunächst nach dem Haushaltsplan<br />
des Vorjahres weiter.<br />
(5) Beschlüsse des Landtags, welche die im Entwurf des Haushaltsplans<br />
eingesetzten Ausgaben erhöhen, sind auf Verlangen der Staatsregierung<br />
noch einmal zu beraten. Diese Beratung darf ohne Zustimmung der<br />
Staatsregierung nicht vor Ablauf von 14 Tagen stattfinden.<br />
(6) Die Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr, in besonderen Fällen auch<br />
für eine längere Dauer bewilligt.<br />
Bay Verfassung Artikel 79<br />
Eine Angelegenheit, welche Ausgaben verursacht, für die im festgesetzten<br />
Haushaltsplan kein entsprechender Betrag eingestellt ist, darf seitens des<br />
Landtags nur in Beratung gezogen und beschlossen werden, wenn gleichzeitig<br />
für die notwendige Deckung gesorgt wird.<br />
Bay Verfassung Artikel 80<br />
(1) Über die Verwendung aller Staatseinnahmen legt der Staatsminister der<br />
Finanzen im folgenden Rechnungsjahr zur Entlastung der Staatsregierung<br />
dem Landtag Rechnung. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch einen mit<br />
richterlicher Unabhängigkeit ausgestatteten Rechnungshof.<br />
(2) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregierung den Präsidenten des<br />
Rechnungshofs. Die Wahldauer beträgt 12 Jahre. Wiederwahl ist<br />
ausgeschlossen. Er kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf seiner<br />
Amtszeit nur abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung der<br />
Vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies<br />
rechtfertigt. Die Durchführung eines Amtsenthebungsverfahrens bedarf<br />
der Zustimmung des Landtags mit Zweidrittelmehrheit seiner<br />
Mitgliederzahl.<br />
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.<br />
Bay Verfassung Artikel 81<br />
Das Grundstockvermögen des Staates darf in seinem Wertbestand nur auf<br />
Grund eines <strong>Gesetze</strong>s verringert werden. Der Erlös aus der Veräußerung von<br />
Bestandteilen des Grundstockvermögens ist zu Neuerwerbungen für dieses<br />
Vermögen zu verwenden.
Bay Verfassung Artikel 82<br />
Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei außerordentlichem Bedarf<br />
beschafft werden. Alle Kreditbeschaffungen und Kreditgewährungen oder<br />
Sicherheitsleistungen zu Lasten des Staates, deren Wirkung über ein Jahr<br />
hinausgeht, erfordern ein Gesetz.<br />
Bay Verfassung Artikel 83<br />
(1) In den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden (Art. 11 Abs. 2) fallen<br />
insbesonders die Verwaltung des Gemeindevermögens und der<br />
Gemeindebetriebe; der örtliche Verkehr nebst Straßen- und Wegebau; die<br />
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht, Gas und elektrischer<br />
Kraft; Einrichtungen zur Sicherung der Ernährung; Ortsplanung,<br />
Wohnungsbau und Wohnungsaufsicht; örtliche Polizei, Feuerschutz;<br />
örtliche Kulturpflege; Volks- und Berufsschulwesen und<br />
Erwachsenenbildung; Vormundschaftswesen und Wohlfahrtspflege;<br />
örtliches Gesundheitswesen; Ehe- und Mütterberatung sowie<br />
Säuglingspflege; Schulhygiene und körperliche Ertüchtigung der Jugend;<br />
öffentliche Bäder; Totenbestattung; Erhaltung ortsgeschichtlicher<br />
Denkmäler und Bauten.<br />
(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, einen Haushaltsplan aufzustellen. Sie<br />
haben das Recht, ihren Bedarf durch öffentliche Abgaben zu decken.<br />
(3) Überträgt der Staat den Gemeinden Aufgaben, verpflichtet er sie zur<br />
Erfüllung von Aufgaben im eigenen Wirkungskreis oder stellt er besondere<br />
Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben, hat er<br />
gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt<br />
die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung der<br />
Gemeinden, ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.<br />
(4) Die Gemeinden unterstehen der Aufsicht der Staatsbehörden. In den<br />
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden wacht der<br />
Staat nur über die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten und die Einhaltung<br />
der gesetzlichen Vorschriften durch die Gemeinden. In den<br />
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises sind die Gemeinden<br />
überdies an die Weisungen der übergeordneten Staatsbehörden<br />
gebunden. Der Staat schützt die Gemeinden bei Durchführung ihrer<br />
Aufgaben.<br />
(5) Verwaltungsstreitigkeiten zwischen den Gemeinden und dem Staate<br />
werden von den Verwaltungsgerichten entschieden.<br />
(6) Die Bestimmungen der Abs. 2 mit 5 gelten auch für die<br />
Gemeindeverbände.<br />
(7) Die kommunalen Spitzenverbände sollen rechtzeitig gehört werden, bevor<br />
durch Gesetz oder Rechtsverordnung Angelegenheiten geregelt werden,<br />
welche die Gemeinden oder die Gemeindeverbände berühren. Die<br />
Staatsregierung vereinbart zur Umsetzung des Konnexitätsprinzips<br />
(Abs. 3) ein Konsultationsverfahren mit den kommunalen<br />
Spitzenverbänden.
8. ABSCHNITT Die Rechtspflege<br />
Bay Verfassung Artikel 84<br />
Die allgemein anerkannten Grundsätze des Völkerrechts gelten als Bestandteil<br />
des einheimischen Rechts.<br />
Bay Verfassung Artikel 85<br />
Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen.<br />
Bay Verfassung Artikel 86<br />
(1) Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen<br />
Richter entzogen werden.<br />
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete sind nur kraft gesetzlicher<br />
Bestimmung zulässig.<br />
Bay Verfassung Artikel 87<br />
(1) Die Richter können gegen ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung<br />
und nur aus Gründen und unter den Formen, die gesetzlich bestimmt sind,<br />
dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle<br />
oder in den Ruhestand versetzt werden. Die gesetzliche Bestimmung einer<br />
Altersgrenze ist zulässig.<br />
(2) Die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit werden auf Lebenszeit<br />
ernannt.<br />
Bay Verfassung Artikel 88<br />
An der Rechtspflege sollen Männer und Frauen aus dem Volke mitwirken. Ihre<br />
Zuziehung und die Art ihrer Auswahl wird durch Gesetz geregelt.<br />
Bay Verfassung Artikel 89<br />
Die öffentlichen Ankläger vor den Strafgerichten sind an die Weisungen ihrer<br />
vorgesetzten Behörde gebunden.<br />
Bay Verfassung Artikel 90<br />
Die Verhandlungen vor allen Gerichten sind öffentlich. Bei Gefährdung der<br />
Staatssicherheit oder der öffentlichen Sittlichkeit kann die Öffentlichkeit durch<br />
Gerichtsbeschluß ausgeschlossen werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 91<br />
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.<br />
(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte kann sich eines<br />
Verteidigers bedienen.<br />
Bay Verfassung Artikel 92<br />
Hält der Richter ein Gesetz für verfassungswidrig, so hat er die Entscheidung<br />
des Verfassungsgerichtshofs herbeizuführen.
Bay Verfassung Artikel 93<br />
Verwaltungsrechtliche Streitigkeiten entscheiden die Verwaltungsgerichte.<br />
9. ABSCHNITT Die Beamten<br />
Bay Verfassung Artikel 94<br />
(1) Die Beamten des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände werden<br />
nach Maßgabe der <strong>Gesetze</strong> vom Volk gewählt oder von den zuständigen<br />
Behörden ernannt.<br />
(2) Die öffentlichen Ämter stehen allen wahlberechtigten Staatsbürgern nach<br />
ihrer charakterlichen Eignung, nach ihrer Befähigung und ihren Leistungen<br />
offen, die, soweit möglich, durch Prüfungen im Wege des Wettbewerbs<br />
festgestellt werden. Für die Beförderung des Beamten gelten dieselben<br />
Grundsätze.<br />
Bay Verfassung Artikel 95<br />
(1) Die Grundlagen des Beamtenverhältnisses werden durch Gesetz geregelt.<br />
Das Berufsbeamtentum wird grundsätzlich aufrechterhalten.<br />
(2) Den Beamten steht für die Verfolgung ihrer vermögensrechtlichen<br />
Ansprüche der ordentliche Rechtsweg offen.<br />
(3) Gegen jedes dienstliche Straferkenntnis muß der Beschwerdeweg und ein<br />
Wiederaufnahmeverfahren offenstehen.<br />
(4) In die Nachweise über die Person des Beamten dürfen ungünstige<br />
Tatsachen erst eingetragen werden, wenn der Beamte Gelegenheit gehabt<br />
hat, sich über sie zu äußern. Die Äußerung des Beamten ist in den<br />
Personalnachweis mitaufzunehmen.<br />
(5) Jeder Beamte hat das Recht, seine sämtlichen Personalnachweise jederzeit<br />
einzusehen.<br />
Bay Verfassung Artikel 96<br />
Die Beamten sind Diener des ganzen Volkes, nicht einer einzelnen Partei. Der<br />
Beamte hat sich jederzeit zum demokratisch-konstitutionellen Staat zu<br />
bekennen und zu ihm innerhalb und außerhalb des Dienstes zu stehen.<br />
Bay Verfassung Artikel 97<br />
Verletzt ein Beamter in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt<br />
schuldhaft die ihm einem anderen gegenüber obliegende Amtspflicht, so haftet<br />
für die Folgen der Staat oder diejenige öffentliche Körperschaft, in deren<br />
Diensten der Beamte steht. Der Rückgriff gegen den Beamten bleibt<br />
vorbehalten. Der ordentliche Rechtsweg darf nicht ausgeschlossen werden.<br />
ZWEITER HAUPTTEIL Grundrechte und Grundpflichten<br />
Bay Verfassung Artikel 98<br />
Die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte dürfen grundsätzlich<br />
nicht eingeschränkt werden. Einschränkungen durch Gesetz sind nur zulässig,<br />
wenn die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, Gesundheit und Wohlfahrt es
zwingend erfordern. Sonstige Einschränkungen sind nur unter den<br />
Voraussetzungen des Art. 48 zulässig. Der Verfassungsgerichtshof hat <strong>Gesetze</strong><br />
und Verordnungen für nichtig zu erklären, die ein Grundrecht<br />
verfassungswidrig einschränken.<br />
Bay Verfassung Artikel 99<br />
Die Verfassung dient dem Schutz und dem geistigen und leiblichen Wohl aller<br />
Einwohner. Ihr Schutz gegen Angiffe von außen ist gewährleistet durch das<br />
Völkerrecht, nach innen durch die <strong>Gesetze</strong>, die Rechtspflege und die Polizei.<br />
Bay Verfassung Artikel 100<br />
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist<br />
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.<br />
Bay Verfassung Artikel 101<br />
Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der <strong>Gesetze</strong> und der<br />
guten Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet.<br />
Bay Verfassung Artikel 102<br />
(1) Die Freiheit der Person ist unverletzlich.<br />
(2) Jeder von der öffentlichen Gewalt Festgenommene ist spätestens am Tage<br />
nach der Festnahme dem zuständigen Richter vorzuführen. Dieser hat<br />
dem Festgenommenen mitzuteilen, von welcher Behörde und aus welchen<br />
Gründen die Festnahme verfügt worden ist, und ihm Gelegenheit zu<br />
geben, Einwendungen gegen die Festnahme zu erheben. Er hat gegen den<br />
Festgenommenen entweder Haftbefehl zu erlassen oder ihn unverzüglich<br />
in Freiheit zu setzen.<br />
Bay Verfassung Artikel 103<br />
(1) Eigentumsrecht und Erbrecht werden gewährleistet.<br />
(2) Eigentumsordnung und Eigentumsgebrauch haben auch dem Gemeinwohl<br />
zu dienen.<br />
Bay Verfassung Artikel 104<br />
(1) Eine Handlung kann nur dann mit Strafe belegt werden, wenn die<br />
Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen<br />
wurde.<br />
(2) Niemand darf wegen derselben Tat zweimal gerichtlich bestraft werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 105<br />
Ausländer, die unter Nichtbeachtung der in dieser Verfassung niedergelegten<br />
Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Bayern geflüchtet sind,<br />
dürfen nicht ausgeliefert und ausgewiesen werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 106<br />
(1) Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung.
(2) Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates<br />
und der Gemeinden.<br />
(3) Die Wohnung ist für jedermann eine Freistätte und unverletzlich.<br />
Bay Verfassung Artikel 107<br />
(1) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.<br />
(2) Die ungestörte Religionsausübung steht unter staatlichem Schutz.<br />
(3) Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der bürgerlichen und<br />
staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den<br />
staatsbürgerlichen Pflichten darf es keinen Abbruch tun.<br />
(4) Die Zulassung zu den öffentlichen Ämtern ist von dem religiösen<br />
Bekenntnis unabhängig.<br />
(5) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die<br />
Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer<br />
Religionsgemeinschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen<br />
oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.<br />
(6) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an<br />
religiösen Übungen oder Feierlichkeiten oder zur Benutzung einer<br />
religiösen Eidesformel gezwungen werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 108<br />
Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.<br />
Bay Verfassung Artikel 109<br />
(1) Alle Bewohner Bayerns genießen volle Freizügigkeit. Sie haben das Recht,<br />
sich an jedem beliebigen Ort aufzuhalten und niederzulassen, Grundstücke<br />
zu erwerben und jeden Erwerbszweig zu betreiben.<br />
(2) Alle Bewohner Bayerns sind berechtigt, nach außerdeutschen Ländern<br />
auszuwandern.<br />
Bay Verfassung Artikel 110<br />
(1) Jeder Bewohner Bayerns hat das Recht, seine Meinung durch Wort,<br />
Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem<br />
Recht darf ihn kein Arbeits- und Anstellungsvertrag hindern und niemand<br />
darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht.<br />
(2) Die Bekämpfung von Schmutz und Schund ist Aufgabe des Staates und<br />
der Gemeinden.<br />
Bay Verfassung Artikel 111<br />
(1) Die Presse hat die Aufgabe, im Dienst des demokratischen Gedankens<br />
über Vorgänge, Zustände und Einrichtungen und Persönlichkeiten des<br />
öffentlichen Lebens wahrheitsgemäß zu berichten.<br />
(2) Vorzensur ist verboten. Gegen polizeiliche Verfügungen, welche die<br />
Pressefreiheit berühren, kann gerichtliche Entscheidung verlangt werden.
Bay Verfassung Artikel 111 a<br />
(1) Die Freiheit des Rundfunks wird gewährleistet. Der Rundfunk dient der<br />
Information durch wahrheitsgemäße, umfassende und unparteiische<br />
Berichterstattung sowie durch die Verbreitung von Meinungen. Er trägt zur<br />
Bildung und Unterhaltung bei. Der Rundfunk hat die freiheitliche<br />
demokratische Grundordnung, die Menschenwürde, religiöse und<br />
weltanschauliche Überzeugungen zu achten. Die Verherrlichung von<br />
Gewalt sowie Darbietungen, die das allgemeine Sittlichkeitsgefühl grob<br />
verletzen, sind unzulässig. Meinungsfreiheit, Sachlichkeit, gegenseitige<br />
Achtung, Schutz vor Verunglimpfung sowie die Ausgewogenheit des<br />
Gesamtprogramms sind zu gewährleisten.<br />
(2) Rundfunk wird in öffentlicher Verantwortung und in öffentlich-rechtlicher<br />
Trägerschaft betrieben. An der Kontrolle des Rundfunks sind die in<br />
Betracht kommenden bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und<br />
gesellschaftlichen Gruppen angemessen zu beteiligen. Der Anteil der von<br />
der Staatsregierung und dem Landtag in die Kontrollorgane entsandten<br />
Vertreter darf ein Drittel nicht übersteigen. Die weltanschaulichen und<br />
gesellschaftlichen Gruppen wählen oder berufen ihre Vertreter selbst.<br />
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.<br />
Bay Verfassung Artikel 112<br />
(1) Das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis ist unverletzlich.<br />
(2) Beschränkungen des Rundfunkempfanges sowie des Bezuges von Druck-<br />
Erzeugnissen sind unzulässig.<br />
Bay Verfassung Artikel 113<br />
Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere<br />
Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln.<br />
Bay Verfassung Artikel 114<br />
(1) Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu<br />
bilden.<br />
(2) Vereine und Gesellschaften, die rechts- oder sittenwidrige Zwecke<br />
verfolgen oder solche Mittel gebrauchen oder die darauf ausgehen, die<br />
staatsbürgerlichen Freiheiten zu vernichten oder gegen Volk, Staat oder<br />
Verfassung Gewalt anzuwenden, können verboten werden.<br />
(3) Der Erwerb der Rechtsfähigkeit steht jedem Verein gemäß den<br />
Vorschriften des bürgerlichen Rechts frei.<br />
Bay Verfassung Artikel 115<br />
(1) Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder<br />
Beschwerden an die zuständigen Behörden oder an den Landtag zu<br />
wenden.<br />
(2) Die Rechte des Landtags zur Überprüfung von Beschwerden werden durch<br />
Gesetz geregelt.
Bay Verfassung Artikel 116<br />
Alle Staatsangehörigen ohne Unterschied sind entsprechend ihrer Befähigung<br />
und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen.<br />
Bay Verfassung Artikel 117<br />
Der ungestörte Genuß der Freiheit für jedermann hängt davon ab, daß alle ihre<br />
Treuepflicht gegenüber Volk und Verfassung, Staat und <strong>Gesetze</strong>n erfüllen. Alle<br />
haben die Verfassung und die <strong>Gesetze</strong> zu achten und zu befolgen, an den<br />
öffentlichen Angelegenheiten Anteil zu nehmen und ihre körperlichen und<br />
geistigen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert.<br />
Bay Verfassung Artikel 118<br />
(1) Vor dem Gesetz sind alle gleich. Die <strong>Gesetze</strong> verpflichten jeden in gleicher<br />
Weise und jeder genießt auf gleiche Weise den Schutz der <strong>Gesetze</strong>.<br />
(2) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die<br />
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und<br />
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.<br />
(3) Alle öffentlich-rechtlichen Vorrechte und Nachteile der Geburt oder des<br />
<strong>Stand</strong>es sind aufgehoben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Bestandteil<br />
des Namens; sie dürfen nicht mehr verliehen und können durch Adoption<br />
nicht mehr erworben werden.<br />
(4) Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie mit einem Amt oder einem<br />
Beruf in Verbindung stehen. Sie sollen außerhalb des Amtes oder Berufs<br />
nicht geführt werden. Akademische Grade fallen nicht unter dieses Verbot.<br />
(5) Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nur nach Maßgabe der <strong>Gesetze</strong><br />
verliehen werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 118 a<br />
Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Der Staat<br />
setzt sich für gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne<br />
Behinderung ein.<br />
Bay Verfassung Artikel 119<br />
Rassen- und Völkerhaß zu entfachen ist verboten und strafbar.<br />
Bay Verfassung Artikel 120<br />
Jeder Bewohner Bayerns, der sich durch eine Behörde in seinen<br />
verfassungsmäßigen Rechten verletzt fühlt, kann den Schutz des Bayerischen<br />
Verfassungsgerichtshofes anrufen.<br />
Bay Verfassung Artikel 121<br />
Alle Bewohner Bayerns sind zur Übernahme von Ehrenämtern, insbesondere<br />
als Vormund, Waisenrat, Jugendpfleger, Schöffe und Geschworener<br />
verpflichtet. Das Nähere bestimmen die <strong>Gesetze</strong>.
Bay Verfassung Artikel 122<br />
Bei Unglücksfällen, Notständen und Naturkatastrophen und im nachbarlichen<br />
Verkehr sind alle nach Maßgabe der <strong>Gesetze</strong> zur gegenseitigen Hilfe<br />
verpflichtet.<br />
Bay Verfassung Artikel 123<br />
(1) Alle sind im Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens und unter<br />
Berücksichtigung ihrer Unterhaltspflicht zu den öffentlichen Lasten<br />
heranzuziehen.<br />
(2) Verbrauchssteuern und Besitzsteuern müssen zueinander in einem<br />
angemessenen Verhältnis stehen.<br />
(3) Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von<br />
Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern. Sie ist nach dem<br />
Verwandtschaftsverhältnis zu staffeln.<br />
DRITTER HAUPTTEIL Das Gemeinschaftsleben<br />
1. ABSCHNITT Ehe, Familie und Kinder<br />
Bay Verfassung Artikel 124<br />
(1) Ehe und Familie sind die natürliche und sittliche Grundlage der<br />
menschlichen Gemeinschaft und stehen unter dem besonderen Schutz des<br />
Staates.<br />
(2) Mann und Frau haben in der Ehe grundsätzlich die gleichen bürgerlichen<br />
Rechte und Pflichten.<br />
Bay Verfassung Artikel 125<br />
(1) Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. Sie haben Anspruch auf<br />
Entwicklung zu selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen<br />
Persönlichkeiten. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die<br />
Fürsorge des Staates.<br />
(2) Die Reinhaltung, Gesundung und soziale Förderung der Familie ist<br />
gemeinsame Aufgabe des Staates und der Gemeinden.<br />
(3) Kinderreiche Familien haben Anspruch auf angemessene Fürsorge,<br />
insbesondere auf gesunde Wohnungen.<br />
Bay Verfassung Artikel 126<br />
(1) Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder<br />
zur leiblichen, geistigen und seelischen Tüchtigkeit zu erziehen. Sie sind<br />
darin durch Staat und Gemeinden zu unterstützen. In persönlichen<br />
Erziehungsfragen gibt der Wille der Eltern den Ausschlag.<br />
(2) Uneheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung wie<br />
eheliche Kinder.<br />
(3) Kinder und Jugendliche sind durch staatliche und gemeindliche<br />
Maßnahmen und Einrichtungen gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche,
geistige und körperliche Verwahrlosung und gegen Misshandlung zu<br />
schützen. Fürsorgeerziehung ist nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig.<br />
Bay Verfassung Artikel 127<br />
Das eigene Recht der Religionsgemeinschaften und staatlich anerkannten<br />
weltanschaulichen Gemeinschaften auf einen angemessenen Einfluß bei der<br />
Erziehung der Kinder ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung wird<br />
unbeschadet des Erziehungsrechtes der Eltern gewährleistet.<br />
2. ABSCHNITT Bildung und Schule, Schutz der natürlichen<br />
Lebensgrundlagen und der kulturellen Überlieferung<br />
Bay Verfassung Artikel 128<br />
(1) Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine seinen erkennbaren<br />
Fähigkeiten und seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu<br />
erhalten.<br />
(2) Begabten ist der Besuch von Schulen und Hochschulen, nötigenfalls aus<br />
öffentlichen Mitteln zu ermöglichen.<br />
Bay Verfassung Artikel 129<br />
(1) Alle Kinder sind zum Besuch der Volksschule und der Berufsschule<br />
verpflichtet.<br />
(2) Der Unterricht an diesen Schulen ist unentgeltlich.<br />
Bay Verfassung Artikel 130<br />
(1) Das gesamte Schul- und Bildungswesen steht unter der Aufsicht des<br />
Staates, er kann daran die Gemeinden beteiligen.<br />
(2) Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige, fachmännisch<br />
vorgebildete Beamte ausgeübt.<br />
Bay Verfassung Artikel 131<br />
(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch<br />
Herz und Charakter bilden.<br />
(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser<br />
Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung,<br />
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft,<br />
Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und<br />
Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt.<br />
(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen<br />
Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu<br />
erziehen.<br />
(4) Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege,<br />
Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen.
Bay Verfassung Artikel 132<br />
Für den Aufbau des Schulwesens ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für<br />
die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine<br />
Neigung, seine Leistung und seine innere Berufung maßgebend, nicht aber die<br />
wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern.<br />
Bay Verfassung Artikel 133<br />
(1) Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche Anstalten zu sorgen. Bei<br />
ihrer Einrichtung wirken Staat und Gemeinde zusammen. Auch die<br />
anerkannten Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen<br />
Gemeinschaften sind Bildungsträger.<br />
(2) Die Lehrer an öffentlichen Schulen haben grundsätzlich die Rechte und<br />
Pflichten der Staatsbeamten.<br />
Bay Verfassung Artikel 134<br />
(1) Privatschulen müssen den an die öffentlichen Schulen gestellten<br />
Anforderungen entsprechen. Sie können nur mit Genehmigung des<br />
Staates errichtet und betrieben werden.<br />
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Schule in ihren Lehrzielen (Art.<br />
131) und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer<br />
Lehrer nicht hinter den gleichartigen öffentlichen Schulen zurücksteht,<br />
wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrer genügend<br />
gesichert ist und gegen die Person des Schulleiters keine Bedenken<br />
bestehen.<br />
(3) Private Volksschulen dürfen nur unter besonderen Voraussetzungen<br />
zugelassen werden. Diese Voraussetzungen liegen insbesonders vor, wenn<br />
den Erziehungsberechtigten eine öffentliche Schule ihres Bekenntnisses<br />
oder ihrer Weltanschauung nicht zur Verfügung steht.<br />
Bay Verfassung Artikel 135<br />
Die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle<br />
volksschulpflichtigen Kinder. In ihnen werden die Schüler nach den<br />
Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. Das<br />
Nähere bestimmt das Volksschulgesetz.<br />
Bay Verfassung Artikel 136<br />
(1) An allen Schulen sind beim Unterricht die religiösen Empfindungen aller zu<br />
achten.<br />
(2) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach aller Volksschulen,<br />
Berufsschulen, mittleren und höheren Lehranstalten. Er wird erteilt in<br />
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden<br />
Religionsgemeinschaft.<br />
(3) Kein Lehrer kann gezwungen oder gehindert werden, Religionsunterricht<br />
zu erteilen.<br />
(4) Die Lehrer bedürfen der Bevollmächtigung durch die<br />
Religionsgemeinschaften zur Erteilung des Religionsunterrichts.<br />
(5) Die erforderlichen Schulräume sind zur Verfügung zu stellen.
Bay Verfassung Artikel 137<br />
(1) Die Teilnahme am Religionsunterricht und an kirchlichen Handlungen und<br />
Feierlichkeiten bleibt der Willenserklärung der Erziehungsberechtigten,<br />
vom vollendeten 18. Lebensjahr ab der Willenserklärung der Schüler<br />
überlassen.<br />
(2) Für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht<br />
über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten.<br />
Bay Verfassung Artikel 138<br />
(1) Die Errichtung und Verwaltung der Hochschulen ist Sache des Staates.<br />
Eine Ausnahme bilden die kirchlichen Hochschulen (Art. 150 Abs. 1).<br />
Weitere Ausnahmen bedürfen staatlicher Genehmigung.<br />
(2) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung. Die Studierenden<br />
sind daran zu beteiligen, soweit es sich um ihre Angelegenheiten handelt.<br />
Bay Verfassung Artikel 139<br />
Die Erwachsenenbildung ist durch Volkshochschulen und sonstige mit<br />
öffentlichen Mitteln unterstützte Einrichtungen zu fördern.<br />
Bay Verfassung Artikel 140<br />
(1) Kunst und Wissenschaft sind von Staat und Gemeinde zu fördern.<br />
(2) Sie haben insbesondere Mittel zur Unterstützung schöpferischer Künstler,<br />
Gelehrter und Schriftsteller bereitzustellen, die den Nachweis ernster<br />
künstlerischer oder kultureller Tätigkeit erbringen.<br />
(3) Das kulturelle Leben und der Sport sind von Staat und Gemeinden zu<br />
fördern.<br />
Bay Verfassung Artikel 141<br />
(1) Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch eingedenk der<br />
Verantwortung für die kommenden Generationen, der besonderen<br />
Fürsorge jedes einzelnen und der staatlichen Gemeinschaft anvertraut.<br />
Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt. Mit<br />
Naturgütern ist schonend und sparsam umzugehen. Es gehört auch zu den<br />
vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften des<br />
öffentlichen Rechts,<br />
Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen,<br />
eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen und auf<br />
möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten,<br />
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft zu<br />
verbessern,<br />
den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu<br />
schützen und eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder<br />
auszugleichen,<br />
die heimischen Tier- und Pflanzenarten und ihre notwendigen<br />
Lebensräume sowie kennzeichnende Orts- und Landschaftsbilder zu<br />
schonen und zu erhalten.
(2) Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die<br />
Aufgabe,<br />
die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die<br />
Landschaft zu schützen und zu pflegen,<br />
herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und der Geschichte möglichst<br />
ihrer früheren Bestimmung wieder zuzuführen,<br />
die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes ins Ausland zu verhüten.<br />
(3) Der Genuß der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur,<br />
insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der<br />
Gewässer und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem<br />
Umfang ist jedermann gestattet. Dabei ist jedermann verpflichtet, mit<br />
Natur und Landschaft pfleglich umzugehen. Staat und Gemeinde sind<br />
berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen,<br />
Seen, Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten freizuhalten<br />
und allenfalls durch Einschränkungen des Eigentumsrechtes freizumachen<br />
sowie Wanderwege und Erholungsparks anzulegen.<br />
3. ABSCHNITT Religion und Religionsgemeinschaften<br />
Bay Verfassung Artikel 142<br />
(1) Es besteht keine Staatskirche.<br />
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu gemeinsamer Hausandacht, zu öffentlichen<br />
Kulthandlungen und Religionsgemeinschaften sowie deren<br />
Zusammenschluß innerhalb Bayerns unterliegen im Rahmen der allgemein<br />
geltenden <strong>Gesetze</strong> keinerlei Beschränkung.<br />
(3) Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften sowie solche<br />
weltanschauliche Gemeinschaften, deren Bestrebungen den allgemein<br />
geltenden <strong>Gesetze</strong>n nicht widersprechen, sind von staatlicher<br />
Bevormundung frei. Sie ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten<br />
innerhalb der Schranken der für alle geltenden <strong>Gesetze</strong> selbständig. Sie<br />
verleihen ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der politischen<br />
Gemeinde.<br />
Bay Verfassung Artikel 143<br />
(1) Die Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften<br />
erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften des bürgerlichen<br />
Rechts.<br />
(2) Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften bleiben Körperschaften<br />
des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. Anderen anerkannten<br />
Religionsgemeinschaften sowie solchen weltanschaulichen<br />
Gemeinschaften, deren Bestrebungen den allgemein geltenden <strong>Gesetze</strong>n<br />
nicht widersprechen, sind nach einer Bestandszeit von fünf Jahren auf<br />
Antrag die gleichen Rechte zu gewähren.<br />
(3) Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie weltanschauliche<br />
Gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen<br />
auf Grund der öffentlichen Steuerlisten Steuern erheben.
Bay Verfassung Artikel 144<br />
(1) In der Erfüllung ihrer Amtspflichten genießen die Geistlichen den Schutz<br />
des Staates.<br />
(2) Jede öffentliche Verächtlichmachung der Religion, ihrer Einrichtungen, der<br />
Geistlichen und Ordensleute in ihrer Eigenschaft als Religionsdiener ist<br />
verboten und strafbar.<br />
(3) Geistliche können vor Gerichten und anderen Behörden nicht um Auskunft<br />
über Tatsachen angehalten werden, die ihnen in ihrer Eigenschaft als<br />
Seelsorger anvertraut worden sind.<br />
Bay Verfassung Artikel 145<br />
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder anderen Rechtstiteln beruhenden bisherigen<br />
Leistungen des Staates oder der politischen Gemeinden an die<br />
Religionsgemeinschaften bleiben aufrechterhalten.<br />
(2) Neue freiwillige Leistungen des Staates, der politischen Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände an eine Religionsgemeinschaft werden durch<br />
Zuschläge zu den Staatssteuern und Umlagen der Angehörigen dieser<br />
Religionsgemeinschaft aufgebracht.<br />
Bay Verfassung Artikel 146<br />
Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgemeinschaften, religiöser<br />
Vereine, Orden, Kongregationen, weltanschaulicher Gemeinschaften an ihren<br />
für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten,<br />
Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.<br />
Bay Verfassung Artikel 147<br />
Die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der<br />
seelischen Erhebung und der Arbeitsruhe gesetzlich geschützt.<br />
Bay Verfassung Artikel 148<br />
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern,<br />
Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die<br />
Religionsgemeinschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen,<br />
wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.<br />
Bay Verfassung Artikel 149<br />
(1) Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß jeder Verstorbene schicklich<br />
beerdigt werden kann. Über die Mitwirkung der Religionsgemeinschaften<br />
haben diese selbst zu bestimmen.<br />
(2) In Friedhöfen, die nur für einzelne Religionsgemeinschaften bestimmt<br />
sind, ist die Beisetzung Andersgläubiger unter den für sie üblichen Formen<br />
und ohne räumliche Absonderung zu gestatten, wenn ein anderer<br />
geeigneter Begräbnisplatz nicht vorhanden ist.<br />
(3) Im übrigen bemißt sich der Simultangebrauch der Kirchen und Friedhöfe<br />
nach bisherigem Recht, soweit nicht durch Gesetz Abänderungen getroffen<br />
werden.
Bay Verfassung Artikel 150<br />
(1) Die Kirchen haben das Recht, ihre Geistlichen auf eigenen kirchlichen<br />
Hochschulen auszubilden und fortzubilden.<br />
(2) Die theologischen Fakultäten an den Hochschulen bleiben erhalten.<br />
VIERTER HAUPTTEIL Wirtschaft und Arbeit<br />
1. ABSCHNITT Die Wirtschaftsordnung<br />
Bay Verfassung Artikel 151<br />
(1) Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl,<br />
insbesonders der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für<br />
alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller<br />
Volksschichten.<br />
(2) Innerhalb dieser Zwecke gilt Vertragsfreiheit nach Maßgabe der <strong>Gesetze</strong>.<br />
Die Freiheit der Entwicklung persönlicher Entschlußkraft und die Freiheit<br />
der selbständigen Betätigung des einzelnen in der Wirtschaft wird<br />
grundsätzlich anerkannt. Die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen findet<br />
ihre Grenze in der Rücksicht auf den Nächsten und auf die sittlichen<br />
Forderungen des Gemeinwohls. Gemeinschädliche und unsittliche<br />
Rechtsgeschäfte, insbesonders alle wirtschaftlichen Ausbeutungsverträge<br />
sind rechtswidrig und nichtig.<br />
Bay Verfassung Artikel 152<br />
Die geordnete Herstellung und Verteilung der wirtschaftlichen Güter zur<br />
Deckung des notwendigen Lebensbedarfes der Bevölkerung wird vom Staat<br />
überwacht. Ihm obliegt die Sicherstellung der Versorgung des Landes mit<br />
elektrischer Kraft.<br />
Bay Verfassung Artikel 153<br />
Die selbständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetriebe in Landwirtschaft,<br />
Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie sind in der Gesetzgebung und<br />
Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen.<br />
Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre wirtschaftliche Freiheit und<br />
Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung durch genossenschaftliche Selbsthilfe<br />
zu sichern, vom Staat zu unterstützen. Der Aufstieg tüchtiger Kräfte aus<br />
nichtselbständiger Arbeit zu selbständigen Existenzen ist zu fördern.<br />
Bay Verfassung Artikel 154<br />
Die auf demokratischer Grundlage aus den Kreisen der Berufsverbände<br />
gewählten Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft nehmen an den<br />
wirtschaftlichen Gestaltungsaufgaben teil. Das Nähere bestimmt ein Gesetz.<br />
Bay Verfassung Artikel 155<br />
Zum Zweck einer möglichst gleichmäßigen Befriedigung der wirtschaftlichen<br />
Bedürfnisse aller Bewohner können unter Berücksichtigung der<br />
Lebensinteressen der selbständigen, produktiv tätigen Kräfte der Wirtschaft<br />
durch Gesetz besondere Bedarfsdeckungsgebiete gebildet und dafür
Körperschaften des öffentlichen Rechts auf genossenschaftlicher Grundlage<br />
errichtet werden. Sie haben im Rahmen der <strong>Gesetze</strong> das Recht auf<br />
Selbstverwaltung.<br />
Bay Verfassung Artikel 156<br />
Der Zusammenschluß von Unternehmungen zum Zwecke der<br />
Zusammenballung wirtschaftlicher Macht und der Monopolbildung ist<br />
unzulässig. Insbesondere sind Kartelle, Konzerne und Preisabreden verboten,<br />
welche die Ausbeutung der breiten Massen der Bevölkerung oder die<br />
Vernichtung selbständiger mittelständischer Existenzen bezwecken.<br />
Bay Verfassung Artikel 157<br />
(1) Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der<br />
Volkswirtschaft.<br />
(2) Das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung<br />
der Bedürfnisse aller Bewohner.<br />
2. ABSCHNITT Das Eigentum<br />
Bay Verfassung Artikel 158<br />
Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Offenbarer Mißbrauch des<br />
Eigentums- oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz.<br />
Bay Verfassung Artikel 159<br />
Eine Enteignung darf nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und gegen<br />
angemessene Entschädigung erfolgen, die auch in Form einer Rente gewährt<br />
werden kann. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfall der<br />
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.<br />
Bay Verfassung Artikel 160<br />
(1) Eigentum an Bodenschätzen, die für die allgemeine Wirtschaft von<br />
größerer Bedeutung sind, an wichtigen Kraftquellen, Eisenbahnen und<br />
anderen der Allgemeinheit dienenden Verkehrswegen und<br />
Verkehrsmitteln, an Wasserleitungen und Unternehmungen der<br />
Energieversorgung steht in der Regel Körperschaften oder<br />
Genossenschaften des öffentlichen Rechtes zu.<br />
(2) Für die Allgemeinheit lebenswichtige Produktionsmittel, Großbanken und<br />
Versicherungsunternehmungen können in Gemeineigentum übergeführt<br />
werden, wenn die Rücksicht auf die Gesamtheit es erfordert. Die<br />
Überführung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage und gegen angemessene<br />
Entschädigung.<br />
(3) In Gemeineigentum stehende Unternehmen können, wenn es dem<br />
wirtschaftlichen Zweck entspricht, in einer privatwirtschaftlichen Form<br />
geführt werden.
Bay Verfassung Artikel 161<br />
(1) Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen<br />
überwacht. Mißbräuche sind abzustellen.<br />
(2) Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder<br />
Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit<br />
nutzbar zu machen.<br />
Bay Verfassung Artikel 162<br />
Das geistige Eigentum, das Recht der Urheber, der Erfinder und Künstler<br />
genießen den Schutz und die Obsorge des Staates.<br />
3. ABSCHNITT Die Landwirtschaft<br />
Bay Verfassung Artikel 163<br />
(1) Grund und Boden sind frei. Der Bauer ist nicht an die Scholle gebunden.<br />
(2) Der in der land- und forstwirtschaftlichen Kultur stehende Grund und<br />
Boden aller Besitzgrößen dient der Gesamtheit des Volkes.<br />
(3) Das bäuerliche Eigentum an Grund und Boden wird gewährleistet.<br />
(4) Bauernland soll seiner Zweckbestimmung nicht entfremdet werden. Der<br />
Erwerb von land- und forstwirtschaftlich genutztem Boden soll von einem<br />
Nachweis der Eignung für sachgemäße Bewirtschaftung abhängig gemacht<br />
werden; er darf nicht lediglich der Kapitalanlage dienen.<br />
(5) Enteignungen an land- und forstwirtschaftlichem Grund und Boden sind<br />
nur für dringende Zwecke des Gesamtwohls, insbesonders der Siedlung,<br />
gegen angemessene Entschädigung unter Schonung der Mustergüter und<br />
Beispielwirtschaften zulässig.<br />
Bay Verfassung Artikel 164<br />
(1) Der landwirtschaftlichen Bevölkerung wird durch Anwendung des<br />
technischen Fortschritts auf ihren Lebensbereich, Verbesserung der<br />
Berufsausbildung, Pflege des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens<br />
und Förderung der Erzeugung und des Absatzes ein menschenwürdiges<br />
Auskommen auf der ererbten Heimatscholle gewährleistet.<br />
(2) Ein angemessenes landwirtschaftliches Einkommen wird durch eine den<br />
allgemeinen Wirtschaftsverhältnissen entsprechende Preis- und<br />
Lohngestaltung sowie durch Marktordnungen sichergestellt. Diesen<br />
werden Vereinbarungen zwischen den Organisationen der Erzeuger,<br />
Verteiler und Verbraucher zugrundegelegt.<br />
Bay Verfassung Artikel 165<br />
Die Überschuldung landwirtschaftlicher Betriebe ist durch die Gesetzgebung<br />
möglichst zu verhindern.
4. ABSCHNITT Die Arbeit<br />
Bay Verfassung Artikel 166<br />
(1) Arbeit ist die Quelle des Volkswohlstandes und steht unter dem<br />
besonderen Schutz des Staates.<br />
(2) Jedermann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömmliche Existenz<br />
zu schaffen.<br />
(3) Er hat das Recht und die Pflicht, eine seinen Anlagen und seiner<br />
Ausbildung entsprechende Arbeit im Dienste der Allgemeinheit nach<br />
näherer Bestimmung der <strong>Gesetze</strong> zu wählen.<br />
Bay Verfassung Artikel 167<br />
(1) Die menschliche Arbeitskraft ist als wertvollstes wirtschaftliches Gut eines<br />
Volkes gegen Ausbeutung, Betriebsgefahren und sonstige gesundheitliche<br />
Schädigungen geschützt.<br />
(2) Ausbeutung, die gesundheitliche Schäden nach sich zieht, ist als<br />
Körperverletzung strafbar.<br />
(3) Die Verletzung von Bestimmungen zum Schutz gegen Gefahren und<br />
gesundheitliche Schädigungen in Betrieben wird bestraft.<br />
Bay Verfassung Artikel 168<br />
(1) Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf<br />
angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit den<br />
gleichen Lohn.<br />
(2) Arbeitsloses Einkommen arbeitsfähiger Personen wird nach Maßgabe der<br />
<strong>Gesetze</strong> mit Sondersteuern belegt.<br />
(3) Jeder Bewohner Bayerns, der arbeitsunfähig ist oder dem keine Arbeit<br />
vermittelt werden kann, hat ein Recht auf Fürsorge.<br />
Bay Verfassung Artikel 169<br />
(1) Für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgesetzt werden, die dem<br />
Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende<br />
Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie ermöglichen.<br />
(2) Die Gesamtvereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und<br />
Arbeitnehmerverbänden über das Arbeitsverhältnis sind für die<br />
Verbandsangehörigen verpflichtend und können, wenn es das<br />
Gesamtinteresse erfordert, für allgemein verbindlich erklärt werden.<br />
Bay Verfassung Artikel 170<br />
(1) Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und<br />
Wirtschaftsbedingungen ist für jedermann und für alle Berufe<br />
gewährleistet.<br />
(2) Alle Abreden und Maßnahmen, welche die Vereinigungsfreiheit<br />
einschränken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig und nichtig.
Bay Verfassung Artikel 171<br />
Jedermann hat Anspruch auf Sicherung gegen die Wechselfälle des Lebens<br />
durch eine ausreichende Sozialversicherung im Rahmen der <strong>Gesetze</strong>.<br />
Bay Verfassung Artikel 172<br />
Die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden in einem<br />
besonderen Gesetz geregelt.<br />
Bay Verfassung Artikel 173<br />
Über die tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeit werden durch Gesetz<br />
besondere Bestimmungen erlassen.<br />
Bay Verfassung Artikel 174<br />
(1) Jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf Erholung. Es wird grundsätzlich<br />
gewährleistet durch ein freies Wochenende und durch einen Jahresurlaub<br />
unter Fortbezug des Arbeitsentgelts. Die besonderen Verhältnisse in<br />
einzelnen Berufen werden durch Gesetz geregelt. Der Lohnausfall an<br />
gesetzlichen Feiertagen ist zu vergüten.<br />
(2) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag.<br />
Bay Verfassung Artikel 175<br />
Die Arbeitnehmer haben bei allen wirtschaftlichen Unternehmungen ein<br />
Mitbestimmungsrecht in den sie berührenden Angelegenheiten sowie in<br />
Unternehmungen von erheblicher Bedeutung einen unmittelbaren Einfluß auf<br />
die Leitung und die Verwaltung der Betriebe. Zu diesem Zwecke bilden sie<br />
Betriebsräte nach Maßgabe eines besonderen <strong>Gesetze</strong>s. Dieses enthält auch<br />
Bestimmungen über die Mitwirkung der Betriebsräte bei Einstellung und<br />
Entlassung von Arbeitnehmern.<br />
Bay Verfassung Artikel 176<br />
Die Arbeitnehmer als gleichberechtigte Glieder der Wirtschaft nehmen<br />
zusammen mit den übrigen in der Wirtschaft Tätigen an den wirtschaftlichen<br />
Gestaltungsaufgaben teil.<br />
Bay Verfassung Artikel 177<br />
(1) Arbeitsstreitigkeiten werden durch Arbeitsgerichte entschieden, die aus<br />
einer gleichen Anzahl von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und einem<br />
unabhängigen Vorsitzenden zusammengesetzt sind.<br />
(2) Schiedssprüche in Arbeitsstreitigkeiten können gemäß den bestehenden<br />
<strong>Gesetze</strong>n für allgemeinverbindlich erklärt werden.<br />
Schluß- und Übergangsbestimmungen<br />
Bay Verfassung Artikel 178<br />
Bayern wird einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat<br />
beitreten. Er soll auf einem freiwilligen Zusammenschluß der deutschen<br />
Einzelstaaten beruhen, deren staatsrechtliches Eigenleben zu sichern ist.
Bay Verfassung Artikel 179<br />
Die in dieser Verfassung bezeichneten sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen<br />
Körperschaften, Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft und Organisationen<br />
der Erzeuger, Verteiler und Verbraucher (Art. 154, 155, 164) sind keine<br />
öffentlichen Behörden und dürfen keine staatlichen Machtbefugnisse ausüben.<br />
Zwangsmitgliedschaft bei ihnen ist ausgeschlossen.<br />
Bay Verfassung Artikel 180<br />
Bis zur Errichtung eines deutschen demokratischen Bundesstaates ist die<br />
Bayerische Staatsregierung ermächtigt, soweit es unumgänglich notwendig ist,<br />
mit Zustimmung des Bayerischen Landtags Zuständigkeiten des Staates<br />
Bayern auf den Gebieten der auswärtigen Beziehungen, der Wirtschaft,<br />
Ernährung, des Geldwesens und des Verkehrs an den Rat der<br />
Ministerpräsidenten der Staaten der US-Zone oder andere deutsche<br />
Gemeinschaftseinrichtungen mehrerer Staaten oder Zonen abzutreten.<br />
Bay Verfassung Artikel 181<br />
Das Recht des Bayerischen Staates, im Rahmen seiner Zuständigkeit<br />
Staatsverträge abzuschließen, bleibt unberührt.<br />
Bay Verfassung Artikel 182<br />
Die früher geschlossenen Staatsverträge, insbesondere die Verträge mit den<br />
christlichen Kirchen vom 24. Januar 1925 bleiben in Kraft.<br />
Bay Verfassung Artikel 183<br />
Alle durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft wegen ihrer religiösen<br />
oder politischen Haltung oder wegen ihrer Rasse Geschädigten haben im<br />
Rahmen der Gesetzgebung Anspruch auf Wiedergutmachung.<br />
Bay Verfassung Artikel 184<br />
Die Gültigkeit von <strong>Gesetze</strong>n, die gegen Nationalsozialismus und Militarismus<br />
gerichtet sind oder ihre Folgen beseitigen wollen, wird durch diese Verfassung<br />
nicht berührt oder beschränkt.<br />
Bay Verfassung Artikel 185<br />
Die alten Kreise (Regierungsbezirke) mit ihren Regierungssitzen werden<br />
ehestens wiederhergestellt.<br />
Bay Verfassung Artikel 186<br />
(1) Die Bayerische Verfassung vom 14. August 1919 ist aufgehoben.<br />
(2) Die übrigen <strong>Gesetze</strong> und Verordnungen bleiben vorläufig in Kraft, soweit<br />
ihnen diese Verfassung nicht entgegensteht.<br />
(3) Anordnungen der Behörden, die auf Grund bisheriger <strong>Gesetze</strong> in<br />
rechtsüblicher Weise getroffen waren, behalten ihre Gültigkeit bis zur<br />
Aufhebung im Wege anderweitiger Anordnung oder Gesetzgebung.
Bay Verfassung Artikel 187<br />
Alle Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst sind auf diese Verfassung<br />
zu vereidigen.<br />
Bay Verfassung Artikel 188<br />
Jeder Schüler erhält vor Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck dieser<br />
Verfassung.
Gesetz über den Bayerischen<br />
Verfassungsgerichtshof (Bay VfGHG)<br />
vom 10. Mai 1990 GVBl. S. 122, ber. S. 231, geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 10. Juli 1998 GVBl. S.<br />
385 , vom 16. Dezember 1999 GVBl. S. 521 , vom 24. April 2001 GVBl. S. 140 , vom 24. Dezember<br />
2005 GVBl. S. 665 (FN BayRS 1103-1-S)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Einrichtung und Zuständigkeit<br />
Art. 1 Sitz<br />
Art. 2 Zuständigkeit<br />
ZWEITER TEIL Zusammensetzung und Organisation<br />
Art. 3 Besetzung<br />
Art. 4 Wahl der Verfassungsrichter<br />
Art. 5 Wählbarkeit<br />
Art. 6 Vorschläge für die Wahl der berufsrichterlichen Mitglieder<br />
Art. 7 Vereidigung<br />
Art. 8 Vorrang der Amtsausübung<br />
Art. 9 Ausschließung und Ablehnung<br />
Art. 10 Geschäftsverteilung<br />
Art. 11 Generalsekretär<br />
Art. 12 Befugnisse außerhalb der Sitzung; Vertretung des Präsidenten und des<br />
Generalsekretärs<br />
Art. 13 Geschäftsstelle<br />
DRITTER TEIL Verfahren<br />
KAPITEL I Allgemeine Verfahrensvorschriften<br />
Art. 14 Antragstellung
Art. 15 Zustellung, Ladung<br />
Art. 16 Verfahrensbevollmächtigte<br />
Art. 17 Fristen, Wiedereinsetzung<br />
Art. 18 Amts- und Rechtshilfe<br />
Art. 19 Akteneinsicht<br />
Art. 20 Terminierung, Sitzungsort<br />
Art. 21 Berichterstatter<br />
Art. 22 Mündliche Verhandlung<br />
Art. 23 Beweisaufnahme<br />
Art. 24 Beratung, Abstimmung, Öffentlichkeit, Sitzungspolizei und<br />
Gerichtssprache<br />
Art. 25 Entscheidung<br />
Art. 26 Einstweilige Anordnung<br />
Art. 27 Kosten<br />
Art. 28 Prozeßkostenhilfe, Kostenfestsetzung, Gegenstandswert<br />
Art. 29 Bindungswirkung der Entscheidung, Vollzug<br />
Art. 30 Ergänzende Bestimmungen<br />
KAPITEL II Besondere Verfahrensvorschriften<br />
1. ABSCHNITT Anklagen gegen ein Mitglied der Staatsregierung oder des<br />
Landtags (Art. 2 Nr. 1)<br />
Art. 31 Erhebung der Anklage<br />
Art. 32 Rücktritt und Entlassung des Anzuklagenden; Auflösung des Landtags<br />
Art. 33 Zurücknahme der Anklage<br />
Art. 34 Mehrere Angeklagte
Art. 35 Aussetzung des Verfahrens<br />
Art. 36 Zustellung der Anklageschrift<br />
Art. 37 Voruntersuchung<br />
Art. 38 Mündliche Verhandlung<br />
Art. 39 Gang der mündlichen Verhandlung<br />
Art. 40 Urteil<br />
Art. 41 Verkündung des Urteils; Zustellung<br />
Art. 42 Sonstige Verfahrensvorschriften<br />
Art. 43 Wiederaufnahme des Verfahrens<br />
Art. 44 Verfahren<br />
Art. 45 Antrag<br />
2. ABSCHNITT Entscheidungen über den Ausschluß von Wählergruppen von<br />
Wahlen und Abstimmungen (Art. 2 Nr. 2)<br />
Art. 46 Antrag<br />
Art. 47 Verfahren<br />
3. ABSCHNITT Entscheidungen über die Gültigkeit der Wahl der Mitglieder des<br />
Landtags und den Verlust der Mitgliedschaft beim Landtag (Art. 2 Nr. 3)<br />
Art. 48 Antrag, Verfahren<br />
4. ABSCHNITT Verfassungsstreitigkeiten zwischen obersten Staatsorganen;<br />
Meinungsverschiedenheiten über Verfassungsänderung (Art. 2 Nrn. 4 und 8)<br />
Art. 49 Verfahren, Zustellung<br />
5. ABSCHNITT Richtervorlagen (Art. 2 Nr. 5)<br />
Art. 50 Verfahren, Zustellung<br />
6. ABSCHNITT Verfassungsbeschwerden (Art. 2 Nr. 6)
Art. 51 Inhalt und Voraussetzung der Verfassungsbeschwerde; Frist<br />
Art. 52 Äußerung der Staatsregierung oder des zuständigen<br />
Staatsministeriums<br />
Art. 53 Verfahren<br />
Art. 54 Inhalt der Entscheidung<br />
7. ABSCHNITT Popularklagen (Art. 2 Nr. 7)<br />
Art. 55 Popularklage<br />
VIERTER TEIL Änderungs-, Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 56 Antrag<br />
Art. 57 Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Übergangsregelung<br />
ERSTER TEIL Einrichtung und Zuständigkeit<br />
Bay VfGHG Art. 1 Sitz<br />
Der Verfassungsgerichtshof besteht beim Oberlandesgericht München.<br />
Bay VfGHG Art. 2 Zuständigkeit<br />
Der Verfassungsgerichtshof ist zuständig zur Entscheidung<br />
1. über Anklagen des Landtags gegen ein Mitglied der Staatsregierung oder<br />
des Landtags (Art. 61 Abs. 1 der Verfassung),<br />
2. über den Ausschluß von Wählergruppen von Wahlen und Abstimmungen<br />
(Art. 62 der Verfassung),<br />
3. über die Gültigkeit der Wahl der Mitglieder des Landtags und den Verlust der<br />
Mitgliedschaft zum Landtag (Art. 63 der Verfassung),<br />
4. über Verfassungsstreitigkeiten zwischen den obersten Staatsorganen oder in<br />
der Verfassung mit eigenen Rechten ausgestatteten Teilen eines obersten<br />
Staatsorgans (Art. 64 der Verfassung),<br />
5. über Richtervorlagen wegen Verfassungswidrigkeit von Rechtsvorschriften<br />
(Art. 65 der Verfassung),<br />
6. über Verfassungsbeschwerden (Art. 66 der Verfassung),<br />
7. über Popularklagen wegen Verfassungswidrigkeit von Rechtsvorschriften<br />
(Art. 98 Satz 4 der Verfassung),<br />
8. über Meinungsverschiedenheiten darüber, ob durch ein Gesetz die<br />
Verfassung verletzt wird oder ob ein Antrag auf unzulässige<br />
Verfassungsänderung vorliegt (Art. 75 Abs. 3 der Verfassung),<br />
9. in den übrigen durch Gesetz zugewiesenen Fällen (Art. 67 der Verfassung).
ZWEITER TEIL Zusammensetzung und Organisation<br />
Bay VfGHG Art. 3 Besetzung<br />
(1) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus dem Präsidenten, 22<br />
berufsrichterlichen Mitgliedern, 15 weiteren Mitgliedern und deren<br />
Vertretern.<br />
(2) 1 An den einzelnen Verfahren wirken mit:<br />
1. in den Fällen des Art. 2 Nr. 1 der Präsident, acht berufsrichterliche<br />
Mitglieder, von denen drei dem Verwaltungsgerichtshof angehören, sowie<br />
zehn weitere Mitglieder,<br />
2. in den Fällen des Art. 2 Nrn. 5, 7 und 8 und, wenn der Organstreit die<br />
Verfassungsmäßigkeit einer Rechtsvorschrift betrifft, auch im Fall des<br />
Art. 2 Nr. 4, der Präsident und acht berufsrichterliche Mitglieder, von<br />
denen drei dem Verwaltungsgerichtshof angehören,<br />
3. in den übrigen Fällen der Präsident, drei berufsrichterliche Miglieder,<br />
von denen zwei dem Verwaltungsgerichtshof angehören, und fünf weitere<br />
Mitglieder.<br />
2<br />
Für die Verfahrensarten im Sinn des Satzes 1 können im<br />
Geschäftsverteilungsplan jeweils mehrere Spruchgruppen gebildet werden.<br />
3<br />
Jedes Mitglied des Verfassungsgerichtshofs gehört mindestens einer<br />
Spruchgruppe an.<br />
(3) 1 Kommt der Verfassungsgerichtshof in einem vor ihm anhängigen<br />
anderen Verfahren in der Zusammensetzung nach Art. 3 Abs. 2 Nrn. 1<br />
oder 3 zu der Auffassung, daß eine entscheidungserhebliche<br />
Rechtsvorschrift des bayerischen <strong>Landesrecht</strong>s verfassungswidrig sei, so<br />
hat er über diese Frage in der in Art. 3 Abs. 2 Nr. 2 vorgeschriebenen<br />
Zusammensetzung vorab zu entscheiden. 2 Er hat das bei ihm anhängige<br />
Verfahren bis zu dieser Entscheidung auszusetzen. 3 Die Entscheidung ist<br />
zu begründen und die für verfassungswidrig gehaltene Rechtsvorschrift zu<br />
bezeichnen.<br />
(4) 1 Hält eine Spruchgruppe ihre Zuständigkeit nicht für gegeben, gibt sie<br />
durch Beschluß das Verfahren an die nach ihrer Ansicht zuständige<br />
Spruchgruppe ab. 2 Hält sich auch diese nicht für zuständig, bestimmt das<br />
Berufsrichterplenum die zuständige Spruchgruppe mit bindender Wirkung;<br />
das gleiche gilt, wenn mehrere Spruchgruppen sich für zuständig halten.<br />
(5) 1 In den vom Gesetz bestimmten Fällen entscheidet der<br />
Verfassungsgerichtshof in der kleinen Besetzung. 2 Diese besteht aus dem<br />
Präsidenten und zwei berufsrichterlichen Mitgliedern, von denen einer dem<br />
Verwaltungsgerichtshof angehören muß.<br />
(6) 1 Der Präsident und die berufsrichterlichen Mitglieder bilden das<br />
Berufsrichterplenum. 2 Es ist beschlußfähig, wenn seine Mitglieder<br />
rechtzeitig geladen sind und der Präsident und mindestens die Hälfte der<br />
berufsrichterlichen Mitglieder anwesend sind. 3 Die Ladungsfrist beträgt<br />
zwei Wochen. 4 Das Berufsrichterplenum entscheidet mit der Mehrheit der<br />
Stimmen der anwesenden Mitglieder. 5 Bei Stimmengleichheit gibt die<br />
Stimme des Präsidenten, im Vertretungsfall die seines Vertreters, den<br />
Ausschlag.
Bay VfGHG Art. 4 Wahl der Verfassungsrichter<br />
(1) 1 Der Präsident, die berufsrichterlichen Mitglieder des<br />
Verfassungsgerichtshofs und der aus diesen zu wählende erste und zweite<br />
Vertreter des Präsidenten werden vom Landtag auf die Dauer von acht<br />
Jahren gewählt. 2 Die Wahl findet ohne Aussprache in der<br />
Vollversammlung statt. 3 Sie ist in einem Gremium des Landtags<br />
vorzubereiten, dessen Zusammensetzung und Verfahren der Landtag<br />
bestimmt. 4 Die Sitzungen des Gremiums sind nichtöffentlich; über den<br />
Inhalt der Beratungen ist Stillschweigen zu bewahren. 5 Die Teilnahme an<br />
den Sitzungen des Gremiums ist anderen Abgeordneten als seinen<br />
Mitgliedern oder deren Vertretern nicht gestattet. 6 Der Präsident des<br />
Verfassungsgerichtshofs oder sein Vertreter nimmt an den Sitzungen teil.<br />
7<br />
Eine Anhörung der Vorgeschlagenen findet nicht statt.<br />
(2) Die weiteren Mitglieder und ihre Vertreter werden jeweils vom neuen<br />
Landtag nach seinem Zusammentritt gemäß den Grundsätzen des<br />
Verhältniswahlrechts gewählt.<br />
(3) Wiederwahl ist zulässig.<br />
(4) Bis zur Neuwahl führen die bisherigen Mitglieder ihr Amt weiter, sofern<br />
das Ausscheiden nicht auf einem Verlust der Wählbarkeit beruht.<br />
Bay VfGHG Art. 5 Wählbarkeit<br />
(1) 1 Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs müssen das 40. Lebensjahr<br />
vollendet haben und zum Landtag wählbar sein. 2 Sie sollen sich durch<br />
besondere Kenntnisse im öffentlichen Recht auszeichnen. 3 Auch die<br />
weiteren Mitglieder sollen die Befähigung zum Richteramt haben oder<br />
Lehrer der Rechtswissenschaft an einer bayerischen Universität sein.<br />
(2) Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs können nicht Mitglieder des<br />
Landtags, der Staatsregierung oder eines entsprechenden Organs des<br />
Bundes oder eines anderen Landes sein.<br />
(3) 1 Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs ist aus den Präsidenten der<br />
bayerischen Oberlandesgerichte zu wählen. 2 Die übrigen<br />
berufsrichterlichen Mitglieder müssen Richter auf Lebenszeit an einem<br />
Gericht des Freistaates Bayern sein. 3 Mit dem Ausscheiden aus dem<br />
richterlichen Hauptamt an einem Gericht des Freistaates Bayern endet die<br />
Mitgliedschaft beim Verfassungsgerichtshof.<br />
Bay VfGHG Art. 6 Vorschläge für die Wahl der berufsrichterlichen<br />
Mitglieder<br />
(1) 1 Wird die Wahl eines berufsrichterlichen Mitglieds wegen des Ablaufs der<br />
Amtszeit oder aus sonstigen Gründen erforderlich, unterbreitet der<br />
Präsident des Verfassungsgerichtshofs nach Anhörung der<br />
berufsrichterlichen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs der<br />
Staatsregierung für jedes zu wählende berufsrichterliche Mitglied einen<br />
Wahlvorschlag. 2 Der Vorschlag wird von der Staatsregierung dem Landtag<br />
übermittelt.<br />
(2) 1 Dem Wahlvorschlag ist eine schriftliche Erklärung des Vorgeschlagenen<br />
beizufügen, daß er im Fall der Wahl bereit ist, das Amt anzunehmen. 2 Das
gilt auch für Wahlvorschläge der Staatsregierung oder aus der Mitte des<br />
Landtags.<br />
Bay VfGHG Art. 7 Vereidigung<br />
(1) Die weiteren Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs leisten beim<br />
Präsidenten vor ihrer ersten Amtshandlung folgenden Eid: “Ich schwöre,<br />
das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik<br />
Deutschland, getreu der Verfassung des Freistaates Bayern und getreu<br />
dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen<br />
der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen,<br />
so wahr mir Gott helfe.”<br />
(2) 1 Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden.<br />
2<br />
Erklärt ein Richter, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen<br />
Eid leisten könne, so hat er an Stelle der Worte “ich schwöre” die Worte<br />
“ich gelobe” zu sprechen oder das Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis<br />
seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung seiner<br />
Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden, gleichwertigen<br />
Beteuerungsformel einzuleiten.<br />
(3) 1 Die Vereidigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs gilt für die<br />
Dauer ihres Amts. 2 Werden sie für eine weitere Amtszeit wiedergewählt,<br />
so ist ihre erneute Vereidigung nicht erforderlich.<br />
(4) Über die Vereidigung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom<br />
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und dem Vereidigten zu<br />
unterzeichnen ist.<br />
Bay VfGHG Art. 8 Vorrang der Amtsausübung<br />
1 Die Tätigkeit als Mitglied des Verfassungsgerichtshofs geht allen anderen<br />
Aufgaben vor. 2 Der Generalsekretär ist von den Aufgaben im richterlichen<br />
Hauptamt freigestellt.<br />
Bay VfGHG Art. 9 Ausschließung und Ablehnung<br />
Auf die Ausschließung und die Ablehnung eines Mitglieds des<br />
Verfassungsgerichtshofs sind die Vorschriften der §§ 22 bis 30 StPO<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
Bay VfGHG Art. 10 Geschäftsverteilung<br />
(1) 1 Vor Ablauf eines Kalenderjahres beschließt das Berufsrichterplenum den<br />
Geschäftsverteilungsplan für das neue Kalenderjahr. 2 Der<br />
Geschäftsverteilungsplan enthält Bestimmungen über Bildung und<br />
Besetzung von Spruchgruppen, die Verteilung der Geschäfte und die<br />
Vertretung.<br />
(2) Während des Kalenderjahres kann der Präsident den<br />
Geschäftsverteilungsplan ändern, soweit das wegen des Ausscheidens<br />
oder Eintretens von Mitgliedern erforderlich ist.<br />
(3) Der Geschäftsverteilungsplan und seine Änderungen sind im Bayerischen<br />
Staatsanzeiger zu veröffentlichen.<br />
(4) 1 Jedes einzelne Verfahren wird in der Zusammensetzung zu Ende geführt,<br />
in der es begonnen wurde. 2 Es ist begonnen, wenn die Spruchgruppe die
Beratung aufgenommen hat. 3 Scheidet ein Mitglied nach Beginn des<br />
Verfahrens aus oder ist es für längere Zeit verhindert, tritt sein Vertreter<br />
an seine Stelle.<br />
Bay VfGHG Art. 11 Generalsekretär<br />
1 Der Präsident ernennt aus dem Kreis der berufsrichterlichen Mitglieder des<br />
Verfassungsgerichtshofs zu seiner Unterstützung und zur Durchführung der<br />
Verwaltungsgeschäfte einen Generalsekretär. 2 Die Ernennung zum<br />
Generalsekretär gilt für die Dauer der Amtszeit als berufsrichterliches Mitglied<br />
des Verfassungsgerichtshofs. 3 Im Fall seiner Wiederwahl kann das Mitglied<br />
erneut zum Generalsekretär ernannt werden.<br />
Bay VfGHG Art. 12 Befugnisse außerhalb der Sitzung; Vertretung des<br />
Präsidenten und des Generalsekretärs<br />
(1) 1 Die dem Verfassungsgerichtshof zustehenden Befugnisse werden<br />
außerhalb der Sitzung von seinem Präsidenten oder nach Anordnung des<br />
Präsidenten vom Generalsekretär wahrgenommen. 2 Dem Generalsekretär<br />
können insbesondere die zur Vorbereitung der Sitzung erforderlichen<br />
verfahrensleitenden Befugnisse sowie die Durchführung der<br />
Verwaltungsgeschäfte übertragen werden.<br />
(2) Im Fall seiner Verhinderung wird der Präsident durch den ersten oder<br />
zweiten Vertreter, im Fall auch ihrer Verhinderung von einem der übrigen<br />
berufsrichterlichen Mitglieder nach Maßgabe der in der Geschäftsverteilung<br />
festgelegten Reihenfolge vertreten.<br />
(3) 1 Der Präsident ordnet an, wer den Generalsekretär in dessen<br />
Aufgabenbereich außerhalb seines Richteramts vertritt. 2 Der Vertreter des<br />
Generalsekretärs muß Richter auf Lebenszeit an einem Gericht des<br />
Freistaates Bayern sein.<br />
Bay VfGHG Art. 13 Geschäftsstelle<br />
Beim Verfassungsgerichtshof wird eine Geschäftsstelle eingerichtet.<br />
DRITTER TEIL Verfahren<br />
KAPITEL I Allgemeine Verfahrensvorschriften<br />
Bay VfGHG Art. 14 Antragstellung<br />
(1) 1 Das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof wird nur auf schriftlichen<br />
Antrag eingeleitet. 2 Dem Antrag und allen anderen Schriftsätzen sind<br />
jeweils so viele Abschriften beizufügen, als weitere Beteiligte vorhanden<br />
sind.<br />
(2) 1 Den übrigen Beteiligten ist vom Verfassungsgerichtshof eine Abschrift<br />
des Antrags zu übermitteln. 2 Zugleich ist ihnen Gelegenheit zu geben,<br />
innerhalb bestimmter Frist schriftlich Stellung zu nehmen.<br />
Bay VfGHG Art. 15 Zustellung, Ladung<br />
1 Zustellungen und Ladungen geschehen von Amts wegen. 2 Die<br />
Zustellungsvorschriften der Zivilprozeßordnung sind entsprechend<br />
anzuwenden. 3 Zustellungen und Ladungen können auch durch
eingeschriebenen Brief gegen Rückschein sowie in der Weise bewirkt werden,<br />
daß der Urkundsbeamte oder ein anderer damit beauftragter Beamter das<br />
Schriftstück gegen Empfangsbestätigung aushändigt.<br />
Bay VfGHG Art. 16 Verfahrensbevollmächtigte<br />
(1) 1 Die Beteiligten können sich in jeder Lage des Verfahrens durch<br />
Bevollmächtigte vertreten lassen. 2 Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen<br />
oder zu bestätigen und kann nachgereicht werden. 3 Der<br />
Verfassungsgerichtshof kann hierfür eine Frist bestimmen.<br />
(2) 1 Erfordert es die Sach- und Rechtslage oder ist der Antragsteller zum<br />
Vortrag nicht geeignet, so kann ihm der Verfassungsgerichtshof auftragen,<br />
einen Bevollmächtigten nach Absatz 4 Satz 1 zu bestellen. 2 Der<br />
Verfassungsgerichtshof kann mehreren Beteiligten mit gleichen Interessen<br />
die Bestellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten auftragen.<br />
(3) Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so sind die Mitteilungen des Gerichts an<br />
ihn zu richten.<br />
(4) 1 Als Bevollmächtigte sind zugelassen Rechtsanwälte und Rechtslehrer an<br />
Hochschulen allgemein, Vertreter beruflicher, genossenschaftlicher und<br />
gewerkschaftlicher Vereinigungen für den von ihnen in dieser Eigenschaft<br />
vertretenen Personenkreis. 2 Andere Personen können vom<br />
Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen werden, wenn sie die Vertretung<br />
geschäftsmäßig betreiben oder zum geeigneten Vortrag unfähig sind.<br />
(5) In den Fällen, in denen die Vertretung Beteiligter durch einen<br />
Bevollmächtigten vorgeschrieben oder aufgetragen ist, kann nur der<br />
Bevollmächtigte rechtswirksam Anträge stellen und rechtsverbindlich<br />
Erklärungen abgeben.<br />
(6) Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, gelten für die Bevollmächtigung<br />
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechend.<br />
Bay VfGHG Art. 17 Fristen, Wiedereinsetzung<br />
(1) 1 Die Fristen werden nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs<br />
berechnet. 2 Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag<br />
oder einen allgemeinen Feiertag, so endet die Frist mit Ablauf des<br />
nächstfolgenden Werktags.<br />
(2) 1 Wer glaubhaft macht, daß er ohne Verschulden verhindert war, eine<br />
gesetzliche Frist einzuhalten, innerhalb derer ein Antrag zu stellen war, ist<br />
auf seinen Antrag in den vorigen <strong>Stand</strong> einzusetzen. 2 Innerhalb der<br />
Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen. 3 Ist das geschehen,<br />
kann die Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.<br />
(3) 1 Die Wiedereinsetzung in den vorigen <strong>Stand</strong> muß binnen zwei Wochen<br />
nach Beseitigung des Hindernisses beantragt werden. 2 Nach Ablauf eines<br />
Jahres seit dem Ende der versäumten Frist ist der Antrag ausgeschlossen,<br />
es sei denn, daß höhere Gewalt vorliegt.<br />
(4) 1 Über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen <strong>Stand</strong> beschließt<br />
nach Anhörung der Beteiligten der Verfassungsgerichtshof in der kleinen<br />
Besetzung. 2 Wird die Wiedereinsetzung abgelehnt, kann binnen zwei<br />
Wochen die Entscheidung der nach Art. 3 Abs. 2 für die Hauptsache<br />
zuständigen Spruchgruppe beantragt werden. 3 Diese kann über den
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen <strong>Stand</strong> unmittelbar<br />
entscheiden, wenn sie dabei zugleich über die Hauptsache entscheidet.<br />
(5) Richterliche Fristen können jederzeit verlängert werden.<br />
Bay VfGHG Art. 18 Amts- und Rechtshilfe<br />
1 Gerichte und Behörden haben dem Verfassungsgerichtshof Rechts- und<br />
Amtshilfe zu leisten und ihm insbesondere die von ihm verlangten Akten und<br />
Urkunden vorzulegen. 2 § 99 Abs. 1 und 2 Sätze 1 und 2 VwGO finden<br />
entsprechende Anwendung.<br />
Bay VfGHG Art. 19 Akteneinsicht<br />
(1) 1 Die Beteiligten haben das Recht, auf der Geschäftsstelle des<br />
Verfassungsgerichtshofs Einsicht in die Akten zu nehmen. 2 Ist für einen<br />
Beteiligten die Akteneinsicht auf der Geschäftsstelle des<br />
Verfassungsgerichtshofs wegen persönlicher Umstände erheblich<br />
erschwert oder unmöglich, so können die Akten an ein anderes Gericht<br />
oder eine andere Behörde zur Einsichtnahme übersandt werden.<br />
(2) 1 Ausgenommen von dem Recht auf Akteneinsicht sind Akten oder<br />
Aktenstücke, deren Einsichtnahme vom Verfassungsgerichtshof mit dem<br />
Staatswohl für unvereinbar erklärt wird. 2 Hält der Präsident die<br />
Einsichtnahme in Akten oder Aktenstücke mit dem Staatswohl für<br />
unvereinbar, so ist diese bis zur Entscheidung des<br />
Verfassungsgerichtshofs vorläufig zu verweigern; dasselbe gilt, wenn der<br />
Landtag, die Staatsregierung oder das zuständige Staatsministerium,<br />
soweit sie am Verfahren beteiligt sind, die Einsichtnahme mit dem<br />
Staatswohl für unvereinbar halten. 3 Die Entscheidung des<br />
Verfassungsgerichtshofs ist unverzüglich herbeizuführen. 4 Er entscheidet<br />
in der für die Hauptsache nach Art. 3 Abs. 2 vorgeschriebenen Besetzung.<br />
(3) Die Akteneinsicht ist den Beteiligten und ihren Bevollmächtigten auch<br />
noch nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu gewähren,<br />
wenn sie ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen.<br />
(4) Ist zu einer Entscheidung eine abweichende Ansicht niedergelegt,<br />
erstreckt sich das Recht auf Akteneinsicht nicht auf die Erlangung der<br />
Kenntnis von der Person des Richters, der sie niedergelegt hat.<br />
(5) Anderen Personen als Beteiligten kann Akteneinsicht gewährt werden,<br />
wenn sie ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen und die Belange der<br />
Beteiligten, Dritter, des Staates oder die Erfordernisse des Verfahrens<br />
nicht entgegenstehen.<br />
Bay VfGHG Art. 20 Terminierung, Sitzungsort<br />
Termin und Ort der Sitzungen werden vom Präsidenten bestimmt.<br />
Bay VfGHG Art. 21 Berichterstatter<br />
Der Präsident kann für jedes Verfahren aus dem Kreis der berufsrichterlichen<br />
Mitglieder der zuständigen Spruchgruppe einen Berichterstatter und, falls er es<br />
für geboten erachtet, einen Mitberichterstatter ernennen.
Bay VfGHG Art. 22 Mündliche Verhandlung<br />
(1) 1 Der Verfassungsgerichtshof entscheidet, soweit nichts anderes bestimmt<br />
ist, auf Grund mündlicher Verhandlung. 2 Einer solchen bedarf es nicht,<br />
wenn alle Beteiligten ausdrücklich auf sie verzichten.<br />
(2) 1 Zur mündlichen Verhandlung sind die Beteiligten von Amts wegen mit<br />
einer Frist von zwei Wochen zu laden. 2 In dringenden Fällen kann der<br />
Präsident die Frist abkürzen.<br />
(3) 1 Nach Aufruf der Sache und Feststellung, wer von den Beteiligten<br />
erschienen ist, trägt der Vorsitzende oder der Berichterstatter den<br />
Sachverhalt vor. 2 Hierauf erhalten die Beteiligten Gelegenheit zu ihren<br />
Ausführungen und Anträgen. 3 Die Antragsteller haben das letzte Wort.<br />
(4) 1 Der Vorsitzende schließt die mündliche Verhandlung. 2 Das Gericht kann<br />
ihre Wiedereröffnung beschließen.<br />
(5) 1 Zur mündlichen Verhandlung ist ein Urkundsbeamter der Geschäftsstelle<br />
als Schriftführer zuzuziehen. 2 Der Schriftführer nimmt über den Gang der<br />
Verhandlung und die gestellten Anträge eine Niederschrift auf, die von ihm<br />
und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.<br />
(6) Im übrigen gelten die §§ 136 bis 139, 141 und 159 bis 164 ZPO<br />
entsprechend.<br />
Bay VfGHG Art. 23 Beweisaufnahme<br />
(1) 1 Der Verfassungsgerichtshof erhebt ohne Bindung an Anträge den nach<br />
seinem Ermessen erforderlichen Beweis. 2 Zur Vorbereitung der<br />
Verhandlung kann auch der Präsident außerhalb der Sitzung durch ein<br />
berufsrichterliches Mitglied des Verfassungsgerichtshofs als beauftragten<br />
Richter Beweise aufnehmen lassen oder zu bestimmten Beweisthemen ein<br />
anderes Gericht um die Aufnahme bestimmter Beweise ersuchen.<br />
(2) 1 Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen unter Mitteilung des<br />
Beweisthemas benachrichtigt und können der Beweisaufnahme<br />
beiwohnen. 2 Sie können an Zeugen und Sachverständige sachdienliche<br />
Fragen richten oder richten lassen. 3 Über die Aussagen von Zeugen,<br />
Sachverständigen und Beteiligten ist eine Niederschrift aufzunehmen.<br />
(3) Bei Beweisaufnahmen außerhalb der Sitzung entscheidet über eine<br />
Beschwerde gegen die Festsetzung eines Ordnungsmittels im Fall des<br />
§ 180 GVG oder die Anordnung von Zwangsmitteln der<br />
Verfassungsgerichtshof in der kleinen Besetzung; im übrigen sind<br />
richterliche Maßnahmen im Rahmen der Beweisaufnahme nicht gesondert<br />
anfechtbar.<br />
(4) Auf die Beweisaufnahme finden im übrigen in den Fällen des Art. 2 Nr. 1<br />
die Vorschriften der Strafprozeßordnung, in den übrigen Fällen die<br />
Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung.<br />
Bay VfGHG Art. 24 Beratung, Abstimmung, Öffentlichkeit,<br />
Sitzungspolizei und Gerichtssprache<br />
(1) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen nur die zur Entscheidung<br />
berufenen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs anwesend sein.
(2) 1 Die zur Entscheidung berufenen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs<br />
stimmen nach dem Lebensalter; der Jüngere stimmt vor dem Älteren.<br />
2 Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, stimmt er zuerst; nach ihm stimmt<br />
gegebenenfalls der Mitberichterstatter. 3 Zuletzt stimmt der Vorsitzende.<br />
4 Stimmenthaltung ist nicht zulässig.<br />
(3) Eine schriftliche Abstimmung, insbesondere eine solche im Weg des<br />
Umlaufs bei den zur Entscheidung berufenen Mitgliedern des<br />
Verfassungsgerichtshofs, ist nicht zulässig.<br />
(4) Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs sind verpflichtet, über den<br />
Gang der Beratung und Abstimmung Stillschweigen zu wahren.<br />
(5) Im übrigen sind hinsichtlich der Öffentlichkeit, Sitzungspolizei,<br />
Gerichtssprache, Beratung und Abstimmung die Vorschriften der Titel 14<br />
bis 16 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend anwendbar.<br />
Bay VfGHG Art. 25 Entscheidung<br />
(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet: “Im Namen des Freistaates<br />
Bayern.”<br />
(2) 1 Der Verfassungsgerichtshof entscheidet nach seiner freien, aus dem<br />
Inhalt der Verhandlung und dem Ergebnis der Beweisaufnahme<br />
geschöpften Überzeugung. 2 Die Entscheidung ist am Schluß der<br />
mündlichen Verhandlung oder in einem späteren, den Beteiligten<br />
bekanntgegebenen Termin durch Verlesen der Entscheidungsformel zu<br />
verkünden. 3 Die Entscheidungsgründe werden bei der Verkündung<br />
vorgelesen oder ihrem wesentlichen Inhalt nach mitgeteilt. 4 Die<br />
Entscheidung wird mit der Verkündung wirksam. 5 Entscheidet der<br />
Verfassungsgerichtshof ohne mündliche Verhandlung, so wird die<br />
Entscheidung mit Zustellung an die Beteiligten wirksam.<br />
(3) 1 Die Entscheidung ist schriftlich niederzulegen, zu begründen und von den<br />
Richtern, die bei ihr mitgewirkt haben, zu unterschreiben. 2 Ist ein Richter<br />
an der Unterzeichnung der Entscheidung verhindert, so wird dies unter<br />
Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Vorsitzenden, bei dessen<br />
Verhinderung vom lebensältesten berufsrichterlichen Beisitzer unter der<br />
Entscheidung vermerkt.<br />
(4) Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in der<br />
Entscheidung kann der Vorsitzende berichtigen.<br />
(5) Jeder Richter hat das Recht, seine von der Entscheidung oder von deren<br />
Begründung abweichende Ansicht in einem Sondervotum schriftlich<br />
niederzulegen; das Sondervotum ist ohne Angabe des Verfassers der<br />
Entscheidung anzuschließen.<br />
(6) Ausfertigungen der Entscheidung sind den Beteiligten durch den<br />
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zuzustellen.<br />
(7) Wird eine Rechtsvorschrift für verfassungswidrig, nichtig oder nur in einer<br />
bestimmten Auslegung für verfassungsgemäß erklärt, ist die Entscheidung<br />
des Verfassungsgerichtshofs im Gesetz- und Verordnungsblatt zu<br />
veröffentlichen.
Bay VfGHG Art. 26 Einstweilige Anordnung<br />
(1) Der Verfassungsgerichtshof kann eine einstweilige Anordnung erlassen,<br />
wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender<br />
Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund dringend geboten ist.<br />
(2) 1 Die einstweilige Anordnung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.<br />
2<br />
Bei besonderer Dringlichkeit kann der Verfassungsgerichtshof davon<br />
absehen, den am Verfahren zur Hauptsache Beteiligten oder<br />
Äußerungsberechtigten vor der Entscheidung Gelegenheit zur<br />
Stellungnahme zu geben.<br />
(3) 1 Kann in Fällen besonderer Dringlichkeit die Entscheidung der zuständigen<br />
Spruchgruppe nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so entscheidet der<br />
Präsident oder im Fall seiner Verhinderung sein Vertreter. 2 Gegen die<br />
Entscheidung kann jeder Beteiligte innerhalb von zwei Wochen nach<br />
Bekanntgabe Widerspruch erheben. 3 Über den Widerspruch entscheidet<br />
der Verfassungsgerichtshof in der Besetzung nach Art. 3 Abs. 2. 4 Der<br />
Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 5 Der<br />
Verfassungsgerichtshof kann die Vollziehung der einstweiligen Anordnung<br />
aussetzen.<br />
(4) Die einstweilige Anordnung tritt mit der Beendigung des<br />
Hauptsacheverfahrens außer Kraft, sofern sie der Verfassungsgerichtshof<br />
nicht früher aufhebt.<br />
Bay VfGHG Art. 27 Kosten<br />
(1) 1 Das Verfahren des Verfassungsgerichtshofs ist kostenfrei. 2 Ist jedoch in<br />
den Fällen des Art. 2 Nr. 6 die Beschwerde und in den Fällen des Art. 2<br />
Nr. 7 die Popularklage unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so kann<br />
der Verfassungsgerichtshof dem Beschwerdeführer oder Antragsteller eine<br />
Gebühr bis zu eintausendfünfhundert Euro auferlegen. 3 Der<br />
Verfassungsgerichtshof kann dem Beschwerdeführer oder Antragsteller<br />
aufgeben, einen entsprechenden Vorschuß zu leisten. 4 Über die<br />
Auferlegung eines Kostenvorschusses entscheidet der<br />
Verfassungsgerichtshof in der kleinen Besetzung.<br />
(2) In den Fällen des Art. 2 Nr. 1 sind dem nicht für schuldig Befundenen die<br />
notwendigen Auslagen einschließlich der Kosten der Verteidigung zu<br />
ersetzen.<br />
(3) Erklärt der Verfassungsgerichtshof in einem Verfahren nach Art. 55 eine<br />
Rechtsvorschrift für verfassungswidrig, nichtig oder nur in einer<br />
bestimmten Auslegung für verfassungsgemäß, ordnet er an, daß die<br />
juristische Person des öffentlichen Rechts, deren Vorschrift Gegenstand<br />
des Verfahrens war, dem Antragsteller oder Beschwerdeführer die<br />
notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu erstatten hat.<br />
(4) 1 Erweist sich eine Verfassungsbeschwerde als begründet, sind dem<br />
Beschwerdeführer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu<br />
erstatten. 2 Erstattungspflichtig ist die juristische Person des öffentlichen<br />
Rechts, der die Verletzung des verfassungsmäßigen Rechts zuzurechnen<br />
ist.<br />
(5) In den übrigen Fällen kann der Verfassungsgerichtshof volle oder teilweise<br />
Erstattung von Kosten und Auslagen anordnen.
Bay VfGHG Art. 28 Prozeßkostenhilfe, Kostenfestsetzung,<br />
Gegenstandswert<br />
(1) 1 Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über Prozeßkostenhilfe gelten<br />
entsprechend. 2 Über einen Antrag auf Gewährung von Prozeßkostenhilfe<br />
entscheidet der Verfassungsgerichtshof in der kleinen Besetzung.<br />
(2) Ist ein Kostenvorschuß eingefordert oder die Erstattung von Kosten oder<br />
Auslagen von einem Beteiligten beantragt worden, so entscheidet über die<br />
Pflicht zur Kostentragung nach Erledigung der Hauptsache der<br />
Verfassungsgerichtshof in der kleinen Besetzung.<br />
(3) 1 Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle setzt auf Antrag die zu<br />
erstattenden Kosten und Auslagen fest. 2 Dem Antrag sind<br />
Kostenberechnung und Belege beizufügen.<br />
(4) 1 Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß kann binnen einer Frist von zwei<br />
Wochen ab Zustellung Erinnerung eingelegt werden. 2 Über die Erinnerung<br />
entscheidet der Verfassungsgerichtshof in der kleinen Besetzung. 3 Die<br />
Erinnerung hat aufschiebende Wirkung.<br />
(5) Der Verfassungsgerichtshof setzt in der kleinen Besetzung den<br />
Gegenstandswert nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte<br />
fest.<br />
Bay VfGHG Art. 29 Bindungswirkung der Entscheidung, Vollzug<br />
(1) Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs sind für alle anderen<br />
Verfassungsorgane sowie für Gerichte und Behörden bindend.<br />
(2) Der Verfassungsgerichtshof kann in seiner Entscheidung die Art und Weise<br />
des Vollzugs regeln.<br />
Bay VfGHG Art. 30 Ergänzende Bestimmungen<br />
(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren enthält,<br />
sind die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung, ergänzend die der<br />
Zivilprozeßordnung entsprechend heranzuziehen.<br />
(2) 1 Im übrigen kann das Berufsrichterplenum des Verfassungsgerichtshofs<br />
das Verfahren und den Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung<br />
regeln. 2 Diese ist im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffentlichen.<br />
KAPITEL II Besondere Verfahrensvorschriften<br />
1. ABSCHNITT Anklagen gegen ein Mitglied der Staatsregierung<br />
oder des Landtags (Art. 2 Nr. 1)<br />
1. Unterabschnitt Anklagen gegen ein Mitglied der Staatsregierung<br />
Bay VfGHG Art. 31 Erhebung der Anklage<br />
(1) 1 Der Landtag erhebt die Anklage durch Übersendung einer Anklageschrift<br />
an den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs. 2 Der Anklageschrift sind<br />
die Akten über die Erhebung der Anklage sowie eine Ausfertigung des<br />
Beschlusses, durch den der Landtag bestimmt hat, wer die Anklage vor<br />
dem Verfassungsgerichtshof vertritt, beizufügen.
(2) 1 Die Anklageschrift muß die Handlung oder Unterlassung, wegen welcher<br />
die Anklage erhoben ist, die Bestimmung der Verfassung oder des<br />
<strong>Gesetze</strong>s, die verletzt sein soll, und die Tatsachen, auf welche sich die<br />
Anklage stützt, bezeichnen. 2 Sie muß die Feststellung enthalten, daß der<br />
Beschluß des Landtags auf Erhebung der Anklage mit Zweidrittelmehrheit<br />
der gesetzlichen Mitgliederzahl gefaßt ist.<br />
(3) 1 Der Landtag bestimmt, wer die Anklage vor dem Verfassungsgerichtshof<br />
vertritt. 2 Der Anklagevertreter kann seine Bestellung nicht ablehnen. 3 Er<br />
darf nicht Mitglied des Verfassungsgerichtshofs sein.<br />
Bay VfGHG Art. 32 Rücktritt und Entlassung des Anzuklagenden;<br />
Auflösung des Landtags<br />
Die Erhebung oder Weiterverfolgung der Anklage werden durch den Rücktritt<br />
(Art. 44 Abs. 3 der Verfassung) oder die Entlassung (Art. 45 der Verfassung)<br />
des Anzuklagenden, die Vertagung oder Auflösung des Landtags oder den<br />
Ablauf der Wahldauer nicht berührt.<br />
Bay VfGHG Art. 33 Zurücknahme der Anklage<br />
(1) Die Anklage kann mit Zustimmung des Angeklagten bis zur Verkündung<br />
des Urteils durch Beschluß des Landtags zurückgenommen werden; für<br />
diesen Beschluß ist eine Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen<br />
Mitgliederzahl erforderlich.<br />
(2) 1 Wird die Anklage zurückgenommen, ist eine Ausfertigung des<br />
Beschlusses an den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs zu<br />
übersenden. 2 Ist die Zustimmungserklärung des Angeklagten nicht<br />
beigefügt, so fordert der Präsident den Angeklagten auf, binnen<br />
bestimmter Frist sich über die Zustimmung schriftlich zu erklären.<br />
Bay VfGHG Art. 34 Mehrere Angeklagte<br />
1 Gegen mehrere Mitglieder der Staatsregierung kann gemeinschaftlich Anklage<br />
erhoben werden. 2 Der Verfassungsgerichtshof kann durch Beschluß die<br />
Verfahren gegen Mitglieder der Staatsregierung auch nachträglich verbinden<br />
oder ein verbundenes Verfahren trennen.<br />
Bay VfGHG Art. 35 Aussetzung des Verfahrens<br />
Ist gegen den Angeklagten wegen einer mit dem Verfahren vor dem<br />
Verfassungsgerichtshof zusammenhängenden Handlung ein Strafverfahren<br />
anhängig, so kann der Verfassungsgerichtshof die Verhandlung bis zur<br />
Erledigung des Strafverfahrens aussetzen.<br />
Bay VfGHG Art. 36 Zustellung der Anklageschrift<br />
Die Anklageschrift wird dem Angeklagten zugestellt.<br />
Bay VfGHG Art. 37 Voruntersuchung<br />
(1) 1 Der Verfassungsgerichtshof kann zur Vorbereitung der Verhandlung eine<br />
Voruntersuchung anordnen. 2 Der Anklagevertreter und der Angeklagte<br />
können Antrag auf Anordnung einer Voruntersuchung stellen. 3 Über die<br />
Anordnung der Voruntersuchung und über Anträge auf Ergänzung der
Voruntersuchung entscheidet der Verfassungsgerichtshof in der Besetzung<br />
nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 1.<br />
(2) 1 Mit der Führung der Voruntersuchung ist ein berufsrichterliches Mitglied<br />
des Verfassungsgerichtshofs zu betrauen. 2 Der Untersuchungsführer ist<br />
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 3 Sein Amt erlischt, sobald<br />
seine Mitgliedschaft beim Verfassungsgerichtshof endet (Art. 5 Abs. 3<br />
Satz 3). 4 Maßgebender Zeitpunkt für die Ablehnung im Sinn des § 25<br />
Abs. 1 StPO ist das Ende der erstmaligen Vernehmung des Angeklagten.<br />
5 Über die Ablehnung entscheidet der Verfassungsgerichtshof in der<br />
kleinen Besetzung abschließend.<br />
(3) 1 Zeugen und Sachverständige werden in der Voruntersuchung nur dann<br />
beeidigt, wenn sie voraussichtlich am Erscheinen in der Verhandlung vor<br />
dem Verfassungsgerichtshof verhindert sein werden oder wenn ihr<br />
Erscheinen wegen großer Entfernung besonders erschwert sein würde.<br />
2<br />
Ist die Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen wegen großer<br />
Entfernung erschwert, so kann der die Voruntersuchung führende Richter<br />
das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Zeuge oder Sachverständige sich<br />
aufhält, um die Vernehmung ersuchen.<br />
(4) 1 Die Voruntersuchung beginnt mit einer Vernehmung des Angeklagten.<br />
2<br />
Ist er aus zwingenden Gründen am Erscheinen verhindert und hat er dies<br />
unverzüglich mitgeteilt, ist er erneut zu laden. 3 Erscheint der Angeklagte<br />
zu seiner Vernehmung nicht, so wird die Voruntersuchung ohne ihn<br />
weitergeführt. 4 Die Verhaftung, die vorläufige Festnahme und die<br />
Vorführung des Angeklagten sind unzulässig.<br />
(5) 1 Vor Abschluß der Voruntersuchung ist dem Angeklagten Gelegenheit zu<br />
seiner Verteidigung zu geben. 2 Nach der abschließenden Anhörung legt<br />
der Untersuchungsführer die Akten mit einem zusammenfassenden<br />
Bericht dem Präsidenten vor.<br />
(6) 1 Im Übrigen finden Art. 26, 27, 29, 30, 32 und 51 Abs. 2, Art. 54 des<br />
Bayerischen Disziplinargesetzes auf die Voruntersuchung entsprechende<br />
Anwendung. 2 Dem Angeklagten ist zu gestatten, die Akten und<br />
beigezogenen Schriftstücke einzusehen, soweit dies ohne Gefährdung des<br />
Untersuchungszwecks möglich ist. 3 An Stelle des Verwaltungsgerichts<br />
entscheidet der Verfassungsgerichtshof in der kleinen Besetzung.<br />
(7) Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs kann in den Fällen, in denen<br />
eine Voruntersuchung nicht stattfindet, zur Vorbereitung der Verhandlung<br />
vor dem Verfassungsgerichtshof einzelne Ermittlungen anordnen und mit<br />
der Durchführung ein berufsrichterliches Mitglied der zuständigen<br />
Spruchgruppe beauftragen.<br />
Bay VfGHG Art. 38 Mündliche Verhandlung<br />
(1) 1 Über die Anklage wird mündlich verhandelt. 2 Zu der Verhandlung sind<br />
der Anklagevertreter, der Angeklagte, sein Bevollmächtigter und die<br />
erforderlichen Zeugen und Sachverständigen zu laden. 3 Bei der Ladung ist<br />
der Angeklagte darauf hinzuweisen, daß ohne ihn verhandelt wird, wenn<br />
er unentschuldigt ausbleibt oder sich ohne hinreichenden Grund vorzeitig<br />
entfernt. 4 Im übrigen finden die §§ 217 bis 222 StPO entsprechende<br />
Anwendung.
(2) 1 Die Zeugen und Sachverständigen werden von Amts wegen geladen,<br />
soweit der Präsident oder die zuständige Spruchgruppe die Ladung nach<br />
Lage der Sache, insbesondere nach dem Ergebnis der Voruntersuchung<br />
oder der angestellten Ermittlungen, für nötig erachtet. 2 Über Anträge des<br />
Anklagevertreters oder des Angeklagten oder seines Bevollmächtigten auf<br />
Ladung von Zeugen oder Sachverständigen entscheidet in der mündlichen<br />
Verhandlung die zuständige Spruchgruppe, außerhalb der mündlichen<br />
Verhandlung der Präsident.<br />
Bay VfGHG Art. 39 Gang der mündlichen Verhandlung<br />
1 In der Verhandlung wird zunächst die Anklageschrift verlesen. 2 Sodann wird<br />
der Angeklagte vernommen. 3 Hierauf findet die Beweisaufnahme statt. 4 Zum<br />
Schluß wird der Anklagevertreter mit seinem Antrag und der Angeklagte mit<br />
seinem Verteidigungsvorbringen gehört. 5 Der Angeklagte hat das letzte Wort.<br />
Bay VfGHG Art. 40 Urteil<br />
(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet auf der Grundlage der<br />
Anklageschrift des Landtags nach dem Ergebnis der mündlichen<br />
Verhandlung.<br />
(2) Der Verfassungsgerichtshof spricht in seinem Urteil aus, daß der<br />
Angeklagte vorsätzlich die Verfassung oder ein näher zu bezeichnendes<br />
Gesetz verletzt hat oder daß er von der Anklage freigesprochen wird.<br />
(3) Zur Bejahung der Schuldfrage sind mehr als zwölf Stimmen erforderlich.<br />
Bay VfGHG Art. 41 Verkündung des Urteils; Zustellung<br />
(1) Die Verkündung des Urteils erfolgt durch Verlesung der Urteilsformel und<br />
Eröffnung der Urteilsgründe am Schluß der Verhandlung oder spätestens<br />
nach Ablauf eines Monats nach dem Schluß der Verhandlung.<br />
(2) Ausfertigungen des Urteils samt Gründen sind dem Landtag, der<br />
Staatsregierung und dem Angeklagten zuzustellen.<br />
Bay VfGHG Art. 42 Sonstige Verfahrensvorschriften<br />
Im übrigen finden auf die Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof die<br />
Vorschriften der §§ 226 bis 229, 236, 238, 240 bis 258, 271 bis 273 und 275<br />
StPO entsprechend Anwendung.<br />
Bay VfGHG Art. 43 Wiederaufnahme des Verfahrens<br />
(1) 1 Die Wiederaufnahme des Verfahrens findet nur zugunsten des<br />
Verurteilten und nur auf seinen Antrag oder nach seinem Tod auf Antrag<br />
seines Ehegatten oder seiner Abkömmlinge unter den Voraussetzungen<br />
der §§ 359 und 364 StPO statt. 2 In dem Antrag müssen der gesetzliche<br />
Grund der Wiederaufnahme sowie die Beweismittel angegeben werden; er<br />
ist schriftlich bei dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs<br />
einzureichen. 3 Durch den Antrag auf Wiederaufnahme wird die<br />
Wirksamkeit des Urteils nicht gehemmt.<br />
(2) 1 Über die Zulassung des Antrags entscheidet der Verfassungsgerichtshof<br />
in der Besetzung nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 1 ohne mündliche Verhandlung.
2 Die Vorschriften der §§ 368 bis 370 und 371 Abs. 1 bis 3 StPO finden<br />
entsprechende Anwendung.<br />
(3) Auf die erneute Hauptverhandlung finden die Vorschriften der Art. 38 bis<br />
42 Anwendung.<br />
(4) In dem erneuten Urteil ist entweder das frühere Urteil aufrechtzuerhalten<br />
oder aufzuheben und der Angeklagte freizusprechen.<br />
2. Unterabschnitt Anklagen gegen Abgeordnete<br />
Bay VfGHG Art. 44 Verfahren<br />
(1) Auf das Verfahren finden die besonderen Verfahrensvorschriften bei<br />
Anklagen gegen Mitglieder der Staatsregierung entsprechende<br />
Anwendung.<br />
(2) Die Erhebung und Weiterverfolgung der Anklage werden durch den Verlust<br />
der Mitgliedschaft beim Landtag nicht berührt.<br />
(3) Ausfertigungen des Urteils samt Gründen sind dem Landtag, dem<br />
Angeklagten und der Staatsregierung zuzustellen.<br />
Bay VfGHG Art. 45 Antrag (weggefallen)<br />
2. ABSCHNITT Entscheidungen über den Ausschluß von<br />
Wählergruppen von Wahlen und Abstimmungen (Art. 2 Nr. 2)<br />
Bay VfGHG Art. 46 Antrag<br />
(1) Der Antrag auf Entscheidung über den Ausschluß von Wählergruppen von<br />
Wahlen und Abstimmungen kann von der Staatsregierung oder von einer<br />
der im Landtag vertretenen politischen Parteien gestellt werden.<br />
(2) In dem Antrag sind die Tatsachen und Beweismittel zu bezeichnen, aus<br />
denen hervorgeht, daß die Mitglieder oder Förderer der Wählergruppe<br />
darauf ausgehen, die staatsbürgerlichen Freiheiten zu unterdrücken oder<br />
gegen Volk, Staat oder Verfassung Gewalt anzuwenden.<br />
Bay VfGHG Art. 47 Verfahren<br />
(1) 1 Der Antrag ist der beteiligten Wählergruppe zur Äußerung binnen einer<br />
zu bestimmenden Frist mitzuteilen. 2 Hat eine im Landtag vertretene<br />
politische Partei den Antrag gestellt, ist der Staatsregierung Gelegenheit<br />
zur Äußerung zu geben.<br />
(2) 1 Der Antragsteller und die Wählergruppe müssen sich durch einen<br />
Bevollmächtigten vertreten lassen. 2 Dieser hat bei seiner ersten Äußerung<br />
eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. 3 Wird der Antrag von einer<br />
politischen Partei gestellt, ist zugleich der Nachweis vorzulegen, daß die<br />
Vollmacht von dem nach der Parteisatzung hierzu Berechtigten erteilt<br />
wurde.<br />
(3) Ausfertigungen der Entscheidung sind der Staatsregierung, auch wenn sie<br />
den Antrag nicht gestellt hat, den Bevollmächtigten des Antragstellers und<br />
der beteiligten Wählergruppe, dem Landtag und dem Landeswahlleiter<br />
zuzustellen.
3. ABSCHNITT Entscheidungen über die Gültigkeit der Wahl der<br />
Mitglieder des Landtags und den Verlust der Mitgliedschaft beim<br />
Landtag (Art. 2 Nr. 3)<br />
Bay VfGHG Art. 48 Antrag, Verfahren<br />
(1) Gegen Beschlüsse des Landtags über die Gültigkeit der Wahl oder den<br />
Verlust der Mitgliedschaft können die Entscheidung des<br />
Verfassungsgerichtshofs beantragen<br />
1. Abgeordnete, deren Mitgliedschaft im Landtag bestritten ist,<br />
2. Fraktionen des Landtags oder Minderheiten des Landtags, die<br />
wenigstens ein Zehntel der gesetzlichen Mitgliederzahl umfassen,<br />
3. Stimmberechtigte, deren Wahlbeanstandung vom Landtag verworfen<br />
worden ist, wenn ihnen mindestens einhundert Stimmberechtigte<br />
beitreten.<br />
(2) 1 Der Antrag ist schriftlich bei dem Präsidenten des<br />
Verfassungsgerichtshofs binnen einem Monat seit der Beschlußfassung des<br />
Landtags einzureichen; er ist durch die Anführung von Tatsachen und<br />
Beweismitteln zu begründen. 2 Eine Landtagsminderheit muß sich durch<br />
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 3 Dieser hat bei der<br />
Antragstellung den Nachweis seiner Bevollmächtigung vorzulegen. 4 Die<br />
Stimmberechtigten, die einem Stimmberechtigten als Antragsteller<br />
beitreten, müssen diese Erklärung persönlich unterzeichnen und<br />
Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung)<br />
angeben.<br />
(3) 1 Der fristgemäß eingereichte Antrag ist den weiteren Beteiligten zur<br />
Äußerung binnen einer zu bestimmenden Frist mitzuteilen. 2 Beteiligt sind<br />
außer dem Antragsteller der Landtag und die Personen, deren<br />
Mitgliedschaft im Landtag durch die beantragte Entscheidung betroffen<br />
wäre. 3 Die Äußerung und die Gegenerklärung erfolgen schriftlich.<br />
(4) Ist die Frist des Absatzes 2 Satz 1 nicht eingehalten worden, so ist der<br />
Antrag als unzulässig zurückzuweisen.<br />
(5) Ausfertigungen der Entscheidung sind dem Abgeordneten, dem Landtag,<br />
den etwaigen übrigen Beteiligten, der Staatsregierung und dem<br />
Landeswahlleiter zuzustellen.<br />
4. ABSCHNITT Verfassungsstreitigkeiten zwischen obersten<br />
Staatsorganen; Meinungsverschiedenheiten über<br />
Verfassungsänderung (Art. 2 Nrn. 4 und 8)<br />
Bay VfGHG Art. 49 Verfahren, Zustellung<br />
(1) Bei Verfassungsstreitigkeiten zwischen den obersten Staatsorganen oder<br />
in der Verfassung mit eigenen Rechten ausgestatteten Teilen eines<br />
obersten Staatsorgans (Art. 64 der Verfassung) sowie bei<br />
Meinungsverschiedenheiten darüber, ob durch ein Gesetz die Verfassung<br />
verletzt wird oder ob ein Antrag auf eine unzulässige<br />
Verfassungsänderung vorliegt (Art. 75 Abs. 3 der Verfassung), kann die<br />
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs herbeigeführt werden.
(2) 1 Antragsberechtigt sind der Landtag, die Staatsregierung und die in der<br />
Verfassung mit eigenen Rechten ausgestatteten Teile eines obersten<br />
Staatsorgans. 2 Letztere müssen sich durch einen Bevollmächtigten<br />
vertreten lassen, der den Antrag zu stellen und dabei den Nachweis seiner<br />
Bevollmächtigung vorzulegen hat. 3 Bei Meinungsverschiedenheiten<br />
innerhalb des Landtags (Art. 75 Abs. 3 der Verfassung) müssen sich auch<br />
die Mitglieder des Landtags, die die gegenteilige Ansicht vertreten, durch<br />
einen Bevollmächtigten vertreten lassen.<br />
(3) Ausfertigungen der Entscheidung sind dem Landtag und der<br />
Staatsregierung zuzustellen.<br />
5. ABSCHNITT Richtervorlagen (Art. 2 Nr. 5)<br />
Bay VfGHG Art. 50 Verfahren, Zustellung<br />
(1) Hält ein Gericht eine Rechtsvorschrift des bayerischen <strong>Landesrecht</strong>s, die<br />
für die Entscheidung eines bei ihm anhängigen Verfahrens erheblich ist,<br />
für verfassungswidrig, so hat es das Verfahren auszusetzen und die<br />
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs herbeizuführen.<br />
(2) 1 Das Gericht leitet den Vorlagebeschluß mit den Akten dem<br />
Verfassungsgerichtshof unmittelbar zu. 2 In der Begründung des<br />
Beschlusses ist auszuführen, aus welchen Gründen die Rechtsvorschrift für<br />
das anhängige Verfahren entscheidungserheblich ist und für<br />
verfassungswidrig erachtet wird.<br />
(3) Der Verfassungsgerichtshof gibt dem Landtag, der Staatsregierung und<br />
den sonst am Verfahren Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung.<br />
(4) Ausfertigungen der Entscheidung sind dem Landtag und der<br />
Staatsregierung zuzustellen.<br />
6. ABSCHNITT Verfassungsbeschwerden (Art. 2 Nr. 6)<br />
Bay VfGHG Art. 51 Inhalt und Voraussetzung der<br />
Verfassungsbeschwerde; Frist<br />
(1) 1 In der Beschwerde nach Art. 120 der Verfassung sind die Handlung oder<br />
Unterlassung der Behörde, gegen die sich der Beschwerdeführer wendet,<br />
und das verfassungsmäßige Recht, dessen Verletzung der<br />
Beschwerdeführer geltend macht, zu bezeichnen; die Bestimmungen der<br />
Verfassung, deren Verletzung behauptet wird, sollen angeführt werden.<br />
2<br />
Die Beschwerde kann auch gegen die Handlung oder Unterlassung eines<br />
Gerichts erhoben werden.<br />
(2) 1 Ist hinsichtlich des Beschwerdegegenstands ein Rechtsweg zulässig, so<br />
ist bei Einreichung der Beschwerde nachzuweisen, daß der Rechtsweg<br />
erschöpft worden ist. 2 Die Verfassungsbeschwerde ist spätestens zwei<br />
Monate nach der schriftlichen Bekanntgabe der vollständigen<br />
letztgerichtlichen Entscheidung an den Beschwerdeführer beim<br />
Verfassungsgerichtshof einzureichen.<br />
(3) 1 Ist ein Rechtsweg nicht zulässig und wird die Beschwerde gegen eine<br />
einem Staatsministerium nachgeordnete Behörde erhoben, so muß der
Beschwerdeführer bei Einreichung der Beschwerde nachweisen, daß er<br />
innerhalb eines Monats, seit er von der Handlung der Behörde Kenntnis<br />
hat, ohne Erfolg bei dem zuständigen Staatsministerium um Abhilfe<br />
nachgesucht hat. 2 Sind seit der Einreichung des Gesuchs um Abhilfe drei<br />
Monate verstrichen, ohne daß dem Beschwerdeführer ein Bescheid<br />
zugegangen ist, so wird angenommen, daß das Gesuch um Abhilfe<br />
erfolglos geblieben ist. 3 Die Verfassungsbeschwerde ist spätestens zwei<br />
Monate nach der Entscheidung des Staatsministeriums oder der von ihm<br />
beauftragten Dienststelle und, falls eine Entscheidung nicht ergangen ist,<br />
zwei Monate nach Ablauf der Frist des Satzes 2 beim<br />
Verfassungsgerichtshof einzureichen.<br />
(4) Wird der Nachweis, daß der Rechtsweg erschöpft oder das Abhilfegesuch<br />
an das zuständige Staatsministerium ohne Erfolg geblieben ist, bei<br />
Einreichung der Verfassungsbeschwerde nicht erbracht, so kann ihn der<br />
Präsident unter Setzung einer Frist beim Beschwerdeführer anfordern.<br />
(5) Ist ein Rechtsweg nicht zulässig und auch ein Gesuch um Abhilfe nach<br />
Absatz 3 Satz 1 nicht möglich, so ist<br />
1. die Verfassungsbeschwerde gegen die Handlung einer Behörde<br />
spätestens zwei Monate seit der Kenntnisnahme des Beschwerdeführers,<br />
2. die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung<br />
spätestens zwei Monate seit der schriftlichen Bekanntgabe der<br />
vollständigen Entscheidung an den Beschwerdeführer,<br />
3. die Verfassungsbeschwerde gegen die Unterlassung einer beantragten<br />
Handlung spätestens sechs Monate nach der Antragstellung<br />
zu erheben.<br />
(6) Im Fall des Art. 48 Abs. 3 der Verfassung findet Absatz 1 Satz 1<br />
entsprechende Anwendung.<br />
Bay VfGHG Art. 52 Äußerung der Staatsregierung oder des zuständigen<br />
Staatsministeriums<br />
Vor einer abschließenden Entscheidung übermittelt der Verfassungsgerichtshof<br />
eine Abschrift der Beschwerde im Fall des Art. 48 Abs. 3 der Verfassung der<br />
Staatsregierung, im Fall des Art. 120 der Verfassung dem beteiligten<br />
Staatsministerium und gibt Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu<br />
bestimmenden Frist.<br />
Bay VfGHG Art. 53 Verfahren<br />
(1) 1 Über die Beschwerde entscheidet der Verfassungsgerichtshof ohne<br />
mündliche Verhandlung. 2 Der Präsident oder der Verfassungsgerichtshof<br />
können mündliche Verhandlung anordnen.<br />
(2) Zur mündlichen Verhandlung sind der Beschwerdeführer und die<br />
Staatsregierung oder das beteiligte Staatsministerium zu laden.<br />
(3) Der Präsident oder der Verfassungsgerichtshof können das persönliche<br />
Erscheinen des Beschwerdeführers anordnen.<br />
Bay VfGHG Art. 54 Inhalt der Entscheidung<br />
1 Wird einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben, so ist in der Entscheidung<br />
festzustellen, welche Verfassungsbestimmung verletzt wurde und durch welche
gerichtliche oder behördliche Handlung oder Unterlassung die Verletzung<br />
erfolgt ist. 2 Der Verfassungsgerichtshof bestimmt, in welcher Weise der<br />
Beschwerde abzuhelfen ist.<br />
7. ABSCHNITT Popularklagen (Art. 2 Nr. 7)<br />
Bay VfGHG Art. 55 Popularklage<br />
(1) 1 Die Verfassungswidrigkeit einer Rechtsvorschrift des bayerischen<br />
<strong>Landesrecht</strong>s kann jedermann durch Beschwerde beim<br />
Verfassungsgerichtshof geltend machen. 2 Er hat darzulegen, daß ein<br />
durch die Verfassung gewährleistetes Grundrecht verfassungswidrig<br />
eingeschränkt wird.<br />
(2) Der Verfassungsgerichtshof hat dem Landtag, der Staatsregierung und<br />
den übrigen Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung zu geben.<br />
(3) Der Verfassungsgerichtshof kann von einer mündlichen Verhandlung<br />
absehen, wenn er eine solche nach der Sach- und Rechtslage nicht für<br />
geboten erachtet.<br />
(4) Ausfertigungen der Entscheidung sind dem Landtag und der<br />
Staatsregierung zuzustellen.<br />
(5) Der Verfassungsgerichtshof kann trotz einer Rücknahme der Popularklage<br />
über diese entscheiden, wenn er eine Entscheidung im öffentlichen<br />
Interesse für geboten hält; er hat über die Popularklage zu entscheiden,<br />
wenn die juristische Person des öffentlichen Rechts, deren<br />
Rechtsvorschrift angegriffen ist, eine Entscheidung binnen vier Wochen ab<br />
Zustellung der Rücknahmeerklärung beantragt.<br />
VIERTER TEIL Änderungs-, Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay VfGHG Art. 56 Antrag (weggefallen)<br />
Bay VfGHG Art. 57 Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Übergangsregelung<br />
(1) 1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 2 Gleichzeitig treten außer<br />
Kraft<br />
1. das Gesetz über den Verfassungsgerichtshof – VfGHG – (BayRS 1103-<br />
1-S) und<br />
2. die Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofs für den Freistaat<br />
Bayern vom 15. Juli 1963 (GVBl S. 151, BayRS 1103-1-1-S), geändert<br />
durch Bekanntmachung vom 18. Februar 1966 (GVBl S. 159).<br />
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten Art. 3 Abs. 6, Art. 10 Abs. 1 und<br />
Art. 30 Abs. 2 am 1. August 1990 in Kraft.<br />
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt als Übergangsregelung<br />
folgendes:<br />
1. 1 Die Vorschriften über die Dauer der Amtszeit der berufsrichterlichen<br />
Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, über die Wählbarkeit und über die<br />
Wahlvorschläge (Art. 4 Abs. 1, Art. 5 und 6) gelten nur für die Mitglieder<br />
des Verfassungsgerichtshofs, die nach Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
gewählt werden. 2 Für die zuvor gewählten Mitglieder bleiben die<br />
bisherigen Vorschriften maßgebend.
2. 3 Die Bestimmungen dieses <strong>Gesetze</strong>s sind auch auf bereits anhängige<br />
Verfahren anzuwenden. 4 Anträge und Erklärungen, die entsprechend dem<br />
bisherigen Recht gestellt oder abgegeben wurden, bleiben wirksam.<br />
5 Verfahren, in denen die mündliche Verhandlung vor dem Inkrafttreten<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s begonnen hat, werden nach dem bisherigen Recht zu<br />
Ende geführt. 6 Eine Gebühr nach Art. 27 Abs. 1 kann bei Popularklagen,<br />
die vor Inkrafttreten dieses <strong>Gesetze</strong>s erhoben wurden, nicht auferlegt<br />
werden.
Verwaltungsgemeinschaftsordnung für<br />
den Freistaat Bayern (Bay VGemO)<br />
(BayRS 2020-2-1-I) geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 10. Juni 1994 GVBl. S. 426 , vom 26. Juli 2004<br />
GVBl. S. 272 , vom 24. Dezember 2005 GVBl. S. 659<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Die Verwaltungsgemeinschaft<br />
Art. 1 Wesen und Rechtsform<br />
Art. 2 Bildung und Erweiterung von Verwaltungsgemeinschaften<br />
Art. 3 Bestimmung von Name und Sitz<br />
Art. 4 Aufgaben<br />
Art. 5 Mitwirkung der Gemeinden<br />
Art. 6 Organe der Verwaltungsgemeinschaft<br />
Art. 7 Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft<br />
Art. 8 Deckung des Finanzbedarfs<br />
Art. 9 Auflösung und Entlassung<br />
Art. 10 Bekanntmachung; Anwendung des <strong>Gesetze</strong>s über die kommunale<br />
Zusammenarbeit<br />
ZWEITER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Art. 11 Übergangsvorschriften<br />
Art. 12 Inkrafttreten<br />
ERSTER TEIL Die Verwaltungsgemeinschaft<br />
Bay VGemO Art. 1 Wesen und Rechtsform<br />
(1) 1 Die Verwaltungsgemeinschaft ist ein Zusammenschluß benachbarter<br />
kreisangehöriger Gemeinden unter Aufrechterhaltung des Bestands der<br />
beteiligten Gemeinden. 2 Sie erfüllt öffentliche Aufgaben nach Maßgabe<br />
der folgenden Bestimmungen und dient der Stärkung der Leistungs- und<br />
Verwaltungskraft ihrer Mitglieder.
(2) 1 Die Verwaltungsgemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen<br />
Rechts. 2 Sie kann Dienstherr von Beamten sein.<br />
Bay VGemO Art. 2 Bildung und Erweiterung von<br />
Verwaltungsgemeinschaften<br />
(1) Verwaltungsgemeinschaften können gebildet werden,<br />
1. wenn die beteiligten Gemeinden einverstanden sind,<br />
2. gegen den Willen beteiligter Gemeinden, wenn Gründe des öffentlichen<br />
Wohls vorliegen; die beteiligten Gemeinden sind vorher zu hören.<br />
(2) Eine Gemeinde kann in eine bestehende Verwaltungsgemeinschaft<br />
aufgenommen werden,<br />
1. wenn die Gemeinde, die Verwaltungsgemeinschaft und deren<br />
Mitgliedsgemeinden einverstanden sind,<br />
2. gegen den Willen der Gemeinde, der Verwaltungsgemeinschaft oder<br />
einer Mitgliedsgemeinde, wenn Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen;<br />
die Gemeinde, die Verwaltungsgemeinschaft und deren<br />
Mitgliedsgemeinden sind vorher zu hören.<br />
(3) Verwaltungsgemeinschaften werden durch Gesetz gebildet oder erweitert.<br />
(4) Die mit der Bildung oder Erweiterung von Verwaltungsgemeinschaften<br />
zusammenhängenden Rechts- und Verwaltungsfragen regelt die<br />
Regierung.<br />
(5) 1 Im Fall der Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft dürfen bis zur<br />
Bekanntmachung ihrer ersten Haushaltssatzung ausgabenwirksame<br />
Maßnahmen nur getroffen werden, wenn und soweit sie für eine<br />
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung unerläßlich sind; insoweit dürfen<br />
Ausgaben geleistet werden. 2 Bis zum gleichen Zeitpunkt kann die<br />
Verwaltungsgemeinschaft nach Maßgabe des Art. 8 Abs. 1 Sätze 1 und 2<br />
eine vorläufige Umlage erheben. 3 Sie kann ferner einen vorläufigen<br />
Höchstbetrag für Kassenkredite festsetzen. 4 Der Stellenplan gilt insoweit<br />
als festgesetzt, als Beamte und Angestellte von Mitgliedsgemeinden<br />
übernommen werden.<br />
Bay VGemO Art. 3 Bestimmung von Name und Sitz<br />
(1) Name und Sitz einer neuen Verwaltungsgemeinschaft werden durch<br />
Rechtsverordnung der Regierung bestimmt, sofern das nach Art. 2 Abs. 3<br />
erlassene Gesetz dazu nichts bestimmt.<br />
(2) 1 Die Regierung kann durch Rechtsverordnung nach Anhörung der<br />
Verwaltungsgemeinschaft deren Namen und Sitz ändern. 2 Die<br />
Namensänderung setzt ein öffentliches Bedürfnis, die Sitzänderung ein<br />
dringendes öffentliches Bedürfnis voraus.<br />
Bay VGemO Art. 4 Aufgaben<br />
(1) 1 Die Verwaltungsgemeinschaft nimmt alle Angelegenheiten des<br />
übertragenen Wirkungskreises ihrer Mitgliedsgemeinden wahr,<br />
ausgenommen den Erlaß von Satzungen und Verordnungen. 2 Die<br />
Mitgliedsgemeinden sind über die sie betreffenden Vorgänge im<br />
übertragenen Wirkungskreis zu informieren. 3 Das Staatsministerium des<br />
Innern kann durch Rechtsverordnung allgemein bestimmen, daß einzelne
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bei den Mitgliedsgemeinden<br />
verbleiben.<br />
(2) 1 Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft erfüllen die<br />
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. 2 Die Verwaltungsgemeinschaft<br />
führt dabei die Aufgaben nach den folgenden Sätzen 3 und 4 als Behörde<br />
der jeweiligen Mitgliedsgemeinde nach deren Weisung aus; der erste<br />
Bürgermeister kann die Mitgliedsgemeinde auch insoweit vertreten. 3 Der<br />
Verwaltungsgemeinschaft obliegen die verwaltungsmäßige Vorbereitung<br />
und der verwaltungsmäßige Vollzug der Beschlüsse der<br />
Mitgliedsgemeinden sowie die Besorgung der laufenden<br />
Verwaltungsangelegenheiten, die für die Mitgliedsgemeinden keine<br />
grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen<br />
erwarten lassen. 4 Das gleiche gilt für die Aufgaben, die nach Absatz 1 bei<br />
den Mitgliedsgemeinden verbleiben.<br />
(3) Die Mitgliedsgemeinden können durch Zweckvereinbarung einzelne<br />
Aufgaben und Befugnisse des eigenen Wirkungskreises auf die<br />
Verwaltungsgemeinschaft übertragen.<br />
(4) 1 Mit dem Inkrafttreten des <strong>Gesetze</strong>s (Art. 2 Abs. 3) tritt die<br />
Verwaltungsgemeinschaft an die Stelle von Zweckverbänden, die aus<br />
denselben Mitgliedern wie die Verwaltungsgemeinschaft bestehen; solche<br />
Zweckverbände können nicht neu gebildet werden. 2 Andere<br />
Zweckverbände können ihre Verwaltungsaufgaben (Absatz 2) durch<br />
Zweckvereinbarung auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen. 3 Die<br />
Aufgaben und Befugnisse von Verbänden, die nicht auf Grund des<br />
<strong>Gesetze</strong>s über die kommunale Zusammenarbeit, sondern auf Grund<br />
anderer Rechtsvorschriften gebildet sind, können nach Maßgabe der für<br />
sie geltenden Vorschriften auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen<br />
werden.<br />
(5) Die Verwaltungsgemeinschaft soll ihre Mitgliedsgemeinden bei der<br />
Erfüllung der übrigen gemeindlichen Aufgaben beraten.<br />
Bay VGemO Art. 5 Mitwirkung der Gemeinden<br />
Die Mitgliedsgemeinden sind verpflichtet, die Verwaltungsgemeinschaft bei der<br />
Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen.<br />
Bay VGemO Art. 6 Organe der Verwaltungsgemeinschaft<br />
(1) Die Verwaltungsgemeinschaft wird durch die Gemeinschaftsversammlung<br />
verwaltet, soweit nicht der Gemeinschaftsvorsitzende zuständig ist.<br />
(2) 1 Die Gemeinschaftsversammlung besteht aus den Vertretern der<br />
Mitgliedsgemeinden. 2 Vertreter sind die ersten Bürgermeister und je ein<br />
Gemeinderatsmitglied; für jedes volle Tausend ihrer Einwohner entsenden<br />
die Mitgliedsgemeinden ein weiteres Gemeinderatsmitglied. 3 Die ersten<br />
Bürgermeister werden im Fall der Verhinderung durch ihre Stellvertreter<br />
vertreten. 4 Für jedes der übrigen Mitglieder der<br />
Gemeinschaftsversammlung ist für den Fall, daß es verhindert ist oder den<br />
ersten Bürgermeister nach Satz 3 vertritt, ein Stellvertreter aus der Mitte<br />
des Gemeinderats zu bestellen. 5 Bei der Bestellung der übrigen Mitglieder<br />
und ihrer Stellvertreter gelten Art. 33 Abs. 1 Sätze 2 bis 5 der
Gemeindeordnung (GO) entsprechend. 6 Jede Mitgliedsgemeinde hat so<br />
viele einzeln abzugebende Stimmen, als Vertreter von ihr anwesend sind.<br />
(3) 1 Die Gemeinschaftsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen der ersten<br />
Bürgermeister zum Gemeinschaftsvorsitzenden und einen oder zwei<br />
Stellvertreter, und zwar je auf die Dauer ihres gemeindlichen Amts. 2 Die<br />
Vertreter der Mitgliedsgemeinden sind insoweit an Weisungen nicht<br />
gebunden.<br />
(4) 1 Für die Aufgaben und Befugnisse des Gemeinschaftsvorsitzenden gelten<br />
die Vorschriften über die Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden eines<br />
Zweckverbands entsprechend. 2 Er führt die Dienstaufsicht über die<br />
Dienstkräfte der Verwaltungsgemeinschaft und ist Dienstvorgesetzter ihrer<br />
Beamten.<br />
Bay VGemO Art. 7 Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft<br />
(1) 1 Die Verwaltungsgemeinschaft stellt das fachlich geeignete<br />
Verwaltungspersonal an, das erforderlich ist, um den ordnungsmäßigen<br />
Gang der Geschäfte zu gewährleisten. 2 Unbeschadet der Verpflichtung<br />
nach Satz 1 soll die Verwaltungsgemeinschaft mindestens einen Beamten<br />
mit der Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst haben.<br />
(2) 1 Der Gemeinschaftsvorsitzende kann dem Leiter der Geschäftsstelle<br />
laufende Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen. 2 Der<br />
Leiter der Geschäftsstelle nimmt an den Sitzungen der<br />
Gemeinschaftsversammlung beratend teil.<br />
(3) Verwaltungsgemeinschaften, die versorgungsberechtigte Beamte und<br />
Angestellte haben, sind Mitglieder des Bayerischen Versorgungsverbands.<br />
Bay VGemO Art. 8 Deckung des Finanzbedarfs<br />
(1) 1 Die Verwaltungsgemeinschaft erhebt von ihren Mitgliedsgemeinden eine<br />
Umlage, soweit ihre sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um ihren<br />
Finanzbedarf zu decken. 2 Die Umlage wird für die Aufgaben nach Art. 4<br />
Abs. 1 und 2 nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der<br />
Mitgliedsgemeinden bemessen; maßgebend ist die auf der Grundlage der<br />
letzten Volkszählung fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem <strong>Stand</strong><br />
vom 30. Juni des vorausgegangenen Jahres. 3 Durch einstimmigen<br />
Beschluß der Gemeinschaftsversammlung kann eine andere Regelung<br />
getroffen werden. 4 Die Regierung soll für die Bemessung der Umlage ein<br />
anderes Verhältnis festlegen oder die Umlage für eine oder mehrere<br />
Mitgliedsgemeinden abweichend von Satz 2 festsetzen, wenn das<br />
erforderlich ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. 5 Der Kostenersatz<br />
für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Art. 4 Abs. 3 und 4 Satz 2 bleibt<br />
der besonderen Regelung in der Zweckvereinbarung vorbehalten. 6 In den<br />
Fällen des Art. 4 Abs. 4 Sätze 1 und 3 verbleibt es bei der bisherigen<br />
Kostenregelung, soweit sie nicht durch Beschluß der<br />
Gemeinschaftsversammlung mit den Stimmenzahlen der Mitglieder des<br />
früheren Verbands aufgehoben wird.<br />
(2) 1 Die Verwaltungsgemeinschaft ist verpflichtet, eine Haushaltssatzung zu<br />
erlassen. 2 Die Höhe der Umlage ist für jedes Rechnungsjahr durch
Beschluß der Gemeinschaftsversammlung in der Haushaltssatzung<br />
festzusetzen.<br />
Bay VGemO Art. 9 Auflösung und Entlassung<br />
(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls kann<br />
1. eine Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst werden,<br />
2. eine Mitgliedsgemeinde aus einer Verwaltungsgemeinschaft entlassen<br />
werden.<br />
(2) 1 Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch Gesetz vorgenommen. 2 Die<br />
Verwaltungsgemeinschaft und die Mitgliedsgemeinden sind vorher zu<br />
hören.<br />
(3) Die mit der Auflösung oder Entlassung zusammenhängenden Rechts- und<br />
Verwaltungsfragen regelt die Regierung.<br />
(4) 1 Im Fall der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft bestimmt die<br />
Regierung eine Gemeinde oder eine neu entstehende<br />
Verwaltungsgemeinschaft zur Gesamtrechtsnachfolgerin, die im Bereich<br />
der bisherigen Verwaltungsgemeinschaft deren Geschäfte einschließlich<br />
der Rechnungslegung abwickelt. 2 Über das Ergebnis der<br />
Haushaltswirtschaft und das Vermögen setzen sich die bisherigen<br />
Mitgliedsgemeinden durch Übereinkunft auseinander. 3 Im Fall der<br />
Entlassung einer Mitgliedsgemeinde findet eine Auseinandersetzung<br />
zwischen der Verwaltungsgemeinschaft und der entlassenen Gemeinde<br />
statt. 4 Der Übereinkunft kommt mit dem in ihr bestimmten Zeitpunkt,<br />
frühestens jedoch mit Rechtswirksamkeit der Auflösung oder Entlassung,<br />
unmittelbar rechtsbegründende Wirkung zu. 5 Kommt eine Übereinkunft<br />
nicht zustande, so entscheiden das Verwaltungsgericht und in der<br />
Berufungsinstanz der Verwaltungsgerichtshof als Schiedsgerichte.<br />
Bay VGemO Art. 10 Bekanntmachung; Anwendung des <strong>Gesetze</strong>s über<br />
die kommunale Zusammenarbeit<br />
(1) 1 Rechtsvorschriften der Verwaltungsgemeinschaft sind im Amtsblatt der<br />
Verwaltungsgemeinschaft amtlich bekanntzumachen. 2 Unterhält die<br />
Verwaltungsgemeinschaft kein Amtsblatt, so sind die Rechtsvorschriften<br />
im Amtsblatt des Landkreises oder des Landratsamts, sonst in anderen<br />
regelmäßig erscheinenden Druckwerken amtlich bekanntzumachen. 3 Die<br />
amtliche Bekanntmachung kann auch dadurch bewirkt werden, daß die<br />
Rechtsvorschrift in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft<br />
niedergelegt und die Niederlegung durch Anschlag an den für öffentliche<br />
Bekanntmachungen allgemein bestimmten Stellen oder durch Mitteilung in<br />
einer Tageszeitung bekanntgegeben wird; diese Form der<br />
Bekanntmachung ist nur zulässig, wenn sämtliche Mitgliedsgemeinden<br />
dieselbe Art der Bekanntmachung gewählt haben. 4 Für die öffentliche<br />
Bekanntmachung von Verwaltungsakten, Ladungen und sonstigen<br />
Mitteilungen gilt Art. 27 Abs. 2 GO entsprechend.<br />
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten für die<br />
Verwaltungsgemeinschaft die Bestimmungen des <strong>Gesetze</strong>s über die<br />
kommunale Zusammenarbeit entsprechend.
ZWEITER TEIL Übergangs- und Schlußvorschriften<br />
Bay VGemO Art. 11 Übergangsvorschriften<br />
(1) 1 Für Rechtsgeschäfte, die aus Anlaß der Bildung, Erweiterung oder<br />
Auflösung einer Verwaltungsgemeinschaft oder der Entlassung von<br />
Mitgliedsgemeinden aus einer Verwaltungsgemeinschaft erforderlich<br />
werden, werden Abgaben (insbesondere auch die Kosten nach dem<br />
Gerichtskostengesetz und der Kostenordnung einschließlich der<br />
Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren) nicht erhoben, soweit eine<br />
Befreiung landesrechtlich zulässig ist. 2 Auslagen werden nicht ersetzt.<br />
(2) Die Behandlung der Verwaltungsgemeinschaften im Finanzausgleich bleibt<br />
besonderer gesetzlicher Regelung vorbehalten; die Bildung von<br />
Verwaltungsgemeinschaften ist dabei finanziell zu fördern.<br />
Bay VGemO Art. 12 Inkrafttreten<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung – Erstes Gesetz zur Stärkung der kommunalen<br />
Selbstverwaltung – vom 27. Juli 1971 (GVBl S. 247).<br />
(1) Art. 4 dieses <strong>Gesetze</strong>s tritt am 1. Januar 1976, Art. 17 am 1. Januar 1970<br />
in Kraft.<br />
(2) Im übrigen tritt das Gesetz am 1. August 1971 in Kraft.
<strong>Bayerisches</strong><br />
Verwaltungsverfahrensgesetz (Bay<br />
VwVfG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 23. Juli 1985 (GVBl. S. 269), vom 24. Juli 1990 (GVBl. S. 235), vom<br />
27. Dezember 1991 (GVBl. S. 496), vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 348), vom 27. Dezember 1999<br />
(GVBl. S. 532), vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 962), vom<br />
24. Dezember 2002 (GVBl. S. 975), vom 10. Juni 2008 (GVBl. S. 312), vom 27. Juli 2009 (GVBl.<br />
S. 376), vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 628)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER TEIL Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische<br />
Kommunikation, Amtshilfe, europäische Verwaltungszusammenarbeit<br />
Abschnitt I Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische<br />
Kommunikation<br />
Art. 1 Anwendungsbereich<br />
Art. 2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich<br />
Art. 3 Örtliche Zuständigkeit<br />
Art. 3 a Elektronische Kommunikation<br />
Art. 3 b Selbsteintritt<br />
Abschnitt II Amtshilfe<br />
Art. 4 Amtshilfepflicht<br />
Art. 5 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe<br />
Art. 6 Auswahl der Behörde<br />
Art. 7 Durchführung der Amtshilfe<br />
Art. 8 Kosten der Amtshilfe<br />
Abschnitt III Europäische Verwaltungszusammenarbeit<br />
Art. 8 a Grundsätze der Hilfeleistung<br />
Art. 8 b Form und Behandlung der Ersuchen
Art. 8 c Kosten der Hilfeleistung<br />
Art. 8 d Mitteilungen von Amts wegen<br />
Art. 8 e Anwendbarkeit<br />
ZWEITER TEIL Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren<br />
ABSCHNITT I Verfahrensgrundsätze<br />
Art. 9 Begriff des Verwaltungsverfahrens<br />
Art. 10 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens<br />
Art. 11 Beteiligungsfähigkeit<br />
Art. 12 Handlungsfähigkeit<br />
Art. 13 Beteiligte<br />
Art. 14 Bevollmächtigte und Beistände<br />
Art. 15 Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten<br />
Art. 16 Bestellung eines Vertreters von Amts wegen<br />
Art. 17 Vertreter bei gleichförmigen Eingaben<br />
Art. 18 Vertreter für Beteiligte bei gleichem Interesse<br />
Art. 19 Gemeinsame Vorschriften für Vertreter bei gleichförmigen Eingaben<br />
und bei gleichem Interesse<br />
Art. 20 Ausgeschlossene Personen<br />
Art. 21 Besorgnis der Befangenheit<br />
Art. 22 Beginn des Verfahrens<br />
Art. 23 Amtssprache<br />
Art. 24 Untersuchungsgrundsatz<br />
Art. 25 Beratung, Auskunft
Art. 26 Beweismittel<br />
Art. 27 Versicherung an Eides Statt<br />
Art. 28 Anhörung Beteiligter<br />
Art. 29 Akteneinsicht durch Beteiligte<br />
Art. 30 Geheimhaltung<br />
ABSCHNITT II Fristen, Termine, Wiedereinsetzung<br />
Art. 31 Fristen und Termine<br />
Art. 32 Wiedereinsetzung in den vorigen <strong>Stand</strong><br />
ABSCHNITT III Amtliche Beglaubigung<br />
Art. 33 Beglaubigung von Dokumenten<br />
Art. 34 Beglaubigung von Unterschriften<br />
DRITTER TEIL Verwaltungsakt<br />
ABSCHNITT I Zustandekommen des Verwaltungsakts<br />
Art. 35 Begriff des Verwaltungsakts<br />
Art. 36 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt<br />
Art. 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsakts<br />
Art. 38 Zusicherung<br />
Art. 39 Begründung des Verwaltungsakts<br />
Art. 40 Ermessen<br />
Art. 41 Bekanntgabe des Verwaltungsakts<br />
Art. 42 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt<br />
Art. 42 a Genehmigungsfiktion<br />
ABSCHNITT II Bestandskraft des Verwaltungsakts
Art. 43 Wirksamkeit des Verwaltungsakts<br />
Art. 44 Nichtigkeit des Verwaltungsakts<br />
Art. 45 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern<br />
Art. 46 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern<br />
Art. 47 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsakts<br />
Art. 48 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts<br />
Art. 49 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsakts<br />
Art. 49 a Erstattung, Verzinsung<br />
Art. 50 Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren<br />
Art. 51 Wiederaufgreifen des Verfahrens<br />
Art. 52 Rückgabe von Urkunden und Sachen<br />
ABSCHNITT III Einfluß des Verwaltungsakts auf Verjährung und Erlöschen<br />
Art. 53 Hemmung der Verjährung und des Erlöschens durch Verwaltungsakt<br />
VIERTER TEIL Öffentlich-rechtlicher Vertrag<br />
Art. 54 Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrags<br />
Art. 55 Vergleichsvertrag<br />
Art. 56 Austauschvertrag<br />
Art. 57 Schriftform<br />
Art. 58 Zustimmung von Dritten und Behörden<br />
Art. 59 Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrags<br />
Art. 60 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen<br />
Art. 61 Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung<br />
Art. 62 Ergänzende Anwendung von Vorschriften
FÜNFTER TEIL Besondere Verfahrensarten<br />
ABSCHNITT I Förmliches Verwaltungsverfahren<br />
Art. 63 Anwendung der Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren<br />
Art. 64 Form des Antrags<br />
Art. 65 Mitwirkung von Zeugen und Sachverständigen<br />
Art. 66 Verpflichtung zur Anhörung von Beteiligten<br />
Art. 67 Erfordernis der mündlichen Verhandlung<br />
Art. 68 Verlauf der mündlichen Verhandlung<br />
Art. 69 Entscheidung<br />
Art. 70 Anfechtung der Entscheidung<br />
Art. 71 Besondere Vorschriften für das förmliche Verfahren vor Ausschüssen<br />
ABSCHNITT I a Verfahren über eine einheitliche Stelle<br />
Art. 71 a Anwendbarkeit<br />
Art. 71 b Verfahren<br />
Art. 71 c Informationspflichten<br />
Art. 71 d Gegenseitige Unterstützung<br />
Art. 71 e Elektronisches Verfahren<br />
ABSCHNITT II Planfeststellungsverfahren<br />
Art. 72 Anwendung der Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren<br />
Art. 73 Anhörungsverfahren<br />
Art. 74 Planfeststellungsbeschluß, Plangenehmigung<br />
Art. 75 Rechtswirkungen der Planfeststellung<br />
Art. 76 Planänderungen vor Fertigstellung des Vorhabens
Art. 77 Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses<br />
Art. 78 Zusammentreffen mehrerer Vorhaben<br />
ABSCHNITT III Verwaltungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Art. 78 a Anwendbarkeit<br />
Art. 78 b Zweck der Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Art. 78 c Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Art. 78 d Unterrichtung des Trägers des Vorhabens<br />
Art. 78 e Unterlagen des Trägers des Vorhabens<br />
Art. 78 f Beteiligung anderer Behörden<br />
Art. 78 g Beteiligung der Öffentlichkeit<br />
Art. 78 h Grenzüberschreitende Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
Art. 78 i Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen<br />
Art. 78 j Bewertung der Umweltauswirkungen und Berücksichtigung des<br />
Ergebnisses bei der Entscheidung<br />
Art. 78 k Vorbescheid und Teilzulassungen<br />
Art. 78 l Zulassung eines Vorhabens durch mehrere Behörden<br />
SECHSTER TEIL Rechtsbehelfsverfahren<br />
Art. 79 Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte<br />
Art. 80 Kosten im Vorverfahren<br />
SIEBTER TEIL Ehrenamtliche Tätigkeit, Ausschüsse<br />
ABSCHNITT I Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
Art. 81 Anwendung der Vorschriften über die ehrenamtliche Tätigkeit<br />
Art. 82 Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit
Art. 83 Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit<br />
Art. 84 Verschwiegenheitspflicht<br />
Art. 85 Entschädigung<br />
Art. 86 Abberufung<br />
Art. 87<br />
ABSCHNITT II Ausschüsse<br />
Art. 88 Anwendung der Vorschriften über Ausschüsse<br />
Art. 89 Ordnung in den Sitzungen<br />
Art. 90 Beschlußfähigkeit<br />
Art. 91 Beschlußfassung<br />
Art. 92 Wahlen durch Ausschüsse<br />
Art. 93 Niederschrift<br />
ACHTER TEIL Schlußvorschriften<br />
Art. 94 Länderübergreifende Verfahren<br />
Art. 95 Sonderregelung für Verteidigungsangelegenheiten<br />
Art. 96 Überleitung von Verfahren<br />
Art. 96 a Übergangsregelung<br />
Art. 97 Revision<br />
Art. 98 (Änderungsbestimmung)<br />
Art. 99 Inkrafttreten
ERSTER TEIL Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit,<br />
elektronische Kommunikation, Amtshilfe, europäische<br />
Verwaltungszusammenarbeit<br />
Abschnitt I Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit,<br />
elektronische Kommunikation<br />
Bay VwVfG Art. 1 Anwendungsbereich<br />
(1) 1 Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der<br />
Behörden des Freistaates Bayern, der Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
und der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden<br />
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, soweit nicht<br />
Rechtsvorschriften des Freistaates Bayern inhaltsgleiche oder<br />
entgegenstehende Bestimmungen enthalten. 2 Verfahrensregelungen in<br />
Rechtsvorschriften des Bundes bleiben unberührt.<br />
(2) Behörde im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist jede Stelle, die Aufgaben der<br />
öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.<br />
Bay VwVfG Art. 2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich<br />
(1) 1 Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der<br />
Religionsgemeinschaften und der weltanschaulichen Gemeinschaften<br />
sowie ihrer Verbände und Einrichtungen. 2 Das Gesetz gilt auch nicht für<br />
die Anstalt des öffentlichen Rechts “Bayerischer Rundfunk”.<br />
(2) Dieses Gesetz gilt ferner nicht für<br />
1. Verfahren der Finanzbehörden nach der Abgabenordnung,<br />
2. die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von<br />
Ordnungswidrigkeiten, die Rechtshilfe für das Ausland in Straf- und<br />
Zivilsachen und, unbeschadet des Art. 80 Abs. 4, für Maßnahmen des<br />
Richterdienstrechts,<br />
3. Verfahren im Zusammenhang mit Ehrungen und der Ausübung des<br />
Begnadigungsrechts,<br />
4. Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch,<br />
5. das Recht des Lastenausgleichs,<br />
6. das Recht der Wiedergutmachung.<br />
(3) Das Gesetz gilt für die Tätigkeit<br />
1. der Gerichtsverwaltungen und der Behörden der Justizverwaltung<br />
einschließlich der ihrer Aufsicht unterliegenden Körperschaften des<br />
öffentlichen Rechts nur, soweit die Tätigkeit der Nachprüfung durch die<br />
Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder durch die in<br />
verwaltungsrechtlichen Anwalts- und Notarsachen zuständigen Gerichte<br />
unterliegt,<br />
2. der Behörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von<br />
Personen nur, soweit nicht die Besonderheiten des Prüfungsverfahrens<br />
entgegenstehen.<br />
Bay VwVfG Art. 3 Örtliche Zuständigkeit<br />
(1) Örtlich zuständig ist<br />
1. in Angelegenheiten, die sich auf unbewegliches Vermögen oder ein
ortsgebundenes Recht oder Rechtsverhältnis beziehen, die Behörde, in<br />
deren Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt,<br />
2. in Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder<br />
einer seiner Betriebsstätten, auf die Ausübung eines Berufs oder auf eine<br />
andere dauernde Tätigkeit beziehen, die Behörde, in deren Bezirk das<br />
Unternehmen oder die Betriebsstätte betrieben oder der Beruf oder die<br />
Tätigkeit ausgeübt wird oder werden soll,<br />
3. in anderen Angelegenheiten, die<br />
a) eine natürliche Person betreffen, die Behörde, in deren Bezirk die<br />
natürliche Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte,<br />
b) eine juristische Person oder eine Vereinigung betreffen, die Behörde, in<br />
deren Bezirk die juristische Person oder die Vereinigung ihren Sitz hat<br />
oder zuletzt hatte,<br />
4. in Angelegenheiten, bei denen sich die Zuständigkeit nicht aus den<br />
Nummern 1 bis 3 ergibt, die Behörde, in deren Bezirk der Anlaß für die<br />
Amtshandlung hervortritt.<br />
(2) 1 Sind nach Absatz 1 mehrere Behörden zuständig, so entscheidet die<br />
Behörde, die zuerst mit der Sache befaßt worden ist, es sei denn, die<br />
gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbehörde bestimmt, daß eine<br />
andere örtlich zuständige Behörde zu entscheiden hat. 2 Sie kann in den<br />
Fällen, in denen eine gleiche Angelegenheit sich auf mehrere<br />
Betriebsstätten eines Betriebs oder Unternehmens bezieht, eine der nach<br />
Absatz 1 Nr. 2 zuständigen Behörden als gemeinsame zuständige Behörde<br />
bestimmen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten zur<br />
einheitlichen Entscheidung geboten ist. 3 Diese Aufsichtsbehörde<br />
entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, wenn sich mehrere<br />
Behörden für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn die<br />
Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist. 4 Fehlt eine<br />
gemeinsame Aufsichtsbehörde, so treffen die fachlich zuständigen<br />
Aufsichtsbehörden die Entscheidung gemeinsam.<br />
(3) Ändern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens die die Zuständigkeit<br />
begründenden Umstände, so kann die bisher zuständige Behörde das<br />
Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter Wahrung der<br />
Interessen der Beteiligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung<br />
des Verfahrens dient und die nunmehr zuständige Behörde zustimmt.<br />
(4) 1 Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen jede Behörde<br />
örtlich zuständig, in deren Bezirk der Anlaß für die Amtshandlung<br />
hervortritt. 2 Die nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 örtlich zuständige Behörde ist<br />
unverzüglich zu unterrichten.<br />
Bay VwVfG Art. 3 a Elektronische Kommunikation<br />
(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der<br />
Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet.<br />
(2) 1 Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht<br />
durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die<br />
elektronische Form ersetzt werden. 2 In diesem Fall ist das elektronische<br />
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem<br />
Signaturgesetz zu versehen. 3 Die Signierung mit einem Pseudonym, das
die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht<br />
ermöglicht, ist nicht zulässig.<br />
(3) 1 Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur<br />
Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe der<br />
für sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit.<br />
2<br />
Macht ein Empfänger geltend, er könne das von der Behörde<br />
übermittelte elektronische Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihm<br />
erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück zu<br />
übermitteln.<br />
Bay VwVfG Art. 3 b Selbsteintritt<br />
(1) Kommt eine staatliche Behörde einer schriftlichen Weisung der<br />
Aufsichtsbehörde nicht fristgerecht nach, so kann der Leiter der<br />
Aufsichtsbehörde an Stelle der angewiesenen Behörde handeln<br />
(Selbsteintritt).<br />
(2) Der Selbsteintritt gegenüber einem Landratsamt als Staatsbehörde ist nur<br />
zulässig, wenn der fachlich zuständige Minister ein sofortiges Handeln aus<br />
wichtigen Gründen des öffentlichen Wohls, insbesondere in Fällen von<br />
überörtlicher oder landesweiter Bedeutung, im Einzelfall für erforderlich<br />
hält und dies gegenüber der Aufsichtsbehörde erklärt.<br />
Abschnitt II Amtshilfe<br />
Bay VwVfG Art. 4 Amtshilfepflicht<br />
(1) Jede Behörde leistet anderen Behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe<br />
(Amtshilfe).<br />
(2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn<br />
1. Behörden einander innerhalb eines bestehenden Weisungsverhältnisses<br />
Hilfe leisten,<br />
2. die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der ersuchten Behörde als<br />
eigene Aufgabe obliegen.<br />
Bay VwVfG Art. 5 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe<br />
(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn sie<br />
1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst vornehmen<br />
kann,<br />
2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die zur Vornahme der<br />
Amtshandlung erforderlichen Dienstkräfte oder Einrichtungen fehlen, die<br />
Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann,<br />
3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis von Tatsachen<br />
angewiesen ist, die ihr unbekannt sind und die sie selbst nicht ermitteln<br />
kann,<br />
4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder sonstige Beweismittel<br />
benötigt, die sich im Besitz der ersuchten Behörde befinden,<br />
5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Aufwand vornehmen<br />
könnte als die ersuchte Behörde.<br />
(2) 1 Die ersuchte Behörde darf Hilfe nicht leisten, wenn<br />
1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist,
2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder eines Landes<br />
erhebliche Nachteile bereitet würden.<br />
2<br />
Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden oder<br />
Akten sowie zur Erteilung von Auskünften nicht verpflichtet, wenn die<br />
Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheimgehalten<br />
werden müssen.<br />
(3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe nicht zu leisten, wenn<br />
1. eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher oder mit wesentlich<br />
geringerem Aufwand leisten kann,<br />
2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand leisten könnte,<br />
3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde<br />
durch die Hilfeleistung die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben ernstlich<br />
gefährden würde.<br />
(4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe nicht deshalb verweigern, weil sie das<br />
Ersuchen aus anderen als den in Absatz 3 genannten Gründen oder weil<br />
sie die mit der Amtshilfe zu verwirklichende Maßnahme für unzweckmäßig<br />
hält.<br />
(5) 1 Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für verpflichtet, so teilt sie<br />
der ersuchenden Behörde ihre Auffassung mit. 2 Besteht diese auf der<br />
Amtshilfe, so entscheidet über die Verpflichtung zur Amtshilfe die<br />
gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbehörde oder, sofern eine solche<br />
nicht besteht, die für die ersuchte Behörde fachlich zuständige<br />
Aufsichtsbehörde.<br />
Bay VwVfG Art. 6 Auswahl der Behörde<br />
Kommen für die Amtshilfe mehrere Behörden in Betracht, so soll nach<br />
Möglichkeit eine Behörde der untersten Verwaltungsstufe des<br />
Verwaltungszweigs ersucht werden, dem die ersuchende Behörde angehört.<br />
Bay VwVfG Art. 7 Durchführung der Amtshilfe<br />
(1) Die Zulässigkeit der Maßnahme, die durch die Amtshilfe verwirklicht<br />
werden soll, richtet sich nach dem für die ersuchende Behörde, die<br />
Durchführung der Amtshilfe nach dem für die ersuchte Behörde geltenden<br />
Recht.<br />
(2) 1 Die ersuchende Behörde trägt gegenüber der ersuchten Behörde die<br />
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der zu treffenden Maßnahme. 2 Die<br />
ersuchte Behörde ist für die Durchführung der Amtshilfe verantwortlich.<br />
Bay VwVfG Art. 8 Kosten der Amtshilfe<br />
(1) 1 Die ersuchende Behörde hat der ersuchten Behörde für die Amtshilfe<br />
keine Verwaltungsgebühr zu entrichten. 2 Besondere Aufwendungen hat<br />
sie der ersuchten Behörde auf Anforderung zu erstatten, wenn sie<br />
fünfundzwanzig Euro übersteigen. 3 Leisten Behörden desselben<br />
Rechtsträgers einander Amtshilfe, so werden die Aufwendungen nicht<br />
erstattet.<br />
(2) Nimmt die ersuchte Behörde zur Durchführung der Amtshilfe eine<br />
kostenpflichtige Amtshandlung vor, so stehen ihr die von einem Dritten
hierfür geschuldeten Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren<br />
und Auslagen) zu.<br />
Abschnitt III Europäische Verwaltungszusammenarbeit<br />
Bay VwVfG Art. 8 a Grundsätze der Hilfeleistung<br />
(1) Jede Behörde leistet Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen<br />
Union auf Ersuchen Hilfe, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der<br />
Europäischen Union geboten ist.<br />
(2) 1 Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union können um<br />
Hilfe ersucht werden, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der<br />
Europäischen Union zugelassen ist. 2 Um Hilfe ist zu ersuchen, soweit dies<br />
nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen Union geboten ist.<br />
(3) Art. 5, 7 und 8 Abs. 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit Rechtsakte<br />
der Europäischen Union nicht entgegenstehen.<br />
Bay VwVfG Art. 8 b Form und Behandlung der Ersuchen<br />
(1) 1 Ersuchen sind in deutscher Sprache an Behörden anderer Mitgliedstaaten<br />
der Europäischen Union zu richten; soweit erforderlich, ist eine<br />
Übersetzung beizufügen. 2 Die Ersuchen sind gemäß den<br />
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben und unter Angabe des maßgeblichen<br />
Rechtsakts zu begründen.<br />
(2) 1 Ersuchen von Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union<br />
dürfen nur erledigt werden, wenn sich ihr Inhalt in deutscher Sprache aus<br />
den Akten ergibt. 2 Soweit erforderlich, soll bei Ersuchen in einer anderen<br />
Sprache von der ersuchenden Behörde eine Übersetzung verlangt werden.<br />
(3) Ersuchen von Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union<br />
können abgelehnt werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß und unter<br />
Angabe des maßgeblichen Rechtsakts begründet sind und die erforderliche<br />
Begründung nach Aufforderung nicht nachgereicht wird.<br />
(4) 1 Einrichtungen und Hilfsmittel der Kommission zur Behandlung von<br />
Ersuchen sollen genutzt werden. 2 Informationen sollen elektronisch<br />
übermittelt werden<br />
Bay VwVfG Art. 8 c Kosten der Hilfeleistung<br />
Ersuchende Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben<br />
Verwaltungsgebühren oder Auslagen nur zu erstatten, soweit dies nach<br />
Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen Union verlangt werden kann.<br />
Bay VwVfG Art. 8 d Mitteilungen von Amts wegen<br />
(1) 1 Die zuständige Behörde teilt den Behörden anderer Mitgliedstaaten der<br />
Europäischen Union und der Kommission Angaben über Sachverhalte und<br />
Personen mit, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der<br />
Europäischen Union geboten ist. 2 Dabei sollen die hierzu eingerichteten<br />
Informationsnetze genutzt werden.<br />
(2) Übermittelt eine Behörde Angaben nach Abs. 1 an die Behörde eines<br />
anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union, unterrichtet sie den
Betroffenen über die Tatsache der Übermittlung, soweit Rechtsakte der<br />
Europäischen Union dies vorsehen; dabei ist auf die Art der Angaben<br />
sowie auf die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der<br />
Übermittlung hinzuweisen.<br />
Bay VwVfG Art. 8 e Anwendbarkeit<br />
(1) 1 Die Regelungen dieses Abschnitts sind mit Inkrafttreten des jeweiligen<br />
Rechtsaktes der Europäischen Gemeinschaft, wenn dieser unmittelbare<br />
Wirkung entfaltet, im Übrigen mit Ablauf der jeweiligen Umsetzungsfrist<br />
anzuwenden. 2 Sie gelten auch im Verhältnis zu den anderen<br />
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,<br />
soweit Rechtsakte der Europäischen Union auch auf diese Staaten<br />
anzuwenden sind.<br />
ZWEITER TEIL Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren<br />
ABSCHNITT I Verfahrensgrundsätze<br />
Bay VwVfG Art. 9 Begriff des Verwaltungsverfahrens<br />
Das Verwaltungsverfahren im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist die nach außen<br />
wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die<br />
Vorbereitung und den Erlaß eines Verwaltungsakts oder auf den Abschluß eines<br />
öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist; es schließt den Erlaß des<br />
Verwaltungsakts oder den Abschluß des öffentlich-rechtlichen Vertrags ein.<br />
Bay VwVfG Art. 10 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens<br />
1 Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit<br />
keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen.<br />
2 Es ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen.<br />
Bay VwVfG Art. 11 Beteiligungsfähigkeit<br />
Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind<br />
1. natürliche und juristische Personen,<br />
2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann,<br />
3. Behörden.<br />
Bay VwVfG Art. 12 Handlungsfähigkeit<br />
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind<br />
1. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig sind,<br />
2. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in der<br />
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, soweit sie für den Gegenstand des<br />
Verfahrens durch Vorschriften des bürgerlichen Rechts als geschäftsfähig<br />
oder durch Vorschriften des öffentlichen Rechts als handlungsfähig<br />
anerkannt sind,<br />
3. juristische Personen und Vereinigungen (Art. 11 Nr. 2) durch ihre<br />
gesetzlichen Vertreter oder durch besonders Beauftragte,<br />
4. Behörden durch ihre Leiter, deren Vertreter oder Beauftragte.
(2) Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs den Gegenstand des Verfahrens, so ist ein geschäftsfähiger<br />
Betreuter nur insoweit zur Vornahme von Verfahrenshandlungen fähig, als<br />
er nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ohne Einwilligung des<br />
Betreuers handeln kann oder durch Vorschriften des öffentlichen Rechts<br />
als handlungsfähig anerkannt ist.<br />
(3) Die §§ 53 und 55 der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend.<br />
Bay VwVfG Art. 13 Beteiligte<br />
(1) Beteiligte sind<br />
1. Antragsteller und Antragsgegner,<br />
2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder<br />
gerichtet hat,<br />
3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag<br />
schließen will oder geschlossen hat,<br />
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren<br />
hinzugezogen worden sind.<br />
(2) 1 Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren<br />
rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt werden<br />
können, als Beteiligte hinzuziehen. 2 Hat der Ausgang des Verfahrens<br />
rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten, so ist dieser auf Antrag als<br />
Beteiligter zu dem Verfahren hinzuzuziehen; soweit er der Behörde<br />
bekannt ist, hat diese ihn vor der Einleitung des Verfahrens zu<br />
benachrichtigen.<br />
(3) Wer anzuhören ist, ohne daß die Voraussetzungen des Absatzes 1<br />
vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter.<br />
Bay VwVfG Art. 14 Bevollmächtigte und Beistände<br />
(1) 1 Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.<br />
2<br />
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren<br />
betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht<br />
etwas anderes ergibt. 3 Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine<br />
Vollmacht schriftlich nachzuweisen. 4 Ein Widerruf der Vollmacht wird der<br />
Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.<br />
(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch<br />
eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen<br />
Vertretung aufgehoben; der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den<br />
Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf<br />
Verlangen schriftlich beizubringen.<br />
(3) 1 Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, so soll sich die<br />
Behörde an ihn wenden. 2 Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden,<br />
soweit er zur Mitwirkung verpflichtet ist. 3 Wendet sich die Behörde an den<br />
Beteiligten, so soll der Bevollmächtigte verständigt werden. 4 Vorschriften<br />
über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben unberührt.<br />
(4) 1 Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem<br />
Beistand erscheinen. 2 Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von<br />
dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich<br />
widerspricht.
(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen<br />
§ 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen.<br />
(6) 1 Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen<br />
werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag<br />
können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen<br />
Vortrag nicht fähig sind. 2 Nicht zurückgewiesen werden können Personen,<br />
die nach § 67 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nrn. 3 bis 7 der<br />
Verwaltungsgerichtsordnung zur Vertretung im verwaltungsgerichtlichen<br />
Verfahren befugt sind.<br />
(7) 1 Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten,<br />
dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, mitzuteilen.<br />
2<br />
Verfahrensverhandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder<br />
Beistands, die dieser nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam.<br />
Bay VwVfG Art. 15 Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten<br />
1 Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder<br />
Geschäftsleitung im Inland hat der Behörde auf Verlangen innerhalb einer<br />
angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten im Inland zu benennen.<br />
2 Unterlässt er dies, so gilt ein an ihn gerichtetes Schriftstück am siebten Tag<br />
nach der Aufgabe zur Post und ein elektronisch übermitteltes Dokument am<br />
dritten Tag nach der Absendung als zugegangen. 3 Dies gilt nicht, wenn<br />
feststeht, dass das Dokument den Empfänger nicht oder zu einem späteren<br />
Zeitpunkt erreicht hat. 4 Auf die Rechtsfolgen der Unterlassung ist der<br />
Beteiligte hinzuweisen.<br />
Bay VwVfG Art. 16 Bestellung eines Vertreters von Amts wegen<br />
(1) Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das Betreuungsgericht, für einen<br />
minderjährigen Beteiligten das Familiengericht auf Ersuchen der Behörde<br />
einen geeigneten Vertreter zu bestellen<br />
1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt ist,<br />
2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt ist oder<br />
der an der Besorgung seiner Angelegenheiten verhindert ist,<br />
3. für einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Geltungsbereich des<br />
Grundgesetzes, wenn er der Aufforderung der Behörde, einen Vertreter zu<br />
bestellen, innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen ist,<br />
4. für einen Beteiligten, der infolge einer psychischen Krankheit oder<br />
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage ist,<br />
in dem Verwaltungsverfahren selbst tätig zu werden,<br />
5. bei herrenlosen Sachen, auf die sich das Verfahren bezieht, zur<br />
Wahrung der sich in bezug auf die Sache ergebenden Rechte und<br />
Pflichten.<br />
(2) Für die Bestellung des Vertreters ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 das<br />
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beteiligte seinen gewöhnlichen<br />
Aufenthalt hat; im übrigen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die<br />
ersuchende Behörde ihren Sitz hat.<br />
(3) 1 Der Vertreter hat gegen den Rechtsträger der Behörde, die um seine<br />
Bestellung ersucht hat, Anspruch auf eine angemessene Vergütung und<br />
auf die Erstattung seiner baren Auslagen. 2 Die Behörde kann von dem
Vertretenen Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen. 3 Sie bestimmt die<br />
Vergütung und stellt die Auslagen und Aufwendungen fest.<br />
(4) Im übrigen gelten für die Bestellung und für das Amt des Vertreters in den<br />
Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 die Vorschriften über die Betreuung, in den<br />
übrigen Fällen die Vorschriften über die Pflegschaft entsprechend.<br />
Bay VwVfG Art. 17 Vertreter bei gleichförmigen Eingaben<br />
(1) 1 Bei Anträgen und Eingaben, die in einem Verwaltungsverfahren von<br />
mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form<br />
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht worden sind<br />
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner<br />
als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen,<br />
seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er<br />
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. 2 Vertreter kann<br />
nur eine natürliche Person sein.<br />
(2) 1 Die Behörde kann gleichförmige Eingaben, die die Angaben nach<br />
Absatz 1 Satz 1 nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift<br />
versehenen Seite enthalten oder dem Erfordernis des Absatzes 1 Satz 2<br />
nicht entsprechen, unberücksichtigt lassen. 2 Will die Behörde so<br />
verfahren, so hat sie dies durch ortsübliche Bekanntmachung mitzuteilen.<br />
3<br />
Die Behörde kann ferner gleichförmige Eingaben insoweit<br />
unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift<br />
nicht oder unleserlich angegeben haben.<br />
(3) 1 Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter oder der Vertretene<br />
dies der Behörde schriftlich erklärt; der Vertreter kann eine solche<br />
Erklärung nur hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. 2 Gibt der Vertretene<br />
eine solche Erklärung ab, so soll er der Behörde zugleich mitteilen, ob er<br />
seine Eingabe aufrechterhält und ob er einen Bevollmächtigten bestellt<br />
hat.<br />
(4) 1 Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die Behörde die<br />
nicht mehr Vertretenen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist<br />
einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. 2 Sind mehr als 50 Personen<br />
aufzufordern, so kann die Behörde die Aufforderung ortsüblich<br />
bekanntmachen. 3 Wird der Aufforderung nicht fristgemäß entsprochen, so<br />
kann die Behörde von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter<br />
bestellen.<br />
Bay VwVfG Art. 18 Vertreter für Beteiligte bei gleichem Interesse<br />
(1) 1 Sind an einem Verwaltungsverfahren mehr als 50 Personen im gleichen<br />
Interesse beteiligt, ohne vertreten zu sein, so kann die Behörde sie<br />
auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen<br />
Vertreter zu bestellen, wenn sonst die ordnungsmäßige Durchführung des<br />
Verwaltungsverfahrens beeinträchtigt wäre. 2 Kommen sie der<br />
Aufforderung nicht fristgemäß nach, so kann die Behörde von Amts wegen<br />
einen gemeinsamen Vertreter bestellen. 3 Vertreter kann nur eine<br />
natürliche Person sein.<br />
(2) 1 Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter oder der Vertretene<br />
dies der Behörde schriftlich erklärt; der Vertreter kann eine solche
Erklärung nur hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. 2 Gibt der Vertretene<br />
eine solche Erklärung ab, so soll er der Behörde zugleich mitteilen, ob er<br />
seine Eingabe aufrechterhält und ob er einen Bevollmächtigten bestellt<br />
hat.<br />
Bay VwVfG Art. 19 Gemeinsame Vorschriften für Vertreter bei<br />
gleichförmigen Eingaben und bei gleichem Interesse<br />
(1) 1 Der Vertreter hat die Interessen der Vertretenen sorgfältig<br />
wahrzunehmen. 2 Er kann alle das Verwaltungsverfahren betreffenden<br />
Verfahrenshandlungen vornehmen. 3 An Weisungen ist er nicht gebunden.<br />
(2) Art. 14 Abs. 5 bis 7 gelten entsprechend.<br />
(3) 1 Der von der Behörde bestellte Vertreter hat gegen deren Rechtsträger<br />
Anspruch auf angemessene Vergütung und auf Erstattung seiner baren<br />
Auslagen. 2 Die Behörde kann von den Vertretenen zu gleichen Anteilen<br />
Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen. 3 Sie bestimmt die Vergütung und<br />
stellt die Auslagen und Aufwendungen fest.<br />
Bay VwVfG Art. 20 Ausgeschlossene Personen<br />
(1) 1 In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,<br />
1. wer selbst Beteiligter ist,<br />
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist,<br />
3. wer einen Beteiligten kraft <strong>Gesetze</strong>s oder Vollmacht allgemein oder in<br />
diesem Verwaltungsverfahren vertritt,<br />
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem<br />
Verfahren vertritt,<br />
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als<br />
Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs<br />
tätig ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte<br />
ist,<br />
6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein<br />
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.<br />
2<br />
Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die<br />
Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann.<br />
3<br />
Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, daß<br />
jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren<br />
gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden.<br />
(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit und für<br />
die Abberufung von ehrenamtlich Tätigen.<br />
(3) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug<br />
unaufschiebbare Maßnahmen treffen.<br />
(4) 1 Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (Art. 88) für ausgeschlossen<br />
oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben<br />
sind, ist dies dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen. 2 Der<br />
Ausschuß entscheidet über den Ausschluß. 3 Der Betroffene darf an dieser<br />
Entscheidung nicht mitwirken. 4 Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der<br />
weiteren Beratung und Beschlußfassung nicht zugegen sein.<br />
(5) 1 Angehörige im Sinn des Absatzes 1 Nrn. 2 und 4 sind:<br />
1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder der Lebenspartner im Sinn des<br />
Lebenspartnerschaftsgesetzes (Lebenspartner),<br />
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,<br />
4. Geschwister,<br />
5. Kinder der Geschwister,<br />
6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister des Ehegatten sowie<br />
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister des Lebenspartners,<br />
7. Geschwister der Eltern,<br />
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis<br />
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden<br />
sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).<br />
2 Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn<br />
1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende<br />
Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,<br />
2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder<br />
Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,<br />
3. im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht,<br />
sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden<br />
sind.<br />
Bay VwVfG Art. 21 Besorgnis der Befangenheit<br />
(1) 1 Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Mißtrauen gegen eine unparteiische<br />
Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem Beteiligten das<br />
Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer in einem<br />
Verwaltungsverfahren für eine Behörde tätig werden soll, den Leiter der<br />
Behörde oder den von diesem Beauftragten zu unterrichten und sich auf<br />
dessen Anordnung der Mitwirkung zu enthalten. 2 Betrifft die Besorgnis der<br />
Befangenheit den Leiter der Behörde, so trifft diese Anordnung die<br />
Aufsichtsbehörde, sofern sich der Behördenleiter nicht selbst einer<br />
Mitwirkung enthält.<br />
(2) Für Mitglieder eines Ausschusses (Art. 88) gilt Art. 20 Abs. 4<br />
entsprechend.<br />
Bay VwVfG Art. 22 Beginn des Verfahrens<br />
1 Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie<br />
ein Verwaltungsverfahren durchführt. 2 Dies gilt nicht, wenn die Behörde auf<br />
Grund von Rechtsvorschriften<br />
1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muß,<br />
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt.<br />
Bay VwVfG Art. 23 Amtssprache<br />
(1) Die Amtssprache ist deutsch.<br />
(2) 1 Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache Anträge gestellt<br />
oder Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll<br />
die Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung verlangen. 2 In<br />
begründeten Fällen kann die Vorlage einer beglaubigten oder von einem<br />
öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer<br />
angefertigten Übersetzung verlangt werden. 3 Wird die verlangte<br />
Übersetzung nicht unverzüglich vorgelegt, so kann die Behörde auf Kosten
des Beteiligten selbst eine Übersetzung beschaffen. 4 Hat die Behörde<br />
Dolmetscher oder Übersetzer herangezogen, erhalten diese in<br />
entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -<br />
entschädigungsgesetzes eine Vergütung.<br />
(3) Soll durch eine Anzeige, einen Antrag oder die Abgabe einer<br />
Willenserklärung eine Frist in Lauf gesetzt werden, innerhalb deren die<br />
Behörde in einer bestimmten Weise tätig werden muß, und gehen diese in<br />
einer fremden Sprache ein, so beginnt der Lauf der Frist erst mit dem<br />
Zeitpunkt, in dem der Behörde eine Übersetzung vorliegt.<br />
(4) 1 Soll durch eine Anzeige, einen Antrag oder eine Willenserklärung, die in<br />
fremder Sprache eingehen, zugunsten eines Beteiligten eine Frist<br />
gegenüber der Behörde gewahrt, ein öffentlich-rechtlicher Anspruch<br />
geltend gemacht oder eine Leistung begehrt werden, so gelten die<br />
Anzeige, der Antrag oder die Willenserklärung als zum Zeitpunkt des<br />
Eingangs bei der Behörde abgegeben, wenn auf Verlangen der Behörde<br />
innerhalb einer von dieser zu setzenden angemessenen Frist eine<br />
Übersetzung vorgelegt wird. 2 Andernfalls ist der Zeitpunkt des Eingangs<br />
der Übersetzung maßgebend, soweit sich nicht aus zwischenstaatlichen<br />
Vereinbarungen etwas anderes ergibt. 3 Auf diese Rechtsfolge ist bei der<br />
Fristsetzung hinzuweisen.<br />
Bay VwVfG Art. 24 Untersuchungsgrundsatz<br />
(1) 1 Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. 2 Sie bestimmt<br />
Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die<br />
Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden.<br />
(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die<br />
Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen.<br />
(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die<br />
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie<br />
die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder<br />
unbegründet hält.<br />
Bay VwVfG Art. 25 Beratung, Auskunft<br />
(1) 1 Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen<br />
oder die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anregen, wenn diese<br />
offensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder<br />
unrichtig abgegeben oder gestellt worden sind. 2 Sie erteilt, soweit<br />
erforderlich, Auskunft über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren<br />
zustehenden Rechte und die ihnen obliegenden Pflichten.<br />
(2) 1 Die Behörde erörtert, soweit erforderlich, bereits vor Stellung eines<br />
Antrags mit dem zukünftigen Antragsteller, welche Nachweise und<br />
Unterlagen von ihm zu erbringen sind und in welcher Weise das Verfahren<br />
beschleunigt werden kann. 2 Soweit es der Verfahrensbeschleunigung<br />
dient, soll sie dem Antragsteller nach Eingang des Antrags unverzüglich<br />
Auskunft über die voraussichtliche Verfahrensdauer und die Vollständigkeit<br />
der Antragsunterlagen geben.
Bay VwVfG Art. 26 Beweismittel<br />
(1) 1 Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem<br />
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. 2 Sie kann<br />
insbesondere<br />
1. Auskünfte jeder Art einholen,<br />
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen oder die<br />
schriftliche oder elektronische Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen<br />
und Zeugen einholen,<br />
3. Urkunden und Akten beiziehen,<br />
4. den Augenschein einnehmen.<br />
(2) 1 Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken.<br />
2<br />
Sie sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel<br />
angeben. 3 Eine weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts<br />
mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen oder<br />
zur Aussage, besteht nur, soweit sie durch Rechtsvorschrift besonders<br />
vorgesehen ist.<br />
(3) 1 Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder<br />
zur Erstattung von Gutachten, wenn sie durch Rechtsvorschriften<br />
vorgesehen ist. 2 Falls die Behörde Zeugen und Sachverständige<br />
herangezogen hat, erhalten diese auf Antrag in entsprechender<br />
Anwendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine<br />
Entschädigung oder Vergütung.<br />
Bay VwVfG Art. 27 Versicherung an Eides Statt<br />
(1) 1 Die Behörde darf bei der Ermittlung des Sachverhalts eine Versicherung<br />
an Eides Statt nur verlangen und abnehmen, wenn die Abnahme der<br />
Versicherung über den betreffenden Gegenstand und in dem betreffenden<br />
Verfahren durch Gesetz oder Rechtsverordnung vorgesehen und die<br />
Behörde durch Rechtsvorschrift für zuständig erklärt worden ist. 2 Eine<br />
Versicherung an Eides Statt soll nur gefordert werden, wenn andere Mittel<br />
zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem Ergebnis<br />
geführt haben oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. 3 Von<br />
eidesunfähigen Personen im Sinn des § 393 der Zivilprozeßordnung darf<br />
eine eidesstattliche Versicherung nicht verlangt werden.<br />
(2) 1 Wird die Versicherung an Eides Statt von einer Behörde zur Niederschrift<br />
aufgenommen, so sind zur Aufnahme nur der Behördenleiter, sein<br />
allgemeiner Vertreter sowie Angehörige des öffentlichen Dienstes befugt,<br />
welche die Befähigung zum Richteramt haben oder die Voraussetzungen<br />
des § 110 Satz 1 des deutschen Richtergesetzes erfüllen. 2 Andere<br />
Angehörige des öffentlichen Dienstes kann der Behördenleiter oder sein<br />
allgemeiner Vertreter hierzu allgemein oder im Einzelfall schriftlich<br />
ermächtigen.<br />
(3) 1 Die Versicherung besteht darin, daß der Versichernde die Richtigkeit<br />
seiner Erklärung über den betreffenden Gegenstand bestätigt und erklärt:<br />
“Ich versichere an Eides Statt, daß ich nach bestem Wissen die reine<br />
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.” 2 Bevollmächtigte und<br />
Beistände sind berechtigt, an der Aufnahme der Versicherung an Eides<br />
Statt teilzunehmen.
(4) 1 Vor der Aufnahme der Versicherung an Eides Statt ist der Versichernde<br />
über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die<br />
strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen<br />
eidesstattlichen Versicherung zu belehren. 2 Die Belehrung ist in der<br />
Niederschrift zu vermerken.<br />
(5) 1 Die Niederschrift hat ferner die Namen der anwesenden Personen sowie<br />
den Ort und den Tag der Niederschrift zu enthalten. 2 Die Niederschrift ist<br />
demjenigen, der die eidesstattliche Versicherung abgibt, zur Genehmigung<br />
vorzulesen oder auf Verlangen zur Durchsicht vorzulegen. 3 Die erteilte<br />
Genehmigung ist zu vermerken und von dem Versichernden zu<br />
unterschreiben. 4 Die Niederschrift ist sodann von demjenigen, der die<br />
Versicherung an Eides Statt aufgenommen hat, sowie von dem<br />
Schriftführer zu unterschreiben.<br />
Bay VwVfG Art. 28 Anhörung Beteiligter<br />
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten<br />
eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die<br />
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.<br />
(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den<br />
Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn<br />
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im<br />
öffentlichen Interesse notwendig erscheint,<br />
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung<br />
maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde,<br />
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem<br />
Antrag oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten<br />
abgewichen werden soll,<br />
4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte<br />
in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer<br />
Einrichtungen erlassen will,<br />
5. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen.<br />
(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse<br />
entgegensteht.<br />
Bay VwVfG Art. 29 Akteneinsicht durch Beteiligte<br />
(1) 1 Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die einzelnen Teile der das<br />
Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur<br />
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen<br />
erforderlich ist. 2 Satz 1 gilt bis zum Abschluß des Verwaltungsverfahrens<br />
nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer<br />
unmittelbaren Vorbereitung. 3 Soweit nach den Art. 17 und 18 eine<br />
Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch auf<br />
Akteneinsicht.<br />
(2) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit<br />
durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde<br />
beeinträchtigt, das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem Wohl des<br />
Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die<br />
Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen
der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen,<br />
geheimgehalten werden müssen.<br />
(3) 1 Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. 2 Organen<br />
der Rechtspflege können die Akten zur Einsicht vorübergehend in ihre<br />
Geschäftsräume hinausgegeben werden. 3 Im Einzelfall kann die Einsicht<br />
auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder<br />
berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im<br />
Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten<br />
führt, gestatten.<br />
Bay VwVfG Art. 30 Geheimhaltung<br />
Die Beteiligten haben Anspruch darauf, daß ihre Geheimnisse, insbesondere<br />
die zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse sowie die<br />
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Behörde nicht unbefugt offenbart<br />
werden.<br />
ABSCHNITT II Fristen, Termine, Wiedereinsetzung<br />
Bay VwVfG Art. 31 Fristen und Termine<br />
(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von Terminen<br />
gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend,<br />
soweit nicht durch die Absätze 2 bis 5 etwas anderes bestimmt ist.<br />
(2) Der Lauf einer Frist, die von einer Behörde gesetzt wird, beginnt mit dem<br />
Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer wenn dem Betroffenen<br />
etwas anderes mitgeteilt wird.<br />
(3) 1 Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag<br />
oder einen Samstag, so endet die Frist mit dem Ablauf des<br />
nächstfolgenden Werktags. 2 Dies gilt nicht, wenn dem Betroffenen unter<br />
Hinweis auf diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist<br />
mitgeteilt worden ist.<br />
(4) Hat eine Behörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum zu<br />
erbringen, so endet dieser Zeitraum auch dann mit dem Ablauf seines<br />
letzten Tags, wenn dieser auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag<br />
oder einen Samstag fällt.<br />
(5) Der von einer Behörde gesetzte Termin ist auch dann einzuhalten, wenn<br />
er auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Samstag fällt.<br />
(6) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonntage, gesetzliche<br />
Feiertage oder Samstage mitgerechnet.<br />
(7) 1 Fristen, die von einer Behörde gesetzt sind, können verlängert werden.<br />
2<br />
Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können sie rückwirkend<br />
verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den<br />
Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 3 Die Behörde<br />
kann die Verlängerung der Frist nach Art. 36 mit einer Nebenbestimmung<br />
verbinden.
Bay VwVfG Art. 32 Wiedereinsetzung in den vorigen <strong>Stand</strong><br />
(1) 1 War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist<br />
einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen <strong>Stand</strong><br />
zu gewähren. 2 Das Verschulden eines Vertreters ist dem Vertretenen<br />
zuzurechnen.<br />
(2) 1 Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses<br />
zu stellen. 2 Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der<br />
Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen.<br />
3 4<br />
Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen. Ist<br />
dies geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt<br />
werden.<br />
(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die<br />
Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt oder die versäumte Handlung<br />
nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist<br />
infolge höherer Gewalt unmöglich war.<br />
(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Behörde, die über<br />
die versäumte Handlung zu befinden hat.<br />
(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift<br />
ergibt, daß sie ausgeschlossen ist.<br />
ABSCHNITT III Amtliche Beglaubigung<br />
Bay VwVfG Art. 33 Beglaubigung von Dokumenten<br />
(1) 1 Jede Behörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst<br />
ausgestellt hat, zu beglaubigen. 2 Darüber hinaus sind die von der<br />
Staatsregierung durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden befugt,<br />
Abschriften zu beglaubigen, wenn die Urschrift von einer Behörde<br />
ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei einer Behörde benötigt<br />
wird, sofern nicht durch Rechtsvorschrift die Erteilung beglaubigter<br />
Abschriften aus amtlichen Registern und Archiven anderen Behörden<br />
ausschließlich vorbehalten ist.<br />
(2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der<br />
Annahme berechtigen, daß der ursprüngliche Inhalt des Schriftstücks,<br />
dessen Abschrift beglaubigt werden soll, geändert worden ist,<br />
insbesondere wenn dieses Schriftstück Lücken, Durchstreichungen,<br />
Einschaltungen, Änderungen, unleserliche Wörter, Zahlen oder Zeichen,<br />
Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen und Zeichen enthält oder<br />
wenn der Zusammenhang eines aus mehreren Blättern bestehenden<br />
Schriftstücks aufgehoben ist.<br />
(3) 1 Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglaubigungsvermerk, der<br />
unter die Abschrift zu setzen ist. 2 Der Vermerk muß enthalten<br />
1. die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt<br />
wird,<br />
2. die Feststellung, daß die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten<br />
Schriftstück übereinstimmt,<br />
3. den Hinweis, daß die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der<br />
angegebenen Behörde erteilt wird, wenn die Urschrift nicht von einer
Behörde ausgestellt worden ist,<br />
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die<br />
Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel.<br />
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigungen von<br />
1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren<br />
hergestellten Vervielfältigungen,<br />
2. auf fototechnischem Weg von Schriftstücken hergestellten Negativen,<br />
die bei einer Behörde aufbewahrt werden,<br />
3. Ausdrucken elektronischer Dokumente,<br />
4. elektronischen Dokumenten,<br />
a) die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden,<br />
b) die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten<br />
elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten haben.<br />
(5) 1 Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach<br />
Absatz 3 Satz 2 bei der Beglaubigung<br />
1. des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer<br />
qualifizierten elektronischen Signatur verbunden ist, die Feststellungen<br />
enthalten,<br />
a) wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist,<br />
b) welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur<br />
ausweist und<br />
c) welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen;<br />
2. eines elektronischen Dokuments den Namen des für die Beglaubigung<br />
zuständigen Bediensteten und die Bezeichnung der Behörde, die die<br />
Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des für die<br />
Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel nach<br />
Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 werden durch eine dauerhaft überprüfbare<br />
qualifizierte elektronische Signatur ersetzt.<br />
2<br />
Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format<br />
als das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbundene<br />
Ausgangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der<br />
Beglaubigungsvermerk zusätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nr. 1 für<br />
das Ausgangsdokument enthalten.<br />
(6) Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie beglaubigt<br />
sind, beglaubigten Abschriften gleich.<br />
Bay VwVfG Art. 34 Beglaubigung von Unterschriften<br />
(1) 1 Die von der Staatsregierung durch Rechtsverordnung bestimmten<br />
Behörden sind befugt, Unterschriften zu beglaubigen, wenn das<br />
unterzeichnete Schriftstück zur Vorlage bei einer Behörde oder bei einer<br />
sonstigen Stelle, der auf Grund einer Rechtsvorschrift das unterzeichnete<br />
Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird. 2 Dies gilt nicht für<br />
1. Unterschriften ohne zugehörigen Text,<br />
2. Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung (§ 129 des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs) bedürfen.<br />
(2) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des<br />
beglaubigenden Bediensteten vollzogen oder anerkannt wird.<br />
(3) 1 Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die<br />
beglaubigt werden soll, anzubringen. 2 Er muß enthalten
1. die Bestätigung, daß die Unterschrift echt ist,<br />
2. die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt<br />
wird, sowie die Angabe, ob sich der für die Beglaubigung zuständige<br />
Bedienstete Gewißheit über diese Person verschafft hat und ob die<br />
Unterschrift in seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist,<br />
3. den Hinweis, daß die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der<br />
angegebenen Behörde oder Stelle bestimmt ist,<br />
4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die<br />
Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel.<br />
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen<br />
entsprechend.<br />
DRITTER TEIL Verwaltungsakt<br />
ABSCHNITT I Zustandekommen des Verwaltungsakts<br />
Bay VwVfG Art. 35 Begriff des Verwaltungsakts<br />
1 Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche<br />
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des<br />
öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen<br />
gerichtet ist. 2 Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen<br />
nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis<br />
richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre<br />
Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.<br />
Bay VwVfG Art. 36 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt<br />
(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer<br />
Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift<br />
zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, daß die gesetzlichen<br />
Voraussetzungen des Verwaltungsakts erfüllt werden.<br />
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach<br />
pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden mit<br />
1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu<br />
einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten<br />
Zeitraum gilt (Befristung),<br />
2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer<br />
Vergünstigung oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines<br />
zukünftigen Ereignisses abhängt (Bedingung),<br />
3. einen Vorbehalt des Widerrufs<br />
oder verbunden werden mit<br />
4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder<br />
Unterlassen vorgeschrieben wird (Auflage),<br />
5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder<br />
Ergänzung einer Auflage.<br />
(3) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsakts nicht<br />
zuwiderlaufen.
Bay VwVfG Art. 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsakts<br />
(1) Ein Verwaltungsakt muß inhaltlich hinreichend bestimmt sein.<br />
(2) 1 Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in<br />
anderer Weise erlassen werden. 2 Ein mündlicher Verwaltungsakt ist<br />
schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes<br />
Interesse besteht und der Betroffene dies unverzüglich verlangt. 3 Ein<br />
elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzungen<br />
schriftlich zu bestätigen; Art. 3 a Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.<br />
(3) 1 Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende<br />
Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe<br />
des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten.<br />
2<br />
Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die<br />
Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form verwendet, muss auch<br />
das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein<br />
zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat die erlassende Behörde<br />
erkennen lassen.<br />
(4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach Art. 3 a Abs. 2 erforderliche<br />
Signatur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit<br />
vorgeschrieben werden.<br />
(5) 1 Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer<br />
Einrichtungen erlassen wird, können abweichend von Absatz 3 Unterschrift<br />
und Namenswiedergabe fehlen. 2 Zur Inhaltsangabe können<br />
Schlüsselzeichen verwendet werden, wenn derjenige, für den der<br />
Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, auf Grund<br />
der dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsakts<br />
eindeutig erkennen kann.<br />
Bay VwVfG Art. 38 Zusicherung<br />
(1) 1 Eine von der zuständigen Behörde erteilte Zusage, einen bestimmten<br />
Verwaltungsakt später zu erlassen oder zu unterlassen (Zusicherung),<br />
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. 2 Ist vor dem Erlaß des<br />
zugesicherten Verwaltungsakts die Anhörung Beteiligter oder die<br />
Mitwirkung einer anderen Behörde oder eines Ausschusses auf Grund<br />
einer Rechtsvorschrift erforderlich, so darf die Zusicherung erst nach<br />
Anhörung der Beteiligten oder nach Mitwirkung dieser Behörde oder des<br />
Ausschusses gegeben werden.<br />
(2) Auf die Unwirksamkeit der Zusicherung finden, unbeschadet des<br />
Absatzes 1 Satz 1, Art. 44, auf die Heilung von Mängeln bei der Anhörung<br />
Beteiligter und der Mitwirkung anderer Behörden oder Ausschüsse Art. 45<br />
Abs. 1 Nrn. 3 bis 5 sowie Abs. 2, auf die Rücknahme Art. 48, auf den<br />
Widerruf, unbeschadet des Absatzes 3, Art. 49 entsprechende<br />
Anwendung.<br />
(3) Ändert sich nach Abgabe der Zusicherung die Sach- oder Rechtslage<br />
derart, daß die Behörde bei Kenntnis der nachträglichen eingetretenen<br />
Änderung die Zusicherung nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen<br />
Gründen nicht hätte geben dürfen, ist die Behörde an die Zusicherung<br />
nicht mehr gebunden.
Bay VwVfG Art. 39 Begründung des Verwaltungsakts<br />
(1) 1 Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch<br />
bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. 2 In der<br />
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe<br />
mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. 3 Die<br />
Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte<br />
erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres<br />
Ermessens ausgegangen ist.<br />
(2) Einer Begründung bedarf es nicht,<br />
1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt<br />
und der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines anderen eingreift,<br />
2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der<br />
von ihm betroffen wird, die Auffassung der Behörde über die Sach- und<br />
Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn ohne<br />
weiteres erkennbar ist,<br />
3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder<br />
Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erläßt und die<br />
Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist,<br />
4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt,<br />
5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekanntgegeben wird.<br />
Bay VwVfG Art. 40 Ermessen<br />
Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr<br />
Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die<br />
gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.<br />
Bay VwVfG Art. 41 Bekanntgabe des Verwaltungsakts<br />
(1) 1 Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekanntzugeben, für den<br />
er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. 2 Ist ein Bevollmächtigter<br />
bestellt, so kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenommen werden.<br />
(2) 1 Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt<br />
wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben.<br />
2<br />
Ein Verwaltungsakt, der im Inland oder in das Ausland elektronisch<br />
übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Absendung als bekannt<br />
gegeben. 3 Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem<br />
späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den<br />
Zugang des Verwaltungsakts und den Zeitpunkt des Zugangs<br />
nachzuweisen.<br />
(3) 1 Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekanntgegeben werden, wenn dies<br />
durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. 2 Eine Allgemeinverfügung darf auch<br />
dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die<br />
Beteiligten untunlich ist.<br />
(4) 1 Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen<br />
Verwaltungsakts wird dadurch bewirkt, daß sein verfügender Teil<br />
ortsüblich bekanntgemacht wird. 2 In der ortsüblichen Bekanntmachung ist<br />
anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen<br />
werden können. 3 Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der<br />
ortsüblichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. 4 In einer
Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch<br />
frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden.<br />
(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsakts mittels<br />
Zustellung bleiben unberührt.<br />
Bay VwVfG Art. 42 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt<br />
1 Die Behörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare<br />
Unrichtigkeiten in einem Verwaltungsakt jederzeit berichtigen. 2 Bei<br />
berechtigtem Interesse des Beteiligten ist zu berichtigen. 3 Die Behörde ist<br />
berechtigt, die Vorlage des Dokuments zu verlangen, das berichtigt werden<br />
soll.<br />
Bay VwVfG Art. 42 a Genehmigungsfiktion<br />
(1) 1 Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf einer für die Entscheidung<br />
festgelegten Frist als erteilt (Genehmigungsfiktion), wenn dies durch<br />
Rechtsvorschrift angeordnet und der Antrag hinreichend bestimmt ist.<br />
2<br />
Die Vorschriften über die Bestandskraft von Verwaltungsakten und über<br />
das Rechtsbehelfsverfahren gelten entsprechend.<br />
(2) 1 Die Frist nach Abs. 1 Satz 1 beträgt drei Monate, soweit durch<br />
Rechtsvorschrift nichts Abweichendes bestimmt ist. 2 Die Frist beginnt mit<br />
Eingang der vollständigen Unterlagen. 3 Sie kann einmal angemessen<br />
verlängert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit<br />
gerechtfertigt ist. 4 Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig<br />
mitzuteilen.<br />
(3) Auf Verlangen ist demjenigen, dem der Verwaltungsakt nach Art. 41<br />
Abs. 1 hätte bekannt gegeben werden müssen, der Eintritt der<br />
Genehmigungsfiktion schriftlich zu bescheinigen.<br />
ABSCHNITT II Bestandskraft des Verwaltungsakts<br />
Bay VwVfG Art. 43 Wirksamkeit des Verwaltungsakts<br />
(1) 1 Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist<br />
oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm<br />
bekanntgegeben wird. 2 Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam,<br />
mit dem er bekanntgegeben wird.<br />
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht<br />
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch<br />
Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist.<br />
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.<br />
Bay VwVfG Art. 44 Nichtigkeit des Verwaltungsakts<br />
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders<br />
schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller<br />
in Betracht kommenden Umstände offenkundig ist.<br />
(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist<br />
ein Verwaltungsakt nichtig,<br />
1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende
Behörde aber nicht erkennen läßt,<br />
2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer<br />
Urkunde erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt,<br />
3. den eine Behörde in bezug auf unbewegliches Vermögen außerhalb<br />
ihres Bezirks oder in bezug auf ein Recht oder Rechtsverhältnis, das an<br />
einen Ort außerhalb ihres Bezirks gebunden ist, erlassen hat, ohne dazu<br />
ermächtigt zu sein,<br />
4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann,<br />
5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Strafoder<br />
Bußgeldtatbestand verwirklicht,<br />
6. der gegen die guten Sitten verstößt.<br />
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil<br />
1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden<br />
sind, außer wenn ein Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt,<br />
2. eine nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 6 ausgeschlossene Person<br />
mitgewirkt hat,<br />
3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuß den für<br />
den Erlaß des Verwaltungsakts vorgeschriebenen Beschluß nicht gefaßt<br />
hat oder nicht beschlußfähig war,<br />
4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen<br />
Behörde unterblieben ist.<br />
(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsakts, so ist er im<br />
ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, daß die Behörde<br />
den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.<br />
(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen;<br />
auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein<br />
berechtigtes Interesse hat.<br />
Bay VwVfG Art. 45 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern<br />
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht den<br />
Verwaltungsakt nach Art. 44 nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn<br />
1. der für den Erlaß des Verwaltungsakts erforderliche Antrag nachträglich<br />
gestellt wird,<br />
2. die erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird,<br />
3. die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachgeholt wird,<br />
4. der Beschluß eines Ausschusses, dessen Mitwirkung für den Erlaß des<br />
Verwaltungsakts erforderlich ist, nachträglich gefaßt wird,<br />
5. die erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde nachgeholt wird.<br />
(2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten<br />
Tatsacheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt<br />
werden.<br />
(3) 1 Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder ist die<br />
erforderliche Anhörung eines Beteiligten vor Erlaß des Verwaltungsakts<br />
unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige Anfechtung des<br />
Verwaltungsakts versäumt worden, so gilt die Versäumung der<br />
Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet. 2 Das für die<br />
Wiedereinsetzungsfrist maßgebende Ereignis tritt im Zeitpunkt der<br />
Nachholung der unterlassenen Verfahrenshandlung ein.
Bay VwVfG Art. 46 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern<br />
Die Aufhebung eines Verwaltungsakts, der nicht nach Art. 44 nichtig ist, kann<br />
nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von<br />
Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit<br />
zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, daß die Verletzung die<br />
Entscheidung in der Sache nicht beeinflußt hat.<br />
Bay VwVfG Art. 47 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsakts<br />
(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen anderen Verwaltungsakt<br />
umgedeutet werden, wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der<br />
erlassenden Behörde in der geschehenen Verfahrensweise und Form<br />
rechtmäßig hätte erlassen werden können und wenn die Voraussetzungen<br />
für dessen Erlaß erfüllt sind.<br />
(2) 1 Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den der fehlerhafte<br />
Verwaltungsakt umzudeuten wäre, der erkennbaren Absicht der<br />
erlassenden Behörde widerspräche oder seine Rechtsfolgen für den<br />
Betroffenen ungünstiger wären als die des fehlerhaften Verwaltungsakts.<br />
2<br />
Eine Umdeutung ist ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte<br />
Verwaltungsakt nicht zurückgenommen werden dürfte.<br />
(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene Entscheidung<br />
ergehen kann, kann nicht in eine Ermessensentscheidung umgedeutet<br />
werden.<br />
(4) Art. 28 ist entsprechend anzuwenden.<br />
Bay VwVfG Art. 48 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts<br />
(1) 1 Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar<br />
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die<br />
Vergangenheit zurückgenommen werden. 2 Ein Verwaltungsakt, der ein<br />
Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat<br />
(begünstigender Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der<br />
Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden.<br />
(2) 1 Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende<br />
Geldleistung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür<br />
Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der<br />
Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat und sein<br />
Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer<br />
Rücknahme schutzwürdig ist. 2 Das Vertrauen ist in der Regel<br />
schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder<br />
eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter<br />
unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. 3 Auf Vertrauen kann<br />
sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er<br />
1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder<br />
Bestechung erwirkt hat,<br />
2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher<br />
Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,<br />
3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts kannte oder infolge grober<br />
Fahrlässigkeit nicht kannte.
4 In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit<br />
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen.<br />
(3) 1 Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt,<br />
zurückgenommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den<br />
Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, daß er auf<br />
den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat, soweit sein Vertrauen<br />
unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist.<br />
2 3<br />
Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der Vermögensnachteil ist jedoch<br />
nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der<br />
Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsakts hat. 4 Der<br />
auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt.<br />
5<br />
Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden;<br />
die Frist beginnt, sobald die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen<br />
hat.<br />
(4) 1 Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines<br />
rechtswidrigen Verwaltungsakts rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur<br />
innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig.<br />
2<br />
Dies gilt nicht im Fall des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1.<br />
(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des<br />
Verwaltungsakts die nach Art. 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann,<br />
wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde<br />
erlassen worden ist.<br />
Bay VwVfG Art. 49 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsakts<br />
(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch<br />
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung<br />
für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt<br />
gleichen Inhalts erneut erlassen werden müßte oder aus anderen Gründen<br />
ein Widerruf unzulässig ist.<br />
(2) 1 Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er<br />
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die<br />
Zukunft nur widerrufen werden,<br />
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im<br />
Verwaltungsakt vorbehalten ist,<br />
2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der<br />
Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist<br />
erfüllt hat,<br />
3. wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen<br />
berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen und wenn ohne den<br />
Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde,<br />
4. wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift<br />
berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der<br />
Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder<br />
auf Grund des Verwaltungsakts noch keine Leistungen empfangen hat,<br />
und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde,<br />
5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu<br />
beseitigen.<br />
2<br />
Art. 48 Abs. 4 gilt entsprechend.
(2 a) 1 Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende<br />
Geldleistung oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten<br />
Zweckes gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er<br />
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die<br />
Vergangenheit widerrufen werden,<br />
1. wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht<br />
mehr für den in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird;<br />
2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der<br />
Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist<br />
erfüllt hat.<br />
2<br />
Art. 48 Abs. 4 gilt entsprechend.<br />
(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des<br />
Widerrufs unwirksam, wenn die Behörde keinen anderen Zeitpunkt<br />
bestimmt.<br />
(4) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des<br />
Verwaltungsakts die nach Art. 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann,<br />
wenn der zu widerrufende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde<br />
erlassen worden ist.<br />
(5) 1 Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2<br />
Nrn. 3 bis 5 widerrufen, so hat die Behörde den Betroffenen auf Antrag für<br />
den Vermögensnachteil zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, daß<br />
er auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat, soweit sein<br />
Vertrauen schutzwürdig ist. 2 Art. 48 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 gelten<br />
entsprechend. 3 Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist der<br />
ordentliche Rechtsweg gegeben.<br />
Bay VwVfG Art. 49 a Erstattung, Verzinsung<br />
(1) 1 Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit<br />
zurückgenommen oder widerrufen worden oder infolge Eintritts einer<br />
auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte<br />
Leistungen zu erstatten. 2 Die zu erstattende Leistung ist durch<br />
schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen.<br />
(2) 1 Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die<br />
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer<br />
ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. 2 Auf den Wegfall der<br />
Bereicherung kann sich der Begünstigte nicht berufen, soweit er die<br />
Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur<br />
Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts<br />
geführt haben.<br />
(3) 1 Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des<br />
Verwaltungsakts an mit sechs v. H. jährlich zu verzinsen. 2 Von der<br />
Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen<br />
werden, wenn der Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum<br />
Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts geführt haben,<br />
nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von<br />
der Behörde festgesetzten Frist leistet.<br />
(4) 1 Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den<br />
bestimmten Zweck verwendet, so können für die Zeit bis zur
zweckentsprechenden Verwendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1 verlangt<br />
werden. 2 Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch<br />
genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen<br />
sind. 3 Art. 49 Abs. 2 a Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.<br />
Bay VwVfG Art. 50 Rücknahme und Widerruf im<br />
Rechtsbehelfsverfahren<br />
Art. 48 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 sowie Art. 49 Abs. 2 bis 3 und 5 gelten<br />
nicht, wenn ein begünstigender Verwaltungsakt, der von einem Dritten<br />
angefochten worden ist, während des Vorverfahrens oder während des<br />
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem<br />
Widerspruch oder der Klage abgeholfen wird.<br />
Bay VwVfG Art. 51 Wiederaufgreifen des Verfahrens<br />
(1) Die Behörde hat auf Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder<br />
Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungsakts zu entscheiden, wenn<br />
1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage<br />
nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat,<br />
2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen günstigere<br />
Entscheidung herbeigeführt haben würden,<br />
3. Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der Zivilprozeßordnung<br />
gegeben sind.<br />
(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene ohne grobes Verschulden<br />
außerstande war, den Grund für das Wiederaufgreifen in dem früheren<br />
Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen.<br />
(3) 1 Der Antrag muß binnen drei Monaten gestellt werden. 2 Die Frist beginnt<br />
mit dem Tag, an dem der Betroffene von dem Grund für das<br />
Wiederaufgreifen Kenntnis erhalten hat.<br />
(4) Über den Antrag entscheidet die nach Art. 3 zuständige Behörde; dies gilt<br />
auch dann, wenn der Verwaltungsakt, dessen Aufhebung oder Änderung<br />
begehrt wird, von einer anderen Behörde erlassen worden ist.<br />
(5) Die Vorschriften des Art. 48 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 49 Abs. 1 bleiben<br />
unberührt.<br />
Bay VwVfG Art. 52 Rückgabe von Urkunden und Sachen<br />
1 Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen oder<br />
ist seine Wirksamkeit aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr<br />
gegeben, so kann die Behörde die auf Grund dieses Verwaltungsakts erteilten<br />
Urkunden oder Sachen, die zum Nachweis der Rechte aus dem Verwaltungsakt<br />
oder zu deren Ausübung bestimmt sind, zurückfordern. 2 Der Inhaber und,<br />
sofern er nicht der Besitzer ist, auch der Besitzer dieser Urkunden oder Sachen<br />
sind zu ihrer Herausgabe verpflichtet. 3 Der Inhaber oder der Besitzer kann<br />
jedoch verlangen, daß ihm die Urkunden oder Sachen wieder ausgehändigt<br />
werden, nachdem sie von der Behörde als ungültig gekennzeichnet sind; dies<br />
gilt nicht bei Sachen, bei denen eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht mit<br />
der erforderlichen Offensichtlichkeit oder Dauerhaftigkeit möglich ist.
ABSCHNITT III Einfluß des Verwaltungsakts auf Verjährung und<br />
Erlöschen<br />
Bay VwVfG Art. 53 Hemmung der Verjährung und des Erlöschens durch<br />
Verwaltungsakt<br />
(1) 1 Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung oder Durchsetzung des<br />
Anspruchs eines öffentlich-rechtlichen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt<br />
die Verjährung und das Erlöschen dieses Anspruchs. 2 Die Hemmung endet<br />
mit Eintritt der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts oder sechs Monate<br />
nach seiner anderweitigen Erledigung.<br />
(2) 1 Wird ein Verwaltungsakt im Sinn des Absatzes 1 unanfechtbar, beginnt<br />
eine Verjährungs- und Erlöschungsfrist von 30 Jahren. 2 Soweit der<br />
Verwaltungsakt einen Anspruch auf künftig fällig werdende regelmäßig<br />
wiederkehrende Leistungen zum Inhalt hat, bleibt es bei der für diesen<br />
Anspruch geltenden Verjährungs- und Erlöschensfrist.<br />
VIERTER TEIL Öffentlich-rechtlicher Vertrag<br />
Bay VwVfG Art. 54 Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrags<br />
1 Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch<br />
Vertrag begründet, geändert oder aufgehoben werden (öffentlich-rechtlicher<br />
Vertrag), soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 2 Insbesondere kann<br />
die Behörde, anstatt einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlichrechtlichen<br />
Vertrag mit demjenigen schließen, an den sie sonst den<br />
Verwaltungsakt richten würde.<br />
Bay VwVfG Art. 55 Vergleichsvertrag<br />
Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinn des Art. 54 Satz 2, durch den eine bei<br />
verständiger Würdigung des Sachverhalts oder der Rechtslage bestehende<br />
Ungewißheit durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird (Vergleich), kann<br />
geschlossen werden, wenn die Behörde den Abschluß des Vergleichs zur<br />
Beseitigung der Ungewißheit nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig<br />
hält.<br />
Bay VwVfG Art. 56 Austauschvertrag<br />
(1) 1 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinn des Art. 54 Satz 2, in dem sich<br />
der Vertragspartner der Behörde zu einer Gegenleistung verpflichtet, kann<br />
geschlossen werden, wenn die Gegenleistung für einen bestimmten Zweck<br />
im Vertrag vereinbart wird und der Behörde zur Erfüllung ihrer<br />
öffentlichen Aufgaben dient. 2 Die Gegenleistung muß den gesamten<br />
Umständen nach angemessen sein und im sachlichen Zusammenhang mit<br />
der vertraglichen Leistung der Behörde stehen.<br />
(2) Besteht auf die Leistung der Behörde ein Anspruch, so kann nur eine<br />
solche Gegenleistung vereinbart werden, die bei Erlaß eines<br />
Verwaltungsakts Inhalt einer Nebenbestimmung nach Art. 36 sein könnte.<br />
Bay VwVfG Art. 57 Schriftform<br />
Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist schriftlich zu schließen, soweit nicht durch<br />
Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben ist.
Bay VwVfG Art. 58 Zustimmung von Dritten und Behörden<br />
(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der in Rechte eines Dritten eingreift,<br />
wird erst wirksam, wenn der Dritte schriftlich zustimmt.<br />
(2) Wird anstatt eines Verwaltungsakts, bei dessen Erlaß nach einer<br />
Rechtsvorschrift die Genehmigung, die Zustimmung oder das<br />
Einvernehmen einer anderen Behörde erforderlich ist, ein Vertrag<br />
geschlossen, so wird dieser erst wirksam, nachdem die andere Behörde in<br />
der vorgeschriebenen Form mitgewirkt hat.<br />
Bay VwVfG Art. 59 Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrags<br />
(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus<br />
der entsprechenden Anwendung von Vorschriften des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuchs ergibt.<br />
(2) Ein Vertrag im Sinn des Art. 54 Satz 2 ist ferner nichtig, wenn<br />
1. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nichtig wäre,<br />
2. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines<br />
Verfahrens- oder Formfehlers im Sinn des Art. 46 rechtswidrig wäre und<br />
dies den Vertragschließenden bekannt war,<br />
3. die Voraussetzungen zum Abschluß eines Vergleichsvertrags nicht<br />
vorlagen und ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur<br />
wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im Sinn des Art. 46<br />
rechtswidrig wäre,<br />
4. sich die Behörde eine nach Art. 56 unzulässige Gegenleistung<br />
versprechen läßt.<br />
(3) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Vertrags, so ist er im ganzen<br />
nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, daß er auch ohne den nichtigen Teil<br />
geschlossen worden wäre.<br />
Bay VwVfG Art. 60 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen<br />
(1) 1 Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts<br />
maßgebend gewesen sind, sich seit Abschluß des Vertrags so wesentlich<br />
geändert, daß einer Vertragspartei das Festhalten an der ursprünglichen<br />
vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei<br />
eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse<br />
verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht möglich oder einer<br />
Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen. 2 Die Behörde<br />
kann den Vertrag auch kündigen, um schwere Nachteile für das<br />
Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen.<br />
(2) 1 Die Kündigung bedarf der Schriftform, soweit nicht durch<br />
Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben ist. 2 Sie soll begründet<br />
werden.<br />
Bay VwVfG Art. 61 Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung<br />
(1) 1 Jeder Vertragschließende kann sich der sofortigen Vollstreckung aus<br />
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinn des Art. 54 Satz 2<br />
unterwerfen. 2 Die Behörde muß hierbei von dem Behördenleiter, seinem<br />
allgemeinen Vertreter oder einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes,
der die Befähigung zum Richteramt hat oder die Voraussetzungen des<br />
§ 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllt, vertreten werden.<br />
(2) 1 Auf öffentlich-rechtliche Verträge im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 ist der<br />
Zweite Hauptteil des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und<br />
Vollstreckungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 2 Will eine natürliche<br />
oder juristische Person des Privatrechts oder eine nichtrechtsfähige<br />
Vereinigung die Vollstreckung wegen einer Geldforderung betreiben, so<br />
sind § 170 Abs. 1 bis 3 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)<br />
entsprechend anzuwenden. 3 Richtet sich die Vollstreckung wegen der<br />
Erzwingung einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gegen eine<br />
Behörde, so ist § 172 VwGO entsprechend anzuwenden.<br />
Bay VwVfG Art. 62 Ergänzende Anwendung von Vorschriften<br />
1 Soweit sich aus den Art. 54 bis 61 nichts Abweichendes ergibt, gelten die<br />
übrigen Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s. 2 Ergänzend gelten die Vorschriften des<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.<br />
FÜNFTER TEIL Besondere Verfahrensarten<br />
ABSCHNITT I Förmliches Verwaltungsverfahren<br />
Bay VwVfG Art. 63 Anwendung der Vorschriften über das förmliche<br />
Verwaltungsverfahren<br />
(1) Das förmliche Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz findet statt,<br />
wenn es durch Rechtsvorschrift angeordnet ist.<br />
(2) Für das förmliche Verwaltungsverfahren gelten die Art. 64 bis 71 und,<br />
soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften<br />
dieses <strong>Gesetze</strong>s.<br />
(3) 1 Die Mitteilung nach Art. 17 Abs. 2 Satz 2 und die Aufforderung nach<br />
Art. 17 Abs. 4 Satz 2 sind im förmlichen Verwaltungsverfahren öffentlich<br />
bekanntzumachen. 2 Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch<br />
bewirkt, daß die Behörde die Mitteilung oder die Aufforderung in ihrem<br />
amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem in örtlichen<br />
Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich die<br />
Entscheidung voraussichtlich auswirken wird, bekanntmacht.<br />
Bay VwVfG Art. 64 Form des Antrags<br />
Setzt das förmliche Verwaltungsverfahren einen Antrag voraus, so ist er<br />
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde zu stellen.<br />
Bay VwVfG Art. 65 Mitwirkung von Zeugen und Sachverständigen<br />
(1) 1 Im förmlichen Verwaltungsverfahren sind Zeugen zur Aussage und<br />
Sachverständige zur Erstattung von Gutachten verpflichtet. 2 Die<br />
Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Pflicht, als Zeuge<br />
auszusagen oder als Sachverständiger ein Gutachten zu erstatten, über<br />
die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von<br />
Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Zeugen oder Sachverständige<br />
gelten entsprechend.
(2) 1 Verweigern Zeugen oder Sachverständige ohne Vorliegen eines der in<br />
den §§ 376, 383 bis 385 und 408 der Zivilprozeßordnung bezeichneten<br />
Gründe die Aussage oder die Erstattung des Gutachtens, so kann die<br />
Behörde das für den Wohnsitz oder den Aufenthaltsort des Zeugen oder<br />
des Sachverständigen zuständige Verwaltungsgericht um die Vernehmung<br />
ersuchen. 2 Befindet sich der Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des Zeugen<br />
oder des Sachverständigen nicht am Sitz eines Verwaltungsgerichts oder<br />
einer besonders errichteten Kammer, so kann auch das zuständige<br />
Amtsgericht um die Vernehmung ersucht werden. 3 In dem Ersuchen hat<br />
die Behörde den Gegenstand der Vernehmung darzulegen sowie die<br />
Namen und Anschriften der Beteiligten anzugeben. 4 Das Gericht hat die<br />
Beteiligten von den Beweisterminen zu benachrichtigen.<br />
(3) Hält die Behörde mit Rücksicht auf die Bedeutung der Aussage eines<br />
Zeugen oder des Gutachtens eines Sachverständigen oder zur<br />
Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage die Beeidigung für<br />
geboten, so kann sie das nach Absatz 2 zuständige Gericht um die eidliche<br />
Vernehmung ersuchen.<br />
(4) Das Gericht entscheidet über die Rechtmäßigkeit einer Verweigerung des<br />
Zeugnisses, des Gutachtens oder der Eidesleistung.<br />
(5) Ein Ersuchen nach den Absätzen 2 oder 3 an das Gericht darf nur von dem<br />
Behördenleiter, seinem allgemeinen Vertreter oder einem Angehörigen des<br />
öffentlichen Dienstes gestellt werden, der die Befähigung zum Richteramt<br />
hat oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen<br />
Richtergesetzes erfüllt.<br />
(6) § 180 VwGO findet entsprechende Anwendung.<br />
Bay VwVfG Art. 66 Verpflichtung zur Anhörung von Beteiligten<br />
(1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren ist den Beteiligten Gelegenheit zu<br />
geben, sich vor der Entscheidung zu äußern.<br />
(2) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, der Vernehmung von Zeugen<br />
und Sachverständigen und der Einnahme des Augenscheins beizuwohnen<br />
und hierbei sachdienliche Fragen zu stellen; ein schriftlich oder<br />
elektronisch vorliegendes Gutachten soll ihnen zugänglich gemacht<br />
werden.<br />
Bay VwVfG Art. 67 Erfordernis der mündlichen Verhandlung<br />
(1) 1 Die Behörde entscheidet nach mündlicher Verhandlung. 2 Hierzu sind die<br />
Beteiligten mit angemessener Frist schriftlich zu laden. 3 Bei der Ladung ist<br />
darauf hinzuweisen, daß bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn<br />
verhandelt und entschieden werden kann. 4 Sind mehr als 50 Ladungen<br />
vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt<br />
werden. 5 Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß der<br />
Verhandlungstermin mindestens zwei Wochen vorher im amtlichen<br />
Veröffentlichungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen<br />
Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich die<br />
Entscheidung voraussichtlich auswirken wird, mit dem Hinweis nach<br />
Satz 3 bekanntgemacht wird. 6 Maßgebend für die Frist nach Satz 5 ist die<br />
Bekanntgabe im amtlichen Veröffentlichungsblatt.
(2) Die Behörde kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn<br />
1. einem Antrag im Einvernehmen mit allen Beteiligten in vollem Umfang<br />
entsprochen wird,<br />
2. kein Beteiligter innerhalb einer hierfür gesetzten Frist Einwendungen<br />
gegen die vorgesehene Maßnahme erhoben hat,<br />
3. die Behörde den Beteiligten mitgeteilt hat, daß sie beabsichtige, ohne<br />
mündliche Verhandlung zu entscheiden, und kein Beteiligter innerhalb<br />
einer hierfür gesetzten Frist Einwendungen dagegen erhoben hat,<br />
4. alle Beteiligten auf sie verzichtet haben,<br />
5. wegen Gefahr im Verzug eine sofortige Entscheidung notwendig ist.<br />
(3) Die Behörde soll das Verfahren so fördern, daß es möglichst in einem<br />
Verhandlungstermin erledigt werden kann.<br />
Bay VwVfG Art. 68 Verlauf der mündlichen Verhandlung<br />
(1) 1 Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. 2 An ihr können Vertreter<br />
der Aufsichtsbehörden und Personen, die bei der Behörde zur Ausbildung<br />
beschäftigt sind, teilnehmen. 3 Anderen Personen kann der<br />
Verhandlungsleiter die Anwesenheit gestatten, wenn kein Beteiligter<br />
widerspricht.<br />
(2) 1 Der Verhandlungsleiter hat die Sache mit den Beteiligten zu erörtern. 2 Er<br />
hat darauf hinzuwirken, daß unklare Anträge erläutert, sachdienliche<br />
Anträge gestellt, ungenügende Angaben ergänzt sowie alle für die<br />
Feststellung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben<br />
werden.<br />
(3) 1 Der Verhandlungsleiter ist für die Ordnung verantwortlich. 2 Er kann<br />
Personen, die seine Anordnungen nicht befolgen, entfernen lassen. 3 Die<br />
Verhandlung kann ohne diese Personen fortgesetzt werden.<br />
(4) 1 Über die mündliche Verhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen. 2 Die<br />
Niederschrift muß Angaben enthalten über<br />
1. den Ort und den Tag der Verhandlung,<br />
2. die Namen des Verhandlungsleiters, der erschienenen Beteiligten,<br />
Zeugen und Sachverständigen,<br />
3. den behandelten Verfahrensgegenstand und die gestellten Anträge,<br />
4. den wesentlichen Inhalt der Aussagen der Zeugen und<br />
Sachverständigen,<br />
5. das Ergebnis eines Augenscheins.<br />
3<br />
Die Niederschrift ist von dem Verhandlungsleiter und, soweit ein<br />
Schriftführer hinzugezogen worden ist, auch von diesem zu unterzeichnen.<br />
4<br />
Der Aufnahme in die Verhandlungsniederschrift steht die Aufnahme in<br />
eine Schrift gleich, die ihr als Anlage beigefügt und als solche bezeichnet<br />
ist; auf die Anlage ist in der Verhandlungsniederschrift hinzuweisen.<br />
Bay VwVfG Art. 69 Entscheidung<br />
(1) Die Behörde entscheidet unter Würdigung des Gesamtergebnisses des<br />
Verfahrens.<br />
(2) 1 Verwaltungsakte, die das förmliche Verfahren abschließen, sind<br />
schriftlich zu erlassen, schriftlich zu begründen und den Beteiligten<br />
zuzustellen; in den Fällen des Art. 39 Abs. 2 Nrn. 1 und 3 bedarf es einer
Begründung nicht. 2 Ein elektronischer Verwaltungsakt nach Satz 1 ist mit<br />
einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur zu<br />
versehen. 3 Sind mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen, so können sie<br />
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 4 Die öffentliche<br />
Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß der verfügende Teil des<br />
Verwaltungsakts und die Rechtsbehelfsbelehrung im amtlichen<br />
Veröffentlichungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen<br />
Tageszeitungen bekanntgemacht werden, die in dem Bereich verbreitet<br />
sind, in dem sich die Entscheidung voraussichtlich auswirken wird. 5 Der<br />
Verwaltungsakt gilt mit dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tag der<br />
Bekanntmachung in dem amtlichen Veröffentlichungsblatt zwei Wochen<br />
verstrichen sind; hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. 6 Nach<br />
der öffentlichen Bekanntmachung kann der Verwaltungsakt bis zum Ablauf<br />
der Rechtsbehelfsfrist von den Beteiligten schriftlich oder elektronisch<br />
angefordert werden; hierauf ist in der Bekanntmachung gleichfalls<br />
hinzuweisen.<br />
(3) 1 Wird das förmliche Verwaltungsverfahren auf andere Weise<br />
abgeschlossen, so sind die Beteiligten hiervon zu benachrichtigen. 2 Sind<br />
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch<br />
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; Absatz 2 Satz 4 gilt<br />
entsprechend.<br />
Bay VwVfG Art. 70 Anfechtung der Entscheidung<br />
Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die einen im förmlichen<br />
Verwaltungsverfahren erlassenen Verwaltungsakt zum Gegenstand hat, bedarf<br />
es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren.<br />
Bay VwVfG Art. 71 Besondere Vorschriften für das förmliche Verfahren<br />
vor Ausschüssen<br />
(1) 1 Findet das förmliche Verwaltungsverfahren vor einem Ausschuß (Art. 88)<br />
statt, so hat jedes Mitglied das Recht, sachdienliche Fragen zu stellen.<br />
2<br />
Wird eine Frage von einem Beteiligten beanstandet, so entscheidet der<br />
Ausschuß über ihre Zulässigkeit.<br />
(2) 1 Bei der Beratung und Abstimmung dürfen nur Ausschußmitglieder<br />
zugegen sein, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben.<br />
2<br />
Ferner dürfen Personen zugegen sein, die bei der Behörde, bei der der<br />
Ausschuß gebildet ist, zur Ausbildung beschäftigt sind, soweit der<br />
Vorsitzende ihre Anwesenheit gestattet. 3 Die Abstimmungsergebnisse sind<br />
festzuhalten.<br />
(3) 1 Jeder Beteiligte kann ein Mitglied des Ausschusses ablehnen, das in<br />
diesem Verwaltungsverfahren nicht tätig werden darf (Art. 20) oder bei<br />
dem die Besorgnis der Befangenheit besteht (Art. 21). 2 Eine Ablehnung<br />
vor der mündlichen Verhandlung ist schriftlich oder zur Niederschrift zu<br />
erklären. 3 Die Erklärung ist unzulässig, wenn sich der Beteiligte, ohne den<br />
ihm bekannten Ablehnungsgrund geltend zu machen, in die mündliche<br />
Verhandlung eingelassen hat. 4 Für die Entscheidung über die Ablehnung<br />
gelten Art. 20 Abs. 4 Sätze 2 bis 4.
ABSCHNITT I a Verfahren über eine einheitliche Stelle<br />
Bay VwVfG Art. 71 a Anwendbarkeit<br />
(1) Ist durch Rechtsvorschrift angeordnet, dass ein Verwaltungsverfahren<br />
über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden kann, so gelten die<br />
Vorschriften dieses Abschnitts und, soweit sich aus ihnen nichts<br />
Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s.<br />
(2) Der zuständigen Behörde obliegen die Pflichten aus Art. 71 b Abs. 3, 4<br />
und 6, Art. 71 c Abs. 2 und Art. 71 e auch dann, wenn sich der<br />
Antragsteller oder Anzeigepflichtige unmittelbar an die zuständige Behörde<br />
wendet.<br />
Bay VwVfG Art. 71 b Verfahren<br />
(1) Die einheitliche Stelle nimmt Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und<br />
Unterlagen entgegen und leitet sie unverzüglich an die zuständigen<br />
Behörden weiter.<br />
(2) 1 Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen und Unterlagen gelten am dritten<br />
Tag nach Eingang bei der einheitlichen Stelle als bei der zuständigen<br />
Behörde eingegangen. 2 Fristen werden mit Eingang bei der einheitlichen<br />
Stelle gewahrt.<br />
(3) 1 Soll durch die Anzeige, den Antrag oder die Abgabe einer<br />
Willenserklärung eine Frist in Lauf gesetzt werden, innerhalb deren die<br />
zuständige Behörde tätig werden muss, stellt die zuständige Behörde eine<br />
Empfangsbestätigung aus. 2 In der Empfangsbestätigung ist das Datum<br />
des Eingangs bei der einheitlichen Stelle mitzuteilen und auf die Frist, die<br />
Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs und auf eine an den<br />
Fristablauf geknüpfte Rechtsfolge sowie auf die verfügbaren Rechtsbehelfe<br />
hinzuweisen.<br />
(4) 1 Ist die Anzeige oder der Antrag unvollständig, teilt die zuständige<br />
Behörde unverzüglich mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. 2 Die<br />
Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Abs. 3 erst<br />
mit Eingang der vollständigen Unterlagen beginnt. 3 Das Datum des<br />
Eingangs der nachgereichten Unterlagen bei der einheitlichen Stelle ist<br />
mitzuteilen.<br />
(5) 1 Soweit die einheitliche Stelle zur Verfahrensabwicklung in Anspruch<br />
genommen wird, sollen Mitteilungen der zuständigen Behörde an den<br />
Antragsteller oder Anzeigepflichtigen über sie weitergegeben werden.<br />
2<br />
Verwaltungsakte werden auf Verlangen desjenigen, an den sich der<br />
Verwaltungsakt richtet, von der zuständigen Behörde unmittelbar bekannt<br />
gegeben.<br />
(6) 1 Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post in das Ausland<br />
übermittelt wird, gilt einen Monat nach Aufgabe zur Post als bekannt<br />
gegeben. 2 Art. 41 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.<br />
Bay VwVfG Art. 71 c Informationspflichten<br />
(1) 1 Die einheitliche Stelle erteilt auf Anfrage unverzüglich Auskunft über die<br />
maßgeblichen Vorschriften, die zuständigen Behörden, den Zugang zu den<br />
öffentlichen Registern und Datenbanken, die zustehenden
Verfahrensrechte und die Einrichtungen, die den Antragsteller oder<br />
Anzeigepflichtigen bei der Aufnahme oder Ausübung seiner Tätigkeit<br />
unterstützen. 2 Sie teilt unverzüglich mit, wenn eine Anfrage zu<br />
unbestimmt ist.<br />
(2) 1 Die zuständigen Behörden erteilen auf Anfrage unverzüglich Auskunft<br />
über die maßgeblichen Vorschriften und deren gewöhnliche Auslegung.<br />
2<br />
Nach Art. 25 erforderliche Anregungen und Auskünfte werden<br />
unverzüglich gegeben.<br />
Bay VwVfG Art. 71 d Gegenseitige Unterstützung<br />
1 Die einheitliche Stelle und die zuständigen Behörden wirken gemeinsam auf<br />
eine ordnungsgemäße und zügige Verfahrensabwicklung hin; die Pflicht zur<br />
Unterstützung besteht auch gegenüber einheitlichen Stellen oder sonstigen<br />
Behörden des Bundes oder anderer Länder. 2 Die zuständigen Behörden stellen<br />
der einheitlichen Stelle insbesondere die erforderlichen Informationen zum<br />
Verfahrensstand zur Verfügung.<br />
Bay VwVfG Art. 71 e Elektronisches Verfahren<br />
1 Das Verfahren nach diesem Abschnitt wird auf Verlangen in elektronischer<br />
Form abgewickelt. 2 Art. 3 a Abs. 2 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 bleiben<br />
unberührt.<br />
ABSCHNITT II Planfeststellungsverfahren<br />
Bay VwVfG Art. 72 Anwendung der Vorschriften über das<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
(1) Ist ein Planfeststellungsverfahren durch Rechtsvorschrift angeordnet, so<br />
gelten hierfür die Art. 73 bis 78 und, soweit sich aus ihnen nichts<br />
Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s; Art. 51 ist<br />
nicht anzuwenden, Art. 29 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß<br />
Akteneinsicht nach pflichtgemäßem Ermessen zu gewähren ist.<br />
(2) 1 Die Mitteilung nach Art. 17 Abs. 2 Satz 2 und die Aufforderung nach<br />
Art. 17 Abs. 4 Satz 2 sind im Planfeststellungsverfahren öffentlich<br />
bekanntzumachen. 2 Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch<br />
bewirkt, daß die Behörde die Mitteilung oder die Aufforderung in ihrem<br />
amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem in örtlichen<br />
Tageszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das<br />
Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, bekanntmacht.<br />
Bay VwVfG Art. 73 Anhörungsverfahren<br />
(1) 1 Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur<br />
Durchführung des Anhörungsverfahrens einzureichen. 2 Der Plan besteht<br />
aus den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlaß<br />
und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen<br />
erkennen lassen.<br />
(2) Innerhalb eines Monats nach Zugang des vollständigen Plans fordert die<br />
Anhörungsbehörde die Behörden, deren Aufgabenbereich durch das<br />
Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme auf und veranlaßt, daß der
Plan in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben auswirkt, ausgelegt<br />
wird.<br />
(3) 1 Die Gemeinden nach Absatz 2 haben den Plan innerhalb von drei Wochen<br />
nach Zugang für die Dauer eines Monats zur Einsicht auszulegen. 2 Auf<br />
eine Auslegung kann verzichtet werden, wenn der Kreis der Betroffenen<br />
bekannt ist und ihnen innerhalb angemessener Frist Gelegenheit gegeben<br />
wird, den Plan einzusehen.<br />
(3 a) 1 Die Behörden nach Absatz 2 haben ihre Stellungnahme innerhalb einer<br />
von der Anhörungsbehörde zu setzenden Frist abzugeben, die drei Monate<br />
nicht überschreiten darf. 2 Nach dem Erörterungstermin eingehende<br />
Stellungnahmen werden nicht mehr berücksichtigt, es sei denn, die<br />
vorgebrachten Belange sind der Planfeststellungsbehörde bereits bekannt<br />
oder hätten ihr bekannt sein müssen oder sind für die Rechtmäßigkeit der<br />
Entscheidung von Bedeutung.<br />
(4) 1 Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis<br />
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur<br />
Niederschrift bei der Anhörungsbehörde oder bei der Gemeinde<br />
Einwendungen gegen den Plan erheben. 2 Im Fall des Absatzes 3 Satz 2<br />
bestimmt die Anhörungsbehörde die Einwendungsfrist. 3 Mit Ablauf der<br />
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf<br />
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 4 Hierauf ist in der<br />
Bekanntmachung der Auslegung oder bei der Bekanntgabe der<br />
Einwendungsfrist hinzuweisen.<br />
(5) 1 Die Gemeinden, in denen der Plan auszulegen ist, haben die Auslegung<br />
vorher ortsüblich bekanntzumachen. 2 In der Bekanntmachung ist darauf<br />
hinzuweisen,<br />
1. wo und in welchem Zeitraum der Plan zur Einsicht ausgelegt ist,<br />
2. daß etwaige Einwendungen bei den in der Bekanntmachung zu<br />
bezeichnenden Stellen innerhalb der Einwendungsfrist vorzubringen sind,<br />
3. daß bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch<br />
ohne ihn verhandelt werden kann,<br />
4. daß<br />
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem<br />
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt<br />
werden können,<br />
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch<br />
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann,<br />
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen<br />
sind.<br />
3<br />
Nicht ortsansässige Betroffene, deren Person und Aufenthalt bekannt<br />
sind oder sich innerhalb angemessener Frist ermitteln lassen, sollen auf<br />
Veranlassung der Anhörungsbehörde von der Auslegung mit dem Hinweis<br />
nach Satz 2 benachrichtigt werden.<br />
(6) 1 Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die<br />
rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die<br />
Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des<br />
Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die<br />
Einwendungen erhoben haben, zu erörtern. 2 Der Erörterungstermin ist<br />
mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen. 3 Die
Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen<br />
erhoben haben, sind von dem Erörterungstermin zu benachrichtigen.<br />
4<br />
Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des<br />
Vorhabens mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können<br />
diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt<br />
werden. 5 Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß<br />
abweichend von Satz 2 der Erörterungstermin im amtlichen<br />
Veröffentlichungsblatt der Anhörungsbehörde und außerdem in örtlichen<br />
Tageszeitungen bekanntgemacht wird, die in dem Bereich verbreitet sind,<br />
in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; maßgebend für<br />
die Frist nach Satz 2 ist die Bekanntgabe im amtlichen<br />
Veröffentlichungsblatt. 6 Im übrigen gelten für die Erörterung die<br />
Vorschriften über die mündliche Verhandlung im förmlichen<br />
Verwaltungsverfahren (Art. 67 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Nrn. 1 und 4 und<br />
Abs. 3, Art. 68) entsprechend. 7 Die Erörterung soll innerhalb von drei<br />
Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abgeschlossen werden.<br />
(7) Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 6 Sätze 2 bis 5 kann der<br />
Erörterungstermin bereits in der Bekanntmachung nach Absatz 5 Satz 2<br />
bestimmt werden.<br />
(8) 1 Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und werden dadurch der<br />
Aufgabenbereich einer Behörde oder Belange Dritter erstmalig oder<br />
stärker als bisher berührt, so ist diesen Gelegenheit zu geben, innerhalb<br />
von zwei Wochen zur Änderung Stellung zu nehmen und Einwendungen zu<br />
erheben. 2 Wirkt sich die Änderung auf das Gebiet einer anderen<br />
Gemeinde aus, so ist der geänderte Plan in dieser Gemeinde auszulegen;<br />
die Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend.<br />
(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine<br />
Stellungnahme ab und leitet diese möglichst innerhalb eines Monats nach<br />
Abschluß der Erörterung mit dem Plan, den Stellungnahmen der Behörden<br />
und den nicht erledigten Einwendungen der Planfeststellungsbehörde zu.<br />
Bay VwVfG Art. 74 Planfeststellungsbeschluß, Plangenehmigung<br />
(1) 1 Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest<br />
(Planfeststellungsbeschluß). 2 Die Vorschriften über die Entscheidung und<br />
die Anfechtung der Entscheidung im förmlichen Verwaltungsverfahren<br />
(Art. 69 und 70) sind anzuwenden.<br />
(2) 1 Im Planfeststellungsbeschluß entscheidet die Planfeststellungsbehörde<br />
über die Einwendungen, über die bei der Erörterung vor der<br />
Anhörungsbehörde keine Einigung erzielt worden ist. 2 Sie hat dem Träger<br />
des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von<br />
Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur<br />
Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind.<br />
3<br />
Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem<br />
Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene<br />
Entschädigung in Geld.<br />
(3) Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, ist diese<br />
im Planfeststellungsbeschluß vorzubehalten; dem Träger des Vorhabens<br />
ist dabei aufzugeben, noch fehlende oder von der<br />
Planfeststellungsbehörde bestimmte Unterlagen rechtzeitig vorzulegen.
(4) 1 Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vorhabens, den<br />
bekannten Betroffenen und denjenigen, über deren Einwendungen<br />
entschieden worden ist, zuzustellen. 2 Eine Ausfertigung des Beschlusses<br />
ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des<br />
festgestellten Plans in den Gemeinden zwei Wochen zur Einsicht<br />
auszulegen; der Ort und die Zeit der Auslegung sind ortsüblich<br />
bekanntzumachen. 3 Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluß<br />
gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der<br />
Bekanntmachung hinzuweisen.<br />
(5) 1 Sind außer an den Träger des Vorhabens mehr als 50 Zustellungen nach<br />
Absatz 4 vorzunehmen, so können diese Zustellungen durch öffentliche<br />
Bekanntmachung ersetzt werden. 2 Die öffentliche Bekanntmachung wird<br />
dadurch bewirkt, daß der verfügende Teil des<br />
Planfeststellungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis<br />
auf die Auslegung nach Absatz 4 Satz 2 im amtlichen<br />
Veröffentlichungsblatt der zuständigen Behörde und außerdem in örtlichen<br />
Tageszeitungen bekanntgemacht werden, die in dem Bereich verbreitet<br />
sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; auf<br />
Auflagen ist hinzuweisen. 3 Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der<br />
Beschluß den Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen<br />
erhoben haben, als zugestellt; hierauf ist in der Bekanntmachung<br />
hinzuweisen. 4 Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der<br />
Planfeststellungsbeschluß bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den<br />
Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben,<br />
schriftlich angefordert werden; hierauf ist in der Bekanntmachung<br />
gleichfalls hinzuweisen.<br />
(6) 1 An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung<br />
erteilt werden, wenn<br />
1. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich<br />
mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts<br />
schriftlich einverstanden erklärt haben und<br />
2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt<br />
wird, das Benehmen hergestellt worden ist.<br />
2<br />
Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung mit<br />
Ausnahme der enteignungsrechtlichen Vorwirkung; auf ihre Erteilung<br />
finden die Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren keine<br />
Anwendung. 3 Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf<br />
es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. 4 Art. 75 Abs. 4 gilt<br />
entsprechend.<br />
(7) 1 Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen von<br />
unwesentlicher Bedeutung. 2 Diese liegen vor, wenn<br />
1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder die erforderlichen<br />
behördlichen Entscheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht<br />
entgegenstehen und<br />
2. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit den vom Plan<br />
Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen worden sind.
Bay VwVfG Art. 75 Rechtswirkungen der Planfeststellung<br />
(1) 1 Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens<br />
einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im<br />
Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt;<br />
neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen nach<br />
Landes- oder Bundesrecht, insbesondere öffentlich-rechtliche<br />
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen,<br />
Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. 2 Durch die<br />
Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen<br />
dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen<br />
rechtsgestaltend geregelt.<br />
(1 a) 1 Mängel bei der Abwägung der von dem Vorhaben berührten öffentlichen<br />
und privaten Belange sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf<br />
das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen sind. 2 Erhebliche Mängel bei<br />
der Abwägung führen nur dann zur Aufhebung des<br />
Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht<br />
durch Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfahren behoben<br />
werden können.<br />
(2) 1 Ist der Planfeststellungsbeschluß unanfechtbar geworden, so sind<br />
Ansprüche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder<br />
Änderung der Anlagen oder auf Unterlassung ihrer Benutzung<br />
ausgeschlossen. 2 Treten nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens<br />
oder der dem festgestellten Plan entsprechenden Anlagen auf das Recht<br />
eines anderen erst nach Unanfechtbarkeit des Plans auf, so kann der<br />
Betroffene Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von<br />
Anlagen verlangen, welche die nachteiligen Wirkungen ausschließen. 3 Sie<br />
sind dem Träger des Vorhabens durch Beschluß der<br />
Planfeststellungsbehörde aufzuerlegen. 4 Sind solche Vorkehrungen oder<br />
Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so richtet sich der<br />
Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld. 5 Werden<br />
Vorkehrungen oder Anlagen im Sinn des Satzes 2 notwendig, weil nach<br />
Abschluß des Planfeststellungsverfahrens auf einem benachbarten<br />
Grundstück Veränderungen eingetreten sind, so hat die hierdurch<br />
entstehenden Kosten der Eigentümer des benachbarten Grundstücks zu<br />
tragen, es sei denn, daß die Veränderungen durch natürliche Ereignisse<br />
oder höhere Gewalt verursacht worden sind; Satz 4 ist nicht anzuwenden.<br />
(3) 1 Anträge, mit denen Ansprüche auf Herstellung von Einrichtungen oder<br />
auf angemessene Entschädigung nach Absatz 2 Sätze 2 und 4 geltend<br />
gemacht werden, sind schriftlich an die Planfeststellungsbehörde zu<br />
richten. 2 Sie sind nur innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt<br />
zulässig, zu dem der Betroffene von den nachteiligen Wirkungen des dem<br />
unanfechtbar festgestellten Plan entsprechenden Vorhabens oder der<br />
Anlage Kenntnis erhalten hat; sie sind ausgeschlossen, wenn nach<br />
Herstellung des dem Plan entsprechenden Zustands 30 Jahre verstrichen<br />
sind.<br />
(4) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf Jahren nach<br />
Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt er außer Kraft, es sei<br />
denn, er wird vorher von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf<br />
Jahre verlängert.
Bay VwVfG Art. 76 Planänderungen vor Fertigstellung des Vorhabens<br />
(1) Soll vor Fertigstellung des Vorhabens der festgestellte Plan geändert<br />
werden, bedarf es eines neuen Planfeststellungsverfahrens.<br />
(2) Bei Planänderungen von unwesentlicher Bedeutung kann die<br />
Planfeststellungsbehörde von einem neuen Planfeststellungsverfahren<br />
absehen, wenn die Belange anderer nicht berührt werden oder wenn die<br />
Betroffenen der Änderung zugestimmt haben.<br />
(3) Führt die Planfeststellungsbehörde in den Fällen des Absatzes 2 oder in<br />
anderen Fällen einer Planänderung von unwesentlicher Bedeutung ein<br />
Planfeststellungsverfahren durch, so bedarf es keines<br />
Anhörungsverfahrens und keiner öffentlichen Bekanntgabe des<br />
Planfeststellungsbeschlusses.<br />
Bay VwVfG Art. 77 Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses<br />
1 Wird ein Vorhaben, mit dessen Durchführung begonnen worden ist, endgültig<br />
aufgegeben, so hat die Planfeststellungsbehörde den Planfeststellungsbeschluß<br />
aufzuheben. 2 In dem Aufhebungsbeschluß sind dem Träger des Vorhabens die<br />
Wiederherstellung des früheren Zustands oder geeignete andere Maßnahmen<br />
aufzuerlegen, soweit dies zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung<br />
nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich ist. 3 Werden solche<br />
Maßnahmen notwendig, weil nach Abschluß des Planfeststellungsverfahrens auf<br />
einem benachbarten Grundstück Veränderungen eingetreten sind, so kann der<br />
Träger des Vorhabens durch Beschluß der Planfeststellungsbehörde zu<br />
geeigneten Vorkehrungen verpflichtet werden; die hierdurch entstehenden<br />
Kosten hat jedoch der Eigentümer des benachbarten Grundstücks zu tragen, es<br />
sei denn, daß die Veränderungen durch natürliche Ereignisse oder höhere<br />
Gewalt verursacht worden sind.<br />
Bay VwVfG Art. 78 Zusammentreffen mehrerer Vorhaben<br />
(1) Treffen mehrere selbstständige Vorhaben, für deren Durchführung<br />
Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben sind, derart zusammen, daß für<br />
diese Vorhaben oder für Teile von ihnen nur eine einheitliche Entscheidung<br />
möglich ist, so findet für diese Vorhaben oder für deren Teile nur ein<br />
Planfeststellungsverfahren statt.<br />
(2) 1 Zuständigkeiten und Verfahren richten sich nach den Rechtsvorschriften<br />
über das Planfeststellungsverfahren, das für diejenige Anlage<br />
vorgeschrieben ist, die einen größeren Kreis öffentlich-rechtlicher<br />
Beziehungen berührt. 2 Bestehen Zweifel, welche Rechtsvorschrift<br />
anzuwenden ist, so entscheidet, falls nach den in Betracht kommenden<br />
Rechtsvorschriften mehrere Behörden des Geschäftsbereichs eines<br />
Staatsministeriums zuständig sind, das Staatsministerium; gehören die<br />
Behörden zum Geschäftsbereich verschiedener Staatsministerien, so<br />
entscheidet die Staatsregierung. 3 Bestehen Zweifel, welche<br />
Rechtsvorschrift anzuwenden ist, und sind nach den in Betracht<br />
kommenden Rechtsvorschriften Behörden verschiedener Länder zuständig,<br />
so führen, falls sich die obersten Behörden der Länder nicht einigen, die<br />
Landesregierungen das Einvernehmen darüber herbei, welche<br />
Rechtsvorschrift anzuwenden ist; sind nach den in Betracht kommenden<br />
Rechtsvorschriften eine Bundesbehörde und eine Landesbehörde
zuständig, so führen, falls sich die obersten Bundes- und Landesbehörden<br />
nicht einigen, die Bundesregierung und die Staatsregierung das<br />
Einvernehmen darüber herbei, welche Rechtsvorschrift anzuwenden ist.<br />
ABSCHNITT III Verwaltungsverfahren mit<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Bay VwVfG Art. 78 a Anwendbarkeit<br />
Ist in Rechtsvorschriften des Freistaates Bayern für Vorhaben ein<br />
Verwaltungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben, so<br />
gelten hierfür die Art. 78 b bis 78 l und, soweit sich aus diesen nichts<br />
Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s.<br />
Bay VwVfG Art. 78 b Zweck der Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Zweck der Umweltverträglichkeitsprüfung ist es sicherzustellen, dass bei den in<br />
Art. 78 a bezeichneten Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge nach<br />
einheitlichen Grundsätzen<br />
1. die erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend<br />
ermittelt, beschrieben und bewertet werden,<br />
2. das Ergebnis der Bewertung so früh wie möglich bei allen behördlichen<br />
Entscheidungen über die Zulässigkeit berücksichtigt wird.<br />
Bay VwVfG Art. 78 c Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
1 Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist ein<br />
unselbständiger Teil der Verwaltungsverfahren, in denen über die Zulässigkeit<br />
von Vorhaben entschieden wird. 2 Sie umfasst die Ermittlung, die Beschreibung<br />
und die Bewertung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf<br />
1. Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,<br />
2. Sachgüter, die der Daseinsvorsorge dienen, und das kulturelle Erbe,<br />
einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen.<br />
Bay VwVfG Art. 78 d Unterrichtung des Trägers des Vorhabens<br />
1 Auf Verlangen des Trägers des Vorhabens hat ihn die zuständige Behörde<br />
nach Anhörung derjenigen Behörden, deren Aufgabenbereich durch das<br />
Vorhaben berührt wird, über Art und Umfang der nach Art. 78 e voraussichtlich<br />
beizubringenden Unterlagen zu unterrichten. 2 Vor der Unterrichtung gibt die<br />
zuständige Behörde dem Träger des Vorhabens Gelegenheit zu einer<br />
Besprechung über die beizubringenden Unterlagen. 3 Die Besprechung soll sich<br />
auf der Grundlage geeigneter, vom Träger des Vorhabens beizubringender<br />
Unterlagen auch auf Gegenstand, Umfang und Methoden der<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung erstrecken. 4 Zu der Besprechung sollen im<br />
Zulassungsverfahren zu beteiligende Behörden hinzugezogen werden; mit<br />
Zustimmung des Trägers des Vorhabens können Sachverständige und Dritte<br />
hinzugezogen werden. 5 Verfügt die zuständige Behörde über Informationen,<br />
die für die Beibringung der Unterlagen nach Art. 78 e zweckdienlich sind, soll<br />
sie diese Informationen dem Träger des Vorhabens zur Verfügung stellen.
Bay VwVfG Art. 78 e Unterlagen des Trägers des Vorhabens<br />
(1) Der Träger des Vorhabens hat die entscheidungserheblichen Unterlagen<br />
über die erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens der zuständigen<br />
Behörde zu Beginn des Verfahrens vorzulegen, in dem die<br />
Umweltverträglichkeit geprüft wird.<br />
(2) 1 Inhalt und Umfang der Unterlagen nach Absatz 1 bestimmen sich nach<br />
den Rechtsvorschriften, die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des<br />
Vorhabens maßgebend sind. 2 Die Absätze 3 und 4 sind anzuwenden,<br />
soweit die in diesen Absätzen genannten Unterlagen durch<br />
Rechtsvorschrift nicht im Einzelnen festgelegt sind.<br />
(3) Die Unterlagen nach Absatz 1 müssen zumindest folgende Angaben<br />
enthalten:<br />
1. Beschreibung des Vorhabens mit Angaben über <strong>Stand</strong>ort, Art und<br />
Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden,<br />
2. Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche<br />
Beeinträchtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder soweit<br />
möglich ausgeglichen werden, sowie der Ersatzmaßnahmen bei nicht<br />
ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft,<br />
soweit solche möglich sind,<br />
3. Beschreibung von Art und Menge der von dem Vorhaben unter<br />
Berücksichtigung der Maßnahmen nach Nummer 2 zu erwartenden<br />
Emissionen und Reststoffe, insbesondere der Luftverunreinigungen, der<br />
Abfälle und des Anfalls von Abwasser,<br />
4. Beschreibung der bei Errichtung und Betrieb oder sonstiger<br />
Durchführung des Vorhabens zu erwartenden erheblichen Auswirkungen<br />
auf die Umwelt einschließlich der Wechselwirkungen unter<br />
Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein<br />
anerkannten Prüfmethoden,<br />
5. Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens geprüften<br />
Vorhabenalternativen und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im<br />
Hinblick auf die erheblichen Umweltauswirkungen,<br />
6. allgemein verständliche Zusammenfassung der in den Nummern 1 bis 5<br />
genannten Angaben.<br />
(4) 1 Die Unterlagen nach Absatz 1 müssen auch die folgenden Angaben<br />
enthalten, soweit sie für die Umweltverträglichkeitsprüfung nach der Art<br />
des Vorhabens erforderlich sind und ihre Beibringung für den Träger des<br />
Vorhabens zumutbar ist:<br />
1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen<br />
Verfahren,<br />
2. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile unter Berücksichtigung<br />
des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten<br />
Prüfmethoden, soweit dies zur Feststellung und Beurteilung aller sonstigen<br />
für die Zulässigkeit des Vorhabens erheblichen Auswirkungen des<br />
Vorhabens auf die Umwelt erforderlich sind,<br />
3. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der<br />
Angaben aufgetreten sind, z. B. technische Lücken oder fehlende<br />
Kenntnisse.<br />
2<br />
Die allgemein verständliche Zusammenfassung nach Absatz 3 Nr. 6 muss<br />
sich auch auf die in den Nummern 1 bis 3 genannten Angaben erstrecken.
Bay VwVfG Art. 78 f Beteiligung anderer Behörden<br />
1 Die zuständige Behörde fordert die Behörden, deren Aufgabenbereich durch<br />
das Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme auf und übermittelt ihnen die<br />
hierfür erforderlichen Unterlagen des Trägers des Vorhabens. 2 Art. 73 Abs. 3 a<br />
Satz 1 gilt entsprechend. 3 Die zuständige Behörde kann abweichend von<br />
Satz 1 auf die Beteiligung anderer Behörden verzichten, soweit sie über<br />
ausreichende eigene Kenntnisse verfügt. 4 Auf die nach dem Erörterungstermin<br />
oder in den Fällen des Art. 78 g Abs. 1 Satz 5 nach Ablauf der gemäß Satz 2<br />
gesetzten Frist eingehenden Stellungnahme ist Art. 73 Abs. 3 a Satz 2<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
Bay VwVfG Art. 78 g Beteiligung der Öffentlichkeit<br />
(1) 1 Die zuständige Behörde hat der Öffentlichkeit die Unterlagen nach<br />
Art. 78 e zugänglich zu machen, damit der betroffenen Öffentlichkeit<br />
Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Umweltauswirkungen des<br />
Vorhabens zu äußern. 2 Öffentlichkeit sind einzelne oder mehrere<br />
natürliche oder juristische Personen sowie deren Vereinigungen.<br />
3<br />
Betroffene Öffentlichkeit ist jede Person, deren Belange durch eine<br />
Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens berührt werden; hierzu<br />
gehören auch Vereinigungen zur Förderung des Umweltschutzes, deren<br />
satzungsmäßiger Aufgabenbereich durch eine Entscheidung über die<br />
Zulässigkeit des Vorhabens berührt wird. 4 Das Anhörungsverfahren muss<br />
den Anforderungen des Art. 73 Abs. 3 und 4 bis 7 entsprechen.<br />
5<br />
Abweichend von Satz 4 entfällt der Erörterungstermin nach Art. 73<br />
Abs. 6, wenn für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens ein<br />
Verwaltungsverfahren ohne Erörterungstermin vorgeschrieben ist; im<br />
Übrigen kann die zuständige Behörde abweichend von Satz 4 von einem<br />
Erörterungstermin absehen. 6 Ändert der Träger des Vorhabens die nach<br />
Art. 78 e erforderlichen Unterlagen im Lauf des Verfahrens, so kann von<br />
einer erneuten Anhörung der Öffentlichkeit abgesehen werden, soweit<br />
keine zusätzlichen oder anderen erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt<br />
zu erwarten sind.<br />
(1 a) Bei der Bekanntmachung zu Beginn des Anhörungsverfahrens nach<br />
Abs. 1 hat die zuständige Behörde die Öffentlichkeit über Folgendes zu<br />
unterrichten:<br />
1. den Antrag auf Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens, den<br />
eingereichten Plan oder eine sonstige Handlung des Trägers des<br />
Vorhabens zur Einleitung eines Verfahrens, in dem die<br />
Umweltverträglichkeit geprüft wird,<br />
2. die Feststellung der UVP-Pflicht des Vorhabens sowie erforderlichenfalls<br />
über die Durchführung einer grenzüberschreitenden Beteiligung nach<br />
Art. 78 h,<br />
3. die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit<br />
des Vorhabens jeweils zuständigen Behörden, bei denen weitere relevante<br />
Informationen erhältlich sind und bei denen Äußerungen oder Fragen<br />
eingereicht werden können, sowie die festgesetzten Fristen für deren<br />
Übermittlung,<br />
4. die Art einer möglichen Entscheidung über die Zulässigkeit des<br />
Vorhabens,
5. die Unterlagen, die nach Art. 78 e vorgelegt wurden,<br />
6. wo und in welchem Zeitraum die Unterlagen nach Art. 78 e zur Einsicht<br />
ausgelegt werden,<br />
7. weitere Einzelheiten des Verfahrens der Beteiligung der Öffentlichkeit.<br />
(1 b) 1 Im Rahmen des Anhörungsverfahrens nach Abs. 1 hat die zuständige<br />
Behörde zumindest folgende Unterlagen zur Einsicht für die Öffentlichkeit<br />
auszulegen:<br />
1. die Unterlagen nach Art. 78 e,<br />
2. die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen betreffend<br />
das Vorhaben, die der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt des Beginns<br />
des Beteiligungsverfahrens vorgelegen haben.<br />
2<br />
Weitere Informationen, die für die Entscheidung über die Zulässigkeit<br />
des Vorhabens von Bedeutung sein können und die der zuständigen<br />
Behörde erst nach Beginn des Anhörungsverfahrens vorliegen, sind der<br />
Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Bayerischen<br />
Umweltinformationsgesetzes zugänglich zu machen.<br />
(2) 1 Die zuständige Behörde hat die Entscheidung über die Zulassung oder<br />
Ablehnung des Vorhabens einschließlich Angaben über das Verfahren zur<br />
Beteiligung der Öffentlichkeit öffentlich bekannt zu machen. 2 Für die<br />
öffentliche Bekanntmachung gelten Art. 74 Abs. 4 Sätze 2 und 3 und<br />
Abs. 5 Sätze 2 bis 4 entsprechend. 3 Im Fall der Zulassung des Vorhabens<br />
erhält die Begründung des Bescheids auch eine Beschreibung der<br />
Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die<br />
Umwelt vermieden, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden.<br />
Bay VwVfG Art. 78 h Grenzüberschreitende Behörden- und<br />
Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
(1) 1 Stellt die zuständige Behörde fest, dass ein in Art. 78 a bezeichnetes<br />
Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines Staates<br />
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (anderer Staat) haben kann,<br />
so unterrichtet sie so bald wie möglich, spätestens im Zeitpunkt der<br />
Beteiligung der Öffentlichkeit nach Art. 78 g, den anderen Staat unter<br />
Übermittlung der Unterlagen nach Art. 78 e über das Vorhaben und über<br />
die Art der möglichen Entscheidung; ferner ersucht sie den anderen Staat<br />
um Mitteilung innerhalb einer angemessenen Frist, ob er an der Prüfung<br />
der Umweltverträglichkeit teilnimmt. 2 Hat der andere Staat keine<br />
zuständige Behörde benannt, ist die oberste für Umweltangelegenheiten<br />
zuständige Behörde dieses Staates zu unterrichten. 3 Satz 1 gilt<br />
entsprechend, wenn ein anderer Staat um Unterrichtung über ein<br />
Vorhaben mit möglichen erheblichen Auswirkungen auf seine Umwelt<br />
ersucht. 4 Teilt der andere Staat fristgemäß mit, dass er an der Prüfung<br />
der Umweltverträglichkeit teilnimmt, so übermittelt die zuständige<br />
Behörde dem anderen Staat die nach Art. 78 g Abs. 1 a erforderlichen und<br />
nach Art. 78 g Abs. 1 b Satz 1 Nrn. 1 und 2 bereitgestellten<br />
Informationen. 5 Die innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist<br />
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und der betroffenen<br />
Öffentlichkeit dieses Staates sind in gleicher Weise und im gleichen<br />
Umfang in das Verfahren einzubeziehen wie die behördlichen<br />
Stellungnahmen nach Art. 78 f und die Einwendungen nach Art. 78 g
Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit Art. 73 Abs. 4. 6 Sofern ein<br />
Erörterungstermin durchgeführt wird, ist der andere Staat hiervon<br />
rechtzeitig zu benachrichtigen. 7 Sobald die Entscheidung getroffen ist, ist<br />
der Bescheid mit dem nach Art. 78 g Abs. 2 bekannt zu machenden Inhalt<br />
der zuständigen Behörde des anderen Staates zu übermitteln.<br />
(2) 1 Unterrichtet ein anderer Staat den Freistaat Bayern unter Übermittlung<br />
der zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen über ein Vorhaben, das<br />
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in Bayern haben kann, so prüft<br />
die zuständige Behörde im Benehmen mit denjenigen Behörden, deren<br />
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, ob sie an der Prüfung<br />
der Umweltverträglichkeit im anderen Staat teilnimmt; das Ergebnis teilt<br />
sie dem anderen Staat mit. 2 Wird ein Vorhaben im Sinn von Satz 1 auf<br />
andere Weise bekannt, ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die<br />
zuständige Behörde den anderen Staat zunächst um Unterrichtung über<br />
das Vorhaben ersucht; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3 Im Fall der<br />
Teilnahme nimmt die zuständige Behörde auf der Grundlage der von ihr<br />
eingeholten Stellungnahmen derjenigen Behörden, deren Aufgabenbereich<br />
durch das Vorhaben berührt wird, innerhalb der gesetzten angemessenen<br />
Frist gegenüber dem anderen Staat zu dem Vorhaben Stellung. 4 Ferner<br />
unterrichtet sie durch öffentliche Bekanntmachung in entsprechender<br />
Anwendung des Art. 73 Abs. 6 Satz 5 Halbsatz 1 die betroffene<br />
Öffentlichkeit in Bayern über das Vorhaben und die dem Einzelnen im<br />
anderen Staat eingeräumten Teilnahmerechte sowie darüber, wann die<br />
vom anderen Staat übermittelten Unterlagen bei ihr eingesehen werden<br />
können. 5 Für die Unterrichtung der Öffentlichkeit in Bayern über die vom<br />
anderen Staat getroffene Entscheidung gilt Satz 4 entsprechend.<br />
(3) 1 In den Fällen des Absatzes 1 bietet die zuständige Behörde dem anderen<br />
Staat Gespräche über die Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung<br />
der erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf seine Umwelt an; sie<br />
sind so zügig zu führen, dass der Abschluss des Zulassungsverfahrens<br />
nicht unangemessen verzögert wird. 2 In den Fällen des Absatzes 2<br />
ersucht die zuständige Behörde den anderen Staat um solche Gespräche,<br />
falls erhebliche nachteilige Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die<br />
Umwelt des Freistaates Bayern zu besorgen sind.<br />
(4) Zuständige Behörde im Sinn von Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 ist die<br />
Regierung, deren Regierungsbezirk dem Vorhaben am nächsten liegt.<br />
(5) Völkerrechtliche Verpflichtungen des Bundes oder des Freistaates Bayern<br />
bleiben unberührt.<br />
Bay VwVfG Art. 78 i Zusammenfassende Darstellung der<br />
Umweltauswirkungen<br />
1 Die zuständige Behörde erarbeitet auf der Grundlage der Unterlagen nach<br />
Art. 78 e, der behördlichen Stellungnahmen nach Art. 78 f und 78 h Abs. 1, der<br />
Äußerungen der Öffentlichkeit nach Art. 78 g und 78 h Abs. 1 und eigener<br />
Ermittlungen eine zusammenfassende Darstellung der erheblichen<br />
Auswirkungen des Vorhabens auf die in Art. 78 c Abs. 1 Satz 2 genannten<br />
Schutzgüter einschließlich der Wechselwirkungen. 2 Die zusammenfassende<br />
Darstellung ist möglichst innerhalb eines Monats nach Abschluss des
Anhörungsverfahrens nach Art. 78 g zu erarbeiten. 3 Sie kann in der<br />
Begründung der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens erfolgen.<br />
Bay VwVfG Art. 78 j Bewertung der Umweltauswirkungen und<br />
Berücksichtigung des Ergebnisses bei der Entscheidung<br />
Die zuständige Behörde bewertet die erheblichen Umweltauswirkungen des<br />
Vorhabens auf der Grundlage der zusammenfassenden Darstellung nach<br />
Art. 78 i und berücksichtigt diese Bewertung bei der Entscheidung über die<br />
Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im<br />
Sinn der Art. 78 b und 78 c Satz 2 nach Maßgabe der geltenden <strong>Gesetze</strong>.<br />
Bay VwVfG Art. 78 k Vorbescheid und Teilzulassungen<br />
(1) 1 Vorbescheid und erste Teilgenehmigung oder entsprechende erste<br />
Teilzulassungen dürfen nur nach Durchführung einer<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt werden. 2 Die<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung hat sich in diesen Fällen vorläufig auf die<br />
nach dem jeweiligen Planungsstand erkennbaren erheblichen<br />
Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens und abschließend auf die<br />
erheblichen Umweltauswirkungen zu erstrecken, die Gegenstand von<br />
Vorbescheid oder Teilzulassung sind. 3 Diesem Umfang der<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei der Unterrichtung des Trägers des<br />
Vorhabens nach Art. 78 d und bei den Unterlagen nach Art. 78 e<br />
Rechnung zu tragen.<br />
(2) 1 Beim abschließenden Bescheid oder bei weiteren Teilgenehmigungen<br />
oder entsprechenden Teilzulassungen soll die Prüfung der<br />
Umweltverträglichkeit auf zusätzliche oder andere erhebliche<br />
Umweltauswirkungen des Vorhabens beschränkt werden. 2 Absatz 1 gilt<br />
entsprechend.<br />
Bay VwVfG Art. 78 l Zulassung eines Vorhabens durch mehrere<br />
Behörden<br />
(1) 1 Bedarf ein Vorhaben der Zulassung durch mehrere Behörden, so nimmt<br />
eine von ihnen als federführende Behörde die Aufgaben nach Art. 78 d bis<br />
78 i wahr. 2 Federführende Behörde ist die höchste der beteiligten<br />
Zulassungsbehörden. 3 Gehören die beteiligten Zulassungsbehörden<br />
derselben Verwaltungsebene an, ist federführend diejenige, die das<br />
Verfahren mit dem größten Kreis öffentlich-rechtlicher Beziehungen<br />
durchzuführen hat. 4 Bestehen Zweifel, welche der Zulassungsbehörden<br />
federführende Behörde ist, entscheidet das Staatsministerium, zu dessen<br />
Geschäftsbereich die Behörden gehören. 5 Gehören die Behörden zum<br />
Geschäftsbereich verschiedener Staatsministerien, so entscheidet die von<br />
den Staatsministerien gemeinsam bestimmte Behörde; einigen sich die<br />
Staatsministerien nicht, entscheidet die Staatsregierung. 6 Bei der<br />
Entscheidung über Zweifelsfälle ist stets das Staatsministerium für<br />
Landesentwicklung und Umweltfragen zu beteiligen.<br />
(2) 1 Die Zulassungsbehörden haben auf der Grundlage der<br />
zusammenfassenden Darstellung nach Art. 78 i eine Gesamtbewertung<br />
der erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens vorzunehmen und<br />
diese nach Art. 78 j bei den Entscheidungen zu berücksichtigen. 2 Die
federführende Behörde hat das Zusammenwirken der Zulassungsbehörden<br />
sicherzustellen.<br />
SECHSTER TEIL Rechtsbehelfsverfahren<br />
Bay VwVfG Art. 79 Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte<br />
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gilt die<br />
Verwaltungsgerichtsordnung, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes<br />
bestimmt ist; im übrigen gelten die Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s.<br />
Bay VwVfG Art. 80 Kosten im Vorverfahren<br />
(1) 1 Ist der Widerspruch erfolgreich, so hat der Rechtsträger, dessen Behörde<br />
den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, die Kosten des<br />
Widerspruchsverfahrens zu tragen; dies gilt auch, wenn der Widerspruch<br />
nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung einer Verfahrens- oder<br />
Formvorschrift nach Art. 45 unbeachtlich ist. 2 Ist der Widerspruch<br />
erfolglos geblieben oder zurückgenommen worden, so hat derjenige, der<br />
den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu<br />
tragen; dies gilt nicht für die Verwaltungskosten und die zur<br />
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung<br />
notwendigen Aufwendungen der Behörde, die den angefochtenen<br />
Verwaltungsakt erlassen hat, wenn der Widerspruch gegen einen<br />
Verwaltungsakt eingelegt wird, der im Rahmen<br />
1. eines bestehenden oder früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder<br />
Amtsverhältnisses oder<br />
2. einer bestehenden oder früheren gesetzlichen Dienstpflicht oder einer<br />
Tätigkeit, die an Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistet werden<br />
kann,<br />
erlassen wurde. 3 Ist der Widerspruch zum Teil erfolgreich, so gilt § 155<br />
Abs. 1 VwGO entsprechend. 4 Aufwendungen, die einem Beteiligten durch<br />
eigenes Verschulden oder das Verschulden seines Vertreters entstanden<br />
sind, hat er selbst zu tragen. 5 Erledigt sich der Widerspruch auf andere<br />
Weise, so wird über die Kosten nach billigem Ermessen entschieden; der<br />
bisherige Sachstand ist zu berücksichtigen.<br />
(2) 1 Zu den Kosten des Widerspruchsverfahrens gehören nur die<br />
Verwaltungskosten und die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung<br />
oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen dessen, der den<br />
Widerspruch eingelegt hat, und der Behörde, die den angefochtenen<br />
Verwaltungsakt erlassen hat. 2 Aufwendungen anderer Beteiligter sind<br />
erstattungsfähig, wenn sie aus Billigkeit demjenigen, der die Kosten des<br />
Widerspruchsverfahrens zu tragen hat, oder der Staatskasse auferlegt<br />
werden. 3 Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines<br />
sonstigen Bevollmächtigten im Widerspruchsverfahren sind nur dann<br />
notwendige Aufwendungen, wenn die Zuziehung eines Bevollmächtigten<br />
notwendig war.<br />
(3) 1 Die Behörde, die die Kostenentscheidung getroffen hat, setzt auf Antrag<br />
den Betrag der zu erstattenden Aufwendungen fest; hat ein Ausschuß<br />
oder Beirat (§ 73 Abs. 2 VwGO) die Kostenentscheidung getroffen, so<br />
obliegt die Kostenfestsetzung der Behörde, bei der der Ausschuß oder
Beirat gebildet ist. 2 Die Kostenentscheidung bestimmt auch, ob die<br />
Zuziehung eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten<br />
notwendig war.<br />
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für andere förmliche<br />
verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe und für Vorverfahren bei Maßnahmen<br />
des Richterdienstrechts.<br />
SIEBTER TEIL Ehrenamtliche Tätigkeit, Ausschüsse<br />
ABSCHNITT I Ehrenamtliche Tätigkeit<br />
Bay VwVfG Art. 81 Anwendung der Vorschriften über die<br />
ehrenamtliche Tätigkeit<br />
Für die ehrenamtliche Tätigkeit im Verwaltungsverfahren gelten die Art. 82 bis<br />
87, soweit Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmen.<br />
Bay VwVfG Art. 82 Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit<br />
Eine Pflicht zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit besteht nur, wenn sie<br />
durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist.<br />
Bay VwVfG Art. 83 Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit<br />
(1) Der ehrenamtlich Tätige hat seine Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch<br />
auszuüben.<br />
(2) 1 Bei Übernahme seiner Aufgaben ist er zur gewissenhaften und<br />
unparteiischen Tätigkeit und zur Verschwiegenheit besonders zu<br />
verpflichten. 2 Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.<br />
Bay VwVfG Art. 84 Verschwiegenheitspflicht<br />
(1) 1 Der ehrenamtlich Tätige hat, auch nach Beendigung seiner<br />
ehrenamtlichen Tätigkeit, über die ihm dabei bekanntgewordenen<br />
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. 2 Dies gilt nicht für<br />
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig<br />
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.<br />
(2) Der ehrenamtlich Tätige darf ohne Genehmigung über Angelegenheiten,<br />
über die er Verschwiegenheit zu wahren hat, weder vor Gericht noch<br />
außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben.<br />
(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn<br />
die Aussage dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten<br />
oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich<br />
erschweren würde.<br />
(4) 1 Ist der ehrenamtlich Tätige Beteiligter in einem gerichtlichen Verfahren<br />
oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung seiner berechtigten<br />
Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, wenn die<br />
Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn<br />
ein zwingendes öffentliches Interesse dies erfordert. 2 Wird sie versagt, so<br />
ist dem ehrenamtlich Tätigen der Schutz zu gewähren, den die<br />
öffentlichen Interessen zulassen.
(5) Die Genehmigung nach den Absätzen 2 bis 4 erteilt die fachlich zuständige<br />
Aufsichtsbehörde der Stelle, die den ehrenamtlich Tätigen berufen hat.<br />
Bay VwVfG Art. 85 Entschädigung<br />
Der ehrenamtlich Tätige hat Anspruch auf Ersatz seiner notwendigen Auslagen<br />
und seines Verdienstausfalls.<br />
Bay VwVfG Art. 86 Abberufung<br />
1 Personen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit herangezogen worden sind, können<br />
von der Stelle, die sie berufen hat, abberufen werden, wenn ein wichtiger<br />
Grund vorliegt. 2 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der<br />
ehrenamtlich Tätige<br />
1. seine Pflicht gröblich verletzt oder sich als unwürdig erwiesen hat,<br />
2. seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann.<br />
Bay VwVfG Art. 87 (weggefallen)<br />
ABSCHNITT II Ausschüsse<br />
Bay VwVfG Art. 88 Anwendung der Vorschriften über Ausschüsse<br />
Für Ausschüsse, Beiräte und andere kollegiale Einrichtungen (Ausschüsse)<br />
gelten, wenn sie in einem Verwaltungsverfahren tätig werden, die Art. 89 bis<br />
93, soweit Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmen.<br />
Bay VwVfG Art. 89 Ordnung in den Sitzungen<br />
Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen; er ist für die<br />
Ordnung verantwortlich.<br />
Bay VwVfG Art. 90 Beschlußfähigkeit<br />
(1) 1 Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn alle Mitglieder geladen und mehr<br />
als die Hälfte, mindestens aber drei der stimmberechtigten Mitglieder<br />
anwesend sind. 2 Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren<br />
gefaßt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.<br />
(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit zurückgestellt worden<br />
und wird der Ausschuß zur Behandlung desselben Gegenstands erneut<br />
geladen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen<br />
beschlußfähig, wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen worden ist.<br />
Bay VwVfG Art. 91 Beschlußfassung<br />
1 Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. 2 Bei Stimmengleichheit<br />
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, wenn er stimmberechtigt ist; sonst<br />
gilt Stimmengleichheit als Ablehnung.<br />
Bay VwVfG Art. 92 Wahlen durch Ausschüsse<br />
(1) 1 Gewählt wird, wenn kein Mitglied des Ausschusses widerspricht, durch<br />
Zuruf oder Zeichen, sonst durch Stimmzettel. 2 Auf Verlangen eines<br />
Mitglieds ist geheim zu wählen.
(2) 1 Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten erhalten<br />
hat. 2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Leiter der Wahl zu<br />
ziehende Los.<br />
(3) 1 Sind mehrere gleichartige Wahlstellen zu besetzen, so ist nach dem<br />
Höchstzahlverfahren d'Hondt zu wählen, außer wenn einstimmig etwas<br />
anderes beschlossen worden ist. 2 Über die Zuteilung der letzten<br />
Wahlstelle entscheidet bei gleicher Höchstzahl das vom Leiter der Wahl zu<br />
ziehende Los.<br />
Bay VwVfG Art. 93 Niederschrift<br />
1 2<br />
Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muß<br />
Angaben enthalten über<br />
1. den Ort und den Tag der Sitzung,<br />
2. die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Ausschußmitglieder,<br />
3. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge,<br />
4. die gefaßten Beschlüsse,<br />
5. das Ergebnis von Wahlen.<br />
3<br />
Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und, soweit ein Schriftführer<br />
hinzugezogen worden ist, auch von diesem zu unterzeichnen.<br />
ACHTER TEIL Schlußvorschriften<br />
Bay VwVfG Art. 94 Länderübergreifende Verfahren<br />
1<br />
Ist nach Art. 3 Abs. 2 Satz 4 eine gemeinsame zuständige Behörde bestimmt<br />
und erstreckt sich das Verwaltungsverfahren auf das Gebiet eines anderen<br />
Bundeslandes, so ist insoweit das Verfahrensrecht dieses Landes anzuwenden.<br />
2<br />
Die fachlich zuständigen Aufsichtsbehörden können durch Vereinbarung eine<br />
abweichende Regelung treffen.<br />
Bay VwVfG Art. 95 Sonderregelung für Verteidigungsangelegenheiten<br />
1<br />
Nach Feststellung des Verteidigungsfalls oder des Spannungsfalls kann in<br />
Verteidigungsangelegenheiten von der Anhörung Beteiligter (Art. 28 Abs. 1),<br />
von der schriftlichen Bestätigung (Art. 37 Abs. 2 Satz 2) und von der<br />
schriftlichen Begründung eines Verwaltungsakts (Art. 39 Abs. 1) abgesehen<br />
werden; in diesen Fällen gilt ein Verwaltungsakt abweichend von Art. 41 Abs. 4<br />
Satz 3 mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekanntgegeben.<br />
2<br />
Dasselbe gilt für die sonstigen gemäß Art. 80 a des Grundgesetzes<br />
anzuwendenden Rechtsvorschriften.<br />
Bay VwVfG Art. 96 Überleitung von Verfahren<br />
1 Art. 53 in der ab dem 1. Januar 2003 geltenden Fassung findet auf die an<br />
diesem Tag bestehenden und noch nicht verjährten oder erloschenen<br />
Ansprüche Anwendung. 2 Eine vor Ablauf des 31. Dezember 2002 eingetretene<br />
und mit diesem Zeitpunkt noch nicht beendete Unterbrechung der Verjährung<br />
oder des Erlöschens gilt mit Ablauf des 31. Dezember 2002 als beendet; die<br />
neue Verjährung ist mit Beginn des 1. Januar 2003 gehemmt. 3 Ist ein<br />
Verwaltungsakt, der zur Unterbrechung der Verjährung oder des Erlöschens<br />
geführt hat, vor Ablauf des 31. Dezember 2002 aufgehoben worden und ist an<br />
diesem Tag die in § 212 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis
zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung bestimmte Frist noch nicht<br />
abgelaufen, so ist § 212 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in dieser<br />
Fassung entsprechend anzuwenden.<br />
Bay VwVfG Art. 96 a Übergangsregelung<br />
1 Verfahren für die in Art. 78 a bezeichneten Vorhaben, die vor dem 25. Juni<br />
2005 begonnen worden sind, sind nach den Vorschriften dieses <strong>Gesetze</strong>s in der<br />
ab dem 1. Juli 2008 geltenden Fassung zu Ende zu führen. 2 Satz 1 findet keine<br />
Anwendung auf Verfahren, bei denen das Vorhaben vor dem 25. Juni 2005<br />
bereits öffentlich bekannt gemacht worden ist.<br />
Bay VwVfG Art. 97 Revision<br />
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision auch darauf gestützt<br />
werden, daß das angefochtene Urteil auf der Verletzung dieses <strong>Gesetze</strong>s<br />
beruht.<br />
Bay VwVfG Art. 98 (Änderungsbestimmung)<br />
Bay VwVfG Art. 99 Inkrafttreten<br />
1 Dieses Gesetz ist dringlich. 2 Es tritt am 1. Januar 1977 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. Dezember 1976 (GVBl S. 544).
<strong>Bayerisches</strong> Verwaltungszustellungs-<br />
und Vollstreckungsgesetz (Bay VwZVG)<br />
geändert durch <strong>Gesetze</strong> vom 27. Dezember 1991 (GVBl. S. 494), vom 27. Dezember 1991 (GVBl.<br />
S. 496), vom 12. April 1994 (GVBl. S. 210), vom 23. April 1997 (GVBl. S. 62), vom 24. April 2001<br />
(GVBl. S. 140), vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 962, ber. 2004 S. 198), vom 26. Juli 2006<br />
(GVBl. S. 387), vom 10. Juni 2008 (GVBl. S. 312)<br />
(Nichtamtliche Inhaltsübersicht)<br />
ERSTER HAUPTTEIL Zustellungsverfahren<br />
ERSTER ABSCHNITT Geltungsbereich und Erfordernis der Zustellung<br />
Art. 1<br />
ZWEITER ABSCHNITT Arten der Zustellung<br />
Art. 2 Allgemeines<br />
Art. 3 Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde<br />
Art. 4 Zustellung durch die Post mittels Einschreiben<br />
Art. 5 Zustellung durch die Behörde gegen Empfangsbekenntnis<br />
Artikel 6<br />
DRITTER ABSCHNITT Gemeinsame Vorschriften für alle Zustellungsarten<br />
Art. 7 Zustellung an gesetzliche Vertreter<br />
Art. 8 Zustellung an Bevollmächtigte<br />
Art. 8 a Zustellung an Ehegatten<br />
Art. 9 Heilung von Zustellungsmängeln<br />
VIERTER ABSCHNITT (weggefallen)<br />
Art. 10 bis 13<br />
FÜNFTER ABSCHNITT Sonderarten der Zustellung<br />
Art. 14 Zustellung im Ausland
Art. 15 Öffentliche Zustellung<br />
Artikel 16<br />
Art. 17 Zustellungen im Besteuerungsverfahren und bei der Heranziehung zu<br />
sonstigen öffentlichen Abgaben und Umlagen<br />
ZWEITER HAUPTTEIL Vollstreckungsverfahren<br />
ERSTER ABSCHNITT Gemeinsame Vorschriften<br />
Art. 18 Geltungsbereich<br />
Art. 19 Voraussetzungen der Vollstreckung<br />
Art. 20 Begriffsbestimmungen<br />
Art. 21 Einwendungen gegen den zu vollstreckenden Anspruch<br />
Art. 21 a Sofortige Vollziehbarkeit<br />
Art. 22 Einstellung der Vollstreckung<br />
ZWEITER ABSCHNITT Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine<br />
Geldleistung gefordert wird<br />
Art. 23 Besondere Voraussetzungen der Vollstreckung<br />
Art. 24 Vollstreckungsanordnung<br />
Art. 25 Vollstreckung von Geldforderungen des Staates<br />
Art. 26 Vollstreckung von Geldforderungen der Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände<br />
Art. 27 Vollstreckung von Geldforderungen sonstiger juristischer Personen des<br />
öffentlichen Rechts<br />
Art. 28 Erstattungsanspruch<br />
DRITTER ABSCHNITT Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine<br />
Handlung, Duldung oder Unterlassung gefordert wird<br />
Art. 29 Zulässigkeit des Verwaltungszwangs; Zwangsmittel<br />
Art. 30 Zuständigkeit
Art. 31 Zwangsgeld<br />
Art. 32 Ersatzvornahme<br />
Art. 33 Ersatzzwangshaft<br />
Art. 34 Unmittelbarer Zwang<br />
Art. 35 Zwangsmittel in unaufschiebbaren Fällen<br />
Art. 36 Androhung der Zwangsmittel<br />
Art. 37 Anwendung der Zwangsmittel<br />
Art. 38 Rechtsbehelfe<br />
Art. 39 Anspruch auf Beseitigung von Vollstreckungsfolgen<br />
VIERTER ABSCHNITT Einschränkungen von Grundrechten<br />
Art. 40<br />
FÜNFTER ABSCHNITT Kosten<br />
Art. 41 Kostenschuldner; Kostenersatz; Forderungsübergang; Zwangsgelder<br />
Art. 41 a Kosten der Ersatzvornahme<br />
DRITTER HAUPTTEIL Übergangs- und Schlußbestimmungen<br />
Art. 42 Durchführungsvorschriften<br />
Art. 43 Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen nach § 350 b<br />
Abs. 5 des Lastenausgleichsgesetzes<br />
Art. 44 Finanzämter als Vollstreckungsbehörden für bestimmte Fälle<br />
Artikel 45 bis 47<br />
Artikel 48<br />
Art. 49 Inkrafttreten
ERSTER HAUPTTEIL Zustellungsverfahren<br />
ERSTER ABSCHNITT Geltungsbereich und Erfordernis der<br />
Zustellung<br />
Bay VwZVG Art. 1<br />
(1) 1 Die Behörden des Freistaates Bayern und die Körperschaften, Anstalten<br />
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die unmittelbar oder mittelbar<br />
seiner Aufsicht unterstehen (Behörden), stellen nach den Vorschriften<br />
dieses Hauptteils zu. 2 Im Widerspruchsverfahren wird nach den<br />
Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt.<br />
(2) 1 Gerichte können bei der Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten<br />
auch nach den Vorschriften zustellen, nach denen sie im Rahmen ihrer<br />
rechtsprechenden Tätigkeit zu verfahren haben. 2 Das gilt entsprechend<br />
für Staatsanwaltschaften.<br />
(3) Die Landesfinanzbehörden stellen nach den Vorschriften des<br />
Verwaltungszustellungsgesetzes zu.<br />
(4) Die Vorschriften dieses Hauptteils gelten nicht für Zustellungen nach der<br />
Justizbeitreibungsordnung und der Hinterlegungsordnung.<br />
(5) Zugestellt wird, wenn es durch Rechtsvorschrift oder behördliche<br />
Anordnung bestimmt ist.<br />
ZWEITER ABSCHNITT Arten der Zustellung<br />
Bay VwZVG Art. 2 Allgemeines<br />
(1) Zustellung ist die Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen<br />
Dokuments in der in diesem Gesetz bestimmten Form.<br />
(2) 1 Die Zustellung wird durch einen Erbringer von Postdienstleistungen<br />
(Post) oder durch die Behörde ausgeführt. 2 Daneben gelten die in den<br />
Art. 14, 15 und 17 geregelten Sonderarten der Zustellung.<br />
(3) Die Behörde hat die Wahl zwischen den einzelnen Zustellungsarten.<br />
Bay VwZVG Art. 3 Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde<br />
(1) Soll durch die Post mit Zustellungsurkunde zugestellt werden, übergibt die<br />
Behörde der Post den Zustellungsauftrag, das zuzustellende Dokument in<br />
einem verschlossenen Umschlag und einen vorbereiteten Vordruck einer<br />
Zustellungsurkunde.<br />
(2) 1 Für die Ausführung der Zustellung gelten die §§ 177 bis 182 der<br />
Zivilprozessordnung entsprechend. 2 Im Fall des § 181 Abs. 1 der<br />
Zivilprozessordnung kann das zuzustellende Dokument bei einer von der<br />
Post dafür bestimmten Stelle am Ort der Zustellung oder am Ort des<br />
Amtsgerichts, in dessen Bezirk der Ort der Zustellung liegt, niedergelegt<br />
werden oder bei der Behörde, die den Zustellungsauftrag erteilt hat, wenn<br />
sie ihren Sitz an einem der vorbezeichneten Orte hat. 3 Für die<br />
Zustellungsurkunde, den Zustellungsauftrag, den verschlossenen<br />
Umschlag nach Abs. 1 und die schriftliche Mitteilung nach § 181 Abs. 1
Satz 3 der Zivilprozessordnung sind die Vordrucke nach der<br />
Zustellungsvordruckverordnung zu verwenden.<br />
Bay VwZVG Art. 4 Zustellung durch die Post mittels Einschreiben<br />
(1) Ein Dokument kann durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe<br />
oder mittels Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden.<br />
(2) 1 Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein. 2 Im Übrigen gilt<br />
das Dokument am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es<br />
sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.<br />
3 Im Zweifel hat die Behörde den Zugang und dessen Zeitpunkt<br />
nachzuweisen. 4 Der Tag der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu<br />
vermerken. 5 An Stelle des Vermerks kann ein Vordruck mit der genauen<br />
Bezeichnung des zuzustellenden Dokuments (Betreff, Datum,<br />
Aktenzeichen) und dem eingedruckten, von der Post bestätigten<br />
Einlieferungsschein zu den Akten genommen werden.<br />
Bay VwZVG Art. 5 Zustellung durch die Behörde gegen<br />
Empfangsbekenntnis<br />
(1) 1 Bei der Zustellung durch die Behörde händigt der zustellende Bedienstete<br />
das Dokument dem Empfänger in einem verschlossenen Umschlag aus.<br />
2<br />
Das Dokument kann auch offen ausgehändigt werden, wenn keine<br />
schutzwürdigen Interessen des Empfängers entgegenstehen. 3 Der<br />
Empfänger hat ein mit dem Datum der Aushändigung versehenes<br />
Empfangsbekenntnis zu unterschreiben. 4 Der Bedienstete vermerkt das<br />
Datum der Zustellung auf dem Umschlag des auszuhändigenden<br />
Dokuments oder bei offener Aushändigung auf dem Dokument selbst.<br />
(2) 1 Die §§ 177 bis 181 der Zivilprozessordnung sind anzuwenden. 2 Zum<br />
Nachweis der Zustellung ist in den Akten zu vermerken:<br />
1. im Fall der Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen und<br />
Einrichtungen nach § 178 der Zivilprozessordnung der Grund, der diese<br />
Art der Zustellung rechtfertigt,<br />
2. im Fall der Zustellung bei verweigerter Annahme nach § 179 der<br />
Zivilprozessordnung, wer die Annahme verweigert hat und dass das<br />
Dokument am Ort der Zustellung zurückgelassen oder an den Absender<br />
zurückgesandt wurde sowie der Zeitpunkt und der Ort der verweigerten<br />
Annahme,<br />
3. in den Fällen der Ersatzzustellung nach §§ 180 und 181 der<br />
Zivilprozessordnung der Grund der Ersatzzustellung sowie wann und wo<br />
das Dokument in einen Briefkasten eingelegt oder sonst niedergelegt und<br />
in welcher Weise die Niederlegung schriftlich mitgeteilt wurde.<br />
3<br />
Im Fall des § 181 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann das zuzustellende<br />
Dokument bei der Behörde, die den Zustellungsauftrag erteilt hat,<br />
niedergelegt werden, wenn diese Behörde ihren Sitz am Ort der<br />
Zustellung oder am Ort des Amtsgerichts hat, in dessen Bezirk der Ort der<br />
Zustellung liegt.<br />
(3) 1 Zur Nachtzeit, an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf nach<br />
Abs. 1 und 2 im Inland nur mit schriftlicher oder elektronischer Erlaubnis<br />
des Behördenleiters oder seines Stellvertreters oder eines Beamten mit<br />
der Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst oder für das
Richteramt zugestellt werden. 2 Die Nachtzeit umfasst die Stunden von 21<br />
bis 6 Uhr. Die Erlaubnis ist bei der Zustellung in Kopie mitzuteilen. 3 Eine<br />
Zustellung, bei der diese Vorschriften nicht beachtet sind, ist wirksam,<br />
wenn die Annahme nicht verweigert wird.<br />
(4) 1 Das Dokument kann an Behörden, Körperschaften, Anstalten und<br />
Stiftungen des öffentlichen Rechts, an Rechtsanwälte, Patentanwälte,<br />
Notare, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer,<br />
vereidigte Buchprüfer, Steuerberatungsgesellschaften,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften auch<br />
auf andere Weise, auch elektronisch, gegen Empfangsbekenntnis<br />
zugestellt werden. 2 Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum<br />
und Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an die Behörde<br />
zurückzusenden ist.<br />
(5) 1 Ein elektronisches Dokument kann im Übrigen unbeschadet des Abs. 4<br />
elektronisch zugestellt werden, soweit der Empfänger hierfür einen<br />
Zugang eröffnet. 2 Das Dokument ist mit einer qualifizierten<br />
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. 3 Zum<br />
Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und Unterschrift<br />
versehene Empfangsbekenntnis, das an die Behörde zurückzusenden ist.<br />
Bay VwZVG Artikel 6 (weggefallen)<br />
DRITTER ABSCHNITT Gemeinsame Vorschriften für alle<br />
Zustellungsarten<br />
Bay VwZVG Art. 7 Zustellung an gesetzliche Vertreter<br />
(1) 1 Zustellungen für eine natürliche Person, die nicht handlungsfähig im Sinn<br />
des Art. 12 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist, sind an<br />
ihren gesetzlichen Vertreter zu richten. 2 Gleiches gilt bei Personen, für die<br />
ein Betreuer bestellt ist, soweit der Aufgabenkreis des Betreuers reicht.<br />
(2) Bei Behörden wird an den Behördenleiter, bei juristischen Personen, nicht<br />
rechtsfähigen Personenvereinigungen und Zweckvermögen an ihre<br />
gesetzlichen Vertreter zugestellt.<br />
(3) Bei mehreren gesetzlichen Vertretern oder Behördenleitern genügt die<br />
Zustellung an einen von ihnen.<br />
(4) Der zustellende Bedienstete braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift den<br />
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspricht.<br />
Bay VwZVG Art. 8 Zustellung an Bevollmächtigte<br />
(1) 1 Zustellungen können an den allgemein oder für bestimmte<br />
Angelegenheiten bestellten Bevollmächtigten gerichtet werden. 2 Sie sind<br />
an ihn zu richten, wenn er schriftliche Vollmacht vorgelegt hat. 3 Ist ein<br />
Bevollmächtigter für mehrere Beteiligte bestellt, so genügt die Zustellung<br />
eines Dokuments an ihn für alle Beteiligten.<br />
(2) Einem Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele<br />
Ausfertigungen oder Kopien zuzustellen, als Beteiligte vorhanden sind.
Bay VwZVG Art. 8 a Zustellung an Ehegatten<br />
1 Betrifft ein zusammengefaßter schriftlicher Bescheid Ehegatten oder<br />
Ehegatten mit ihren Kindern oder Alleinstehende mit ihren Kindern, so reicht<br />
es für die Zustellung an alle Beteiligten aus, wenn ihnen eine Ausfertigung<br />
unter ihrer gemeinsamen Anschrift zugestellt wird. 2 Der Bescheid ist den<br />
Beteiligten einzeln zuzustellen, soweit sie dies beantragt haben.<br />
Bay VwZVG Art. 9 Heilung von Zustellungsmängeln<br />
Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder<br />
ist es unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen, gilt es<br />
als in dem Zeitpunkt zugestellt, in dem es dem Empfangsberechtigten<br />
tatsächlich zugegangen ist, im Fall des Art. 5 Abs. 5 in dem Zeitpunkt, in dem<br />
der Empfänger das Empfangsbekenntnis zurückgesendet hat.<br />
VIERTER ABSCHNITT (weggefallen)<br />
Bay VwZVG Art. 10 bis 13 (weggefallen)<br />
FÜNFTER ABSCHNITT Sonderarten der Zustellung<br />
Bay VwZVG Art. 14 Zustellung im Ausland<br />
(1) Eine Zustellung im Ausland erfolgt<br />
1. durch Einschreiben mit Rückschein, soweit die Zustellung von<br />
Dokumenten unmittelbar durch die Post völkerrechtlich zulässig ist,<br />
2. auf Ersuchen der Behörde durch die Behörden des fremden Staates<br />
oder durch die zuständige diplomatische oder konsularische Vertretung<br />
der Bundesrepublik Deutschland,<br />
3. auf Ersuchen der Behörde durch das Auswärtige Amt an eine Person,<br />
die das Recht der Immunität genießt und zu einer Vertretung der<br />
Bundesrepublik Deutschland im Ausland gehört, sowie an<br />
Familienangehörige einer solchen Person, wenn diese das Recht der<br />
Immunität genießen, oder<br />
4. durch Übermittlung elektronischer Dokumente nach Art. 5 Abs. 5,<br />
soweit dies völkerrechtlich zulässig ist.<br />
(2) 1 Zum Nachweis der Zustellung nach Abs. 1 Nr. 1 genügt der Rückschein.<br />
2<br />
Die Zustellung nach Abs. 1 Nrn. 2 und 3 wird durch das Zeugnis der<br />
ersuchten Behörde nachgewiesen. 3 Zum Nachweis der Zustellung gemäß<br />
Abs. 1 Nr. 4 genügt das Empfangsbekenntnis nach Art. 5 Abs. 5 Satz 3.<br />
(3) 1 Die Behörde kann bei der Zustellung nach Abs. 1 Nrn. 2 und 3 anordnen,<br />
dass die Person, an die zugestellt werden soll, innerhalb einer<br />
angemessenen Frist einen Zustellungsbevollmächtigten benennt, der im<br />
Inland wohnt oder dort einen Geschäftsraum hat. 2 Wird kein<br />
Zustellungsbevollmächtigter benannt, können spätere Zustellungen bis zur<br />
nachträglichen Benennung dadurch bewirkt werden, dass das Dokument<br />
unter der Anschrift der Person, an die zugestellt werden soll, zur Post<br />
gegeben wird. 3 Das Dokument gilt am siebenten Tag nach Aufgabe zur<br />
Post als zugestellt, wenn nicht feststeht, dass es den Empfänger nicht<br />
oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat. 4 Die Behörde kann eine
längere Frist bestimmen. 5 In der Anordnung nach Satz 1 ist auf diese<br />
Rechtsfolgen hinzuweisen. 6 Zum Nachweis der Zustellung ist in den Akten<br />
zu vermerken, zu welcher Zeit und unter welcher Anschrift das Dokument<br />
zur Post gegeben wurde.<br />
Bay VwZVG Art. 15 Öffentliche Zustellung<br />
(1) 1 Zustellung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn<br />
1. der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung<br />
an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist,<br />
2. der Inhaber der Wohnung, in der zugestellt werden müsste, der<br />
inländischen Gerichtsbarkeit nicht unterworfen und die Zustellung in der<br />
Wohnung deshalb nicht möglich ist, oder<br />
3. sie im Fall des Art. 14 nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.<br />
2<br />
Die Anordnung über die öffentliche Zustellung trifft ein<br />
zeichnungsberechtigter Bediensteter.<br />
(2) 1 Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung einer<br />
Benachrichtigung an der Stelle, die von der Behörde hierfür allgemein<br />
bestimmt ist, oder durch Veröffentlichung einer Benachrichtigung im<br />
Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger. 2 Die<br />
Benachrichtigung muss<br />
1. die Behörde, für die zugestellt wird,<br />
2. Namen und die letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten,<br />
3. das Datum und das Aktenzeichen des Dokuments sowie<br />
4. die Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann,<br />
erkennen lassen.<br />
3<br />
Die Benachrichtigung muss den Hinweis enthalten, dass das Dokument<br />
öffentlich zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach<br />
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 4 Bei der Zustellung einer<br />
Ladung muss die Benachrichtigung den Hinweis enthalten, dass das<br />
Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, dessen Versäumung<br />
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 5 In den Akten ist zu vermerken,<br />
von wann bis wann und wie die Benachrichtigung bekannt gemacht wurde.<br />
6<br />
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der<br />
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.<br />
Bay VwZVG Artikel 16 (weggefallen)<br />
Bay VwZVG Art. 17 Zustellungen im Besteuerungsverfahren und bei<br />
der Heranziehung zu sonstigen öffentlichen Abgaben und Umlagen<br />
(1) Die Zustellung von schriftlichen Bescheiden, die im Besteuerungsverfahren<br />
und bei der Heranziehung zu sonstigen öffentlichen Abgaben und Umlagen<br />
ergehen, kann dadurch ersetzt werden, daß der Bescheid dem Empfänger<br />
durch einfachen Brief verschlossen zugesandt wird.<br />
(2) 1 Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem<br />
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, daß das<br />
zuzusendende Schriftstück nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt<br />
zugegangen ist. 2 Im Zweifel hat die Behörde den Zugang des<br />
Schriftstücks und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
(3) 1 Die Aufgabe geschieht durch Einwerfen in einen Postbriefkasten oder<br />
Einlieferung bei der Post. 2 Bei Einwurf in einen Straßenbriefkasten gilt der<br />
Tag der auf den Einwurf folgenden Leerung als Tag der Aufgabe zur Post.<br />
(4) 1 Auf der bei den Akten verbleibenden Urschrift ist der Tag der Aufgabe<br />
zur Post zu vermerken; des Namenszeichens des damit beauftragten<br />
Bediensteten bedarf es nicht. 2 Bei der Zustellung maschinell erstellter<br />
Bescheide können an Stelle des Vermerks die Bescheide numeriert und die<br />
Absendung in einer Sammelliste eingetragen werden.<br />
ZWEITER HAUPTTEIL Vollstreckungsverfahren<br />
ERSTER ABSCHNITT Gemeinsame Vorschriften<br />
Bay VwZVG Art. 18 Geltungsbereich<br />
(1) Verwaltungsakte, die zur Leistung von Geld oder zu einem sonstigen<br />
Handeln, einem Dulden oder einem Unterlassen verpflichten oder zu einer<br />
unmittelbar kraft einer Rechtsnorm bestehenden solchen Pflicht anhalten,<br />
werden nach diesem Gesetz vollstreckt, soweit die Vollstreckung nicht<br />
durch Bundesrecht unmittelbar geregelt ist oder bundesrechtliche<br />
Vollstreckungsvorschriften durch <strong>Landesrecht</strong> für anwendbar erklärt sind.<br />
(2) Die Vorschriften des Polizeiaufgabengesetzes bleiben unberührt.<br />
Bay VwZVG Art. 19 Voraussetzungen der Vollstreckung<br />
(1) Verwaltungsakte können vollstreckt werden,<br />
1. wenn sie nicht mehr mit einem förmlichen Rechtsbehelf angefochten<br />
werden können oder<br />
2. wenn der förmliche Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat oder<br />
3. wenn die sofortige Vollziehung angeordnet ist.<br />
(2) Die Vollstreckung setzt voraus, daß der zur Zahlung von Geld oder zu<br />
einer sonstigen Handlung, einer Duldung oder einer Unterlassung<br />
Verpflichtete (Vollstreckungsschuldner) seine Verpflichtung nicht<br />
rechtzeitig erfüllt.<br />
Bay VwZVG Art. 20 Begriffsbestimmungen<br />
Im Sinn dieses <strong>Gesetze</strong>s ist<br />
1. Anordnungsbehörde die Behörde, die den zu vollstreckenden Verwaltungsakt<br />
erlassen hat,<br />
2. Vollstreckungsbehörde die Behörde, die zur Vollstreckung eines<br />
Verwaltungsakts zuständig ist,<br />
3. Vollstreckungsgericht das um die Vollstreckung ersuchte Amtsgericht.<br />
Bay VwZVG Art. 21 Einwendungen gegen den zu vollstreckenden<br />
Anspruch<br />
1 Über Einwendungen gegen die Vollstreckung, die den zu vollstreckenden<br />
Anspruch betreffen, entscheidet die Anordnungsbehörde. 2 Sie sind nur<br />
zulässig, soweit die geltend gemachten Gründe erst nach Erlaß des zu<br />
vollstreckenden Verwaltungsakts entstanden sind und mit förmlichen<br />
Rechtsbehelfen nicht mehr geltend gemacht werden können.
Bay VwZVG Art. 21 a Sofortige Vollziehbarkeit<br />
1 Rechtsbehelfe haben keine aufschiebende Wirkung, soweit sie sich gegen<br />
Maßnahmen richten, die in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden.<br />
2 § 80 Abs. 4, 5, 7 und 8 der Verwaltungsgerichtsordnung gelten entsprechend.<br />
Bay VwZVG Art. 22 Einstellung der Vollstreckung<br />
Vollstreckungsmaßnahmen sind einzustellen, wenn und soweit<br />
1. sie für unzulässig erklärt werden oder<br />
2. der zu vollstreckende Verwaltungsakt rechtskräftig aufgehoben wird oder<br />
3. die Verpflichtung offensichtlich erloschen ist oder<br />
4. die Anordnungsbehörde aus sonstigen Gründen um die Einstellung ersucht.<br />
ZWEITER ABSCHNITT Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit<br />
denen eine Geldleistung gefordert wird<br />
Bay VwZVG Art. 23 Besondere Voraussetzungen der Vollstreckung<br />
(1) Ein Verwaltungsakt, mit dem eine öffentlich-rechtliche Geldleistung<br />
gefordert wird (Leistungsbescheid), kann vollstreckt werden, wenn<br />
1. er dem Leistungspflichtigen zugestellt ist,<br />
2. die Forderung fällig ist und<br />
3. der Leistungspflichtige von der Anordnungsbehörde oder von der für sie<br />
zuständigen Kasse oder Zahlstelle nach Eintritt der Fälligkeit durch<br />
verschlossenen Brief, durch Nachnahme oder durch ortsübliche öffentliche<br />
Bekanntmachung ergebnislos aufgefordert worden ist, innerhalb einer<br />
bestimmten Frist von mindestens einer Woche zu leisten (Mahnung).<br />
(2) Bei Verwaltungsakten, die bei der Festsetzung und Erhebung von<br />
Realsteuern ergehen, genügt an Stelle der Zustellung die Zusendung<br />
gemäß Art. 17.<br />
(3) Die Mahnung kann unterbleiben, wenn die sofortige Vollstreckung im<br />
überwiegenden öffentlichen Interesse liegt oder wenn die Mahnung den<br />
Vollstreckungserfolg gefährden würde.<br />
Bay VwZVG Art. 24 Vollstreckungsanordnung<br />
(1) Die Anordnungsbehörde oder die für sie zuständige Kasse oder Zahlstelle<br />
ordnet die Vollstreckung dadurch an, daß sie<br />
1. in den Fällen des Art. 25 das Finanzamt oder die nach dem Recht eines<br />
anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland oder die nach einer<br />
völkerrechtlichen Vereinbarung zuständige Stelle um Beitreibung ersucht<br />
und auf das Beitreibungsersuchen die Erklärung setzt, daß der<br />
beizutreibende Anspruch vollstreckbar ist;<br />
2. in den Fällen der Art. 26 und 27 auf eine Ausfertigung des<br />
Leistungsbescheids oder eines Ausstandsverzeichnisses die Klausel setzt:<br />
“Diese Ausfertigung ist vollstreckbar”.<br />
(2) Mit der Vollstreckungsanordnung übernimmt die Anordnungsbehörde oder<br />
die für sie zuständige Kasse oder Zahlstelle die Verantwortung dafür, daß<br />
die in den Art. 19 und 23 bezeichneten Voraussetzungen der<br />
Zwangsvollstreckung gegeben sind.
(3) Bei einer Vollstreckungsanordnung, die mit Hilfe automatischer<br />
Einrichtungen erlassen wird, können Unterschrift und Dienstsiegel fehlen.<br />
Bay VwZVG Art. 25 Vollstreckung von Geldforderungen des Staates<br />
(1) Vollstreckungsbehörden für Leistungsbescheide des Staates sind die<br />
Finanzämter.<br />
(2) 1 Für das Verfahren der Finanzämter und die Kosten der Vollstreckung<br />
gelten die Vorschriften der Abgabenordnung und der zu ihrer<br />
Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften entsprechend. 2 Soweit nicht<br />
ein anderer Rechtsweg ausdrücklich gegeben ist, findet die<br />
Finanzgerichtsordnung Anwendung.<br />
Bay VwZVG Art. 26 Vollstreckung von Geldforderungen der Gemeinden<br />
und Gemeindeverbände<br />
(1) Gemeinden, Landkreise, Bezirke und Zweckverbände sind berechtigt, zur<br />
Beitreibung von Geldforderungen, die sie durch einen Leistungsbescheid<br />
geltend machen, eine Vollstreckungsanordnung zu erteilen.<br />
(2) Für die Vollstreckung sind die ordentlichen Gerichte zuständig.<br />
(3) Die Pfändung und Verwertung beweglicher Sachen können die Gemeinden,<br />
Landkreise, Bezirke und Zweckverbände durch Gerichtsvollzieher oder<br />
innerhalb ihres Gebiets durch eigene Vollstreckungsbedienstete bewirken<br />
lassen.<br />
(4) 1 Schon vor der Pfändung einer Geldforderung können die Gemeinden,<br />
Landkreise, Bezirke und Zweckverbände dem Drittschuldner verbieten, vor<br />
der Entscheidung des Vollstreckungsgerichts an den Schuldner zu zahlen,<br />
und dem Schuldner gebieten, sich vor dieser Entscheidung jeder<br />
Verfügung über die Forderung zu enthalten. 2 Diese Anordnungen verlieren<br />
ihre Wirkung, wenn die Pfändung der Forderung nicht innerhalb von drei<br />
Wochen bewirkt wird. 3 Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das<br />
Zahlungsverbot dem Drittschuldner zugestellt wird.<br />
(5) 1 Gemeinden, Landkreise, Bezirke und Zweckverbände können<br />
Geldforderungen und andere Vermögensrechte, die nicht Gegenstand der<br />
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen sind, selbst pfänden<br />
und einziehen, wenn Schuldner und der Drittschuldner ihren gewöhnlichen<br />
Aufenthalt oder Sitz in Bayern haben. 2 Dies gilt auch, wenn Schuldner<br />
oder der Drittschuldner oder beide ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder<br />
Sitz in einem anderen Land haben, sofern das dort geltende <strong>Landesrecht</strong><br />
dies zuläßt. 3 Kommunale Vollstreckungsbehörden, die ihren Sitz in einem<br />
anderen Land haben, können Geldforderungen und andere<br />
Vermögensrechte, die nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das<br />
unbewegliche Vermögen sind, auch dann selbst pfänden und einziehen,<br />
wenn der Schuldner oder der Drittschuldner oder beide ihren<br />
gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in Bayern haben.<br />
(6) Für die Bezirke üben die Regierungen die Befugnisse nach den Absätzen 3,<br />
4 und 5 aus, soweit diese Aufgaben nach Art. 35 b der Bezirksordnung auf<br />
den Freistaat Bayern übertragen sind.<br />
(7) 1 Die Vorschriften des Achten Buchs der Zivilprozeßordnung über die<br />
Zwangsvollstreckung mit Ausnahme der §§ 883 bis 898 sind entsprechend
anzuwenden. 2 Nach der Zivilprozeßordnung regelt sich auch die<br />
Entscheidung über Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen der<br />
Vollstreckungsgerichte und Gerichtsvollzieher. 3 Rechtsbehelfe gegen die<br />
Pfändung und Verwertung beweglicher Sachen durch eigene<br />
Vollstreckungsbedienstete der Gemeinden, Landkreise, Bezirke und<br />
Zweckverbände und gegen die Pfändung und Einziehung von<br />
Geldforderungen und andere Vermögensrechte durch Gemeinden,<br />
Landkreise und Bezirke und durch die für die Bezirke handelnden<br />
Regierungen (Absatz 6) unterliegen der verwaltungsgerichtlichen<br />
Entscheidung.<br />
Bay VwZVG Art. 27 Vollstreckung von Geldforderungen sonstiger<br />
juristischer Personen des öffentlichen Rechts<br />
(1) 1 Für die Vollstreckung von Geldforderungen sonstiger juristischer<br />
Personen des öffentlichen Rechts gilt Art. 26 entsprechend, soweit sie<br />
Verwaltungsakte erlassen können und zur Anbringung der<br />
Vollstreckungsklausel befugt sind. 2 Zur Pfändung und Einziehung von<br />
Geldforderungen sind diese juristischen Personen jedoch nicht befugt.<br />
(2) 1 Soweit die juristische Person des öffentlichen Rechts ihre<br />
Geldforderungen durch Verwaltungsakt geltend machen darf, kann die<br />
Staatsregierung durch Rechtsverordnung die Befugnis zur Anbringung der<br />
Vollstreckungsklausel erteilen, wenn bei der juristischen Person des<br />
öffentlichen Rechts gewährleistet ist, daß die Vollstreckungsverfahren<br />
ordnungsgemäß durchgeführt werden. 2 Art. 98 Abs. 4 der<br />
Gemeindeordnung, Art. 85 Abs. 4 der Landkreisordnung und Art. 81 b<br />
Abs. 4 der Bezirksordnung bleiben unberührt.<br />
Bay VwZVG Art. 28 Erstattungsanspruch<br />
(1) 1 Ist zu Unrecht vollstreckt worden, weil kein vollstreckbarer<br />
Verwaltungsakt vorlag oder weil er ganz oder teilweise aufgehoben wurde<br />
oder weil die Geldforderung nach Erlaß des zu vollstreckenden<br />
Verwaltungsakts erloschen ist oder gestundet wurde oder das<br />
Zwangsverfahren gegen den nicht durchgeführt werden durfte, gegen den<br />
es gerichtet war, so ist der zu Unrecht gezahlte Betrag zu erstatten.<br />
2<br />
Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.<br />
(2) Über den Erstattungsanspruch entscheidet die Anordnungsbehörde.<br />
DRITTER ABSCHNITT Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit<br />
denen eine Handlung, Duldung oder Unterlassung gefordert wird<br />
Bay VwZVG Art. 29 Zulässigkeit des Verwaltungszwangs; Zwangsmittel<br />
(1) Verwaltungsakte, mit denen die Herausgabe einer Sache, die Vornahme<br />
einer sonstigen Handlung oder eine Duldung oder eine Unterlassung<br />
gefordert wird, können nach den Vorschriften dieses Abschnitts mit<br />
Zwangsmitteln vollstreckt werden (Verwaltungszwang).<br />
(2) Zwangsmittel sind<br />
1. das Zwangsgeld (Art. 31),<br />
2. die Ersatzvornahme (Art. 32),
3. die Ersatzzwangshaft (Art. 33),<br />
4. der unmittelbare Zwang (Art. 34).<br />
(3) 1 Das Zwangsmittel muß in angemessenem Verhältnis zu seinem Zweck<br />
stehen. 2 Dabei ist das Zwangsmittel möglichst so zu bestimmen, daß der<br />
Betroffene und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt werden.<br />
(4) Gegen Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ist<br />
Verwaltungszwang nur zulässig, soweit er durch Gesetz oder auf Grund<br />
eines <strong>Gesetze</strong>s besonders zugelassen ist.<br />
Bay VwZVG Art. 30 Zuständigkeit<br />
(1) 1 Die Anordnungsbehörde vollstreckt ihre Verwaltungsakte innerhalb ihres<br />
Bereichs grundsätzlich selbst; sie vollstreckt auch die im<br />
Verwaltungsverfahren ergangenen Rechtsbehelfsentscheidungen. 2 Die<br />
Abschiebung von Ausländern obliegt der Polizei; hierfür gelten die<br />
Vorschriften des Polizeiaufgabengesetzes. 3 Abmeldungsbescheide der<br />
Zulassungsbehörden wegen nicht entrichteter Kraftfahrzeugsteuer<br />
vollstrecken die Finanzämter; für das Verfahren der Finanzämter und die<br />
Kosten der Vollstreckung gelten die Vorschriften der Abgabenordnung und<br />
der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften entsprechend;<br />
Art. 35 dieses <strong>Gesetze</strong>s bleibt unberührt.<br />
(2) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde, in deren Gebiet die Zwangsmittel<br />
angewendet werden müssen, ist auf Ersuchen einer anderen<br />
Anordnungsbehörde zur Durchführung des Verwaltungszwangs<br />
verpflichtet; sie ist dann Vollstreckungsbehörde. 2 Vollstreckt ein<br />
Landratsamt als ersuchte Kreisverwaltungsbehörde, so ist die<br />
Vollstreckung eine staatliche Aufgabe. 3 Ist die ersuchte<br />
Kreisverwaltungsbehörde eine kreisfreie Gemeinde, so ist die<br />
Durchführung des Ersuchens eine übertragene Aufgabe. 4 Ist die<br />
ersuchende Stelle die Rechtsaufsichtsbehörde der ersuchten Gemeinde<br />
oder ist sie hinsichtlich des zu vollstreckenden Verwaltungsakts ihre<br />
Fachaufsichtsbehörde, so ist sie zu Weisungen über die Wahl und die<br />
Anwendung des Zwangsmittels befugt, wenn dies zur Erreichung des mit<br />
der Vollstreckung angestrebten Erfolgs erforderlich ist.<br />
(3) 1 Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften vollstrecken ihre<br />
Verwaltungsakte selbst oder lassen sie durch die Kreisverwaltungsbehörde<br />
nach Absatz 2 vollstrecken. 2 Im übrigen können juristische Personen des<br />
öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaften sind, ihre<br />
Verwaltungsakte nur durch die Kreisverwaltungsbehörde nach Absatz 2<br />
vollstrecken lassen, wenn sie nicht durch besonderes Gesetz oder auf<br />
Grund eines besonderen <strong>Gesetze</strong>s selbst zur Anwendung von<br />
Verwaltungszwang ermächtigt sind. 3 Zur Androhung von Zwangsmitteln<br />
sind sie jedoch stets befugt.<br />
Bay VwZVG Art. 31 Zwangsgeld<br />
(1) Wird die Pflicht zu einer Handlung, einer Duldung oder einer Unterlassung<br />
nicht oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit erfüllt, so kann<br />
die Vollstreckungsbehörde den Pflichtigen durch ein Zwangsgeld zur<br />
Erfüllung anhalten.
(2) 1 Das Zwangsgeld beträgt mindestens fünfzehn und höchstens<br />
fünfzigtausend Euro. 2 Das Zwangsgeld soll das wirtschaftliche Interesse,<br />
das der Pflichtige an der Vornahme oder am Unterbleiben der Handlung<br />
hat, erreichen. 3 Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so<br />
kann es überschritten werden. 4 Das wirtschaftliche Interesse des<br />
Pflichtigen ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen.<br />
(3) 1 Das Zwangsgeld wird nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts<br />
beigetrieben. 2 Die Androhung des Zwangsgeldes (Art. 36) ist dabei ein<br />
Leistungsbescheid im Sinn des Art. 23 Abs. 1. 3 Wird die Pflicht nach<br />
Absatz 1 bis zum Ablauf der Frist des Art. 36 Abs. 1 Satz 2 nicht erfüllt, so<br />
wird die Zwangsgeldforderung fällig (Art. 23 Abs. 1 Nr. 2).<br />
Bay VwZVG Art. 32 Ersatzvornahme<br />
1 Wird die Pflicht zu einer Handlung, die auch ein anderer vornehmen kann<br />
(vertretbare Handlung), nicht oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen<br />
Zeit erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehörde die Handlung auf Kosten des<br />
Pflichtigen vornehmen lassen. 2 Die Ersatzvornahme ist nur zulässig, wenn ein<br />
Zwangsgeld keinen Erfolg erwarten läßt.<br />
Bay VwZVG Art. 33 Ersatzzwangshaft<br />
(1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich und verspricht auch unmittelbarer<br />
Zwang keinen Erfolg, so kann das Verwaltungsgericht nach Anhörung des<br />
Pflichtigen auf Antrag der Vollstreckungsbehörde durch Beschluß<br />
Ersatzzwangshaft anordnen, wenn der Pflichtige bei der Androhung des<br />
Zwangsgeldes auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist.<br />
(2) Die Ersatzzwangshaft beträgt mindestens einen Tag und höchstens zwei<br />
Wochen.<br />
(3) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Vollstreckungsbehörde von der<br />
Justizverwaltung nach den §§ 904 bis 911 der Zivilprozeßordnung zu<br />
vollstrecken.<br />
Bay VwZVG Art. 34 Unmittelbarer Zwang<br />
1 Führen die sonstigen zulässigen Zwangsmittel nicht zum Ziel oder würden sie<br />
dem Pflichtigen einen erheblich größeren Nachteil verursachen als<br />
unmittelbarer Zwang oder läßt ihre Anwendung keinen zweckentsprechenden<br />
und rechtzeitigen Erfolg erwarten, so kann die Vollstreckungsbehörde den<br />
Verwaltungsakt durch unmittelbaren Zwang vollziehen. 2 Die<br />
Vollstreckungsbehörde kann unmittelbaren Zwang auch dann anwenden, wenn<br />
gegen die Ersatzvornahme Widerstand geleistet wird.<br />
Bay VwZVG Art. 35 Zwangsmittel in unaufschiebbaren Fällen<br />
Ersatzvornahme und unmittelbarer Zwang können innerhalb der Zuständigkeit<br />
der handelnden Behörde ohne vorausgehende Androhung angewendet werden,<br />
wenn es zur Verhütung oder Unterbindung einer mit Strafe bedrohten<br />
Handlung oder zur Abwehr einer drohenden Gefahr oder zur Durchführung der<br />
Abmeldung nicht versteuerter Kraftfahrzeuge von Amts wegen notwendig ist.
Bay VwZVG Art. 36 Androhung der Zwangsmittel<br />
(1) 1 Die Zwangsmittel müssen unbeschadet des Art. 34 Satz 2 und des<br />
Art. 35 schriftlich angedroht werden. 2 Hierbei ist für die Erfüllung der<br />
Verpflichtung eine Frist zu bestimmen, innerhalb welcher dem Pflichtigen<br />
der Vollzug billigerweise zugemutet werden kann.<br />
(2) 1 Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch<br />
den die Handlung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben wird. 2 Sie soll<br />
mit ihm verbunden werden, wenn der sofortige Vollzug angeordnet ist<br />
oder wenn den Rechtsbehelfen keine aufschiebende Wirkung zukommt.<br />
(3) 1 Es muß ein bestimmtes Zwangsmittel angedroht werden. 2 Es darf nicht<br />
angedroht werden, daß mehrere Zwangsmittel gleichzeitig angewendet<br />
werden.<br />
(4) 1 Soll die Handlung durch Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen<br />
ausgeführt werden, so ist in der Androhung der Kostenbetrag vorläufig zu<br />
veranschlagen. 2 In der Androhung kann bestimmt werden, daß dieser<br />
Betrag bereits vor der Durchführung der Ersatzvornahme fällig wird. 3 Das<br />
Recht auf Nachforderung bleibt unberührt, wenn die Ersatzvornahme<br />
einen höheren Kostenaufwand verursacht.<br />
(5) Der Betrag des Zwangsgeldes ist in bestimmter Höhe anzudrohen.<br />
(6) 1 Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße<br />
angedroht werden. 2 Eine neue Androhung ist erst dann zulässig, wenn die<br />
vorausgegangene Androhung des Zwangsmittels erfolglos geblieben ist.<br />
(7) 1 Die Androhung ist zuzustellen. 2 Das gilt auch dann, wenn sie mit dem<br />
zugrundeliegenden Verwaltungsakt verbunden ist und für ihn keine<br />
Zustellung vorgesehen ist.<br />
Bay VwZVG Art. 37 Anwendung der Zwangsmittel<br />
(1) 1 Wird die Verpflichtung nicht innerhalb der in der Androhung bestimmten<br />
Frist erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehörde das angedrohte<br />
Zwangsmittel anwenden. 2 Zwangsmittel können so lange und so oft<br />
angewendet werden, bis die Verpflichtung erfüllt ist. 3 Die zur<br />
Durchsetzung eines bestimmten Verwaltungsakts insgesamt festgesetzte<br />
Ersatzzwangshaft darf jedoch die Höchstdauer von vier Wochen nicht<br />
übersteigen.<br />
(2) Soweit zur Anwendung unmittelbaren Zwangs die Heranziehung von<br />
Polizeibeamten erforderlich ist, hat die örtlich zuständige<br />
Polizeidienststelle auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde Hilfe zu leisten.<br />
(3) 1 Die mit der Durchführung des Verwaltungszwangs beauftragten<br />
Bediensteten der Vollstreckungsbehörde und Polizeibeamten sind, soweit<br />
es der Zweck der Vollstreckung erfordert, befugt, die Wohnung des<br />
Pflichtigen zu betreten und verschlossene Türen und Behältnisse zu<br />
öffnen. 2 Sie dürfen zur Nachtzeit (Art. 12 Abs. 2), an Sonntagen und an<br />
gesetzlichen Feiertagen ein Zwangsmittel nur mit schriftlicher Erlaubnis<br />
der Vollstreckungsbehörde anwenden.<br />
(4) 1 Die Anwendung der Zwangsmittel ist einzustellen, sobald der Pflichtige<br />
seiner Verpflichtung nachkommt. 2 Ein angedrohtes Zwangsgeld ist jedoch<br />
beizutreiben, wenn der Duldungs- oder Unterlassungspflicht
zuwidergehandelt worden ist, deren Erfüllung durch die Androhung des<br />
Zwangsgeldes erreicht werden sollte; sind weitere Zuwiderhandlungen<br />
nicht mehr zu befürchten, so kann die Vollstreckungsbehörde von der<br />
Beitreibung absehen, wenn diese eine besondere Härte darstellen würde.<br />
Bay VwZVG Art. 38 Rechtsbehelfe<br />
(1) 1 Gegen die Androhung des Zwangsmittels sind die förmlichen<br />
Rechtsbehelfe gegeben, die gegen den Verwaltungsakt zulässig sind,<br />
dessen Durchsetzung erzwungen werden soll. 2 Ist die Androhung mit dem<br />
zugrundeliegenden Verwaltungsakt verbunden, so erstreckt sich der<br />
förmliche Rechtsbehelf zugleich auf den Verwaltungsakt, soweit er nicht<br />
bereits Gegenstand eines Rechtsbehelfs- oder gerichtlichen Verfahrens ist<br />
oder der Rechtsbehelf ausdrücklich auf die Androhung des Zwangsmittels<br />
beschränkt wird. 3 Ist die Androhung nicht mit dem zugrundeliegenden<br />
Verwaltungsakt verbunden und ist dieser unanfechtbar geworden, so kann<br />
die Androhung nur insoweit angefochten werden, als eine<br />
Rechtsverletzung durch die Androhung selbst behauptet wird.<br />
(2) Wird ein Zwangsmittel nach Art. 35 ohne vorausgehende Androhung<br />
angewendet, so sind die förmlichen Rechtsbehelfe zulässig, die gegen<br />
Verwaltungsakte allgemein gegeben sind.<br />
(3) Förmliche Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen der Vollstreckungsbehörde bei<br />
der Anwendung eines Zwangsmittels sind insoweit zulässig, als geltend<br />
gemacht werden kann, daß diese Maßnahmen eine selbständige<br />
Rechtsverletzung darstellen.<br />
Bay VwZVG Art. 39 Anspruch auf Beseitigung von Vollstreckungsfolgen<br />
1 Ist Verwaltungszwang zur Vollstreckung eines Verwaltungsakts angewendet<br />
worden, weil die sofortige Vollziehung angeordnet war oder die Anfechtung mit<br />
einem förmlichen Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hatte (Art. 19<br />
Abs. 1 Nrn. 2 und 3), so kann der Pflichtige die Beseitigung der<br />
Vollstreckungsfolgen insoweit verlangen, als der Verwaltungsakt nach der<br />
Vollstreckung rechtskräftig aufgehoben oder abgeändert wird. 2 Ein gleicher<br />
Anspruch besteht, wenn der Verwaltungszwang nach Art. 35 durchgeführt<br />
wurde und nachträglich rechtskräftig festgestellt wird, daß dem Pflichtigen<br />
hierdurch rechtswidrig ein Nachteil verursacht wurde. 3 Weitergehende<br />
Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.<br />
VIERTER ABSCHNITT Einschränkungen von Grundrechten<br />
Bay VwZVG Art. 40<br />
Nach diesem Hauptteil können das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das<br />
Recht auf Freiheit der Person, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung<br />
und das Recht auf Eigentum eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und<br />
2, Art. 13 und 14 des Grundgesetzes, Art. 102 Abs. 1, Art. 106 Abs. 3 und<br />
Art. 103 der Verfassung).
FÜNFTER ABSCHNITT Kosten<br />
Bay VwZVG Art. 41 Kostenschuldner; Kostenersatz;<br />
Forderungsübergang; Zwangsgelder<br />
(1) 1 Für Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren werden Kosten nach<br />
dem Kostengesetz erhoben, soweit nicht bundesrechtliche<br />
Kostenvorschriften unmittelbar gelten oder landesrechtlich für anwendbar<br />
erklärt sind. 2 Kostenschuldner ist der Vollstreckungsschuldner; das gilt<br />
auch dann, wenn die Vollstreckungsbehörde auf Veranlassung der<br />
Anordnungsbehörde tätig wird.<br />
(2) 1 Wenn Behörden Verwaltungsakte vollstrecken, die sie nicht selbst<br />
erlassen haben, so können sie von den juristischen Personen des<br />
öffentlichen Rechts, denen die Anordnungsbehörden angehören, Ersatz<br />
der Kosten verlangen, die beim Vollstreckungsschuldner nicht beigetrieben<br />
werden können, sofern diese im Einzelfall fünfundzwanzig Euro<br />
übersteigen. 2 Die Kostenforderung gegen den Vollstreckungsschuldner<br />
geht insoweit auf diese juristische Person über, als sie Ersatz leistet.<br />
(3) Zwangsgelder fließen der Vollstreckungsbehörde zu.<br />
Bay VwZVG Art. 41 a Kosten der Ersatzvornahme<br />
1 Der Kostenbetrag einer Ersatzvornahme ist ab Fälligkeit mit einem Zinssatz<br />
von sechs v. H. zu verzinsen. 2 Von der Erhebung geringfügiger Zinsen kann<br />
abgesehen werden.<br />
DRITTER HAUPTTEIL Übergangs- und Schlußbestimmungen<br />
Bay VwZVG Art. 42 Durchführungsvorschriften<br />
1 Die zur Durchführung dieses <strong>Gesetze</strong>s erforderlichen Rechtsvorschriften erläßt<br />
die Staatsregierung. 2 Die Zuständigkeit des Staatsministeriums der Finanzen<br />
in kostenrechtlichen Angelegenheiten bleibt unberührt.<br />
Bay VwZVG Art. 43 Vollstreckung öffentlich-rechtlicher<br />
Geldforderungen nach § 350 b Abs. 5 des Lastenausgleichsgesetzes<br />
(1) 1 Öffentlich-rechtliche Geldforderungen des Bundes nach § 350 b des<br />
Lastenausgleichsgesetzes werden nach den Bestimmungen dieses<br />
<strong>Gesetze</strong>s über die Vollstreckung von Geldforderungen des Staates<br />
beigetrieben. 2 Dieses Gesetz tritt an die Stelle des Verwaltungs-<br />
Vollstreckungsgesetzes (VwVG).<br />
(2) Anordnungsbehörden sind die Regierungen.<br />
Bay VwZVG Art. 44 Finanzämter als Vollstreckungsbehörden für<br />
bestimmte Fälle<br />
Für Vollstreckungen nach § 66 Abs. 2 des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch und<br />
nach § 200 Abs. 2 des Sozialgerichtsgesetzes ist Vollstreckungsbehörde im<br />
Sinn des § 4 VwVG das nach Art. 25 zuständige Finanzamt.
Bay VwZVG Artikel 45 bis 47 (weggefallen)<br />
Bay VwZVG Artikel 48 (weggefallen)<br />
Bay VwZVG Art. 49 Inkrafttreten<br />
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1961 in Kraft.<br />
Amtliche Fußnote: Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. Mai 1961 (GVBl S. 148).
Verordnung über Zuständigkeiten im<br />
Ordnungswidrigkeitenrecht (Bay<br />
ZuVOWiG)<br />
vom 21. Oktober 1997 (GVBl. S. 727), geändert durch Verordnungen vom 27. Juni 1998 (GVBl.<br />
S. 348), vom 22. Juni 1999 (GVBl. S. 264, ber. S. 356), vom 14. Dezember 1999 (GVBl. S. 561),<br />
vom 15. Mai 2001 (GVBl. S. 238), durch Gesetz vom 23. November 2001 (GVBl. S. 734), durch<br />
Verordnung vom 25. Juli 2002 (GVBl. S. 342), durch Gesetz vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 470),<br />
durch Verordnungen vom 6. Juli 2004 (GVBl. S. 262), vom 21. Dezember 2004 (GVBl. S. 548), vom<br />
7. Juni 2005 (GVBl. S. 187), vom 18. Juli 2006 (GVBl. S. 417), vom 3. Juli 2007 (GVBl. S. 453),<br />
vom 7. August 2007 (GVBl. S. 575), vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 552) (FN BayRS 454-1-I)<br />
Auf Grund von § 36 Abs. 2 Satz 1 des <strong>Gesetze</strong>s über Ordnungswidrigkeiten<br />
(OWiG), § 21 Abs. 1 Satz 1 des Güterkraftverkehrsgesetzes, § 61 Abs. 3<br />
Satz 1 des Personenbeförderungsgesetzes und § 26 Abs. 1 Satz 1 des<br />
Straßenverkehrsgesetzes erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende<br />
Verordnung:<br />
Bay ZuVOWiG § 1 Regelzuständigkeit<br />
1<br />
Zuständige Verwaltungsbehörde zur Verfolgung und Ahndung von<br />
Ordnungswidrigkeiten ist diejenige Behörde, der der Vollzug der<br />
Rechtsvorschrift obliegt, gegen die sich die Zuwiderhandlung richtet. 2 Satz 1<br />
ist nicht anzuwenden, soweit die §§ 2, 3 Abs. 1 und §§ 4 bis 11 etwas anderes<br />
bestimmen oder soweit es sich um Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des<br />
Naturschutzrechts oder der Zweckverbände handelt.<br />
Bay ZuVOWiG § 2 Gemeinden<br />
(1) 1 Die kreisangehörigen Gemeinden sind zuständig für<br />
1. die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Ortsrecht,<br />
2. Verwarnungen nach § 56 OWiG wegen Zuwiderhandlungen gegen<br />
sonstige Rechtsvorschriften, deren Vollzug ihnen obliegt.<br />
2<br />
Ist die Gemeinde Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft, so ist in den<br />
Fällen der Nummer 1 die Mitgliedsgemeinde, in den Fällen der Nummer 2<br />
die Verwaltungsgemeinschaft zuständig.<br />
(2) Die Großen Kreisstädte und diejenigen kreisangehörigen Gemeinden,<br />
denen nach Art. 53 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)<br />
die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen worden sind,<br />
sowie diejenigen kreisangehörigen Gemeinden, denen nach § 1 Abs. 3 der<br />
Verordnung zur Durchführung der Gewerbeordnung (GewV) und § 1<br />
Abs. 2 der Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes (GastV)<br />
Aufgaben übertragen worden sind, sind ferner zuständig für die<br />
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen<br />
1. die Bayerische Bauordnung,<br />
2. Rechtsverordnungen, die auf Grund des Art. 38 Abs. 1 oder 3 des<br />
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) oder des Art. 80 Abs. 1<br />
BayBO oder auf Grund dieser beiden Ermächtigungen erlassen worden<br />
sind,<br />
3. das Wasserhaushaltsgesetz oder das Bayerische Wassergesetz,<br />
4. das Gaststättengesetz,
5. § 144 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c und d, Abs. 2 Nrn. 1, 3 und 4, § 145<br />
Abs. 1 Nrn. 2 und 4, Abs. 2 Nrn. 1 und 7 Buchst. b und c und Abs. 3<br />
Nrn. 1 und 5 bis 9 sowie § 146 Abs. 2 Nrn. 1 und 4 bis 9 der<br />
Gewerbeordnung (GewO), soweit sich diese Vorschriften auf<br />
Gewerbetreibende beziehen, die den Vorschriften der §§ 14, 33 a, 33 c,<br />
33 d, 33 i, 55 c, 55 f, 56 a, 60 a, 60 b, 67, 69, 69 a, 70 a und 70 b GewO<br />
unterliegen,<br />
6. das Bestattungsgesetz oder die auf Grund dieses <strong>Gesetze</strong>s erlassenen<br />
Verordnungen,<br />
7. die Energieeinsparverordnung,<br />
8. Art. 19 Abs. 8 LStVG,<br />
9. das Denkmalschutzgesetz,<br />
soweit diesen Gemeinden der Vollzug dieser Vorschriften obliegt.<br />
(3) 1 Neben den in § 6 benannten Stellen sind auch die Gemeinden zuständig<br />
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des<br />
Straßenverkehrsgesetzes (StVG),<br />
1. die im ruhenden Verkehr festgestellt werden,<br />
2. die Verstöße gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit<br />
von Fahrzeugen betreffen,<br />
3. die Verkehrsordnungswidrigkeiten betreffen, welche in unmittelbarem<br />
Zusammenhang stehen mit den verkehrsrechtlichen Anordnungen<br />
folgender Verkehrszeichen der Anlagen 2 und 3 der Straßenverkehrs-<br />
Ordnung (StVO):<br />
a) Zeichen 220 (Einbahnstraße) in Verbindung mit Zeichen 267 (Verbot<br />
der Einfahrt), soweit die Verkehrsordnungswidrigkeit durch Radfahrer<br />
begangen wird,<br />
b) Zeichen 237 (Radweg),<br />
c) Zeichen 239 (Gehweg),<br />
d) Zeichen 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg),<br />
e) Zeichen 241 (Getrennter Rad- und Gehweg),<br />
f) Zeichen 242.1 und 242.2 (Beginn und Ende eines Fußgängerbereichs),<br />
g) Zeichen 244.1 und 244.2 (Beginn und Ende einer Fahrradstraße),<br />
h) Zeichen 325.1 und 325.2 (Beginn und Ende eines verkehrsberuhigten<br />
Bereichs),<br />
4. die von Radfahrern auf Gehwegen begangen werden.<br />
2<br />
§ 6 Abs. 2 gilt entsprechend.<br />
(4) Die Gemeinden machen die Aufnahme sowie die Beendigung der<br />
Tätigkeiten nach Abs. 3 jeweils entsprechend den Vorschriften, die für die<br />
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden gelten, amtlich bekannt.<br />
(5) In anderen als in den nach dieser Verordnung zugelassenen Fällen sind die<br />
Gemeinden für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten<br />
nicht zuständig.<br />
Bay ZuVOWiG § 3 Kreisverwaltungsbehörden<br />
(1) Die Kreisverwaltungsbehörden sind, soweit sie nicht bereits nach § 1<br />
zuständig sind, auch zuständig für die Verfolgung und Ahndung von<br />
Zuwiderhandlungen nach<br />
1. §§ 117 und 118 der Handwerksordnung,<br />
2. § 124 Nr. 1 OWiG, soweit sich diese Vorschrift auf das Bayerische
Staatswappen bezieht,<br />
3. § 76 Abs. 2 Nrn. 1b und 2 des Tierseuchengesetzes, soweit Vorschriften<br />
über das innergemeinschaftliche Verbringen sowie die Einfuhr und<br />
Durchfuhr von Tieren und Waren betroffen sind,<br />
4. § 154 des Flurbereinigungsgesetzes und Art. 23 des <strong>Gesetze</strong>s zur<br />
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes,<br />
5. Art. 22 des Abmarkungsgesetzes,<br />
6. Art. 15 des Vermessungs- und Katastergesetzes,<br />
7. § 39 Abs. 1 Nr. 7 des Bundesjagdgesetzes und Art. 56 Abs. 1 Nr. 15<br />
des Bayerischen Jagdgesetzes, soweit Vorschriften über das Aussetzen<br />
von Tierarten betroffen sind,<br />
8. Art. 46 des Waldgesetzes für Bayern,<br />
9. § 49 Abs. 3 Nr. 4 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 und Abschnitt 6 der<br />
Anlage 2 StVO, soweit sich die Anordnung auf § 45 Abs. 1 a Nr. 4 oder 4 a<br />
StVO stützt; die Zuständigkeit der Polizei bleibt unberührt.<br />
(2) Ist nach den §§ 1, 2 und 4 bis 12 dieser Verordnung für die Verfolgung<br />
oder Ahndung einer Ordnungswidrigkeit keine zuständige Behörde<br />
bestimmt, so ist die Kreisverwaltungsbehörde zuständig.<br />
Bay ZuVOWiG § 4 Regierungen<br />
(1) Die Regierungen sind, soweit sie nicht bereits nach § 1 zuständig sind,<br />
auch für die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen nach<br />
1. § 334 des Handelsgesetzbuchs,<br />
2. § 405 des Aktiengesetzes,<br />
3. Art. 12 des Dolmetschergesetzes,<br />
4. § 64 b der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, soweit es sich nicht<br />
um Eisenbahnen des Bundes handelt,<br />
5. § 49 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen,<br />
soweit es sich nicht um Eisenbahnen des Bundes handelt,<br />
zuständig.<br />
(2) Die Regierung von Oberbayern ist zuständig für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Zuwiderhandlungen nach § 20 des<br />
Transplantationsgesetzes.<br />
(3) 1 Die Regierung von Mittelfranken ist zuständig für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Zuwiderhandlungen nach § 43 BDSG. 2 Sie ist ferner<br />
zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen nach<br />
§ 16 des Telemediengesetzes sowie nach § 49 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 13 bis<br />
16 des Rundfunkstaatsvertrags.<br />
(4) Die Regierung von Schwaben ist zuständig für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Zuwiderhandlungen nach Art. 8 des Ingenieurgesetzes.<br />
Bay ZuVOWiG § 5 Staatsministerien<br />
(1) Das Staatsministerium des Innern ist zuständig für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Zuwiderhandlungen nach § 37 der Verordnung über die<br />
Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen<br />
(PrüfVBau) in Verbindung mit Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO, soweit es<br />
Anerkennungsbehörde nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 PrüfVBau ist.
(2) Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ist für die<br />
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das Bayerische<br />
Hochschulgesetz zuständig.<br />
(3) Das Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und<br />
Technologie ist, soweit es nicht bereits nach § 1 dieser Verordnung<br />
zuständig ist, für die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen<br />
gegen § 62 des Börsengesetzes zuständig.<br />
Bay ZuVOWiG § 6 Polizei<br />
(1) 1 Das Bayerische Polizeiverwaltungsamt ist zuständig für die Verfolgung<br />
und Ahndung von Zuwiderhandlungen nach<br />
1. §§ 23, 24, 24 a und 24 c StVG, ausgenommen Zuwiderhandlungen<br />
gegen die Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz,<br />
2. § 45 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 der Verordnung über den Betrieb von<br />
Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr sowie nach § 5 Abs. 1 des<br />
Bundesnichtraucherschutzgesetzes, soweit die Beförderung mit<br />
Oberleitungsbussen und Kraftfahrzeugen betroffen ist,<br />
3. § 8 Abs. 1, § 8 a Abs. 1 bis 3 des Fahrpersonalgesetzes sowie der<br />
§§ 21 bis 25 der Fahrpersonalverordnung, soweit diese durch die Polizei<br />
festgestellt werden,<br />
4. § 9 Abs. 1 und 2 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-<strong>Gesetze</strong>s<br />
(BKrFQG), soweit nicht das Bundesamt für Güterverkehr nach § 9 Abs. 4<br />
Satz 1 BKrFQG zuständig ist,<br />
5. Art. 52 Abs. 4 Nrn. 1 bis 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes,<br />
soweit diese durch die Polizei festgestellt werden,<br />
6. § 116 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e, Nrn. 2, 13 und 14 sowie § 116 Abs. 2<br />
Nr. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 a Satz 3 der<br />
Strahlenschutzverordnung,<br />
7. § 10 Abs. 1 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBefG) sowie § 37<br />
der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt.<br />
2<br />
In den Fällen der Nrn. 6 und 7 gilt dies nur, soweit die<br />
Zuwiderhandlungen durch die Polizei oder bei Straßenkontrollen anderer<br />
Behörden festgestellt werden oder sonst in Zusammenhang mit der<br />
Beförderung gefährlicher Güter der Klasse 7 im Straßenverkehr stehen.<br />
3<br />
§ 10 Abs. 5 GGBefG bleibt unberührt.<br />
(2) Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten einschließlich der Erteilung<br />
von Verwarnungen in den Fällen des Absatzes 1 sind neben dem<br />
Bayerischen Polizeiverwaltungsamt auch die Dienststellen der Bayerischen<br />
Landespolizei und der Bayerischen Bereitschaftspolizei, soweit sie zur<br />
Unterstützung des polizeilichen Einzeldienstes bei der allgemeinen<br />
Dienstverrichtung herangezogen werden, zuständig, solange sie die Sache<br />
nicht an das Bayerische Polizeiverwaltungsamt oder an die<br />
Staatsanwaltschaft abgegeben haben oder wenn die Staatsanwaltschaft<br />
die Sache nach § 41 Abs. 2 oder § 43 Abs. 1 OWiG an die Polizei zurückoder<br />
abgibt.<br />
(3) Die dem Staatsministerium des Innern unmittelbar nachgeordneten<br />
Polizeidienststellen sind für die Verfolgung und Ahndung von<br />
Ordnungswidrigkeiten nach Art. 37 des Bayerischen Datenschutzgesetzes<br />
in ihrem Bereich zuständig.
(4) 1 In anderen Fällen sind Dienststellen der Polizei für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nicht zuständig. 2 Die Ermächtigung<br />
der Polizei zu Verwarnungen nach § 57 Abs. 2 OWiG bleibt unberührt.<br />
Bay ZuVOWiG § 7 Staatsanwaltschaften<br />
Die Staatsanwaltschaften, die bei den Landgerichten bestehen, sind zuständig<br />
für die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen<br />
1. gegen § 115 OWiG und gegen Art. 21 LStVG, soweit sich der Gefangene<br />
oder Verwahrte im Gewahrsam von Justizvollzugsanstalten befindet,<br />
2. gegen § 20 des Rechtsdienstleistungsgesetzes.<br />
Bay ZuVOWiG § 8 Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau<br />
Die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau ist zuständig für die Verfolgung<br />
und Ahndung von Zuwiderhandlungen nach § 7 der Reblausverordnung.<br />
Bay ZuVOWiG § 9 Landesanstalt für Landwirtschaft<br />
(1) 1 Die Landesanstalt für Landwirtschaft ist zuständig für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das Öko-Landbaugesetz vom<br />
10. Juli 2002 (BGBl I S. 2558), auch soweit der Vollzug der verletzten<br />
Rechtsvorschrift beliehenen Kontrollstellen obliegt. 2 Diese sind für<br />
Verwarnungen nach § 56 OWiG wegen Zuwiderhandlungen gegen das<br />
Öko-Landbaugesetz zuständig, soweit ihnen der Vollzug der verletzten<br />
Rechtsvorschrift obliegt.<br />
(2) die Landesanstalt für Landwirtschaft ist zuständig für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Zuwiderhandlungen nach dem Saatgutrecht, dem<br />
Pflanzenschutzrecht und dem Düngemittelrecht, ausgenommen die<br />
Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das<br />
Forstvermehrungsgutgesetz vom 22. Mai 2002 (BGBl I S. 1658).<br />
(3) Die Landesanstalt für Landwirtschaft ist zuständig für die Verfolgung und<br />
Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das Tierzuchtgesetz (TierZG)<br />
vom 21. Dezember 2006 (BGBl I S. 3294) und das Bayerische<br />
Tierzuchtgesetz.<br />
Bay ZuVOWiG § 10 Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung<br />
Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ist, soweit es nicht bereits<br />
nach § 1 zuständig ist, zuständig für die Verfolgung und Ahndung von<br />
Zuwiderhandlungen nach Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Statistikgesetzes und<br />
nach § 23 des Bundesstatistikgesetzes.<br />
Bay ZuVOWiG § 11 Bayerische Architektenkammer, Bayerische<br />
Ingenieurekammer-Bau<br />
Die Bayerische Architektenkammer und die Bayerische Ingenieurekammer-Bau<br />
sind zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen nach<br />
§ 37 PrüfVBau in Verbindung mit Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO, soweit die<br />
Eintragungsausschüsse bei den Kammern Anerkennungsbehörden nach § 6<br />
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 PrüfVBau sind.
Bay ZuVOWiG § 12 Verweisungen<br />
Soweit diese Verordnung auf Rechtsvorschriften verweist, bezieht sich die<br />
Verweisung auf die Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung.<br />
Bay ZuVOWiG § 13 Inkrafttreten<br />
(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 1997 in Kraft.<br />
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über Zuständigkeiten im<br />
Ordnungswidrigkeitenrecht (ZuVOWiG) vom 16. Dezember 1980 (BayRS<br />
454-1-I), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Oktober 1996 (GVBl<br />
S. 422), außer Kraft.<br />
Anlage 1<br />
(weggefallen)<br />
Anlage 2<br />
(weggefallen)<br />
Anlage 3<br />
(weggefallen)