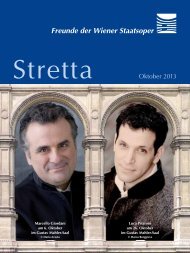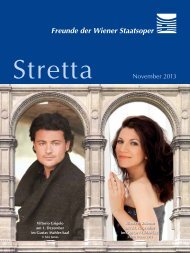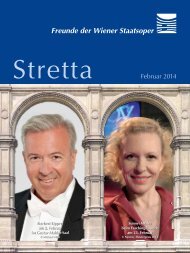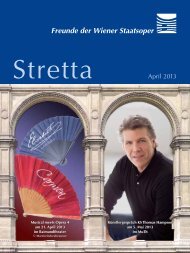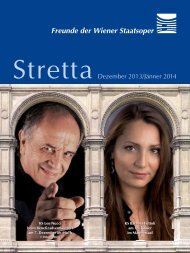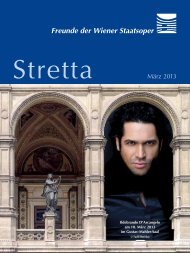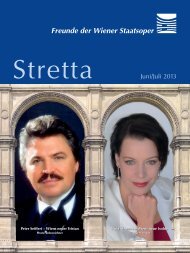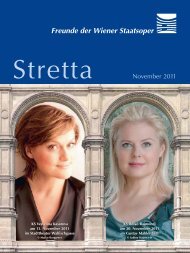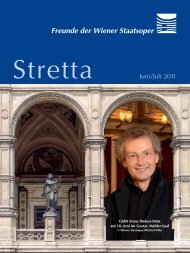Download Stretta_Maerz2010 - Freunde der Wiener Staatsoper
Download Stretta_Maerz2010 - Freunde der Wiener Staatsoper
Download Stretta_Maerz2010 - Freunde der Wiener Staatsoper
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4<br />
Anmerkungen zu<br />
Arnold Schönbergs<br />
abgeschlossenem Fragment<br />
Moses und Aron<br />
Arnold Schoenberg<br />
(c) Christian Brandstätter Verlag, Wien<br />
„Und mit demselben Gefühl eines<br />
ahnungsvollen Bewun<strong>der</strong>ns, das noch<br />
lange kein ,Erkennen’ ist, stehe ich deinem<br />
,Moses und Aron’ gegenüber. Ich<br />
kann heute nur sagen, daß ich diese<br />
Dichtung – und das ist sie im höchsten<br />
Sinne des Wortes – so gewaltig empfinde,<br />
daß ich sie – auch ohne Musik –<br />
eine ganz ganz große Komposition,<br />
eines von den halben Dutzend unsterblichen<br />
Oratorien nennen muß. Mehr zu<br />
sagen fühle ich mich nicht berechtigt (...)“<br />
Alban Berg, Schüler und Freund<br />
Schönbergs, bringt in seinem<br />
Schreiben vom April 1929 nach <strong>der</strong><br />
Lektüre des ersten Textentwurfes das<br />
Gefühl zum Ausdruck, das auch heute<br />
noch Ausführende, Opernpublikum und<br />
Fachleute gleichermaßen in Bann hält.<br />
Die Oper, die, so Berg, aus einem<br />
„kolossalen Plan“ heraus entstand, ist bis<br />
heute eine schwergewichtige Herausfor<strong>der</strong>ung,<br />
die für alle Beteiligten Anreiz<br />
und Problem gleichermaßen darstellt.<br />
Aus <strong>der</strong> Perspektive des Ausführenden<br />
heraus ist dies – da hier die Schwierigkeiten<br />
zunächst rein technischer Natur<br />
sind – wohl am Nachvollziehbarsten. Es<br />
sind enorme Ansprüche zu erfüllen,<br />
wenn ein musikalisch ohnehin an die<br />
Grenzen gehendes komplexes Werk<br />
neben zwei außerordentlich disponierten<br />
Titelpartien, weitere 34 solistisch zu<br />
besetzende Gesangsrollen, drei Chöre,<br />
ein mit rund 80 Musikern ausstaffiertes<br />
Orchester und zusätzlich eine illuster<br />
reichhaltig besetzte Bühnenmusik verlangt.<br />
Zu dieser umfangreichen personellen<br />
Anfor<strong>der</strong>ung tritt noch erschwerend<br />
<strong>der</strong> Aspekt hinzu, diese Menge in<br />
einer überdurchschnittlichen Zahl von<br />
Proben entsprechend koordinieren zu<br />
müssen. So nimmt es einen nicht wun<strong>der</strong>,<br />
dass selbst ein großes, gut ausgestattetes<br />
Unternehmen wie die <strong>Wiener</strong><br />
<strong>Staatsoper</strong> seit <strong>der</strong> ersten Produktion im<br />
Haus am Ring 1960 (als Gastspiel <strong>der</strong><br />
Städtischen Oper Berlin) nur gerade auf<br />
etwas mehr als 30 Aufführungen in<br />
lediglich zwei Inszenierungen kam.<br />
Anmerkungen zu Schönbergs<br />
“Moses und Aron”/ Simon Haasis<br />
Das dem Publikum wie auch den Fachleuten<br />
Abverlangte trifft sich dem<br />
gegenüber in inhaltlichen Fragen, die<br />
an dieses Opus magnum des Komponisten<br />
zu stellen sind: was ist mit diesem<br />
Werk anzufangen und wo liegt seine<br />
Botschaft, da es sich doch <strong>der</strong>art dem zu<br />
wi<strong>der</strong>setzten scheint, was man von <strong>der</strong><br />
Opernbühne gewohnt ist? Vieles hiervon<br />
beantwortet sich mit einem Blick<br />
auf die Umstände seiner sich über Jahrzehnte<br />
dahinziehenden Entstehung.<br />
Ein Schockerlebnis des Sommers 1921 –<br />
Schönberg, <strong>der</strong> bereits früh den protestantischen<br />
Glauben angenommen<br />
hatte, sieht sich mit dem alltäglichen<br />
Antisemitismus in Österreich konfrontiert<br />
– wird zur Initialzündung für eine<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung des zuvor Unpolitischen<br />
mit den Folgen dieser Gefahr,<br />
wie aber auch verstärkt mit politischen<br />
und religiösen Fragen des Judentums,<br />
<strong>der</strong> Religion seiner Väter. Produkte dieses<br />
Prozesses sind zunächst ein Drama<br />
mit dem Titel Der biblische Weg (1922–<br />
1927), das die Thematik von Moses und<br />
Aron bereits vorweg nimmt, und eine<br />
Kantate Moses am brennenden Dornbusch,<br />
ein Plan, <strong>der</strong> sich ab 1928 zum<br />
dreiteiligen Oratorium erweitert. Mit<br />
<strong>der</strong> kompositorischen Ausführung<br />
dieses Vorhabens zögert Schönberg<br />
doch zunächst, da er sich mit seiner<br />
1923 entwickelten „Zwölftontechnik“<br />
noch nicht sicher genug fühlt, um einen<br />
<strong>der</strong>art langen Text vertonen zu können.<br />
Erst die positiven Erfahrungen mit seinen<br />
Variationen für Orchester, op. 31 und<br />
<strong>der</strong> „Zeitoper“ Von heute auf morgen<br />
bringen ihn zum nunmehr gewandelten<br />
Projekt zurück: Aus dem Oratorium war<br />
eine Oper, aus dem nur kommentierenden<br />
Chor eine handelnde Masse geworden.<br />
Die Komposition und die begleitende<br />
Texteinrichtung schritten ab 1930<br />
zunächst stetig voran, sodass Schönberg<br />
im August 1931 Alban Berg freudig mitteilen<br />
konnte, dass nunmehr ein Aufzug<br />
mit 1000 Takten vollendet sei und ein<br />
weiterer bereits 250 umfasse. Nach<br />
zwei Jahren Arbeit lagen die ersten<br />
beiden Akte <strong>der</strong> Oper vor. Fortsetzung S. 6