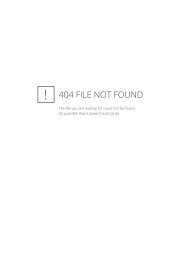Sitzung 5.pdf - Moodle 2
Sitzung 5.pdf - Moodle 2
Sitzung 5.pdf - Moodle 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Vorbereitung für die<br />
wissenschaftliche Arbeit“<br />
I.<br />
Ablauf im empirischen Forschungsprozess<br />
Entscheidungs-<br />
und Planungsphase<br />
II. Problemanalyse<br />
Themenwahl<br />
Erfahrungen Studienschwerpunkte Literatur<br />
Formulierung des Untersuchungsproblems<br />
Vorgespräch mit dem Betreuer<br />
Erstellung einer Disposition<br />
Formale Bestätigung der Arbeit<br />
Erarbeitung /<br />
Bereitstellung der<br />
Untersuchungs-<br />
methoden<br />
Auswertungs-<br />
strategie<br />
Theoriephase<br />
Untersuchungskonzeption<br />
III. Konzeption der<br />
empirischen Unter- Hypothesenbildung Untersuchungsdesign/ Untersuchungssuchung<br />
/<br />
Vorgehensweise<br />
methoden<br />
hermeneutische<br />
Arbeitsweise<br />
PlausibilitätsprüfungRahmenbedingung<br />
IV. Empirische<br />
Untersuchung /<br />
hermeneutische<br />
Bearbeitung<br />
V. Datenanalyse<br />
VI. Ausarbeitung<br />
Vergleich von<br />
Theorien<br />
Untersuchungsdurchführung<br />
Rekrutierung der<br />
Stichprobe / Quellen<br />
Datenanalyse<br />
Datenaufbereitung/<br />
Kategorisierung<br />
Erarbeitung /<br />
Bereitstellung der<br />
Interventions- und<br />
Analysemethoden<br />
Statistische Bearbeitung /<br />
Entscheidungsgrundlagen<br />
Ausarbeitung<br />
Formale Regeln Inhaltliche Gestaltung<br />
Darstellung und<br />
Interpretation der<br />
Ergebnisse<br />
* aus Literaturstudium<br />
* aus Untersuchungen<br />
Literaturstudium Publizierte<br />
Untersuchungen<br />
lässt das<br />
Untersuchungsproblem<br />
empirischen Zugang zu?<br />
ja nein<br />
Methoden-<br />
kenntnisse<br />
vorhanden<br />
Reflexion der<br />
Ergebnisse/<br />
Rückschlüsse<br />
auf Theorie<br />
aus BÖS, HÄNSEL, SCHOTT 2000, S. 34<br />
Relevanz einer<br />
theoretischen<br />
Bearbeitung<br />
Praxisrelevanz<br />
(Verwertungszu-<br />
sammenhang)<br />
der Ergebnisse<br />
Titel 6. <strong>Sitzung</strong><br />
Forschungsprozess gesamt<br />
1
Quantitative Methoden – Biomechanik / Motorik<br />
Inhalt<br />
Die naturwissenschaftlichen Theoriebereiche<br />
• Trainingswissenschaft<br />
• Bewegungswissenschaft<br />
• Biomechanik<br />
• Sportmedizin (Sportanatomie, Sportphysiologie)<br />
Quantitative Methoden – Kinemetrie 1<br />
• Grundlagen<br />
• Kinemetrie beschreibt die Geometrie der<br />
Bewegungen, d.h. deren räumlich<br />
zeitlichen Ablauf, wobei Masse und Kraft<br />
(die Bewegungsursache) nicht<br />
berücksichtigt werden.<br />
• Kinemetrie objektiviert den räumlichzeitlichen<br />
Verlauf von Bewegung<br />
• Gesamtheit der Verfahren zur Messung<br />
kinematischer Größen<br />
Inhalt<br />
2
Quantitative Methoden – Kinemetrie 2<br />
• geometrische Merkmale:<br />
• Wege, Strecken, Winkel<br />
• lineare Bewegungen<br />
• Geschwindigkeiten<br />
• Beschleunigungen<br />
Messgrößen<br />
Abgeleitete Grössen<br />
Quantitative Methoden – Kinemetrie 3<br />
Bewegung<br />
Zeit Weg<br />
Messung<br />
• zeitliche Merkmale:<br />
• Zeit, Frequenzen<br />
• Drehbewegungen<br />
• Winkelgeschwindigkeiten<br />
• Winkelbeschleunigungen<br />
3
Quantitative Methoden – Kinemetrie 4<br />
Messprinzipien<br />
Video<br />
Film<br />
Infrarot<br />
Reflex-<br />
Marker<br />
Bewegungsabbild<br />
vollständig unvollständig<br />
LED<br />
Lichtspur-<br />
Marker<br />
Quantitative Methoden – Kinemetrie 5<br />
Anwendungsbeispiele<br />
Ultraschall<br />
Sender/<br />
Sensor<br />
Magnetfeld<br />
Sender/<br />
Sensor<br />
4
Quantitative Methoden – Dynamometrie 1<br />
• Grundlagen<br />
• Die Dynamometrie dient der direkten Messung von äußeren<br />
Kräften, d.h. von Kräften, die an der Peripherie des Körpers<br />
als Reaktionskräfte gemessen werden können.<br />
• Die Messung von Kräften erfolgt heute üblicherweise auf<br />
elektronischem Wege, d.h. die verformende Wirkung der<br />
Kraft an elastischen Körpern wird zur Kraftmessung<br />
benutzt. Diese mechanische Verformung kann in elektrische<br />
Größen umgewandelt werden. Zur Umwandlung<br />
werden im wesentlichen Widerstandsgeber (sogenannte<br />
Dehnungsmessstreifen) und piezoelektrische Geber<br />
(Quarzkristalle) verwendet.<br />
• Früher sprach man von Dynamographie<br />
Quantitative Methoden – Dynamometrie 2<br />
• Grundlagen<br />
Kräfte können nur bei Bewegungsänderungen,<br />
Verformung oder bestimmten Gleichgewichtssituationen<br />
nachgewiesen werden. Kraftmessungen<br />
erfolgen meist anhand der Verformung an einem<br />
Messwertaufnehmer (Sensor).<br />
s<br />
F<br />
Aus dem Hooke‘schen Gesetz folgt:<br />
s = D * F<br />
Also z. B.: F 2 = 2 * F 1 ⇒ s 2 = 2 * s 1<br />
5
Quantitative Methoden – Dynamometrie 3<br />
Messprinzipien<br />
Elektrischer<br />
Widerstand<br />
Piezoelektrischer<br />
Effekt<br />
Deformation<br />
Halbleiter<br />
Widerstand<br />
Magnetoelektrischer<br />
Effekt, Induktion,<br />
(Hall-Effekt)<br />
Quantitative Methoden – Dynamometrie 4<br />
Messprinzipien<br />
Dehnungsmessstreifen<br />
Kapazitiver<br />
Effekt<br />
Elektrischer Widerstand<br />
6
Quantitative Methoden – Dynamometrie 5<br />
Anwendungsbeispiel<br />
Einsatz von<br />
Dehnungsmessstreifen<br />
Quantitative Methoden – Dynamometrie 6<br />
Messprinzipien<br />
Piezoelektrischer Effekt<br />
Geschichte: Entdeckung durch die Brüder Curie im<br />
Jahre 1880<br />
Definition: „Piezo“ = griech. Piezein à� Druck, drücken<br />
Kristalle aus Quarz reagieren auf Druck von<br />
außen mit elektrischen Ladungs-<br />
veränderungen an der Oberfläche.<br />
nach Kistler, Piezoelektrische Meßtechnik<br />
7
Quantitative Methoden – Dynamometrie 7<br />
• Anwendungsbeispiel Einsatz einer Piezo-<br />
Messplattform<br />
Vertikale Bodenreaktionskräfte beim<br />
Laufen mit unterschiedlichen Sportschuhen<br />
Quantitative Methoden – Elektromyografie 1<br />
• Grundlagen<br />
• Elektromyografie erfasst die elektrischen Aktionspotentiale<br />
bei der Aktivierung des Muskels.<br />
• Die Elektromyografie gibt Einsicht in die inter- und intramuskulären<br />
Aspekte der Koordination bei Bewegungshandlungen<br />
im Alltag und im Sport.<br />
• Wissenschaftler verschiedenster Forschungsgebiete verwenden<br />
das EMG zur Registrierung physiologischer und<br />
pathophysiologischer Kontrollphänomene. Physio- und<br />
Sporttherapeuten, Trainer und Sportlehrer haben mit dem<br />
EMG, hier insbesondere mit dem Oberflächen-EMG, ein<br />
Werkzeug entdeckt, das ihnen ermöglicht, komplexe<br />
Bewegungsabläufe zu studieren.<br />
8
Quantitative Methoden – Elektromyografie 2<br />
Deetjen/Speckmann: Physiologie. 1999<br />
Quantitative Methoden – Elektromyografie 3<br />
9
Quantitative Methoden – Elektromyografie 4<br />
Quantitative Methoden – Elektromyografie 5<br />
Nadelelektroden<br />
Eine Nadel wird in die tiefer liegende Muskulatur invasiv eingeführt.<br />
10
Quantitative Methoden – Elektromyografie 6<br />
Monopolare Nadel – EMG<br />
Elektrode<br />
Quantitative Methoden – Elektromyografie 7<br />
Risiken der Nadel EMG<br />
• Infektionsrisiko<br />
• Gefahr von Materialbruch<br />
• Schmerz und damit Bewegungsverfälschung<br />
11
Quantitative Methoden – Elektromyografie 8<br />
• Anwendungsbeispiele<br />
EMG beim Sprung:<br />
Von oben: Integriertes,<br />
gleich-gerichtetes und<br />
Roh-EMG des M.<br />
gastrocnemius und<br />
vertikale Bodenreaktionskraft<br />
beim Tief-<br />
Hochsprung aus 30 cm<br />
Höhe.<br />
Aus der Höhe der EMG-Amplituden könnte die Stärke der muskulären<br />
Aktivierung des Muskels beim reaktiven Sprung abgeschätzt werden.<br />
Beachte: Dieser Muskel ist bereits vor dem Bodenkontakt (Vertikalpfeil) aktiv.<br />
Quantitative Methoden – Elektromyografie 9<br />
• Anwendungsbeispiele<br />
Typisches mittleres EMG<br />
Muster des M. tibialis und<br />
gastrocnemius beim<br />
100m-Sprintlauf.<br />
Die Muster werden aus 7<br />
Einzelschritten beim<br />
Laufen mit höchster Geschwindigkeit<br />
gemittelt.<br />
Der erste Bodenkontakt<br />
(untere Spur, senkrechter<br />
Pfeil) diente als Triggersignal<br />
zur<br />
Synchronisation.<br />
12
High output<br />
Low output<br />
SOL EMG [mV]<br />
10<br />
The H-reflex<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
M-Wave<br />
0 5 10 15 20<br />
Stimulation intensity [mA]<br />
M-Wave<br />
H-Reflex<br />
H-Reflex<br />
Time [ms]<br />
13
Preferred muscles<br />
m. soleus m. tibialis anterior m. flexor carpi radialis<br />
TMS<br />
14
Historical background<br />
Galvani and Volta in the 1790’s Principles of electromagne?c<br />
induc?on were first discovered by<br />
Michael Faraday in 1831<br />
Historical background<br />
Silvanus P. Thompson<br />
trying to s?mulate his<br />
brain using a magne?c<br />
field, London 1910<br />
The Sheffield group with the s?mulator<br />
which first achieved transcranial<br />
magne?c s?mula?on, February 1985.<br />
From leM to right: Reza Jalinous, Ian<br />
Freeston and Tony Barker<br />
15
The methodology – the magne?c field<br />
The methodology – current s?mulators<br />
16
The methodology – coils<br />
The methodology – applying TMS<br />
monophasic<br />
biphasic<br />
Lines of flux<br />
HalleV (2007)<br />
monophasic biphasic<br />
PA<br />
AP<br />
PA<br />
AP<br />
17
The physiology – the motor evoked poten?al (MEP)<br />
by single pulse TMS<br />
EMG<br />
~25 ms<br />
Repetitive TMS<br />
18
Ar?ficially induced cor?cal plas?city – repe??ve<br />
TMS (rTMS)<br />
rTMS – recordings of the descending volleys<br />
at the spinal cord<br />
DiLazzaro et al. (2002)<br />
Pascual-‐Leone (1994)<br />
19
Clinical applica?on of rTMS<br />
-‐ Major depression<br />
-‐ Schizophrenia<br />
-‐ Tinitus<br />
-‐ Stroke<br />
-‐ …<br />
Ridding and Rothwell (2007)<br />
Quantitative Methoden – Ergometrie 1<br />
• Grundlagen der Verfahren<br />
• Messprinzipien<br />
• Anwendungsbeispiele<br />
20
Quantitative Methoden – Ergometrie 2<br />
• Grundlagen<br />
VO 2 max ist die maximale Menge an Sauerstoff, die ein<br />
Individuum der Luft entnehmen, zu den Organen transportieren<br />
und dort verwerten kann. Sie ist identisch mit<br />
der Menge Sauerstoff, die durch große Muskelgruppen<br />
während einer Belastung mit zunehmender Intensität bis<br />
zur subjektiven Erschöpfung verbraucht werden kann.<br />
Messgrößen:<br />
Absolut in Liter/Minute<br />
relativ in ml/kg*min.<br />
Sie hängt sowohl von der Lungen- als auch von der<br />
Herzfunktion ab!<br />
Quantitative Methoden – Ergometrie 3<br />
• Messprinzipien<br />
Bei der Spiroergometrie erfolgt eine umfassende Untersuchung<br />
der Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge.<br />
Der Athlet atmet durch ein Mundstück über ein Mess-<br />
System, und es werden bestimmt:<br />
• das Atemzugvolumen (Atemvolumen, das bei jedem<br />
einzelnen Atemzug geatmet wird)<br />
• das Atemminutenvolumen (in einer Minute insgesamt<br />
geatmetes Volumen).<br />
• Weitere Parameter sind:<br />
� Herzfrequenz<br />
� Sauerstoffaufnahme<br />
Ø� Laktat - (aerob-anaerober Übergangsbereich)<br />
21
Quantitative Methoden – Ergometrie 4<br />
% der maximalen<br />
O 2 -Aufnahme<br />
100<br />
50<br />
maximale<br />
aerobe Leistung<br />
2 4 6 8<br />
Stunden<br />
Quantitative Methoden – Ergometrie 5<br />
• Anwendungsbeispiele<br />
§� Leichtathletische<br />
Ausdauerdisziplinen<br />
§� Triathlon<br />
§� Radsport<br />
§� Schwimmsport<br />
§� Rudern etc.<br />
Anwendungsbeispiel<br />
Mit zunehmender Arbeitsdauer nimmt<br />
der Prozentsatz der maximalen<br />
Sauerstoffaufnahme (VO 2 max) ab,<br />
und zwar beim Untrainierten stärker<br />
als beim Trainierten.<br />
Trainiert<br />
Untrainiert<br />
Aus Weineck, Sportbiologie, 1998, S. 176<br />
22
Literaturempfehlung<br />
ergänzend und vertiefend:<br />
• Roth,K. und Willimczik, K. (1999). Bewegungswissen-<br />
schaft. Reinbek: Rowohlt.<br />
• Nigg, B.M. und Herzog, W. (Eds.) (1999). Biomechanics<br />
of the Musculo-skeletal System. Wiley: Chichester<br />
• Autorenkollektiv: Biomechanische Untersuchungsme-<br />
thoden – Sommerkurs der Deutschen Gesell-<br />
schaft für Biomechanik, Münster, 1999<br />
Übung<br />
(Kopie im Ordner und Download als PDF-Datei)<br />
Kraftzunahme und muskuläre Aktivierung bei<br />
Maximalkrafttraining bei Skispringern<br />
a.) Fragestellung<br />
b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />
c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />
d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />
23
Übung<br />
Veränderung des Laufstils durch Barfußtraining<br />
a.) Fragestellung<br />
b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />
c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />
d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />
Übung<br />
Gangbild von Männern versus Frauen<br />
a.) Fragestellung<br />
b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />
c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />
d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />
24
Übung<br />
Unterschied von verschiedenen Fussballschuhen<br />
bezüglich muskulärer Aktivierung und Belastung<br />
des Bewegungsapparats (Kniegelenk,<br />
Sprunggelenk)<br />
a.) Fragestellung<br />
b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />
c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />
d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />
Übung<br />
Verletzungsmechanismen bei Balletttänzerinnen<br />
während des Gleichgewichtstrainings<br />
a.) Fragestellung<br />
b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />
c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />
d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />
25
Übung<br />
Aktivierung des Gehirns bei maximalkräftigen<br />
versus schnellkräftigen Kontraktionen<br />
a.) Fragestellung<br />
b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />
c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />
d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />
Schwarz<br />
26


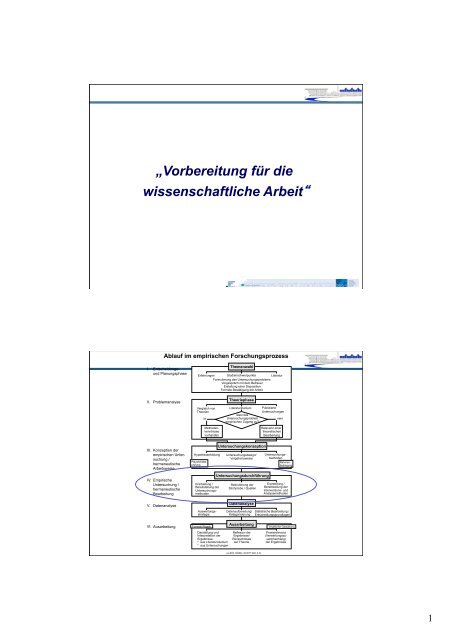






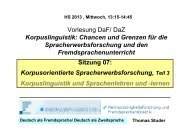


![Vorlesung DaF/ DaZ [L028.0239] Korpuslinguistik ... - Moodle 2](https://img.yumpu.com/45172857/1/190x134/vorlesung-daf-daz-l0280239-korpuslinguistik-moodle-2.jpg?quality=85)