Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>B|BRAUN</strong><br />
8 Applikationsmöglichkeiten ............................................................ 687<br />
8.1 Venöser Zugang.......................................................................................................687<br />
8.1.1 Peripherer Zugang.......................................................................................687<br />
8.1.2 Zentrale Katheter Zugänge........................................................................698<br />
8.2 Arterieller Zugang ................................................................................................. 6970<br />
8.3 Subcutane Infusion....................................................................................................69<br />
8.4 Zusammenfassung ..................................................................................................710<br />
8.5 Kontrollfragen...........................................................................................................721<br />
67
<strong>B|BRAUN</strong><br />
8<br />
APPLIKATIONS-<br />
MÖGLICHKEITEN<br />
Das Kapitel „Applikationsmöglichkeiten“ zeigt verschiedene Möglichkeiten des Infusi-<br />
onszugangs auf. Im wesentlichen wird hier unterschieden zwischen venöser, arteri-<br />
eller und subcutaner Infusion.<br />
8.1 VENÖSER ZUGANG<br />
Über eine Kanüle oder einen Katheter werden die gewünschten Stoffe direkt in die<br />
Vene infundiert und sehr rasch (verdünnt) zum Herz geführt, von wo sie sich gleich-<br />
mäßig über den ganzen Körper verteilen (systemische Wirkung). Man unterscheidet<br />
beim venösen Zugang zwischen peripherem Zugang und zentralen Katheter-<br />
Zugängen.<br />
Lernziele<br />
8.1.1 PERIPHERER ZUGANG<br />
Mit einer Kanüle werden die Venen des Unterarmes (ab Ellenbeuge abwärts) und<br />
des Handrückens sowie (in Ausnahmen) des Fußrückens punktiert. Vorgenommen<br />
werden kann die Punktion mit einer<br />
� Überblick gewinnen über die verschiedenen<br />
Infusionszugänge und ihr Anwendungsbereiche<br />
� Kenntnis der Kriterien für die jeweiligen venösen<br />
Zugänge<br />
� Vertraut werden mit den Infusionslösungen des<br />
venösen Infusionszugangs<br />
� Kenntnis der mit den verschiedenen<br />
Infusionszugängen verbundenen Gefahren<br />
68
<strong>B|BRAUN</strong><br />
� starren Kanüle (Venofix): nur für Kurzinfusionen und einmalig (ca. 20 – 100 ml,<br />
z. B. Antibiotika, Asthmamedikamente) oder<br />
� flexiblen Verweilkanüle (Braunüle ® , Vasofix ® , Introcan ® ) bei sich wieder-<br />
holenden Infusionen, größeren Flüssigkeitsmengen oder auch Blutkonserven.<br />
Lösungen die periphervenös infundiert werden können sind z. B.:<br />
� Glukose 5%, 280 (m Osmol)<br />
� Vollelektrolytlösungen, 300 – 320 (m Osmol)<br />
� Kochsalz 0,9 %, 310 (m Osmol)<br />
� Fettemulsionen 10 %, 320 – 340 (m Osmol)<br />
� Glukose, 555 (m Osmol)<br />
� Mischlösungen zur parenteralen Ernährung von ca. 570 – max. 1.050 (m Osmol)<br />
(abhängig von der Dauer der Infusionstherapie und dem Zustand des Patienten)<br />
Merke<br />
Nur isosmolare und leicht hyperosmolare Lösungen sollten<br />
peripher infundiert werden, da stark hyperosmolare Lösun-<br />
gen die Venen schädigen, sogar zerstören können.<br />
8.1.2 ZENTRALE KATHETER ZUGÄNGE<br />
Als zentrale Venen bezeichnet man die fest im Gewebe fixierten Gefäße des Brust-<br />
und Halsbereichs.<br />
Im Schockzustand kollabieren die peripheren Gefäße, es ist somit nur noch ein zen-<br />
traler Zugang möglich. Sollte selbst dies unmöglich sein, so ist nur noch die vena<br />
sectio (operative Freilegung und Kanülierung) möglich.<br />
Alle diese Katheter münden mit ihrer Spitze in der oberen Hohlvene. Da aufgrund<br />
des starken Blutstromes dort der größte Verdünnungseffekt erreicht wird.<br />
Lösungen, die zentralvenös infundiert werden müssen, sind z.B.:<br />
� Misch- und Kombinationslösungen für die parenterale Ernährung von ca. > 1 000<br />
(m Osmol)<br />
� aggressive Medikamente (Achtung: pH-Werte > 9), z.B. Cytostatika, einige Anti-<br />
biotika<br />
Detaillierte Zusammenhänge werden in dem Skript „Venenpunktion“ erläutert.<br />
69
<strong>B|BRAUN</strong><br />
8.2 ARTERIELLER ZUGANG<br />
Bei der arteriellen Infusion oder Injektion werden die Wirkstoffe in eine bestimmte<br />
Arterie mit einem definierten Verteilungsgebiet gegeben (regionale Wirkung). Die<br />
Wirkstoffe gelangen relativ unverdünnt dorthin und erreichen erst nach Passage des<br />
Kapillarbettes und der Venen stark verdünnt die übrigen Körperbezirke.<br />
Folgendes ist zu beachten:<br />
� Der Druck in den Arterien läßt die Infusion nur per Druckinfusion oder mit-<br />
tels Infusionspumpe zu.<br />
� Es besteht die Gefahr von arteriellen Spasmen, die nur schwer zu lösen sind und<br />
zum Ausfall der Durchblutung bzw. nachfolgender Nekrose (Absterben des be-<br />
troffenen Gewebebezirkes) führen.<br />
� Das Entstehen eines Aneurysmas (arterielle Aussackung) nach Punktion einer<br />
Arterie wird bei Patienten mit Arterio-Sklerose (Arterien-Verkalkung) öfters beob-<br />
achtet und sollte als Risiko erwähnt werden.<br />
Merke<br />
Die arterielle Infusion ist eine relativ seltene Maßnahme.<br />
Beispiele für ihre Indikation sind durchblutungsfördernde<br />
Maßnahmen in der Peripherie oder lokale Chemotherapie.<br />
8.3 SUBCUTANE INFUSION<br />
Subcutane Injektionen nutzen das langsame Diffundieren der Wirkstoffe aus dem Be-<br />
reich des Interstitiums in das Gefäß, um eine Langzeitwirkung zu erzeugen (Depo-<br />
teffekt).<br />
In die Bereiche zwischen den Zellen (Interstitum) wird in Ausnahmefällen infundiert,<br />
wenn es sich um kleine Flüssigkeitsmengen handelt und keine punktierbaren Gefäße<br />
zur Verfügung stehen (wie bei Säuglingen und Greisen!). Man benutzt hierzu das<br />
subcutane Fettgewebe im Bauchbereich und im Oberschenkel.<br />
70
<strong>B|BRAUN</strong><br />
Merke<br />
Lösungen, die in den subcutanen Bereich gebracht werden,<br />
müssen gewebeverträglich sein.<br />
8.4 ZUSAMMENFASSUNG<br />
Bei den verschiedenen Möglichkeiten, um eine Infusion zu applizieren, unterscheidet<br />
man zwischen venösem, arteriellem und subcutanem Zugang.<br />
Bei der venösen Infusion werden die gewünschten Stoffe über eine Kanüle oder ei-<br />
nen Katheter direkt in die Vene infundiert und sehr rasch zum Herz geführt, von wo<br />
sie sich gleichmäßig über den ganzen Körper verteilen. Man unterscheidet beim ve-<br />
nösen Zugang zwischen peripherem Zugang und zentralen Katheter-Zugängen. Nur<br />
isoosmolare und leicht hyperosmolare Lösungen sollten peripher infundiert werden,<br />
da stark hyperosmolare Lösungen die Venen schädigen bzw. zerstören können. Im<br />
Schockzustand kollabieren die peripheren Gefäße, es ist somit nur noch ein zentraler<br />
Zugang möglich. Als zentrale Venen bezeichnet man die fest im Gewebe fixierten<br />
Gefäße des Brust- und Halsbereichs.<br />
Bei der arteriellen Infusion oder Injektion werden die Wirkstoffe in eine bestimmte<br />
Arterie mit einem definierten Verteilungsgebiet gegeben. Die Wirkstoffe gelangen<br />
relativ unverdünnt dorthin und erreichen erst nach Passage des Kapillarbettes und<br />
der Venen stark verdünnt die übrigen Körperbezirke. Es ist zu beachten, dass der<br />
Druck in den Arterien nur die Infusion per Druckinfusion oder mittels Infusionspumpe<br />
zulässt.<br />
Subcutane Injektionen nutzen das langsame Diffundieren der Wirkstoffe aus dem Be-<br />
reich des Interstitiums in das Gefäß, um eine Langzeitwirkung zu erzeugen. In die<br />
Bereiche zwischen den Zellen (Interstitum) wird in Ausnahmefällen infundiert, wenn<br />
es sich um kleine Flüssigkeitsmengen handelt und keine punktierbaren Gefäße zur<br />
Verfügung stehen. Lösungen, die in den subcutanen Bereich gebracht werden, müs-<br />
sen gewebeverträglich sein.<br />
71
<strong>B|BRAUN</strong><br />
8.5 KONTROLLFRAGEN<br />
� Beschreiben Sie das Vorgehen bei peripheren Zugang (venös) und zentralem<br />
Katheter Zugang!<br />
� Welche Infusionslösungen können/müssen peripher bzw. zentral infundiert<br />
werden?<br />
� Beschreiben Sie den Verlauf der arteriellen und subcutanen Infusion!<br />
� Was ist bei der arteriellen Infusion zu beachten?<br />
� Was ist bei der subcutanen Infusion zu beachten?<br />
72
<strong>B|BRAUN</strong><br />
Glossar: ERKLÄRUNG VON FACHAUSDRÜCKEN<br />
Albumin<br />
Eiweißstoff im Blut, der das Wasser im Gewebesystem<br />
bindet<br />
Alkalose Krankhafter Basenüberschuß im Blut, z. B. bei Verlust<br />
saurer Sekrete (Erbrechen)<br />
Alkalität Basenüberschuß einer Lösung<br />
Aminosäuren Eiweißbausteine<br />
Anitkörpertiter Gehalt einer Lösung an Antikörpern (Substanz, die im<br />
Blut gebildet wird und den Körper gegen bestimmte<br />
Krankheiten schützt)<br />
Atom Elementarbaustein<br />
Azidität Säuregehalt einer Lösung<br />
Azidose Krankhafte Übersäuerung des Blutes durch Stoff-<br />
wechselprodukte<br />
Bicarbonat Saures Salz der Kohlensäure. Im Blut vorkommender<br />
Stoff, der Wasserstoffionen (H+) bindet und dadurch eine<br />
Übersäuerung (Azidose)verhindert. Wird bei Störungen<br />
durch Infusion künstlich zugeführt (Puffersubstanz)<br />
Bltuplasma Blut ohne Zellbestandteile<br />
Dextran Aus Glukosemolekülen aufgebauter hochmolekularer<br />
Zucker, der in Lösungen als Volumenersatzmittel Ver-<br />
wendung findet.<br />
Diffusion Allmähliche selbsttätige Vermischung von gasförmigen ,<br />
flüssigen oder festen Stoffen, die untereinander in<br />
Berührung stehen, bis zur völligen Einheitlichkeit.<br />
Elektrolyt Stoff, der in einer Lösung den elektrischen Strom leitet,<br />
z. B. Säuren, Laugen, Salze. Gegensatz: Nichtelektro-<br />
lyte, z. B. Zucker<br />
73
<strong>B|BRAUN</strong><br />
Enteral durch den Magen-Darm-Trakt<br />
Ester Verbindung aus Alkoholen u. Säuren<br />
Extrazellulär Außerhalb der Zelle<br />
Glykogen Speicherungsform der Zucker im Körper (Leber, Muskel)<br />
Glyzerin dreiwertiger, sirupartiger Alkohol<br />
Homöostase Durch den Regulationsmechanismus aufrechterhaltene<br />
Stabilität gewisser Körperfunktionen wie Stoffwechsel,<br />
Temperatur, Blutdruck u. a. gegenüber vielfältigen Ein-<br />
flüssen.<br />
Hyper erhöht<br />
Hypo erniedrigt<br />
Insuffizienz ungenügende Leistung<br />
Interstitum Zwischenzellgewebe<br />
Intrazellulär innerhalb der Zelle<br />
Inkompatibel unverträglich<br />
Ionen Atome oder Atomgruppen mit positiver (+ Kation) oder<br />
negativer (- Anion) elektrischer Ladung<br />
Isoton Lösung mit der gleichen Anzahl osmotisch wirksamer<br />
Teilchen wie eine Vergleichslösung, z. B. Blut (Blut-<br />
isoton)<br />
Kalorie Die Wärmemenge, die 1 l Wasser von 14,5 auf 15,5° C<br />
erwärmt.<br />
Katabolismus Abbaustoffwechsel<br />
Kohlendioxid (CO2) Gas, das beim Stoffwechsel der Zellen entsteht und über<br />
die Lungen ausgeatmet wird. Führt bei Lungenversagen<br />
durch Anhäufung im Blut zur sogenannten Azidose.<br />
74
<strong>B|BRAUN</strong><br />
Kolloide Stoffe, die sich in feinster, mikroskopisch nicht mehr er-<br />
kennbarer Verteilung in einem Lösungsmittel befinden,<br />
aber nicht echt gelöst sind (Eiweiß, Dextran).<br />
Kolloidale Lösung Medizinisch: Lösung von Kolloiden mit starkem Wasser-<br />
Kolloidosmotischer<br />
(onkotischer) Druck<br />
Kompatibilität Verträglichkeit<br />
bindungsvermögen zum Blutvolumenersatz.<br />
Von in einer Lösung befindlichen Kolloiden mit starkem<br />
Wasserbindungsvermögen auf eine Membran (die sie<br />
nicht durchdringen können) ausgeübter Druck.<br />
Lactat Salz der Milchsäure, Stoffwechselprodukt der Zellen, das<br />
sich bei Kreislaufversagen im Blut anhäuft und zur soge-<br />
nannten Lactatazidose führt.<br />
Mannit Höherwertiger Zuckeralkohol<br />
Membran Zarte Haut, medizinisch: poröse Scheidewand, Grenz-<br />
fläche zwischen Zelle und Umgebung.<br />
Molekül Die kleinste Einheit einer chemischen Verbindung. Sie<br />
besteht aus Atomen, gleicher oder verschiedener Art.<br />
Molekulargewicht Gewicht eines Moleküls. Läßt auf seine Größe schließen,<br />
die beim Durchtritt durch Membranen eine Rolle spielt.<br />
Ödem Ansammlung wäßriger Flüssigkeit im Zwischenzell-<br />
gewebe.<br />
Osmose Konzentrationsausgleich durch eine poröse Scheide-<br />
wand (Membran) zwischen unterschiedlich konzentrier-<br />
ten Lösungen.<br />
Osmotischer Druck Bei Verwendung halbdurchlässiger (semipermeabler)<br />
Membranen entsteht osmotischer Druck, da solche<br />
Membranen nur für das Lösungsmittel, nicht aber für den<br />
gelösten Stoff durchlässig sind, so dass dieser auf die<br />
Membranen drückt.<br />
75
<strong>B|BRAUN</strong><br />
Osmolarität (Kurzbildung aus Osmose und Molekül) Konzentration<br />
Osmotherapie und<br />
Osmodiurese<br />
aller in einer Lösung osmotisch wirksamen Moleküle,<br />
ausgedrückt in Volumeneinheiten.<br />
Durch Infusion einer hochkonzentrierten Zuckerlösung<br />
(um den osmotischen Druck des Blutes zu erhöhen) wird<br />
der Einstrom von Gewebswasser in das Blut erzwungen<br />
(Beseitigung von Ödemen) und dadurch auch die<br />
Harnausscheidung vermehrt.<br />
Parenteral Unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes<br />
Phagozytose<br />
Aufnahme und Auflösung von Fremdköprern<br />
pH-Wert Maß für den Gehalt einer Lösung an Wasserstoffionen<br />
(H + ) (Maßzahl 1 – 14). Von diesem hängt ab, ob eine<br />
Lösung sauer (hoher Gehalt an H + -Ionen, Maßzahl 1 – 7)<br />
oder basisch (niedriger Gehalt an H + -Ionen, Maßzahl 7 –<br />
14) reagiert.<br />
Plasmaexpander Blutvolumen-Ersatzlösung, die über das zugeführte<br />
Volumen hinaus noch Flüssigkeit aus dem Zwischenzell-<br />
gewebe in die Blutbahn zieht.<br />
Proteine Zusammengesetzte Eiweißkörper<br />
Puffersubstanz Stoff, der sowohl WasserstoffIonen aufnehmen wie auch<br />
abgeben kann und dadurch Störungen im Säuren-<br />
Basen-Gleichgewicht ausgleicht.<br />
Reststickstoff (Rest-N) Gesamtgehalt an Nichteiweißstickstoff im Blut-<br />
serum, der nach völligen Ausfällen des Eiweißes aus<br />
dem Serum zurückbleibt. Der Rest-N besteht im wesent-<br />
lichen aus harnpflichtigen Schlackenstoffen aus dem<br />
Stoffwechsel.<br />
semipermeabel halbdurchlässig, z. B. bei Membranen, d. h. sie sind<br />
durchlässig für das Lösungsmittel, aber nicht für die<br />
gelöste Substanz.<br />
Serum Blutpasma nach Entzug des Fibrins<br />
76
<strong>B|BRAUN</strong><br />
Sorbit höherwertiger Zuckeralkohol<br />
Substitution Ersatz<br />
Thrombophlebitis Entzündung der Gefäßwände<br />
Viskosität Zähigkeit, Dickflüssigkeit<br />
77


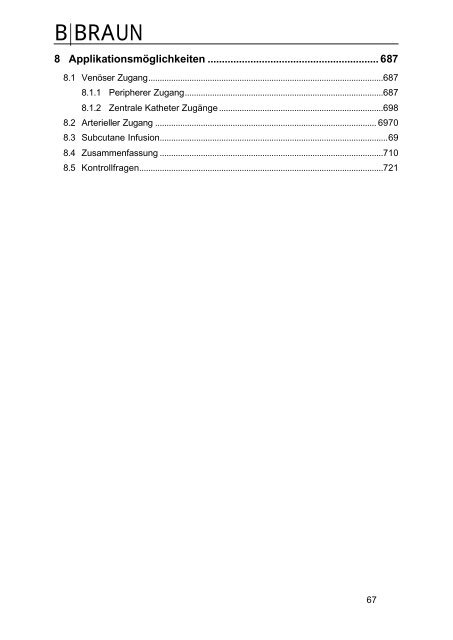



![PDF [1,03 MB] - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/23384805/1/184x260/pdf-103-mb-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)




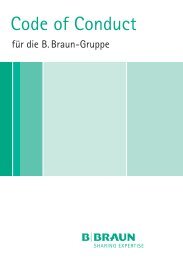
![PDF [2,85 MB] - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/21557003/1/184x260/pdf-285-mb-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)




![PDF [0,73 MB]](https://img.yumpu.com/19440641/1/184x260/pdf-073-mb.jpg?quality=85)