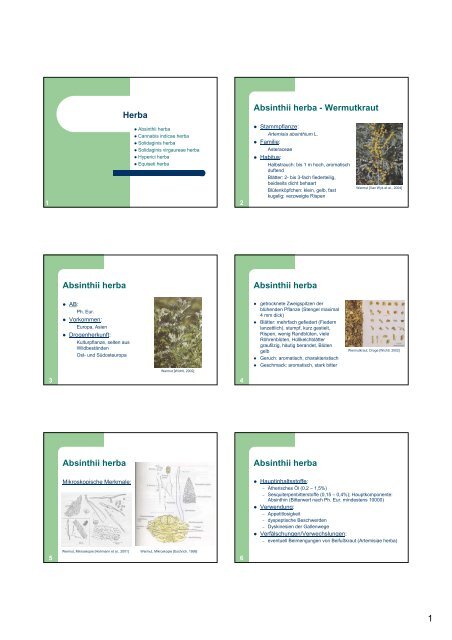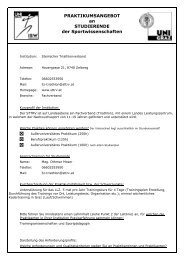Absinthii herba
Absinthii herba
Absinthii herba
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
3<br />
5<br />
<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />
� AB:<br />
Ph. Eur.<br />
� Vorkommen:<br />
Europa, Asien<br />
� Drogenherkunft:<br />
Kulturpflanze, selten aus<br />
Wildbeständen<br />
Ost- und Südosteuropa<br />
<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />
Mikroskopische Merkmale:<br />
Herba<br />
� <strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />
� Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />
� Solidaginis <strong>herba</strong><br />
� Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />
� Hyperici <strong>herba</strong><br />
� Equiseti <strong>herba</strong><br />
Wermut [Wichtl, 2002]<br />
Wermut, Mikroskopie [Hohmann et al., 2001] Wermut, Mikroskopie [Eschrich, 1999]<br />
2<br />
4<br />
6<br />
<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong> - Wermutkraut<br />
� Stammpflanze:<br />
Artemisia absinthium L.<br />
� Familie:<br />
Asteraceae<br />
� Habitus:<br />
Halbstrauch: bis 1 m hoch, aromatisch<br />
duftend<br />
Blätter: 2- bis 3-fach fiederteilig,<br />
beidseits dicht behaart<br />
Blütenköpfchen: klein, gelb, fast<br />
kugelig; verzweigte Rispen<br />
<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />
� getrocknete Zweigspitzen der<br />
blühenden Pflanze (Stengel maximal<br />
4 mm dick)<br />
� Blätter: mehrfach gefiedert (Fiedern<br />
lanzettlich), stumpf, kurz gestielt,<br />
Rispen, wenig Randblüten, viele<br />
Röhrenblüten, Hüllkelchblätter<br />
graufilzig, häutig berandet, Blüten<br />
gelb<br />
� Geruch: aromatisch, charakteristisch<br />
� Geschmack: aromatisch, stark bitter<br />
<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />
Wermut [Van Wyk et al., 2004]<br />
Wermutkraut, Droge [Wichtl, 2002]<br />
� Hauptinhaltsstoffe:<br />
– Ätherisches Öl (0,2 – 1,5%)<br />
– Sesquiterpenbitterstoffe (0,15 – 0,4%); Hauptkomponente:<br />
Absinthin (Bitterwert nach Ph. Eur. mindestens 10000)<br />
� Verwendung:<br />
– Appetitlosigkeit<br />
– dyspeptische Beschwerden<br />
– Dyskinesien der Gallenwege<br />
� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />
– eventuell Beimengungen von Beifußkraut (Artemisiae <strong>herba</strong>)<br />
1
7<br />
9<br />
11<br />
Cannabis indicae <strong>herba</strong> – Kraut des<br />
Indischen Hanfs<br />
� Stammpflanze:<br />
Cannabis sativa L. var. indica<br />
� Familie:<br />
Cannabaceae<br />
� Habitus:<br />
Pflanze: einjährig, bis 4 m hoch,<br />
2-häusig<br />
Blätter: gefingert, gesägt<br />
Blüten: unscheinbar<br />
Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />
Hanf [Van Wyk et al., 2004]<br />
� Sprossspitzen der weiblichen Pflanze mit Blüten und Früchten,<br />
wenige Blätter<br />
� Blütenstände: braungrün, durch Harz verklebt, flachgepresst<br />
� Blüte: verwachsene Blütenhülle, scheidenförmiges, zugespitztes<br />
Deckblatt, umgibt den Fruchtknoten becherförmig<br />
� Frucht: Nuss, ca. 4 mm groß, zerbrechliche Schale<br />
� Same: mit gekrümmtem Keimling, ohne Endosperm<br />
� Blätter: handförmig, 5- bis 7-zählig, schmal-lanzettlich, gesägt,<br />
behaart, unten drüsig punktiert<br />
� Stengel: vierkantig, behaart<br />
� Geruch: eigenartig<br />
� Geschmack: aromatisch bitter<br />
Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />
� Hauptinhaltsstoffe:<br />
– Cannabinoide<br />
– THC (∆9-Tetrahydrocannabinol) � Verwendung:<br />
– Sedativum<br />
– Halluzinogen<br />
� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />
mit den nicht von Harz verklebten Sprossen des Gewöhnlichen<br />
Hanfs (Cannabis sativa)<br />
8<br />
10<br />
12<br />
Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />
� Vorkommen:<br />
Asien<br />
� Drogenherkunft:<br />
Kulturpflanze; gemäßigte<br />
Klimaregionen (oft illegal)<br />
� Begriffserklärung:<br />
– Marihuana: weibliche Blüten<br />
mit Triebspitzen<br />
– Haschisch: Harz der<br />
weiblichen Blüten<br />
Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />
Mikroskopische<br />
Merkmale:<br />
Hanf [Van Wyk et al., 2004]<br />
Hanf, Blattquerschnitt [Fischer, 1978]<br />
Solidaginis <strong>herba</strong> - Goldrutenkraut<br />
� Stammpflanzen:<br />
Solidago gigantea AIT.<br />
Solidago canadensis L.<br />
� Familie:<br />
Asteraceae<br />
� Habitus:<br />
Pflanze: krautig, ausdauernd, 50 – 150 cm<br />
hoch<br />
Stengel: bei Solidago gigantea kahl, bei<br />
Solidago canadensis behaart<br />
Blätter: lanzettlich, zugespitzt, sitzend<br />
Blütenköpfchen: 5 – 8 mm groß, gelb,<br />
Rispen<br />
Riesen-Goldrute<br />
[Schönfelder, 1995]<br />
2
13<br />
15<br />
17<br />
Solidaginis <strong>herba</strong><br />
� AB:<br />
Ph. Eur.<br />
� Vorkommen:<br />
Nordamerika,<br />
eingebürgert in Europa<br />
� Drogenherkunft:<br />
Wildbestände; ost- und<br />
südosteuropäische Länder<br />
Solidaginis <strong>herba</strong><br />
Kanadische Goldrute [Van Wyk et al., 2004]<br />
� Hauptinhaltsstoffe:<br />
– Flavonoide (Solidago gigantea ca. 3,8%; Solidago canadensis<br />
ca. 2,4%)<br />
– Triterpensaponine (Solidago gigantea ca. 9%; Solidago<br />
canadensis ca. 12,5%)<br />
– Diterpene<br />
– Ätherisches Öl<br />
– Phenolcarbonsäuren<br />
– Gerbstoffe<br />
– Polysaccharide<br />
Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong> –<br />
Echtes Goldrutenkraut<br />
� Stammpflanze:<br />
Solidago virgaurea L.<br />
� Familie:<br />
Asteraceae<br />
� Habitus:<br />
Pflanze: krautig, ausdauernd, über<br />
1 m hoch<br />
Blätter: untere B.elliptisch,<br />
gezähnter Rand; obere B. schmal<br />
Blütenkörbchen: gelb, je 6 – 12<br />
Randblüten, Traube Echte Goldrute<br />
[Van Wyk et al., 2004]<br />
14<br />
16<br />
18<br />
Solidaginis <strong>herba</strong><br />
� Stengel: grünlichgelb oder<br />
grünlichbraun, teilweise rötlich<br />
überlaufen, rundlich, gerieft, weißes<br />
Mark, im oberen Teil behaart<br />
� Blätter: 8 – 12 cm lang, 1 – 3 cm<br />
breit, lanzettlich, lang zugespitzt<br />
� Blütenköpfchen: goldgelb, gestielt,<br />
Rispen, Zungen- und Röhrenblüten,<br />
Hüllkelchblätter, Pappus<br />
� Geruch: schwach aromatisch<br />
� Geschmack: schwach adstringierend<br />
Solidaginis <strong>herba</strong><br />
� Verwendung:<br />
Goldrutenkraut, Droge [Wichtl, 2002]<br />
– zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der<br />
ableitenden Harnwege, bei Harnsteinen und Nierengrieß<br />
– zur Vorbeugung von Harnsteinen und Nierengrieß<br />
– VM: bei Alltagsbeschwerden<br />
� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />
andere Solidago-Arten<br />
im Handel oft Gemische aus Echtem Goldrutenkraut<br />
(Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong>) und Riesengoldrutenkraut<br />
(Solidaginis giganteae <strong>herba</strong>)<br />
Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />
� AB:<br />
DAB<br />
� Vorkommen:<br />
Europa, Asien, Nordafrika,<br />
Nordamerika<br />
� Drogenherkunft:<br />
Wildvorkommen;<br />
Ungarn, Polen, nördliche<br />
Balkanländer<br />
Echte Goldrute [Schaffner, 1999]<br />
3
19<br />
21<br />
23<br />
Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />
� Stengel: rund, derb, längs gerieft,<br />
mit Mark, untere Teile violett,<br />
obere kurz behaart<br />
� Blätter: lang und lanzettlich,<br />
ganzrandig, grau bis braungrün,<br />
dicht netznervig<br />
� Blütenköpfchen: goldgelb,<br />
endständig, 10 – 15 mm breit und<br />
6 – 9 mm lang; Zungen- und<br />
Röhrenblüten, Hüllkelchblätter:<br />
dachziegelartig, Pappus<br />
� Geruch: schwach aromatisch<br />
� Geschmack: herb, schwach<br />
adstringierend<br />
Echtes Goldrutenkraut, Droge<br />
[Wichtl, 2002]<br />
Makroskopische Unterschiede der<br />
3 Solidago-Arten<br />
Hüllkelchblätter<br />
Einzelblüten<br />
Behaarung der<br />
Laubblätter<br />
Solidago virgaurea<br />
lanzettlich, innen<br />
stark glänzend, 5 – 7<br />
mm lang<br />
gelb, 6 – 9 mm lang,<br />
Zungenblüten<br />
deutlich länger als<br />
die Hüllblätter, häufig<br />
mit Pappus<br />
spärlich behaart,<br />
vereinzelt Haare von<br />
säbelförmiger, leicht<br />
gebogener Gestalt<br />
Solidago gigantea<br />
3 – 4 mm lang<br />
gelb, 4 – 5 mm lang,<br />
Zungenblüten<br />
überragen die<br />
Hüllblätter nur wenig<br />
praktisch kahl, sehr<br />
selten ein einzelnes,<br />
oft einzelliges oder<br />
peitschenartiges<br />
Haar, gegenüber S.<br />
virgaurea ist dieses<br />
wesentlich länger<br />
2 – 2,5 mm lang,<br />
gelb<br />
Hyperici <strong>herba</strong> - Johanniskraut<br />
� Stammpflanze:<br />
Hypericum perforatum L.<br />
� Familie:<br />
Hypericaceae<br />
� Habitus:<br />
Pflanze: krautig, ausdauernd,<br />
ca. 60 cm hoch<br />
Stengel: 2 Längsleisten<br />
Blätter: gegenständig<br />
Blüten: gelb, 5-zählig,<br />
auffallend lange Staubblätter<br />
Solidago canadensis<br />
2,5 – 3 mm lang,<br />
Zungenblüten kaum<br />
länger als die<br />
Hüllblätter<br />
behaart, mit kurzen,<br />
flaumigen Haaren,<br />
v.a. auf der<br />
Unterseite und auf<br />
den Nerven<br />
Johanniskraut [Schaffner, 1999]<br />
20<br />
22<br />
24<br />
Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />
� Hauptinhaltsstoffe:<br />
– Ätherisches Öl (0,4 – 0,5%)<br />
– Diterpene<br />
– Triterpensaponine<br />
– Flavonoide (ca. 1,5%)<br />
� Verwendung:<br />
– zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der<br />
ableitenden Harnwege, bei Harnsteinen und Nierengrieß<br />
– zur Vorbeugung von Harnsteinen und Nierengrieß<br />
– VM: Alltagsbeschwerden<br />
� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />
Virgaureae <strong>herba</strong> selten auf dem Markt, deshalb oft auf<br />
Solidaginis <strong>herba</strong> ausgewichen; Verfälschungen mit Senecio-<br />
Arten<br />
Mikroskopische Unterschiede der 3<br />
Solidago-Arten<br />
Gliederhaare<br />
Hüllkelchblattrand<br />
Zwillingshaare<br />
am<br />
Fruchtknoten<br />
Kronblätter<br />
Solidago virgaurea<br />
etwas geschlängelt,<br />
deutlich gestreift bis<br />
gekörnt, 5- bis 6zellig,<br />
200 – 1000 µm<br />
Geißelhaare mit 1 –<br />
3 Stielzellen und<br />
fahnenartiger<br />
Endzelle<br />
300 µm lang, stark<br />
getüpfelte Mittelwand<br />
200 – 300 µm lange,<br />
2-zellreihige<br />
Drüsenzotten<br />
Hyperici <strong>herba</strong><br />
� AB:<br />
Ph. Eur.<br />
� Vorkommen:<br />
Europa, Asien, Nordafrika<br />
� Drogenherkunft:<br />
Wildvorkommen; Europa,<br />
Westasien<br />
Importe aus ost- und<br />
südosteuropäischen Ländern<br />
Anbau: Deutschland, Chile<br />
Solidago gigantea<br />
säbelartig gebogen, dünnwandig, 5- oder 6zellig,<br />
330 – 360 µm<br />
vereinzelt 2- bis 3zellige<br />
Gliederhaare<br />
und wenige<br />
Geißelhaare mit<br />
dünner Endzelle<br />
bis 200 µm lang,<br />
deutlich wellige oder<br />
streifige Cuticula<br />
keine Behaarung<br />
Solidago canadensis<br />
5-zellige<br />
Gliederhaare und<br />
Geißelhaare mit<br />
relativ dicker<br />
Endzelle<br />
kleiner als 100 µm<br />
Johanniskraut [Schaffner, 1999]<br />
4
25<br />
27<br />
29<br />
Hyperici <strong>herba</strong><br />
� Stengel: gelbgrün, hohl, rund mit 2<br />
Längskanten, kahl<br />
� Blätter: hell- bis braungrün, bis 3 cm<br />
lang, elliptisch-länglich, ganzrandig,<br />
kahl, deutlich durchscheinend punktiert<br />
� Blüten und Blütenknospen: gelb bis<br />
gelbbraun, Rispen, Blütenstiele kahl,<br />
schwarzdrüsig, je 5 Kelch- und<br />
Kronblätter (mit drüsiger Punktierung)<br />
� Frucht: 3-klappige Kapsel, ca. 1 cm<br />
lang, mit zahlreichen dunklen Samen<br />
� Geruch: schwach, eigenartig würzig<br />
� Geschmack: herb-bitter, adstringierend<br />
Hyperici <strong>herba</strong><br />
Johanniskraut, Droge [Wichtl, 2002]<br />
� Verwendung:<br />
– innere Anwendung: psychovegetative Störungen, depressive<br />
Verstimmungszustände, Angst und/oder nervöse Unruhe, ölige<br />
Zubereitungen bei dyspeptischen Beschwerden<br />
– äußere Anwendung: zur Behandlung und Nachbehandlung<br />
von scharfen oder stumpfen Verletzungen, Myalgien und<br />
Verbrennungen 1. Grades<br />
– VM: auch zur Entwässerung und bei Rheumatismus<br />
Equiseti <strong>herba</strong> -<br />
Schachtelhalmkraut<br />
� Stammpflanze:<br />
Equisetum arvense L.<br />
� Familie:<br />
Equisetaceae<br />
� Habitus:<br />
im Frühjahr: fertile Sprosse (10 – 40 cm<br />
hoch) mit den charakteristischen,<br />
bräunlichen Sporophyllständen<br />
im Sommer: bis 50 cm hoch, grün,<br />
quirlig, verzweigte, sterile Sprosse mit<br />
meist 4-flügeligen Seitenästen Schachtelhalm, fertile Sprosse<br />
[Wichtl, 2002]<br />
26<br />
28<br />
30<br />
Hyperici <strong>herba</strong><br />
� Hauptinhaltsstoffe:<br />
– Naphtodianthrone: (0,1 – 0,3%); Hypericin und Hypericinderivate<br />
– Phloroglucinderivate: (2 – 4%); Hyperforin<br />
– Flavonoide (2 – 4%)<br />
– Gerbstoffe<br />
– Xanthone<br />
– Ätherisches Öl (0,1 – 0,3%)<br />
Hyperici <strong>herba</strong><br />
� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />
relativ häufig mit anderen Hypericum-Arten:<br />
– Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum)<br />
– Berg-Johanniskraut (Hypericum montanum)<br />
– Behaartes Johanniskraut (Hypericum hirsutum)<br />
– Bart-Johanniskraut (Hypericum barbatum)<br />
– Flügel-Johanniskraut (Hypericum tetrapterum)<br />
Equiseti <strong>herba</strong><br />
� AB:<br />
Ph. Eur.<br />
� Vorkommen:<br />
in den gemäßigten Zonen<br />
der nördlichen Halbkugel<br />
� Drogenherkunft:<br />
Ost- und Südosteuropa,<br />
China<br />
Schachtelhalm, sterile Sprosse<br />
[Wichtl, 2002]<br />
5
31<br />
33<br />
35<br />
Equiseti <strong>herba</strong><br />
� Stengel und Äste: hell grau-grün, steifbrüchig,<br />
raue Oberfläche, Hauptachse<br />
(1 – 3,5 mm dick, hohl) feinrinnig mit 6<br />
– 19 Rippen, Seitenzweige nur 1 mm<br />
dick, markig<br />
� Blätter: an den Nodien quirlig zu einer<br />
kurzen (5 – 12 mm) röhrig-trichterigen,<br />
gezähnten Scheide verwachsen,<br />
gerippte Seitenäste aus mehreren<br />
Internodien, unverzweigt oder mit<br />
Wirteln<br />
� Geruch: kaum wahrnehmbar<br />
� Geschmack: geschmacklos<br />
Equiseti <strong>herba</strong><br />
Schachtelhalm, Droge [Wichtl, 2002]<br />
� Hauptinhaltsstoffe:<br />
– mineralische Bestandteile (über 10 %); Hauptbestandteil: 2/3<br />
Kieselsäure<br />
– Flavonoide<br />
– Hydroxyzimtsäurederivate<br />
– Polyensäuren<br />
– Dicarbonsäuren<br />
Makroskopische Unterschiede der<br />
beiden Equisetum-Arten<br />
Sprossquerschnitt<br />
unterstes Internodium<br />
der Seitensprosse<br />
Equisetum arvense<br />
Hauptsprosse mit (6 bis) 9<br />
Rippen und Vallekularhöhlen,<br />
Seitensprosse<br />
ohne Vallekularhöhlen<br />
länger als die zugehörige<br />
Blattscheide des<br />
Hauptsprosses<br />
Equisetum palustre<br />
Hauptsprosse mit nur 4 – 8<br />
Rippen und Vallekularhöhlen,<br />
Seitensprosse<br />
ohne Vallekularhöhlen<br />
kürzer als die zugehörige<br />
Blattscheide des<br />
Hauptsprosses<br />
Equisetaceae, Abbildungen [Hohmann et al., 2001] 36<br />
32<br />
34<br />
Equiseti <strong>herba</strong><br />
Mikroskopische<br />
Merkmale:<br />
Equiseti <strong>herba</strong><br />
� Verwendung:<br />
Schachtelhalm, Mikroskopie, Pulver<br />
[Eschrich, 1999]<br />
– innere Anwendung: posttraumatisches und statisches Ödem,<br />
zur Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen<br />
Erkrankungen der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß<br />
– äußere Anwendung: unterstützende Behandlung schlecht<br />
heilender Wunden<br />
– VM: auch als Hämostyptikum<br />
� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />
häufig, v.a. mit dem toxischen Sumpfschachtelhalm<br />
(Equisetum palustre)<br />
Mikroskopische Unterschiede der<br />
beiden Equisetum-Arten (1)<br />
Epidermishöcker<br />
(sind auf den Rippen<br />
von Seitenästen und<br />
Spross)<br />
Spaltöffnungsskelette<br />
(nach dem<br />
Veraschen)<br />
Abbildungen: siehe nächste Folie<br />
Equisetum arvense<br />
bestehen aus 2<br />
Zellen<br />
Spalt mit groben<br />
„Haifisch“-Zähnen<br />
Equisetum palustre<br />
bestehen nur aus 1<br />
Zellen<br />
Spalt mit feinen,<br />
Reißverschluss<br />
ähnlichen Zähnchen<br />
6
37<br />
Mikroskopische Unterschiede der<br />
beiden Equisetum-Arten (2)<br />
Epidermalhöcker Aschenbild: Stomata<br />
Equisetaceae<br />
[Wichtl, 2002]<br />
E. palustre<br />
E. arvense<br />
Equisetaceae<br />
[Wichtl, 2002]<br />
38<br />
DC der Schachtelhalm-Flavonoide<br />
E. arvense: 1, 2, 4 (Europa), 3 (Ostasien)<br />
E. palustre: 6, 7, 9 (Europa)<br />
Gemische: 5, 8<br />
Ref.: Qu-3-gluc + Lut-5-gluc<br />
A: Qu-3-gluc<br />
B: Qu-3-glyk E 10<br />
C: Api-5-gluc<br />
D: Lut-5-gluc<br />
E: Qu-3,5-digluc<br />
F: Qu-3-sophorosid<br />
G: Kä-3,7-digluc<br />
H: Kä-3-rutinosid-7-gluc<br />
I: Kä-3-sophorosid-7-gluc<br />
Det.: NA/PEG (UV 365 )<br />
[Wichtl, 2002]<br />
7