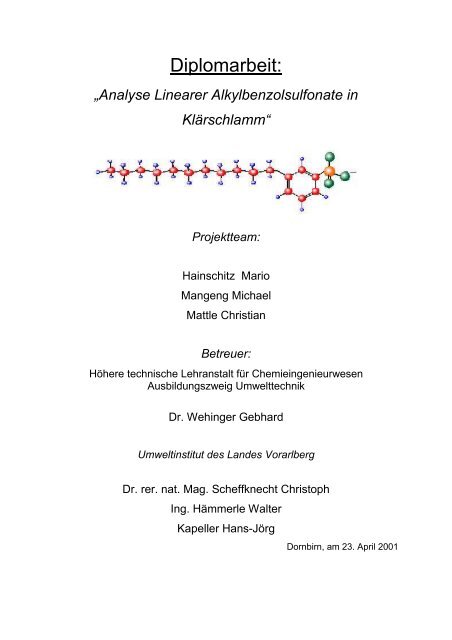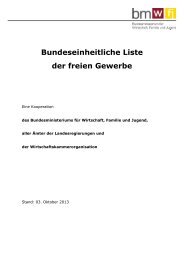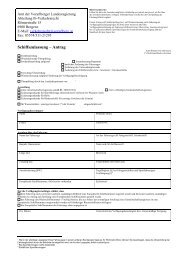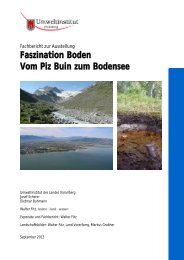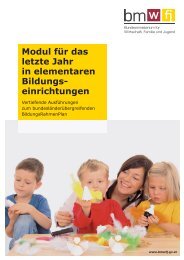Analyse linearer Alkylbenzolsulfonate in Klärschlamm - Vorarlberg
Analyse linearer Alkylbenzolsulfonate in Klärschlamm - Vorarlberg
Analyse linearer Alkylbenzolsulfonate in Klärschlamm - Vorarlberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diplomarbeit:<br />
„<strong>Analyse</strong> L<strong>in</strong>earer <strong>Alkylbenzolsulfonate</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>Klärschlamm</strong>“<br />
Projektteam:<br />
Ha<strong>in</strong>schitz Mario<br />
Mangeng Michael<br />
Mattle Christian<br />
Betreuer:<br />
Höhere technische Lehranstalt für Chemie<strong>in</strong>genieurwesen<br />
Ausbildungszweig Umwelttechnik<br />
Dr. Weh<strong>in</strong>ger Gebhard<br />
Umwelt<strong>in</strong>stitut des Landes <strong>Vorarlberg</strong><br />
Dr. rer. nat. Mag. Scheffknecht Christoph<br />
Ing. Hämmerle Walter<br />
Kapeller Hans-Jörg<br />
Dornbirn, am 23. April 2001
Danksagung<br />
An dieser Stelle möchten wir, Ha<strong>in</strong>schitz Mario, Mangeng Michael und<br />
Mattle Christian, uns bei allen, die uns bei diesem Projekt unterstützt<br />
haben herzlichst bedanken. Seitens der Schule möchten wir uns im<br />
speziellen bei unserem sehr geschätzten Herrn Dr. Gebhard Weh<strong>in</strong>ger<br />
bedanken, aber auch all den anderen Lehrern der HTL Dornbirn, die uns<br />
bei Bedarf die Abwesenheit vom Unterricht verziehen haben.<br />
Besonderer Dank gilt aber unseren Betreuern vom Umwelt<strong>in</strong>stitut des<br />
Landes <strong>Vorarlberg</strong> <strong>in</strong> Bregenz.<br />
Dr. Christoph Scheffknecht, Ing. Walter Hämmerle und Hans-Jörg<br />
Kapeller standen uns bei den auftretenden Problemen tatkräftig zur<br />
Seite.<br />
Danke
Inhaltsverzeichnis:<br />
1. Zusammenfassung bzw. Abstract 1<br />
2. Liste der wichtigsten Abkürzungen 2<br />
3. Zielsetzung und Motivation 2<br />
3.1 Zeitlicher Ablauf 3<br />
4. E<strong>in</strong>leitung 3<br />
4.1 Zweck des Projektes 3<br />
4.2 Allgeme<strong>in</strong>es 4<br />
4.2.1 Tenside 4<br />
4.2.2 Stoffbeschreibung LAS 6<br />
4.2.3 Stoffbeschreibung <strong>Klärschlamm</strong> 7<br />
4.2.4 HPLC 8<br />
5. Geräte und Chemikalien 10<br />
5.1 Geräte und diverse Materialien 10<br />
5.2 Chemikalien 11<br />
6. Durchführung 12<br />
6.1 Probennahme und Konservierung 12<br />
6.2 Probenvorbereitung 12<br />
6.2.1 Herstellung der benötigten Lösungen 14<br />
6.2.2 Soxhletextraktion 13<br />
6.2.3 Festphasenre<strong>in</strong>igung 14
6.3 Analytik 14<br />
6.3.1 HPLC 14<br />
6.3.1.1 Herstellung der Lösungen 14<br />
6.3.1.2 HPLC E<strong>in</strong>stellungen 16<br />
6.4 Qualitätssicherung 17<br />
6.4.1 Def<strong>in</strong>itionen 17<br />
6.4.2 Händische Auswertung (Rechengang) 22<br />
6.4.3 Verfahrenskenndaten 25<br />
6.4.4 Diskussion der QSA Ausdrucke (Graphische<br />
Darstellungen) 25<br />
6.5 Kurzbeschreibung der Methode (Flussdiagramm) 29<br />
7. Ergebnisse 30<br />
7.1 Tabellarische Zusammenfassung 30<br />
7.2 Bewertung und Interpretation 31<br />
7.3 Verfassung der SOP 31<br />
8. Literaturverzeichnis 32<br />
9. Schlusswort 34<br />
10. Anhang 35<br />
Teil 1: Allgeme<strong>in</strong>e Methoden Parameter<br />
Teil 2: QSA Ausdrucke (Statistik, Kalibrierung)<br />
Teil 3: Beispielchromatogramme<br />
Teil 4: Graphische Darstellung der Messwerte<br />
Teil 5: SOP (Standardarbeitsanweisung)
1. Zusammenfassung:<br />
LAS (L<strong>in</strong>eare <strong>Alkylbenzolsulfonate</strong>) s<strong>in</strong>d anionische Tenside, die <strong>in</strong> praktisch<br />
jedem Waschmittel als waschaktive Substanzen vorkommen. Sie<br />
besitzen ke<strong>in</strong>e akut toxischen Eigenschaften und s<strong>in</strong>d relativ gut biologisch<br />
abbaubar. Aufgrund der großen Mengen, <strong>in</strong> denen sie vorkommen,<br />
wurden mittels e<strong>in</strong>er neuen Methode die Gehalte an LAS im <strong>Klärschlamm</strong><br />
heimischer Kläranlagen quantitativ bestimmt. Dies geschah<br />
mittels HPLC und UV - Detektion. Die LAS-Gehalte liegen je nach Region<br />
zwischen 1000 mg/kg TS und 9000 mg/kg Trockensubstanz. E<strong>in</strong><br />
Grenzwert für LAS existiert <strong>in</strong> den derzeitigen Rechtsvorschriften nicht,<br />
wird aber im Entwurf zur <strong>Klärschlamm</strong>richtl<strong>in</strong>ie der EU diskutiert.<br />
Abstract:<br />
LAS (=L<strong>in</strong>ear-Alkylbenzol-Sulfonate) are anionic wash<strong>in</strong>g-active substances,<br />
which are wideley used <strong>in</strong> every wash<strong>in</strong>g powder. They have no<br />
acute toxic properties and they are quite easily biodegradable. But there<br />
is one po<strong>in</strong>t, which causes some problems. LAS are found <strong>in</strong> sewage<br />
sludge <strong>in</strong> quite high concentrations.<br />
In cooperation with the <strong>Vorarlberg</strong> Environmental Institute we have developed<br />
a new method to determ<strong>in</strong>e the amount of LAS <strong>in</strong> some of the<br />
most important waste water treatment plants <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong>. This job was<br />
significantly facilitated by the fact, that we could use the <strong>in</strong>stitute´s High<br />
Performance Liquid Chromatographie device.<br />
The concentration of LAS we found lies between and 9000 mg per kilogram<br />
dry sewage sludge. At the moment there is no legal limit of LAS<br />
concentration, but some of the water treatment plants <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> have<br />
such a high amount of LAS, that the government will have to determ<strong>in</strong>e<br />
an appropriate threshold value <strong>in</strong> the near future.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 1 -
2. Liste der wichtigsten Abkürzungen:<br />
ARA Abwasser Re<strong>in</strong>igungs Anlage<br />
AS Auto Sampler<br />
HPLC High Performance Liquid Chromatography<br />
(=Hochleistungsflüssigkeitschromatographie)<br />
ISO International Standardisation Organisation<br />
LAS L<strong>in</strong>eare Alkyl-Benzolsulfonate<br />
SOP Standard Operat<strong>in</strong>g Procedure (Standard Arbeitsanweisung)<br />
TS Trockensubstanz<br />
UV Ultraviolett<br />
3. Zielsetzung und Motivation:<br />
Ziel des Projektes ist die Erstellung e<strong>in</strong>er <strong>Analyse</strong>nmethode für LAS <strong>in</strong><br />
Klärschlämmen, die dann als Rout<strong>in</strong>emethode im Umwelt<strong>in</strong>stitut des<br />
Landes <strong>Vorarlberg</strong> e<strong>in</strong>gesetzt wird. Die Festschreibung der Methode er-<br />
folgt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er SOP, die im Zuge der analytischen Qualitätssicherung (ISO<br />
17025) gefordert wird.<br />
Untersucht werden Klärschlämme der wichtigsten Abwasser-<br />
re<strong>in</strong>igungsanlagen im Raum <strong>Vorarlberg</strong>. Die Methode stützt sich dabei<br />
stark auf e<strong>in</strong>en Vorschlag des Umweltbundesamtes <strong>in</strong> Wien, jedoch<br />
mussten für das Labor <strong>in</strong> Bregenz e<strong>in</strong>ige Adaptierungen durchgeführt<br />
werden. Die orientierende Untersuchung der wichtigsten Kläranlagen <strong>in</strong><br />
<strong>Vorarlberg</strong> dient dazu, um bei e<strong>in</strong>er Grenzwertfestlegung produktiv mit-<br />
wirken zu können. Es existieren bereits Vorschläge der Europäischen<br />
Geme<strong>in</strong>schaft für LAS im <strong>Klärschlamm</strong>, deren E<strong>in</strong>haltung aber nicht<br />
überall möglich se<strong>in</strong> wird.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 2 -
3.1 Zeitlicher Ablauf des Projektes:<br />
Juni bis September 2000: Literaturstudium, Kennenlernen der<br />
Betriebssoftware und des <strong>Analyse</strong>nge-<br />
rätes,<br />
Beschaffung der Chemikalien und<br />
Standardsubstanzen;<br />
Oktober bis Dezember 2000: Analytische Arbeiten und Fertigstel-<br />
lung der Methode; Erstellung e<strong>in</strong>er<br />
Rohversion der SOP;<br />
Jänner bis Februar 2001: <strong>Analyse</strong> von Klärschlämmen aus ver-<br />
schiedenen Kläranlagen im Raum<br />
<strong>Vorarlberg</strong>; Fertigstellung der SOP;<br />
Februar bis April 2001: Erstellung des Berichtes;<br />
Der gesamte Zeitaufwand betrug pro Person ca. 150 h.<br />
4. E<strong>in</strong>leitung:<br />
4.1 Zweck des Projekts:<br />
Der persönliche und schulische Zweck des Projektes ist die Zusammen-<br />
arbeit mit Instituten und somit e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Berufswelt sowie die<br />
praktische Anwendung des <strong>in</strong> der Schule gelernten theoretischen und<br />
praktischen Stoffes.<br />
Das Ziel des Projektes ist die Erstellung e<strong>in</strong>er <strong>Analyse</strong>nmethode für LAS<br />
<strong>in</strong> Klärschlämmen, die als Rout<strong>in</strong>emethode im Umwelt<strong>in</strong>stitut e<strong>in</strong>gesetzt<br />
wird.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 3 -
4.2 Allgeme<strong>in</strong>es:<br />
4.2.1 Tenside:<br />
Der E<strong>in</strong>satz der Tenside ist vielfältig. Tenside f<strong>in</strong>den hauptsächlich <strong>in</strong><br />
Wasch- und Re<strong>in</strong>igungsmitteln, ferner als Netzmittel, Schaumbildner und<br />
Re<strong>in</strong>igungsverstärker, Textilhilfsmittel, Antistatika (Mittel gegen elek-<br />
trostatische Aufladung), Emulgatoren und Demulgatoren Verwendung.<br />
Weiters werden sie unter anderem zu Lötmitteln, Frostschutzbädern,<br />
galvanischen Bädern, Schneid- und Bohrölen, Bitumen und Schädl<strong>in</strong>gs-<br />
bekämpfungsmitteln zugesetzt.<br />
Tenside werden auch zur Herstellung gleichmässiger Emulsionen <strong>in</strong> der<br />
Margar<strong>in</strong>e-, Backwaren- und Schokoladen<strong>in</strong>dustrie, <strong>in</strong> der Papier-,<br />
Leder-, Klebstoff-, Gummi- und Kunststoff<strong>in</strong>dustrie verwendet und zur<br />
Lösungsvermittlung <strong>in</strong> der Kosmetik- und Arzneimittel<strong>in</strong>dustrie e<strong>in</strong>ge-<br />
setzt.<br />
Die Bestandteile e<strong>in</strong>es Waschmittels müssen beim Waschprozess spe-<br />
zielle Aufgaben erfüllen, wobei moderne Waschmittel aus folgenden<br />
großen Substanzgruppen bestehen:<br />
- Waschaktive Substanzen (Tenside)<br />
- Waschmittelaufbaustoffe (Gerüstsubstanzen, sog. „Builder“ )<br />
- Sonderzusätze (Bleichmittel, Enzyme, usw.)<br />
- Hilfsstoffe (Pulverfeuchte, usw.)<br />
Tenside – obwohl dem Mengenanteil nach den Buildern unterlegen –<br />
s<strong>in</strong>d die wichtigste Gruppe der Waschmittel<strong>in</strong>haltsstoffe. Sie s<strong>in</strong>d gut<br />
wasserlösliche Substanzen, die e<strong>in</strong>e langgestreckte unverzweigte Koh-<br />
lenwasserstoffkette mit hydrophoben Eigenschaften haben und e<strong>in</strong>e hy-<br />
drophile funktionelle Gruppe aufweisen.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 4 -
Diese Verb<strong>in</strong>dungen s<strong>in</strong>d daher e<strong>in</strong>erseits gut wasserlöslich, zeigen aber<br />
auch e<strong>in</strong>e hohe Aff<strong>in</strong>ität zu Fetten. Art und räumliche Anordnung der<br />
Moleküle, sowie das Verhältnis der Gruppen im Molekül bestimmen die<br />
grenzflächenaktive Wirksamkeit.<br />
Wir unterscheiden anionische, kationische, nichtionische und amphotere<br />
Tenside. Diese Begriffe s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Grobe<strong>in</strong>teilung, denn sie geben nur<br />
Auskunft über die Ladung der Tensidmoleküle <strong>in</strong> der Wasserlauge:<br />
- Anionische: (A-) Tenside s<strong>in</strong>d negativ geladen<br />
- Nichtionische: (N-) Tenside tragen ke<strong>in</strong>e Ladung<br />
- Amphotere: Tenside tragen <strong>in</strong> der alkalischen Lauge e<strong>in</strong>e negative<br />
Ladung, <strong>in</strong> der sauren Lösung e<strong>in</strong>e positive;<br />
- Kationische: (K-) Tenside s<strong>in</strong>d positiv geladen<br />
Die waschaktiven Substanzen <strong>in</strong> den heutigen Waschmitteln s<strong>in</strong>d vor-<br />
wiegend e<strong>in</strong>e synergetisch wirkende Mischung aus anionischen und<br />
nichtionischen Tensiden, die gute Waschwirkung gegenüber Synthese-<br />
fasern, Fasermischungen und hochveredelter Baumwolle aufweisen.<br />
Nach Anzahl und produzierter Menge ist die Gruppe der A- Tenside die<br />
größte Gruppe. Infolge ihrer breiten Anwendung s<strong>in</strong>d Tenside und deren<br />
Abbauprodukte im aquatischen Ökosystem <strong>in</strong> messbaren Konzentratio-<br />
nen zu f<strong>in</strong>den.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 5 -
Anionische Tenside s<strong>in</strong>d (z.B.):<br />
- Seife<br />
- L<strong>in</strong>eare <strong>Alkylbenzolsulfonate</strong> (LAS)<br />
- Olef<strong>in</strong>sulfonate (AOS)<br />
- Alkansulfonate (SAS)<br />
- Fettalkoholethersulfate (FAES)<br />
- Fettalkoholsulfate (FAS)<br />
- Fettsäureestersulfonate (ES)<br />
(vgl. Scharf, Hob<strong>in</strong>ger, Seif; UBA Wien, Seite 1,2)<br />
4.2.2 Stoffbeschreibung LAS:<br />
LAS s<strong>in</strong>d – nach Seife – die wichtigsten E<strong>in</strong>zeltenside mit e<strong>in</strong>em Markt-<br />
anteil von etwa 30 Prozent und e<strong>in</strong>er Weltproduktion von zur Zeit etwa<br />
1,5 Mio. Tonnen pro Jahr. Sie werden hauptsächlich <strong>in</strong> pulverförmigen,<br />
aber auch <strong>in</strong> flüssigen Wasch-, Spül- und Re<strong>in</strong>igungsmitteln e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Die LAS s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zelstoffe, sondern Stoffgemische aus l<strong>in</strong>earen Al-<br />
kylbenzolsulfonaten. Die Alkylkette der für Waschmittel verwendeten<br />
LAS bee<strong>in</strong>haltet meist zwischen zehn und dreizehn C-Atome.<br />
In diesem Bereich hat das Produkt se<strong>in</strong> Optimum im Waschverhalten<br />
und der biologischen Abbaubarkeit. Der mengenmäßig größte Anteil der<br />
LAS <strong>in</strong> Waschmitteln hat e<strong>in</strong>e Kettenlänge von zwölf C-Atomen.<br />
LAS s<strong>in</strong>d aufgrund ihrer Verwendung als e<strong>in</strong>e „Massenchemikalie“ zu<br />
betrachten, die bestimmungsgemäß und zielgerichtet über den Abwas-<br />
serpfad entsorgt werden.<br />
Nach ihrem Gebrauch gelangt der größte Teil der Haushalts-, Gewerbe-<br />
und Industriewaschmittel und damit die dar<strong>in</strong> enthaltenen Tenside direkt<br />
<strong>in</strong> das Abwasser.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 6 -
LAS s<strong>in</strong>d biologisch unter aeroben Bed<strong>in</strong>gungen gut und rasch, unter<br />
anaeroben Bed<strong>in</strong>gungen nicht abbaubar. Der Abbau von freiem LAS<br />
wird überwiegend, wenn auch nicht vollständig, von Mikroorganismen<br />
bewerkstelligt. Es kann davon ausgegangen werden, dass komplexierte<br />
LAS (z.B. durch kationische Tenside) biologisch schlechter abbaubar<br />
s<strong>in</strong>d als re<strong>in</strong>e LAS. Komplexieren bedeutet, dass die LAS mit anderen<br />
Substanzen im Wasser unterschiedliche B<strong>in</strong>dungen e<strong>in</strong>gehen. Die Ab-<br />
bauraten dieser LAS s<strong>in</strong>d noch relativ wenig untersucht.<br />
(vgl. Scharf, Hob<strong>in</strong>ger, Seif; UBA Wien, Seite 4,5)<br />
4.2.3 Stoffbeschreibung <strong>Klärschlamm</strong>:<br />
Kommunales Abwasser ist e<strong>in</strong> Gemisch aus häuslichem und gewerbli-<br />
chem Abwasser, welches geme<strong>in</strong>sam mit gesammelten Niederschlags-<br />
mengen meist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Mischkanalisation e<strong>in</strong>geleitet wird.<br />
In jedem Haushalt entsteht Abwasser und damit zwangsläufig auch Klär-<br />
schlamm, der bei der für den Schutz von Wasser und Boden notwendi-<br />
gen Abwasserre<strong>in</strong>igung anfällt.<br />
In der mechanischen Re<strong>in</strong>igungsstufe werden wasserunlösliche Stoffe<br />
aus dem Abwasser entfernt, <strong>in</strong> großen Klärbecken kommt das Abwasser<br />
zur Ruhe, so dass die unlöslichen Stoffe mehrheitlich auf den Grund der<br />
Anlage abs<strong>in</strong>ken und dort als sogenannter „Primärschlamm“ abgezogen<br />
werden können.<br />
Er ist durch die zum Teil sehr groben Bestandteile <strong>in</strong>homogen, dickt <strong>in</strong><br />
der Vorklärung auf e<strong>in</strong>en Feststoffgehalt von fünf bis zehn Prozent e<strong>in</strong><br />
und besteht zu e<strong>in</strong>em hohen Anteil aus anorganischen Stoffen.<br />
In ihm s<strong>in</strong>d auch Schwermetalle enthalten.<br />
Das geklärte Abwasser, das noch die wasserlöslichen Stoffe enthält,<br />
fließt anschließend <strong>in</strong> das Belüftungsbecken der biologischen Stufe. Mit<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 7 -
Hilfe des Belebtschlammes erfolgt e<strong>in</strong>e weitere Re<strong>in</strong>igung. Dieser Be-<br />
lebtschlamm besteht hauptsächlich aus aeroben Mikroorganismen.<br />
<strong>Klärschlamm</strong> ist abgestorbene Biomasse aus der biologischen Re<strong>in</strong>i-<br />
gungsstufe.<br />
(vgl. Scharf, Schneider, Zethner; UBA Wien, Seite 14)<br />
4.2.4 HPLC:<br />
HPLC bedeutet High Performance Liquid Chromatographie, was soviel<br />
bedeutet wie Hoch-Leistungs-Flüssigkeits-Chromatographie.<br />
Es handelt sich dabei um e<strong>in</strong>en Trennprozeß, bei welchem das flüssige<br />
Probengemisch zwischen zwei Phasen – der stationären „ruhenden“<br />
Phase und der mobilen „strömenden“ Phase – aufgetrennt wird.<br />
(vgl. Veronika R. Mayer, 1992, S. 14)<br />
Dabei werden verschiedene Trennpr<strong>in</strong>zipien unterschieden:<br />
• Adsorptionschromatographie<br />
• Chromatographie mit Phasenumkehr<br />
• Flüssig – Flüssig Verteilungschromatographie<br />
• Ionenaustauschchromatographie<br />
• Ionenpaarchromatographie<br />
• Ionenchromatographie<br />
• Ausschlußchromatographie<br />
• Aff<strong>in</strong>itätschromatographie<br />
(vgl. Veronika R. Meyer, 1992, S. 4)<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 8 -
Schematischer Aufbau e<strong>in</strong>er HPLC Apparatur :<br />
Quelle: CD – Römpp © 1995 Georg Thieme Verlag<br />
Moderne HPLC Apparaturen haben noch zusätzlich Autosampleranlagen<br />
zur kont<strong>in</strong>uierlichen Probenaufgabe und EDV–Systeme zur Auswertung.<br />
Detektoren:<br />
Der Detektor stellt die Änderung der mobilen Phase fest und muß diese<br />
Änderung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> elektrisches Signal umwandeln um dieses auf den Bild-<br />
schirm, Schreiber oder Integrator weiterzuleiten (vgl. Veronika R. Meyer,<br />
1992, S.61).<br />
Wichtige Detektoren <strong>in</strong> der HPLC:<br />
• UV - Detektor<br />
Elutionsmittel<br />
Pum pe<br />
bis 350 bar<br />
mV - Schreiber<br />
Fraktionssammler<br />
• Brechungs<strong>in</strong>dex – Detektor<br />
• Fluoreszenz – Detektor<br />
Probenaufgabe<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
�����������<br />
Trennsäule<br />
Detektor<br />
Signalwandler<br />
• Weitere: Leitfähigkeitsdetektor, Infrarotdetektor;<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 9 -<br />
�����������<br />
������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������
UV – Detektor:<br />
Dieser Detektor wird von uns auch bei dieser Projektarbeit verwendet.<br />
Pr<strong>in</strong>zip: Das Pr<strong>in</strong>zip beruht auf der Absorptionsfähigkeit verschiedener<br />
Stoffe von UV Strahlung. Die Strahlung durchdr<strong>in</strong>gt die Probelösung und<br />
wird dabei abgeschwächt. Der Unterschied zur ursprünglichen Intensität<br />
wird über e<strong>in</strong>e Photodiode erfaßt und <strong>in</strong> e<strong>in</strong> elektrisches Signal umge-<br />
wandelt. Um die Eigenabsorption der mobilen Phase zu erfassen werden<br />
auch Referenzzellen verwendet, wodurch diese Eigenabsorptionen an-<br />
geglichen werden können. (vgl. Veronika R. Meyer, 1992, S.66)<br />
Beim herkömmlichen UV Detektor muß das Absorptionsmaximum zuerst<br />
bestimmt und dann e<strong>in</strong>gestellt werden.<br />
E<strong>in</strong> Diodenarraydetektor h<strong>in</strong>gegen misst simultan entweder das gesamte<br />
Wellenlängenspektrum oder nur e<strong>in</strong>en bestimmten Wellenlängenbereich.<br />
(siehe auch A. Primer, 1994, S.66).<br />
5. Geräte und Chemikalien:<br />
5.1 Geräte und diverse Materialien:<br />
Extraktionshülsen 22 x 80 mm<br />
Festphasenextraktionssäule RP C – 18 1g, endcapped<br />
z.B.: Macherey-Nagel Art.Nr. 730 015<br />
HPLC Vorsäule LiChrospher 100 RP-8<br />
5µm, 4mm x 4mm ID<br />
HPLC Trennsäule LiChrospher 100 RP-18<br />
5µm, 125 mm x 4mm ID<br />
HPLC – Anlage: „Spectrasystem“ der Fa. Thermo Separation Products<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 10 -
Kolbenhubpipetten 5 ml, 10ml, 1ml<br />
Gradientenpumpe Typ P 2000<br />
Autosampler AS 1000<br />
Diodenarraydetektor UV 6000<br />
Vakuumfiltrationsapparatur mit E<strong>in</strong>fülltrichter;<br />
Verwendete Filter:<br />
Regenerierte Cellulose (für Laufmittel B = Pufferlösung)<br />
PTFE Filtermembran (für Laufmittel A = Acetonitril )<br />
Saugvorrichtung für Festphasenextraktion mit Vakuumpumpe und An-<br />
schlussschläuche<br />
Soxhletextraktionsapparatur<br />
10ml, 100ml, 250ml, 1000 ml Messkolben (Klasse A)<br />
Ultraschallbad<br />
Hammermühle, Ultrazentrifuge<br />
Rotavapor<br />
5.2 Chemikalien:<br />
Chemikalie Zusatz<strong>in</strong>formation<br />
Acetonitril H3C - CN gradient grade<br />
z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />
Methanol CH3OH gradient grade<br />
z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />
Natriumdodecylbenzolsulfonsäure-salz 80 – 85 %<br />
z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />
Formaldehydlösung m<strong>in</strong>. 37% p.A.<br />
z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 11 -
Kaliumhydroxidplätzchen p.A.<br />
z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />
Natriumperchlorat-Monohydrat NaClO4 * H2O p.A.<br />
z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />
Salzsäure HCl 37,5% p.A<br />
z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />
Re<strong>in</strong>stwasser hergestellt mit Milli-Q-Plus<br />
6. Durchführung:<br />
6.1 Probennahme und Konservierung:<br />
Die Probennahme des <strong>Klärschlamm</strong>es erfolgt direkt bei der Kläranlage<br />
nach allen Aufarbeitungsschritten. Die Proben haben dabei sehr unter-<br />
schiedliche Konsistenz und Wassergehalte. Die Probe der ARA Dornbirn<br />
zum Beispiel liegt als Granulat vor, h<strong>in</strong>gegen besitzt die Probe der ARA<br />
Hofsteig <strong>in</strong> Hard nur 27 % TS. Die <strong>Klärschlamm</strong>probe wird lyophilisiert<br />
(= gefriergetrocknet), damit sie wasserfrei ist. Anschließend wird mittels<br />
Schneidrotor vorzerkle<strong>in</strong>ert und mit der Zentrifugalmühle fe<strong>in</strong>stgemahlen.<br />
Die Konservierung erfolgt bei – 25 °C <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em entsprechenden Gefäß.<br />
6.2 Probenvorbereitung:<br />
6.2.1 Herstellung der benötigten Lösungen:<br />
a) methanolische KOH Lösung für die Extraktion:<br />
c(KOH) = 0,5 mol/l<br />
M(KOH) = 56,11 g/mol<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 12 -
m = c(KOH) ⋅M(KOH)<br />
m =<br />
0,5 mol/l ⋅56,11g/mol<br />
= 28,055g<br />
b) Herstellung der 25% igen HCl:<br />
Verdünnung erfolgt aus konzentrierter HCl (w=37,5%).<br />
37,5g..............100g<br />
25g.............. x g<br />
x = 66,67 g<br />
Es müssen 67 g der konzentrierten HCl auf 100 g verdünnt werden.<br />
6.2.2 Soxhletextraktion:<br />
250 mg der Probe werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Extraktionshülse gegeben und mit<br />
80 ml methanolischer KOH (c= 0,5 mol/l) 4 Stunden lang extrahiert. Dies<br />
dient zur Extraktion der LAS aus dem <strong>Klärschlamm</strong>. Das Lösungsmittel<br />
wird im Rotavapor entfernt (T = 50 °C). Es bleiben ca. 5-10 ml Rück-<br />
stand, die nicht e<strong>in</strong>gedampft werden können. Der Rückstand wird <strong>in</strong> 30<br />
ml Wasser/Methanol (30/70 V/V) aufgenommen und mit 25%-iger HCl<br />
auf pH=1 e<strong>in</strong>gestellt.<br />
auf 1l<br />
Anschließend wird die Probe im Ultraschallbad ca. 1 m<strong>in</strong> lang behandelt,<br />
um das Kaliumchlorid <strong>in</strong> Lösung zu br<strong>in</strong>gen (= Soxhletextrakt).<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 13 -
6.2.3 Festphasenre<strong>in</strong>igung:<br />
Die C–18 Säule wird mit 3 ml Methanol und mit 2 ml 0,1 mol/l HCl kondi-<br />
tioniert. Anschließend wird der Soxhletextrakt mit e<strong>in</strong>er Geschw<strong>in</strong>digkeit<br />
von etwa 4 ml /m<strong>in</strong> über die C–18 Säule gesaugt. Die Säule wird danach<br />
mit 2 ml 0,1 mol/l HCl gewaschen. Die LAS werden mit 9 ml (3x3 ml)<br />
Methanol <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en 10 ml Messkolben eluiert. Dann wird mit Methanol auf<br />
10 ml aufgefüllt (= Probenextrakt).<br />
HINWEIS: Während des gesamten Vorganges darf die Säule nicht trok-<br />
kenlaufen !<br />
6.3 Analytik:<br />
6.3.1 HPLC:<br />
Nach Inbetriebnahme der gesamten Anlage (Software hochfahren, Pum-<br />
pe, Autosampler, Degasser (zur Entgasung der Laufmittel) und Detektor<br />
e<strong>in</strong>schalten) wird das gesamte System durch das PURGE Ventil entlüf-<br />
tet. Ebenfalls wird die Spritze des Autosamplers entgast. Vor e<strong>in</strong>er Mes-<br />
sung muß die Anlage konditioniert werden, <strong>in</strong>dem man e<strong>in</strong> Laufmittelge-<br />
misch, welches bereits die bei der späteren <strong>Analyse</strong> verwendeten Kom-<br />
ponenten enthält, ca. 12-24h lang durch die Säule pumpt.<br />
6.3.1.1 Herstellung der Lösungen:<br />
a) Herstellung des Laufmittels A (Acetonitril):<br />
1 l Acetonitril gradient grade z.B. der Fa. Fluka werden über e<strong>in</strong>en<br />
PTFE – Filter vakuumfiltriert (Vakuumfiltrationsapparatur), um die gelöste<br />
Luft zu entfernen. Auch kann mittels Ultraschallbad noch zusätzlich ent-<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 14 -
gast werden. Allerd<strong>in</strong>gs stellte sich heraus, dass die Vakuumfiltration die<br />
wesentlich effizientere Methode ist.<br />
b) Herstellung des Laufmittels B (NaClO4*H2O c = 0,1 mol/l <strong>in</strong> AcN / H2O<br />
(25/75 V/V)):<br />
M(NaClO4 . H2O) = 140,46 g/mol<br />
c = 0,1 mol/l<br />
m(NaClO4 . H2O) = c . V . M(NaClO4 . H2O) = 14,046g<br />
Es müssen ca. 14 g e<strong>in</strong>gewogen werden.<br />
Diese 14 g <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em 1000ml – Meßkolben mit AcN / H2O (25/75 V/V) auf<br />
1l gelöst. Anschließend wird die Lösung über e<strong>in</strong>en<br />
Regenerierte-Cellulose-Filter entgast.<br />
c) Stammlösung LAS-Standard:<br />
1g Natriumdodecylbenzosulfonat wird e<strong>in</strong>gewogen und 1 ml Formalde-<br />
hydlösung dazugegeben. Anschließend wir mit Re<strong>in</strong>stwasser auf 100ml<br />
aufgefüllt. Die Stammlösung enthält dann 10g LAS /l.<br />
Dabei ist zu beachten, dass ke<strong>in</strong>e Standardsubstanz verloren geht, da<br />
das Natriumdodecylbenzosulfonat sehr stark schäumt.<br />
Deshalb ist zu empfehlen, zuerst etwa 95 ml Re<strong>in</strong>stwasser <strong>in</strong> den Meß-<br />
kolben zu geben und anschließend die Standardsubstanz h<strong>in</strong>zuzufügen.<br />
Zum Lösen wurde auch im Ultraschallbad gearbeitet.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 15 -
d) Kalibrierlösungen:<br />
Es werden 6 Kalibrierstandards zu je 100 ml hergestellt:<br />
Nr. Konz. Volumen der<br />
[mg LAS/l] Stammlösung [ml]<br />
1 10 0,1<br />
2 50 0,5<br />
3 100 1,0<br />
4 150 1,5<br />
5 200 2,0<br />
6 250 2,5<br />
Die Standards werden mit Methanol auf 100 ml aufgefüllt !<br />
6.3.1.2 HPLC E<strong>in</strong>stellungen:<br />
Methode: Gradientenelution (<strong>l<strong>in</strong>earer</strong> Gradient):<br />
Zeit<br />
[m<strong>in</strong>]<br />
Laufmittel A<br />
Acetonitril<br />
[%]<br />
Laufmittel B<br />
0,1 mol/l NaClO4*H2O <strong>in</strong><br />
AcN / H2O (25/75 V/V) [%]<br />
Fluss<br />
[ml/m<strong>in</strong>]<br />
0 15 85 1<br />
1 15 85 1<br />
10 40 60 1<br />
15 40 60 1<br />
20 70 30 1<br />
25 70 30 1<br />
26 15 85 1<br />
30 15 85 1<br />
Wellenlänge Diodenarraydetektor = 225 nm<br />
Injektionsvolumen = 20 µL<br />
Messwert = Peakfläche <strong>in</strong> gerätespezifischen Flächene<strong>in</strong>heiten<br />
Kalibrierung erfolgt über Gruppenpeaks: Start – Zeit: 7,767 m<strong>in</strong><br />
End – Zeit: 15,304 m<strong>in</strong><br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 16 -
Auswertung mit dem Programm „QSA“ (Qualitätssicherung <strong>in</strong> der Analy-<br />
tischen Chemie): Die Peakfläche wird um den Faktor 1000 verr<strong>in</strong>gert<br />
e<strong>in</strong>gegeben, da das Programm nur acht Stellen darstellen kann.<br />
Das QSA – Programm berechnet den Arbeitsbereich und die Nachweis-<br />
grenze der Methode. Weiters wird e<strong>in</strong> L<strong>in</strong>earitätstest durchgeführt. Die<br />
Ergebnisse der Berechnungen werden auch als Diagramme graphisch<br />
dargestellt.<br />
Die QSA Ausdrucke s<strong>in</strong>d im Anhang Teil 2 dargestellt.<br />
Weiters s<strong>in</strong>d sämtliche Parameter, die zur Steuerung der HPLC–Anlage<br />
<strong>in</strong> der Software „Chrom Quest“ e<strong>in</strong>zustellen waren, im Anhang Teil 1 zu<br />
f<strong>in</strong>den.<br />
E<strong>in</strong> mathematisches Rechenbeispiel zur Auswertung ist im Kapitel Qua-<br />
litätssicherung unter Punkt 6.4.2. zu f<strong>in</strong>den.<br />
6.4 Qualitätssicherung:<br />
6.4.1 Def<strong>in</strong>itionen:<br />
a) Statistische Grundbegriffe:<br />
Relative Verfahrensstandardabweichung (Variationskoeffizient) <strong>in</strong> %:<br />
Der Variationskoeffizient ist e<strong>in</strong>e relative Angabe. Er ist e<strong>in</strong> Maß dafür,<br />
wie hoch die durchschnittliche Abweichung der Meßpunkte vom Mittel-<br />
wert <strong>in</strong> % ist.<br />
Mittelwert:<br />
Summe aller E<strong>in</strong>zelwerte dividiert durch die Anzahl der Meßwerte.<br />
(Arithmetisches Mittel)<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 17 -
Zufällige Fehler:<br />
Die zufälligen Fehler s<strong>in</strong>d bed<strong>in</strong>gt durch nicht-systematische E<strong>in</strong>flüsse.<br />
Ihre vollständige Elim<strong>in</strong>ation ist nicht immer möglich. Um e<strong>in</strong>en möglichst<br />
genauen Meßwert zu bekommen, muss man die Messung mehrmals<br />
wiederholen. Die zufälligen Fehler können als absolute und relative<br />
Fehler bestimmt werden.<br />
Reststandardabweichung:<br />
Die Reststandardabweichung ist die Standardabweichung der Residuen<br />
(=die vertikale Abweichung der Messpunkte zur Ausgleichsgerade). Bei<br />
Normalverteilung der Residuen liegen etwa 95% <strong>in</strong>nerhalb der doppelten<br />
Standardabweichung des Regressionswertes.<br />
Standardabweichung:<br />
Sie zeigt an, wie weit die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert<br />
ist. Ist die Abweichung sehr groß, liegen die Meßwerte eher außerhalb.<br />
E<strong>in</strong>e große Standardabweichung besagt, dass die Messwerte um den<br />
Regressionswert weit gestreut s<strong>in</strong>d. Ist die Standardabweichung sehr<br />
ger<strong>in</strong>g, liegen sie sehr nahe am Trend.<br />
Varianz:<br />
Die Varianz ist die Summe der quadrierten Abweichungen der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Werte e<strong>in</strong>es Datenbündels vom Mittelwert, dividiert durch die Anzahl der<br />
Beobachtungen. Die Varianz ist also e<strong>in</strong> Maß dafür, wie weit die e<strong>in</strong>zel-<br />
nen Werte von Mittelwert entfernt liegen. Die Varianz ist ebenfalls e<strong>in</strong><br />
Streuungsmaß.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 18 -
) Begriffe der Analytischen Qualitätssicherung:<br />
Qualität:<br />
Gesamtheit der Merkmale und der Merkmalswerte e<strong>in</strong>es Gegenstandes<br />
bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse<br />
zu erfüllen. (vgl. W. Funk, 1992, S. XV)<br />
Qualitätssicherung:<br />
Gesamtheit der Tätigkeiten des Qualitätsmanagement, der Qualitätspla-<br />
nung, der Qualitätslenkung und der Qualitätsprüfungen.<br />
• Qualitätsmanagement: Derjenige Aspekt der<br />
Gesamtführungsaufgabe, welcher die Qualitätspolitik festlegt und zur<br />
Ausführung br<strong>in</strong>gt.<br />
• Qualitätsplanung: Auswählen, klassifizieren und gewichten der Qua-<br />
litätsmerkmale sowie konkretisieren der Qualitätsforderung unter Be-<br />
rücksichtigung von Anspruchsniveau und Realisierungsmöglichkei-<br />
ten.<br />
• Qualitätslenkung: Überwachung der Werte der Qualitätsmerkmale im<br />
H<strong>in</strong>blick auf die gegebenen Forderungen sowie Korrekturmaßnah-<br />
men.<br />
• Qualitätsprüfung: Feststellen, <strong>in</strong>wieweit der Qualitätsgegenstand die<br />
Qualitätsforderung erfüllt.<br />
(vgl. W.Funk, 1992, S. XV)<br />
<strong>Analyse</strong>nverfahren:<br />
Bezieht sich nur auf die Bestimmung e<strong>in</strong>es def<strong>in</strong>ierten Stoffs und die<br />
Auswertung der Meßwerte. (vgl. W.Funk, 1992, S. XVII)<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 19 -
<strong>Analyse</strong>nmethode:<br />
Komb<strong>in</strong>ation des <strong>Analyse</strong>verfahrens mit speziellen (objektabhängigen)<br />
Vorbereitungstechniken (Probennahme, Probenvorbereitung).<br />
(vgl. W.Funk, 1992, S. XVII)<br />
Systematische Abweichung:<br />
Die systematische Abweichung ist der Unterschied zwischen dem Er-<br />
wartungswert e<strong>in</strong>es Merkmals und dem richtigen bzw. wahrem Wert die-<br />
ses Merkmals.<br />
Konstant systematische Abweichung: Der Betrag des systematischen<br />
Fehlers ist unabhängig vom Betrag des <strong>Analyse</strong>nergebnisses (z.B. im-<br />
mer 21 µ/l zuwenig gemessen).<br />
Proportional systematische Abweichung: Der Betrag des systematischen<br />
Fehlers steigt und fällt mit dem Betrag des <strong>Analyse</strong>nergebnisses (z.B.<br />
immer 10% zuviel gemessen). (vgl. W.Funk, 1992, S. XXI)<br />
Grober Fehler:<br />
E<strong>in</strong> grober Fehler ist e<strong>in</strong>e Abweichung, die nachweislich bei korrektem<br />
Arbeiten leicht zu vermeiden wäre. (vgl. W.Funk, 1992, S. XXI)<br />
Kalibrieren:<br />
Das Kalibrieren e<strong>in</strong>es Systems ist die Ermittlung und Festlegung e<strong>in</strong>es<br />
funktionalen Zusammenhangs zwischen e<strong>in</strong>er zähl- bzw. meßbaren<br />
Größe und e<strong>in</strong>er zu bestimmenden Konzentration (Aktivität, Häufig-<br />
keit,...) aus Daten, die im allgeme<strong>in</strong>en mit zufälligen Abweichungen be-<br />
haftet s<strong>in</strong>d. (vgl. W.Funk, 1992, S. XXII)<br />
Präzision:<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 20 -
Die Präzision ist e<strong>in</strong>e qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der ge-<br />
genseitigen Annäherung vone<strong>in</strong>ander unabhängiger <strong>Analyse</strong>nergebnisse<br />
bei mehrfacher Anwendung e<strong>in</strong>es festgelegten <strong>Analyse</strong>verfahrens unter<br />
vorgegebener Bed<strong>in</strong>gungen.<br />
Die Bed<strong>in</strong>gung, unter denen die <strong>Analyse</strong>ergebnisse gewonnen werden,<br />
s<strong>in</strong>d genau anzugeben.<br />
Man unterscheidet vor allem zwischen der Wiederholpräzision und der<br />
Vergleichspräzision. (vgl. W.Funk, 1992, S. XIX)<br />
Wiederholpräzision:<br />
Wiederholpräzision ist e<strong>in</strong>e qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der<br />
gegenseitigen Annäherung der <strong>Analyse</strong>nergebnisse unter Wiederholbe-<br />
d<strong>in</strong>gungen.<br />
Wiederholbed<strong>in</strong>gungen:<br />
Bei der Gew<strong>in</strong>nung vone<strong>in</strong>ander unabhängiger <strong>Analyse</strong>nergebnisse<br />
geltende Bed<strong>in</strong>gungen, bestehend <strong>in</strong> der wiederholten Anwendung des<br />
festgelegten <strong>Analyse</strong>verfahrens/Methode am identischen Objekt (glei-<br />
ches Material/gleiche Probe) <strong>in</strong> kurzen Zeitabständen (unmittelbar h<strong>in</strong>-<br />
tere<strong>in</strong>ander) mit derselben Geräteausrüstung (sowie mit den selben<br />
Hilfsmaterialien) am selben Ort (im selben Labor). (vgl. W.Funk, 1992, S.<br />
XIX)<br />
Vergleichpräzision:<br />
Die Vergleichspräzision ist e<strong>in</strong>e qualitative Bezeichnung für das Ausmaß<br />
der gegenseitigen Annäherung der <strong>Analyse</strong>nergebnisse unter Ver-<br />
gleichsbed<strong>in</strong>gungen.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 21 -
Vergleichsbed<strong>in</strong>gungen:<br />
Bei der Gew<strong>in</strong>nung vone<strong>in</strong>ander unabhängiger <strong>Analyse</strong>nergebnisse<br />
geltende Bed<strong>in</strong>gungen, bestehend <strong>in</strong> der Anwendung des festgelegten<br />
<strong>Analyse</strong>nverfahrens/Methode am identischen Objekt (gleiches Materi-<br />
al/gleiche Probe) mit verschiedener Geräteausrüstung (und mit ver-<br />
schiedene Hilfsmaterialien) an verschiedenen Orten (<strong>in</strong> verschiedenen<br />
Labors).<br />
(vgl. W.Funk, 1992, S. XX)<br />
Matrix:<br />
Die Matrix e<strong>in</strong>es Materials ist die Gesamtheit aller Bestandteile dieses<br />
Materials und ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften e<strong>in</strong>-<br />
schließlich der gegenseitigen Bee<strong>in</strong>flussungen.<br />
(vgl. W.Funk, 1992, S. XXI)<br />
6.4.2 Händische Auswertung (Rechengang):<br />
Die Auswertung erfolgt im Normalfall über e<strong>in</strong>e Auswertesoftware.<br />
Methodenfaktor = 40; D.h. Bei der Berechnung der Kalibrierkurve<br />
werden die Konzentrationen der Meßwerte mit Faktor 40 multipliziert,<br />
da im Zuge der Probenvorbereitung e<strong>in</strong>e 40-fache Verdünnung erfolgt.<br />
Berechnung der Kalibriergerade:<br />
Grundlegende Geradengleichung:<br />
y = a + b ⋅ x<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 22 -
Steigung:<br />
= i x<br />
1<br />
N<br />
Achsenabschnitt: a = y − b * x wobei: x * ∑<br />
und i x b a y * + =<br />
Daraus ergibt sich die Geradengleichung, womit unbekannte Messwerte<br />
berechnet werden können.<br />
Die weiter angeführten Formeln dienen zur händischen Ermittlung der<br />
Verfahrenskenndaten unter Zugrundelegung e<strong>in</strong>es l<strong>in</strong>earen Zusammen-<br />
hanges:<br />
Reststandardabweichung:<br />
Verfahrensstandardabweichung:<br />
s<br />
y<br />
−<br />
=<br />
− 2<br />
∑( y yˆ<br />
i i )<br />
N<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 23 -<br />
2<br />
sy<br />
sxo<br />
=<br />
b<br />
Wobei: y ˆ i = a + b * xi<br />
Verfahrensvariationskoeffizient = rel. Verfahrensstandardabweichung:<br />
Erklärung der Symbole:<br />
b<br />
∑[<br />
( xi<br />
− x)<br />
* ( y i − y ) ]<br />
∑(<br />
xi<br />
− x)<br />
= 2<br />
s<br />
Vxo<br />
=<br />
x<br />
xo<br />
*100(%)<br />
x Konzentration an LAS <strong>in</strong> mg/kg TS<br />
x Arithmetischer Mittelwert von x<br />
y gerätespezifische Flächene<strong>in</strong>heit<br />
y Arithmetischer Mittelwert von y<br />
a Achsenabschnitt der Kalibrierfunktion<br />
b Steigung der Kalibrierfunktion
xi<br />
yi<br />
sy<br />
Konzentration der i-ten Standardprobe<br />
Messwert der i-ten Standardprobe<br />
Reststandardabweichung<br />
sxo Verfahrensstandardabweichung<br />
Vxo Verfahrensvariationskoeffizient<br />
Berechnung der Wiederf<strong>in</strong>dungsraten:<br />
Dies wird anhand von Aufstockversuchen ermittelt.<br />
E<strong>in</strong>e Probe mit e<strong>in</strong>em Gehalt von 4617 mg/kg LAS wurden mit drei Na-<br />
triumdodecylbenzolsulfonat-Standards (ß=2000, 5000, 4000 mg/kg TS)<br />
aufgestockt.<br />
Probenbezeichnung A1 A2 A3 A4 A5 A6<br />
verdünnt verdünnt<br />
Anmerkung<br />
1+1 1+1<br />
Aufgestockte Menge<br />
[mg/kg TS] 2000 2000 5000 5000 4000 4000<br />
Menge LAS von TS<br />
[mg/kg] 4617 4617 4617 4617 2308 2308<br />
Gesamt [mg/kg] 6617 6617 9617 9617 6308 6308<br />
Gemessen 6252 6405 9803 9768 5902 7105<br />
x Ax und A x+1 6328,5 9785,5 6503,5<br />
x m<strong>in</strong>us LAS von TS 1711,5 5168,5 4195,5<br />
Wiederf<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> % 85,58 % 103,37 % 104,89 %<br />
Daraus ergibt sich e<strong>in</strong>en mittlere Wiederf<strong>in</strong>dung von 98%.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 24 -
6.4.3 Verfahrenskenndaten:<br />
Kalibrierfunktion: y = 4,4107x + 90,10<br />
Steigung b = 4,4107 [area/mg/kg]<br />
Achsenabschnitt a = 90,10 [area-units]<br />
Arbeitsbereich: 1600 bis 10.000 mg/kg<br />
Sy = Reststandardabweichung = 765,814<br />
Sxo = Verfahrensstandardabweichung = 173,625<br />
Vxo = Verfahrensvariationskoeffizient = 3,43 %<br />
6.4.4 Diskussion der QSA Ausdrucke (Graphische Darstellungen):<br />
L<strong>in</strong>earitätstest (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 1)<br />
Beim Anpassungstest nach Mandel wird aus den beiden Reststandar-<br />
dabweichungen des l<strong>in</strong>earen Trends sy1 und des Trends 2. Grades sy2<br />
die Differenz der Varianzen DS 2 berechnet. Aus DS 2 kann der Prüfwert<br />
PW berechnet werden. Dieser wird mit e<strong>in</strong>em Tabellenwert, dem F–Wert<br />
(P=99%) vergleichen.<br />
Da der Prüfwert Wert kle<strong>in</strong>er als der Tabellenwert F ist, wird durch die<br />
Kalibrierfunktion 2. Grades ke<strong>in</strong>e signifikant bessere Anpassung erreicht.<br />
Die L<strong>in</strong>earität kann damit angenommen werden.<br />
Verfahrenskenndaten der l<strong>in</strong>earen Kalibrierfunktion:<br />
(siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 2)<br />
Verfahrensstandardabweichung sxo:<br />
Sie zeigt an, wie hoch die durchschnittliche Abweichung der Messwerte<br />
vom Mittelwert ist.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 25 -
Ist die Abweichung sehr groß, liegen die Messwerte eher außerhalb der<br />
Ausgleichsgerade. Ist die Standardabweichung sehr ger<strong>in</strong>g, liegen sie<br />
sehr nahe an der Ausgleichsgerade. Die Standardabweichung ist e<strong>in</strong>e<br />
absolute Abweichung.<br />
Reststandardabweichung sy:<br />
Die Reststandardabweichung ist die Standardabweichung der Residuen.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Normalverteilung der Messwerte liegen etwa 95% der Residu-<br />
en <strong>in</strong>nerhalb der doppelten Standardabweichung des Regressionswer-<br />
tes.<br />
Bestimmungsgrenze VBrel [%]:<br />
Die Bestimmungsgrenze des analytischen Grundverfahrens ist def<strong>in</strong>iert<br />
als die kle<strong>in</strong>ste Konzentration e<strong>in</strong>er Substanz, die mit e<strong>in</strong>er vorgegebe-<br />
nen <strong>Analyse</strong>npräzision, ausgedrückt als relativer Vertrauensbereich<br />
VBrel, bestimmt werden kann.<br />
Der Wert der Bestimmungsgrenze ist daher abhängig vom größten zufäl-<br />
ligen Fehler, der bei der Angabe von Ergebnissen noch toleriert werden<br />
kann.<br />
(vgl. W.Funk, 1992, S. 27)<br />
Kalibriergerade (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 3)<br />
Kalibrierfunktion: y = 4,41074 * x + 90,10<br />
� b (Steigung) = 4,41074 [area/mg/kg]<br />
� a (Achsenabschnitt) = 90,10 [area-units]<br />
Anzahl Standards: N = 6<br />
Vertrauensbereich: p=95%<br />
Abszisse: Konzentration an LAS <strong>in</strong> mg / kg Trockensubstanz<br />
Ord<strong>in</strong>ate: Gerätespezifische Flächene<strong>in</strong>heit<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 26 -
Die Kalibriergerade stellt die Basis für die weitergehende statistische<br />
Auswertung der Proben dar. Es werden Standards mit unterschiedlichen<br />
Konzentrationen an Natriumdodecylbenzolsulfonat, dem repräsentativen<br />
LAS, gemessen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Koord<strong>in</strong>atensystem, Konzentration gegen<br />
Messwert, aufgetragen. In den 95% Vertrauensbereich Banden bef<strong>in</strong>den<br />
sich 95% aller Meßwerte.<br />
E<strong>in</strong>e Ausgleichsgerade wird durch die Meßpunkte gezogen, durch die<br />
die Konzentration an LAS <strong>in</strong> den Proben bestimmt werden kann. Die<br />
Steigung k der Ausgleichsgerade stellt die Empf<strong>in</strong>dlichkeit der Methode<br />
dar, da je steiler die Ausgleichsgerade ist, desto empf<strong>in</strong>dlicher ist die<br />
Methode, da pro Meßwertänderung die Änderung der Konzentration hö-<br />
her ist als bei e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen Steigung.<br />
Residuen (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 4)<br />
Abszisse: Konzentration an LAS <strong>in</strong> mg / kg Trockensubstanz<br />
Ord<strong>in</strong>ate: Gerätespezifische Flächene<strong>in</strong>heit<br />
Die Residuen stellen die vertikale Abweichungen der Meßwerte (Stan-<br />
dards) von der Ausgleichsgerade dar. Diese Darstellung ist e<strong>in</strong>e Hilfe zur<br />
Identifizierung der Art der Ausgleichsgerade (l<strong>in</strong>ear, 2. Grades). Da die<br />
Anzahl der Residuen e<strong>in</strong>e große Rolle spielt, ist z.B. die Identifizierung<br />
der Ausgleichsgerade 2. Grades mit der ger<strong>in</strong>gen Anzahl von 6 Stan-<br />
dards recht unsicher, da die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit zur richtigen Erkennung<br />
der Art der Ausgleichsgerade mit fallender Anzahl der Meßpunkte eben-<br />
falls s<strong>in</strong>kt.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 27 -
Absolute Unpräzision (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 5)<br />
Aus dem Diagramm Vertrauensbereich [mg/kg] gegen Konzentration<br />
kann abgelesen werden, <strong>in</strong> welchem Bereich die Abweichung des Ist-<br />
wertes vom wahren Wert liegt. Die niedrigste Abweichung vom wahren<br />
Wert ist <strong>in</strong> der Mitte des Arbeitsbereiches (bei etwa 5000 mg LAS/kg TS)<br />
gegeben, während die höchste Abweichung an den beiden Arbeitsbe-<br />
reichsgrenzen liegt. (z.B.: absolute Abweichung von 500 mg/kg TS bei<br />
Meßwert von 5000 mg/kg TS; absolute Abweichung von 700 mg/kg TS<br />
bei e<strong>in</strong>em Meßwert von 10.000 mg/kg TS.)<br />
Relative Unpräzision (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 6)<br />
Die relative Unpräzision gibt die Abweichung des Istwertes vom wahren<br />
Wert <strong>in</strong> % des Vertrauensbereiches (95%) an. Der Fehler ist im niederen<br />
Konzentrationsbereich bedeutend höher, als im hohen Konzentrations-<br />
bereich, da z.B. e<strong>in</strong>e Abweichung des Istwertes vom wahren Wert von<br />
500 bei e<strong>in</strong>er Konzentration von 2000 mg/kg bedeutend höher ist, als<br />
dieselbe Abweichung bei e<strong>in</strong>er Konzentration von 8000 mg/kg.<br />
Nachweisgrenze (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 7)<br />
Die Nachweisgrenze XN kennzeichnet den Messwert, unterhalb dessen<br />
die Nachweismethode ke<strong>in</strong>en zuverlässigen Messwert liefern.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 28 -
6.5 Kurzbeschreibung der Methode (Flußschema):<br />
Probennahme und Konservierung<br />
Probenvorbereitung<br />
1. Gefriertrocknen<br />
2. Zerkle<strong>in</strong>ern<br />
3. Mahlen<br />
Extraktion der Proben<br />
Chromatographie der Probenextrakte<br />
Auswertung der Messungen, Ergebnisse<br />
Herstellung der Stammlösung (10g<br />
LAS/l) und Kalibrierlösungen<br />
Kalibrierung<br />
Berechnung der Verfahrensparameter<br />
(Validierung)<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 29 -
7. Ergebnisse:<br />
7.1 Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse:<br />
Nr. Proben ID Area Konzentration Mittelwerte<br />
[area-units] [mg/kg] [mg/kg TS]<br />
1 Bl<strong>in</strong>dwert 1235 260<br />
2 Bl<strong>in</strong>dwert 840 170 215<br />
3 Aufst. 1 28236 6381<br />
4 Aufst. 2 28928 6538 6460<br />
5 Aufst. 3 44274 10017<br />
6 Aufst. 4 44117 9982 10000<br />
7 Aufst. 5 27674 6254<br />
8 Aufst. 6 33310 7532 6893<br />
9 ARA Dornbirn2 21155 4776<br />
10 ARA Dornbirn2 20548 4638 4707<br />
11 ARA Hofsteig2 16117 3634<br />
12 ARA Hofsteig2 17654 3982 3808<br />
13 ARA Hohenems 18873 4258<br />
14 ARA Hohenems 16564 3735 3970<br />
15 ARA Feldkirch 20589 4648<br />
16 ARA Feldkirch 18812 4245 4447<br />
17 ARA Bregenz 46670 10561<br />
18 ARA Bregenz 41517 9392 9977<br />
19 ARA Dornbirn1 25117 5674<br />
20 ARA Dornbirn1 23858 5389 5532<br />
21 ARA Hofsteig1 24652 5569<br />
22 ARA Hofsteig1 24437 5520 5546<br />
23 ARA Montafon 33661 7611<br />
24 ARA Montafon 30649 6928 7270<br />
25 ARA Bezau 18437 4160<br />
26 ARA Bezau 18775 4236 4198<br />
27 ARA Leiblachtal 2539 555<br />
28 ARA Leiblachtal 3293 726 641<br />
29 ARA Rotachtal 23081 5212<br />
30 ARA Rotachtal 24658 5570 5391<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 30 -
7.2 Bewertung und Interpretation der Ergebnisse:<br />
Im Rahmen der von uns untersuchten Kläranlagen beträgt der ermittelte<br />
Durchschnittswert der Konzentrationen an LAS 5000 mg/kg TS. In der<br />
benachbarten Ostschweiz lagen die mittlere Konzentration an LAS bei<br />
4000mg/kg TS (Quelle: Projekt Nr. 4.645.0.83.07 des Nationalen For-<br />
schungsprogramms Nr. 7D; 1983). Der Bereich an LAS-Konzentrationen<br />
lag zwischen 500 und 11.900 mg/kg TS, welcher <strong>in</strong> etwa mit dem Kon-<br />
zentrationsbereich <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> zu vergleichen ist (500-11000mg/kg<br />
TS). Weiters ergab die <strong>Analyse</strong> von Schlämmen aus den USA, der BRD<br />
und aus F<strong>in</strong>nland sowie auch Messungen anderer Autoren ebenfalls<br />
Konzentrationen <strong>in</strong> der Grössenordnung von e<strong>in</strong>igen g LAS pro kg TS.<br />
In der deutschen „Umweltpraxis“ Ausgabe 3/2001 wird die Novellierung<br />
der EG-<strong>Klärschlamm</strong>richtl<strong>in</strong>ie 86/278/ EWG diskutiert. Dar<strong>in</strong> wird von<br />
der EU Kommission Abteilung Umwelt e<strong>in</strong> Grenzwert von 2600mg/kg TS<br />
vorgeschlagen.<br />
7.3 Verfassung der SOP:<br />
Teil der Aufgabe dieses Projektes war auch die Verfassung e<strong>in</strong>er SOP<br />
(=Standard Arbeitsanweisung). SOP‘s im H<strong>in</strong>blick auf die analytische<br />
Qualitätssicherung werden von <strong>in</strong>ternationalen Normen (ISO 17025) so-<br />
wie von nationalen Gesetzen gefordert, um gleichbleibende Qualität und<br />
<strong>in</strong>ternationale Vergleichbarkeit der <strong>Analyse</strong>nergebnisse zu gewährlei-<br />
sten. Die Struktur sowie das Layout der SOP s<strong>in</strong>d vom Umwelt<strong>in</strong>stitut<br />
vorgegeben, wofür ebenfalls e<strong>in</strong>e SOP besteht. Die erarbeitete SOP<br />
kann im Anhang e<strong>in</strong>gesehen werden.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 31 -
8. Literaturverzeichnis:<br />
- BEYER Walter: Lehrbuch der organischen Chemie, 23. Auflage;<br />
S. Hirzel Verlag Stuttgart<br />
- BERGS G. Claus, KREBSBACH Alfons: Umweltpraxis;<br />
Ausgabe 3/2001;<br />
- BLIEFERT Claus: Umweltchemie; 2. Auflage; VCH-<br />
Verlagsgesellschaft<br />
- CRESSER M.S., MARR I.L., OTTENDORFER L.J.: Umweltanalytik;<br />
Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York<br />
- DAMMANN V., DONNEVERT G., FUNK W.: Qualitätssicherung <strong>in</strong> der<br />
Analytischen Chemie; ISBN 3-527-28291-2<br />
- GIGER Walter, BRUNNER H. Paul, AHEL Marijan, MCEVOY James,<br />
MARCOMINI Antonio, SCHAFFNER Christian: Gas, Wasser, Abwas-<br />
ser 67. Jahrgang 1987 Nr. 3;<br />
- Handbuch Chrom Quest<br />
- HOBINGER Peter, SCHARF Sigrid, SEIF Peter: LAS <strong>in</strong> der Umwelt;<br />
UBA Wien;<br />
- MEYER R. Veronika: Praxis für HPLC, 7. Auflage; Salle + Sauerlän-<br />
der Verlag 1992; ISBN 3-7941-2792-7 (Sauerländer)<br />
- PRIMER A.: HPLC for enviromental analysis; ISBN 12-5091-9750E<br />
- RUMP Hermann Hans: Laborhandbuch für die Untersuchung von<br />
Wasser, Abwasser und Boden, 3. Auflage; Wiley- VCH- Verlag<br />
ISBN 3-527-28888-0<br />
- SCHARF Sigrid, SCHNEIDER Manfred, ZETHNER Gerhard: Zur Si-<br />
tuation der Verwertung und Entsorgung des kommunalen Klär-<br />
schlammes <strong>in</strong> Österreich; UBA Wien;<br />
- UBA <strong>Analyse</strong>nvorschrift und UBA <strong>Analyse</strong>nbericht; Umweltbundes-<br />
amt Wien<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 32 -
- DIN Normen:<br />
- Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze; DIN 32 645<br />
- Allgeme<strong>in</strong>e Angaben; DIN 38 402, Teil 51<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 33 -
9. Schlußwort:<br />
Die Erstellung dieser Methode war e<strong>in</strong>e sehr <strong>in</strong>teressante und berei-<br />
chernde Aufgabe für uns alle. Es wurde uns während dieser sechs Mo-<br />
nate e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> den Berufsalltag des Umwelt<strong>in</strong>stitutes gewährt, wel-<br />
cher <strong>in</strong> unserer Zukunft sicher von großem Vorteil se<strong>in</strong> wird.<br />
Wir möchten uns deshalb an dieser Stelle nochmals bei unseren Betreu-<br />
ern für die große Unterstützung bedanken und hoffen dem Leser dieses<br />
Berichtes e<strong>in</strong>en ausreichenden Überblick gegeben zu haben.<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 34 -
10. Anhang:<br />
Teil 1: Allgeme<strong>in</strong>e Methoden Parameter<br />
Teil 2: QSA Ausdrucke (Statistik, Kalibrierung)<br />
Teil 3: Beispielchromatogramme<br />
Teil 4: Graphische Darstellung der Messwerte<br />
Teil 5: SOP (Standardarbeitsanweisung)<br />
LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 35 -