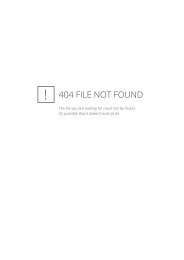Rainer Balloff Kindeswille, Grundbedürfnisse des ... - Userpage
Rainer Balloff Kindeswille, Grundbedürfnisse des ... - Userpage
Rainer Balloff Kindeswille, Grundbedürfnisse des ... - Userpage
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Rainer</strong> <strong>Balloff</strong><br />
<strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>, <strong>Grundbedürfnisse</strong> <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> und Kin<strong>des</strong>wohl in<br />
Umgangsrechtsfragen<br />
Familie, Partnerschaft, Recht, 8, 240-245. (Diese Zeitschrift<br />
befindet sich in der FU-Silberlauben-Bibliothek)<br />
Einleitung<br />
Die Bedeutung <strong>des</strong> kindlichen Willens wird angesichts der<br />
lebhaften Debatte um das Eltern-Entfremdungs-Syndrom<br />
(Parental-Alienation-Syndrome - PAS) 1 – vor allem mit dem<br />
Argument in Frage gestellt -, dass ein Kind angesichts seiner<br />
1 Fegert, J. M. (2001). Parental Alienation oder Parental Accusation<br />
Syndrome? (Teil 1). Die Frage der Suggestibilität, Beeinflussung und<br />
Induktion in Umgangsrechtsgutachten. Kindschaftsrechtliche Praxis, 4, 3-7.<br />
Fegert, J. M. (2001). Parental Alienation oder Parental Accusation<br />
Syndrome? (Teil 2). Die Frage der Suggestibilität, Beeinflussung und<br />
Induktion in Umgangsrechtsgutachten. Kindschaftsrechtliche Praxis, 4, 39-<br />
42.<br />
Fischer, W. (1998). Das Parental Alienation Syndrome (PAS) und die<br />
Interessenvertretung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>. Ein Interventionsmodell für Jugendhilfe<br />
und Gericht - Teil 1. Nachrichtendienst für öffentliche und private<br />
Fürsorge, 79, (Heft 10), 306-310.<br />
Fischer, W. (1998). Das Parental Alienation Syndrome (PAS) und die<br />
Interessenvertretung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>. Ein Interventionsmodell für Jugendhilfe<br />
und Gericht - Teil 2. Nachrichtendienst für öffentliche und private<br />
Fürsorge, 79 (Heft 11), 343-348.<br />
Gerth, U. (1998). Das Leben ist komplizierter. Kindschaftsrechtliche<br />
Praxis, 1, 171-172.<br />
Jopt, U. & Behrend, K. (2000). Das Parental Alienation Syndrome (PAS) – Ein<br />
Zwei-Phasen-Modell (Teil 1). Zentralblatt für Jugendrecht, 87, 223-231.<br />
Jopt, U. & Behrend, K. (2000). Das Parental Alienation Syndrome (PAS) – Ein<br />
Zwei-Phasen-Modell (Teil 2). Zentralblatt für Jugendrecht, 87, 258-271.<br />
Kodjoe, U. (1998). Ein Fall von PAS. Kindschaftsrechtliche Praxis, 1, 172-<br />
174.<br />
Kodjoe, U. & Koeppel, P. (1998). The Parental Alienation Syndrome (PAS).<br />
Der Amtsvormund, 72, 9-28.<br />
Kodjoe, U. & Koeppel, P. (1998). Früherkennung von PAS - Möglichkeiten<br />
psychologischer und rechtlicher Interventionen. Kindschaftsrechtliche<br />
Praxis, 1, 138-144.<br />
Lehmkuhl, U. & Lehmkuhl, G. (1999). Wie ernst nehmen wir den <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n?<br />
Kindschaftsrechtliche Praxis, 2, 159-161.<br />
Leitner, W. G. & Schoeler, R. (1998). Maßnahmen und Empfehlungen für das<br />
Umgangsverfahren im Blickfeld einer Differentialdiagnose bei Parental<br />
Alienation Syndrome (PAS) unterschiedlicher Ausprägung in Anlehnung an<br />
Gardner (1992/1997). Der Amtsvormund, 71, 849-867.<br />
Rexilius, G. (1999). Kin<strong>des</strong>wohl und PAS. Zur aktuellen Diskussion <strong>des</strong><br />
Parental Alienation Syndrome. Kindschaftsrechtliche Praxis, 2, 149-159.<br />
Salzgeber, J. & Stadler, M. (1998). Beziehung contra Erziehung - kritische<br />
Anmerkungen zur aktuellen Rezeption von PAS. Ein Plädoyer für Komplexität.<br />
Kindschaftsrechtliche Praxis, 1, 167-171.
mangelnden Reife nicht in der Lage ist, über derart bedeutsame<br />
Angelegenheiten wie Beziehungspflege oder Kontaktabbruch mit<br />
einer engen Bezugsperson Entscheidungen zu treffen. Hierzu<br />
bleibt zunächst folgen<strong>des</strong> festzuhalten:<br />
1. In der Rechtspsychologie, Rechtswissenschaft und<br />
Rechtsprechung herrscht Übereinstimmung, dass selbst das<br />
ältere Kind über 14 Jahren beispielsweise über die<br />
Aufnahme, Durchführung oder den Abbruch von<br />
Umgangskontakten nicht allein entscheiden darf.<br />
2. Der <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong> wird gerade angesichts problematischer<br />
Familienrechtsfälle im Kontext mit dem Kin<strong>des</strong>wohl<br />
betrachtet.<br />
3. Umstritten ist:<br />
- In welchen familienrechtlichen Zusammenhängen hat der<br />
kindliche Wille welche relevante Bedeutung?<br />
- Ist der Wille <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> ein Akt der Selbstbestimmung und<br />
in welchem Kontext zum Kin<strong>des</strong>wohl und Elternrecht nach<br />
Art. 6 GG steht er?<br />
- Ab welchem Alter ist der <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong> beachtlich?<br />
- Handelt es sich bei einem beeinflussten, manipulierten,<br />
suggerierten und schlimmstenfalls induzierten Willen<br />
überhaupt um einen <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n?<br />
- Wie lässt sich ein <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong> feststellen?<br />
4. Nach der Rezeption <strong>des</strong> PAS-Modells vor etwa drei Jahren<br />
in Deutschland wird nunmehr offenbar bezweifelt, dass es<br />
einen kindlichen Willen gibt und ob man diesen zur<br />
Kenntnis nehmen und beachten sollte (vgl. Klenner, 2002,<br />
zitiert bei Koeppel: www.koeppel-<br />
kindschaftsrecht.de/anmerk-klenner.htm).<br />
Definition <strong>des</strong> <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n<br />
Der Wille <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> kann mit Dettenborn (2001, S., 63) als<br />
die altersgemäß stabile und autonome Ausrichtung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>
auf erstrebte, persönlich bedeutsame Zielzustände verstanden<br />
werden. Insofern handelt es sich bei der kindlichen<br />
Willensbildung um einen meist langanhaltenden, oft sogar<br />
dauerhaften Prozess, der vielfältigen Änderungen unterworfen<br />
sein kann. Das Erreichen bedeutsamer Zielzustände beinhaltet<br />
nicht unbedingt das Erreichen nur eines einzigen Zieles (z.B.<br />
den Vater wieder besuchen und die Billigung der Mutter<br />
erfahren). (Vgl. auch Zitelmann, 2001, S. 228, mit weiteren<br />
Nachweisen).<br />
Die Heranbildung <strong>des</strong> kindlichen Willens<br />
Entscheidend ist bei der Kenntnisnahme und Überprüfung <strong>des</strong><br />
<strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>ns zunächst zu fragen nach dem Woher (die Quelle<br />
können z.B. Bedürfnisse, Motivationen, Triebe sein) und nach<br />
dem Wohin (z.B. die Zielorientierung).<br />
Dabei führt die Annahme eines Woher (welche Quellen sind<br />
identifizierbar? Bedürfnis, Trieb, Wunsch?) <strong>des</strong> kindlichen<br />
Willens zu der Erkenntnis, dass dieser sich, soweit<br />
identifizierbar, zunächst in der sog. präintentionalen Phase<br />
befindet, während das Wohin (welches Ziel soll erreicht<br />
werden?) bedeutet, dass sich der kindliche Wille nunmehr in<br />
der sog. intentionalen und damit zielgerichteten Phase bewegt.<br />
Präintentionale Bedürfnisse, Motivationen und Wünsche, aber<br />
auch Neid, Instinkt oder Anreiz sowie intentionale Ziel-Zweck-<br />
Ausprägungen spielen somit beim Entstehen der bewussten und<br />
absichtlichen Ausrichtung <strong>des</strong> kindlichen Willens eine<br />
entwicklungspsychologisch und familienrechtspsychologisch<br />
bedeutsame Rolle, wobei<br />
- das Alter,<br />
- die Persönlichkeitsentwicklung sowie<br />
- der Entwicklungsstand <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong><br />
für das Heranbilden und die Ausprägung eines kindlichen<br />
Willens entscheidend sind.
Der international bekannte Entwicklungspsychologe Piaget<br />
(1962) beobachtete und betonte bereits 1962 die Fähigkeit erst<br />
15 Monate alter Kinder, so zu tun als ob (z.B. sich schlafend<br />
stellen, um die Mutter zu täuschen), als Fähigkeit <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>,<br />
den mentalen Zustand einer anderen Person zu verstehen, um<br />
diesen gegebenenfalls zu beeinflussen oder sogar zu täuschen.<br />
Des weiteren wohnt dieser frühen Fähigkeit <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> inne,<br />
zwischen Vorstellung und Phantasie einerseits sowie Realität<br />
andererseits und zwischen Gedanken und Dingen zu<br />
unterscheiden.<br />
Dabei beinhaltet die Einstellung als spezifischer Typus<br />
einer mentalen Ausrichtung (z.B. Überzeugung, Bedürfnis und<br />
Absicht) und die inhaltliche Ausgestaltung der kindlichen<br />
Aussage (ich sitze auf einem Dreirad = Überzeugung; ich möchte<br />
ein Fahrrad mit Stützrädern haben = Bedürfnis; ich will ins<br />
Kaufhaus gehen, um ein Fahrrad zu bekommen = Absicht) nicht<br />
nur eine zweckrationale Einheit, sondern ebenso die Fähigkeit<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>, spätestens im Alter von drei bis vier Jahren,<br />
einen eindeutigen und klaren Willen zu formulieren, um ein<br />
bestimmtes Ziel zu erreichen oder zu vermeiden.<br />
Dabei führen permanente Ereignisse aus der Umwelt<br />
- zur differenzierteren Wahrnehmung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>,<br />
- zur Heranbildung von Überzeugungen und Bedürfnissen,<br />
die ebenso durch Emotionen oder Triebe verursacht und gespeist<br />
werden, die dann in<br />
- einen eigenen Willen und Handlungen einmünden und<br />
- zu einem zielorientierten Ergebnis führen können<br />
(vgl. Astington, 2000, S. 90, die dieses Strukturmodell für<br />
die Theorie <strong>des</strong> Denkens nutzbar machte).<br />
Insbesondere im Alter <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> von drei bis vier Jahren<br />
zeigen sich Kompetenzentwicklungen, die auch zunehmend<br />
differenzierte Willensbildungen ermöglichen (vgl. Dettenborn,<br />
2001, S. 70f., mit weiteren eindrucksvollen Belegen aus der<br />
Entwicklungspsychologie).
Hierzu gehören im Alter von drei bis vier Jahren u.a.<br />
- der Erwerb der Überzeugung,<br />
- die Fähigkeit zwischen Realität und Überzeugung zu<br />
unterscheiden,<br />
- die Fähigkeit zur Täuschung anderer,<br />
- die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub,<br />
- Selbstkontrolle und Verzicht,<br />
- erste Vorstellungen über Zeitspannen,<br />
- die Fähigkeit Gegensätze zu benennen und<br />
- mentale Wollens- und Könnens-Ausdrücke zu benutzen<br />
(Dettenborn, a. a. 0.)<br />
Entwicklungspsychologisch unauffällige Kinder haben somit<br />
bereits im Alter von drei bis Jahren alle notwendigen sozialen<br />
und psychischen Kompetenzen erworben, um einen eigenen<br />
(autonomen) und festen (stabilen) Willen zu haben und bei<br />
hinreichender Sprachentwicklung auch formulieren zu können.<br />
Vom Kind selbst erworbene und definierte Vorstellungen,<br />
Meinungen, Wünsche, Einstellungen, Haltungen, Sichtweisen,<br />
Prioritäten, Favorisierungen etc. sind also<br />
entwicklungspsychologisch sehr frühzeitig möglich und stellen<br />
wesentliche Aspekte der Persönlichkeits- und<br />
Identitätsentwicklung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> dar.<br />
Sie beinhalten somit ureigene – subjektive - Interessen <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong> und sollten im Rahmen einer kindorientierten Haltung<br />
nicht als eine Äußerung umgedeutet werden, die nur dann<br />
beachtlich ist, wenn sie im wohl verstandenes Interesse<br />
gemacht wurde oder wenn es sich um einen sog. vernünftigen<br />
Willen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> im Sinne <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>wohls handelt.<br />
Der Wille <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> sollte ferner in Fällen schwerer<br />
familiärer Konflikte nicht sogleich mit einem moralisch zwar<br />
akzeptablen und familienpsychologisch sowie rechtlich<br />
erwünschten und anstrebenswerten „höherwertigen Ziel“<br />
verknüpft werden (z.B. Umgangskontakte <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> mit einem<br />
Elternteil), da bei einer derartigen Verbindung der Wille <strong>des</strong>
Kin<strong>des</strong> – beispielsweise im Kontext von Kin<strong>des</strong>wohlkriterien -<br />
zwangsläufig an Bedeutung verlieren muss.<br />
Im übrigen lässt sich der hier vertretene<br />
<strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>nsbegriff – die (zwangsweise) Umsetzung <strong>des</strong><br />
<strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>ns kann dem Kin<strong>des</strong>wohl erheblich schaden im<br />
Gegensatz zu der Annahme, dass es kein Kin<strong>des</strong>wohl gegen den<br />
<strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n gibt -, am ehesten im § 50b FGG identifizieren.<br />
Dort heißt es: „wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> für die Entscheidung von Bedeutung sind“. Weniger<br />
eindeutig ist die Formulierung im neuen § 50 FGG, wenn im Abs.<br />
1 von „Interessen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>“ die Rede ist, also von einem<br />
subjektiven und objektiven Bestimmungselement, nämlich Wille<br />
und Wohl <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>.<br />
Unabhängig von der weiteren Vorstellung, den Willen <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong> in einen rationalen oder emotionalen Akt zu<br />
unterteilen, der dann entweder als Akt der Selbstbestimmung<br />
oder als Teilaspekt <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>wohls angesehen wird (vgl. die<br />
umfassende Darstellung hierzu bei Zitelmann, 2001, S. 206 ff.)<br />
oder ihn als grundsätzlich unbeachtlich anzusehen, weil er<br />
u.U. beeinflusst, manipuliert oder schlimmstenfalls induziert<br />
wurde, bleibt zu klären, ob nach dem Kenntnisstand kindlicher<br />
Entwicklungsprozesse dem Subjektstatus <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> Rechnung<br />
getragen werden soll oder ob die Meinungsäußerung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>,<br />
die sich zum <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n verdichtet hat, lediglich als wenig<br />
bedeutsame Meinung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> zu begreifen und zu verstehen<br />
ist.<br />
Dabei wird gerade im Verstehen und Begreifen der kindlichen<br />
Vorstellungen, Meinungen, Haltungen, Wünsche und <strong>des</strong> Willens<br />
das in der Psychologie herausragende hermeneutische Prinzip<br />
der Sinnvermittlung und Auslegung betont, das der<br />
Rekonstruktion von Präintentionalität (im Sinne der Frage nach<br />
dem Woher?) und Intentionalität (im Sinne der Frage nach dem<br />
Wohin?) kindlicher Willensbildungsprozesse dient.<br />
Darüber hinaus begreifen die psychologischen Theorien <strong>des</strong><br />
Subjekts – z.B. die Kritische Psychologie von Klaus Holzkamp -
den Menschen, also auch Kinder als grundsätzlich fähig, sich<br />
Handlungsräume, Freiheitsgrade und Rahmenbedingungen aktivkognitiv<br />
strukturierend anzueignen und zu gestalten und sich<br />
dementsprechend eine eigene Vorstellung und Meinung von seiner<br />
Umwelt zu machen.<br />
Eine andere Auffassung vertritt Klenner (2002), der<br />
offenbar ein Kind nicht als erkenntnis- und handlungsfähiges<br />
Subjekt begreift und damit den Willen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> nur dann für<br />
relevant erachtet, wenn es „seinen unabhängigen und freien<br />
Willen erklären kann“.<br />
Hier ist jedoch zu fragen, welcher Mensch überhaupt in der<br />
Lage ist, einen unabhängigen und freien Willen zu äußern.<br />
Dennoch kritisiert Klenner (2002) jede andere<br />
kindorientiertere Meinung als eine „aus ideologischer<br />
Sichtweise resultierenden Idee der Selbstbestimmung <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong>“, die dazu führe, dass sich „die für das Kind<br />
verantwortlichen Erwachsenen der Verantwortung“ entzögen.<br />
<strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>, <strong>Grundbedürfnisse</strong> <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> und Kin<strong>des</strong>wohl<br />
Wie oben bereits angeführt wird allein der kindliche Wille<br />
weder bei Sorgerechts- noch bei Umgangsrechtsentscheidungen<br />
ausschlaggebend sein, da allgemein bekannt ist, dass nicht nur<br />
Erwachsene, sondern auch Kinder u.U. Ziele anstreben, die bei<br />
objektiver Betrachtung riskant oder gefährlich sind oder unter<br />
dem Einfluss eines Dritten zum selbstdefinierten Ziel <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong> oder Jugendlichen wurden.<br />
Wenn also der <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong> regelmäßig in den Kontext sog.<br />
psychosozialen <strong>Grundbedürfnisse</strong>n <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> (basic needs of<br />
children) und <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>wohls gestellt wird, sollte dennoch<br />
Maxime professionellen Handelns mit Kindern – auch im<br />
hochstrittigen Umgangsrechtsverfahren - sein, den <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n<br />
soweit wie möglich herauszuarbeiten und gegebenenfalls auch zu
espektieren, zu akzeptieren und nur soviel jugendamtliche,<br />
gutachtliche oder richterliche Eingriffe in den Subjektstatus<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> und <strong>des</strong>sen Willensbildungsprozess vorzunehmen, wie<br />
es zur Sicherstellung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>wohls nötig ist, also<br />
beispielsweise beim selbstgefährdenden <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n oder beim<br />
induzierten <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>n, der schwersten Form der<br />
Beeinflussung, Manipulation und Suggestion.<br />
Die gerichtliche Festlegung eines Umgangs, einer<br />
Umgangsbegleitung oder von Zwangsmaßen gegen den<br />
boykottierenden Elternteil bewirken häufig sehr wenig. Die<br />
Erfolge sind dürftig, die Abbruch- und Verweigerungsquote ist<br />
hoch.<br />
Bekannt ist schon längst, dass erzwungene Kontakte, also<br />
gegen den Willen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> gerichtete Besuchskontakte, meist<br />
die Beziehungen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> mit dem den Umgang begehrenden<br />
Elternteil nicht verbessern oder stabilisieren (vgl. etwa die<br />
Langzeitstudie von Wallerstein & Lewis, 2001, S. 68ff.).<br />
Sinnvoller ist aus interventionspsychologischer Sicht die<br />
Inanspruchnahme einer Mediation, Beratung oder Psychotherapie<br />
der Erwachsenen, die auch durch gerichtliche Auflagen forciert<br />
werden sollte.<br />
Einfacher als sogleich den Kin<strong>des</strong>wohlbegriff zu bemühen,<br />
der im übrigen bei Umgangsrechtsstreitigkeiten in der<br />
bekannten Unterteilung in erwachsenen- und kindzentrierte<br />
Kriterien (z.B. Erziehungsfähigkeit, Förderung, Kontinuität,<br />
Stabilität, Bindungstoleranz, Wunsch nach Einvernehmlichkeit<br />
der Eltern sowie die Beziehungen und Bindungen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> an<br />
die Eltern, Geschwister und sonstige im § 1685 BGB genannten<br />
Personen, Wunsch und Wille <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>) nicht zutreffend ist,<br />
sollten bei strittigen Umgangsfragen zunächst die<br />
psychosozialen <strong>Grundbedürfnisse</strong> <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>, die sog. basic<br />
needs of children beachtet und gegebenenfalls überprüft<br />
werden.<br />
Hinzu kommt, das angesichts der im Normalfall mittlerweile<br />
vielfältigen und oft mehrfach in der Woche oder im Monat
erfolgenden wechselnden Umgangskontakte <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> mit beiden<br />
Eltern (vgl. etwa die Ausführungen zur Ausgestaltung <strong>des</strong><br />
Umgangs bei Fthenakis, 1995) die sehr eingeschränkte<br />
juristische Vorstellung nunmehr aufgegeben werden sollte, nach<br />
der ein Umgang <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> dazu dient,<br />
- die verwandtschaftlichen Beziehungen zu pflegen und<br />
- dem Elternteil, in <strong>des</strong>sen Obhut sich das Kind nicht<br />
befindet, die Möglichkeit zu geben, sich persönlich in<br />
regelmäßigen Abständen von der Entwicklung und dem Wohlergehen<br />
seines Kin<strong>des</strong> zu überzeugen.<br />
Ein zeitgemäßer und weitaus umfangreicherer Umgang zur<br />
Aufrechterhaltung und Pflege der Beziehungen und Bindungen <strong>des</strong><br />
Kin<strong>des</strong> mit dem betreffenden Elternteil an den Wochenenden,<br />
zuzüglich an einigen Tagen unter der Woche und im Rahmen von<br />
Feiertags- und Ferienregelungen beinhaltet faktisch so gut wie<br />
immer eine Betreuung, Versorgung und Erziehung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>.<br />
Selbst die aktuelle Rechtsprechung (vgl. hierzu auch<br />
Oelkers, in diesem Heft) beruht offenbar auf überholten<br />
Vorstellungen, wenn die Wurzeln derartiger Vorstellungen in<br />
den heute kaum noch verständlichen restriktiven Annahmen bei<br />
Dürr (1979) u.a. zu finden sind. Z.B. sollten nach Dürr (1979,<br />
S. 25) dem Kind im<br />
- Alter von bis zu zwei Jahren einmal im Monat ein bis zwei<br />
Stunden Umgang eingeräumt werden,<br />
- einem Kind im Alter von zwei bis sechs Jahren einmal<br />
monatlich vier bis sechs Stunden,<br />
- im Alter von sechs bis zehn Jahren einmal monatlich sechs<br />
bis acht Stunden und ab<br />
- zehn Jahren einmal monatlich acht bis zehn Stunden.<br />
Die Beachtung und Überprüfung der bereits erwähnten<br />
psychosozialen <strong>Grundbedürfnisse</strong> <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> (basic needs)<br />
angesichts der seit Jahren erheblich erweiterten<br />
Umgangskontakte beinhaltet folgen<strong>des</strong> Vorgehen:<br />
Ist beispielsweise der den Umgang begehrende Elternteil in<br />
der Lage, folgende Bedürfnisse <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>
- wahrzunehmen,<br />
- richtig zu interpretieren,<br />
- prompt und<br />
- angemessen darauf zu reagieren?<br />
1. Bedürfnis <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> nach Ernährung, Versorgung und<br />
Gesundheit<br />
2. Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit,<br />
Sicherheit, Schutz vor Gefahren materieller und sexueller<br />
Übergriffe und Ausbeutung<br />
3. Bedürfnis nach beständigen Beziehungen, sicheren<br />
Bindungen, stabilen und unterstützenden Gemeinschaften<br />
sowie nach einer sicheren Zukunft<br />
4. Bedürfnis nach Liebe, Akzeptanz, Geborgenheit,<br />
Zuwendung, Unterstützung<br />
5. Bedürfnis nach Wissen, Bildung und Vermittlung neuer<br />
und hinreichender Erfahrungen.<br />
6. Bedürfnis nach Lob,(adäquater) Anerkennung,<br />
Verantwortung und Selbständigkeit.<br />
7. Bedürfnis nach Übersicht, Zusammenhang,<br />
Orientierung, Regeln, Strukturen und Grenzen.<br />
(vgl. hierzu auch: Brazelton & Greenspan, 2002; Fegert,<br />
1999, S. 326f.)<br />
Ist der betreffende Elternteil bzw. die den Umgang begehrende<br />
Person hierzu willens und in der Lage, wird als nächster<br />
Schritt der Wille <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> bei der Ausgestaltung <strong>des</strong> Umgangs<br />
zu prüfen sein, der nach Dettenborn (2001, S. 95f.) folgende<br />
Kriterien (Kategorien) beinhaltet:<br />
1. Zielorientiertheit (Hat z.B. die Willensbekundung<br />
ein klar erkennbares Ziel? Äußert sich z.B. das Kind<br />
über den Umfang und die Ausgestaltung <strong>des</strong> Umgangs.<br />
Hat das Kind Angst vor Übernachtungen? Werden unter<br />
verschiedenen Möglichkeiten einzelne favorisiert?<br />
Werden Argumente hervorgebracht, ein bestimmtes Ziel<br />
zu erreichen?)
2. Intensität (Beruht die Willensbekundung auf einer<br />
gefühlsmäßigen Grundlage, die einfühlbar ist oder<br />
äußert sich das Kind z.B. „Ich-fremd“. Werden<br />
Zielorientierungen eindeutig, nachdrücklich und<br />
beharrlich beibehalten?)<br />
3. Stabilität (Wird z.B. die Willensbekundung über<br />
einen längeren Zeitraum eindeutig vorgetragen? Oder<br />
waren die geäußerten Willensinhalte <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong><br />
instabil, wechselnd? Wurden sie auch in Bezug auf<br />
verschiedene Personen und in unterschiedlichen<br />
Kontexten beibehalten? Wo, wann und wie ist die<br />
Geburtsstunde der ersten Willensbekundung zu<br />
identifizieren und wie stellt sich der weitere<br />
Verlauf, also die Geschichte <strong>des</strong><br />
Willenbildungsprozesses dar?)<br />
4. Autonomie (Ist beispielsweise die Willensbekundung<br />
erlebnisgestützt bzw. erlebnisfundiert – entspringt<br />
sie somit einem realen Erleben oder ist sie aufgrund<br />
von Beeinflussungen zustandegekommen? Hier sollte<br />
auch eine denkbare Induktion <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> beachtet<br />
werden. Aber auch dann gilt, dass auch der<br />
induzierte Wille ein Wille ist) (vgl. hierzu<br />
Peschel-Gutzeit, 1989, 1995).<br />
Denkbar ist ebenso, dass angesichts einer Induktion <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong><br />
das Kind keinen Willen äußert oder einen Willen kundgibt, der<br />
nicht seinen „wirklichen“ Intentionen entspricht. Werden<br />
Kinder induziert, gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten<br />
diesen Induktionsprozess in Bezug auf die Eltern und das Kind<br />
diagnostisch zu erfassen und zu klären:<br />
I. Elternebene<br />
1. Der induzierende Elternteil macht meist auch Jahre nach der<br />
Trennung oder Scheidung andauernde negative Äußerungen über<br />
den anderen Elternteil (dein Vater/deine Mutter ist ein
Versager, Feigling, ein Betrüger, der Zerstörer der Familie<br />
etc.).<br />
2. Der induzierende Elternteil hält nachpartnerschaftliche<br />
Schuldprojektionen bezüglich <strong>des</strong> anderen Elternteils – meist<br />
angesichts schwerer Kränkungen und seelischer Verletzungen -<br />
hartnäckig aufrecht.<br />
3. Der induzierende Elternteil äußert seine Vorbehalte<br />
normalerweise nicht direkt gegenüber dem anderen Elternteil,<br />
sondern wählt sich das Kind als Ansprech-,<br />
Manipulationspartner und Komplizen aus. Auch das Jugendamt,<br />
der Sachverständige, Verfahrenspfleger, Umgangsbegleiter<br />
oder das Gericht werden häufig in diese Dynamik mit<br />
einbezogen, um den Kontakt <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> mit dem anderen<br />
Elternteil einzuschränken oder auszusetzen.<br />
4. Der induzierende Elternteil instrumentalisiert das Kind, um<br />
eigenen Verlustängsten zu begegnen und weiter bestehende<br />
Haß- und Rachegefühle gegenüber dem anderen Elternteil<br />
auszuleben. Eine Trennung bzw. Differenzierung der<br />
Elternebene von der Paarebene scheint unmöglich zu sein.<br />
5. Trennungsbedingte Symptome und Beunruhigungen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong><br />
werden dem abgelehnten Elternteil zugerechnet.<br />
6. Meist wird eine Hilfe oder Unterstützung - beispielsweise im<br />
ASD <strong>des</strong> Jugendamtes - oder eine Mediation, Beratung oder<br />
Therapie nicht in Anspruch genommen; direkte Kontakte mit<br />
dem anderen Elternteil werden abgelehnt.<br />
7. Der induzierende Elternteil folgt oft dem Motto: Beide<br />
Eltern sind im allgemeinen auch nach einer Trennung für die<br />
Kinder wichtig, nicht aber im konkreten (in meinem) Fall.<br />
Der andere Elternteil hat alle „Rechte“ am Kind verwirkt.<br />
8. Die Beziehungen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> zu anderen Familienmitgliedern<br />
<strong>des</strong> abgelehnten Elternteils werden als genauso schädlich<br />
eingestuft wie die Kontakte zu ihm selbst.<br />
9. Selbst von neutralen Personen begleitete Umgangskontakte<br />
werden oft als dem Kind unzumutbar abgelehnt.
10. Einmal aufgestellte Behauptungen werden auch im Falle<br />
einer „Widerlegung“ durch Fachleute oder durch gerichtlichen<br />
Beschluss weiterhin als Realität angesehen (z.B. beim<br />
sexuellen Missbrauchsthema).<br />
I. Kindebene<br />
1. In den Gesprächen mit einem induzierten Kind fällt auf,<br />
dass der induzierende Elternteil meist durchweg positiv,<br />
der abgelehnte Elternteil dagegen meist durchgängig negativ<br />
beschrieben wird.<br />
2. Auf die Frage, wie sich der abgelehnte Elternteil ändern<br />
müsste bzw. was geschehen müsste, um ein besseres Bild vom<br />
abgelehnten Elternteil zu bekommen, fällt dem Kind so gut<br />
wie nie eine Antwort ein. Typische Antworten lauten<br />
beispielsweise: „Der kann sich gar nicht ändern“; „der hat<br />
bei mir keine Chance mehr.“<br />
3. Auf die Frage, warum das Kind keinen Kontakt mit dem anderen<br />
Elternteil haben möchte, werden meist nur lapidare<br />
Erklärungen oder vage Hinweise gegeben: „Dort muss ich den<br />
Tisch abräumen“; „da muss ich lesen üben“; „da musste ich<br />
den Mülleimer auslehren“.<br />
4. Wenn ein derart induziertes Kind seine ablehnende Haltung<br />
begründen soll, werden meist wortgetreu die Beschuldigungen<br />
<strong>des</strong> anderen Elternteil wiedergegeben. Nähere Erläuterungen,<br />
Begründungen oder Konkretisierungen sind dem Kind jedoch<br />
meist nicht möglich.<br />
Nach Gardner (1992) zeigen in diesem Sinne induzierte Kinder<br />
(PAS) im hochstrittigen Sorgerechts- oder Umgangsverfahren<br />
folgende Besonderheiten:<br />
- Verunglimpfungskampagnen <strong>des</strong> anderen Elternteils<br />
- Absurden Rationalisierungen und Verunglimpfungen<br />
- Fehlende Ambivalenz<br />
- Betonung „eigenständigen Denkens“<br />
- Reflexive Unterstützung <strong>des</strong> betreuenden Elternteils
- Fehlende Schuldgefühle<br />
- „Entliehene Szenarien“<br />
- Ausweitung der Feindseligkeiten auf weitere Angehörige<br />
<strong>des</strong> abgelehnten Elternteils<br />
Werden derartig gravierende Induzierungen beim Kind nicht<br />
erkennbar, sondern eher typische Beeinflussungen,<br />
Manipulationen oder Instrumentalisierungen <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>, sind<br />
folgende Leitfragen zur Klärung der Lebenssituation und der<br />
Vorstellungswelt <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> bei der Realisierung von<br />
Umgangskontakten hilfreich (vgl. hierzu Westhoff, Terlinden-<br />
Arzt & Klüber, 2000):<br />
- Wann hat das Kind seine Mutter, seinen Vater nach der<br />
Elterntrennung erstmalig wieder gesehen?<br />
- Gab es seitdem Unterbrechungen der Kontakte?<br />
- Wie häufig trifft das Kind seine Mutter bzw. seinen<br />
Vater?Wie lange dauern jeweils die Kontakte?<br />
- Unter welchen Bedingungen finden die Kontakte statt?<br />
- Welche Personen sind außer dem jeweiligen Elternteil<br />
anlässlich der Kontakte dabei?<br />
- Was unternehmen das Kind und seine Mutter bzw. sein<br />
Vater, wenn sie zusammen sind?<br />
- Gibt es telefonische und/oder briefliche Kontakte<br />
zwischen dem Kind und dem betreffenden Elternteil?<br />
- Gab bzw. gibt es Schwierigkeiten bei der Durchführung der<br />
Umgangskontakte?<br />
- Wie sieht die Übergabe- und Abholsituation aus?<br />
- Wie geht das Kind auf seine Mutter bzw. seinen Vater zu,<br />
wenn es zu einem Zusammentreffen kommt?<br />
- Wie geht es dem Kind beim Abschied nehmen?<br />
- Wie verhält sich das Kind, wenn es wieder zurückkommt?<br />
- Wie erlebt das Kind die Besuchskontakte?<br />
- Kann das Kind von den Besuchskontakten profitieren?<br />
- Berichtet das Kind von den Besuchen und Aktivitäten?
- Wie verhält sich das Kind bei den Besuchskontakten<br />
gegenüber seiner Mutter bzw. seinem Vater?<br />
- Welchen Willen kann das Kind äußern?<br />
- Fanden bereits Umgangskontakte gegen den erklärten Willen<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> statt?<br />
- Haben die Eltern eine Mediation, Trennungsberatung oder<br />
eine Psychotherapie in Anspruch genommen?<br />
- Boykottiert ein Elternteil die Umgangskontakte?<br />
- Welche Auflagen, gerichtlichen Beschlüsse und Sanktionen<br />
sind bereits erfolgt, um den Boykott zu beheben?<br />
Zusammenfassung und Perspektiven<br />
Beeinflussungen, Manipulationen, Instrumentalisierungen,<br />
Parentifizierungen von Kindern aller Altersgruppen und<br />
Induzierungen in hoch strittigen Trennungsprozessen, bei<br />
Sorgerechts- und Umgangsregelungen sind seit Jahren bekannte<br />
Phänomene in der Sozialarbeit, Verfahrenspflegschaft,<br />
familienpsychologischen Sachverständigentätigkeit,<br />
Beratungspraxis und im Gerichtsverfahren.<br />
Im Rahmen dieser Diskussion macht in den letzten Jahren vor<br />
allem das Parental-Alienation-Syndrome (PAS) auf sich<br />
aufmerksam. Bei diesem Konzept handelt es sich um ein<br />
Arbeitsmodell, das nicht auf der Grundlage empirisch<br />
hinreichend belegter Annahmen steht. Insbesondere die Annahme,<br />
dass es sich um eine Krankheit <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> handelt, analog dem<br />
Modell eines Folie à deux (vgl. ICD 10 F24) 2 , widerspricht dem<br />
2 Nach ICD-10 F24 soll die Diagnose einer induzierten wahnhaften Störung<br />
nur gestellt werden, wenn:<br />
1. Zwei oder mehr Menschen denselben Wahn oder dasselbe Wahnsystem<br />
teilen, und sich in dieser Überzeugung bestärken.<br />
2. Diese Menschen eine außergewöhnlich enge Beziehung verbindet.<br />
3. Durch einen zeitlichen oder sonstigen Zusammenhang belegt ist, dass<br />
der Wahn bei dem passiven Partner durch Kontakt mit dem aktiven<br />
induziert wurde.
das gesamte Familiensystem umfassenden systemischen<br />
Denkansatz, der keine isolierte Krankheitssicht betont.<br />
Allen Professionellen ist bekannt, dass induzierende<br />
Elternteile in der Lage sind, Kinder derart zu beeindrucken,<br />
dass sie u.U. sogar den Kontakt mit dem ehemals geliebten<br />
Elternteil verweigern.<br />
Kritisch anzumerken ist, dass gerade im Rahmen der PAS-<br />
Diskussion davon ausgegangen wird, dass der induzierte Wille<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> nicht zu beachten ist, obwohl gerade dieser<br />
intentionale Wille mit einer klaren Zielrichtung besonders<br />
stark ausgeprägt sein kann und je<strong>des</strong> Kontaktbemühen scheitern<br />
lässt.<br />
Nicht der zwangsweise durchgesetzte Umgang stellt in der<br />
Regel ein erfolgreiches Modell dar, da bei jedem<br />
Umgangskontakt meist der Wille <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> erneut gebrochen<br />
werden muss, sondern die Inanspruchnahme z.B. einer Mediation,<br />
Beratung, Familientherapie oder Psychotherapie durch die<br />
Eltern und/oder eine bereits kurze Zeit nach einer Trennung<br />
erfolgende konsequente Festlegung <strong>des</strong><br />
Aufenthaltsbestimmungsrechts auf den bindungstoleranteren und<br />
nicht boykottierenden Elternteil.<br />
Hat sich aber der Wille eines Kin<strong>des</strong> erst verfestigt –<br />
intentionalisiert – wird er meist ab einem Lebensalter von ca.<br />
zehn Jahren nicht mehr, ohne neuen Schaden anzurichten, zu<br />
verändern sein. In diesem Zusammenhang wird auch der Vorschlag<br />
von einigen Vertretern <strong>des</strong> PAS-Modells, der vor allem von<br />
betroffenen Vätern aufgegriffen wurde, das Kind beispielsweise<br />
in einem Heim unterzubringen, grundsätzlich als nicht<br />
kin<strong>des</strong>wohlverträglich abzulehnen sein.<br />
Allerdings entfällt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der<br />
Wille <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> verfestigt hat, meist die Möglichkeit, einen<br />
Wechsel <strong>des</strong> Aufenthaltsbestimmungsrechts oder <strong>des</strong> Sorgerechts<br />
herbeizuführen, es sei denn, dass trotz der Induzierung die<br />
Widerstandskraft (Resilienz) (Egle, Hoffmann & Joraschky,<br />
2000, S. 4) <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> besonders ausgeprägt ist. Unter
Resilienz ist in diesem Zusammenhang das Phänomen zu<br />
verstehen, sich selbst unter schwierigen Lebensumständen<br />
andauernder familiärer Konflikte gesund und kompetent zu<br />
entwickeln. Darüber hinaus wird unter Resilienz auch zu<br />
subsumieren sein, wenn sich das Kind z.B. nach einem<br />
Sorgerechtswechsel von seinem Störungszustand der Induktion<br />
schnell erholt.<br />
Dabei spielt offensichtlich nicht nur die resiliente<br />
Persönlichkeit <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> eine herausragende Rolle, sondern<br />
ebenso der familiäre Zusammenhalt in den Teilfamilien - auch<br />
im Sinne der Bindungstheorie - und das Vorhandensein externer<br />
Unterstützung, z.B. bei älteren Kindern in der Verwandtschaft,<br />
Freundschaft und peer-groups oder bei jüngeren Kindern<br />
zusätzlich in Trennungs- und Scheidungsgruppen, die die<br />
kindlichen Coping-Strategien fördern und stärken.<br />
Beachtenswert ist ferner die allgemeine Lebenseinstellung und<br />
sichere Einbettung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> in das soziale Umfeld, die u.U.<br />
noch einen späteren Wechsel <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> zu dem anderen<br />
Elternteil zulässt.<br />
Literatur<br />
Astington, J. W. (2000). Wie Kinder das Denken entdecken.<br />
München: Reinhardt.<br />
Braun, O. L. (Hrsg.). (1998). Ziele und Wille in der<br />
Psychologie. Grundlagen und Anwendungen. Landau: Verlag<br />
Empirische Pädagogik.<br />
Brazelton, T. B. & Greenspan, S. I. (2002). Die sieben<br />
<strong>Grundbedürfnisse</strong> von Kindern. Was je<strong>des</strong> Kind braucht, um<br />
gesund aufzuwachsen, gut zu lernen und glücklich zu sein.<br />
Weinheim: Beltz.<br />
Dettenborn, H. (2001). Kin<strong>des</strong>wohl und <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong>.<br />
Psychologische und rechtliche Aspekte: Reinhardt.<br />
Dürr, R. (1979). Verkehrregelungen gemäß § 1634 BGB. 2.<br />
Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Egle, U. T., Hoffmann, S. O. & Joraschky, P. (2000). Sexueller<br />
Mißbrauch, Mißhandlung, Vernachlässigung. Erkennung und<br />
Therapie psychischer und psychosomatischer Folgen früher<br />
Traumatisierungen. Stuttgart: Schattauer.<br />
Fthenakis, W. E. (1995). Umgangsmodelle zur kindgerechten<br />
Gestaltung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern in<br />
der Nachscheidungsphase. Familie, Partnerschaft, Recht, 1,<br />
94-98.
Gardner, R. A. (1992). The Parental-Alienation-Syndrome. A<br />
guide for mental and legal professionells. Creskill/NJ,<br />
Creative Therapeutics Inc.<br />
Peschel-Gutzeit, L. M. (1989). Das Recht zum Umgang mit dem<br />
eigenen Kinde. Eine systematische Darstellung. Berlin: de<br />
Gruyter.<br />
Peschel-Gutzeit, L. M. (1995). Immer wiederkehrende Probleme<br />
<strong>des</strong> Umgangsrechts. Familie, Partnerschaft, Recht, 1, 82-88.<br />
Piaget, J. (1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood.<br />
New York: Norton. Deutsch: (1989). Nachahmung, Spiel,<br />
Traum. Gesammelte Werke. Band 5. Stuttgart. Klett-Cotta).<br />
Wallerstein, J. S. & Lewis, J. (2001). Langzeitwirkungen der<br />
elterlichen Ehescheidung auf Kinder. – Eine<br />
Längsschnittuntersuchung über 25 Jahre -. Zeitschrift für<br />
das gesamte Familienrecht, 48, 65-72.<br />
Westhoff, K., Terlinden-Arzt, P. & Klüber, A. (2000).<br />
Entscheidungsorientierte psychologische Gutachten für das<br />
Familiengericht. Berlin: Springer.<br />
Zitelmann, M. (2001). Kin<strong>des</strong>wohl und <strong>Kin<strong>des</strong>wille</strong> im<br />
Spannungsfeld von Pädagogik und Recht. Münster: Votum.


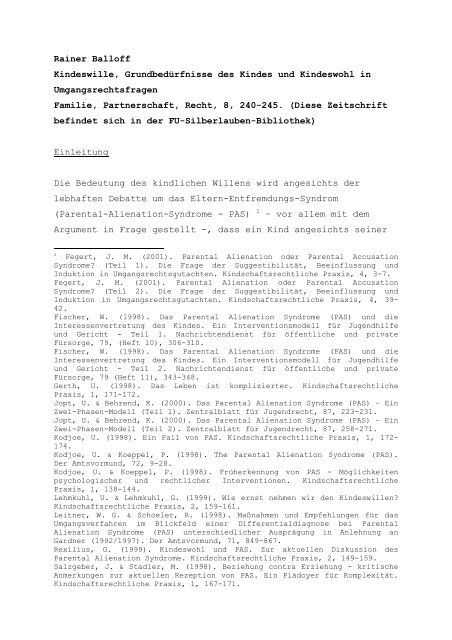








![[UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN?] - Userpage](https://img.yumpu.com/22343335/1/184x260/unbegrenzte-moglichkeiten-userpage.jpg?quality=85)