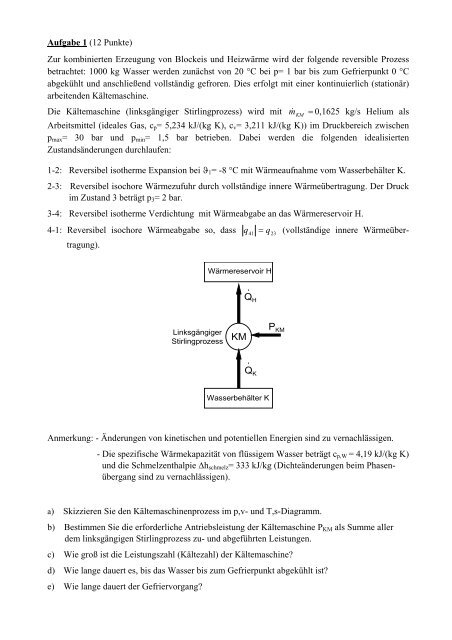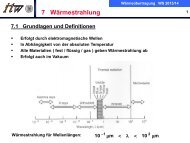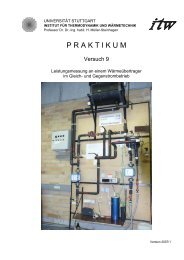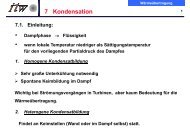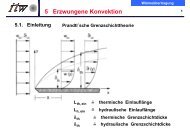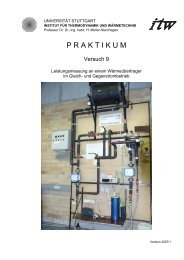UNIVERSITÄT STUTTGART - Institut für Thermodynamik und ...
UNIVERSITÄT STUTTGART - Institut für Thermodynamik und ...
UNIVERSITÄT STUTTGART - Institut für Thermodynamik und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufgabe 1 (12 Punkte)<br />
Zur kombinierten Erzeugung von Blockeis <strong>und</strong> Heizwärme wird der folgende reversible Prozess<br />
betrachtet: 1000 kg Wasser werden zunächst von 20 °C bei p= 1 bar bis zum Gefrierpunkt 0 °C<br />
abgekühlt <strong>und</strong> anschließend vollständig gefroren. Dies erfolgt mit einer kontinuierlich (stationär)<br />
arbeitenden Kältemaschine.<br />
Die Kältemaschine (linksgängiger Stirlingprozess) wird mit m� KM � 0,1625 kg/s Helium als<br />
Arbeitsmittel (ideales Gas, cp= 5,234 kJ/(kg K), cv= 3,211 kJ/(kg K)) im Druckbereich zwischen<br />
pmax= 30 bar <strong>und</strong> pmin= 1,5 bar betrieben. Dabei werden die folgenden idealisierten<br />
Zustandsänderungen durchlaufen:<br />
1-2: Reversibel isotherme Expansion bei �1= -8 °C mit Wärmeaufnahme vom Wasserbehälter K.<br />
2-3: Reversibel isochore Wärmezufuhr durch vollständige innere Wärmeübertragung. Der Druck<br />
im Zustand 3 beträgt p3= 2 bar.<br />
3-4: Reversibel isotherme Verdichtung mit Wärmeabgabe an das Wärmereservoir H.<br />
4-1: Reversibel isochore Wärmeabgabe so, dass q41 � q23<br />
(vollständige innere Wärmeübertragung).<br />
Linksgängiger<br />
Stirlingprozess<br />
Wärmereservoir H<br />
KM<br />
.<br />
QH .<br />
QK Wasserbehälter K<br />
Anmerkung: - Änderungen von kinetischen <strong>und</strong> potentiellen Energien sind zu vernachlässigen.<br />
P KM<br />
- Die spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser beträgt cp,W = 4,19 kJ/(kg K)<br />
<strong>und</strong> die Schmelzenthalpie �hschmelz= 333 kJ/kg (Dichteänderungen beim Phasen-<br />
übergang sind zu vernachlässigen).<br />
a) Skizzieren Sie den Kältemaschinenprozess im p,v- <strong>und</strong> T,s-Diagramm.<br />
b) Bestimmen Sie die erforderliche Antriebsleistung der Kältemaschine PKM als Summe aller<br />
dem linksgängigen Stirlingprozess zu- <strong>und</strong> abgeführten Leistungen.<br />
c) Wie groß ist die Leistungszahl (Kältezahl) der Kältemaschine?<br />
d) Wie lange dauert es, bis das Wasser bis zum Gefrierpunkt abgekühlt ist?<br />
e) Wie lange dauert der Gefriervorgang?