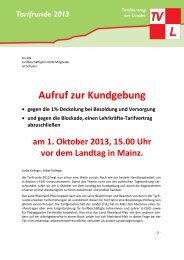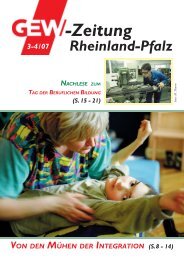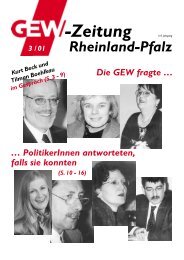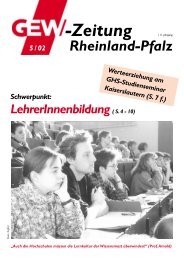Zeitung Rheinland-Pfalz 4-5 - GEW
Zeitung Rheinland-Pfalz 4-5 - GEW
Zeitung Rheinland-Pfalz 4-5 - GEW
- TAGS
- zeitung
- www.gew-rlp.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4-5/03<br />
-<strong>Zeitung</strong><br />
112. Jahrgang<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Kollateralschaden<br />
Sonderbeilage (S. I - XII):<br />
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
The ode to hell<br />
„If you cannot find Osama,<br />
bomb Iraq.<br />
If the markets are a drama,<br />
bomb Iraq.<br />
If the terrorists are frisky,<br />
Pakistan is looking shifty,<br />
North Korea is too risky,<br />
bomb Iraq.<br />
If we have no allies with us,<br />
bomb Iraq.<br />
If we think someone has dissed us,<br />
bomb Iraq.<br />
So to hell with the inspections,<br />
let’s look tough for the elections,<br />
close you mind and take directions.<br />
bomb Iraq. ...“<br />
Auf einer Schülerdemonstration gegen den Irakkrieg wurde in Tübingen<br />
ein Spottlied aus England, das im Daily Mirror veröffentlicht wurde, verteilt.<br />
Zu singen ist dieses Lied auf die Melodie „If you`re happy and you<br />
know it“. Quelle: www.cityinfonetz.de/das magazin/2003/09/artikel 5<br />
Krieg ist keine Lösung!
Foto: Lucas Schmitt<br />
Kolumne / Inhalt / Impressum<br />
Obersuperräte<br />
Es geschah am nicht mehr ganz helllichten<br />
Tag: Zwei hochkarätige Funktionäre<br />
verließen beim letzten <strong>GEW</strong>-Bundesgewerkschaftstag<br />
in Lübeck den Kreis der<br />
illustren Gäste bei der Eröffnungsveranstaltung<br />
diskret durch die Hintertür, um<br />
in eine nahe Großstadt zu eilen, wo ein<br />
sportliches Großereignis ihres Kommens<br />
harrte. Im dortigen Stadion - einst in sympathisch-proletarischem<br />
Duktus nach einem<br />
Park für das Volk benannt und jetzt<br />
in profan-merkantiler Manier in Soundso-Arena umgetauft - wollten<br />
sie einer genuin pädagogischen Tätigkeit nachgehen: junge Menschen<br />
bei der körperlichen Ertüchtigung beobachten und dieses Treiben dann<br />
später ihrer fachmännischen Bewertung unterziehen.<br />
Weniger gestelzt ausgedrückt: Sie wollten die Leistungen der FCK-Kicker<br />
beim Spiel gegen den HSV benoten und diese Zensuren dann am<br />
nächsten Tag mit den Urteilen des Sportredakteurs der Regionalzeitung<br />
vergleichen! Das gar nicht erstaunliche Ergebnis: Während die<br />
beiden Vollblutpädagogen und Fußballkenner im kritischen Diskurs<br />
sehr rasch zu nur minimal divergierenden Einschätzungen kamen,<br />
wichen die Noten des <strong>Zeitung</strong>smannes in einigen Fällen krass davon<br />
ab.<br />
Womit wir leider schon wieder bei PISA bzw. der letzten Ergänzungsuntersuchung<br />
wären, die eine gänzlich neue Erkenntnis brachte: Mit<br />
der Vergleichbarkeit schulischer Zensuren ist es nicht weit her. Wer hätte<br />
das gedacht. In allen Klassen herrschen doch die gleichen Bedingungen,<br />
alle Lehrkräfte unterrichten gleichermaßen gut, es gibt weder<br />
Unterschiede beim Unterrichtsausfall noch in den Klassengrößen oder<br />
bei den Unterrichtsmaterialien und in was sonst noch immer. Da muss<br />
die Leistung für eine Drei in der 10. Klasse einer Hauptschule in Kaiserslautern<br />
exakt der gleichen Note in einem Gymnasium in Cottbus<br />
entsprechen.<br />
Platzverschwendung, hier auf die seit Jahrzehnten bekannte Fragwürdigkeit<br />
der schulischen Ziffernoten einzugehen. Interessant dagegen ist,<br />
sich die Funktion von Zensuren mal wieder zu vergegenwärtigen. Zu<br />
diesem Zweck nochmals zurück zum Fußball. Ein junger Westpfälzer<br />
polnischer Herkunft, damals gerade auf dem Sprung in die Nationalmannschaft,<br />
hatte an diesem kühlen Maienabend eine eher dürftige<br />
Leistung abgeliefert, wurde aber von dem Sportchef des Regionalblattes<br />
mit „gut“ bewertet. Die eindeutige Intention: Der Nachwuchsstar<br />
Aus dem Inhalt <strong>GEW</strong>-ZEITUNG <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> Nr. 4-5 / 2003:<br />
Kolumne Seite 2<br />
Politik: „Wir wollen keinen Krieg!“ Seite 3<br />
Aufruf Seite 4<br />
Tarifpolitik Seite 5<br />
Schulen Seiten 6 - 12<br />
Bildungspolitik Seite 13<br />
Weiterbildung Seite 14<br />
Tipps + Termine Seite 15 - 16<br />
Alter + Ruhestand Seiten 17 - 18<br />
Kreis + Region Seiten 18 - 19<br />
Ostergeist Seite 20<br />
Sonderbeilage: „Bildung von Anfang an“ Seiten I - XII<br />
sollte auch nach einem schwachen Auftritt nicht durch zuviel Kritik<br />
heruntergezogen, sondern aufgebaut werden, auch wenn die Note im<br />
Vergleich zu seinen Mitspielern ungerecht war.<br />
Okay, wen interessiert das schon. Es geht um Noten für SchülerInnen<br />
durch Lehrkräfte und nicht für Fußballer durch Journalisten.<br />
Aber sind Parallelen wirklich so einfach von der Hand zu weisen? Auch<br />
bei Bewertungen im Bildungswesen spielen oft sachfremde Momente<br />
mit - ob die immer illegitim und nicht manchmal auch pädagogisch<br />
sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Zensuren können als Rückmeldungen<br />
auf Leistungen motivieren wie demotivieren, sie können gerecht<br />
und ungerecht sein. Primär dienen sie - und da wird es nun traurig -<br />
der Selektion. Pech gehabt, wer in Zeiten des „Überangebotes“ (welch<br />
schreckliches Wort) trotz guter Leistungen nur schlechte Chancen hat.<br />
Denken wir an viele unserer jugendlichen Schulabgänger, für die es in<br />
diesem Jahr voraussichtlich mal wieder kein ausreichendes Angebot an<br />
Lehrstellen geben wird.<br />
Denken wir an die Generationen von arbeitslosen Lehrkräften, die<br />
neuerdings ungläubig wahrnehmen müssen, dass in Zeiten des Lehrermangels<br />
nun plötzlich Leute unterrichten dürfen, die nicht einmal die<br />
formalen Voraussetzungen zweier Staatsexamina haben.<br />
Denken wir an die Studienräte, die wegen des Stellenkegels - auch solch<br />
ein Leistungskriterium - seit Jahren auf ihre Beförderung warten und<br />
letztes Jahr nochmals in die Röhre schauen durften, weil ihre Schulleitungen<br />
glaubten, „echte Noten“ machen zu müssen und somit die<br />
bekanntermaßen notwendige Punktezahl nicht vergeben zu können.<br />
Ein geradezu klassisches Beispiel für die Absurdität der Zensierungspraxis:<br />
An Gymnasien und berufsbildenden Schulen gibt es mehrheitlich<br />
supergute Studienräte, die bei der Beförderungsrunde dennoch leer<br />
ausgingen, weil sie nicht an die obersupergute Konkurrenz heranreichen<br />
konnten. Obersuperräte.<br />
Denken wir an KollegInnen, die bei Funktionsstellen nicht zum Zuge<br />
kamen, weil schmalbrüstige Günstlinge der ..............( Leerstelle bitte<br />
selbst füllen) durch wasserdichte Beurteilungen hochgehievt wurden,<br />
obwohl deren Unfähigkeit allenthalben bekannt war.<br />
Am besten denken wir gar nicht mehr daran, denn sonst vergeht die<br />
Freude am eigentlich Wichtigen und Befriedigenden an der Arbeit von<br />
Lehrkräften: nicht zensieren und somit Lebenschancen zuweisen, sondern<br />
der Begeisterung am Abenteuer Lernen wecken und erhalten.<br />
Und vergessen wir bitteschön solch hohle Sprüche wie „Die Besten müssen<br />
Lehrer werden“, die sogar in <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong>en kursieren. Ein klassischer<br />
Fall für unseren Orden für sprachliche Fehlleistungen. Als eigneten<br />
sich schulische und universitäre Zensuren als Prognosen dafür, wer<br />
mal eine gute Lehrkraft wird.<br />
Günter Helfrich<br />
Impressum <strong>GEW</strong>-ZEITUNG <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, Neubrunnenstr. 8, 55116<br />
Mainz, Tel.: (0 61 31) 28988-0, Fax: (06131) 28988-80, E-mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.de<br />
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.) und Karin Helfrich, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen,<br />
Tel./ Fax: (0621) 564995, e-mail: <strong>GEW</strong>ZTGRL1@aol.com; Ursel Karch ( Anzeigen), Arnimstr.<br />
14, 67063 Ludwigshafen, Tel.: (0621) 69 73 97, Fax.: (0621) 6 33 99 90, e-mail:<br />
UKarch5580@aol.com; Antje Fries, Rheindürkheimer Str. 3, 67574 Osthofen, Tel./Fax: (0 62 42)<br />
91 57 13, e-mail: antje.fries@gmx.de<br />
Verlag, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433 Neustadt a.d.W.,<br />
Tel.: (06321) 8 03 77; Fax: (0 63 21) 8 62 17; e-mail: VPP.NW@t-online.de, Datenübernahme per<br />
ISDN: (0 63 21) 92 90 92 (Leonardo-SP - = 2 kanalig)<br />
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen<br />
nicht in jedem Falle der Ansicht des <strong>GEW</strong>-Vorstandes oder der Redaktion. Nur maschinengeschriebene<br />
Manuskripte können angenommen werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine<br />
Gewähr übernommen. Manuskripte und sonstige Zuschriften für die Redaktion der <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong><br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> werden nach 67023 Ludwigshafen, Postfach 22 02 23, erbeten.<br />
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto<br />
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.<br />
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.<br />
Anzeigenpreisliste Nr. 12 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 5. des Vormonats.<br />
2 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
„Wir wollen keinen Krieg!“<br />
Es ist Donnerstagmorgen,<br />
kurz vor acht. Wie<br />
an jedem Tag strömen<br />
die Mädchen und Jungen<br />
in ihre Schulen.<br />
Doch es ist kein Tag wie<br />
jeder andere. Wenige<br />
Stunden zuvor fielen<br />
die ersten amerikanischen<br />
Bomben auf<br />
Bagdad. Der Krieg hat<br />
begonnen!<br />
Sprachlosigkeit, Wut,<br />
Entsetzen, Ohnmacht<br />
kennzeichnet die Stimmung<br />
in den Klassen der Konrad<br />
Adenauer-Realschule in Landau.<br />
Auch die Lehrkräfte sind rat- und<br />
hilflos, vielen fehlen die Worte. Eine<br />
Fünftklässlerin möchte spontan ein<br />
Shalom-Lied anstimmen, das sie<br />
kennt, Stefan aus der Sechsten bittet<br />
darum, eine kleine Rede gegen den<br />
Krieg halten zu dürfen, und die<br />
Zehntklässler malen Plakate: „We<br />
believe in peace“, „Wir wollen keinen<br />
Krieg“, „Krieg ist keine Lösung“.<br />
Die zehnjährige Vanessa findet den<br />
Krieg „blöd“, „weil die USA sowieso<br />
gewinnen“. Alle in der Klasse nennen<br />
das, was in der Nacht im Irak<br />
begonnen hat, „blöd“ und auch denjenigen,<br />
der diesen Krieg vom Zaun<br />
gebrochen hat: den amerikanischen<br />
Präsidenten George W. Bush. Viele<br />
der Schülerinnen denken zuerst an<br />
die unschuldigen Menschen und<br />
Kinder, die leiden und sterben müssen.<br />
Dass es nur um das Öl geht und<br />
nicht um die Befreiung der Menschen<br />
im Irak, ist in allen Klassen zu<br />
hören, „denn auch noch andere Län-<br />
Kurzkommentar<br />
Arschkriech(g)er<br />
Welch ein Segen, in diesen traurigen<br />
Zeiten keine CDU-Regierung ertragen<br />
zu müssen. Da werden SchülerInnen,<br />
die am Tag nach dem Beginn der amerikanisch-britischen<br />
Angriffe auf den<br />
Irak an spontanen Friedensdemos teilnahmen,<br />
in unseren Nachbarbundesländern<br />
Saarland und Baden-Würt-<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
der will Bush angreifen“, mutmaßt<br />
der Fünftklässler Christopher und<br />
stellt den amerikanischen Präsidenten<br />
ungeniert in eine Reihe mit Hitler<br />
und anderen Aggressoren. Für<br />
Manuel ist dieser Krieg einfach nur<br />
„ungerecht“ und „unsinnig“, „wo<br />
doch die UNO einer friedlichen Lösung<br />
so nahe gewesen ist.“<br />
Auch die Mädchen und Jungen der<br />
8e sind wortkarg, wenn es um die<br />
Frage geht, was man gegen den Krieg<br />
tun könne. „Wenn Millionen weltweit<br />
dagegen demonstrieren und wir<br />
auf den Marktplatz gehen, bringt das<br />
offensichtlich nichts“, meint Jonas<br />
mit resignativem Unterton. „Bush<br />
geht über Leichen“, ergänzt Christine.<br />
Man spürt in den Klassen weniger<br />
eine antiamerikanische Stimmung<br />
als den Zorn gegen den derzeitigen<br />
Präsidenten in Washington.<br />
Cacrina aus Florida, seit 10 Jahren<br />
in Landau, liebt ihr Heimatland, wie<br />
sie betont, verurteilt aber Bush auf<br />
das Schärfste. „Er verstößt gegen das<br />
Völkerrecht“. Viele ihrer Verwandten<br />
seien beunruhigt, stellt sie fest.<br />
Sie selbst werde in nächster Zeit auch<br />
nicht in ihre Heimat fliegen. „Die<br />
Angst vor dem Terror geht um bei<br />
uns zuhause“. Für Jara aus der 10d<br />
ist die USA eine große Nation, „der<br />
wir immer mit Respekt begegnet<br />
sind, zu der wir in vielen aufgeschaut<br />
haben“. Mit seinem jetzigen Präsidenten,<br />
fürchtet sie, verfinstere sich<br />
das Amerikabild und bekomme die<br />
„Züge eines Rambos“, wie ein Mitschüler<br />
meint. Die sechzehnjährige<br />
Derya versteht ihre türkische Regierung<br />
nicht, sich einfach am Krieg zu<br />
temberg mit Repressalien bis hin zum<br />
Schulausschluss bedroht. Absurd, junge<br />
Menschen, die heute so seltene Tugenden<br />
wie Empathie und Engagement<br />
zeigen, mit vordergründig-schulrechtlichen<br />
Begründungen bestrafen zu wollen.<br />
Belobigen müsste man sie! Hier geht<br />
es nicht um die Ahndung von Verstößen<br />
gegen die Schulordnung, sondern<br />
um Gesinnungsterror. Oder wie würden<br />
die CDU-Kultusminister denn<br />
etwa reagieren, wenn ein westliches<br />
Politik<br />
beteiligen, „wo alle Menschen im<br />
Irak doch auch Muslime sind wie wir<br />
Türken“. Immer wieder taucht das<br />
Wort „traurig“ auf, wenn die Mädchen<br />
und Jungen in der Realschule<br />
über den Krieg sprechen. Lena: „Ich<br />
finde es traurig, dass die Menschheit<br />
immer noch nichts dazu gelernt hat,<br />
traurig, dass die Menschen immer<br />
noch nicht kapiert haben, dass Krieg<br />
und Gewalt keine Lösung sind.“ Julia<br />
und andere können schließlich<br />
nicht verstehen, dass unsere Lehrer<br />
uns immer wieder beibringen, in<br />
Konfliktfällen vernünftige Lösung zu<br />
suchen und Gewalt zu vermeiden,<br />
„während die große Politik kopflos<br />
Menschen und Städte bombardiert“.<br />
Was bedeutet ein solcher Krieg für<br />
Schule und Erziehung? Schulleiter<br />
Jürgen Schmidt zeigt sich „entsetzt“<br />
über den Kriegsbeginn, doch es gebe<br />
trotz Rückschläge keine Alternative<br />
zur Friedenserziehung. Seine Stellvertreterin<br />
Dorothea Müller schüttelt<br />
ärgerlich den Kopf über die<br />
scheinbar diplomatischen Antworten<br />
deutscher Politiker, die den Aggressor<br />
nicht beim Namen nennen.<br />
Wütend zeigt sich Müller auch über<br />
die steigenden Aktien und die<br />
Kriegsgewinnler, die vom Unglück<br />
vieler Menschen profitierten. Als<br />
einen“Schlag ins Gesicht unserer<br />
Konfliktlösungsarbeit“ bezeichnet<br />
Lehrerin Sylvia Saling die amerikanische<br />
Aggression.. „Auch wenn sich<br />
Bush momentan wie ein Gott auf<br />
Erden fühlt“, verstoße er dennoch<br />
gegen alle Regeln des friedlichen<br />
Miteinander, „die wir unseren Kindern<br />
und Jugendlichen tagtäglich<br />
vermitteln“.<br />
Paul Schwarz<br />
Land angegriffen würde und die<br />
Schülerunion in der Unterrichtszeit<br />
zu Demos aufriefe? Wo bleibt da die<br />
angebliche Liberalität des saarländischen<br />
Ministerpräsidenten, und welche<br />
Rolle spielt eigentlich die einstige<br />
DGB-Oberfrau Regina Görner in<br />
diesem Kabinett? Teilen die alle die<br />
arschkriech(g)erische Haltung der<br />
CDU-Bundesvorsitzenden gegenüber<br />
der amerikanischen Regierung?<br />
gh<br />
3
Aufruf<br />
Zeit für Veränderungen<br />
<strong>GEW</strong> ruft am 27. Juni zum „Tag der Bildung“ auf<br />
Am 27. Juni 2003 soll Bildung in der gesamten Bundesrepublik zum „Tagesthema“<br />
werden. Deshalb rufen die <strong>GEW</strong>, die BundesschülerInnenvertretung<br />
(BSV) und der Bundes Eltern Verband Kindertageseinrichtungen (BEVK) zum<br />
„Tag der Bildung“ auf.<br />
„Es ist höchste Zeit für grundlegende<br />
Veränderungen in unserem Bildungssystem“,<br />
erklärten die<br />
Vorsitzenden der Bündnisorganisationen,<br />
Eva-Maria Stange<br />
(<strong>GEW</strong>), Dana Lüddemann<br />
(BSV) und Karsten Müller<br />
(BEVK), vor Medienvertretern<br />
in Berlin.<br />
„ Anderthalb Jahre nach dem<br />
Schock durch der Ergebnisse<br />
der Schulleistungsstudie PISA<br />
müssen wir ernüchtert feststellen,<br />
dass die politisch Verantwortlichen<br />
den Hebel in der<br />
Bildungspolitik nicht umgelegt<br />
haben. Jetzt nehmen die für die<br />
Bildungsprozesse Verantwortlichen<br />
die Sache selber in die<br />
Hand“, betonten die Bündnissprecher.<br />
Pädagoginnen und Pädagogen,<br />
Kinder, Jugendliche und Eltern<br />
werden an diesem Tag in ihren<br />
Bildungseinrichtungen Bilanz<br />
ziehen. Sie sagen, was an Kindertagesstätten,<br />
Schulen,<br />
Hochschulen oder Weiterbildungseinrichtungen<br />
gut läuft und wo es<br />
Auch in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> wird die<br />
<strong>GEW</strong> am Tag der Bildung Veranstaltungen<br />
durchführen. Dabei gibt es<br />
allerdings ein Problem: Dieser Freitag<br />
ist der Tag, an dem die Schulabgänger<br />
entlassen und entsprechende Feiern zur<br />
Schulentlassung stattfinden werden.<br />
Deshalb lädt die <strong>GEW</strong> bereits für Mittwoch,<br />
den 25 Juni, zu einer ganztägigen<br />
bildungspolitischen Konferenz nach<br />
Mainz in den Erbacher Hof ein. Über<br />
die Situation des Bildungswesens in<br />
unserem Bundesland referiert dabei der<br />
Jugendsoziologe Prof. Dr. Roland<br />
Eckert von der Universität Trier. Die<br />
Themen in den Arbeitsgruppen: Bil-<br />
brennt. Sie bestimmen, welche Projekte<br />
weiter laufen sollen und wel-<br />
Gewerkschaft<br />
Erziehung und Wissenschaft<br />
Auch<br />
Adam Riese<br />
war mal ein<br />
Dreikäsehoch<br />
Jedes Kind ist<br />
anders: Darum brauchen<br />
wir Unterrichtskonzepte,<br />
die<br />
auf individuelle<br />
Förderung setzen.<br />
Talente sollen sich<br />
entfalten können, Begabungen müssen wir<br />
fördern, Schwachstellen erkennen und durch<br />
kontinuierliche Lernzuwächse ausgleichen.<br />
Individuelles Lernen<br />
ist das Zentrum von Schule.<br />
Rettet die Bildung!<br />
Qualität entwickeln – Arbeitsbedingungen verbessern<br />
che neuen Vorhaben in Angriff genommen<br />
werden. „Der ‚Tag der Bil-<br />
Der Tag der Bildung in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
dungsstandards, Leistungsbewertung<br />
und Lernkultur, Lernen in Vielfalt,<br />
Fördern statt Auslese, Wo brennt es an<br />
den Haupt- und Regionalen Schulen?,<br />
Berufliche Bildung, Gesamtschule -<br />
Schule ohne äußere Leistungsdifferenzierung.<br />
Für das Abschlussforum wurde<br />
Bildungsministerin Ahnen angefragt.<br />
Am Tag der Bildung selbst finden nach<br />
dem jetzigen Planungsstand zwei Veranstaltungen<br />
statt: Ebenfalls im Erbacher<br />
Hof in Mainz geht es nachmittags<br />
in einem Vortrag von Gewerkschaftssekretär<br />
Bernd Huster sowie in<br />
der anschließenden Diskussion unter<br />
dung‘ ist der Tag der Basis. Denn<br />
hier arbeiten und leben die Fachleute<br />
für ‚ihre‘ Bildungseinrichtung, für<br />
‚ihre‘ Region“, betonten Stange,<br />
Lüddemann und Müller.<br />
Ziel des Tages der Bildung sei, konkrete<br />
Veränderungen vor Ort zu initiieren<br />
und die Rahmenbedingungen<br />
für Lehr- und Lernprozesse zu<br />
verbessern. „Qualität von Bildung<br />
und gute Arbeitsbedingungen der<br />
Lehrenden sind zwei Seiten einer<br />
Medaille“, unterstrichen die<br />
Bündnissprecher. Sie verlangten<br />
eine bessere materielle und personelle<br />
Ausstattung des Bildungsbereiches.<br />
„Pädagogen,<br />
Lernende und Eltern sind bereit,<br />
ihren Beitrag dafür zu leisten,<br />
dass Deutschland von der Bildungs-Regionalliga<br />
in die Bundesliga<br />
aufsteigt. Jetzt sind Politik<br />
und Wirtschaft gefordert, ihren<br />
Sonntagsreden Taten folgen<br />
zu lassen - und Bildung nicht<br />
länger als Steinbruch zur Sanierung<br />
der leeren Kassen in Bund<br />
und Ländern zu missbrauchen“,<br />
sagten Stange, Lüddemann und<br />
Müller. „Wir laden die Öffentlichkeit,<br />
die Wirtschaft, die<br />
Kommunalvertreter herzlich<br />
ein, sich am ‚Tag der Bildung‘<br />
ein realistisches Bild von unseren<br />
Bildungseinrichtungen zu<br />
machen.“<br />
gew-pm<br />
dem Motto „Bildung von Anfang an“<br />
um PISA und die Folgen für die Kindertagesstätten.<br />
Ganztägig beschäftigt sich der „LiA-<br />
Tag“ in Kaiserslautern, der sich an<br />
LehrerInnen in Ausbildung richtet,<br />
mit „modernem Unterricht praktisch“.<br />
Das Thema wird in einem Referat,<br />
zahlreichen Arbeitsgruppen und<br />
einer Talk-Runde beleuchtet.<br />
Genaueres zu den Veranstaltungen ist<br />
den <strong>GEW</strong>-Aushängen in den Bildungseinrichtungen<br />
sowie der nächsten<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> zu entnehmen.<br />
gh<br />
4 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
Macht der Gewerkschaften nicht gebrochen<br />
Kita-Personalräte diskutieren Tarifergebnis im Öffentlichen Dienst<br />
Am Rande zweier Schulungen zum Bundesangestelltentarifvertrag, die die<br />
<strong>GEW</strong> für Personalvertretungen in Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen<br />
der Jugendhilfe durchgeführt hat, wurde auch das Ergebnis der Tarifverhandlungen<br />
für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst diskutiert.<br />
Dabei zeigten sich die ca. 40 Teilnehmerinnen mit dem Ergebnis überwiegend<br />
zufrieden.<br />
Gewerkschaftssekretär<br />
Bernd<br />
Huster vom<br />
<strong>GEW</strong>-Regionalbüro<br />
Nord diskutierte<br />
mit<br />
Beschäftigten<br />
aus dem sozialpädagogischen<br />
Bereich das<br />
Ergebnis der<br />
Tarifrunde.<br />
4,46 % tabellenwirksamerErhöhung<br />
für die<br />
nächsten zwei<br />
Jahre wurden als<br />
gut erachtet,<br />
zumal die Erwartungenwesentlichpessimistischergewesen<br />
waren. Eine<br />
Teilnehmerin<br />
zeigte sich aufgrund<br />
der Gesamtsituation,<br />
in der diese Tarifrunde<br />
stattgefunden hat, erleichtert über<br />
dieses Ergebnis: „Den öffentlichen<br />
Arbeitgebern ist es nicht gelungen,<br />
die Macht der Gewerkschaften zu<br />
brechen.“ Immerhin hatten Innenminister<br />
Schily als Vertreter des Bundes<br />
und seine Arbeitgeberkollegen<br />
aus den Ländern und Kommunen<br />
für diese Tarifrunde eine Nullrunde<br />
und eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit<br />
durchsetzen wollen. Die lange<br />
Laufzeit - der Tarifvertrag läuft bis<br />
zum 31.01.2005 -stört die Kolleginnen<br />
nicht. Antje Rüten-Budde und<br />
Helene Issa, Betriebsratsmitglieder<br />
bei der GeSo, einer privaten Kinderund<br />
Jugendhilfeeinrichtung in Trier,<br />
konnten der langen Laufzeit sogar<br />
Personalräte Ortsgemeinde Wörrstadt. V. r.n.l.: Annette Landsiedel, Anne Röder-Müller,<br />
Bettina Eichholz und Peter Holdenried Foto: Bernd Huster<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
Positives abgewinnen. „Bei Entgeltverhandlungen<br />
mit den Kostenträgern<br />
ist es unserem Arbeitgeber jetzt<br />
möglich, steigende Personalkosten<br />
exakt zu kalkulieren und in die Verhandlungen<br />
mit einzubringen.<br />
Dadurch lassen sich die Erhöhungen<br />
auch für Beschäftigte der GeSo<br />
leichter umsetzen.“ Die GeSo ist<br />
nicht tarifgebunden, die Arbeitsbedingungen<br />
werden über Arbeitsverträge,<br />
teilweise auch über Vereinbarungen<br />
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber<br />
geregelt. Die Erzieherinnen<br />
übten allerdings auch Kritik am<br />
Tarifergebnis. So seien zahlreiche Beschäftigte<br />
darüber enttäuscht, dass<br />
zukünftig ein arbeitsfreier Tag gestrichen<br />
wird. Mit dem Einverständnis<br />
zur Streichung eines arbeitsfreien<br />
Tages hatten die Gewerkschaften<br />
den Arbeitgebern eine „Gegenleistung“<br />
zur Tariferhöhung zugestanden.<br />
„Besonders teilzeitbeschäftigte<br />
Kolleginnen haben mehr von einem<br />
freien Tag als von einer Gehaltserhöhung.<br />
Mehr Geld macht sich wegen<br />
der oft hohen steuerlichen Belastung<br />
(Steuerklasse 5) bei diesen<br />
Kolleginnen kaum bemerkbar“, so<br />
die Meinung einer Personalrätin, die<br />
nicht mit voller Stundenzahl beschäftigt<br />
ist. Auch jüngere Kolleginnen,<br />
die erst einenUrlaubsanspruch<br />
von 26<br />
Tagen im Jahr<br />
besäßen, treffe<br />
die Streichung<br />
des arbeitsfreien<br />
Tages hart.<br />
Diese müssten<br />
ihren Jahresurlaub<br />
fast kom-<br />
plett in den<br />
Schließungszeiten<br />
der Einrich-<br />
Tarifpolitik<br />
tungen nehmen, es stünden dann<br />
keine Tage mehr für individuelle Planungen<br />
zur Verfügung. Kritisiert<br />
wurde von den Teilnehmerinnen<br />
darüber hinaus, dass die sozialen<br />
Komponenten des Tarifergebnisses<br />
(Festbeträge bzw. verzögerte Umsetzung<br />
für höhere Vergütungsgruppen)<br />
zu kurz griffen. „Die Beträge<br />
zwischen den Vergütungsgruppen<br />
gehen immer weiter auseinander,<br />
wenn soziale Komponenten zu gering<br />
ausfallen,“ argumentierte Norbert<br />
Wagner, Betriebsrat bei der Lebenshilfe<br />
in Idar-Oberstein. Im<br />
Rückblick auf die Tarifauseinandersetzung<br />
waren sich die Teilnehmerinnen<br />
einig, dass die Beschäftigten<br />
des öffentlichen Dienstes auch zukünftig<br />
nicht von Lohn- und Einkommensentwicklungen<br />
in anderen<br />
Branchen abkoppelt werden dürften.<br />
Die Arbeitnehmer müssten<br />
schließlich weiterhin qualifizierte<br />
Arbeit leisten und seien nicht dafür<br />
verantwortlich, wenn es leere öffentliche<br />
Kassen gäbe. Die rheinlandpfälzischen<br />
Erzieherinnen, die sich<br />
an den Warnstreiks beteiligt hatten,<br />
wurden von den anderen Kolleginnen<br />
für ihren Einsatz und ihren Mut<br />
sehr gelobt. Die Warnstreikenden, so<br />
Erni Schaaf-Peitz und Claudia Justen<br />
aus einer Kindertagesstätte der<br />
Stadt Wittlich, berichteten, dass sie<br />
mit ihren Aktionen auf großes Verständnis<br />
bei den Eltern gestoßen seien.<br />
Alle Teilnehmer der Schulungen<br />
waren sich einig, dass das tarifpolitische<br />
Engagement der Erzieherinnen<br />
zukünftig ausgeweitet werden<br />
soll.<br />
Bernd Huster<br />
5
Schulen<br />
Zufriedenstellende Ergebnisse<br />
Erste Verhandlungsrunde <strong>GEW</strong> / Ministerium zu neuen Ganztagsschulen<br />
Die Bewertung der seit diesem<br />
Schuljahr laufenden „Ganztagsschule<br />
in neuer Form“ in <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> hat zwischen Ministerium und<br />
<strong>GEW</strong> sowie auch innerhalb der<br />
<strong>GEW</strong> zu kontroversen Debatten<br />
geführt. Auf einer Landesvorstandssitzung<br />
Ende Oktober 2002 wurde<br />
eine Kommission eingesetzt, die den<br />
Auftrag erhielt, mit dem Ministerium<br />
über aus <strong>GEW</strong>-Sicht bestehende<br />
Mängel zu verhandeln. Von der<br />
ersten Verhandlungsrunde berichtet<br />
Tilman Boehlkau.<br />
„Am 12. Februar 2003 trafen sich auf<br />
Einladung von Bildungsministerin<br />
Doris Ahnen die Verhandlungsgruppe<br />
des Landesvorstandes<br />
der<br />
<strong>GEW</strong> (Rosemarie<br />
Kettern,<br />
Heinz Winter,<br />
Klaus-Peter<br />
Hammer, Dieter<br />
Roß und Tilman<br />
Boehlkau)<br />
mit den Verantwortlichen<br />
für<br />
das Ganztagsschulprogramm<br />
des Ministeriums<br />
für Bildung,<br />
Frauen<br />
und Jugend<br />
(Doris Ahnen,<br />
Karl-Heinz<br />
Held, Dieter<br />
Wunder, Johannes<br />
Jung, Bernd<br />
Weirauch und Ottmar Schwinn), um<br />
wesentliche Punkte aus den Landesvorstandsbeschlüssen<br />
vom 29. August<br />
2001 und 23. Oktober 2002 zu<br />
besprechen.<br />
Das Gespräch verlief in einer guten<br />
Atmosphäre, da beide Seiten ein hohes<br />
Interesse daran hatten, für die Beschäftigten<br />
und die SchülerInnen an<br />
den Ganztagsschulen in neuer Form<br />
optimale Arbeitsbedingungen zu erreichen.<br />
Dass dies nicht sofort umzusetzen<br />
ist, zeigte die Umfrage der<br />
<strong>GEW</strong>, deren Ergebnisse ebenso eine<br />
Rolle spielten, wie die POLIS-Studie<br />
des MBFJ zur Ganztagsschule.<br />
Die Ministerin sagte der <strong>GEW</strong> zu,<br />
dass die Ganztagsschule in neuer<br />
Form in das Schulgesetz aufgenommen<br />
wird. Bei notwendigen baulichen<br />
Maßnahmen hilft mit Sicherheit<br />
das von der Bundesregierung mit<br />
den Ländern vereinbarte Investitionsprogramm<br />
für den Ausbau der<br />
Ganztagsschulen, aus dem <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
ca. 198 Millionen EURO<br />
erhalten wird. Die Ministerin sagte<br />
zu, dass diese Mittel, wenn sie denn<br />
fließen, zusätzlich in das rheinlandpfälzische<br />
Ganztagsschulprogramm<br />
aufgenommen und an die Schulträger<br />
verteilt werden.<br />
Neue<br />
Ganztagsschulen<br />
Auch eine weitere - bisher strittige -<br />
Frage wurde angesprochen und eine<br />
erste Lösung gefunden: Die Hauptpersonalräte<br />
werden in Zukunft vor<br />
Abschluss der Rahmenvereinbarungen<br />
und Kooperationsverträge frühzeitig<br />
informiert. Das ist noch nicht<br />
die Mitbestimmung, die die Personalräte<br />
eingefordert haben (das Ministerium<br />
hat juristisch prüfen lassen,<br />
ob die Personalräte überhaupt<br />
zu beteiligen sind und ist zu dem<br />
Schluss gekommen, dass keine Mitbestimmungs-<br />
oder Beteiligungs-<br />
rechte vorliegen), aber ein Schritt zur<br />
vertrauensvollen Zusammenarbeit<br />
zwischen Dienststelle und Personalvertretungen.<br />
Unterschiedliche Auffassungen blieben<br />
allerdings bei der Form der<br />
Ganztagsschule bestehen:<br />
Während die <strong>GEW</strong>-VertreterInnen<br />
der Ganztagsschule in verpflichtender<br />
Form den Vorrang geben, zumal<br />
sich dabei auch personelle, insbesondere<br />
aber räumliche Ressourcen<br />
effizienter nutzen ließen, warb die<br />
Ministerin für die Ganztagsschule in<br />
neuer Form. Den Schulen solle nicht<br />
vorgeschrieben werden, wie sie sich<br />
organisieren (additiv, rhythmisiert<br />
oder Kombination aus beiden), dies<br />
sei ein Schulentwicklungsprozess.<br />
Die<br />
neuen Ganztagsschulenhätten<br />
keine beliebigenpädagogischenAngebote,<br />
sondern seien<br />
durch die<br />
Vorgaben des<br />
Ministeriums<br />
gebunden.<br />
Nach Ansicht<br />
der Ministerin<br />
hätten sich im<br />
Übrigen nicht<br />
so viele Schulen<br />
bereit gefunden,<br />
sich in Ganztagsschulen<br />
in<br />
neuer Form<br />
umzuwandeln, wenn sie die verpflichtende<br />
Form vorgeschrieben<br />
hätte. Dies fand nicht die ungeteilte<br />
Zustimmung der <strong>GEW</strong>-VertreterInnen.<br />
Wie die <strong>GEW</strong> sieht auch das Ministerium<br />
die Notwendigkeit einer verbesserten<br />
Ausstattung der Schulen<br />
mit Verwaltungspersonal. Dies sei<br />
allerdings Angelegenheit der Schulträger.<br />
Die kommunalen Spitzenverbände<br />
wehrten sich gegen Festschreibungen.<br />
Einzelne Schulträger sind<br />
aber bei den neuen Ganztagsschulen<br />
6 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
durchaus bereit, mehr Stunden für<br />
das Verwaltungspersonal zur Verfügung<br />
zu stellen.<br />
Dies ist nach Ansicht der <strong>GEW</strong> noch<br />
keine zufriedenstellende Lösung, hier<br />
sind Standards unerlässlich, denn<br />
nicht alles kann von den Schulleitungen<br />
und den Lehrkräften erwartet<br />
bzw. verlangt werden.<br />
Die <strong>GEW</strong>-VertreterInnen machten<br />
auf das Problem der befristeten Verträge<br />
für Pädagogische Fachkräfte<br />
aufmerksam und forderten das Ministerium<br />
dazu auf, bei den Schulen<br />
darauf hinzuwirken, dass für diesen<br />
Personenkreis unbefristete Verträge<br />
die Regel werden. Der zuständige<br />
Abteilungsleiter im MBFJ, Karl-<br />
Heinz Held, führte dazu aus, dass aus<br />
seiner Sicht natürlich unbefristete<br />
Verträge den Vorrang dort erhalten<br />
sollen, wo die einzelnen Ganztagsangebote<br />
längerfristig eingerichtet<br />
werden, also der Bedarf dauerhaft<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
vorhanden ist. Dort, wo allerdings<br />
noch „probiert“ werde, könne auch<br />
eine Befristung erfolgen. Wer<br />
allerdings die Ganztagsschule in<br />
neuer Form wolle, der müsse auch<br />
Personalsicherung betreiben, und<br />
dies gehe letztlich nur, wenn unbefristete<br />
Verträge angeboten würden.<br />
Nach Auffassung der <strong>GEW</strong> ist das<br />
zusätzliche Personal noch nicht ausreichend<br />
in die Kollegien integriert.<br />
Auch die Teilnahme an Konferenzen<br />
ist nicht einheitlich geregelt. Die<br />
<strong>GEW</strong>-VertreterInnen forderten das<br />
Ministerium auf, dafür Sorge zu tragen,<br />
dass auch das zusätzliche Personal<br />
zu Konferenzen eingeladen<br />
wird und bei der Notengebung Vorschläge<br />
machen kann. Ministerin<br />
Ahnen erklärte, dass für Pädagogische<br />
Fachkräfte die Teilnahme an<br />
Konferenzen geregelt sei, für das<br />
nichtpädagogische Personal gelte<br />
folgende Regelungen: Sie können<br />
Schulen<br />
Qualität nur mit gut ausgebildeten Lehrkräften<br />
Auf seiner ersten Sitzung im neuen<br />
Jahr fasste der <strong>GEW</strong>-Landesvorstandes<br />
den folgenden Beschluss „zur Sicherung<br />
eines anspruchsvollen Vertretungsunterrichtes.“<br />
Mit Beginn des laufenden Schuljahres<br />
hat in allen Schularten der Anteil von<br />
Vertretungsunterricht, der von nicht<br />
oder nur teilweise ausgebildeten Lehrkräften<br />
erteilt werden soll, in erheblichem<br />
Maße zugenommen. Diese Praxis<br />
steht im Widerspruch zum Schulgesetz,<br />
das die Lehramtsbefähigung für die<br />
Lehrkräfte vorschreibt.<br />
Die Misere des Vertretungsunterrichts<br />
durch nur teilweise oder kaum ausgebildete<br />
Vertretungslehrkräfte hat nach<br />
Auffassung der <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Ursachen:<br />
• Die Entwicklung des Mangels an<br />
Fachlehrkräften wurde nicht oder nicht<br />
ausreichend vom Fachministerium beachtet.<br />
• Mittel- und langfristige Bedarfsuntersuchung<br />
in Fächern und Lehrämtern<br />
fehlen.<br />
• Durch die Höchstzahlverordnungen<br />
wurden die Ausbildungsmöglichkeiten<br />
völlig unzureichend bzw. falsch kanalisiert.<br />
• Die Ausbildungskapazitäten der Studienseminare<br />
wurden nicht bedarfsgerecht<br />
genutzt bzw. geschaffen.<br />
• Insbesondere wurde dem negativen<br />
Image des LehrerInnenberufs nicht genügend<br />
entgegengetreten, sodass viele<br />
potenzielle Lehramtsstudierende abgeschreckt<br />
wurden.<br />
• Arbeitsbedingungen und Bezahlung<br />
werden von LehramtsinteressentInnen<br />
negativ eingeschätzt.<br />
Eine stufenbezogene LehrerInnenausbildung<br />
mit verbesserten Arbeitsbedingungen<br />
und einer gut organisierten<br />
Weiterbildung steigert die Attraktivität<br />
des LehrerInnenberufs, schafft mehr<br />
Flexibilität im Einsatz der Lehrkräfte<br />
und ermöglicht eine Unterrichtsversorgung,<br />
die grundlegenden Reformen<br />
unseres Schulsystems nicht im Wege<br />
steht. Die Erhöhung des Praxisanteils<br />
in der LehrerInnenausbildung ist rasch<br />
umzusetzen.<br />
Die vom Bildungsministerium verordnete<br />
Qualitätsentwicklung durch Festlegung<br />
und Evaluation eines Schulprogramms<br />
an jeder Einzelschule kann nur<br />
mit gut ausgebildeten KollegInnen gelingen.<br />
Die <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> lehnt deshalb<br />
die Beschäftigung von nicht oder<br />
zur Konferenz eingeladen werden.<br />
Ministerin Ahnen sagte zu, die neuen<br />
Ganztagsschulen darauf hinzuweisen,<br />
dass das außerschulische Personal<br />
auch Vorschläge zur Notengebung<br />
unterbreiten kann.<br />
Bildungsministerin Doris Ahnen<br />
bedankte sich für das konstruktive<br />
Gespräch und die Anregungen bzw.<br />
Hinweise, die von Seiten der <strong>GEW</strong>-<br />
VertreterInnen unterbreitet wurden.<br />
Der Punktekatalog der <strong>GEW</strong> sei ein<br />
wichtiger Merkposten, um das reibungslose<br />
Gelingen der Ganztagsschulen<br />
in neuer Form zu erreichen.<br />
Die <strong>GEW</strong>-VertreterInnen stellten<br />
fest, dass dieses erste Gespräch nach<br />
einer weiteren Erfahrungszeit mit der<br />
neuen Ganztagsschule einer Neuauflage<br />
bedarf.“<br />
nur teilweise ausgebildeten Lehrkräften<br />
in Vertretungsverträgen ab. Nur<br />
vollständig ausgebildete LehrerInnen<br />
bieten die Gewähr für qualifizierten<br />
Unterricht, wie er von allen gesellschaftlichen<br />
Gruppen eingefordert<br />
wird - insbesondere nach der Veröffentlichung<br />
der PISA-Studie. Unzulänglicher<br />
Vertretungsunterrichts<br />
wird durch die Schaffung einer ausreichenden<br />
Vertretungsreserve mit fest<br />
eingestellten Lehrkräften entscheidend<br />
reduziert.<br />
Seit Schuljahresbeginn ist das „Projekt<br />
Erweiterte Selbstständigkeit von<br />
Schulen“ (PES) auf rund 200 Schulen<br />
des Landes <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> ausgedehnt<br />
worden. In diesen Schulen<br />
können Schulleitungen unter Beteiligung<br />
der Schulpersonalräte Vertretungslehrkräfte<br />
für kurzfristige Vertretungsanlässe<br />
(max. vier Wochen)<br />
vor Ort auswählen und beschäftigen.<br />
Die <strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> fordert<br />
auch hier grundsätzlich den Einsatz<br />
voll ausgebildeter Lehrkräfte für den<br />
Vertretungsunterricht.<br />
gew-lv<br />
7
Schulen<br />
Die zentrale Rolle des Unterrichts im Qualitätsprogramm<br />
Im Gespräch mit Paul Schwarz: Doris Ahnen, Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> engagiert sich finanziell<br />
stark in Sachen pädagogischer<br />
Schulentwicklung. Welche Erwartungen<br />
verbinden Sie mit diesem<br />
Großprogramm?<br />
Nicht erst seit PISA, aber auch durch<br />
PISA steht die Lehr- und Lernkultur<br />
im Mittelpunkt der Überlegungen,<br />
den Unterricht weiter zu entwickeln.<br />
Und hier bin ich überzeugt,<br />
dass auch das Konzept der Pädagogischen<br />
Schulentwicklung (PSE-<br />
Projekt) mit seiner Erweiterung der<br />
Methodenkompetenz bei Schülerinnen<br />
und Schülern, bei Lehrerinnen<br />
und Lehrern einen ganz wichtigen<br />
Beitrag leistet.<br />
Was muss sich am traditionellen Unterricht,<br />
entscheidend verändern,<br />
wenn der Unterricht zukunftsfähig<br />
sein soll? Warum brauchen wir eine<br />
neue Lernkultur bzw. worauf muss<br />
Lernen heute ausgerichtet sein?<br />
Unterricht in der Schule muss darauf<br />
ausgerichtet sein, Wissen zu vermitteln,<br />
aber es geht auch um die<br />
Fähigkeit, dieses Wissen anwenden<br />
und sich neues Wissen immer<br />
wieder, und zwar möglichst lebenslang,<br />
auch selbstständig beschaffen<br />
zu können. Damit erhalten die Lernkompetenz<br />
oder die Methodenbeherrschung<br />
einen ganz besonderen<br />
Stellenwert.<br />
Die Belastung<br />
der Lehrerinnen<br />
und Lehrer<br />
wächst, viele<br />
sind verzagt,<br />
kommen mit<br />
der neuen Schülergeneration<br />
immer weniger<br />
zurecht. Es<br />
kommt in vielen<br />
Kollegien das<br />
Gefühl auf, den<br />
neuen Anforderungen<br />
und Erwartungen<br />
nicht mehr gerecht<br />
werden zu<br />
können. Wie kann angesichts dieser<br />
äußeren und inneren Schulsituation<br />
ein Kollegium noch für Schulentwicklung<br />
gewonnen werden?<br />
Ich nehme gerne und mit Überzeugung<br />
die Lehrkräfte vor solcher Kritik<br />
in Schutz, weil ich den Eindruck<br />
habe, dass viele Lehrpersonen sehr<br />
engagiert an der Weiterentwicklung<br />
von Schule arbeiten. Wir brauchen<br />
motivierte Lehrkräfte, und wir haben<br />
sie. Wir müssen anerkennen,<br />
was geleistet worden ist, gleichzeitig<br />
aber auch sagen, wo es aus unserer<br />
Sicht Weiterentwicklungsbedarf<br />
gibt. Gerade in den letzten Monaten<br />
habe ich den Eindruck gewonnen,<br />
dass Schulentwicklung nicht<br />
nur als Problem verstanden wird,<br />
sondern auch als Chance. Es muss<br />
uns besser als bisher gelingen, Schülerinnen<br />
und Schüler<br />
möglichst individuell zu fördern.<br />
Wir müssen verstärktes Augenmerk<br />
auf das legen, was im Unterricht<br />
stattfindet und was wir mit einem<br />
guten Unterricht erreichen wollen.<br />
Wenn wir die Qualität in Schule<br />
und Unterricht verbessern wollen,<br />
müssen wir dann nicht die Lehrkräfte,<br />
die vor 10, 20 oder 30 Jahren studiert<br />
haben, nachqualifizieren, also<br />
beispielsweise an der Vermittlungskompetenz<br />
ansetzen?<br />
Einerseits müssen wir ganz sicher die<br />
Lehrerausbildung reformieren. Wir<br />
müssen dies auch deshalb tun, weil<br />
die Lehrerausbildung die Standards<br />
für die Lehrerfort- und -weiterbildung<br />
setzt. Wir müssen vor allem<br />
Angebote machen, das didaktische<br />
und methodische Repertoire zu erweitern,<br />
um Schülerinnen und Schüler<br />
zu mehr Eigentätigkeit motivieren<br />
zu können.<br />
Wie viel Hilfe brauchen die Schule<br />
von außen, um Schule und Unterricht<br />
weiter zu entwickeln?<br />
Die Reform muss an der einzelnen<br />
Schule ansetzen und in allen Schularten.<br />
Schulentwicklung findet vor<br />
Ort statt. Schule braucht aber auch<br />
Unterstützung von außen, z.B.<br />
durch die Rahmenbedingungen, die<br />
die Politik setzt, durch pädagogische<br />
Unterstützungssysteme, die pädagogischen<br />
Serviceeinrichtungen und<br />
durch die Schulaufsicht. Sie helfen,<br />
Reformen in Gang zu setzen und zu<br />
beschleunigen, sind aber auch notwendig,<br />
um die Ergebnisse von Reformschritten<br />
zu evaluieren.<br />
Ist die Fortbildung einzelner Lehrkräfte<br />
noch zeitgemäß, muss nicht<br />
mehr als bisher das gesamte Kollegium<br />
in die Fortbildung eingebunden<br />
werden?<br />
Wir brauchen in den einzelnen<br />
Schulen mehr als bisher eine Fortbildungsplanung,<br />
da es eben nicht<br />
nur eine individuelle Entscheidung<br />
sein darf, welche Fortbildung eine<br />
Lehrkraft besucht. Eben dies sieht<br />
unser Qualitätsprogramm auch vor.<br />
Die Schule insgesamt muss sich<br />
darüber verständigen : An welchen<br />
Punkten haben wir als Kollegium<br />
Fortbildungsbedarf? Wir brauchen<br />
sicherlich die „klassische“ Fortbildung,<br />
die aus zentralen und regionalen<br />
Veranstaltungen besteht, an<br />
denen einzelne Kolleginnen und<br />
Kollegen teilnehmen. Wir benötigen<br />
aber auch verstärkt eine schulinterne<br />
Fortbildung, bei der sich ganze<br />
Kollegien - wie auch im PSE-Projekt<br />
- fortbilden. .<br />
8 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
Wir sprechen gern von Basiskompetenzen<br />
oder Schlüsselqualifikationen,<br />
die die Schüler brauchen, welche<br />
brauchen heute Lehrerinnen und<br />
Lehrer?<br />
Eine wichtige Basiskompetenz ist<br />
personaler Art, nämlich die Begeisterung<br />
und Freude für den Beruf,<br />
den Lehrerinnen und Lehrer ausü-<br />
Bücherspalte<br />
Methoden des<br />
lebendigen Lernens<br />
Die von Prof. Dr. Arnold und<br />
Dipl.Päd. Ingeborg Schüßler als<br />
Heft Nr. 1 der Reihe „Pädagogische<br />
Materialien der Universität<br />
Kaiserslautern“ herausgegebene<br />
Broschüre beinhaltet alle im Verlauf<br />
eines handlungsorientierten<br />
Methodenseminars erprobten<br />
Methoden inklusive anschaulicher<br />
Beispiele, Anwendungsfelder und<br />
Einsatzbewertungen. Auch die 3.<br />
Auflage 2002 ist wieder durch die<br />
<strong>GEW</strong> veröffentlicht.<br />
Euro 3,60 zzgl. Porto<br />
BAT/BAT-O<br />
Textfassung mit Erläuterungen<br />
392 Seiten<br />
8.Aufl.2002<br />
Euro 5,60 zzgl. Porto<br />
Beamtenversorgungsrecht<br />
In dieser <strong>GEW</strong>-Broschüre wird die<br />
Berechnung des Ruhegehalts dargestellt.<br />
Grundlage ist das ab 1.<br />
Jan. 1992 geltende Beamtenversorgungsrecht<br />
i.d.F. der Änderungsgesetze<br />
1997, 1998 und<br />
2000.<br />
6. Aufl. 2001, 230 Seiten<br />
Euro 4,00 zzgl. Porto<br />
111 Tipps zu Sozialleistungen<br />
DGB-Broschüre mit Tipps für Erwerbstätige,<br />
Arbeitslose oder allein<br />
Erziehende zu Leistungen wie Arbeitslosengeld,<br />
Wohngeld, Sozialhilfe<br />
u.v.m.<br />
185 Seiten, 2. Aufl. 2002<br />
Euro 4,90 zzgl. Porto<br />
Bestellungen an:<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Neubrunnenstr. 8 · 55116 Mainz<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
ben. Daneben steht das absolut solide<br />
Fachwissen, gepaart mit einem<br />
breiten didaktischen und methodischen<br />
Repertoire. Mehr und mehr<br />
sind daneben zum Beispiel auch<br />
Medienkompetenz und interkulturelle<br />
Kompetenz gefragt.<br />
Auf der einen Seite steht der Anspruch,<br />
es darf kein Unterricht ausfallen,<br />
z.B. in der Vollen Halbtagsschule<br />
als verlässliche Grundschule,<br />
auf der anderen Seite ist es notwendig,<br />
die Lehrkräfte weiter zu qualifizieren.<br />
Denken Sie daran, künftig<br />
die Fortbildung mehr in die unterrichtsfreie<br />
Zeit, z.B. auch in die Ferien,<br />
zu legen? Oder setzen Sie mehr<br />
auf schulinterne Fortbildung an Studientagen<br />
Der Vorteil einer schulinternen Fortbildungsplanung<br />
wäre es, dass eben<br />
auch gezielter für Vertretungsregelungen<br />
in der Schule gesorgt werden<br />
kann. Wir müssen immer wieder den<br />
Ausgleich schaffen zwischen der<br />
Fort- und Weiterbildung für die<br />
Lehrkräfte und dem Recht der Schülerinnen<br />
und Schüler auf Unterricht.<br />
Deshalb arbeiten wir auch daran,<br />
mehr regionale und schulinterne<br />
Fortbildung als bisher anzubieten.<br />
Was die Volle Halbtagsschule angeht,<br />
so haben wir dort Feuerwehrlehrkräfte,<br />
um die zeitweilige Abwesenheit<br />
von Lehrerkräften besser verkraften<br />
zu können. Darüber hinaus bietet<br />
auch das „Projekt Erweiterte Selbstständigkeit<br />
(PES)“ den Schulen mehr<br />
Möglichkeiten, Vertretungsreserven<br />
zu mobilisieren.<br />
Zentraler Punkt Ihres Konzepts zur<br />
„Qualitätsentwicklung an Schulen<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>“ ist die Erarbeitung<br />
eines Qualitätsprogramms an<br />
jeder Schule, also der Bestandsaufnahme,<br />
der Leitbildentwicklung und<br />
der Erfolgskontrolle. Wie zuversichtlich<br />
sind Sie, dass solche Hochglanzpapiere<br />
den Unterricht überhaupt<br />
Klassenfahrten nach Berlin<br />
(incl. Transfer, Unterkunft,<br />
Programmgestaltung nach Absprache).<br />
Broschüre anfordern bei:<br />
Biss, Freiligrathstr. 3, 10967 Berlin,<br />
Tel. (030) 6 93 65 30<br />
erreichen, den Sie ja in Ihrem Konzept<br />
als Kernstück der Qualitätsentwicklung<br />
bezeichnen?<br />
Wir sprechen ganz bewusst von Qualitätsprogramm<br />
und nicht allgemein<br />
von Schulprogramm. Wir haben<br />
Eckpunkte formuliert, auf die ein<br />
solches Qualitätsprogramm Antwort<br />
geben muss, und da spielt der Unterricht<br />
eine zentrale Rolle. Ich bin<br />
sehr optimistisch, dass die Erarbeitung<br />
eines Qualitätsprogramms<br />
zunächst einmal der Ausgangspunkt<br />
für eine Standortbestimmung im<br />
Kollegium ist. Daraus folgt dann<br />
eine allgemeine Zielformulierung<br />
und vor allem das Definieren geeigneter<br />
Maßnahmen, deren Erfolg regelmäßig<br />
überprüft werden muss.<br />
Hier kommt dann auch die Schulaufsicht<br />
ins Spiel, die die Realisierung<br />
dieser Koppelung sicherstellen<br />
soll.<br />
Welches sind gegenwärtig aus Ihrer<br />
Sicht die wichtigsten Aufgaben für<br />
Schule und Unterricht nach PISA<br />
und erwarten Sie wie weiland Roman<br />
Herzog einen gesellschaftlichen Ruck<br />
- nunmehr in Sachen Bildung?<br />
Ich sehe drei wichtige Bereiche, die<br />
alle mit den Defiziten zu tun haben,<br />
die uns PISA aufgezeigt hat. Wir<br />
müssen einmal das Lesevermögen<br />
und die Fähigkeit zur Umsetzung<br />
beziehungsweise Anwendung gelesener<br />
Inhalte verbessern. Dann müssen<br />
wir auch das mathematisch-naturwissenschaftliche<br />
Verständnis vertiefen.<br />
Genauso wichtig ist es aber<br />
auch, dass keine neuen sozialen Ungleichheiten<br />
entstehen und wir die<br />
bestehenden Ungleichheiten abbauen.<br />
Und schließlich brauchen wir<br />
bessere Angebote für die Schülerinnen<br />
und Schüler mit Migrationshintergrund.<br />
Psychotherapeutische Praxis<br />
Dipl.-Psychologe H. von Vangerow<br />
• Beihilfeberechtigte<br />
c/o Euteneuer, Kurfürstemstr. 87a<br />
56068 Koblenz T: 0178 / 392 71 36<br />
Schulen<br />
9
Schulen<br />
Qualitätsverlust durch Abbau von Beratungsstellen<br />
<strong>GEW</strong>, Grüne und LEB gegen Reform des schulpsychologischen Dienstes<br />
Die <strong>GEW</strong> kritisiert die Reform des schulpsychologischen Dienstes. „Die<br />
Zusammenlegung der 31 Beratungsstellen zu elf Servicezentren wird längere<br />
Fahrzeiten zu den Beratungsgesprächen zur Folge haben,“ sagte <strong>GEW</strong>-<br />
Geschäftsführer Udo Küssner. Nach der Umsetzung der neuen Organisation<br />
gebe es bis zu 100 Kilometer lange Anfahrtswege zu den Servicezentren.<br />
Gerade in ländlichen Gebieten würden damit der Erreichbarkeit<br />
der Beratung hohe Hürden gesetzt, die viele Eltern davon abhalten könnten,<br />
den Dienst in Anspruch zu nehmen.<br />
„Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen kann unter der umfangreichen<br />
Auflösung dezentraler Beratungsstellen leiden“, meinte der <strong>GEW</strong>-<br />
Geschäftsführer. Die Schulpsychologen könnten voraussichtlich weniger<br />
individuelle Beratung erteilen und müssten ihre Aufgabenschwerpunkte<br />
verlagern, da wesentlich längere Fahrzeiten zu den Schulen ihre Arbeitskapazitäten<br />
zeitlich eingrenzen werden.<br />
Die <strong>GEW</strong> hält einen qualitativen Synergieeffekt, wie es das Ministerium<br />
sieht, für mehr als fragwürdig und verweist auf die bekannten Qualitätsverluste,<br />
die sich vor allen im Bereich der Schulen im Zusammenhang mit<br />
der Auflösung der Bezirksregierungen ergeben haben. Die <strong>GEW</strong> fordert<br />
daher das Ministerium auf, den Umfang der Zusammenlegungen der Beratungsstellen<br />
gemeinsam mit allen betroffenen gesellschaftlichen Gruppierungen<br />
noch einmal sorgfältig zu überprüfen und keine voreiligen Entscheidungen<br />
zu treffen, die später wieder heftige Reaktionen Betroffener<br />
und breite Unzufriedenheit mit einer „Reform“ hervorrufen.<br />
Kritisiert wird die geplante Reduzierung der Standorte auch von Nils<br />
Wiechmann, bildungspolitischer Sprecher von Bündnis 90/DIE GRÜ-<br />
NEN im Landtag.: „Der schulpsychologische Dienst hat die Aufgabe, Schulen,<br />
Schüler, Eltern und Lehrer vor Ort zu beraten. Um wirksam arbeiten<br />
zu können, brauchen die schulpsychologischen Beratungsstellen die Nähe<br />
zu den Schulen, Eltern und Kindern. Nicht der Rückzug aus der Fläche,<br />
sondern der wohnortnahe Ausbau der bisher bestehenden Schulpsychologischen<br />
Beratungsstellen ist das Gebot der Stunde“<br />
Auch der Landeselternbeirat kann in keiner Weise nachvollziehen, dass in<br />
einer Zeit, in der die Anforderungen an den Fachbereich Schulpsychologischer<br />
Dienst im IFB gestiegen sind, seine Ressourcen verringert werden.<br />
„Nach den enttäuschenden deutschen Ergebnissen in der PISA-Studie sollen<br />
die SchulpsychologInnen einen größeren Beitrag zur Qualitätsentwicklung<br />
in den Schulen leisten und dazu beitragen, dass die Bereiche individuelle<br />
Förderung, Diagnose von Lern- und Leistungsschwächen, Qualität<br />
der Lehr- und Lernprozesse sowie Sucht- und Drogenprävention an Schulen<br />
signifikant weiterentwickelt werden. Seit den tragischen Ereignissen<br />
in Erfurt sollen die SchulpsychologInnen in stärkerem Maß als bisher bei<br />
drohendem Schulausschluss und bei gefährdetem Schulabschluss Krisenintervention<br />
leisten“, so die Elternvertreter in einer Presseerklärung.<br />
Gerade die Einzelfallhilfe sei für die Eltern unverzichtbarer Bestandteil<br />
des Schulpsychologischen Dienstes. Während man international eine SchulpsychologInnen-SchülerInnen-Relation<br />
von 1:5.000 für angemessen hält,<br />
liege diese Relation in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> nur bei 1:15.000, weit unter internationalem<br />
Durchschnitt. Die Zahl der SchulpsychologInnen müsse verdreifacht<br />
werden, um eine wünschenswerte Relation zu sichern. Schon bei<br />
der jetzigen Ausstattung müssten Rat suchende Eltern lange Wartezeiten<br />
in Kauf nehmen. Von der Anmeldung bis zum ersten Beratungstermin<br />
vergingen oft mehrere Wochen, manchmal Monate, obwohl das Problem<br />
schon auf den Nägeln brenne.<br />
pm<br />
„Das ist eine maßgebliche Verschlechterung“<br />
Rheinpfalz-Interview mit dem Schulpsychologen-Vorsitzenden von Gleichenstein<br />
Ministerin Ahnen sagt, in größeren Teams könne der schulpsychologische<br />
Dienst seine Aufgaben besser bewältigen; Ein-Personen-Dienststellen,<br />
wie es sie derzeit überwiegend gibt, würden den Anforderungen<br />
nicht gerecht. Ist der Beratungsdienst reformreif?<br />
Das muss man differenzierter sehen. Aufgabenfelder, die mit der Lehrerfortbildung<br />
oder der Beratung des gesamten Schulsystems zusammenhängen,<br />
sind sicher in einem Team leichter zu bewältigen, weil hier Arbeitsteilung<br />
möglich ist. Ganz anders sieht es bei der Beratung von Eltern,<br />
Schülern und Lehrern in Einzelproblemfällen aus. Da ist kein Team und<br />
keine Arbeitsteilung erforderlich, hier ist jeder einzelne Schulpsychologe in<br />
seinem Bereich selbst zuständig. Daher wird dieses Beratungsangebot mit<br />
der Umorganisation vor allem in den Flächenkreisen, die wir in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
haben, wesentlich schlechter werden, weil die Entfernungen<br />
größer werden.<br />
Schlechter heißt: Es wird weniger Beratungen geben?<br />
Die zusätzlichen Fahrtzeiten werden natürlich auf Kosten der Arbeitszeit<br />
für Beratungen gehen. Unsere Arbeit findet sehr viel an den Schulen statt.<br />
Und wenn ich 60 bis 70 Kilometer allein bis zur Schule fahren muss,<br />
dann ist das schon einmal über eine Stunde Fahrtzeit hin und eine zurück.<br />
Dadurch wird Arbeitszeit gebunden. Das ist eine maßgebliche Verschlechterung.<br />
In welcher Größenordnung? Können Sie dazu Zahlen nennen?<br />
Für einen der großen neuen Beratungsbereiche haben wir das einmal durchgerechnet:<br />
Da fallen 8600 Kilometer zusätzlich an. Zeitmäßig sind das<br />
rund 80 Stunden, also zwei Wochen nur auf der Straße, von den Fahrt-<br />
kosten gar nicht zu reden. Und das ist nur für ein Beratungszentrum<br />
gerechnet. Da kommen für das ganze Land horrende Summen zusammen.<br />
Dazu entsteht eine Hemmschwelle für die Eltern und Schüler, die<br />
zu uns kommen wollen. Schon jetzt erleben wir in etlichen Fällen, dass es<br />
heißt, das ist uns zu weit, wir haben kein Auto und mit öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
ist das nicht machbar.<br />
Nach den schrecklichen Ereignissen in Erfurt hieß es im Mainzer<br />
Bildungsministerium, es gebe kein fertiges Konzept für eine Reform<br />
des schulpsychologischen Dienstes, deshalb gebe es auch nichts, was<br />
aufgrund von Erfurt zurückgenommen werden müsse. Kommt die<br />
Reform jetzt nicht genau so, wie sie sich damals abzeichnete?<br />
Ja. Damit wird man den Konsequenzen, die aus Erfurt aber auch aus der<br />
Pisa-Studie zu ziehen sind, nicht gerecht. Der direkten Beratung der Schulen<br />
vor Ort wird bei den weiten Entfernungen Grenzen gesetzt.<br />
Das soll aber mit einer effizienten Teamarbeit wettgemacht werden.<br />
Die Annahme, dass die Beratung durch die Bündelung effizienter oder<br />
besser abgedeckt wird, ist ja insofern ein Märchen, als die Schulpsychologen<br />
dann zwar zu mehreren an einer Stelle sitzen, aber für ein dreimal so<br />
großes Gebiet zuständig sind. Das ist nicht effizienter, es ist bisher eine<br />
Mangelverwaltung und es wird mit der neuen Organisation eine Mangelverwaltung<br />
sein. Die Ein-Personen-Dienststellen sind ja entstanden, weil<br />
der Ausbau des schulpsychologischen Dienstes 1978/79 gestoppt wurde.<br />
Ursprünglich war geplant gewesen, jede Dienststelle mit mindestens zwei<br />
Psychologen zu besetzen.<br />
ros<br />
10 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
Seiteneinstieg ins Lehramt<br />
An den Studienseminaren bereiten<br />
sich, wie aus der statistischen Übersicht<br />
des Statistischen Landesamtes<br />
(Stand 01.10.2002) zu ersehen ist,<br />
63 SeiteneinsteigerInnen (33%<br />
weiblich) auf das Lehramt vor. Die<br />
nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung<br />
auf die Lehrämter.<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
Mit drei Viertel ihrer Arbeitszeit<br />
unterrichten sie in der Schule und<br />
das restliche Viertel verwenden sie<br />
für eine berufsbegleitende Qualifizierung<br />
an den Studienseminaren.<br />
Nach erfolgreich abgelegter Prüfung<br />
werden sie weiter beschäftigt, als reguläre<br />
Lehrkraft anerkannt und kön-<br />
Ausbildung für das Lehramt an männlich weiblich insgesamt<br />
Grund- und Hauptschulen 5 6 11<br />
Realschulen 16 11 27<br />
Gymnasien 9 2 11<br />
berufsbildenden Schulen 12 2 14<br />
Seit dem Schuljahr 2001/02 werden<br />
Akademiker, die keine bzw. noch<br />
nicht abgeschlossene Lehrerausbildung<br />
haben, in Bedarfsfächern befristet<br />
in Vollzeitbeschäftigung im<br />
Angestelltenverhältnis in den Schuldienst<br />
des Landes aufgenommen.<br />
nen ins Beamtenverhältnis übernommen<br />
werden.<br />
Die SeiteneinsteigerInnen werden in<br />
Musik (21), Mathematik (14), Englisch<br />
(11), Deutsch (11), Informatik<br />
(8), Metalltechnik (7), Physik<br />
(6), Bildende Kunst (5), Physik/<br />
Schulen<br />
Chemie (4), Französisch (3), Chemie<br />
(2) und jeweils eine Person in Betriebswirtschaft,<br />
Drucktechnik,<br />
Elektrotechnik, Gesundheit, Informationstechnik,<br />
Sozialkunde, Wirtschaftskunde<br />
und Wirtschaftslehre<br />
ausgebildet.<br />
26 SeiteneinsteigerInnen lernen am<br />
Seminarort Trier, 12 in Koblenz, 11<br />
in Speyer, 8 in Kaiserslautern und 2<br />
in Mainz. An den Seminarorten<br />
Neuwied, Bad Kreuznach, Simmern<br />
und Westerburg lernt jeweils ein/e<br />
SeiteneinsteigerIn.<br />
SeiteneinsteigerInnen werden nach<br />
Abschluss der regulären Einstellungsrunde<br />
an den Schulen befristet eingestellt,<br />
an denen der bestimmte<br />
Fachbedarf nicht anders gedeckt werden<br />
kann.<br />
Wer detailliertere Informationen zu<br />
dem Seiteneinsteigerprogramm<br />
wünscht, wendet sich schriftlich an<br />
die <strong>GEW</strong>-Landesrechtsschutzstelle in<br />
Mainz.<br />
d.r<br />
11
Schulen<br />
Lehrpersonal an den Studienseminaren<br />
Je niedriger der Status, desto höher der Frauenanteil<br />
Tabelle 1:<br />
Ausbildung für das Lehramt an LeiterInnen Stellvertretung FachleiterInnen Lehrbeauftragte<br />
Grund- und Hauptschulen 8 6 149 67<br />
Sonderschulen 2 2 26 23<br />
Realschulen 3 3 53 23<br />
Gymnasien 6 6 114 13<br />
berufsbildenden Schulen 4 4 64 35<br />
Insgesamt 23 21 406 161<br />
611 Personen ( Stand: Oktober 2002)<br />
lehren an den rheinland-pfälzischen<br />
Studienseminaren und bereiten LehramtsanwärterInnen<br />
und ReferendarInnen<br />
auf die Zweite Staatsprüfung<br />
für das jeweilige Lehramt vor.<br />
Sie gliedern sich nach Aufgabe bzw.<br />
Status wie in der o.a. Tabelle auf.<br />
Im Leitungsbereich sind die Frauen<br />
mit einem Anteil von 23% noch<br />
deutlich unterrepräsentiert. Bei den<br />
FachleiterInnen liegt der Frauenan-<br />
Wieder Run auf Gesamtschulen<br />
Wettrennen um<br />
IGS-Plätze<br />
Der Trend der vorausgegangenen Jahre<br />
hielt auch bei der diesjährigen Anmelderunde<br />
an den Integrierten Gesamtschulen<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> an: Wesentlich<br />
mehr Anmeldungen lagen vor als<br />
bei den Aufnahmeentscheidungen berücksichtigt<br />
werden konnten: Landesweit<br />
konnte jede dritte Bewerbung nicht<br />
berücksichtigt werden.<br />
Für die Gemeinnützige Gesellschaft<br />
Gesamtschule ist dies ein deutlicher Beweis,<br />
dass sich Gesamtschulen mit ihrem<br />
Angebot bewährt und in der öffentlichen<br />
Meinung durchgesetzt haben.<br />
„Eltern erkennen und schätzen die<br />
Möglichkeiten und Chancen der<br />
Durchlässigkeit und individuellen Förderung<br />
für Schülerinnen und Schüler<br />
in diesem System“, erläuterte Franz-Jo-<br />
sef Bronder, Vorstandssprecher der<br />
GGG in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>, vor der Presse.<br />
Der Gesamtschulverband hält durch<br />
diese Anmeldezahlen die Errichtung<br />
weiterer Integrierter Gesamtschulen für<br />
dringend erforderlich. Das im Schulgesetz<br />
des Landes garantierte Recht auf<br />
freie Schulwahl könne durch Schulträger<br />
und Bildungsbehörde zurzeit nicht<br />
ausreichend gewährleistet werden. Als<br />
besonders auffällig wertet der Verband,<br />
dass in Stadtregionen mit IGS-Angebot<br />
besonders hohe Anmeldequoten verzeichnet<br />
wurden: Kaiserslautern mit<br />
vier Gesamtschulen liegt im Landesdurchschnitt,<br />
die Landeshauptstadt<br />
muss jeden zweiten Bewerber an eine<br />
andere Schule verweisen und in der<br />
teil bei 35%, bei den Lehrbeauftragten<br />
hingegen bei 51%.<br />
Oder anders formuliert: Je niedriger<br />
der Status, desto höher ist der Frauenanteil.<br />
Der Anteil der Nebenamtlichkeit bei<br />
dem lehrenden Personal ist lehramtsbezogen<br />
sehr unterschiedlich:<br />
Der Wissenschaftsminister hat hier<br />
noch eine erhebliche Aufgaben zu<br />
bewältigen, um die Benachteiligungen<br />
zu beseitigen.<br />
d.r<br />
Region Ludwigshafen kann sogar nur<br />
einer von drei Bewerbern berücksichtigt<br />
werden. Unabhängig davon könnten<br />
Eltern in bestimmten Regionen wie<br />
beispielsweise Trier überhaupt nicht auf<br />
dieses Angebot zugreifen, da hier keine<br />
Integrierten Gesamtschulen vorhanden<br />
sind.<br />
„Die Schulträger und die Landesregierung<br />
sind hier gefordert, das entsprechende<br />
Angebot für Eltern sowie Schülerinnen<br />
und Schüler bereit zu stellen“,<br />
fordert der Sprecher der GGG. Aus<br />
Sicht des Gesamtschulverbandes wäre<br />
dies möglich, wenn Schulträger die<br />
Umwidmung bestehender Schulen vorantrieben,<br />
die Schulträgerschaft für<br />
Integrierte Gesamtschulen überdacht<br />
und durch die Landespolitik eine gezielte<br />
Förderung bei der Errichtung<br />
praktiziert würde.<br />
ggg<br />
Arme Kinder abgehängt<br />
12 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
Horte wichtiger als Betreuungsangebote<br />
Studie über Situation armer Kinder im Grundschulalter<br />
Grundschule belastet Kinder aus armen<br />
Familien und verschärft die soziale<br />
Chancenungleichheit. Dies ist<br />
die Kernbotschaft eines im Auftrag<br />
der AWO vom Institut für Sozialarbeit<br />
und Sozialpädagogik in<br />
Frankfurt (ISS) erstellten Studie<br />
über „Armut im Grundschulalter“,<br />
die Anfang des Jahres veröffentlicht<br />
wurde. Die Studie belegt Erkenntnisse,<br />
die zwar engagierten PädagogInnen<br />
vertraut sind, aber bis heute<br />
von der Politik ausgeblendet werden.<br />
Zur institutionellen Benachteiligung<br />
der armen Kinder: Die Studie verweist<br />
darauf, dass mit Beginn der Schulpflicht<br />
die Grundschule eine dominante<br />
Rolle im Leben der Grundschulkinder<br />
übernimmt. Im Gegensatz zu den<br />
nicht-armen Kindern erleben arme,<br />
mehrfach belastete Kinder den Anspruch<br />
und Bildungsauftrag der Schule<br />
eher negativ. Ihre Familien können<br />
sie nicht angemessen unterstützen, da<br />
die kulturellen und sozialen Ressourcen<br />
fehlen. Das gilt in hohem Maße<br />
für arme Kinder mit Migrationshintergrund.<br />
Durch die Beschränkung auf ihr<br />
Wohnumfeld sowie die elterliche Wohnung<br />
fehlen armen Kindern im<br />
Grundschulalter auch Anregungen und<br />
Erfahrungen, die für nicht-arme Kinder<br />
selbstverständlich sind. Sie besuchen<br />
deutlich seltener Vereine, feiern<br />
nur in Ausnahmefällen ihren Geburtstag<br />
mit anderen Kindern und fahren<br />
in der Regel nicht in Urlaub.<br />
Mit wachsenden Schulschwierigkeiten<br />
entwickeln arme Kinder ein problemmeidendes<br />
Bewältigungsverhalten, dem<br />
negative Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung,<br />
die Gesundheit und<br />
die Widerstandskraft gegen Belastungen<br />
und Stressoren zugesprochen werden.<br />
Sie entwickeln auch größere Verhaltensauffälligkeiten.<br />
Als dauernde<br />
Überforderung wird die Grundschule<br />
für arme Kinder und deren Familien<br />
zu einer Belastung für das Leben in<br />
der Familie insgesamt. Sie beeinflusst<br />
aber auch außerschulische Aktivitäten<br />
negativ, weil sie arme Kinder mit<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
Schulschwierigkeiten durch die Zuweisung<br />
zu Sonderschulen sozial segregiert.<br />
In dieser Situation erweist sich nach<br />
den Erkenntnissen der Studie derzeit<br />
der Hort als das zentrale außerschulische<br />
Angebot für arme und belastete<br />
Kinder. Die Studie bestätigt ihn in seiner<br />
Auffang- und Ersatzfunktion für<br />
ein problematisches Elternhaus und die<br />
fehlenden Angebote anderer Institutionen.<br />
Er ist als Lebensraum mit seiner<br />
sozialintegrativen Funktion mehr als<br />
Betreuung, Hausaufgabenhilfe und<br />
Spielangebot.<br />
Die Studie belegt ein krasses Defizit an<br />
vernetzten kind-, eltern- und familienbezogenen<br />
Angeboten und Hilfen<br />
während der bildungs- und lebensbiografisch<br />
entscheidenden Grundschulzeit,<br />
in der die Weichen für weitere<br />
Lernprozesse gestellt werden. Kinder -<br />
und Jugendhilfe sind strukturell nicht<br />
vernetzt, allenfalls bestehen zufalls- und<br />
einzelfallbezogenen Verknüpfungen.<br />
Betreuungsangebote sind<br />
keine Lösung<br />
Vor diesem Hintergrund müssen<br />
Grundschule, Kinder- und Jugendhilfe<br />
neu gedacht werden. Ziel einer vernetzen<br />
Arbeit von Schule, Kinder-, Jugend-<br />
und Familienhilfe muss ein doppeltes<br />
sein: umfassende individuelle<br />
Unterstützung und Förderung der armen<br />
Kinder sowie die Stärkung der Erziehungskompetenzen<br />
ihrer Eltern.<br />
Da die Bundesregierung die Abrufung<br />
der Mittel für die Einrichtung von<br />
Ganztagsschulen nicht an einzuhaltende<br />
Qualitätsstandards bindet, steht zu<br />
erwarten, dass in den Ländern jedwede<br />
Konstruktion erweiterter Angebote<br />
als Ganztagsschule deklariert wird. Die<br />
Konzeption der „offenen Ganztagsgrundschule“,<br />
wie sie in NRW beispielsweise<br />
für das nächste Schuljahr anvisiert<br />
wird, kann die kompensatorischen<br />
pädagogischen Aufgaben mit einem<br />
lediglich angehängten betreuten Nachmittagsbereich<br />
nicht annähernd erfüllen.<br />
Aufgrund ihrer Konstruktionsmängel<br />
kann sie Kindern und Eltern in Ar-<br />
Bildungspolitik<br />
mutssituationen keine nachhaltige Entlastung<br />
und Unterstützung in ihren<br />
belasteten Lebenslagen bringen: Bildung<br />
und Erziehung der betroffenen Kinder<br />
kommen aber auch weiterhin in der<br />
Schule zu kurz. Für die Lernprozesse<br />
im Unterricht gilt wie bisher, dass den<br />
LehrerInnen ein viel zu enger Zeitrahmen<br />
zur Verfügung steht. Nur bildungsnahe<br />
Elternhäuser können diesen Mangel<br />
kompensieren.<br />
Wegen der fehlenden personellen und<br />
konzeptionellen Verzahnung von Vorund<br />
Nachmittagsbereich, von Schule,<br />
Kinder-/Jugendhilfe und sonstigen Akteuren<br />
mangelt es auch an einem einheitlichen<br />
und verbindlich geltenden<br />
Bildungs- und Erziehungskonzept.<br />
Durch den Wechsel der betreuenden<br />
Personen sind vielmehr Brüche, Widersprüche<br />
und Diskrepanzen in der Erziehungsarbeit<br />
zu befürchten.<br />
Die Erfahrung verlässlicher sozialer<br />
Beziehungen ist für Kinder in Armutssituationen<br />
besonders wichtig. Durch<br />
einen häufigen Personalwechsel mit<br />
unterschiedlichem (mögli-cherweise<br />
auch gar keinem) pädagogischen Qualifikationsprofil<br />
ist diese Erfahrung nur<br />
schwer herstellbar.<br />
Arme Kinder brauchen ein reichhaltiges<br />
und hochwertiges kulturelles Angebot<br />
in der Schule, um den häuslichen<br />
Mangel zu kompensieren. Dies ist nicht<br />
sichergestellt, wenn hochwertige Angebote<br />
zusätzlich eingekauft und von Eltern<br />
bezahlt werden müssen.<br />
An benachteiligten Schulstandorten<br />
kann die Mitarbeit von Eltern nicht<br />
vorausgesetzt werden, sie muss erst aufgebaut<br />
werden durch die Stärkung der<br />
elterlichen Kompetenzen. Dafür gibt es<br />
aber keine Strukturen in der offenen<br />
Ganztagsgrundschule.<br />
Was arme Kinder brauchen, ist eine echte<br />
Ganztagsgrundschule mit pädagogischem<br />
Profil, die sich an qualitativen<br />
Standards für integrative Angebote von<br />
Erziehung, Bildung und Betreuung orientiert<br />
und überall da angeboten wird,<br />
wo sie gebraucht wird. Ohne die Erfüllung<br />
dieser Standards verbietet sich das<br />
Plattmachen der Horte zugunsten der<br />
Ganztagsgrundschule, wie es z. B. die<br />
Landesregierung in NRW in ihrem Erlass<br />
vorgibt.<br />
Brigitte Schuman, ifenici@aol.com<br />
13
Weiterbildung<br />
Offenes Ohr der <strong>GEW</strong><br />
Hotline für Honorarkräfte<br />
Honorarkräfte:<br />
Viel Arbeit,<br />
wenig Lohn,<br />
keine soziale<br />
Absicherung<br />
Gut genutzt<br />
wurde bisher<br />
die <strong>GEW</strong>-Hotline<br />
für Honorarkräfte<br />
und<br />
FreiberuflerInnen<br />
aus der<br />
Weiterbildung<br />
seit ihrer Freischaltung<br />
im<br />
Januar 2001.<br />
Fast 5.000 Anrufe<br />
haben bislang den kostenlosen<br />
Beratungsservice in Anspruch genommen,<br />
der Anonymität streng<br />
gewahrt hat.<br />
Obwohl die Frist der Befreiungsanträge<br />
zur Rentenversicherungspflicht<br />
für ältere Honorarkräfte abgelaufen<br />
und die Flut der Anrufe danach<br />
merklich zurück gegangen ist, gehen<br />
noch regelmäßig mehr als 80 Beratungsanfragen<br />
pro Monat ein.<br />
Aus den positiven Erfahrungen der<br />
Durch die Vermittlung eines Kollegen<br />
wurde den selbstständigen Lehrkräften<br />
der VHS Mainz ein Gespräch über die<br />
Situation der Honorarkräfte mit dem<br />
Justizminister Mertin (FDP) angeboten.<br />
Irene Ahl übernahm als Fachbereichsleiterin<br />
für Deutsch die Aufgabe,<br />
für ihre Kolleginnen und Kollegen zu<br />
sprechen.<br />
Der erste Eindruck, die Gesprächspartner<br />
würden den Minister nur langweilen,<br />
änderte sich zum Glück recht<br />
schnell. Nachdem der Minister überzeugt<br />
wurde, dass es uns nicht um individuelle<br />
Probleme gehen sollte, entstand<br />
ein lebhaftes, engagiertes Gespräch<br />
über die Situation der selbständigen<br />
Lehrkräfte und mögliche Lösungen.<br />
Seine anfängliche „Belehrung“ darüber,<br />
dass Selbstständige eben ihre Arbeit<br />
wechseln müssten, wenn sie nicht genug<br />
verdienten, konnte rasch widerlegt werden:<br />
Die Weiterbildung würde zusammenbrechen,<br />
wenn ein großer Teil der<br />
Lehrkräfte abwandern würde. Anliegen<br />
war es, dem Minister zu verdeutli-<br />
zweijährigen Projektphase des Beratungsservices<br />
wird die <strong>GEW</strong> jetzt<br />
ihre Konsequenzen ziehen und die<br />
Erreichbarkeit der Hotline erweitern<br />
durch eine bundesweite Freischaltung<br />
und erweiterte Beratungszeiten.<br />
Peu à peu ändern sich auch die Beratungsinhalte<br />
erkennbar. War bisher<br />
das Spektrum fokussiert auf Probleme<br />
im Zusammenhang mit der Rentenversicherungspflicht<br />
sowie auf<br />
Fragen der Sozialversicherung,<br />
insbesondere der Krankenversicherung,<br />
kommen jetzt viele weitergehende<br />
Fragen ins Gespräch: Fragen<br />
der Honorarerhöhung und der Verbesserung<br />
und Sicherung ungeschützter,<br />
prekärerer Beschäftigung<br />
sowie der Gestaltung einer selbstständigen<br />
Existenz und Mitbestimmung.<br />
Die Beraterin am Telefon ist eine<br />
Fachkraft der <strong>GEW</strong>, die über umfangreiche<br />
arbeits- und sozialrechtliche<br />
Kompetenzen verfügt und den<br />
Status der freien Mitarbeiterin in der<br />
Weiterbildung aus eigener Erfahrung<br />
kennt. Neben den Einzelberatungen<br />
werden auf Anfrage auch Experten<br />
benannt, die auf Mitarbeiterver-<br />
sammlung, an Volkshochschulen<br />
und anderen interessierten Weiterbildungseinrichtungen<br />
referieren. Noch<br />
unregelmäßig werden zur Zeit in einigen<br />
Bundesländern Informationsseminare<br />
angeboten, in denen die<br />
rein rechtliche Situation der ungesicherten<br />
beschäftigten Honorarkräfte<br />
Thema ist und überlegt wird, wie<br />
mit gezielter Interessenvertretung<br />
gemeinsam Verbesserungen und Perspektiven<br />
entwickelt werden können.<br />
Paul Weitkamp<br />
Die Beratungs- und Freischaltzeiten<br />
für Anrufende von Festnetzanschlüssen<br />
(nicht Handy) aus allen Bundesländern<br />
sind demnächst: Jeweils<br />
Montag von 19.00 bis 23.00 Uhr und<br />
Dienstag von 09.00 bis 13.00 Uhr.<br />
Die neue Hotline läuft auch unter<br />
einer neuen Rufnummer: 01804/<br />
100927<br />
Anrufe außerhalb der genannten<br />
Sprechzeiten können leider nicht persönlich<br />
entgegen genommen werden.<br />
Die Beratungskontakte sind an keine<br />
<strong>GEW</strong>-Mitgliedschaft gebunden.<br />
„Selbstständige Lehrkräfte sind ArbeitnehmerInnen“<br />
chen, wie viel den Lehrkräften die Weiterbildung<br />
bedeutet. „Weiterbildung ist<br />
ein eigenständiger mit Schule, Hochschule<br />
und Berufsausbildung gleichberechtigter<br />
und verbundener Teil des Bildungswesens<br />
in öffentlicher Verantwortung“<br />
(WBG § 1). Auf Grund der prekären<br />
Beschäftigungsverhältnisse wird<br />
es aber immer schwieriger, das Angebot<br />
an Weiterbildungseinrichtungen<br />
aufrecht zu erhalten. Die Fluktuation<br />
der Lehrkräfte ist so stark, dass Kontinuität<br />
nicht mehr gewährleistet werden<br />
kann und notwendige Kurse ausfallen<br />
müssen.<br />
Der Minister stellte nun ganz entschieden<br />
fest, dass selbstständige Lehrkräfte,<br />
die in Sprachkursen der Volkshochschule<br />
oder anderer Anbieter arbeiten, gar<br />
keine Selbstständigen seien. Ihnen müsse<br />
der Arbeitnehmerstatus zuerkannt<br />
werden. Nach seiner Meinung können<br />
Politiker gewonnen werden, die gesetzliche<br />
Grundlage dafür zu schaffen.<br />
Aber, wer soll das bezahlen in einer<br />
Zeit, in der überall gespart werden<br />
muss? Für die Auftraggeber und da vor<br />
allem die Volkshochschulen hätte das<br />
Konsequenzen. Die Volkshochschulen<br />
können die fehlenden Finanzmittel<br />
nicht durch die Erhöhung der Teilnehmerbeiträge<br />
ausgleichen, denn sie haben<br />
den Auftrag, bezahlbare Angebote<br />
zu machen. Die Festanstellung von<br />
Lehrkräften würde ohne zusätzliche<br />
Fördermittel den Abbau von Angeboten<br />
bedeuten. Der Minister bemerkte<br />
explizit, dass auf dem Rücken von Lehrkräften<br />
Probleme ausgetragen würden,<br />
für die sie nichts könnten.<br />
Es müssen aber dringend Lösungen gefunden<br />
werden, denn die Reduzierung<br />
von Angeboten ist jetzt schon Realität,<br />
weil viele Lehrkräfte die besseren Beschäftigungsbedingungen<br />
in der Schule<br />
vorziehen bzw. wie schon in anderen<br />
Bundesländern dabei sind, gerichtlich<br />
auf Festanstellung zu klagen.<br />
Nach diesem Gespräch ist es dringender<br />
Wunsch der HonorarlehrerInnen,<br />
dass Politiker Phantasie entwickeln und<br />
innovative Vorschläge einbringen, um<br />
zu sinnvollen Lösungen zu kommen,<br />
die allen Betroffenen nützen. im<br />
14 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
Auch an Grundschulen wird geklippert<br />
Nach mehrjähriger Erprobungsarbeit<br />
ist es nun endlich soweit. Der Nebel<br />
in Sachen Methoden-, Kommunikations-<br />
und Teamtraining in der<br />
Grundschule hat sich gelichtet.<br />
Dank der von Klippert ausgebildeten<br />
Trainerinnen und Trainer in einigen<br />
deutschen Regionen ist<br />
mittlerweile ziemlich klar geworden,<br />
was in den Grundschulen geht und<br />
was nicht. Denn nicht alles, was in<br />
punkto Methodenschulung in der<br />
Sekundarstufe I und II machbar ist<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
und in Hunderten von deutschen<br />
Schulen bereits umgesetzt wird, ist<br />
auch auf die Grundschule zu übertragen.<br />
Das neue Buch von Heinz<br />
Klippert und Frank Müller „Methodenlernen<br />
in der Grundschule. Bausteine<br />
für den Unterricht“ bietet diesbezüglich<br />
umfangreiche Anregungen,<br />
zahlreiche Beispiele und praktische<br />
Hilfen für die schulinterne<br />
Innovationsarbeit. Den Schwerpunkt<br />
bilden Lernspiralen zu gängigen<br />
Themen der Grundschule in den<br />
Tipps + Termine<br />
Fächern Deutsch (z.B. Freies Erzählen<br />
von Fantasiegeschichten), Mathematik<br />
(z.B. Addition/Subtraktion im<br />
Bereich bis 100), Sachkunde (Mindmap<br />
zum Thema „Katze“) und weiteren<br />
Fächern (z.B. Memory-Übung<br />
zur modernen Popmusik). Es schließen<br />
sich Trainingsspiralen zu wichtigen<br />
Methodenfeldern an, z.B. Lernund<br />
Arbeitstechniken einüben, Kommunikation<br />
und Kooperation. psw<br />
Heinz Klippert und Frank Müller:<br />
„Methodenlernen in der Grundschule.<br />
Bausteine für den Unterricht“,<br />
Beltz-Verlag Weinheim, 315 Seiten,<br />
22,90 Euro<br />
Auswirkungen von Religion und Esoterik auf Erziehung und Bildung<br />
Die <strong>GEW</strong> Studierenden- und DoktorandInnengruppe<br />
an der Universität<br />
Trier und die <strong>GEW</strong> Trier laden zu dem<br />
Kongress „Die ewige Wiederkehr des<br />
Religiösen. Kongress zur Untersuchung<br />
der Auswirkungen von Religion und<br />
Esoterik auf Erziehung und Bildung“<br />
ein. In Kooperation mit der Jenny<br />
Marx Gesellschaft für politische Bildung<br />
e.V. und weiteren Verbänden diskutiert<br />
der Kongress alternative Erziehungsmodelle<br />
im Hinblick auf die bevorstehenden<br />
Veränderungen durch das<br />
GATS-Abkommen (General Agreement<br />
Schüler mit eigener CD gegen Gewalt<br />
und Fremdenhass<br />
Die Idee kam im Deutsch-Förderkurs:<br />
„Stoppt die Gewalt und reicht<br />
euch die Hände, macht diesem<br />
Schwachsinn doch endlich ein<br />
Ende!“<br />
Schülerinnen und Schüler der 10.<br />
Klasse der Erich Kästner-Realschule<br />
in Gladbeck wollten ein Zeichen<br />
setzten gegen Gewalt und Fremdenhass<br />
in der Welt und schrieben engagierte<br />
Texte zum Thema. Unter der<br />
24. Pfingsttreffen schwuler Lehrer<br />
Wie jedes Jahr treffen sich schwule<br />
Lehrer, die im Schuldienst, in der<br />
Ausbildung, die arbeitslos oder im<br />
Ruhestand sind, im Waldschlösschen<br />
bei Göttingen. Im persönlichen<br />
Gespräch und in vorbereitenden<br />
Arbeitsgruppen wollen wir unsere<br />
Erfahrungen austauschen, uns<br />
auseinander setzen mit unseren Lebens-<br />
und Arbeitsbedingungen.<br />
Zeit wird auch sein für das Wandern<br />
in der grünen Umgebung und für<br />
Anleitung ihres Lehrers Jörg Lehwald<br />
und mit professioneller musikalischer<br />
Unterstützung entstand<br />
eine CD, auf der die Texte vertont<br />
wurden. Sie ist für 5,49 Euro zzgl.<br />
1,44 Euro Porto zu beziehen bei:<br />
1. Jörg Lehwald, Tel.: 0209/<br />
786375, FAX: 0209/3617468,<br />
E-mail: j.lehwald@joerg-lehwald.de<br />
pm<br />
eine kreative Vorbereitung des gemeinsamen<br />
Festes. Ein ausführliches<br />
Programm ist ab April erhältlich.<br />
(Info: www.schwulelehrer.de)<br />
Organisatorisches: Termin: 6. Juni<br />
(Anreise) bis 9. Juni 2003<br />
Telephonische Anmeldung und Auskunft:<br />
(0 55 92) 9 27 70<br />
E-Mail: info@waldschloesschen.org<br />
Freies Tagungshaus Waldschlösschen,<br />
37130 Reinhausen bei Göttingen<br />
dm<br />
on Trade in Services).<br />
Über die Zukunft der Bildung wird<br />
nicht erst seit PISA gestritten. Die einen<br />
fordern die staatliche Hand im Bildungssystem,<br />
die anderen plädieren für<br />
eine stärkere Öffnung des Bildungssektors<br />
für private Anbieter. Durch das<br />
GATS-Abkommen der Welthandelsorganisation<br />
WTO steht eine weitreichende<br />
Liberalisierung der öffentlichen<br />
Dienstleistungen bevor - auch des „Bildungsmarktes“.<br />
Wenn Schranken fallen,<br />
bedeutet dies nicht nur mehr Freiheit<br />
und weniger Staat; zuallererst bringt<br />
dies ein mehr an Verantwortung für die<br />
Eltern und SchülerInnen, da sie einer<br />
Vielzahl von Alternativen gegenüberstehen.<br />
Wessen Alternative durch die Privatisierung<br />
von Bildung sich durchsetzen<br />
wird, will der Kongress anhand von<br />
weltanschaulichen und esoterischen Trägern<br />
kritisch diskutieren.<br />
Als ReferentInnen wurden unter anderem<br />
eingeladen: Prof. F. Buggle (Christentum),<br />
Prof. K. Prange (Anthroposophie/Waldorfpädagogik),<br />
Dipl. psych.<br />
C. Goldner (Esoterische Psychoszene),<br />
Dr. phil. W. Proske (Montessori) und<br />
Dr. phil. M. Wölflingseder (Irrationalismus).<br />
Weitere Informationen zum Kongress<br />
sind zu erhalten auf der Homepage<br />
www.fda-kongress.de, unter der Email-<br />
Adresse fda@uni-trier.de und unter der<br />
Telefonnummer (0651) 99 86 828 sowie<br />
der Faxnummer (0651) 99 86 829.<br />
Christoph Lammers<br />
(Projektverantwortlicher)<br />
15
Tipps + Termine<br />
Neu: CD mit Grundschulmaterial für den Anfangsunterricht<br />
Die CD „Grundschulmaterial 1 - für<br />
den Anfangsunterricht“ enthält über<br />
5000 Grafiken zur Erstellung eigener<br />
Lehr- und Lernmittel. Die CD<br />
stellt viele fertige Vorlagen für den<br />
Anfangsunterricht direkt zum Ausdrucken<br />
im A4-Format bereit, gele-<br />
Bildungsinformationen im Netz<br />
Aufgabe des Informationszentrums<br />
(IZ) Bildung des Deutschen Instituts<br />
für Internationale Pädagogische Forschung<br />
(DIPF), Frankfurt/M., ist es,<br />
Bildungsinformationen zu sammeln,<br />
aufzubereiten und die entwickelten<br />
Angebote und Serviceleistungen ei-<br />
Filme gegen Rassismus<br />
Filme, Spiele, Unterrichtsmaterial<br />
und Fachliteratur zu den Themen<br />
Rassismus und ethnische Diskriminierung<br />
verleiht das Antidiskriminierungsbüro<br />
in Siegen. Stöbern in<br />
Kompetenz für Einwanderung<br />
Damit Einwanderung funktioniert,<br />
brauchen Beschäftigte, Ausländerbeauftragte<br />
und Betriebsräte Kompetenz,<br />
um für ihre ausländischen KollegInnen<br />
im Job gleiche Rechte<br />
durchzusetzen. Dieses Know-how<br />
vermitteln die Seminare des "Bil-<br />
Steuern sparen am<br />
Computer<br />
Es gibt zahlreiche PC-Programme,<br />
die bei der Steuererklärung helfen<br />
sollen. Acht davon hat das Magazin<br />
Finanztest der Stiftung Warentest<br />
unter die Lupe genommen. Nur eines,<br />
das Programm "Steuer-Spar-Erklärung"<br />
des Verlags Akademische<br />
Arbeitsgemeinschaft, Mannheim,<br />
erhielt das Prädikat "sehr gut". Am<br />
schlechtesten schnitt "Capital Einkommen-Steuer"<br />
der Infotax Software<br />
GmbH, Euskirchen, ab. Bei allen<br />
Programmen bemängeln die Tester<br />
die komplizierte Bedienung.<br />
www.finanztest.de<br />
gentlich auch wahlweise in Farbe<br />
oder schwarzweiß. Alle Grafiken,<br />
Zeichnungen und Vorlagen dienen<br />
zur Gestaltung des Klassenraumes,<br />
zur Information und Orientierung<br />
der SchülerInnen oder zur Übung im<br />
Normal-, Freiarbeits- oder Förderun-<br />
ner interessierten Zielgruppe bekannt<br />
zu machen Ein Überblick über<br />
dieses Angebot ist unter www.dipf.<br />
de/projekte/bildungsinformation.<br />
htm zu finden.<br />
Diese Fachinformationen im Bildungsbereich<br />
- u.a. der Deutsche Bil-<br />
der Mediathek des Büros ist vor Ort<br />
und im Internet möglich. Die Ausleihe<br />
funktioniert ebenfalls online<br />
und ist, abgesehen vom Porto, kostenlos.<br />
Träger des Antidiskriminie-<br />
dungsprogramms 2003" des Bereichs<br />
Migration und Qualifizierung im<br />
DGB-Bildungswerk. Die Palette<br />
reicht von "Training in Zivilcourage<br />
(4.-9. Mai, Hattingen) bis zu "Asylund<br />
Migrationspolitik der EU" (30.<br />
terricht. Zu finden sind: Anlauttabellen,<br />
Arbeitsblätter Bastelbogen,<br />
Bilder von A-Z, Gestaltungsmittel,<br />
Spielvorlagen Tafelbilder u.v.m.<br />
Bezug: vertrieb@medienwerkstattonline.de<br />
pm<br />
dungsserver, die FIS Bildung Literaturdatenbank<br />
oder auch die <strong>Zeitung</strong>sdokumentationBildungswesen,<br />
kurz ZEITDOK genannt - können<br />
viele sinnvoll und gewinnbringend<br />
für ihre Arbeit verwenden: z.B.<br />
LehrerInnen, WissenschaftlerInnen<br />
und Studierende.<br />
dipf<br />
rungsbüros ist der Verein für soziale<br />
Arbeit und Kultur Südwestfalen.<br />
Mediathek gegen Rassismus,<br />
Kölner Straße 11, 57072 Siegen,<br />
www. mediathek-siegen.de<br />
November bis 5. Dezember, Hattingen).<br />
DGB-Bildungswerk<br />
Migration und Qualifizierung,<br />
Hans-Böckler-Straße 39,<br />
40476 Düsseldorf,<br />
www.migration-online.de<br />
16 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
Die <strong>GEW</strong> gratuliert …<br />
… im Mai 2003<br />
zum 70. Geburtstag<br />
Frau Renate Schwender<br />
03.05.1933<br />
In der Dreispitz 4 · 67157 Wachenheim<br />
zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Rudi Oberlinger<br />
04.05.1928<br />
Villenstr. 8 · 66482 Zweibrücken<br />
Herrn Hermann Frech<br />
09.05.1928<br />
Hauptstr. 31 · 76831 Göcklingen<br />
Frau Elisabeth Hoermann<br />
24.05.1928<br />
Wappenschmiedstr. 6 · 76889 Pleisweiler-Oberhofen<br />
Frau Ruth Wagner<br />
27.05.1928<br />
Carl-Maria-von-Weber-Str. 33 · 66955 Pirmasens<br />
zum 80. Geburtstag<br />
Frau Elisabeth Langner<br />
01.05.1923<br />
Bewingerstr. 3 · 54568 Gerolstein<br />
Frau Vera Przyrembel<br />
01.05.1923<br />
Am Marienpfad 57 · 55128 Mainz<br />
Frau Ruth Rech<br />
13.05.1923<br />
Karl-Theodor-Str. 14 · 66954 Pirmasens<br />
Herrn Erich Morgenstern<br />
18.05.1923<br />
Glanstr. 11 · 66914 Waldmohr<br />
zum 86. Geburtstag<br />
Frau Inge Dreyer<br />
07.05.1917<br />
Wiedstr. 6 · 57627 Hachenburg<br />
zum 88. Geburtstag<br />
Herrn Franz Fremgen<br />
28.05.1914<br />
Weinstr. 33 · 76887 Bad Bergzabern<br />
zum 93. Geburtstag<br />
Herrn Georg Blees<br />
04.05.1910<br />
Hochstr. 2 · 67629 Streithausen<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
… im Juni 2003<br />
zum 70. Geburtstag<br />
Herrn Prof. Dr. Friedrich Kron<br />
18.06.1933<br />
Am Linsenberg 21 · 55131 Mainz<br />
Herrn Gerhard Gabel<br />
28.06.1933<br />
Lessingstr. 16 · 67663 Kaiserslautern<br />
zum 75. Geburtstag<br />
Frau Edith Gehenn<br />
07.06.1928<br />
Hauptstr. 27 · 55605 Bergen<br />
Herrn Oskar Haeussler<br />
07.06.1928<br />
Werderstr. 54 · 67069 Ludwigshafen<br />
Herrn Wolfgang Wiedenroth<br />
20.06.1928<br />
Grundstr. 38 · 55218 Ingelheim<br />
Herrn Alexander Persijn<br />
25.06.1928<br />
Schubertstr. 12 · 67655 Kaiserslautern<br />
zum 80. Geburtstag<br />
Herrn Heinz Teichmann<br />
12.06.1923<br />
Moltkestr. 30 · 67454 Haßloch<br />
Herrn Erhard Christmann<br />
13.06.1923<br />
Im Klingeltal 98 · 66482 Zweibrücken<br />
zum 86. Geburtstag<br />
Herrn Erich Huettig<br />
07.06.1917<br />
Saarstr. 19 · 76870 Kandel<br />
Alter + Ruhestand<br />
zum 87. Geburtstag<br />
Herrn Helmut Heil<br />
08.06.1916<br />
Wolfsangel 15 · 67663 Kaiserslautern<br />
Frau Marianne Kleinhans<br />
10.06.1916<br />
Im Schillerstift Kapellengasse 25 · 67071 Ludwigshafen<br />
zum 89. Geburtstag<br />
Herrn Walter Willems<br />
06.06.1914<br />
An der Bach 31 · 56329 St. Goar<br />
Herrn Hasso Bayer<br />
26.06.1914<br />
Riedstr. 27 · 55130 Mainz<br />
zum 90. Geburtstag<br />
Herrn Herbert Dietzsch<br />
01.06.1913<br />
Arnold-Schönberg-Str. 29 · 66955 Pirmasens<br />
Herrn Gustav Arzt<br />
16.06.1913<br />
Gartenstr. 47 · 66917 Wallhalben Der Landesvorstand<br />
17
Alter + Ruhestand<br />
Gratulation, lieber Edmund<br />
Für sein 50. Dienstjubiläum<br />
wurde Edmund Theiß am 8. Februar<br />
in seiner Wahl-Heimatstadt<br />
Westerburg mit der Urkunde<br />
des Ministerpräsidenten Kurt<br />
Beck geehrt. 42 Jahre lang war<br />
er im Schuldienst, acht Jahre<br />
Stadtbeigeordneter und mehr als<br />
40 Jahre ehrenamtlich in Gewerkschaft,<br />
Schule, Kirche und<br />
Partei sowie in der Kommunal-<br />
politik tätig. Seine erste Stelle im Schuldienst trat der Pfälzer, der<br />
1928 in Sankt Alban geboren wurde, in der <strong>Pfalz</strong> an. Später war er<br />
im damaligen Regierungsbezirk Montabauer Lehrer, bevor er 1965<br />
nach Westerburg kam. Edmund Theiß ist seit 42 Jahren ohne Unterbrechung<br />
für die <strong>GEW</strong> auf verschiedenen Organisationsebenen<br />
aktiv, seit elf Jahren bereits Vorsitzender des Landesausschusses für<br />
SeniorInnen.<br />
Unter den zahlreichen Gratulanten bei der Feierstunde war auch<br />
der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende Tilman Boehlkau, dessen guten Wünschen<br />
für den aktiven Jubilar sich die Redaktion der <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong><br />
gerne anschließt.<br />
red.<br />
Abschlagszahlungen bei Krankenhausaufenthalt<br />
In einem Schreiben vom 30.12.2002 bat Edmund Theiß den Minister<br />
der Finanzen, Herrn Gernot Mittler, um Auskunft wegen<br />
der im gewerkschaftlichen Spitzengespräch am 29.5.2002 vereinbarten<br />
Zusage zu Abschlagszahlungen der Beihilfenstellen bei Krankenhausaufenthalt<br />
direkt an den Krankenhausträger. Minister<br />
Kreis + Region<br />
Kreis Zweibrücken<br />
Große Sprünge in Mathematik<br />
Was haben Kängurus mit Mathematik am Hut? Abgesehen davon,<br />
dass der Begriff „Dreisatz“ durch diese Beuteltiere womöglich eine<br />
neue inhaltliche Komponente erhalten könnte, wahrscheinlich<br />
nicht viel. Rund 155 000 deutsche SchülerInnen können Ihnen<br />
aber vermutlich genau erklären, was ein „Känguru der Mathematik“<br />
ist. Denn sie haben im letzten Jahr an dem Mathe-Wettbewerb<br />
gleichen Namens teilgenommen. Die Schulleiterin der Grundschule<br />
Mittelbach, Karolina Engel, wusste ebenfalls mit dem „Känguru<br />
der Mathematik“ etwas anzufangen und informierte in den<br />
Räumen der Mittelbacher Grundschule für die <strong>GEW</strong>- Zweibrücken<br />
umfassend über diesen Wettbewerb.<br />
In Australien wird dieser Wettstreit bereits seit 1978 ausgetragen<br />
und wurde von zwei französischen Mathematiklehrern nach Frankreich<br />
geholt. Zu Ehren der australischen Erfinder wurde er „Kangourou<br />
des Mathematiques (Känguru der Mathemathik)“ genannt.<br />
Inzwischen nehmen immer mehr europäische Länder an diesem<br />
Wettbewerb teil, der seit 1995 auch in Deutschland angeboten<br />
Studienreisen / Klassenfahrten<br />
8-Tage-Busreise z.B. nach<br />
WIEN ÜF 192,-- €<br />
BUDAPEST ÜF 192,-- €<br />
LONDON ÜF 254,-- €<br />
PRAG ÜF 199,-- €<br />
PARIS ÜF 224,-- €<br />
ROM ÜF 238,-- €<br />
10-Tage-Busreise z.B. nach<br />
SÜDENGLAND Ü 213,-- €<br />
TOSKANA Ü 202,-- €<br />
SÜDFRANKREICH Ü 230,-- €<br />
(Unterbringung in<br />
Selbstversorgerunterkünften)<br />
Alle Ausflugsfahrten inklusive.<br />
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks<br />
in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!<br />
REISEBÜRO KRAUSE GMBH · MÜNSTERSTR. 55a · 44534 LÜNEN<br />
TEL: (0 23 06) 7 57 55-0 · FAX: (0 23 06) 7 57 55-49 · E-mail: info@rsb-krause.de<br />
Mittler schrieb dazu, dass er beabsichtige, dies bei der anstehenden<br />
Neufassung der Verwaltungsvorschrift „Durchführung der Beihilfenverordnung“<br />
umzusetzen und damit dem <strong>GEW</strong>-Anliegen<br />
Rechnung trage.<br />
red<br />
wird und sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 3<br />
bis 13 richtet. In allen Teilnehmerländern wird der Wettbewerb<br />
zeitgleich ausgetragen, in diesem Jahr war das am 20. März.<br />
In jeweils zwei aufeinander folgenden Klassenstufen gibt es den<br />
gleichen Aufgabenkatalog, der aus 30 Aufgaben (Grundschule 21<br />
Aufgaben) besteht und von den TeilnehmerInnen innerhalb von<br />
75 Minuten im Ankreuzverfahren zu lösen ist. Die Aufgaben sind<br />
dabei in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt und werden dementsprechend<br />
bei richtiger Lösung unterschiedlich bepunktet (von 3<br />
bis 5 Punkten). Bei falscher Antwort wird die entsprechende Punktzahl<br />
abgezogen. Ziel eines jeden Teilnehmers ist es, sein Startkapital<br />
von 21 Punkten auszubauen und dabei womöglich noch den<br />
größten Känguru-Sprung hinzulegen (Anzahl der richtigen Lösungen<br />
in Folge). Denn an jeder Schule erhält der Teilnehmer mit<br />
dem weitesten Sprung ein T-Shirt, weitere Preise erhalten Kinder,<br />
die besonders viele Punkte erzielt haben.<br />
Ziel der Veranstalter vom internationalen Verein „Kangourou sans<br />
frontieres“ ist eine Popularisierung der Mathematik. Die Aufgaben<br />
sind darum fast durchweg sehr anregend, heiter, ein wenig<br />
unerwartet und erfordern nicht nur algebraische Fähigkeiten und<br />
geometrisches Vorstellungsvermögen, sondern auch logisches Denken<br />
und gesunden Menschenverstand. Aufgaben der Vorjahre können<br />
übrigens im Internet unter www.mathe-kaenguru.de oder unter<br />
www.paetec.de abgerufen werden.<br />
Weitere Informationen erteilt der<br />
„Mathematikwettbewerb Känguru e.V.“, c/o Mathematische Schülergesellschaft,<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Mathematik,<br />
Unter den Linden 6, 10099 Berlin<br />
Nachsatz für PISA-Geschädigte: Ein Vergleich der Ergebnisse zwischen<br />
den Ländern erfolgt nicht; auch kein Vergleich zwischen<br />
Bundesländern oder Schulen.<br />
ar<br />
18 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
Kreis Zweibrücken<br />
Webzugriff auf EpoS-Mails<br />
Der gute alte Brief wird immer mehr zum Auslaufmodell. Das<br />
könnte das Fazit einer Fortbildungsveranstaltung der <strong>GEW</strong>-Zweibrücken<br />
sein, die Kollege Gregor Simon in den Räumen der Zweibrücker<br />
Hauptschule Mitte abhielt. Denn auch in der Kommunikation<br />
zwischen Schulen und Schulaufsicht kommt der elektronischen<br />
Post immer größere Bedeutung zu. Vorausgesetzt, Schulleitungen,<br />
Personalräte und SekretärInnen beherrschen den Webzugriff<br />
auf EpoS-Mails (EpoS = Elektronische Post für Schulleitungen),<br />
womit auch die Zielgruppe der Fortbildung umrissen wäre.<br />
Der außerordentlich gute Zuspruch machte deutlich, dass in diesem<br />
Punkt noch Informationsbedarf besteht.<br />
Wohl dem Kreisverband, der für derartige Themen einen Computer-Fachmann<br />
wie Gregor Simon in seinen Reihen weiß, der nicht<br />
nur über immenses Wissen in diesem Bereich verfügt, sondern<br />
dieses auch an andere vermitteln kann. In die Aufbereitung seiner<br />
Informationen investierte Simon wie immer viel Zeit und Mühe,<br />
so dass die TeilnehmerInnen größtmöglichen Profit aus der Veranstaltung<br />
ziehen konnten. Selbstverständlich waren die Informationen<br />
auf dem neuesten Stand. Sogar eine Abänderung des Webzugriffs<br />
etwa eine Woche vor der Veranstaltung wurde von Gregor<br />
Simon noch eingearbeitet.<br />
Simon unterteilte seine Ausführung in zwei Blöcke. Im ersten erläuterte<br />
er die Funktionsweise des EpoS-Programms über eine Beamerprojektion<br />
auf der Leinwand. Simon informierte zunächst über<br />
die technischen Zugangsvoraussetzungen zu EpoS. Schritt für<br />
Schritt demonstrierte er im Anschluss den Weg von der Einrichtung<br />
eines EpoS-Kontos bis zum Versenden, Lesen und Löschen<br />
von E-Mails mit dem Programm. Ausführlich ging der Computer-Experte<br />
dabei auf die unterschiedlichen Menüs des EpoS-Bildschirms<br />
ein.<br />
Im zweiten Teil der Veranstaltung stand der praktische Umgang<br />
mit dem Programm im Mittelpunkt. Dabei sollten die im ersten<br />
Teil gewonnenen Kenntnisse in erste Schritte im EpoS-Programm<br />
umgesetzt werden. Die TeilnehmerInnen sollten nun beispielsweise<br />
E-Mails versenden oder ihre Ordner auf den Eingang von E-Mails<br />
hin überprüfen. Das Anlegen verschiedener Nachrichten-Ordner<br />
wurde ebenso geübt wie das Anfügen von Dateienanlagen.<br />
Abschließend lässt sich feststellen, dass die Veranstaltung eine runde<br />
Sache war. Und genau die konnte am Ende jeder mit nach Hause<br />
nehmen, denn Gregor Simon hatte für alle TeilnehmerInnen sämtliche<br />
Informationen auf einer CD-ROM zusammengestellt.<br />
ar<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003<br />
Mit Ahnen und der <strong>GEW</strong><br />
auf dem Betze<br />
Kreis Ludwigshafen / Speyer<br />
Informationen und Wahlen<br />
Kreis + Region<br />
Zu einer öffentlichen Veranstaltung mit Bildungsministerin Doris<br />
Ahnen im Rahmen des Gewerkschaftstages lädt die <strong>GEW</strong> Rheinhessen-<strong>Pfalz</strong><br />
für den 27. Mai ins Kongresszentrum auf dem Betzenberg<br />
in Kaiserslautern ein. Die Ministerin referiert über „Die<br />
Bildungspolitik in <strong>Rheinland</strong> - <strong>Pfalz</strong>“; im Anschluss daran folgen<br />
Aussprache und Diskussion.<br />
ht<br />
Bei der Mitgliederversammlung des KV Ludwigshafen / Speyer<br />
Mitte März erbrachte die Wahl der KreisvertreterInnen für den<br />
Bezirksgewerkschaftstag Rheinhessen-<strong>Pfalz</strong> einen starken Anteil von<br />
Delegierten aus der Fachgruppe berufsbildende Schulen. Zu Beginn<br />
der MV hatte Kreisvorsitzender Helmut Thyssen über aktuelle<br />
Themen informiert, z.B. über Änderungen bei der Beihilfe<br />
und die Personalaktenführung der ADD. Auch rief der Kreisvorstand<br />
zur Teilnahme an einer Anti-Kriegs-Demo in Ludwigshafen<br />
auf. Als sehr informativ erwies sich ein Vortrag der Debeka über<br />
die Konditionen der zusätzlichen Altersvorsorge bei dem von der<br />
<strong>GEW</strong> empfohlenen Versicherungskonsortium „Das RentenPlus“.<br />
gh<br />
Beamtendarlehen supergünstig, z. B. B.a.L. od. DO-Angest., 35 Jahre, 12 Jahre Laufzeit, bei 30 000,– €, mtl. *315,– €,<br />
bei 60 000,– €, *630,– € Rate, *jeweils inkl. Zins- und Lebensvers.-Prämie. Festzinsgarantie ges. Laufzeit ab Nominal<br />
5,45%, effektiver Jahreszins ab 6,25%, b. 12 Jahre. Superangebote auch zu Lfz. 20 Jahre und 25 Jahre. Kürzere<br />
Laufzeit bei Gewinnanteilsverrechnung. * 1) Darlehen supergünstig *<br />
Extradarlehen nominal 2,75% ab 3,16% effektiver Jahreszins ab Zuteilung<br />
mit neuem Bausparvertrag. Supergünstige Annuitätenhypotheken, Beleihung bis 100% plus EHZ. Schufafreie Eurokredite<br />
bis 100 000,– € mit Tilgungsversicherung. Vorfinanzierung der Eigenheimzulage. Gute Angebote an Angestellte/<br />
Arbeiter/ö.D. Sprechen Sie vertrauensvoll mit uns. AK-Finanz wählen – eine clevere Entscheidung. Supergünstige<br />
Lebensvers.-Darlehen an Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst.<br />
Ja! Bitte jetzt Info anfordern. Mein Wunsch: € Info und Sofortangebote<br />
Name:<br />
unter Servicenummer<br />
Straße:<br />
0800/1000 500<br />
Ort:<br />
Zum Nulltarif!<br />
Darlehenspartner für öffentlich Bedienstete und Beamte, wir wählen für Sie supergünstige Möglichkeiten aus.<br />
AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen,<br />
Faxabruf: (06 21) 62 86 09, Telefax: (06 21) 51 94 88, www.ak-finanz.de<br />
Bundesweiter unverbindlicher Beratungsservice z. Nulltarif. Info per Post/Tel.<br />
1) nominal 2,75% ab 3,16% effektiver Jahreszins<br />
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter<br />
keinerlei Vermittlungskosten<br />
Beraterkompetenz mit über 30jähriger Erfahrung<br />
Internet: www.ak-finanz.de<br />
19
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Beilage zur E&W<br />
Ostergeist<br />
Der Osterhase und die Ich-AG<br />
- Ein Märchen von Klaus Britting -<br />
Frühjahrspreisrätsel:<br />
Wer kennt<br />
diesen Mann?<br />
Der Osterhase<br />
hatte im Wirtschaftsteil<br />
seiner<br />
Tageszeitung einengrundlegenden<br />
Artikel<br />
über die Möglichkeitengelesen,<br />
eine Ich-<br />
AG zu gründen<br />
und vom Staat<br />
jeden Monat<br />
dafür beschenkt<br />
zu werden.<br />
Endlich würde<br />
sich ihm somit<br />
die Gelegenheit bieten, in größerem Stil<br />
ganzjährig unternehmerisch tätig zu<br />
werden. Dabei dachte er natürlich an<br />
ganz andere Geschäfte als solche, für die<br />
er zu Ostern bekannt war. Immerhin,<br />
das kommende Osterfest sollte der erste<br />
Test werden.<br />
Natürlich sprach der Osterhase sofort<br />
mit dem Huhn. Das Huhn grinste,<br />
denn es wusste, dass des Osterhasen<br />
Kapazität begrenzt war. Der Osterhase<br />
kann ja bekanntlich nur in der Osterwoche<br />
Eier legen. Um einen günsti-<br />
Die originellsten Zuschriften an die<br />
Redaktion werden mit Buchpräsenten<br />
prämiert.<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Neubrunnenstraße 8 · 55116 Mainz<br />
Telefon: 06131-28988-0 • FAX 06131-28988- 80<br />
E-mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.de<br />
gen Preis zu erzielen, musste er sich verpflichten,<br />
hundert Eier abzunehmen.<br />
Doch die hundert Eier konnte der Osterhase<br />
weder allein bemalen noch liefern.<br />
Also engagierte er eine ihm flüchtig<br />
bekannte Graugans, die in der Toskana<br />
letztes Jahr einen Malkurs besucht<br />
hatte. Die Graugans sicherte ihm zu,<br />
die hundert Eier unter Mithilfe ihrer<br />
wirklich kunstsinnigen Familie, wie sie<br />
versicherte, zu bemalen. Für den Transport<br />
holte sich der Osterhase die Unterstützung<br />
eines älteren Ziegenbocks,<br />
welcher versprach, die Eier mit einem<br />
kleinen Wägelchen zu transportieren,<br />
das er im Stall stehen hatte und vor das<br />
die Kinder ihn gerne spannten.<br />
In der Osterwoche ging der Osterhase<br />
dann zum Huhn, um die fertigen Eier<br />
zu besichtigen. Sein Schrecken war<br />
groß, als das Huhn ihm nur dreißig Eier<br />
vorlegen konnte. Mehr sei nicht möglich<br />
gewesen, denn vor rund vier Wochen<br />
sei ein junger Hahn auf dem Hof<br />
erschienen und habe ihre vier Töchter,<br />
die mit produzieren sollten, so verwirrt,<br />
dass die kaum noch etwas legen konnten.<br />
Das Huhn lief dabei puterrot an,<br />
und als Mann von Welt merkte der Os-<br />
terhase sofort, dass auch dieses an dem<br />
jungen Hahn starken Gefallen gefunden<br />
hatte. „Diese dummen Hühner!“,<br />
schimpfte der Osterhase und begab sich<br />
zur Graugans.<br />
„Ich habe jetzt leider nur dreißig Eier<br />
zum Bemalen“, sagte er zu ihr. „Das<br />
ist ohnehin zu viel für mich, weil meine<br />
Familie letzte Woche wegen des<br />
schlechten Wetters in den Süden geflogen<br />
ist“, schnatterte die Graugans, „aber<br />
ich werde mich beeilen, vielleicht schaffe<br />
ich die Menge ja doch“. Der Osterhase<br />
lief sofort zum Ziegenbock, der<br />
immerhin sein Wort hielt und die Eier<br />
vom Huhn zur Graugans transportierte.<br />
Natürlich konnte der Osterhase für<br />
die fehlenden Eier keinen Ersatz mehr<br />
finden und deshalb Tage lang nicht<br />
schlafen.<br />
Am Ostersamstagnachmittag lief der<br />
Osterhase zur Graugans, um die bemalten<br />
Eier zu besichtigen. Entsetzen packte<br />
ihn, als er die Malerei sah. Alles nur<br />
hingeschmiert, nichts fein ausgemalt,<br />
wie er es gewohnt war und wie seine<br />
Kunden es auch von ihm erwarteten.<br />
„Bei dem Zeitdruck war einfach nicht<br />
mehr möglich“, krächzte die Graugans.<br />
„Blöde Gans“, dachte der Osterhase und<br />
ahnte, dass der Malkurs in der Toskana<br />
ganz anderen Zwecken gedient haben<br />
mochte. Nun aber rasch zum Ziegenbock!<br />
Als er sich dem Hof näherte,<br />
sah er schon von weitem auf dem Feld<br />
den Ziegenbock mit einer ihm bis dahin<br />
nicht bekannten äußerst jungen Ziege.<br />
Und wie der Bock um sie herumsprang!<br />
Er rief ihm zu, dass nun die Lieferung<br />
der Eier an seine Kunden fällig sei.<br />
Doch der Ziegenbock wackelte nur mit<br />
dem Kopf und torkelte wie betrunken<br />
ständig im Kreis um die junge Ziege.<br />
„Dieser alte Bock!“, ärgerte sich der<br />
Osterhase, weil er nun die ganze Nacht<br />
selbst die Eier in Kleinstmengen zu den<br />
Kunden transportieren und sich anhören<br />
musste, wie hässlich sie aussahen.<br />
Erschöpft hat der Osterhase die Ich-AG<br />
sofort aufgegeben. Er lebt bis zum<br />
nächsten Fest wie bisher vom Arbeitslosengeld<br />
und beschränkt sich wieder<br />
auf seine eigenen Eier - selbst gelegt und<br />
selbst bemalt. Garantiert!<br />
20 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 4-5 /2003
4-5/ 03<br />
Sonderbeilage der<br />
-<strong>Zeitung</strong><br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
Bildung von Anfang an<br />
Aktuelle politische Entwicklungen im KiTa-Bereich<br />
Über die <strong>GEW</strong>-Fachtagung zum Bildungsstandort Kindertagesstätte<br />
Ende Januar berichtete die <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> bereits in ihrer letzten Ausgabe<br />
in einem zusammenfassenden Artikel. In diesem Schwerpunkt<br />
folgen nun weitere Berichte, insbesondere aus den Arbeitsgruppen.<br />
Zunächst hier die einleitende Rede des stellvertretenden <strong>GEW</strong>-Bundesvorsitzenden<br />
Norbert Hocke, der für den Vorstandsbereich Jugendhilfe<br />
und Sozialarbeit zuständig ist und in seinem Vortrag aktuelle politische<br />
Entwicklungen im Kindertagesstättenbereich beleuchtete.<br />
Deutschland im<br />
Jahre 2003, im<br />
ersten Nach-<br />
PISA-Jahr! Es<br />
heißt in der Einladung<br />
zu diesemErzieherinnentag:<br />
„PISA<br />
hat Deutschland<br />
wach gerüttelt.“<br />
Bei unterschiedlichenInterpretationen<br />
scheint eines<br />
gewiss: So,<br />
wie es ist, kann<br />
es nicht bleiben!<br />
Aber - so wie die Entscheidungen für<br />
die Tageseinrichtungen für Kinder<br />
durch die Kultusministerien laufen,<br />
dürfen sie nach PISA nicht weiter<br />
laufen.<br />
Warum? Einige Nach-PISA-Beispiele<br />
- natürlich nicht aus <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> - aus anderen Bundesländern.<br />
Für die verhinderte Redaktion sprach Norbert Hocke seine<br />
Rede nochmals aufs Diktiergerät. Die Auszubildende Sarah<br />
Menacher von der <strong>GEW</strong>-Landesgeschäftsstelle in Mainz übernahm<br />
die sehr schwierige Aufgabe des Transkribierens. Herzlichen<br />
Dank!<br />
Fotos in dieser Beilage: Ernie Schaaf-Peitz<br />
Man sollte ja immer andere nehmen,<br />
weil in dem Land, in dem man gerade<br />
redet, fast alles richtig läuft.<br />
Dresden: Die Stadt Dresden hat im<br />
Dezember Krippen- und Horteltern,<br />
die zu Hause sind, die Plätze für ihre<br />
Kinder gekündigt. Fall 1: Silvia B.<br />
hätte einen Grund zur Freude. Sie<br />
hat eine Arbeitsstelle, Töchterchen<br />
Lena geht es gut und im April<br />
kommt noch einmal Nachwuchs.<br />
Die Mutter könnte sich also angesichts<br />
des Streits um die Kinderbetreuung<br />
entspannt zurück lehnen.<br />
Doch stattdessen ist sie durch die<br />
Festlegung der neuen Zugangskriterien<br />
für Krippen und Horte in eine<br />
unangenehme Situation geraten. Sie<br />
möchte nach der Geburt des zweiten<br />
Kindes eine Elternzeit von einem<br />
halben Jahr nehmen, um sich um das<br />
Baby zu kümmern. Macht sie das,<br />
verliert Tochter Lena jedoch ihren<br />
Krippenplatz. Denn wenn die Mutter<br />
nicht arbeitet, kann sie ihr 15<br />
Monate altes Kind auch zu Hause<br />
betreuen, so die Argumentation der<br />
Stadtverwaltung. Die Mutter: „Mein<br />
erstes Kind wird bestraft, wenn das<br />
zweite auf die Welt kommt.“ Der<br />
Wiedereinstieg in den Beruf werde<br />
deutlich erschwert nach der Mutterpause<br />
des zweiten Kindes.<br />
Dresden Fall 2: Johannes Berger geht<br />
in die vierte Klasse und nach der<br />
Schule in den Hort. Dort kann er<br />
wandern, Sport treiben - alles Dinge,<br />
die mit seinen Eltern nicht möglich<br />
sind. Sein Vater ist gehbehindert,<br />
seine Mutter sogar sehr schwer gehbehindert.<br />
Den Bergers flatterte kurz<br />
vor Weihnachten die Kündigung für<br />
den Hortplatz ihres Sohnes ins Haus.<br />
Sie widersprachen der Entscheidung<br />
und legten den Brief dem Städtischen<br />
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen<br />
ihre Behindertenausweise<br />
bei. Als Antwort mussten sie lesen,<br />
dass die Kündigung nach um-<br />
I
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
II<br />
fassender Prüfung bestehen bleibt.<br />
Die Eltern: „Als Behinderte bekommen<br />
wir seit Jahren keine feste Arbeit<br />
mehr, und nun bekommt unser<br />
Sohn das auch zu spüren.“<br />
Deutschland 2003: Immer noch<br />
werden in dieser Republik Plätze für<br />
Kinder vergeben nach Dringlichkeitsstufen<br />
und nach engen Zeitkorsetten!<br />
Der Rechtsanspruch auf einen<br />
Halbtagsplatz für die 3-6 Jährigen<br />
war der erste Schritt. Wir brauchen<br />
aber in diesem Land den Europäischen<br />
Anschluss: Eltern müssen<br />
die Möglichkeit haben, ihr Kind so<br />
lange sie wollen in einer Tageseinrichtung<br />
unterzubringen. Vom ersten<br />
bis zum zwölften Lebensjahr. Das<br />
wäre eine bildungspolitische Antwort,<br />
die sowohl sozialpolitisch als<br />
auch familienpolitisch im<br />
Kontext einer Nach-PISA-<br />
Politik steht.<br />
Hessen: „Wer als Fünfjähriger<br />
den obligatorischen<br />
Sprachtest bei der Anmeldung<br />
für die Grundschule<br />
nicht besteht, kann bis zur<br />
Einschulung nacharbeiten“‚<br />
schreibt Kultusministerin<br />
Wolf. „Wenn ein<br />
Kind aber im Alter von<br />
sechs Jahren wieder durch<br />
den Deutschtest fällt, darf<br />
es nicht in die erste Klasse.<br />
Statt dessen wird es zu<br />
einem Deutschkurs in der<br />
Schule verpflichtet.“<br />
Hessen 2: Empfehlungen<br />
für das Schuleingangsverfahren<br />
22.08.2002. Auf<br />
Seite 3 heißt es: 3. Schulaufnahme:<br />
„Die Entscheidung<br />
über die Schulaufnahme, die<br />
in der Entscheidungskompetenz der<br />
Schulleiterin bzw. des Schulleiters<br />
liegt, wird wie bisher zeitnah zum<br />
Schuljahresbeginn getroffen. Die<br />
Beteiligung des schulärztlichen und<br />
gegebenenfalls des schulpsychologischen<br />
Dienstes besteht fort. Das Verfahren<br />
zur Feststellung der Schulfähigkeit<br />
liegt in der Verantwortung<br />
der Einzelschule, die festlegt, ob<br />
beispielsweise ein Kennenlerntag<br />
durchgeführt wird, Erzieherinnen<br />
und Erzieher einbezogen werden,<br />
Einzel- oder Kleingruppengespräche<br />
mit den Kindern geführt werden, der<br />
Schulpsychologische Dienst eingebunden<br />
wird und welche Instrumente<br />
eingesetzt werden.“<br />
Baden Württemberg 13.11.2002,<br />
Stuttgarter <strong>Zeitung</strong>: Als hervorragendes<br />
Leuchtturmprojekt bezeichnet<br />
Ministerpräsident Erwin Teufel<br />
(CDU) das Programm Sprachförderung<br />
im Kindergarten. ´Damit nehme<br />
Baden-Württemberg eine „Pionierrolle“<br />
für alle 16 Bundesländer<br />
ein. Mit den Tests und den Förderkursen<br />
für Kinder ein Jahr vor der<br />
Einschulung ziehe das Land nachhaltige<br />
Konsequenzen aus der Pisa-Studie`,<br />
pflichtet Kultusministerin<br />
Anette Schavan (CDU) bei. Kinder,<br />
die bei den Tests erhebliche Defizite<br />
zeigen, können ein halbes Jahr lang<br />
sechs Stunden pro Woche einen<br />
Sprachkurs belegen. Die Tests und<br />
die Kurse sind freiwillig. Die fünf<br />
Millionen Euro sind berechnet für<br />
25.000 Kinder pro Jahr. Ein Kurs soll<br />
pro Kind 240 Euro kosten. Damit<br />
ist ein Sechstel der Kosten noch offen.<br />
Dafür müssen möglicherweise<br />
die Eltern in die Tasche greifen.<br />
Die Beispiele über Sprachtests ließen<br />
sich beliebig fortsetzen. Sprachtests<br />
sind zum Allheilmittel nach PISA<br />
geworden. Diese Tests messen<br />
Schwächen von Kindern, halten<br />
Fehlleistungen fest. Eines hat PISA<br />
aber deutlich gezeigt: Wir brauchen<br />
Bildungsinstitutionen von Anfang<br />
an, die nicht aussondern, sondern<br />
alle mit einschließen: All-Included-<br />
Bildungsinstitutionen. Die Schulen<br />
und die Kitas dürfen nicht selektieren.<br />
Sie müssen Lernformen und<br />
Methoden finden, Kinder in ihren<br />
Stärken zu unterstützen. Wir müssen<br />
Schluss machen mit den Schuleingangstests,<br />
jedes Kind im Alter<br />
von sechs Jahren spätestens muss in<br />
die Schule aufgenommen werden.<br />
Keines darf zurückgestellt werden.<br />
Sprache wird nicht in externen Kursen<br />
erworben, Sprache wird im Zusammenhang<br />
des alltäglichen Lebens<br />
von Kindern vermittelt, ist Bildungsbegleitung<br />
und nicht gesondertes<br />
Lernen. Wir haben es in<br />
Deutschland geschafft, Kinder<br />
nach Behinderungen, Schwerstbehinderungen,<br />
Mehr-, Schwerfach-Behinderungen,<br />
geistig behindert,<br />
körperlich behindert,<br />
sehbehindert, Ausländer, Asylanten<br />
- aufzuteilen und auszusondern.<br />
Spätestens nach PISA<br />
muss damit Schluss sein.<br />
Professor Dr. Gerd E. Schäfer,<br />
Universität Köln, beschreibt den<br />
Teil der standardisierten Tests<br />
wie folgt: „Wenn man Bildungsqualität<br />
verbessern will, dann<br />
gelingt dies nicht dadurch, dass<br />
man in erster Linie klar definierte<br />
Standards ausweist, Lernstände<br />
überprüft und Förderziele<br />
festlegt. Das ist ein Lernverständnis<br />
aus den sechziger und<br />
siebziger Jahren. Diese Instrumente,<br />
deren grundsätzliche Bedeutung<br />
nicht bestritten wird,<br />
dienen dazu, einen Ist-Stand zu beschreiben,<br />
um eventuell daraus neue<br />
Ziele festzulegen. Sie können aber<br />
nichts darüber aussagen, wie man<br />
solche Ziele erreicht. Benachteiligungen<br />
ausgleichen, kulturelle Unterschiede<br />
berücksichtigen, auf individuelle<br />
Differenzen eingehen, das<br />
kann man nicht dadurch, dass man<br />
Leistungsziele erhöht, ihre Füllung<br />
überprüft und Defizite feststellt, sondern<br />
vor allem dadurch, dass man<br />
erfasst, was Kinder können, dass man<br />
sich darum bemüht, herauszubekommen,<br />
wo Bildungsprozesse im
Einzelfall ansetzen können, dass vorhandene<br />
Fähigkeiten anerkannt und<br />
nicht Defizite nachgewiesen werden,<br />
dass man Neugier der Kinder anspricht<br />
sowie die Interessen und<br />
Denkansätze ernst nimmt.“<br />
Deutschland nach PISA: Berlin,<br />
Sommer 2002: Die Kita-Gebühren<br />
werden nach oben gesetzt, der Erzieherschlüssel<br />
für den Hort wird verschlechtert,<br />
Leitungsanteile werden<br />
um zwanzig Prozent gekürzt. Brandenburg:<br />
Für den Landeshaushalt<br />
2003 werden mehrere Millionen<br />
Euro aus dem Kitabereich als Sparopfer<br />
gebracht.<br />
Beide Länder zeigen, dass sie die<br />
PISA-Ergebnisse überhaupt nicht<br />
verstanden haben. Im europäischen<br />
Kontext wird der Nulltarif für die<br />
Tageseinrichtungen für Kinder diskutiert<br />
und umgesetzt. Deutschland<br />
erhöht die Kitagebühren! - Und verschlechtert<br />
die Rahmenbedingungen.<br />
Die bildungspolitische Antwort<br />
auf PISA muss lauten: Die Rahmenbedingungen<br />
in den Tageseinrichtungen<br />
für Kinder auf europäisches<br />
Niveau bringen! Das heißt: zwei Erzieherinnen<br />
pro Gruppe á fünfzehn<br />
Kinder. Therapeuten, Psychologen,<br />
Sozialpädagogen in die Einrichtungen<br />
holen als fester Stamm. Eigene<br />
Verpflegung gehört ins Haus. Ein<br />
Drittel der Arbeitszeit muss Vor- und<br />
Nachbereitungszeit sein, zwei Drittel<br />
Dienst mit den Kindern! Leitungskräfte<br />
müssen ab sechzig Kindern<br />
freigestellt werden, um qualifiziert<br />
die Arbeit gestalten zu können,<br />
mit den Eltern und mit den ErzieherInnen.<br />
Zehn Tage verpflichtende,<br />
freigestellte Fortbildung unter Fortzahlung<br />
der Bezüge! Dies sind Rahmenbedingungen,<br />
die im europäischen<br />
Netzwerk für die Tageseinrichtungen<br />
für Kinder vor mehreren Jahren<br />
verabschiedet worden sind und<br />
zu deren Umsetzung sich die Länder<br />
verpflichtet haben.<br />
Deutschland im Jahre 1 nach PISA:<br />
Bund-Länder-Kommission, Dezember<br />
2002: Zum 3. Mal wird in der<br />
Bund-Länder-Kommission im Innovationsausschuss<br />
der Antrag des Landes<br />
Berlin zurückgewiesen, einen<br />
Modellversuch zur Reform der Erzieherausbildung<br />
durch die Bund-<br />
Länder-Kommission<br />
für Bildungsfragen<br />
zu<br />
finanzieren.<br />
Damit bleibt<br />
Deutschland<br />
weiterhin<br />
Schlusslicht in<br />
der europäischenErzieherinnen-Ausbildung:<br />
Die bildungspolitische<br />
Antwort nach<br />
PISA muss sein:<br />
Erzieherinnen auf Hochschulniveau<br />
auszubilden und schrittweise zu einer<br />
gemeinsamen Grundausbildung<br />
von ErzieherInnen und Lehrern zu<br />
kommen.<br />
Was sind nun unsere Antworten auf<br />
PISA, Antworten der Beschäftigten<br />
in den Tageseinrichtungen für Kinder<br />
im System der Kinder- und Jugendhilfe.<br />
Nach PISA: Gelassenheit<br />
und Reflektion. Gelassenheit deshalb,<br />
weil PISA Fünfzehnjährige<br />
untersucht und daraus Rückschlüsse<br />
gezogen hat, die sehr bedenklich<br />
sind in deren Interpretation auf die<br />
Kita-Landschaft, denn vor fünfzehn<br />
Jahren waren in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> relativ<br />
wenig Kinder in einer Tageseinrichtung<br />
für Kinder. Gelassenheit<br />
deswegen, weil wir bereits in den<br />
sechziger und siebziger Jahren Bildungsdiskussionen<br />
hatten in den Tageseinrichtungen,<br />
die im mathematischen<br />
Kompetenzbereich lagen und<br />
in der kognitiven Erziehung. Wir<br />
haben uns dieses Themas angenommen,<br />
aber die Rahmenbedingungen<br />
nicht bekommen, die für eine qualitativ<br />
gute Bildungsarbeit notwendig<br />
wären. Deshalb müssen wir mit der<br />
Gelassenheit konsequent unsere Veränderungen<br />
der Rahmenbedingungen<br />
einfordern. Reflektion: Wir<br />
müssen in unserer Arbeit konsequenter<br />
beobachten, dokumentieren,<br />
Kindern im Bildungsprozess gestaltend<br />
unter die Arme greifen. Wir<br />
müssen konsequenter den Abschied<br />
aus der Jahreszeiten- und Festtagspädagogik<br />
in Angriff nehmen. Die<br />
Qualitätsdebatte der letzten Jahre<br />
war der richtige Weg. Viele Qualitätshandbücher<br />
sind entstanden. Sie<br />
weiter zu entwickeln, sie in die Tat<br />
umzusetzen, wird ein spannender<br />
Prozess sein, der sich zur Zeit in vielen<br />
Einrichtungen vollzieht.<br />
Lassen wir uns von den Ergebnissen<br />
der Nationalen Qualitätsinitiative,<br />
die im Mai bekannt gegeben werden,<br />
positiv überraschen. Nehmen wir sie<br />
auf, bauen wir sie in unsere Alltagsarbeit<br />
ein. Wir brauchen Bundesstandards,<br />
die wir dann für unsere<br />
Einrichtungen runterbrechen. In der<br />
Einrichtung muss das Konzept für<br />
alle Kinder und der Bildungsplan für<br />
das einzelne Kind Stück für Stück<br />
bearbeitet werden. Dazu hat die<br />
<strong>GEW</strong> einen Entwurf vorgelegt. Der<br />
Rahmenplan frühkindlicher Bildung<br />
(Bildungsbuch) ist soeben erschienen<br />
und wir hoffen, dass die KollegInnen<br />
diesen Entwurf weiter entwickeln<br />
und wir so zu einer spannenden<br />
Entwicklung in den nächsten<br />
zwei Jahren kommen werden.<br />
Deshalb sagen wir aber auch: Wer<br />
von uns Bildung will, muss die Rahmenbedingungen<br />
drastisch verändern!<br />
Dies ist auch in dem Bildungsbuch<br />
mit aufgeführt. Wenn wir dokumentieren,<br />
wenn wir festhalten<br />
sollen, dann müssen wir Zeit für diese<br />
Dokumentation bekommen.<br />
Aber unsere Einforderung nach besseren<br />
Rahmenbedingungen muss<br />
organisierter als bisher erfolgen. Die<br />
<strong>GEW</strong> braucht dazu die tatkräftige<br />
Mitgliedschaft jeder Erzieherin, jedes<br />
Erziehers vor Ort. Im europäischen<br />
Kontext sind ErzieherInnen<br />
selbstverständlich Mitglieder einer<br />
Gewerkschaft. Dies sollte es in<br />
Deutschland auch werden!<br />
Zusammenfassend vier Punkte, die<br />
wir als ErzieherInnen aufgrund der<br />
Bildung von Anfang an<br />
III
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
IV<br />
Ergebnisse der PISA-Studie beherzigen<br />
sollten:<br />
1. Wir müssen einen Bildungsbegriff<br />
für die Altersstufe von null bis sechs<br />
Jahren definieren. Nicht von drei bis<br />
sechs, von null bis drei, von fünf bis<br />
sechs, sondern von null bis sechs!<br />
Diesen zusammen mit der Wissenschaft<br />
und der Praxis entwickeln und<br />
selbstbewusst vertreten.<br />
2. Wir müssen in unserer Arbeit verbindlicher<br />
werden: Den Lebenslauf<br />
des Kita-Kindes dokumentieren:<br />
Sprachentwicklung, Kunst und Malen,<br />
Zahlen und Zeichnen, Technik<br />
und Natur, Emotionalität und<br />
Selbstständigkeit. Einen Bildungsplan<br />
mit den Eltern erstellen vom<br />
Anfang bis zum Ende. Die Entwicklungsverläufe<br />
in Form und Text und<br />
Bild festzuhalten.<br />
3. Mehrsprachigkeit in unseren Einrichtungen<br />
akzeptieren. Herkunftssprache<br />
und deutsche Sprache gleichberechtigt<br />
verankern.<br />
4. Die Schule erkundigt sich in der<br />
Kita über den Verlauf der ersten sechs<br />
Lebensjahre. Wir und nicht imaginäre<br />
Schuluntersuchungen und/oder<br />
externe Tests geben Auskunft über<br />
den Lebensweg.<br />
5. Selbstbewusst unsere Arbeit nach<br />
außen hin vertreten und für bessere<br />
Rahmenbedingungen kämpfen.<br />
Denn beides, unsere Persönlichkeit<br />
und die Rahmenbedingungen, unter<br />
denen wir arbeiten, entscheiden<br />
heute über die Zukunft unserer Kinder.<br />
So bleibt die Frage, die an dieser Stelle<br />
dann immer kommt: Wer soll das<br />
bezahlen? Die Arbeiter und Angestellten,<br />
die Facharbeiter, die Beamten,<br />
sie bezahlen bereits mit ihren<br />
Steuern dieses Bildungssystem. Gewerbesteuer<br />
wird nicht mehr gezahlt,<br />
große Betriebe rechnen sich in ihren<br />
Steuerbeträgen so weit runter, dass<br />
sie keine Steuern der Gemeinde abführen<br />
müssen. Deshalb fordert die<br />
<strong>GEW</strong> eine Veränderung der Gewerbesteuer.<br />
Kommunen müssen wieder<br />
Geld bekommen. Und wir fordern<br />
eine Vermögenssteuer, die sozial gerecht,<br />
haushaltspolitisch geboten<br />
und bildungspolitisch unverzichtbar<br />
ist. Millionen zahlen Steuern - bald<br />
auch Millionäre. Dieses Geld - im<br />
Übrigen im europäischen Kontext<br />
völlig üblich - soll dann gezielt den<br />
Bildungsinstitutionen zugute kommen.<br />
In einer Untersuchung des DIW im<br />
August 2002 wird festgestellt, dass<br />
244.000 allein erziehende Mütter<br />
mit Kindern unter dreizehn Jahren<br />
1997 wie folgt Sozialhilfe empfangen<br />
haben:<br />
- Mütter mit Krippenkindern: 467<br />
Millionen DM,<br />
- Mütter mit Kindergarten-Kindern<br />
977 Millionen DM,<br />
- Mütter mit Hort-Kindern 1,4 Milliarden<br />
DM.<br />
Wenn ein Großteil dieser Mütter einen<br />
Kita-Platz bekommen würde,<br />
weil viele, sehr viele von ihnen arbeiten<br />
wollen (knapp ca. 90 % dieser<br />
Mütter würde gerne arbeiten gehen<br />
und kann dies aufgrund einer<br />
fehlenden Tageseinrichtung für Kinder<br />
nicht), würden Gelder wie folgt<br />
eingespart werden können:<br />
- Mütter mit Krippenkindern 437<br />
Millionen,<br />
- Mütter mit Kindergartenkindern<br />
675 Millionen,<br />
- Mütter mit Hortkindern 497 Millionen,<br />
so die Berechnung 1997.<br />
Wir hätten weitere Einnahmeeffekte<br />
durch zusätzliches Kita-Personal:<br />
94 Millionen Einkommenssteuereinnahmen<br />
durch den Einsatz von ErzieherInnen,<br />
wenn alle Kinder entsprechend<br />
in Tageseinrichtungen untergebracht<br />
wären. Die Sozialversicherungen<br />
würden sogar mit 7,8<br />
Milliarden DM Sozialversicherungseinnahmen<br />
zu verzeichnen haben.<br />
Dies zeigt: Wir müssen uns lösen<br />
von dem Gedanken, Kitas sind nur<br />
Bittsteller. Kitas sind Institutionen,<br />
die zum volkswirtschaftlichen Nutzen<br />
einer Republik beitragen.<br />
„Alle Erzieher (Eltern, Kindergärtner,<br />
Lehrer, Hochschullehrer) müssen<br />
wissen, was sie tun und warum<br />
sie es tun, und sie müssen von einer<br />
Gesellschaft unterstützt werden, die<br />
dafür streitet, der jeweils nachwachsenden<br />
Generation nicht die bequemsten,<br />
sondern die besten Bedingungen<br />
zu schaffen.“ (McKinsey)<br />
Zusammenfassend die bildungspolitische<br />
Antwort auf PISA mit den<br />
Worten Donata Elschenbroichs:<br />
„Kinder sind ein Schlüssel im Verständnis<br />
eines Landes, nicht nur die<br />
Sitten einer Gesellschaft, sondern<br />
auch ihre kollektive Intelligenz ihrer<br />
Zukunftsfähigkeit. Was wird investiert<br />
in die frühen Jahre jener Generation<br />
- wie viel Fürsorge in Form<br />
von Zeit, Phantasie, Geld sind sie<br />
den Erwachsenen wert? Welche Freiheiten<br />
gestatten sie den Heranwachsenden,<br />
bei welchen Gelegenheiten<br />
dürfen sie Nein sagen?“<br />
(Aus „Weltwissen der Siebenjährigen“)<br />
Es heißt im 11. Kinder- und Jugendbericht<br />
der Bundesregierung: „Alle in<br />
Deutschland lebenden Kinder und<br />
Jugendlichen haben ein Recht auf<br />
umfassende Teilhabe an und ungehinderten<br />
Zugang zu den sozialen,<br />
ökonomischen, ökologischen und<br />
kulturellen Ressourcen der Gesellschaft.<br />
Die Einlösung dieses Rechts<br />
ist Aufgabe und sollte Ziel aller Politik-<br />
und gesellschaftlichen Bereiche<br />
in Deutschland sein. PISA hat festgestellt,<br />
dass soziale Ungleichheit in<br />
Deutschland im Bildungssystem gestärkt<br />
wird: Es ist Aufgabe aller Beschäftigten<br />
im Bereich der Tageseinrichtungen<br />
für Kinder, dafür zu sorgen,<br />
dass Chancengleichheit und soziale<br />
Gerechtigkeit in den Bildungsinstitutionen<br />
hergestellt werden.“<br />
Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung<br />
- Bildung von Anfang an.<br />
Das ist der Auftrag, den wir als ErzieherInnen<br />
im System der Kinderund<br />
Jugendhilfe haben.<br />
Wichtige <strong>GEW</strong>-Adressen:<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> · Landesgeschäftstelle<br />
Neubrunnenstraße 8 · 55116 Mainz<br />
Tel.: 0 61 31 / 2 89 88 - 0<br />
Fax: 0 61 31 / 2 89 88 - 80<br />
E-Mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.de<br />
www.gew-rheinland-pfalz.de<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> · Regionalbüro Nord<br />
Hohenzollernstraße 64 · 56056 Koblenz<br />
Tel.: 02 61 / 13 32 880 · Fax: 02 61 / 13 32 881<br />
E-Mail: gew-nord@<strong>GEW</strong>-<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.de<br />
<strong>GEW</strong> <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> · Regionalbüro Süd<br />
Logenstraße 10 · 67655 Kaiserslautern<br />
Tel.: 06 31 / 3 61 28 75<br />
Fax: 61 31 / 3 61 28 77<br />
E-Mail: gew-sued@<strong>GEW</strong>-<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.de<br />
VB Jugendhilfe und Sozialarbeit:<br />
Erni Schaaf-Peitz<br />
Raiffeisenstr. 2a · 54516 Wittlich<br />
Tel.: 0 65 71 / 67 36 · Fax: 06571 / 26 07 63<br />
schaaf-peitz@t-online.de
Berichte aus den Arbeitsgruppen<br />
AG 1: Interkulturelle Kompetenz frühzeitig entwickeln<br />
Die Referentin Sanem Kleff, Mitglied<br />
im Bundesausschuss für multikulturelle<br />
Angelegenheiten der <strong>GEW</strong>, berichtete<br />
den pädagogischen Fachkräften aus<br />
Kindertagesstätten, Horten und Schulen<br />
in der Arbeitsgruppe „Interkulturelle<br />
Kompetenz frühzeitig entwickeln“,<br />
dass interkulturelles Lernen zu einer der<br />
wichtigsten Schlüsselqualifikationen<br />
der Zukunft zählt.<br />
Gemeinsam wurde in der Arbeitsgruppe<br />
erarbeitet, dass interkulturelle Kompetenz<br />
eine Grundlage ist, die jeder<br />
Mensch benötigt, da unsere Gesellschaft<br />
- und damit auch die Kitas und Schulen<br />
- aus sehr unterschiedlichen multikulturellen<br />
Gruppen besteht.<br />
Die Aufgabe von pädagogischen Fachkräften<br />
muss sein, die Voraussetzungen<br />
für interkulturelles Lernen zu schaffen.<br />
Vor allem, da durch lernpsychologische<br />
Quellen bekannt ist, dass solche Grundlagen<br />
in der frühesten Kindheit gelegt<br />
werden. Denn gerade in dieser Zeit sind<br />
Kinder offen, um Andersartigkeit<br />
wahrzunehmen und zu akzeptieren,<br />
was für das spätere Leben in unserer<br />
multikulturellen Gesellschaft von enormer<br />
Bedeutung ist.<br />
An Hand dieser Tatsache reicht es als<br />
Erzieher und Lehrer nicht aus, z.B.<br />
Lieder anderer Sprachen zu singen, oder<br />
ausländische Gerichte zu kochen. Interkulturelles<br />
Lernen darf ebenfalls<br />
nicht als ein starres, fertiges Konzept mit<br />
alleinigem Erlernen der deutschen Sprache<br />
verstanden werden. Die Schlüsselqualifikation<br />
der interkulturellen Kompetenz<br />
zeigt sich vielmehr in allen Situationen<br />
des pädagogischen Alltags<br />
und bezieht sich somit auf alles, was<br />
anders sein kann (z.B. die Sprache, die<br />
Religion, das familiäre Umfeld, der Migrationshintergrund<br />
usw.).<br />
Ebenfalls hat interkulturelles Lernen<br />
viel mit Emotionen, Wahrnehmung von<br />
Gemeinsamkeiten und Andersartigkeit,<br />
Kommunikationsfähigkeit und der<br />
Fähigkeit zum Zuhören zu tun. Da die<br />
Akzeptanz von Andersartigkeit in unserer<br />
Gesellschaft bisher nicht zufriedenstellend<br />
erfolgt und damit sich dieses<br />
Wissen und die Wichtigkeit über interkulturelle<br />
Lernen verbreitet, hat die<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
in Zusammenarbeit mit der<br />
Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam<br />
das Material „Das Bin Ich - international“<br />
entwickelt und im Jahr 2001 herausgegeben.<br />
Dieses pädagogische Konzept „Das Bin<br />
Ich - international“ wurde speziell für<br />
Bildung von Anfang an<br />
Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter<br />
entwickelt. Kinder und Erwachsene<br />
aus vier europäischen Ländern<br />
(Dänemark, Deutschland, Luxemburg<br />
und Niederlande) waren mit<br />
in die Entstehung dieses Materials eingebunden.<br />
Berichtet wird darin über Themen aus<br />
dem Alltag von Kindern zwischen vier<br />
und acht Jahren, die aus einem dieser<br />
vier Länder stammen. Jedes Kind<br />
kommt aus einem anderen familiären<br />
Umfeld, mit verschiedenen Erfahrungen,<br />
teils mit Migrationshintergrund<br />
und daher anderer Sprache und Kultur.<br />
Andersartigkeiten ( z.B. Mehrsprachigkeit,<br />
ungewohnte Kleidung, usw.)<br />
werden nicht verschwiegen, sondern in<br />
Lautschrift und auf Fotos gezeigt. Der<br />
Hauptschwerpunkt liegt jedoch darin,<br />
Andersartigkeit zu akzeptieren und<br />
dennoch Gemeinsamkeiten zu erkennen.<br />
Zum Beispiel spielt das Thema<br />
„Angst“ im Leben eines jeden Kindes<br />
eine Rolle, egal, woher es stammt und<br />
wo es lebt. Jedes Kind kann individuell<br />
etwas zu diesem Thema berichten<br />
und somit stolz auf seine Herkunft sein<br />
und so Selbstwertgefühl entwickeln.<br />
Gleichzeitig wird das Zusammengehörigkeitsgefühl<br />
in der Gruppe gesteigert<br />
und die Gefühle und Meinungen von<br />
anderen Kindern werden wahrgenommen.<br />
Weiterhin ermöglichen die Geschichten,<br />
eine positive Haltung zur Mehrsprachigkeit<br />
einzunehmen und gegenseitigen<br />
Respekt und Akzeptanz zu erfahren.<br />
Es ist dennoch nicht das Ziel dieses pädagogischen<br />
Materials, alles zu generalisieren<br />
und gleichzusetzen. Jedes Kind<br />
muss als Individuum geschätzt werden<br />
und lernen, Andersartigkeit zuzulassen,<br />
gleichzeitig jedoch auch zu erkennen,<br />
dass Menschen trotz Unterschiedlichkeiten<br />
vieles verbindet.<br />
Das Materialpaket „Das Bin Ich - International“<br />
enthält:<br />
- 12 Kniebücher (Geschichten mit<br />
ganzseitigen, großformatigen Fotos, der<br />
Text wird auf der jeweils folgenden Seite<br />
vorgelesen (zum Teil mit Lautschrift),<br />
V
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
VI<br />
- CD mit ausgewählten zweisprachigen<br />
Kniebuchgeschichten,<br />
- CD mit Liedern und Musik, die auf<br />
die jeweilige Kindergruppe abgewandelt<br />
werden können,<br />
- Handpuppengeschichten zur Vertiefung<br />
der Geschichten und Themen<br />
zum Einsatz als Kommunikationsmedium,<br />
AG 2: Offene Konzeption in der KiTa als Bildungschance<br />
Regina Braun, die Fachfrau für Offene<br />
Arbeit, war Referentin der Arbeitsgemeinschaft<br />
„Bildung als aktive Wahrnehmung<br />
mit Blick aus dem offenen<br />
Fenster“.<br />
Gespannt warteten alle Teilnehmerinnen<br />
der am stärksten frequentierten<br />
Arbeitsgemeinschaft auf das, was Regina<br />
Braun zum Thema Bildung und<br />
offene Arbeit zu erzählen hatte.<br />
Denn eines ist sicher: Niemand kann<br />
so anschaulich und mitreißend über<br />
Erfahrungen aus den offenen Konzeptionen<br />
erzählen wie Regina Braun. Als<br />
eine der ersten ErzieherInnen, die ein<br />
offenes Haus leitete, praktizierte sie<br />
über zehn Jahre die offene Konzeption<br />
und steht jetzt mit ihrer großen praktischen<br />
Erfahrung immer mehr Einrichtungen<br />
und Veranstaltungen als<br />
Referentin zur Verfügung.<br />
Zunächst bekamen die Teilnehmerinnen<br />
eine ausführliche und professionelle<br />
Ausführung dessen, was Regina<br />
Braun unter Bildungserfahrungen in<br />
Kindertagesstätten versteht.<br />
- Ideenbuch mit hilfreichen Anregungen<br />
für die Praxis, Erläuterungen und<br />
Hilfestellungen zu den einzelnen Kniebüchern,<br />
Liedern, Geschichten und<br />
CD‚s,<br />
- Video als Hilfe für Erwachsene zum<br />
Einsatz des Materials bei pädagogischen<br />
Fachkräften,bzw. als Elterninformation.<br />
Schwerpunkte waren:<br />
• Kinder brauchen verlässliche Beziehungen<br />
zu Erwachsenen und zu anderen<br />
Kindern.<br />
• Die Räume einer Einrichtung sollen<br />
zu komplexen Bildungserfahrungen<br />
anregen.<br />
• Die Zumutung von Themen, die auf<br />
prozessartige Weise an die Kinder herangetragen<br />
werden.<br />
• Erwachsene, die auf die Fragen der<br />
Kinder eingehen und „anwesend“ sind.<br />
• PädagogInnen, die ihren eigenen Bildungsprozess<br />
hinterfragen und nicht<br />
stehen bleiben.<br />
Die Schwerpunkte wurden anschließend<br />
mit der Gruppe gemeinsam inhaltlich<br />
weiter ausgebaut. Dabei ergaben<br />
sich folgende Fragen zur Bildungsarbeit<br />
in offenen Einrichtungen:<br />
• Wie kann Bildung in Projekten der<br />
offenen Konzeption ihren Platz finden?<br />
• Wie kann eine gute Beziehungsarbeit<br />
im oftmals hektischen Alltag stattfinden?<br />
• Wie macht sich eine Regeleinrichtung<br />
auf den Weg zur offenen Einrichtung?<br />
Nähere Informationen zum Material<br />
„Das Bin Ich - International“ unter:<br />
Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft,<br />
Postfach 102752, 45027 Essen<br />
Ebenfalls entstanden sind:<br />
1995: „Das Sind Wir“, Alter: 9 bis 12<br />
Jahre<br />
1999: „Das Schaff Ich Schon“, Alter:<br />
14 bis 18 Jahre<br />
Marina Fischer<br />
• Wie lassen sich Räume zu bildungsund<br />
kindgerechten Orten einrichten?<br />
Die Fragen wurden anschließend in<br />
Kleingruppen bearbeitet, danach im<br />
Plenum vorgestellt und von Regina<br />
Braun inhaltlich ergänzt:<br />
Ein zentraler Punkt in offenen Einrichtungen<br />
bildet die Projektarbeit. Projekte<br />
sollten mit den Kindern gemeinsam<br />
entwickelt werden nach dem Motto:<br />
„learning by doing!“<br />
Projekte sind nicht einfach von den<br />
ErzieherInnen ausgedacht, sondern sie<br />
beruhen auf ständiger situativer Beobachtung<br />
der Kinder und ihrer Themen,<br />
mit denen sie sich gerade beschäftigen.<br />
Die Kinder sind die primären Forscher,<br />
und die PädagogInnen sind die Begleiter.<br />
Selbstverständlich füllt eine gute<br />
Erzieherin die laufenden Projektschritte<br />
mit ihrem Wissen und eröffnet somit<br />
neue Bildungschancen für die Kinder.<br />
Gerade in der offenen Pädagogik hat<br />
die Pädagogin Zeit zum Zuhören, zum<br />
Einfühlen, zur Begleitung des Kindes<br />
und kann somit verlässliche Beziehungen<br />
aufbauen.<br />
Die offene Konzeption bietet dadurch<br />
eine Chance für gute Bindungsarbeit,<br />
aus der im Laufe der Zeit Bildungsarbeit<br />
entsteht.<br />
Auf dem Weg zur offenen Konzeption<br />
sollten sich die ErzieherInnen unbedingt<br />
durch TeamfortbildnerInnen,<br />
„Ein Raum, in dem die<br />
Erzieherin ständig reglementieren<br />
muss, ist<br />
falsch und nicht nach<br />
den Bedürfnissen der<br />
Kinder eingerichtet.“<br />
Regina Braun
SupervisorInnen und geeignete Fortbildungsinstitute<br />
unterstützen lassen. Sie<br />
benötigen die professionelle Unterstützung,<br />
um geeignete Überzeugungsarbeit<br />
in ihrem Umfeld (Träger, Elternausschuss,<br />
Elternschaft etc.) leisten zu<br />
können.<br />
AG 3: Lernwerkstatt Naturspielraum<br />
„Die Natur will, dass die Kinder sie selbst<br />
sind, bevor sie zu Erwachsenen werden.“<br />
Jean-Jacques Rousseau<br />
Mit elementaren Entwicklungs- und<br />
Bildungsprozessen im Zusammenspiel<br />
von innerer und äußerer Natur beschäftigte<br />
sich eine Arbeitsgruppe mit<br />
dem Diplom-Pädagogen Dr. Richard<br />
Wagner als Referenten. Bereits zu Beginn<br />
wurde den TeilnehmerInnen klar,<br />
dass in dieser Fortbildung nicht die<br />
Umgestaltung des Außengeländes ihrer<br />
jeweiligen Kita thematisiert, sondern<br />
grundsätzliche konzeptionelle Überlegungen<br />
der pädagogischen Arbeit<br />
„innen und außen“ erarbeitet werden<br />
sollten.<br />
Verknüpfend mit dem Impulsreferat<br />
von Anne Heck am Vormittag betonte<br />
der Referent den sozial-ökologischen<br />
Kontext der elementarpädagogischen<br />
Lebens- und Spielräume.<br />
Wenn das Lernen eine ureigene, subjektive<br />
Leistung des Kindes ist, dann<br />
sind zwei Aspekte zu klären:<br />
1. Die Frage nach der Lernkompetenz<br />
der Kinder ist grundlegend als Frage<br />
nach der Identitätsbildung, d.h. nach<br />
den Bedingungen der kognitiv-emoti-<br />
Ebenfalls gibt es seit einiger Zeit geeignete<br />
Fachliteratur zur offenen Pädagogik,<br />
die fundiertes Wissen und Diskussionskompetenz<br />
vermittelt.<br />
Zum Schluss bekamen die Teilnehmerinnen<br />
von der Referentin noch einen<br />
„DENKZETTEL“ (Ein Thesenpapier,<br />
onalen Entwicklung des Kindes zu stellen.<br />
2. Die Rolle der Erwachsenen, die als<br />
Eltern und PädagogInnen die Entwicklung<br />
begleiten, ist in der Richtung neu<br />
zu bestimmen, dass sie die Lernkompetenz<br />
der Kinder nicht untergraben, sondern<br />
kompetent werden, die kindlichen<br />
Lern-Interessen wahrzunehmen, zu<br />
begleiten und zu bestärken.<br />
Die folgenden Überlegungen zum Thema<br />
„Lernwerkstatt Natur-Spiel-Raum“<br />
sehen die Ausbildung des kindlichen<br />
Ichs als einen Prozess der produktiven<br />
Aneignung und aktiven Auseinandersetzung<br />
mit der äußeren Realität, d.h.<br />
den materiellen und sozialen Lebensbedingungen,<br />
die die Umwelt als Lebensraum<br />
bilden.<br />
Verstädterung, Ballungsräume mit extrem<br />
hohen Wohndichten und ghettohafte<br />
soziale Brennpunkte im urbanen<br />
Raum stehen neben einer Umwandlung<br />
ländlicher Regionen zu Wohnstätten<br />
und Verkehrsräumen.<br />
Auf diesem Hintergrund ist die Frage<br />
nach dem Funktions- und Selbstverständnis<br />
kindorientierter naturnaher<br />
Spielraumgestaltung als eine elementarpädagogische<br />
Frage zu formulieren.<br />
Denn für die Sozialisation von Vorschulkindern<br />
ist die Kita selbst als die<br />
Umwelt, d.h. der Lebensraum für die<br />
Bildung von Anfang an<br />
das die inhaltlichen Schwerpunkte offener<br />
Bildungsarbeit anschaulich darstellt)<br />
verpasst.<br />
Minette Petri<br />
potentiellen Lern- und Erfahrungsprozesse<br />
der Kinder zu untersuchen. Vor<br />
allen pädagogischen Aktivitäten bestimmt<br />
die Struktur des kindlichen<br />
Spiel- und Erfahrungsraums das Bild,<br />
das Kinder von ihrer Umwelt und sich<br />
selbst entwickeln können.<br />
Das Konzept „Lernwerkstatt Natur-<br />
Spiel-Raum“ stellt die ErzieherInnen<br />
vor eine zweifache Herausforderung:<br />
Sie begreifen sich selbst als Lernende,<br />
die in der sozial-ökologischen Gestaltung<br />
ihres Arbeitsfeldes an der eigenen<br />
Erfahrungsfähigkeit arbeiten.<br />
Der Aufbau der Lernwerkstatt Naturspielraum<br />
eröffnet den ErzieherInnen<br />
Partizipationschancen, an der Gestaltung<br />
ihrer eigenen Lebensgrundlagen<br />
kreativ mitzuwirken.<br />
Nach der Erarbeitung dieser Punkte<br />
beleuchtete nun Dr. Richard Wagner<br />
‚„das kompetente Kind“ und erläuterte<br />
die evolutiven Grundlagen der kindlichen<br />
Selbstentwicklung.<br />
Aus der Sicht der evolutiven Anthropologie<br />
ist das Kind ein Naturwesen,<br />
das von Geburt an drei Grundvoraussetzungen<br />
für die Entwicklung seiner<br />
Persönlichkeit besitzt:<br />
a) die genetisch vorgegebene Grobstruktur<br />
des Gehirns<br />
b) das Erkundungsverhalten und<br />
c) das Bindungsverhalten.<br />
Das Konzept der Lernwerkstatt Naturspielraum<br />
basiert auf der Grundannahme,<br />
dass die Grundlagen der kindlichen<br />
Entwicklung in der Evolution der Gattung<br />
Mensch geschaffen worden sind.<br />
Das menschliche Gehirn hat sich evolutiv<br />
in drei Phasen herausgebildet:<br />
• Stammhirn (Reptiliengehirn: steuert<br />
Instinkt, Sexualität, Körperfunktionen)<br />
• Limbisches System (das ältere Säugetiergehirn:<br />
verarbeitet Impulse/Reize<br />
von außen zu Emotionen- emotionale<br />
Intelligenz/Kompetenz wird entwickelt)<br />
• Neokortex ( jüngeres Säugetiergehirn:<br />
VII
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
VIII<br />
ermöglicht Sprache, reflexives Denken,<br />
Abstraktion).<br />
Von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr<br />
durchläuft das kindliche Gehirn<br />
eine gestufte Entwicklung.<br />
Nun kommen wir zur Verknüpfung<br />
zum Impulsreferat von Anne Heck :<br />
J. Piaget beschreibt die kindliche Entwicklung<br />
als einen stufenförmig sich<br />
vollziehenden Prozess: Der kindliche<br />
Organismus und die Umwelt wirken<br />
beide aufeinander ein und streben ein<br />
Gleichgewicht an. Dieses Gleichgewicht<br />
vollzieht sich in drei Austauschprozessen:<br />
1. Der kindliche Organismus verleibt<br />
sich Gegebenheiten seiner Umwelt ein<br />
(Assimilation)<br />
2. Der kindliche Organismus passt sich<br />
Gegebenheiten seiner Umwelt an (Akkomodation).<br />
3. Der kindliche Organismus organisiert<br />
seine Strukturen neu (Organisation)<br />
Mit jedem neuen Zyklus von Assimilation,<br />
Akkomodation und Organisation<br />
wird die Aktivität des Individuums<br />
höher strukturiert. Die gesamte Entwicklung<br />
des Kindes und insbesondere<br />
seine emotional-kognitive ist eine Abfolge<br />
strukturell verschiedener Perioden.<br />
Die Perioden treten auf das Alter bezogen<br />
variabel auf und dauern unterschiedlich<br />
lang an. Die Abfolge der Stufen<br />
ist jedoch genetisch fixiert.<br />
Bis zum Alter von ca. 10 - 12 Jahren<br />
entwickelt sich das Gewebe des limbischen<br />
Systems in der alltäglichen leibsinnlich<br />
vermittelten Interaktion, die<br />
das Kind mit den Personen, Dingen<br />
und Vorgängen realisiert. Die neuronalen<br />
Netze des limbischen Systems bilden<br />
die Grundlage für die Entwicklung<br />
des Neokortex. Die evolutive Regel lautet:<br />
Je differenzierter und reichhaltiger<br />
die Strukturen des limbischen Systems<br />
sich entwickeln, desto stimmiger wird<br />
das Selbst- und Weltbild des Kindes und<br />
schöpferischer sein Welterkunden.<br />
Die Herausbildung des limbischen Systems<br />
ist die zentrale Entwicklungsaufgabe<br />
des ersten Lebensjahrzehnt des<br />
Kindes.<br />
Nun zur Bedeutung der pädagogischen<br />
Arbeit in der Kita und vor allem auch<br />
in der Entwicklung des Außengeländes<br />
als gleichwertigem Spielraum zu den<br />
Spielräumen im Haus:<br />
Die Entwicklungsbedingungen können<br />
„draußen“ viel reichhaltiger sein, als es<br />
„drinnen“ je zu schaffen ist (auch das<br />
abstrakte Bild wurzelt im Konkreten).<br />
Prof. Dr. Gert Schäfer sagt: „Ein Kind,<br />
das viele Dinge wahrnehmen kann,<br />
knüpft viele Beziehungen zu den Dingen“.<br />
Die Lernwerkstatt<br />
Kindertagesstätte oder:<br />
spielend leben lernen<br />
Die Grundform kindlicher Entwicklung<br />
ist das sinnenvolle, eigensinnige<br />
Spiel. Wenn Kinder in Naturspielräumen<br />
ihres Nahbereichs Hütten bauen,<br />
bauen sie sich selbst. Wenn Kinder im<br />
Außengelände mit Wasser, Sand und<br />
Erde spielen, spüren sie sich selbst. Wenn<br />
Kinder im Naturspielraum Pflanzen<br />
und Tiere erleben, erleben sie sich selbst.<br />
Im freien Spiel in kindgemäß gestalteten<br />
Spielräumen entwickeln Kinder Beziehungen<br />
zu anderen Kindern, zu<br />
Dingen, zu Naturphänomenen und<br />
AG 4: Bindung als Voraussetzung für Bildung<br />
Ulricke Geiß-Maaß war Referentin der<br />
Arbeitsgemeinschaft „Bildungschancen<br />
in altersgemischten Gruppen“<br />
Und dass es Ulricke Geiß-Maaß war,<br />
das war gut so. Denn die Diplom-Pädagogin<br />
aus Schornsheim war einer von<br />
mehreren Glücksgriffen in Bezug auf<br />
die <strong>GEW</strong>-Fachtagung in Trier. Höchst<br />
engagiert und außerordentlich kompetent,<br />
führte sie die gut besuchte Arbeitsgemeinschaft<br />
in gut zwei Stunden durch<br />
das Thema „Bildungschancen in altersgemischten<br />
Gruppen“.<br />
Zu Beginn wurde die Frage aufgeworfen,<br />
was denn überhaupt mit dem Begriff<br />
Bildung, insbesondere angewendet<br />
auf Kindertageseinrichtungen, gemeint<br />
sei. Ulricke Geiß-Maaß informierte<br />
über einige Eckpunkte aus der<br />
aktuellen Bildungsdebatte. Nach intensivem<br />
Austausch war man sich am<br />
Ende über folgende Ausgangslage einig:<br />
* Bildung ist etwas sehr Komplexes,<br />
schwer Greifbares. Es hat nichts mit<br />
Eintrichtern von Wissen zu tun. Beispielesweise<br />
ist das stupide Ausfüllen<br />
Naturelementen.<br />
Zum Abschluss der Arbeitsgruppe warf<br />
Dr. Richard Wagner Fragen zum Thema<br />
in die Runde „Lernen am Modell“:<br />
Welche lebenspraktischen Tätigkeiten<br />
erleben Kinder in ihrem Nahbereich<br />
und inwieweit können sie an diesen<br />
Handlungsabläufen partizipieren?<br />
Welche Widerstände müssen wir aufbrechen,<br />
um lebenspraktischen Ansätzen<br />
im Elementarbereich mehr als den<br />
Status des unverbindlich Exotischen<br />
zuzumessen?<br />
Wo können wir im Kita-Alltag Modell<br />
sein?<br />
Wie gehen wir mit den Dingen, Situationen,<br />
KollegInnen, Kindern im Kita-<br />
Alltag um?<br />
Wie sieht grundsätzlich unser Bild von<br />
der Kita aus?<br />
Wie sehen wir das Verhältnis Gesellschaft-Kind?<br />
Wo schaffen wir limbische Räume für<br />
Entfaltung der Kinder, für unsere eigene<br />
Weiterentwicklung?<br />
Mit diesen diskussionsanregenden Fragen<br />
für Teamgespräche in der Kita gingen<br />
die einzelnen TeilnehmerInnen<br />
nach Hause bzw. in ihre Kita zurück,<br />
jedoch mit der Botschaft von Dr.<br />
Richard Wagner gestärkt:<br />
„Die Kindertagesstätte als ‚Heimat‘ (Jedes<br />
Kind braucht ein Dorf):<br />
Im alltäglichen Entdecken, Staunen,<br />
Fragen, Handeln, Beobachten, Sprechen<br />
lustvoll dem Leben und sich selbst<br />
auf die Schliche zu kommen, ist nur<br />
möglich, wenn sich Gleichgesinnte treffen-<br />
nicht Gleichmächtige-, die täglich<br />
einen Blick in das Land werfen wollen,<br />
in dem noch keiner war, das jedoch<br />
in allem Tun täglich aufschimmern<br />
kann.“<br />
Erni Schaaf-Peitz<br />
von irgendwelchen Arbeitsbögen noch<br />
lange kein Bildungsprozess. „Beschränkten<br />
wir Bildung darauf“, so<br />
Geiß-Maaß, „unterforderten wir unsere<br />
Kinder mit Sicherheit.“<br />
* Bildung geschieht in Kindertageseinrichtungen<br />
im Wesentlichen durch Begleitung<br />
sowie Förderung der individuellen<br />
Lernprozesse des Kindes.<br />
An vielen Beispielen, auch aus der aktuellen<br />
Praxis der TeilnehmerInnen,<br />
wurde anschaulich verdeutlicht, warum<br />
es in altersgemischten Gruppen so
viel leichter fällt das Ideal der Förderung<br />
von individuellen Lernprozessen<br />
zu verwirklichen. Kleinste Alltagssituationen<br />
führen beispiels-weise oftmals<br />
zum größten Erfolg. Und Alltagssituationen,<br />
die die Kinder angehen, entstehen<br />
nun einmal dort, wo möglichst viele<br />
und möglichst unterschiedliche Lebensäußerungen<br />
aufeinander treffen, wo<br />
vielfältigste Erfahrungen ausgetauscht<br />
werden können. Diese Aspekte zeigen<br />
die besonderen Chancen von altersgemischten<br />
Gruppen auf.<br />
Aber was ist das denn eigentlich, eine<br />
altersgemischte Gruppe? Zunächst<br />
einmal muss gesagt werden, dass seit den<br />
Siebzigern altersgemischte Gruppen in<br />
Deutschland die Regel sind. Denn die<br />
Betreuung von Kindern von drei bis<br />
sechs Jahren in Gruppen ist natürlich<br />
bereits eine Altersmischung. Mit dem<br />
Projekt des „Hauses für<br />
Kinder“, an dem Ulricke<br />
Geiß-Maaß maßgeblich<br />
beteiligt war, erhielt<br />
die sogenannte<br />
„große Altersmischung“<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong><br />
Einzug. Auch andere<br />
Ausdrücke waren und<br />
sind üblich. So ist häufig<br />
von alterserweiterten<br />
Gruppen, Kindergemeinschaftsgruppen<br />
oder auch von Familiengruppen die<br />
Rede. Alle meinen sie das Gleiche: Eine<br />
Öffnung der Einrichtungen für ältere<br />
und jüngere Kinder.<br />
Im Folgenden wurden viele Aspekte und<br />
Notwendigkeiten bei der Errichtung<br />
solcher Gruppen diskutiert, wobei die<br />
fundierten Kenntnisse der Referentin<br />
über das Projekt „Haus für Kinder“<br />
absolut hilfreich waren.<br />
Ein Schwerpunkt der Diskussion wurde<br />
auf Grund seiner besonderen Bedeutung<br />
zu Recht die Frage der Eingewöhnung.<br />
Geiß-Maaß stellte das Eingewöhnungsmodell<br />
auf Grundlage der Bindungstheorie<br />
vor. Diese geht davon aus,<br />
dass Bindung die Voraussetzung für<br />
Bildung ist. Von einem sogenannten Sicherheitspolster<br />
durch Bindung, (durch<br />
durchdachte Eingewöhnung bewerkstelligt)<br />
profitiert das Kind seine gesam-<br />
AG 5: Kinder mit und ohne Behinderung<br />
Mit der Forderung nach gemeinsamer<br />
Erziehung aller Kinder eröffnete die<br />
Diplom-Psychologin Anne Heck ihre<br />
Ausführungen über Bildungsprozesse in<br />
integrativen Gruppen und ermöglichte<br />
den Teilnehmerinnen der Arbeitsgruppe<br />
in den folgenden zwei Stunden<br />
einen umfassenden Einblick in ihre<br />
langjährige Praxisforschung.<br />
Dabei bezog sie sich auf Theorieaspekte<br />
zum aktuellen Bildungsverständnis<br />
von Kindern, welche auf wissenschaftlichen<br />
Untersuchungen basieren und<br />
auch die Grundlage ihres Vortrages am<br />
Vormittag darstellten:<br />
1. Das Kind muss nicht gebildet werden,<br />
es bildet sich selbst.<br />
Ausgangspunkt des aktiven Sich-Selbst-<br />
Bildens ist das, was das Kind wahrnimmt.<br />
Als Grundlage für seine Selbstbildungsprozesse<br />
braucht es komplexe<br />
Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten.<br />
Die Wahrnehmung ist dabei<br />
als ein Konstruktionsprozess zu sehen<br />
und nicht als bloße Abbildung der äußeren<br />
Realität im Kopf des Kindes.<br />
2. Prozesse wechselseitiger Anerkennung<br />
sind notwendige Bedingungen für<br />
die Qualität der Selbstbildungsprozesse<br />
der Kinder.<br />
Werden Kinder von Erwachsenen anerkannt,<br />
machen sie sich auf den Weg,<br />
um die Welt zu verstehen.<br />
* Grundlage für wechselseitige Anerkennung<br />
sind die frühen Bindungsbeziehungen.<br />
Darauf gründen sich die<br />
Interaktionen zwischen Erwachsenen<br />
und Kindern, die ihrerseits in der Haltung<br />
der emotionalen Zuwendung<br />
wichtige Voraussetzungen für Bildungsprozesse<br />
darstellen.<br />
* Kindliche Bildungsprozesse sind ei-<br />
Bildung von Anfang an<br />
te Kindertagesstättenzeit und darüber<br />
hinaus. Doch braucht erfolgreiche Eingewöhnung<br />
auch Zeit. Ein Kind kann<br />
natürlich nicht nach einem einzigen<br />
Tag seine KiTa als Heimat begreifen.<br />
Möglicherweise braucht es eine Woche,<br />
vielleicht aber auch deren drei. Es ist<br />
unabdingbar, dass sich Eltern wie ErzieherInnen<br />
diese Zeit nehmen. Es muss<br />
ihnen klar sein, dass sich Kinder nur<br />
dort gut entwickeln, wo sie sich zu<br />
Hause fühlen, eine Heimat spüren, wo<br />
sie (wie ein Schiff in seinem Heimathafen)<br />
andocken können. So wird die<br />
Grundlage für alles Weitere geschaffen.<br />
Im Gegenzug können die Kinder nach<br />
erfolgreicher Eingewöhnung die größtmögliche<br />
Freiheit einer Kindertageseinrichtung<br />
für ihre Entwicklung nutzen.<br />
Es stehen dann den Kindern in altersgemischten<br />
und erst recht in alterserweiterten<br />
Gruppen unschätzbare Erfahrungswerte<br />
offen. Sie erwerben sich<br />
die Fähigkeit<br />
* mit verschiedenen Menschen unterschiedlichen<br />
Alters umzugehen,<br />
* sie erfahren Chancengleichheit,<br />
* sie lernen Ausgrenzungen zu vermeiden<br />
bzw. abzubauen,<br />
* sie lernen mit allen Beteiligten zu<br />
kooperieren und<br />
* für sich und andere Verantwortung<br />
zu übernehmen.<br />
Na, wenn das keine Perspektiven sind.<br />
pbg<br />
gen-sinnige Konstruktionen und nicht<br />
sofort und unmittelbar zu verstehen, so<br />
dass eine Haltung der kognitiven Achtung<br />
erforderlich ist, um Bildungsprozesse<br />
zu unterstützen.<br />
* Bildung von Kindern in einer Kindergruppe<br />
beruht auf Ko-Konstruktionen.<br />
Im Miteinander stellen sich Kinder<br />
den Fragen und Herausforderungen<br />
der Welt, schaffen sich Probleme<br />
und erarbeiten sich Lösungen. Die Erwachsenen<br />
stellen dafür relevante Weltausschnitte<br />
und Wissensbereiche zur<br />
Verfügung und begegnen dem Kind mit<br />
einer Haltung der sozialen Wertschätzung.<br />
Diese beiden Grundannahmen sind für<br />
die Bildungsprozesse aller Kinder, behinderter<br />
und nicht behinderter, wesentlich.<br />
Allen Kindern die Möglichkeit zu ge-<br />
IX
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
X<br />
ben, in gemeinsamen Bildungsprozessen<br />
wichtige Erfahrungen ko-konstruktiv<br />
auszuhandeln, sich wechselseitig in<br />
ihrer Verschiedenheit anzuerkennen<br />
und sich dadurch ihrer Identität zu<br />
vergewissern – dies sollte in den Bildungseinrichtungen<br />
ein Selbstverständnis<br />
sein.<br />
Anne Heck betonte die Wichtigkeit sozialer<br />
Beziehungen als Voraussetzung<br />
für Bildungsprozesse, vor allem für behinderte<br />
Kinder. Da diese Kinder durch<br />
Krankenhausaufenthalte und sonstige<br />
Maßnahmen innerhalb ihres ersten<br />
Lebensjahres bis zu zehnmal häufiger<br />
„fremdversorgt“ werden als gesunde<br />
Kinder, kann ihre „Frühkommunikation“<br />
mit den Eltern als wichtigste Bindungspersonen<br />
oft nicht kontinuierlich<br />
verlaufen. Diese Bindung schafft jedoch<br />
das Fundament, um eine Bindungsbeziehung<br />
zur Erzieherin möglich zu machen<br />
und das Kind zu befähigen, Beziehungen<br />
zu „Gleichen“ zu knüpfen<br />
und Freundschaften zu schließen.<br />
Teilnehmerinnen der Arbeitsgruppe<br />
berichteten über ihre Arbeit in integrativen<br />
Gruppen und dort auftauchenden<br />
Schwierigkeiten und Unsicherhei-<br />
„Sein Selbstbewusstsein entwickelt das<br />
Kind am Du“, so eröffnete Freya Pausewang,<br />
Sozialpädagogin aus Schlangenbad,<br />
die Arbeitsgruppe „Emotionale<br />
und Soziale Kompetenz“. Deshalb sei<br />
es wichtig, dass die Erzieherinnen den<br />
Kindern Bindungserfahrungen ermöglichten<br />
und ihnen gleichzeitig als „Spiegel“<br />
zur Verfügung stünden. Nicht die<br />
kognitiven Erlebnisse und Ergebnisse<br />
sollten die Arbeit der Fachkräfte in den<br />
Kindertagesstätten an erster Stelle bestimmen,<br />
vielmehr sei zunächst auf eine<br />
gute emotionale und soziale Entwicklung<br />
der Kinder zu achten. „Nur so<br />
entsteht das Selbstwertgefühl, welches<br />
später die Motivation der Kinder bestimmt,<br />
in Bildungsprozesse einzusteigen<br />
und sich kognitive Fähigkeiten anzueignen,“<br />
referierte Frau Pausewang.<br />
Durch gezielte Beobachtungen der Erzieherinnen<br />
könne entschlüsselt werden,<br />
wie jedes einzelne Kind seine Bildungsprozesse<br />
organisiert, welche sozialen und<br />
emotionalen Kompetenzen vorhanden<br />
ten:<br />
- Verunsicherung der Eltern gesunder<br />
Kinder: Wird mein Kind in dieser<br />
Gruppe noch ausreichend gefördert?<br />
- Angst der Eltern behinderter Kinder:<br />
Bekommt mein Kind ausreichend Therapie?<br />
Wird es von den anderen Kindern<br />
in der Gruppe akzeptiert?<br />
- Mangelnde fachliche Unterstützung<br />
des Personals.<br />
- Wie geht es nach der Kindertagesstättenzeit<br />
für das behinderte Kind weiter?<br />
- Oft fehlt das Angebot an integrativen<br />
Schulen.<br />
Hier würden sich alle mehr Akzeptanz<br />
und Information, intensive fachliche<br />
Begleitung und eine bessere Vernetzung<br />
verschiedener Institutionen wünschen.<br />
Anne Heck berichtete von ihrer Praktikumszeit<br />
als Psychologiestudentin in<br />
Reggio Emilia/Italien, wo ganz selbstverständlich<br />
behinderte und nicht behinderte<br />
Kinder gemeinsame Kindertagesstätten<br />
und Schulen besuchen,<br />
ohne Hervorhebung der Behinderungen.<br />
Sie zeigte an einigen Beispielen<br />
auf, welche Bildungsprozesse in integrativen<br />
Gruppen durch Ko-Konstruktion<br />
behinderter und nicht behinder-<br />
AG 6: „Emotionale und Soziale Intelligenz“<br />
sind und was den Kindern hilft, eine<br />
eigene Identität zu finden.<br />
Freya Pausewang, die bis zu ihrer Pensionierung<br />
an einer Fachschule für Sozialwesen<br />
Erzieherinnen ausgebildet<br />
hatte, ist es in dieser Arbeitsgruppe gelungen,<br />
die Fachkräfte für einen anderen<br />
Blick auf die Kinder zu sensibilisieren.<br />
Darüber hinaus hat sie interessante<br />
Übungen mit den TeilnehmerInnen<br />
durchgeführt, um deren Selbstreflexion<br />
zu fördern und sie zu anderen<br />
Verhaltensweisen zu inspirieren.<br />
So meditierten die Erzieherinnen unter<br />
Anleitung über die Frage „Was sind<br />
angenehme Spielerinnerungen meiner<br />
Kindheit?“. Die jeweiligen Ergebnisse<br />
wurden individuell auf Karten visualisiert<br />
und danach zugeordnet unter<br />
Gesichtspunkten wie „Spiele mit (gekauftem)<br />
Material/ Spiele ohne Material“<br />
oder „Spiele mit anderen/ Spiele<br />
allein“ oder „Spiele mit Erwachsenen/<br />
Spiele ohne Erwachsene“ oder „mein<br />
Spielvorschlag/anderer Spielvorschlag“.<br />
ter Kinder zu beobachten sind.<br />
Ein Grundbaustein ist die Bewegung,<br />
über die sich jedes Kind die Welt erschließt.<br />
Wichtige Übungen sind dabei<br />
besonders für die behinderten Kinder<br />
die Herausforderungen des Alltags.<br />
Dabei können sich behinderte Kinder<br />
an nicht behinderten Kindern orientieren,<br />
umgekehrt erfahren nicht behinderte<br />
Kinder durch behinderte Kinder<br />
oft noch eine „andere Sicht der Welt“.<br />
Die Teilnehmerinnen der Arbeitsgruppen<br />
konnten übereinstimmend feststellen,<br />
dass die entwicklungsorientierten<br />
Kriterien der Beobachtung in integrativen<br />
Gruppen sich für alle Kinder<br />
positiv auswirken und die Arbeit und<br />
Zusammenarbeit der Erzieherinnen<br />
intensivieren.<br />
Zum Schluss betonte Anne Heck die<br />
Wichtigkeit einer überschaubaren<br />
Gruppenstärke als Grundvoraussetzung<br />
intensiver Begleitung von Bildungsprozessen<br />
behinderter und nicht<br />
behinderter Kinder. Dies würden sich<br />
auch die Teilnehmerinnen in ihren<br />
Kindertagesstätten wünschen, die Realität<br />
sieht jedoch leider anders aus.<br />
Claudia Justen<br />
Die Ergebnisse dieser Arbeit waren<br />
teilweise überraschend. Angenehme<br />
Spielerinnerungen gab es überwiegend<br />
an Spiele ohne Material, an Spiele mit<br />
anderen zusammen. Auch die Erwachsenen<br />
sind als Mitspieler offensichtlich<br />
gar nicht so interessant gewesen, denn<br />
ein großer Teil der positiven Spielerinnerungen<br />
galt den Spielen, die ohne<br />
Erwachsene gespielt worden sind.<br />
Schließlich war es unter dem Gesichtspunkt<br />
angenehmer Spielerinnerungen<br />
von herausragender Bedeutung, dass<br />
die eigenen Spielideen der Kinder verwirklicht<br />
worden waren.<br />
Die Referentin kritisierte eine heutige<br />
allgemeine Lebensweise, die von einer<br />
starken materiellen Ausrichtung geprägt<br />
sei. Grundlegende Werte, wie<br />
beispielsweise solidarisches Verhalten,<br />
würden ihrer Beobachtung nach dagegen<br />
in der familiären Erziehungsarbeit<br />
häufig vernachlässigt. Hier müsse die<br />
Kindertagesstätte ausgleichend arbeiten,<br />
da sonst Störungen im sozial-emo-
tionalen Bereich der Kinder auftreten<br />
könnten.<br />
Frau Pausewang wies darauf hin, dass<br />
die Nahsinne der Kinder heute teilweise<br />
unterfordert seien. Diese seien aber zur<br />
Entwicklung von umfassender Intelligenz<br />
und Wachheit besonders wichtig.<br />
Zu den Nahsinnen zählt sie Tastsinn,<br />
Gleichgewichtssinn, Kraft und alle<br />
Dinge, die mit Bewegung und Handlung<br />
zu tun haben. Die Fernsinne, wie<br />
das Sehen, würden dagegen überfordert.<br />
So machten die Kinder viele Erfahrungen<br />
2-dimensionalen Sehens, so z.B.<br />
wenn sie aus dem fahrenden Autofenster<br />
schauten oder Sendungen im Fernsehen<br />
anschauten. Diese 2-dimensionalen<br />
Bilder, erklärte die Referentin am<br />
Beispiel der Entfernung, könnten die<br />
Kinder aber erst dann verstehen, wenn<br />
sie diese über ihre Nahsinne (hier: bewegen)<br />
erfasst hätten. Deshalb plädierte<br />
sie dafür, die Bewegungsarbeit in der<br />
Kindertagesstätte nicht nur als Reaktion<br />
auf den Bewegungsdrang der Kinder<br />
zu sehen, sondern auch zur Schulung<br />
der geistigen und emotionalen Sin-<br />
ne zu nutzen. Frau Pausewang wies auf<br />
ihre Beobachtungen hin, wonach Kindergartenkinder<br />
es heute vielfach nicht<br />
mehr gewöhnt seien, sich anzustrengen.<br />
Anstrengung sei in der Regel an die<br />
Erwartung einer Belohnung geknüpft.<br />
Anders verhielten sich noch die 2-jährigen<br />
Kinder: Diese strengten sich an<br />
wegen einer Leistung, die sie vollbringen<br />
wollten. Die Lust an der Leistung<br />
im Kindergarten zu erhalten sei wichtig,<br />
weil dadurch die Entwicklung der<br />
Nahsinne, und damit der emotionalen<br />
und sozialen Intelligenz gefördert würden.<br />
„Die Erzieherinnen legen mit ihrer<br />
Arbeit die Basis für die politische Sozialisation<br />
der Kinder“, erläuterte die<br />
Referentin, „denn sie ermöglichen den<br />
Kindern erste Fremderfahrungen bzw.<br />
Erfahrungen mit Autoritäten außerhalb<br />
der Familie. Können die Kinder<br />
ihre Meinung sagen? Dürfen sie mitbestimmen<br />
oder müssen sie sich unterordnen?“<br />
Pausewang plädierte für mehr<br />
Anteile in der Elementarpädagogik, in<br />
denen die Kinder in Entscheidungen<br />
Kindertagesstätten:<br />
Auf die Qualität kommt es an<br />
Trier. Nicht gerade<br />
das Zentrum von<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong>.<br />
Dort eine Fachtagung?<br />
Im Januar???<br />
Nicht wenige fanden<br />
diese Idee im<br />
Vorfeld doch ein<br />
wenig seltsam,<br />
zweifelten am Gemütszustand<br />
der<br />
Vorbereitungsgruppe<br />
oder fanden die<br />
ganze Unternehmung<br />
zumindest<br />
recht mutig.<br />
Vorsichtig geworden,<br />
rechneten wir<br />
zunächst mit hundertTeilnehmerInnen.<br />
Dann kamen<br />
die Anmeldungen. In kürzester Zeit<br />
waren die hundert Plätze belegt. Wir<br />
erweiterten erst auf hundertdreißig,<br />
dann auf hundertfünfzig TeilnehmerInnen<br />
und schließlich ging nichts<br />
mehr. Die KollegInnen aus den Kindertageseinrichtungen<br />
hatten uns mit<br />
ihren Anmeldungen überrannt. Weit<br />
mehr als dreihundert KollegInnen wollten<br />
an diesem Tag nach Trier kommen.<br />
Der große Tag. Vielleicht kommen ja<br />
ein paar KollegInnen weniger: Krankheit,<br />
schließlich haben wir Januar;<br />
Glatteis, schließlich ist es Winter; zu<br />
weite Wege, schließlich ist <strong>Rheinland</strong>-<br />
<strong>Pfalz</strong> ein Flächenland. Von wegen, alle<br />
kamen, und die Arbeitsgruppen platzten<br />
aus den Nähten, Hausmeister richteten<br />
weitere Stuhlreihen im Plenum,<br />
die Hotelköche begannen hektisch zu<br />
brutzeln.<br />
Und es lief gut. Die KollegInnen hatten<br />
Verständnis, zeigten sich unglaublich<br />
interessiert und waren nach stundenlanger,<br />
nicht gerade einfacher geistiger<br />
Kost frisch wie zu Beginn. Die<br />
ReferentInnen waren sich anschließend<br />
einig: Die Diskussionen fanden auf<br />
außergewöhnlich hohem Niveau statt.<br />
„Das hier gezeigte Engagement kann<br />
gar nicht hoch genug bewertet werden“,<br />
Bildung von Anfang an<br />
mit einbezogen werden.<br />
In Murmelgruppen gingen die TeilnehmerInnen<br />
abschließend der Frage nach,<br />
was sie in ihren Einrichtungen konkret<br />
verändern können. Sie sollten sich<br />
dabei beziehen auf Alltagspädagogik,<br />
Projekte, Elternarbeit, Teamarbeit,<br />
Trägerkontakte und dazu konkrete<br />
Ansätze für ihre Arbeit zuhause formulieren:<br />
„Was habe ich für Gedanken<br />
mitgebracht?“. Es wurden eine<br />
Menge interessanter Aspekte zusammengetragen,<br />
wie: Bildungsinhalte diskutieren,<br />
sich selber wertschätzen lernen,<br />
Umsetzungsprobleme der Bildungsarbeit<br />
besprechen, Rahmenbedingungen<br />
verbessern, Teamarbeit intensivieren<br />
(wo steht der einzelne, gemeinsame<br />
Basis suchen), Selbstkritik<br />
üben (kann es auch an unserer Arbeit<br />
liegen, wenn die Interessen der Kinder<br />
nachlassen?), sich mit dem Leistungsgedanken<br />
beschäftigen: sind die Kinder<br />
schulreif - aber auch: ist die Schule<br />
kinderreif, sich mehr mit den Erwartungen<br />
der Eltern auseinandersetzen,<br />
u.v.m.<br />
Bernd Huster<br />
so Norbert Hocke, stellvertretender<br />
Bundesvorsitzender der <strong>GEW</strong>, der eigens<br />
aus Berlin angereist war.<br />
Resümee: „Wenn diese hochmotivierten<br />
rheinland-pfälzischen ErzieherInnen<br />
für die Zukunft unserer Kinder,<br />
unserer Gesellschaft verantwortlich<br />
zeichnen, dann brauchen wir uns<br />
wirklich nicht zu fürchten.“<br />
Die bange Frage nach Trier wird viel<br />
mehr sein: Bekommen die KollegInnen<br />
die Ressourcen und Möglichkeiten,<br />
die sie für ihre kompetente Arbeit<br />
benötigen? Ministerin Ahnen<br />
macht an diesem Tag alles andere als<br />
Mut. Bessere Standards? Fehlanzeige.<br />
Eine veränderte Erzieherinnenausbildung,<br />
die auch nur annähernd<br />
mit europäischen Standards mithalten<br />
könnte? Auch das verneinte Ministerin<br />
Ahnen an diesem Tag und<br />
nicht wenige KollegInnen gingen mit<br />
dem Eindruck nach Hause, dass die<br />
Abschlussrede der Ministerin nicht gerade<br />
das Highlight des Tages darstellte.<br />
Peter Blase-Geiger<br />
XI
Bildungsstandort Kindertagesstätten<br />
„Wenn das die Antwort auf PISA ist ...“<br />
Tilman Boehlkau fragte – Doris Ahnen wich aus!<br />
Den Abschluss der <strong>GEW</strong>-Fachtagung in Trier stellte die Rede der Ministerin<br />
für Bildung, Frauen und Jugend, Doris Ahnen, dar. Zuvor fasste<br />
der <strong>GEW</strong>-Landesvorsitzende Tilman Boehlkau wichtige Eindrücke des<br />
Tages zusammen und gab in seiner Überleitung Doris Ahnen einige<br />
Fragen mit.<br />
XII<br />
Boehlkau zeigte sich zunächst von<br />
den motivierten TeilnehmerInnen,<br />
dem guten Ambiente der Europäischen<br />
Rechtsakademie Trier sowie<br />
des Hotel Mercur und der Aufbruchstimmung,<br />
die von den Erzieherinnen<br />
in Trier ausgegangen war begeistert.<br />
„Diese Aufbruchstimmung nach<br />
PISA“, so Boehlkau, „machen wir<br />
besonders bei den ErzieherInnen<br />
aus. Dies zeichnete sich<br />
schon beim DGB-Bildungstag<br />
in Mainz ab und findet nun<br />
hier in Trier seine Fortsetzung.“<br />
Konkret gab Boehlkau Frau<br />
Ahnen als Steilvorlage drei<br />
Fragen mit auf den Weg zum<br />
Redepult:<br />
1. Gibt es Überlegungen, den<br />
künftigen ErzieherInnen eine<br />
höher qualifizierte Ausbildung<br />
anzubieten und diese damit<br />
europäischen Standards anzugleichen?<br />
2. Gibt es Überlegungen, die<br />
Personalbemessung in den<br />
Kindertageseinrichtungen zu<br />
verbessern? Dringend erforderlich<br />
sind nach Auffassung<br />
der <strong>GEW</strong> beispielsweise Freistellungen<br />
der Leitungskräfte<br />
(spätestens ab 60 Kinder eine<br />
volle Freistellung) sowie geregelte<br />
Verfügungszeiten (ein<br />
Drittel der Arbeitszeit).<br />
3. Die <strong>GEW</strong> hat als Orientierung<br />
einen Diskussionsentwurf<br />
„Rahmenplan frühkindliche Bildung“<br />
herausgegeben. Nun ist bekannt,<br />
dass auch das Ministerium an<br />
einem solchen Plan arbeitet. Kürzlich<br />
nannte der Trierische Volksfreund<br />
in einem Artikel diesen Plan<br />
einen Lehrplan für Kindertagesstätten.<br />
Was kommt tatsächlich auf die<br />
KollegInnen in den Kindertageseinrichtungen<br />
zu?<br />
Ministerin Ahnen machte klar, dass<br />
nach Pisa dringender Handlungsbedarf<br />
bestehe. Es mache sie besonders<br />
betroffen, dass in Deutschland - bezogen<br />
auf den internationalen Vergleich<br />
- bei den Bildungschancen -<br />
offensichtlich die sozialen Unterschiede<br />
bzw. die Herkunft der Kinder<br />
eine große Rolle spielten. Auch<br />
sei der Abstand im Leistungsvermögen<br />
zwischen den schwächsten und<br />
den besten Schülern eklatant groß.<br />
Dem gelte es zukünftig entgegenzuwirken.<br />
Die Empfehlungen zur Bildungsund<br />
Erziehungsarbeit in Kindertagesstätten,<br />
die das Ministerium für<br />
Bildung, Frauen und Jugend im<br />
Sommer veröffentlichen will, soll für<br />
die KollegInnen in den Einrichtun-<br />
gen eine pädagogische Orientierungshilfe<br />
sein. Weder handele es<br />
sich hierbei um einen Lehrplan noch<br />
sollen schulische Lerninhalte in die<br />
Kindertageseinrichtungen vorgezogen<br />
werden. Die Empfehlung definiere<br />
einen eigenen Bildungsansatz<br />
der Kindertageseinrichtungen und<br />
gebe Anregungen und praktische<br />
Hilfestellungen. Es seien viele Aspekte<br />
des <strong>GEW</strong>-Diskussionsentwurfes<br />
„Rahmenplan frühkindliche Bildung“<br />
mit in die ministeriellen Empfehlungen,<br />
die nach Erscheinen im<br />
Sommer diesen Jahres durch die<br />
Fachpraxis erprobt und nach einem<br />
Jahr überarbeitet werden sollen, eingeflossen.<br />
Mit einer entgültigen Fassung<br />
sei Mitte 2004 zu rechnen.<br />
Leider ging Ministerin Ahnen nur<br />
kurz auf die Frage der Ausbildung<br />
von Erzieherinnen und<br />
Erziehern ein. Inhaltliche Veränderungen<br />
werde es geben,<br />
aber eine Anhebung etwa auf<br />
Fachhochschulniveau (nur Österreich<br />
und Deutschland bilden<br />
Erzieherinnen nicht an<br />
Fachhochschulen oder Universitäten<br />
aus) erachte sie nicht als<br />
notwendig.<br />
Auch eine Verbesserung der<br />
Personalbemessung sei aktuell<br />
nicht vorgesehen, denn eine<br />
Anhebung der Qualität in den<br />
Einrichtungen sei nicht<br />
zwangsweise abhängig von einer<br />
Anhebung der Standards.<br />
Was das denn nun konkret für<br />
die Praxis in der Kindertagesstätten<br />
bedeute, hätte ein mancher<br />
gerne nachgefragt. Doch<br />
leider ließen Zeit und Struktur<br />
der Veranstaltung eine Diskussion<br />
nicht mehr zu.<br />
So gingen nicht wenige KollegInnen<br />
mit den Gedanken nach<br />
Hause, dass außer der Erstellung<br />
einer Empfehlung zur Bildungsund<br />
Erziehungsarbeit sowie kleinerer<br />
Veränderungen der ErzieherInnenausbildung<br />
sich offensichtlich<br />
nicht viel bewegt. Ein enttäuschter<br />
Kollege sprach es beim Hinausgehen<br />
deutlich aus: „Also, wenn das die<br />
Antwort auf Pisa ist, ich weiß nicht.“<br />
pbg