J. & L. Lobmeyr. 150 Jahre - Pressglas-Korrespondenz
J. & L. Lobmeyr. 150 Jahre - Pressglas-Korrespondenz
J. & L. Lobmeyr. 150 Jahre - Pressglas-Korrespondenz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Pressglas</strong>-<strong>Korrespondenz</strong> Nr. 01/1999<br />
Peter Rath, Wien / Glasatelier Steinschönau 9.10.1998<br />
J. & L. <strong>Lobmeyr</strong> und seine Glashütten in Slavonien<br />
Auszug aus<br />
Robert Schmidt, „100 <strong>Jahre</strong> österreichische Glaskunst. <strong>Lobmeyr</strong> 1823-1923“, Verlag Anton Schroll &<br />
Co., Wien 1926, Hrsg. zum 100-jährigen Bestands-Jubiläum von J. & L. <strong>Lobmeyr</strong>, Wien<br />
[SG: zur besseren Übersicht wurden Absätze und Zwischentitel eingefügt]<br />
Die <strong>Pressglas</strong>-Hütte in Marienthal<br />
Zusammen mit einem gewissen Joseph Kempf pachtete<br />
Josef <strong>Lobmeyr</strong> im <strong>Jahre</strong> 1837 [SG: 1836 ?] die dortige,<br />
der gräflich Pejacsevich‘schen Herrschaft gehörende<br />
Glashütte in Marienthal gegen eine Pachtsumme von<br />
1000 Gulden auf 12 <strong>Jahre</strong>. <strong>Lobmeyr</strong> scheint aber weder<br />
große Freude noch großen Gewinn von dieser Pachtung<br />
gehabt zu haben. Kempf war Direktor der Hütte, ließ<br />
sich aber bald Unregelmäßigkeiten zuschulden kommen,<br />
so dass er gerichtlich belangt und davon gejagt<br />
werden musste. Daraufhin engagierte <strong>Lobmeyr</strong> als Leiter<br />
der Hütte Georg Trnka, der bereits auf der in Bergreichenstein<br />
im Böhmerwald gelegenen Glasfabrik von<br />
Johann Baptist Eisner & Sohn tätig gewesen war. Die<br />
Hütte brauchte fort und fort Zuschüsse. <strong>Lobmeyr</strong> musste<br />
in jedem Jahr nach dem Rechten sehen, konnte aber<br />
nicht helfend eingreifen, weil ihm die technischen Vorkenntnisse<br />
fehlten.<br />
Erkundigungen in Paris<br />
Noch vor 1839 war der unternehmerische Mann nach<br />
Paris und London gefahren und dabei in Frankreich in<br />
die Glasfabrik St. Louis gekommen, wo nach den Aufzeichnungen<br />
Ludwig <strong>Lobmeyr</strong>s „brillantiertes <strong>Pressglas</strong><br />
als epochemachende Neuigkeit in Menge erzeugt wurde.<br />
So wurden wohl eine Maschine und Pressmodelle in<br />
Marienthal angefertigt, welche sich aber als untauglich<br />
erwiesen. Es gelang dem Vater, sich Maschinen und<br />
Formen aus Frankreich zu verschaffen, die taugten. Aber<br />
unser Glas war zu hart, unsere Erzeugnisse waren<br />
nicht mit den französischen zu vergleichen."<br />
Die <strong>Pressglas</strong>-Hütte in Zwechewo<br />
Derartige Misserfolge aber konnten <strong>Lobmeyr</strong> nicht von<br />
seinen Zielen abbringen. Im Gegenteil, als sich im <strong>Jahre</strong><br />
1841 die Gelegenheit bot, noch eine weitere Glashütte<br />
zu betreiben, griff er sofort zu. Es handelte sich um das<br />
nicht allzuweit von Marienthal gelegene Zwechewo, wo<br />
er mit einem gewissen Karl Sigismund Hondl zusammen<br />
eine Glasfabrik errichtete. Am 24. August 1841<br />
schließen dann <strong>Lobmeyr</strong> und Hondl in Wien einen Gesellschaftsvertrag<br />
ab. Die Firma hieß Hondl & <strong>Lobmeyr</strong>;<br />
die Geschäftskarte zeigt eine Ansicht der Hütte<br />
mit allen zugehörigen Wohn- und Werksgebäuden.<br />
(Beide Hüttenplätze haben Beate und Peter Rath am 22.<br />
August 1997 wiederentdeckt und genauestens kartographiert).<br />
Hondl, der bisher eine andere Glashütte - in Jankowacz<br />
bei Daruvar [SG: Westslawonien] - betrieben hatte, übernahm<br />
die Oberaufsicht gegen ein jährliches Gehalt<br />
von 600 Gulden, die brauchbaren Materialien und<br />
Werkzeuge der aufgelassenen Hütte werden nach dem<br />
realen Werte als bare Einlage übernommen, ebenso<br />
wurden etliche Arbeiter von dort hier wieder eingestellt.<br />
Die besseren, feineren Artikel sollten - gemäß dem oben<br />
angeführten Kontrakt-Paragraphen - in Zwechewo gearbeitet<br />
werden.<br />
Abb. 01-99/15<br />
aus <strong>Lobmeyr</strong> 1998, S. 27<br />
Das Ende des „slavonischen Abenteuers“<br />
Wegen der stets mangelhaften Buchführung musste<br />
<strong>Lobmeyr</strong> häufig nach Slavonien reisen, wobei er immer<br />
einen seiner Söhne mitnahm, bis von 1848 an Ludwig<br />
<strong>Lobmeyr</strong> mit der Ordnung der dortigen Geschäfte allein<br />
betraut wurde. Als die 12-jährige Pacht von Marienthal<br />
mit dem <strong>Jahre</strong> 1848 ablief, erneuerte <strong>Lobmeyr</strong> sie nicht.<br />
Seit 1850 war ein Prozess gegen Hondl anhängig, der<br />
unendlichen Aufwand an Zeit und Mühe kostete und<br />
damit endete, dass vom 5. Juli 1851 an die Firma <strong>Lobmeyr</strong><br />
Alleinbesitzerin der Hütte war. Josef <strong>Lobmeyr</strong> erlebte<br />
das ersehnte Ende des Unternehmens nicht mehr.<br />
Erst im Januar 1857 konnte Ludwig <strong>Lobmeyr</strong> das „slavonische<br />
Abenteuer", wie er es selbst nennt, endgültig<br />
liquidieren. Das hineingesteckte Kapital war zwar gerettet,<br />
aber um den Preis von Ludwig <strong>Lobmeyr</strong>s Gesundheit,<br />
die durch die anstrengenden Reisen nach Marienthal<br />
und Zwechewo dauerhaft angegriffen war.<br />
Seite 14 von 60 Seiten d:\<strong>Pressglas</strong>\<strong>Korrespondenz</strong>\pk-1999-01-1.doc Stand 08.12.00



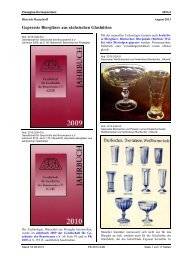



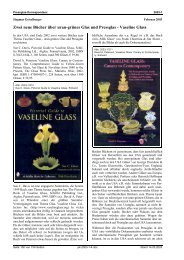

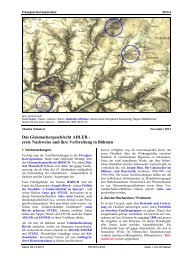





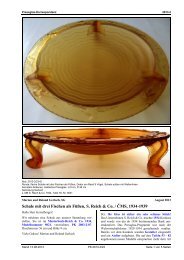

![Kapusta, Glasmachen im Bergland [Sklárstvà na horácku]](https://img.yumpu.com/25481954/1/184x260/kapusta-glasmachen-im-bergland-sklarstva-na-horacku.jpg?quality=85)