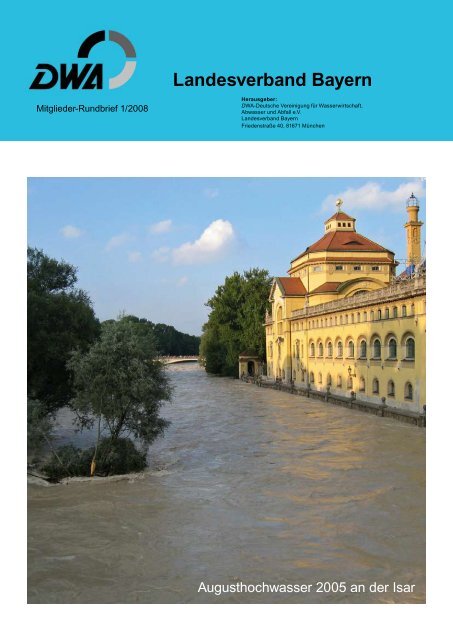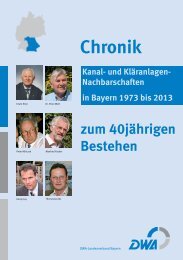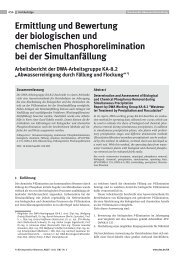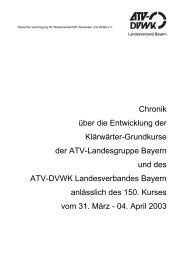Wasserwirtschaft in Bayern - aktuelle Herausforderungen
Wasserwirtschaft in Bayern - aktuelle Herausforderungen
Wasserwirtschaft in Bayern - aktuelle Herausforderungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
Herausgeber:<br />
DWA-Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für <strong>Wasserwirtschaft</strong>,<br />
Abwasser und Abfall e.V.<br />
Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
Friedenstraße 40, 81671 München<br />
Augusthochwasser 2005 an der Isar<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
1
2<br />
Liebe Leser<strong>in</strong>nen, liebe Leser,<br />
mit der Funktion als neuer stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes<br />
<strong>Bayern</strong> habe ich gleichzeitig die Verantwortung für den Mitgliederrundbrief<br />
übernommen. Ich möchte hiermit diese Aufgabe fortsetzen,<br />
die bisher Jürgen Bauer <strong>in</strong> der gleichen Funktion <strong>in</strong> bewährter Weise<br />
viele Jahre sozusagen gepflegt hat.<br />
Mit me<strong>in</strong>er Wahl zum Stellvertretenden Vorsitzenden hoffe ich, dass<br />
zum<strong>in</strong>dest beim DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> der Süden und der Norden<br />
<strong>Bayern</strong>s näher zusammenrücken wird und ich sehe mich <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> dieser Funktion als Botschafter des Norden <strong>Bayern</strong>s.<br />
Mit me<strong>in</strong>er Wahl folge ich den Spuren von Jürgen Bauer, der sich als<br />
Stellvertreter des Landesvorsitzenden zurückgezogen hat. Ich möchte<br />
ihm persönlich aber auch im Auftrag des Landesverbands <strong>Bayern</strong> für<br />
diese Tätigkeit, <strong>in</strong>sbesondere für die Bearbeitung der Mitgliederrundbriefe<br />
an dieser Stelle sehr herzlich danken. Gleichzeitig hoffe ich, dass er se<strong>in</strong> Wissen, se<strong>in</strong>e Erfahrungen und se<strong>in</strong>e Ideen auch noch<br />
weiter dem Landesverband zur Verfügung stellen wird. Ich persönlich habe Jürgen Bauer bezüglich me<strong>in</strong>es beruflichen Erfolges<br />
viel zu verdanken. Wie auch andere habe ich ihn als e<strong>in</strong>e herausragende Führungskraft am Landesamt kennen gelernt. Se<strong>in</strong><br />
menschlich geprägter Führungsstil und se<strong>in</strong> fachliches Wissen hat ihn viel persönliche Anerkennung und Respekt e<strong>in</strong>gebracht.<br />
Er ist für mich immer noch Vorbild, u. a. auch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er früheren Eigenschaft als Vorgesetzter.<br />
Ob der Rundbrief zukünftig vielfältiger wird, wie es sich Jürgen Bauer wünscht, ist fraglich und untersteht Ihrem Urteil. Der letzte<br />
Dezember-Rundbrief ist so reichhaltig und abwechslungsreich, wie er nur schwer zu überbieten ist. Ich bemühe mich zum<strong>in</strong>dest<br />
den Rundbrief so <strong>in</strong>teressant wie möglich für Sie zu gestalten. Dies erfordert auch Unterstützung und Anregungen von allen Seiten.<br />
Sie als Mitglieder können dazu beitragen, wie Jürgen Bauer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vorwort der Dezemberausgabe 2007 erwähnt hat. Ich<br />
stelle mir ebenso gut vor, dass unsere Kommunalen Mitglieder viele fachliche Themen zu diesem Rundbrief beitragen könnten.<br />
Als Beispiel verweise ich <strong>in</strong> diesem Heft auf den bei Berichten abgedruckten Kommentar zu Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
von Hermann Klotz. Ich appelliere an Sie alle, Ihre Beiträge an die Geschäftsstelle oder an mich zu schicken.<br />
Mit dem redaktionellen Wechsel gibt es auch e<strong>in</strong>en Wechsel <strong>in</strong> der Schriftleitung. Die neue Besetzung repräsentiert alle Bereiche,<br />
die Wissenschaft, die Wirtschaft, den kommunalen Bereich und die Verwaltung. An dieser Stelle möchte ich mich bei den<br />
Mitgliedern der Schriftleitung für die Bereitschaft hierbei mitzuwirken sehr herzlich bedanken. Von dort wünsche ich mir viele<br />
Anregungen für <strong>in</strong>teressante Artikel.<br />
Ich hoffe, dass Ihnen me<strong>in</strong> erster gestalteter Mitgliederrundbrief gefällt und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.<br />
Ihr<br />
Richard Oberhauser<br />
Titelbild:<br />
Augusthochwasser 2005 an der Isar, Blickrichtung flussaufwärts am Deutsches Museum <strong>in</strong> München. Foto Univ.-Prof. Dr.-Ing Markus Disse.<br />
Impressum:<br />
Der Mitglieder-Rundbrief des DWA-Landesverbandes <strong>Bayern</strong> ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> der Regel zweimal jährlich und zwar im Mai und Dezember.<br />
Die Beiträge stellen die Me<strong>in</strong>ung des jeweiligen Verfassers dar.<br />
Auflagenhöhe: 3500<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. Richard Oberhauser, DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong>, München<br />
Schriftleitung:<br />
Prof. Dr.-Ing. Markus Disse, Universität der Bundeswehr, München<br />
Dipl.-Ing. Helmut Ferrari, Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft, München<br />
Dipl.-Ing. Hermann Klotz, Münchner Stadtentwässerung<br />
Dipl.-Ing. Gregor Overhoff, Bayer. Landesamt für Umwelt, München<br />
Redaktionsschluss:<br />
15. März und 15. September<br />
Layout:<br />
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Hlauschek, Bayer. Landesamt für Umwelt, Dienstort München<br />
Druck:<br />
Hirthammer Verlag GmbH, Oberhach<strong>in</strong>g<br />
Anzeigen:<br />
Hirthammer Verlag, Telefon (089) 323 3360, E-Mail: <strong>in</strong>fo@hirthammerverlag.de<br />
Beiträge s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>zureichen an:<br />
Geschäftsstelle des DWA-Landesverbandes <strong>Bayern</strong>, Friedenstraße 40, 81671 München<br />
Telefon (089) 233 62590, Fax (089) 233 62595 (Herr Stockbauer), E-Mail: stockbauer@dwa-bayern.de<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Leitartikel<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> - <strong>aktuelle</strong> <strong>Herausforderungen</strong> ..................................................................................................... 4<br />
Titelbericht<br />
Dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen ............................................................................................................................ 7<br />
Der besondere Beitrag<br />
Wasserproblematik aus globaler Sicht - Chancen für bayerische Unternehmen .................................................................. 13<br />
Veranstaltungen<br />
Sem<strong>in</strong>ar „Wasserrückhalt <strong>in</strong> der Fläche“ am 31. Juli / 01. August 2008 ................................................................................ 16<br />
Fachtagung „Gewässermorphologie & EU-WRRL“ am 24. / 25. Juli 2008 ............................................................................ 18<br />
Fachausstellung und Hochwasserforum Mangfall ................................................................................................................. 20<br />
Internationales Klärschlamm-Symposium vom 30. Juni - 02. Juli 2008 ................................................................................ 21<br />
In eigener Sache<br />
Sem<strong>in</strong>ar „Nürnberger <strong>Wasserwirtschaft</strong>stag“ am 26. Juni 2008 ........................................................................................... 22<br />
Fachexkursion für junge <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler 2008 ............................................................................................................... 24<br />
Symposium „Klimawandel - was kann die <strong>Wasserwirtschaft</strong> tun?“ am 24. / 25. Juni 2008 .................................................. 25<br />
Workshop „Kanalsanierung, Anforderungsprofil für Schlauchl<strong>in</strong>ersanierungen“ .................................................................. 25<br />
Leserbrief ................................................................................................................................................................................ 26<br />
DWA-Fachexkursion <strong>in</strong>s Rhe<strong>in</strong>land ........................................................................................................................................ 28<br />
Jürgen Bauer - schade dass er geht ...................................................................................................................................... 30<br />
Bericht zum Internationalen Symposium „Qualitätsmanagement <strong>in</strong> der <strong>Wasserwirtschaft</strong>“ ................................................. 32<br />
DWA-Landesverband stellt sich bei <strong>Bayern</strong>s neuem Umweltstaatssekretär Dr. Marcel Huber vor ...................................... 33<br />
DWA-Reise nach Myanmar – noch Restplätze frei ................................................................................................................ 34<br />
Berichte<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Rosenheim erhält von der Staatsregierung Auszeichnung für „Innovative Verwaltung 2007“ ......... 35<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Traunste<strong>in</strong> gew<strong>in</strong>nt Innovationspreis 2007 der Bayerischen Staatsregierung ................................. 37<br />
Die Bayerischen Landeskraftwerke - e<strong>in</strong> Staatsbetrieb wird zur GmbH ................................................................................ 39<br />
Strahlenschutz für Beschäftigte <strong>in</strong> bayerischen Wasserwerken ............................................................................................ 41<br />
Wasserforum International – Erfahrungsaustausch zum <strong>in</strong>ternationalen Wassermarkt ....................................................... 45<br />
Zusammenarbeit zwischen Vermessung und <strong>Wasserwirtschaft</strong> ........................................................................................... 45<br />
Vollzug der Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen ....................................................................................... 46<br />
Kommentar zum Bericht: Vollzug der Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen ............................................. 47<br />
Produktprüfungen bei Schlauchl<strong>in</strong>er ...................................................................................................................................... 48<br />
Bau<strong>in</strong>vestitionen Kanalisation - Marktumfrage ....................................................................................................................... 50<br />
geofora <strong>in</strong> Hof und <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> .................................................................................................................................................... 51<br />
Personalnachrichten<br />
Neuer Behördenleiter am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Kempten ................................................................................................... 52<br />
Dieter Wagner <strong>in</strong> den Vorruhestand verabschiedet ............................................................................................................... 53<br />
Theodor-Rehbock-Medaille für Prof. Dr.-Ing. Franz Valent<strong>in</strong> ................................................................................................. 54<br />
DWA zeichnet Hartmut Kaunz<strong>in</strong>ger mit ihrer Ehrennadel aus ............................................................................................... 55<br />
Drei <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler <strong>in</strong>s Bürgermeisteramt gewählt ....................................................................................................... 55<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
Seite<br />
3
4<br />
Leitartikel<br />
Leitartikel<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> - <strong>aktuelle</strong><br />
<strong>Herausforderungen</strong><br />
Nachfolgender Beitrag ist <strong>in</strong> der Zeitschrift „Technik <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“, Ausgabe 2 veröffentlicht worden. Wegen der Bedeutung für<br />
wasserwirtschaftliches Handeln erfolgt hier die ungekürzte Wiedergabe. Der Chefredaktion der Zeitschrift wird für die Freigabe<br />
des Artikels gedankt.<br />
<strong>Bayern</strong>s Flüsse und Seen s<strong>in</strong>d sauber;<br />
Tr<strong>in</strong>kwasser steht rund um die Uhr <strong>in</strong> guter<br />
Qualität und ausreichender Menge zu<br />
Verfügung; der Hochwasserschutz kann<br />
sich sehen lassen. Lebt <strong>Bayern</strong> was das<br />
Wasser betrifft auf e<strong>in</strong>er Insel der Glückseligkeit?<br />
Können sich die bayerischen<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>ler zurücklehnen und<br />
auf den Erfolgen ausruhen?<br />
Fakt ist: Dank jahrzehntelanger konsequenter<br />
Gewässerschutzpolitik und milliardenschwerer<br />
Investitionen der Kommunen<br />
und des Freistaates <strong>Bayern</strong> <strong>in</strong> die<br />
Wasserver- und Abwasserentsorgung<br />
sowie den Hochwasserschutz haben wir<br />
<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> e<strong>in</strong>en Zustand erreicht, um den<br />
uns viele Länder beneiden. Angesichts<br />
der erreichten Anschlussgrade von 96<br />
und 99 Prozent an die öffentliche Abwasserentsorgung<br />
und Wasserversorgung<br />
wäre Max von Pettenkofer hocherfreut.<br />
Selbst Carl Friedrich von Wiebek<strong>in</strong>g, der<br />
Urvater der Flussregulierung <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>,<br />
wäre sicher e<strong>in</strong>verstanden, wenn wir<br />
heute viele der e<strong>in</strong>st mühsam begradigten<br />
und verbauten Flüsse wieder behutsam<br />
da, wo es geht, von ihrem engen<br />
Korsett befreien.<br />
Fakt ist aber auch, dass gerade im H<strong>in</strong>blick<br />
auf das Wasser Veränderungen<br />
im Gange s<strong>in</strong>d, auf die die <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
reagieren muss. Wir denken<br />
hier <strong>in</strong>sbesondere an den Klimawandel,<br />
der ja schon fast zum Shoot<strong>in</strong>gstar am<br />
weltweiten Medienhimmel geworden ist.<br />
Dass der Mensch e<strong>in</strong>en entscheidenden<br />
Anteil an der Klimaerwärmung trägt,<br />
weiß man schon seit den 80er Jahren.<br />
Neu ist die so <strong>in</strong>tensive Wahrnehmung<br />
des Problems <strong>in</strong> der Öffentlichkeit. Klimaneutrales<br />
Verhalten oder wenigstens<br />
das darüber Reden ist gesellschaftsfähig<br />
gar schick geworden. Aus Sicht der weltweiten<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>, auf die der Klimawandel<br />
enormen E<strong>in</strong>fluss nimmt, war<br />
es <strong>in</strong> der Tat höchste Zeit für diese Debatte,<br />
stehen wir doch <strong>in</strong> vielen Ländern<br />
am Rand e<strong>in</strong>er f<strong>in</strong>alen Wasserklemme.<br />
Es wäre jedoch zu kurz gesprungen, die<br />
Umweltpolitik künftig alle<strong>in</strong> auf den Klimawandel<br />
zu fokussieren. Ressourcenschonung<br />
und -schutz s<strong>in</strong>d ebenso wich-<br />
Isar unterhalb des Ick<strong>in</strong>ger Wehrs 2005; Nach Entnahme der Ufersicherung 2001<br />
konnte der Fluss se<strong>in</strong>en Lauf <strong>in</strong> die angrenzenden Aufwaldflächen verlagern. Das<br />
neue Gewässerbett zeigt typische Elemente e<strong>in</strong>er alp<strong>in</strong> geprägten Flusslandschaft:<br />
Flussarme, Kiesbänke, Totholz, Weichholzaue.<br />
tig, besonders wenn es um die wichtige<br />
Lebensressource Wasser geht. Traurig,<br />
aber wahr: der heute bereichsweise bereits<br />
höchst kritische globale Zustand im<br />
Wasserhaushalt geht im Wesentlichen<br />
auf das Konto „konventioneller“ Bewirtschaftungsfehler,<br />
hat also noch nichts<br />
mit dem Klimawandel zu tun.<br />
Auch der demographische Wandel, e<strong>in</strong><br />
geändertes Verbraucherverhalten, die<br />
sich wandelnden Ansprüche der Gesellschaft<br />
an die Gewässer und nicht zuletzt<br />
die Konsequenzen der Globalisierung<br />
werden uns künftig auf Trab halten. Von<br />
Langeweile unter den <strong>Wasserwirtschaft</strong>lern<br />
also ke<strong>in</strong>e Spur.<br />
Veränderungen zw<strong>in</strong>gen uns auch <strong>in</strong><br />
<strong>Bayern</strong> zum Handeln<br />
Die Umwelt ist fragil. Um auch nur den<br />
Stand von heute zu erhalten, s<strong>in</strong>d schon<br />
erhebliche Anstrengungen nötig. Unsere<br />
Wasser<strong>in</strong>frastruktur verkörpert Milliardenwerte,<br />
die bedient und unterhalten<br />
werden müssen. Das alle<strong>in</strong>e würde uns<br />
bereits reichlich beschäftigen. Reagieren<br />
auf bereits erfolgte Veränderungen ist<br />
nicht genug, vorausschauendes Agieren<br />
ist angezeigt. Wasserpolitisch ist die europäische<br />
Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie und<br />
aktuell ihre Schwesterrichtl<strong>in</strong>ie für das<br />
Hochwasser Ausdruck für dieses Bemühen.<br />
Erhalt des Erreichten und moderate<br />
Verbesserung s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> gesellschaftlicher<br />
Kraftakt, der sich aber lohnt. Wer sich<br />
davon erst noch überzeugen lassen<br />
muss, möge Länder der Welt bereisen,<br />
wo solche strengen Anforderungen nicht<br />
gelten. Die für jeden Experten erkennbare<br />
dramatische Entwicklung <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a,<br />
Indien oder auch Nordamerika spricht<br />
hier Bände.<br />
Der Klimawandel ist mehr als e<strong>in</strong>e<br />
Prognose. Wir registrieren ihn längst<br />
überall, auch <strong>in</strong> Europa, dort besonders<br />
ausgeprägt im Süden und <strong>in</strong> den alp<strong>in</strong>en<br />
Bereichen. Die Wetterextreme werden<br />
sich verstärken, mehr Trockenperioden<br />
und <strong>in</strong>tensivere Niederschläge mit Hochwasserereignissen<br />
s<strong>in</strong>d die Folge. „Jahrhunderthochwasser“<br />
werden häufiger.<br />
Mit dem Verschieben der Frostgrenze<br />
schmelzen <strong>in</strong> Regionen wie dem Hima-<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
laja wichtige natürliche Wasserspeicher<br />
weg; uns trifft besonders die Destabilisierung<br />
von Hängen mit der Gefahr von<br />
Murenabgängen.<br />
Mit e<strong>in</strong>em enormen Kraftakt aller Länder<br />
der Welt könnte es gel<strong>in</strong>gen, durch Verr<strong>in</strong>gerung<br />
des CO 2 -Ausstoßes die Klimaerwärmung<br />
etwas abzuschwächen oder<br />
zu verzögern. Die schon jetzt erkennbaren<br />
negativen Auswirkungen werden wir<br />
allerd<strong>in</strong>gs nicht verh<strong>in</strong>dern können. Die<br />
deshalb nötigen Anpassungsstrategien<br />
betreffen vor allem die <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
- „mitigation is energy - adaptation is water“<br />
heißt es im <strong>in</strong>ternationalen Raum.<br />
Die demografische Entwicklung <strong>in</strong> Europa<br />
ist gegenläufig zur weltweiten. Hier<br />
s<strong>in</strong>d für uns strukturelle Aufgaben zu lösen,<br />
denken wir nur an die Auslastung<br />
von Wasser<strong>in</strong>frastruktur.<br />
Umgekehrt wird die zunehmende weltweite<br />
Anspannung im Wassersektor auch<br />
zu <strong>in</strong>dustriellem Druck auf die wasserreichen<br />
Länder führen. Gut für die Arbeitsplätze,<br />
aber vorbereitet sollte man se<strong>in</strong>.<br />
Die weltweiten Agrarmärkte s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
Bewegung. E<strong>in</strong> konstant wachsender<br />
Nahrungsmittelbedarf trifft sich <strong>in</strong> unglücklicher<br />
Weise mit der Idee, Pflanzen<br />
zu Energiezwecken zu nutzen. Neben<br />
steil steigenden Preisen (der Weizenpreis<br />
hat sich im zweiten Halbjahr 2007<br />
verdoppelt) wächst der Flächenbedarf.<br />
Auch abhängig vom Klima, bedeutet<br />
dies sowohl Belastungen des Wasserhaushalts<br />
durch Agrarhilfsstoffe (Dünger,<br />
Pflanzenschutzmittel), aber auch<br />
durch Bewässerung.<br />
Wie können wir als <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> reagieren?<br />
Das Wichtigste ist e<strong>in</strong>e möglichst ehrliche<br />
Analyse der kommenden <strong>Herausforderungen</strong><br />
und die E<strong>in</strong>speisung <strong>in</strong><br />
die gesellschaftspolitische Diskussion.<br />
Tatsächlich können wir vielleicht sogar<br />
aus den zu erwartenden Veränderungen<br />
Vorteile schöpfen, nämlich dann, wenn<br />
es uns gel<strong>in</strong>gt, unser auf Umweltschutz<br />
und Nachhaltigkeit basierendes System<br />
auszubauen und damit Standortsicherheit<br />
zu schaffen. Der Nebeneffekt, damit<br />
e<strong>in</strong>en globalen Leuchtturm zu entwickeln,<br />
könnte im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Gesamtverantwortung<br />
zusätzliche Motivation se<strong>in</strong>.<br />
Die Schritte dah<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d vorgezeichnet:<br />
Schutz vor Hochwasser<br />
In wenigen Jahrzehnten wird es <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong><br />
im W<strong>in</strong>ter bis zu 35% mehr Niederschläge<br />
geben. Immer häufiger werden<br />
uns extreme Hochwasserereignisse<br />
heimsuchen. Das Pf<strong>in</strong>gsthochwasser<br />
1999 und die Augusthochwasser von<br />
2002 und 2005 waren e<strong>in</strong> Vorgeschmack<br />
darauf, was uns erwartet. Viele, die<br />
Leitartikel<br />
Stadt am Fluss: Die umgestaltete Pegnitz im Stadtgebiet Nürnberg 2001. Das Gewässer<br />
wurde durch Entnahme der Verbauung und Abflachung der Ufer für die Anwohner<br />
wieder zugänglich gemacht.<br />
sich h<strong>in</strong>ter Schutzmauern und Deichen<br />
sicher gefühlt haben, s<strong>in</strong>d jetzt auf e<strong>in</strong>mal<br />
wieder im Spiel. Es wird nun wieder<br />
bewusst, dass es absolute Sicherheit<br />
nicht gibt. E<strong>in</strong>e weitere Reduzierung<br />
der Risiken ist möglich. Am Ende ist<br />
aber das stets verbleibende Restrisiko<br />
gegen den für e<strong>in</strong>e weitere Reduzierung<br />
erforderlichen Aufwand abzuwägen. Wir<br />
haben bayernweit dr<strong>in</strong>genden Bedarf an<br />
Retentionsräumen, an Speichern und<br />
Flutpoldern. Um Riesenunglücke wie<br />
Rumänien 2006 zu verh<strong>in</strong>dern, denken<br />
wir über Notüberlaufräume nach, um<br />
im Fall katastrophaler Ereignisse wenigstens<br />
die Schäden <strong>in</strong> Siedlungen zu<br />
verm<strong>in</strong>dern. Das bedeutet aber, dass <strong>in</strong><br />
den Flusstälern auch <strong>in</strong> vergrößerten<br />
Überschwemmungsbereichen weitere<br />
Besiedlungen kritisch gesehen werden<br />
und e<strong>in</strong>ige flussnahe landwirtschaftlich<br />
genutzte Flächen verstärkt wieder ihre<br />
ursprüngliche Funktion als Retentionsräume<br />
wahrnehmen müssen.<br />
Zur Zeit <strong>in</strong>vestieren wir, streng nach<br />
Prioritäten gereiht, über 150 Millionen<br />
Euro pro Jahr <strong>in</strong> den Hochwasserschutz.<br />
Das rechnet sich: So entg<strong>in</strong>gen München<br />
und weitere an der Isar liegende<br />
Städte und Geme<strong>in</strong>den beim Hochwasser<br />
2005 nur Dank des 1999 erhöhten<br />
Sylvenste<strong>in</strong>speichers ganz knapp e<strong>in</strong>er<br />
Katastrophe, die Milliarden Euro gekostet<br />
hätte.<br />
Dort, wo wir planen, berücksichtigen wir<br />
neben den ökologischen Interessen auch<br />
die Bedürfnisse der Menschen nach<br />
Naturerleben, Freizeit und Erholung. So<br />
entstehen <strong>in</strong> Dörfern und Städten wieder<br />
vermehrt reale Erlebniswelten an den<br />
Gewässern, manchmal e<strong>in</strong> wohltuender<br />
Kontrapunkt zu virtuellen Sche<strong>in</strong>welten<br />
aus dem Fernseher oder dem PC.<br />
Wasser<strong>in</strong>frastruktur<br />
Die Periode Herbst 2006 bis Frühjahr<br />
2007 hat e<strong>in</strong>en Vorgeschmack auf die<br />
kommenden Klimaszenarien gegeben.<br />
Plötzlich ist das „Wasserland <strong>Bayern</strong>“<br />
von Trockenheiten betroffen. Die Auswirkungen<br />
s<strong>in</strong>d erheblich! Bereits im Sommer<br />
2003 und 2006 drohte e<strong>in</strong>e europaweite<br />
Energiekrise, weil den Kraftwerken<br />
das Kühlwasser der zu warm werdenden<br />
Flüsse ausg<strong>in</strong>g. Mit erweiterter Kühlkapazität<br />
ist dies wohl zu beherrschen.<br />
Tiefer gehen die Probleme aber bei der<br />
Landwirtschaft. Weltweit geht ca. 70%<br />
des Wasserverbrauchs <strong>in</strong> die Bewässerung,<br />
<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> s<strong>in</strong>d es bislang nur wenige<br />
Prozent. Mehr Bewässerung kostet<br />
zunächst e<strong>in</strong>mal Geld (und Energie!),<br />
außerdem stellt sich die Frage: woher<br />
nehmen wir das kühle Nass? Die Flüsse<br />
und Bäche s<strong>in</strong>d bei zunehmendem<br />
Niedrigwasser kaum als Entnahmestelle<br />
geeignet, das Grundwasser ist prioritär<br />
für die Tr<strong>in</strong>kwassernutzung zu reservieren.<br />
Wir arbeiten deshalb aktuell an e<strong>in</strong>em<br />
vollkommen überdachten Niedrigwassermanagement,<br />
damit auch bei steigendem<br />
Bedarf das Wasser <strong>in</strong> der benötigten<br />
Qualität und Quantität bereitgestellt<br />
werden kann. Um regionalen Versorgungsengpässen<br />
zu begegnen, s<strong>in</strong>d<br />
die bayerischen Kommunen gut beraten,<br />
sich e<strong>in</strong> zweites Standbe<strong>in</strong> für die Wasserversorgung<br />
aufzubauen oder überörtliche<br />
Verbundsysteme zu nutzen.<br />
Daneben gilt es, den Bestand zu erhalten.<br />
Damit s<strong>in</strong>d nicht nur die milliardenschweren<br />
Infrastruktur<strong>in</strong>vestitionen<br />
geme<strong>in</strong>t, sondern auch die Qualität<br />
unseres Tr<strong>in</strong>kwassers, die uns weltweit<br />
auszeichnet: Wasser „designed by<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
5
6<br />
Leitartikel<br />
Der Klimawandel wird immer häufiger extreme Hochwasser br<strong>in</strong>gen. Bei künftigen Planungen<br />
wird deshalb mit e<strong>in</strong>em Klimaänderungsfaktor von 15% gerechnet. Hier: überströmte Hochwasserschutzmauer<br />
beim Triebwerk des Allgäuer Überlandwerkes an der Iller <strong>in</strong> Kempten beim<br />
Augusthochwasser 2005.<br />
God“ ist e<strong>in</strong> Markenzeichen, das vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergrund der weltweiten Entwicklung<br />
gar nicht hoch genug geschätzt werden<br />
kann und auch nicht durch die beste Aufbereitung<br />
zu ersetzen ist. Dieses Stück<br />
Selbstbestimmung ist auch e<strong>in</strong>e Frage<br />
der nachhaltigen Effizienz, es hat aber<br />
ebenso mit Respekt vor der Schöpfung,<br />
mit Heimat und mit Selbstbewusstse<strong>in</strong><br />
zu tun. Dass wir dies mit modernsten<br />
Mitteln - von der geologischen Modellrechnung<br />
bis zum betrieblichen Benchmark<br />
- verteidigen, gehört ebenso dazu<br />
wie die Suche nach e<strong>in</strong>em fairen gesellschaftlichen<br />
Konsens zum Beispiel<br />
bei der Frage der landwirtschaftlichen<br />
Ausgleichsleistungen.<br />
Strukturveränderungen und weitere<br />
„versteckte“ Folgen<br />
Die Nutzung erneuerbarer Energien<br />
spart fossile Brennstoffe und ist e<strong>in</strong><br />
aktiver Beitrag zum Klimaschutz. In se<strong>in</strong>em<br />
Sondergutachten zum Klimaschutz<br />
durch Biomasse vom Juli 2007 misst der<br />
Sachverständigenrat für Umweltfragen<br />
der Energiegew<strong>in</strong>nung aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen große Bedeutung<br />
zu. Er weist aber ausdrücklich darauf<br />
h<strong>in</strong>: Grundvoraussetzung dafür, dass<br />
durch den E<strong>in</strong>satz von Biomasse zur<br />
Energieerzeugung im Vergleich zu der<br />
Verwendung fossiler Energieträger weniger<br />
Treibhausgase freigesetzt werden,<br />
ist, dass die nachwachsenden Rohstoffe<br />
umweltverträglich und klimaschutzorientiert<br />
angebaut und genutzt werden<br />
(Sachverständigenrat für Umweltfragen<br />
(SRU), Klimawandel durch Biomasse;<br />
Sondergutachten Juli 2007, S. 54 ff).<br />
Wenn dagegen – wie u.a. der Wissenschaftler<br />
A. Heißenhuber es beschreibt<br />
- zum Beispiel die EU-Öko-Sprit-Politik<br />
tatsächlich zur Abholzung der Regenwälder<br />
beiträgt, ist etwas schief gegangen.<br />
Wie immer ist die Welt komplex. In der<br />
Erzeugung von Bioenergie als e<strong>in</strong>e Alternative<br />
zu Erdöl sehen natürlich viele<br />
Landwirte e<strong>in</strong>e neue E<strong>in</strong>kommensquelle.<br />
Wenn dies nicht auf umweltverträgliche<br />
Art und Weise geschieht, könnte die damit<br />
verbundene Intensivierung der Landwirtschaft<br />
auf gleichzeitig trockeneren<br />
Standorten (weniger Verdünnung) zu<br />
Grundwasserbelastungen führen. Möglicherweise<br />
e<strong>in</strong> Desaster, wenn das, was<br />
wir eigentlich erhalten wollten – die rare<br />
Ressource Wasser – so „verbraucht“<br />
würde. Hier ist <strong>in</strong> Zukunft noch deutlich<br />
mehr landwirtschaftlichen Know Hows<br />
gefragt, zum Beispiel bei <strong>in</strong>novativem,<br />
umweltschonendem Anbau.<br />
Gleiches trifft für die Nutzung der Erdwärme<br />
zu, die <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> derzeit boomt.<br />
Doch auch hier müssen die Auswirkungen,<br />
z.B. auf das Grundwasser, genau<br />
untersucht und bei der Planung beachtet<br />
werden. Auch die Wasserkraftnutzung<br />
<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> ist durch Modernisierung und<br />
weiteren Ausbau noch steigerungsfähig.<br />
Ingenieurverstand ist gefordert, um die<br />
Durchgängigkeit der Gewässer zu erhalten<br />
oder sogar zu verbessern.<br />
E<strong>in</strong>e ganz andere, positive Folge der<br />
weltweiten Umweltkrise ist das wachsende<br />
Interesse, das <strong>in</strong>ternational an<br />
deutscher Umwelttechnologie und Umweltmanagement<br />
besteht. E<strong>in</strong>e Reihe<br />
von Mittelständischen Unternehmen<br />
profitieren hier von der erhöhten<br />
Nachfrage – endlich und<br />
zu recht, wie wir me<strong>in</strong>en, setzen<br />
sich doch langsam auch<br />
weltweit die nachhaltigen Lösungen<br />
durch. Den Technologievorsprung,<br />
den wir hier<br />
<strong>in</strong>sbesondere im Bereich der<br />
Wasseraufbereitung und der<br />
Abwasserbehandlung haben,<br />
sollen Organisationen wie der<br />
Umweltcluster <strong>Bayern</strong> steigern.<br />
Die <strong>Wasserwirtschaft</strong> leistet e<strong>in</strong>en<br />
Beitrag <strong>in</strong> Form des Technologietransfers<br />
Wasser. Der<br />
Nachhaltigkeit und dem IntegriertenWasserressourcenmanagement<br />
verschrieben, leisten<br />
wir e<strong>in</strong>en Beitrag zu „good<br />
governance“, der <strong>in</strong>zwischen<br />
se<strong>in</strong>en Wert mehrfach bewiesen<br />
hat.<br />
Demografischer Wandel,<br />
Verbrauchsverhalten, Zukunft<br />
Für viele Fragen der Zukunft<br />
haben wir heute noch ke<strong>in</strong>e<br />
befriedigende Antwort. Phänomene wie<br />
die Schwächung der ländlichen Räume,<br />
demografischer Wandel, zunehmend<br />
Identitätsverluste durch Säkularisierung<br />
der Gesellschaft und andere kritische<br />
E<strong>in</strong>flüsse aus der Globalisierung haben<br />
aber zum<strong>in</strong>dest mittelbar auch mit dem<br />
Wassersektor zu tun. Wir müssen auf<br />
gesellschaftliche <strong>Herausforderungen</strong><br />
reagieren. So nehmen wir Begriffe wie<br />
Balance der Nachhaltigkeit, Regionalität,<br />
Kultur und Heimat bewusst neben<br />
der Forderung nach angepasster, effizienter<br />
Technologie <strong>in</strong> unsere Planungen<br />
auf. Wir s<strong>in</strong>d sicher, dass diese Art des<br />
nachhaltigen Planens e<strong>in</strong>en positiven<br />
E<strong>in</strong>fluss hat. Wir orientieren uns damit<br />
an den Gedanken des Altmeisters Goethe:<br />
Willst du dich am Ganzen<br />
erquicken,<br />
So mußt du das Ganze im<br />
Kle<strong>in</strong>sten erblicken.<br />
aus „Gott, Gemüt und Welt“, Goethes Werke, Vollständige Ausgabe<br />
letzter Hand, Bd. 1-4: Gedichte, Stuttgart und Tüb<strong>in</strong>gen<br />
(Cotta) 1827<br />
So gesehen ist uns nicht bange um unsere<br />
zukünftigen Aufgaben.<br />
Mart<strong>in</strong> Grambow<br />
Leiter der Abteilung<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> im StMUGV<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Titelbericht<br />
Titelbericht<br />
Dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
Das Institut für Wasserwesen – <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
und Ressourcenschutz<br />
der Universität der Bundeswehr München<br />
bearbeitet seit Oktober 2007 im<br />
Auftrag des Bayerischen Landesamtes<br />
für Umwelt (LfU) das Forschungsvorhaben<br />
‚Entwicklung e<strong>in</strong>er Methodik zur<br />
Erstellung von Hochwasserrückhaltekonzepten<br />
unter Berücksichtigung des<br />
Klimawandels am Beispiel der W<strong>in</strong>dach’.<br />
Das Projekt be<strong>in</strong>haltet die Beantwortung<br />
folgender Fragestellungen anhand e<strong>in</strong>es<br />
Flussgebietsmodells der W<strong>in</strong>dach:<br />
• Ermöglichen Maßnahmen des dezentralen<br />
Hochwasserschutzes e<strong>in</strong>e<br />
Reduktion der Abflussspitze bzw. der<br />
Abflussfülle?<br />
• Verändert der zu erwartende Klimawandel<br />
die Hochwasserverhältnisse?<br />
• Können zusätzliche Hochwasserrückhaltebecken<br />
unterhalb des W<strong>in</strong>dachspeichers<br />
die Hochwasserwellen<br />
effektiv dämpfen?<br />
Weiterh<strong>in</strong> wird auf Wunsch des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Weilheim e<strong>in</strong>e<br />
Variantenrechnung <strong>in</strong> das Projekt mite<strong>in</strong>bezogen,<br />
um die Auswirkung e<strong>in</strong>er<br />
bereits geplanten Vorsperre zum W<strong>in</strong>dachspeicher<br />
auf den Hochwasserabfluss<br />
zu quantifizieren.<br />
Das Projekt gliedert sich <strong>in</strong> folgende drei<br />
Arbeitsabschnitte:<br />
1. Literatur- und Datenrecherche über<br />
dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
2. Modellierung des Ist-Zustands, zukünftiger<br />
Landnutzungs- und Klimaänderungen<br />
sowie geplanter Gewässerrenaturierungen<br />
unter Berücksichtigung<br />
der geplanten Vorsperre zum W<strong>in</strong>dachspeicher<br />
3. Erstellung e<strong>in</strong>es Hochwasserrückhaltekonzeptes<br />
für die W<strong>in</strong>dach<br />
Die Literatur- und Datenrecherche über<br />
dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
ist <strong>in</strong>zwischen abgeschlossen,<br />
wobei im E<strong>in</strong>zelnen Landnutzungsänderungen,<br />
landwirtschaftliche und<br />
forstwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahmen,<br />
Kle<strong>in</strong>rückhalte und Renaturierung<br />
von Fließgewässern mit ihren<br />
Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss<br />
näher beleuchtet wurden. Ziel ist<br />
es, den <strong>aktuelle</strong>n Stand des Wissens<br />
aufzuzeigen, wobei die Übertragbarkeit<br />
der Ergebnisse auf den bayerischen<br />
Raum gewährleistet se<strong>in</strong> soll.<br />
Abb. 1: Moderner Hochwasserschutz mit se<strong>in</strong>en 3 Handlungsfeldern (StMUGV, 2005)<br />
Die Literaturrecherche bezieht sich <strong>in</strong><br />
erster L<strong>in</strong>ie auf Fallbeispiele aus <strong>Bayern</strong><br />
und basiert zum e<strong>in</strong>en auf e<strong>in</strong>er Datenbankrecherche<br />
an der Universitätsbibliothek<br />
der Bundeswehr München,<br />
zum anderen wurde <strong>aktuelle</strong>s Informationsmaterial<br />
von den entsprechenden<br />
Behörden aus den Bereichen Umwelt,<br />
Landwirtschaft, Forsten und <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
schwerpunktmäßig <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> e<strong>in</strong>geholt.<br />
Weiterh<strong>in</strong> dienten nationale und<br />
<strong>in</strong>ternationale Symposien, Konferenzen<br />
und Forschungsprojekte als Quellen,<br />
um die Frage zu beantworten, wie stark<br />
der Scheitelabfluss und das Abflussvolumen<br />
bei Hochwasserereignissen <strong>in</strong><br />
Abhängigkeit von welchen Parametern<br />
reduziert werden kann.<br />
In diesem Artikel werden die Anwendungsbereiche<br />
und die Bewertung dezentraler<br />
Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
erläutert. In e<strong>in</strong>em späteren DWA Mitglieder-Rundbrief<br />
sollen erste Ergebnisse des<br />
Forschungsprojektes für das W<strong>in</strong>dach-<br />
E<strong>in</strong>zugsgebiet veröffentlicht werden.<br />
Anwendungsbereiche des dezentralen<br />
Hochwasserschutzes<br />
Gemäß dem Hochwasser-Aktionsprogramm<br />
2020, das durch das bayerische<br />
Staatsm<strong>in</strong>isterium für Landesentwicklung<br />
und Umweltfragen im Mai 2001 beschlossen<br />
wurde, f<strong>in</strong>det der dezentrale<br />
Hochwasserschutz im ersten Bauste<strong>in</strong><br />
‚Natürlicher Rückhalt’ der entwickelten<br />
Hochwasserschutzstrategie Anwendung.<br />
Diese ist <strong>in</strong> Abb. 1 dargestellt:<br />
Ziel ist hierbei, das vorhandene Schadenspotential<br />
zu verr<strong>in</strong>gern, e<strong>in</strong>e künftige<br />
Schadenspotentialzunahme zu<br />
vermeiden sowie e<strong>in</strong>en ausreichenden<br />
Hochwasserschutz für Bebauung und<br />
hochwertige Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen<br />
zu gewährleisten (StMLU, 2002). Aus<br />
Abb. 1 lässt sich ableiten, dass e<strong>in</strong>e<br />
optimale Wirksamkeit erzielt werden<br />
kann, wenn dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
<strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation<br />
mit technischen Anlagen, wie Deiche,<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
7
8<br />
Titelbericht<br />
Tab. 1: E<strong>in</strong>teilung der unterschiedlichen Skalen nach BECKER (1992)<br />
Mauern, Flutmulden, Talsperren, etc.<br />
geplant werden und dabei zusätzliche<br />
Hochwasservorsorge, wie Vermeidung<br />
der Bebauung <strong>in</strong> gefährdeten Bereichen,<br />
angepasste Bauweise, Verhaltens- und<br />
Risikovorsorge, betrieben wird.<br />
Weiterh<strong>in</strong> wird durch die LAWA empfohlen,<br />
die Maßnahmen zur Verbesserung<br />
des natürlichen Wasserrückhalts <strong>in</strong> den<br />
Bewirtschaftungsplänen nach EU-Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie<br />
zu berücksichtigen, da<br />
sich Maßnahmen zur Verbesserung des<br />
ökologischen Zustands positiv auf das<br />
Abflussgeschehen auswirken und Hochwasserstände<br />
m<strong>in</strong>dern (LAWA, 2004).<br />
Natürliche Rückhaltung soll gemäß<br />
dieser LAWA-Handlungsempfehlung<br />
schwerpunktmäßig <strong>in</strong> der Landschaft<br />
Anwendung f<strong>in</strong>den. Hierbei trägt gerade<br />
im bayerischen Raum die Land- und<br />
Forstwirtschaft e<strong>in</strong>e große Verantwortung<br />
bei der Umsetzung e<strong>in</strong>er standortgerechten<br />
Bewirtschaftung.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus gibt es für Maßnahmen<br />
am Gewässer die Zielsetzung, verloren<br />
gegangene Flutungs- und<br />
Retentionsräume zurückzugew<strong>in</strong>nen.<br />
Dabei wird e<strong>in</strong>e<br />
enge Zusammenarbeit mit<br />
dem Naturschutz vorgesehen,<br />
um e<strong>in</strong>e Verbesserung<br />
der ökologischen Vielfalt <strong>in</strong><br />
und an den Gewässern und<br />
ihren Auen zu erlangen.<br />
Aus diesen Empfehlungen<br />
lässt sich ableiten, dass<br />
die dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
sehr<br />
vielfältig und <strong>in</strong> den verschiedensten<br />
Bereichen Anwendung<br />
f<strong>in</strong>den können und<br />
müssen, um e<strong>in</strong>e optimale<br />
Wirkung zu erzielen. Daher<br />
sollte bei der Planung das<br />
vollständige E<strong>in</strong>zugsgebiet<br />
untersucht werden, um e<strong>in</strong>e ganzheitliche<br />
Betrachtung zu ermöglichen. Bei<br />
der Betrachtung nur e<strong>in</strong>es Teils besteht<br />
die Gefahr, dass Lösungen erarbeitet<br />
werden, die für Ober- oder Unterlieger<br />
zu Verschlechterungen führen oder die<br />
nicht das Optimum h<strong>in</strong>sichtlich Naturverträglichkeit,<br />
hydrologischer Effektivität,<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> das Landschaftsbild und<br />
Kosten-Nutzen-Verhältnis darstellen<br />
(DITTRICH, 2006).<br />
Vor allem die E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />
spielt im Zusammenhang mit dezentralen<br />
Hochwasserschutzmaßnahmen e<strong>in</strong>e<br />
große Rolle und sollte deshalb differenziert<br />
betrachtet werden. Hierfür liegen<br />
verschiedene Skalene<strong>in</strong>teilungen vor,<br />
von denen die E<strong>in</strong>teilung nach BECKER<br />
(1992) sehr verbreitet ist (Tab 1).<br />
Auf Grundlage dieser E<strong>in</strong>teilung wurde<br />
im Rahmen des LAHoR-Projektes (KHR,<br />
2003) der E<strong>in</strong>fluss der Landoberfläche<br />
und der Ausbaumaßnahmen am Gewässer<br />
auf die Hochwasserbed<strong>in</strong>gungen<br />
im Rhe<strong>in</strong>gebiet quantifiziert, woraus<br />
sich Rückschlüsse auf die Wirksamkeit<br />
dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
für die<br />
verschiedenen Skalen ziehen<br />
lassen.<br />
Das Ergebnis des Forschungsprojektes<br />
LAHoR<br />
(KHR, 2003) lässt sich wie<br />
folgt zusammenfassen:<br />
Für E<strong>in</strong>zugsgebiete bis zur<br />
Mesoskala ist e<strong>in</strong> deutlicher<br />
E<strong>in</strong>fluss verschiedener<br />
Landnutzungen erkennbar<br />
und durch dezentrale Versickerungsmaßnahmenwurden<br />
Scheitelabm<strong>in</strong>derungen<br />
bis zu 20% ermittelt. Jedoch<br />
müssen hierbei die Regenereignisse<br />
unterschieden<br />
werden, da die deutlichen<br />
Scheitelabm<strong>in</strong>derungen nur bei konvektiven<br />
Niederschlägen mit ger<strong>in</strong>ger<br />
Bodenvorsättigung beobachtet wurden.<br />
Im Gegenzug führte <strong>in</strong> dieser Skala e<strong>in</strong>e<br />
Verdoppelung der versiegelten Flächen<br />
bei konvektiven Ereignissen zu e<strong>in</strong>er<br />
Scheitelerhöhung von 20% - 30%. Für<br />
E<strong>in</strong>zugsgebiete der oberen Mesoskala<br />
brachte diese Maßnahme e<strong>in</strong>e Scheitelerhöhung<br />
um ca. 10% mit sich. Daraus<br />
lässt sich für dezentrale „entsiegelnde“<br />
Maßnahmen schließen, dass ihre Wirkung<br />
mit ansteigender Skala nachlässt<br />
und von der Art des fallenden Niederschlags<br />
abhängt. In der Makroskala, z.B.<br />
Rhe<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zugsgebiet, wurden <strong>in</strong> diesem<br />
Projekt kaum Effekte durch realistische<br />
Landnutzungsänderungen, worunter<br />
auch dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
zu zählen s<strong>in</strong>d, erzielt. Ihre<br />
Wirkung konzentriert sich folglich auf die<br />
Entstehung kle<strong>in</strong>räumiger Hochwasser.<br />
In KREITER (2007) wurden die Möglichkeiten<br />
und Grenzen dezentraler<br />
Rückhalte untersucht, wobei deren<br />
Wirksamkeit <strong>in</strong> Abhängigkeit zur (Teil-)<br />
E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße gestellt wurde. Als<br />
Abb. 2: Wirkung der verschiedenen Strategien zum Hochwasserschutz im Bezug auf die E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />
(RÖTTCHER & TÖNSMANN, 2004)<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
ealistische Obergrenze wurde hierbei<br />
e<strong>in</strong> Grenzwert von 150 km² festgelegt,<br />
was sich mit den Ergebnissen der LA-<br />
HoR-Studie deckt.<br />
Insgesamt ist es aber sehr schwierig,<br />
pauschale Grenzwerte für die Wirksamkeit<br />
dezentraler Maßnahmen festzulegen,<br />
da sich die E<strong>in</strong>zugsgebiete <strong>in</strong><br />
der Regel h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Topographie,<br />
Geologie und Landnutzung unterscheiden,<br />
was sich im Abflussverhalten widerspiegelt.<br />
Es bleibt notwendig, dezentrale<br />
Maßnahmen gewässer- und e<strong>in</strong>zugsgebietspezifisch<br />
zu untersuchen und für<br />
das jeweilige E<strong>in</strong>zugsgebiet das größte<br />
Potential an dezentralem Rückhalt durch<br />
entsprechende Maßnahmenkomb<strong>in</strong>ationen<br />
zu ermitteln. Dennoch ergibt sich<br />
die Folgerung, dass mit wachsender E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />
kle<strong>in</strong>räumige dezentrale<br />
Maßnahmen an Wirkung verlieren.<br />
E<strong>in</strong>e zusammenfassende Darstellung für<br />
die fließenden Übergänge der Wirksamkeit<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Strategien des modernen<br />
Hochwasserschutzkonzepts auf<br />
unterschiedlich große E<strong>in</strong>zugsgebiete<br />
liefert Abbildung 2.<br />
Bewertung dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
Vergleich zwischen zentralen und<br />
dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
Dezentrale Maßnahmen müssen <strong>in</strong> großer<br />
Anzahl oder über große Flächen verbreitet<br />
vorliegen, um e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Wirkung auf Hochwasserscheitel zu erzielen.<br />
Daher liegt es nahe, dezentrale<br />
Maßnahmen mit den zentralen Maßnahmen,<br />
wie beispielsweise e<strong>in</strong> großes<br />
Rückhaltebecken mit gesteuerten Auslässen,<br />
zu vergleichen. Am H<strong>in</strong>terbach <strong>in</strong><br />
Villmergen (Schweiz) wurde zu diesem<br />
Zweck e<strong>in</strong> Variantenvergleich zwischen<br />
E<strong>in</strong>zelbecken und folgenden zwei Alternativen<br />
durchgeführt (HUMBEL & MÜL-<br />
LER, 2002):<br />
• 4 kle<strong>in</strong>e Becken <strong>in</strong> Serie,<br />
• Kaskade von Rückhaltedämmen.<br />
Die Untersuchungen ergaben, dass unter<br />
Nutzung von vier dezentralen Becken<br />
die annähernd dreifache Fläche überflutet<br />
wird, verglichen mit der zentralen<br />
Alternative. Das Dammschüttvolumen<br />
lag ebenfalls beim dreifachen Wert der<br />
E<strong>in</strong>zelmaßnahme. Die Kaskadenvariante<br />
mit e<strong>in</strong>er Stauhöhe von zwei Meter, welche<br />
für e<strong>in</strong> vergleichbares Rückhaltevolumen<br />
30 Becken benötigen würde, wäre<br />
im Untersuchungsgebiet auf Grund der<br />
gegebenen topographischen Verhältnisse<br />
kaum umsetzbar. Betrachtet man<br />
das Rückhaltepotential und die Kosten<br />
der Maßnahme, so liegen die Vorzüge<br />
beim zentralen E<strong>in</strong>zelbecken gegenüber<br />
Titelbericht<br />
Abb. 3: Maßnahme zum dezentralen Hochwasserschutz an der Lauter fünf Jahre<br />
nach Beendigung der Baumaßnahme (HÄSSLER-KIEFHABER, 2007)<br />
den dezentralen Alternativen. Beispiele<br />
zeigen jedoch, dass <strong>in</strong> vielen Fällen<br />
versucht wird, anstelle e<strong>in</strong>es zentralen<br />
E<strong>in</strong>zelbeckens dezentrale Lösungen zu<br />
bevorzugen.<br />
E<strong>in</strong> direkter Vergleich zwischen zentralen<br />
und dezentralen Maßnahmen gestaltet<br />
sich nach RÖTTCHER (2007) schwierig,<br />
da dezentrale Maßnahmen:<br />
• stark von örtlichen Gegebenheiten<br />
abhängig s<strong>in</strong>d,<br />
• <strong>in</strong> sich sehr unterschiedlich s<strong>in</strong>d (geme<strong>in</strong>same<br />
Bezugsgrößen fehlen),<br />
• e<strong>in</strong>en erhöhten, schwer quantifizierbaren<br />
Flächenbedarf besitzen,<br />
• kaum nach Normen geregelt s<strong>in</strong>d,<br />
• wenig praxiserprobt s<strong>in</strong>d,<br />
• neben dem Hochwasserschutz weitere<br />
positive Nebeneffekte mit sich<br />
br<strong>in</strong>gen und<br />
• der Hochwasserschutz an sich nur e<strong>in</strong><br />
Nebeneffekt ist und somit nur anteilig<br />
berücksichtigt werden darf.<br />
Die letzten beiden Aussagen machen<br />
deutlich, dass die dezentralen Maßnahmen<br />
Synergieeffekte aufweisen und<br />
sich dadurch gegenüber e<strong>in</strong>er zentralen<br />
Maßnahme durchsetzen können.<br />
Synergieeffekte<br />
In se<strong>in</strong>er Untersuchung zur Bewertung<br />
dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
legt RÖTTCHER (2007) weiterh<strong>in</strong><br />
dar, dass diese im Umweltbereich viele<br />
Vorteile aufweisen. Beispielsweise tragen<br />
Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung<br />
teilweise zur Grundwasserneubildung<br />
bei oder verbessern das<br />
Kle<strong>in</strong>klima. Dezentrale Rückhaltebecken<br />
bee<strong>in</strong>trächtigen das Landschaftsbild weniger<br />
als größere, zentrale Maßnahmen.<br />
Weiterh<strong>in</strong> wirken sich Renaturierungs-<br />
maßnahmen aller Art durchweg positiv<br />
auf die def<strong>in</strong>ierten Schutzgüter Flora und<br />
Fauna, Wasser und biologische Vielfalt<br />
aus.<br />
E<strong>in</strong> praktisches Beispiel hierfür stellt<br />
die naturnahe Gestaltung der Lauter<br />
dar. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund der massiven<br />
E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> den Naturhaushalt wurde auf<br />
technische Rückhaltebecken im Lautertal<br />
verzichtet und stattdessen setzte<br />
man naturverträgliche Maßnahmen um<br />
(HÄSSLER-KIEFHABER, 2007). Diese<br />
bestanden aus e<strong>in</strong>er Gewässerrenaturierung,<br />
flächigem Geländeabtrag zur<br />
Förderung des Retentionsraums, drei<br />
ungesteuerten kle<strong>in</strong>en Rückhaltebecken<br />
mit Hilfe talquerender Vorlandwälle<br />
sowie mehrerer kle<strong>in</strong>er Geländemulden<br />
entlang des Bachbettes und <strong>in</strong> der<br />
Talaue (Abb. 3).<br />
Die Maßnahme wurde von den Unterliegern<br />
als spürbar wirksam bewertet und<br />
e<strong>in</strong> frühzeitiges Ausufern der Lauter<br />
<strong>in</strong> die Vorländer ist feststellbar, wobei<br />
bisher ke<strong>in</strong>e Aufzeichnungen für die<br />
Wirksamkeit der Maßnahme unter Spitzenabflüssen<br />
vorliegen. Nachweisbar ist<br />
e<strong>in</strong>e deutliche Verbesserung des ökologischen<br />
Zustands <strong>in</strong> diesem Abschnitt,<br />
<strong>in</strong> dem <strong>in</strong>nerhalb kurzer Zeit hochwertige<br />
Fischhabitate entstanden s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />
weiterer Synergieeffekt der dezentralen<br />
Hochwasserschutzmaßnahme ist <strong>in</strong> diesem<br />
Fall der große Zulauf zu Naherholungszwecken,<br />
der sich auf Grund des<br />
verbesserten Landschaftsbildes und der<br />
aufgewerteten Ökologie e<strong>in</strong>gestellt hat.<br />
Dies würde auch im E<strong>in</strong>klang mit der EU-<br />
Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie (EU-WRRL) stehen,<br />
die den guten ökologischen Zustand<br />
zum Ziel hat, den Hochwasserschutz<br />
jedoch bewusst ausklammert, um den<br />
Zeitplan zur Umsetzung nicht zu belasten<br />
(RÖTTCHER, TÖNSMANN, 2004).<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
9
10<br />
Titelbericht<br />
Tab. 2: Maßnahmen des dezentralen <strong>in</strong>tegrierten Hochwasserschutzes und den damit<br />
verbundenen Auswirkungen im S<strong>in</strong>ne der EU-WRRL (RÖTTCHER, TÖNSMANN,<br />
2004)<br />
Tab. 3: Landnutzungsszenarien für die Untersuchungen im Weißeritz-EZG; HB = Hökkenbach<br />
(A E0 = 16,7 km²), WB = Weißbach (A E0 = 7,4 km²) (MERTA ET AL., 2007)<br />
Jedoch wurde erkannt, dass <strong>in</strong>tegrierte,<br />
dezentrale Hochwasserschutzkonzepte<br />
e<strong>in</strong>en Beitrag zur EU-WRRL leisten können,<br />
was Tabelle 2 zeigt.<br />
Die Landnutzung kann ebenfalls e<strong>in</strong>e<br />
Maßnahme zum dezentralen Hochwasserschutz<br />
darstellen. Durch Untersuchungen<br />
im Weißeritz-EZG (384 km²)<br />
von MERTA ET AL. (2007) wird verdeutlicht,<br />
dass Naturschutz und Hochwasserschutz<br />
nicht zwangsläufig konträre<br />
Ansprüche an die Landnutzung haben.<br />
Es wurden Landnutzungsszenarien entwickelt,<br />
die im E<strong>in</strong>klang mit ökologischen<br />
Interessen stehen und deren E<strong>in</strong>fluss auf<br />
Hochwasserabflüsse ermittelt (Tab.3).<br />
Dabei wurden Synergien zwischen Belangen<br />
des Hochwasserschutzes und<br />
des Naturschutzes abgeleitet.<br />
Um die Landnutzungsszenarien zu bewerten<br />
wurde e<strong>in</strong>e Differenzierung der<br />
Abflüsse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e schnelle (Oberflächen-,<br />
schneller Zwischenabfluss) und e<strong>in</strong>e<br />
langsame Komponente (langsamer Zwischenabfluss,<br />
Tiefenversickerung) vollzogen.<br />
Das Ergebnis der Berechnungen<br />
mit Hilfe des Wissensbasierten System<br />
(WBS) FLAB stellt sich wie <strong>in</strong> Abbildung<br />
4 gezeigt dar.<br />
Die Extremszenarien (Hochwasserschutz,<br />
Naturschutz, Komb<strong>in</strong>ation,<br />
PNV) ergaben durchweg die größte<br />
Reduzierung der schnellen Abflusskomponente,<br />
was sich zusätzlich positiv auf<br />
den Erosionsschutz auswirkt (MERTA,<br />
2007). Die Wasserhaushaltsmodellierung<br />
ergab, dass beispielsweise durch<br />
konservierende Bewirtschaftung bzw.<br />
e<strong>in</strong>er Umwandlung von Acker <strong>in</strong> Grün-<br />
Abb. 4: Gegenüberstellung der Flächenanteile mit langsamen und schnellen Abflusskomponenten für den Ist-Zustand und die<br />
Szenarien für die TEZG Höckenbach (HB) (AE0 = 16,7 km²) und Weißbach (WB) (AE0 = 7,4 km²) (MERTA ET AL., 2007)<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Abb. 5: Abnahme des m<strong>in</strong>eralischen Stickstoffs <strong>in</strong> den<br />
grassed waterways (GWW) (FIENER, AUERSWALD,<br />
2003)<br />
land Scheitelabm<strong>in</strong>derungen bis zu<br />
30% erzielt werden können, wobei die<br />
Wirkung der Maßnahmen abnehmen,<br />
je länger die Niederschlagsereignisse<br />
andauern. Dabei ist zu betonen, dass<br />
aus naturschutzfachlicher Bewertung<br />
alle Landnutzungsszenarien e<strong>in</strong>e Verbesserung<br />
gegenüber dem Ist-Zustand<br />
darstellen.<br />
Im Zusammenhang mit Synergieeffekten<br />
dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die von FIENER<br />
und AUERSWALD (2003) untersuchten<br />
„grassed waterways“ (GWW) zu<br />
nennen. Neben Abflussreduzierungen<br />
von bis zu 39% wurden <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es<br />
achtjährigen Forschungsprojektes<br />
Erosionsm<strong>in</strong>derungen, vor allem Grabenerosion,<br />
von bis zu 82% festgestellt so-<br />
wie weiterer ökologischer<br />
Nutzen dieser Maßnahme<br />
erkannt. Neben dem<br />
reduzierten Sedimentaustrag<br />
aus dem E<strong>in</strong>zugsgebiet<br />
der Größe<br />
24 Hektar zeigt sich e<strong>in</strong>e<br />
deutliche Abnahme der<br />
Stickstoffkonzentration<br />
vor allem <strong>in</strong>nerhalb des<br />
GWW (bis zu 84%, Abb.<br />
5) aber auch im Umfeld<br />
des GWW.<br />
Auswirkungen auf die<br />
Pflanzenvielfalt wurden<br />
bei dieser Untersuchung<br />
ebenfalls festgestellt, da<br />
sich <strong>in</strong> kurzer Zeit verschiedene<br />
Gräser, Pflanzen,<br />
Kräuter und auch<br />
Gehölze ansiedelten, je<br />
nachdem, ob die GWW<br />
jährlich geschnitten wurden<br />
oder nicht. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus war e<strong>in</strong> Anstieg<br />
der Anzahl an Bodenorganismen vor allem<br />
<strong>in</strong> der Nähe des GWW festzustellen,<br />
wie auch e<strong>in</strong>e möglicherweise durch die<br />
GWW herbeigeführte Ansiedlung verschiedener<br />
Vogelarten. Weitere, vor allem<br />
landwirtschaftliche Vorteile liegen <strong>in</strong><br />
der Befahrbarkeit der GWW bei Trockenperioden<br />
sowie <strong>in</strong> den Puffereigenschaften<br />
gegenüber benachbarten Felder <strong>in</strong><br />
Bezug auf Unkraut und Schädl<strong>in</strong>gen.<br />
Neben den landwirtschaftlichen Maßnahmen<br />
kann auch der dezentrale<br />
Hochwasserschutz durch die Forstwirtschaft<br />
(Aufforstung, Waldumgestaltung)<br />
zahlreiche Synergieeffekte aufweisen,<br />
da Wälder an sich e<strong>in</strong>e Biotopfunktion<br />
darstellen, zu Naherholungszwecken<br />
beliebt s<strong>in</strong>d sowie für Luftre<strong>in</strong>igung und<br />
Sauerstoffproduktion beitragen.<br />
Titelbericht<br />
Grenzen dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
Wegen des angesprochenen, umfangreichen<br />
Potentials der dezentralen Maßnahmen<br />
zusätzlich zum Hochwasserschutz<br />
ist diese Strategie e<strong>in</strong> wichtiger<br />
Bestandteil e<strong>in</strong>es modernen <strong>in</strong>tegrierten<br />
Hochwasserschutzkonzeptes. Betrachtet<br />
man ausschließlich die Hochwasserschutzfunktion<br />
dieser Maßnahmen,<br />
s<strong>in</strong>d aber auch deutliche Grenzen aufzuführen.<br />
Dezentrale Maßnahmen können nur<br />
dann Scheitelabm<strong>in</strong>derungen erwirken,<br />
wenn sie <strong>in</strong> entsprechend großer Zahl<br />
vorhanden s<strong>in</strong>d und wenn sie standortspezifisch<br />
optimiert bzw. komb<strong>in</strong>iert<br />
werden. Allgeme<strong>in</strong> nimmt ihre Wirkung<br />
mit wachsender E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />
deutlich ab. Darüber h<strong>in</strong>aus ist die<br />
Wirksamkeit der Maßnahmen stark von<br />
dem jeweiligen Niederschlagsereignis<br />
abhängig. Viele dieser Maßnahmen<br />
erzielen bei kurzen <strong>in</strong>tensiven Niederschlagsereignissen,<br />
wie sie im Sommer<br />
auftreten, ihre optimale Wirkung, vor allem<br />
wenn der Boden nicht vorgesättigt<br />
ist. Ist die Wasserspeicherfähigkeit des<br />
Bodens erschöpft, so werden vor allem<br />
die dezentralen Maßnahmen unwirksam,<br />
die die Infiltrationseigenschaften<br />
von Böden verbessern. Diese Tatsache<br />
wurde unter anderem <strong>in</strong> der LAHoR-<br />
Studie (KHR, 2003) nachgewiesen und<br />
ist <strong>in</strong> Abbildung 6 dargestellt. Hierbei ist<br />
erkennbar, dass sich Landnutzungsänderungen,<br />
wie die Erhöhung des Siedlungsanteils<br />
deutlicher bei kurzen, <strong>in</strong>tensiven<br />
Niederschlägen auswirken.<br />
STEINMANN (2007) folgert aus der Studie<br />
zahlreicher Untersuchungen, dass<br />
diese übere<strong>in</strong>stimmend zeigen, dass<br />
der E<strong>in</strong>fluss dezentraler Maßnahmen mit<br />
Abb. 6: Auswirkung erhöhter Siedlungsanteile auf den Abfluss unter dem E<strong>in</strong>fluss verschiedener Niederschlagsereignisse (Jährlichkeit<br />
des Niederschlags: 3 Jahre, Größe des E<strong>in</strong>zugsgebietes: 115 km²) (KHR, 2003)<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
11
12<br />
Titelbericht<br />
zunehmender E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße, mit<br />
zunehmendem Gefälle, mit zunehmender<br />
Niederschlags<strong>in</strong>tensität und damit<br />
vor allem auch mit abnehmender Ereignishäufigkeit<br />
abnimmt (vgl. auch Abb.<br />
7 für das Beispiel Gewässerrenaturierung).<br />
Viele dezentrale Maßnahmen s<strong>in</strong>d<br />
bis zu e<strong>in</strong>em Abfluss von HQ 20 wirksam.<br />
Die dennoch bestehende Berechtigung,<br />
dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
zu realisieren, liegt zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> den<br />
genannten Synergien begründet, zum anderen<br />
ist die Machbarkeit e<strong>in</strong>es zentralen<br />
Rückhaltebeckens auf Grund bestehender<br />
Bauwerke, Infrastrukturanlagen, landwirtschaftlicher<br />
Nutzungen häufig schwer<br />
umsetzbar (HUMBEL, 2002).<br />
Bei der Umsetzung dezentraler Hochwasserschutzmaßnehmen<br />
kommt erschwerend<br />
der angesprochene große<br />
Flächenbedarf h<strong>in</strong>zu, wodurch Überschneidungen<br />
der Nutzungsansprüche<br />
beispielsweise mit der Landwirtschaft<br />
entstehen. Die angesprochenen grassed<br />
waterways (GWW) s<strong>in</strong>d hierfür e<strong>in</strong><br />
anschauliches Beispiel: Neben der nachgewiesenen<br />
Wirkung dieser Maßnahme<br />
ist festzustellen, dass <strong>in</strong> dem betrachteten<br />
Teilgebiet mit e<strong>in</strong>er Fläche von 21,8<br />
ha e<strong>in</strong> GWW e<strong>in</strong>e Ausdehnung von 10<br />
m – 50 m Breite auf 650 m Länge besitzt<br />
(FIENER & AUERSWALD, 2007). Dies<br />
entspricht e<strong>in</strong>er Fläche von 1,95 ha, wodurch<br />
ca. 9% der Fläche nicht mehr zur<br />
Bewirtschaftung und für den Ertrag zur<br />
Verfügung stehen (Abb. 8).<br />
Dies führt möglicherweise dazu, dass<br />
Landwirte nicht gewillt s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e solche<br />
Maßnahme umzusetzen, was auch<br />
für dezentrale Rückhaltebecken, Aufforstungsmaßnahmen<br />
oder ähnliche<br />
Landnutzungsänderungen im S<strong>in</strong>ne<br />
des Hochwasserschutzes gilt, die die<br />
bewirtschaftbare Fläche reduzieren.<br />
Abb. 7: E<strong>in</strong>fluss des Gewässerlängsgefälles auf Scheitelreduzierungen durch Renaturierungsmaßnahmen<br />
an Gewässer verschiedener Größenordnungen, bezogen auf<br />
e<strong>in</strong>e Gewässerstrecke von 20km (BAUER, 2007)<br />
Zusammenfassende Bewertung<br />
Der Vergleich dezentraler Maßnahmen<br />
mit zentralen Hochwasserrückhaltebecken<br />
ergab bezüglich Wirkung und<br />
Kosten den e<strong>in</strong>deutigen Vorzug für das<br />
zentrale Becken. Jedoch wurde aufgezeigt,<br />
dass durch dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
neben den Auswirkungen<br />
auf den Hochwasserabfluss<br />
weitere positive Nebeneffekte, auch im<br />
S<strong>in</strong>ne der EU-WRRL, erzielt werden.<br />
Technische Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> unverzichtbar für<br />
e<strong>in</strong>en möglichst wirksamen Hochwasserschutz.<br />
Die dezentralen Maßnahmen<br />
können gerade dort e<strong>in</strong>e Alternative<br />
darstellen, wo aus standörtlichen Ge-<br />
Abb. 8: Untersuchungsgebiet SCHEYERN mit Grassed Waterway (FIENER & AUERSWALD, 2007)<br />
gebenheiten e<strong>in</strong>e zentrale Maßnahme<br />
nicht möglich ist. Vielmehr jedoch s<strong>in</strong>d<br />
die dezentralen Maßnahmen gemäß<br />
LAWA-Leitl<strong>in</strong>ie (1995) als zusätzlicher<br />
Beitrag zu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>tegrierten Hochwasserschutzkonzept<br />
zu sehen, <strong>in</strong>dem sie<br />
zentrale Maßnahmen ergänzen und<br />
entlasten, vor kle<strong>in</strong>eren Hochwassern<br />
schützen und mit ihren genannten Synergieeffekten<br />
bessere Konditionen<br />
für Natur, Landwirtschaft und Mensch<br />
schaffen.<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Disse<br />
Wolfgang Rieger<br />
UniBW<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Der besondere Beitrag<br />
Der besondere Beitrag<br />
Wasserproblematik aus globaler Sicht -<br />
Chancen für bayerische Unternehmen<br />
Nachfolgender Beitrag ist <strong>in</strong> der Zeitschrift „Technik <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“, Ausgabe 2 veröffentlicht worden. Wegen der Bedeutung für<br />
wasserwirtschaftliches Handeln erfolgt hier die ungekürzte Wiedergabe. Der Chefredaktion der Zeitschrift wird für die Freigabe<br />
des Artikels gedankt.<br />
Situation <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> / Deutschland<br />
Wasser ist für uns <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>, <strong>in</strong> Deutschland<br />
ke<strong>in</strong> Thema. Wir haben überall ausreichende<br />
Mengen an Wasser <strong>in</strong> bester<br />
Qualität. Wasser steht für alle Lebensbereiche<br />
- für den Humanverbrauch,<br />
für die Landwirtschaft und die Industrie<br />
- zur Verfügung. Unser Leben, unser<br />
Umgang mit dem Wasser ist auf diese<br />
Tatsache der generellen Verfügbarkeit<br />
aufgebaut.<br />
Wir gehen dabei zweifelsohne sorgsam<br />
mit unserem Wasser um. Wir haben <strong>in</strong><br />
150 Jahren e<strong>in</strong> System der Ver- und<br />
Entsorgung aufgebaut, welches perfekt<br />
funktioniert. Wir entnehmen der Natur<br />
Wasser, verwenden es für den jeweiligen<br />
Verbrauch, re<strong>in</strong>igen es und geben<br />
es dann <strong>in</strong> möglichst ursprünglichem<br />
Zustand der Natur zurück. Dieser Umgang<br />
mit Wasser ist bei uns möglich, weil<br />
Wasser ausreichend vorhanden ist. Wir<br />
müssen nicht sparsam, aber wir müssen<br />
sorgsam mit dem Wasser umgehen und<br />
das tun wir.<br />
Passend zu unseren klimatischen Verhältnissen<br />
haben wir diese Wasserversorgung<br />
mit entsprechend gesetzlichen<br />
Vorgaben und behördlichen Kontrollen<br />
aufgebaut. Wir haben die dazu notwendigen<br />
Technologien der Gew<strong>in</strong>nung,<br />
Speicherung, Verteilung und Re<strong>in</strong>igung<br />
entwickelt und diese genügen den Anforderungen.<br />
Sie s<strong>in</strong>d darüber h<strong>in</strong>aus wirtschaftlich<br />
und sie s<strong>in</strong>d vor allen D<strong>in</strong>gen<br />
umweltfreundlich. Das soll nicht heißen,<br />
dass wir nicht noch Weiterentwicklungen<br />
<strong>in</strong> der Technologie bräuchten. Natürlich<br />
müssen wir <strong>in</strong> Zukunft noch mehr Wert<br />
darauf legen, der Natur unser Wasser<br />
absolut gere<strong>in</strong>igt zurückzugeben. Dazu<br />
gehören Technologien, die über die bisherigen<br />
Re<strong>in</strong>igungsverfahren h<strong>in</strong>ausgehen,<br />
die vor allen D<strong>in</strong>gen Bakterien, Viren,<br />
aber auch Antibiotika, Hormone aus<br />
dem aufbereiteten Abwasser entfernen.<br />
Dies wird dann umso wichtiger, wenn wir<br />
kle<strong>in</strong>ere Kreisläufe zu schließen haben,<br />
d.h. unser gebrauchtes, aufbereitetes<br />
Abwasser wieder <strong>in</strong> das Grundwasser<br />
zurückführen wollen. Dies wird zu<br />
überlegen se<strong>in</strong>, wenn – durch den Kli-<br />
Wasserknappheit <strong>in</strong> Deutschland: ke<strong>in</strong> Thema<br />
mawandel – auch bei uns e<strong>in</strong> anderes<br />
Wasserdargebot herrschen wird, wenn<br />
wir längere Trockenzeiten zu überstehen<br />
haben, wenn wir stärkere Regenereignisse<br />
dazu nutzen müssen, unsere<br />
Grundwasservorräte aufzufüllen.<br />
Diese Technologien stehen zum Teil <strong>in</strong><br />
Form von Membrantechnologien, UV-<br />
und Ozonbehandlung zur Verfügung.<br />
Die ersten Anwendungen dieser Richtung<br />
gibt es, da <strong>in</strong>zwischen die Abläufe<br />
aus e<strong>in</strong>igen bayerischen Kläranlagen<br />
bereits „Badewasserqualität“ haben. So<br />
wird derzeit die Kläranlage Hutthurm mit<br />
e<strong>in</strong>er entsprechenden Membrananlage<br />
ausgerüstet, die dies gewährleistet.<br />
Wassersituation – global<br />
Ganz andere Probleme stellen sich <strong>in</strong><br />
weiten Teilen der Welt heute schon dar,<br />
wenn wir bedenken, dass etwa 1,2 Milliarden<br />
Menschen ke<strong>in</strong>en Zugang zu sauberem<br />
Tr<strong>in</strong>kwasser und 2,4 Milliarden<br />
Menschen ke<strong>in</strong>e adäquate Abwasserentsorgung<br />
haben. Die Folgen davon<br />
s<strong>in</strong>d Krankheiten, Hunger und täglich<br />
etwa 6.000 Menschenleben, die der<br />
Mangel an Wasser bzw. verschmutztes<br />
Wasser fordern. H<strong>in</strong>zu kommt Hunger,<br />
da <strong>in</strong> diesen wasserarmen Gebieten<br />
nicht genügend Lebensmittel angebaut<br />
werden können.<br />
Deshalb hat United Nations im Jahr 2005<br />
die „Millennium Development Goals“ verabschiedet,<br />
welche fordern<br />
„… die Zahl der Menschen, die ke<strong>in</strong>en<br />
Zugang zu sauberem Wasser haben, zu<br />
halbieren,<br />
… die Zahl der Menschen, die ke<strong>in</strong>e<br />
adäquate Abwasserentsorgung hat, zu<br />
halbieren.“<br />
Die hauptsächlich von dieser Situation<br />
betroffenen Gebiete s<strong>in</strong>d Afrika, große<br />
Teile Südamerikas und Teile Asiens.<br />
Dabei wissen wir, dass sich das Problem<br />
noch dadurch verschärfen wird, dass<br />
wir vor weiteren gravierenden Veränderungen<br />
stehen, die verursacht werden<br />
durch<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
13
14<br />
Der besondere Beitrag<br />
2,4 Mrd. Menschen haben weltweit ke<strong>in</strong>e adäquate Abwasserentsorgung, die Folgen s<strong>in</strong>d Krankheit durch Mangel an Wasser<br />
oder verschmutztes Wasser<br />
➢ Klimawandel<br />
➢ wachsende Weltbevölkerung<br />
➢ Migration<br />
➢ Anwachsen der Megacities<br />
Wir <strong>in</strong> den entwickelten Ländern müssen<br />
e<strong>in</strong> starkes Interesse daran haben,<br />
dass die Probleme <strong>in</strong> diesen Regionen<br />
für diese Menschen gelöst werden. Dies<br />
ist nicht nur e<strong>in</strong>e humanitäre Aufgabe,<br />
sondern wir müssen uns dessen bewusst<br />
se<strong>in</strong>, dass, wenn wir die Probleme<br />
<strong>in</strong> diesen Ländern nicht lösen, die Probleme<br />
dann <strong>in</strong> Form von Menschen zu uns<br />
kommen werden. Dies geschieht heute<br />
schon durch die Migranten aus Afrika<br />
Darstellung Huber Safe Dr<strong>in</strong>k-Verfahren®<br />
nach Süditalien, nach Spanien und auf<br />
die Kanarischen Inseln.<br />
Chancen für bayerische / deutsche<br />
Unternehmen<br />
Natürlich bietet die globale Wassersituation<br />
auch Exportchancen für die deutsche<br />
Industrie. Deutschland hat e<strong>in</strong> breit<br />
gefächertes Spektrum an Firmen, die<br />
sich mit Beratung, Ausrüstung, Bau und<br />
Betrieb von Anlagen für Wasser/Abwasser<br />
beschäftigen und dort e<strong>in</strong>en hervorragenden<br />
Ruf genießen. Dass diese Firmen<br />
Chancen <strong>in</strong> diesem globalen Markt<br />
haben, ist selbstverständlich. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
müssen wir, um diese Chancen zu nutzen,<br />
angepasste Leistungen, Produkte<br />
und Technologien anbieten.<br />
Angepasst heißt dabei, an<br />
➢ klimatische Verhältnisse<br />
➢ Wasserdargebot, Wasserknappheit<br />
➢ Siedlungsstruktur<br />
➢ das Problem der Megacities<br />
Angepasst heißt darüber h<strong>in</strong>aus auch,<br />
dass die von uns angebotenen Produkte<br />
und Leistungen bedienbar, bezahlbar<br />
und <strong>in</strong> der zur Verfügung stehenden Zeit<br />
realisierbar s<strong>in</strong>d.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Bei allen angepassten Technologien<br />
dürfen ke<strong>in</strong>e Abstriche <strong>in</strong> der notwendigen<br />
Hygiene gemacht werden. Die Gesundheit,<br />
die Sicherheit der Menschen<br />
ist oberstes Pr<strong>in</strong>zip. Dabei müssen wir<br />
davon ausgehen, dass <strong>in</strong> diesen Zielländern<br />
Wasser generell der Wiederverwendung<br />
zugeführt wird und unsere<br />
Technologien müssen so angepasst<br />
se<strong>in</strong>, dass sie der jeweiligen Art der Wiederverwendung<br />
entsprechen – „Treatment<br />
fit for purpose“. Etwa 80% des gesamten<br />
Süßwassers ist zur Erzeugung<br />
von Nahrungsmitteln notwendig, d.h.<br />
wird <strong>in</strong> der Landwirtschaft gebraucht.<br />
In Regionen, <strong>in</strong> denen Regen, Grundwasser<br />
nicht zur Verfügung steht, ist es<br />
s<strong>in</strong>nvoll, Abwasser aufzubereiten und<br />
damit die Felder zu bewässern. Hier ist<br />
es sicherlich nicht s<strong>in</strong>nvoll – wie es bei<br />
uns üblich ist –, Stickstoff und Phosphor<br />
zu entfernen, sondern diese Nährstoffe<br />
sollen im Wasser belassen werden, da<br />
sie ja als Dünger für die Felder dienen;<br />
dies als Beispiel für andere, s<strong>in</strong>nvolle<br />
Technologien.<br />
Wiederum muss diese Bewässerung<br />
<strong>in</strong> diesen ariden Gebieten so erfolgen,<br />
dass ke<strong>in</strong>e Verdunstungsverluste auftreten.<br />
Bei Sprühbewässerung gehen<br />
z. B. 50% des Wassers durch Verdunstung<br />
verloren. Aus diesem Grund muss<br />
dort Wurzel- bzw. Flutungsbewässerung<br />
durchgeführt werden.<br />
Wasserwiederverwendung bed<strong>in</strong>gt <strong>in</strong>sgesamt<br />
andere Technologien, schließt<br />
kle<strong>in</strong>räumige Wasserkreisläufe, schafft<br />
aber auch mehr Verantwortung des Nutzers<br />
für das Wasser. Dies bedeutet aber<br />
auch dezentrale Anlagen der Wasserver-<br />
und Abwasserentsorgung, die nahe<br />
am Kunden s<strong>in</strong>d, die auch e<strong>in</strong> stärkeres<br />
Bewusstse<strong>in</strong> für Wasser schaffen.<br />
Technologien für die Tr<strong>in</strong>kwasserversorgung<br />
In ariden, <strong>in</strong> Wassermangelgebieten und<br />
Megacities stellt die Tr<strong>in</strong>kwasserversorgung<br />
e<strong>in</strong> besonderes Problem dar. Hier<br />
reichen häufig die natürlichen Ressourcen<br />
aus Oberflächen- und Grundwasser<br />
nicht aus, um die Menschen mit Tr<strong>in</strong>k-<br />
und Gebrauchswasser zu versorgen.<br />
Hier bieten sich drei Möglichkeiten an,<br />
die auch bereits umgesetzt werden<br />
➢ Aufbereitung von Abwasser zu<br />
Brauchwasser<br />
➢ Aufbereitung von Abwasser zu<br />
Tr<strong>in</strong>kwasser<br />
➢ Tr<strong>in</strong>kwasser durch Meerwasserentsalzung<br />
➢ Tr<strong>in</strong>kwasser aus Luftfeuchte<br />
Diese vier Technologien stehen zur Verfügung.<br />
Dabei ist selbstverständlich die<br />
Gew<strong>in</strong>nung von Wasser aus Luftfeuchte<br />
Der besondere Beitrag<br />
Ohne Wasser ke<strong>in</strong> Leben: weltweit haben etwa 1,2 Mrd. Menschen ke<strong>in</strong>en Zugang<br />
zu sauberem Tr<strong>in</strong>kwasser<br />
heute noch <strong>in</strong> den Anfängen. Aber gerade<br />
diese Technologie dürfte auch im<br />
Rahmen des Klimawandels, d.h. höherer<br />
Lufttemperaturen und damit verbundenen<br />
höheren Luftfeuchtegehalten, an<br />
Bedeutung gew<strong>in</strong>nen.<br />
Die Meerwasserentsalzung ist dabei immer<br />
mit hohen energetischen Aufwänden<br />
verbunden und damit entsprechend<br />
kosten<strong>in</strong>tensiv und umweltbelastend.<br />
E<strong>in</strong> weiteres Anwendungsgebiet ergibt<br />
sich sicherlich noch <strong>in</strong> der adäquaten<br />
Aufbereitung von Abwasser h<strong>in</strong> zu<br />
Brauchwasser (mit relativ e<strong>in</strong>fachen<br />
Technologien) und h<strong>in</strong> zu Tr<strong>in</strong>kwasser,<br />
wie dies der Stadtstaat S<strong>in</strong>gapur heute<br />
bereits erfolgreich durchführt.<br />
Chancen für deutsche Unternehmen<br />
In diesem globalen Wassermarkt, der<br />
heute bereits e<strong>in</strong>en Umfang von etwa<br />
$ 180 Milliarden/Jahr umfasst und jährlich<br />
um 6% Prozent wächst, gibt es für<br />
die deutschen Firmen e<strong>in</strong> weites Betätigungsfeld.<br />
Dabei können diese nicht nur<br />
durch niedrigen Preis punkten, sondern<br />
mit Attributen, die glaubhaft s<strong>in</strong>d, die<br />
Deutschland allgeme<strong>in</strong> zugeschrieben<br />
werden:<br />
Innovation, Qualität,<br />
Nachhaltigkeit, Clean Bus<strong>in</strong>ess<br />
Ich denke, wenn sich die deutsche<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> diesen Pr<strong>in</strong>zipien<br />
verschreibt, wenn sie dazu steht, dann<br />
hat sie mit ihrem breiten Angebot an Produkten<br />
und Leistungen im Wassermarkt<br />
der Welt e<strong>in</strong>e gute Position. Dazu wird<br />
es aber auch notwendig se<strong>in</strong>, dass die<br />
deutsche Industrie den Bedürfnissen des<br />
Marktes dah<strong>in</strong>gehend Rechnung trägt,<br />
dass üblicherweise von den Kunden<br />
„Komplettlösungen“ erwartet werden.<br />
Das heißt, deutsche Firmen mit sich ergänzendem<br />
Leistungsspektrum müssen<br />
sich zu Konsortien zusammenf<strong>in</strong>den, <strong>in</strong><br />
denen sie das Problem des Kunden <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er Gesamtheit lösen. Diese Konsortien<br />
werden auf Zeit und projektbezogen<br />
e<strong>in</strong>zugehen se<strong>in</strong>.<br />
Ausblick<br />
Das Problem Wasser ist e<strong>in</strong> globales<br />
Problem, welches <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Fall unterschätzt<br />
werden darf. Es bietet Chancen<br />
für unsere Industrie, aber es ist auch<br />
e<strong>in</strong>e Verpflichtung für uns als Menschen.<br />
In diesem S<strong>in</strong>ne ist sicherlich auch die<br />
Politik gefordert, hier das Nötige zu tun,<br />
Forschung zu betreiben und geme<strong>in</strong>sam<br />
mit der Industrie <strong>in</strong> den Ländern der Welt<br />
aktiv zu werden.<br />
Es wird ke<strong>in</strong>e friedliche Welt geben,<br />
wenn die Menschen ke<strong>in</strong> Wasser haben.<br />
– Wasser ist die Grundlage des<br />
Lebens.<br />
Dr.-Ing. E.h. Hans Huber<br />
Hans Huber AG<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
15
16<br />
Veranstaltungen<br />
Veranstaltungen<br />
Sem<strong>in</strong>ar „Wasserrückhalt <strong>in</strong> der Fläche“<br />
Möglichkeiten und Grenzen des dezentralen Hochwasserschutzes<br />
am 31. Juli / 01. August 2008 <strong>in</strong> der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Laufen<br />
Der Schwerpunkt des Sem<strong>in</strong>ars besteht dar<strong>in</strong>, die Möglichkeiten und Grenzen dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
aufzuzeigen und an Hand von Beispielen zu erläutern.<br />
Am zweiten Tag wird e<strong>in</strong>e Podiumsdiskussion mit Vertretern des Naturschutzes, der Wissenschaft und der <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung<br />
das Thema aus verschiedenen Blickw<strong>in</strong>keln erörtern.<br />
Den Rahmen und E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> das Sem<strong>in</strong>ar bildet das vom Bayerischen Umweltm<strong>in</strong>isterium geförderte Projekt:<br />
Entwicklung e<strong>in</strong>er Methodik zur Erstellung von Hochwasserrückhaltekonzepten unter Berücksichtigung des Klimawandels am<br />
Beispiel W<strong>in</strong>dach<br />
Donnerstag, 31. Juli 2008<br />
ab 09:00 Registrierung<br />
11:00 Begrüßung und E<strong>in</strong>führung<br />
Dr. C. Goppel, Direktor der Bayer. ANL<br />
Mdgt Dr.-Ing. M. Grambow, Bayer. StMUGV<br />
Prof. Dr.-Ing. M. Disse, UniBw München<br />
11:30 Session I - Dezentraler Hochwasserrückhalt<br />
1. Dezentraler Hochwasserschutz am Beispiel der W<strong>in</strong>dach<br />
Dipl.-Ing. W. Rieger, UniBw München<br />
2. Synergien zwischen <strong>Wasserwirtschaft</strong> und Naturschutz beim Wasserrückhalt <strong>in</strong> der Fläche<br />
LRD H. Leicht, Bayer. LfU<br />
3. Hochwasserrisikomanagement und natürlicher Wasserrückhalt<br />
Prof. Dr.-Ing. U. Grünewald, BTU Cottbus<br />
13:00 Mittagspause<br />
14:30 Session II - Maßnahmen <strong>in</strong> der Landwirtschaft<br />
4. Vorbeugender Hochwasserschutz durch Wasserrückhalt <strong>in</strong> der Fläche - untersucht am Beispiel des E<strong>in</strong>zugsgebiet<br />
der Mulde <strong>in</strong> Sachsen<br />
Prof. Dr.-Ing. F. Sieker, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH<br />
5. Möglichkeiten und Grenzen der Wasserrückhaltung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen<br />
Herr Kreitmayr, Bayer. Landesanst. f. Landwirtschaft<br />
6. Wirkung der Land- und Forstwirtschaft auf Extremereignisse<br />
Prof. Dr.-Ing. H.-P. Nachtnebel, Universität für Bodenkunde Wien<br />
16:00 Kaffeepause<br />
16:30 Session III - Maßnahmen <strong>in</strong> der Forstwirtschaft<br />
7. Dezentraler Wasserrückhalt im Wald <strong>in</strong> Abhängigkeit des Standortpotentials.<br />
Prof. Dr. habil. G. Schüler, Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz<br />
8. Das forsthydrologische Paradigma - Entstehung, Wandel und heutiger Stand<br />
Prof. Dr. P. Germann, Universität Bern<br />
9. Aufforstungsmaßnahmen und Hochwasserschutz<br />
Dr. F. B<strong>in</strong>der, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freis<strong>in</strong>g<br />
18.00 Ende der Vorträge<br />
20:00 Abendessen<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Freitag, 01. August 2008<br />
09:00 Session IV - Natur- und Hochwasserschutz<br />
Veranstaltungen<br />
10. Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts im E<strong>in</strong>zugsgebiet: Ergebnisse aus dem Rhe<strong>in</strong>- und Illergebiet<br />
Prof. Dr.-Ing. A. Bronstert, Universität Potsdam<br />
11. Ökologie und Hochwasserschutz I<br />
Herr L. Sothmann, Landesbund für Vogelschutz<br />
12. Ökologie und Hochwasserschutz II<br />
Prof. Dr. H. Weiger, Bund Naturschutz<br />
10:30 Kaffeepause<br />
11:00 Session V – Diskussion<br />
13. Wasserrückhalt <strong>in</strong> der Fläche und Jahrhunderthochwasser<br />
Prof. G. Ste<strong>in</strong>mann, FH Würzburg<br />
12:30 Zusammenfassung<br />
Prof. Dr.-Ing. M. Disse, UniBw München<br />
MR P. Frei, Bayer. StMUGV<br />
Organisatorisches<br />
Anmeldung: Per Fax oder Email<br />
Anmeldeschluss: 04. Juli 2008<br />
Teilnahmegebühren: ke<strong>in</strong>e,<br />
Tagungsunterlagen, Kaffeepausen, Mittagessen <strong>in</strong>klusive<br />
Teilnehmerzahl: max. 100<br />
Ansprechperson: Dipl.-Ing. Wolfgang Rieger<br />
Tel.: 089 / 6004 - 2477<br />
Fax: 089 / 6004 - 4642<br />
wolfgang.rieger@unibw.de<br />
Unterkunft: zu buchen über die Bayer. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
www.anl.bayern.de<br />
Tel.: 08682 / 89630<br />
Veranstalter: Professur für <strong>Wasserwirtschaft</strong> und Ressoucenschutz, Prof. Dr.-Ing. M. Disse,<br />
Institut für Wasserwesen, Universität der Bundeswehr<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
17
18<br />
Veranstaltungen<br />
Fachtagung „Gewässermorphologie & EU-WRRL“<br />
am 24. / 25. Juli 2008 <strong>in</strong> Wallgau<br />
Die Tagung befasst sich unter anderem mit dem <strong>aktuelle</strong>n Stand der Umsetzung der EU-WRRL, der Bedeutung der hydromorphologischen<br />
Parameter <strong>in</strong> der Umsetzung der WRRL, den flussbaulichen Projekten, der numerischen Modellierung von<br />
morphologischen Prozessen, den hydromorphologischen Maßnahmen im Rahmen der WRRL und der Messtechnik und dem<br />
Monitor<strong>in</strong>g.<br />
Im Anschluss an die Tagung f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong>e Besichtigung der Versuchsanstalt für Wasserbau <strong>in</strong> Obernach statt.<br />
Ziel der Fachtagung ist es, für beteiligte Unternehmen, Planungsbüros, <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltungen sowie Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
e<strong>in</strong>e Plattform zu bieten, auf der neue wissenschaftliche Entwicklungen, praxisbezogene Probleme und Erfahrungen<br />
präsentiert und diskutiert werden können.<br />
Donnerstag, 24. Juli 2008<br />
10:00 Begrüßung und E<strong>in</strong>führung / Peter Rutschmann<br />
Sitzung 01 – Umsetzung der WRRL<br />
10:10 Gewässerökologie und Gewässernutzung – die Fakten, das Recht, die Akteure / Rolf-Dieter Dörr<br />
10:35 Umsetzung der EU Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> - Strategie und Priorisierung / Grambow<br />
11:00 Verbesserung der Gewässerstruktur – Kraftakt von Naturwissenschaft, Ingenieurskunst und gesellschaftlicher<br />
Leistungsfähigkeit im Zeitkorsett der EU / Albert Göttle<br />
11:25 Die Wasserkraft <strong>in</strong> den Zeiten der EU-WRRL – E<strong>in</strong> Stück <strong>in</strong> drei Akten / Dom<strong>in</strong>ik Godde<br />
11:50 Mittagessen<br />
Sitzung 02 – Bedeutung der Hydromorphologie <strong>in</strong> der WRRL<br />
13:00 Bedeutung der Morphodynamik für die Zielerfüllung der Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie / Helmut Habersack<br />
13:25 Der gute Gewässerzustand als Zielvorgabe – von E<strong>in</strong>zelmaßnahmen zu e<strong>in</strong>er gewässersystemaren Entwicklung /<br />
Michael Weyand, Thomas Grünebaum<br />
13:50 Zielkonflikte und Potentiale bei der Umsetzung der WRRL an B<strong>in</strong>nenwasserstraßen / Jürgen Stamm<br />
14:15 Geschiebemanagement am frei fließenden Rhe<strong>in</strong> - Kon-zeption, Umsetzung, Erfolgskontrolle / Emil Gölz<br />
14:40 Kaffeepause<br />
Sitzung 03 - Flussbauliche Projekte<br />
15:10 Untere Salzach – E<strong>in</strong>tiefung ohne Ende? / Günther Hopf<br />
15:35 Untere Salzach – E<strong>in</strong> <strong>in</strong>novativer Lösungsansatz: weich und aufgelöst / Michael Spannr<strong>in</strong>g<br />
16:00 Der Isarplan - Vielfältige Anforderungen an den Hochwasserschutz <strong>in</strong> der Innenstadt von München /<br />
Stefan Kirner, Daniela Schaufuß<br />
16:25 Modellversuch Isarplan – die Große Isar ganz kle<strong>in</strong> / Markus Aufleger, Valerie Neisch<br />
16:50 Kaffeepause<br />
Sitzung 04 – Numerische Methoden<br />
17:20 Modellversuch Isarplan - numerischer Geschiebetransport ganz groß / Bernhard Schaipp, Frank Michel<br />
17:45 Numerische Modellierung von eigendynamischen Flussaufweitungsprozessen / Tobias Hafner<br />
18:10 3D Modelle für Geschiebetransport - was ist möglich / Peter Rutschmann, M<strong>in</strong>h Duc Bui<br />
18:35 Ende Vortragsprogramm Tag 1<br />
19:30 Geme<strong>in</strong>sames Abendessen im Haus des Gastes<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Freitag, 25. Juli 2008<br />
Sitzung 05 - Hydromorphologische Maßnahmen - Theorie und Praxis<br />
Veranstaltungen<br />
09:30 Kriterien für e<strong>in</strong>e Priorisierung hydromorphologi-scher Maßnahmen / Christoph L<strong>in</strong>nenweber<br />
09:55 Ökologische Effizienz von hydromorphologischen Verbesserungen / Walter B<strong>in</strong>der<br />
10:20 V-Rampen – ökologisch weitgehend durchgängige Querbauwerke / Andreas Niedermayr<br />
10:45 Anwendung neuer Methoden zur Sohlstabilisierung an der Unteren Iller / Marion Schneider, Christoph Schöpfer,<br />
Joachim Eberle<strong>in</strong>, Ottfried Arnold, Wil-helm Grotz, Wolfgang Schill<strong>in</strong>g, Me<strong>in</strong>hard Schlauß, Harald Blau<br />
11:10 Kaffeepause<br />
Sitzung 06 – Monitor<strong>in</strong>g und Messtechnik<br />
11:40 Modellierung der Wassergüte von Fließgewässern – Welchen E<strong>in</strong>fluss hat die Morphologie? / Harald Horn<br />
12:05 Hat das Schwebstoffmonitorr<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> e<strong>in</strong>e Zukunft? / Carmen Roth<br />
12:30 Abschätzung der Sohloberflächekornzusammensetzung von digitalen Photoaufnahmen / Nikos Efthymiou<br />
12:55 Erfassung hydromorphologischer Vorgänge mit ADCP-Messungen / Theodor Strobl, Kathar<strong>in</strong>a Fiedler<br />
13:20 Schlussworte / Peter Rutschmann<br />
13:30 Ende Vortragsprogramm Tag 2<br />
14:00 Besichtigung der Versuchsanstalt Obernach (Mittagsimbiss!)<br />
Organisatorisches:<br />
Veranstalter: Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau und <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
Technische Universität München, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Rutschmann,<br />
Arcisstraße 21, 80290 München<br />
Veranstaltungsort: Kurhaus „Haus des Gastes“ <strong>in</strong> 82499 Wallgau (an der Bundesstraße 11)<br />
Kontakt: Dipl.-Ing. Nikos Efthymiou, Tel.: 0 8858 920 317, FAX: 0 8858 9203 33, E-Mail: n.efthymiou@bv.tum.de<br />
Tagungsband: Zu den Vorträgen s<strong>in</strong>d Beiträge <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Mitteilungsband des Lehrstuhls gesammelt worden, der <strong>in</strong><br />
den Tagungsunterlagen enthalten ist.<br />
Teilnahmegebühren: Die Teilnahmegebühren betragen € 150,- pro Teilnehmer s<strong>in</strong>d unter Angabe des Vor- und Nachnamens<br />
und der PKNr. (!) auf unten angegebenes Konto zu überweisen. Der Tagungsbeitrag be<strong>in</strong>haltet<br />
die Teilnahme an der Fachtagung, den Tagungsband, die Verpflegung während der Pausen und der<br />
Abendveranstaltung. Ermäßigte Gebühren für Studenten, Hochschulangehörige, etc. auf Anfrage<br />
Bankverb<strong>in</strong>dung:<br />
Bayerische Landesbank Girozentrale, Empfänger: Lehrstuhl für Wasserbau,<br />
Konto: 24 866, Bankleitzahl: 700 500 00,<br />
Swift Code: bylademm, IBAN: DE10700500000000024866,<br />
PKNr. 0007.0143.8158<br />
Bitte PKNr. unbed<strong>in</strong>gt bei Überweisung angeben!<br />
Anmeldung: Die Anmeldung kann ab sofort per E-Mail, FAX, oder schriftlich erfolgen.<br />
Folgendes ist bei der Anmeldung anzugeben:<br />
Name, Vorname, Titel, Institution/Firma/Abteilung, Adresse, Telefon, FAX, E-Mail,<br />
Teilnahme am Abendessen / VAO-Besichtigung<br />
Anmeldeschluss: 27. Juni 2008<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
19
20<br />
Veranstaltungen<br />
Fachausstellung und Hochwasserforum Mangfall<br />
Vom 15. April bis 8. Mai 2008 fand e<strong>in</strong>e Fachausstellung „Hochwasserschutz Mangfall“ <strong>in</strong> der Zeigstelle der Volksbank Mangfalltal-<br />
Rosenheim <strong>in</strong> Bruckmühl statt. Die Ausstellung zeigte Wissenswertes von der Entstehung der Hochwasser, über den E<strong>in</strong>fluss<br />
des Menschen bis h<strong>in</strong> zu den Lösungen für das Mangfalltal und ergänzend historische Hochwasseraufnahmen.<br />
Nach dieser Auftaktveranstaltung f<strong>in</strong>det im Sommer 2008 e<strong>in</strong>e Veranstaltungsreihe „Hochwasserforum Mangfalltal“ des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Rosenheim statt. Diese Veranstaltung wurde im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt<br />
„Mangfalltal“ konzipiert. Der bayerische Staatsm<strong>in</strong>ister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz , Dr. Otmar Bernhard,<br />
hat für das Hochwasserforum die Schirmherrschaft übernommen.<br />
Programm „Hochwasserforum Mangfalltal“:<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Veranstaltungen<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
21
22<br />
In eigener Sache<br />
In eigener Sache<br />
Sem<strong>in</strong>ar „Nürnberger <strong>Wasserwirtschaft</strong>stag“ am 26. Juni 2008<br />
Im traditionellen Zweijahres-Turnus veranstaltet der DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> <strong>in</strong> diesem Jahr wieder se<strong>in</strong>en Nürnberger<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>stag <strong>in</strong> der Meisters<strong>in</strong>gerhalle <strong>in</strong> Nürnberg.<br />
In der 1-tägigen Veranstaltung werden <strong>in</strong>teressante Beiträge zu den Themenbereichen <strong>Wasserwirtschaft</strong> und Gewässerschutz<br />
angeboten. Die Vortragsthemen wurden dabei so ausgewählt, dass der praktische Nutzen für die Teilnehmer von Unternehmensträgern,<br />
Behörden und Ingenieurbüros möglichst hoch ist.<br />
Der Nürnberger <strong>Wasserwirtschaft</strong>stag wird von e<strong>in</strong>er Fachausstellung begleitet, <strong>in</strong> der Firmen und Ingenieurbüros ihre Produkte<br />
und Dienstleistungen aus den Bereichen Abwasser, Abfall und <strong>Wasserwirtschaft</strong> präsentieren.<br />
Die Teilnahmegebühr beträgt 90,00 € für DWA-Mitglieder bzw. 125,00 € für Nicht-Mitglieder.<br />
Weitere Informationen:<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong>, Friedenstraße 40, 81671 München; Tel: 089/233-62590, Fax: 089/233-62595,<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@dwa-bayern.de<br />
Programm:<br />
09.00 Uhr Eröffnung des Sem<strong>in</strong>ars und Begrüßung<br />
Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert, DWA-Landesverbandsvorsitzender<br />
Grußwort der Stadt Nürnberg<br />
09.20 Uhr Entwurf des neuen Umweltgesetzbuches<br />
MR Ulrich Drost, Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, München<br />
09.40 Uhr Neuerungen des EEG<br />
Dr.-Ing. Markus Schröder, Ingenieurgesellschaft Tuttahs und Meyer GmbH, Aachen<br />
10.00 Uhr Diskussion, anschließend Kaffeepause <strong>in</strong>nerhalb der Fachausstellung<br />
Sem<strong>in</strong>ar Gewässerschutz<br />
Block 1:<br />
Leitung: MR Dipl.-Ing. Erich Englmann, Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz,<br />
München<br />
10.50 Uhr Benchmark<strong>in</strong>g Abwasser <strong>Bayern</strong> – Projektvorstellung und Ergebnisse<br />
Dipl.-Ing. Peter Graf, aquabench GmbH, Köln<br />
11.10 Uhr Der neue PSW „Grundstücksentwässerungsanlagen“ – Dienstleister für Bürger und Kanalnetzbetreiber<br />
Dipl.-Ing. German Berger, Bayerisches. Landesamt für Umwelt, Augsburg<br />
11.30 Uhr Qualitätssicherung <strong>in</strong> der Kanalsanierung aus Sicht des Auftraggebers<br />
Dipl.-Ing. (FH) Mario He<strong>in</strong>le<strong>in</strong>, Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg<br />
11.50 Uhr Diskussion, anschließend Mittagspause <strong>in</strong>nerhalb der Fachausstellung<br />
Block 2:<br />
Leitung: Dr.-Ing. Friedrich Seyler, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg<br />
13.30 Uhr Energetische Konzepte für Kläranlagen<br />
Dr.-Ing. Gerd Kolisch, WiW mbH, Wuppertal<br />
13.50 Uhr Energiee<strong>in</strong>sparung auf Kläranlagen – Praktische Vorgehensweise und Erfahrungen aus der Praxis<br />
Dr. Stefan L<strong>in</strong>dtner, Ingenieurbüro k2w, Wien<br />
14.10 Uhr Umgang mit Betriebsstörungen auf Kläranlagen<br />
Dr. Volkmar Neitzel, Ruhrverband, Essen<br />
14.30 Uhr Diskussion, anschließend Kaffeepause <strong>in</strong>nerhalb der Fachausstellung<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Block 3:<br />
Leitung: Dipl.-Ing. Hermann Klotz, Münchner Stadtentwässerung<br />
15.30 Uhr Konsequenzen aus e<strong>in</strong>er neuen Düngemittel- und Klärschlammverordnung<br />
RD Dr. Claus Bergs, Bundesumweltm<strong>in</strong>isterium, Bonn<br />
15.50 Uhr Kommunale Zusammenarbeit bei der Reststoffentsorgung<br />
Johann Buchmeier, Entwässerungsbetrieb Stadt Straub<strong>in</strong>g<br />
In eigener Sache<br />
16.10 Uhr Konsequenzen für die Abwasser- und Schlammbehandlung aus alternativen Konzepten zur<br />
landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung<br />
Dr.-Ing. Eberhard Ste<strong>in</strong>le, Dr.-Ing. Dieter Schreff, Ste<strong>in</strong>le Ingenieurgesellschaft mbH, Weyarn<br />
16.30 Uhr Diskussion und Schlusswort<br />
Sem<strong>in</strong>ar <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
Block 1: Erdwärme, die Energie der Zukunft<br />
Leitung: Dipl.-Geol. Udo Kleeberger, <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Nürnberg<br />
10.50 Uhr Erdwärme, e<strong>in</strong>e zukunftssichere Energie – mit Beispielen aus der Praxis<br />
Dipl.-Geol. Manfred Piewak, Ingenieurbüro Piewak und Partner, Bayreuth<br />
11.10 Uhr Brunnenservice bei geothermischen und anderen Brunnen<br />
Gerhard Etschel, Etschel Brunnenservice GmbH, Hof<br />
11.30 Uhr Grundwasser-Wärmepumpen<br />
Dipl.-Ing. Hannes Berger, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Hof<br />
11.50 Uhr Diskussion, anschließend Mittagspause <strong>in</strong>nerhalb der Fachausstellung<br />
Block 2: Fischerei und <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
Leitung: Dipl.-Ing. Jürgen Bauer, DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong>, München<br />
13.30 Uhr Schlamm <strong>in</strong> der Wiesent – was tun?<br />
Dipl.-Ing. Erich Haussel, Regierung von Oberfranken, Bayreuth<br />
13.50 Uhr Fischereiliche Aspekte bei der Entschlammung von Gewässern<br />
Dr. Robert Klupp, Bezirk Oberfranken, Bayreuth<br />
14.10 Uhr Durchgängigkeit von Fließgewässern – Erfahrungsbericht<br />
Dr. Dagobert Smija, Regierung von Schwaben, Augsburg<br />
14.30 Uhr Diskussion, anschließend Kaffeepause <strong>in</strong>nerhalb der Fachausstellung<br />
Block 3: Hochwasserrückhalt<br />
Leitung: Dipl.-Ing. Erich Haussel, Regierung von Oberfranken, Bayreuth<br />
15.30 Uhr Die Bedeutung der Hochwasserrückhaltung im Seifener Becken – Obere Iller<br />
Dipl.-Ing. Karl Sch<strong>in</strong>dele, <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Kempten<br />
15.50 Uhr Standortsuche für Hochwasser-Rückhaltebecken<br />
Dr.-Ing. N<strong>in</strong>a W<strong>in</strong>kler, Ingenieurbüro W<strong>in</strong>kler und Partner GmbH, Stuttgart<br />
16.10 Uhr FFH-Verträglichkeit bei Raumordnungsverfahren für Hochwasserrückhaltebecken –<br />
Beispiele aus Oberfranken<br />
Dipl.-Geoökologe Franz Moder, Büro Opus, Bayreuth<br />
16.30 Uhr Diskussion und Schlusswort<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
23
24<br />
In eigener Sache<br />
Aufgrund der erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr<br />
führt der DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> im Oktober 2008<br />
wieder e<strong>in</strong>e Fachexkursion speziell für junge <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler<br />
unter 30 Jahren (Auszubildende zur Fachkraft für<br />
Abwassertechnik bzw. Rohr- Kanal- und Industrietechnik,<br />
Ver- und Entsorger, Abwassermeister, Studierende bzw. Absolventen<br />
von Hochschulen u. a.) durch.<br />
Bei der Exkursion werden verschiedene Objekte (Wasserkraft,<br />
Abwasserbehandlung, Gewässerrenaturierung, Industrietechnik<br />
u. a.) besichtigt und Gespräche mit führenden Personen<br />
aus den jeweiligen Unternehmen geführt. Die Fachexkursion<br />
bietet den Teilnehmern dadurch die Gelegenheit, die Aufgaben<br />
<strong>in</strong> der <strong>Wasserwirtschaft</strong> anhand praktischer Beispiele<br />
genauer kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen und sich<br />
über Beschäftigungsmöglichkeiten sowie berufliche Entwicklungsmöglichkeiten<br />
zu <strong>in</strong>formieren. Die Veranstaltung wird von<br />
Fachleuten begleitet, die schon viele Jahre <strong>in</strong> der bayerischen<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> tätig s<strong>in</strong>d. Dadurch können, z.B. während<br />
des geme<strong>in</strong>samen Abendessens <strong>in</strong>teressante Gespräche<br />
geführt und Erfahrungen ausgetauscht werden.<br />
Die Fachexkursion für junge <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler im Jahr 2006<br />
auf der Kläranlage D<strong>in</strong>golf<strong>in</strong>g……<br />
Begleitung:<br />
Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert<br />
(Universität der Bundeswehr München, DWA-Landesverbandsvorsitzender <strong>Bayern</strong>)<br />
Dipl.-Ing. Richard Oberhauser<br />
(Amtsleiter des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes Hof, stellvertretender DWA-Landesverbandsvorsitzender <strong>Bayern</strong>)<br />
Teilnahmegebühr:<br />
Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro für DWA-Mitglieder bzw. 20 Euro für Nicht-Mitglieder. Im Preis ist die Busfahrt <strong>in</strong>begriffen;<br />
Verpflegung ist dar<strong>in</strong> nicht enthalten.<br />
Mitgliederwerbung:<br />
Nicht-Mitglieder, die im Vorfeld der Exkursion e<strong>in</strong>en Aufnahmeantrag für e<strong>in</strong>e Mitgliedschaft <strong>in</strong> der DWA unterschreiben,<br />
können kostenlos an der Exkursion teilnehmen.<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>er Schnuppermitgliedschaft ist für neue Jungmitglieder die DWA-Mitgliedschaft bis Ende 2008 kostenfrei.<br />
Weitere Informationen:<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong>, Friedenstraße 40, 81671 München; Tel: 089/233-62590; Fax: 089/233-62595; E-Mail: <strong>in</strong>fo@<br />
dwa-bayern.de; Homepage: www.dwa-bayern.de<br />
… bei der Hans Huber AG <strong>in</strong> Berch<strong>in</strong>g,<br />
…..<br />
… bei der Besichtigung des Projekts „Isar-<br />
Plan“ <strong>in</strong> München, ...<br />
… und beim E.ON-Kraftwerk <strong>in</strong> Neuf<strong>in</strong>s<strong>in</strong>g.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Symposium „Klimawandel – was kann die <strong>Wasserwirtschaft</strong> tun?“<br />
am 24. / 25. Juni 2008 <strong>in</strong> Nürnberg - Meisters<strong>in</strong>gerhalle<br />
Anpassung und Vorsorge statt Verh<strong>in</strong>derung<br />
In eigener Sache<br />
Klimawandel ist e<strong>in</strong> prom<strong>in</strong>entes Thema auf höchster politischer Ebene geworden.<br />
Auf der Veranstaltung der Fachgeme<strong>in</strong>schaft Hydrologische Wissenschaften <strong>in</strong> der DWA sowie dem DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
soll vorgetragen und diskutiert werden, wo neue wasserwirtschaftliche Probleme durch den Klimawandel zu erwarten und<br />
welche Handlungsmöglichkeiten bereits überlegt und vorbereitet worden s<strong>in</strong>d. Dabei wird nicht der Ansatz verfolgt bestimmte<br />
Aktivitätsfelder des Menschen „klimasicher“ zu machen. Vielmehr steht im Fokus, wie man sich dem Klimawandel anpassen<br />
kann, d.h. se<strong>in</strong>e Folgen auf regionaler, lokaler und fachspezifischer Ebene erkennen und Maßnahmen konkret gestalten kann.<br />
Schwerpunkte:<br />
• Grundlagen und Wirkungen des Klimawandels<br />
• Modellierungen<br />
• Maßnahmen bei geänderten extremen Ereignissen<br />
• Aktivitäten bei geänderter Wasserverfügbarkeit und Wasserqualität<br />
• Ökonomische und politische Folgen<br />
Organisatorisches<br />
Term<strong>in</strong>: 24. / 25. Juni 2008<br />
Ort: Nürnberg – Meisters<strong>in</strong>gerhalle<br />
Veranstalter: Fachgeme<strong>in</strong>schaft Hydrologische Wissenschaften <strong>in</strong> der DWA<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
Zielgruppe: Ingenieure und Naturwissenschaftler aus Unternehmen, Verbänden,<br />
Verwaltungen, Hochschulen, Ingenieurbüros<br />
Teilnahmegebühren: 260 € (DWA-Mitglied) bzw. 320 € (Nicht-Mitglied)<br />
Weitere Informationen:<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong>, Friedenstraße 40, 81671 München<br />
Tel: 089/233-62590, Fax: 233-62595<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@dwa-bayern.de<br />
Das detaillierte Programm e<strong>in</strong>schließlich Anmeldemöglichkeit kann auch im Internet unter www.dwa-bayern.de abgerufen<br />
werden.<br />
Workshop „Kanalsanierung, Anforderungsprofil für Schlauchl<strong>in</strong>ersanierungen“<br />
Im Zuge von haltungsweisen Kanalsanierungen ist der E<strong>in</strong>satz von Schlauchl<strong>in</strong>ern e<strong>in</strong> weit verbreitetes System. Das Sanierungsverfahren<br />
ist e<strong>in</strong>erseits technisch weit entwickelt andererseits qualitativen Schwankungen unterworfen. Dies ist u. a. darauf<br />
zurückzuführen, dass unterschiedliche Ausschreibungs- und Ausführungsanforderungen existieren. E<strong>in</strong>e Arbeitsgruppe mehrerer<br />
süddeutscher Städte hat es sich zur Aufgabe gemacht e<strong>in</strong> Anforderungsprofil zu erstellen, das Planung, Ausschreibung,<br />
Wertung, Ausführung und Qualitätskontrolle von Schlauchl<strong>in</strong>ersanierungen e<strong>in</strong>deutig regelt. Dieses Anforderungsprofil kann<br />
als zusätzliche technische Vertragsgrundlage (ZTV) dem Bauvertrag beigefügt werden. Der Aufbau und die Anwendung des<br />
Anforderungsprofils, sowie die Vorstellung praktischer Ergebnisse s<strong>in</strong>d Inhalt des Workshops.<br />
Zielgruppe des Workshops s<strong>in</strong>d kommunale Tiefbauämter und Abwasserentsorgungsunternehmen sowie Ingenieure und Techniker,<br />
die mit der Planung und Ausführung von Kanalsanierungsprojekten befasst s<strong>in</strong>d.<br />
Aus dem Programm<strong>in</strong>halt<br />
• Grundlagen • Vergabe und Wertung<br />
• Sanierungsverfahren • Qualitätssicherung<br />
• Statische Dimensionierung • Materialprüfung und Maßnahmenbewertung<br />
• Planung und Ausschreibung<br />
Der Workshop wird vom DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> im Herbst 2008 <strong>in</strong> Südbayern durchgeführt.<br />
Weitere Informationen und e<strong>in</strong> Anmeldeformular zu der Veranstaltung erhalten Sie beim DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong>: Tel.<br />
089/23362590; E-Mail: <strong>in</strong>fo@dwa-bayern.de; Homepage: www.dwa-bayern.de<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
25
26<br />
In eigener Sache<br />
Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief<br />
Unsere Me<strong>in</strong>ung<br />
Liebe Leser<strong>in</strong>nen und Leser,<br />
haben Sie zufällig die beiden Artikel über die Gründung des „HochwasserKompetenzCentrums e.V.“<br />
(HKC) <strong>in</strong> der Aprilausgabe der KA oder KW gelesen? Wenn ja, dann wird Ihnen beim Durchlesen vielleicht<br />
kaum etwas Besonderes aufgefallen se<strong>in</strong>, da der Artikel die Tatsachen nur unzureichend wiedergibt.<br />
Wir wollen Ihnen gerne sagen, was uns an diesen Darstellungen und an dem neuen Vere<strong>in</strong> stört und<br />
entrüstet. Wenn Sie nämlich auf die Internetseite dieses neuen Vere<strong>in</strong>s gehen (www.hkc-koeln.de) - <strong>in</strong><br />
dem erwähnten Artikel fehlt dieser H<strong>in</strong>weis - , dann können Sie <strong>in</strong> der Satzung und auf der Homepage<br />
nachlesen, um was es hier eigentlich geht.<br />
Aus den im Internet aufgelisteten Aufgabengebieten, Schwerpunkten und Arbeitsweisen greifen wir nur<br />
e<strong>in</strong>ige heraus:<br />
• Wirkungszusammenhänge zwischen Umwelt, Klima und Hochwasser<br />
• Hochwasservorhersage, Risikoerfassung und -bewertung<br />
• Technischer und baulicher Hochwasserschutz<br />
• Hochwassermanagement und Hochwassernachsorge<br />
• Grundlagenfragen zur Risikoabsicherung<br />
• Bildung e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>ternationalen Netzwerkes<br />
• Darstellung von Forschungsergebnissen und Vorzeigeprojekten<br />
• Organisation von Veranstaltungen und Symposien zur Weitergabe von Know How<br />
• Förderung von Bildungs- und Ausbildungsarbeit im Hochwasserschutz<br />
• Strukturierung des Gesamtthemas „Hochwasser“<br />
• Konzeption von anwendungsbezogenen F+E Projekten<br />
Me<strong>in</strong>en Sie nicht auch, dass das alles Aufgaben s<strong>in</strong>d, die bereits von der DWA bearbeitet werden oder<br />
bearbeitet werden können? Warum dann e<strong>in</strong> neuer Vere<strong>in</strong>? Und warum hat ausgerechnet unser DWA-<br />
Präsident Otto Schaaf dieses HochwasserKompetenzCentrum im September 2007 gegründet und sich<br />
zum Vorsitzenden wählen lassen? Lässt Sie das kalt?<br />
Wenn <strong>in</strong> Deutschland jemand e<strong>in</strong>en Vere<strong>in</strong> gründet, der sich wie das HKC mit Hochwasser beschäftigt,<br />
dann kann unsere DWA dagegen natürlich nichts unternehmen. Die DWA müsste sich aber fragen, ob<br />
sie ihre Aufgaben nicht ausreichend genug <strong>in</strong> der Öffentlichkeit kommuniziert hat, denn dann wäre es<br />
sicher nicht zu e<strong>in</strong>er überflüssigen neuen Vere<strong>in</strong>sgründung gekommen. Wenn allerd<strong>in</strong>gs unser eigener<br />
Präsident, der den Aufgabenbereich doch sicher kennt, e<strong>in</strong>en offensichtlichen Konkurrenzvere<strong>in</strong> gründet<br />
und auch noch dessen Vorsitzender wird, dann fehlt uns dafür jedes Verständnis.<br />
Selbst wenn sich der neue Vere<strong>in</strong> mit Aufgaben beschäftigen sollte, die bisher <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em der DWA-Ausschüsse<br />
behandelt werden – was wir nicht erkennen können – wäre es die Pflicht unseres Präsidenten<br />
gewesen, erst e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> der DWA diese Aufgaben zu <strong>in</strong>tegrieren sowie unsere Mitglieder zu aktivieren<br />
und zu motivieren, statt e<strong>in</strong>en neuen Vere<strong>in</strong> zu gründen.<br />
Schon alle<strong>in</strong> die Bezeichnung „HochwasserKompetenzCentrum“ ist e<strong>in</strong>e Provokation der DWA und zeigt<br />
die Konkurrenzsituation. Die Kompetenz bei Hochwasserfragen war bisher bei der DWA und dort solle<br />
sie auch bleiben. Der DVWK hat sie bei der Fusion <strong>in</strong> den neuen Verband mit e<strong>in</strong>gebracht. Dass sie der<br />
DWA erhalten bleibt, dafür werden wir uns e<strong>in</strong>setzen.<br />
Seit Jahren versucht die DWA mit dem „Bund der Ingenieure für <strong>Wasserwirtschaft</strong>, Abfallwirtschaft und<br />
Kulturbau“ (BWK) zu fusionieren, der vergleichbare Aufgaben hat wie der frühere DVWK und wie jetzt<br />
unsere DWA, zum<strong>in</strong>dest auf dem Gebiet der Hochwasserproblematik. Wäre es für e<strong>in</strong>en Präsidenten<br />
nicht wichtiger gewesen, die Verhandlungen mit dem BWK weiter zu betreiben, um durch e<strong>in</strong>e Fusion die<br />
Bedeutung e<strong>in</strong>es so gestärkten wasserwirtschaftlichen Verbandes gegenüber der Politik zu verbessern?<br />
Haben wir nicht das Vorbild der Hydrologen, die sich <strong>in</strong> der DWA als Fachgeme<strong>in</strong>schaft Hydrologische<br />
Wissenschaften organisiert haben und ke<strong>in</strong>en neuen Vere<strong>in</strong> gegründet haben? Gehört es nicht auch<br />
zu den Pflichten e<strong>in</strong>es Präsidenten, die DWA mit allen ihren Mitgliedern zu fördern, sie zusammen zu<br />
halten, zu erweitern und nicht zu zersplittern?<br />
Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
In eigener Sache<br />
Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief<br />
Bei der Fusion der ATV mit dem DVWK hatte der neue Vere<strong>in</strong> ca. 15.000 Mitglieder. Inzwischen ist die<br />
Zahl auf weniger als 14.000 gesunken. Der Landesverband <strong>Bayern</strong> versucht seit Jahren, neue Mitglieder<br />
zu werben, z.B. durch kostenlose Teilnahme an Sem<strong>in</strong>aren bei gleichzeitiger neuer Vere<strong>in</strong>szugehörigkeit<br />
oder durch kostenlose Teilnahme an speziellen Fachexkursionen für junge <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler. Und was<br />
macht unser Präsident? Er gründet e<strong>in</strong>en neuen Vere<strong>in</strong> und „war begeistert vom Zulauf <strong>in</strong> den Vere<strong>in</strong>“<br />
(s. Internet). Das HKC hatte bei der Gründung bereits 100 neue Mitglieder.<br />
Vielleicht können unsere Kollegen aus dem Abwasserbereich unsere Empörung über unseren Präsidenten<br />
dann nachvollziehen, wenn sie sich vorstellen, Herr Schaaf hätte e<strong>in</strong> „AbwasserKompetenzCentrum“<br />
gegründet mit den gleichen Aufgaben wie unsere DWA.<br />
Wir me<strong>in</strong>en, dass unser Präsident Otto Schaaf nicht im Interesse der DWA gehandelt hat. Das Dilemma,<br />
das er sich geschaffen hat, muss er selbst auflösen; gut geme<strong>in</strong>te Ratschläge und Kompromissse<br />
s<strong>in</strong>d nicht notwendig. Die Mitglieder sollten darüber bef<strong>in</strong>den, ob Herr Schaaf als Präsident noch das<br />
Vertrauen genießt. Wir werden deshalb e<strong>in</strong>en entsprechenden Antrag bei der Mitgliederversammlung<br />
im September <strong>in</strong> Mannheim e<strong>in</strong>reichen.<br />
Liebe Leser<strong>in</strong>nen und Leser, verstehen Sie das bitte richtig, wir haben nichts gegen Herrn Schaaf persönlich.<br />
Aber wir müssen nun mit ansehen, wie mit der Gründung des HKC e<strong>in</strong> großer Teil fundamentaler<br />
Aufgaben der <strong>Wasserwirtschaft</strong> und des Wasserbaus wieder herausgelöst werden soll. Unser Anliegen ist<br />
es, die Fachkompetenz und das Aufgabenspektrum unseres Verbandes zu erhalten und zu stärken.<br />
Wir denken, dass dies auch <strong>in</strong> Ihrem Interesse ist!<br />
Jürgen Bauer und Prof. Dr.-Ing. Hans-B. Kleeberg, München<br />
H<strong>in</strong>weis aus Sicht des Landesverbandes <strong>Bayern</strong> an unsere Leser:<br />
In der Beiratssitzung des Landesverbandes am 20.02.2008 war dieser e<strong>in</strong>stimmig der Me<strong>in</strong>ung,<br />
dass zu dieser Thematik Klärungs- bzw. Handlungsbedarf besteht.<br />
In der Aprilausgabe 2008 der „KA - Korrespondenz Abwasser“ und der „KW - Korrespondenz<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>“ wurde der Sachverhalt sowohl aus Sicht des HochwasserKompetenzCentrums<br />
(HKC) als auch aus Sicht des DWA-Bundespräsidiums dargestellt.<br />
Lesertbriefe s<strong>in</strong>d nicht Me<strong>in</strong>ungsäußerungen der Redaktion, sondern stellen ausschließlich die Me<strong>in</strong>ung<br />
der Verfasser wieder.<br />
Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief ✉ Leserbrief<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
27
DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion<br />
28<br />
In eigener Sache<br />
DWA-Fachexkursion <strong>in</strong>s Rhe<strong>in</strong>land<br />
Unser DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> veranstaltet<br />
vom 11. August bis 13. August<br />
2008 e<strong>in</strong>e 3-tägige Fachexkursion <strong>in</strong>s<br />
Rhe<strong>in</strong>land. Der Bus wird von München<br />
aus starten, Zustiegsmöglichkeiten s<strong>in</strong>d<br />
auf der Strecke von München über Augsburg<br />
nach Ulm und weiter nach Stuttgart<br />
<strong>in</strong> Abstimmung mit unserer Geschäftsstelle<br />
selbstverständlich möglich. Auch<br />
Nichtmitglieder s<strong>in</strong>d wie immer herzlich<br />
willkommen.<br />
Die Kosten pro Teilnehmer betragen<br />
45.- Euro für Mitglieder und 65.- Euro<br />
für Nichtmitglieder. Sie enthalten die<br />
Fahrtkosten und die Kosten für die<br />
Stadtführung. Wir werden im Hotel Königshof<br />
<strong>in</strong> Ma<strong>in</strong>z übernachten. Die Übernachtungskosten<br />
betragen 41.- Euro pro<br />
Person und Nacht im DZ und 59.- Euro<br />
pro Person und Nacht im EZ. E<strong>in</strong> Frühstücksbüfett<br />
ist im Preis enthalten. Da<br />
die Hotelkosten für unsere Gruppe vorab<br />
überwiesen werden müssen, wird<br />
unsere Geschäftsstelle diese Kosten<br />
geme<strong>in</strong>sam mit den Fahrtkosten den<br />
Teilnehmern <strong>in</strong> Rechnung stellen.<br />
Die Teilnehmerzahl muss bei dieser Fachexkursion wegen der maximal zulässigen Passagierzahl an Bord der „MS Burgund“<br />
auf 30 Personen begrenzt werden! Maßgebend ist die Reihenfolge der Anmeldungen.<br />
Programm<br />
Montag, 11. August 2008<br />
9.30 Uhr Abfahrt <strong>in</strong> München, Elisenstraße beim Neptunbrunnen, Fahrt über Stuttgart nach Worms, unterwegs Halt an e<strong>in</strong>er<br />
Autobahnraststätte<br />
15.00 Uhr Besichtigung der Rhe<strong>in</strong>gütestation Worms<br />
Die Gütestation überwacht zentral das gesamte Rhe<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zugsgebiet unterhalb des Bodensees. Die Wasserqualität<br />
wird rund um die Uhr gemessen und überwacht.<br />
17.00 Uhr Weiterfahrt nach Ma<strong>in</strong>z, Übernachtung<br />
Im Labor auf der MS Burgund werden die aus dem Rhe<strong>in</strong> entnommenen<br />
Wasserproben sofort untersucht<br />
„Unser“ Schiff, die MS Burgund auf der Fahrt von Koblenz nach Ma<strong>in</strong>z<br />
Das Zentrallabor der Rhe<strong>in</strong>gütestation<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Dienstag, 12. August 2008<br />
8.00 Uhr Abfahrt vom Hotel nach Koblenz<br />
In eigener Sache<br />
9.30 Uhr Beg<strong>in</strong>n der Schifffahrt mit der MS Burgund von Koblenz nach Ma<strong>in</strong>z. Das Schiff ist e<strong>in</strong>e schwimmende Messstation<br />
und dient gleichzeitig als Informationsplattform für die Öffentlichkeitsarbeit der <strong>Wasserwirtschaft</strong>verwaltung von<br />
Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz. Verpflegung an Bord, Kosten werden umgelegt.<br />
19.00 Uhr Ankunft <strong>in</strong> Ma<strong>in</strong>z, Übernachtung<br />
Mittwoch, 13. August 2008<br />
9.00 Uhr 2-stündige Stadtführung mit Schwerpunkt Wasser <strong>in</strong> Ma<strong>in</strong>z, anschließend Weiterfahrt nach Ingelheim<br />
13.00 Uhr Besichtigung des ökologischen Polders Ingelheim ( Deiche, E<strong>in</strong>- und Auslassbauwerk mit Fischbauchklappen,<br />
Schöpfwerk, Steuerungszentrale)<br />
15.00 Uhr Rückfahrt nach München, Ankunft voraussichtlich gegen 20.00 Uhr<br />
Die Rhe<strong>in</strong>gütestation Worms direkt neben der Nibelungenbrücke überwacht die Wasserqualität<br />
des Rhe<strong>in</strong>s vom Bodensee bis zur holländischen Grenze<br />
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Ich b<strong>in</strong> an der DWA-Fachexkursion <strong>in</strong>teressiert und melde mich mit ....... Person(en) an.<br />
Bitte senden Sie uns diesen Abschnitt bis spätestens 20.06.2008 zu<br />
Anmeldung bitte an die Geschäftsstelle des DWA-Landesverbands <strong>Bayern</strong>, Friedenstraße 40, 81671 München schicken oder faxen (Fax (089) 233 62595)<br />
------------------------------ ------------------------------ -------------------------<br />
Name Vorname Titel / Funktion<br />
------------------------------ ------------------------------ ----------------------------------------------------------------<br />
Straße PLZ / Ort Datum / Unterschrift<br />
------------------------------ ------------------------------ ----------------------------------------------------------------<br />
Tel. Fax E-Mail<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
29<br />
DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion ••••• DWA-Fachexkursion
30<br />
In eigener Sache<br />
Jürgen Bauer – Schade, dass er geht<br />
zum Jahreswechsel 2007/2008 hat Jürgen<br />
Bauer se<strong>in</strong> Amt als stellvertretender<br />
Landesverbandsvorsitzender der DWA<br />
<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> <strong>in</strong> jüngere Hände gelegt.<br />
Se<strong>in</strong> Ausscheiden aus der Bayerischen<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung im September<br />
2006 <strong>in</strong> den Altersruhestand<br />
war für viele überraschend, da er durch<br />
se<strong>in</strong> dynamisches Ersche<strong>in</strong>ungsbild als<br />
Mann <strong>in</strong> den besten Jahren gilt. Zuletzt<br />
leitete er die Abteilung „Wasserbau,<br />
Hochwasserschutz, Gewässerschutz“<br />
am Landesamt für Umwelt - der neuen<br />
Zentralbehörde, <strong>in</strong> der die Landesämter<br />
für <strong>Wasserwirtschaft</strong>, Umweltschutz<br />
und das Geologische Landesamt mit der<br />
Verwaltungsreform 2005 e<strong>in</strong>gegliedert<br />
wurden.<br />
Im September 1941 <strong>in</strong> Magdeburg geboren<br />
zog es ihn und se<strong>in</strong>e Familie 1950<br />
über Regensburg nach München. Nach<br />
Ende des Bau<strong>in</strong>genieurstudiums 1969<br />
an der TU München arbeitete Jürgen<br />
Bauer bei e<strong>in</strong>em Ing.-Büro, bis er 1970<br />
die Referendarausbildung beim Freistaat<br />
<strong>Bayern</strong> antrat. Nach erfolgreicher<br />
Prüfung begann Jürgen Bauer 1973<br />
se<strong>in</strong>e Laufbahn <strong>in</strong> der <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
beim WWA Donauwörth, anschließend<br />
folgten 2 Jahre am Landesamt für <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
im Bereich Wasserversorgung,<br />
bis ihn die besonderen Aufgaben<br />
beim Bau des neuen Flughafen im Erd<strong>in</strong>ger<br />
Moos lockten. Hier hat er von<br />
Anfang 1977 bis Ende 1980 als erster<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>ler die Belange der<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>, den Gewässer- und<br />
Grundwasserschutz <strong>in</strong> der Projektierungs-<br />
und frühen Bauphase erfolgreich<br />
vertreten. Bei se<strong>in</strong>er anschließenden<br />
E<strong>in</strong> Abschiedstrunk am Flughafen von Havanna<br />
Treffen mit Fidel Castro anlässlich der Kuba-Reise 2007 (Fotomontage)<br />
Tätigkeit an der Obersten Baubehörde<br />
kam er mit dem Verkehrswasserbau und<br />
den Landeshäfen <strong>in</strong> Berührung, bis er<br />
ab Mai 1984 die Leitung des Sachgebiets<br />
„Wasserversorgung Oberbayern“<br />
am Landesamt für <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
übernahm.<br />
Wegen se<strong>in</strong>er vielseitigen Interessen<br />
und E<strong>in</strong>satzgebiete wurde Jürgen Bauer<br />
im Dezember 1992 die Leitung der<br />
Abteilung „Wasserbau – Bautechnik und<br />
Landespflege“ am LfW übertragen. Die<br />
<strong>in</strong> München über verschiedene Stand-<br />
orte verteilten Sachgebiete wurden von<br />
ihm zusammengeführt und an der neuen<br />
(„provisorischen“) Außenstelle des LfW<br />
<strong>in</strong> Freimann über 11 Jahre zusammengehalten.<br />
Als Leiter der Großabteilung<br />
„Wasserbau, Hochwasserschutz und<br />
Gewässerschutz“ im neuen LfU (geme<strong>in</strong>sam<br />
mit Erich Englmann) ist Jürgen Bauer<br />
mit Erreichen der Altersgrenze Ende<br />
September 2006 aus dem Staatsdienst<br />
ausgeschieden.<br />
Er hat „se<strong>in</strong>e“ Abteilung mit viel Geschick<br />
geführt, mit menschlicher Note geprägt<br />
und es verstanden, die Kollegen/<strong>in</strong>nen<br />
nach dem Leitbild der <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
(„Wir s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Team“) zu motivieren. Se<strong>in</strong><br />
Vertrauen <strong>in</strong> die Leistungsbereitschaft<br />
der Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen verbunden mit<br />
der Übertragung von Verantwortung hat<br />
vielen im Team gute fachliche und persönliche<br />
Entwicklungschancen geboten.<br />
Nicht umsonst haben die Mitarbeiter ihm<br />
bei der Abschiedsfeier mit dem Ständchen<br />
(frei nach Frank S<strong>in</strong>atra) „You did<br />
it your way“ gedankt.<br />
Fachliche Schwerpunkte setzte Jürgen<br />
Bauer <strong>in</strong> der Wissensvermittlung des LfW<br />
nach außen. Neben den regelmäßigen<br />
Dienstbesprechungen und Schulungen<br />
<strong>in</strong>nerhalb der <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung<br />
wurden auch für die Öffentlichkeit<br />
die Informationsplattformen IÜG (Informationsdienstüberschwemmungsgefährdete<br />
Gebiete), IAN (Informationsdienst<br />
Alp<strong>in</strong>e Naturgefahren) oder die<br />
Angebote des Law<strong>in</strong>enwarndienstes<br />
über das Internet bereitgestellt.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
In se<strong>in</strong>er Zeit im Wasserbau<br />
wurden wichtige wasserbauliche<br />
Maßnahmen durchgeführt,<br />
wie die Nachrüstungen<br />
am Sylvenste<strong>in</strong>speicher, die<br />
Sanierung der Deiche und<br />
Hochwasserschutzanlagen<br />
im Rahmen des Hochwasseraktionsprogramms<br />
2020<br />
wie auch die Renaturierung<br />
von Gewässern.<br />
Neben se<strong>in</strong>en beruflichen<br />
Aufgaben war Jürgen Bauer<br />
auch ehrenamtlich sehr aktiv.<br />
So wurde er 1994 zum<br />
stellvertretenden Vorsitzenden<br />
des Landesverbandes<br />
<strong>Bayern</strong> der Deutschen Verbands<br />
für <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
und Kulturbau (DVWK)<br />
gewählt, der mit der damaligen<br />
Abwassertechnischen<br />
Vere<strong>in</strong>igung (ATV) im Jahr<br />
2000 zur heutigen DWA fusionierte.<br />
Seit der Fusion war<br />
er e<strong>in</strong>er der beiden stellvertretenden<br />
Vorsitzenden des<br />
DWA-Landesverbandes<br />
<strong>Bayern</strong> und leitete mit se<strong>in</strong>er<br />
freundlich-charmanten<br />
Art zusammen mit den Herren<br />
Prof. Günthert, Klotz und<br />
<strong>in</strong> früheren Zeiten Wittmann<br />
die Geschicke des Landesverbandes<br />
<strong>Bayern</strong>. G<strong>in</strong>g es<br />
jedoch um das Wohl und die<br />
Interessen der bayerischen Landesverbandsmitglieder<br />
konnte Jürgen Bauer<br />
schon mal Profil zeigen. Als Ansprechpartner<br />
im Landesverband <strong>Bayern</strong> für die<br />
Themengebiete Hydrologie, Wasserbau,<br />
Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung<br />
konnten durch se<strong>in</strong>e Initiative<br />
und Unterstützung viele Sem<strong>in</strong>ar- und<br />
Tagungsangebote ausgerichtet werden.<br />
Fotopause im Zion National Park (USA-Fachexkursion im September<br />
2006)<br />
Schon fast legendär ist hierbei das von<br />
ihm mit <strong>in</strong>s Leben gerufene Internationale<br />
Symposium im Europäischen Patentamt<br />
<strong>in</strong> München.<br />
E<strong>in</strong>e weitere Herzensangelegenheit von<br />
Jürgen Bauer war <strong>in</strong> dieser Zeit vor allem<br />
auch se<strong>in</strong> Mitgliederrundbrief. Als<br />
Vorbild und Anregung für so manch an-<br />
Abschiedsfeier am LfU im September 2006; Jürgen Bauer mit dem Gstanzel-Duo<br />
In eigener Sache<br />
deren DWA-Landesverband<br />
erreichen die zwei Ausgaben<br />
pro Jahr mit e<strong>in</strong>er Auflage<br />
von jeweils über 3.000<br />
Exemplaren weit mehr als<br />
10.000 Fachleute <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>,<br />
Deutschland sowie<br />
dem benachbarten Ausland<br />
und <strong>in</strong>formieren diese über<br />
<strong>aktuelle</strong> Entwicklungen <strong>in</strong><br />
der (bayerischen) <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
sowie über DWA-<br />
Verbandsangelegenheiten.<br />
E<strong>in</strong> absolutes Schmankerl<br />
s<strong>in</strong>d die <strong>in</strong>teressanten DWA-<br />
Reisen <strong>in</strong> die weite Welt, die<br />
von Jürgen Bauer über den<br />
DWA-Landesverband <strong>in</strong>itiiert<br />
und <strong>in</strong> enger Abstimmung<br />
mit verschiedenen<br />
Reisebüros realisiert werden.<br />
Land und Leute, Kultur<br />
und Naturschönheiten <strong>in</strong><br />
Ch<strong>in</strong>a, Südafrika, Russland,<br />
Vietnam und Kambodscha<br />
sowie Kuba s<strong>in</strong>d den vielen<br />
Reiseteilnehmern <strong>in</strong> schöner<br />
Er<strong>in</strong>nerung. Aber auch fachliche<br />
Objekte wie Talsperren<br />
(Drei Schluchten Damm)<br />
oder wasserwirtschaftliche<br />
Aufgaben im Südwesten<br />
der USA kommen bei se<strong>in</strong>en<br />
Reisen nicht zu kurz.<br />
Die von Jürgen Bauer organisierten<br />
Fachexkursionen<br />
s<strong>in</strong>d ebenfalls äußerst beliebt und ziehen<br />
jeweils e<strong>in</strong>e große Teilnehmerzahl<br />
an. Im Vordergrund dieser Exkursionen<br />
steht, anders als bei den DWA-Reisen,<br />
die Besichtigung wasserwirtschaftlicher<br />
Objekte, wobei aber der gesellschaftliche<br />
Part mit Sicherheit nicht zu kurz<br />
kommt. Dass dieser Absatz im Präsens<br />
geschrieben ist hat natürlich se<strong>in</strong>e besondere<br />
Bewandtnis: Wir hoffen, dass<br />
Jürgen Bauer dem DWA-Landesverband<br />
<strong>Bayern</strong> noch lange als „Reiseleiter“ erhalten<br />
bleibt und auch weiterh<strong>in</strong> solch <strong>in</strong>teressante<br />
Fachexkursionen und DWA-<br />
Reisen für den Landesverband <strong>in</strong>itiiert<br />
und organisiert.<br />
Se<strong>in</strong> künftiges „Mehr an Freizeit“ wird<br />
Jürgen Bauer sicherlich – neben der<br />
Pflege se<strong>in</strong>er Porsche-Oldtimer - mit<br />
vielen sportlichen Aktivitäten füllen.<br />
Dazu wünschen wir ihm beste Gesundheit<br />
sowie Glück und Zufriedenheit im<br />
privaten Bereich.<br />
Gregor Overhoff<br />
LfU<br />
Wolfgang Stockbauer<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
31
32<br />
In eigener Sache<br />
Bericht zum Internationalen Symposium „Qualitätsmanagement <strong>in</strong> der<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>“<br />
Interessante und <strong>aktuelle</strong><br />
Vorträge, e<strong>in</strong> hervorragendes<br />
Ambiente sowie<br />
bezahlbare Teilnehmergebühren<br />
- dies alles führten<br />
dazu, dass am diesjährigen<br />
Internationalen Symposium<br />
im Europäischen Patentamt<br />
<strong>in</strong> München nahezu 150<br />
Fachleute aus Deutschland,<br />
Österreich und der Schweiz<br />
teilnahmen. Die Veranstaltung<br />
mit dem Titel „Qualitätsmanagement<br />
<strong>in</strong> der<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>“ fand am<br />
24. und 25. Januar 2008 <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Zusammenarbeit des<br />
Instituts für Wasserwesen<br />
der Universität der Bundeswehr,<br />
des StMUGV, der Hydrologischen<br />
Wissenschaften<br />
sowie des DWA-Landesverbandes<br />
<strong>Bayern</strong> statt.<br />
Der Vorsitzende des DWA-Landesverbandes <strong>Bayern</strong><br />
Prof. F. Wolfgang Günthert bei der Begrüßung der ca.<br />
150 Teilnehmer<br />
Die Teilnehmer des Symposiums im angenehmen Ambiente des Europäischen Patentamtes <strong>in</strong><br />
München<br />
Nach der Begrüßung<br />
durch die Veranstalter<br />
und dem Festvortrag<br />
„Qualitätsmanagement<br />
– e<strong>in</strong>e unverzichtbare<br />
Komponente unternehmerischen<br />
Erfolgs“<br />
<strong>in</strong>formierte das Symposium<br />
<strong>in</strong> den fünf Themenblöcken„Grundlagen“,<br />
„Planung“, „Bau“,<br />
„Betrieb“ und „Organisation“<br />
wie Ingenieurbüros,<br />
Baufirmen sowie<br />
Kommunal- und Fachverwaltungen<br />
mit Hilfe<br />
der Qualitätssicherung<br />
und des Qualitätsmanagements<br />
trotz Personal-<br />
und F<strong>in</strong>anzmittelknappheit<br />
die immer<br />
anspruchvoller werdenden<br />
Aufgaben der <strong>Wasserwirtschaft</strong>bewältigen<br />
und dem hohen<br />
Qualitätsanspruch der<br />
Auftraggeber gerecht<br />
werden können. Mit<br />
dem Abschlussvortrag<br />
„Ist Qualität Wissen mit<br />
System? Anforderungen an e<strong>in</strong> qualitätsorientiertes<br />
Wissensmanagement“<br />
endete das Symposium.<br />
Damit der gesellige Teil nicht zu kurz<br />
kommt, fand am ersten Tag des Symposiums<br />
traditionsgemäß e<strong>in</strong> Empfang im<br />
Foyer des Patentamtes mit anschließender<br />
Filmvorführung statt. Gezeigt wurde<br />
dieses Jahr „E<strong>in</strong>e unbequeme Wahrheit“<br />
von Al Gore.<br />
Die Resonanz der Veranstaltung bei den<br />
teilnehmenden Fachleuten aus Ingenieurbüros,<br />
Wissenschaft, Verwaltung und<br />
Kommunen war sehr positiv. Dies lag<br />
nicht zuletzt auch daran, dass das Symposiums<br />
se<strong>in</strong>e Thematik sowohl aus den<br />
Blickw<strong>in</strong>keln der Forschung als auch der<br />
Verwaltungs- und freiberuflichen Praxis<br />
beleuchtete und dadurch erfolgreiche<br />
Lösungen aus den unterschiedlichen<br />
wasserwirtschaftlichen Aufgabengebieten<br />
an die Teilnehmer vermittelte.<br />
Die Kurzfassungen der Vorträge s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Band zusammengefasst und beim<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> (Tel. 089/<br />
2336259-0; E-Mail: <strong>in</strong>fo@dwa-bayern.de)<br />
erhältlich.<br />
Wolfgang Stockbauer<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
In eigener Sache<br />
DWA-Landesverband stellt sich bei <strong>Bayern</strong>s neuem Umweltstaatssekretär<br />
Dr. Marcel Huber vor<br />
Mit Herrn Dr. Marcel Huber ist seit dem<br />
16. Oktober 2007 e<strong>in</strong> neuer Staatssekretär<br />
im Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
(StMUGV) im Amt. Auf<br />
se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>ladung h<strong>in</strong> trafen sich am 21.<br />
April 2008 die Herren Prof. F. Wolfgang<br />
Günthert und Wolfgang Stockbauer<br />
vom DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> mit<br />
ihm zu e<strong>in</strong>em ersten Informations- und<br />
„Kennenlerngespräch“. Weitere Vertreter<br />
des StMUGV, die ebenfalls am<br />
Der DWA-Landesverbandsvorsitzende Prof. F. Wolfgang Günthert (l<strong>in</strong>ks) mit <strong>Bayern</strong>s<br />
Umweltstaatssekretär Dr. Marcel Huber<br />
Gespräch teilgenommen haben, waren<br />
die Herren LMR Claus Kumutat (Referatsleiter<br />
„Gewässer 1. Ordnung“), MR<br />
Erich Englmann (Referatsleiter „Schutz<br />
der oberirdischen Gewässer, Abwasserentsorgung“),<br />
MDgt Ludwig Kohler<br />
(Abteilungsleiter „Abfallwirtschaft, Bodenschutz<br />
und Altlasten“) und RD Dr.<br />
Hannes Diersch (Referat „Vermeidung<br />
und Verwertung von Abfällen“).<br />
Zu Anfang des Gespräches erläuterte<br />
Prof Günthert Herrn Staatssekretär Dr.<br />
Huber die Tätigkeitsfelder und Aufgaben<br />
des DWA-Landesverbandes <strong>Bayern</strong>.<br />
Dabei hob er die große Bedeutung der<br />
guten Zusammenarbeit zwischen dem<br />
Landesverband <strong>Bayern</strong> der DWA und<br />
dem StMUGV hervor, <strong>in</strong> der beide Seiten<br />
von e<strong>in</strong>ander profitieren können.<br />
Anschließend wurden <strong>aktuelle</strong> Fragen<br />
aus der Wasser- und Abfallwirtschaft<br />
diskutiert, wobei Herrn Staatssekretär<br />
Dr. Huber vor allem die Themen „Innovative<br />
Technologien“, „Klärschlammentsorgung“,<br />
„Bioabfall, Biogas und Kompostierung“<br />
sowie „Überwachung privater<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen“<br />
von Bedeutung waren. Prof. Günthert<br />
konnte hierbei die Standpunkte der DWA<br />
zu den jeweiligen Fachthemen darlegen.<br />
Auf Nachfrage von Herrn Kumutat versicherte<br />
Prof. Günthert, dass sich der<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> auch zukünftig<br />
verstärkt wasserwirtschaftlichen<br />
und wasserbaulichen Themen widmen<br />
wird. So ist zurzeit e<strong>in</strong> neues Kursangebot<br />
des Landesverbandes zum Betrieb<br />
von kle<strong>in</strong>en Hochwasserrückhaltebecken<br />
sowie zum Wasserbau und Gewässerunterhalt<br />
<strong>in</strong> Planung.<br />
Am Ende des Gesprächs bekräftigten<br />
Herr Staatsekretär Dr. Huber und Prof.<br />
Günthert ihre Absicht, die gute Zusammenarbeit<br />
zwischen dem StMUGV und<br />
dem DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> auch<br />
zukünftig weiter zu führen. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
soll die Kooperation im Bereich<br />
Abfallwirtschaft weiter <strong>in</strong>tensiviert werden.<br />
Wolfgang Stockbauer<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
33
DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise<br />
34<br />
In eigener Sache<br />
DWA-Reise nach Myanmar – noch Restplätze frei<br />
In unserem Mitglieder-Rundbrief 2/2007<br />
haben wir die Reise, die vom 8.10. bis<br />
22.10.2008 stattf<strong>in</strong>det, angekündigt.<br />
Zwischenzeitlich haben sich über 40<br />
Teilnehmer angemeldet. Der Reiseveranstalter<br />
KIWI-Tours hat e<strong>in</strong>e Option<br />
beim Flug und <strong>in</strong> den Hotels von etwa<br />
50 Plätzen, es s<strong>in</strong>d also noch e<strong>in</strong> paar<br />
Plätze frei. Vielleicht haben Sie Lust an<br />
dieser von der Fülle der Sehenswürdigkeiten<br />
und der Programmvielfalt e<strong>in</strong>maligen<br />
Reise teilzunehmen?<br />
Myanmar – im Ausland immer noch besser<br />
bekannt unter dem Namen Burma<br />
– öffnet sich nach e<strong>in</strong>er fast 30-jährigen<br />
Isolation langsam wieder dem ausländischen<br />
Besucher. Die Zeit sche<strong>in</strong>t hier<br />
mancherorts stehen geblieben zu se<strong>in</strong>,<br />
das „alte“ Asien ist hier noch be<strong>in</strong>ahe<br />
überall zu sehen und zu erleben. Dem<br />
geheimnisvollen Zauber dieses Landes<br />
kann sich kaum jemand entziehen. Die<br />
Menschen s<strong>in</strong>d hilfsbereit und offen im<br />
Umgang mit dem Besucher. Unzählige<br />
Pagoden, Tempel und Klosterbauten<br />
sowie fasz<strong>in</strong>ierende Landschaften, malerisch<br />
gelegene Orte an den großen<br />
Flüssen und am Inle-See, exotisch-bunte<br />
Märkte und die kulturelle Vielfalt von<br />
über 50 verschiedenen Volksstämmen<br />
lassen sich auf dieser bee<strong>in</strong>druckenden<br />
Reise entdecken.<br />
Zwei Tage werden wir auf und am Inle-See verbr<strong>in</strong>gen. Er ist nicht nur bekannt wegen<br />
se<strong>in</strong>er „E<strong>in</strong>be<strong>in</strong>ruderer“ sondern auch wegen se<strong>in</strong>er schwimmenden Gärten<br />
Das genaue Programm unserer Reise<br />
f<strong>in</strong>den Sie im letzten Rundbrief und falls<br />
Sie den nicht mehr zur Hand haben auch<br />
im Internet unter www.dwa-bayern.de.<br />
Dort ist der gesamte Mitgliederrundbrief<br />
2/2007 veröffentlicht. Was Sie dort noch<br />
nicht f<strong>in</strong>den, ist aber e<strong>in</strong> wichtiger H<strong>in</strong>weis:<br />
wegen der Größe der Gruppe werden<br />
wir auf zwei Busse aufgeteilt und es<br />
werden uns zwei sehr gut deutsch sprechende<br />
örtliche Reiseleiter begleiten.<br />
Wenn Sie sich jetzt noch anmelden wolllen,<br />
dann könnten Sie direkt bei KIWI-<br />
Tours anrufen. Herr Matthias Magnor<br />
(Tel.: (089) 74662534) betreut unsere<br />
Gruppe und schickt Ihnen die Unterlagen<br />
gerne zu. Fotos: Werner Kern.<br />
Auch dieser Tempel mit den vielen Buddha-Statuen steht auf unserem Besichtigungsprogramm, es ist der U M<strong>in</strong> Thone Sae<br />
Tempel <strong>in</strong> Saga<strong>in</strong>g<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise ••••• DWA-Reise
Berichte<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Rosenheim erhält von der Staatsregierung<br />
Auszeichnung für „Innovative Verwaltung 2007“<br />
Im November 2007 hat M<strong>in</strong>isterpräsident<br />
Dr. Günther Beckste<strong>in</strong> das <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Rosenheim mit dem Innovationspreis<br />
der Bayerischen Staatsregierung<br />
ausgezeichnet. Im Beise<strong>in</strong> von<br />
Umweltm<strong>in</strong>ister Dr. Otmar Bernhard<br />
nahm der Leiter des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes,<br />
Paul Geisenhofer , geme<strong>in</strong>sam<br />
mit se<strong>in</strong>en am Projekt beteiligten Mitarbeitern<br />
den begehrten Preis im Kuppelsaal<br />
der bayerischen Staatskanzlei aus<br />
den Händen des M<strong>in</strong>isterpräsidenten<br />
entgegen. Damit erhielt das <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Rosenheim als e<strong>in</strong>er der<br />
ersten 5 Preisträger e<strong>in</strong>e besondere Ehrung.<br />
Der Wettbewerb stand heuer unter<br />
dem Motto „Im Dienste der Bürger<strong>in</strong>nen<br />
und Bürger“. Prämiert wurde das Projekt<br />
„Deichbruchmodell Mangfall“.<br />
Zum Projekt<br />
Für Evakuierungsentscheidungen steht<br />
dem Katastrophenstab erstmals bundesweit<br />
e<strong>in</strong> Echtzeitdeichbruchmodell<br />
zur Verfügung. Das neuartige Programm<br />
kann während e<strong>in</strong>es ablaufenden Hochwassers<br />
<strong>in</strong>nerhalb von 30 M<strong>in</strong>uten die<br />
Auswirkungen e<strong>in</strong>es drohenden Deichbruchs<br />
an der Mangfall berechnen und<br />
vorhersagen. Als Ergebnis erhält der<br />
Katastrophenschutz detaillierte Karten,<br />
die den zeitlichen Ablauf e<strong>in</strong>es Deichbruches,<br />
das heißt die Ausbreitung des<br />
Wassers und die sich e<strong>in</strong>stellenden<br />
Wassertiefen <strong>in</strong> den Gefahrenbereichen<br />
darstellen. Damit kann die Sicherheit der<br />
<strong>in</strong> den Gefahrenbereichen lebenden<br />
42.000 Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger wesentlich<br />
erhöht werden. Gleichzeitig können<br />
e<strong>in</strong>erseits hohe Kosten der Hochwasserschäden<br />
und andererseits Kosten für unnötige<br />
Katastrophenschutzmaßnahmen<br />
vermieden werden. Das Schadenpotential<br />
beträgt ca. 1 Mrd. Euro.<br />
Das Modell wird <strong>in</strong> enger Abstimmung<br />
mit den Landratsämtern (Katastrophenschutzbehörden)<br />
und den Feuerwehren<br />
e<strong>in</strong>gesetzt. Die Berechnungen laufen am<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Rosenheim, die Er-<br />
Berichte<br />
gebnisse werden dem Katastrophenstab<br />
für Entscheidungen zur Verfügung gestellt.<br />
Vergleichbare Modelle s<strong>in</strong>d nicht bekannt.<br />
Mit dem Deichbruchmodell hat die <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
den Katastrophenschutzbehörden<br />
e<strong>in</strong> hocheffizientes Entscheidungsmittel<br />
an die Hand gegeben. Das<br />
Deichbruchmodell ist Teil e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>tegralen<br />
Konzepts zum Hochwasserschutz<br />
im Mangfalltal.<br />
Die Konzeption und Methodik des Deichbruchmodells<br />
ist auch auf andere von<br />
Hochwasser gefährdete Flussgebiete<br />
und <strong>Wasserwirtschaft</strong>s- und Katastrophenschutzverwaltungen<br />
übertragbar.<br />
Zum Wettbewerb<br />
Seit fünf Jahren führt die Bayerische<br />
Staatsregierung den Wettbewerb Innovative<br />
Verwaltung durch. Teilnehmen können<br />
alle staatlichen Dienststellen und Kommunen<br />
aus <strong>Bayern</strong>. Bei der diesjährigen Preis-<br />
Auszeichnung <strong>in</strong> der Staatskanzlei, München<br />
von l<strong>in</strong>ks: Mar<strong>in</strong>ko Nujic (Ing.-Büro Nujic), Herbert Blasczyk-Höfl<strong>in</strong>g, Klaus Schmalzl und Christoph Wiedemann (alle <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Rosenheim), M<strong>in</strong>isterpräsident Dr. Günther Beckste<strong>in</strong>, Ra<strong>in</strong>er Stemmer (StMUGV ehemals <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Rosenheim), Paul Geisenhofer (<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Rosenheim), Staatsm<strong>in</strong>ister Dr. Otmar Bernhard (StMUGV), Prof. Hill<br />
(Universität Speyer) und Franz Rasp (<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Traunste<strong>in</strong> ehemals <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Rosenheim)<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
35
36<br />
Berichte<br />
Vergleich mit / ohne Deichbruch-Auswirkungen<br />
Für alle Fälle - Echtzeitdeichbruchmodell<br />
verleihung unterstrich M<strong>in</strong>isterpräsident<br />
Beckste<strong>in</strong> die Qualität des Öffentlichen<br />
Dienstes: „Unsere Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und<br />
Mitarbeiter bei Freistaat und Kommunen<br />
verlassen ausgetretene Pfade und erproben<br />
mit viel Kreativität neue Wege.“<br />
Der Wettbewerb 2007 umfasste die Bereiche<br />
Sicherheit, Klima- und Umweltschutz,<br />
Zukunft und Arbeitsplätze sowie<br />
K<strong>in</strong>der und Familien. Im Themenbereich<br />
„Im Dienste für <strong>Bayern</strong>s Sicherheit“ holte<br />
nun das <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt die<br />
hochkarätige Auszeichnung nach Rosenheim.<br />
Paul Geisenhofer<br />
WWA Rosenheim<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Traunste<strong>in</strong> gew<strong>in</strong>nt Innovationspreis 2007 der<br />
Bayerischen Staatsregierung<br />
Gewässer-Renaturierung zum<br />
Anfassen<br />
Für das Projekt „Das Flussbiotop<br />
Almau für die Schüler im Achental“<br />
wurde das <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Traunste<strong>in</strong> im Rahmen des<br />
„Wettbewerbs Innovative Verwaltung<br />
2007“ ausgezeichnet.<br />
M<strong>in</strong>isterpräsident Dr. Günther<br />
Beckste<strong>in</strong> persönlich überreichte<br />
im November 2007 die begehrte<br />
Auszeichnung im Kuppelsaal<br />
der Staatskanzlei <strong>in</strong> München<br />
<strong>in</strong> der Kategorie „Im Dienste<br />
für <strong>Bayern</strong>s Umwelt“. Damit erhielt<br />
das <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Traunste<strong>in</strong> als e<strong>in</strong>er der ersten 5<br />
Preisträger e<strong>in</strong>e besondere Ehrung.<br />
„Die Ärmelschoner haben<br />
<strong>in</strong> unserer modernen öffentlichen<br />
Verwaltung längst ausgedient.<br />
Das hat der Wettbewerb Innovative<br />
Verwaltung e<strong>in</strong>mal mehr<br />
e<strong>in</strong>drucksvoll bewiesen.“ so der<br />
M<strong>in</strong>isterpräsident <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Laudatio.<br />
Die Tiroler Achen entspr<strong>in</strong>gt <strong>in</strong><br />
den Bergen Tirols und mündet<br />
nach ihrem Verlauf durch das<br />
Achental <strong>in</strong> den Chiemsee.<br />
Während der Oberlauf der Tiroler<br />
Achen noch viele naturnahe<br />
Strukturen aufweist, ist der Mittel-<br />
und Unterlauf bis wenige Kilometer<br />
vor der Mündung <strong>in</strong> den Chiemsee<br />
massiv wasserbaulich gesichert und<br />
mit direkt am Ufer angrenzenden Hoch-<br />
wasserschutzdeichen verbaut. E<strong>in</strong>e<br />
vom <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Traunste<strong>in</strong><br />
angestrebte Deichrückverlegung mit<br />
großräumiger Gewässerrenaturierung<br />
Übersichtsskizze, Aue außerhalb der Deiche, d.h. ohne Flussdynamik<br />
Berichte<br />
Auszeichnung <strong>in</strong> der Staatskanzlei, München<br />
von l<strong>in</strong>ks: Hans Aderbauer; Rektor der Volksschule Übersee, Franz Rasp; Abteilungsleiter<br />
am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Traunste<strong>in</strong>, Georg Hermannsdorfer und Albert Enz<strong>in</strong>ger vom<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Traunste<strong>in</strong>, M<strong>in</strong>isterpräsident Dr. Günther Beckste<strong>in</strong>, Professor Dr.<br />
Hermann Hill; Vorsitzender der Jury für die Preisverleihung, Günter Hopf; Leiter des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Traunste<strong>in</strong>, Dr. Otmar Bernhard; Staatsm<strong>in</strong>ister für Umwelt, Gesundheit<br />
und Verbraucherschutz<br />
ist für die nächsten Jahrzehnte wegen<br />
der Grundbesitzverhältnisse und der<br />
vor kurzem <strong>in</strong>vestierten Gelder <strong>in</strong> die<br />
Deichsanierung nicht absehbar.<br />
Aue aus zweiter Hand<br />
Um den Talraum aufzuwerten<br />
wurde e<strong>in</strong>e „Flussaue<br />
aus zweiter Hand“ - d. h.<br />
e<strong>in</strong>e sog. Renaturierung<br />
h<strong>in</strong>ter den Deichen - geschaffen.<br />
Sie soll die ökologischen<br />
Defizite verr<strong>in</strong>gern.<br />
Parallel dazu wurde<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich die Idee<br />
realisiert, gleichzeitig e<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>teraktives Schulungsprojekt<br />
zu schaffen.<br />
In Zusammenarbeit mit e<strong>in</strong>er<br />
Schule <strong>in</strong> Übersee am<br />
Chiemsee und zwei Schulen<br />
aus dem benachbarten<br />
Österreich wurde der Unterricht<br />
<strong>in</strong> der freien Natur<br />
möglich. Das langfristig<br />
angelegte Projekt motiviert<br />
Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler,<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
37
38<br />
Berichte<br />
Flussaue an der Tiroler Achen vor Beg<strong>in</strong>n des Projekts (oben) und nach<br />
den ersten Renaturierungsarbeiten<br />
Unter den „toten Ste<strong>in</strong>en“ gibt es e<strong>in</strong>iges zu entdecken<br />
sich für die Belange des Umweltschutzes<br />
e<strong>in</strong>zusetzen und schärft frühzeitig das<br />
Umweltbewusstse<strong>in</strong> junger Menschen.<br />
Die Jugendlichen legen selbst Hand<br />
an und gestalten die Biotope mit. Dabei<br />
besteht die e<strong>in</strong>zigartige Möglichkeit<br />
„live“ die Zusammenhänge an unseren<br />
Gewässern zu „begreifen“. Das Angebot<br />
wurde begeistert angenommen und alle<br />
waren mit Feuereifer bei der Sache, sei<br />
es beim Pflanzen von heimischen Sträuchern,<br />
beim Anlegen von Wegen oder<br />
beim Errichten e<strong>in</strong>es Beobachtungssteges.<br />
Fachkundig wurde das Projekt<br />
begleitet durch die Lehrer und durch die<br />
Experten des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Traunste<strong>in</strong>.<br />
Die Grund- und Hauptschule Übersee<br />
übernimmt diese Flächen langfristig als<br />
Experimentierfeld für feldbiologische<br />
Experimente und zur Förderung des sozialen<br />
Lernens durch Arbeiten <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>stgruppen<br />
<strong>in</strong> der Natur.Pädagogen und<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>ler s<strong>in</strong>d sich e<strong>in</strong>ig: „Es<br />
kommt darauf an, dass die Schüler die<br />
vielfachen wechselseitigen Abhängigkeiten<br />
zwischen Mensch, Umwelt und Natur<br />
möglichst gut verstehen. Dazu brauchen<br />
sie vielfältige, auch außerschulische Gelegenheiten<br />
zum eigenen Erleben von<br />
Natur und Kultur, damit das Verhältnis<br />
zur Umwelt nicht nur von der Sorge um<br />
das Überleben der Menschheit, sondern<br />
auch von zweckfreiem Natur- und Kulturverständnis,<br />
von Ehrfurcht vor der<br />
Schöpfung bestimmt wird.“<br />
Günter Hopf<br />
WWA Traunste<strong>in</strong><br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Die Bayerischen Landeskraftwerke - e<strong>in</strong> Staatsbetrieb wird zur GmbH<br />
Die Landeskraftwerke waren seit ihrer<br />
Gründung im Jahre 1963 bis Anfang<br />
2007 e<strong>in</strong> staatlicher Wirtschaftsbetrieb<br />
und zudem als Funktionsbehörde <strong>in</strong><br />
die bayerische <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung<br />
<strong>in</strong>tegriert. Zentrale Aufgabe<br />
des Staatsbetriebs als auch des neuen<br />
Wirtschaftsbetriebes war und bleibt es<br />
auch <strong>in</strong> der neuen Organisationsform,<br />
die Wasserkraftwerke an den Talsperren<br />
und Hochwasserrückhaltebecken,<br />
die sich im Besitz des Freistaates <strong>Bayern</strong><br />
bef<strong>in</strong>den, zu bauen, zu betreiben und zu<br />
unterhalten. Die Bayer. Landeskraftwerke<br />
waren <strong>in</strong> den vergangenen zehn Jahren,<br />
wie viele andere staatliche Beteiligungsunternehmen,<br />
Gegenstand von<br />
Privatisierungsüberlegungen. Es wurden<br />
<strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Jahren 1995 bis<br />
1999 zwar mehrfach Strukturveränderungen<br />
andiskutiert, e<strong>in</strong>e Privatisierung<br />
der damals 14 Wasserkraftanlagen hat<br />
die politische Spitze <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> aber stets<br />
abgelehnt.<br />
Rückwirkend zum Januar 2007 haben<br />
die Bayer. Landeskraftwerke nun e<strong>in</strong>e<br />
Betriebsaufspaltung vorgenommen, um<br />
künftig die Stromvergütungen nach dem<br />
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)<br />
zu erhalten. Der Staatsbetrieb bleibt dabei<br />
als Besitzverwaltung bestehen, das<br />
operative Geschäft von Stromproduktion-<br />
und Handel führt die im März 2007 neu<br />
gegründete GmbH weiter. Die Wasserkraftwerke<br />
verbleiben aber weiterh<strong>in</strong> im<br />
Eigentum des Freistaats <strong>Bayern</strong>.<br />
Gründung und Aufgabe der Bayerischen<br />
Landeskraftwerke<br />
Mit dem Sylvenste<strong>in</strong>speicher, der die<br />
Isar südlich von Bad Tölz aufstaut, begann<br />
<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> Ende der 1950er Jahre<br />
der bayerische Talsperrenbau. Der 1959<br />
<strong>in</strong> Betrieb gegangene Sylvenste<strong>in</strong>speicher<br />
- <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie für den Hochwasserschutz<br />
der Anra<strong>in</strong>er im Isartal bis nach<br />
München gedacht - dient im Sommer<br />
auch zur Niedrigwasseraufhöhung und<br />
ist zudem e<strong>in</strong> beliebtes überregionales<br />
Ausflugsziel. Nach dem 2. Weltkrieg war<br />
elektrische Energie aufgrund der Kriegsschäden<br />
knapp, so dass es damals nahezu<br />
selbstverständlich war, an der neu<br />
erbauten Talsperre e<strong>in</strong> Wasserkraftwerk<br />
zu <strong>in</strong>tegrieren. Für e<strong>in</strong>e wirtschaftliche<br />
Betätigung, wie es der Stromhandel darstellt,<br />
bedurfte es schon damals e<strong>in</strong>es<br />
sogenannten „Betriebes gewerblicher<br />
Art“. Im Jahre 1963 wurde daraufh<strong>in</strong><br />
der Staatsbetrieb „Landeskraftwerke“<br />
gegründet, der den erzeugten Strom des<br />
Kavernenkraftwerkes am Sylvenste<strong>in</strong>see<br />
(3.200 kW) an das regionale Energieversorgungsunternehmen<br />
Isar-Amper-<br />
Werke verkaufte. Der Wirtschaftsbetrieb<br />
war anfangs am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Francis-Turb<strong>in</strong>e im Sylvenste<strong>in</strong>speicher<br />
München und später am Bayer. Landesamt<br />
für <strong>Wasserwirtschaft</strong> angesiedelt.<br />
Seit 1992 ist der Sitz des Betriebes <strong>in</strong><br />
Regensburg.<br />
In den folgenden Jahren wurden <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong><br />
für Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung<br />
oder für die Sicherung<br />
der überregionalen Wasserversorgung<br />
<strong>in</strong>sgesamt 23 Talsperren und Rückhaltebecken<br />
gebaut. Die 1960er und 70er<br />
Jahre wurden dabei zum „Goldenen Zeitalter“<br />
des bayerischen Talsperrenbaus.<br />
Aktuell stehen zwei weitere Hochwasserrückhaltebecken<br />
bei Coburg (Goldbergsee)<br />
und Furth im Wald (Drachensee)<br />
kurz vor der Vollendung.<br />
Derzeit s<strong>in</strong>d 15 Wasserkraftwerke und<br />
<strong>in</strong>sgesamt 20 Turb<strong>in</strong>en mit e<strong>in</strong>er Ausbauleistung<br />
von 20.000 kW an 14 staatseigenen<br />
Talsperren und Rückhaltebecken<br />
<strong>in</strong> Betrieb. Im Herbst 2008 wird zudem<br />
das Wasserkraftwerk am Drachensee<br />
h<strong>in</strong>zukommen. Die GmbH hat zudem<br />
Berichte<br />
noch drei weitere Neubauten von Wasserkraftwerken<br />
mit e<strong>in</strong>er Ausbauleistung<br />
von <strong>in</strong>sgesamt über 2.000 kW am Ma<strong>in</strong>-<br />
Donau-Kanal <strong>in</strong> Planung.<br />
Zusammenarbeit der Bayerischen<br />
Landeskraftwerke mit der <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
Die Landskraftwerke haben seit ihrer<br />
Gründung vor 45 Jahren ke<strong>in</strong> eigenes<br />
Personal für die ihr übertragenen Aufgaben<br />
beschäftigt. Traditionell hat die<br />
Bayer. <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung das<br />
notwendige Fachpersonal für den Betrieb<br />
und Unterhalt der Wasserkraftanlagen<br />
an den Talsperren und Rückhaltebecken<br />
gegen Kostenerstattung durch die<br />
Landeskraftwerke gestellt. Die Landeskraftwerke<br />
hätten eigenes Personal an<br />
den <strong>in</strong> ganz <strong>Bayern</strong> verstreut gelegenen<br />
Standorten wirtschaftlich nicht e<strong>in</strong>setzen<br />
können. Für beide Seiten war diese<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
39
40<br />
Berichte<br />
Luftbild Sylvenste<strong>in</strong>speicher<br />
Kooperation stets von Vorteil. Mit dem<br />
E<strong>in</strong>satz von qualifiziertem Fachpersonal<br />
der <strong>Wasserwirtschaft</strong>sämter konnten für<br />
beide Partner wertvolle Synergieeffekte<br />
genutzt werden.<br />
Die Mitbetreuung durch Fachkräfte der<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> ist nicht nur wirtschaftlich<br />
s<strong>in</strong>nvoll, sondern auch aus Sicherheitsgründen<br />
geboten, da die Kraftwerke<br />
die wichtigsten Betriebsauslassorgane<br />
zur Fe<strong>in</strong>regulierung der Talsperren s<strong>in</strong>d.<br />
Auch nach der Änderung der Organisationsform<br />
werden die Landeskraftwerke<br />
beim Betrieb der Kraftwerksanlagen auf<br />
das Personal der <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung<br />
zurückgreifen.<br />
Auswirkungen der Strommarktliberalisierung<br />
ab dem Jahre 2000<br />
Der Staatsbetrieb verfolgte seit se<strong>in</strong>er<br />
Gründung ke<strong>in</strong>e Gew<strong>in</strong>nerzielungsabsicht,<br />
es wurde aber langfristig die<br />
„schwarze Null“ angestrebt. Die Strome<strong>in</strong>nahmen<br />
aus dem Kraftwerksbetrieb<br />
sollten jedoch die laufenden Kosten für<br />
Personal, Abschreibung, Rücklagen<br />
und für den laufenden Unterhalt erwirtschaften.<br />
Bis Anfang 2000 standen die<br />
E<strong>in</strong>nahmen mit den Ausgaben, je nach<br />
hydrologischen Gegebenheiten und Investitionen,<br />
langfristig im E<strong>in</strong>klang. Die<br />
Strommarktliberalisierung veränderte<br />
den Energiemarkt jedoch grundlegend.<br />
Ab dem Jahre 2000 g<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>folge des<br />
e<strong>in</strong>setzenden Wettbewerbes und des<br />
damals vorhandenen Überangebotes an<br />
Kraftwerkskapazitäten die Vergütung für<br />
die Erzeuger <strong>in</strong> kurzer Zeit um bis zu 50<br />
% zurück. Ab 2003 hatte sich die ehemals<br />
kle<strong>in</strong>teilige deutsche Versorgerlandschaft<br />
im Wesentlichen auf die vier<br />
große Konzerne reduziert, die 80 % der<br />
deutschen Stromversorgung abdecken.<br />
Die Konsolidierung des Strommarktes<br />
bewirkte letztendlich, dass die traditionelle<br />
regionale Struktur <strong>in</strong> der Stromversorgung<br />
großen Versorgungsnetzen<br />
weichen musste.<br />
Die Vergütungen für die Stromproduzenten<br />
blieben erheblich h<strong>in</strong>ter der allgeme<strong>in</strong><br />
ansteigenden Preisentwicklung<br />
zurück. Als Folge davon wurden selbst<br />
große Kohlekraftwerke wie Franken II<br />
bei Erlangen, Schwandorf und Arzberg<br />
stillgelegt. Die Strommarktliberalisierung<br />
hatte auch für die Bayer. Landeskraftwerke<br />
<strong>in</strong> den Jahren nach 2000 erhebliche<br />
wirtschaftliche Auswirkungen. Nachdem<br />
der Staatsbetrieb ke<strong>in</strong>e Vergütung nach<br />
EEG erhielt, konnte der Umsatzrückgang<br />
durch betriebliche E<strong>in</strong>sparungen nicht<br />
aufgefangen werden.<br />
Umstrukturierung der Bayerischen<br />
Landeskraftwerke <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e GmbH<br />
Die Landeskraftwerke mussten mit ihrer<br />
umweltfreundlich erzeugten Energie mit<br />
anderen Erzeugungsarten, wie Strom<br />
aus Kernkraftwerken, auf dem europäischen<br />
Markt konkurrieren. Für Betriebe<br />
des Bundes oder e<strong>in</strong>es Landes, auch<br />
wenn sie privatwirtschaftlich z.B. als<br />
GmbH oder als Körperschaft des öffentlichen<br />
Rechts organisiert waren, galt das<br />
EEG nach allgeme<strong>in</strong>er Rechtsme<strong>in</strong>ung<br />
nicht. Der Bundesgerichtshof hob diese<br />
Rechtsme<strong>in</strong>ung jedoch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Grundsatzurteil<br />
im Jahre 2005 auf, wonach<br />
nicht mehr der Stand des Eigentümers<br />
die ausschlaggebende Rolle spielen<br />
darf, sondern die Rechtsform des Strom<br />
erzeugenden Betriebes. Für die Bayer.<br />
Landeskraftwerke bedeutete dies, dass<br />
bei e<strong>in</strong>er Umwandlung bzw. Betriebsaufspaltung<br />
von e<strong>in</strong>em Staatsbetrieb <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
die höheren EEG-Vergütungen nun möglich<br />
waren.<br />
Der Bayerische M<strong>in</strong>isterrat beschloss<br />
im Dezember 2006 die notwendige<br />
Ausgliederung des Betriebsvermögens<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e GmbH, die aber zu 100 % im<br />
Eigentum des Freistaates <strong>Bayern</strong> verbleiben<br />
sollte. Die notarielle Ausgliederung<br />
<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit der Gründung<br />
der GmbH erfolgte im Frühjahr 2007. Die<br />
Rechtsformprivatisierung brachte aber<br />
auch e<strong>in</strong>e Reihe von <strong>in</strong>nerbetrieblichen<br />
Veränderungen mit sich. So musste e<strong>in</strong><br />
Geschäftsführer bestellt und die <strong>in</strong>nerbetriebliche<br />
Organisation <strong>in</strong> weiten Teilen<br />
an das Handels- und Privatrecht angepasst<br />
werden.<br />
E<strong>in</strong> weiterer Schwerpunkt der Umstrukturierung<br />
war die Anpassung aller<br />
Verträge und Verb<strong>in</strong>dlichkeiten nach<br />
Außen, <strong>in</strong>sbesondere mit den <strong>Wasserwirtschaft</strong>sämtern<br />
und den beteiligten<br />
M<strong>in</strong>isterien.<br />
Die „neue“ Bayerischen Landeskraftwerke<br />
GmbH<br />
Das Hauptziel, die Erlangung der EEG-<br />
Fähigkeit, wurde mit der Betriebsaufspaltung<br />
rückwirkend zum 01. Januar<br />
2007 erreicht. Die Bayer. Landeskraftwerke<br />
GmbH ist im Vergleich mit den<br />
privaten Wasserkraftbetreibern seither<br />
ertragsmäßig nicht mehr benachteiligt.<br />
Die GmbH ist nun <strong>in</strong> der Lage, den<br />
wirtschaftlichen Betrieb der 15 Wasserkraftwerke<br />
weiterzuführen, Neubaumaßnahmen<br />
am so genannten Überleitungssystem<br />
(Ma<strong>in</strong>-Donau-Kanal)<br />
zu beg<strong>in</strong>nen und wirtschaftlich positive<br />
Bilanzen vorzulegen. Im Übrigen wird<br />
die bewährte Zusammenarbeit mit der<br />
Bayer. <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung<br />
fortgesetzt.<br />
Die Umstrukturierung hat die Landeskraftwerke<br />
auf e<strong>in</strong> wirtschaftlich tragfähiges<br />
Fundament gestellt, ohne dass der<br />
Betrieb der Talsperren und Rückhaltebecken<br />
für die bayerische <strong>Wasserwirtschaft</strong>sverwaltung<br />
e<strong>in</strong>geschränkt wird.<br />
Günther Prem<br />
Bayerische Landeskraftwerke GmbH<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Strahlenschutz für Beschäftigte <strong>in</strong> bayerischen Wasserwerken<br />
In der im August 2001 <strong>in</strong> Kraft getretenen<br />
novellierten Strahlenschutzverordnung<br />
(StrlSchV) ist erstmals auch die Exposition<br />
durch natürliche radioaktive Stoffe<br />
geregelt, zum Beispiel durch Radon und<br />
se<strong>in</strong>e Zerfallsprodukte. An bestimmten<br />
Arbeitsplätzen muss daher die Exposition<br />
der Beschäftigten durch Radon erhoben<br />
werden. Zu diesen Arbeitsplätzen zählen<br />
neben Radonheilbädern und Bergwerken<br />
auch Anlagen der Wasserversorgung.<br />
Dementsprechend wurde seit 2002 die<br />
Exposition der bayerischen Wasserwarte<br />
systematisch untersucht. Inzwischen<br />
liegen dem Bayerischen Landesamt für<br />
Umwelt (LfU) die Ergebnisse der Erhebungsmessungen<br />
aus fast allen Wasserversorgungsunternehmen<br />
(WVU) vor.<br />
Radon – e<strong>in</strong> natürlich vorkommendes<br />
radioaktives Edelgas<br />
Radon ist e<strong>in</strong> radioaktives, farb-, geruch-<br />
und geschmackloses Edelgas. Es entsteht<br />
aus dem radioaktiven Zerfall von<br />
Uran, das im Boden natürlich vorkommt,<br />
und löst sich gut im Grund- und Quellwasser.<br />
Dabei hängt die Konzentration<br />
von den hydrogeologischen Verhältnissen<br />
<strong>in</strong> der Förderregion ab. Mit dem geförderten<br />
Grund- und Quellwasser wird<br />
das Radon <strong>in</strong> die verschiedenen Wasser-<br />
versorgungsanlagen transportiert und<br />
gast dort <strong>in</strong> die Raumluft aus (s. Abb. 1).<br />
Bereits <strong>in</strong> den Räumen der Quell- und<br />
Sammelschächte sowie <strong>in</strong> den Brunnenstuben<br />
entweicht es, so dass dort zum<br />
Teil sehr hohe Raumluftkonzentrationen<br />
entstehen. Auch offene und geschlossene<br />
Aufbereitungsanlagen können für<br />
e<strong>in</strong>e hohe Konzentration von Radon <strong>in</strong><br />
der Raumluft verantwortlich se<strong>in</strong>, da die<br />
radonbelastete Abluft meist direkt <strong>in</strong> die<br />
Raumluft des Aufbereitungsgebäudes<br />
gelangt. Beispiele s<strong>in</strong>d offene Kiesbettfilter<br />
zur Entsäuerung oder Filterkessel<br />
zur Eisen- und Manganausfällung. Höhere<br />
Radonkonzentrationen f<strong>in</strong>det man<br />
darüber h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> Anlagenteilen, die der<br />
Wasservorratshaltung dienen (Hoch-<br />
und Tiefbehälter). Auch bestimmte Betriebsabläufe,<br />
z.B. das Befüllen e<strong>in</strong>es<br />
Behälters oder die Spülung der Aufbereitungsanlagen,<br />
können den Transfer von<br />
Radon <strong>in</strong> die Raumluft stark erhöhen.<br />
Zudem s<strong>in</strong>d die Gebäude, <strong>in</strong> denen sich<br />
diese Anlagen bef<strong>in</strong>den, meist schlecht<br />
belüftet, um den E<strong>in</strong>trag von Stäuben<br />
und Mikroorganismen zu unterb<strong>in</strong>den.<br />
Durch die Inhalation von Radongas<br />
kann es zu Schäden im Lungengewebe<br />
kommen. Verursacher s<strong>in</strong>d vor allem<br />
die Radon-Zerfallsprodukte: kurzlebige<br />
radioaktive Schwermetalle, die sich gut<br />
Berichte<br />
an Aerosole b<strong>in</strong>den und mit fe<strong>in</strong>en Aerosolen<br />
sogar bis <strong>in</strong> die tieferen Lungenregionen<br />
e<strong>in</strong>geatmet werden können.<br />
Den Hauptanteil der zellschädigenden<br />
Wirkung trägt die energiereiche Alpha-<br />
Strahlung. Deshalb ist die Strahlenbelastung<br />
durch Radon so ger<strong>in</strong>g wie<br />
möglich zu halten.<br />
Umsetzung der gesetzlichen Regelungen<br />
der Strahlenschutzverordnung<br />
für Arbeitsplätze <strong>in</strong> der Wasserversorgung<br />
Im November 2001 hat das LfU alle<br />
bayerischen Wasserversorgungsunternehmen<br />
schriftlich über ihre Pflicht<br />
<strong>in</strong>formiert, die Radonexposition der Beschäftigten<br />
abzuschätzen. Die Radonexposition<br />
(= Strahlenbelastung durch<br />
Radon) der Beschäftigten im jeweiligen<br />
Wasserversorgungsunternehmen hängt<br />
dabei von verschiedenen Faktoren ab:<br />
Zunächst ist die Radonkonzentration im<br />
Rohwasser wesentlich, die von den geologischen<br />
Gegebenheiten <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit den Grundwasserleitern bestimmt<br />
ist. E<strong>in</strong>en bedeutenderen E<strong>in</strong>fluss auf<br />
die Radonkonzentration <strong>in</strong> der Raumluft<br />
hat jedoch die Art der Anlagen (z.<br />
B. schlecht belüftete Quellschächte,<br />
Aufbereitungen mit offenen Wasserflä-<br />
Abb. 1: Der Weg des Radons <strong>in</strong> die verschiedenen Wasserversorgungsanlagen (WVA); die Zahlen <strong>in</strong> den Kästen geben den<br />
Schwankungsbereich der gemessenen Radonkonzentrationen <strong>in</strong> den WVA an<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
41
42<br />
Berichte<br />
Abb. 2: Lage der WVU mit Beschäftigten <strong>in</strong> der kont<strong>in</strong>uierlichen Überwachung<br />
chen). Entscheidend ist aber vor allem<br />
die Aufenthaltsdauer der Wasserwarte<br />
<strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Anlagenteilen: Je<br />
länger die Aufenthaltszeit, desto höher<br />
die Exposition. Für die Erhebung der<br />
Radonexposition hat sich folgendes<br />
standardisierte Verfahren bewährt: Die<br />
Rout<strong>in</strong>eexposition wird durch Tragen e<strong>in</strong>es<br />
personengebundenen Exposimeters<br />
(passives Kernspurexposimeter) über e<strong>in</strong>en<br />
längeren Zeitraum (i.d.R. 3 Monate)<br />
beim Aufenthalt <strong>in</strong> allen Wasserversorgungsanlagen<br />
ermittelt. Zusätzlich müssen<br />
Arbeiten getrennt erfasst werden,<br />
die, wie z.B. die jährlichen Hochbehälterre<strong>in</strong>igungen,<br />
außerhalb der monatlichen<br />
Rout<strong>in</strong>e anfallen. Dazu wird die Radonraumluftkonzentration<br />
<strong>in</strong> den jeweiligen<br />
Anlagen mit e<strong>in</strong>em sog. ortsgebundenen<br />
Exposimeter ermittelt. Weiterh<strong>in</strong> wird die<br />
zusätzliche Aufenthaltszeit erfasst. Aus<br />
diesen Daten kann dann die Exposition<br />
Abb. 3: Unterirdische Entsäuerungskammer und Diagramm mit Verlauf der Radonkonzentration<br />
<strong>in</strong> der Kammer während e<strong>in</strong>es aktiven Belüftungsversuchs<br />
für diese Zusatzarbeiten berechnet werden.<br />
Diese zusätzliche Exposition und<br />
die hochgerechnete Rout<strong>in</strong>eexposition<br />
s<strong>in</strong>d im nächsten Schritt zu e<strong>in</strong>er Gesamtjahresexposition<br />
zu addieren. Überschreitet<br />
dieser Wert den <strong>in</strong> der StrlSchV<br />
festgelegten sog. E<strong>in</strong>greifwert von 6 mSv<br />
(2 MBqh/m³) im Kalenderjahr, liegt e<strong>in</strong>e<br />
anzeigebedürftige Arbeit vor und der<br />
Wasserwart muss se<strong>in</strong>e Radonexposition<br />
kont<strong>in</strong>uierlich überwachen. Die<br />
Erhebungsmessungen lieferten bei Beschäftigten<br />
<strong>in</strong> 76 WVU e<strong>in</strong>e Überschreitung<br />
des E<strong>in</strong>greif- oder Grenzwertes.<br />
Insgesamt 150 Beschäftigte <strong>in</strong> diesen<br />
WVU müssen daher die Radonexposition<br />
kont<strong>in</strong>uierlich überwachen. In der<br />
Abbildung 2 ist die Lage dieser WVU <strong>in</strong><br />
<strong>Bayern</strong> dargestellt.<br />
Teilt man den Freistaat <strong>in</strong> geologische<br />
Regionen mit jeweils <strong>in</strong>nerhalb jeder Region<br />
vergleichbarem Radonpotential e<strong>in</strong><br />
(s. Abb. 2), so fällt die überdurchschnittlich<br />
hohe Anzahl an WVU <strong>in</strong> Ostbayern<br />
auf, deren Erhebung e<strong>in</strong>e Exposition<br />
über dem E<strong>in</strong>greifwert lieferte. In dieser<br />
Region (Nummer 5) f<strong>in</strong>det man im Untergrund<br />
häufig Granite und Gneise, so<br />
dass geologisch bed<strong>in</strong>gt häufiger erhöhte<br />
Radonkonzentrationen im Grundwasser<br />
gemessen werden. Beim E<strong>in</strong>trag dieses<br />
Wassers <strong>in</strong> die Tr<strong>in</strong>kwassergew<strong>in</strong>nungsanlagen<br />
kommt es dann zu e<strong>in</strong>er vermehrten<br />
Anreicherung des Radons vor<br />
allem <strong>in</strong> schlecht belüfteten Räumen.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Für die kont<strong>in</strong>uierliche Überwachung<br />
tragen die Wasserwarte bei jedem Betreten<br />
der Anlagen oder Anlagenteile<br />
e<strong>in</strong> passives Radonexposimeter. Nach<br />
drei Monaten werden die Exposimeter<br />
zur Auswertung geschickt, während die<br />
Messung ohne Unterbrechung mit neuen<br />
Exposimetern fortgesetzt wird. So bleibt<br />
dem Wasserversorgungsunternehmen<br />
beim E<strong>in</strong>treffen der ersten Ergebnisse genügend<br />
Zeit, bei hohen Werten umgehend<br />
Maßnahmen e<strong>in</strong>zuleiten, um e<strong>in</strong>e eventuelle<br />
Überschreitung des Grenzwerts von<br />
20 mSv im Jahr zu verh<strong>in</strong>dern. E<strong>in</strong>e solche<br />
Maßnahme kann z. B. die Verwendung<br />
e<strong>in</strong>es mobilen Belüfters se<strong>in</strong>. Zusätzlich<br />
müssen die Beschäftigten, die der kont<strong>in</strong>uierlichen<br />
Überwachung unterliegen,<br />
dem LfU die Messergebnisse mitteilen.<br />
E<strong>in</strong>ige Beschäftigte messen bereits seit<br />
Mitte 2003 kont<strong>in</strong>uierlich die Radonexposition<br />
und haben Maßnahmen zur Senkung<br />
der Radonexposition durchgeführt.<br />
Der Erfolg dieser Maßnahmen ist daran<br />
ersichtlich, dass im März 2008 bereits 34<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> 20 WVU die Überwachung<br />
beenden konnten. Aktuell liegen weitere<br />
43 WVU mit ihren Überwachungsergebnissen<br />
unter dem E<strong>in</strong>greifwert. Im Jahr<br />
2007 waren 9 Überschreitungen des E<strong>in</strong>greifwertes<br />
und 4 Grenzwertüberschreitungen<br />
zu verzeichnen.<br />
Das LfU hat für <strong>Bayern</strong> festgelegt, dass<br />
die kont<strong>in</strong>uierliche Überwachung beendet<br />
werden kann, wenn folgende Voraussetzungen<br />
erfüllt s<strong>in</strong>d: Für zwei Jahre (=<br />
acht Quartale) müssen die Ergebnisse<br />
der kont<strong>in</strong>uierlichen personengebundenen<br />
Radonmessungen deutlich unter<br />
dem E<strong>in</strong>greifwert von 6 mSv/a liegen.<br />
Des Weiteren müssen für alle Anlagen<br />
Messungen der Radonkonzentration<br />
vorliegen und die durchgeführten Maßnahmen<br />
zur Senkung der Radonexpo-<br />
Abb. 4: Abtrennung offener Filterbecken<br />
sition schriftlich dokumentiert se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong><br />
weiteres Kriterium ist die Erstellung e<strong>in</strong>er<br />
Arbeitsanweisung zum Schutz vor<br />
Radon. Diese Arbeitsanweisung soll<br />
sicherstellen, dass die durchgeführten<br />
Reduktionsmaßnahmen auch langfristig<br />
von allen Beschäftigten beachtet werden,<br />
die <strong>in</strong> den Wasserversorgungsanlagen<br />
arbeiten. In der Arbeitsanweisung<br />
s<strong>in</strong>d alle e<strong>in</strong>zuhaltenden Maßnahmen<br />
festzulegen, z.B. die Aufenthaltszeiten<br />
auf das notwendige M<strong>in</strong>destmaß zu beschränken,<br />
mobile Lüfter e<strong>in</strong>zusetzen<br />
oder die Anlage nur bei bestimmten Betriebszuständen<br />
zu betreten. In Zusammenarbeit<br />
mit der Berufsgenossenschaft<br />
der Gas-, Fernwärme- und <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
(BGFW) hat das LfU e<strong>in</strong>e Bro-<br />
Abb. 5: Radondichte Abdeckung e<strong>in</strong>es Spülkastens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geschlossenen Aufbereitung<br />
Berichte<br />
schüre mit Informationen zur Erstellung<br />
e<strong>in</strong>er Arbeitsanweisung veröffentlicht,<br />
die <strong>in</strong> kurzer verständlicher Weise die<br />
Radonthematik erklärt und das Wasserwerkspersonal<br />
über die Notwendigkeit<br />
e<strong>in</strong>er Arbeitsanweisung zum Schutz vor<br />
Radon <strong>in</strong>formiert.<br />
Praxisbeispiele zur erfolgreichen Reduktion<br />
der Radonexposition<br />
Die Radonexposition wird von zwei<br />
Faktoren bee<strong>in</strong>flusst: der Länge der<br />
Aufenthaltszeit und der Höhe der Radonkonzentration.<br />
Für e<strong>in</strong>e Senkung<br />
der Radonexposition haben sich daher<br />
folgende Maßnahmen bewährt:<br />
Reduktion der Aufenthaltszeiten z.B.<br />
durch Fernüberwachung der Anlagen,<br />
Automatisierung der Rückspülung oder<br />
Verlagerung von Arbeiten an Orte mit<br />
niedriger Radonkonzentration (Büro,<br />
Schüttungsmessung), aktive Belüftung<br />
der Anlagen (Sammelschächte, Hochbehälter<br />
z. B. bei Re<strong>in</strong>igungsarbeiten), Abtrennung<br />
von Anlagenteilen sowie Verh<strong>in</strong>derung<br />
des Transfers radonbelasteter<br />
Abluft aus den Anlagen <strong>in</strong> die Raumluft.<br />
Welche Maßnahmen s<strong>in</strong>nvoll s<strong>in</strong>d, muss<br />
jeweils im E<strong>in</strong>zelfall entschieden werden.<br />
Ebenso wenig ist e<strong>in</strong>e generelle Aussage<br />
möglich, um welchen Betrag e<strong>in</strong>e<br />
Maßnahme die Radonexposition verr<strong>in</strong>gert.<br />
Zur Erfolgskontrolle muss nach<br />
der Durchführung von baulichen Maßnahmen<br />
die Radonkonzentration erneut<br />
gemessen werden. Die folgenden Beispiele<br />
zeigen erfolgreich durchgeführte<br />
Maßnahmen aus der Praxis:<br />
In Abbildung 3 ist dargestellt, wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
unterirdischen Entsäuerungskammer<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
43
44<br />
Berichte<br />
Abb. 6: Entwicklung der Radonkonzentration während der Belüftungs<strong>in</strong>tervalle<br />
mit e<strong>in</strong>em Belüftungsgerät radonarme<br />
Frischluft e<strong>in</strong>geblasen wird. Abbildung<br />
4 zeigt e<strong>in</strong>e Aufbereitungsanlage mit<br />
offenen Filterbecken, <strong>in</strong> der die Becken<br />
durch den E<strong>in</strong>bau von Fenstern vom<br />
Bediengang getrennt wurden. In e<strong>in</strong>er<br />
Aufbereitung mit geschlossenen Filterkesseln<br />
wurde der Spülkasten radondicht<br />
verschlossen (s. Abb. 5). Das obenstehende<br />
Diagramm (Abb. 6) zeigt, wie die<br />
Radonkonzentration während der Belüftungs<strong>in</strong>tervalle<br />
von ursprünglich 90.000<br />
Bq/m³ auf ca. 10.000 Bq/m³ s<strong>in</strong>kt.<br />
Zusammenfassung<br />
Seit Anfang 2001 s<strong>in</strong>d die bayerischen<br />
Wasserversorgungsunternehmen (WVU)<br />
verpflichtet, die Radonexposition ihrer Beschäftigten<br />
zu erheben. Die Ergebnisse<br />
werden dem Bayerischen Landesamt für<br />
Umwelt (LfU) auch bei Unterschreiten des<br />
E<strong>in</strong>greifwertes von 6 mSv im Kalenderjahr<br />
mitgeteilt werden. In 76 WVU wurde bei<br />
den Beschäftigten e<strong>in</strong>e Überschreitung<br />
des E<strong>in</strong>greif- oder Grenzwertes festgestellt.<br />
Diese Beschäftigten unterliegen<br />
der kont<strong>in</strong>uierlichen Überwachung. Die<br />
<strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>geleiteten Maßnahmen<br />
zur Senkung der Radonexposition s<strong>in</strong>d<br />
bei den meisten Wasserwarten, die der<br />
kont<strong>in</strong>uierlichen Überwachung unterliegen,<br />
erfolgreich: die Beschäftigten <strong>in</strong> 20<br />
WVU konnten die Überwachung bereits<br />
beenden. Insgesamt liegen 97 % der<br />
bayerischen WVU unter dem E<strong>in</strong>greifwert<br />
von 6 mSv/a (s. Abb. 7). Um die<br />
Nachhaltigkeit der Reduktionsmaßnahmen<br />
langfristig sicherzustellen, muss<br />
e<strong>in</strong>e Arbeitsanweisung erstellt werden.<br />
Dies ist zugleich e<strong>in</strong>e Vorrausetzung<br />
für die E<strong>in</strong>stellung der kont<strong>in</strong>uierlichen<br />
Überwachung.<br />
E<strong>in</strong>e Musterarbeitsanweisung sowie Beispiele<br />
für erfolgreiche Reduktionsstrategien<br />
s<strong>in</strong>d auf der Internetseite des LfU<br />
erhältlich (www.lfu.bayern.de/strahlung/<br />
fach<strong>in</strong>formationen).<br />
Abb. 7: Ergebnisse der Radonexposition <strong>in</strong> bayerischen Wasserversorgungsunternehmen, Stand März 2008<br />
Dr. Christiane Reifenhäuser<br />
Dr. Simone Körner<br />
LfU<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Wasserforum International –<br />
Erfahrungsaustausch zum <strong>in</strong>ternationalen Wassermarkt<br />
Das Projekt Technologietransfer Wasser<br />
(TTW) am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Hof veranstaltete geme<strong>in</strong>sam mit der<br />
<strong>Bayern</strong> Innovativ GmbH und dem Umweltcluster<br />
<strong>Bayern</strong> zum zweiten Mal das<br />
„Wasserforum International“ <strong>in</strong> Hof. 140<br />
Teilnehmer verfolgten <strong>in</strong>teressiert die <strong>in</strong>teressanten<br />
Vorträge, <strong>in</strong>formierten sich<br />
auf der begleitenden Fachausstellung<br />
und tauschten Erfahrungen aus.<br />
Umweltstaatssekretär Dr. Marcel Huberw<br />
eröffnete das 2. Wasserforum International<br />
mit dem Leitgedanken, dass die weltweite<br />
Wasserverknappung auch bayerische<br />
Experten herausfordert und diese<br />
zukünftig anderen Ländern stärker partnerschaftlich<br />
zur Seite stehen werden.<br />
Beispielhaft für gelungenen Wissens-<br />
und Technologietransfer nannte Huber<br />
die Fortbildung für Kläranlagenpersonal<br />
nach bayerischem Vorbild <strong>in</strong> Polen.<br />
Das 2. Wasserforum International<br />
zeigte die Komplexität<br />
des <strong>in</strong>ternationalen Wassermarktes<br />
auf. Funktionierende<br />
nationale und <strong>in</strong>ternationale<br />
Netzwerke gehören unbestritten<br />
zu den wichtigsten<br />
Instrumenten, um Markterfolg<br />
und <strong>in</strong>tegriertes Wasserressourcenmanagementmite<strong>in</strong>ander<br />
zu verb<strong>in</strong>den. Diesem<br />
Anspruch stellen sich die<br />
Veranstalter bei der täglichen<br />
Arbeit; das Wasserforum International<br />
<strong>in</strong> Hof bietet hierzu<br />
e<strong>in</strong>e geeignete Plattform zur<br />
Pflege der Netzwerke.<br />
Wenke Berl<strong>in</strong>g<br />
Verena Bagehorn<br />
TTW, WWA Hof<br />
Zusammenarbeit zwischen Vermessung und <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
Verfügbarkeit der digitalen Geländemodelle (DGM) nach dem Laserscann<strong>in</strong>g – Verfahren <strong>in</strong><br />
<strong>Bayern</strong><br />
Berichte<br />
Umweltstaatssekretär Dr. Marcel Huber bei der<br />
Eröffnungsrede<br />
Das Bayerische Landesamt für<br />
Umwelt und das Bayerische<br />
Landesamt für Vermessung<br />
und Geo<strong>in</strong>formation hat e<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>tensive Zusammenarbeit bei<br />
der Herstellung und Verwendung<br />
e<strong>in</strong>es hochauflösenden<br />
digitalen Geländemodells beschlossen.<br />
Die Geodaten werden<br />
nach dem Laserscann<strong>in</strong>g-<br />
Verfahren durch Befliegung von<br />
der Vermessungsverwaltung<br />
ermittelt. Mit der Zusammenarbeit<br />
können Kosten e<strong>in</strong>gespart<br />
und Synergieeffekte erreicht<br />
werden.<br />
Bis 2010 ist für ganz <strong>Bayern</strong> die<br />
Fertigstellung der Laser-DGM<br />
vorgesehen. Die Daten werden<br />
z.B. bei der Modellierung von<br />
Überschwemmungsgebieten,<br />
Massenbewegungen und der<br />
Lärmausbreitung <strong>in</strong>tensiv genutzt.<br />
Der <strong>aktuelle</strong> Stand der Verfügbarkeit<br />
kann unter http://geodaten.bayern.de<br />
e<strong>in</strong>gesehen<br />
werden.<br />
Dr. Dieter Rieger<br />
LfU<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
45
46<br />
Berichte<br />
Vollzug der Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
E<strong>in</strong>es der wichtigsten wasserwirtschaftlichen<br />
Ziele ist e<strong>in</strong> funktionsfähiges und<br />
dichtes Abwassernetz aus öffentlichen<br />
und privaten Kanälen. Während die<br />
öffentlichen Kanäle entsprechend der<br />
Eigenüberwachungsverordnung (EÜV)<br />
weitgehend überprüft worden s<strong>in</strong>d, gilt<br />
dies für die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
(GEA) bisher nur <strong>in</strong> wenigen<br />
E<strong>in</strong>zelfällen (z.B. <strong>in</strong> Wasserschutzgebiete<br />
u. a.). Nach DIN 1986 Teil 30<br />
wird aber bis 2015 auch für die privaten<br />
GEA e<strong>in</strong>e entsprechende Überprüfung<br />
gefordert. Das Bayerische Innenm<strong>in</strong>isterium<br />
hat bereits 1991 das Muster der<br />
geme<strong>in</strong>dlichen Entwässerungssatzung<br />
mit e<strong>in</strong>er wiederkehrenden Inspektionspflicht<br />
(alle zehn Jahre) für die Besitzer<br />
von GEA ergänzt. Diese Ergänzung der<br />
Musterentwässerungssatzung wurde <strong>in</strong><br />
den zurückliegenden Jahren von vielen<br />
bayerischen Geme<strong>in</strong>den und Abwasserverbänden<br />
<strong>in</strong> deren Satzung aufgenommen.<br />
(Und selbst wenn e<strong>in</strong>zelne<br />
Satzungen nicht mit der o.g. Prüfpflicht<br />
ergänzt wurden, steht s<strong>in</strong>ngemäß <strong>in</strong> jeder<br />
Entwässerungssatzung „GEA s<strong>in</strong>d<br />
nach den allgeme<strong>in</strong> anerkannten Regeln<br />
der Technik (a.a.R.d.T.) herzustellen,<br />
zu betrieben und zu unterhalten“. Die<br />
a.a.R.d.T. fordern ebenfalls die wiederkehrende<br />
Prüfung von GEA.).<br />
Nun herrscht bei vielen Kanalnetzbetreibern<br />
Unsicherheit, wer für den Vollzug<br />
dieser Anforderungen verantwortlich<br />
ist. Ist es Aufgabe der Kommune, vom<br />
Grundstücksbesitzer die Inspektionspflicht<br />
e<strong>in</strong>zufordern und auf e<strong>in</strong>e zur Erfüllung<br />
der wasserwirtschaftlichen Anforderungen<br />
evtl. notwendige Sanierung<br />
zu drängen oder ist dafür der staatliche<br />
Gewässerschutz (Landratsamt, <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt)<br />
zuständig?<br />
Um diese Frage zu klären hatte der DWA-<br />
Landesverband <strong>Bayern</strong> mit e<strong>in</strong>em Schreiben<br />
vom 16.05.2007 beim Bayerischen<br />
Innenm<strong>in</strong>isterium angefragt, <strong>in</strong>wieweit sich<br />
die Nachweispflicht – und damit die Vollzugsverantwortung<br />
– <strong>in</strong> den kommunalen<br />
Entwässerungssatzungen regeln lässt.<br />
In der Antwort des Bayerischen Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom 28.06.2007 wurde aufgeführt,<br />
dass bei Übernahme der hier<br />
e<strong>in</strong>schlägigen Empfehlung der Mustersatzung<br />
• die Geme<strong>in</strong>de an die von ihr gesetzten<br />
Rechtsvorschriften gebunden ist und<br />
deren E<strong>in</strong>haltung sicherstellen muss<br />
• die staatliche Kreisverwaltungsbehörde<br />
(zuständig für den Vollzug des<br />
Wasserrechts) nicht für den Satzungsvollzug<br />
zuständig ist.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus wurde darauf h<strong>in</strong>gewiesen,<br />
dass Satzungen sich auf den ordnungsgemäßen<br />
Betrieb der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
E<strong>in</strong>richtung beziehen, während<br />
der Gewässerschutz auf die nachhaltige<br />
Sicherung der Wasserressourcen ausgerichtet<br />
ist.<br />
Mit dieser Antwort liegt e<strong>in</strong>e klare Aussage<br />
bzgl. der Vollzugsverantwortung für den<br />
Fall vor, wenn e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de die Empfehlung<br />
der Mustersatzung <strong>in</strong> ihre Entwässerungssatzung<br />
übernommen hat.<br />
Wie vorgegangen werden muss, wenn<br />
diese Regelung von der Kommune nicht<br />
gewählt wurde, wurde mit e<strong>in</strong>em weiteren<br />
Schreiben des DWA-Landesverbandes<br />
<strong>Bayern</strong> an das Bayerische Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz<br />
vom 20.11.2007 nachgefragt.<br />
TV-Untersuchung e<strong>in</strong>er privaten Grundstücksentwässerungsanlage. (Quelle: Bayerisches<br />
Landesamt für Umwelt)<br />
Das Antwortschreiben des Bayerischen<br />
Umweltm<strong>in</strong>isteriums vom 28.11.2007<br />
enthält folgende Kernaussagen:<br />
• Wird Hausabwasser erlaubnispflichtig<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Gewässer e<strong>in</strong>geleitet, ist<br />
der Staat für die Beurteilung dieser<br />
Gewässerbenutzung und für die Kontrolle<br />
der dabei verwendeten Anlagen<br />
zuständig.<br />
• Wird Hausabwasser <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche<br />
Abwasseranlage e<strong>in</strong>geleitet, ist<br />
nach Auffassung des Umweltm<strong>in</strong>isteriums<br />
die Geme<strong>in</strong>de dafür zuständig,<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er entsprechenden Entwässerungssatzung<br />
die Anforderungen an<br />
die GEA zu regeln und zu vollziehen.<br />
Dies <strong>in</strong>sbesondere, da undichte GEA<br />
nicht nur Nachteile für die Umwelt,<br />
sondern vor allem auch Nachteile<br />
für den Betrieb der kommunalen Entwässerungse<strong>in</strong>richtungen<br />
(erhöhter<br />
Fremdwasserzufluss, E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen von<br />
Sand und Geröll <strong>in</strong> die Kanalisation)<br />
mit sich br<strong>in</strong>gen. Das Bayerische<br />
Umweltm<strong>in</strong>isterium verweist hierbei<br />
nochmals auf die vom Bayerischen<br />
Innenm<strong>in</strong>isterium herausgegebene<br />
Mustersatzung.<br />
E<strong>in</strong>e klare Aussage, wer für den Vollzug<br />
der Überprüfung von GEA zuständig ist,<br />
wenn e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de die Empfehlung<br />
der Mustersatzung nicht <strong>in</strong> ihre Entwässerungssatzung<br />
übernommen hat, blieb<br />
das Umweltm<strong>in</strong>isterium mit se<strong>in</strong>em Antwortschreiben<br />
damit schuldig. Es fordert<br />
<strong>in</strong> diesem die Kommunen aber auf, die<br />
zur Kontrolle der GEA erforderlichen Regelungen<br />
zu treffen, da entsprechende<br />
kommunale Regelungen und Vollzugsmaßnahmen<br />
schon wegen der größeren<br />
Nähe der Kommunen an die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Anschlussverhältnisse staatlichen Vollzugsmaßnahmen<br />
vorgehen müssen.<br />
Alle<strong>in</strong> die Umsetzung der Musterentwässerungssatzung<br />
wird sicherlich nicht zu<br />
dem gewünschten Erfolg führen. Im Interesse<br />
des Umweltschutzes (Exfiltration)<br />
und des Betreibers der Abwasseranlage<br />
(Fremdwasser) ist e<strong>in</strong> von der Kommune<br />
organisiertes Vorgehen für den Bereich<br />
des öffentlichen und des privaten Kanalnetzes<br />
erforderlich. Nur so kann <strong>in</strong>sgesamt<br />
e<strong>in</strong>e wirtschaftliche und nachhaltige<br />
Lösung für das gesamte öffentliche<br />
und private Kanalnetz erreicht werden.<br />
Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert<br />
Wolfgang Stockbauer<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Kommentar zum Bericht:<br />
Vollzug der Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
„Nicht nur der Freistaat, sondern<br />
auch die Kommune möchte ke<strong>in</strong>en<br />
Ärger mit dem Bürger wegen<br />
se<strong>in</strong>es undichten Kanals!“ oder<br />
„Vor Gericht und auf hoher See<br />
ist man <strong>in</strong> Gottes Hand!“<br />
Für das Grundwasser ist es ohne<br />
größere Bedeutung, ob e<strong>in</strong>e Bee<strong>in</strong>trächtigung<br />
aufgrund undichter<br />
privater Kanäle oder undichter öffentlicher<br />
Kanäle erfolgt. Es leuchtet<br />
sofort e<strong>in</strong>, dass für den Schutz des<br />
Grundwassers das gesamte Kanalnetz<br />
- sowohl das private als auch<br />
das öffentliche - gleichermaßen<br />
dicht se<strong>in</strong> sollte.<br />
Zuvor kann man sich jedoch die -<br />
nicht ketzerisch geme<strong>in</strong>te - Frage<br />
stellen, ob e<strong>in</strong> ganz dichtes Kanalnetz<br />
wirklich notwendig ist. Immerh<strong>in</strong><br />
s<strong>in</strong>d bisher ke<strong>in</strong>e Grundwasserschäden<br />
bekannt geworden, die durch<br />
undichte Kanäle verursacht wurden.<br />
Und dies vor dem H<strong>in</strong>tergrund, dass<br />
das Thema Dichtheit von Kanälen<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten nicht gerade<br />
e<strong>in</strong> Schwerpunktthema <strong>in</strong> der<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> und bei den Kommunen<br />
war. Es sche<strong>in</strong>t also auch <strong>in</strong><br />
der Praxis mit der Selbstdichtung<br />
von Kanälen und dem Abbau von<br />
Schadstoffen im Untergrund e<strong>in</strong>igermaßen<br />
zu funktionieren.<br />
Daraus ließe sich also ableiten, dass<br />
die Anforderungen an dichte Kanäle<br />
nicht übermäßig hoch se<strong>in</strong> müssen.<br />
Nun ist es jedoch <strong>in</strong> Deutschland<br />
(Gott-sei-Dank) so, dass das Meiste<br />
ausführlich geregelt ist. Also:<br />
• Um die Dichtheit der öffentlichen<br />
Kanäle hat sich die Kommune zu<br />
kümmern. In der sogenannten<br />
Eigenüberwachungsverordnung<br />
zum Bayerischen Wassergesetz<br />
ist dies näher geregelt. So ist u.<br />
a. die Dichtheit alle 20 Jahre zu<br />
überprüfen. Wenn e<strong>in</strong>e Kommune<br />
dies nicht tut, ist das Landratsamt<br />
im Vollzug des Wasserrechts zuständig,<br />
dies e<strong>in</strong>zufordern. Diese<br />
Zuständigkeit ist nachvollziehbar<br />
und unstrittig.<br />
• Für die Dichtheit der privaten Kanäle<br />
ist der Bürger selbst <strong>in</strong> eigener<br />
Verantwortung zuständig. Dazu ist<br />
<strong>in</strong> der Norm DIN 1986 u. a. geregelt,<br />
dass der Bürger bis zum 31.12.<br />
2015 se<strong>in</strong>e Kanäle auf Dichtheit zu<br />
prüfen hat. Ob der Bürger dies jedoch<br />
so genau weiß bzw. wissen<br />
will, darf etwas bezweifelt werden.<br />
Mit Anfrage der DWA beim Bayer. Innenm<strong>in</strong>isterium<br />
und beim Bayer. Umweltm<strong>in</strong>isterium<br />
ist es zum<strong>in</strong>dest teilweise<br />
gelungen, die wasserrechtliche<br />
Vollzugsverantwortung zu klären (siehe<br />
vorherigen Artikel).<br />
Grundsätzlich ist natürlich nicht davon<br />
auszugehen, dass der mündige Bürger<br />
se<strong>in</strong>e privaten Kanäle bis zum 31.12.2015<br />
auf Dichtheit geprüft und anschließend<br />
auch saniert hat (immerh<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d 60 – 80 %<br />
der Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
undicht!).<br />
Es stellt sich also die Frage, wer letztlich<br />
vollzugsverantwortlich dafür ist, dass<br />
die Dichtheitsprüfung bis zum 31.12.2015<br />
flächendeckend geschieht. Dazu liegen<br />
der DWA von den beiden zuständigen<br />
M<strong>in</strong>isterien Antworten vor:<br />
Antwort des Bayer. Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />
kurz gefasst:<br />
In der Mustersatzung wird empfohlen,<br />
dass die Kommune die Vollzugsverantwortung<br />
übernehmen soll. Wenn also<br />
diese Umsetzung <strong>in</strong> der kommunalen<br />
Satzung erfolgt ist, so ist die Kommune<br />
(natürlich) auch für deren E<strong>in</strong>haltung<br />
vollzugsverantwortlich. Diese Zuständigkeit<br />
ist e<strong>in</strong>leuchtend.<br />
Antwort des Bayer. Umweltm<strong>in</strong>isteriums<br />
kurz gefasst:<br />
Das M<strong>in</strong>isterium ist der Me<strong>in</strong>ung, dass<br />
schon wegen der größeren Nähe der<br />
Kommune zum Bürger die Kommune<br />
eher zuständig ist als das Landratsamt.<br />
Hier hatte ich eigentlich erwartet, dass<br />
das Umweltm<strong>in</strong>isterium bestätigt, dass<br />
für den Fall, dass die Kommune ke<strong>in</strong>e<br />
Regelung <strong>in</strong> der Satzung hat, die Wasserrechtsbehörde<br />
(i.d.R. das Landratsamt)<br />
vollzugsverantwortlich ist. Nach<br />
dem Motto:<br />
• Die Entwässerungssatzung schützt<br />
das geme<strong>in</strong>dliche Kanalnetz und die<br />
Kläranlage vor negativen E<strong>in</strong>wirkungen<br />
(z. B. vor zuviel Fremdwasser).<br />
• Der allgeme<strong>in</strong>e Gewässerschutz (hier:<br />
Schutz des Grundwassers) und damit<br />
der Vollzug des Wasserrechts liegt jedoch<br />
bei den Landratsämtern.<br />
Leider hat die Antwort des Umweltm<strong>in</strong>isteriums<br />
diese E<strong>in</strong>schätzung nicht<br />
bestätigt.<br />
Diese Argumentation ersche<strong>in</strong>t mir jedoch<br />
nicht wirklich e<strong>in</strong>leuchtend und<br />
ist mit me<strong>in</strong>em Ingenieurverstand nicht<br />
nachvollziehbar. Man stelle sich nur mal<br />
e<strong>in</strong>en undichten privaten Kanal vor, der<br />
Berichte<br />
weit über dem Grundwasserspiegel<br />
liegt. Hier ist e<strong>in</strong>e Bee<strong>in</strong>trächtigung<br />
der öffentlichen Abwasseranlage<br />
auszuschließen. E<strong>in</strong>e Bee<strong>in</strong>trächtigung<br />
des Grundwassers durch<br />
Exfiltration von Abwasser aus den<br />
privaten Kanal <strong>in</strong> das Grundwasser<br />
ist jedoch denkbar.<br />
Frage: Warum sollte dafür die Kommune<br />
für den wasserrechtlichen<br />
Vollzug verantwortlich se<strong>in</strong>, wo es<br />
sich hier doch um wasserrechtliche<br />
Fragen zur nachhaltigen Sicherung<br />
der Wasserressourcen dreht? Und<br />
dafür ist, wohl unstrittig, das Landratsamt<br />
vollzugsverantwortlich.<br />
Es bleibt also die Frage, ob die<br />
Me<strong>in</strong>ung des Umweltm<strong>in</strong>isteriums<br />
auch e<strong>in</strong>er gerichtlichen Überprüfung<br />
standhält. Um dies herauszubekommen,<br />
wird man deshalb wohl<br />
e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>schlägiges Gerichtsverfahren<br />
abwarten müssen.<br />
In der kommunalen Praxis ist es<br />
allerd<strong>in</strong>gs überhaupt nicht so, dass<br />
sich Kommunen ihrer Mitverantwortung<br />
auf diesem Feld nicht bewusst<br />
wären. Viele Kommunen übernehmen<br />
aus Gründen des Geme<strong>in</strong>wohles<br />
und auch ohne rechtliche Verpflichtung<br />
hier Aufgaben, die nur<br />
die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
betreffen.<br />
Abschließend möchte ich aber nicht<br />
verhehlen, dass es mich schon <strong>in</strong>teressieren<br />
würde, wer denn jetzt für<br />
die Dichtheitsprüfung bei privaten<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
letztlich wirklich vollzugsverantwortlich<br />
ist! Offenbar ist e<strong>in</strong>e klare und<br />
nachvollziehbare Antwort auf diese<br />
Frage aber selbst für das Umweltm<strong>in</strong>isterium<br />
nicht ganz e<strong>in</strong>fach. Zur<br />
Not muss man sich halt mit dem<br />
bekannten Juristenspruch <strong>in</strong> etwas<br />
abgewandelter Form weiterhelfen:<br />
„Vor Gericht, auf hoher See und sogar<br />
bei Anfragen beim M<strong>in</strong>isterium<br />
ist man <strong>in</strong> Gottes Hand!“<br />
Hermann Klotz,<br />
Münchner Stadtentwässerung<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
47
48<br />
Berichte<br />
Produktprüfungen bei Schlauchl<strong>in</strong>er<br />
Das IKT - Institut für Unterirdische<br />
Infrastruktur <strong>in</strong> Gelsenkirchen<br />
und se<strong>in</strong>e Außenstelle IKT-<br />
Süd <strong>in</strong> Neubiberg bei München<br />
führen im Auftrag von Herstellern<br />
neutrale und unabhängige<br />
Produktprüfungen durch.<br />
Dabei müssen es nicht immer<br />
Standardprüfungen se<strong>in</strong>! Zwei<br />
<strong>aktuelle</strong> Beispiele für außergewöhnliche<br />
Prüfungen: e<strong>in</strong>e Qualitätsprüfung<br />
e<strong>in</strong>es XXL-L<strong>in</strong>ers<br />
der Firma Insituform und e<strong>in</strong><br />
Spülversuch an e<strong>in</strong>em Saertex-<br />
S-L<strong>in</strong>er bei dem 70 Jahre statt<br />
50 Jahre Kanalre<strong>in</strong>igung simuliert<br />
wurden.<br />
Qualitätsprüfung<br />
Im Dezember 2007 wurde <strong>in</strong> Krefeld<br />
e<strong>in</strong> Schlauchl<strong>in</strong>er der Nennweite Ei<br />
1200/1800 mit e<strong>in</strong>er Sanierungslänge<br />
von 550 Metern e<strong>in</strong>gebaut. Die IKT-<br />
Prüf<strong>in</strong>genieure nahmen drei Probestücke<br />
genau unter die Lupe. Sie bestätigen<br />
die erfolgreiche Sanierung: Die Proben<br />
s<strong>in</strong>d dicht und erfüllen die Anforderungen<br />
an die statische Tragfähigkeit.<br />
Vorbereitende Maßnahmen<br />
Bei dieser Baumaßnahme war alles<br />
außergewöhnlich. E<strong>in</strong> 240-Tonnen-<br />
Schwertransporter ist drei Nächte auf<br />
der Straße gewesen, um den L<strong>in</strong>er aus<br />
dem Werk <strong>in</strong> Geschwenda (Thür<strong>in</strong>gen)<br />
an den Niederrhe<strong>in</strong> <strong>in</strong> NRW zu br<strong>in</strong>gen.<br />
Der L<strong>in</strong>er wurde 450 km vom E<strong>in</strong>bauort<br />
entfernt im Werk getränkt. Er musste die<br />
ganze Zeit mit Eis gekühlt werden.<br />
Frisch aus der Haltung: drei L<strong>in</strong>erproben von jeweils<br />
ca. 600 x 800 mm<br />
Probenentnahme aus der Haltung<br />
(E<strong>in</strong>bauqualität)<br />
Zur Überprüfung der E<strong>in</strong>bauqualität wurden<br />
nach der Aushärtung drei Proben<br />
aus der Haltung entnommen. Ihre Maße<br />
s<strong>in</strong>d jeweils ca. 600 x 800 mm. Die Entnahmepositionen<br />
befanden sich ca. 10<br />
m und ca. 310 m entfernt vom Schacht.<br />
Das Trägermaterial ist Synthesefasernadelfilz,<br />
getränkt <strong>in</strong> UP-Harz.<br />
Im Anschluss an die Sanierung wurden<br />
die Probestücke entnommen, die im<br />
Labor auf zwei zentrale Schlauchl<strong>in</strong>er-<br />
Eigenschaften h<strong>in</strong> untersucht wurden:<br />
Mechanische Materialkennwerte und<br />
Wasser-Dichtheit. Für die Überprüfung<br />
der Standsicherheit nach DWA-M 127,<br />
T2 werden mechanische und geometrische<br />
Kennwerte bestimmt.<br />
Mechanische Kennwerte<br />
E-Modul und Biegefestigkeit (DIN EN<br />
ISO 178 und DIN EN 13566-4) s<strong>in</strong>d<br />
zentrale Kennwerte für die Tragfähigkeit<br />
des L<strong>in</strong>ers. Die Wanddicke wird mit Hilfe<br />
e<strong>in</strong>er Präzisionsschieblehre als mittlere<br />
Verbunddicke nach DIN EN 13566-4 gemessen.<br />
Beim E-Modul übertreffen alle drei Proben<br />
den Sollwert. Die Soll-Wanddicke<br />
wird ebenfalls erreicht und um bis zu<br />
14% überschritten. Zwei der Proben erreichen<br />
die geforderte Biegefestigkeit,<br />
lediglich e<strong>in</strong>e ist leicht zu ger<strong>in</strong>g. Die statische<br />
Nachberechnung mit den auf der<br />
Baustelle erreichten Werten ergab e<strong>in</strong>e<br />
Sicherheit, die weit über den geforderten<br />
Wert von 2,0 liegt.<br />
Wasser-Dichtheit<br />
Die Wasser-Dichtheit wurde nach der<br />
APS-Pzrüfrichtl<strong>in</strong>ie bestimmt: Zuerst<br />
wird die Innenfolie nach e<strong>in</strong>em festgelegten<br />
Muster e<strong>in</strong>geschnitten. Dann<br />
wird rot gefärbtes Wasser auf die Innenseite<br />
aufgetragen und auf die Außenseite<br />
0,5 bar Unterdruck aufgebracht.<br />
Bilden sich ke<strong>in</strong>e Tropfen, Schaum<br />
oder Feuchtigkeit auf der Außenseite,<br />
so ist der L<strong>in</strong>er dicht. Alle drei Krefelder<br />
Insituform-Proben erwiesen sich als<br />
wasserdicht.<br />
Hamburger Spülversuch zur Simulation der HD-Re<strong>in</strong>igung<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Spülversuch: 70 Jahre Kanalre<strong>in</strong>igung<br />
simuliert<br />
An e<strong>in</strong>em Saertex-S-L<strong>in</strong>er führte das IKT<br />
e<strong>in</strong>en Spülversuch durch. Statt üblicherweise<br />
30 Spüldurchgänge beauftragte<br />
der Hersteller den Test mit 70 Re<strong>in</strong>igungszyklen.<br />
Grundlage des Spülversuches war<br />
das Hamburger Modell, nach dem die<br />
Langzeitbeständigkeit von Rohren und<br />
Abzweigen gegenüber den Beanspruchungen<br />
der Kanalre<strong>in</strong>igung praxisnah<br />
überprüft werden kann. E<strong>in</strong>e HD-Düse<br />
wird unter Zugabe von Splitt <strong>in</strong> die Prüfstrecke<br />
e<strong>in</strong>gespült und wieder zurückgezogen.<br />
Für Schlauchl<strong>in</strong>er werden dabei<br />
heute üblicherweise 30 Spüldurchgänge<br />
durchgeführt, um die Belastung über e<strong>in</strong>en<br />
Zeitraum von 30 Jahren bei jährlicher<br />
HD-Re<strong>in</strong>igung zu simulieren.<br />
Vorangegangene Spülversuche am IKT<br />
bestätigten die gute Beständigkeit des<br />
L<strong>in</strong>ers gegenüber den Beanspruchungen<br />
durch HD-Re<strong>in</strong>igung.<br />
Der Härte-Test zeigt e<strong>in</strong>deutig: Der L<strong>in</strong>er<br />
hält 70 Re<strong>in</strong>igungszyklen stand. Die IKT-<br />
Prüfer besche<strong>in</strong>igen die Beständigkeit<br />
gegenüber 70 Spüldurchgängen, entsprechend<br />
e<strong>in</strong>er Beanspruchung über<br />
70 Jahre bei jährlicher Re<strong>in</strong>igung.<br />
Durchführung Spülversuch<br />
E<strong>in</strong> Re<strong>in</strong>igungszyklus im Hamburger<br />
Spülversuch besteht jeweils aus dem E<strong>in</strong>spülen<br />
und dem Rückziehen<br />
der Re<strong>in</strong>igungsdüse durch die<br />
gesamte Versuchsstrecke.<br />
Vor der Prüfung ermitteln e<strong>in</strong><br />
Drucksensor und e<strong>in</strong> magnetisch-<strong>in</strong>duktives<br />
Durchfluss-<br />
Messsystem (MID) Druck<br />
und Durchfluss. Während der<br />
Prüfung werden die Werte mit<br />
e<strong>in</strong>em Manometer am Spülfahrzeug<br />
kontrolliert. Vor der<br />
Düse werden am Ende der<br />
Prüfstrecke unmittelbar vor<br />
dem Rückziehen fünf Liter<br />
Kalkste<strong>in</strong>-Edelsplitt 2-5 mm<br />
als Prüfgeschiebe zugegeben.<br />
Zusätzlich wird nach<br />
70 Re<strong>in</strong>igungszyklen an drei<br />
Stellen e<strong>in</strong>e punktuelle Dauerbelastung<br />
über drei M<strong>in</strong>uten<br />
aufgebracht.<br />
Ergebnisse<br />
Die IKT-Prüfer konnten feststellen,<br />
dass die Beanspruchungen<br />
ke<strong>in</strong>e Schäden an<br />
dem L<strong>in</strong>er verursachen. In der<br />
Sohle waren lediglich leichte<br />
Schleifspuren zu erkennen,<br />
die <strong>in</strong>nere Re<strong>in</strong>harzschicht<br />
Zugabe von Geschiebe (Splitt)<br />
des L<strong>in</strong>ers war ger<strong>in</strong>gfügig aufgeraut.<br />
Glasfasern lagen jedoch nicht frei.<br />
An e<strong>in</strong>er Hausanschlussöffnung im<br />
Scheitel hat sich allerd<strong>in</strong>gs durch den<br />
Hochdruckwasserstrahl die <strong>in</strong>nere Re<strong>in</strong>harzschicht<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en Teilbereich<br />
von der ersten Glaslage leicht abgelöst.<br />
An den übrigen Hausanschlussöffnungen<br />
im Kämpfer und im Scheitel s<strong>in</strong>d<br />
ke<strong>in</strong>e Veränderungen aufgetreten.<br />
20.000h Scheiteldruckversuch<br />
Berichte<br />
Die IKT-Prüfer können die Beständigkeit<br />
gegenüber 70 Spüldurchgängen,<br />
entsprechend e<strong>in</strong>er Beanspruchung<br />
über 70 Jahre bei jährlicher Re<strong>in</strong>igung<br />
besche<strong>in</strong>igen.<br />
Unter Druck gesetzt<br />
Doch nicht nur gegen Belastungen aus<br />
der HD-Re<strong>in</strong>igung muss e<strong>in</strong> Schlauchl<strong>in</strong>er<br />
beständig se<strong>in</strong>. Standsicherheit und<br />
Tragfähigkeit müssen ebenfalls gewährleistet<br />
se<strong>in</strong>. Um dies auch über<br />
e<strong>in</strong>en (simulierten) Zeitraum<br />
von 70 Jahren zu überprüfen,<br />
führte das IKT e<strong>in</strong>en Langzeit-<br />
Scheiteldruckversuch über<br />
20.000 Stunden durch.<br />
Im Normalfall dauert e<strong>in</strong> Langzeit-Scheiteldruckversuch<br />
10.000 Stunden. Während der<br />
Prüfung wird die Verformung<br />
des L<strong>in</strong>ers aufgezeichnet und<br />
der E-Modul auf e<strong>in</strong>en Zeitraum<br />
von 50 Jahren extrapoliert.<br />
Bei der Versuchsdauer<br />
von 20.000 Stuvanden kann<br />
e<strong>in</strong> Zeitraum von 70 Jahren<br />
dargestellt werden. Dazu wurde<br />
e<strong>in</strong>e Baustellenprobe vom<br />
12. Mai 2004 bis zum 25. August<br />
2006 im IKT „unter Druck<br />
gesetzt“. Die IKT-Prüfer kommen<br />
zu dem Ergebnis, dass<br />
der L<strong>in</strong>er auch nach 70 Jahren<br />
noch se<strong>in</strong> Soll erfüllt.<br />
René Puhl<br />
Institut für unterirdische<br />
Infrastruktur<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
49
50<br />
Berichte<br />
Bau<strong>in</strong>vestitionen Kanalisation - Marktumfrage<br />
Das IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur<br />
führte im Auftrag der STEIN-<br />
ZEUG Abwassersysteme GmbH e<strong>in</strong>e<br />
Markterhebung unter ausgewählten<br />
deutschen Netzbetreibern zum Thema<br />
„Bau<strong>in</strong>vestitionen Kanalisation“ durch<br />
(Oktober – Dezember 2007). Mehr als<br />
2.200 Netzbetreibern wurde e<strong>in</strong> Fragebogen<br />
zugesandt; die Rücklaufquote war<br />
mit knapp 11% sehr gut, man kann daher<br />
davon ausgehen, dass die Erhebung repräsentativ<br />
für Deutschland ist.<br />
Die Ergebnisse der Marktumfrage zeigen,<br />
dass sich der <strong>in</strong> der Vorjahreserhebung<br />
ermittelte positive Trend fortsetzt:<br />
Die Investitionen der Netzbetreiber <strong>in</strong><br />
ihre Kanalisation steigen um bis zu 6%<br />
(2007: +2% und 2008: +6%). Die Prozentangaben<br />
beziehen sich jeweils auf<br />
das Basisjahr 2006.<br />
Bezogen auf die Kanalbaulängen<br />
kündigen die<br />
Netzbetreiber leicht rückläufige<br />
Bauvolum<strong>in</strong>a an<br />
(2007: -1%, 2008: -1%),<br />
allerd<strong>in</strong>gs auf gegenüber<br />
dem Jahr 2005 gestiegenem<br />
Niveau. Bei den<br />
Bauverfahren zeichnet<br />
sich e<strong>in</strong> Strukturwandel<br />
ab: Während der Bereich<br />
Kanalneubau/-erschließung<br />
e<strong>in</strong>e rückläufige<br />
Tendenz aufweist, verzeichnen<br />
Sanierungen<br />
Zuwächse.<br />
Netzbetreiber setzen<br />
verschiedene Rohrwerkstoffe<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit vom<br />
Rohrdurchmesser e<strong>in</strong>.<br />
Gefragt wurde<br />
• nach den Werkstoffen:<br />
Ste<strong>in</strong>zeug, Beton, Guss, Kunststoff<br />
(allgeme<strong>in</strong>), GFK, PVC, PE und PP<br />
sowie<br />
• nach den Rohrdurchmessern:<br />
DN � 200, DN 200 – 400, DN 400 –<br />
800 und DN > 800.<br />
Während im Bereich DN � 200 Ste<strong>in</strong>zeug<br />
und Kunststoff favorisiert werden, s<strong>in</strong>d<br />
im Bereich DN 200 bis DN 400 Ste<strong>in</strong>zeugrohre<br />
am beliebtesten, gefolgt von<br />
Beton und Kunststoff, die gleichauf liegen.<br />
Betonrohre f<strong>in</strong>den v.a. bei Nennweiten<br />
DN � 400 e<strong>in</strong>e große Zustimmung.<br />
Andere Werkstoffe spielen hier nur e<strong>in</strong>e<br />
untergeordnete Rolle.<br />
Bemerkenswert ist der Akzeptanzzuwachs,<br />
den der althergebrachte Werkstoff<br />
Ste<strong>in</strong>zeug <strong>in</strong> allen betrachteten<br />
Querschnitten, v.a. aber im Segment<br />
bis DN 400 erfährt (+5,3%). Auch Kunststoffrohre<br />
werden gegenüber dem Vorjahr<br />
durchweg stärker favorisiert, <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> den Segmenten begehbarer<br />
Rohre (DN > 800: +48,8%) und DN 400<br />
bis 800 (+29,9%). H<strong>in</strong>gegen melden die<br />
Netzbetreiber für Betonrohre bis DN 800<br />
Akzeptanze<strong>in</strong>bußen, hiervon besonders<br />
betroffen ist der Bereich DN 200 bis DN<br />
400 (-16,8%).<br />
Insgesamt deuten die Befragungsergebnisse<br />
darauf h<strong>in</strong>, dass die Netzbetreiber<br />
den Sanierungsauftrag angenommen<br />
haben und die Umsetzung verfolgen.<br />
Roland W. Waniek<br />
Institut für Unterirdische Infrastruktur<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
geofora <strong>in</strong> Hof und <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
Die geofora – Fachmesse und Fachkongress<br />
für Bohrtechnik, Brunnenbau und<br />
Geothermie – war bereits als Auftaktveranstaltung<br />
<strong>in</strong> Hof im Jahr 2007 e<strong>in</strong><br />
voller Erfolg und soll als turnusmäßige<br />
Veranstaltung etabliert werden. Gleichzeitig<br />
ist die figawa Bundesvere<strong>in</strong>igung<br />
der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V,<br />
die sich für die Organisation der geofora<br />
e<strong>in</strong>setzt, mit ihren Mitgliedsunternehmen<br />
alle drei Jahre <strong>in</strong> die WASSER BERLIN<br />
e<strong>in</strong>gebunden. In Abstimmung mit der<br />
Stadt Hof und der Messe Berl<strong>in</strong> ist es<br />
gelungen, die geofora an zwei Standorten<br />
fortzusetzen. Sie wird 2009 als<br />
Kongress und als „Messe <strong>in</strong> der Messe“<br />
im Rahmen von WASSER BERLIN und<br />
2010 im Herbst wieder eigenständig <strong>in</strong><br />
Hof stattf<strong>in</strong>den.<br />
Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung<br />
der geofora im September 2007 <strong>in</strong><br />
Hof wird die Fachmesse und der Fachkongress<br />
für Bohrtechnik, Brunnenbau<br />
und Geothermie im kommenden Jahr<br />
vom 30. März - 3. April 2009 <strong>in</strong> die WAS-<br />
SER BERLIN <strong>in</strong>tegriert. Der geofora-<br />
Messebeirat hat e<strong>in</strong>stimmig entschieden,<br />
die geofora geme<strong>in</strong>sam weiterzuentwickeln<br />
und dabei auch die Möglichkeiten<br />
der Profilbildung und der Vorteile im Verbund<br />
der gesamten <strong>Wasserwirtschaft</strong> im<br />
Rahmen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ternationalen Messe am<br />
Standort Berl<strong>in</strong> zu nutzen. Gleichzeitig<br />
wird der Standort Hof - als Erfolgsstand-<br />
ort des Vorjahres - als Austragungsstätte<br />
im Herbst 2010 beworben. Beide Standorte,<br />
Hof und Berl<strong>in</strong> im Wechsel, ergeben<br />
mit ihrem jeweiligen unterschiedlichen<br />
Charakter, e<strong>in</strong>e sehr gute Basis für e<strong>in</strong>en<br />
anerkannten Treffpunkt der Branche. Mit<br />
dem Freistaat <strong>Bayern</strong> und dem Umweltcluster<br />
<strong>Bayern</strong>, e<strong>in</strong>em Netzwerk der<br />
Wirtschaft und Wissenschaft auf dem<br />
Gebiet der Umwelttechnologie, laufen<br />
Erfolg versprechende Gespräche, den<br />
Umweltstandort Hof weiter zu positionieren.<br />
Die WASSER BERLIN ist der <strong>in</strong>ternationale<br />
Treffpunkt der <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
und bietet mit Fachmesse und speziellen<br />
Kongressen für Wasser und Abwasser<br />
die gute Verb<strong>in</strong>dung von Theorie und<br />
Praxis. Der Bedarf an sauberem Wasser<br />
und e<strong>in</strong>er sichereren Wasserversorgung<br />
wächst stetig. Dies gilt für Tr<strong>in</strong>k-<br />
und Brauchwasser. Deshalb sehen die<br />
Veranstalter der WASSER BERLIN die<br />
geofora als wichtige Branchenplattform<br />
und als Treffpunkt zwischen Wissenschaft<br />
und Industrie <strong>in</strong> den Bereichen für<br />
Wassergew<strong>in</strong>nung, Bohrtechnik sowie<br />
Geothermie - als Teilbereich der regenerativen<br />
Energien – und als sehr gute<br />
Ergänzung <strong>in</strong>nerhalb der Gesamtveranstaltung<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>.<br />
Der begleitende geofora Kongress 2009<br />
bildet an zwei Tagen das Diskussions-<br />
Berichte<br />
forum für Fachleute, die sich auf Lösungen<br />
rund um das Thema Wassergew<strong>in</strong>nung,<br />
Bohrtechnik oder Geothermie<br />
spezialisiert haben. Zu den bewährten<br />
Programmteilen der Erstveranstaltung<br />
soll e<strong>in</strong> zentraler Marktplatz <strong>in</strong>mitten<br />
der geofora Themenhalle zusätzliche<br />
Veranstaltungen mit Sonderthemen für<br />
die allgeme<strong>in</strong>en Besucher der WAS-<br />
SER BERLIN ermöglichen. Hierbei werden<br />
die gezielte Ansprache von Versorgungsunternehmen<br />
für die Bereiche der<br />
Geothermie sowie Fragestellungen des<br />
<strong>in</strong>ternationalen Publikums e<strong>in</strong>en besonderen<br />
Schwerpunkt bilden.<br />
Neben der Positionierung der geofora-<br />
Ausstellung <strong>in</strong> der Themenhalle 1, können<br />
sich die Aussteller von Bohrgeräten<br />
und großen Exponaten der Aufmerksamkeit<br />
aller WASSER BERLIN-Besucher<br />
auf dem Freigelände <strong>in</strong> prädest<strong>in</strong>ierter<br />
Lage neben dem Haupte<strong>in</strong>gang der Messe<br />
sicher se<strong>in</strong>. Darüber h<strong>in</strong>aus ist e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>ladung der bayrischen Landesvertretung<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> vorgesehen. Hier sollen die<br />
die geofora-Aussteller und -Kongressteilnehmer<br />
zu e<strong>in</strong>em bayrischen Abend-<br />
Event e<strong>in</strong>geladen und auf die geofora<br />
2010 <strong>in</strong> Hof e<strong>in</strong>gestimmt werden.<br />
Messebesuch bei der Eröffnung der Messe am 12. September 2007 <strong>in</strong> der Freiheitshalle <strong>in</strong> Hof<br />
Mario Jahn, figawa Köln<br />
Peter Nürmberger, Stadt Hof<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
51
52<br />
Personalnachrichten<br />
Personalnachrichten<br />
Neuer Behördenleiter am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Kempten<br />
Zum 1.1.2008 wurde Herr<br />
Baudirektor Karl Sch<strong>in</strong>dele<br />
zum neuen Leiter des<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Kempten ernannt. Der bisherige<br />
Amtsleiter Herr Ltd.<br />
Baudirektor Wolfgang Arnoldt<br />
wurde mit gleichem<br />
Datum an die Regierung von<br />
Schwaben versetzt. Herr<br />
Arnoldt übernimmt dort Leitung<br />
des Sachgebietes 52<br />
„<strong>Wasserwirtschaft</strong>“.<br />
Herr Arnoldt verbrachte<br />
se<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>dheit <strong>in</strong> Landshut,<br />
Berl<strong>in</strong> und München. Nach<br />
dem Bau<strong>in</strong>genieurstudium<br />
an der TU München folgten<br />
fünf Jahre Berufstätigkeit<br />
bei e<strong>in</strong>em Memm<strong>in</strong>ger<br />
Bauunternehmen und e<strong>in</strong>em<br />
Ingenieurbüro für Abwassertechnik<br />
<strong>in</strong> Ulm. 1978<br />
begann Herr Arnoldt die Referendarzeit<br />
beim <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Krumbach<br />
und der Stadt München.<br />
Nach der großen Staatsprüfung wurde<br />
Herr Arnoldt als Abteilungsleiter und<br />
Fachbereichsleiter am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Krumbach e<strong>in</strong>gesetzt. Er<br />
übernahm dort auch die Funktion des<br />
stellvertretenden Behördenleiters. Ab<br />
Dezember 1992 schloss sich e<strong>in</strong>e fast<br />
siebenjährige Tätigkeit als Referent an<br />
der Regierung von Schwaben an. Er war<br />
dort für den Siedlungswasserbau und<br />
die technische Gewässeraufsicht, sowie<br />
für Deponien und Altlasten zuständig.<br />
Unter anderem auch als Leiter der Arbeitsgruppe<br />
Entmunitionierung und Altlastensanierung<br />
beim Projekt Legoland<br />
<strong>in</strong> Günzburg.<br />
Im September 1999 wurde Herr Arnoldt<br />
zum Leiter des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Krumbach berufen. Schwerpunkte se<strong>in</strong>er<br />
dortigen Tätigkeit waren der Hochwasserschutz<br />
an der Unteren Iller und<br />
der Stadt Neu-Ulm. Nach den Hochwasserereignissen<br />
2002 und 2005 war der<br />
Hochwasserschutz e<strong>in</strong> flächendeckendes<br />
Thema im Amtsbereich.<br />
Im Zuge der Verwaltungsreform wurde<br />
Herrn Arnoldt im August 2006 die<br />
Leitung des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Kempten anvertraut. Die Aufgaben aus<br />
dem Landkreis Unterallgäu und der<br />
Stadt Memm<strong>in</strong>gen, sowie e<strong>in</strong>ige Mitar-<br />
Ltd. Baudirektor Wolfgang Arnoldt (l<strong>in</strong>ks), Regierungspräsident Ludwig Schmid und Baudirektor<br />
Karl Sch<strong>in</strong>dele (rechts) bei der Amte<strong>in</strong>führung am 19.2.2008 <strong>in</strong> Kempten<br />
beiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter wechselten<br />
mit Herrn Arnoldt aufgrund der Reform<br />
an das <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Kempten.<br />
Während der e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halbjährigen Amtszeit<br />
von Herrn Arnoldt konnte das größte<br />
Wasserbauprojekt der letzten Jahre <strong>in</strong><br />
<strong>Bayern</strong>, der Hochwasserschutz an der<br />
Oberen Iller fertig gestellt werden. Das<br />
Hochwasser vom August 2005 bewirkte,<br />
dass e<strong>in</strong>e Vielzahl weiterer Hochwasserschutzprojekte<br />
umgesetzt werden<br />
konnte.<br />
Der neue Leiter des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
Kempten Herr Karl Sch<strong>in</strong>dele<br />
wurde 1960 im Allgäu geboren; er<br />
verbrachte dort se<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>dheit und<br />
Schulzeit. Nach der Ausbildung zum<br />
Bauzeichner und der fachgebundenen<br />
Hochschulreife studierte er Bau<strong>in</strong>genieurwesen<br />
an der TU München. Herr<br />
Sch<strong>in</strong>dele arbeitete nach dem Diplomabschluss<br />
e<strong>in</strong> Jahr als Bauleiter bei e<strong>in</strong>er<br />
Münchner Spezialtiefbaufirma. In se<strong>in</strong>er<br />
Referendarausbildung ab 1987 war er an<br />
den <strong>Wasserwirtschaft</strong>sämtern Freis<strong>in</strong>g,<br />
München und Kempten tätig.<br />
Ab Dezember 1989 übernahm Herr<br />
Sch<strong>in</strong>dele am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Freis<strong>in</strong>g die Abteilungsleitung für den<br />
Landkreis Erd<strong>in</strong>g. E<strong>in</strong> Schwerpunkt<br />
se<strong>in</strong>er Arbeit war die Gutachtens- und<br />
Aufsichtstätigkeit beim Neubau des<br />
Flughabens im Erd<strong>in</strong>ger Moos. Nach<br />
sieben Jahren wechselte er zum Umweltm<strong>in</strong>isterium<br />
nach München <strong>in</strong> das<br />
Referat „Technische Gewässeraufsicht,<br />
Wasserforschung“. Hier waren se<strong>in</strong>e<br />
Aufgabenschwerpunkte der Aufbau e<strong>in</strong>er<br />
modellgestützten Hochwasservorhersage<br />
und der erforderlichen Messnetze,<br />
die Erforschung der Folgen der Klimaänderungen<br />
auf die <strong>Wasserwirtschaft</strong> und<br />
die Leitung e<strong>in</strong>er Projektgruppe nach<br />
dem Pf<strong>in</strong>gsthochwasser 1999.<br />
Im Juli 2005 wurde Herr Sch<strong>in</strong>dele an<br />
das <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Kempten versetzt.<br />
Er übernahm hier die Funktion als<br />
stellvertretender Amtsleiter und die Abteilungsleitung<br />
für den Landkreis Ostallgäu.<br />
Ab 1.1.2008 wurde Herrn Sch<strong>in</strong>dele<br />
die Leitung des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />
übertragen.<br />
Karl Sch<strong>in</strong>dele<br />
WWA Kempten<br />
Der DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
wünscht den Herren Arnold und Sch<strong>in</strong>dele<br />
für ihre neuen Aufgaben alles Gute<br />
und viel Erfolg.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
Dieter Wagner <strong>in</strong> den Vorruhestand verabschiedet<br />
Am 1. November 2007 trat der langjährige<br />
Leiter des Sachgebietes <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
an der Regierung von Schwaben<br />
Leitender Baudirektor Dieter Wagner<br />
<strong>in</strong> die Freistellungsphase se<strong>in</strong>er Altersteilzeit.<br />
Herr Wagner wurde im niederbayerischen<br />
Markt Kößlarn geboten. Nach dem<br />
Abitur, das er <strong>in</strong> München ablegte, und<br />
dem Wehrdienst bei e<strong>in</strong>er Panzere<strong>in</strong>heit<br />
<strong>in</strong> Amberg studierte er Bau<strong>in</strong>genieurwesen<br />
an der Technischen Universität München<br />
mit Abschluss als Diplom-Ingenieur<br />
im Jahre 1972.<br />
Während dieser Studienzeit absolvierte<br />
er Auslandspraktika bei der türkischen<br />
Straßenbauverwaltung und e<strong>in</strong>er Baufirma<br />
<strong>in</strong> London.<br />
Der E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die damalige Bauverwaltung<br />
erfolgte zunächst als Referendar<br />
beim Straßenbauamt München. Die<br />
große Staatsprüfung für den höheren<br />
bautechnischen Verwaltungsdienst legte<br />
er dann <strong>in</strong> der Fachrichtung Wasserbau<br />
und <strong>Wasserwirtschaft</strong> ab, um zielgerichtet<br />
ab 01.01.1975 am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Donauwörth den Landkreis<br />
Donau-Ries als Abteilungsleiter zu betreuen.<br />
Schwerpunkte se<strong>in</strong>er Tätigkeit<br />
waren der Donau- und Lechausbau mit<br />
Wasserkraftanlagen sowie der Gewässerschutz<br />
und hierbei <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Abwasserentsorgung.<br />
In sportlicher H<strong>in</strong>sicht war er für die<br />
Faustballmannschaft des Amtes e<strong>in</strong> unverzichtbarer<br />
H<strong>in</strong>termann.<br />
Mitte 1986 wechselte er zur Regierung<br />
von Schwaben nach Augsburg als Referent<br />
für Wasserversorgung, Gewässerschutz,<br />
technische Gewässeraufsicht,<br />
Altlasten und Deponien. E<strong>in</strong> vielfältiges<br />
Arbeitsgebiet, das ihm sehr nützliche<br />
Kenntnisse über Land und Leute <strong>in</strong> ganz<br />
Schwaben (und im Allgäu) verschaffte.<br />
In dieser Zeit begann auch se<strong>in</strong>e Tätigkeit<br />
als Lehrbeauftragter für den Wasserbau<br />
an der Fachhochschule Augsburg.<br />
Es war ihm immer wieder e<strong>in</strong>e Freude,<br />
jungen Menschen die fachlichen Grundlagen<br />
se<strong>in</strong>es Berufes <strong>in</strong> Vorlesungen und<br />
Exkursionen näherzubr<strong>in</strong>gen.<br />
Der Ruf an die Oberste Baubehörde im<br />
Bayer. Staatsm<strong>in</strong>isterium des Innern<br />
erreichte ihn im September 1992. Dort<br />
waren Themen aus dem Bereich der<br />
Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Donau-AG und dem damit<br />
verbundenen Schifffahrtsweg se<strong>in</strong> Spezialgebiet.<br />
LBD Dieter Wagner<br />
Drei Jahre später, Ende 1995 verließ er<br />
das Bayerische Staatsm<strong>in</strong>isterium für<br />
Landesentwicklung und Umweltfragen<br />
um <strong>in</strong> den Regierungsbezirk Schwaben<br />
zurückzukehren – als Leiter des Sachgebiets<br />
Wasserbau und <strong>Wasserwirtschaft</strong>.<br />
In dieser Funktion wirkte er bis zu se<strong>in</strong>em<br />
Abschied im Oktober 2007.<br />
12 Jahre die durchgängig geprägt waren<br />
vom Streben nach schwäbisch-sparsamer<br />
Verwendung der Haushaltsmittel,<br />
e<strong>in</strong>em ausgleichenden Gerechtigkeitss<strong>in</strong>n<br />
vor allem <strong>in</strong> Personalangelegenheiten,<br />
e<strong>in</strong>er bewundernswerten Beharrlichkeit<br />
bei komplizierten Abläufen<br />
und e<strong>in</strong>er überzeugenden Genauigkeit<br />
<strong>in</strong> Detailfragen.<br />
Das Pf<strong>in</strong>gsthochwasser 1999 brachte<br />
auch für das Sachgebiet <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
an der Regierung von Schwaben<br />
viele <strong>Herausforderungen</strong> und Aufgaben<br />
mit sich. Beg<strong>in</strong>nend mit diesem<br />
markanten Datum s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Schwaben<br />
F<strong>in</strong>anzmittel für den Wasserbau, speziell<br />
den Hochwasserschutz, <strong>in</strong> bis<br />
dah<strong>in</strong> unbekannter Höhe e<strong>in</strong>gesetzt<br />
worden.<br />
Im Team mit se<strong>in</strong>en Kollegen im Sachgebiet<br />
oder am Amt arbeitete Herr Wagner<br />
die Themen kritisch konstruktiv ab.<br />
Stichwort: Hochwasserschutz Obere Iller,<br />
Bemessungshochwasser, Freibordmaß,<br />
Erosionssicherung.<br />
Personalnachrichten<br />
E<strong>in</strong>e besondere Aufgabe war die vom<br />
Staatsm<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Gesundheit<br />
und Verbraucherschutz an<br />
die Regierung von Schwaben übertragene<br />
Federführung für das Hochwasserschutzkonzept<br />
Paar im Landkreis<br />
Aichach-Friedberg.<br />
Aus dem ursprünglichen Auftrag e<strong>in</strong>e<br />
Machbarkeitsstudie zu erarbeiten entstanden<br />
durch se<strong>in</strong> besonderes geschicktes<br />
und beharrliches Engagement<br />
vor Ort e<strong>in</strong> fertiges Hochwasserrückhaltebecken<br />
und baureife Planungen für<br />
den <strong>in</strong>tegralen Hochwasserschutz der<br />
Paartalgeme<strong>in</strong>den.<br />
Ruhe, Übersicht, fundiertes Fachwissen,<br />
Sicherheit <strong>in</strong> der Argumentation, Zuhören<br />
können, Pflichtbewusstse<strong>in</strong>, unermüdlicher<br />
E<strong>in</strong>satz für die <strong>Wasserwirtschaft</strong>,<br />
Menschlichkeit – diese Eigenschaften<br />
zeichnen Dieter Wagner aus.<br />
Wir wünschen Herrn Wagner alles Gute<br />
und e<strong>in</strong>en angenehmen Ruhestand, damit<br />
er sich den D<strong>in</strong>gen widmen kann, die<br />
bisher zu kurz kamen.<br />
Wolfgang Arnoldt,<br />
Regierung von Schwaben<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
53
54<br />
Personalnachrichten<br />
Theodor-Rehbock-Medaille für Prof. Dr.-Ing. Franz Valent<strong>in</strong><br />
Die Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für <strong>Wasserwirtschaft</strong>,<br />
Abwasser und Abfall<br />
e. V. (DWA) vergibt im Rahmen<br />
der Bundestagung und Landesverbandstagung<br />
Sachsen/Thür<strong>in</strong>gen<br />
am 21. Juni 2007 <strong>in</strong> Gera erstmals<br />
die Theodor-Rehbock-Medaille an<br />
verdienten Münchener <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler<br />
für herausragende Innovationen<br />
im Arbeitsgebiet der DWA.<br />
Preisträger dieser hohen Auszeichnung<br />
ist Prof. Dr.-Ing. Franz Valent<strong>in</strong><br />
(68) aus Germer<strong>in</strong>g bei München.<br />
Innerhalb se<strong>in</strong>er beruflichen sowie<br />
ehrenamtlichen Aktivitäten ist es<br />
Franz Valent<strong>in</strong> <strong>in</strong> herausragender<br />
Weise gelungen, die Erkenntnisse<br />
aus se<strong>in</strong>er universitären Forschung<br />
<strong>in</strong> die Praxis zu übertragen, sei es <strong>in</strong><br />
Sem<strong>in</strong>aren und Kursen oder auch <strong>in</strong><br />
der DWA-Arbeitsgruppe „Quantitative<br />
und qualitative Abflussmessung“,<br />
die er viele Jahre <strong>in</strong> ihren Arbeitsthemen<br />
und Arbeitsergebnissen<br />
mitgeprägt hat.<br />
Franz Valent<strong>in</strong> wurde am 16. Dezember<br />
1938 <strong>in</strong> Ochsenfurt am Ma<strong>in</strong> geboren.<br />
Nach dem Abitur studierte er von<br />
1958 bis 1963 Bau<strong>in</strong>genieurwesen an<br />
der Technischen Hochschule München.<br />
Von 1963 bis 1968 arbeitete Franz Valent<strong>in</strong><br />
als wissenschaftlicher Assistent<br />
Theodor-Rehbock-Medaille:<br />
Prof. Dr.-Ing. Franz Valent<strong>in</strong> nach der Preisverleihung<br />
am Lehrstuhl für Hydraulik und Gewässerkunde.<br />
Se<strong>in</strong>e Promotion schloss er<br />
1968 erfolgreich ab, se<strong>in</strong>e Habilitation<br />
drei Jahre später. Franz Valent<strong>in</strong> blieb<br />
am Lehrstuhl und arbeitete dort von 1967<br />
bis 1970 als Konservator, 1971 wurde<br />
er Akademischer Oberrat am gleichen<br />
Institut. Die Lehrbefugnis wurde ihm<br />
1971 erteilt, von 1971 bis 1977 war<br />
er Wissenschaftlicher Rat, von 1977<br />
bis 1986 zusätzlich Professor bzw.<br />
Extraord<strong>in</strong>arius für Hydraulik und<br />
Gewässerkunde. Von 1987 bis zum<br />
E<strong>in</strong>tritt se<strong>in</strong>es Ruhestands 2004 war<br />
Franz Valent<strong>in</strong> Ord<strong>in</strong>arius für Hydraulik<br />
und Gewässerkunde an der<br />
Fakultät für Bau<strong>in</strong>genieur- und Vermessungswesen<br />
der TU München.<br />
1979 trat Franz Valent<strong>in</strong> als Mitglied<br />
dem DVWK (Deutscher Verband für<br />
<strong>Wasserwirtschaft</strong> und Kulturbau)<br />
bei, 1982 <strong>in</strong> die ATV (Abwassertechnische<br />
Vere<strong>in</strong>igung).<br />
In se<strong>in</strong>en Aktivitäten für die DWA<br />
bzw. ihre Vorgängerorganisationen<br />
ATV und DVWK ist es Franz Valent<strong>in</strong><br />
über Jahre h<strong>in</strong>weg <strong>in</strong> herausragender<br />
Weise gelungen, die Erkenntnisse<br />
aus se<strong>in</strong>er universitären Forschung<br />
<strong>in</strong> die fachliche Praxis zu übertragen,<br />
e<strong>in</strong>e für die DWA unschätzbar wertvolle<br />
Leistung.<br />
Wir beglückwünschen Herrn Valent<strong>in</strong> für<br />
diese Auszeichnung.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
Namensgeber dieser Auszeichnung ist Theodor Rehbock (1864 bis 1950), dessen berufliches Wirken vor allem darauf<br />
ausgerichtet war, die Wasserbauforschung und die Arbeit im Wasserbaulabor zur Lösung praktischer Aufgaben<br />
e<strong>in</strong>zusetzen.<br />
Theodor Rehbock – <strong>Wasserwirtschaft</strong>s- und Flussbaupionier:<br />
Der <strong>in</strong> Amsterdam geborene Theodor Rehbock (1864 bis 1950) studierte Wasserbau an den Technischen Hochschulen<br />
<strong>in</strong> München und Berl<strong>in</strong>. Anschließend erwarb er wichtige praktische Erfahrungen während se<strong>in</strong>er langjährigen Tätigkeit<br />
als Wasserbau<strong>in</strong>genieur im In- und Ausland. Im Jahr 1899 wurde Theodor Rehbock an den Lehrstuhl für Wasserbau<br />
der Technischen Hochschule Karlsruhe berufen. Auf se<strong>in</strong>e Initiative geht die Gründung des ersten Karlsruher Flussbaulaboratoriums<br />
im Jahr 1901 zurück, welches er bis 1934 leitete. Theodor Rehbock g<strong>in</strong>g es <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em beruflichen<br />
Wirken vor allem darum, die Wasserbauforschung und die Arbeit im Wasserbaulabor zur Lösung praktischer Aufgaben<br />
e<strong>in</strong>zusetzen. Ihm zu Ehren trägt die Versuchsanstalt für Wasserbau der Universität Karlsruhe den Namen „Theodor-<br />
Rehbock-Laboratorium“.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008
DWA zeichnet Hartmut Kaunz<strong>in</strong>ger mit ihrer Ehrennadel aus<br />
Die Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für <strong>Wasserwirtschaft</strong>,<br />
Abwasser und Abfall e. V.<br />
(DWA) ehrt im Rahmen der Bundestagung<br />
und Landesverbandstagung<br />
Sachsen/Thür<strong>in</strong>gen am 21. Juni 2007<br />
<strong>in</strong> Gera Baudirektor Dipl.-Ing. Hartmut<br />
Kaunz<strong>in</strong>ger (61) mit der Ehrennadel.<br />
Er wird ausgezeichnet aufgrund se<strong>in</strong>es<br />
langjährigen Engagements für die Belange<br />
der Aus-, Fort- und Weiterbildung<br />
<strong>in</strong> der <strong>Wasserwirtschaft</strong>.<br />
Hartmut Kaunz<strong>in</strong>ger, geboren am 21.<br />
August 1945 <strong>in</strong> Würzburg, studierte<br />
Bau<strong>in</strong>genieurwesen an der Technischen<br />
Universität München. Von 1970 bis 1972<br />
absolvierte er die Baureferendarausbildung<br />
bei der Obersten Wasserbehörde<br />
München, Fachgebiet Wasserbau und<br />
Wasserkraft. 1973 arbeitete Kaunz<strong>in</strong>ger<br />
bei der Abteilung <strong>Wasserwirtschaft</strong> der<br />
Regierung von Oberbayern, bevor er als<br />
Abteilungsleiter zum <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt<br />
Würzburg wechselte. Zwischen<br />
1979 und 1989 war Kaunz<strong>in</strong>ger <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Referaten der Obersten<br />
Baubehörde im Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
des Innern tätig, zudem war er<br />
während dieser Zeit <strong>in</strong> den Jahren 1985<br />
und 1986 Geschäftsführer der Länderarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Wasser (LAWA).<br />
Von Juni 1989 bis Juli 2005 arbeitete er<br />
als Sachgebietsleiter des Bereichs „Aus-<br />
und Fortbildung allgeme<strong>in</strong> und <strong>in</strong> der<br />
Ver- und Entsorgung“ im Bayerischen<br />
Landesamt für <strong>Wasserwirtschaft</strong>, später<br />
„Aus- und Fortbildung und Internationale<br />
Zusammenarbeit“. Seit August 2005<br />
nimmt er diese Funktion beim Bayerischen<br />
Landesamt für <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
wahr. Hartmut Kaunz<strong>in</strong>ger ist seit mehr<br />
als drei Jahrzehnten ehrenamtlich <strong>in</strong><br />
Personalnachrichten<br />
DWA-Präsident Otto Schaaf (rechts im Bild) bei der Verleihung der DWA-Ehrennadel<br />
an Herrn Hartmut Kaunz<strong>in</strong>ger<br />
der <strong>Wasserwirtschaft</strong> aktiv. Se<strong>in</strong> Engagement<br />
begann 1974 bei Kuratorium für<br />
Kulturbauwesen (KfK) und fand 1981<br />
se<strong>in</strong>e Fortsetzung <strong>in</strong> der „Ständigen<br />
Kommission für Berufsvor- und Fortbildung“<br />
beim Deutschen Verband für <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />
und Kulturbau (DVWK).<br />
Dort war er ab 1990 Obmann, nach der<br />
Fusion von ATV (Abwassertechnische<br />
Drei <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler <strong>in</strong>s Bürgermeisteramt gewählt<br />
Bei der letzten Kommunalwahl am 2.<br />
März 2008 wurden drei <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler<br />
zu hauptamtlichen ersten Bürgermeistern<br />
gewählt.<br />
Dr. Paul Kruck, Leiter des WWA Bad<br />
Kiss<strong>in</strong>gen, ist neuer Bürgermeister der<br />
Kreisstadt Karlstadt am Ma<strong>in</strong> (15.200<br />
E<strong>in</strong>wohner), Landkreis Ma<strong>in</strong>-Spessart.<br />
Trotz drei weiteren Kandidaten hat Dr.<br />
Kruck, der seit 11 Jahren <strong>in</strong> Karlstadt<br />
wohnt, <strong>in</strong> der Stichwahl am 16.3.08 die<br />
Wahl gewonnen.<br />
Zum Bürgermeister von Berchtesgaden<br />
(7.700 E<strong>in</strong>wohner) wurde Dipl.-Ing. Franz<br />
Rasp, Abteilungsleiter für den Landkreis<br />
Traunste<strong>in</strong> am WWA Traunste<strong>in</strong>, gewählt.<br />
Er hat sich im ersten Wahlgang gegen<br />
den amtierenden Bürgermeister und e<strong>in</strong>en<br />
weiteren Kandidaten durchgesetzt.<br />
In Immenstadt im Allgäu (14.000 E<strong>in</strong>wohner),<br />
Landkreis Oberallgäu übernimmt<br />
Dipl.-Ing. Arm<strong>in</strong> Schaupp, Abteilungsleiter<br />
für Neubau am WWA Kempten das<br />
Bürgermeisteramt.<br />
Vere<strong>in</strong>igung) und DVWK übernahm<br />
er das Amt auch dort. Noch heute ist<br />
er stellvertretender Vorsitzender des<br />
DWA-Hauptausschusses „Bildung und<br />
Internationale Zusammenarbeit“.<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
Wir beglückwünschen die <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler<br />
zu Ihrer Wahl als hauptamtliche<br />
Bürgermeister, wünschen Ihnen alles<br />
Gute und viel Erfolg <strong>in</strong> ihrem zukünftigen<br />
Wirkungsbereich.<br />
Richard Oberhauser<br />
WWA Hof<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
55
����������������<br />
��� �����������������������<br />
��� �����������������<br />
������ � ������� � �����������<br />
��� ������ ��� ������ ��������<br />
�������������������� ������� ��������<br />
��������� ��������������������<br />
��������������� ����<br />
���� ������ ��� �������� �������<br />
������ ���� ��������� ���������<br />
�������������������������<br />
���� ������� ��� �����������������<br />
����<br />
������ ����������� �� � ����� �������<br />
���� ������������� ���� ���� �������<br />
������������������������������<br />
Thermostatschränke für BSB,<br />
Mikrobiologie, Klärwerke, Institute<br />
und Universitäten, Inkubatoren,<br />
Wärmeschränke von<br />
56-1365 Liter.<br />
Alle Geräte mit RS 232 Schnittstelle<br />
für GLP-konforme Datenerfassung,<br />
optional Ethernet/<br />
Internetfähig für externe Überwachung,<br />
oder Steuerung, passwortgeschützt<br />
und Adm<strong>in</strong>istratorfunktion.<br />
NEW<br />
STL is a Division of the SHL Company<br />
L<strong>in</strong>denstraße 20 · D-74382 Neckarwestheim<br />
Phone: +49 7133/2068-0 · Fax: +49 7133/2068-18<br />
Mail: sales@stl-e.com · Web: www.stl-e.com Service · Trade · Laboratory Equipment<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
57<br />
Fordern sie Unterlagen<br />
an, oder vere<strong>in</strong>baren sie<br />
e<strong>in</strong>en unverb<strong>in</strong>dlichen<br />
Besuch bei ihnen vor<br />
Ort.
58<br />
��������������������������<br />
��������������������������������<br />
������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������� ���������������������<br />
����������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������<br />
��������������������������<br />
��������������������������������� �������������<br />
������������������������������������������������<br />
�������������������������<br />
�������� �������������������������������������<br />
�������� ����������������������������������������������<br />
������� ������������������������������������������ ���������<br />
�������������������������������������������<br />
���������������������<br />
�����������������������������������<br />
�������� ����� �� �������������������� �� �� ��<br />
�������� ��������������������������������<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />
�����������������������������
Hocheffiziente Tauchrührwerke.<br />
Made by Wilo.<br />
Bis zu 10% Energiekostene<strong>in</strong>sparung.<br />
Neueste Generation.<br />
Wilo-EMU Megaprop TR 326.<br />
Wilo präsentiert se<strong>in</strong>e neueste und effizienteste Rührwerksgeneration. Dank <strong>in</strong>novativer<br />
Flügelform und Propellerdurchmesser von 2,60 m erreichen unsere langsam laufenden<br />
Rührwerke beste Schubwerte bei günstigster Leistungsziffer (ISO 21630). Die Schubleistungsziffer<br />
erlaubt Ihnen erstmalig den objektiven Vergleich mit gleichwertigen Tauchmotorrührwerken.<br />
Das Ergebnis: bis zu 10% ger<strong>in</strong>gere Energiekosten. E<strong>in</strong>e Umrüstung amortisiert sich<br />
so <strong>in</strong>nerhalb kürzester Zeit. Extrem belastbare e<strong>in</strong>teilige GFK-Lam<strong>in</strong>atflügel gewährleisten<br />
längste E<strong>in</strong>satzdauer bei m<strong>in</strong>imalen Wartungskosten.<br />
Megastark? Wir nennen das Pumpen Intelligenz.<br />
www.wilo.de
60<br />
DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008