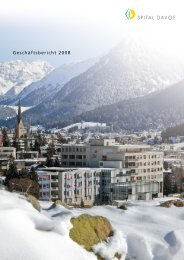Geschichte(n) von Menschen und Medizin - Spital Davos
Geschichte(n) von Menschen und Medizin - Spital Davos
Geschichte(n) von Menschen und Medizin - Spital Davos
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Geschichte</strong>(n) <strong>von</strong> <strong>Menschen</strong> <strong>und</strong> <strong>Medizin</strong><br />
Meilensteine aus 120 Jahren <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>
2<br />
Vorworte: Zum Glück gibt es das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>!<br />
Regierungsrat Dr. Martin Schmid 3<br />
Landrat Dr. Andrea Meisser 5<br />
<strong>Davos</strong> zur Zeit der <strong>Spital</strong>gründung 7<br />
Blick in die Bündner <strong>Spital</strong>landschaft <strong>von</strong> einst 8 – 9<br />
Meilensteine der <strong>Spital</strong>geschichte: Die ersten 100 Jahre 10 – 15<br />
Meilensteine der <strong>Spital</strong>geschichte: Die Jahre 1989–2007 16 – 22<br />
Prägende Köpfe am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
1. Die Chefärzte <strong>und</strong> Verwalter 24<br />
2. Die Abteilungs-Chefärzte 25<br />
3. Die leitenden Spezialärzte 26<br />
4. Die Oberschwestern 27<br />
<strong>Spital</strong>medizin im Wandel<br />
Prof. Dr. med. Peter Matter 29 – 32<br />
Dr. med. Peter Holzach 33 – 35<br />
Dr. med. Christian Ryf 36 – 38<br />
Neue Zeiten, neue Führung<br />
Im Gespräch: Direktor Markus Hehli 40 – 42<br />
Organigramm 44 – 45<br />
Investionen einst <strong>und</strong> jetzt<br />
Infrastruktur <strong>und</strong> medizinische Geräte 46 – 47<br />
Quantensprung in die Zukunft 48 – 49<br />
Herzstücke des <strong>Spital</strong>s<br />
Unverzichtbar: Die Innere <strong>Medizin</strong> 51 – 54<br />
Undenkbar: Ein <strong>Spital</strong> ohne Pflegedienst 55 – 57<br />
Der Um- <strong>und</strong> Neubau des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> 2003–2008<br />
1. Politische Vorgeschichte <strong>und</strong> Entscheide 59 – 61<br />
2. Jährliche Realisierungsetappen 62 – 67<br />
Zum Glück gibt es das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>! 69 – 74
120 Jahre <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> –<br />
«Zum Glück gibt es das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>!»<br />
Liebe <strong>Davos</strong>erinnen <strong>und</strong> <strong>Davos</strong>er, liebe Gäste<br />
Im Namen der Regierung des Kantons Graubünden gratuliere<br />
ich dem <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> zum Abschluss der Gesamtsanierung<br />
<strong>und</strong> zu seinem 120. Geburtstag ganz herzlich.<br />
Die <strong>Geschichte</strong> des <strong>Spital</strong>s ist eng mit der Entwicklung der<br />
Landschaft <strong>Davos</strong> verb<strong>und</strong>en. Der Aufschwung <strong>von</strong> <strong>Davos</strong><br />
begann 1865 mit der Entdeckung <strong>von</strong> Landschaftsarzt Alexander<br />
Spengler <strong>und</strong> der Entdeckung der heilenden Wirkung<br />
des Höhenklimas gegen die Tuberkulose. Die Blütezeit<br />
<strong>von</strong> <strong>Davos</strong> als Tuberkulosekurort endete 1944 mit der Erfindung<br />
des Antibiotikums Streptomycin. In der Folge etablierten<br />
sich in <strong>Davos</strong> aufgr<strong>und</strong> des reizarmen Klimas ausländische<br />
<strong>und</strong> schweizerische Kliniken, die sich auf Asthma<strong>und</strong><br />
Hauterkrankungen spezialisierten. Bekannter ist die<br />
jüngste <strong>Geschichte</strong>. Der <strong>Spital</strong>- <strong>und</strong> Klinikplatz <strong>Davos</strong> hat in<br />
den letzten Jahren in einem hart umkämpften Ges<strong>und</strong>heitsmarkt<br />
immer mehr an Substanz verloren.<br />
Um dieser Abwärtsspirale <strong>und</strong> den damit verb<strong>und</strong>enen negativen<br />
volkswirtschaftlichen Auswirkungen entgegenzutreten,<br />
ist seitens der Ges<strong>und</strong>heitsbetriebe eine stete Weiterentwicklung<br />
gefragt. Es verbessert sich nicht nur die<br />
<strong>Medizin</strong>, sondern es ändern sich auch die Bedürfnisse der<br />
Patientinnen <strong>und</strong> Patienten. Das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> scheint auf<br />
dem besten Weg zu sein, diese Herausforderungen erfolg-<br />
reich zu meistern. Die Verantwortlichen der Landschaft<br />
<strong>Davos</strong> haben schon vor Jahren den Handlungsbedarf erkannt<br />
<strong>und</strong>, nachdem 1999 eine Studie über den Sanierungsbedarf<br />
des <strong>Spital</strong>s erstellt wurde, konnte am 13. April<br />
2004 der Spatenstich erfolgen. Nach nunmehr r<strong>und</strong> vierjähriger<br />
Bauzeit kann der ersehnte Erweiterungsbau offiziell<br />
in Betrieb genommen werden.<br />
Ich bin überzeugt, dass das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> mit der zur Verfügung<br />
stehenden Infrastruktur, dem medizinischen Knowhow<br />
<strong>und</strong> dem kompetenten <strong>und</strong> einsatzfreudigen Personal<br />
bestens für die Zukunft <strong>und</strong> die Bedürfnisse unserer Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> Gäste gerüstet ist. Um Innovationen umsetzen<br />
<strong>und</strong> neue Angebote bereitstellen zu können, muss neben<br />
kompetentem <strong>und</strong> einsatzfreudigem Personal auch eine<br />
zeitgemässe Infrastruktur vorhanden sein. Die getätigten<br />
Investitionen ins <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> sind zudem ein klares Bekenntnis<br />
zu einem starken Ges<strong>und</strong>heitsplatz <strong>Davos</strong>, dessen<br />
Entwicklung aus ges<strong>und</strong>heitspolitischer <strong>und</strong> volkswirtschaftlicher<br />
Sicht auch für den Kanton Graubünden <strong>von</strong> Bedeutung<br />
ist. In jedem Fall aber werden die Patientinnen <strong>und</strong><br />
Patienten <strong>von</strong> der erneuerten Infrastruktur des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong><br />
profitieren, was auch das Hauptziel darstellt.<br />
Regierungsrat<br />
Dr. Martin Schmid<br />
3
Zum Glück gibt es das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>!<br />
Die wegweisende Entscheidung zur Gründung unseres <strong>Spital</strong>s<br />
stellte vor 120 Jahren einen wohl f<strong>und</strong>amentalen Meilenstein<br />
zur erfolgreichen Entwicklung <strong>von</strong> <strong>Davos</strong> dar.<br />
Wir wissen heute nicht, wie der Ges<strong>und</strong>heitsplatz <strong>Davos</strong><br />
ohne <strong>Spital</strong> ausgesehen hätte. Wir können auch nicht so<br />
genau abschätzen, wie attraktiv sich <strong>Davos</strong> ohne <strong>Spital</strong> als<br />
Wohnort für die einheimische Bevölkerung <strong>und</strong> die zahlreichen,<br />
am Aufbau unserer Ferien- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsdestination<br />
beteiligten Neuzuzüger präsentiert hätte. Aber schliesslich<br />
brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen, was<br />
gewesen wäre, wenn vor 120 Jahren anders entschieden<br />
worden wäre, denn: Zum Glück gibt es das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>!<br />
Im Zuge der primär aus Kostengründen notwendig gewordenen<br />
Restrukturierung der schweizerischen Ges<strong>und</strong>heitslandschaft<br />
ist ein eigenes <strong>Spital</strong> für eine vergleichsweise<br />
kleine Gemeinde wie <strong>Davos</strong> heute keineswegs mehr als<br />
Selbstverständlichkeit zu betrachten. Umso höher ist die Bereitschaft<br />
des Kantons Graubünden einzuschätzen, uns als<br />
starker Partner tatkräftig zu unterstützen. Und als ebenso<br />
zukunftsgerichtet wie der Entscheid zur Gründung vor 120<br />
Jahren ist der 2003 erteilte unmissverständliche Auftrag der<br />
<strong>Davos</strong>er Stimmberechtigten zum Neubau eines Personalhauses<br />
<strong>und</strong> zur Sanierung <strong>und</strong> Erweiterung des <strong>Spital</strong>s zu<br />
gewichten: Der Ges<strong>und</strong>heitsplatz <strong>Davos</strong> braucht mehr denn<br />
je ein attraktives <strong>Spital</strong> als Zentrum mit einem breitgefächerten<br />
Angebot an hochstehenden medizinischen Leistungen.<br />
Es ist unverzichtbar für eine hohe Lebensqualität in unserer<br />
Gemeinde, als Gewähr für die Aufrechterhaltung bedeutender<br />
Kongresse, als Sicherheit für unsere zunehmend auf<br />
Ges<strong>und</strong>heit bedachten Gäste <strong>und</strong> nicht zuletzt als umfassender<br />
lokaler Dienstleistungsanbieter für unsere zahlreichen<br />
im medizinischen <strong>und</strong> paramedizinischen Bereich tätigen<br />
Personen, Organisationen <strong>und</strong> Institutionen.<br />
Unser <strong>Spital</strong> hat in seiner 120-jährigen <strong>Geschichte</strong> eine<br />
enorme Entwicklung erfahren. Die Ansprüche <strong>von</strong> aussen<br />
<strong>und</strong> das innere Bedürfnis, zu den Besten zu gehören, lösen<br />
eine kontinuierliche Anpassung an den steten Wandel in unserer<br />
Gesellschaft, an die aktuellen Erkenntnisse der medizinischen<br />
Forschung oder auch an die technologischen<br />
Neuerungen aus. Mit dem Abschluss der umfassenden Sanierung,<br />
Erneuerung <strong>und</strong> Erweiterung gerade rechtzeitig zu<br />
den Jubiläumsfeierlichkeiten verfügen wir über ein modernes,<br />
dem heutigen Stand der Erkenntnisse entsprechendes<br />
<strong>und</strong> nicht zuletzt auch schönes <strong>und</strong> einladendes <strong>Spital</strong>. Für<br />
unsere Patientinnen <strong>und</strong> Patienten <strong>und</strong> ihre Besucherinnen<br />
<strong>und</strong> Besucher, aber auch als qualitativ hochstehender <strong>und</strong><br />
angenehmer Arbeitsplatz für unsere über 300 Mitarbeitenden.<br />
Sie sind es letztlich, die durch ihren unermüdlichen Einsatz<br />
<strong>und</strong> ihr grosses Können für das Wohl der ihnen anvertrauten<br />
in der Ges<strong>und</strong>heit beeinträchtigten Mitmenschen<br />
die Verantwortung tragen.<br />
Dr. Andrea Meisser<br />
Präsident der Bau- <strong>und</strong> <strong>Spital</strong>kommission<br />
5
<strong>Davos</strong> zur Zeit der <strong>Spital</strong>gründung 1888<br />
1865<br />
<strong>Davos</strong> wird Höhenkurort. Die Einwohnerzahl liegt bei 1700<br />
Personen.<br />
1871<br />
Der Kurverein wird gegründet. Die Landschaft <strong>Davos</strong> Gemeinde<br />
schafft die gesetzlichen Rahmenbedingungen,<br />
damit aus dem Siedlungsraum der Walser Bauern der «Weltkurort<br />
im Gebirge» entstehen kann.<br />
1888<br />
<strong>Davos</strong> hat bereits 3891 Einwohner.<br />
In den Wintermonaten logieren 1`356 Gäste in Sanatorien<br />
<strong>und</strong> Fremdenzimmern. Hauptsaison ist jedoch der Sommer.<br />
Aufs ganze Jahr 1888 gesehen, weist das Dokumentenbuch<br />
des Kurvereins folgende Gästezahlen aus:<br />
1931 Deutsche<br />
1415 Engländer<br />
1674 Schweizer<br />
342 Holländer<br />
306 Franzosen <strong>und</strong> Belgier<br />
142 Amerikaner<br />
152 Russen<br />
246 Andere Nationen<br />
Total 6208 Gäste<br />
Wiesen<br />
Um 1890<br />
In der Landschaft <strong>Davos</strong> stehen 1690 Fremdenzimmer mit<br />
2038 Betten zur Verfügung. Das Gästetotal steigt auf<br />
10 167 Personen, da<strong>von</strong> sind r<strong>und</strong> 38 Prozent Schweizer,<br />
knapp 27 Prozent Deutsche <strong>und</strong> 17 Prozent Engländer. Die<br />
RhB-Linie Landquart-<strong>Davos</strong> ist vollendet. Initiant: Der<br />
holländische Pionier Willem Jan Holsboer.<br />
Pro memoria:<br />
Um 1906 gabs in <strong>Davos</strong> nicht weniger als 14 Sanatorien mit<br />
900 Betten!<br />
Quellen:<br />
«Der Aufstieg <strong>von</strong> <strong>Davos</strong>», Jules Ferdmann<br />
«100 Jahre Krankenhaus / <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>», Kaspar Jörger<br />
«<strong>Davos</strong> <strong>von</strong> A bis Z», Kaspar Jörger / Helga Ferdmann<br />
Glaris<br />
Monstein<br />
Platz<br />
Dorf<br />
Frauenkirch<br />
7
8<br />
Die Bündner <strong>Spital</strong>landschaft <strong>von</strong> einst<br />
1853<br />
Eröffnung des Churer Kreuzspitals im Gäuggeliquartier. Initiant<br />
ist der Kapuziner <strong>und</strong> Churer Stadtpfarrer Theodosius.<br />
1868<br />
Das <strong>Spital</strong> Ilanz wird als Privatspital eröffnet. Treibende Kraft:<br />
Pater Dr. Gion Fidel Depuoz. 1888 wird das Krankenhaus<br />
Gemeindespital.<br />
1881<br />
Am 10. Juli 1881 nimmt das Prättigauer Krankenhaus<br />
Schiers den Betrieb auf. Aus eigenen Mitteln liess es der damals<br />
75-jährige Pfarrer Peter Flury, Gründer der Evangelischen<br />
Mittelschule Schiers, erbauen.<br />
1888<br />
Eröffnung des Krankenhauses <strong>Davos</strong> nach 16-jähriger Sammeltätigkeit<br />
durch den <strong>Davos</strong>er Krankenverein (Gründung<br />
1872). Das Startkapital lag bei r<strong>und</strong> 57 000 Franken.<br />
1895<br />
Am 27. Mai 1895 nimmt das <strong>Spital</strong> Oberengadin in Samedan<br />
auf einem <strong>von</strong> Nationalrat A. R. <strong>von</strong> Planta geschenkten<br />
Bauplatz <strong>und</strong> mit einem Baufonds <strong>von</strong> 140 000 Franken<br />
den Betrieb auf.<br />
1908<br />
1908 wird die Stiftung Ospedale Engiadina Bassa gegründet.<br />
Sie bezweckt den Bau eines Insolierhauses für Infek -<br />
tionskrankheiten. Daraus entsteht ein <strong>Spital</strong> mit 20 Betten.<br />
1912<br />
Am 1. November 1911 wird das neue Krankenhaus Thusis<br />
mit Absonderungshaus zu Kosten <strong>von</strong> 156 000 Franken in<br />
Betrieb genommen.<br />
1913<br />
Das provisorische Ospedale Poschiavo wird mit 15 Betten in<br />
der Liegenschaft «La Rasiga» eröffnet. 1927–1929 wird ein<br />
neues 60-Betten-<strong>Spital</strong> erstellt.<br />
1930<br />
1930 wird das <strong>Spital</strong> Savognin in einer Liegenschaft eröffnet,<br />
die dank der Stiftung des Savogniner Hoteliers Alfons<br />
Pianta aus dem Jahr 1924 hatte erworben werden können.<br />
1934<br />
1934 kann schliesslich auch das Ospidal Müstair eröffnet<br />
werden. 15 Jahre zuvor, im Jahr 1919, hatten die Frauen<br />
<strong>von</strong> Sta. Maria einen Fonds mit einer Ersteinlage <strong>von</strong> 300<br />
Franken für ein <strong>Spital</strong> gestiftet. Bis 1936 wuchs er auf<br />
15 000 Franken an.
1941<br />
Am 14. April 1941, mitten im 2. Weltkrieg, wird das Rätische<br />
Kantonsspital Chur nach zweijähriger Bauzeit <strong>und</strong> einer<br />
ungewöhnlich langen Vorgeschichte eingeweiht.<br />
Bereits gut 100 Jahre früher, im Jahr 1840, hatte nämlich<br />
der in Bergamo lebende Bündner Johann Peter Hosang sein<br />
ganzes Vermögen zum Bau eines Kantonsspitals seinem Heimatkanton<br />
vermacht. Doch erst im Jahr 1909 diskutierte die<br />
Sanitätskommission erneut über das Projekt Kantonsspital.<br />
Der Kleine <strong>und</strong> der Grosse Rat lehnten jedoch ab.<br />
Zwischen 1912 <strong>und</strong> 1915 machten zwei gut betuchte Männer<br />
einen neuen Anlauf: Hermann Peter Herold stiftete das<br />
Gut Arlibon mit seinen knapp 58 000 Quadratmetern Fläche<br />
für den Churer Krankenhausneubau. Sein in Alexandrien lebender<br />
Schulfre<strong>und</strong> Anton Cadonau machte eine Spende<br />
<strong>von</strong> 1,5 Mio. Franken. Andere taten es ihm gleich.<br />
Doch bis zur definitiven Unterzeichnung der<br />
Stiftungsurk<strong>und</strong>e am 3. April 1937 vergingen<br />
nochmals gut 20 Jahre.<br />
Ilanz<br />
Thusis<br />
Chur<br />
Savognin<br />
Schiers<br />
<strong>Davos</strong><br />
Samedan<br />
Poschiavo<br />
Scuol<br />
Sta. Maria<br />
9
10<br />
Meilensteine der <strong>Spital</strong>geschichte: Die ersten 100 Jahre<br />
Quelle: Festschrift Dr. Kaspar Jörger «100 Jahre Krankenhaus / <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>»<br />
1872<br />
Gründung eines Krankenvereins<br />
1872 gründen Einheimische <strong>und</strong> in <strong>Davos</strong> Niedergelassene<br />
einen Krankenverein, Vorläufer der heutigen Krankenkassen.<br />
Damit will man kranken oder arbeitsunfähig gewordenen<br />
Mitgliedern helfen.<br />
Seele des Vereins ist Dr. Wilhelm Beeli (1843 – 1900), Allgemeinpraktiker,<br />
Landammann <strong>von</strong> <strong>Davos</strong> (1875 – 1877) <strong>und</strong><br />
Mitglied des Bündner Grossen Rates, verheiratet mit Maria<br />
Elisabeth Bavier aus Chur <strong>und</strong> Vater <strong>von</strong> 5 Kindern.<br />
1887<br />
Ein Bravo der «löblichen Commission» <strong>von</strong> <strong>Davos</strong><br />
Auf Gesuch des Krankenvereins beantragt die «löbliche Commission»<br />
mit Amtslandammann Hans Taverna, Major Johann<br />
Peter Stiffler <strong>und</strong> Landammann Paul Müller der <strong>Davos</strong>er Landsgemeinde<br />
einen Zuschuss <strong>von</strong> Fr. 4000.– aus der Landschaftskasse<br />
fürs geplante Krankenhaus. Die Commission macht verschiedene<br />
Auflagen. Verlangt wird unter anderem auch eine<br />
erstaunliche Statutenänderung: Weibliche Taglöhner <strong>und</strong> Dienst-<br />
boten sollen ebenfalls in den Verein aufgenommen werden!<br />
Die Landsgemeinde bewilligt das Kreditbegehren am 30. Juni<br />
1887.<br />
1888<br />
Das erste <strong>Davos</strong>er Krankenhaus steht<br />
Innert 15 Jahren bringt der Krankenverein aus Spenden <strong>und</strong><br />
Jahresbeiträgen 15 000 Franken zusammen <strong>und</strong> kann endlich<br />
bauen. Ende 1888 wird das erste <strong>Davos</strong>er Krankenhaus<br />
mit 15 Zimmern bezogen. Durch Sammlungen <strong>und</strong> Bazare<br />
stottert der Verein seine Schulden <strong>von</strong> 42 000 Franken ab.<br />
Erster <strong>Spital</strong>arzt wird Dr. Wilhelm Beeli.<br />
1895<br />
Zweiter Streich: Ein Absonderungshaus<br />
Neben dem Krankenhaus plant der Krankenverein ein Absonderungshaus<br />
für akute Infektionskrankheiten. Im Komitee<br />
sitzen Dr. Oswald Peter, Dr. Wilhelm Beeli <strong>und</strong> Dr. Luzius<br />
Spengler. Berater sind Baumeister Gaudenz Issler <strong>und</strong> Wil-
lem Jan Holsboer. Das Bauland <strong>von</strong> Metzger Kaspar Buol<br />
kostet 20 Franken pro Klafter (3,4 Quadratmeter)…<br />
1906<br />
Notfalldienst im Fuhrwerk<br />
Die Landschaft <strong>Davos</strong> Gemeinde stellt keinen Landschaftsarzt<br />
mehr an. Sämtliche <strong>Davos</strong>er Ärzte verpflichten sich vertraglich<br />
zum Notfalldienst r<strong>und</strong> um die Uhr. Die Kosten für<br />
Arztbesuche per Fuhrwerk übernimmt die Landschaft <strong>Davos</strong><br />
gemäss speziellem Transporttarif.<br />
1907<br />
Gemeinde übernimmt Kranken- <strong>und</strong> Absonderungshaus<br />
Im Jahr 1907 bekommen Kranken- <strong>und</strong> Absonderungshaus<br />
eine neue Trägerschaft: Sie werden Eigentum der politischen<br />
Gemeinde <strong>und</strong> Landschaft <strong>Davos</strong>.<br />
Die «Organisation des Gemeindekrankenhauses» tritt am<br />
1. Januar 1907 in Kraft. Zwecks Verwaltung des Krankenhauses<br />
wählt die Obrigkeit der Landschaft <strong>Davos</strong> Gemeinde<br />
eine 7-köpfige <strong>Spital</strong>kommission mit zweijähriger Amtszeit.<br />
Gemeinsam mit dem <strong>Spital</strong>arzt zwecks Verwaltung des<br />
Krankenhauses legt dieses Gremium auch die jährliche Speiseordnung<br />
fest!<br />
1907<br />
Die guten Geister vom Dänlikerhaus<br />
Erster Präsident der <strong>Spital</strong>kommission ist Pfarrer Hans<br />
Accola. Die Krankenschwestern vom Roten Kreuz aus dem<br />
Dänlikerhaus in Bern übernehmen gemäss Vertrag mit der<br />
<strong>Spital</strong>kommission die Krankenpflege in <strong>Davos</strong>. Der Lohn der<br />
Oberschwester liegt bei 500 Franken pro Jahr, nebst einer<br />
Reiseentschädigung <strong>von</strong> 50 Franken. Das Schwesternsalär<br />
beträgt 450 Franken.<br />
1910/1912<br />
Schon wieder Platznöte<br />
Im 22-jährigen <strong>Spital</strong> wirds eng. Man diskutiert eine Verlegung,<br />
weg vom nahen Friedhof. Am 28. April 1910 beschliesst<br />
die Landsgemeinde einen Kredit <strong>von</strong> 278000 Franken<br />
für Bauland südlich des <strong>Spital</strong>s <strong>und</strong> ein neues Abson derungshaus,<br />
das 1910 / 11 erstellt ist. Noch kann das <strong>Spital</strong><br />
selbst aus finanziellen Gründen nicht erneuert werden – ein<br />
Kündigungsgr<strong>und</strong> für <strong>Spital</strong>arzt Dr. Benedikt Meisser. Doch<br />
auch Nachfolger Dr. med. Paul Schreiber aus Thusis plädiert<br />
für einen Neubau.<br />
1913/1914<br />
Ein Sprung nach vorn<br />
Am 6. April 1913 stimmt die <strong>Davos</strong>er Landsgemeinde dem<br />
<strong>Spital</strong>neubau zu. Kostenvoranschlag: 600 000 Franken.<br />
Ende Dezember 1914 wird das «so ziemlich fertige» 90-Betten-<strong>Spital</strong><br />
bezogen. «Es zählt jedenfalls zu den besteingerichteten<br />
Spitälern der Neuzeit», schreibt Landschreiber<br />
Georg Sprecher stolz ins Protokoll.<br />
11
12<br />
1915/1916<br />
Das waren noch Zeiten!<br />
Im Betriebsjahr 1915 /16 erwirtschaftet das <strong>Spital</strong> 91130.99<br />
Franken. Der Aufwand beträgt 86 898.96 Franken. Haupterlös:<br />
75 390.25 Franken aus Verpflegungsgeldern, grösster<br />
Ausgabenposten: Allgemeine Betriebsauslagen für Küche<br />
<strong>und</strong> Keller <strong>von</strong> 45 232.16. Franken. Die Löhne für <strong>Spital</strong>arzt,<br />
Schwestern, Angestellte <strong>und</strong> die Verwaltung belaufen sich<br />
auf nur gerade 20 295.55 Franken. Der Jahresgewinn beträgt<br />
4223.03 Franken.<br />
1921<br />
Bescheidene Verhältnisse<br />
1921 arbeiten zwei Ärzte <strong>und</strong> 29 Angestellte am Krankenhaus<br />
<strong>Davos</strong>, 13 in der Krankenpflege, 16 im Haushalt. Die<br />
Bruttoeinnahmen pro Tag liegen bei 11.62 Franken.<br />
1930/1931<br />
Es wird wieder gebaut<br />
Nach nur 10-jährigem Betrieb fehlen dem <strong>Spital</strong> Privat- <strong>und</strong><br />
Einzelzimmer <strong>und</strong> eine moderne Küche. Gekocht wurde<br />
immer im Absonderungshaus. Das alte Absonderungshaus<br />
wird im August 1924 abgebrochen.<br />
Der Kredit für die <strong>Spital</strong>sanierung <strong>und</strong> -erweiterung <strong>von</strong><br />
500 000 Franken ist umstritten, wird im Dezember 1928<br />
aber knapp angenommen. 1929 /30 wird gebaut, 1930 hat<br />
das <strong>Davos</strong>er Krankenhaus 11 neue Zimmer, eine neue Kü-<br />
che <strong>und</strong> ein Flach- statt eines Walmdachs. Man ist sich einig:<br />
«Das <strong>Davos</strong>er <strong>Spital</strong> steht an erster Stelle im Kanton.»<br />
Patientenfrequenzen 1931<br />
1. <strong>und</strong> 2. Klasse 240 Patienten <strong>und</strong> 18 Begleiter<br />
Allgemein 708 Personen<br />
Total 966 Personen / 20 165 Pflegetage<br />
1938/1939<br />
Wachsende Sorgen<br />
1938 sinken die Pflegetage auf 15 397, die Unterhaltskosten<br />
an Kranken- <strong>und</strong> Absonderungshaus steigen unaufhaltsam.<br />
<strong>Spital</strong>arzt Dr. med. Hermann Schuppisser, seit 1937<br />
im Amt, kommt in der Bevölkerung nicht an. Frakturen werden<br />
immer häufiger <strong>von</strong> Ärzten ausserhalb des Krankenhauses<br />
behandelt.<br />
1939, nach der Mobilmachung, wird das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> militärisch<br />
ein «Grenzspital», will heissen: Militärpatienten bleiben<br />
nur so lange hier, bis sie transportfähig sind.<br />
1941<br />
Düstere Kriegszeiten<br />
1941 wählt der Grosse Landrat unter 24 Bewerbern Dr. med.<br />
Franz Jakob zum Nachfolger <strong>von</strong> <strong>Spital</strong>arzt Schuppisser.<br />
Alles wird teurer: Bäcker, Metzger, Fuhrkosten, Heizmaterial.<br />
Strom ist rationiert, das Gas soll ganz versiegen. Zur
«Hebung der Finanzen» wird eine hydrotherapeutische Anlage<br />
im <strong>Spital</strong>keller installiert. Die Krankenkasse ÖKK bezeichnet<br />
die Röntgenkosten des <strong>Spital</strong>s als eine «ins Untragbare<br />
gestiegene Belastung». 1942 bewilligt die<br />
eidgenössische Preiskontrolle eine vom <strong>Davos</strong>er <strong>Spital</strong>verwalter<br />
beantragte Taxerhöhung um 10 Prozent.<br />
1951<br />
Schon wieder ein Bauprojekt<br />
126 000 Franken soll ein Erweiterungsbau mit Einzelzimmern<br />
für das Pflegepersonal kosten, wie das ein neuer Arbeitsvertrag<br />
vorsieht. Der <strong>Davos</strong>er Souverän nimmt das Kreditbegehren<br />
am 8. Juli 1951 klar an.<br />
1955/1956<br />
Ewiges Thema Platzmangel<br />
1955 wird Dr. med. Max Ziegler als beratender Internist angestellt<br />
– eine Novität. Die <strong>Spital</strong>frequenzen nehmen sehr<br />
stark zu. Im März 1956 stellt die Spitakommission grossen<br />
Platzmangel im <strong>Spital</strong> fest. Internist Ziegler bestätigt, dass<br />
zahlreiche Kranke, die eigentlich hospitalisiert werden müssten,<br />
in <strong>Davos</strong>er Hotels liegen.<br />
1957<br />
Verlegung oder Umbau?<br />
1957 wird mit der AG Parksanatorium (ehemals Turbansanatorium)<br />
über die Verlegung des <strong>Spital</strong>s auf ein Areal mit<br />
101 880 Quadratmetern Fläche verhandelt. Organisatorische<br />
Gründe sprechen dagegen. Ein Projekt für Um- <strong>und</strong><br />
Erweiterungsbauten in Höhe <strong>von</strong> 2,9 Mio. Franken wird <strong>von</strong><br />
der <strong>Spital</strong>kommission als «inakzeptabel» abgelehnt.<br />
1958–1960<br />
Umbauten allüberall<br />
Am 28. September 1958 bewilligt das <strong>Davos</strong>er Stimmvolk<br />
einen Kredit <strong>von</strong> 85 000 Franken für den Umbau der Gebär<strong>und</strong><br />
Säuglingsabteilung.<br />
Am 24. Mai 1959 wird ein weiterer Kredit <strong>von</strong> 388 000 Franken<br />
zur Sanierung <strong>von</strong> Sanitärinstallationen, Büro- <strong>und</strong> Ärzteräumen,<br />
<strong>von</strong> Labor <strong>und</strong> Signalanlage <strong>und</strong> Ähnlichem klar<br />
angenommen.<br />
1960 wird der Eingangs-, Verwaltungs- <strong>und</strong> Untersuchungstrakt<br />
renoviert <strong>und</strong> erweitert.<br />
1962<br />
Die Tübli-Schwestern kommen<br />
1962 kündigt das Berner Mutterhaus der Dänliker-Schwestern<br />
den Vertrag mit dem <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>. Abgelöst werden sie<br />
<strong>von</strong> 10 Tübli-Schwestern.<br />
1963<br />
Das nächste Bauvorhaben ist in Sicht<br />
Im Oktober 1963 bewilligt der <strong>Davos</strong>er Souverän einen Kredit<br />
<strong>von</strong> 1,2 Mio. Franken für den Bau eines Schwesternhauses.<br />
Das Absonderungshaus soll abgebrochen werden.<br />
13
14<br />
AO-Methode im Aufschwung, Skepsis beim Chefarzt<br />
Das Landschaftsprotokoll vom 7. Februar 1963 vermerkt,<br />
dass sich <strong>Spital</strong>chefarzt Franz Jakob nicht mit der neuen AO-<br />
Operationstechnik zur Frakturbehandlung anfre<strong>und</strong>en kann.<br />
Die <strong>Spital</strong>frequenzen sinken: Patienten aus dem Unterland<br />
wollen eben nach neuester Technik, heisst nach AO-Methoden,<br />
behandelt werden. Sie weigern sich deshalb, das<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> aufzusuchen.<br />
1965<br />
Erste Gynäkologin am <strong>Spital</strong><br />
Am 1. Juli 1965 wird Dr. Silvia Bono nebenamtliche Leiterin<br />
der Abteilung Geburtshilfe <strong>und</strong> Spezialärztin für Gynäkologie.<br />
Sie bleibt bis 1992 am <strong>Spital</strong>.<br />
1966<br />
Fertig!<br />
Das neue Arzt- <strong>und</strong> Schwesternhaus wird am 27. November<br />
1966 eröffnet.<br />
1970/1971<br />
Personelle Mutationen…<br />
Die letzte Diakonisse verlässt das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> am 21. März<br />
1970. Eigentlich hatte sie schon vor 9 Jahren gekündigt…<br />
Per 1. Oktober 1971 kündigt auch Chefarzt Dr. Franz Jakob.<br />
Sein Nachfolger, Dr. Peter Matter, war bereits am 11. August<br />
1970 zum chirurgischen Chefarzt gewählt worden. Er<br />
soll sich auch mit dem Projekt des bevorstehenden Um- <strong>und</strong><br />
Erweiterungsbaus des <strong>Spital</strong>s befassen.<br />
1972<br />
… <strong>und</strong> ein grosses Bauprojekt in petto<br />
Am 5. März 1972 stimmt die <strong>Davos</strong>er Bevölkerung mit den<br />
mittlerweile stimmberechtigten Frauen einem Kredit <strong>von</strong><br />
28,5 Mio. Franken für den Neubau des <strong>Spital</strong>s mit geschützter<br />
Operationsstelle (GOPS) mit grossem Mehr zu.<br />
Nach Abzug der kantonalen <strong>und</strong> eidgenössischen Subventionen<br />
verbleiben der Landschaft <strong>Davos</strong> Gemeinde noch Investitionskosten<br />
<strong>von</strong> 13,7 Mio. Franken.<br />
1977<br />
Was lange währt…<br />
Am 7. Oktober 1977, nach über dreijähriger Bauzeit, findet<br />
die offizielle Eröffnung des neuen <strong>Spital</strong>s mit 100 Betten <strong>und</strong><br />
geschützter Operationsstelle <strong>und</strong> einer Pflegestation für Chronischkranke<br />
statt. Es sei «die in der <strong>Geschichte</strong> der Landschaft<br />
<strong>Davos</strong> nicht allein finanziell, sondern auch volumenmässig<br />
grösste, öffentliche Hochbaute», schreibt Landammann Dr.<br />
Christian Jost in der «<strong>Davos</strong>er Zeitung» vom 5. Oktober 1977.<br />
1978<br />
Modernisierter Krankentransport<br />
Ab 1978 besorgt die Firma Express-Taxi mit zwei Ambulanzfahrzeugen<br />
den Verletzten- <strong>und</strong> Krankentransport. Die<br />
Zeit der Fuhrwerke ist vorbei.
1980<br />
Die <strong>Spital</strong>region wächst<br />
Ab 1. Januar 1980 gehören auch Schmitten <strong>und</strong> Wiesen zur<br />
<strong>Spital</strong> region <strong>Davos</strong>. Sie tragen einen prozentualen Anteil des<br />
Betriebsdefizits <strong>und</strong> stellen je einen Vertreter in der <strong>Spital</strong>kommission.<br />
1982<br />
Erster Co-Chefarzt<br />
Das <strong>Spital</strong> regorganisiert sich: In der Person <strong>von</strong> Dr. med.<br />
Peter Holzach gibts 1982 erstmals einen Co-Chefarzt.<br />
1985<br />
Der Chefarzt wird Professor<br />
1985 wird Chefarzt Dr. Peter Matter zum a.o. Professor der<br />
Universität Basel ernannt. «Die Verbindung zur Universität<br />
Basel ergibt wichtige Impulse zum Schritthalten mit den medizinischen<br />
Fortschritten», steht im Jahresbericht 1985 des<br />
<strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>. Die Ultraschallsonographie wird eingeführt.<br />
1987/1988<br />
Baukredit für Pflegeheim <strong>und</strong> Personalunterkünfte<br />
Am 14. Juni 1987 sagt der <strong>Davos</strong>er Souverän wiederum<br />
deutlich Ja zu einem Baukredit <strong>von</strong> 8,33 Mio. Franken für<br />
den Neubau eines Pflegeheims, Personalunterkünfte <strong>und</strong><br />
den Ersatz oder die Ergänzung <strong>von</strong> <strong>Spital</strong>räumen. Baubeginn<br />
ist am 1. Mai 1988, im Jahr des 100-jährigen Bestehens<br />
des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>.<br />
Gedanken zu<br />
«100 Jahre <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>»<br />
Chefarzt Professor Dr. med. Peter Matter:<br />
« Historisch<br />
gesehen war das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> immer fortschrittlich<br />
eingestellt. Es verfügte als eines der ersten Spitäler<br />
dieser Grösse seit 1957 über einen ärztlich geführten<br />
Narkosedienst <strong>und</strong> kennt die Unterteilung in Chirurgie <strong>und</strong><br />
<strong>Medizin</strong> seit 1955 <strong>und</strong> seit 1961 in Geburtshilfe /Gynäkologie<br />
je mit fachspezifisch leitenden Ärzten.<br />
Unsere Patienten erwarten differenzierte <strong>und</strong> moderne Abklärungs-<br />
<strong>und</strong> Behandlungsmöglichkeiten. So konnten wir<br />
z. B. die Ultraschalluntersuchungen vor Kurzem modernisieren<br />
<strong>und</strong> damit nicht nur zum Teil herkömmliche Untersuchungsmethoden,<br />
die oft den Patienten stark belasteten,<br />
ersetzen, sondern vor allem auch unsere diagnostischen<br />
Möglichkeiten weiter verfeinern. Selbstverständlich werden<br />
bei solchen Anschaffungen die finanziellen Auswirkungen<br />
f<strong>und</strong>iert dem möglichen Profit für die Patienten gegenüber -<br />
gestellt.»<br />
<strong>Spital</strong>verwalter Emil Lehmann:<br />
« Vor allem aber gilt es, den für die damalige Zeit (<strong>Spital</strong> -<br />
eröffnung 1888, die Verf.) erstaunlichen Weitblick <strong>und</strong> die<br />
Risikobereitschaft der für diese Gründung verantwortlichen<br />
Initianten zu bew<strong>und</strong>ern <strong>und</strong> zu ehren.»<br />
15
16<br />
Meilensteine der <strong>Spital</strong>geschichte Die Jahre 1989–2007<br />
Quelle: Jahresberichte des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong><br />
1989<br />
Wieder eine Einweihung<br />
Am 15. September 1989 werden das Personalhaus <strong>und</strong> das<br />
34-Betten-Pflegeheim eingeweiht – nach harter Bauzeit, wie<br />
Chefarzt Professor Dr. Peter Matter im Jahresbericht<br />
schreibt: «Die Lärmemission <strong>und</strong> Betriebsbeeinträchtigungen<br />
waren zeitweise kaum tragbar <strong>und</strong> forderten viel guten<br />
Willen <strong>und</strong> Verständnis <strong>von</strong>seiten der Patienten <strong>und</strong> des Personals<br />
des Akutspitals» – ein Seufzer, der 20 Jahre später<br />
erneut volle Berechtigung haben wird.<br />
Jubiläum fürs «Dreibein»<br />
Ebenfalls 1989 feiert die sogenannte «Dreibein»-Führung<br />
am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> mit Chefarzt, Oberschwester <strong>und</strong> Verwalter<br />
ihr 10-Jahr-Jubiläum. Die Devise des <strong>Davos</strong>er Chefarztes<br />
für <strong>Spital</strong>patienten: «Eingeliefert ja, aber nicht ausgeliefert…»<br />
Der moderne Patient, stellt Matter fest, gebe sich<br />
nicht mehr mit optimaler, sondern nur noch mit maximaler<br />
<strong>Medizin</strong> zufrieden.<br />
1990–1992<br />
Fortschritte <strong>und</strong> Sorgen<br />
1990 wird das Ergotherapiezentrum, geführt vom Schweizerischen<br />
Roten Kreuz Graubünden, eröffnet. Erstmals<br />
wer den Gallenblasen laparoskopisch, das heisst in der<br />
minimalinvasiven «Schlüssellochtechnik», entfernt. Das Anästhesie<br />
zentrum wird ausgebaut. 1991 werden Echo kardio-<br />
graphie <strong>und</strong> Dopplersonographie eingeführt. Die Ultra -<br />
schalldiagnostik hat sich etabliert. Sorgen machen dagegen<br />
die finanziellen Leistungen der Bündner Krankenkassen: Sie<br />
decken die effektiven Patientenkosten nicht.<br />
Stabübergabe in der<br />
Gynäkologie<br />
Nach 27 Jahren tritt Dr. Silvia Bono 1992 als leitende Ärztin<br />
Gynäkologie am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> zurück. Nachfolger wird<br />
Florian Tränkner. Im Jahresbericht 1992 zieht sie Bilanz über<br />
ihr langjähriges Wirken:<br />
« Es<br />
bedeutet zunächst, an der medizinischen Entwicklung<br />
beteiligt gewesen zu sein in einer Zeit, da diese immer<br />
breiter, immer tiefer <strong>und</strong> umfassender, immer technischer<br />
<strong>und</strong> apparativer, aber auch immer hektischer wurde. Einer<br />
Zeit, in der es für den einzelnen Arzt <strong>und</strong> erst recht für den<br />
einsamen Gynäkologen in der Peripherie immer problematischer<br />
wurde, diese Entwicklung in genügendem Mass mitzumachen.<br />
Einer Zeit, in der es immer schwerer wird, die<br />
nötige Musse für die eigene Fortbildung zu finden, <strong>und</strong> hie<br />
<strong>und</strong> da auch schwierig, die neuen Ideologien <strong>und</strong> Praktiken<br />
zu verstehen.<br />
Es bedeutet, Veränderungen bei den <strong>Medizin</strong>alberufen miterlebt<br />
zu haben, die, wie nie zuvor, differenzierter, f<strong>und</strong>ierter,<br />
technisch <strong>und</strong> intellektuell anspruchsvoller geworden sind.<br />
Dabei leider häufig auch patientenferner, abstrakter wurden,<br />
mehr mess- als fühlbar, <strong>und</strong> damit vom Kranken, vielfach zu<br />
Unrecht, als distanzierter <strong>und</strong> liebloser empf<strong>und</strong>en.
Es bedeutet, Jahrzehnte miterlebt zu haben, in denen die<br />
Frauen ein bisher nicht gekanntes Mass an Selbstbewusstsein<br />
erlangt haben. Ein Selbstbewusstsein, das sie als Patientinnen<br />
sehr viel anspruchsvoller, aber auch sehr viel kollaborativer<br />
werden liess; durch das sie mehr Aufklärung,<br />
mehr Mitentscheidung fordern, vielfach auch mehr Mitverantwortung<br />
zu übernehmen bereit sind. Ein Selbstbewusstsein<br />
auch, das Frauen als Pflegende, als Schwestern, Hebammen,<br />
Laborantinnen usw. fordernder, anspruchsvoller<br />
macht. Nicht nur das Wie, auch das Warum ist heute gefragt<br />
<strong>und</strong> in Frage gestellt. Wer noch in der alten, hierarchischen<br />
Ordnung gross geworden ist, muss sich nicht<br />
wenig anstrengen, um diesen neuen Herausforderungen<br />
gerecht zu werden.»<br />
1994<br />
Ende einer Aera<br />
Nach 24 Jahren Chefarztätigkeit kündigt Professor Dr. Peter<br />
Matter per Mitte 1994 seinen Rücktritt an. Er wird die Leitung<br />
<strong>von</strong> AOInternational übernehmen. Sein Fazit: «Die<br />
Amtszeit war geprägt <strong>von</strong> einer raschen, konzentrierten Entwicklung<br />
in Diagnostik <strong>und</strong> Therapie, <strong>und</strong> gleichzeitig waren<br />
auch grosse Bauvorhaben zu realisieren.» Nachfolger als<br />
ärztlicher Leiter des <strong>Spital</strong>s wird der orthopädische Chirurg,<br />
Chefarzt Dr. med. Peter Holzach. 1994 gibt sich das <strong>Spital</strong><br />
ein neues Leitbild <strong>und</strong> befasst sich mit Qualitätssicherung<br />
<strong>und</strong> Prozessqualität, ein Thema der nächsten Jahre.<br />
1995/1996<br />
«Profitcenter <strong>Spital</strong>»<br />
Prägend für die 90er-Jahre ist der Kostendruck im Ges<strong>und</strong>heitswesen.<br />
«Das <strong>Spital</strong> im Clinch zwischen Profitcenter <strong>und</strong><br />
Leistungsauftrag», überschreibt der damalige Präsident der<br />
<strong>Spital</strong>kommission (SPIKO), Landrat Dr. Peter Bieler, seinen<br />
Kommentar im Jahresbericht 1995. Zwar sinkt die <strong>Spital</strong>aufenthaltsdauer,<br />
die apparativen <strong>und</strong> personellen Kosten<br />
aber steigen. Aus Kostengründen wird die <strong>Spital</strong>wäsche ab<br />
1995 extern vergeben.<br />
Von Emil Lehmann zu Markus Gautschi<br />
1995 wird Verwaltungsdirektor Emil Lehmann nach 27<br />
Dienstjahren pensioniert. Nachfolger wird Markus Gautschi.<br />
Der Personalbestand des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> liegt bei r<strong>und</strong> 250<br />
Personen. Das neue Unisys-Computernetzwerk mit 10 000<br />
Metern Kabel wird installiert. Ist das der Auftakt zum «digitalen<br />
Patienten», wie Jürg Dannecker, Chefarzt Innere <strong>Medizin</strong>,<br />
im Jahresbericht 1996 befürchtet? Digitalisiert ist auf<br />
jeden Fall bereits die erneuerte Röntgenanlage.<br />
1997<br />
Tagesklinik am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
Anfang 1997 eröffnet das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> eine Tagesklinik. Das<br />
bedeutet erhöhten Komfort für die wachsende Zahl ambulanter<br />
Patientinnen <strong>und</strong> Patienten. Der Gebärsaal mit Stillzimmer<br />
ist renoviert, die Ultraschallanlage erneuert. Der<br />
Psychiatrische Dienst bekommt ein eigenes Sprech st<strong>und</strong>enzimmer<br />
<strong>und</strong> bietet mehr Sprechst<strong>und</strong>en an. In seinem Gast-<br />
17
18<br />
kommentar zum Jahresbericht 1997 bezeichnet Dr. med.<br />
Beat Villiger das gut ausgebaute Aktuspital <strong>Davos</strong> als «Überlebensfaktor»<br />
für die 7 Kliniken mit 1000 Betten in <strong>Davos</strong>.<br />
Einziger Mangel: Der fehlende Computertomograph (CT).<br />
1998<br />
Wechsel in der ärztlichen Leitung<br />
Per 31. Dezember 1998 übergibt Dr. med. Peter Holzach die<br />
ärztliche Leitung des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> an Dr. med. Christian Ryf,<br />
Chefarzt Chirurgie. Ebenfalls im Dezember kann endlich ein<br />
Computertomograph (CT) in Betrieb genommen werden. Er<br />
wurde privat angeschafft. Im kantonalen Lei stungs auftrag<br />
ist keine CT-Anlage vorgesehen.<br />
Der frühere Chefarzt, Dr. Peter Matter, schenkt dem <strong>Spital</strong><br />
«Kunst am Bau» für die Nordfassade. Leuchtkräftige Symbolfiguren<br />
aus feueremailliertem Metall <strong>von</strong> Claire Ochsner.<br />
Planungsstart zur Sanierung Akutspital<br />
Ebenfalls im Jahr 1998 wird eine Baukommission für den<br />
Um- <strong>und</strong> Neubau des nunmehr 21-jährigen Akutspitals eingesetzt.<br />
1999<br />
Konzepte, Konzepte<br />
Am 8. März 1999 genehmigt die <strong>Spital</strong>kommission (SPIKO)<br />
der <strong>Spital</strong>region <strong>Davos</strong> das Raumplanungskonzept für den<br />
geplanten Um- <strong>und</strong> Neubau.<br />
Die Ges<strong>und</strong>heitsdirektion des Kantons Graubünden erlässt<br />
ein neues Rettungskonzept. Da die «Express Taxi AG» nach<br />
40-jährigem Ambulanzdienst gekündigt hat, muss das <strong>Spital</strong><br />
über die künftige Ausgestaltung des <strong>Davos</strong>er Rettungsdienstes<br />
entscheiden.<br />
Aufenthaltsdauer im Akutspital sinkt <strong>und</strong> sinkt<br />
durchschnittliche Aufenthaltstage betriebene Betten<br />
10.43 9.49 9.73 9.5 8.9 7.9 7.6 7.1 7.1 6.6<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999<br />
Trauer im <strong>Spital</strong><br />
Am 10. Februar 1999 stirbt Jürg Dannecker, Chefarzt<br />
Innere <strong>Medizin</strong>, im Alter <strong>von</strong> nur 60 Jahren. Nachfolger wird<br />
Dr. med. Josias Mattli.<br />
2000<br />
(Jahresbericht 1999)<br />
Erfolge – <strong>und</strong> zwei gewichtige Abgänge<br />
Im Juni 2000 schliesst das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> den Zertifizierungsprozess<br />
des Qualitätsmanagement-Systems nach ISO-Norm<br />
9001 erfolgreich ab. Im Oktober 2000 ist der spitaleigene<br />
ReDa (Rettungsdienst <strong>Davos</strong>) operationell.
Das Jahr 2000 bringt aber auch zwei gewichtige Abgänge.<br />
Der Chefarzt Orthopädie, Dr. med. Peter Holzach, kündigt<br />
auf den 1. Februar 2001 wegen der ungünstigen Rahmenbedingungen<br />
im Bündner Ges<strong>und</strong>heitswesen. <strong>Spital</strong>direktor<br />
Markus Gautschi wechselt aus familiären Gründen ans<br />
<strong>Spital</strong> Horgen. Ihre Nachfolger sind Co-Chefarzt Orthopädie,<br />
Dr. med. Thomas Perren, <strong>und</strong> Markus Hehli.<br />
2001<br />
Departementswechsel fürs <strong>Spital</strong><br />
Mit Beginn der neuen Legislatur, ab 1. September 2001,<br />
wird das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> gemäss Beschluss des Kleinen Landrates<br />
neu dem Departement «Öffentliche Betriebe <strong>und</strong> Verkehr»<br />
unter Landrat Andrea Meisser zugeordnet. Auffallend<br />
ist für ihn die im Ges<strong>und</strong>heitswesen «enorm hohe<br />
Regelungsdichte».<br />
Diagnostik optimiert, Projektwettbewerb Neubau<br />
abgeschlossen<br />
Im Jahr 2001 wird im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> das <strong>von</strong> der privaten<br />
Firma «<strong>Davos</strong> Medical Imaging AG» betriebene MRI-Institut<br />
eingeweiht<br />
Das Projekt «Richard Löwenherz» (Prof. R. Leu, Wetzikon, Architekturbüro<br />
Gross + Rüegg, Trin) gewinnt im Juli 2001 den<br />
Wettbewerb für den Neu- <strong>und</strong> Umbau des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>.<br />
Neue Köpfe am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
Per 1. Januar 2001 wird Dr. med. Gregor Niedermaier mit<br />
Zusatzausbildung in Intensiv- <strong>und</strong> Notfallmedizin Co-Chefarzt<br />
Innere <strong>Medizin</strong>. Das <strong>Spital</strong> wird als «medizinische Klinik<br />
B» anerkannt.<br />
Am 5. Juni 2001 wird Dr. med. Paavo Rillmann als Co-Chefarzt<br />
Chirurgie eingestellt. Beide Ärzte vertreten seit Anfang<br />
2008 die Ärzteschaft in der neu formierten, 6-köpfigen <strong>Spital</strong>leitung<br />
mit Direktor Markus Hehli.<br />
2002<br />
Familienfre<strong>und</strong>liches <strong>Spital</strong><br />
Im September 2002 eröffnet der Verein Kinderbetreuung<br />
<strong>Davos</strong> im Personalhaus II den professionell geführten «Chinderchrattä<br />
Junior» für <strong>Spital</strong>angestellte <strong>und</strong> die <strong>Davos</strong>er Bevölkerung.<br />
2002 liegt der Personalbestand bei 300 Personen.<br />
Und: Der Kanton Graubünden bestätigt den<br />
Leistungsauftrag für das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> als «Regionalspital mit<br />
erweiterter Gr<strong>und</strong>versorgung».<br />
Noch ein Bauprojekt, noch ein Sieger<br />
2002 gewinnen die Architekten Michael Curdin <strong>und</strong> Daniel<br />
Schmid mit ihrem Vorschlag «Höhenluft» den Projektwettbewerb<br />
für das neue Personalhaus 1 mit 50 Studios <strong>und</strong> Einstellhalle<br />
zu Baukosten <strong>von</strong> knapp 8 Mio. Franken.<br />
19
20<br />
2003<br />
Deutliches Ja vom <strong>Davos</strong>er Souverän<br />
Am 9. Februar 2003 akzeptiert das <strong>Davos</strong>er Stimmvolk mit<br />
r<strong>und</strong> 80 Prozent Ja-Stimmen die Kreditanträge für den Um<strong>und</strong><br />
Neubau des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> <strong>von</strong> 46,6 Mio. Franken <strong>und</strong><br />
das neue Personalhaus <strong>von</strong> r<strong>und</strong> 7,9 Mio. Franken. Bereits<br />
am 22. November 2003 wird beim neuen Personalhaus Aufrichte<br />
gefeiert.<br />
Weitere News aus dem «Unternehmen <strong>Spital</strong>»<br />
Per 1. November 2003 wird Dr. med. Dietrich Hübner Chefarzt<br />
<strong>und</strong> Leiter Anästhesie.<br />
Mit einem Durchschnitt <strong>von</strong> nur 6,7 Tagen Aufenthaltsdauer<br />
liegt das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> unter den Werten anderer kantonaler<br />
<strong>und</strong> Schweizer Spitäler. Der Aufwand 2003 steigt auf knapp<br />
30 Mio Franken. Das Defizit <strong>von</strong> 5,4 Mio. Franken liegt aber<br />
r<strong>und</strong> 1 Mio. tiefer als im Vorjahr.<br />
2004<br />
Allerlei Freudentage<br />
Das Jahr 2004 bringt endlich die Einführung des neuen Tarifvertrages<br />
TARMED mit seinen 4600 Tarifpositionen. Die<br />
EDV-Anpassungen verursachten Einführungskosten <strong>von</strong><br />
r<strong>und</strong> 1 Mio. Franken. Am 1. November 2004 wird das neue<br />
Personalhaus den Mitarbeitenden übergeben.<br />
Am Osterdienstag, 13. April 2004, erfolgt der Spatenstich<br />
für die Gesamtsanierung des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>. Am 1. November<br />
2004 wird das neue Personalhaus eingeweiht. Die Internisten,<br />
die Drs. med. Gregor Niedermaier <strong>und</strong> Walter Kistler,<br />
erwerben den FMH-Ausweis als Sportmediziner <strong>und</strong> werden<br />
ab 2005 das ganze sportmedizinische Spektrum anbieten.<br />
2004/2005<br />
Ein Schreckensjahr – in <strong>Davos</strong> <strong>und</strong> Asien<br />
Per Ende 2004 schliessen die beiden deutschen Kliniken Valbella<br />
<strong>und</strong> Alexanderhaus. Im März 2005 stellt auch die Thurgauisch-Schaffhausische<br />
Höhenklinik den Betrieb ein.<br />
Schrecklich endet das Jahr 2004 auch in Asien mit der Tsunami-Katastrophe<br />
vom 26. Dezember 2004. Mehrere Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> leisten im<br />
Katastrophengebiet erste Hilfe.<br />
Positiv dagegen ist die Gründung des «Europäischen Kompetenzzentrums<br />
für Asthma <strong>und</strong> Allergien» an der deutschen<br />
Hochgebirgsklinik <strong>Davos</strong> Wolfgang im Jahr 2004.<br />
Hoher Besuch<br />
Am 29. Januar 2005, während der WEF-Tage, besucht B<strong>und</strong>espräsident<br />
Samuel Schmid das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>. Rettungsdienst<br />
<strong>und</strong> <strong>Spital</strong>bereitschaft sind verstärkt. R<strong>und</strong> 40 Fachpersonen<br />
sind im Einsatz.<br />
Neuer Schub für den Ges<strong>und</strong>heitsplatz <strong>Davos</strong>?<br />
Unter dem Patronat der Landschaft <strong>Davos</strong> Gemeinde wird<br />
am 1. Mai 2005 der Verein «<strong>Davos</strong> Health» gegründet. Das
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> ist Gründungsmitglied. Zur Lage auf dem Ges<strong>und</strong>heitsplatz<br />
<strong>Davos</strong> schreibt Landrat Andrea Meisser, Präsident<br />
<strong>Spital</strong>kommission, im Jahresbericht 2005:<br />
« Die<br />
Klinikschliessungen am Ende des letzten <strong>und</strong> zu Beginn<br />
des aktuellen Geschäftsjahres haben uns unsere Verletzlichkeit,<br />
unsere Abhängigkeit <strong>von</strong> erfolgreich operierenden<br />
Unternehmen mit ihren wertvollen Arbeitsplätzen<br />
drastisch vor Augen geführt. Wenn in einer derartigen Situation<br />
trotz allem nach positiven Aspekten gesucht werden<br />
soll, dann ist sicher an erster Stelle die entstandene<br />
Aufbruchstimmung, verb<strong>und</strong>en mit dem Wunsch, sich gegenseitig<br />
noch besser zu unterstützen, zu erwähnen. (…)<br />
Die Neupositionierung <strong>von</strong> <strong>Davos</strong> als europäischem Kompetenzzentrum<br />
für Ges<strong>und</strong>heit verlangt sowohl Strukturen<br />
als auch Mittel zur Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe. Die<br />
volkswirtschaftliche Bedeutung des Ges<strong>und</strong>heistplatzes als<br />
ganzjährigem Standbein neben dem Kongress- <strong>und</strong> Ferientourismus<br />
soll nachhaltig gesichert werden. Die Synergien<br />
des Klinikstandortes mit dem Forschungsstandort sind zu<br />
erhalten <strong>und</strong> weiter auszubauen.»<br />
2006<br />
Neues hier, Neues da<br />
Im Jahr 2006 wird das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> <strong>von</strong> Swiss Olympic als<br />
«Sport Medical Base» anerkannt. Die Privatfirma «Labor<br />
Meditest AG» wird per Vertrag ins <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> integriert.<br />
Der Rettungsdienst <strong>Davos</strong> «ReDa» führt die Präventionskampagne<br />
«Herzsicheres <strong>Davos</strong>» durch. Die Klinik Hirslanden<br />
kündigt den Vertrag zur Durchführung <strong>von</strong> Pneumologie-Sprechst<strong>und</strong>en<br />
am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>. Nach einer Über brü -<br />
ckung szeit durch die Hochgebirgsklinik <strong>Davos</strong> Wolfgang<br />
wird Dr. med. Thomas Rothe ab 1. September Leitender Arzt<br />
im Teilpensum für Pneumologe <strong>und</strong> Schlafmedizin.<br />
Halbzeit beim Um- <strong>und</strong> Neubauprojekt<br />
2006 ist die bisher grösste Bauetappe erfolgreich beendet.<br />
Doch die Bauarbeiten mit ihren Immissionen <strong>und</strong> Provisorien<br />
haben Patienten <strong>und</strong> Personal aufs Äusserste gefordert.<br />
2007<br />
Immer professioneller<br />
Im Jahr 2007 führt das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> den Roomservice ein. In<br />
der neuen Operationsabteilung werden bereits 2000 Operationen<br />
durchgeführt. Das gesamte <strong>Spital</strong> ist rauchfrei, <strong>und</strong><br />
trotz Bautätigkeit lautet der Prüfbericht der Qualitäts-Zertifizierungsstelle<br />
SQS positiv.<br />
Vom 8. bis 14. Juli 2007 betreut ein <strong>Davos</strong>er Sanitätsdienste-<br />
Team aus 3 Ärzten, 19 Rettungssanitätern, 16 Pflegefachpersonen<br />
<strong>und</strong> 4 Hilfskräften unter Leitung <strong>von</strong> Dr. med. Walter<br />
Kistler <strong>und</strong> Rettungschef Steffen Bohn am Swiss Olympic<br />
Gigathlon sage <strong>und</strong> schreibe 6400 Teilnehmenden.<br />
Per Ende 2007 tritt Chefarzt Dr. med. Christian Ryf als ärztlicher<br />
Leiter des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> zurück. In der neu konzipier-<br />
21
22<br />
ten <strong>Spital</strong>leitung vertritt Co-Chefarzt Dr. med. Paavo Rillmann<br />
die orthopädische Chirurgie.<br />
2008<br />
Die neu formierte <strong>Spital</strong>leitung hat die Führungsstrukturen<br />
optimiert. Das Organisationsreglement ist in Revision.<br />
Bereits geplant: Der Abbruch des alten Personalhauses im<br />
Mai / Juni 2008.<br />
Die VBD-Haltestelle «<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>»!<br />
Ein alter Wunsch der Bevölkerung wird erfüllt. Im Auftrag<br />
des Kleinen Landrates hat das Tiefbauamt die Verlängerung<br />
der VBD-Linie 1 bis zum <strong>Spital</strong> bearbeitet <strong>und</strong> im Sommer<br />
2008 realisiert.<br />
Bald ists geschafft …<br />
Im Jahresbericht 2007 schreibt der Präsident <strong>Spital</strong>kommission,<br />
Dr. Andrea Meisser:<br />
« Im<br />
Herbst 2008 kann unser «neues» <strong>Spital</strong> plangemäss<br />
eingeweiht werden, sollte nicht noch in letzter Minute<br />
etwas Unvorhergesehenes passieren. Der Ges<strong>und</strong>heitsplatz<br />
<strong>Davos</strong> braucht ein attraktives Zentrum mit einem breitgefächerten<br />
Angebot an hochstehenden medizinischen Leistungen.<br />
Es ist unverzichtbar für eine hohe Lebensqualität in<br />
unserer Gemeinde, als Gewähr für die Aufrechterhaltung<br />
bedeutender Kongresse wie dem Annual Meeting des WEF,<br />
als Sicherheit für unsere zunehmend auf Ges<strong>und</strong>heit bedachten<br />
Gäste <strong>und</strong> nicht zuletzt als umfassendes lokales<br />
Dienstleistungszentrum für unsere zahlreichen im medizinischen<br />
<strong>und</strong> paramedizinischen Bereich tätigen Personen, Organisationen<br />
<strong>und</strong> Institutionen.»
24<br />
Prägende Köpfe am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
1. Die Chefärzte <strong>und</strong> Verwalter<br />
Die Anfänge ab 1888:<br />
Im ersten <strong>Davos</strong>er Krankenhaus <strong>von</strong> 1888 gabs noch keinen Chefarzt. Diese Bezeichnung kam erst in den 50er-Jahren des<br />
letzten Jahrh<strong>und</strong>erts auf. <strong>Spital</strong>- <strong>und</strong> zugleich Landschaftsärzte waren die folgenden Vereinsärzte des Krankenvereins <strong>Davos</strong><br />
(Quelle: Festschrift 100 Jahre Krankenhaus / <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>, Dr. Kaspar Jörger)<br />
Dr. med. Wilhelm Beeli (1843 –1900)<br />
Dr. med. Florian Buol (1854 –1924<br />
Dr. med. Wilhelm Schibler (1861–1931)<br />
<strong>Spital</strong>ärzte / Chefärzte<br />
Dr. med. Benedikt Meisser<br />
Dr. med. Paul Schreiber<br />
Dr. med. Heinrich Schuppisser<br />
Dr. med. Franz Jakob<br />
Prof. Dr. med. Peter Matter<br />
Dr. med. Peter Holzach<br />
Dr. med. Christian Ryf<br />
Amtszeit<br />
1906 – 1912<br />
1912 – 1937<br />
1937 – 1941<br />
1941 – 1971<br />
1971 – 1994<br />
1994 – 1998<br />
(Abteilungs-Chefarzt<br />
bis 2001)<br />
seit 1999<br />
Verwalter<br />
Peter Lyk<br />
Ernst Graf<br />
Franz Bruhin<br />
Jakob Rutishauser<br />
Ernst Dietiker<br />
Rudolf Feser<br />
Vollamt:<br />
(Statthalter, Kleiner Landrat <strong>Davos</strong>) 1959 – 1980<br />
Willi Hofstetter<br />
Emil Lehmann<br />
Markus Gautschi<br />
Markus Hehli<br />
Amtszeit<br />
Nebenamt:<br />
1907 – 1918<br />
1918 – 1930<br />
1930 – 1936<br />
1936 – 1950<br />
1950 – 1958<br />
1980 – 1983<br />
1983 – 1995<br />
1995 – 2001<br />
seit 2001<br />
Übrigens: Vor gut einem halben Jahrh<strong>und</strong>ert, ab 1. Januar 1956, wurde der Monatslohn des nebenamtlichen <strong>Spital</strong>verwalters<br />
Ernst Dietiker <strong>von</strong> 300 auf 450 Franken erhöht …
Prägende Köpfe am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
2. Die Abteilungs-Chefärzte<br />
<strong>Medizin</strong>ische Abteilung:<br />
Chefarzt<br />
Dr. med. Max Ziegler<br />
Dr. med. Jürg Dannecker<br />
Dr. med. Josias Mattli<br />
Dr. med. Gregor Niedermaier<br />
Dr. med. Walter Kistler<br />
Chirurgische Abteilung:<br />
Chefarzt<br />
Dr. med. Peter Holzach<br />
Dr. med. Christian Ryf<br />
Dr. med. Thomas Perren<br />
Dr. med. Paavo Rillmann<br />
Amtszeit<br />
1955 –1971 beratender Internist<br />
am Krankenhaus,<br />
ab 1971 Chefarzt<br />
1978 –1999<br />
1991–2008<br />
seit 2001<br />
seit 2006<br />
Amtszeit<br />
1983–2001<br />
seit 1994<br />
seit 2000<br />
seit 2001
Prägende Köpfe am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
3. Die leitenden Spezialärzte<br />
Anästhesie:<br />
Leitung<br />
Dr. med. Josef Portmann<br />
Dr. med. Gottfried Isler<br />
Dr. med. Dietrich Hübner<br />
Med. prakt. Lukas Brunner<br />
Gynäkologie/ Geburtshilfe:<br />
Leitung<br />
Dr. med. Silvia Bono<br />
Dr. med. Florian Tränkner<br />
Hals-, Nasen- <strong>und</strong> Ohrenarzt<br />
(Oto-Rhino-Laryngologie/ ORL):<br />
Leitung<br />
Dr. med. Andreas Speiser<br />
Pneumologie:<br />
Leitung<br />
Dr. med. Thomas Rothe<br />
Amtszeit<br />
1983–2006<br />
1995 –2003<br />
seit 2003<br />
seit 2006<br />
Amtszeit<br />
1965 –1993<br />
im Nebenamt<br />
seit 1993<br />
Amtszeit<br />
seit 1996<br />
Amtszeit<br />
seit 2007
Prägende Köpfe am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
4. Die Oberschwestern<br />
Was wäre ein <strong>Spital</strong> ohne das Pflegepersonal?<br />
Zu den prägenden Köpfen des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> gehören <strong>und</strong><br />
gehörten selbstverständlich immer auch die Oberschwestern<br />
<strong>und</strong> die späteren Leitungen Pflegedienst.<br />
Bekanntlich waren es Dänliker-Schwestern, Schwestern aus<br />
einer Vorgängerinstitution des Diakonissenhauses Bern, die<br />
zu Beginn den Pflegedienst im Krankenhaus <strong>Davos</strong> versahen.<br />
Zwischen 1962 <strong>und</strong> 1970 traten die Tübli-Schwestern, freie<br />
Schwestern aus dem Diakonissenhauses Bern, an ihre Stelle.<br />
Lang <strong>und</strong> beeindruckend ist die Liste der <strong>Davos</strong>er Oberschwestern.<br />
Ab 1970, unter Chefarzt Professor Peter Matter,<br />
repräsentierten sie in der «Dreibein»-Geschäftsleitung<br />
mit Chefarzt, <strong>Spital</strong>verwalter <strong>und</strong> Pflegedienst das Pflegepersonal.<br />
Seit 1912 sind folgende Oberschwestern namentlich<br />
bekannt:<br />
Helene Hauser<br />
Lea Klein (29 Jahre im Dienst)<br />
Frieda Huber<br />
Emilie Meier<br />
Loni Flückiger<br />
Edith Veraguth<br />
Esther Grassi<br />
Christina Candrian<br />
In jüngerer Zeit lag die Leitung Pflegedienst bei:<br />
Elsbeth Lüthi<br />
Liselotte Schnyder<br />
Michael Härtel<br />
Cornelia Conzett<br />
Sonja Heine / Beatrice Heeb<br />
Zwischendurch versah Schwester Nelly Fischer bei Bedarf<br />
vier- bis fünfmal diesen Posten (Quelle: Festschrift «100<br />
Jahre Krankenhaus / <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>», Dr. Kaspar Jörger).<br />
(Quelle: <strong>Spital</strong>administration)<br />
1987–1990<br />
1990–1993<br />
1993–2001<br />
2001–2007<br />
seit 2008<br />
27
Professor Dr. med. Peter Matter<br />
(* 1932) – Chefarzt <strong>von</strong> 1970 bis 1994<br />
Warum interessierten Sie sich seinerzeit für die Position<br />
eines Chefarztes in <strong>Davos</strong>?<br />
Ursprünglich wollte ich Praktiker werden <strong>und</strong> sicher nie in<br />
einem grossen Zentrum arbeiten. Im Rahmen meiner medizinischen<br />
Ausbildung kam ich 1959 nach Chur, zum Chirurgen<br />
<strong>und</strong> Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese<br />
(AO), Professor Martin Allgöwer. Und so kam<br />
es, dass ich schliesslich doch die Allgemeinchirurgie wählte.<br />
Als das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> im Jahr 1970 die Chefarztstelle ausschrieb,<br />
meldete ich mich. Die Region war mir vertraut: Eine<br />
meiner Tanten betrieb in Klosters ein Hotel. Als Junge half<br />
ich dort manchmal im Service mit. <strong>Davos</strong> kannte ich vom<br />
Skifahren her. Zu jener Zeit wurde gerade ein <strong>Spital</strong>neubau<br />
geplant. Das interessierte mich: Für einen Chefarzt sind die<br />
Mitarbeit bei der <strong>Spital</strong>planung <strong>und</strong> das Mitgestalten <strong>von</strong><br />
Vorteil, trotz der grossen Zusatzbelastung.<br />
Hatten Sie Konkurrenz?<br />
Oh ja! Es meldeten sich insgesamt 16 Bewerber, darunter<br />
auch Oberarzt Peter Menzi, den man in <strong>Davos</strong> gut kannte.<br />
Er stand darum klar im Vordergr<strong>und</strong>. Die Auswahl erfolgte<br />
durch zwei externe Experten. Ich hatte mich gleichzeitig<br />
auch im <strong>Spital</strong> Samedan gemeldet. Doch bevorzugte man<br />
dort einen romanisch sprechenden Kollegen. Die Selektion<br />
für das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> zog sich hin <strong>und</strong> dauerte r<strong>und</strong> ein halbes<br />
Jahr. Interesse an der Chefarztwahl zeigte auch Professor<br />
Allgöwer, der gerade einen Neubau für das AO-For-<br />
schungszentrum in <strong>Davos</strong> plante. Er wünschte sich die enge<br />
Kooperation zwischen der AO-Forschung <strong>und</strong> dem <strong>Spital</strong>.<br />
Wie präsentierte sich das <strong>Spital</strong>umfeld bei Stellenantritt<br />
– infrastrukturell, personell, führungsmässig<br />
<strong>und</strong> bezüglich strategischer Ausrichtung? Gabs Probleme<br />
bei der Einarbeitung?<br />
Auffällig war die frühe Spezialisierung des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>. Das<br />
ging auf Chefarzt Franz Jakob (Amtszeit: 1941–1971, die<br />
Red.) zurück: Bereits 1955 wurde die Innere <strong>Medizin</strong> eingeführt,<br />
1957 folgte die Anästhesie, 1961 die Gynäkologie.<br />
Das entsprach einer sogenannt erweiterten Gr<strong>und</strong>versorgung.<br />
In den 70er-Jahren gab es in <strong>Davos</strong> wegen der zahlreichen<br />
Höhenkliniken über 2000 Patientenbetten. Das neue Akutspital<br />
sollte einen modernen Ausbaustandard aufweisen.<br />
Mit dem damaligen Landammann Dr. Christian Jost bin ich<br />
öfters nach Chur gepilgert, um bei der Kantonsregierung<br />
mehr Geld herauszuholen. «Schon wieder die <strong>von</strong> <strong>Davos</strong>!»,<br />
hiess der Seufzer damals.<br />
Bei der Planung war für mich funktionales Denken <strong>und</strong> der<br />
enge Kontakt zu den späteren Nutzern das zentrale Anliegen.<br />
So änderten wir zum Beispiel den viel zu klein dimensionierten<br />
Notfall. Während der Saisonspitzen hatten wir<br />
nämlich schon damals bis zu 60 Notfälle pro Tag zu bewältigen!<br />
29
30<br />
Mein grösstes Problem war die Personalsituation. Bei Stellenantritt<br />
war kein qualifiziertes Personal mehr vorhanden:<br />
Keine Operationsschwestern, keine Röntgenassistentinnen,<br />
Arztsekretärinnen <strong>und</strong> Assistenten – keine Seltenheit bei<br />
einem Chefarztwechsel. Die Personalrekrutierung gestaltete<br />
sich äusserst schwierig. Auf eigene Kosten mietete ich einige<br />
Personalwohnungen, um die Stellen attraktiver zu machen.<br />
Von meinem früheren Arbeitsort Basel brachte ich<br />
einen Oberarzt <strong>und</strong> einen Assistenten mit nach <strong>Davos</strong>. Am<br />
1. Dezember – zum Saisonbeginn – hatte ich meine Crew<br />
endlich beisammen.<br />
Dieser Start bei Null hatte durchaus auch Vorteile. Von Anfang<br />
an konnte ich meine Führungsgr<strong>und</strong>sätze durchsetzen:<br />
Ich führte das <strong>Spital</strong> wie ein Privatunternehmen, <strong>und</strong> das<br />
mit – zugegeben – ziemlich straffer Hand …<br />
Welches waren Ihre persönlichen Ziele? Wo sahen<br />
Sie Probleme, beziehungsweise Optimierungsbedarf?<br />
Wie setzten Sie die Verbesserungen um? Mussten<br />
Sie gelegentlich auch Abstriche machen?<br />
Bauseits standen funktionelle <strong>und</strong> strukturelle Anpassungen<br />
im Vordergr<strong>und</strong>. Dinge wie eine Brandmeldeanlage oder geerdete<br />
Stecker im ganzen Haus. Als Chef lag mir zudem an<br />
einem kompetenten Team sowie an der guten Zusammenarbeit<br />
mit dem Verwalter, später auch mit der Leitung Pflegedienst.<br />
Ich war übrigens der einzige vollamtliche Chefarzt<br />
am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>!<br />
Für vordringlich hielt ich eine Imagekorrektur bezüglich des<br />
<strong>Spital</strong>s. Nicht wenige Stimmen warnten damals offen vor<br />
einem Eintritt ins <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>. Das wollte ich durch höhere<br />
Qualität unbedingt ändern. 1972 bekam ich ganz unerwartete<br />
Hilfe: Eine Fernsehsendung aus dem <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> mit<br />
TV-Legende Mäni Weber. Regisseur Walter Plüss war mit<br />
<strong>Davos</strong> bestens vertraut: Er war alljährlich am Spengler-Cup<br />
in <strong>Davos</strong> engagiert. Im Rahmen der AO-Kongresse realisierte<br />
er auch regelmässig Eidophor-Operationsübertragungen<br />
vom <strong>Spital</strong> ins Kongresszentrum. Anfänglich wollte ich <strong>von</strong><br />
der TV-Sendung nichts wissen. Aber Landammann Dr. Christian<br />
Jost intervenierte sofort <strong>und</strong> verhinderte damit, dass das<br />
TV-Team eine Übertragung aus dem <strong>Spital</strong> Samedan realisierte.<br />
Wie erlebten Sie den <strong>Spital</strong>alltag <strong>und</strong> das politische<br />
Klima, zum Beispiel in der <strong>Spital</strong>kommission <strong>und</strong> im<br />
Kanton während Ihrer Chefarztjahre? Erinnern Sie<br />
sich an Highlights oder die grössten Stolpersteine?<br />
Als Chefarzt hatte ich lange Zeit weder Einsitz noch beratende<br />
Stimme in der <strong>Spital</strong>kommission. Die kantonalen Behörden<br />
traf ich meist nur, wenn ich mit Landammann Jost<br />
um mehr Geld fürs <strong>Spital</strong> kämpfte. Gemeinsam mit ihm <strong>und</strong><br />
unterstützt vom Verwalter <strong>und</strong> ehemaligen Statthalter der<br />
Landschaft <strong>Davos</strong> Gemeinde, Rudolf Feser, kämpften wir um<br />
Qualität auf allen Ebenen: Im Interesse der Bevölkerung, der<br />
Höhenkliniken <strong>und</strong> des Sport- <strong>und</strong> Kongressortes <strong>Davos</strong>.
Das neue <strong>Spital</strong> kostete schliesslich 30 Mio. Franken, 3 Mio.<br />
Franken weniger als budgetiert. Aussergewöhnlich an diesem<br />
Bau war die geschützte Operationsstelle im Untergeschoss<br />
mit sage <strong>und</strong> schreibe 180 Betten <strong>und</strong> 2 betriebsbereiten<br />
Operationssälen für Katastrophenfälle.<br />
Ich habe die Bauerei äusserst eng <strong>und</strong> intensiv begleitet,<br />
mich dabei aber nicht immer an das oft allzu langwierige<br />
Bewilligungsprozedere der öffentlichen Hand gehalten. So<br />
liess ich den Baukran bereits im Dezember, einige Monate<br />
vor Baubeginn, aufstellen, weil das der Baufirma terminlich<br />
gelegen kam <strong>und</strong> sie deshalb billiger offerierte als im Frühjahr.<br />
Das gab ziemlichen Wirbel!<br />
Nicht konform handelte ich auch beim Einbau der 500 000<br />
Franken teuren Röntgenanlage: Die Lieferfirma bot bei sofortiger<br />
Zusage einen Rabatt <strong>von</strong> 10 Prozent. Das tat ich denn<br />
auch, obwohl der Kredit vom Kanton noch nicht bewilligt<br />
war. Notfalls hätte ich die Anlage halt aus dem eigenen Sack<br />
berappt. Ebenfalls auf eigenes Risiko liess ich den Helilandeplatz<br />
bauen, obwohl die obrigkeitliche Genehmigung<br />
noch ausstand. Landammann Jost war wütend <strong>und</strong> verlangte<br />
den sofortigen Abbruch. Schlussendlich hat gerade er<br />
den Helilandeplatz als Erster benützt: Für einen Verpflegungstransport<br />
in seine Jagdhütte im Sertig …<br />
Politische Niederlagen? Die habe ich inzwischen glücklicherweise<br />
alle vergessen.<br />
Wenn Sie Ihre Zeit als Chefarzt mit heute vergleichen:<br />
Wo sind die grössten Veränderungen (in<br />
Sachen <strong>Medizin</strong>, Ges<strong>und</strong>heitswesen, <strong>Spital</strong>führung<br />
usw.) eingetreten? Was ist aus Ihrer Sicht echter<br />
Fortschritt, was eher eine Gefahr oder Hypothek für<br />
die Zukunft?<br />
Ich bin 1994, mit 62 Jahren <strong>und</strong> 23-jähriger Tätigkeit als<br />
Chefarzt zurückgetreten <strong>und</strong> leitete danach noch sieben<br />
Jahre lang die Abteilung AO International der AO-Stiftung<br />
<strong>Davos</strong>. Gestiegen ist in all diesen Jahren der Einfluss der Ges<strong>und</strong>heitspolitik.<br />
Früher waren hauptsächlich die Chefarztsaläre<br />
umstritten. Heute ist der Spardruck auf die Spitäler<br />
generell enorm. Nach wie vor meine ich, ein Regionalspital<br />
wie <strong>Davos</strong> sollte man wie eine Art Privatunternehmen führen.<br />
Bestimmt hätte man damit wirtschaftlichen Erfolg.<br />
Unglaublich sind die Fortschritte, die die <strong>Medizin</strong> in den<br />
letzten 50 Jahren gemacht hat. Ich bin mir sicher: Diese Entwicklung<br />
geht weiter. Das heisst aber auch: Die Fort-bildung<br />
<strong>und</strong> die Sicherstellung der medizinischen Kompetenz werden<br />
immer schwieriger. Wer als Spezialist in der Peripherie<br />
ohne Anbindung an grosse Zentren mit ihren Forschungsstätten<br />
arbeitet, fühlt sich bald einmal allein gelassen. Sorgen<br />
machen mir die zunehmende Akademisierung der Ges<strong>und</strong>heitsberufe,<br />
die sinkende Bereitschaft, Verantwortung<br />
zu übernehmen, <strong>und</strong> die verschärfte Haftpflichtproblematik.<br />
31
32<br />
Wo sehen Sie das um- <strong>und</strong> teilweise neu gebaute Regionalspital<br />
<strong>Davos</strong> in 20 Jahren? Wird es noch existieren?<br />
Wo liegen Chancen, wo Risiken?<br />
In den 80er-Jahren war ich Präsident der <strong>Spital</strong>ärzte. Damals<br />
habe ich versucht, die optimale <strong>Spital</strong>grösse – auch aus Patientensicht<br />
– zu definieren. Damals wie heute lautet meine<br />
These: Die ausschliesslich verkehrstechnisch bedingten <strong>Spital</strong>standorte<br />
müssen längerfristig aufgegeben werden.<br />
Bündner Ausnahmen sind das Münstertal <strong>und</strong> das Puschlav.<br />
Da muss der «Service Public» in Sachen Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
aufrecht erhalten werden.<br />
Das Einzugsgebiet des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> sollte aus wirtschaftlichen<br />
<strong>und</strong> qualitativen Überlegungen wachsen. Ein Akutspital<br />
mit einem 24-St<strong>und</strong>en-Betrieb müsste meiner Meinung<br />
nach über r<strong>und</strong> 300 Betten verfügen. Weiter wachsen wird<br />
der ambulante Sektor. Ein <strong>Spital</strong> dieser Grössenordnung erleichtert<br />
die Kompetenzerhaltung in Bezug auf die Akutversorgung,<br />
bei der Betreuung <strong>von</strong> Kongressen oder <strong>von</strong> Zweitwohnungsbesitzern,<br />
die dazu ermuntert werden sollten, ihre<br />
Wahloperationen künftig in <strong>Davos</strong> durchführen zu lassen.<br />
Das alles kann nur gelingen, wenn höchste Qualitätsstandards<br />
gelten <strong>und</strong> enge Kontakte zur Forschung bestehen.
Dr. med. Peter Holzach<br />
(* 1946) Ärztlicher Leiter 1994 – 1998, Chefarzt Orthopädie <strong>von</strong> 1994 bis 2001<br />
«Der Sport ist Teil meines Lebens.<br />
Leben ist Bewegung, <strong>und</strong> Bewegung ist Leben.»<br />
Das ist das Credo des Baslers Peter Holzach. Der orthopädische<br />
Chirurg <strong>und</strong> Traumaspezialist treibt selbst gern <strong>und</strong> regelmässig<br />
Sport. Die Region Klosters/<strong>Davos</strong> ist dem begeisterten<br />
Ski- <strong>und</strong> Tourenfahrer seit Jugendtagen vertraut.<br />
Darum wars für ihn ein Glücksfall, dass er sich als junger Assistent<br />
<strong>von</strong> 1973 bis 1975 im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> beim Chirurgen<br />
<strong>und</strong> Chefarzt, Dr. Peter Matter, weiterbilden konnte.<br />
Ein Glück wars auch, dass er den Leutnantsgrad im <strong>Spital</strong><br />
<strong>Davos</strong> abverdienen <strong>und</strong> alle militärischen Wiederholungskurse<br />
dort absolvieren durfte. «Das habe ich Peter Matter zu<br />
verdanken. Er sorgte dafür, dass das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> <strong>von</strong> der<br />
Armee als Ausbildungsort anerkannt wurde.»<br />
Hinaus in die Welt <strong>und</strong> zurück nach <strong>Davos</strong><br />
Um ein Haar wäre aus dem Assistenten Holzach ein<br />
Ohren-, Nasen- <strong>und</strong> Halsarzt geworden. «Ich hatte in Basel<br />
bereits eine Stelle in Aussicht.» Aber wieder wars der <strong>Davos</strong>er<br />
<strong>Spital</strong>chefarzt Peter Matter, der ihm zur Fachrichtung<br />
Chirurgie riet – «obwohl ich eigentlich eher Angst vor der<br />
Ellbogenmentalität der Chirurgen hatte.»<br />
Nach mehreren Ausbildungsjahren im südafrikanischen Kapstadt,<br />
in Delémont <strong>und</strong> Basel wurde das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> für<br />
Peter Holzach plötzlich wieder aktuell: «Professor Matter<br />
wünschte sich für sein Chirurgenteam mehr Konstanz <strong>und</strong><br />
suchte darum einen Partner.» Eine <strong>Davos</strong>er Delegation reiste<br />
deshalb eigens nach Basel <strong>und</strong> verhandelte mit Peter Holzachs<br />
damaligem Chef <strong>und</strong> AO-Mitbegründer, Professor Martin<br />
Allgöwer. Nach Bereinigung einiger offener Fragen kam<br />
der Vertrag schliesslich zustande.<br />
Von 1983 bis 1994 wirkte Peter Holzach als Co-Chefarzt am<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>. Dann wurden gleich zwei Chefarztstellen als<br />
Nachfolgeregelung für den scheidenden Peter Matter ausgeschrieben:<br />
Eine für Allgemeinchirurgie <strong>und</strong> eine für Orthopädie.<br />
Peter Holzach, der sich in der Zwischenzeit an der<br />
Zürcher Schulthess Klinik in Orthopädie <strong>und</strong> Traumatologie<br />
weitergebildet hatte, wurde im Sommer 1994 zum Chefarzt<br />
Orthopädie gewählt.<br />
Der bisherige Oberarzt Chirurgie am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>, Christian<br />
Ryf, übernahm die Funktion des Chefarztes für allgemeine<br />
Chirurgie. Bis heute ist Peter Holzach beeindruckt, wie rasant<br />
sein Vorgänger, Peter Matter, seinerzeit das Büro<br />
räumte: «Das dauerte nur gerade einen Tag. Am nächsten<br />
Morgen sass ich bereits in diesem Raum.»<br />
Neue Zeiten, neuer Führungsstil, neue Schwerpunkte<br />
«Rein fachlich gesehen waren Christian Ryf <strong>und</strong> ich gut auf<br />
unsere neue Aufgabe in der <strong>Spital</strong>leitung vorbereitet», hält<br />
Peter Holzach rückblickend fest. Gefehlt habe ihnen jedoch<br />
das Managementwissen. «Professor Peter Matter hat ‹sein›<br />
<strong>Spital</strong> hierarchisch geführt. Er war klar der Chef. Wir ande-<br />
33
34<br />
ren profitierten vom Freiraum, zum Beispiel für Weiterbildung<br />
<strong>und</strong> Publikationen.»<br />
Nun aber war er plötzlich selbst ärztlicher Leiter des <strong>Spital</strong>s<br />
<strong>und</strong> sah sich mit der ungewohnten Rolle des Managers konfrontiert.<br />
«Auf so etwas wurde ich während meiner Aus-<br />
bildung nicht vorbereitet.» Erst seit Kurzem gebe es<br />
Managementkurse für Assistenzärztinnen <strong>und</strong> -ärzte. Zusammen<br />
mit Christian Ryf wollte er das <strong>Spital</strong> partizipativ<br />
<strong>und</strong> teambezogen führen. «Wir liessen Entscheidungen gemeinsam<br />
evaluieren. Sie sollten nicht mehr wie früher per<br />
Anordnung durchgesetzt werden.» Das sei für viele eine<br />
grosse Umstellung gewesen. «Manche hatten anfänglich<br />
Mühe, besonders auch wegen der Verantwortung, die sie<br />
nun mittragen mussten.»<br />
Stark vom neuen Führungsstil betroffen war der langjährige<br />
Verwalter, Emil Lehmann. Er wurde zwar zum Direktor des<br />
<strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> befördert, fühlte sich aber in seiner neuen<br />
Rolle unbehaglich <strong>und</strong> <strong>von</strong> zu viel Autonomie überfordert.<br />
«Wir Chefärzte konnten ihm nicht helfen. In Betriebswirtschaft<br />
<strong>und</strong> Administration waren wir nicht kompetent.» Mit<br />
<strong>Spital</strong>direktor Markus Gautschi sei dann aber ein Nachfolger<br />
eingestellt worden, der mit dem Führungsstil der neuen<br />
Chefärzte problemlos zurecht kam.<br />
Als ärztlicher Leiter des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> hat Peter Holzach die<br />
Orthopädie <strong>und</strong> die Prothetik inklusive Osteotomie ausge-<br />
baut. Patienten, die Kunstgelenke brauchten, blieben damit<br />
dem <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> erhalten <strong>und</strong> wanderten nicht mehr in andere<br />
Spitäler ab. «Das hat uns einen deutlichen Patientenzuwachs<br />
gebracht. Zudem konnten wir so die flaue Zwischensaison<br />
überbrücken.» Diskutiert habe man auch die<br />
Einführung der plastischen Chirurgie in <strong>Davos</strong>, ein Gedanke,<br />
der wieder fallen gelassen wurde. «Zum Erfolg wurden die<br />
durch mich bereits 1983 eingeführten, arthroskopischen<br />
Eingriffe am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>. Wir erlebten einen regelrechten<br />
Boom. Ich selber habe mir damit einen Namen machen können.»<br />
Weniger begeistert habe die Kantonsregierung reagiert:<br />
«Sie hat den Kredit für die Arthroskopie-Geräte in<br />
Höhe <strong>von</strong> r<strong>und</strong> 30 000 Franken nicht bewilligt. Darum<br />
haben wir sie halt aus der eigenen Tasche berappt …»<br />
Ebenfalls aus privaten Quellen wurde ein Computertomograph<br />
(CT) finanziert. «Wir wollten unbedingt die Qualität<br />
der Diagnostik am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> verbessern <strong>und</strong> dazu einen<br />
CT anschaffen.» Doch die Ges<strong>und</strong>heitsdirektion des Kantons<br />
Graubünden habe auch diese Finanzierung abgelehnt. «Anträge<br />
aus <strong>Davos</strong> wurden nicht selten als Vorpreschen empf<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> vom zuständigen Regierungsrat abgelehnt.»<br />
«Mit den ‹Halbgöttern in Weiss› ist es vorbei»<br />
Während seiner Zeit als Chefarzt am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>, in den<br />
Jahren zwischen 1994 <strong>und</strong> 2001, habe sich das Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
tiefgreifend verändert, stellt Peter Holzach fest.<br />
Neue Akteure, die Politik <strong>und</strong> die Wirtschaft, seien vermehrt
in Erscheinung getreten. «Auch die Interventionen der Versicherungen<br />
waren einschneidend, <strong>und</strong> die Rolle der Ärzte<br />
wurde oft sehr kritisch beurteilt.» Die Krankenpflege sei zur<br />
Pflegewissenschaft geworden – sogar mit eigener Hochschulprofessur.<br />
Deutlich gewachsen sei das Selbstbewusstsein der Patienten:<br />
«Mit den ‹Halbgöttern in Weiss› ist es vorbei.» Dank<br />
Medien <strong>und</strong> Internet seien die Patienten meist sehr gut informiert.<br />
«Viele bringen ihre Internet-Informationen gleich<br />
ausgedruckt in die Sprechst<strong>und</strong>e mit.» Das sei eine Herausforderung,<br />
nicht zuletzt für junge Ärzte mit wenig Kommunikationserfahrung.<br />
Nicht nur in der Wirtschaft, auch im Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
herrsche heute Wettbewerb mit kurzfristigen Zielen, mit Erfolgsdruck<br />
<strong>und</strong> dem Zwang zur Gewinnmaximierung, stellt<br />
Chirurg Holzach fest. «Werte wie Verantwortungsbewusstsein,<br />
Arbeitsethos <strong>und</strong> Treue haben ausgedient.» Die Komplexität<br />
des Arztberufes habe stark zugenommen. Doch der<br />
gesellschaftliche Wandel erschwere die medizinische Ausbildung:<br />
«Angehende <strong>Medizin</strong>erinnen <strong>und</strong> <strong>Medizin</strong>er sollten<br />
nicht mehr bloss ärztliches Handwerk lernen, sondern in<br />
Management, Ökonomie, analytischem Denken, Ethik <strong>und</strong><br />
medienwirksamem Auftreten geschult werden.» Das sei<br />
kaum möglich: «Die Ausbildung bleibt zwar gleich lange,<br />
aber bei deutlich kürzeren Arbeitszeiten.»<br />
Seit seinem Weggang <strong>von</strong> <strong>Davos</strong> im Jahr 2001 arbeitet der<br />
Traumaspezialist <strong>und</strong> orthopädische Chirurg Peter Holzach<br />
in Zürich, in der SportClinic an der Klinik Hirslanden. Die Entwicklung<br />
im Ges<strong>und</strong>heitswesen beschäftigt ihn aber auch<br />
weiterhin. Dessen wachsende Instabilität führe zu steigender<br />
Verunsicherung bei Ärzteschaft <strong>und</strong> Pflegenden, sagt<br />
Holzach. «Das beeinträchtigt die Qualität der Patientenbetreuung.»<br />
Das Patienten-Arzt-Verhältnis habe sich verschlechtert.<br />
Mehr <strong>und</strong> mehr halte der «Dienst nach Vorschrift»<br />
auch in Spitälern Einzug, vor allem in grösseren,<br />
staatlich subventionierten Häusern, weniger in kleineren Spitälern<br />
oder Privatkliniken.<br />
Das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> hat Zukunft<br />
Auf die Frage, ob er glaube, dass das mittlerweile r<strong>und</strong>um erneuerte<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> auch in 20 Jahren noch existiere, antwortet<br />
Peter Holzach mit einem dezidierten Ja. «Daran zweifle ich<br />
nicht – trotz der vermehrten Zentralisierung der <strong>Spital</strong>standorte<br />
im Kanton Graubünden.» Dafür sorge allein schon die exzentrische<br />
Lage <strong>von</strong> <strong>Davos</strong>. «Hinzu kommt noch der riesige Anfall<br />
an Sportverletzungen während der Wintermonate.»<br />
Peter Holzach hofft, dass das modernisierte <strong>Spital</strong> mit<br />
Wärme <strong>und</strong> Ausstrahlung überzeugt: «Es sollte ein <strong>Spital</strong><br />
für alle, für die ganze Bevölkerung sein.» ISO-Zertifikate <strong>und</strong><br />
Qualitätssiegel allein seien keine Erfolgsgaranten. «Oft sind<br />
das bloss teure Papiertiger. Menschliche Zuwendung <strong>und</strong><br />
Einsatzbereitschaft fördern sie kaum bis gar nicht.»<br />
35
36<br />
Dr. med. Christian Ryf<br />
(*1955) Ärztlicher Leiter 1999 – 2007, Chefarzt Chirurgie seit 1994<br />
Lockruf vom «chirurgischen Juwel in den Alpen»<br />
Es sei kein leichter Entscheid gewesen, damals, im Jahr<br />
1993, als ihn Professor Peter Matter in Chur anrief <strong>und</strong> ihm<br />
die neu bewilligte Oberarztstelle am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> anbot, erinnert<br />
sich Christian Ryf. «Peter Matter kannte mich aus<br />
meiner Assistentenzeit in den Jahren 1984/ 85. Danach ging<br />
ich ans Kantonsspital Chur.» Trotz seines Babyboomer-Jahrgangs<br />
1955 habe er dort rasch Karriere gemacht. «Offenbar<br />
war ich zur rechten Zeit am rechten Ort <strong>und</strong> wurde unter<br />
den Professoren Thomas Rüedi <strong>und</strong> Adrian Leutenegger<br />
bald Oberarzt Chirurgie.» Das Kantonsspital Chur, eine <strong>von</strong><br />
sieben Schweizer Kliniken, hatte A-Status in der Chirurgie-<br />
Ausbildung, das Regionalspital <strong>Davos</strong> hingegen bloss Status<br />
B. Chirurg Christian Ryf wollte fachlich nicht zurückstecken<br />
<strong>und</strong> auch nicht allzu lange Oberarzt bleiben.<br />
«Ich tat mich schwer mit dem Entscheid», gesteht Christian<br />
Ryf. «Mein Chef in Chur, Thomas Rüedi, wollte mich gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
behalten, riet mir aber zum Umstieg an eine Universitätsklinik<br />
mit Habilitation oder zur Weiterbildung in Wirbelsäulen-<br />
<strong>und</strong> Beckenchirurgie in den USA.» Beides sei<br />
verlockend gewesen. Doch habe er auch auf seine junge Familie<br />
Rücksicht nehmen wollen.<br />
1994 brachte ein erneuter Anruf aus <strong>Davos</strong> die Klärung:<br />
Diesmal rief Kollege Peter Holzach an. Er war gerade zum<br />
neuen Chefarzt des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> <strong>und</strong> Nachfolger <strong>von</strong> Peter<br />
Matter ernannt worden. «Er wollte mich als gleichberech-<br />
tigten Partner <strong>und</strong> Co-Chefarzt an Bord nehmen», sagt<br />
Christian Ryf. «Eine ganze Nacht lang haben wir miteinander<br />
diskutiert. Dann wusste ich: Ich wollte sein Angebot annehmen.»<br />
<strong>Davos</strong> habe in <strong>Medizin</strong>erkreisen schon immer als<br />
«chirurgisches Juwel in den Alpen» gegolten, als Kompetenzzentrum<br />
für Traumatologie. «Von Vorteil war auch die<br />
Nähe zur Frakturenforschung am AO-Zentrum <strong>Davos</strong>.»<br />
Eine Klinik, zwei Chefärzte, viel Erfolgsdruck<br />
Die beiden Chirurgen beschlossen, ein neues Konzept zu<br />
realisieren: «Ab 1994 war das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> das erste Schweizer<br />
<strong>Spital</strong>, wo Chirurgie <strong>und</strong> Orthopädie in einer Klinik mit<br />
zwei gleichrangigen Chefärzten vereint waren.» Dieses Modell<br />
sei später <strong>von</strong> anderen Krankenhäusern übernommen<br />
worden, sagt Christian Ryf.<br />
Bei Antritt seiner Chefarztstelle in <strong>Davos</strong> habe er eine «bipolare<br />
Situation» angetroffen: «Einerseits waren die Abläufe top<br />
durchorganisiert, das Renommee des <strong>Spital</strong>s exzellent. Gleichzeitig<br />
standen wir als Nachfolger des erfolgreichen Chirurgen,<br />
des Präsidenten der Schweizerischen Chirurgischen Gesellschaft,<br />
Peter Matter, unter extremem Erfolgsdruck. Dem hatten<br />
Peter Holzach <strong>und</strong> ich standzuhalten.» Mit nur gerade 39<br />
Jahren sei er schweizweit einer der jüngsten Chefärzte Chirurgie<br />
gewesen. «Geholfen haben mir das Vertrauen <strong>von</strong><br />
Peter Holzach <strong>und</strong> das gute Verhältnis zu ihm.» Jeden Morgen<br />
hätten sie sich vor Arbeitsbeginn zu einem viertelstündigen<br />
Gedankenaustausch getroffen. «Das war sehr nützlich.»
In Führungsfragen waren sich Peter Holzach, der ärztliche<br />
Leiter, <strong>und</strong> sein Partner Christian Ryf einig: «Zu Peter Matters<br />
Zeiten dachte <strong>und</strong> lenkte ein einziger Kopf. Die übrigen<br />
folgten ihm. Doch diese patriarchalisch geführte Grossfamilie<br />
war nun Vergangenheit.» Sie beide delegierten Verantwortung<br />
<strong>und</strong> forderten Partizipation auf allen Stufen ein.<br />
Ein Glücksfall war, dass Peter Holzach die minimal invasive<br />
Operationstechnik, die sogenannte «Schlüssellochchirurgie»,<br />
schon sehr früh im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> eingeführt hatte, sagt Christian<br />
Ryf: «Auf diesem Gebiet brachte ich aus meinen Churer<br />
Jahren einen gut gefüllten Rucksack mit <strong>und</strong> konnte gleich<br />
‹mitboomen›!» Skeptisch hätten anfänglich einzig die Operationsteams<br />
reagiert. «Sie fürchteten die überlangen Operationen,<br />
die damals noch häufig die Regel waren.» Doch bei seinem<br />
ersten derartigen Eingriff im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> habe er Riesenglück<br />
gehabt: «Minimal invasiv entfernte ich eine Gallenblase,<br />
<strong>und</strong> das in 16 Minuten statt in den üblichen vier St<strong>und</strong>en!»<br />
Damit habe er das Team für die neue Methode gewonnen gehabt.<br />
Im Verlauf der Jahre seien r<strong>und</strong> 100 000 Franken in Geräte<br />
für minimal invasive Operationen investiert worden.<br />
«Natürlich muss man in einem peripher gelegenen Regionalspital<br />
wie <strong>Davos</strong> beim Leistungskatalog Abstriche machen»,<br />
konstatiert Christian Ryf. Hier gebe es keine Pathologie, keine<br />
Schnellschnittdiagnostik, keine Radiologie, keine Onkologie.<br />
Dazu fehle die nötige Infrastruktur. «Doch mehr als entschädigt<br />
werden wir Chirurgen durch die Unfallchirurgie.» Be-<br />
sonders wichtig ist Christian Ryf die enge Kooperation des<br />
<strong>Spital</strong>s mit dem nahen AO-Forschungszentrum: «Meist sind<br />
<strong>und</strong> waren wir die Ersten, die Prototypen aus der AO-Entwicklungsabteilung<br />
nutzten.» Für Ryf ist dies gewissermassen<br />
das «universitäre Salz <strong>und</strong> Pfeffer am Alpenspital».<br />
Ambivalente Erfahrungen mit Politik<br />
Am 1. Januar 1999 löste Christian Ryf seinen Kollegen Peter<br />
Holzach in seiner Funktion als ärztlicher Leiter des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong><br />
ab <strong>und</strong> hatte vermehrt Kontakt mit der Politik. Seine Erfahrungen<br />
seien ambivalent gewesen, meint er rückblickend. Als<br />
befruchtend habe er die Kooperation mit der <strong>Davos</strong>er <strong>Spital</strong>kommission<br />
(SPIKO) erlebt: «<strong>Davos</strong> war immer stolz auf sein<br />
<strong>Spital</strong> <strong>und</strong> hat dessen Entwicklung bejaht.» Ganz andere Zeichen<br />
seien <strong>von</strong> kantonaler Seite gekommen. «In meinen ersten<br />
vier Jahren am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> hatte ich keinen Vertrag vom<br />
Kanton.» Der damalige Regierungsrat habe das Konzept mit<br />
zwei Chefs an der Spitze des <strong>Davos</strong>er <strong>Spital</strong>s nicht goutiert.<br />
Inzwischen habe sich die Situation entspannt. «Der Dialog mit<br />
der Kantonsregierung ist heute deutlich konstruktiver.»<br />
Belastend sei der Kostendruck im Ges<strong>und</strong>heitswesen <strong>und</strong><br />
der damit verb<strong>und</strong>ene Sparzwang gewesen, stelle Ryf fest.<br />
Das Sparen habe sich auch stark auf die ärztlichen Einkommen<br />
ausgewirkt. «Während der letzten 15 Jahre sind die<br />
Patientenzahlen des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> um 30 Prozent gestiegen.<br />
Mein Chefarztsalär hat sich gleichzeitig um 20 Prozent verringert.»<br />
Jeder seiner insgesamt fünf Arbeitsverträge sei<br />
schlechter gewesen als sein Vorläufer.<br />
37
38<br />
Keinerlei Entschädigung habe es für die Managementaufgaben<br />
als ärztlicher Leiter gegeben, obwohl diese Zusatzfunktion<br />
ausserordentlich zeitaufwendig <strong>und</strong> belastend<br />
gewesen sei. «Am meisten beanspruchten mich Personalfragen.»<br />
Der kreative Spielraum im Rahmen dieser Leitungsfunktion<br />
sei dagegen eher gering.<br />
Sanierungszeit, harte Zeit<br />
Deutlich mehr Kreativität habe die planerische Begleitung<br />
der <strong>Spital</strong>sanierung ab Baubeginn im Jahr 2004 verlangt,<br />
sagt Christian Ryf. Diese Phase sei zwar sehr spannend, aber<br />
gelegentlich auch mehr als nur fordernd gewesen. «Patienten<br />
<strong>und</strong> Personal wurden bis zur Toleranzgrenze gestresst.»<br />
Früher, vor Beginn der mehrjährigen Umbau- <strong>und</strong> Sanierungsarbeiten,<br />
habe man während der Zwischensaison<br />
durchatmen können. «In den letzten vier Jahren ging das<br />
nicht mehr. Wir mussten <strong>von</strong> Provisorium zu Provisorium zügeln,<br />
bei Baulärm <strong>und</strong> Dreck.»<br />
Gefragt, ob es nicht einfacher gewesen wäre, das alte <strong>Spital</strong><br />
abzureissen <strong>und</strong> den Betrieb in eine der ehemaligen Hochgebirgskliniken<br />
auszulagern, meint Christian Ryf: «Ein Abriss<br />
wäre zu teuer gewesen, <strong>und</strong> vor 2004 war eine Auslagerung<br />
gar nicht möglich: Da existierten die Kliniken ja noch!»<br />
Gespannt ist Christian Ryf nun, wie sich das vor Jahren erarbeitete<br />
Raumprogramm für das sanierte <strong>Spital</strong> bewährt:<br />
«Bekannt war damals ja nur die IST-Situation. Doch wie<br />
kann man wissen, was in zehn Jahren sein wird?»<br />
Neuer Abschnitt in Sicht<br />
Per Ende Dezember 2007 hat Christian Ryf die ärztliche Leitung<br />
des <strong>Spital</strong>s abgegeben, ist aber weiterhin Chefarzt Chirurgie.<br />
«Die Führungsstruktur des <strong>Spital</strong>s hat sich geändert»,<br />
sagt er. Chef Executive Officer (CEO) sei neu Direktor Markus<br />
Hehli. Er habe den Vorsitz in der sechsköpfigen <strong>Spital</strong>leitung<br />
mit je zwei Vertretungen der Ärzteschaft <strong>und</strong> des Pflegebereichs<br />
sowie mit dem Finanzchef des <strong>Spital</strong>s. Er selbst, so Ryf,<br />
habe jetzt wieder mehr Freiraum gewonnen <strong>und</strong> den Sessel<br />
für jüngere Kräfte geräumt. «Nun können sie selber <strong>von</strong> der<br />
Oppositions- in die Entscheidungsrolle hineinwachsen.»<br />
Die Zukunftschancen des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> seien intakt, meint<br />
Ryf. Mit Zustimmung der Bevölkerung habe man glücklicherweise<br />
rechtzeitig antizyklisch in die Sanierung <strong>und</strong> Erweiterung<br />
investieren können, obwohl das <strong>Spital</strong>einzugsgebiet<br />
aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich zu klein sei. Doch<br />
der Tourismus mildere diesen Mangel.<br />
Auf Dauer werde man wohl auch im Kanton Graubünden<br />
einige kleine Spitäler aufgeben müssen, sagt Ryf. Doch noch<br />
mangle es am nötigen Veränderungswillen. Das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
hingegen, da<strong>von</strong> ist Christian Ryf überzeugt, werde auch in<br />
20 Jahren noch existieren. «Erfolgsgaranten sind Familiarität<br />
<strong>und</strong> Intimität. Das sind unsere beiden grossen Stärken.<br />
Sie müssen aber tagtäglich gelebt werden. Gefährlich wirds,<br />
wenn nur noch das eigene Ego, die Erfüllung individueller<br />
Wünsche <strong>und</strong> das Geld zählen.»
40<br />
Neue Zeiten, neue Führung<br />
(*1965) Im Gespräch: Direktor Markus Hehli<br />
Im Jahr 2001 haben Sie die Leitung des <strong>Spital</strong>s<br />
<strong>Davos</strong> übernommen. Nur zwei Jahre später begann<br />
die r<strong>und</strong> 50 Mio. Franken teure Sanierung des <strong>Spital</strong>s.<br />
Wie fühlen Sie sich jetzt, nach Abschluss der<br />
5-jährigen Bauzeit?<br />
Natürlich glücklich, dass alles so gut abgelaufen ist! Stolz<br />
<strong>und</strong> Freude sind bei allen Verantwortlichen spürbar. Die eigentliche<br />
Leitung hatte eine sechsköpfige Baukommission<br />
mit mir als Projektleiter, das vierköpfige Architektenteam,<br />
zwei Bauleiter, zirka zehn Fachplaner, der IT-Verantwortliche<br />
(IT = Information Technolgy, die Verf.), zwei Vertreter des<br />
Technischen Dienstes am <strong>Spital</strong> <strong>und</strong> sechs bis acht direktinvolvierte<br />
Benutzer entsprechend der jeweiligen Bauphase.<br />
War das etappierte Vorgehen zur Realisierung des<br />
Projekts richtig? Wäre die <strong>Spital</strong>verlegung mit Neubau<br />
nicht optimaler gewesen?<br />
2001, als ich zum <strong>Spital</strong>leiter ernannt wurde, war das Sanierungsprojekt<br />
bereits weithin vorgegeben. Zudem waren<br />
damals noch alle <strong>Davos</strong>er Höhenkliniken in Betrieb.<br />
Bauland für einen <strong>Spital</strong>neubau gab es nicht. Ausserdem<br />
hätte ein Neubau mindestens 80 bis 90 Mio. Franken gekostet.<br />
Der Kredit zur <strong>Spital</strong>sanierung mit Um- <strong>und</strong> Neubauten<br />
hingegen belief sich auf «bloss» 46,6 Mio Franken.<br />
Hinzu kam noch ein Nachtragskredit in Höhe <strong>von</strong> einer Million<br />
Franken, unter anderem wegen Problemen mit qualitativ<br />
ungenügenden Fenstern, die ersetzt werden mussten<br />
<strong>und</strong> unterschätzten Bauprovisorien. Diesen Kostenrahmen<br />
werden wir einhalten können.<br />
Was war die grösste Belastung in diesen 5 Jahren?<br />
Gabs gelegentlich auch Augenblicke, wo Sie kaum<br />
mehr weiter wussten?<br />
Die grösste Belastung war zweifellos die Doppelbelastung<br />
durch Projektleitung <strong>und</strong> das <strong>Spital</strong>management. Im Gegensatz<br />
zum Umbau des Kantonsspitals Chur hat man in<br />
<strong>Davos</strong> auf einen eigentlichen Projektleiter verzichtet. Aber<br />
ich gebe zu: Die Projektleitung reizte mich, nicht zuletzt<br />
wegen meiner früheren Tätigkeit in der Industrie, wo ich bereits<br />
Erfahrung mit Grossprojekten sammeln konnte. Bald<br />
zeigte sich auch, dass die Personalunion durchaus auch Vorteile<br />
bei der Projektumsetzung hatte.<br />
Während der ganzen Bauzeit musste bekanntlich der<br />
reguläre <strong>Spital</strong>betrieb aufrecht erhalten werden.<br />
Wie brachten Sie Baubegleitung <strong>und</strong> übrige Managementaufgaben<br />
unter einen Hut?<br />
Nur durch strikte Konzentration auf Prioritäten! Glücklicherweise<br />
wurde ich durch Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
stark unterstützt <strong>und</strong> entlastet. Mein Stellvertreter,<br />
Finanzchef Fritz Brand, überwachte den <strong>Spital</strong>betrieb aus<br />
Finanzsicht. Meine Direktionsassistentinnen, zuerst Ladina<br />
Ambühl, jetzt Susanne Selitto, waren mir eine grosse Hilfe,<br />
ebenso Christian Schwendener, stellvertretender Projektleiter<br />
<strong>und</strong> Leiter Technischer Dienst des <strong>Spital</strong>s.
Natürlich gerieten Bauplanung <strong>und</strong> Betriebsbedürfnisse häufig<br />
in einen Clinch. Essenziell waren darum eine rechtzeitige,<br />
umfassende Information über jede Bauphase <strong>und</strong> das<br />
möglichst optimale Timing betriebsinterner Provisiorien. Natürlich<br />
mussten wir alle ständig Tausende <strong>von</strong> Kompromissen<br />
machen.<br />
Zum Glück gabs weder auf der Baustelle noch im Betrieb<br />
einen gravierenden Unfall. Auch die Beanstandungen <strong>von</strong><br />
Patientenseite hielten sich in Grenzen. Auch in diesem Bereich<br />
versuchten wir, mit kleinen Aufmerksamkeiten etwas<br />
Goodwill zu schaffen.<br />
Nicht einfach waren die fünf Baujahre für meine Familie,<br />
meine Frau, meine Tochter <strong>und</strong> die beiden Buben. Sie haben<br />
mich nicht sehr oft zu sehen bekommen.<br />
Wenn Sie heute in die Bündner <strong>Spital</strong>landschaft<br />
schauen: Welchen Listenplatz belegt das sanierte<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> mit den 8000 Quadratmetern Nutzfläche,<br />
75 Betten <strong>und</strong> einem Personalbestand <strong>von</strong> r<strong>und</strong><br />
300 Köpfen? Ist die aktuelle Grösse aus bewirtschaftlicher<br />
Sicht richtig?<br />
Aufgr<strong>und</strong> seiner Grösse rangiert das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> hinter dem<br />
Kantonsspital Chur, den Spitälern Ilanz <strong>und</strong> Samedan auf<br />
Platz 4. Dank der heutigen Top-Infrastruktur, dem touristischen<br />
Gewicht <strong>und</strong> einem Notfalldienst mit 8000 Fällen pro<br />
Jahr rückt es vielleicht sogar auf Platz 3.<br />
Ausgelegt ist das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> auf ein Marktpotenzial <strong>von</strong><br />
insgesamt r<strong>und</strong> 40 000 Einheimischen <strong>und</strong> Gästen. Rein betriebswirtschaftlich<br />
gesehen ist es noch immer ein zu kleines<br />
<strong>Spital</strong>. Denn je kleiner ein <strong>Spital</strong>, desto tiefer liegen die Fallzahlen<br />
<strong>und</strong> die Kosten pro Fall nehmen tendenziell zu. Früher<br />
war die Bettenzahl das entscheidende Finanzierungskriterium.<br />
Heute werden die Spitäler mittels Fallpauschalen<br />
entschädigt.<br />
Diese Art <strong>von</strong> Finanzsteuerung ist eine gefährliche. Ein <strong>Spital</strong><br />
wie <strong>Davos</strong> hat zwangsläufig geringe Fallzahlen, muss<br />
wegen seiner exzentrischen Lage in einem Tourismusort<br />
aber gerade die beiden teuersten <strong>Spital</strong>einrichtungen betreiben:<br />
Den Notfalldienst <strong>und</strong> Operationsräume für orthopädische<br />
Eingriffe <strong>und</strong> Allgemeinchirurgie. Die <strong>Spital</strong>defizite<br />
aber gehen zulasten der Steuerzahler. Also müssen Politik<br />
<strong>und</strong> Bevölkerung schlussendlich entscheiden, wie viel ihnen<br />
ein <strong>Spital</strong> vor der Haustüre wert ist <strong>und</strong> was sie dafür zu<br />
zahlen bereit sind.<br />
Früher wurde das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> wesentlich anders<br />
geführt als heute: Die Chefärzte waren die patronalen<br />
Chefs. Darauf folgte die «Dreibein»-Führung mit<br />
Ärztlicher Leitung, Leitung Pflegedienst <strong>und</strong> Verwaltung.<br />
Seit neuestem führt der Direktor eine<br />
6-köpfige <strong>Spital</strong>leitung mit je zwei Vertretungen der<br />
Ärzteschaft, des Pflegedienstes <strong>und</strong> der Verwaltung.<br />
Seit wann ist das so? Wo liegen die Vorteile der Neu-<br />
41
42<br />
organisation, <strong>und</strong> wie funktioniert die Schnittstelle<br />
zur Politik?<br />
Die neue, heute 7-köpfige <strong>Spital</strong>leitung wurde am 1. September<br />
2007 eingeführt. Das entsprechende <strong>Spital</strong>leitungsreglement<br />
wurde am 18. April 2008 <strong>von</strong> der <strong>Spital</strong>kommission<br />
(SPIKO) bewilligt. Es enthält den eigentlichen Auftrag an<br />
die <strong>Spital</strong>leitung. Die Zustimmung des Kleinen <strong>und</strong> Grossen<br />
Landrates der Landschaft <strong>Davos</strong> Gemeinde steht noch aus.<br />
Die <strong>Spital</strong>leitung ist zuständig für das operative Geschäft<br />
<strong>und</strong> die Erarbeitung der Strategie, die dann <strong>von</strong> der SPIKO<br />
zu genehmigen ist. Als Direktor habe ich Einsitz in der<br />
SPIKO. Zur Behandlung <strong>von</strong> Sachgeschäften können weitere<br />
Fachleute beigezogen werden.<br />
Der SPIKO-Präsident, bisher Landrat Dr. Andrea Meisser, amtet<br />
wie der Delegierte eines Verwaltungsrates. Mit ihm treffe ich<br />
mich jede Woche zu einer einstündigen Orientierung. Die Zusammenarbeit<br />
mit den politischen Instanzen ist gut.<br />
Die <strong>Spital</strong>sanierung ist abgeschlossen. Ist jetzt auch<br />
die Strategie des <strong>Spital</strong>s für die kommenden Jahre<br />
definiert? Oder bestimmt allein der Kanton Graubünden<br />
per Leistungsauftrag, wos künftig langgehen<br />
soll?<br />
Im Gegensatz zu früher ist der geltende Leistungsauftrag<br />
nicht mehr so einschränkend. Er umschreibt zwar die zentralen<br />
Aufgaben des <strong>Spital</strong>s, lässt uns aber freie Hand, zu-<br />
sätzliche Aktionsfelder aufgr<strong>und</strong> unserer Stärken zu definieren.<br />
Denkbar wäre zum Beispiel der Ausbau der Orthopädie,<br />
genauer, der Prothetik, also der Eingriffe zum Gelenkersatz,<br />
die ja oft Wahloperationen sind.<br />
Der kantonale Leistungsauftrag ist aber nicht identisch mit<br />
der Strategie des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>. Die Strategieentwicklung auf<br />
Ebene Vision ist zurzeit im Gange. Bis September 2008 soll<br />
ein Strategiepapier vorliegen, das unsere Ziele, Produkte <strong>und</strong><br />
Geschäftsfelder, Werte <strong>und</strong> Werthaltungen sowie die interne<br />
<strong>und</strong> externe Kommunikationsstrategie definieren wird.
44<br />
Kaderärztekonferenz<br />
Interdisziplinäre<br />
Arztdienste<br />
Dr. med. D. Hübner*<br />
Anästhesie<br />
Radiologie<br />
MTRA<br />
Konsiliarärzte<br />
Spezielle ärztliche<br />
Dienste<br />
<strong>Medizin</strong><br />
Dr. med. G. Niedermaier*<br />
Chefsekretariat<br />
<strong>Medizin</strong><br />
<strong>Medizin</strong><br />
Pädiatrie<br />
Intensivstation<br />
Pneumologie<br />
Sportmedizin<br />
Funktionsdienst<br />
SS-Assistenz/ Dialyse<br />
Rettungsdienst<br />
Labor<br />
Konsiliarärzte<br />
QM-Leitung<br />
Hygienekommission<br />
Chirurgie / Orthopädie<br />
Dr. med. P. Rillmann*<br />
Chefsekretariat<br />
Chirurgie / Orthopädie<br />
Chirurgie / Orthopädie<br />
Physiotherapie<br />
Konsiliarärzte<br />
Gynäkologie /<br />
Geburtshilfe<br />
ORL<br />
Notfallstation<br />
<strong>Spital</strong>kommission<br />
Dr. A. Meisser<br />
<strong>Spital</strong>leitung<br />
Direktor M. Hehli<br />
Pflege Spezialbereiche<br />
S. Heine*<br />
Intensivpflege<br />
Tagesklinik<br />
Notfallpflege<br />
PD Operationssäle<br />
Lagerungspflege / Gips<br />
Anästhesiepflege<br />
Rettungsdienst
Kaderkonferenz SPIDA<br />
Arzneimittelkommission<br />
IT-Kommission<br />
Pflegekaderkonferenz<br />
Pflege Bettenstationen<br />
B. Heeb*<br />
Patientendisposition<br />
Sekretariat PD<br />
Bildung<br />
Abteilung D, Hebammen<br />
Abteilung C<br />
Abteilung B<br />
Langzeitpflegestation<br />
Administration / Dienste<br />
M. Hehli*<br />
Direktionsassistenz<br />
Technischer Dienst<br />
Personalwesen<br />
Hotellerie / Ökonomie<br />
Informatik<br />
Finanz / Patientenadm.<br />
Fritz Brand*<br />
Patientenadmin.<br />
Buchhaltung<br />
Zentralmagazin<br />
Apotheke<br />
Zentralsekretariat<br />
Legende:<br />
* Mitglied der <strong>Spital</strong>leitung<br />
Konferenz (beratend)<br />
Stabsstelle/-kommissionen<br />
Operative<br />
Funktionseinheit<br />
45
46<br />
Investitionen – einst <strong>und</strong> jetzt<br />
<strong>Medizin</strong>isch ständig à jour – mit neuen Geräten<br />
Das waren noch Zeiten…<br />
Ausgewählte Anschaffungen aus den ersten 100 <strong>Spital</strong>jahren:<br />
1943 Röntgenapparat <strong>von</strong> 1928 erneuert 48 500 Franken<br />
1945 Zeiss-Mikroskop 1260 Franken<br />
1946 Telefon- <strong>und</strong> R<strong>und</strong>funkanlage bewilligt 20 500 Franken<br />
1950 Narkoseapparat 5500 Franken<br />
1951 Diverse Apparaturen / Weihnachtsgabe an<br />
Chefarzt Dr. Franz Jakob r<strong>und</strong><br />
Operationslampen (sollten gemäss<br />
2600 Franken<br />
<strong>Spital</strong>kommission für 20 bis 30 Jahre halten) 5414 Franken<br />
Röntgenröhre 2955 Franken<br />
1955 Krankenauto VW 11 850 Franken<br />
Schmerzbetäubungsapparat für Geburtshilfe 2600 Franken<br />
Streckbett für Diskushernien 1100 Franken<br />
Stufenphotometer 1500 Franken<br />
Elektrokardiograph 27 808 Franken<br />
Mobiliar 36 808 Franken<br />
1956 Additionsmaschine 1700 Franken<br />
1958 Photometer Eppendorf für Blutanalysen 4000 Franken<br />
<strong>Medizin</strong>ische Fachliteratur für Dr. Franz Jakob 400 Franken
1965 Siemens-Anlage mit Beleuchtungsautomat<br />
(neuer Röntgenapparat) 130 000 Franken<br />
1966 Mikroskop 3134 Franken<br />
Mingograph (EKG) 10 450 Franken<br />
«Der Kleine Landrat bewilligt immer wieder zeitgemässe Apparaturen», steht in<br />
Kaspar Jörgers Chronik «100 Jahre Krankenhaus/<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>.»<br />
47
«Modern Times» – auch bei Investitionen<br />
Grosse EDV- <strong>und</strong> andere Brocken <strong>von</strong> 1997 bis 2007<br />
1990 Arthroskopie-Turm 1 / Fahrgestell 55 000 Franken<br />
1997 Tagesklinik 383 000 Franken<br />
1998 Netzersatzanlage 180 000 Franken<br />
1999 Telefonanlage 688 000 Franken<br />
2000 EDV 2000, 30 PC <strong>und</strong> 1 Server 90 600 Franken<br />
2 Anästhesie-Arbeitsplätze 226 100 Franken<br />
4 Ambulanzfahrzeuge 692 000 Franken<br />
Bildverstärker 138 000 Franken<br />
2001 EDV 2001, PC <strong>und</strong> Monitore etc. 68 800 Franken<br />
Arthroskopie-Turm 3 / Fahrgestell 56 800 Franken<br />
Dialysegerät 47 800 Franken<br />
Digitale Radiografie 390 000 Franken<br />
2002 EDV 2002 Opale Update 243 000 Franken<br />
3 OP-Tische 528 700 Franken<br />
Respirator IPS 45 600 Franken<br />
Chemie-Analyseautomat 98 500 Franken<br />
Ultraschallgerät 45 200 Franken<br />
2003 EDV 2003 (Tarmed) 602 600 Franken<br />
Respirator 47 828 Franken<br />
Bildverstärker 67 000 Franken<br />
Beatmungsgerät 47 828 Franken<br />
2004 EDV 2004 275 700 Franken<br />
Röntgenmaterial aus der ehemaligen Valbella 33 000 Franken<br />
Bronchioskop 20 475 Franken<br />
Anästhesie-Arbeitsplatz 65 000 Franken
2005 EDV 2005 180 000 Franken<br />
Beatmungsmaschine 65 000 Franken<br />
Ultraschallgerät 225 000 Franken<br />
Reinigungsautomaten für OP-Instrumente 150 150 Franken<br />
C-Bogen 118 000 Franken<br />
2006 2 Gastroskope 61 900 Franken<br />
Ambulanzfahrzeug 116 000 Franken<br />
2 Kaffeemaschinen 37 600 Franken<br />
2 Registrierkassen 31 350 Franken<br />
2007 EDV 2007 Hardware 206 134 Franken<br />
1 Kaffeemaschine 31 000 Franken<br />
Beatmungsgerät 14 900 Franken<br />
Notfall-Einsatzfahrzeug 12 000 Franken<br />
Trainingsvelo 26 900 Franken<br />
Koloskop 28 200 Franken<br />
2 Dialysegeräte 87 800 Franken<br />
Bügelpresse 13 560 Franken<br />
Rhino-Pharyngo-Laryngo-Fiberskop 10 802 Franken
Herzstücke …<br />
Unverzichtbar: Die Innere <strong>Medizin</strong><br />
Dr. med. Gregor Niedermaier (* 1962), Chefarzt <strong>Medizin</strong>ische Klinik <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
Welchen Stellenwert hat die Innere <strong>Medizin</strong> im <strong>Spital</strong><br />
<strong>Davos</strong>? Der Hauptakzent liegt hier ja eher auf<br />
Traumatologie <strong>und</strong> orthopädischer Chirurgie.<br />
Wegen unseres Gespürs für Zusammenhänge werden wir<br />
bei schwierigen Diagnosen häufig <strong>von</strong> Chirurgen <strong>und</strong> anderen<br />
Fachärzten beigezogen. Im <strong>Spital</strong> übernimmt die Innere<br />
<strong>Medizin</strong> die ärztliche Betreuung <strong>von</strong> Patienten mit<br />
komplexen Mehrfacherkrankungen. Oft sind diese Patienten<br />
schwer krank. Internisten sind darauf spezialisiert, in solchen<br />
Fällen die Zusammenhänge im Auge zu behalten <strong>und</strong><br />
nie den Überblick über den ganzen Patienten mit seinen Beschwerden<br />
zu verlieren.<br />
Ist darum die Innere <strong>Medizin</strong> in einem Krankenhaus<br />
unverzichtbar?<br />
Während des <strong>Spital</strong>aufenthalts wird ein Patient meist <strong>von</strong><br />
verschiedenen Fachärzten betreut. Wir Internisten übernehmen<br />
dabei oft die Rolle des Koordinators: Wir stimmen mit<br />
den Spezialisten ab, welche Untersuchungen <strong>und</strong> Behandlungen<br />
durchgeführt werden. Dabei achten wir auf den<br />
sinnvollen <strong>und</strong> optimalen Ablauf <strong>von</strong> Therapie <strong>und</strong> Nachsorge.<br />
Im Mittelpunkt steht der Patient als Ganzes.<br />
Die Innere <strong>Medizin</strong> ist bekanntlich ein weites Feld,<br />
ein Feld für medizinische Generalisten. Trotzdem<br />
gibt es wohl Bereiche, die Sie in <strong>Davos</strong> besonders<br />
pflegen. Welche?<br />
Der enorme Wissenszuwachs in der <strong>Medizin</strong> hat dazu ge-<br />
führt, dass es heutzutage für praktisch jedes Organsystem<br />
mindestens einen Spezialisten, wenn nicht sogar mehrere<br />
gibt. Während sich Kardiologen ausschliesslich um das Herz-<br />
Kreislauf-System kümmern oder Gastroenterologen den<br />
Magen-Darm-Trakt behandeln, behalten wir Internisten den<br />
Überblick über alle Organsysteme. Wir fassen die Erkenntnisse<br />
der Organspezialisten zusammen <strong>und</strong> bieten unseren<br />
Patienten ein ganzheitliches Diagnose- <strong>und</strong> Behandlungskonzept.<br />
Meist decken wir den grössten Teil der Notfall-Situationen<br />
ab. Der überwiegende Teil der stationären Patienten wird<br />
uns via Notfall zugewiesen. Für vollamtliche Organspezialisten<br />
ist das Einzugsgebiet des <strong>Spital</strong>es <strong>Davos</strong> (noch) zu klein.<br />
Aus dieser Situation heraus ergeben sich für uns folgende<br />
Schwerpunktbereiche:<br />
Die Gastroenterologie (Magen- Darm-Untersuchungen),<br />
wo wir akute Blutungen jederzeit beherrschen müssen.<br />
Zur Prävention führen wir Vorsorgeuntersuchungen, vor<br />
allem Darmspiegelungen, durch <strong>und</strong> entfernen Polypen,<br />
die zu einem späteren Zeitpunkt eventuell zu bösartigen<br />
Tumoren entarten könnten.<br />
Dank Ultraschall-Diagnostik sind wir in der Lage, Nierensteine,<br />
Gallensteine, einen entzündlichen Blinddarm oder<br />
freie Flüssigkeit im Bauch als Ursache <strong>von</strong> akuten Bauchschmerzen<br />
zu erkennen.<br />
In der Sportmedizin bieten wir eine «R<strong>und</strong>-um-die-Uhr-<br />
Betreuung» für Sportlerinnen <strong>und</strong> Sportler aus der Re-<br />
51
52<br />
gion. Verbindlich sind wir für das Sportgymnasium, die nationalen<br />
Sport-Stützpunkte <strong>und</strong> den Hockey-Club <strong>Davos</strong> zuständig.<br />
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung handelt<br />
es sich in der Sportmedizin meist um internistische Fragestellungen:<br />
Um Leistungsdiagnostik, Ernährungs- <strong>und</strong> Trainingsfragen,<br />
die Überlastungproblematik, Asthma-Erkrankungen<br />
oder Beratung in Dopingfragen. Das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
verfügt über die Anerkennung <strong>von</strong> Swiss Olympic als Medical<br />
Base <strong>und</strong> übernimmt zudem die medizinische Betreuung<br />
<strong>von</strong> sportlichen Grossanlässen wie dem Swiss Alpine<br />
Marathon oder dem Swiss Olympic Gigathlon <strong>von</strong> 2007.<br />
Gibt es auch Bereiche, die Sie vor Ort nicht<br />
abdecken?<br />
Ja! Das sind jene Bereiche, die extrem spezialisiert sind <strong>und</strong><br />
hohe Apparatekosten verursachen, beispielsweise ein Herzkatheter-Labor<br />
für die Ballon-Dilatation bei Erkrankung der<br />
Herzkranzgefässe, Bestrahlungsapparaturen zur Behandlung<br />
<strong>von</strong> bösartigen Tumoren oder die Behandlung <strong>von</strong> akuten<br />
Leukämien. Das alles können wir am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> nicht anbieten.<br />
Wie wichtig ist das Netzwerk zu anderen Spitälern<br />
<strong>und</strong> Spezialisten?<br />
Seit meinem Stellenantritt in <strong>Davos</strong> konnte ich verschiedene<br />
Fachdisziplinen in <strong>Davos</strong> ansiedeln: Einen leitenden Arzt mit<br />
Teilpensum für Pneumologie /Allergologie / Psychosomatik<br />
sowie Konsiliarärzte für Kardiologie <strong>und</strong> Neurologie. Mit<br />
dem Kantonsspital Graubünden bestehen Zusammenarbeitsverträge<br />
für Konsiliardienste vor Ort in Onkologie <strong>und</strong><br />
Angiologie (Gefäss-Erkrankungen). Mit dessen Intensivstation<br />
findet ein regelmässiger Fachaustausch statt. Verschiedentlich<br />
habe ich Stellvertretungen für den ärztlichen Leiter<br />
sichergestellt.<br />
Das Kantonsspital Graubünden ist für uns ein bewährtes<br />
Partnerspital. Selbstverständlich existieren auch persönliche<br />
Kontakte zu Zentren in der ganzen Schweiz, meist aufgr<strong>und</strong><br />
gemeinsamer Ausbildungsjahre. Die Kontaktpflege, sei es<br />
in Form <strong>von</strong> gegenseitigen Besuchen oder <strong>von</strong> Einladungen<br />
zu fachspezifischen Veranstaltungen, ist ein wichtiges Element<br />
unseres Berufslebens.<br />
Existiert der «Ges<strong>und</strong>heitsplatz <strong>Davos</strong>» eigentlich<br />
noch? Der Verein «<strong>Davos</strong> Health» hat sich ja mittlerweile<br />
aufgelöst. Gibts Synergien zwischen dem<br />
<strong>Spital</strong>, den <strong>Davos</strong>er Hausärzten <strong>und</strong> Kliniken?<br />
Zum «Ges<strong>und</strong>heitsplatz <strong>Davos</strong>», der (hoffentlich) bestehen<br />
bleibt, gehören die Forschungsinstitute <strong>und</strong> das medizinische<br />
Kongresswesen. Hier sind wir in vielen Veranstaltungen<br />
als Mitorganisator oder Referenten involviert – ein immenser<br />
Aufwand. Der Lohn dafür ist aber die Möglichkeit<br />
zum Netzwerken mit «opinion leaders» aus vielen Fachbereichen.<br />
Für die Region ist <strong>und</strong> bleibt der «Ges<strong>und</strong>heitsplatz<br />
<strong>Davos</strong>» eine tolle Sache! Es gibt kaum etwas, was hier in<br />
Sachen Ges<strong>und</strong>heit nicht angeboten würde.
Zwischen dem <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>, den <strong>Davos</strong>er Kliniken <strong>und</strong> Hausärzten<br />
bestehen selbstverständlich nach wie vor viele gewichtige<br />
Synergien. Als Akutspital sind wir meist die erste<br />
Anlaufstelle für Notfälle. Im Gegenzug dazu übernehmen<br />
die lokalen Ges<strong>und</strong>heitsanbieter öfters stationäre Rehabilitationsaufenthalte.<br />
Ein bedeutender Partner für uns ist die Zürcher Höhenklinik<br />
<strong>Davos</strong> Clavadel (ZHD): Oft sehen wir dort hoch komplexe<br />
Krankheitsbilder aus Zürcher Zentren, die zur Frührehabilitation<br />
nach <strong>Davos</strong> kommen <strong>und</strong> bei Komplikationen zu uns ins<br />
<strong>Spital</strong> verlegt werden. Nicht selten können derartige Patienten<br />
nur darum in Clavadel betreut werden, weil das <strong>Spital</strong><br />
<strong>Davos</strong> Dialysen (Nierenersatz-Verfahren) durchführen kann.<br />
Mit der Hochgebirgsklinik <strong>Davos</strong> Wolfgang verbindet uns die<br />
gemeinsame Anstellung des leitenden Arztes für Pneumologie.<br />
Unsere treuesten Patientenzuweiser sind die <strong>Davos</strong>er Hausärzte.<br />
Dass gemäss Angaben aus dem Ges<strong>und</strong>heitsamt der<br />
überwiegende Teil unserer stationären Patienten im ortseigenen<br />
<strong>Spital</strong> betreut wird, zeugt <strong>von</strong> Vertrauen, ebenso die<br />
Zuweisungen in unsere Facharzt-Sprechst<strong>und</strong>en. Andererseits<br />
profitieren die Hausärzte <strong>von</strong> der überdurchschnittlichen<br />
Infrastruktur des <strong>Spital</strong>s <strong>und</strong> der Mitsprache bei therapeutischen<br />
Massnahmen.<br />
Bekanntlich sinkt die durchschnittliche <strong>Spital</strong>aufenthaltsdauer<br />
ständig. Nur dank der unmittelbar anschliessenden Hausarzt-<br />
Betreuung ist eine solche Verkürzung jedoch überhaupt möglich.<br />
Die Hausärzte leisten die unverzichtbare medizinische<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> übernehmen Notfälle, vor allem Hausbesuche,<br />
die wir niemals alleine bewältigen könnten.<br />
Zum Problem dürfte der drohende Hausärztemangel in peripheren<br />
Regionen werden, was bei den noch verbleibenden<br />
Hausärzten zu Mehrbelastungen führen wird. Vom <strong>Spital</strong><br />
aus wollen wir mithelfen, Lösungen zur Entlastung dieser<br />
Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen zu finden, damit die «R<strong>und</strong>-umdie<br />
Uhr»-Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> die Attraktivität des Hausarztberufes<br />
gleichermassen gewährleistet bleiben.<br />
Bereits heute haben viele Patienten keinen Hausarzt im traditionellen<br />
Sinne mehr. Das ist jedoch kein davosspezifisches,<br />
sondern ein gr<strong>und</strong>sätzliches Problem der schweizerischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitspolitik.<br />
Die lange Sanierungsphase des <strong>Spital</strong>s geht zu Ende.<br />
Wie beurteilen Sie das Resultat? Was halten Sie <strong>von</strong><br />
der neuen Führungsstruktur des <strong>Spital</strong>s? Sie sitzen ja<br />
selber in der <strong>Spital</strong>leitung.<br />
Wir freuen uns natürlich sehr über die Einweihung der erneuerten,<br />
erweiterten Räumlichkeiten. Wir sind auch dankbar, dass<br />
eine so grosse Investition in «unser» <strong>Spital</strong> bewilligt wurde.<br />
Ohne Übertreibung darf man sagen, dass wir jetzt über eine<br />
ausgezeichnete Infrastruktur verfügen, die Vergleiche nicht zu<br />
scheuen braucht. Wir sind alle stolz auf «unser» <strong>Spital</strong>!<br />
53
54<br />
Das Unternehmen <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> mit über 30 Mio. Franken<br />
Umsatz <strong>und</strong> mehr als 280 Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
braucht eine professionalisierte Führung. Die erweiterte<br />
<strong>Spital</strong>leitung trägt dieser Notwendigkeit Rechnung. Die<br />
neuen Führungsstrukturen widerspiegeln alle Funktionsbereiche<br />
des <strong>Spital</strong>s. Entscheidungen erfolgen aufgr<strong>und</strong> <strong>von</strong><br />
Anträgen aus den Bereichsleitungen. Dabei achten wir auf<br />
eine breite, interdisziplinäre Abstützung. Intern wie extern,<br />
gegenüber politischen Gremien wie Kostenträgern, soll<br />
Transparenz herrschen. Für die gesamte Region wollen wir<br />
ein verlässlicher, attraktiver Arbeitgeber sein <strong>und</strong> bleiben.
Herzstücke<br />
Undenkbar: Ein <strong>Spital</strong> ohne Pflegende<br />
Sonja Heine <strong>und</strong> Beatrice Heeb, Bereichsleitung Pflegedienst<br />
Sonja Heine (*1969, rechts) stammt aus Villingen bei<br />
Donaueschingen. Beatrice Heeb (*1967, links) kommt<br />
aus Mauren im Fürstentum Liechtenstein. Beide sind<br />
diplomierte Pflegefachfrauen. Zurzeit leiten sie zu je<br />
50% den Pflegedienst des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>. Zu 50 Prozent<br />
sind sie weiterhin pflegerisch tätig.<br />
Für Sonja Heine war es bereits seit ihrem fünften Lebensjahr<br />
klar: Sie wollte Krankenschwester werden. «Mein Gross-<br />
vater lag mit Magenkrebs im Sterben <strong>und</strong> wurde zu Hause<br />
<strong>von</strong> einer Ordensschwester gepflegt – einer faszinierenden<br />
Frau mit Humor, die mich tief beeindruckte.»<br />
Beatrice Heeb hingegen war bezüglich Berufswahl mit 16<br />
Jahren noch unschlüssig, als sie in Vaduz einen Informa -<br />
tionsnachmittag zum Krankenpflegeberuf besuchte <strong>und</strong><br />
gleich spürte: «Das ist es!» Am liebsten, sagt sie, hätte sie<br />
mit Kindern gearbeitet. Nach der Ausbildung zur Pflegefachfrau<br />
bekam sie Gelegenheit dazu: «Ich wurde auf einer<br />
chirurgischen Abteilung mit Kinderbetten eingesetzt.»<br />
Nach den Ausbildungsjahren setzte Sonja Heine für ein Jahr<br />
aus. Sie erwarb die Fachhochschul-Reife <strong>und</strong> kehrte dann<br />
wieder in den Pflegebereich zurück. Nach einer zweijährigen,<br />
berufsbegleitenden Zusatzausbildung in Intensivpflege<br />
<strong>und</strong> Anästhesie hatte sie die für sie richtige Herausforderung<br />
gef<strong>und</strong>en – bis heute.<br />
Beatrice Heeb absolvierte die Pflegefach-Ausbildung in Chur<br />
<strong>und</strong> schloss 1992 mit dem Diplom ab. Die medizinische Pflegerin<br />
wurde danach auf der Chirurgie eingesetzt <strong>und</strong> war<br />
begeistert: Da betreute sie Patientinnen <strong>und</strong> Patienten jeden<br />
Alters, auch Kinder, was ihr besonders gefiel. Sie betreute<br />
Patientinnen <strong>und</strong> Patienten, die das <strong>Spital</strong> nach kurzer Zeit<br />
optimistisch <strong>und</strong> guten Mutes wieder verlassen konnten. Da<br />
wusste sie: «Ich habe den richtigen Beruf.»<br />
Die Zeiten, wo Ordensfrauen oder Diakonissinnen die Kranken<br />
im <strong>Spital</strong> aufopfernd <strong>und</strong> r<strong>und</strong> um die Uhr pflegten,<br />
seien seit den 60er-Jahren des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts vorbei,<br />
konstatiert Sonja Heine. «Hauptthema heute ist der Kostendruck<br />
im Ges<strong>und</strong>heitswesen <strong>und</strong> der (zu) knappe Stellenplan.»<br />
Die Liegezeit im <strong>Spital</strong> habe sich massiv verkürzt.<br />
Das heisse: «Stationäre Patienten bleiben weniger lang bei<br />
uns. Der Patientenwechsel erfolgt schneller», so Beatrice<br />
Heeb. Die Patientenkontakte seien anders geworden. «Der<br />
Pflege bleibt immer weniger Zeit am Krankenbett. Dafür ist<br />
der administrative Aufwand enorm gewachsen.»<br />
An physische Grenzen stossen die beiden Pflegefachfrauen<br />
gelegentlich im Winter, wenn sich Notfälle <strong>und</strong> Operationen<br />
im <strong>Spital</strong> häufen <strong>und</strong> zusätzlich noch Pikettdienst geleistet<br />
werden muss. Trotzdem lieben beide ihren Beruf:<br />
«Wir tun etwas Sinnvolles. Routine <strong>und</strong> blosses Aktenwälzen<br />
gibts nicht.» Verändert habe sich im Verlauf der Zeit<br />
auch das Verhalten der Patientinnen <strong>und</strong> Patienten: «Die<br />
55
56<br />
Ansprüche an die Dienstleistungsqualität sind markant gestiegen.»<br />
Wahrscheinlich liege das an den teuren Krankenkassenprämien:<br />
«Man will eine Gegenleistung für sein Geld.»<br />
Seit Januar 2008 sind die beiden Pflegefachfrauen nicht<br />
mehr nur in der Pflege tätig, sondern zu je 50 Prozent interimistische<br />
Leiterinnen des Pflegedienstes am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>.<br />
Führungsaufgaben habe sie eigentlich nie angestrebt, sagt<br />
Beatrice Heeb. Die neue Funktion wurde ihr angeboten. Sie<br />
nahm die Herausforderung gerne an <strong>und</strong> schätzt das Mitentscheiden,<br />
das Mitorganisieren.<br />
Anders Sonja Heine: Wie sie mit verschmitztem Lächeln<br />
sagt, hat sie nach Erfahrungen mit unfähigen Vorgesetzten<br />
bewusst eine Kaderposition angestrebt: «Ich will zeigen,<br />
dass man besser führen kann!» Die frühere Leiterin Pflegedienst,<br />
Cornelia Conzett, habe sie ebenfalls ermutigt. So sei<br />
sie in die Aufgabe hineingewachsen. Dass sie <strong>und</strong> Beatrice<br />
Heeb zu gleichen Teilen in der Pflege wie im Management<br />
tätig seien, halte sie für vorteilhaft: «So kennen wir die Bedürfnisse<br />
<strong>und</strong> Anforderungen beider Seiten.» Sonja Heine<br />
will sich für attraktive Arbeitsplätze einsetzen <strong>und</strong> möglichst<br />
qualifiziertes Personal rekrutieren.<br />
<strong>Davos</strong> war bekanntlich stets ein kosmopolitischer Ort, ein<br />
Ort, wo sich viele Nationen trafen, einst zur Kur, heute für<br />
Ferien <strong>und</strong> Freizeit. Internationalität ist daher auch am <strong>Spital</strong><br />
<strong>Davos</strong> ein Fakt – im Personalbereich wie bei Patientinnen<br />
<strong>und</strong> Patienten. Darum sind Patienten-Aufklärungsblätter<br />
nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, Französisch,<br />
Italienisch, Portugiesisch <strong>und</strong> Russisch abgefasst. Beim Pflegepersonal<br />
<strong>und</strong> unter der Ärzteschaft sei der Ausländeranteil<br />
in den Spezialbereichen höher als in regulären Abteilungen.<br />
«Doch der Sockelbestand <strong>von</strong> Schweizerinnen <strong>und</strong><br />
Schweizern liegt noch immer bei r<strong>und</strong> zwei Dritteln.» Mehr<br />
saisonal bedingten Zuzug aus dem Ausland gebe es während<br />
der arbeitsintensiven Wintermonate, sagen die beiden<br />
Leiterinnen.<br />
Erleichtert sind Sonja Heine <strong>und</strong> Beatrice Heeb darüber, dass<br />
die fünfjährige Bauzeit nun zu Ende geht. Vor allem am Anfang<br />
sei der Baulärm äusserst belastend gewesen. «Nach<br />
einem vollen Arbeitstag war man enorm müde», sagt Beatrice<br />
Heeb, <strong>und</strong> Sonja Heine erinnert sich an die zwei Jahre<br />
in den provisorischen Operationsräumen im UG6 – ohne Tageslicht.<br />
Das habe schon genervt. Doch jetzt freuen sich<br />
beide über das Resultat <strong>und</strong> die Tatsache, dass Mitsprache<br />
in Detailfragen möglich war. «Die neuen Patientenzimmer<br />
mit Nasszellen <strong>und</strong> TV-Apparaten sind schön geworden.»<br />
Übereinstimmend stellen die beiden Bereichsleiterinnen fest,<br />
dass im <strong>Spital</strong> die toten Zwischensaisonzeiten kaum mehr<br />
existieren: «Heutzutage gibt es viel mehr geplante Operationen<br />
wie den Hüft- <strong>und</strong> Kniegelenkersatz, aber auch mehr<br />
medizinische Fälle.» Im Frühjahr <strong>und</strong> Sommer werde die Bettenzahl<br />
jeweils <strong>von</strong> 75 auf r<strong>und</strong> 57 reduziert <strong>und</strong> der Per-
sonalbestand entsprechend angepasst: «Darum haben diejenigen,<br />
die da sind, unverändert viel zu tun.»<br />
Mit Interesse verfolgt Sonja Heine die weitere Entwicklung<br />
im Bereich Ges<strong>und</strong>heitspolitik. Altersbetreuung <strong>und</strong> Nachwuchsförderung<br />
im weitesten Sinne würden zu grossen<br />
Themen der kommenden Jahre, ist sie überzeugt. Da seien<br />
das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> <strong>und</strong> das Alterszentrum Guggerbach gefordert<br />
<strong>und</strong> müssten gemeinsam nach Lösungen suchen. Beatrice<br />
Heeb ihrerseits wünscht sich <strong>von</strong> einer guten Fee längere<br />
Wochen, damit Beruf <strong>und</strong> Privatleben in Zukunft doch<br />
etwas besser ins Gleichgewicht gebracht werden könnten.<br />
«Der Gesamtstellenplan für den Pflegedienst im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
liegt aufger<strong>und</strong>et bei 102 Stellen. Diese Zahl bezieht sich<br />
auf die Stellenprozente in den Wintermonaten, also den maximalen<br />
Stellenbedarf bei 75 Patientenbetten. In den übrigen<br />
Monaten werden Bettenzahl <strong>und</strong> Personal entsprechend<br />
reduziert.<br />
Der Stellenplan beinhaltet die Pflegeabteilungen, das Pflegeheim,<br />
den Gebärsaal, die Spezialbereiche Operationsabteilung,<br />
Gips- <strong>und</strong> Lagerungspflege, Intensivstation, Notfall,<br />
Anästhesie, Rettungsdienst <strong>und</strong> die Leitung Pflegedienst inklusive<br />
Bettendispositione <strong>und</strong> Ausbildung.»
Quantensprung in die Zukunft<br />
Der Um- <strong>und</strong> Neubau des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> 2003 – 2008<br />
Im Jahr 2002 bestimmt der Kleine Landrat erstmals die Mitglieder der Baukommission<br />
«Sanierung <strong>und</strong> Erweiterung <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>» <strong>und</strong> «Personalhaus <strong>Spital</strong><br />
<strong>Davos</strong>». Es sind dies:<br />
Landrat Dr. Peter Bieler Baukommissionspräsident<br />
Landrat Dr. Andrea Meisser Vertretung politische Behörden<br />
Dr. med. Christian Ryf Ärztlicher Leiter <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
Cornelia Conzett Leiterin Pflegedienst<br />
Christian Ryffel Gemeindearchitekt<br />
Mit beratender Stimme:<br />
Markus Hehli, Direktor Projektleitung Bauherrschaft<br />
Markus Dünner Kant. Hochbauamt<br />
Erich Bandi Dipl. Architekt <strong>und</strong> Fachberater<br />
M. Gross + W. Rüegg Projektleitung Architekten<br />
Fachberatung<br />
Projektorganisation<br />
Bauherrschaft<br />
Landschaft <strong>Davos</strong><br />
Planungs- <strong>und</strong> Baukommission<br />
Projektleitung Bauherr<br />
Administration<br />
Projektgruppe Projektgruppe Bau<br />
Projektleitung Architekten
Für den Neubau Personalhaus,<br />
damit das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> ein attraktiver<br />
Arbeitgeber bleibt.<br />
60<br />
Im Verlauf der 5-jährigen Bauzeit verändert sich die Zusammensetzung der Baukommission<br />
– vorwiegend aus personellen Gründen. 2005 wird ein neuer Kleiner<br />
Landrat gewählt. Mit Protokoll des Kleines Landrates vom 24. Juli 2007 werden<br />
nun folgende Mitglieder der Baukommission <strong>Spital</strong> bestimmt:<br />
Landrat Dr. Andrea Meisser Präsident<br />
Dr. med. Christian Ryf Ärztlicher Leiter<br />
Sonja Heine Leiterin Pflegedienst a. i.<br />
Mit beratender Stimme:<br />
Markus Hehli Direktor / Projektleiter<br />
Bauherrschaft<br />
M. Gross + W. Rüegg Projektleiter Architekten<br />
Von der Baukommission zugezogene<br />
Fachexperten:<br />
Markus Nyfeler Dipl. Ing. ETH<br />
Dr. iur. Hansjörg Kistler Rechtsanwalt<br />
Geben Sie der medizinischen<br />
Versorgung für die Landschaft <strong>Davos</strong><br />
eine gute Zukunft.<br />
Hochprofessionelle Me<br />
20 000 <strong>Menschen</strong><br />
Das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> hat den Auftrag, die erweit<br />
Personen – inklusive den Leistungen für die Da<br />
<strong>Davos</strong> zu gewährleisten. Einwohner <strong>und</strong> Gä<br />
hochprofessionelle medizinische Betreuung zu<br />
das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> einer der grössten Arbeitgeber<br />
2001 <strong>von</strong> ca. 27 Mio. CHF, <strong>von</strong> dem das Spita<br />
schaftete, verdeutlicht die wirtschaftliche Bed<br />
<strong>Davos</strong>. Insgesamt leistet das örtliche <strong>Spital</strong> ein<br />
<strong>von</strong> <strong>Davos</strong> als Wohngebiet <strong>und</strong> als Tourismus
izin für<br />
Grosser Tag fürs <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong>:<br />
Die Landschaftsabstimmung vom 9. Februar 2003<br />
An diesem Tag entscheiden die <strong>Davos</strong>er Stimmbürgerinnen <strong>und</strong> Stimmbürger über zwei Kreditvorlagen zur Sanierung <strong>und</strong><br />
Erweiterung des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong>. Die Anträge des Grossen Landrates der Landschaft <strong>Davos</strong> an den Souverän lauten wie folgt:<br />
erte Gr<strong>und</strong>versorgung für r<strong>und</strong> 20'000<br />
voser Höhenkliniken – in der <strong>Spital</strong>region<br />
ste haben die Sicherheit, jederzeit eine<br />
erhalten. Mit r<strong>und</strong> 260 Mitarbeitern ist<br />
der Region. Ein Betriebsaufwand im Jahr<br />
l <strong>Davos</strong> r<strong>und</strong> 19 Mio. CHF selber erwirteutung<br />
der Institution für die Landschaft<br />
en wesentlichen Beitrag zur Attraktivität<br />
region. Dies auch in Zukunft so bleiben.<br />
1. Sanierung <strong>und</strong> Erweiterung <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
Für die Sanierung <strong>und</strong> Erweiterung des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong> wird<br />
gemäss vorliegendem Projekt Leu /Gross / Rüegg ein Verpflichtungskredit<br />
<strong>von</strong> Fr. 46 606 300 abzüglich die Subventionierung<br />
der anrechenbaren Kosten durch den Kanton<br />
Graubünden (Kostenstand per 1. September 2002) als<br />
Kostendach freigegeben.<br />
Ein modernes <strong>Spital</strong> für die nächsten<br />
Jahrzehnte<br />
Seit der Eröffnung Ende 1888 hat das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> verschiedene Epochen durchlebt. Mit<br />
dem Neubau wurden 1977 die bis heute grösstenteils genutzten Räumlichkeiten bezogen.<br />
Das für die damalige Zeit modern konzipierte <strong>Spital</strong> hat in den vergangenen 25<br />
Jahren gute Dienste geleistet <strong>und</strong> konnte in einigen Bereichen durch Ergänzungen bzw.<br />
Umnutzungen den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden. Allerdings haben sich<br />
mittlerweile die Anforderungen an einen <strong>Spital</strong>bau stark verändert; darüber hinaus<br />
sind Teile der bestehenden Installationen veraltet <strong>und</strong> müssen in jedem Falle ersetzt<br />
werden. Die heutige Infrastruktur erfüllt die Voraussetzungen an eine zeitgemässe<br />
Pflege in keiner Weise, so dass eine Gesamtsanierung unumgänglich ist. Im Gebäude<br />
weit verteilt angelegte Funktionsbereiche wie ambulante Dienste, Administration <strong>und</strong><br />
Verpflegung verunmöglichen zudem ein effizientes Arbeiten. Arbeits- <strong>und</strong> Behandlungs -<br />
plätze (z.B. die Notfallstation) haben kein Tageslicht, was untragbare Arbeits- <strong>und</strong><br />
Behandlungsbedingungen zur Folge hat <strong>und</strong> sich ebenfalls nur durch bauliche<br />
Massnahmen verbessern lässt.<br />
Aus einer engen Zusammenarbeit zwischen den Projektverantwortlichen, den<br />
Verantwortlichen des Kantons, der Landschaft <strong>Davos</strong> <strong>und</strong> den Benutzern ist ein umfassendes<br />
Bauprojekt hervorgegangen, das die Ansprüche <strong>von</strong> Patienten <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
an ein modernes <strong>Spital</strong> für die nächsten Jahrzehnte erfüllt. Es gewährleistet eine<br />
Infrastruktur, die eine Behandlung nach den international geltenden Richtlinien <strong>und</strong><br />
eine zeitgemässe Pflege zulässt.<br />
Mit dem Sanierungsprojekt für das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> verbinden sich<br />
zahlreiche Nutzen:<br />
1. Verbesserung des Patientenkomforts durch den Einbau <strong>von</strong> Nasszellen in den<br />
Patientenzimmern<br />
2. Optimale Betriebssicherheit dank Erneuerung bzw. Ersatz des grössten Teils der 25jährigen<br />
Haustechnik<br />
3. Optimierung der Betriebsabläufe durch die Zusammenführung der Räume <strong>und</strong> die<br />
Schaffung konzentrierter Funktionseinheiten<br />
4. Bereitstellung <strong>von</strong> zeitgemässen Arbeitsplätzen für das Personal sowie optimalen<br />
Behandlungsplätzen zum Wohle der Patienten<br />
5. Konzentration <strong>von</strong> heute vier auf neu drei Bettenstationen<br />
6. Konzentration der ambulanten Dienste auf einer Station<br />
7. Entflechtung <strong>von</strong> öffentlichen <strong>und</strong> innerbetrieblichen Flächen sowie Trennung der<br />
Zufahrt des Rettungsdienstes vom <strong>Spital</strong>vorplatz bzw. Haupteingang<br />
Vorlage / Fraktion<br />
1. Sanierung <strong>und</strong><br />
Erweiterung<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
<strong>Davos</strong> Platz<br />
<strong>Davos</strong> Dorf<br />
Frauenkirch / Sertig<br />
Glaris<br />
Monstein<br />
Total<br />
2. Neubau Personalhaus 1 <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
Für den Neubau des Personalhauses 1 des <strong>Spital</strong>s <strong>Davos</strong><br />
wird gemäss vorliegendem Projekt Michael / Schmid ein<br />
Verpflichtungskredit <strong>von</strong> Fr. 7 924 500.– abzüglich die hälftige<br />
Subventionierung der anrechenbaren Kosten durch<br />
den Kanton Graubünden (Kostenstand per 1. September<br />
2002) als Kostendach freigegeben.<br />
ja<br />
1173<br />
103<br />
23<br />
17<br />
20<br />
1336<br />
= 79%<br />
nein<br />
288<br />
31<br />
2<br />
6<br />
—<br />
327<br />
Vorlage / Fraktion<br />
1. Neubau<br />
Personalhaus 1<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
<strong>Davos</strong> Platz<br />
<strong>Davos</strong> Dorf<br />
Frauenkirch / Sertig<br />
Glaris<br />
Monstein<br />
Total<br />
ja<br />
1114<br />
99<br />
22<br />
14<br />
18<br />
1267<br />
= 75%<br />
nein<br />
347<br />
38<br />
3<br />
10<br />
2<br />
400<br />
61
Baujahr 1: 2003<br />
Neues Personalhaus:<br />
Spatenstich Ostermontag, 22. April 2003<br />
Aufrichtefeier 22. November 2003<br />
Herbst 2003:<br />
Provisorische Inbetriebnahme Einstellhalle
Baujahr 2: 2004<br />
März 2004:<br />
Bezug <strong>von</strong> Provisorien im alten Personalhaus<br />
Am Osterdienstag, 13. April 2004:<br />
Spatenstich zur Gesamtsanierung <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> durch Landrat<br />
<strong>und</strong> Baukommissionspräsident Dr. Andrea Meisser<br />
Mai / Juni 2004:<br />
Grosse Rückbauten unter dem <strong>Spital</strong>vorplatz <strong>und</strong> U1 für Öltankanlage,<br />
Ambulanzhalle <strong>und</strong> neue Zufahrtsrampe Ambulanz<br />
Juli 2004:<br />
Stahlfachwerk im Süden erstellt<br />
September / Dezember 2004:<br />
Innenausbauten <strong>und</strong> Installation Technikanlagen im U1<br />
15. Dezember 2004:<br />
Inbetriebnahme neue Ambulanzhalle, Radiologie <strong>und</strong> Notfallstation
Baujahr 3: 2005<br />
Januar 2005: Neue Pikettzimmer im U3 erstellt<br />
Um Ostern 2005 in Betrieb:<br />
Labor, Büroräume Informatik <strong>und</strong> provisorische Büros des<br />
Stationsarztdienstes im U2<br />
Osterdienstag:<br />
Start Bauetappe 7 mit Abbruch Ambulanzhalle <strong>und</strong> Rückbau<br />
Decke bis U1. Operationssaal 3 ausser Betrieb<br />
Aufbau statischer Tragsysteme für den Nordanbau ab U1.<br />
Wegen starker Regenfälle im Frühjahr <strong>und</strong> im Sommer Probleme<br />
mit dachlosen <strong>Spital</strong>teilen<br />
Mitte August 2005:<br />
Montage der letzten Deckenplatte auf dem OG4.<br />
Einbau Liftschacht vom Dach bis U2<br />
Herbst 2005:<br />
Montage Glasfassade <strong>und</strong> Fenstereinbau im Neubauteil<br />
Genehmigung des B<strong>und</strong>es zum Umbau der geschützten Operationsstelle<br />
(GOPS): Im U5 Einbau <strong>von</strong> zwei Operationssälen.<br />
Provisorische Inbetriebnahme Dezember 2005<br />
Mitte Dezember 2005:<br />
Inbetriebnahme der sanierten Sterilisation, der Funktionsräume<br />
Endoskopie <strong>und</strong> Ergospirometrie, <strong>von</strong> Büro <strong>und</strong> Garderobe<br />
Rettungsdienst
Baujahr 4: 2006<br />
Anfang 2006:<br />
Konstruktive Mängel an den 2005 eingebauten Fenstern<br />
festgestellt. Neuvergabe an Firma Künzli Holzbau, <strong>Davos</strong><br />
Nordanbau an Ostern 2006 fertiggestellt. Die Gebärabteilung<br />
im Dachgeschoss, neue Zweier-Patientenzimmer <strong>und</strong><br />
der provisorische Eingangsbereich mit Cafeteria im EG werden<br />
in Betrieb genommen<br />
Gesamte Operationsabteilung ins Provisorium Geschützte<br />
Operationsstelle (GOPS) U5 verlegt<br />
Juni 2005:<br />
Wassereintritt wegen heftigen Gewitters. Von Bauherrenversicherung<br />
gedeckte Schäden in der sanierten Notfallstation<br />
Anfang September 2006:<br />
Eingelagerter Fassadenschmuck <strong>von</strong> Claire Ochsner wird<br />
wieder an der Nordfront des neuen Bettentrakts montiert<br />
November/Dezember 2006 in Betrieb:<br />
Eingang, Cafeteria, Patientenadministration, Helikopterlandeplatz,<br />
Bettenstationen <strong>und</strong> Gehbad<br />
2006 insgesamt verbaut:<br />
17 Mio. Franken
Baujahr 5: 2007<br />
Umfangreichste Bauetappe – mit einigen Stolpersteinen:<br />
Januar/Februar 2007 in Betrieb:<br />
Praxis Gynäkologie, Bürogeschoss B, neue Küche U3 mit Anlieferung<br />
U4<br />
Die Inbetriebnahme der neuen Operationssäle wird zum<br />
technischen Kraftakt. Erst Mitte Februar 2007 Abschluss<br />
aller technischen Validierungen bei elektrischen Sicherheitssystemen,<br />
bei Luft- <strong>und</strong> Strömungsbedingungen in den<br />
Operationssälen. Mehr Sicherheit durch digitale Übertragung<br />
<strong>von</strong> Radiologiebildern in die Ops-Säle<br />
Frühjahr 2007:<br />
Mutationen in der Baukommission. Ersatzloser Austritt <strong>von</strong><br />
Gemeindearchitekt Christian Ryffel wegen Pensionierung<br />
<strong>und</strong> <strong>von</strong> Landrätin Astrid Heinrich (Vertretung politische Behörden)<br />
auf eigenen Wunsch. Neue Mitglieder: Markus Nyfeler,<br />
dipl. Ing. ETH, <strong>und</strong> Dr. iur. Hansjörg Kistler, <strong>Davos</strong><br />
Abrechnung Bauetappe 2006 ergibt: Der bewilligte Baukredit<br />
wird voraussichtlich überschritten. Information des<br />
Kleinen Landrates, der Geschäftsprüfungskommission (GPK)<br />
des Grossen Landrates sowie der <strong>Davos</strong>er Bevölkerung<br />
Um Ostern 2007:<br />
Provisorien für Zentralmagazin, Intensivpflegestation, Dialyse<br />
<strong>und</strong> Tagesklinik bezogen. Patientenzimmer Südfront<br />
stillgelegt. Im Sommer 2007 stehen dem <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> nur<br />
noch 45 Betten für stationäre Patienten zur Verfügung<br />
Mitte 2007:<br />
Schulungsraum <strong>und</strong> Rapportraum <strong>Medizin</strong> im ehemaligen<br />
Personalrestaurant U3 erstellt<br />
Herbst 2007:<br />
Baukredit-Überschreitung auf 930 000 Franken quantifiziert.<br />
Nachtragskredit <strong>von</strong> 1 Mio. Franken beantragt. Vom Grossen<br />
Landrat am 6. Dezember 2006 bewilligt<br />
Spätherbst 2007:<br />
Physiotherapie, Tagesklinik, Dialysestation <strong>und</strong> Bettenstationen<br />
mit 75 Betten wieder in Betrieb, ebenso die ans Rote<br />
Kreuz Graubünden vermieteten Räume für Ergotherapie<br />
<strong>und</strong> Kinderphysiotherapie
Baujahr 6: 2008<br />
Abschluss der grossen Sanierungs- <strong>und</strong> Erweiterungsphase<br />
2003 – 2008. Letzte Arbeiten im Gange:<br />
Fertigstellung <strong>von</strong> Wäscheversorgung, Büros <strong>und</strong> Rapport -<br />
raum Chiurgie im U3<br />
Ostern 2008:<br />
Der chirurgische Arztdienst kehrt nach vier Jahren aus dem<br />
Provisorium im alten Personalhaus 1 in die neuen Büros im<br />
EG zurück<br />
Mai / Juni 2008:<br />
Abbruch des alten Personalhauses 1<br />
Fertigstellung Autoeinstellhalle Personalhaus 4 <strong>und</strong> Einstellhalle<br />
U5. Wiederherstellung <strong>von</strong> Grünanlagen <strong>und</strong> Parkfeldern<br />
Das Bauprogramm <strong>von</strong> 2003 wurde eingehalten, <strong>und</strong> der<br />
VBD erfüllt dem <strong>Spital</strong> einen alten Wunsch: Die Buslinie 1<br />
wird ab Juli 2008 direkt vors <strong>Spital</strong> fahren<br />
Gesamteröffnung<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> nach Sanierung:<br />
26.– 28. September 2008
Gabriela Sievi<br />
(*1964)<br />
Hotelfachfrau / eidg. dipl. Betriebsleiterin, seit 17. September 2007<br />
Leiterin Hotellerie <strong>und</strong> Ökonomie <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
« Im<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> habe ich meine Traumstelle gef<strong>und</strong>en – ein sehr dankbares<br />
Aufgabengebiet mit viel Abwechslung <strong>und</strong> Selbstständigkeit. Es umfasst den gesamten<br />
Verpflegungssektor für Patienten, Mitarbeitende <strong>und</strong> die Cafeteria<br />
«Mezzo», den Reinigungsdienst, die Wäscherei sowie die Verwaltung der drei<br />
Personalhäuser. Vor r<strong>und</strong> anderthalb Jahren wurde im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> zudem der<br />
Room-Service eingeführt.<br />
R<strong>und</strong> 45 Personen arbeiten derzeit im Hotellerie- <strong>und</strong> Ökonomie-Team. Chancen<br />
für einen weiteren Ausbau unserer Dienstleistungen sehe ich speziell im Gastronomiebereich:<br />
Wir möchten externen Gästen die Möglichkeit bieten, ihre<br />
privaten oder Firmen-Anlässe wie Geburtstagsfeiern, Betriebsessen <strong>und</strong> Veranstaltungen<br />
mit Verpflegung bei uns im <strong>Spital</strong> durchzuführen.<br />
Wann ist ein <strong>Spital</strong> ein gutes <strong>Spital</strong>? Aus Patientensicht kann ich das zum Glück<br />
nicht beurteilen. Ich war noch nie selber <strong>Spital</strong>patientin! Was hingegen den Betrieb<br />
betrifft, sind es meiner Ansicht nach die gleichen Komponenten wie in jeder<br />
anderen, guten Organisation: Ein angenehmes Betriebsklima, eine ausgeprägte<br />
Firmenkultur, ein Ambiente der Fre<strong>und</strong>lichkeit <strong>und</strong> eine gepflegte, gut funktionierende<br />
Infrastruktur. Durch regelmässige Personalschulung wollen wir die hohe<br />
Dienstleistungsqualität im Umgang mit unseren K<strong>und</strong>innen <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en pflegen<br />
<strong>und</strong> aufrechterhalten.»<br />
69
70<br />
Ilaria Menghini<br />
(*1961)<br />
Dipl. Pflegefachfrau, derzeit chirurgisch-orthopädische Abteilung C<br />
« Als<br />
langjährige Mitarbeiterin schätze ich das gute Arbeitsklima, die tolle Kollegialität<br />
untereinander <strong>und</strong> natürlich meine Arbeit als Pflegefachfrau, die mir<br />
auch nach vielen Jahren immer noch sehr viel Freude macht.<br />
<strong>Davos</strong> braucht ein <strong>Spital</strong> mit erweiterter Gr<strong>und</strong>versorgung. Damit ist die stationäre<br />
<strong>und</strong> ambulante Akutversorgung der Bevölkerung <strong>und</strong> der Feriengäste während<br />
des ganzen Jahres gewährleistet – <strong>und</strong> dies in einem Kurort mit Sport- <strong>und</strong><br />
Kongresstourismus.<br />
Was ist ein gutes <strong>Spital</strong>? Das ist ein <strong>Spital</strong>, in dem medizinische <strong>und</strong> pflegerische<br />
Leistungen <strong>von</strong> hoher Qualität erbracht werden, wo die Wünsche <strong>und</strong> Bedürfnisse<br />
der Patienten im Vordergr<strong>und</strong> stehen <strong>und</strong> die Teamdynamik stimmt, ein<br />
<strong>Spital</strong>, das dem Personal regelmässige Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung anbietet <strong>und</strong> ermöglicht.»
Tina Marugg<br />
(*1960)<br />
Dipl. Pflegefachfrau im Notfalldienst, heute mit einem 50%-Pensum<br />
« Das<br />
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> ist ein grosser Arbeitgeber. Seine vielen Arbeitsplätze sind<br />
wichtig für die Region. Gäbe es das <strong>Spital</strong> nicht, wären die Wege zur medizinischen<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung wesentlich länger. Das hiesse: Länger Schmerzen haben,<br />
länger Angst haben. Das <strong>Spital</strong> gibt Gästen <strong>und</strong> Einheimischen Sicherheit.<br />
Schon seit meinem 9. Altersjahr wollte ich Krankenschwester werden, obwohl<br />
meine Eltern ein Studium lieber gesehen hätten. 1982, noch zur Zeit <strong>von</strong> Chefarzt<br />
Dr. Peter Matter <strong>und</strong> Dr. Jürg Dannecker, Chefarzt für Innere <strong>Medizin</strong>, arbeitete<br />
ich im Notfalldienst <strong>und</strong> habe ihn <strong>von</strong> 1983 bis 1989 geleitet. Doch dann<br />
kamen unsere drei Buben. Zum Glück konnte ich auf Teilzeit umstellen. Das habe<br />
ich wie andere Pflegefachfrauen mit Familienpflichten sehr geschätzt. So gabs bei<br />
mir nie entweder nur Familienfrust oder nur Arbeitsstress, sondern immer das<br />
Beste aus beiden Welten.<br />
Ich arbeite gerne <strong>und</strong> mit Freude in meinem Beruf – wie alle im Notfalldienst.<br />
Das wirkt sich positiv auf die Betriebsatmosphäre aus. Zu einem guten <strong>Spital</strong> gehören<br />
Fachkompetenz, Menschlichkeit, funktionale Zimmer mit moderner Ausstattung<br />
<strong>und</strong> gutes Essen. Aber hie <strong>und</strong> da ist allein schon die w<strong>und</strong>erbare Aussicht<br />
ins Landwassertal ein Trost in schweren St<strong>und</strong>en …»<br />
71
72<br />
Dr. med. Björn Zappe<br />
(*1973) Deutschland – Kaufbeuren<br />
Seit 1. September 2007 Stationsarzt Chirurgie/Orthopädie. Nach dem<br />
Studium in Erlangen (D) Ausbildung im Paraplegikerzentrum Nottwil,<br />
im <strong>Spital</strong> Liestal <strong>und</strong> im Universitätsspital Basel (Orthopädie <strong>und</strong><br />
Traumatologie)<br />
« Für ein so bekanntes <strong>und</strong> grosses Skigebiet wie <strong>Davos</strong> / Klosters ist es ein enormes<br />
Plus, ein <strong>Spital</strong> mit Frakturen- <strong>und</strong> Traumatologienzentrum direkt an Ort zu<br />
haben. Viele andere Skistationen im In- <strong>und</strong> Ausland haben diese Möglichkeit<br />
nicht. Verunfallte Gäste aus dem Ausland, auch solche mit langer <strong>Spital</strong>erfahrung,<br />
loben immer wieder den Service <strong>und</strong> die positive Stimmung im <strong>Spital</strong>.<br />
Aus meiner Sicht hat das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> eine gute Grösse: Es ist kein anonymes<br />
Grossspital. Die Kommunikationswege sind kurz: Zur Radiologie, zur Inneren <strong>Medizin</strong>,<br />
zum Notfall. Verunfallte werden schnell <strong>und</strong> gut versorgt, nicht einfach abgestellt.<br />
Wo nötig operieren wir auch am Wochenende, sobald es die Weichteilverletzungen<br />
zulassen <strong>und</strong> Schwellungen abgeklungen sind. Das erlaubt eine<br />
sehr speditive Abwicklung <strong>von</strong> Patientenneuzugängen. Weitere Vorzüge sind die<br />
professionelle Pflege, die gute Verpflegung <strong>und</strong> nicht zuletzt die grossartige Aussichtslage<br />
des <strong>Spital</strong>s. Privat nutze ich die Vielfalt der Sportmöglichkeiten <strong>von</strong><br />
<strong>Davos</strong>: Ich jogge gern, fahre Mountainbike <strong>und</strong> Rennrad <strong>und</strong> mag Ski alpin.<br />
Wenn man während acht bis zehn St<strong>und</strong>en im Operationssaal steht, muss die<br />
Chemie im Team stimmen. Das funktioniert bestens. Ich schätze es auch sehr,<br />
dass ich Eingriffe mit den Chefärzten vorbesprechen <strong>und</strong> jederzeit Fragen stellen<br />
kann. Die Kontakte zu allen Abteilungen sind problemlos <strong>und</strong> sehr gut.»
Christian Schwendener<br />
(*1965)<br />
Gelernter Elektromonteur. Seit 1991 im Team<br />
Technischer Dienst, seit 2006 dessen Leiter<br />
« Eine<br />
so grosse Tourismusregion wie die Region <strong>Davos</strong> / Klosters braucht ein<br />
Regionalspital. Für Verunfallte wäre der Weg bis ins Kantonsspital Chur zu weit.<br />
Vor 17 Jahren habe ich im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> als Betriebselektriker angefangen. Seither<br />
hat sich die Technik, speziell die <strong>Medizin</strong>technik, enorm entwickelt. Fast alljährlich<br />
gibts Neuerungen, beispielsweise in der Radiologie. Bei der Gerätemontage<br />
arbeiten wir eng mit den Lieferfirmen zusammen <strong>und</strong> werden <strong>von</strong> ihnen<br />
auch geschult. Für Störungsmeldungen aus dem Haus gibts ein Meldesystem,<br />
damit wir Defekte raschmöglichst beheben können.<br />
Die 5-jährige Sanierungs- <strong>und</strong> Umbauphase am <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> hat unser nur 4-köpfiges<br />
Technikteam stark gefordert. Schwierig war vor allem die jederzeit saubere<br />
Trennung <strong>von</strong> Bau <strong>und</strong> Betrieb mit ihren vielen Provisiorien. Die Belastung war<br />
hoch <strong>und</strong> führte zu vielen Überst<strong>und</strong>en. Doch jetzt ist das <strong>Spital</strong> saniert <strong>und</strong> verfügt<br />
über modernste elektronische Alarmierungs- <strong>und</strong> Hausleitsysteme, was natürlich<br />
wiederum höhere Anforderungen an uns Techniker stellt. Die Szenarien bei<br />
Stromausfall oder Brand müssen jederzeit abgesichert sein <strong>und</strong> gemäss Qualitätssystem<br />
(QMS) geübt werden. Neu ins <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> Eintretende werden einen<br />
halben Tag lang über <strong>Spital</strong>abläufe instruiert <strong>und</strong> <strong>von</strong> uns speziell in Arbeitssicherheit<br />
<strong>und</strong> Brandschutz eingeführt.»<br />
73
74<br />
Dr. phil. nat. Michael Treina<br />
(*1964) Strategieberater<br />
Begleitet derzeit die Strategieentwicklung der <strong>Davos</strong>er <strong>Spital</strong>leitung<br />
« Bei<br />
meinem ersten Besuch im <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> hat mich die hohe Qualität der Infrastruktur<br />
<strong>und</strong> des Leistungsangebots sehr überrascht.<br />
Ich denke, dass die Gemeinde <strong>Davos</strong> <strong>und</strong> der Kanton Graubünden mit diesem<br />
modernen <strong>Spital</strong> weitsichtig in eine attraktive Tourismusdestination investiert<br />
haben. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> steigender Ges<strong>und</strong>heitskosten sind in den nächsten<br />
Jahren jedoch harte Zeiten angesagt. Vor allem die Konkurrenz <strong>und</strong> der Kostendruck<br />
werden markant steigen. Gerade das kleine <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> muss daher sehr<br />
flexibel sein <strong>und</strong> sich den Marktveränderungen rasch anpassen. Dazu ist eine<br />
professionelle Unternehmensführung <strong>und</strong> der Schulterschluss mit Gemeinde <strong>und</strong><br />
Kanton ebenso entscheidend wie die gute medizinische Arbeit. Alle Kräfte werden<br />
gefragt sein, um das <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> als das zu erhalten, was heute ist – eine<br />
Perle in der alpinen Ges<strong>und</strong>heitsversorgung.»
Impressum Festschrift <strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong><br />
Projektleitung:<br />
Markus Hehli, <strong>Davos</strong> Frauenkirch<br />
Konzept <strong>und</strong> Text:<br />
Marianne Frey-Hauser, <strong>Davos</strong> Dorf<br />
Layout:<br />
Beat Rüttimann, <strong>Davos</strong> Monstein<br />
Fotos:<br />
Dokumentationsbibliothek <strong>Davos</strong><br />
Marianne Frey-Hauser, <strong>Davos</strong> Dorf<br />
Marcel Giger, <strong>Davos</strong> Platz<br />
Urs Hegnauer, <strong>Davos</strong> Dorf<br />
Archiv Professor Dr. med. Peter Matter, <strong>Davos</strong> Platz<br />
Herbert Scherer, Dietikon<br />
Druck:<br />
Buchdruckerei <strong>Davos</strong><br />
Auflage:<br />
3000 Ex.<br />
75
<strong>Spital</strong> <strong>Davos</strong> ● Promenade 4 ● CH-7270 <strong>Davos</strong> Platz<br />
Tel +41 (0)81 414 88 88 ● Fax +41 (0)81 414 84 28<br />
info@spitaldavos.ch ● www.spitaldavos.ch