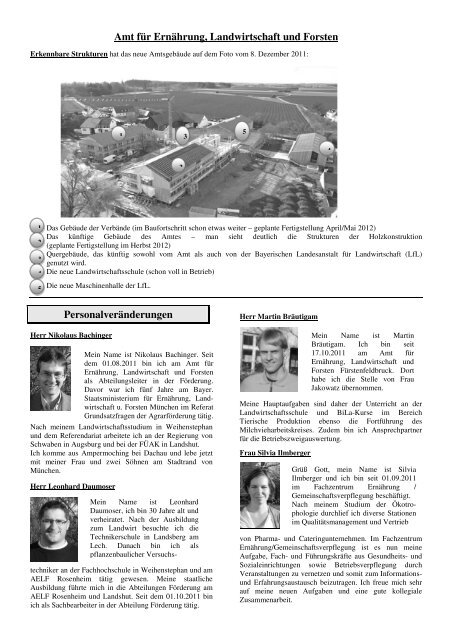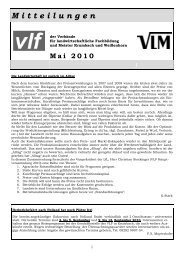Gemeinsamer Teil Mitteilungsblatt Weihnachten 2011 - Verband für ...
Gemeinsamer Teil Mitteilungsblatt Weihnachten 2011 - Verband für ...
Gemeinsamer Teil Mitteilungsblatt Weihnachten 2011 - Verband für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
Erkennbare Strukturen hat das neue Amtsgebäude auf dem Foto vom 8. Dezember <strong>2011</strong>:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Das Gebäude der Verbände (im Baufortschritt schon etwas weiter – geplante Fertigstellung April/Mai 2012)<br />
Das künftige Gebäude des Amtes – man sieht deutlich die Strukturen der Holzkonstruktion<br />
(geplante Fertigstellung im Herbst 2012)<br />
Quergebäude, das künftig sowohl vom Amt als auch von der Bayerischen Landesanstalt <strong>für</strong> Landwirtschaft (LfL)<br />
genutzt wird.<br />
Die neue Landwirtschaftsschule (schon voll in Betrieb)<br />
Die neue Maschinenhalle der LfL.<br />
Personalveränderungen<br />
Herr Nikolaus Bachinger<br />
Nach meinem Landwirtschaftsstudium in Weihenstephan<br />
und dem Referendariat arbeitete ich an der Regierung von<br />
Schwaben in Augsburg und bei der FÜAK in Landshut.<br />
Ich komme aus Ampermoching bei Dachau und lebe jetzt<br />
mit meiner Frau und zwei Söhnen am Stadtrand von<br />
München.<br />
Herr Leonhard Daumoser<br />
1 3<br />
Mein Name ist Nikolaus Bachinger. Seit<br />
dem 01.08.<strong>2011</strong> bin ich am Amt <strong>für</strong><br />
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
als Abteilungsleiter in der Förderung.<br />
Davor war ich fünf Jahre am Bayer.<br />
Staatsministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />
u. Forsten München im Referat<br />
Grundsatzfragen der Agrarförderung tätig.<br />
Mein Name ist Leonhard<br />
Daumoser, ich bin 30 Jahre alt und<br />
verheiratet. Nach der Ausbildung<br />
zum Landwirt besuchte ich die<br />
Technikerschule in Landsberg am<br />
Lech. Danach bin ich als<br />
pflanzenbaulicher Versuchs-<br />
techniker an der Fachhochschule in Weihenstephan und am<br />
AELF Rosenheim tätig gewesen. Meine staatliche<br />
Ausbildung führte mich in die Abteilungen Förderung am<br />
AELF Rosenheim und Landshut. Seit dem 01.10.<strong>2011</strong> bin<br />
ich als Sachbearbeiter in der Abteilung Förderung tätig.<br />
2<br />
5<br />
Herr Martin Bräutigam<br />
Meine Hauptaufgaben sind daher der Unterricht an der<br />
Landwirtschaftsschule und BiLa-Kurse im Bereich<br />
Tierische Produktion ebenso die Fortführung des<br />
Milchvieharbeitskreises. Zudem bin ich Ansprechpartner<br />
<strong>für</strong> die Betriebszweigauswertung.<br />
Frau Silvia Ilmberger<br />
4<br />
Mein Name ist Martin<br />
Bräutigam. Ich bin seit<br />
17.10.<strong>2011</strong> am Amt <strong>für</strong><br />
Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Forsten Fürstenfeldbruck. Dort<br />
habe ich die Stelle von Frau<br />
Jakowatz übernommen.<br />
Grüß Gott, mein Name ist Silvia<br />
Ilmberger und ich bin seit 01.09.<strong>2011</strong><br />
im Fachzentrum Ernährung /<br />
Gemeinschaftsverpflegung beschäftigt.<br />
Nach meinem Studium der Ökotrophologie<br />
durchlief ich diverse Stationen<br />
im Qualitätsmanagement und Vertrieb<br />
von Pharma- und Cateringunternehmen. Im Fachzentrum<br />
Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung ist es nun meine<br />
Aufgabe, Fach- und Führungskräfte aus Gesundheits- und<br />
Sozialeinrichtungen sowie Betriebsverpflegung durch<br />
Veranstaltungen zu vernetzen und somit zum Informations-<br />
und Erfahrungsaustausch beizutragen. Ich freue mich sehr<br />
auf meine neuen Aufgaben und eine gute kollegiale<br />
Zusammenarbeit.
Frau Annemarie Pentenrieder und Frau Karoline<br />
Ruhdorfer (siehe Foto „Ein neues Sachgebiet“)<br />
Frau Marianne Schuster verabschiedet<br />
Bild: Frau Schuster in<br />
ihrem Element – bei der<br />
Vorstellung der „Münchner<br />
Francaise“ anläßlich des<br />
traditionellen „Balles der<br />
Landwirtschaft“.<br />
Seit dem 15. Dezember<br />
<strong>2011</strong> befindet sich Frau<br />
Marianne Schuster in der<br />
Freistellungsphase.<br />
Sie war seit 1968 (43<br />
Jahre!) ausschließlich an<br />
unserem Amt beschäftigt.<br />
Ihre Tätigkeit unterbrach sie lediglich <strong>für</strong> 12 Jahre zur<br />
Kindererziehung. In zweiter Generation kamen schon<br />
wieder die Kinder ihrer Schülerinnen aus den Anfangsjahren<br />
zum Unterricht. Über 500 Studierende schätzten sie<br />
so – wie sie immer war – äußerst kompetent in musischen<br />
und gestalterischen Bereichen (Stichwort Singen und<br />
Blumenschmuck). Als Beraterin wirkte sie äußerst<br />
hilfsbereit und unterstützend in den vielen sozialen und<br />
familiären Fragen.<br />
Ihre Fachkompetenz bewies sie auch in 33 Jahren Mitgliedschaft<br />
des Meisterprüfungsausschusses „Hauswirtschaft“ –<br />
zuletzt als stellvertretende Vorsitzende.<br />
Wir bedanken uns bei Frau Schuster <strong>für</strong> eine langjährige,<br />
sehr angenehme Zusammenarbeit und wünschen ihr <strong>für</strong> den<br />
Ruhestand alles Gute und immer viel Gesundheit.<br />
I. Bereich Landwirtschaft<br />
Abteilung L 1 – Förderung<br />
1. Antragstellung Agrarumweltmaßnahmen –<br />
Neuerungen beim KULAP<br />
Nachdem der Bayerische Landtag weitere Mittel <strong>für</strong> den<br />
Gewässer- und Bodenschutz in Aussicht gestellt hat, erwägt<br />
das Landwirtschaftsministerium beim Kulturlandschaftsprogramm<br />
(KULAP) neben der Neuantragstellung <strong>für</strong> den<br />
Ökologischen Landbau voraussichtlich auch <strong>für</strong> ausgewählte<br />
einzelflächenbezogene Maßnahmen eine Neuantragstellung<br />
zu eröffnen. Für folgende Maßnahmen können<br />
Neueinsteiger nach derzeitigem Stand eine 5-jährige Verpflichtung<br />
eingehen:<br />
- Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb (A11)<br />
- Winterbegrünung (A32)<br />
- Mulchsaatverfahren (A33)<br />
- Umwandlung von Ackerland in Grünland (A34)<br />
- Grünstreifen zum Gewässer- und Bodenschutz (A35)<br />
Für alle anderen Landwirte bleibt die Möglichkeit bestehen,<br />
ihre im Jahr <strong>2011</strong> auslaufenden KULAP-Verpflichtungen<br />
um weitere zwei Jahre zu verlängern.<br />
Beim Vertragsnaturschutz (VNP) gibt es keine<br />
Neuerungen: Hier sind eine Antragstellung <strong>für</strong> Neueinsteiger<br />
und die zweijährige Verlängerungsmöglichkeit <strong>für</strong><br />
auslaufende Verpflichtungen vorgesehen.<br />
Die Antragstellung <strong>für</strong> KULAP und VNP beginnt noch im<br />
Dezember und endet voraussichtlich am 24.02.2012.<br />
Aktuelle Hinweise zur Förderung finden Sie auch auf der<br />
Homepage des Amtes unter www.aelf-ff.bayern.de<br />
2. MFA-Online 2012<br />
Im November und Anfang Dezember wurden im Dienstgebiet<br />
insgesamt vier Informationsveranstaltungen zum<br />
Thema „MFA-Online“ durchgeführt, die sehr gut besucht<br />
waren. Besonders gut ist bei den Landwirten die<br />
Einführung in das EDV-Programm, mit dem im nächsten<br />
Jahr ab März bis 15. Mai 2012 der Mehrfachantrag gestellt<br />
werden soll, angekommen. Über das Internet wurden vor<br />
Ort an einem Beispielsbetrieb alle notwendigen<br />
Eingabeschritte <strong>für</strong> die erfolgreiche Onlineantragstellung<br />
gezeigt. Ebenso können über das Onlineprogramm auch<br />
Flächenänderungen durchgeführt werden. Der große<br />
Vorteil dabei ist, dass die vorgenommenen Änderungen<br />
gleich in den Flächennutzungsnachweis (FNN)<br />
übernommen werden. Online liegt der FNN damit stets<br />
aktuell vor.<br />
Mit der edv-gestützten Antragstellung und den hinterlegten<br />
Plausibilitätsprüfungen, die schon bei der Eingabe auf<br />
Fehler hinweisen, ist eine sehr hohe Qualität der eingereichten<br />
Daten gewährleistet.<br />
Für die geplanten Schulungen, bei denen der eigene Mehrfachantrag<br />
direkt am PC eingegeben und verbindlich abgeschickt<br />
wird, haben sich sehr viele Landwirte angemeldet.<br />
Die Terminplanung wird derzeit vorbereitet. Eingeladen<br />
wird dazu aber erst im Frühjahr zeitnah zur Mehrfachantragstellung.<br />
Eine weitere Hilfestellung soll auch die neu eingerichtete<br />
Hotline-Nummer bieten. Während des Antragszeitraums<br />
kann bei Fragen zum MFA-Online-Programm unter �<br />
08191 / 9175-199 während der üblichen Geschäftszeiten<br />
am Amt nachgefragt werden.<br />
- Stellenanzeige -<br />
Mitarbeiter/in im Bereich Agrarförderung (InVeKoS)<br />
ab sofort gesucht!<br />
Das Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
Fürstenfeldbruck (AELF), Bismarckstr. 2, 82256<br />
Fürstenfeldbruck, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt<br />
eine/n Mitarbeiter/-in <strong>für</strong> Arbeiten im landwirtschaftlichen<br />
Fördervollzug (Abt. L 1).<br />
Aufgaben sind u. a.:<br />
Bearbeitung und Kontrolle von Förderanträgen über<br />
anwendergestützte EDV-Programme, Erstellung von<br />
Statistiken, Betreuung von Antragstellern.<br />
Erwartet wird von den Bewerbern:<br />
Bereitschaft sich in ein neues Aufgabengebiet<br />
einzuarbeiten, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein<br />
und selbständiges Arbeiten.<br />
Die Besetzung der Stelle erfolgt auf Grundlage des TV-L<br />
befristet auf neun Monate und ist teilzeitfähig.<br />
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei<br />
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt<br />
berücksichtigt. An der Bewerbung von Frauen besteht ein<br />
besonderes Interesse.<br />
Bei Interesse melden Sie sich bitte umgehend am AELF<br />
Fürstenfeldbruck unter ���� 08141 / 3223-0 oder per E-<br />
Mail an: poststelle@aelf-ff.bayern.de.
Abteilung L 2 – Bildung und Beratung<br />
SG L 2.1 Ernährung, Haushaltsleistungen<br />
1. Ein neues Sachgebiet:<br />
Die Ämterreform hat dem Sachgebiet nicht nur eine neue<br />
Nummer zugeordnet, sondern auch die Personalsituation<br />
verändert: Frau Annemarie Pentenrieder wurde vom AELF<br />
Weilheim und Frau Karoline Ruhdorfer vom AELF<br />
Ingolstadt nach FFB versetzt.<br />
Zusammen mit Heidemarie Hirschfelder und Irmgard<br />
Hollering und der Sachgebietsleiterin Marianne Heidner<br />
bearbeiten insgesamt drei Voll-AK die Themengebiete des<br />
Sachgebietes Ernährung und Haushaltsleistungen. Schwerpunkte<br />
sind die Unterrichtserteilung in der Landwirtschaftsschule,<br />
Abt. Hauswirtschaft, und der Meistervorbereitung,<br />
der Aufbau des Netzwerkes Junge Familie und<br />
die Ernährungs- und Bewegungsschule sowie die Einkommensdiversifizierung<br />
durch Haushaltsleistungen.<br />
Wir heißen die neuen Kolleginnen herzlich willkommen,<br />
wünschen ihnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre und<br />
ein gutes Wirken im Dienstgebiet!<br />
Von links nach rechts:<br />
Frau Pentenrieder – Frau Ruhdorfer – Frau Hirschfelder –<br />
Frau Hollering – Frau Heidner<br />
2. Netzwerk Junge Familie – Ernährung und<br />
Bewegung: neue Netzwerkangebote:<br />
Die Ernährungs- und Bewegungsschule <strong>für</strong> Eltern mit<br />
Kindern von 0 bis 3 Jahren wird jetzt neben<br />
Fürstenfeldbruck auch in den Landkreisen Dachau und<br />
Landsberg/Lech angeboten: In Dachau in Kooperation mit<br />
dem Dachauer Forum und in Landsberg in Kooperation mit<br />
dem Landsberger Eltern-ABC.<br />
Hier die Termine, die bereits zur Anmeldung offen stehen:<br />
Mittwoch 25. Januar 2012, 19.30 Uhr:<br />
Mehr als Pizza, Pasta und Pommes Kochpraxis<br />
Mittwoch 8. Februar 2012, 19.30 Uhr:<br />
Die Familienküche: Kochpraxis<br />
Ort: jeweils Hauptschule Markt Indersdorf<br />
Mittwoch 09. Mai 2012, 10.00 Uhr:<br />
Spiele mit Hase Fipsi und Pferdchen Olly:<br />
Bewegungsspiele und Tiere erleben auf dem<br />
Erlebnisbauernhof<br />
Ort: Erlebnisbauernhof Lukas-Hof Tandern<br />
Wir bitten Sie, sich direkt beim Dachauer Forum<br />
anzumelden: Frau Schwibach, � 08136 / 9747<br />
Broschüren und weitere Informationen bei<br />
heidemarie.hirschfelder@aelf-ff.bayern.de<br />
In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk KoKi am<br />
Landratsamt (Koordinierende Kinderschutzstelle) wird<br />
auch Frauen mit Kleinkindern aus sozial schwachem<br />
Hintergrund gedient: In acht Treffen wird<br />
ernährungsphysiologisches Wissen praxisnah verpackt und<br />
in kleinen Häppchen serviert, gemeinsam gekocht und<br />
pädagogische Möglichkeiten gezeigt, wie man Kinder in<br />
die Selbstherstellung von Speisen einbinden kann.<br />
Eine erste Fachtagung „Netzwerk Junge Familie“ fand <strong>für</strong><br />
Interessenten aus ganz Oberbayern am 30. November <strong>2011</strong><br />
im Veranstaltungsforum Fürstenfeld in FFB statt. Das<br />
Sachgebiet beteiligte sich mit einem Ausstellungstand und<br />
zeigte das vielfältige Programm des „Netzwerkes Junge<br />
Familie“, das zugunsten der neuen Generation ins Leben<br />
gerufen wurde.<br />
SG L 2.2 Landwirtschaft<br />
Veranstaltungen<br />
1. Kleinbiogasanlagen <strong>für</strong> interessierte Tierhalter<br />
Freitag, 20. Januar 2012 um 10.00 Uhr in St. Ottilien,<br />
Emminger Hof<br />
Das neue EEG startet ab 01. Januar 2012. Es sieht u. a.<br />
auch die besondere Förderung von sog. „Kleinbiogasanlagen“<br />
vor.<br />
Auf der Basis von überwiegendem Gülleeinsatz wird die<br />
Kilowattstunde mit 25 ct pauschal vergütet.<br />
Welche Technik zum Einsatz kommt und wie die Wirtschaftlichkeit<br />
sich in solchen Anlagen rechnet, das erfahren<br />
Sie in dieser Veranstaltung.<br />
Am Nachmittag werden zwei Kleinanlagen besichtigt.<br />
Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, den 13. Januar<br />
2012 unter ���� 08141 / 3223-222 .<br />
Die <strong>Teil</strong>nehmer erhalten das Programm kurzfristig zugeschickt<br />
– bitte bei der Anmeldung eine mögliche E-Mail-<br />
Adresse angeben.<br />
2. Landsberger Praxistag<br />
Eiweißgewinnung im heimischen Betrieb<br />
Montag, 06. Februar 2012 von 9.00 – 15.00 Uhr in der<br />
Landmaschinenschule Landsberg am Lech<br />
9.00 Uhr Begrüßung<br />
Wolfgang Stützle, ABZ LL<br />
9.15 Uhr –<br />
9.45 Uhr<br />
9.45 Uhr -<br />
10.15 Uhr<br />
10.15 Uhr –<br />
10.30 Uhr Pause<br />
10.30 Uhr -<br />
11.15 Uhr<br />
Moderation: Alois Pfluger, AELF FFB<br />
Das bayerische Aktionsprogramm<br />
„Heimische Eiweißfuttermittel“ – Was<br />
steckt dahinter?<br />
Josef Groß, LfL, Institut <strong>für</strong> Ländliche<br />
Strukturentwicklung, Betriebswirtschaft<br />
u. Agrarinformatik<br />
Eiweißgewinnung durch den Anbau<br />
gentechnikfreier Sojabohnen<br />
Josef Asam, Kissing<br />
Top Grünland – auf was kommt´s an?<br />
Dr. Michael Diepolder, LfL, Institut <strong>für</strong><br />
Agrarökologie, Ökologischer Landbau u.<br />
Bodenschutz
11.15 Uhr –<br />
11.45 Uhr<br />
11.45 Uhr –<br />
12.00 Uhr<br />
12.00 Uhr Brotzeit<br />
13.00 Uhr -<br />
15.00 Uhr<br />
Grünlandmanagement im praktischen<br />
Betrieb<br />
Peter Kaindl, Schöffelding<br />
Einführung in die ausgestellte<br />
Maschinentechnik<br />
Dr. Horst-Georg Unteutsch, Landmaschinenschule<br />
LL<br />
Besichtigung der ausgestellten<br />
Maschinen<br />
Die Veranstaltung wird unterstützt vom AELF Fürstenfeldbruck,<br />
Absolventenverband ABZ LL, VlF LL,<br />
Maschinenring LL, FFB und DAH; BBV Kreisverband LL<br />
– Ring der Landwirte LL – Club der Landwirte<br />
Tagungspauschale € 10,-- (inkl. Brotzeit und Tagungsband)<br />
3. Energietag Oberbayern Nord<br />
Donnerstag, 08. März 2012 von 9.30 – 16.00 Uhr in<br />
Freising (DEULA – Wippenhauser Str. 65)<br />
Vorgestellt wird das Erneuerbare Energien Gesetz.<br />
Sie erhalten Informationen zur:<br />
• Standortsuche <strong>für</strong> Windkraftanlagen<br />
• zur Rentabilität von Kurzumtriebsplantagen<br />
• Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen<br />
Zudem berichtet ein praktischer Landwirt über die Umsetzung<br />
vom Wärmenetzen bei Biogasanlagen.<br />
Neben Landwirten sind zu dieser Veranstaltung auch<br />
kommunale Mandatsträger eingeladen.<br />
Veranstalter ist das Fachzentrum <strong>für</strong> Diversifizierung und<br />
Strukturentwicklung am Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Forsten Ingolstadt.<br />
Anmeldung erforderlich unter ���� 0841 / 3109-0.<br />
4. Tagesseminar <strong>für</strong> Milchviehhalter am LVFZ<br />
Achselschwang am 22.03.2012<br />
Programm:<br />
9:00 - 11:30 Uhr Laufen heimische Eiweißfuttermittel<br />
Soja den Rang ab? Dr. Katrin Malkow<br />
(Lehr- und Versuchszentrum<br />
Futterkamp der Landwirtschaftkammer<br />
Schleswig-Holstein)<br />
11:30 – 12:30 Uhr Überprüfung der Futterration in der<br />
Praxis - Dr. Katrin Malkow u. a.<br />
Mittagessen<br />
13:45 – 15:00 Uhr Besprechung der Ergebnisse und<br />
Diskussion - Dr. Katrin Malkow u. a.<br />
Kosten: 20,- € incl. Mittagessen<br />
Anmeldung erforderlich bis Montag 05. März 2012<br />
unter ���� 08191 / 9175-0<br />
Fachinformationen<br />
1. Schimmelpilze in Silomais<br />
Im Rahmen des Silocontrollings wurde auf einigen<br />
Betrieben Schimmelpilzbefall in den noch jungen Maissilagen<br />
des Erntejahres <strong>2011</strong> festgestellt. Besonders<br />
alarmierend ist, dass diese Probleme bereits jetzt zu Beginn<br />
des Winters auftreten. Dies lässt starke Schimmelprobleme<br />
im nächsten Frühjahr/Sommer be<strong>für</strong>chten, sobald die<br />
Temperaturen wieder ansteigen.<br />
Es handelt sich dabei um blaue oder rote ballförmige<br />
Schimmelnester, sogenannte „hot spots“, die meist von den<br />
Pilzen Penicillium roqueforti oder Monascus ruber verursacht<br />
werden. Als Voraussetzung <strong>für</strong> das Entstehen dieser<br />
Schimmelnester müssen in der Silage sowohl die Sporen<br />
der Schimmelpilze, als auch eine ausreichende Menge an<br />
Sauerstoff vorhanden sein. Einen besonders hohen Besatz<br />
an Schimmelsporen findet man z. B. an Mais, der durch<br />
einen Hagel geschädigt wurde. Der wichtigste Risikofaktor<br />
<strong>für</strong> die Entstehung von Schimmelpilzen ist Sauerstoff, auf<br />
den sowohl Schimmelpilze als auch Hefen <strong>für</strong> ein schnelles<br />
Wachstum angewiesen sind. Dabei ist weniger der Restsauerstoff,<br />
der nach dem Walzen des Silos im Futterstock<br />
verbleibt das Problem, sondern vielmehr der „frische“<br />
Sauerstoff, der bei der Entnahme des Futters in die Anschnittfläche<br />
eindringt. Je geringer die Verdichtung eines<br />
Silostockes ist, desto mehr Sauerstoff kann in den Futterstock<br />
eindringen und desto höher ist die Gefahr <strong>für</strong><br />
Schimmelbefall und Nacherwärmung. Weil die Verdichtung<br />
im Silo naturgemäß von unten nach oben abnimmt,<br />
findet man diese Probleme v.a. im oberen Silodrittel.<br />
Die Schimmelnester sitzen dabei meist in einem<br />
Bereich von 0,25 – 1,00 m unterhalb der Silofolie.<br />
Gründe <strong>für</strong> einen starken Schimmelbefall der diesjährigen<br />
Maissilagen sind neben den höheren Schimmelsporengehalten<br />
auf verhagelten Maisbeständen auch die z. T. sehr<br />
hohen Trockenmassegehalte der Maissilagen. Trockene<br />
Silagen lassen sich deutlich schlechter verdichten, die Luft<br />
kann dadurch besser und tiefer in die Anschnittfläche des<br />
Silos eindringen und das Wachstum von Schimmelpilzen<br />
und Hefen wird gefördert. Darüber hinaus zeichnen sich die<br />
Maissilagen dieses Jahr durch sehr hohe Stärke- und<br />
Energiegehalte aus, was ebenfalls das Wachstum der<br />
Gärschädlinge begünstigt und die Stabilität der Silagen<br />
gefährdet.<br />
Verschimmelte Bereiche dürfen auf keinen Fall verfüttert<br />
werden! Sie müssen sorgfältig aussortiert werden, weil sie<br />
die Tiergesundheit und damit auch die Leistung der Tiere<br />
nachhaltig beeinträchtigen können. Dies gilt auch <strong>für</strong> das<br />
Futter der zukünftigen Hochleistungskühe - dem Jungvieh!<br />
Als mögliche Gegenmaßnahmen um das Ausbreiten der<br />
Schimmelnester einzudämmen, sollte auf einen hohen Vorschub<br />
und eine geringe Auflockerung des Futterstockes bei<br />
der Entnahme geachtet werden. Falls die Schimmelprobleme<br />
im Laufe des nächsten Frühjahr/Sommer überhand<br />
nehmen, sollte eine nachträgliche Konservierung der<br />
Maissilage mit Siliermitteln der DLG Wirkungsrichtung 2<br />
vorgenommen werden. Denkbar wäre z.B. der Einsatz von<br />
Propionsäure, die mithilfe von Lanzen in das obere Silodrittel<br />
eingespritzt wird. Alternativ könnten teilweise geleerte<br />
Silos wieder auf die volle Silolänge umsiliert werden,<br />
dabei sollte ein chemisches Siliermittel der DLG<br />
Wirkungsrichtung 2 zur Vorbeugung eines weiteren Verderbes<br />
zugegeben werden.<br />
Grundsätzlich gilt: Vorbeugen ist besser als die<br />
Behandlung der Symptome! Es sollte bei der<br />
Silagebereitung stets auf eine optimale Verdichtung bei<br />
nicht zu hohen TM-Gehalten geachtet werden. Wenn<br />
Probleme mit Schimmel und Nacherwärmung im Betrieb<br />
häufiger auftreten, sollte über den vorbeugenden Einsatz<br />
eines Siliermittels der DLG Wirkungsrichtung 2 bereits bei<br />
der Ernte nachgedacht werden.<br />
Für weitere Fragen zu diesem Thema steht Ihnen Herr<br />
Herbert Heiligmann � 08141 / 3223-221 zur Verfügung.
2. Pflugloser Ackerbau contra Pflugeinsatz: Ein<br />
Praktikerbericht<br />
Welche pflanzenbauliche und ökonomische Auswirkungen<br />
ergeben sich durch eine Bodenbewirtschaftung mit komplettem<br />
Pflugverzicht? Unter welchen Bedingungen funktioniert<br />
dies und wo sind die Grenzen?<br />
Dieses Thema wird unter Landwirten und auch in der<br />
angewandten Forschung leidenschaftlich und kontrovers<br />
diskutiert wird.<br />
Dass pflugloser Ackerbau auch unter schwierigen Bedingungen<br />
erfolgreich praktiziert werden kann, erlebten die<br />
Gäste der VlF Monatsverssammlung in Landsberied. In<br />
einem Einführungsvortrag von Fachberater Maximilian<br />
Stadler (AELF Pfaffenhofen, Fachzentrum Agrarökologie)<br />
über die vielfältigen positiven Auswirkungen einer<br />
gesunden Bodenfauna und Bodenstruktur, die vor allem<br />
über den gezielten Zwischenfruchtanbau hergestellt bzw.<br />
erhalten wird, wurde den Zuhörern vor allem die enorme<br />
Bedeutung eines hohen Regenwurmbesatzes erklärt.<br />
Versuche zeigten, dass bei intaktem Boden ca. eine Tonne<br />
„Regenwurmmasse“ pro ha vorhanden sein kann, das<br />
entspricht in Großvieheinheiten ausgedrückt etwa 2 GV/ha.<br />
Stadler ging dabei unter anderem auf die Funktion der<br />
Zwischenfrucht als „Futter <strong>für</strong> den Regenwurm“ ein.<br />
Wie plugloser Ackerbau in der Praxis erfolgreich gelingen<br />
kann, erklärte anschließend Bernhard Reischl. Er bewirtschaftet<br />
einen 145 ha Ackerbaubetrieb (Lehmböden,<br />
Bonität ca. 40-60 Bodenpunkte) mit 660 Schweinemastplätzen<br />
in Lindach (Petershausen). Angebaut werden v.a.<br />
Winterweizen, Raps, Zuckerrüben und seit kurzem auch<br />
Ackerbohnen. Er bewirtschaftet seinen Betrieb seit acht<br />
Jahren ohne Pflugeinsatz. Reischl erklärte, dass dies auch<br />
bei schweren Böden und problematischen Kulturen wie<br />
z.B. Winterraps erfolgreich gelingen kann: „Meine Erträge<br />
sind seither nicht zurückgegangen, eher im Gegenteil, so<br />
liegen die Weizenerträge bei 90-100 dt/ha, auch der Raps<br />
liegt bei 40-50 dt/ha. Aufgefallen ist mir, dass<br />
Ertragsschwankungen seit der Umstellung zurückgegangen<br />
sind“, so Reischl. Pflugloser Ackerbau ist als ein System zu<br />
betrachten, das bereits bei der Vorfrucht beginnt. Größter<br />
Wert wird auf eine gute Verrottung der Ernterückstände<br />
gelegt, dabei ist das Mulchgerät die entscheidende<br />
Maschine. Welche Effekte der Verzicht auf den Pflug mit<br />
sich brachte, legte Reischl anhand von seinen Zahlen dar.<br />
So lag der Einspareffekt beim Dieselverbrauch bei 43 l/ha,<br />
die Reduzierung des Arbeitsaufwandes lag bei etwa 1,5<br />
Stunden pro Hektar. Was aber vor allem auffiel, war eine<br />
deutlich verbesserte Tragfähigkeit und somit Befahrbarkeit<br />
der Böden. Dieser Effekt kommt durch den geringen<br />
Eingriff in das Bodengefüge zustande, die Bodenaggregate<br />
stabilisieren sich von Jahr zu Jahr besser. „Ich habe die<br />
Bearbeitungstiefe in den Jahren schrittweise bis auf etwa 10<br />
- 15 cm reduziert“, so Reischl. Als Fazit in der<br />
anschließenden Diskussion nahmen die Gäste mit, dass<br />
pflugloser Ackerbau eine Alternative darstellt, die<br />
vielfältige Einsparmöglichkeiten und Bodenverbesserungen<br />
mit sich bringt. Es ist aber wichtig, dass man dies als ein<br />
System betrachtet, bei dem nicht nur einfach der Pflug<br />
weggelassen wird, sondern das gesamte<br />
Produktionsverfahren darauf abzustimmen ist.<br />
Zeit- und Dieselbedarf im pfluglosen Verfahren<br />
Arbeitsgang<br />
Zeitbedarf<br />
(min/ha)<br />
Dieselverbrauch<br />
(l/ha)<br />
Stoppelmamagement 10 5<br />
Grubbern tief 20 10<br />
Grubbern flach 10 5<br />
Saat 17 6<br />
Pflanzenschutz 4,5 x 27 7<br />
Düngen 4x 16 4<br />
Ernte 20 17<br />
Gesamt 120 54<br />
Zeit- und Dieselbedarf im konventionellen Verfahren<br />
Arbeitsgang<br />
Zeitbedarf<br />
(min/ha)<br />
Dieselverbrauch<br />
(l/ha)<br />
Grubbern 20 10<br />
Pflügen 60 25<br />
Vorkreiseln 50 % 22 10<br />
Saat 45 20<br />
Pflanzenschutz 4 x 24 6<br />
Düngen 4x 16 4<br />
Ernte 25 22<br />
Gesamt 212 97<br />
Vergleich beider Verfahren<br />
konventionell 212 97<br />
pfluglos 120 54<br />
Differenz 92 43<br />
3. Lehrfahrt <strong>für</strong> Milchviehhalter an den Bodensee vom<br />
08.09.- 10.09.<strong>2011</strong><br />
Das Ziel der Milchviehhalter in diesem Jahr war der neue<br />
Arbeitsbereich unseres Projektmitarbeiters Florian Vetter.<br />
Das dortige Beratungsteam betreut auf Vertragsbasis ihre<br />
Kunden in allen Fragen um die Milchwirtschaft.<br />
Auf der Hinfahrt konnten wir auf dem Landwirtschaftlichen<br />
Zentrum <strong>für</strong> Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft,<br />
Wild und Fischerei in Aulendorf (www.lazbw.de),<br />
den im Jahr 2010 neu gebauten Milchviehstall unter die<br />
Lupe nehmen. Der zweireihige Außenklimastall <strong>für</strong> 80<br />
Kühe ist eine Sheddachhalle mit Kassettendach. Für Lehr-<br />
und Versuchszwecke sind verschiedene Aufstallungen,<br />
Hoch- sowie Tiefboxen, Liege- und Laufflächen eingebaut.<br />
Gemolken werden die Kühe im Altgebäude sowohl mit<br />
einem Side by Side- als auch einem Fischgrätmelkstand.<br />
Die Weiterfahrt führte über das malerische Städtchen<br />
Meersburg, wo nach einer Burgführung im „Alten Schloß“<br />
die Meisten eine Kaffeepause in der Altstadt einlegten.<br />
Insgesamt vier Milchviehbetriebe standen auf dem Besichtigungsprogramm.<br />
Alle Betriebe wirtschaften mit 120<br />
bis 160 Milchkühen und sind hochmotiviert. Zu kämpfen<br />
haben alle Betriebe mit der vorherrschenden Flächenstruktur<br />
trotz des günstigeren Klimas herrscht ein Grünlandanteil<br />
von mehr als 50 % vor und die jeweils um 150<br />
ha bewirtschaftenden Betriebe müssen dazu 107 Feldstücke<br />
anfahren, die dann auch noch sehr hügelig sind.<br />
Auf dem Betrieb Deyer GbR bei Mühlingen laufen seit<br />
zwei Jahren zwei Melkroboter in zwei verschiedenen<br />
Stallgebäuden.<br />
Die gemischte Fleckvieh- und Holsteinherde melken die<br />
Roboter problemlos im freien Kuhverkehr. Nur mit den<br />
Zellgehalten ist der Betriebsleiter noch nicht zufrieden. Die<br />
Familie wird noch von zwei Azubis verstärkt. Zusätzlich<br />
wird noch Bauernhofeis an Großkunden vermarktet. Der<br />
Nachbarbetrieb der Familie Scheppe melkt im neugebauten<br />
Melkkarussell mit Hilfe einer vorerst auf ein Jahr
efristeten Arbeitskraft und spart durch die Nutzung der<br />
Maschinen des Onkels beim Maschinenkapital. Auf dem<br />
Hof Römersberg (www.hof-roemersberg.de) bei Hilzingen<br />
arbeitet der landwirtschaftliche Betrieb der Staufen-GbR.<br />
Die GbR bewirtschaftet seit 2001 den Milchviehstall.<br />
Gemolken wird hier in einem 8 x 8 Side by Side-<br />
Melkstand. Der Nachbar liefert als GbR-Mitglied das<br />
fehlende Futter. Frau Angela Graf vom Hof Römersberg<br />
wirkt als Kräuterpädagogin, vermietet oder bewirtschaftet<br />
selbst einen Gastraum, in dem wir auch unseren Kaffee<br />
genießen konnten. Der Betrieb Ziegler in Frickingen fiel<br />
durch die harmonische Zusammenarbeit der jungen<br />
Betriebsleiterfamilie mit drei Kindern und den 60 jährigen<br />
Eltern auf.<br />
Etwas Einblick in die Probleme des Gemüsebaus auf der<br />
Insel Reichenau verschaffte uns Herr Franz Gut. Er bewirtschaftet<br />
einen von 50 Vollerwerbsbetrieben (gesamt<br />
100 Betriebe), die sich die 160 ha Anbaufläche der Insel<br />
teilen müssen. Mit vollem Engagement zeigte er uns seinen<br />
Anbau von Salat, Gurken und Tomaten. Dennoch antwortete<br />
er auf die Frage nach der Hofnachfolge: „Eine<br />
Ausbildung im Gemüsebau empfehle ich schon, eine<br />
selbständige Tätigkeit auf der Insel Reichenau nicht“.<br />
Grund da<strong>für</strong> sind die strukturellen Nachteile auf der Insel.<br />
Abschließend konnten wir uns noch bei unserem<br />
Organisator und Berater Florian Vetter mit seiner Partnerin<br />
<strong>für</strong> die Vorbereitung bedanken. Wir haben hochmotivierte<br />
Betriebsleiter, die mit Zuversicht in die Zukunft blicken,<br />
kennengelernt.<br />
4. EU Wasserrahmenrichtlinie - Erosionsschutzstreifen<br />
Im vergangenen Frühjahr wurde ein Schauversuch mit<br />
Erosionsschutzstreifen im Mais bei Petershausen (Speckhof)<br />
angelegt. Er sollte unter örtlichen Gegebenheiten die<br />
Unterschiede der Kulturen in ihrer Entwicklung hinsichtlich<br />
der Erosionsschutzwirkung aufzeigen. Es wurden<br />
Hafer, Weidelgras, Sommergerste und Wintergerste miteinander<br />
verglichen.<br />
Die Erosionsschutzverordnung gibt vor, dass der Schutzstreifen<br />
bis zum Reihenschluss vorhanden sein muss. Wenn<br />
man auf das Jahr 2010 zurückblickt wird klar, dass der<br />
größte Unsicherheitsfaktor im Pflanzenschutz liegt.<br />
Aus der Luftaufnahme vom September kann man die<br />
Wuchsdepression (ca. 20 cm) der Schutzstreifen erkennen.<br />
Die Intensität ist jedoch unterschiedlich. Der Versuch hat<br />
gezeigt, dass es möglich ist zu pflügen und im Frühjahr<br />
einen Erosionsschutz zu sähen.<br />
Die Schwierigkeit liegt jedoch im Pflanzenschutz. Es<br />
wurden zwei verschiedene Spritzzeitpunkte angewandt. Im<br />
Bild 2 ist die Wuchsentwicklung der unterschiedlichen<br />
Anwendungen deutlich zu erkennen. Um hier jedoch noch<br />
mehr Erfahrungen sammeln zu können, wären weitere<br />
Versuche notwendig.<br />
Interessierte sollten sich am Amt melden.<br />
Erosionsschutz durch Mulchsaat<br />
Die Alternative zu den Erosionsschutzstreifen stellt die<br />
Mulchsaat dar. Hier gibt es ein sehr großes Spektrum an<br />
Möglichkeiten: Zum Einen in der Technik von Mähdreschersaat,<br />
Sommerfurche und Schneckenkornstreuer,<br />
Grubberstrich, Scheibenegge, Untersaat, bis hin zur<br />
kombinierten Saat und zum Anderen in der Wahl der<br />
Zwischenfrüchte.<br />
Hier ist von der Reinsaat mit Senf, Phacelia, Erbsen, Hafer,<br />
Kresse, Ramtillkraut usw. über Eigenmischungen bis hin zu<br />
Fertigmischungen, welche der Handel bereits anbietet, eine<br />
ausgesprochene Vielfalt an Möglichkeiten vorhanden.<br />
Um sich ein Bild der im Handel erhältlichen Mischungen<br />
zu machen, wurde ein Zwischenfrucht Schauversuch mit<br />
handelsüblichen Mischungen verschiedener Anbieter angelegt.<br />
Dieser liegt bei Luttenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck),<br />
und dient im kommenden Frühjahr als Mulchsaat Schauversuch.<br />
Es handelt sich um die<br />
Fertigmischungen MS100A<br />
(BSV); Alexandrinerklee+PhaceliaFertigmischung<br />
(Dehner Agrar);<br />
MG2 (Maier Saaten);<br />
ZWH4022 (Planterra); SB100<br />
(BSV) und MG5 (Maier<br />
Saaten).<br />
Alle Mischungen haben sich gut entwickelt – überzeugen<br />
Sie sich selbst.<br />
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei der Familie<br />
Mair (Speckhof) und Familie Keller (Luttenwang) recht<br />
herzlich bedanken, dass Sie <strong>für</strong> uns die Versuchsflächen zur<br />
Verfügung gestellt haben.<br />
5. Das neue Fachzentrum <strong>für</strong> Rinderhaltung in Erding<br />
Am 01. Oktober ist am Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Forsten eine neue Organisationsstruktur in Kraft getreten.<br />
Um die Beratung und effiziente Koordination in<br />
speziellen Fachfragen zu sichern, wurde überregional am<br />
AELF Erding ein Fachzentrum Rinderhaltung eingerichtet.
Das neue Fachzentrum bietet Ihnen neben der Beratung in<br />
Fragen des Stallbaus, der Fütterungs- bzw. Stalltechnik und<br />
Energieeffizienz auch fachliche Unterstützung in Spezialfragen<br />
der Produktionstechnik und Verfahrensökonomik in<br />
enger Zusammenarbeit mit den Beratern der ÄELF<br />
Pfaffenhofen und Ingolstadt sowie den Fütterungstechnikern<br />
des LKV.<br />
Die Berater des Fachzentrums Rinderhaltung Erding sind<br />
<strong>für</strong> 12 Landkreise im nördlichen Oberbayern zuständig<br />
(MÜ, AÖ, EBE, M, ED, FS, PAF, EI, ND, FFB, DAH,<br />
LL), eine Region mit ca. 5.600 milchviehhaltenden<br />
Betrieben und ca. 165.000 Milchkühen.<br />
Unter � 08122 / 480-0 sind die Berater im Fachzentrum<br />
Rinderhaltung erreichbar:<br />
• Frau Petra Praum<br />
• Herr Josef Heitzer (Bauberatung bei Neu-, An- und<br />
Umbauten von Wirtschaftsgebäuden)<br />
• Herr Josef Haider (Beratung zur Verfahrenstechnik in<br />
der Tierhaltung)<br />
• Frau Vanessa Eberl<br />
Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit<br />
zum Vorteil der Milchviehbetriebe.<br />
Bei den Milchviehtagen in Pflugdorf und Bergkirchen im<br />
Februar 2012 werden wir Sie über weitere Details<br />
informieren.<br />
Weitere Fachzentren stellen sich im nächsten<br />
<strong>Mitteilungsblatt</strong> vor!<br />
Ausbildung und Landwirtschaftsschule<br />
Aktuelles aus der Berufsausbildung<br />
Meisterbriefüberreichung am 03.11.<strong>2011</strong><br />
1. Reihe von links:<br />
Andreas Bertele aus Altomünster, Wolfgang Münch aus<br />
Erdweg, Elisabeth Robeller (Hauswirtschaftsmeisterin) aus<br />
Mammendorf, Michael Ostermair aus Hilgertshausen-<br />
Tandern, Georg Krimmer aus Markt Indersdorf<br />
2. Reihe von links:<br />
Andreas Wörle aus Egling a. d. Paar, Martin Riedmair aus<br />
Altomünster, Michael Mösl aus Sulzemoos, Josef Reischl<br />
aus Stetten, Andreas Lapperger aus Altomünster, Andreas<br />
Sigl aus Kottgeisering<br />
3. Reihe von links:<br />
Roland Kobböck aus Unterbrunn, Michael Mösl aus<br />
Hofstetten, Martin Neheider aus Mammendorf, Josef Haas<br />
aus Maisach, Michael Schneller aus Utting, Martin<br />
Schuster aus Fuchstal<br />
Nicht auf dem Foto:<br />
Johannes Nottensteiner aus Schwabhausen (DAH), Stefan<br />
Kistler aus Petershausen, Vitus Liegsalz aus Bergkirchen<br />
und Lukas Polz aus Wörthsee.<br />
Herzlichen Glückwunsch!<br />
Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck<br />
Abt. Landwirtschaft<br />
Die beiden Semester haben die neue Schule gut<br />
angenommen. Im Mittelpunkt des 3. Semesters steht derzeit<br />
natürlich die Erstellung der schriftlichen Hausarbeit<br />
(Meisterarbeit), bei der der eigene Betrieb in der IST-<br />
Situation berechnet und mit einer ZIEL-Lösung (z. B.<br />
Stallneubau) kalkuliert wird.<br />
Abt. Hauswirtschaft<br />
1. Einkommensdiversifizierung im Fach Unternehmensführung<br />
Der neue Lehrplan erlaubt zum ersten Mal, dass auch externe<br />
Interessenten zugelassen werden. Die Landwirtschaftsschule<br />
beteiligt sich an diesem Modellprojekt des<br />
Bayerischen Staatsministeriums <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Forsten. Bäuerinnen, die am Aufbau einer Einkommenskombination<br />
interessiert sind, können das „Interdisziplinäre<br />
Grundlagenseminar“ besuchen, das im<br />
Rahmen des Landwirtschaftsschulunterrichtes angeboten<br />
wird. Möglichkeiten der Diversifizierung, unternehmerische<br />
Strategien zur Erschließung neuer Geschäftsfelder<br />
sowie steuerliche und sozialrechtliche Belange<br />
werden Inhalte sein.<br />
Interessenten können sich voranmelden bei<br />
marianne.heidner@aelf-ff.bayern.de<br />
Möglichkeiten der Einkommensdiversifizierung können<br />
sein: Erlebnisbäuerinnen, die verschiedenen Altersstufen<br />
den Bauernhof als Lernort und/oder Erlebnisort vorstellen,<br />
Hauswirtschaftliche Fachservice, die im Team ein Angebot<br />
von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Catering-<br />
Service schaffen (besonders in Ballungsräumen nachgefragt),<br />
die Direkt- und Regionalvermarktung – auch in<br />
Zusammenarbeit mit Supermärkten - und die Ländliche<br />
Gästebeherbergung und Gästebewirtung.<br />
Für Personen, die das „Interdisziplinäre<br />
Grundlagenseminar“ besucht haben, besteht die<br />
Möglichkeit Aufbauseminare zu den o.g. Themen zu<br />
besuchen und mit einer Qualifizierungsurkunde<br />
abzuschließen, um gut ausgebildet zu sein <strong>für</strong> eine neue<br />
Einkommenskombination.<br />
2. Fächerübergreifender Projektunterricht:<br />
Das erste Projekt: Catering
Erst drei Wochen an der Schule und schon haben die<br />
Studierenden das erste gemeinsame Projekt im Fächerübergreifenden<br />
Projektunterricht geschultert:<br />
Catering beim 10 -jährigen Jubiläumsfest von Donum Vitae<br />
mit Fingerfood – Buffet und Anrichten und Service.<br />
Zweites Projekt: Hauswirtschaftliche Betreuung<br />
Foto: Über hundert große Sterne wurden aus Weide<br />
und Haselnuss angefertigt und von den Kindern weihnachtlich<br />
verziert.<br />
Das Thema „Hauswirtschaftliche Betreuung“ ist <strong>für</strong><br />
künftige Hauswirtschafterinnen ein neues Prüfungsgebiet.<br />
Darin übten sich die Studierenden beim Adventsmarkt der<br />
Landfrauen auf dem Wolfgangshof in Olching am<br />
1. Advent, als sie Kinder anleiteten, mit naturnahen<br />
Materialien adventliche Geschenke anzufertigen. Ein<br />
weiteres Erlebnis dabei war, dass der Bayerische Rundfunk<br />
das Geschehen filmte und es in der Sendung<br />
Gesundheitsmagazin ausstrahlte.<br />
II. Bereich Forsten<br />
1. Neuerungen beim Forstliches Gutachten zur<br />
Situation der Waldverjüngung 2012<br />
Im kommenden Frühjahr wird wieder das Forstliche<br />
Gutachten zur Situation der Waldverjüngung durchgeführt.<br />
Da es nach wie vor zu Diskussionen zwischen den<br />
Beteiligten kommt, sollen dieses Mal die Akzeptanz und<br />
Aussagekraft des Verfahrens gesteigert werden. Dazu dient<br />
die neu entwickelte „Revierweise Aussage“. Sie ergänzt<br />
das Ihnen bekannte und nur unwesentlich veränderte<br />
Inventurverfahren, das in bewährter Weise auf der Basis<br />
des gleichen Gitternetzes wie 2009 stattfinden wird.<br />
Die „Revierweise Aussage“ wird von den Revierleitern der<br />
Forstbehörden automatisch <strong>für</strong> jedes einzelne Revier in den<br />
Hegegemeinschaften erstellt, bei denen im vorangegangen<br />
Gutachten die Verbissbelastung als zu hoch bewertet wurde<br />
(„Rote Hegegemeinschaften“).<br />
In den Hegegemeinschaften mit tragbarer Belastung<br />
(„Grüne Hegegemeinschaften“) werden diese<br />
„Revierweisen Aussagen“ nur gefertigt, wenn dies<br />
zumindest von einem Beteiligten (Jagdvorstand,<br />
Revierinhaber, Eigenjagdbesitzer, einzelne Jagdgenossen)<br />
beantragt wird.<br />
Empfohlen wird, diesen Antrag bald, spätestens aber bis<br />
zum 31.01.2012, schriftlich (siehe Anlage) oder zur<br />
Niederschrift am Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Forsten in Fürstenfeldbruck zu stellen.<br />
Das AELF bietet die Möglichkeit an, den Revierleiter beim<br />
Revierbegang zu begleiten. Dies wird in Verbindung mit<br />
den Aufnahmen zur Verbissinventur geschehen, also in den<br />
Monaten März oder April 2012. Den genauen Termin teilt<br />
das Amt den Betroffenen im Laufe des Februar mit.<br />
100 Jahre VlF Bayern<br />
500 Gäste in der vollbesetzten NeuStadtHalle am Schloß in<br />
Neustadt/Aisch (Mfr) feierten das 100-jährige Bestehen des<br />
VlF Landesverbandes. Die anwesenden VlF-Vertreter<br />
(auch aus unseren Kreisverbänden) und zahlreiche<br />
Ehrengäste repräsentierten 120.000 VlF-Mitglieder in<br />
Bayern.<br />
Nach einem ökumenischen Begleitwort von Regionalbischof<br />
Christian Schmidt und Pater Josef Fischer begrüßte<br />
der Landesvorsitzende Hans Koller die Landesversammlung<br />
mit einem Rückblick auf 100 Jahre VlF-Bayern.<br />
Ministerpräsident Horst Seehofer hielt die anschließende<br />
Festrede zum Thema „Aufbruch Bayern – <strong>für</strong> eine landwirtschaftliche<br />
Zukunft“.<br />
In der überaus gelungen Veranstaltung wurde deutlich, dass<br />
Bildung nicht mit dem Empfang der Zeugnisse aufhört,<br />
sondern ein lebenslanger Prozess ist. Die Halbwertzeit des<br />
Wissens verkürzt sich laufend – was gestern noch Stand der<br />
Technik war, kann heute bereits überholt oder morgen<br />
falsch sein. Anders ist es bei Werten und Haltungen, die<br />
auch durch noch so revolutionäre Neuerungen nicht an<br />
Bedeutung verlieren. Die Landwirtschaftsschule hat die<br />
Aufgabe neben der reinen Wissensvermittlung auch die<br />
geistige und menschliche Haltung zu vermitteln. Gemeinsam<br />
mit Qualifikation, Geschick und Unternehmensgeist<br />
sind das immer mehr die Garantien <strong>für</strong> eine erfolgreiche<br />
Unternehmensführung. Die laufende Fortbildung im<br />
Berufsleben gewinnt deshalb immer mehr an Bedeutung.<br />
Die regionalen VlFs haben sich im landwirtschaftlichen<br />
und hauswirtschaftlichem Bildungsbereich zu tragenden<br />
Säulen entwickelt – die gilt es zu erhalten und laufend zu<br />
stärken.<br />
vlf-Bundesseminar „Bauernhofgastronomie“-Petersberg<br />
Weil das vlf-Bundesseminar „Die Bauernhofgastronomie<br />
zur Stärkung der Landwirtschaft im ländlichen Raum“ in<br />
unserem Dienstgebiet stattfindet, wollen wir gerne gesondert<br />
darauf hinweisen. Termin: 23. u. 24. Januar 2012.<br />
Tagungsort: Katholische Landvolkshochschule Petersberg,<br />
Oberes Haus. Seminargebühr:€ 55,--, bei Unterkunft und<br />
Verpflegung € 77,--. Frau Marianne Scharr, Vertreterin der<br />
Hauswirtschaft im Bundesverband vlf, stellvertretende<br />
Frauenvorsitzende im vlf Bayern und selbst<br />
Milchviehhalterin aus Dettenschwang (Lkr. LL) wird als<br />
Coach dieses Seminar maßgeblich mitgestalten. Nähere<br />
Informationen zum Programm und Anmeldung am<br />
AELF Traunstein unter ���� 0861 / 7098-0. Offizieller<br />
Anmeldschluss war bereits am 19. Dezember <strong>2011</strong>. Jedoch<br />
werden kurzfristige Anmeldungen gerne noch entgegen<br />
genommen, soweit diese nun schnellstmöglich erfolgen!