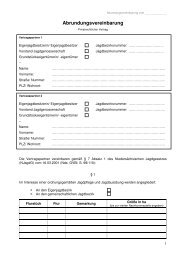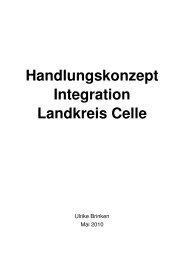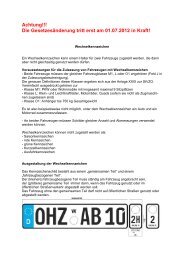Entwicklung des Naturschutzgroßprojekts - Landkreis Celle
Entwicklung des Naturschutzgroßprojekts - Landkreis Celle
Entwicklung des Naturschutzgroßprojekts - Landkreis Celle
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die <strong>Entwicklung</strong> <strong>des</strong> Natursch utzgroßprojekts<br />
,, Mei ßendorfer Teiche/Ban netzer Moor"<br />
(<strong>Landkreis</strong> <strong>Celle</strong>, Niedersachsen) seit 1979<br />
The deuelopment of tbe 'Mei/Sendorfer Teicbe/Bannetzer Moor'<br />
large-scale conselaation project in tbe district of <strong>Celle</strong> (Lower Saxony) since 1979<br />
1 Einleitung<br />
Das Förderprogramm <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>ministeriums<br />
für Umwelt, Nafurschutz und<br />
Reaktorsicherheit zur Errichtung und Sicherung<br />
schutzwürdiger Teile von Natur<br />
und Landschaft mit gesamtstaatlich<br />
repräsentativer Bedeutung besteht seit<br />
1979 (Scnrnrosn 2002). Das Naturschutzgroßprojekt,,Meißendorfer<br />
Teiche / Bannetzer<br />
Moor" war unter den ersten, die<br />
gefördert wurden. Träger ist der <strong>Landkreis</strong><br />
<strong>Celle</strong>. Der Förderzeitraum dauerte<br />
von t979 bis1983 und umfasste ein Volumen<br />
von 2155 Mio. DM. Es erfolgte<br />
dann 1984 die rechtsgültige Festsetzung<br />
als Naturschutzgebiet mit einer Gesamtfläche<br />
von ca. 900 ha. Zwar ist diese erste<br />
Phase längst abgeschlossery dennoch<br />
wurden und werden noch immer Aufkäufe<br />
in zum Teilbedeutendem Maße getätigt,<br />
um durch Grunderwerb die Möglichkeit<br />
zu erlangery recht viele Ziele <strong>des</strong><br />
Naturschutzes zu realisieren.<br />
Schon zu Beginn war klar, dass die<br />
Teiche als alte Kulturlandschaft nicht<br />
sich selbst überlassen werden können<br />
(Mnr.tNnrruc 1982) und ein Prozessschutz<br />
sehr schnell zum Verschwinden<br />
dieser Kulturlandschaft führen würde.<br />
Naturgemäß erfordern der Erhalt und<br />
die Bewirtschaftung der ehemaligen<br />
Fischteiche in einer Größenordnung von<br />
400 ha mit ca. 60 Teichen die meistenAnstrengungen.<br />
Aber auch in der Meißeniederung<br />
und im Bereich <strong>des</strong> Bannetzer<br />
Moors konnten viele Maßnahmen durchgeführt<br />
und abgeschlossen werden. An<br />
dieser Stelle soll der Versuch untemommen<br />
werdery die Auswirkungen dieser<br />
Maßnahmen auf die Gebietsentwicklung<br />
sowie auf Flora und Fauna über einen<br />
längeren Zeitraum an ausgewählten Beispielen<br />
darzustellen.<br />
2 Gebietsbeschreibung<br />
Die Lage und Bedeutung der Meißendorfer<br />
Teiche, dem wichtigsten Teichgebiet<br />
Niedersachsens, hat MnrrrNrxrNc 1982<br />
Hans-Joachim Clausnitze6 Eckehard Bühring, Hannes Langbehn,<br />
Michael Ortmann. Gerhard Rufert & Andreas Thiess<br />
beschrieben. Das NSG umfasst drei Landschaftsteile:<br />
L. Teiche,2. Moorflächen <strong>des</strong><br />
Bannetzer Moors sowie 3. Flachmoore<br />
und Bruchwälder in der Meißeniederung.<br />
Die Teiche wurden von Ernst von<br />
Schrader 1892 begründet, der die damals<br />
größte Karpfenzucht Nordwestdeutschlands<br />
anlegte (vgl. Abb. 1, untery und<br />
Abb.2, S. 250). In der Meißeniederung<br />
herrschen nährstoffreichere Niedermoore<br />
und Erlenbrüche mit ihren anthropogen<br />
bedingten Ersatzgesellschaften vor.<br />
Beim Bannetzer Moor handelt es sich um<br />
ein entwässertes Hochmoo(, das neben<br />
Grünland ausgedehnte Gagelflächen und<br />
Moorbirkenwälder aufweist.<br />
Die gesamte Fläche <strong>des</strong> NSG unterlag<br />
früher einer mehr oder weniger intensiven<br />
Nutzung. Inzwischen wird der überwiegende<br />
Teil der Fischteiche nicht mehr<br />
nutzungsorientiert bewirtschaftet, aus<br />
den Moorflächen und der Meißeniede-<br />
rung hat sich die Landwirtschaft zum<br />
Teil zurückgezogen.<br />
3 Zielsetzung<br />
Schutzziel ist weiterhin die Erhaltung,<br />
Pflege und <strong>Entwicklung</strong> der Lebensgemeinschaften<br />
von Pflanzen und Tieren<br />
der Teiche und Fließgewässeq, <strong>des</strong> Hochmoors<br />
und der Wälder dieser Landschaft.<br />
Vor allem soll dabei die Erhaltung<br />
und <strong>Entwicklung</strong> der charakteristischery<br />
insbesondere der gefährdeten Tier- und<br />
Pfl anzenarten berücksichtigt werden.<br />
4 Gebietsentwicklung<br />
4.1 Grunderwerb<br />
Viele Ziele ließen sich nur dadurch realisierery<br />
dass der <strong>Landkreis</strong> Eigenhimer<br />
Abb. 1: Die Meißendorter Teichlandschaft (Fotos 1-3: E. Bühring)<br />
Fig. 1: The Meissendoi pond landscape<br />
Xaur uro rar{BcH rr - 79. Jahrgang (2004) - Heft 6 249
der entsprechenden Flächen wurde, daher<br />
spielte deren Erwerb eine zentrale<br />
Rolle. Neben dem Flächenaufkauf innerhalb<br />
<strong>des</strong> <strong>Naturschutzgroßprojekts</strong> erfolgte<br />
bereits zu Beginn, u. a. für Tauschzwecke,<br />
auch ein Erwerb von Flächen<br />
außerhalb <strong>des</strong> Projektgebiets. Insgesamt<br />
wurden bislang ca. 6 Mio. € für den Aufkauf<br />
von über 700 ha Flächen innerhalb<br />
und außerhalb <strong>des</strong> Projektgebiets investiert.<br />
Dies geschah mit Hilfe <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Niedersachsen und <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>. Diese<br />
Flächen dienen einmal der Arrondierung<br />
öffentlichen Eigentums im Teichgebiet<br />
und im Bannetzer Moor, aber auch der<br />
Vergrößerung durch die Einbeziehung<br />
der Meißeniederung mit dem Thörener<br />
Bruch. Dieser Flächenerwerb wird noch<br />
weiterverfolgt.<br />
4.2 Maßnahmen im Teichgebiet<br />
o Ständige Wasserhaltung und schwacher<br />
Fischbesatz zur Förderung von<br />
Verlandungsvegetation, Lutchen und<br />
Libellen: Diese Teiche werden alle<br />
10-15 ]ahre einmal abgefischt, damit<br />
die Mönche auf ihre Haltbarkeit überprüft<br />
werden können.<br />
o Dreiiähriger Abfischrhythmus und<br />
hoher Fischbesatz: Die Teiche dienen<br />
besonders Fisch fressenden Vögeln<br />
und dem Fischotter als Nahrungshabitat.<br />
o Produktion von Fischen mit jährlichem<br />
Abfischrhythmus: Hier erfolgt<br />
nur ein Besatz mit Laichfischen zur<br />
Erzeugung von möglichst viel Fischbrut.<br />
. Kurzfristiges Ablassen im Herbst:<br />
Dadurch werden die Teiche fischarm<br />
250<br />
TeichelBanneher Moor"<br />
Die Bewirtschaftung der gekauften sowie<br />
der angepachteten Teichflächen wird Abb.2: Blick in dle Südost-Ecke der Teichgruppe mit angrenzenden Landwirt-<br />
sehr extensiv und ausschließlich naturschafts-<br />
und Forstflächen<br />
schutzorientiert von zwei Arbeitskräften Fig.2: View of the south-eastern corner of the pond group, with adjoining agricultural and<br />
betrieben. Mit einem Minimalaufwand<br />
an Personal und Maschinen soll der ur-<br />
silvicultural areas<br />
sprüngliche Zustand <strong>des</strong> Teichgebiets<br />
erhalten bzw. im Sinne einer noch größe- gehalten - zur Förderung von Lur<strong>des</strong> Schlamms mehrere Monate trocken<br />
ren Artenvielfalt weiterentwickelt werchen und Libellen.<br />
liegen. Damit durchziehende Limikolen<br />
den. Für diese Maßnahmen sowie Per- o Bei Tiockenheit nur begrenzter Was- auf zum Teil trocken gefallenen Teichsonalkosten<br />
stehen ca. 85000 € jährlich serzufluss: Diese Teiche liegen im böden nach Nahrung suchen können,<br />
zur Verfügung.<br />
Randbereich, sind teilweise total mit werden einige Teiche bereits im Spät-<br />
Einen Arbeitsschwerpunkt bildet der Röhricht oder Erlenaufwuchs zugesommer abgelassen.<br />
Erhalt <strong>des</strong> ca.25 km langen Dammsyswachsen und können im Spätsommer<br />
tems. Um die Länge der pflegeintensiven<br />
Teichdämme zu reduzieren, wurden kleinere<br />
Teiche zusammengelegt. Zusätzlich<br />
mussten nicht mehr sichere Dämme er-<br />
trockenfallen. Sie erhalten nur im<br />
Frtihiahr und Frühsommer Wasser<br />
(vgl. Abb. 3).<br />
4.3 Maßnahmen<br />
im Bannetzer Moor und<br />
in der Meißeniederung<br />
neuert werden. Neben der regelmäßigen Die im Herbst zum Abfischen abgelasse- Angrenzend an das Teichgebiet wurde<br />
Kontrolle der Dämme und der sofortigen nen Teiche bleiben zur Mineralisierung der <strong>Landkreis</strong> <strong>Celle</strong> Eigentrimer von<br />
Behebung auftretender Schäden wird in<br />
den Wintermonaten - zur Verbesserung<br />
der Dammsicherheit - der Baum- und<br />
Strauchbestand weitgehend entfernt.<br />
Die Teiche unterliegen fünf verschiedenen<br />
Bewirtschaftu ngsweisen:<br />
&s<br />
-.4<br />
ip-<br />
Abb.3:<br />
Fig.3:<br />
Weitgehend verlandeter Teich<br />
Largely silted-up pond<br />
Xan r uxD rar{Dscr{aFr - 79. Jahrgang (2004) - Hefi 6
91 ha Crünland in der Meißeniederung<br />
und im Bannetzer Moor. Dieses Grünland<br />
wird extensiv mit dem Ziel <strong>des</strong><br />
Nährstoffentzugs bewirtschaftet. Entlang<br />
der größeren Fließgewässer - wie<br />
etwa Meiße, Flöte und Bruchgraben -<br />
bleiben bis zu 10 m breite Brachestreifen<br />
erhalten.<br />
Auf den vom <strong>Landkreis</strong> erworbenen<br />
Moorflächen entfernte man standortfremde<br />
Fichtenaufforstungen und staute<br />
Binnengräben an, was sich als kleinräumig<br />
effektiv erwies. Da die Hauptentwässerungsgräben<br />
wegen der Besitzverhältnisse<br />
noch nicht verschlossen<br />
werden konnten, gelang eine großflächige<br />
Wiedervernässung <strong>des</strong> Moors<br />
nicht.<br />
Im Norden <strong>des</strong> Teichgebiets verläuft<br />
die begradigte, eingetiefte und aufgestaute<br />
Meiße. Sie wurde 1998 in einem<br />
ersten Abschnitt renaturiert, indem der<br />
Bach ein neues, sich eigendynamisch<br />
entwickeln<strong>des</strong> Längs- und Querprofil<br />
erhielt. Dieser 900 m langeAbschnitt soll,<br />
je nach Flächenverfügbarkeit, in den<br />
nächsten Jahren verlängert werden.<br />
Tendenzen bei<br />
Pflanzen und Tieren<br />
5.1 Flora<br />
Im NSG wurden insgesamt 535 Pflanzenarten<br />
registriert, darunter 30 Arten der<br />
Roten Liste Deutschlands (Tab. 1). Im<br />
entwässerten Bannetzer Moor mit verschiedenen<br />
Degenerationsstadien (Pfeifengras-<br />
und Moorhei<strong>des</strong>tadien sowie<br />
sekundären Birken-Moorwäldern) sind<br />
noch typische und gefährdete Moorarten<br />
vorhanden, jedoch, mit Ausnahme <strong>des</strong><br />
Gagelstrauchs, alle nur noch sehr selten.<br />
Diese Relikt-Vorkommen der ehemaligen<br />
Moorvegetation wachsen am Rand<br />
von Gräben und Torfstichen, besonders<br />
wenn die Wasserverhältnisse durch Anstau<br />
verbessert wurden. Ihre Bestände<br />
blieben auf niedrigem Niveau erhalten.<br />
Kennzeichnend für das Bannetzer Moor<br />
sind ausgedehnte Gagelbestände.<br />
Der große Teichkomplex mit seinen<br />
mesotrophen und eutrophen Gewässern,<br />
den verschiedenen Verlandungsbereichen,<br />
zeitweilig trockenfallenden<br />
Teichböden, den Gräben und umgebenden<br />
Feuchtwäldern besitzt eine vielfältige<br />
Flora mit zahlreichen gefährdeten<br />
Arten. Da die Teiche nicht alle gleichmäßig<br />
bewirtschaftet werden, können<br />
sich neben der typischen Teichvegetation<br />
auch Verlandungsstadien bis zur<br />
Flachmoorbildung relativ ungestört entwickeln.<br />
Die gefährdeten Pflanzen dieser<br />
Biotope zeigen seit der Unterschutzstellung<br />
zum großen Teil eine positive<br />
Tendenz.<br />
5.2 Fauna<br />
5,2.1 Vögel<br />
N atu rsch utzg roßprojekt,,M ei ßendorter Teiche I Ban neker Moar"<br />
Die Erfassung <strong>des</strong> Vogelbestands geschah<br />
fast ausschließlich durch ehrenamtliche<br />
Vogelkundler. So sammelten<br />
Mitglieder der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft<br />
Südheide (OAGS) seit<br />
ca. 1950 Daten und publizierten sie (Ganva1977;<br />
Ganvn & FlaoE 1983; NrrnuHn<br />
1970; Tonrurn 2001). Diese detaillierten<br />
Bestandsaufnahmen bildeten eine wichtige<br />
Grundlage für die Unterschutzstellung<br />
<strong>des</strong> Gebiets. Yor 7970 sind 9 Vogelarten<br />
ausgestorben: Dies sind mit Kornund<br />
Wiesenweihe, Sumpfohreule, Birkhuhn<br />
und Bruchwasserläufer einerseits<br />
Vogelarten, die im Zuge der Kultivierung<br />
<strong>des</strong> Bannetzer Moores ihre Lebensgrundlage<br />
verloren, andererseits mit Fluss- und<br />
Trauerseeschwalbe, Zwergdommel und<br />
Schwarzhalstaucher Arten, die in den<br />
ehemals natürlichen Aller-Auen reichlich<br />
vorkamen und auch das Meißendorfer<br />
Teicheebiet besiedelten.<br />
Tabelle 1:<br />
Table: 1:<br />
Um die <strong>Entwicklung</strong> der Vogelwelt im<br />
NSG besser einschätzen zu können, werden<br />
Bestandserhebungen von 1,976 herangezogen<br />
(Aucsr 1978), also vor Beginn<br />
<strong>des</strong> <strong>Naturschutzgroßprojekts</strong>.<br />
Tab.2, S.252, zeigt die Bestandsentwicklung<br />
einiger Vögel, die im NSG oder<br />
randlich außerhalb brüten und es als<br />
Hauptnahrungsgebiet nutzen. Der Vergleich<br />
zwischen 1999 12000 und 2003<br />
verdeutlicht, dass sich innerhalb von<br />
2-3 Jahren Schwankungen ergeben, die<br />
mit Biotopveränderungen, aber auch mit<br />
überregionalen <strong>Entwicklung</strong>en zu tun<br />
haben können, wie beipielsweise beim<br />
Rohrschwirl.<br />
Die bun<strong>des</strong>weit vom Aussterben<br />
bedrohte Rohrdommel gilt als Leitart<br />
der Meißendorfer Teiche. Ausgedehnte,<br />
strukturreiche Schilfzonen sowie ein hinreichen<strong>des</strong><br />
Angebot kleiner bis mittelgroßer<br />
Fische bilden die Existenzgrundlage<br />
dieses Reihervogels. Die Zahl der<br />
rufenden Männchen liegt über viele Jahre<br />
konstant bei drei bis fünf. Erhaltung<br />
und Förderung der Schilfbestände bilden<br />
wichtige Maßnahmen, von denen auch<br />
Gefährdete Pflanzen im Naturschutzgebiet<br />
Häufigkeit + selten; ++ mäBig häufig; ++_+ häufig<br />
Tendenz: + Bestandszunahme; . Keine Anderung; - Rückgang<br />
Endangered plants in the conservation area<br />
Occurrence: + rare; ++ fairly frequent; +++ frequent<br />
Trend: + numbers rising; = no change; - decline<br />
Wissenschattlicher Name Deutscher Name RLD Häufigkeit Tendenz<br />
Andromeda polifolia Rosmarinheide +<br />
Calla palustis Sumpf-Schlangenwurz e +<br />
Carex lasiocarpa Faden-Segge 3 + +<br />
Carex vulpina Fuchs-Segge e +<br />
Cicuta virosa Wasserschierlrng 3 +<br />
Drosera intermedia Mittlerer Sonnentau e +<br />
Drosera rotundifolia Rundblättrioer Sonnentau J +<br />
Dryopteis cristata Kammfarn<br />
Elatine hydropiper Wasserofeffer-Tännel 3 +<br />
Elatine triandra Dreimänniger Tännel +++<br />
Eleocharis acicularis Nadel-Sumpfbinse +++<br />
Gentiana Dneumonanthe Lungenenzian 3 +<br />
H v d ro c h ar i s m o rsu s - ranae Froschbiss 3 +++ +<br />
Leersia oryzoi<strong>des</strong> Wilder Reis ++<br />
Luronium natans Schwimmen<strong>des</strong> Froschkraut +<br />
Lycopodiella inundata Moorbärlapp +<br />
Lysi m ac h i a t hy rsif I o ra Strauß-Gilbweiderich 3 +<br />
Myrica gale Gagelstrauch +++<br />
Nafthecium ossifragum Beinbrech J<br />
Osmunda regalis Königsfarn a<br />
Pilularia globulifera Pillenfarn 3 +<br />
Potamog eto n o btu s if ol i u s Stumpf blättriges Laichkraut a<br />
Potamogeton polygon ifol i u s Knöterich-Laichkraut +<br />
Rhynchospora alba Weißes Schnabelried 3 +<br />
Sparganium natans Zwerg-lgelkolben 2<br />
Stratiotes a/ol<strong>des</strong> Krebsschere 3 i+<br />
Thelypteris palustris Sumpf-Lappenfarn +<br />
Uticularia australis Verkannter Wasserschlauch 2 ++<br />
Utricularia minor Kleiner Wasserschlauch 2 +++ +<br />
Vaccinium oxycoccus Moosbeere J +<br />
x^Arur uxD lar{Ds€lraFr - 79. Jahrgang (2004) - Heft 6 251
NaturschutzgroßprojeK,,Meißendorter Teichel Bannetzer Moor"<br />
verschiedene Enten- und Rallenarten<br />
orofitieren.<br />
Dagegen ist der drastische Rückgang<br />
der Rohrsänger Besorgnis erregend. Auch<br />
wenn bei Drossel- und Schilfrohrsänqer<br />
sowie Rohrschwirl wohl überregionale Be-<br />
standstrends ausschlaggebend sind, können<br />
als Rückgangsursache überalterte<br />
Schilfbestände, abnehmende Halmgrößen<br />
und -stärken nicht ausgeschlossen werden<br />
(Scurunrrnrcw 1999). Auffällig ist, dass<br />
mit Zunahme der Crauganspopulation<br />
das Schilf von den Rändern her immer<br />
stärker abgeweidet wird. Dadurch fehlen<br />
die lichten Übergangszonen zwischen<br />
Mischbeständen aus Altschill Neuschilf<br />
und Freiwasserflächen. Versuche, durch<br />
unterschiedliche Stauhöhen die Strukturvielfalt<br />
der Verlandunsszonen zu erhöhen,<br />
reichten nicht aus. Sicherlich würde<br />
ein parzellenweises Mähen oder Abbrennen<br />
zu dichter Schilfbestände erheblich<br />
zur Wüchsigkeit der Schilfhalme und zur<br />
Auflockerung der Schilfdickichte beitragen<br />
(ScururrpREcHr 1999). Die Umsetzuns<br />
scheiterte bisher aber an Kosten für<br />
den hohen Arbeitsaufwand bzw. an feuerschutzrechtlichen<br />
Bedenken.<br />
Seit 1997 brütet ein Seeadlerpaar in unmittelbarer<br />
Nähe <strong>des</strong> NSC, das die Teiche<br />
als Hauptnahr-ungsrevier nutzt. Eine<br />
Gruppe engagierter Adlerschützer überwacht<br />
das großräumig gesperrte Horstgebiet<br />
inZusammenarbeit mit der Kommandantur<br />
<strong>des</strong> Truppenübungsplatzes und<br />
dem Bun<strong>des</strong>forstamt Siebensteinhäuser.<br />
Die Realisation von Wiedervernässungen<br />
kürzlich erworbener aufgelassener<br />
Teiche hat sich besonders positiv auf die<br />
Bestände der Rallen ausgewirkt. Auch<br />
der Kranich, für den die dichten Schilfgürtel<br />
nicht den typischen Bruthabitat<br />
bilden. Drofitierte von diesen Maßnahmen<br />
- er hat sich erfolgreich im NSG<br />
etabliert. In den letzten Jahren entwickelte<br />
sich das Gebiet vor der eigentlichen<br />
Kranichzugzeit im Herbst zu einem Sammel-<br />
und Ruheplatz der regionalen Kranichpopulation.<br />
Durch kontrollierte Absenkung<br />
<strong>des</strong> Wasserstands einiger größerer<br />
Teiche im Oktober/November finden<br />
die Kraniche sichere Ruheplätze.<br />
Nach Abholzung von Fichtenforsten<br />
und durch Anstau von Binnengräben im<br />
Bannetzer Moor sind wieder größere<br />
Freiflächen mit Cagel und Pfeiiengras<br />
bestanden, die von Neuntöter, Braunund<br />
Schwarzkehlchen in erfreulicher<br />
Dichte besiedelt werden. Die fehlende<br />
Moorregeneration verhindert allerdings<br />
die Wiederansiedlung typischer Tierarten<br />
der Moore (2. B. Birkhuhn).<br />
Im Meißetal hat als Folge einer extensiven<br />
Grünlandnutzung der Wachtelkönig<br />
mit min<strong>des</strong>tens fünf rufenden Männchen<br />
2002 einen Höchstbestand erre:icht. Der<br />
einst im Bannetzer Moor häufige Kiebitz<br />
scheitert mit Bmtversuchen auf Grünland<br />
252<br />
Tabelle 2: Bestandsänderungen ausgewählter Brutvögel im NSG<br />
Bzf Brutzeitfeststellung; sM singen<strong>des</strong> Männchen<br />
Tendenz: + Bestandszunahme; - keine Anderung; - Rückgang<br />
1 Innerhalb als auch randlich außerhalb <strong>des</strong> NSG<br />
2 Randlich außerhalb <strong>des</strong> NSG<br />
Table: 2: Development of selected species of breeding birds from 1975 to 2003<br />
Bzf breeding species,' sM singing males<br />
Trend: + numbers rising; = no change; - decline<br />
1 within and on the outer fringe of the conservation area<br />
2 on the outer frinoe of the conservation area<br />
Vogelarl RLD 19ir511976 um1990 1999/2{p0 2008 Tendenz<br />
Zwergtaucher<br />
Rothalstaucher<br />
20<br />
0<br />
20<br />
'I<br />
7 -10<br />
,]<br />
10-12<br />
l Bzt<br />
Rohrdommel 3-4 3-4 3-4 3<br />
Schwazstorch2 3 1<br />
'I<br />
1<br />
Schnatterente 1 4-6 18 20<br />
Knäkente 2 o 8 +<br />
Krickente ca. 5 6-8 6-8<br />
Löffelente 5 4-5 A<br />
Schellente 0 3 4-6 3-4<br />
Flohrweihe o 10 7 7<br />
Baumfalker 3 2-3 2-3 2-3 2<br />
Seeadler2 J 0 0 +<br />
Wasserralle 22 38 40 +<br />
Tüpfelsumpfhuhn 1 Bzt 1 Bzt 1Bn<br />
Kleines Sumpfhuhn 0 0 1 Bzt +<br />
Wachtelkönig 2 1 -2 Bzt 1 Bzt 3-4 BzI 3-4 Bzl +<br />
Kranich 0 2 +<br />
Kiebitz > 10 5-6 J-q J-4<br />
Bekassine > 10 3-4 5-6<br />
Großer Brachvogel 2 1 1 1 0<br />
Braunkehlchen 3 < 10 24 24 24 +<br />
Schwarzkehlchen
Tabelle 3: Reptilien und Lurche im NSG<br />
Tendenz: + Bestandszunahme; = Keine Anderung;<br />
- Rückgang; ? Keine Zuordnung möglich<br />
Table: 3: Reptiles and amphibians in the conservation area<br />
Trend: + numbers rising; = no change;<br />
- decline; ? unceftain<br />
Wissenschaft licher Name Deutscher Name RLD Tendenz<br />
Reptili6n<br />
Vipera berus Kreuzotter 2<br />
Coronella austriaca Schlingnatter ?<br />
Natrix natrix Ringelnattef 3<br />
Lacerta vivipara Waldeidechse<br />
Anguis fragilis Blindschleiche<br />
Emys orbiculars Sumpfschildkröte ?<br />
Lurch6<br />
Rana arvalis Moorfrosch 2 +<br />
Rana temporaria Grasfrosch +<br />
Bana kl. esculenta Wasserfrosch<br />
Bufo bufo<br />
Pelobates fuscus<br />
Erdkröte<br />
Knoblauchkröte 2 ')<br />
Triturus cristatus Kammmolch +<br />
Triturus vulgaris Teichmolch<br />
Tabelle 4: Fische im NSG<br />
F Fließgewässer; T Teiche; G Gräben<br />
Table: 4: Fishes in the conservation area<br />
F watercourses; T ponds; G dltches<br />
Wiss€nschaftlicher Name Deutscher Name RLD Biotop<br />
Lampetra planeri Bachneunauge 2 F<br />
Anguilla anguilla Aal F,G,T<br />
Salmo trutta fario Bachforelle 3 F<br />
Oncorhynchus mykiss Regenbogenforelle F,T<br />
Esox lucius Hecht 3 F,T<br />
Rutilus rutilus Rotauge T<br />
Leucaspius delineatus Moderlieschen 3 T,G<br />
Leuclscus dus Aland, Nerfling T<br />
Scard i n i u s ervth roDhthal m us Rotfeder T<br />
Abramis bjoernkna Güster T<br />
Abramis brama Brachsen T<br />
Gobio gobio Gründling<br />
nnca tinca Schleie T<br />
Carass,us carasslus Karausche<br />
Carassius gibelio Giebel T,G<br />
Cyprinus carpio Karpfen T<br />
Rhodeus sericeus Bitterling 2 T<br />
Barbatula bafuatula Bachschmerle 3 F<br />
Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 2 T,G<br />
lctalurus nebulosus Zwergwels F,T<br />
Lota lota Quappe 2 F<br />
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling F,G,T<br />
Pungitius pungitius Zwergstichling<br />
Perca fluviatilis Barsch F,T<br />
Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch T<br />
Sander lucioperca Zander T<br />
Die Ringelnattern zeigen eine positive<br />
Bestandsentwicklung, was für die anderen<br />
beiden Schlangenarten nicht zutrifft.<br />
Im Vergleich zur Kartierung von Fnooa<br />
(1984) ist es bei der Kreuzotter offenbar<br />
zu einer Bestandsreduktion gekommen.<br />
XauR uxD raxDscr{aEr - 79. Jahrgang (2004) - Heft 6<br />
Natursch utzg roßprojekt,,Meißendorter TeichelBannetzer Msqr"<br />
Biotopveränderungen scheiden als Ursache<br />
für diese negative <strong>Entwicklung</strong> aus,<br />
ein Grund könnte in der sehr starken<br />
Zunahme der Wildschweine seit 1984<br />
liegen, die auch in anderen Gebieten<br />
Schlangenbestände negativ beeinflusst<br />
haben (Fnrrpr et al. 2002, Völxr et al.<br />
2002).<br />
Für Kreuzotter und Schlingnatter haben<br />
sich alte Wiesenbrachen als günstig<br />
erwiesen. Ihre Attraktivität für Schlangen<br />
ist nach Beendigung einer auch nur<br />
extensiven Bewirtschaftung deutlich gesrlegen.<br />
Im Teichgebiet vermehren sich derzeit<br />
7 Lurcharten. Das sind zwei weniger<br />
als von Aucsr 1978 aufgefnhrt. Der<br />
damal s angegebene Fadenmolch konnte<br />
nicht nachgewiesen werden, allerdings<br />
entsprechen weder die großen Teiche<br />
noch die entwässerten Moorflächen<br />
den Habitatansprüchen dieser Art. Auch<br />
vom Seefrosch gelangen keine Nachweise<br />
mehr. Dafür kommt der Kammmolch<br />
im Teichgebiet vor, der 1978 nicht<br />
erwähnt wurde. Die noch 1984 nach<br />
Gewitterregen auf überschwemmten<br />
Ackerflächen rufende Kreuzkröte fehlt<br />
mangels geeigneter Habitate inzwischen<br />
im NSG.<br />
Während Erdkröte und Wasserfrosch<br />
im gesamten Teichgebiet laichery konzentrieren<br />
sich die Laichgebiete von<br />
Moor- und Grasfrosch auf die peripheren<br />
und stärker verlandeten Teiche. Gerade<br />
s:ie besitzen eine große Bedeutung für die<br />
Braunfrösche, deren Sommerlebensräume<br />
im Bannetzer Moor und in der<br />
Meißeniederung liegen.<br />
Von den drei Froscharten und der Erdkröte<br />
existieren zum Teil sehr große<br />
Laichkolonien. Der Reproduktionserfol g<br />
in den stark verlandeten Teichen ist trotz<br />
eines vorhandenen Fischbesatzes gut.<br />
Fazit: Die <strong>Entwicklung</strong> vieler im<br />
Teichgebiet lebender Lurche und Reptilien<br />
ist positiv dies trifft besonders für<br />
Moorfroich und Ringelnatter zu.<br />
5.2.3 Fische<br />
Der Fischbesatz besteht hauptsächlich<br />
aus verschiedenen Weißfischen, Karpfen<br />
und Schleien. Unerwünscht, aber immer<br />
wieder einwandernd, vermehrt sich der<br />
Zwergwels in den Teichen. Die Fische<br />
werden weder durch Düngung noch<br />
durch Fütterung gefördert.<br />
Der Fischbestand innerhalb <strong>des</strong> Naturschutzgebiets<br />
(Tab.4) ist recht artenreich,<br />
allerdings ist dabei zu berücksichtigen,<br />
dass er in ehemaligen Fischteichen<br />
auch auf vielen Besatzmaßnahmen beruht.<br />
Von daher sind vergleichende Betrachtungen<br />
über die <strong>Entwicklung</strong> in den<br />
letzten jahren wenig sinnvoll. Da sich<br />
unmittelbar am Rand <strong>des</strong> NSG künstlich<br />
besetzte Angelteiche befinden, steigt die<br />
Artenzahl, weil immer wieder Fische aus<br />
den Angelteichen entweichen und dann<br />
über Zuflüsse in die NSG-Teiche gelangen.<br />
Auch von der Meiße, mii deren<br />
Wasser die Teiche bespannt werdery erreichen<br />
Fische das Gebiet.
Naturcchutzgroßprojekt,,Meißendorter Teichel Ban netzer Moor"<br />
5.2.4 Libellen<br />
Das Teichgebiet mit seinen unterschiedlichen<br />
Wasserflächen und Verlandungszonen<br />
bildet für Libellen einen idealen<br />
Lebensraum, hinzu kommen verschiedene<br />
Bäche und Gräben, in denen sich<br />
Fließwasserarten entwickeln.<br />
Im Untersuchungsgebiet gibt es 41 Libellenarten<br />
(Tab. 5), die bodenständig<br />
sind oder regelmäßig im Gebiet auftreten.<br />
Das sind 50 % <strong>des</strong> deutschen Artenbestands!<br />
Die Bodenständigkeit der<br />
Großlibellen konnte mit vier Ausnahmen<br />
durch Exuvienfunde, sonst durch Eiablage<br />
und Häufigkeit belegt werden.<br />
Im NSG vermehren sich eine vom<br />
Aussterben bedrohte sowie je neun stark<br />
gefährdete und gefährdete Libellenarten<br />
der Roten Liste Deutschland (Orr & Prrrn<br />
1998). Es handelt sich dabei hauptsächlich<br />
um Bewohner von Fließgewässern,<br />
Teichen und Flachmooren. Das Ergebnis<br />
verdeutlicht die große Bedeutung <strong>des</strong><br />
NSG für den Schutz der Libellen.<br />
Um die <strong>Entwicklung</strong> der Odonatenfauna<br />
bewerten zu können, soll auf die in<br />
den Teichen reproduzierenden Arten<br />
eingegangen werden. Als Grundlage<br />
dient ein Vergleich der Kartierung von<br />
1983 1L984 (Fnooe, 1984) mit dem aktuellen<br />
Artenspektrum (200212003). So kann<br />
die Effektivität der Naturschutzmaßnahmen<br />
für Libellen bilanziert werden.<br />
In genutzten Fischteichen herrschen<br />
für Libellen besondere Bedingungen<br />
(CreusNrrzEn 1974), hauptsächlich Binsenjungfern<br />
und Heidelibellen vermehren<br />
sich erfolgreich, wobei die Sumpfheidelibelle<br />
(Sympetrum depressiusculum) zu<br />
Teichen für die Aufzucht von Jungkarpfen<br />
eine hohe Affinität hat (Ewnns 1996).<br />
1984 hatte Filoda 34 Libellenarten im<br />
gesamten NSG gefunden, im Teichgebiet<br />
dominierten noch die Fischteicharten, so<br />
entwickelte sich S. depressiusculum zahlreich.<br />
Die wichtigsten Veränderungen<br />
bei den Libellen <strong>des</strong> Teichgebiets von<br />
1984 bis 2003 zeigtTab.6.<br />
Sechs Libellenarten sind im Teicheebiet<br />
neu aufgetaucht und reproduzieren<br />
hier, fünf davon stehen auf der Roten Liste.<br />
Bei der Großen Moosjungfer handelt<br />
es sich um eine FFH-Art nach Anhang 2.<br />
Die Aufgabe der traditionellen Teichwirtschaft<br />
bildet die Voraussetzung für<br />
diese Veränderung. Besonders in Teichen<br />
mit Verlandungsvegetation und Flachmoorbildung<br />
kam es zur Neuansiedlung<br />
gefährdeter Arten.<br />
Dieser Zunahme steht ein Verlust gegenüber:<br />
Die 1984 noch häufige Syntpetrum<br />
depressiusculum ist verschollen. Sie<br />
bevorzugt in Niedersachsen genutzte<br />
Fischteiche, so die Aschauteiche (Cr-.A,us-<br />
NrrzER 1974) und die Ahlhorner Teiche<br />
(Ewtns 1996). Da die Meißendorfer<br />
Teiche nicht mehr in der alten Form<br />
254<br />
Tabelle 5:<br />
Table:5:<br />
lm NSG nachgewiesene Libellen; ohne Gäste<br />
Status: B sicher bodenständig;<br />
? Status unklar, jedoch vermutlich bodenständig; V verschollen<br />
Dragonflies found in the conseNation area, without vagrants<br />
Status; B certainly autochthonous;<br />
? sfatus unclear, but presumably autochthonaus; V presumed extinct<br />
Wssenschaftlicher Nam€ Deutscher Name RLD Statug<br />
Calopteryx splendens Gebänderte Prachtlibelle B<br />
Calopteryx vhgo Blauflügel Prachtlibelle ö<br />
Sympecma fusca Gemeine Winterlibelle 3 B<br />
Lesfes dryas Glänzende Binsenjungfer e B<br />
Lestes sponsa Gemeine Binsenjungfer b<br />
Lestes vlrens Kleine Binseniungfer tJ<br />
Lestes viridls Große Binsenjungfer B<br />
Pyrrhosoma nymphula Gemeine Adonislibelle B<br />
lschnura elegans Gemeine Pechlibelle ö<br />
Enallagma cyathigerum Becher-Azurjungfer B<br />
Coenagrion hastulatum Speer-Azurjungfer 2<br />
Coenagrion puella Hufeisen-Azurjungfer B<br />
Coenagrion pulchellum Fledermaus-Azurjungfer 3 B<br />
Erythromma najas Großes Granatauge B<br />
Platycnemis pennipes Federlibelle 2<br />
C o rd u I egaster bo lto n i i Zweigestreift e Quelljungfer B<br />
Brachytron pratense Kleine Mosaikjungfer 3 B<br />
Aeshna cyanea Blaugrüne Mosaikjungfer ö<br />
Aeshna grandis Braune Mosaikjungfer B<br />
Aeshna isosce/es Keilflecklibelle ö<br />
Aeshna iuncea Torf-N4osaikjungfer 3 B<br />
Aeshna mixta Herbst-Mosaikjungfer B<br />
Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer 1 B<br />
Anax imperator Große Königslibelle tJ<br />
Gomphus vulgatissimus Gemeine Flussjungfer 2 B<br />
Ophiogomphus cecilia Grüne Flusslungfer 2 ö<br />
Cordulia aenea Gemeine Smaragdlibelle B<br />
Somatoc h I o ra f I av o m acu I ata Gef leckte Smaragdlibelle 2 B<br />
So m at o c h I o ra m etal I i ca Glänzende Smaragdlibelle B<br />
Libellula depressa Plattbauch B<br />
Libel I u la qu ad ri macu lata Vierfleck B<br />
Ofthetrum cancellatum Großer Blaupfeil<br />
Sympetrum danae Schwarze Heidelibelle B<br />
Sym pet ru m depressi u scu I u m Sumof-Heidelibelle 2<br />
Sympetrum flaveolum Gef leckte Heidelibelle 3 B<br />
Sympetrum sanguineum Blutrote Heidelibelle B<br />
Sympetrum striolatum Große Heidelibelle ?<br />
Sympetrum vulgatum Gemeine Heidelibelle B<br />
Leucorrhinia dubia Kleine Moosjungfer 2 B<br />
Leu co rrh i n i a pecto ral is Große Moosjungfer I B<br />
Leucorrhinia rubicunda Nordische [/4oosjungfer 2 B<br />
bewirtschaftet werden, ist die auf diese<br />
Bewirtschaftung angewiesene Libelle<br />
verschwunden.<br />
Von 1984 bis 2003 nahmen also stenöke<br />
und gefährdete Arten zu - eine aus<br />
odonatologischer Sicht erfreuliche <strong>Entwicklung</strong>.<br />
Neben den Fischteicharten<br />
dominieren nunmehr tvoische Weiherund<br />
Flachmoorarten.<br />
Die Fließgewässer im NSG enthalten<br />
den in norddeutschen Heidebächen typischen<br />
Artenset an Libellen in zum Teil<br />
sehr hohen Pooulationen.<br />
Ein Defizit ergibt sich lediglich bei den<br />
Arten oligotropher Moore wegen der<br />
fehlenden großfl ächigen Vernässung <strong>des</strong><br />
Bannetzer Moors.<br />
6 Einbindung der Öffentlichkeit<br />
Neben den Ansprüchen der Tiere und<br />
Pflanzen werden im NSG auch die Belange<br />
der Erholung suchenden Bevölkerung<br />
berücksichtigt. So befindet sich der<br />
Hüttensee im Besitz <strong>des</strong> LK <strong>Celle</strong>, er wurde<br />
nicht Bestandteil <strong>des</strong> NSG, sondern<br />
bewusst der Erholungsnutzung vorbehalten.<br />
Die Nutzungsintensität dort wird<br />
durch einen Vertrag so geregelt, dass sie<br />
naturverträqlich bleibt.<br />
In unmittelbarer Nähe <strong>des</strong> NSG befindet<br />
sich auch die NABU-Akademie Gut<br />
Sundeq, eine Bildungseinrichtung für<br />
Natur- und Umweltschutz mit einem<br />
vielfältigen Programm. Das NSG darf<br />
XArUt UxD lafiDscl{aFr - 79. Jahrgang (2004) - Heft 6
Tabelle 6: Veränderungen im Bestand ausgewählter Libellen<br />
Tendenz: + Bestandszunahme; = keine Anderung;<br />
- Rückgang; neu: Die Art fehlte 19&4<br />
Table: 6: Development of selected dragonflies 1984 to 2003<br />
Trend: + numbers rising; = no change;<br />
- decline; neu: species not present in 1984<br />
Art RL-D 1984 ans Tendenz<br />
Lestes dnlas J fehll 1 Teich + neu<br />
Lesfes virens 1 Teich 7 Teiche<br />
Coenagrion hastulatum 3 serlen setten<br />
Coenagrion pulchellum sehr häufig sehr häulig<br />
Brachytron. pratense 5 Teiche 24 Teiche +<br />
Aeshna lsosce/es fehlt 3 Teiche + neu<br />
Aeshna mixta häufig häufig<br />
Aeshna viridis 1 fehlt 1 Teich + neu<br />
Cordulia aenea 3 Teiche 24feiche<br />
So m at oc h I o ra f I av o m ac u I at a z fehlt 5 Teiche + neu<br />
Orthetrum cancellatum sehr häufig sehr häufig<br />
Sympetrum danae häufig mäßig häufig<br />
Sy m petru m d ep ressi u scu I u m häufig fehlt<br />
Sympetrum sanguineum sehr häufig sehr häufig<br />
Sympetrum striolatum fehlt 3 Teiche + neu<br />
Leu conh i n i a pectoral i s fehlt 3 Teiche + neu<br />
Leucorrhinia rubicunda selten serren<br />
auf öffentlichen und gekennzeichneten<br />
Wegen betreten werden. Als zusätzliches<br />
Angebot existieren drei Aussichtstürme<br />
und ein Beobachtungshügel, von denen<br />
sich beste Einsichtmöglichkeiten bieten,<br />
die Soerrbereiche sind dadurch in weiten<br />
Teilen einsehbar.<br />
Um der interessierten Öffentlichkeit<br />
einen Einblick in das eigentliche Teichgebiet<br />
zu ermöglichen, gab es 2000 einen<br />
Tag <strong>des</strong> offenen Naturschutzgebiets. Es<br />
wurden an zwei Terminen geführte Wanderungen<br />
durch den sonst gesperrten<br />
Bereich <strong>des</strong> NSG angebotery wo an bestimmten<br />
Stellen Fachleute weitere Erläuterungen<br />
gaben.<br />
7 Ausblick<br />
Für die weitere <strong>Entwicklung</strong> <strong>des</strong> Naturschutzgebiets<br />
werden folgende langfristige<br />
Ziele angestrebt:<br />
. Kontinuierliche extensive Teichwirtschaft<br />
unter Berücksichtigung der<br />
Ansprüche möglichst vieler Arten.<br />
o Fortführung der bereits begonnenen<br />
Renaturierung der Meiße und Vernässung<br />
der Meißeniederung durch Verschluss<br />
von Binnengräben.<br />
o Renaturierung <strong>des</strong> Bannetzer Moors<br />
und Thörener Bruchs.<br />
. Weiterer Flächenankauf, um diese<br />
Maßnahmen realisieren zu können.<br />
8 Zusammenfassung<br />
Die bisherige <strong>Entwicklung</strong> im Naturschutzgroßprojekt<br />
NSG Meißendorfer<br />
Teiche/Bannetzer Moor und die durchgeführten<br />
Maßnahmen werden darge-<br />
N atu rsch utzg roßprojekt,,M ei ße ndorfer Telchel Bannoäl€r Nooi'l<br />
stellt. Das Projekt wurde von 1979 bis<br />
1983 u. a. von der Bun<strong>des</strong>regierung gefördert,<br />
Flächen konnten gekauft werden,<br />
auch weiterhin erfolgt noch ein Flächenaufkauf.<br />
Das ca. 900 ha umfassende<br />
Schutzgebiet besteht aus den ungefähr<br />
400 ha großen Meißendorfer Teichen,<br />
dem Bannetzer Moor und der Meißeniederung.<br />
Die ehemaligen Fischteiche<br />
werden im Sinne <strong>des</strong> Naturschutzes extensiv<br />
bewirtschaftet. Am Beispiel der<br />
Pflanzen, Vögel, Reptilien, Lurihe und<br />
Libellen werden überwiegend positive<br />
Veränderungen seit der Unterschutzstellung<br />
1984 aufgezeigt. Besonders auffällig<br />
sind positive <strong>Entwicklung</strong>en im Cebiet<br />
der Meißendorfer Teiche. Eine Wiedervernässung<br />
<strong>des</strong> Bannetzer Moors gelang<br />
noch nicht im gewünschten Maße, wird<br />
aber weiterhin angestrebt. Ein erster Abschnitt<br />
der begradigten und vertieften<br />
erfolgreich renaturiert<br />
}];ij:".u.""te<br />
Summary<br />
The article <strong>des</strong>cribes develooments to<br />
date in the 'Meißendorfer Teiche/Bannetzer<br />
Moor' nature conservation project<br />
in Lower Saxony, Germany, and the results<br />
of measures implemented. The project<br />
was implemented from 1979 to 1983.<br />
Its aim was to conserve and develoo the<br />
fauna and flora of poncls, rivers and a<br />
bog area. Many fishponds and fields<br />
were purchased. Fishponds cover about<br />
400 ha in the conservation area. These<br />
former fish farms are managed extensively<br />
in line with nature conservation<br />
principles. Taking the example of plants,<br />
birds, reptiles, amphibians and dragon-<br />
flies, the article presents the changes<br />
that have occurred since the project was<br />
launched in 1984. The positive developments<br />
since cessation of fish farming in<br />
the'Meißendorfer Teiche' fishoonds are<br />
particularly striking. In the bannetzer<br />
Moor bog the water level could not yet be<br />
raised to the level <strong>des</strong>irable. One section<br />
of the river Meiße was restored to a more<br />
natural state in 1998.<br />
9 Literatur<br />
Aucsr, H.-J. 0978): Die Bedeutung der<br />
Meißendorfer Fischteiche (Ldkrs. <strong>Celle</strong>)<br />
für den Tierartenschutz. fahrbuch Naturw.<br />
Verein Fürstentum Lüneburg (34):<br />
149 -782.<br />
Baunn, H.-C.; Brnrnoro, P.; Bovs, P.;<br />
KNIE4 W; SüonEcr, P. & Wrrl K. (2002):<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands.<br />
3., überarb. Fassung, 8. 5. 2002. Berichte<br />
Vogelschutz (39): I 3-60.<br />
Beurlrn, A.; CErcEn, A.; KonruacxEn,<br />
P. M.; KüHwEI, K.-D.; Laurrn, H.; Poo-<br />
LoucK, R.; BovE, P. & DrrrnrcH, E.<br />
(1998): Rote Liste der Kriechtiere (Repfilin)<br />
und Rote Liste der Lurche (Amphibia).<br />
-In: BtNol M.; Brrss, R.; Bovr,<br />
P.; CnurrxE, H. & PnErscHsn, P. (1998):<br />
Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands.<br />
Landwirtschaftsverlag. Münster:<br />
48-52.<br />
Brnss, R.; Lnnx, A. & Werrnsrnaal A.<br />
(1998): Rote Liste der in Binnengewässern<br />
lebenden Rundmäuler und Fische<br />
(Ctlclostomata & Pisces). -In: BrNol M.;<br />
Brrss, R.; BovE, P.; Gnurrrr, H. & PnnrscHER,<br />
P. (1998): Rote Liste gefährdeter<br />
Tiere Deutschlands. Landwirtschaf tsverlag.<br />
Münster: 53-59.<br />
Cr.q.usNrrznn, H.-1. (1974): Die ökologischen<br />
Bedingungen für Libellen (Odona-<br />
/n) an intensiv bewirtschafteten Fischteichen.<br />
Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens<br />
27 @\:78-90.<br />
Ewrns, M. (1996): Zum Vorkommen der<br />
Sumpf-Heidelibelle (Sy mp etr um depressiusculwn)<br />
und anderer Libellen an den<br />
Ahlhorner Teichen. Oldenburger Jahrbuch<br />
96: 297 -312.<br />
Fnrrlr, E. & Lursnnr, L. (2002): Negative<br />
effect of the wild boar (Sus scrofa) on<br />
the populations of snakes at a protected<br />
mountainous forest in central Italy. Ecologia<br />
mediterranea 28 (1): 93 - 98.<br />
Fnooe, H. (1984): Durchführung wissenschaftlicher<br />
Untersuchungen im geplanten<br />
NSG,,Meißendorfer Teiche/Bannetzer<br />
Moor" für folgende Tierarten: Lurche<br />
- Kriechtiere - Libellen. Unveröffentlichtes<br />
Gutachten im Auftrag der Bezirksregierung<br />
Lüneburg.53 S.<br />
X^fur Ur.D rar{|r5cl{atr - 79. Jahrgang (2004) - Heft 6 255
Ganvr, E. (1977): Die Vögel der Südheide<br />
und der Allerniederung. l.Tell: Non-Passeriformes.2.<br />
Aufl. <strong>Celle</strong>r Berichte zur Vogelkunde<br />
(3):1-336.<br />
Genw, E. & Fr.epr, M. (1983): Die Vögel<br />
der Südheide und der Allemiederung.<br />
2. TeI: Passuiformes, 37 ausgew:ihlte Arten.<br />
<strong>Celle</strong>r Berichte zur Vogelkunde (4):1,-174.<br />
MENNETTNc, H. (1982): Errichtung und<br />
Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur<br />
und Landschaft mit gesamtstaatlich<br />
repräsentativer Bedeutung. Beispiel:<br />
Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor.<br />
Natur und Landschaft 57 (11,):389-391,.<br />
Nrtnuun, O. (1970): Die Vögel der Südheide<br />
und der Allerniederung. 1. Teil:<br />
N on-P asserifurmes. <strong>Celle</strong>r Berichte zur Vogelkunde<br />
(1):l-94.<br />
Orr, J. & Prrrn, W. (1998): Rote Liste der<br />
Libellen (Odonata). -In: Brxor, M.; Br.rss,<br />
R.; Bovr, P.; GRUTTKE, H. & Pnrrscurn, P.<br />
(1998): Rote Liste gefährdeter Tiere<br />
Deutschlands. Landwirtschaftsverlag.<br />
Münster: 260 -263.<br />
ScHnnrosn, V. (2002): Naturschutzgroßprojekte<br />
und Gewässerrandstreifenprogramm<br />
<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>. -In: Korrloro, W.;<br />
Böcrrn, R. & HaurrcrE, U. (2002):<br />
Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege<br />
. 8. ErgLfg.ll I 02 1, -19 .<br />
Scnruupnrcur, H. (1999): Die Große<br />
Rohrdommel als Zielart. Naturschutz<br />
und Landschaftsplanung 31 (8):247 -252.<br />
Tonxr.rn, A. (2001): Die Vogelwelt der<br />
Meißendorfer Teiche. Avifaunistischer<br />
Sammelbericht 1999 I 2000. <strong>Celle</strong>r Berichte<br />
zur Vogelkunde (7):1,-74.<br />
Völru, W. & THrrslmrnn, B. (2002): Die<br />
Kreuzotter: ein Leben in festen Bahnen?<br />
Beiheft 5 der Zeitschrift für Feldherpetologie.<br />
Laurenti Verlag. Bielefeld. 160 S.<br />
Anschriften der Autoren:<br />
Eckehard Bühring<br />
Spörckenstraße 23D<br />
29221. <strong>Celle</strong><br />
Hans-Joachim Clausnitzer<br />
Eichenstraße 11<br />
29348 Eschede<br />
Dr. Hannes Langbehn<br />
Am Tiergarten 2b<br />
29221<strong>Celle</strong><br />
Michael Ortmann<br />
Gerhard Rufert<br />
Andreas Thiess<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Celle</strong><br />
Amt für Umwelt und ländlichen Raum<br />
Trifft26<br />
29221<strong>Celle</strong><br />
256<br />
nMeißendofier Teichel Ba n netzer Moor"<br />
Das praxisnahe<br />
Standardwerk<br />
Siefke/Voth/Spi n dter/Rackwitz<br />
Jagdrecht<br />
M ecklen bu rg-Vorpom mern<br />
Ertäuterte Textausgabe<br />
2., vollst. überarb. Auflage 2004<br />
XII,420 Seiten. Kart.<br />
€ 44,-<br />
ISBN 3-555-53040-2<br />
Kommunate Schriften für<br />
Mecktenburg-Vorpom mern<br />
Das Lan<strong>des</strong>jagdgesetz Mecktenburg-Vorpommern<br />
ist am 1. Aprit 2000 in Kraft<br />
getreten und hat das Lan<strong>des</strong>jagdgesetz von<br />
1992 abgetöst. Alte wesent[ichen Durchfüh<br />
run gsverordnun gen und Verwattungsvorschriften<br />
wurden daraufhin ebenfatls<br />
neu erlassen. Zwischenzeitliche linderungen<br />
im Bun<strong>des</strong>jagdgesetz sowie in vieten das<br />
Jagdrecht berührenden Gesetzen, Verordnungen<br />
und Verwattungsvorschriften haben<br />
Berücksichtigung gefunden. Atte, die sich<br />
in Mecklenburg-Vorpommern mit der Jagd<br />
befassen, finden in dieser Textausgabe ein<br />
in seiner Vol,l.ständigkeit und Anwenderfreundtichkeit<br />
einma[iqes Werk vor.<br />
Prof. Dr. Axe[ Siefke, ehem. Vizepräsident<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>jagdverban<strong>des</strong> Mecktenburg-<br />
Vorpommern,<br />
Dipt.-Forsting. Wolfgang Voth, Forstoberrat,<br />
Dipl.-Forsting. (FH) Ratf Spindler,<br />
Forstamtman n, Landwirtschaftsministerium<br />
Meckten burg-Vorpom m ern,<br />
Dip[.-Forsting. Martin Rackwitz,<br />
Forstdirektor, Landwi rtschaftsmi nisteri u m<br />
Mecktenburg-Vorpommern.<br />
www.kohlhammende<br />
Deutscher Gemeindeverlag GmbH . 70549 Stuttgart<br />
x^fur uxD raf{Gcr{arr - 79. Jahrgang (2004) - Heft 6