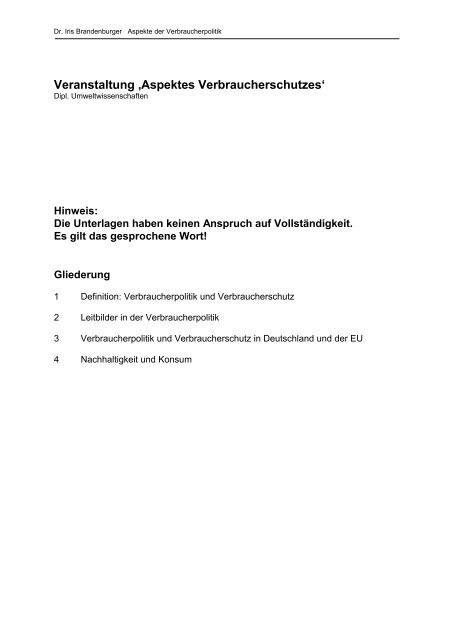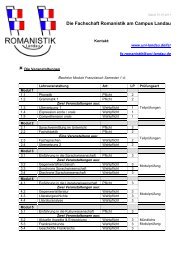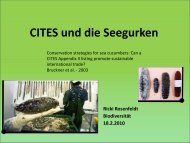Thema: Wissenschaftliche Ansätze zur ... - Campus Landau
Thema: Wissenschaftliche Ansätze zur ... - Campus Landau
Thema: Wissenschaftliche Ansätze zur ... - Campus Landau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Veranstaltung ‚Aspektes Verbraucherschutzes‘<br />
Dipl. Umweltwissenschaften<br />
Hinweis:<br />
Die Unterlagen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.<br />
Es gilt das gesprochene Wort!<br />
Gliederung<br />
1 Definition: Verbraucherpolitik und Verbraucherschutz<br />
2 Leitbilder in der Verbraucherpolitik<br />
3 Verbraucherpolitik und Verbraucherschutz in Deutschland und der EU<br />
4 Nachhaltigkeit und Konsum
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Literatur:<br />
Belz, F-M.; Karg. G.; Witt, D. (2007): Nachhaltiger Konsum und Verbraucherpolitik im 21. Jahrhundert.<br />
Marburg: Metropolis<br />
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Hg.) (2004): Verbraucherpolitische<br />
Bericht 2004 der Bundesregierung. Dokument 1010157 vom 29.11.2004<br />
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Hg.): (o.A.): Gesundheitlicher<br />
Verbraucherschutz. Wer macht was? Berlin<br />
Busse, T. (2006): Die Einkaufsrevolution. Konsumenten entdecken ihre Macht. München: Blessing<br />
Brunner, K-M.; Schönberger, G. (Hg.) (2005): Nachhaltigkeit und Ernährung. Produktion – Handel –<br />
Konsum. Frankfurt/Main: <strong>Campus</strong><br />
Erdmann, L. et al. (2003): Nachhaltigkeit und Ernährung. Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung,<br />
Werkstattbericht 57, Berlin<br />
Frede, W. (Hg.) (2010): Handbuch für Lebensmittelchemiker. Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetik,<br />
Futtermittel. 3. Aufl., Berlin: Springer<br />
Gabler-Wirtschaftslexikon (2010), Wiesbaden: Gabler<br />
Hansen, U. (2003): Verbraucherinformation durch Selbstverpflichtungserklärung der Wirtschaft. Berlin<br />
Kantelhardt, J.; Heißenhuber, A. (2005): Nachhaltigkeit und Landwirtschaft. In: Brunner, K-M.; Schönberger,<br />
G. (Hg.): Nachhaltigkeit und Ernährung. Produktion – Handel – Konsum.<br />
Frankfurt/Main: <strong>Campus</strong>, S. 25-48<br />
Kroeber-Riel, W. (2009): Konsumentenverhalten. 9. Aufl., München: Vahlen<br />
Kroeber-Riel, W.; Esch, F. (2010): Strategien und Technik der Werbung. 7. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer<br />
Kuhlmann, E. (1990): Verbraucherpolitik. München: Vahlen<br />
Linz, M., Scherhorn, G. et al. (2002): Von nichts zu viel. Suffizienz gehört <strong>zur</strong> Zukunftsfähigkeit. Wuppertal:<br />
Wuppertal Institut<br />
Neugebauer, B. (2004): Die Erfassung von Umweltbewußtsein und Umweltverhalten. ZUMA-Methodenbericht<br />
Nr. 2004/07, Mannheim<br />
Priddat, B. (Hg.) (2007): Neuroökonomie. Marburg: Metropolis<br />
Reisch, L. et al. (2003): Strategische Grundsätze und Leitbilder einer neuen Verbraucherpolitik. Diskussionspapier<br />
des <strong>Wissenschaftliche</strong>n Beirats für Verbraucher- und Ernährungspolitik beim<br />
BMVEL. 2. Überarbeitete Fassung, Stuttgart-Hohenheim<br />
Rogall, H. (2004): Ökonomie der Nachhaltigkeit. Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft. Wiesbaden:<br />
Verlag für Sozialwissenschaften<br />
Soloman, M.; Banossy, G.; Askegard, S. (2001): Konsumentenverhalten. Der europäische Markt.<br />
München: Pearson Studium<br />
Soloman, M.; Bamossy, G.; Askegaard, S.; Hogg, M. (2006): Consumer Behaviour. A European Perspective.<br />
3. Edition, Essex: Pearson<br />
Stern, N. (2006): Stern Review on the Economics of Climate Change. www.hmtreasury.gov.uk/6520.htm<br />
Verein Partnerschaft Dritte Welt Giessen, Weltladen-Dachverband, BUKO-Agrarkoordination (Hg.)<br />
(2000): Einkaufen verändert die Welt. Die Auswirkungen unserer Ernährung auf Umwelt und<br />
Entwicklung. Stuttgart: Schmetterling
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Verbraucherpolitik<br />
„Zur Verbraucherpolitik zählen alle Maßnahmen und Entscheidungen,<br />
die darauf abzielen dem Verbraucherinteresse gegenüber<br />
dem Anbieter zu einer angemessenen Durchsetzung zu<br />
verhelfen. ...“<br />
(Gabler Wirtschaftslexikon (2010), Wiesbaden: Gabler)<br />
Maßnahmen der Humankapitalbildung<br />
• Verbrauchererziehung<br />
• Verbraucherberatung<br />
• Verbraucherinformation<br />
Verbraucherschutz<br />
• Eine Vielzahl von Ge- und Verboten soll die Stellung der Verbraucher<br />
gegenüber Marketing-Praktiken von Anbietern stärken.<br />
Die Ge- und Verbote sind festgelegt in zivil- und öffentlich-rechtlichen<br />
Regelungen<br />
• Inhalte des Verbraucherschutzes sind:<br />
- Gesetze, Rechsprechung, Verwaltungskontrolle<br />
- Selbstkontrolle der Wirtschaft
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Arten der Einflussnahme von verbraucherpolitischen Maßnahmen<br />
• „Zwang“, d.h. Androhung von negativen Konsequenzen bei<br />
Abweichungen z.B. von gesetzlich vorgeschriebenen Normen<br />
• „Überzeugung“, d.h. Veränderung von Kenntnissen, Fähigkeiten,<br />
Fertigkeiten sowie Einstellungen und Bedürfnissen<br />
(Zielen) auf dem Weg der Kommunikation<br />
(nach Kuhlmann, 1990, S. 6)<br />
Ökonomische Ressourcen privater Haushalte:<br />
- Humanvermögen/-kapital (Arbeitskraft + Zeit)<br />
- Sachvermögen<br />
- Finanzvermögen<br />
Diskussion: Welche Zielsetzung hat der Verbraucher? Warum konsumieren<br />
wir?<br />
Maslowsche Bedürfnishierachie<br />
Quelle: Kotler,P.; Bliemel, F. (1992): Marketingmanagement: Analyse, Planung, Umsetzung und<br />
Steuerung. Stuttgart, S. 265<br />
Selbstverwirklichung<br />
Geltung<br />
Geborgenheit und Liebe<br />
Sicherheit<br />
Physiologische Bedürfnisse
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Definition von Bedürfnis<br />
Ein Bedürfnis ist ein Gefühl des Mangels mit dem Bestreben, diesen<br />
Mangel mittels Güter zu beseitigen.<br />
Definition von Bedarf<br />
Der Bedarf sind die Güter, die dazu dienen, das Bedürfnis zu befriedigen.<br />
Der Bedarf ist somit die Konkretisierung eines Bedürfnisses.<br />
Leitbilder in der Verbraucherpolitik<br />
Die Stellung des Verbrauchers zwischen Hilflosigkeit<br />
und Souveränität<br />
Gegenwärtige<br />
Stellung des<br />
Verbrauchers<br />
Maßnahmen<br />
Angestrebte Stellung<br />
des<br />
Verbrauchers<br />
Hilflosigkeit Souveränität<br />
IST SOLL<br />
(Kuhlmann, 1990, S. 27)
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Konzeptionen:<br />
1. Wettbewerbsmodell<br />
2. Schutz- und Gegenmachtmodell<br />
3. Partizipationsmodell<br />
Quelle: Gabler – Wirtschaftslexikon (2010), Wiesbaden<br />
Diskussion: Wie ist die Stellung des Verbrauchers?<br />
Träger der Verbraucherpolitik in Deutschland und Europa<br />
In Deutschland und der EU wird die Verbraucherpolitik vom Staat bzw.<br />
der Europäischen Gemeinschaft getragen, sie finanzieren Verbraucherorganisationen<br />
(sogenannte Fremdorganisationen) und durch die Bürger<br />
in Form von eingetragenen Vereinen (Selbstorganisation).<br />
Diskussion: Vor- und Nachteile der Selbst- und Fremdorganisation<br />
Träger der Verbraucherpolitik in der Europäischen Union<br />
Europäische Union<br />
Im Zentrum der Europäischen Unio steht der Binnenmarkt:<br />
„Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen,<br />
Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen des<br />
Vertrages gewährleistet ist“ (EG-Vertrag 1992, Art. 14 Abs. 2).<br />
Das Gemeinschaftsrecht basiert auf<br />
- EG-Vertrag (Rom 1992) – primäres Recht<br />
Sekundäres Recht<br />
- EG-Verordnungen<br />
- EG-Richtlinien<br />
- EG-Entscheidung/Beschluss<br />
(Frede (Hg.), 2010, S. 2 f.)
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
In der Europäischen Union gibt es drei wesentliche Organe. Dies sind:<br />
- das Europäische Parlament,<br />
- der Rat der Europäischen Union (Ministerrat) und<br />
- die Europäische Kommission.<br />
Diese drei Organe werden auch als ‚institutionelles Dreieck‘ bezeichnet.<br />
Sie erstellen politische Programme und Rechtsvorschriften (Richtlinien,<br />
Verordnungen, Entscheidungen).<br />
Quelle: Frede, W. (Hg.) (2010): Handbuch für Lebensmittelchemiker. Berlin: Springer, S. 7
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Quelle: Frede, W. (Hg.) (2010): Handbuch für Lebensmittelchemiker. Berlin: Springer, S. 8<br />
Europäische Kommission<br />
http://europa.eu<br />
Die Kommission besteht aus 27 Personen mit einem Mitarbeiterstab aus<br />
25.000 Beamten. Die Kommissionsmitglieder werden auf fünf Jahre gewählt<br />
(2009-2014). Sie sind unabhängig von den Regierungen der Mitgliedstaaten.<br />
Die Kommission teilt sich in Generaldirektionen (GD) auf.<br />
General Direktion für Gesundheits- und Verbraucherschutz (Health<br />
and Consumer Protection), Kommissar John Dalli (Malta) mit sechs<br />
Abteilungen für:<br />
- Allgemeines,<br />
- Belange des Verbrauchers,<br />
- Gesundheitsschutz und Risikoeinschätzung,<br />
- Lebensmittelsicherheit: Produktions- und Handelsketten,<br />
- Lebensmittelsicherheit: Pflanzengesundheit, Tiergesundheit,<br />
Tierschutz und internationale Fragen,<br />
- Lebensmittel- und Veterinäramt
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Mit der GD verbundene EU-Agenturen:<br />
- Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA),<br />
Parma<br />
- Gemeinschaftliche Sortenamt (CPVO), Angers<br />
- Europäische Zentrum für die Prävention und Bekämpfung<br />
von Seuchen, Stockholm<br />
- European Monitoring Center for Drugs, London<br />
- Executiv Agency for Health and Consumers, Lissabon<br />
Verfahren für die Annahme neuer EU-Rechtsvorschriften<br />
a) Mitentscheidungsverfahren<br />
b) Anhörungsverfahren<br />
c) Zustimmungsverfahren<br />
Europäisch beratende Verbrauchergruppe<br />
Sie kann zu allen Fragen, die mit dem Schutz der Verbraucherinteressen<br />
auf Ebene der EU zusammenhängen, von der Kommission gehört werden.<br />
Sie hat 29 Mitglieder: je ein Vertreter der nationalen Verbraucherorganisation<br />
je Mitgliedstaat und jeweils ein Vertreter der europäischen<br />
Verbraucherorganisationen (BEUC, ANEC). Ihre Aufgabe ist es, den Informationsaustausch<br />
zwischen der Kommission und den Verbraucherverbänden<br />
vor Ort zu fördern.<br />
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA/EESC)<br />
www.esc.eu.int<br />
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein beratendes Gremium der<br />
Kommissare und dem Ministerrat mit einer Vielzahl von Fachgruppen<br />
und 300 Mitgliedern. Vertreten sind wichtige Interessengruppen der EU:<br />
Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Verbraucherorganisationen, Umweltschützer,<br />
Landwirte
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Verbraucherorganisationen in der EU<br />
Europäische Büro der Verbraucherverbände/<br />
Bureau Européen des Unions de Consomateurs (BEUC)<br />
www.beuc.org<br />
Die BEUC ist eine Dachorganisation von 41 europäischen Verbraucherverbänden<br />
in der EU mit Sitz in Brüssel. Sie ist unabhängig von Industrie<br />
und Handel. Finanziert wird sie von den Mitgliedsverbänden und der Europäischen<br />
Kommission.<br />
Europäischer Verband für die Koordinierung der Verbrauchervertretung<br />
bei der Normung (ANEC)<br />
www.anec.org<br />
Die ANEC wurde 1995 als gemeinnützige Gesellschaft in Belgien gegründet.<br />
Sie repräsentiert Verbraucherorganisationen der Europäischen<br />
Union und Staaten der EFTA (European Free Trade Association) (Island,<br />
Norwegen, Schweiz). Die Gesellschaft bemüht sich um einheitliche<br />
Standards in Europa. Die Anec wird finanziert durch die Europäische<br />
Kommission und die EFTA.<br />
Nichtdiskriminierung, freier Warenverkehr und gegenseitige Anerkennung<br />
Verboten ist „jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten die geeignet ist,<br />
den innergemeinschaftlichen Handel mittelbar oder unmittelbar, tatsächlich<br />
oder potentiell zu behindern“ (EG-Vertrag Art. 28).<br />
Gemeinschaftliche Lebensmittelrecht<br />
Basis-Lebensmittelverordnung von 2002<br />
- Farm-to-fork-Konzept<br />
- Artikel 2: Definition von Lebensmitteln<br />
“... alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind<br />
oder denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden<br />
kann, dass sie in verarbeitetem Zustand von Menschen<br />
aufgenommen werden“.
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
- Artikel 2: Definition Lebensmittelunternehmen<br />
“... alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung<br />
ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffentlich<br />
oder privat sind, die einer mit der Produktion, der Verarbeitung<br />
und dem Vertrieb von Lebensmittel zusammenhängende<br />
Tätigkeit ausführen“.<br />
- Einbeziehung sämtlicher Futtermittel und Futtermittelunternehmen,<br />
sowie Lebensmittelbedarfsgegenstände<br />
Risikobewertung und Vorsorgeprinzip<br />
Risikoanalyse bei Maßnahmen:<br />
- Risikobewertung: EFSA und EMEA (Tierarzneimittelrückstände)<br />
- Risikomanagement<br />
- Vorsorgeprinzip<br />
Rückverfolgbarkeit<br />
Basis-Verordnung: Die Lebensmittelunternehmer haben die rechtliche<br />
Grundverantwortung für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit<br />
Nur Leitlinien!<br />
Consumers International (CI)<br />
Eight basic consumer rights:<br />
- the right to satisfaction of basic needs<br />
- the right to safety<br />
- the right to be informed<br />
- the right to choose<br />
- the right to be heard<br />
- the right to redress<br />
- the right to consumer education<br />
- the right to a healthy environment
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Träger der Verbraucherpolitik in Deutschland<br />
Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft<br />
www.bmelv.de<br />
Ziele:<br />
- Verzahnung von Ernährung und Lebensmittelsicherheit<br />
- Organisatorische Verstärkung der Verbraucherpolitik<br />
- Stärkere Verbindung der nachhaltigen Land- und Fortwirtschaft mit<br />
Umwelt, Klima und Energieaspekten<br />
- ...<br />
Geschäftsbereiche<br />
I Bundesbehörden<br />
II Rechtlich selbständige Anstalten des öffentlichen Rechts<br />
III Bundesforschungsinstitute im Geschäftsbereich des BMELV<br />
IV Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm<br />
Leibnitz<br />
V Sonstige institutionelle Zuwendungsempfänger<br />
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)<br />
(www.vzbv.de)<br />
Die vzbv ist die Dachorganisation von 42 Verbraucherverbänden (16<br />
Verbraucherzentralen und 26 Verbänden). Der VZBV ist Mitglied der<br />
BEUC und der CI. Er ist gemeinnützig und parteipolitisch neutral.<br />
„Verbraucherschutz will mehr als das beste Produkt zum niedrigsten<br />
Preis.“<br />
Ziele:<br />
- Gleichberechtigung und Chancengleichheit zwischen Anbietern<br />
und Verbrauchern herzustellen; wollen dem Verbraucher Gehör<br />
schaffen<br />
- Recht auf sichere und gesundheitlich unbedenkliche Produkte<br />
und Dienstleistungen<br />
- wirksamer Schutz vor materieller Übervorteilung
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
- umfassende Informationen für den Verbraucher und echte<br />
Wahlfreiheit<br />
- Einsatz für einen nachhaltigen Konsum<br />
Handeln:<br />
- Einfluss nehmen/Lobbyarbeit, Politikberatung<br />
- Recht durchsetzen: z.B. Verbandsklagebefugnis, Verbraucherinformationsgesetz<br />
- Beratung fördern<br />
Stiftung Warentest<br />
www.stiftung-warentest.de<br />
Die Stiftung Warentest ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts (d.h. sie ist<br />
unabhängig). Sie wurde 1964 von der Bundesregierung als Institut <strong>zur</strong><br />
Durchführung vergleichender Waren- und Dienstleistungsunter-suchungen<br />
gegründet.<br />
Ziele:<br />
- Markttransparenz, objektive Merkmale des Nutz- und Gebrauchswertes<br />
sowie der Umweltverträglichkeit<br />
- optimale Haushaltsführung, rationale Einkommensverwendung,<br />
über gesundheits- und umweltbewusstes Verhalten<br />
aufklären<br />
- die Prüfungen geschehen nach wissenschaftlichen Methoden<br />
Herausgegeben werden die Zeitschriften ‚Test‘ und ‚Finanztest‘ sowie<br />
zahlreiche Einzelveröffentlichungen. Um die Unabhängigkeit zu waren<br />
sind die Zeitschriften frei von Werbung.<br />
Verbraucherinformation<br />
Informatiosquellen:<br />
- neutrale Quellen<br />
- beeinflussende Marketingquellen<br />
- unbeeinflussende Marketingquellen<br />
- personale Quellen
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Verbraucherschutz<br />
Eine Vielzahl von Ge- und Verboten soll die Stellung der Verbraucher<br />
gegenüber den Marketing-Praktiken von Anbietern stärken. Die Ge- und<br />
Verbote sind festgelegt in zivil- und öffentlich-rechtlichen Regelungen.<br />
Inhalte des Verbraucherschutzes:<br />
- Gesetze, Rechtsprechung, Verwaltungskontrolle<br />
- Selbstkontrolle der Wirtschaft<br />
Sie lassen sich folgendermaßen untergliedern:<br />
a) Reglementierung des Anbieterhandelns auf Konsumgütermärkten<br />
(z.B. LFMB; UWG; GWG, AbzG; AGB-Gesetz, Mietrecht)<br />
b) Reglementierung des Handelns öffentlicher Anbieter (z.B. Informationsrechte<br />
bei der Planung öffentlicher Güter)<br />
c) Schutz individueller Rechtsgüter vor Verletzungen durch Anbieter<br />
(z.B. Produkthaftung, Haftung für Planungsfehler, Entschädigungsrecht)<br />
Quelle: Kuhlmann, 1990, S. 87 ff.<br />
Wettbewerbsgesetze:<br />
z.B.:<br />
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)<br />
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)<br />
- Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz)<br />
Bürgerliche Gesetzbuch<br />
z.B.:<br />
- Recht der Allgemeinen Geschäftbedingungen (§§ 305 ff. BGB)<br />
- Verbraucherkreditregeln (§§ 491 ff. BGB)<br />
- Haustürwiderrufsregeln (§§ 312, 312a BGB)<br />
- Fernabsatzregeln (§§ 312b ff. BGB)<br />
- Teilzeitwohnrechtsregeln (§§ 481 ff. BGB)<br />
- Regeln zum elektronischen Rechtsverkehr (§ 312 e BGB)
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Selbstverpflichtung der Wirtschaft<br />
- nichtrechtliche Maßnahmen/Soft Law<br />
- gesetzlich nicht verbindliche Standards oder Verhaltensregeln, die unter<br />
der Regie einer Behörde zustande kommen, z.B. Deutsche Weberat<br />
Deutsche Werberat (seit 1972)<br />
... gehört zum ZAW – Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft<br />
... ist eine Institution der Wirtschaft<br />
Aufgaben:<br />
- Werbung im Hinblick auf Inhalte, Aussage und Gestaltung<br />
weiterzuentwickeln und Missstände festzustellen und zu<br />
beseitigen<br />
- Leitlinien eines selbstdisziplinären Charakters zu entwickeln<br />
- Grauzonen im Vorfeld der gesetzlichen Grenzen zu ermitteln<br />
und Darstellungen, die anstößig oder unzuträglich<br />
sind, zum Schutze der Umworbenen abzustellen<br />
Grundlagen:<br />
- Gesetze<br />
- werberechtliche Vorschriften: sie verbieten Unlauterkeit<br />
und Irreführung in der Werbung<br />
- Verhaltensregeln des Deutschen Werberats zu einigen<br />
Sozialbereichen (z.B. Werbung von und mit Kindern im<br />
Fernsehen und Hörfunk; Bewerbung von alkoholischen<br />
Getränken)<br />
- die aktuell herrschende Auffassung über Sitte, Anstand<br />
und Moral in der Gesellschaft
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Werbung<br />
Bedingungen für Werbung:<br />
Kommunikationsbedingungen<br />
- Informationsüberlastung<br />
- Dominanz von Bildkommunikation<br />
• Schnelle Aufnahme und Bearbeitung von Bildern<br />
• Geringere Anstrengung bei der Verarbeitung von Bildern<br />
• Bildkommunikation prägt die Anforderungen an die Informationsdarbietung<br />
Marktbedingungen<br />
- Sättigung der Märkte und austauschbare Angebote<br />
- Nachlassendes Informationsinteresse<br />
- Versagen der informativen Werbung<br />
- Zunehmende Marktdifferenzierung<br />
- Differenzierung der Markenkommunikation<br />
Quelle: Kroeber-Riel, W.; Esch, F., 2000<br />
Gesellschaftliche Bedingungen<br />
Quelle: Kroeber-Riel, W.; Esch, F., 2000<br />
Recht: Rechtsnormen für Kommunikation<br />
- Vorschrift des UWGs (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)<br />
- EU-Richtlinie vom Okt. 1997 <strong>zur</strong> vergleichenden Werbung: ist erlaubt<br />
- Selbstkontrolle der Werbewirtschaft (Deutscher Werberat)<br />
Öffentliche Meinung<br />
- kritische Haltung gegenüber Werbung hat Einfluss auf sie<br />
- die Sensibilität gegenüber werblicher Beeinflussung ist in den letzten<br />
Jahrzehnten gestiegen (Umweltfreundlichkeit/-schädlichkeit, Emanzipation<br />
der Frau)<br />
Wertorientierungen
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
- Erlebnis- und Genussorientierung<br />
- Gesundheits- und Umweltbewusstsein<br />
- Betonung der Freizeit<br />
- Internationale und multikulturelle Ausrichtung<br />
- Suche nach Individualität<br />
- Viel Haben für wenig Geld/Schnäppchenjäger<br />
Zentrale Stichworte:<br />
erlebnisorientierter Konsum und<br />
Geiz ist geil!<br />
Wirkung von Werbung<br />
Emotion: aufgrund der dargebotenen Reize wird das Angebot emotional<br />
erlebt.<br />
Information: der sachliche Inhalt löst eine rationale Beurteilung des Angebots<br />
aus<br />
Erst bei dem Zusammenwirken von emotionaler Haltung zum Angebot<br />
und rationaler Beurteilung kommt es zu einer komplexen inneren Haltung<br />
(„Einstellung“), die das Verhalten beeinflusst.<br />
Sozialtechniken der Werbung<br />
Zur gezielten Aktivierung der Empfänger gibt es drei Techniken, die Verwendung<br />
von:<br />
- physisch intensiven Reizen (z.B. Farbe),<br />
- emotionalen Reizen (z.B. Babys) und<br />
- überraschenden Reizen (Witze, Pointen).<br />
Klassisches Einstellungsmodell <strong>zur</strong> Wirkung von Werbung:<br />
Kroeber-Riel, W.; Esch, F., 2000<br />
Die Eigenschaften eines Angebotes werden zunächst wahrgenommen<br />
und dann beurteilt. Erst nach einer sachlichen Beurteilung bildet sich ein<br />
positives oder negatives Urteil aus, d.h. die gedankliche (kognitive) Einsicht<br />
entscheidet, ob der Gegenstand akzeptiert wird.<br />
Kritik:
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
... ein solches Verhalten tritt nur ein, wenn sich der Konsument eingehend<br />
mit den Eigenschaften eines Gutes auseinandersetzt. Aber selbst<br />
dann beeinflusst die spontan zustande gekommene emotionale Haltung<br />
die rationale Beurteilung.<br />
Die gedankliche Auseinandersetzung mit einem Angebot ist häufig gering.<br />
In einem solchen Fall spielt der emotionale Eindruck eine große<br />
Rolle. Der emotionale Eindruck wird als Angelpunkt bezeichnet („Vor-<br />
-Entscheidung“).<br />
Emotion und Information als Ziel<br />
Informationen treffen nur auf Resonanz, wenn bei dem Konsumenten<br />
bereits die Bedürfnisse geweckt sind. Bedürfnisse können durch die<br />
Werbung aktualisiert, verstärkt und neu geschaffen werden.<br />
Selbstbild des Konsumenten<br />
Quelle: Soloman, M.; Bamossy, G.; Askegaard, S. (2001): Konsumentenverhalten. Der europäische<br />
Markt. München: Pearson Studium, S. 212ff.<br />
Multiples Selbst<br />
- Jeder Mensch hat verschiedene soziale Rollen in sich (Ehepartner,<br />
Student, Kind, Eltern, Vorgesetzter, ...)<br />
- Annahme: der Mensch lebt in einer symbolischen Umwelt. Die Situation<br />
oder das Objekt wird durch die Interpretation dieser Symbole festgelegt.<br />
- Auch der Mensch interpretiert seine eigene Identität. Die Interpretation<br />
wird weitestgehend durch die Menschen um uns herum beeinflusst.<br />
„Für wen halten mich die anderen?“<br />
Konsum und Selbsteinschätzung<br />
- Der Mensch hat verschiedene soziale Rollen und ‚spielt‘ diese Rollen.<br />
- Konsumenten lernen, dass die verschiedenen Rollen von Produkten<br />
und Aktivitäten begleitet werden, die bei der Definition der Rollen behilflich<br />
sind.<br />
- Anhand des Kaufverhaltens einer Person beurteilen Menschen deren<br />
soziale Identität.
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
- Objekte können als eine Art Sicherheitsnetz dienen, indem sie unsere<br />
Identität verstärken – besonders in ungewohnten Situationen.<br />
- Die Verwendung von Konsuminformationen <strong>zur</strong> Definition des Selbst<br />
ist dann besonders wichtig, wenn eine neue Identität gebildet wird<br />
(neue oder unbekannte Rolle, z.B. Jugendliche)<br />
- Der Konsument identifiziert sich mit den Eigenschaften des Produkts<br />
(z.B. Autofahrer)<br />
- Bleibt die Frage: Kaufen Menschen Produkte, weil sie sie für<br />
ähnlich mit ihrem Selbst halten, oder vermuten sie, diese Produkte<br />
müssten ihnen ähnlich sein, weil sie sie kaufen.<br />
Produktwahl<br />
- Bewertungskriterien: z.B. funktionale, ...<br />
- Heuristik: geistige Abkürzungen z.B.:<br />
- teure Produkte sind qualitativ wertvoller<br />
- dieselbe Marke kaufen wie letztes mal<br />
- dieselbe Marke kaufen wie Mutter, ...<br />
- Verlassen auf Produktsiegel<br />
- Marktüberzeugungen<br />
- Herkunftsland<br />
- Vertraute Markennamen<br />
- Konsistenzprinzip<br />
- Menschen neigen dazu, zu sehen was sie sehen wollen; so suchen<br />
sie Produktinformationen, die ihre Meinung bestätigt<br />
Sebstachtung und Sozialer Vergleich<br />
- Marketingkommunikation kann die Selbstachtung eines Konsumenten<br />
beeinflussen. Ist eine Person Werbeanzeigen ausgesetzt, so kann<br />
dadurch ein Prozess des sozialen Vergleichs ausgelöst werden.<br />
Solomon, M. et al. (2006): Consumer Behaviour. 3. Aufl., Harlow: Pearson Education, S. 209
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Nachhaltige Entwicklung<br />
„Nachhaltig ist eine Entwicklung dann, wenn sie den Bedürfnissen<br />
der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten der zukünftigen<br />
Generationen zu gefährden."<br />
Internationale Kommission für Umwelt und Entwicklung, Brundtland-Report, 1987<br />
Demographie<br />
Folien: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung<br />
www.weltbevoelkerung.de unter Info-Service (Themenmagazin, Weltkarten<br />
und Grafiken)<br />
Nachhaltige Entwicklung<br />
Untersucht man die Funktionen, die die Ökosphäre für die Technosphäre<br />
wahrnimmt, so ergeben sich folgende Bereiche:<br />
Produktionsfunktionen versorgen die Gesellschaft mit Produkten der<br />
natürlichen Umwelt<br />
Trägerfunktionen nehmen Aktivitäten, Erzeugnisse und Abfälle<br />
menschlichen Handelns auf<br />
Regelungsfunktionen sorgen für eine natürliche Regelung der Zustandsgrößen<br />
(Temperatur, Druck, Konzentration usw.)<br />
Ethische Funktion der Ökosphäre hat eine hohe soziale und kulturelle<br />
Bedeutung<br />
In der Vergangenheit beschränkte man die Beziehungen zwischen Ökosphäre<br />
und Technosphäre meist nur auf die Produktionsfunktion und die<br />
Trägerfunktion. Es sind beide nicht ersetzbare Leistungen der Natur und<br />
sie sind der natürliche Kapitalstock der Menschheit, der daher erhalten<br />
werden muß.
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Ableitungen operativer Managementregeln:<br />
(Rogall, H., 2002)<br />
Ökologische Managementregeln<br />
- Regenerationsregel: Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen darf die<br />
Regenerationsrate nicht überschreiten.<br />
- Assimilationsregel: Stoffeinträge in die Umwelt müssen die natürliche<br />
Assimilationsfähigkeit der Natur beachten<br />
- Substitutionsregel: Nicht erneuerbare Ressourcen dürfen nur insoweit<br />
verwendet werden als ein gleichwertiger Ersatz substituierbar ist.<br />
Ökonomische Managementregeln<br />
- funktionsfähiges Preissystem<br />
- Wettbewerb<br />
Soziale Managementregeln<br />
- Menschenwürde, Grundbedürfnisse<br />
- Solidargemeinschaft, Gerechtigkeitsempfinden<br />
Risiken für die Ökosphäre:<br />
Globalität: Die Auswirkungen der Stoffpolitik erstreckt sich auf den gesamten<br />
Globus<br />
Irreversibilität: Eingetretene Schäden sind praktisch nicht oder nur in<br />
sehr langen Zeiträumen wieder rückgängig zu machen<br />
Divergenz der Zeitkonstanten: Die Veränderungen der stofflichen Zusammensetzung<br />
erfolgen so schnell, daß evolutionäre Anpassungsmechanismen<br />
versagen, da sie zu langsam sind.<br />
Divergenz der räumlichen Belastung: Schädigungen und Schäden<br />
verteilen sich ungleich innerhalb einer Generation über den Globus.<br />
Daraus ergeben sich zwangsläufig Verteilungskonflikte.<br />
Divergenz der zeitlichen Belastung: Schädigungen und Schäden verteilen<br />
sich ungleich über die Generationen. Daraus ergeben sich<br />
Verteilungsprobleme zwischen nachfolgenden Generationen.<br />
Unterscheidung zwischen Schaden (Schadensereignis) und der zeitlich<br />
nachfolgenden Schädigung.<br />
Bsp. Düngung und Grundwasserbelastung
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Leitbilder<br />
1. Vermeidung statt Verwertung!<br />
2. Nachrangig zu dem Leitbild steht das Prinzip der Wiederverwertung<br />
(Kreislaufwirtschaft)<br />
Konvergenz von Handeln und Wissen in den Industrieländern!!!!<br />
Nachhaltiger Konsum im weiteren Sinne (z.B. Hybridauto)<br />
- der nachhaltige Konsum im weiteren Sinne ist dadurch gekennzeichnet,<br />
dass er nicht für 6,6 Mrd. Menschen verallgemeinerbar ist, sondern<br />
nur eine relative Verbesserung des Status quo<br />
Nachhaltiger Konsum im engeren Sinne<br />
- dies wäre eine absolute Zielerreichung, er wäre verallgemeinerbar für<br />
alle Menschen auf der Welt<br />
- Problem: das Konsumniveau auf dem alle Menschen theoretisch leben<br />
müsste definiert werden (spezifisches Konsumniveau: ökologischer<br />
Fußabdruck)<br />
Quelle: Belz, F-M; Karg, G.; Witt, D. (Hg.) (2007): Nachhaltiger Konsum und Verbraucherpolitik im 21.<br />
Jahrhundert. Marburg: Metropolis<br />
Definition: Ökologischer Fußabdruck<br />
„Der ökologische Fußabdruck einer gegebenen Bevölkerung (oder deren<br />
Wirtschaft) kann als das Gebiet von biologisch produktiven Land<br />
(und Wasser) in verschiedenen Kategorien wie Ackerland, Weiden,<br />
Wäldern usw. definiert werden, das erforderlich wäre um mit der<br />
heutigen Technologie für die Bevölkerung<br />
1. alle konsumierte Energie und alle materiellen Ressourcen bereit<br />
zu stellen und<br />
2. allen Abfall zu absorbieren.“<br />
Quelle: Wackernagel, M; Rees, W. (1997): Unser ökologischer Fußabdruck. Wie der Mensch Einfluss<br />
auf die Umwelt nimmt. Basel<br />
Drei <strong>Ansätze</strong> <strong>zur</strong> Realisierung nachhaltigen Konsum:
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
1 Effizienz<br />
2 Suffizienz<br />
3 Konsistenz<br />
Quelle: Belz, F-M; Karg, G.; Witt, D. (Hg.) (2007): Nachhaltiger Konsum und Verbraucherpolitik im 21.<br />
Jahrhundert. Marburg: Metropolis<br />
Intrinsische Motive zum Handeln: Selbstbestimmung, Verantwortung,<br />
Ethik/Moral, Eigennutz<br />
Extrinsiche Motivation<br />
Suffizienz und ein gutes Leben?<br />
Akteure der Suffizienz: Wer kann was tun?<br />
- Der Konsum der privaten Haushalte muß ernst genommen werden,<br />
aber die privaten Haushalte dürfen nicht überfordert werden. Grund:<br />
Das soziale Verhalten wird stark durch soziale Prägungen geformt<br />
(medial, sozial, finanziell). Der Einzelne ist überfordert, wenn er alleine<br />
die Verantwortung übernehmen soll.<br />
- Wirtschaft und Politik sind gefordert. Die Politik mit Anreizen und<br />
Grenzen (Steuern, Steuerprogression, Subventionen, Ordnungsrecht,<br />
Planungsrecht)<br />
- Es bedarf einer öffentlichen Diskussion um das <strong>Thema</strong> mit einer Meinungsführerschaft<br />
in der Gesellschaft und öffentlichen Druck.<br />
Quelle: Linz/Wuppertal Institut, Tagungsbeitrag vom 6.6.2005 in Trier<br />
Defizite in Deutschland:<br />
- Eine koordinierte politische Strategie für nachhaltigen Konsum fehlt!<br />
- Es wäre dringend notwendig, eine bessere Informationsgrundlage für<br />
die Verbraucher zu schaffen.<br />
- Es fehlt eine dauerhafte Diskussionsplattform für die Gesellschaft<br />
(Meinungsführerschaft).
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Bedingungen für individuelles Umwelthandeln<br />
(Fietkau und Kessel, 1981)<br />
- Alternative Verhaltensangebote – Gibt es überhaupt Alternativen?<br />
- Anreize für Verhalten – Was ist attraktiv an dem Handeln?<br />
- Wissen: Information, Hintergrundwissen, Handlungswissen<br />
- Einstellungen und Werte<br />
- Wahrgenommene Konsequenzen des eigenen Handelns – Wie kann<br />
ich die Wirkung rückmelden?<br />
Belohnung langfristigen umweltbezogenen Engagements<br />
(Kals und Montada, 1994)<br />
- Verantwortungsübernahme<br />
- Emotionen<br />
- Eigene Einflußmöglichkeiten (Selbstwirksamkeit)<br />
Erfolgreiche Maßnahmen ...<br />
1 zeigen konkrete Handlungsmöglichkeiten auf,<br />
2 greifen die Motive der Adressaten (Zielgruppen) auf (z.B. „gutes<br />
Leben“, Gesundheit),<br />
3 bieten Anreize,<br />
4 brechen Gewohnheiten auf,<br />
5 vermitteln Wissen über Zusammenhänge,<br />
6 fördern Selbstwirksamkeit,<br />
7 fördern persönliche Verantwortung,<br />
8 nutzen Emotionen <strong>zur</strong> Selbsterkenntnis,<br />
9 fördern umweltbezogene Einstellungen,<br />
10 werden in ihrer Wirksamkeit durch Evaluation überprüft.<br />
Beispiele ...
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Text:<br />
Kantelhardt, J.; Heißenhuber, A. (2005): Nachhaltigkeit und Landwirtschaft.<br />
In: Brunner, K-M.; Schönberger, G. (Hg.): Nachhaltigkeit<br />
und Ernährung. Produktion – Handel – Konsum. Frankfurt/Main:<br />
<strong>Campus</strong>, S. 25-48<br />
Beispiel für Verbraucherinformation Lebensmittelkennzeichnung:<br />
Gütezeichen, Herkunftszeichen, Verbandszeichen,<br />
Qualitätskennzeichnung<br />
• Überblick über die Qualitätskennzeichnung im EU-Binnenmarkt<br />
• Bedeutung der Zeichen für die Kaufentscheidung<br />
Qualitätszeichen können als Globalinformation die Kaufentscheidung<br />
vereinfachen, indem sie die Einhaltung von Qualitätsstandards versprechen.<br />
Andererseits ist ihr Erscheinungsbild geeignet, beim Käufer<br />
falsche, überhöhte Qualitätserwartungen zu wecken.<br />
Schwerpunkte:<br />
- Anforderungen, die den unterschiedlichen Zeichentypen zugrunde liegen<br />
- Funktion der Zeichen: Absatzförderung, überdurchschnittliche Qualität<br />
- Kontrolle<br />
- Wert des Zeichens für die Verbraucher<br />
Kennzeichnungsssyteme und Qualitätsaussagen<br />
Warenzeichen<br />
... sind Kennzeichen, die auf der Ware oder Verpackung sichtbar sind<br />
und eigenständig in Erscheinung treten. Zeichenträger können Vereine,<br />
Verbände, Unternehmen oder sonstige rechtsfähige Gemeinschaften<br />
sein.<br />
Warenzeichen sind nicht an eine Güte- oder Qualitätskennzeichnung gebunden.<br />
Sie werden unterschieden in Marken-, Güte-, Herkunfts- und<br />
Verbandszeichen.
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Markenzeichen<br />
... sind betriebliche Warenzeichen, die der Anbieter <strong>zur</strong> Profilierung seines<br />
Produktes im Wettbewerbsumfeld dienen.<br />
Beispiele: Herstellermarken: Du darfst, Bärenmarke, Coca-Cola, Danone<br />
Handelsmarken: Plus, Spar, Rewe, Neuform<br />
Güte-, Herkunfts- und Verbandszeichen<br />
... sind überbetriebliche Warenzeichen. Sie gelten für ganze Warengruppen<br />
und werden von einer größeren Anzahl von Unternehmen oder Erzeugern<br />
geführt.<br />
Gütezeichen<br />
Unter Güterzeichen werden Wort- und/oder Bildzeichen verstanden, die<br />
kontrollierte Aussagen über die Gesamtheit der oder eine Auswahl von<br />
Eigenschaften eines Produkts treffen. Die Gütezeichen bedürfen der Anerkennung<br />
einer herstellerunabhängigen neutralen Institution.<br />
In Deutschland liegt das Gütezeichenwesen in den Händen des RAL –<br />
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.‘<br />
Herkunftszeichen<br />
mit und ohne Qualitätszeichen<br />
... weisen auf den geographischen Ursprungsort eines Produktes hin.<br />
Funktion:<br />
- Unterstützung des ländlichen Raumes bei der Erhaltung<br />
spezifischer Erzeugungen; Absatzförderung für die Region<br />
- Schutz bestimmter Produktbezeichnungen (Z. B. Parmaschinken,<br />
Sherry, ...)<br />
- Hervorhebung einer besonderen Produktqualität oder Rezeptur<br />
Verbandszeichen<br />
Verbandszeichen sind Warenzeichen von Verbänden, die einen gewerblichen<br />
Zweck verfolgen und den Geschäftsbetrieben der Mitglieder <strong>zur</strong><br />
Warenkennzeichnung dienen. Es findet eine verbandsbezogene Produktkennzeichnung<br />
statt. Dokumentiert wird hier nicht die Qualität der<br />
Ware selbst, sondern die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft.<br />
Verbandszeichen sind Waren kennzeichenrechtlich geschützt. Sie brauchen<br />
keine Qualitätsgarantie zu geben.
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
Diese Form der Kennzeichnung nutzen besonders Erzeugergemeinschaften<br />
und Anbauverbände des kontrollierten ökologischen Anbaus<br />
(Demeter, Bioland usw.).<br />
Verbrauchererziehung<br />
Ziel der Verbrauchererziehung ist es, in der sozialen Marktwirtschaft den<br />
Verbraucher <strong>zur</strong> Handlungsautonomie zu befähigen und gleichzeitig <strong>zur</strong><br />
sozialen Verantwortlichkeit anzuleiten.<br />
Das Leitbild zeichnet sich durch einen aktiven Verbraucher aus, der neben<br />
seinen individuellen Interessen auch soziale und ökologische Belange<br />
verantwortungsbewusst verfolgt.<br />
Ziel sind Änderung/Ergänzungen/Korrektur/Verhinderung von Dispositionen,<br />
die durch den Sozialisationsprozess geformt wurden.<br />
Sozialisationsforschung:<br />
- Familialer Einfluss prägt Dispositionen und Verbraucherverhalten von<br />
Kindern bereits in sehr frühen Jahren<br />
- Ein Teil der erlernten Dispositionen kann bereits im Kindes- und Jugendalter<br />
in Verhalten umgesetzt werden, ein anderer Teil wird erst<br />
mit erheblicher Zeitverzögerung wirksam, wenn die jungen Erwachsenen<br />
einen eigenen Haushalt führen.<br />
- Erlernte Dispositionen besitzen erhebliche Stabilitiät und bestimmen<br />
Grundmuster des Verhaltens auch beim erwachsenen Verbraucher.<br />
Quelle: Kuhlmann, E.: Verbraucherpolitik. München: Valen, 1990, S. 274<br />
Bilder die Massenmedien vermitteln (Tendenzen):<br />
- Idealbilder zeitnahen Konsumverhaltens demonstrieren besonders<br />
eindringlich vermögende, mächtige Personen der Oberschicht sowie<br />
junge, beruflich erfolgreiche Aufsteiger der Mittelschicht.<br />
- Das dargestellte Verbraucherverhalten ist auf unmittelbaren individuellen<br />
Lustgewinn (Hedonismus) ausgerichtet und stellt den Besitz von<br />
Gütern als einen Wert an sich dar (Materialismus).<br />
- Es werden jene Merkmale von Gütern und Dienstleistungen in den<br />
Vordergrund gestellt, die private Werthaltungen und sozialen Status
Dr. Iris Brandenburger Aspekte der Verbraucherpolitik<br />
auszudrücken geeignet sind. Wirtschaftliche, funktionale Eigenschaften<br />
treten in den Hintergrund.<br />
Verbraucherberatung<br />
Besteht aus:<br />
- Kommunikationshandlungen, durch die<br />
- Berater<br />
- während eines Interaktionsprozesses<br />
- Probleme zu definieren und zu lösen suchen,<br />
- die Verbraucher an sie herantragen<br />
Der Berater ...<br />
- sollte neutral und objektiv sein.<br />
- braucht methodische und psychologische Kompetenzen<br />
- braucht fundierte Fachkenntnisse<br />
Der Beratungsprozess ...<br />
- ist problemorientiert.<br />
- ist freiwillig.<br />
- wird partnerschaftlich vollzogen<br />
- erbringt Lösungsvorschläge<br />
- ist in seinem Ergebnis nicht vorbestimmt.<br />
Beratung sollte ‚Hilfe <strong>zur</strong> Selbsthilfe‘ sein.<br />
Da der Berater niemals alle Einflussgrößen auf die Situation des Ratsuchenden<br />
erfassen kann, muss die Entscheidung letzten Endes immer<br />
beim Ratsuchenden liegen.