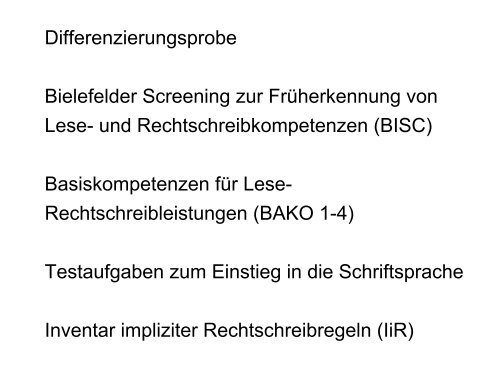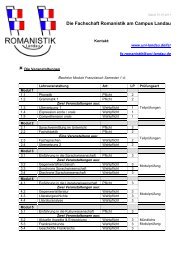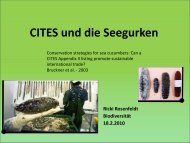Folie 1
Folie 1
Folie 1
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Differenzierungsprobe<br />
Bielefelder Screening zur Früherkennung von<br />
Lese- und Rechtschreibkompetenzen (BISC)<br />
Basiskompetenzen für Lese-<br />
Rechtschreibleistungen (BAKO 1-4)<br />
Testaufgaben zum Einstieg in die Schriftsprache<br />
Inventar impliziter Rechtschreibregeln (IiR)
„Differenzierungsprobe“<br />
(Breuer, Weuffen 2004)
theoretischer Hintergrund:<br />
psycholinguistische Annahmen<br />
Wahrnehmungsleistungen hier als untrennbar mit Sprach- und<br />
Denkentwicklung verbunden betrachtet<br />
beim Hören und Verstehen gesprochener Sprache erfolgt Orientierung an<br />
Varianten der Artikulation<br />
Betonung<br />
Stimmführung<br />
Sprechpausen<br />
Gliederung von Lauten im Wort<br />
Gliederung der Wörter im Satz<br />
→ Abgleich mit im Gedächtnis gespeicherten Wortklangbildern,<br />
Satzschemata<br />
→ verstehen, was der andere sagt
WICHTIG auch feine Lautunterschiede wahrnehmen zu können<br />
Mimik und Gestik des Gegenübers unterstützen diesen Prozess<br />
durch optische Signale<br />
=> Sprachverstehen liegen verschiedene Differenzierungsleistungen<br />
zugrunde<br />
bei Schwierigkeiten mit einer oder mehreren dieser Differenzierungs-<br />
leistungen auch Probleme beim Schriftspracherwerb
Dinge erhalten „Namen“ und darüber interne, im Gedächtnis<br />
gespeicherte Repräsentation<br />
→ ermöglicht zunehmend Handlungsabläufe zu planen und Ergebnisse<br />
zu antizipieren<br />
erforderlich<br />
→ Anregung zur Sprachentwicklung durch Umwelt<br />
Intaktheit des verbo-sensomotorischen Apparats (Sinnesmodalitäten<br />
nicht eingeschränkt)<br />
=> leichtere Einschränkungen mit DP zu erkennen<br />
DP:<br />
nicht normiert, ausschließlich Feststellung eines möglichen<br />
Förderbedarfs<br />
Material ist standardisiert, d. h. vorgegeben, Testanweisungen<br />
möglichst einhalten
Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen:<br />
Optisch-graphomotorische Differenzierungsfähigkeit<br />
Voraussetzung für Sinnentnahme beim Lesen und Schreiben<br />
1. Automatisierung der optischen Wahrnehmung und<br />
graphomotorischen Wiedergabe der Buchstaben<br />
besondere Merkmale der einzelnen Laute und Buchstaben,<br />
in die sie umgesetzt werden<br />
korrekte Wahrnehmung auch kleiner Unterschiede<br />
z. B. „b“ und „d“ oder „m“ und „n“<br />
Band - Rand – Land – Hand
2. einzelne Buchstaben in ihrer Abfolge innerhalb eines Wortes<br />
richtig erkennen<br />
→ Fähigkeit zur räumlichen Gliederung<br />
→ Orientierung an Lautklangfolgen im Wort und Sinnentnahme<br />
in Wortfolgen, die im Rahmen eines oder mehrerer Sätze einen Sinn<br />
ergeben<br />
→ Abruf aus Gedächtnis muss automatisiert erfolgen können,<br />
sonst leidet Flüssigkeit beim Lesen und Schreiben erheblich<br />
→ Fähigkeit zur exakten Speicherung ist Voraussetzung<br />
in DP => buchstabenähnliche Zeichen richtig abzeichnen<br />
<strong>Folie</strong>
Phonematisch-akustische Differenzierungsfähigkeit<br />
akustisches Gehör → ermöglicht das Hören überhaupt, Wahrnehmung<br />
von Geräuschen an sich<br />
phonematisches Gehör → verantwortlich für Sinnentnahme aus<br />
Gehörtem, „Sprachgehör“<br />
=> je präziser phonematische Struktur eines Wortes wahrgenommen<br />
wird, um so genauer kann sein Sinngehalt verstanden werden<br />
Zusammenhang zwischen Wortschatz und phonematischer<br />
Differenzierungsfähigkeit<br />
für Umsetzung gesprochener Sprache in Buchstaben (Schreiben)<br />
notwendig, in Phonemstruktur, ganzem Wort, Einzellaute herauszuhören
wenn Laute nicht richtig phonematisch-akustisch diskriminiert werden<br />
→ Schreibungen wie<br />
„Galb“ statt „Kalb“<br />
„leize“ statt „leise“<br />
in DP II: Klingen die Wörter gleich?<br />
Petra - Peter Tür - Tier bemühen - bemühen<br />
Nagel - Nadel Seife - Seite<br />
<strong>Folie</strong> zu Bildtafeln
Kinästhetische-artikulatorische Differenzierungsfähigkeit<br />
Sprechen höchste motorische Leistung zu der Menschen fähig sind<br />
für richtige Artikulation Koordination feinster Muskelbewegungen<br />
erforderlich<br />
sprechmotorische Leistungen in ersten Lebensjahren eng mit<br />
Entwicklung der Motorik überhaupt verbunden<br />
für Lesen- und Schreibenlernen ist Sprechkinästhesie (Sprech-<br />
bewegungsvorstellung) wichtig, weil Schreibanfänger sich zunächst<br />
vorsprechen, was sie schreiben<br />
Kinder speichern Wörter im Gedächtnis, wie sie sie zu hören glauben<br />
und selbst aussprechen<br />
→ wenn ein Wort mit falscher Artikulation gemerkt ist, wird es falsch<br />
geschrieben
in DP Wörter nachsprechen:<br />
DP 0 „Blitzableiter“,<br />
„Waschwasser“<br />
„Aquarium“<br />
DP I und II „Postkutsche“<br />
„Aluminium“<br />
„Schellfischflosse“<br />
„Konsumgenossenschaft“<br />
„Krambambuli“<br />
„Elektrizität“
Melodisch-intonatorische Differenzierungsfähigkeit<br />
gesprochene Sprache ist melodisch<br />
je nach stimmlichen Ausdruck vermitteln gleiche Worte verschiedene<br />
Botschaften<br />
richtige Interpretation situationsspezifischer und emotionaler Signale<br />
wichtig für das Verständnis des Gesagten<br />
(hart) „Schauen Sie mich an ...“<br />
(weich) „Schauen Sie mich an ...“<br />
Bedeutung dieser Melodie wird gelernt<br />
→ notwendig, melodische Unterschiede erkennen zu können<br />
in DP: Lied singen
Rhythmisch-strukturierende Differenzierungsfähigkeit:<br />
Rhythmen strukturieren Raum und Zeit<br />
geben ihnen seriale Ordnung von vorher und nachher<br />
Sprache ist rhythmisch gegliedert<br />
→ sprachlicher Rhythmus bildet Verbindung zwischen sinnlich<br />
wahrnehmbaren Modalitäten und semantischer (inhaltlicher)<br />
rhythmische Differenzierungsfähigkeit wichtig für Behalten sprachlicher<br />
Inhalte → gliedert Wörter und Sätze
Unterschied:<br />
„Meine Mutter schläft“ = nicht irgendeine andere, sondern meine<br />
„Meine Mutter schläft“ = nicht mein Vater, Bruder oder Onkel,<br />
sondern meine Mutter<br />
„ Meine Mutter schläft“ = sie kocht, putzt und spült nicht<br />
„Schläft meine Mutter?“ = Frage<br />
Kinder mit Schwierigkeiten mit Rhythmisierung der Sprache<br />
schreiben u. U. „Amo“ statt „Oma“, weil sie als letzten und am<br />
stärksten betonten Buchstaben ein A hören und damit dann das<br />
Wort beginnen<br />
können sich nicht an Betonung orientieren<br />
in DP: Takt nachklatschen
Optische Differenzierungsfähigkeit:<br />
Voraussetzung für Sinnentnahme beim Lesen und Schreiben, dass<br />
optische Wahrnehmung und graphomotorische Wiedergabe der<br />
Buchstaben automatisiert wird<br />
Fähigkeit, verschiedene Zeichen sicher unterscheiden und wiedergeben<br />
zu können<br />
in DP buchstabenähnliche Zeichen richtig abzeichnen:<br />
╞ ├ │• С
Bielefelder Screening zur Früherkennung<br />
von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten<br />
(BISC)<br />
(Jansen, Mannhaupt, Marx, Skowronek 2002)
Theoretischer Hintergrund des BISC<br />
Annahme, dass Lese-Rechtschreibschwierigkeiten vor allem mit<br />
Schwierigkeiten bei Verarbeitung von gesprochener Sprache<br />
zusammenhängen<br />
→ phonologische Bewusstheit<br />
Zuordnung von Lauten zu Schriftzeichen (Phonem-Graphem-Zuordnung)<br />
erfordert Aufmerksamkeit auf formalen Aspekt der Sprachlaute zu richten<br />
und geeignete Merkmale zu unterscheiden<br />
→Inhalt tritt dabei in den Hintergrund<br />
Einsatz: 10 oder 4 Monate vor Schuleintritt
BISC überprüft 4 Bereiche:<br />
1. Phonologische Bewusstheit<br />
Vorschulkinder können:<br />
sprachliche Einheiten in Form von Silben<br />
Reimen<br />
betonten Vokalen analysieren<br />
→ zeigen i. R. gute Leistungen<br />
bei rhythmisch unterstützter Silbengliederung<br />
beim Vergleichen von Reimendungen zweier Wörter<br />
bei Entscheidung, ob sich langer Vokal in einem Wort, wenn Vokal und<br />
Wort kurz nacheinander dargeboten werden
im BISC Unterscheidung zwischen phonologischer Bewusstheit<br />
im weiteren und im engeren Sinne<br />
phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne knüpft an<br />
Sprachleistungen an, die Kinder von entsprechenden Spielen (Reimen,<br />
Silbenklatschen) kennen<br />
phonologische Bewusstheit im engeren Sinne erfordert Beachtung der<br />
Lautstruktur ohne konkrete rhythmische oder semantische Bezüge<br />
→ stärker mit Analyseleistungen verwandt, die für Schriftspracherwerb<br />
erforderlich
1. Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne<br />
2. Reimen =<br />
Wortpaare werden vorgegeben<br />
z. B. „Kind - Wind“<br />
„Kind - Stuhl“<br />
Klingt es ähnlich oder verschieden?<br />
Wörter von Cassette<br />
Anzahl der richtigen Lösungen<br />
8. Silben-Segmentieren =<br />
nacheinander werden Substantive vorgesprochen<br />
z. B. „Gabel“ oder „Federball“<br />
soll sie in Silben zerlegen, indem es sie klatscht<br />
Wörter kommen von Cassette<br />
Anzahl der richtigen Trennungen
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne<br />
9. Laut-zu-Wort-Vergleich =<br />
Kind soll entscheiden, ob ein isoliert vorgesprochener Vokal mit einem<br />
am Anfang eines Wortes vorkommenden Vokal klangähnlich ist<br />
z. B. „Hörst Du ein /i:/ in ‚Igel’ oder hörst du /i:/ in ‚Auto’?“<br />
Wörter von Cassette<br />
Anzahl der richtigen Entscheidungen
4. Laute-Assoziieren =<br />
für jedes Item eine Bildkarte mit vier Abbildungen vorgelegt<br />
z. B. Zange<br />
Pinsel<br />
Zebra<br />
Schlange<br />
ein Wort wird getrennt vorgesprochen<br />
z. B. /ts/-/ange/<br />
Kind soll genanntes Objekt Tafel zeigen und benennen<br />
(Zange und Schlange werden als richtig gewertet, weil sie<br />
klangähnlich sind)<br />
Wörter von Cassette<br />
<strong>Folie</strong>
2. Schneller Abruf aus dem Langzeitgedächtnis<br />
beim Lesen- und Schreibenlernen werden Verbindungen zwischen<br />
Lauten und Buchstaben gelernt und im Gedächtnis gespeichert<br />
Abruf dieser Verbindungen aus dem Gedächtnis wird zunehmend<br />
automatisiert<br />
→ Konzentration auf Inhalt des Gelesenen, nicht mehr mit Dekodierung<br />
beschäftigt<br />
bei Kindern mit Leseschwierigkeiten oft nur schwach ausgeprägte<br />
Repräsentationen dieser Laut-Buchstabe-Verbindungen<br />
→ können sie nicht so schnell abrufen wie gute Leser<br />
langsamerer Abruf zeigt sich auch beim Benennen von Bildobjekten,<br />
Zahlen, Farben<br />
im BISC: Grundfarben, weil fast allen Kindern bereits vor Schuleintritt<br />
vertraut<br />
<strong>Folie</strong>
5. Farbabfrage =<br />
Kind wird gesagt, ein Maler einen Salat, eine Tomate, eine Zitrone<br />
und eine Pflaume gemalt<br />
Kind soll die Farben benennen<br />
anschließend werden die Farben geübt<br />
Testdurchgang: so schnell wie möglich alle Farben in richtiger<br />
Reihenfolge nennen<br />
Anzahl der richtigen Farbnennungen<br />
<strong>Folie</strong>
6. Schnelles-Benennen-Farben (schwarz/weiß Objekte) =<br />
selbe Gemüse wie vorher, aber ohne Farbe<br />
→ wenn z. B. der Buchstabe /i/ gezeigt wird, muss eine bestimmte<br />
lautliche Einheit aus dem Gedächtnis abgerufen werden<br />
= lautlich-visuelle Verbindung<br />
→ wird bei Kindergartenkindern über Gemüse simuliert<br />
so schnell wie möglich die zugehörige Farbe nennen<br />
benötigte Zeit und Anzahl der richtigen Benennungen<br />
<strong>Folie</strong>
7. Schnelles-Benennen-Farben (farbig inkongruente Objekte) =<br />
Überprüfung der Störanfälligkeit beim Abrufen von Reizen<br />
beim Lesen muss der gerade zu lesende Buchstabe von anderen<br />
nichtrelevanten Reizen, z. B. Nachbarbuchstaben, abgeschirmt werden<br />
→ zu Gemüse, das in der falschen Farbe gezeigt wird, so schnell wie<br />
möglich die richtige Farbe nennen<br />
benötigte Zeit, Anzahl der richtigen Benennungen<br />
<strong>Folie</strong>
3. Phonetisches Rekodieren im Kurzzeitgedächtnis<br />
Lesen und Schreiben erfordern auch, dass Laute, Buchstaben,<br />
Wörter und größere semantische Einheiten kurzfristig im<br />
Arbeitsgedächtnis präsent gehalten werden können und ein<br />
fehlerfreier Abruf aus dem Kurzzeitgedächtnis möglich ist
1. Pseudowörter-Nachsprechen =<br />
Pseudowörter richtig nachsprechen<br />
→ kurzfristiges Behalten und Wiedergeben von unterschiedlich langen<br />
Silbenfolgen =<br />
Gedächtnisspanne<br />
Artikulationsgenauigkeit für unbekannte Begriffe<br />
z. B. „zippelzack“<br />
„bunitkonos“<br />
Wörter von Cassette<br />
Anzahl korrekt nachgesprochener Pseudowörter
4. Visuelle Aufmerksamkeitssteuerung<br />
Unterscheidung zwischen relevanten und irrelevanten Informationsanteilen<br />
aufmerksame Verarbeitung der Informationen<br />
z. B. Anzahl der Buchstaben in einem Wort überprüfen<br />
Reihenfolge der Buchstaben<br />
Raumlage der Buchstaben usw.<br />
als gesichert gilt, dass Zusammenhänge zwischen visuellem<br />
Aufmerksamkeitsverhalten und Lese- und Schreibschwierigkeiten NUR mit<br />
Schriftmaterial überprüft werden können
3. Wort-Vergleich-Suchaufgabe =<br />
Kind wird aufgefordert, sich Wort oben in Ruhe anzuschauen<br />
dann unten das Wort herauszusuchen, das genauso aussieht<br />
Anzahl richtig gezeigter Wörter, benötigte Zeit<br />
<strong>Folie</strong>
Basiskompetenzen für Lese-<br />
Rechtschreibleistungen ( BAKO 1-4)<br />
(Stock, Marx, Schneider 2003)
Theoretischer Hintergrund:<br />
orientiert an Theorie zum Schriftspracherwerb von Frith<br />
→ überprüft phonologische Bewusstheit als eine der Voraussetzungen<br />
für den Schriftspracherwerb bei deutschen Schülern<br />
da eine große Zahl „lese-rechtschreibschwacher Kinder im<br />
Grundschulalter ein gravierendes Defizit im phonologischen Bereich<br />
aufweist, das durch gezielte Förderung zu überwinden ist“<br />
(Manual S. 13)
Durchführung:<br />
Normen für die 2. Hälfte der 1. bis 4. Klasse<br />
Testdauer: ca. 20 bis 45 min.<br />
um Durchführungsobjektivität zu gewährleisten, kommen<br />
Wörter von einer CD<br />
Testmanual enthält ausführliche Durchführungshinweise für die<br />
einzelnen Untertests
Untertest 1: Pseudowortsegmentierung<br />
Kernaufgabe der phonologischen Bewusstheit<br />
Laute eines vorgesprochenen Wortes sollen einzeln aufgesagt werden<br />
Konsonantenhäufungen erhöhen die Schwierigkeit<br />
insgesamt 10 Items<br />
z. B. skop<br />
breta<br />
askletno
Untertest 2: Vokalersetzung<br />
[a] in einem Wort durch ein [i] ersetzen<br />
Erkennen der Vokale und Einsetzung neuer Vokale<br />
insgesamt 12 Items<br />
z. B. Mittag Mittig<br />
sugita sugiti<br />
alemaka ilemiki
Untertest 3: Restwortbestimmung<br />
Anlaut entfernen, am schwierigsten, wenn Konsonantencluster<br />
vorgegeben werden (bei 2 der 7 Items, 4 Items sind Pseudowörter)<br />
z. B. Ende nde<br />
Atlas tlas<br />
eksi ksi
Untertest 4: Phonemvertauschung<br />
erste beiden Laute eines vorgegebenen Wortes sind zu vertauschen<br />
gefordert korrekte Segmentierung des Wortanfangs und Verschmelzung<br />
der vertauschten Buchstabenfolge mit dem Wortrest<br />
hohe Anforderung an das Arbeitsgedächtnis<br />
5 der 11 Aufgaben sind Pseudowörter, 6 bestehen am Anfang aus einer<br />
Vokal-Konsonant-Kombination, was die Aufgabe zusätzlich erschwert<br />
z. B. Masse zu amsse<br />
ilma zu lima<br />
Monat zu omnat
Untertest 5: Lautkategorisierung<br />
Wort erkennen, das aufgrund des Anfangs- oder Endlautes nicht zu den<br />
anderen passt, Analyse ähnlicher Laute<br />
8 multiple-choice-Items, darunter 5 Pseudowortgruppen<br />
z. B. mib - mad - nob -mot<br />
grau - froh -Pfau -blau<br />
fük - mük - nüt -rük
Untertest 6: Vokallängenbestimmung<br />
aus einer Gruppe von Wörtern mit langem Vokal das mit kurzem<br />
heraushören oder umgekehrt<br />
z. B. maar - raas - dack - laat<br />
wuul - duck - tupp - pumm<br />
tiez - lick - gipp - piff
Untertest 7: Wortumkehr<br />
Wörter rückwärts wiedergegeben, Analyse wie Synthese der Wörter,<br />
Arbeitsgedächtnis<br />
18 Items, davon 10 Pseudowörter, von denen 4 nach der Umkehr ein<br />
richtiges Wort ergeben<br />
z. B. ral zu lar<br />
eman zu Name<br />
Osten zu netso
Testaufgaben zum Einstieg<br />
in die Schriftsprache<br />
(Probst o. J.)
• Aufgabensammlung<br />
• für Schulanfänger, die von Eltern oder Geschwistern schon<br />
erste Buchstaben usw. gelernt haben<br />
• auch für Kinder, die in der ersten oder zweiten Klasse durch<br />
schwache Leistungen in Deutsch auffallen<br />
• theoretischer Hintergrund: psycholinguistische Konzepte<br />
• nicht normiert aber standardisiert
Untertests:<br />
1. Wissen um Motiv zum Schreiben und Lesen<br />
1.1. Schriftsprachliche/graphische Tätigkeiten erkennen<br />
Bilder von Figuren gezeigt, die malen, lesen, schreiben usw.<br />
Kind soll sagen, was die tun<br />
→ werden Tätigkeiten unterschieden?<br />
<strong>Folie</strong><br />
1.2. Zweck der Schriftsprache, Motiv sie zu erlernen<br />
gefragt wird, warum das Kind glaubt, lesen und schreiben lernen zu<br />
sollen<br />
ABER Literalität des häuslichen Milieus
2. Verständnis des Zeichencharakters von Wort und Schrift<br />
a. Kind werden jeweils langes und kurzes Wort genannt<br />
z. B. „Kuh“ und „Piepvögelchen“<br />
„Streichholzschachtel“ und „Haus“<br />
Kind soll sagen, welches Wort länger ist<br />
→ Stufe des Wortrealismus<br />
b. Kind wird gefragt:<br />
„Wie würde ein Hund machen, wenn ich Kuh zu ihm sage?“<br />
→ Unterscheidung zwischen Gegenstand und Bezeichnung
3. Wortrepräsentation und Entsprechung zwischen Schreib- und<br />
„Sprechrichtung“ von links nach rechts<br />
Wissen, dass Wörter in dem Satz, der gezeigt und vorgelesen wird,<br />
von links nach rechts dastehen<br />
Satz wird vorgelesen<br />
→ Wo steht …?
4. Phonologische Bewusstheit<br />
4.1 Wörter mit gleichlautenden Anfangs-, Mittel- oder Endlauten erkennen<br />
z. B.: was klingt vorne/in der Mitte/am Ende gleich:<br />
„Boot, Rot, Bett“<br />
4.2 Klangbausteine/Reime erkennen<br />
reimt sich … auf Klaus? (vgl. DP)<br />
4.3 Rhythmische Differenzierung<br />
Rhythmen nachklatschen (vgl. DP)<br />
4.4 Wörter nach Silbenstruktur erkennen und rhythmisieren<br />
Tier benennen und Anzahl der Silben dabei mitklatschen<br />
→ Anzahl der Sprechimpulse in einem Wort<br />
<strong>Folie</strong>
5. Artikulation, kinästhetische Differenzierung<br />
„Bananenschale“<br />
„Lokomotive<br />
„Bushaltestelle“ nachsprechen<br />
6. Zugriff auf Grafisches/Schriftliches<br />
6.1. Logos erkennen/lesen<br />
alltägliche grafische Botschaften im Original, in schwarz-weiß, in<br />
einfacher Schrift<br />
<strong>Folie</strong><br />
6.2 Figuren mit topologischen Eigenschaften abzeichnen<br />
hier Smileys<br />
<strong>Folie</strong>
7. Inventar erster Schriftzeichen und Wörter<br />
7.1 Wörter schreiben<br />
alle Wörter aufschreiben, die Kind schon kennt<br />
7.2 Grapheme schreiben<br />
alle Buchstaben aufschreiben, die es schon kennt und sie benennen<br />
(lautiert oder buchstabiert das Kind?!)<br />
7.3 Erkennen/Erlesen von Graphemen und kleinen Wörtern<br />
Das Kind soll alle Buchstaben zeigen und benennen, die es kennt und<br />
dann ggf. die kleinen Wörter lesen<br />
<strong>Folie</strong>
8. Schriftsprachliche Fachausdrücke<br />
auf einer Buchseite<br />
Wort<br />
Buchstaben<br />
Satz<br />
Punkt etc. zeigen<br />
→ schriftsprachliche Fachausdrücke<br />
9. Sinnentnahme aus vorgelesener Geschichte<br />
Geschichte vorgelesen<br />
Kind soll erzählen, was da passiert
Inventar impliziter Rechtschreibregeln<br />
(Probst o. J.)
• überprüft grundlegende Rechtschreibkompetenzen<br />
Fähigkeit, sich korrekte Schreibung nicht geübter Wörter zu erschließen<br />
• ab Ende 1. Klasse Regelschule bis 4. Klasse<br />
ausdrücklich auch für Lernhilfeschüler etwa ab 5. Klasse<br />
Erwachsene mit deutlichen Rechtschreibproblemen<br />
Analphabeten<br />
• nicht normiert, aber standardisiert<br />
• Durchführungsdauer: schwache Schreiber zwei mal 45 Minuten<br />
Grundschüler 45 bis 60 Minuten
• Untertests in einer „dreischichtigen Pyramide“ hierarchisch geordnet<br />
<strong>Folie</strong><br />
• Fertigkeiten in den einfacheren Subtests bilden Voraussetzung<br />
zur korrekten Bearbeitung der schwierigeren<br />
→ struktur-niveauorientierten Diagnostik<br />
• Modell der strukturbezogenen oder qualitativen Diagnostik legt<br />
als Bezugssystem die „Sachlogik eines Lerngegenstandes und<br />
die Entwicklungslogik einer kognitiven Struktur“ (Probst 1979)<br />
zugrunde<br />
• Theorien aus Entwicklungspsychologie, Lerntheorie, fachdidaktische<br />
Überlegungen<br />
• Ziel der Diagnostik: aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes<br />
bzgl. einem konkreten Lerngegenstand zu erkennen
Theoretischer Hintergrund:<br />
Entwicklungsstand des Kindes steht bestimmte Sachstruktur des<br />
Lerngegenstandes, die bestimmte Einsichten erfordert, gegenüber<br />
→ Grundlage für Zone der nächsten Entwicklung<br />
vorausgesetzt wird, dass es etwas wie eine „gemeinsame <strong>Folie</strong><br />
der allgemeinen Entwicklung“ gibt<br />
→ jedes Kind soll dort abgeholt werden, wo es sich in seiner Entwicklung<br />
befindet
„Sachstruktur des Lerngegenstandes“ hier → Gesetzmäßigkeiten<br />
der Schriftsprache, linguistischer Zugang zu ihr<br />
ergänzt durch inneres Modell des Lerngegenstandes,<br />
das Lernende für sich konstruieren<br />
mit dem Zunehmen an Wissen immer weiter modifizieren<br />
Schriftspracherwerb = aktiver Prozess
Probst:<br />
keine einzelne Strategie (Graphem-Phonem-Korrespondenz,<br />
Ganzwortprinzip etc.) ermöglicht, orthographisch korrekt zu schreiben<br />
verschiedene Zugriffsweisen müssen integriert und angewendet werden<br />
IiR soll überprüfen, welche Zugriffsweisen bereits angewendet werden,<br />
welche noch vermittelt werden müssen<br />
schwierigster Untertest erfordert korrektes Schreiben noch unbekannter<br />
Pseudowörter (Nachnamen)<br />
→ Schreibung aus den Rechtschreibkonventionen zu erschließen<br />
= „orthographischer Freischwimmer“ (Probst)<br />
Vor- und Nachnamendiktat
Untertests im „Inventar impliziter Rechtschreibregeln“ von Probst<br />
Hierarchieebene 1:<br />
1. Sichtwortschatz (Erkennen richtiger Schreibweisen)<br />
12 Gruppen von jeweils vier Wörtern<br />
nur eins davon richtig geschrieben → soll gekennzeichnet werden<br />
Wörter kommen in meisten Leselehrgängen vor<br />
Untertest mit „Eisbrecherfunktion“<br />
<strong>Folie</strong><br />
Auswahl der Wörter so, dass nur visueller Zugriff zum richtige Ergebnis<br />
verhilft<br />
phonologische Rekodierung hilft nicht weiter<br />
maximal ein falsches Item, sonst Kriterium nicht erreicht
6. Reime/Signalgruppen<br />
14 Reimwörter, die häufig vorkommende Signalgruppe enthalten<br />
Reimwörter werden dazu diktiert, die nicht aus Grundwortschatz stammen<br />
Wort kann unter Übernahme der Signalgruppe geschrieben werden<br />
Kriterium: 11 Reimwörter richtig<br />
z. B. Hund - Mund<br />
<strong>Folie</strong><br />
Saft - Haft
2. Morpheme ersehen (visuelles Erkennen von Hauptmorphemen)<br />
in sinnvollem Text von 75 Wörtern kommt 18 mal Stammorphem<br />
„fahr“ bzw. „fähr“ vor<br />
auch in Großschreibung und im Wortinneren<br />
Text soll nicht unbedingt verstanden werden<br />
nicht jedes Mal an Wortstamm „fahr“ denken<br />
lediglich Wortteilgestalt visuell ausgliedern und kennzeichnen,<br />
nur visuelles Erkennen<br />
maximal 2 Fehler zulässig<br />
<strong>Folie</strong>
11. Groß- und Kleinschreibung<br />
12 Paare mit jeweils einem Verb oder Adjektiv und einem Substantiv<br />
Wort kennzeichnen, das groß geschrieben wird<br />
→ „der, die, das-Regel“ anwendbar<br />
Substantive überwiegend Lernwörter<br />
Kriterium: 11 von 12 richtig
Hierarchieebene 2:<br />
7. Silbentrennung<br />
Segmentierung in Sprechsilben<br />
4 lange Wörter von 5 und 6 Silben rhythmisch vorsprechen<br />
oder vorklatschen und Silben kennzeichnen, bei denen getrennt wird<br />
→ Klangeinheiten um Konsonanten und Vokale herum zur Orientierung<br />
Erkennen der Stellen, bei denen man beim Sprechen eine Pause machen<br />
kann, nicht orthographisch korrekte Trennung<br />
Kriterium: 18 von 20 Trennungen
5. Ableitungen<br />
zu vorgegebenen Substantiven Plural bilden,<br />
wobei Umlaut entsteht, wie in „Äpfel“<br />
gelingt nur, wenn Wortstamm berücksichtigt wird<br />
phonologisch wäre „Epfel“<br />
bei Singularbildung zu beachten, dass aus harten Konsonanten am Ende<br />
des Wortes, die man hört, ein weicher Konsonant gemacht werden muss<br />
z. B. aus „Rat“ -„Rad“<br />
Kriterium: 11 Ableitungsaufgaben richtig<br />
<strong>Folie</strong>
12. Affixe<br />
Stammmorphem, z. B. „-sicht“ vorgegeben<br />
muss durch Ergänzung eines Affixes zu neuem Wort gemacht<br />
werden, hier „Ge-sicht“<br />
→ Affixe als wiederkehrende konstante Elemente eines Wortes<br />
erkannt? meiste sind NICHT phonematisch herzuleiten<br />
z. B. „ver-“, ent-“ oder „-ig“<br />
Fehler bei Groß- und Kleinschreibung werden nicht berücksichtigt<br />
Veränderungen oder Hinzufügungen am Wortstamm als falsch gewertet<br />
„Verdursttet“ = 1 Punkt statt 2, „forsichttich“ = 0 Punkte<br />
Kriterium: 20 von 22 Affixen<br />
<strong>Folie</strong>
3. Diktat von Vornamen<br />
Vornamen unzweideutig strukturiert<br />
→ Prinzip Konsonant-Vokal<br />
phonetisch zu schreiben<br />
Länge- oder Kürzezeichen nicht als Fehler gewertet, solange Name<br />
klangtreu geschrieben<br />
z. B. „Tiena“, „Illona“<br />
Kriterium: maximal 1 Name falsch
8. Morpheme erhören<br />
Text mit insgesamt 18 mal dem Wortbaustein „fahr“ oder „fähr“ wird<br />
satzweise vorgelesen<br />
nach jedem Satz angeben, wie oft der Wortbaustein gehört wurde<br />
→ klangliches Erkennen eines konstanten Bausteins in<br />
unterschiedlichen Einbettungen<br />
Kriterium: 7 Morpheme von 18 richtig erkannt
9. Unterscheidung von Lang- und Kurzvokal<br />
9 Sätze vorgegeben, bei denen je ein Minimalpaar mit einem Lang-<br />
und einem Kurzvokal gegenübergestellt sind<br />
fehlenden Wörter als Lückendiktat diktiert<br />
Auswertung für Untertest 9: wurde der phonetische Unterschied<br />
überhaupt durch unterschiedliche Schreibung kenntlich gemacht<br />
verwendete Länge- und Kürzezeichen müssen nicht normgerecht sein<br />
z. B. „Das Lam ist laam“ oder „Das Lam ist lahm“ ergibt 1 Punkt<br />
Kriterium: 8 von 9 Sätzen<br />
<strong>Folie</strong>
Hierarchieebene 3:<br />
4. Diktat von Nachnamen<br />
Nachnamen nicht klangtreu zu schreiben<br />
→ Repräsentanten der wichtigsten Klangbausteine zur Markierung<br />
von Lang- und Kurzvokalen<br />
→ häufige Nomensuffixe (=Nachsilbe)<br />
Kriterium: maximal ein Name falsch
10. Länge- und Kürzezeichen<br />
Wörter von Untertest 9 mit orthographisch korrekt<br />
wiedergegebenen Länge- und Kürzezeichen<br />
Kriterium: 16 von 18 orthographisch korrekt