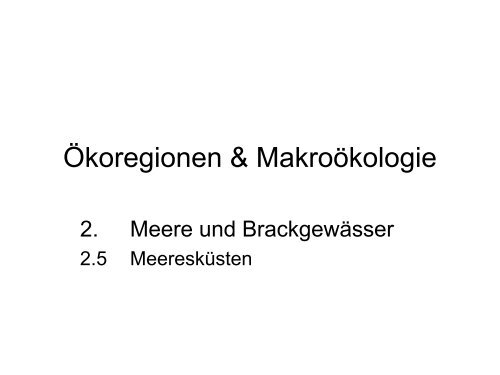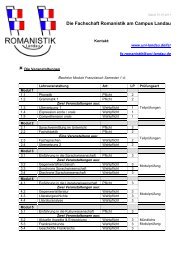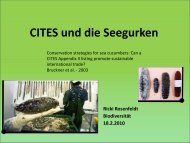Ökoregionen & Makroökologie
Ökoregionen & Makroökologie
Ökoregionen & Makroökologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Ökoregionen</strong> & <strong>Makroökologie</strong><br />
2. Meere und Brackgewässer<br />
2.5 Meeresküsten
Zonierung des Litorals<br />
Aus Janke et al. 1990<br />
MSpThw =<br />
Mittleres<br />
Springtidenhochwasser<br />
MNThw =<br />
Mittleres<br />
Nipptidenhochwasser<br />
MNTnw =<br />
Mittleres<br />
Nipptidenniedrigwasser<br />
MSpTnw =<br />
Mittleres<br />
Springtidenniedrigwasser
Wirkende Kräfte<br />
Brandung Felsküste<br />
Ablagerung von Schlick<br />
(Ton & org. Material)<br />
Verlagerung durch<br />
Strömung<br />
Marschen, Mangroven<br />
Sandstrand<br />
Zerkleinerung des Materials:<br />
Blöcke→Geröll→Kies→Sand<br />
Verlagerung durch<br />
Wind<br />
Küstendünen
Anpassungen von Organismen in der<br />
Gezeitenzone<br />
• Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen<br />
• Toleranz gegenüber Änderungen des Salzgehalts<br />
– poikilosmotisch (Strandschnecke, Seepocken)<br />
– homoiosmotisch: Hypertonieregulation (Schnecken marinen Ursprungs,<br />
Enchytraeiden, Krebse), Hypo- und Hypertonieregulation<br />
(Strandkrabben, Asseln, Amphipoden, landlebende Arthropoden)<br />
• Schutz vor UV-Strahlung<br />
• Gewährleistung der Sauerstoffversorgung<br />
– Kiemenatmer: Feuchthalten der Kiemen<br />
– Landtiere: Überdauerung in luftgefüllten Spalten, Herabsetzung des<br />
Sauerstoffverbrauchs<br />
• Anpassungen gegenüber Dichteänderungen
Biologischer Rhythmik<br />
Aus Tischler 1993<br />
Zeitgeber:<br />
• Tageslicht (24 h)<br />
• Mond (14,7 d)<br />
• Gezeiten (12,4 h)
Horn & Gibson 1991<br />
Felsküsten
Felsküsten<br />
Eulitoral: Zone zw. Hoch- und Niedrigwasser<br />
• Vertikale Zonierung (ausgeprägt im gemäßigten Klima): Trockenheit, hohe<br />
Temperaturen, Besonnung, Wellenschlag<br />
Braunalgen<br />
Seepocken<br />
Sublitoral Eulitoral Supralitoral<br />
• Horizontale Verteilung (Lage zum Aufprall des Wassers): Felslücken,<br />
Anhäufung von Detritus, Sukzession<br />
• Konkurrenz und Feinde<br />
Biotische Faktore<br />
Abiotische Faktore
Smith & Smith 2009
Supralitoral:<br />
• Spritzone:<br />
Felsküsten<br />
– nur gelegentlich von Springtiden überflutet<br />
– Meeres- und Landbewohner<br />
– starke Windeinwirkung, salzhaltige Luft,<br />
Wasserspritzer, Schwankungen der Temperatur &<br />
Luftfeuchte<br />
• Steilwände und Felsinseln:<br />
– Brutplätze für Vögel
Sandstrand und Küstendünen<br />
Aus Janke et al. 1990<br />
• Prallhang mit bewegtem und<br />
durchspülten Sand<br />
• Farbstreifen-Sandwatt<br />
– graugelb: Umlagerung<br />
– blaugrün: Cyanobakterien<br />
– rot: Schwefelpurpurbakterien<br />
– schwarz: Desulfurikanten<br />
• Zone des Strandanwurfs<br />
• trockener Innenstrand und<br />
Dünen
Aus Tischler 1993<br />
Psammon:<br />
• Meso-/Mikropsammon (< 5 mm):<br />
Nematoden, Turbellaria,<br />
Anneliden, Krebse,<br />
Gnathostomulida, Gastrotricha,<br />
Loricifera, Tardigrada,<br />
Meeresmilben, Nacktschnecken,<br />
Zwergmedusen, Mosstierchen,<br />
Protozoen<br />
• Import von Detritus und Plankton<br />
als Nahrungsgrundlage<br />
• hohe Individuendichte (2000<br />
Ind./100 cm³)
Marschküsten: Watt<br />
Aus Janke et al. 1990<br />
• Schwemmland aus Sedimenten<br />
feinster Mineralteilchen & org.<br />
Partikel<br />
• Eintrag von Plankton<br />
• nährstoffreich<br />
• Verlandung → Salzwiesen<br />
• Boden-Typ<br />
– Sandwatt (> 1% org. Anteil)<br />
– Sand-Schlickwatt<br />
– Schlickwatt (5 – 10 % org. Anteil)
Beispiel: Wattenmeer<br />
• Ca. 450 km<br />
Küstenlänge<br />
• 3500 km²<br />
Wattfläche<br />
• Entstehung<br />
vor ca. 4000<br />
Jahren<br />
Tardent 1993
Beispiel:<br />
Wattenmeer<br />
Reise 1991
Biotische<br />
Faktoren<br />
Tardent 1993
Biotische Faktoren<br />
Aus Janke et al. 1990
Biotische<br />
Faktoren<br />
Wattwurm (Arenicola marina)<br />
Reise 1991
Einflüsse des Menschen:<br />
Deichbau & Landgewinnung<br />
• Umwandlung der<br />
Überschwemmungsflächen<br />
in<br />
Weiden und Äcker<br />
• Verlust von 80 %<br />
der Salzwiesenflächen<br />
seit 1600<br />
Reise 1991
Landgewinnung im Bereich der westfriesischen Inseln<br />
1 km
Einflüsse des Menschen:<br />
Deichbau & Landgewinnung<br />
Folgen:<br />
• Verminderung des Eintrags von pflanzlichem Detritus<br />
aus den Salzwiesen<br />
• Verstärkte Umlagerung von Sedimenten<br />
Vertiefung & Erweiterung der Priele und Baljen<br />
Verlagerung der Außensande und Barrieren-Inseln landwärts<br />
• Verlust an Brackwasser- und Salzwiesenarten<br />
• Zunahme der filtrierenden Muscheln; Rückgang der<br />
Detritusfresser<br />
• Vordringen von Arten der tieferen Nordsee; Rückgang<br />
von Flachwasserarten
Einflüsse des Menschen:<br />
Veränderung der Artengemeinschaft<br />
Rückgang & Aussterben:<br />
Europäischer Stör<br />
(Acipenser sturio)<br />
Nagelrochen (Raja clavata)<br />
Sandröhrenwurm (Sabellaria alveolata & S. spinulosa)<br />
Europäische Auster<br />
(Ostrea edulis)
Einflüsse des Menschen:<br />
Veränderung der Artengemeinschaft<br />
Neubesiedlung: Anteil der Neozoen am Gesamtartenbestand 3 – 10 %<br />
Nehring & Leuchs 1999
Einflüsse des Menschen:<br />
• Phosphat- und Nitrat<br />
• Öl<br />
Nähr- & Schadstoffe<br />
Zunahme der Planktonproduktion Sauerstoffmangel bei<br />
geschichtetem Wasser<br />
Zunahme der Miesmuschelbänke<br />
Zunahme algenfressender Schnecken und anderer Bodentiere<br />
Zunahme fädiger Grünalgen (G. Enteromorpha) <br />
Sauerstoffmangel im Boden<br />
• Schwermetalle<br />
• chlorierte Kohlenwasserstoffe (z.B. polychlorierten<br />
Biphenyle, PCB), polyzyklische aromatische<br />
Kohlenwasserstoffe (PAK oder PAH)<br />
• Tributylzinn (TBT)
Einflüsse des Menschen:<br />
• Phosphat- und Nitrat<br />
• Öl<br />
Nähr- & Schadstoffe<br />
Zunahme der Planktonproduktion Sauerstoffmangel bei<br />
geschichtetem Wasser<br />
Zunahme der Miesmuschelbänke<br />
Zunahme algenfressender Schnecken und anderer Bodentiere<br />
Zunahme fädiger Grünalgen (G. Enteromorpha) <br />
Sauerstoffmangel im Boden<br />
• Schwermetalle<br />
• chlorierte Kohlenwasserstoffe (z.B. polychlorierten<br />
Biphenyle, PCB), polyzyklische aromatische<br />
Kohlenwasserstoffe (PAK oder PAH)<br />
• Tributylzinn (TBT)<br />
Reise 1991
Einflüsse des Menschen:<br />
Schaumbildung an Brandungsstränden<br />
durch gallertbildende<br />
Planktonalge (Phaeocystis globosa)<br />
Nähr- & Schadstoffe<br />
Fädige Grünalgen (G. Enteropmorpha)
Marschküsten: Salzwiesen<br />
Aus Janke et al. 1990<br />
• Entstehung aus Watt (Erstbesiedler Queller<br />
Salicornia & Schlickgräser Spartina)<br />
• Salzregulation der Halophyten:<br />
– selektive Salzaufnahme<br />
– Abwerfen von Blättern mit salzgesättigter<br />
Lösung in den Vakuolen<br />
– Salzablagerungen in den Vakuolen der<br />
Sprosse<br />
– Abscheidung von überschüssigem Salz aus<br />
epidermalen Drüsen<br />
– Sukkulenz<br />
• Hohe Produktion, geringer Anteil an<br />
Konsumenten
Marschküsten:<br />
Salzwiesen
Mangroven • trop. und subtrop.<br />
Gezeitenwälder an<br />
Küsten mit<br />
Schwemmland („trop.<br />
Marschküsten“)<br />
• bis zu 30 m hohen,<br />
immergrünen<br />
Bäumen und bis zu 2<br />
m hohen Sträuchern<br />
(obligate Halophyten)<br />
• Lebensräume<br />
– Flussmündungsmangroven<br />
– Küstenmangroven<br />
– Riffmangroven<br />
Aus Tischler 1993
Keimung:<br />
• Viviparie<br />
• Kryptviviparie<br />
Anpassungen der Pflanzen<br />
Wurzelatmung:<br />
• Stelzwurzeln<br />
• Luftwurzeln<br />
• Lentizellen mit feinen Öffnungen, die Endringen von Wasser<br />
verhindern<br />
Anpassungen an den Salzgehalt:<br />
• Einschränkung der Transpiration<br />
• Ultrafiltration<br />
• Erhöhung der Saugkräfte durch Salzspeicherung in den Vakuolen<br />
• Eliminierung von Salz durch abfallende Blätter oder<br />
Salzausscheidung („Salzdrüsen“)
Verbreitung<br />
Region Fläche in km² (Anteil an<br />
Gesamtfläche)<br />
Süd- und Südostasien 75.000 (42 %)<br />
Australasien 19.000 (10 %)<br />
Nord- und Südamerika 49.000 (27 %)<br />
Westafrika 28.000 (16 %)<br />
Ostafrika und Mittlerer Osten 10 000 (6%)<br />
Gesamt 180.000
Verbreitung<br />
www2.tu-berlin.de/~kehl/
Bedrohungen<br />
• > 50 % der Mangroven bereits verschwunden<br />
• Ursachen:<br />
– Umwandlung in Plantagen<br />
– Trockenlegung<br />
– Zuchtfarmen für Shrimps<br />
– Holzgewinnung<br />
• Folgen:<br />
– Rückgang der Fischbestände<br />
– Verschlammung von Riffen<br />
– Fehlende Produktion<br />
– Fehlender Küstenschutz
Nettoprimärproduktion ausgewählter<br />
Lebensräume<br />
Ökosystem Nettoprimär-produktion<br />
(kg•m - ²•a -1 )<br />
Eintrag<br />
(kg•m- ²•a-1 )<br />
Wattenmeereulitoral 0,2 bis zu 0,2<br />
Salzwiesen 0,2-1,9 bis zu 1,5<br />
Seegrasbestände 0,4-0,6<br />
Großalgenbestände bis zu 4,0
<strong>Ökoregionen</strong> & <strong>Makroökologie</strong><br />
2. Meere und Brackgewässer<br />
2.6 Ästuarien und andere Brackgewässer
Typen von Brackwässern<br />
1. Meere, die noch eine schmale Verbindung zu den<br />
Ozeanen haben (Ostsee, Schwarze Meer) oder in<br />
früheren Zeiten hatten (Kaspische Meer, Aralsee)<br />
2. Brackwässer im Küstenbereich mit geringer oder<br />
fehlender Strömung (Fjorde, Lagunen, Strandtümpel)<br />
3. Brackwässer mit starker Strömung in den<br />
Mündungsgebieten der Flüsse (Ästuarien)<br />
4. Unterirdisches Küstengrundwasser<br />
5. Brackwasser im Binnenland (Salzquellen,<br />
Brackwassersümpfe, brackige Seen)
Ästuarien<br />
• trichterförmig erweiterte<br />
Flussmündung<br />
• Einfluss der<br />
Gezeitenströme<br />
• Übergang Süßwasser<br />
zum Salzwasser<br />
• hoher Gehalt importierter<br />
Schwebstoffe<br />
• z.B. Nördliche<br />
Amazonasmündung
Physikalische & chemische<br />
Eigenschaften: Salzgehalt<br />
• polyhalin (3,0-1,8 %)<br />
• α-mesohalin (1,8-0,8 %)<br />
• β-mesohalin (0,8-0,3 %)<br />
• oligohalin (0,3-0,05 %)
Physikalische & chemische<br />
Eigenschaften: Salzgehalt<br />
Erhöhung des Salzgehalts durch:<br />
• Meerwasser<br />
• Lösung von Salzen aus dem Untergrund<br />
• Verdunstung<br />
Erniedrigung des Salzgehalts durch:<br />
• Einfluss von Süßwasser<br />
• Schmelzwässer<br />
• Infiltration von Grundwasser<br />
• Niederschläge
Physikalische & chemische<br />
Eigenschaften: Sauerstoff<br />
• meist gute O 2-Versorgung<br />
• bei stabiler Schichtung tiefere Schichten häufig O 2–<br />
Armut aufgrund von:<br />
– geringem vertikalen Austausch<br />
– hoher biologischer Aktivität<br />
– niedriger Durchflussrate<br />
• Substrat extrem O 2–arm:<br />
– viel organisches Material, hohe biologischer Aktivität<br />
– geringer Austausch
Temperatur<br />
Physikalische & chemische<br />
Eigenschaften<br />
• zeitlich (tageszeitlich, saisonal) und räumlich (horizontal,<br />
vertikal) variabel:<br />
– rasches Aufheizen durch Sonne<br />
– Temperaturunterschiede von Fluss- und Meerwasser<br />
– Schichtungsverhältnisse<br />
Trübung<br />
• Fracht suspendierter Partikel meist hoch<br />
• geringe Lichtdurchflutung, führt zu geringer Primärproduktion
Substrat<br />
Physikalische & chemische<br />
Eigenschaften<br />
• schlammige oder sandige Sedimente sowie ausgeflockte<br />
Suspensionspartikel<br />
• hoher Anteil an organischem Material<br />
Strömung<br />
• wechselnde Strömungen durch Ebbe und Flut<br />
• meist schwache Wellenbewegung
Brackwasser als Lebensraum<br />
• Euryhaline Arten:<br />
– Vorkommen in Süß-, Brack- und Meerwasser<br />
– Respirationsrate vom Salzgehalt unabhängig<br />
– meist Arten mit limnischen Ursprung, einige Arten mit marinem<br />
Ursprung, zyklisch euryhaline Arten (katadrome und anadrome<br />
Tiere)<br />
• Limnische Arten<br />
– meist empfindlich gegen Salzwasser (nur wenige Arten bei > 1,8<br />
% Salzgehalt)<br />
– Erniedrigung der Respirationsrate im Brackwasser<br />
• Marine Arten<br />
– für meiste Arten 1,8 % Salzgehalt untere biol. Grenze<br />
– Erhöhung der Respirationsrate im Brackwasser<br />
• Spez. Brackwasserarten<br />
– überwiegend oder ausschließlich im Brackwasser<br />
– meist Arten mit stammesgeschichtlich marinen Ursprung
Artenzusammensetzung<br />
Aus Tischler 1993
Besonderheiten der<br />
Lebensgemeinschaft<br />
• Artenarmut:<br />
– rel. artenarm, jedoch reich an Individuen<br />
• Abnahme der Körpergröße<br />
– häufig geringere Körpergrößen, z.B. Nesseltiere, Mollusken,<br />
Echinodermata, Fische<br />
• Abweichung der Form<br />
– Änderungen der Struktur, z.B. Rotalgen, Nesseltiere<br />
• Abweichung in Entwicklung & Fortpflanzung<br />
– verzögerte Entwicklung und Wachstum bei euryhalinen Organismen<br />
– Sterilität, z.B. bei Algen, Seegras, Seestern, Polychaet<br />
• Mischcharakter<br />
– Lebensgemeinschaften aus limnischen und marinen Arten<br />
– Verknüfung unterschiedlicher Lebensräume<br />
• Nahrungsbeziehungen<br />
– viele Arten polytroph<br />
– lange und umfangreiche Nahrungsnetze
Aus Tischler 1993<br />
Mischcharakter des<br />
Lebensraumes<br />
Verzahnung der Brackwasserlebewelt mit<br />
der umgebenden Landschaft am Beispiel<br />
von Meeresvögeln, die im Bereich der<br />
salinen Lagunenzone brüten.
Ökologische Anpassungen<br />
Morphologie<br />
• Tiere:<br />
– Anpassungen an Leben im Schlamm (z. B.<br />
Haarsäume um Eingänge der<br />
Atmungsorgane)<br />
• Gefäßpflanzen:<br />
– Aerenchym zur O2 – Versorgung der Wurzel<br />
– hoher Lignin – Gehalt
Ökologische Anpassungen<br />
Physiologie<br />
• Tiere:<br />
– Osmokonformer (poikiloosmotische Tiere): Anpassung des<br />
Salzgehalt der Körperflüssigkeiten an umgebendes Wasser<br />
– Osmoregulatoren (homoiosmotische Tiere):<br />
Aufrechterhaltung des internen Salzgehalts unabhängig vom<br />
umgebenden Wasser (z.B. durch Ausscheidung über<br />
Kiemen, Salzdrüsen, bluthyperosmotischen Harn)<br />
• Gefäßpflanzen:<br />
– Erhöhung der Ionenkonzentration in den Wurzeln<br />
– Drüsen zur Salz - Exkretion<br />
– Einlagerung von Salzen in Blätter und deren Abwurf
Verhalten<br />
Ökologische Anpassungen<br />
• Vergraben im Schlamm:<br />
– geringere Schwankungen von Salinität und<br />
Temperatur<br />
– Schutz vor Fressfeinden<br />
• Wanderungsmuster:<br />
– Verlagerung empfindlicher Stadien (Eier,<br />
Jungtiere) ins offene Meer (einige Krabben-Arten)<br />
– Nutzung der futterreichen und sicheren Ästuare<br />
als Kinderstuben (viele Fisch-Arten)
Stoff- und Energieflüsse<br />
Primärproduktion<br />
• sehr hohe Produktivität: bis 20 000 kcal / m 2 * a<br />
• systeminterne Primärproduzenten: v.a. Algen und<br />
bodenlebende Diatomeen, Phytoplankton,<br />
Seegras<br />
• externe Quellen organischen Materials:<br />
Salzmarschen, Fluss, Meer<br />
• große Menge an Detritus (Schweb- / Sinkstoffe):<br />
bis zu 100 mg / l (Meerwasser: 1- 3 mg / l)
Stoff- und Energieflüsse
Nahrungsnetze<br />
Stoff- und Energieflüsse<br />
• großer Nahrungsreichtum<br />
• komplexe Netze durch Eurytrophie und interspezifischen<br />
Verknüpfungen<br />
• unvollkommene Energienutzung<br />
• wesentliche Glieder der Nahrungskette:<br />
– Detritus (und Bakterien)<br />
– Primärproduzenten: Algen, Phytoplankton, Diatomeen<br />
– detritusfressende und filtrierende Organismen (z. B. Muscheln,<br />
Krebse, Borstenwürmer)<br />
– Prädatoren (Fische, Vögel)