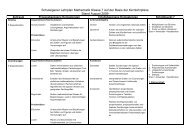Physik - Realschule am Jungbornpark
Physik - Realschule am Jungbornpark
Physik - Realschule am Jungbornpark
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grundsätze<br />
I Vorwort<br />
für den<br />
Städt. <strong>Realschule</strong> Moers<br />
<strong>Realschule</strong> <strong>am</strong> <strong>Jungbornpark</strong><br />
Sekundarstufe I<br />
<strong>Physik</strong>unterricht<br />
1<br />
Stand: Oktober 2011<br />
Grundlage sind die Richtlinien und Kernlehrpläne für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen für<br />
das Fach <strong>Physik</strong> vom 07.07.2011.<br />
Kernlehrplan des Faches <strong>Physik</strong> stellt das Abschlussprofil <strong>am</strong> Ende der Sekundarstufe I fest.<br />
Er ordnet Kompetenzerwartungen an, die als Zwischenstufen <strong>am</strong> Ende bestimmter<br />
Jahrgangsstufen erfüllt sein müssen.<br />
Der schulinterne Lehrplan <strong>Physik</strong> stellt eine durch Beschlüsse der Fachkonferenz bindende<br />
Darstellung von Lernzielen, Inhalten, Methoden und Leistungsbewertungen im Fach <strong>Physik</strong> an<br />
der <strong>Realschule</strong> <strong>am</strong> <strong>Jungbornpark</strong> dar und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die<br />
Schülerinnen und Schüler die angestrebten Kompetenzen erreichen.<br />
Im Sinne einer Schülerorientierung, Weiterentwicklung und zu Gunsten des Aktualitätsbezuges<br />
muss die Auswahl der die obligatorischen Lernziele vermittelnden Inhaltsschwerpunkte sowie<br />
zugehöriger Versuche und Medien variabel bleiben.<br />
Die Stoffverteilung auf die Jahrgangsstufen ist variabel, da der Unterricht nicht durchgängig<br />
zwei Wochenstunden umfasst.<br />
Die Reihenfolge der Themen kann für einzelne Jahrgänge variieren, ebenso der zeitliche<br />
Umfang.<br />
Die eingeführten Schulbücher sind Cornelsen Natur und Technik <strong>Physik</strong>.<br />
II Inhaltsübersicht<br />
1. Allgemeine Aufgaben und Ziele des <strong>Physik</strong>unterrichts<br />
2. Didaktische Konzeption<br />
3. Basiskonzepte in der <strong>Physik</strong><br />
4. Fachübergreifende Vernetzung<br />
5. Übergeordnete Kompetenzbereiche des Faches <strong>Physik</strong><br />
6. Förderung der deutschen Sprache<br />
7. Gesundheitsförderung<br />
8. Berufsorientierung<br />
9. Leistungsbewertung<br />
10. Qualitätssicherung und Evaluation<br />
11. Laborordnung<br />
12. Stoffverteilungsplan<br />
12.1. Schuleigener Lehrplan <strong>Physik</strong> 5,6<br />
12.2. Schuleigener Lehrplan <strong>Physik</strong> 7,8<br />
12.3. Schuleigener Lehrplan <strong>Physik</strong> 9,10<br />
1 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, Endfassung, 07.07.2011<br />
1
1. Allgemeine Aufgaben und Ziele des <strong>Physik</strong>unterrichts<br />
• Der <strong>Physik</strong>unterricht vermittelt die Fähigkeit grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Natur zu<br />
erkennen und zu erklären, Zus<strong>am</strong>menhänge in natürlichen und technischen Phänomenen<br />
zu modellieren und die Modelle und ihre Prognosen durch Experimente und Messungen zu<br />
überprüfen.<br />
• Der <strong>Physik</strong>unterricht hilft den Schülerinnen und Schülern, ein grundlegendes physikalisches<br />
Verständnis ihrer Lebenswelt zu gewinnen, insbesondere in Bezug zur Bewältigung<br />
technischer Alltagsprobleme.<br />
• Der <strong>Physik</strong>unterricht zeigt Möglichkeiten auf, besondere technische und natürliche<br />
Phänomene zu erkunden und physikalische Modelle zur Erklärung zu nutzen.<br />
2. Didaktische Konzeption<br />
Die Themen des <strong>Physik</strong>unterrichts müssen sich in ihrer Formulierung zwar weitgehend auf<br />
physikalische Sachverhalte wie Phänomene und Gesetze beziehen, andere über die<br />
Fachwissenschaft hinausgehende Aspekte wie technische-, ethische-, ästhetische-,<br />
ökologische-, wirtschaftliche- und gesellschaftliche Aspekte sollen auch thematisiert und an<br />
geeigneten Stellen im Unterricht eingebunden werden.<br />
3. Basiskonzepte in der <strong>Physik</strong><br />
Basiskonzepte beinhalten zentrale, aufeinander bezogene Begriffe, Modellvorstellungen und<br />
Prozesse sowie d<strong>am</strong>it verknüpfte Handlungsmöglichkeiten. Als Konzepte eigenen sie sich<br />
besonders gut zur Vernetzung des Wissens. Sie ermöglichen auch, Sachverhalte<br />
situationsübergreifend aus bestimmten Perspektiven anzugehen.<br />
Basiskonzepte sind: „System“, „Struktur der Materie“ und „Energie“.<br />
4. Fachübergreifende Vernetzung<br />
Die Schülerinnen und Schüler können erworbene Kompetenzen und Erkenntnisse in der<br />
Auseinandersetzung mit komplexen Zus<strong>am</strong>menhängen, auch in Verbindung mit anderen<br />
Fächern, vernetzen.<br />
<strong>Physik</strong> als naturwissenschaftliches Fach zeigt vielfältige Berührungspunkte zum Fach<br />
Mathematik, z.B. die Nutzung einer Tabellenkalkulation, das Anfertigen von Diagr<strong>am</strong>men oder<br />
Modellierungen naturwissenschaftlicher Zus<strong>am</strong>menhänge.<br />
Einige Basiskonzepte ermöglichen die Vernetzung der Fächer untereinander.<br />
• Basiskonzept „Struktur der Materie“ (<strong>Physik</strong>-Chemie): Einfache Beschreibungen der<br />
Stoffeigenschaften, Modelle des elektrischen Ladungstransports, Atommodelle, Modelle<br />
des Aufbaus von Materie.<br />
• Das Basiskonzept „System“ (<strong>Physik</strong>-Biologie): Unterschiedliche, aber sich ergänzende und<br />
nicht gegensätzliche Gesichtspunkte.<br />
2
5. Übergeordnete Kompetenzbereiche des Faches <strong>Physik</strong><br />
2<br />
Das naturwissenschaftliche Fach „<strong>Physik</strong>“ befähigt die Schülerinnen und Schüler den Erwerb von Kompetenzen, die in vier Bereiche unterteilt<br />
sind: „Umgang mit Fachwissen“, „Erkenntnisgewinnung“, „Kommunikation“ und „Bewertung“.<br />
• Kompetenzbereich „Umgang mit Fachwissen“<br />
Schülerinnen und Schüler können…<br />
UF1: Fakten wiedergeben und Phänomene und Vorgänge mit einfachen physikalischen Konzepten beschreiben und erläutern.<br />
erläutern<br />
UF2: Konzepte unterscheiden bei der Beschreibung physikalischer Sachverhalte Fachbegriffe angemessen und korrekt verwenden.<br />
und auswählen<br />
UF3: Sachverhalte ordnen und physikalische Objekte und Vorgänge nach vorgegebenen Kriterien ordnen.<br />
strukturieren<br />
UF4: Wissen vernetzen Alltagsvorstellungen kritisch infrage stellen und gegebenenfalls durch physikalische Konzepte ergänzen oder<br />
ersetzen.<br />
• Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“<br />
Schülerinnen und Schüler können…<br />
E1: Fragestellungen erkennen physikalische Fragestellungen von anderen Fragestellungen unterscheiden.<br />
E2: Bewusst wahrnehmen Phänomene nach vorgegebenen Kriterien beobachten und zwischen der Beschreibung und der Deutung einer<br />
Beobachtung unterscheiden.<br />
E3: Hypothesen entwickeln Vermutungen zu physikalischen Fragestellungen mit Hilfe von Alltagswissen und einfachen fachlichen Konzepten<br />
begründen.<br />
E4: Untersuchungen und<br />
Experimente planen<br />
vorgegebene Versuche begründen und einfache Versuche selbst entwickeln.<br />
E5: Untersuchungen und Untersuchungsmaterialien nach Vorgaben zus<strong>am</strong>menstellen und unter Beachtung von Sicherheits- und<br />
Experimente durchführen Umweltaspekten nutzen.<br />
E6: Untersuchungen und Beobachtungen und Messdaten mit Bezug auf eine Fragestellung schriftlich festhalten, daraus<br />
Experimente auswerten<br />
Schlussfolgerungen ableiten und Ergebnisse verallgemeinern.<br />
E7: Modelle auswählen und einfache Modelle zur Veranschaulichung physikalischer Zus<strong>am</strong>menhänge beschreiben und Abweichungen der<br />
Modellgrenzen angeben<br />
Modelle von der Realität angeben.<br />
E8: Modelle anwenden physikalische Phänomene mit einfachen Modellvorstellungen erklären.<br />
E9: Arbeits- und Denkweisen<br />
reflektieren<br />
in einfachen physikalischen Zus<strong>am</strong>menhängen Aussagen auf Stimmigkeit überprüfen.<br />
2 Zitat: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, Endfassung, 07.07.2011<br />
3
• Kompetenzbereich „Kommunikation“<br />
Schülerinnen und Schüler können…<br />
K1: Texte lesen und erstellen altersgemäße Texte mit physikalischen Inhalten Sinn entnehmend lesen und sinnvoll zus<strong>am</strong>menfassen.<br />
K2: Informationen identifizieren relevante Inhalte fachtypischer bildlicher Darstellungen wiedergeben sowie Werte aus Tabellen und einfachen<br />
Diagr<strong>am</strong>men ablesen.<br />
K3: Untersuchungen<br />
bei Untersuchungen und Experimenten Fragestellungen, Handlungen, Beobachtungen und Ergebnisse<br />
dokumentieren<br />
nachvollziehbar schriftlich festhalten.<br />
K4: Daten aufzeichnen und Beobachtungs- und Messdaten in Tabellen übersichtlich aufzeichnen und in vorgegebenen einfachen<br />
darstellen<br />
Diagr<strong>am</strong>men darstellen.<br />
K5: Recherchieren Informationen zu vorgegebenen Begriffen in ausgewählten Quellen finden und zus<strong>am</strong>menfassen.<br />
K6: Informationen umsetzen auf der Grundlage vorgegebener Informationen Handlungsmöglichkeiten benennen.<br />
K7: Beschreiben, präsentieren, physikalische Sachverhalte, Handlungen und Handlungsergebnisse für andere nachvollziehbar beschreiben und<br />
begründen<br />
begründen.<br />
K8: Zuhören, hinterfragen bei der Klärung physikalischer Fragestellungen anderen konzentriert zuhören, deren Beiträge zus<strong>am</strong>menfassen<br />
und bei Unklarheiten sachbezogen nachfragen.<br />
K9: Kooperieren und im Te<strong>am</strong> mit einem Partner oder in einer Gruppe gleichberechtigt, zielgerichtet und zuverlässig arbeiten und dabei<br />
arbeiten<br />
unterschiedliche Sichtweisen achten.<br />
• Kompetenzbereich „Bewertung“<br />
Schülerinnen und Schüler können…<br />
B1: Bewertungen an Kriterien in einfachen Zus<strong>am</strong>menhängen eigene Bewertungen und Entscheidungen unter Verwendung physikalischen<br />
orientieren<br />
Wissens begründen.<br />
B2: Argumentieren und Position<br />
beziehen<br />
bei gegensätzlichen Ansichten Sachverhalte nach vorgegebenen Kriterien und vorliegenden Fakten beurteilen.<br />
B3: Werte und Normen<br />
Wertvorstellungen, Regeln und Vorschriften in physikalisch-technischen Zus<strong>am</strong>menhängen hinterfragen und<br />
berücksichtigen<br />
begründen.<br />
4
6. Förderung der deutschen Sprache<br />
Der <strong>Physik</strong>unterricht fördert durch eine Vielzahl natürlicher Rede- und Schreibanlässe die<br />
allgemeine sprachliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in folgender Weise:<br />
• Sprachliche Fixierung von Versuchsbeobachtungen<br />
• Erfassen und beschreiben von Handlungsabfolgen (mündlich und in Protokollform)<br />
• Problematisieren der Umgangssprache in Hinblick auf die Bewusstmachung enthaltener,<br />
z.T. sachlich unrichtiger Vorstellungen<br />
• Situationsbezogene und angemessene Einübung und Anwendung fachsprachlicher Begriffe<br />
und Konzepte<br />
• Erläutern und Verständlichmachen von Sachzus<strong>am</strong>menhängen in der Lerngruppe bzw. in<br />
der Öffentlichkeit<br />
7. Gesundheitsförderung<br />
Die gesundheitsfördernden Aspekte im <strong>Physik</strong>unterricht beziehen sich vor allem auf die<br />
Bewusstmachung von Gefahren und die Kenntnis von sicherem Verhalten in Hinblick auf<br />
elektrischen Strom; Lärm; radioaktive-, UV- und IR-Strahlen und Straßenverkehr.<br />
8. Berufsorientierung<br />
Längerfristig angestrebt ist die Einbeziehung von Schülerarbeiten in Form von multimedialen<br />
Präsentationen zu Erfahrungen in den Betriebspraktika der Stufe 9. Hierdurch können zum<br />
Einen Bezüge zwischen Arbeitswelt und <strong>Physik</strong>unterricht aufgezeigt werden und zum Anderen<br />
Einblicke in Berufe gegeben werden, die „mit <strong>Physik</strong> zu tun haben“. Die Schülerinnen und<br />
Schüler erhalten so einen Überblick über die Tätigkeitsfelder lokaler Unternehmen und Impulse<br />
für den Unterricht (z.B. Berufe wie „Mechaniker“ und „Elektriker“).<br />
9. Leistungsbewertung<br />
Für das Fach „<strong>Physik</strong>“ der Sekundarstufe I sind keine Klassenarbeiten und<br />
Lernstandserhebungen vorgesehen. Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht<br />
erworbenen Kompetenzen, die in Beurteilungsbereiche „Schriftliche Beiträge“, „Mündliche<br />
Beiträge“ und „Manuelle Fähigkeiten (praktische Tätigkeiten)“ angemessen berücksichtigt<br />
werden. Mündliche Leistungen werden in einem kontinuierlichen Prozess besonders durch<br />
Beobachtung während des Schuljahres festgestellt.<br />
Bewertungskriterien: Kontinuität und Qualität, d.h. im Einzelnen:<br />
• sachliche Richtigkeit<br />
• Vollständigkeit<br />
• verständliche Darstellung, gedankliche Klarheit, Gebrauch der Fachsprache<br />
• Quellenangaben bei schriftlichen Arbeiten<br />
Allgemeine Anforderungen:<br />
• In Fachräumen gilt besondere Sauberkeits- und Ordnungspflicht gemäß der<br />
Laborordnung<br />
5
• Angemessene Vor- und Nachbereitung auf den Unterricht: Hausaufgaben,<br />
Wiederholung<br />
• Ordentliche Heftführung (z.B. Vollständigkeit in Hinblick auf Inhalte, Hausaufgaben,<br />
eingeheftete und bearbeitete Arbeitsblätter)<br />
Wertung der sprachlichen Richtigkeit<br />
Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit sollen bei schriftlichen Übungen,<br />
Hausaufgabenkontrollen und Arbeiten gekennzeichnet werden. Dabei müssen keine<br />
detaillierten Fehlerzeichen gesetzt werden.<br />
Es liegt im Ermessen der Fachlehrerin/des Fachlehrers zu entscheiden, wie Verstöße<br />
gegen die sprachliche Richtigkeit in die Bewertung einer schriftlichen Leistung einbezogen<br />
werden.<br />
10. Qualitätssicherung und Evaluation<br />
In den parallelen Lerngruppen eines Jahrganges mit gleicher Wochenstundenzahl wird im<br />
Schuljahr mindestens eine schriftliche Übung klassen- und kursübergreifend gestellt. Die bei<br />
den Korrekturen gewonnenen Erkenntnisse werden in der jeweils nächsten Fachkonferenz<br />
diskutiert.<br />
Das Gütesiegel „Individuelle Förderung“ ist im Schuljahr 2009/2010 der Schule verliehen<br />
worden. Als Förderansatz werden im Fach <strong>Physik</strong> die schriftlichen Übungen mit einem<br />
einheitlichen Kopf versehen, welcher Platz für modulare Förderempfehlungen enthält. Im 2.<br />
Halbjahr wird das Verfahren evaluiert.<br />
9. Sicherheitsbelehrung<br />
Zu Beginn jeden Schulhalbjahres findet eine Sicherheitsbelehrung statt.<br />
6
Schuleigener Lehrplan für das Fach <strong>Physik</strong> in den Jahrgansstufen 5 und 6 auf der Basis der Kernlehrpläne<br />
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
3, 4, 5<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
Einführung, Regeln,<br />
Sicherheit<br />
Optik Umgang mit Fachwissen<br />
- das Sehen mit einem Modell beschreiben<br />
- das Aussehen von Körpern mit dem Verhalten von Licht an ihren<br />
Oberflächen erläutern (Reflexion, Streuung, Absorption)<br />
- erklären von Jahres- und Tagesrhythmus durch die Neigung der<br />
Erdachse bzw. die Drehung der Erde im Sonnensystem<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- beschreiben von Beobachtungen und Handlungen<br />
- durchführen von einfachen Versuchen nach Vorgaben<br />
- überprüfen von Vermutungen zur Entstehung von<br />
Schattenphänomenen<br />
- begründen von Vermutungen zur Entstehung der Mondphasen<br />
- überprüfen die Entstehung der Mondphasen mit Modellversuche<br />
- nutzen das Modell der Lichtstrahlen für die Erklärung von Finsternissen<br />
und die Entstehung von Tag und Nacht<br />
Kommunikation<br />
- erläutern von Darstellungen (z.B. Erde im Sonnensystem) in<br />
vollständigen Sätzen<br />
- finden und demonstrieren von Beispielen für Sternbilder mit Hilfe von<br />
altersgerechten Suchmaschinen<br />
Bewertung<br />
- stellen den Bezug zur Biologie u.a. her<br />
Magnetismus Umgang mit Fachwissen<br />
- nennen von magnetisierbaren Stoffen<br />
- aufstellen von Regeln für Anziehung bzw. Abstoßung zwischen<br />
Magneten<br />
- magnetische Felder als Ursache der Wechselwirkung zwischen<br />
3 Quelle: Passgenau – zum neuen Kernlehrplan für NRW, <strong>Physik</strong> Interaktiv, Natur und Technik 5/6, Cornelsen Verlag<br />
4 Quelle: Stoffverteiler Naturwissenschaften, NRW 1. Progressionsstufe, Erlebnis <strong>Physik</strong>, 09.05.2011, Anne Geese<br />
5 Quelle: Stoffverteilungsplan, PRISMA <strong>Physik</strong> Nordrhein-Westfalen, Band 1, Klett 978-3-12-068785-6<br />
6 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, 21.03.2011<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Fachraum <strong>Physik</strong> mit<br />
Sicherheitseinrichtungen, Laborordnung,<br />
Betriebsanweisungen<br />
• Einführung in das Thema Optik „Lehre des<br />
Lichts“<br />
• Bedeutung der Lichtquellen, Sehen und<br />
gesehen werden<br />
• Sicherheit im Straßenverkehr, in der<br />
Schule, beim Spielen<br />
• Lichtquellen, kalte u. heiße Lichtquellen<br />
• Lichtausbreitung, Lichtstrahl, Lichtbündel<br />
• Licht fällt ins Auge<br />
• Schatten, Schattenraum, Kernschatten,<br />
Halbschatten<br />
• Licht u. Schatten auf der Erde<br />
• Wechselnde Gestalt des Mondes,<br />
Mondfinsternis, Sonnenfinsternis<br />
• Abbildung der Sonne, Sonnentalar<br />
• Bau einer Lochk<strong>am</strong>era, Die Bilder der<br />
Lochk<strong>am</strong>era<br />
• Einführung in das Thema „Magnetismus“,<br />
Richtungen <strong>am</strong> Magneten<br />
• Magnetisierbarkeit, Herstellung eines<br />
Magneten, Entmagnetisieren<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte 6<br />
System: Auge,<br />
Bildentstehung, Schatten<br />
Wechselwirkung:<br />
Absorption, Reflexion,<br />
Streuung<br />
Energie: Licht<br />
Wechselwirkung: Kräfte<br />
und Felder zwischen<br />
Magneten<br />
Struktur der Materie:<br />
7
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
, ,<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
Magneten benennen<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- Magnetismus mit dem Modell der Elementarmagnete erklären<br />
- beschreiben Magnetfelder mit der Modellvorstellung von Feldlinien<br />
Kommunikation<br />
- protokollieren ihre Beobachtungen und Ergebnisse<br />
- nutzen ausgewählte Informationsquellen<br />
- bei Versuchen im Te<strong>am</strong> Verantwortung übernehmen und die Aufgaben<br />
fair verteilen und diese sorgfältig im verabredeten Zeitraum erfüllen<br />
Bewertung<br />
- stellen den Bezug zur Erdkunde u.a. her<br />
Schall Umgang mit Fachwissen<br />
- Schwingungen als Ursache von Schall beschreiben<br />
- Schall-Grundgrößen (Frequenz, Amplitude) erläutern<br />
- das Hören als Empfang und Verarbeitung von Schwingungen erläutern<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- beschreiben von Beobachtungen und Handlungen<br />
- durchführen von einfachen Versuchen nach Vorgaben<br />
- vergleichen Versuchsergebnisse zum Hören und Sehen und ableiten<br />
von einfachen Regeln<br />
- Schallausbereitung mit Luftverdichtungen und Luftverdünnungen<br />
erklären<br />
Kommunikation<br />
- entnehmen von Informationen aus Sachtexten und Bildern<br />
- Aufgaben zur Schallwahrnehmung gemeins<strong>am</strong> mit dem Partner<br />
bearbeiten, Absprachen treffen und Absprachen einhalten<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Bau eines einfachen Kompass<br />
• Die Erde als Magnet, Magnetfeld<br />
• Orientierung früher und heute<br />
• Einführung in das Thema „Schall“<br />
• Schallentstehung, Schallwellen,<br />
Schallausbreitung, Frequenz, Amplitude,<br />
Schwingungen: Lernen an Stationen<br />
• Aufbau des menschl. Ohres, Hörbereich,<br />
Infraschall, Ultraschall<br />
• Bau einfacher Musikinstrumente<br />
• Schallverstärkung, Schallarten, Hörbereich,<br />
Messung der Schallgeschwindigkeit<br />
• Schallaufzeichnung<br />
• Lärm macht Krank<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
Magnetisierbare Stoffe<br />
System: Ohr, Frequenz,<br />
Amplitude<br />
Wechselwirkung:<br />
Schallschwingungen<br />
Energie: Schall<br />
Struktur der Materie:<br />
Schallausbreitung im<br />
Teilchenmodell<br />
Wärmelehre<br />
Bewertung<br />
- bewerten von Aussagen zur Lärmschädigung des Ohrs auf der<br />
Grundlage vorliegender Informationen<br />
- nehmen Stellung zu den Aussagen<br />
- aus Kenntnissen über die Wirkung von Lärm Konsequenzen für<br />
eigenes Verhalten ziehen<br />
- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Musik, Biologie u.a.) her<br />
Umgang mit Fachwissen • Einführung in das Thema „Wärmelehre“ System: Wärmetransport<br />
8
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
, ,<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
- benennen Wärme als Energieform<br />
- unterscheiden Begriffe wie Temperatur und Wärme<br />
- erläutern die Funktion eines Thermometers<br />
- geben Beispiele für die Speicherung, den Transport und die<br />
Umwandlung von Energie aus dem Alltag an<br />
- beschreiben die Auswirkungen der Anomalie des Wassers bei<br />
alltäglichen Vorgänge<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- erklären die Übergänge zwischen Aggregatzuständen sowie die<br />
Wärmeausdehnung von Stoffen mit einem Teilchenmodell<br />
- führen Messreihen zu Temperaturänderungen durch<br />
- wählen einen angemessenen Temperaturbereich und sinnvolle<br />
Zeitintervalle zur Aufzeichnung von Temperatur-Zeit-Diagr<strong>am</strong>m aus<br />
Kommunikation<br />
- experimentieren sachgerecht nach Anleitung<br />
- sinnentnehmend lesen und zus<strong>am</strong>menfassen von Texten mit<br />
physikalischen Inhalten in Sachbüchern und in vorgegebenen<br />
Internetquellen<br />
- nutzen ausgewählte Informationsquellen<br />
- lesen aus Tabellen und Diagr<strong>am</strong>men Temperaturen und andere Werte<br />
ab<br />
- tragen Messergebnisse in ein Diagr<strong>am</strong>m ein und verbinden sie durch<br />
eine Messkurve<br />
- hören die Beiträgen anderer bei Diskussionen über physikalische Ideen<br />
und Sachverhalte intensiv zu<br />
Bewertung<br />
- erklären und bewerten die isolierende Wirkung von Baustoffen mit<br />
Mechanismus des Wärmetransports<br />
- beschreiben die Gefahren durch hohe Temperaturen<br />
- einhalten von Sicherheitsmaßnahmen und -regeln<br />
Elektrizitätslehre Umgang mit Fachwissen<br />
- verschiedene Materialien als Leiter oder Nichtleiter einordnen<br />
- die notwendigen Elemente eines Stromkreises nennen<br />
- zwischen einfachen Reihen- und Parallelschaltungen unterscheiden<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Menschliche Temperaturempfinden,<br />
Thermometer, Eichen eines Thermometers<br />
• Thermometerskala, Fixpunkte,<br />
Celsiusskala, Temperatur-Zeit-Diagr<strong>am</strong>m<br />
• Verhalten von Flüssigkeiten beim Erwärmen<br />
(Ausdehnung) und beim Abkühlen<br />
• Eigenschaften des Wassers, Anomalie des<br />
Wassers<br />
• Verhalten von festen Körpern beim<br />
Erwärmen (Ausdehnung) und beim<br />
Abkühlen<br />
• Berücksichtigung der Ausdehnung fester<br />
Körper, Geschichte, Hausbau, Technik<br />
• Bimetalle, Bimetallstreifen,<br />
Bimetallthermometer<br />
• Gase werden erwärmt (Ausdehnung) und<br />
Abgekühlt<br />
• Vergleich: Ausdehnung und Abkühlung von<br />
Flüssigkeiten, von Festkörpern und von<br />
Gasen<br />
• Temperatur und Energie: Wärme kommt<br />
und geht, Wärme wird weitergeleitet<br />
• Wärmeabgabe und Wärmeleitung,<br />
Wärmespeicherung, Wärmeabgabe in<br />
Wärmetransport durch Kreisläufe, Beispiele<br />
aus der Technik<br />
• Isolierung (Wärmedämmung) und Energie<br />
(Wärmeleitung) beim Hausbau<br />
• Erläuterung Energiebegriff, thermische<br />
Energie, Wärmeleitung, Energiefluss,<br />
Energiehaus<br />
• Konvektion, Strahlung<br />
• Einführung in das Thema „Elektrizität“<br />
• Elektrische Stromkreise<br />
• Aufbau einer Glühl<strong>am</strong>pe<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
als Temperaturausgleich,<br />
Wärme- und<br />
Wasserkreislauf<br />
Wechselwirkung:<br />
Absorption und Reflexion<br />
von Strahlung,<br />
Wärmeisolierung<br />
Energie: Wärme,<br />
Temperatur,<br />
Wärmetransport, UV-<br />
Strahlung<br />
Struktur der Materie:<br />
Einfaches<br />
Teilchenmodell,<br />
Aggregatzustände,<br />
Wärmebewegung,<br />
Wärmeausdehnung<br />
System: Stromkreis,<br />
Parallel- und<br />
Reihenschaltungen,<br />
Schaltung und Funktion<br />
9
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
, ,<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
- beschreiben den Aufbau und Funktionsweise einfacher elektrischer<br />
Geräte<br />
- die Auswirkungen des elektrischen Stroms (Licht, Wärme,<br />
Magnetismus) und die Energieumwandlungen bei einfachen elektrischen<br />
Geräten nennen<br />
- den Aufbau, die Eigenschaften und Anwendungen von<br />
Elektromagneten erklären<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- einfache el. Schaltungen (UND/ODER – Schaltungen) planen,<br />
aufbauen und überprüfen<br />
- erklären die Vorgänge in einem Stromkreis mithilfe einfacher Modelle<br />
Kommunikation<br />
- experimentieren sachgerecht nach Anleitung<br />
- el. Stromkreise durch Schaltpläne und –symbole darstellen<br />
- einfache Schaltungen nach Schaltplänen aufbauen und erklären<br />
- Funktionszus<strong>am</strong>menhänge in einer einfachen Schaltung begründen<br />
Bewertung<br />
- die elektrischen Geräte sachgerecht nach Sicherheits- und<br />
Funktionshinweisen bedienen<br />
- Sicherheitsanweisungen für den Umgang mit dem el. Strom begründen<br />
und einhalten<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Fehler in einem Stromkreis<br />
• Leiter (stromleitende Stoffe), Nichtleiter<br />
(Isolatoren)<br />
• Reihenschaltung / Parallelschaltung<br />
• Sicherheitsschaltung, Klingelschaltung,<br />
UND/ODER – Schaltungen<br />
• Wechselschaltung<br />
• Elektrische Energiequellen, Dyn<strong>am</strong>o,<br />
Batterie, Akku, Solarzellen<br />
• Heizgeräte und L<strong>am</strong>pen<br />
• Kurzschluss und Sicherung<br />
• Aufbau einer Schmelzsicherung<br />
• Elektromagnete: Unterschied zu<br />
Dauermagneten, Lasthebemagnete,<br />
elektrische Klingel<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
einfacher Geräte<br />
Wechselwirkung:<br />
Stromwirkungen<br />
Energie:<br />
Energietransport durch<br />
elektrischen Strom,<br />
Energieumwandlungen<br />
Struktur der Materie:<br />
Leiter und Nichtleiter,<br />
einfaches Modell des<br />
elektrischen Stroms<br />
10
Schuleigener Lehrplan für das Fach <strong>Physik</strong> in den Jahrgansstufen 7 und 8 auf der Basis der Kernlehrpläne<br />
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
7, 8<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
Einführung, Regeln,<br />
Sicherheit<br />
Optik Umgang mit Fachwissen<br />
- beschreiben und unterscheiden die Strahlengänge bei Abbildungen mit<br />
Linsen<br />
- argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig in Bezug auf<br />
Bildentstehung, Bildgröße und Bildschärfe<br />
- erklären die Funktionsweise des Auges gemäß der Linsennachbildung<br />
- erläutern den Aufbau und die Funktion von Sehhilfen<br />
- erläutern, wie Licht an Grenzflächen zwischen durchsichtigen Medien<br />
gebrochen oder total reflektiert wird<br />
- unterscheiden zwischen reellen und virtuellen Bildern<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- Formulieren und überprüfen Vermutungen zu Abbildungseigenschaften<br />
von Linsen<br />
- wenden geeignete Modelle zur Erarbeitung der Bildentstehung bei<br />
Loch- und Linsenk<strong>am</strong>era an<br />
- unterscheiden zwischen der optischen Abbildungen auf der Netzhaut<br />
und dem Wahrnehmungsprozess<br />
- interpretieren die schematischen Darstellungen zu Aufbau und<br />
Funktion des Auges<br />
- beschreiben die Funktion von optischen Geräten nach vorgegebenen<br />
Kriterien in einem Sachtext<br />
- ordnen und systematisieren die Beobachtungen von Spiegelbildern<br />
- erklären die Entstehung von Spiegelbildern mit dem Reflexionsgesetz<br />
- erklären und beschreiben entstandene Scheinbilder durch Brechung<br />
Kommunikation<br />
- protokollieren die Beobachtungen und Ergebnisse strukturiert,<br />
nachvollziehbar und genau<br />
- präsentieren die Ergebnisse der Experimente mit angemessenen<br />
Medien fachlich korrekt und anschaulich<br />
7 Quelle: Passgenau – zum neuen Kernlehrplan für NRW, <strong>Physik</strong> Interaktiv, Natur und Technik 7/8, Cornelsen Verlag<br />
8 Quelle: Stoffverteilungsplan, PRISMA <strong>Physik</strong> Nordrhein-Westfalen, Band 2, 978-3-12-068790-0<br />
9 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, 21.03.2011<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
Fachraum <strong>Physik</strong> mit Sicherheitseinrichtungen,<br />
Laborordnung, Betriebsanweisungen<br />
• Einführung in das Thema Optik „Lehre des<br />
Lichts“, Körper streuen Licht<br />
• Absorption, Reflexion, Lochblenden<br />
• Lichtbündel erzeugen Bilder, Bilder mit der<br />
Lochk<strong>am</strong>era und mit Linsen<br />
• Brennweite, Bildgröße, Bildweite,<br />
Bestimmung der Brennweite einer Linse<br />
• S<strong>am</strong>mel- und Zerstreuungslinse,<br />
Konstruktionen an der S<strong>am</strong>mellinse<br />
(Konvexlinse), Konstruktionen an der<br />
Zerstreuungslinse (Konkavlinse), Bilder der<br />
S<strong>am</strong>mellinse<br />
• Das Auge (der menschliche Sehvorgang),<br />
nah und fern sehen<br />
• Augenfehler und deren Korrektur<br />
• Spiegelbilder, Wölbspiegel, Hohlspiegel,<br />
das Reflexionsgesetz<br />
• Die Brechung des Lichts, Totalreflexion<br />
• Der Augenoptiker weitere Berufe mit<br />
Kenntnissen der Lehre des Lichts<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte 9<br />
System: Linsen,<br />
Bildentstehung<br />
Wechselwirkung:<br />
Lichtbrechung,<br />
Totalreflexion, Gravitation<br />
Energie: Sonnenenergie<br />
Struktur der Materie:<br />
Massenanziehung<br />
11
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche) ,<br />
Bewertung<br />
- bewerten die technischen Geräte bzgl. ihrer Funktionalität<br />
- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Biologie u.a.) her<br />
Mechanik Umgang mit Fachwissen<br />
- als Ursache für die Verformungen bzw. Bewegungsänderungen eines<br />
Körpers das Wirken von Kräften auf den Körper erkennen<br />
- unterscheiden das physikalische Verständnis von Kräften von einem<br />
umgangssprachlichen Verständnis<br />
- beschreiben die Gravitation als Kraft zwischen Massen<br />
- geben für eine Masse die wirkende Gewichtskraft an<br />
- stellen Beziehungen zwischen Kräften, Energie und Leistung dar<br />
- erklären Alltagsgeräte wie Zangen, Scheren, Hebel u.a. mit den<br />
Konzepten Kraft und Energieübertragung<br />
- deuten die „Goldene Regel der Mechanik“ zur Funktion einfacher<br />
Maschinen als Spezialfall des Energieerhaltungsgesetz<br />
- analysieren körperliche Tätigkeiten in Hinsicht auf Leistungs- und<br />
Kraftgrenze<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- planen Versuche zur Messung physikalischer Größen<br />
- untersuchen Messwerte auf Proportionalität und interpretieren den<br />
Proportionalitätsfaktor für Geschwindigkeit<br />
- benennen selbstständig die zu messenden Größen bei Versuchen mit<br />
einfachen Maschinen (R<strong>am</strong>pen, Hebel, Flaschenzug) und Kraftwandlern<br />
und untersuchen systematisch den Einfluss dieser Größen<br />
- unterscheiden Kraft und Energie durch Analyse von Experimenten<br />
- berechnen mechanisch übertragenen Energie (E = F * s)<br />
Kommunikation<br />
- diskutieren Lösungsansätze und Ergebnisse<br />
- verwenden Zahlenwert und Einheit zur Angabe physikalischer Größen<br />
(Länge, Fläche, Zeit, u.a.)<br />
- stellen Messwerte in Diagr<strong>am</strong>men dar<br />
- stellen in Zeichnungen die Wirkung und das Zus<strong>am</strong>menwirken von<br />
Kräften durch Vektorpfeile<br />
- stellen in Abbildungen physikalischer Sachverhalte und<br />
Kräfteverhältnisse dar und interpretieren sie<br />
- erklären Vorgänge aus der Umwelt unter Verwendung der<br />
Fachsprache<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Körper in Bewegung: Weg, Zeit,<br />
Geschwindigkeit<br />
• Beispiele zu Geschwindigkeiten und<br />
Messverfahren<br />
• Gleichförmige und ungleichförmige<br />
Geschwindigkeiten<br />
• Kraftbegriff, Kräfte messen und vergleichen,<br />
Kräftedarstellung<br />
• Masse und Gewichtskraft<br />
• Wechselwirkungsprinzip<br />
• Hebel und deren Wirkung, die<br />
verschiedenen Hebel, das Hebelgesetz,<br />
Hebel in der Natur<br />
• Rollen und Seile, Flaschenzügen, Gesetze<br />
zu Flaschenzügen<br />
• Arbeit, verschiedene Arbeitsarten, Arbeit<br />
und Energie, Energieentwertung<br />
• Die goldene Regel der Mechanik<br />
• Funktion des Rades, die Gangschaltung<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
System: Kraftwandler,<br />
Hebel<br />
Wechselwirkung: Kräfte<br />
Energie: Energie und<br />
Leistung (mechanisch<br />
und Elektrisch),<br />
Energieerhaltung<br />
Struktur der Materie:<br />
Masse<br />
12
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
Energie /<br />
Elektrizitätslehre<br />
(Kompetenzbereiche) ,<br />
Bewertung<br />
- bewerten die Geräte wie R<strong>am</strong>pen, Flaschenzug, Hebel in Bezug auf<br />
die Erleichterung bei der Energieübertragung<br />
Umgang mit Fachwissen<br />
- ordnen Beispiele aus Umwelt, Natur und Technik verschiedenen<br />
Energieformen zu<br />
- stellen Umwandlungs- und Energietransportketten dar<br />
- unterscheiden verschiedene Möglichkeiten des Energietransports und<br />
der Energiespeicherung<br />
- erklären einfache elektrostatische Phänomene mit Hilfe der<br />
Eigenschaften von positiven und negativen Ladungen<br />
- beschreiben den Zus<strong>am</strong>menhang zwischen el. Energie und el.<br />
Leistung<br />
- erläutern die Begriffe Ladung und Stromstärke und ihren<br />
Zus<strong>am</strong>menhänge mit Hilfe eines Kern-Hülle-Modells<br />
- erläutern die Begriffe el. Stromstärke, Spannung und Widerstand und<br />
ihren Zus<strong>am</strong>menhänge mit Hilfe einer Modellvorstellung zum el.<br />
Stromkreis<br />
- erläutern die Aufteilung von Strömen und Spannungen bei el.<br />
Stromkreisen (Reihen- und Parallelschaltung)<br />
- beschreiben verschiedene Möglichkeiten der Spannungserzeugung in<br />
Natur und Technik<br />
- vernetzen Energie, Energiestrom und zeitliche Nutzung<br />
- erläutern die Abhängigkeit des el. Widerstandes eines Leiters von<br />
dessen Eigenschaften (Leitermaterial, Länge, Querschnitt, Temperatur)<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- untersuchen Maßnahmen zur Reduzierung der Energieentwertung<br />
- verwenden das Teilchenmodell zur Klärung der Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
zwischen Energie und Temperatur<br />
- beschreiben und erklären die physikalischen Vorgänge zu Aufladungen<br />
und Entstehung von Blitzen<br />
- beschreiben und vergleichen verschiedene Energieströme<br />
- stellen geeignete Modelle zur Energieübertragung dar<br />
- erklären Vorzüge und Grenzen verschiedener Analogiemodelle zu<br />
elektrischen Stromkreisen<br />
- beschreiben und vergleichen verschiedene Ströme<br />
- führen Experimente zur Wirkung des el. Stromes durch<br />
- interpretieren Messungen und Ergebnisse von Stromstärken und<br />
Spannungen<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Einführung in das Thema „ Energie,<br />
Energieformen, Energieumwandlungen“,<br />
Elektrische Energie, Elektrische Quellen als<br />
Energiewandler<br />
• Der Kreislauf elektrischer Ladung (Vergleich<br />
mit anderen Kreisläufen),<br />
Energieumwandlung in Kreisläufen,<br />
Energiestrom-Ladungsstrom,<br />
• Elektrische Erscheinungen (z. B.<br />
Reibungselektrizität, Gewitter, Blitzableiter,<br />
Kopierer, Entstaubungsanlagen, …),<br />
Positive und negative Ladungen und ihre<br />
Eigenschaften<br />
• Messen von elektrischen Strömen,<br />
Strommessgeräte, Schaltzeichen<br />
• Messbare Wirkungen des elektrischen<br />
Stroms<br />
• Zwei Schaltungsarten: Reihenschaltung,<br />
Parallelschaltung, Energieversorgung im<br />
Haushalt<br />
• Die Elektrische Spannung, verschiedene<br />
Spannungen, Spannungsmessgerät<br />
• Widerstand, das Ohm´sche Gesetz, Simon<br />
Georg Ohm<br />
• Messen in Stromkreisen, Berechnung<br />
elektrischer Größen, Stromstärke,<br />
Spannung, Widerstand<br />
• Festwiderständen, Farbcode bei<br />
Festwiderständen<br />
• Leistung und Energie<br />
• Typenschilder verschiedener Elektrogeräte,<br />
Leistung von Geräten – Messung und<br />
Berechnung<br />
• Elektrogeräte als Energiewandler,<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
System: Stromstärke,<br />
Spannung, Widerstand,<br />
Parallel- und<br />
Reihenschaltung<br />
Wechselwirkung: Kräfte<br />
zwischen Ladungen,<br />
elektrisches Feld<br />
Energie: Spannung,<br />
elektrische Energie,<br />
elektrische Leistung<br />
Struktur der Materie:<br />
Kern-Hülle Modell des<br />
Atoms, Eigenschaften<br />
von Ladungen<br />
13
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche) ,<br />
- werten Messdaten zur Stromstärke in Parallelschaltungen und<br />
Reihenschaltungen aus<br />
- formulieren die Gesetzmäßigkeiten<br />
- vertiefen das Modell des Elektronenflusses<br />
- planen Versuche zu Spannungs- und Stromstärkemessungen<br />
- führen Messungen unter sachgerechter Verwendung der Messgeräte<br />
durch<br />
- verwenden Größengleichungen und korrekte Maßeinheiten für<br />
Messungen bei Stromkreisen<br />
- interpretieren aus Messergebnissen den Zus<strong>am</strong>menhang von Leistung<br />
und Stromstärke<br />
- bestimmen die Leistung von Elektrogeräten aus den Werten für<br />
Stromstärke und Spannung<br />
- bestimmen die Energiekosten<br />
- führen Experimente zur Wärmeeinwirkung unterschiedlicher<br />
Materialien durch<br />
- bestimmen den Widerstand in el. Stromkreisen aus den Werten für<br />
Stromstärke und Spannung<br />
Kommunikation<br />
- benutzen Fachbegriffe und Darstellungsformen für die Umwandlung,<br />
Transport und Entwertung von Energie<br />
- setzen Informationen zu Schutzmaßnahmen bei Gewittern in sinnvolle<br />
Verhaltensregeln um<br />
- erkennen die wesentlichen Angaben für die Ermittlung des<br />
Energiebedarfs von Elektrogeräten<br />
- diskutieren Messergebnisse<br />
- recherchieren und präsentieren Referate zu verschiedenen Themen<br />
wie „Spannungen in Natur und Technik“ und „Energieverbrauch“ u.a.<br />
- erklären den Zus<strong>am</strong>menhang von Leistung und Stromstärke mit Hilfe<br />
eines Diagr<strong>am</strong>ms<br />
- reflektieren, diskutieren und bewerten Versuchsergebnisse<br />
- werten Untersuchungen unter Verwendung von Fachsprache,<br />
Diagr<strong>am</strong>men, Tabellen, Texten und Grafiken aus<br />
- präsentieren die Erkenntnisse und Fakten in angemessener<br />
Fachsprache<br />
- fertigen geeignete Tabellen für die Messreihen mit mehren Variablen<br />
zu el. Schaltungen an<br />
- erklären den Zus<strong>am</strong>menhang zwischen Spannung und Stromstärke mit<br />
Hilfe von Diagr<strong>am</strong>men<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
Stromrechnung früher und heute,<br />
Stromzähler – Stromrechnung,<br />
Energienutzung und Energieeinsparung<br />
• Spannungsabfall an Widerständen,<br />
Sicherung, Kurzschluss, Überlastung<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
14
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche) ,<br />
Bewertung<br />
- begründen und beachten Sicherheitsregeln und Schutzmaßnahmen<br />
bei der Nutzung el. Anlagen<br />
- begründen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei Gewitter<br />
- beurteilen verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung auf der<br />
Grundlage von Energieberechnungen<br />
- nennen Möglichkeiten zum spars<strong>am</strong>en Gebrauch von el. Energie<br />
- stellen den Energiebedarf eines Haushalts mit verschiedenen<br />
Diagr<strong>am</strong>mformen aus<br />
- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Chemie: Atommodelle u.a.) her<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
15
Schuleigener Lehrplan für das Fach <strong>Physik</strong> in den Jahrgansstufen 9 und 10 auf der Basis der Kernlehrpläne<br />
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
Einführung, Regeln,<br />
Sicherheit<br />
Elektromagnetismus<br />
und Induktion,<br />
elektrische<br />
Energieerzeugung<br />
und -übertragung<br />
(Kompetenzbereiche) 10<br />
Umgang mit Fachwissen<br />
- erklären Phänomene des Elektromagneten und des Elektromotors mit<br />
bekannten Zus<strong>am</strong>menhängen zum Magnetismus<br />
- beschreiben und veranschaulichen Magnetfelder mit der<br />
Modellvorstellung von Feldlinien<br />
- beschreiben Gemeins<strong>am</strong>keiten und Unterschiede el. Und magn.<br />
Felder<br />
- beschreiben den Aufbau und die Funktion von Generatoren und<br />
Transformatoren<br />
- erklären die Funktion eines Generators und eines Transformators mit<br />
Hilfe der elektromagn. Induktion<br />
- erklären die Energieübertragung durch Hochspannung mit bekannten<br />
Konzepten (Widerstand, Energieerhaltung und Energiestrom)<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- führen Untersuchungen zur Eigenschaft von Elektromagneten durch<br />
- erweitern das Modell der magn. Feldlinien<br />
- führen Induktionsversuche durch und beschreiben strukturiert die<br />
Beobachtungsergebnisse<br />
- untersuchen Stromstärke und Spannungen <strong>am</strong> Transformator<br />
- untersuchen die Induktionsspannung in Abhängigkeit verschiedener<br />
Par<strong>am</strong>eter<br />
- erklären Phänomene mit bekannten Konzepten (Magnetfeld,<br />
Induktion, Energieerhaltung, Energiestrom)<br />
- interpretieren Untersuchungsergebnisse<br />
- entwickeln mathematische Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
Kommunikation<br />
- recherchieren und präsentieren Referate zu verschiedenen Themen<br />
wie „Dyn<strong>am</strong>os gestern und heute“ u.a.<br />
- planen, strukturieren und präsentieren ihre Arbeiten im Te<strong>am</strong><br />
10 Quelle: Passgenau – zum neuen Kernlehrplan für NRW, <strong>Physik</strong> Interaktiv, Natur und Technik 9/10, Cornelsen Verlag<br />
11 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, 21.03.2011<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
Fachraum <strong>Physik</strong> mit Sicherheitseinrichtungen,<br />
Laborordnung, Betriebsanweisungen<br />
• Dauer-/Permanentmagnete - Beispiele und<br />
Eigenschaften, Modell „Elementarmagnete“<br />
• Kräfte auf Probekörper-Feldbegriff und<br />
Merkmale, Feldlinienbilder (Betrag und<br />
Richtung), Magnetfeld der Erde<br />
• Elektromagnete als stromdurchflossene<br />
Spulen mit Eisenkern,<br />
Gemeins<strong>am</strong>keiten/Unterschiede zum<br />
Dauermagnet, Anwendungen<br />
(Lasthebemagnet, Relais, Klingel)<br />
• André Marie Ampère und der<br />
Elektromagnetismus<br />
• Die elektromagnetische Induktion –<br />
Induktionsstrom in Spulen - Von der<br />
Induktion zum Generator (Bewegung<br />
erzeugt Strom)<br />
• Fahrrad-Dyn<strong>am</strong>o, Faraday<br />
(Generatorprinzip 1831), Bedingungen und<br />
Verbesserungsmöglichkeiten (Strom,<br />
Windungen, Kern,..)<br />
• Aufbau, Wirkungsweise,<br />
Energieumwandlung, unterschiede bei<br />
Gleich-/Wechselstromgeneratoren, Messen<br />
von Wechselstromgrößen,<br />
Kraftwerksgeneratoren<br />
• Sichtbar machen von Wechselspannungen<br />
– Das Oszilloskop: Aufbau, Wirkungsweise<br />
• Der Elektromotor (Strom erzeugt<br />
Bewegung) – Aufbau, Funktionsprinzip des<br />
Gleichstrom- Elektromotors (Drehspule und<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte 11<br />
System: Transformator,<br />
Generator, Elektromotor<br />
Wechselwirkung:<br />
Magnetfelder von Leitern<br />
und Spulen, elektrische<br />
Felder, Induktion<br />
Energie:<br />
Energietransport,<br />
Wirkungsgrad,<br />
Energieumwandlung<br />
16
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
Bewertung<br />
- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Erdkunde: Energie), zu Industrie und<br />
Verkehr: Transrapid, Leben, Umwelt, Zukunft, Drehspulenmessgeräte u.a. her<br />
Mechanik, Bewegte<br />
Körper und ihre<br />
Energie,<br />
Geschwindigkeit,<br />
Beschleunigung<br />
Umgang mit Fachwissen<br />
- als Ursache für die Verformungen bzw. Bewegungsänderungen eines<br />
Körpers das Wirken von Kräften auf den Körper erkennen<br />
- erläutern die Bedeutung des Trägheits- und des<br />
Wechselwirkungsgesetzes<br />
- beschreiben die Bewegungsenergie als Energieform<br />
- erläutern die Umwandlungen von Bewegungsenergie in andere<br />
Energieformen<br />
- nutzen die energetische Konzepte, um Bremsvorgänge und<br />
Sicherheitsmaßnahmen im Auto zu analysieren<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- unterscheiden gleichförmige und beschleunigte Bewegungen<br />
- modellieren Messwerte zur gleichförmigen Bewegung durch eine<br />
Proportionalität von Weg und Zeit<br />
- berechnen Geschwindigkeiten<br />
- ermitteln die für Bewegungen benötigte Zeit durch Rechnungen<br />
- unterscheiden verschiedene Bewegungsarten hinsichtlich der<br />
Energieumwandlung<br />
- entwickeln selbstständig Versuchspläne zur systematischen<br />
Untersuchung von Kraftwirkungen und setzen sie um<br />
- klassifizieren Bewegungswiderstände<br />
- identifizieren spezielle Kräfte (Gewichts-, Reibungskräfte, …) in<br />
alltäglichen Situationen aufgrund ihrer Wirkungen<br />
Kommunikation<br />
- planen, durchführen, auswerten und reflektieren Gruppenarbeiten, u.a.<br />
zu Geschwindigkeitsmessungen<br />
- verarbeiten Messwerte zu Bewegungen mit Hilfe eines<br />
Tabellenkalkulationsprogr<strong>am</strong>m und stellen daraus<br />
Bewegungsdiagr<strong>am</strong>me her<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
Kommutator)<br />
• Der Transformator – zwei Spulen und ein<br />
Eisenkern, Energieübertragung durch<br />
Transformatoren, Aufbau, Wirkungsweise,<br />
Energie, Anwendungen (Fernleitung,<br />
Klingel, Zündspule Kfz, Schweißen,...),<br />
Verluste durch Wirbelströme<br />
• Hochstrom-Transformatoren,<br />
Energieübertragung mit Hochspannung<br />
• Geschwindigkeiten in Natur und Technik,<br />
Momentan- und<br />
Durchschnittsgeschwindigkeit,<br />
gleichförmige und ungleichförmige<br />
Bewegung – Diagr<strong>am</strong>me<br />
• Infos aus Fahrtenschreibern, Autodaten,<br />
Beschleunigung: „von 0 auf 100 in ... „<br />
Diagr<strong>am</strong>me, Anhalten = Reagieren +<br />
Bremsen, freier Fall, Fallschirmspringen<br />
• Antriebskräfte-Pfeildiagr<strong>am</strong>me,<br />
Bewegungswiderstände, Trägheit von<br />
Körpern, Grundgleichung der Mechanik<br />
• Bewegungsenergie,<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
• Gefährliche Kurven, Fliehkraft, Zentralkraft<br />
und Abhängigkeiten<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
System: Kraftwandler,<br />
Geschwindigkeit<br />
Wechselwirkung: Kräfte<br />
Energie: Mechanische<br />
Energie,<br />
Energieerhaltung<br />
Struktur der Materie:<br />
Masse<br />
17
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
- protokollieren Messreihen zu Bewegungen und stellen sie in Zeit-Weg-<br />
Diagr<strong>am</strong>men dar<br />
- beschreiben qualitativ Bewegungen anhand eines Weg-Zeit-<br />
Diagr<strong>am</strong>ms bzw. eines Geschwindigkeits-Zeit-Diagr<strong>am</strong>m und<br />
bestimmen die Durchschnittsgeschwindigkeit<br />
Informationstechnik,<br />
Informationsübertragung<br />
Hydrostatik, Kraft und<br />
Druck, Auftrieb<br />
Bewertung<br />
- bewerten unterschiedliche Fortbewegungsarten hinsichtlich<br />
Energiebedarf und Umweltbelastung<br />
- reflektieren und beurteilen die Angemessenheit des eigenen<br />
Verhaltens im Straßenverkehr<br />
- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Mathe: Lineare Funktionen und<br />
Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen;<br />
Verkehr/Verkehrserziehung: Faustregeln Bremsen, Gurtpflicht Nackenstütze,<br />
Schutzhelm; Sport: H<strong>am</strong>merwurf, Diskuswurf u.a.) her<br />
Umgang mit Fachwissen<br />
- erklären die Funktion von Dioden und Transistoren<br />
- erläutern die Umwandlung zwischen Schall und el. Signalen bei<br />
Mikrofonen und Lautsprechern<br />
- deuten an Beispielen den Unterschied zwischen digitalen und<br />
analogen Signalen<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- untersuchen die Funktionsweise von Sensoren<br />
- zeigen gesellschaftliche Veränderungen durch die Entwicklung der<br />
Informationstechnologie auf (Bsp.: Internet)<br />
- planen Versuche zur Signalübertragung mit Licht<br />
Kommunikation<br />
- präsentieren fachlich korrekt die Funktion und Bedeutung von<br />
Lichtleitern für die Informationsübertragung<br />
- beschaffen, ordnen, zus<strong>am</strong>menfassen und auswerten von<br />
Informationen zur Funktionsweise von Kommunikationsgeräten<br />
Bewertung<br />
- benennen Gefahren der Datennutzung in digitalen Netzwerken und<br />
Maßnahmen zum Datenschutz<br />
Umgang mit Fachwissen<br />
- erklären Phänomene durch den Luftdruck als Schweredruck der Luft<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Verschiedene Elektrobauteile, LED,<br />
Widerstand, Transistor, Relais<br />
• Bau eines Feuchtigkeitsmelders<br />
(Regenmelder), Messungen an dem<br />
Feuchtigkeitsmelder<br />
• Informationsübertragung mit Schall,<br />
Infraschall, Ultraschall, Schallstärke<br />
• Telefonieren, prinzipieller Aufbau des<br />
Telefons, Geschichte<br />
• Daten / Schall dauerhaft speichern<br />
• Relais - Schaltungen, Alarmanlage,<br />
Kondensatoren als Speicher<br />
• Datenkodierung, analoge u. digitale<br />
Signale, das duale Zahlensystem, der<br />
ASCII - Code<br />
• Fehlerkorrektur bei Daten<br />
• Elektronenleitung in Silizium, Solarzelle<br />
• Der Ablauf in einem Transistor<br />
• Steuern und Regeln<br />
• Was ist Druck?, Druckmessungen in<br />
Abhängigkeit einer Flüssigkeitssäule, Der<br />
kartesische Taucher<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
System: Analoge und<br />
digitale Kodierung,<br />
elektromagnetische<br />
Strahlung,<br />
Sensorschaltungen<br />
Wechselwirkung:<br />
Elektroakustische<br />
Signalwandlung<br />
Energie:<br />
Elektromagnetische<br />
Energieumwandlungen<br />
Struktur der Materie:<br />
Dioden und Transistoren<br />
System: Geschwindigkeit<br />
Wechselwirkung: Druck,<br />
18
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- stellen Hypothesen zur Abhängigkeit der Temperatur von der Höhe der<br />
Luftschicht auf<br />
- führen Experimente zum Komprimieren und Expandieren von Luft<br />
Energie, Kraftwerke<br />
im Vergleich,<br />
alternative Energien<br />
Kommunikation<br />
- präsentieren Ergebnisse Adressanten- und situationsgerecht mit<br />
angemessenem Medieneinsatz<br />
Umgang mit Fachwissen<br />
- stellen die Energieumwandlungsketten von einem Kraftwerk bis zu den<br />
Haushalten unter Berücksichtigung der Energieentwertung und des<br />
Wirkungsgrades dar<br />
- beschreiben Beispiele für nicht erneuerbare und regenerative<br />
Energiequellen<br />
- erklären Unterschiede zwischen nicht erneuerbaren und regenerativen<br />
Energiequellen<br />
- erläutern die Kernspaltung in einem Kernreaktor und die d<strong>am</strong>it<br />
verbundenen Stoff- und Energieumwandlung<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- verwenden Funktionsmodelle zur Veranschaulichung der<br />
Kraftwerkprozesse<br />
- zerlegen das Problem zukünftiger Energieversorgung in physikalisch<br />
relevante Teilprobleme<br />
- ermitteln die Leistung von Modellen von Wasser- und Windkraftwerken<br />
sowie von Solarmodulen<br />
Kommunikation<br />
- stellen die Vorgänge in Kraftwerken unter Verwendung der<br />
Fachsprache dar<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Druck, Dichtebestimmung, Der<br />
hydrostatische Druck<br />
• Druck in miteinander verbundenen<br />
Gefäßen, kommunizierende Gefäße,<br />
Technische Anwendungen für<br />
kommunizierende Gefäße, U-<br />
Rohrmanometer<br />
• Auftrieb in Flüssigkeiten, Schwimmen,<br />
Schweben, Sinken<br />
• Warme und kalte Luft, Gase, Der Auftrieb in<br />
Luft, Drachen, Flugzeug und Hubschrauber,<br />
der Luftwiderstand<br />
• Fallschirm, „Ahornrotor“, Der<br />
Raketenantrieb<br />
• Die Anfänge des Fliegens, Tragflügel,<br />
Fliegen mit und ohne Motor, Bau<br />
verschiedener Flugmodelle<br />
• Energie, Energiearten, Kernkraftwerk,<br />
Kohlekraftwerk<br />
• Energiealternativen, Umwelt<br />
• Aufwind-, Biomasse-, Wind- und<br />
Wasserkraftwerk, Solarenergie, Bioenergie,<br />
Erdwärme<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
Schweredruck,<br />
Auftriebskraft, Kraft und<br />
Gegenkraft, Trägheit<br />
Energie:<br />
Bewegungsenergie<br />
Struktur der Materie:<br />
Masse, Dichte<br />
System: Kraftwerke,<br />
regenerative<br />
Energiequellen,<br />
Stromnetze<br />
Energie:<br />
Energietransport,<br />
Wirkungsgrad,<br />
Energieentwertung<br />
Struktur der Materie:<br />
Fossile und regenerative<br />
Energieträger<br />
19
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
- stellen zus<strong>am</strong>menfassend Informationen aus verschiedenen Quellen<br />
zur effektiven Bereitstellung und Übertragung von Energie<br />
- planen, strukturieren und präsentieren ihre Arbeiten im Te<strong>am</strong><br />
Bewertung<br />
- beurteilen lokale und globale Auswirkungen von Anlagen zur el.<br />
Energieerzeugung auf die Welt<br />
- bewerten und diskutieren Möglichkeiten der el. Energieversorgung<br />
unter den Gesichtspunkten Versorgungssicherheit,<br />
Umweltbeeinflussung, gesellschaftliche Akzeptanz und<br />
Zukunftsaussichten auf der Grundlage fachlicher Kenntnisse<br />
- erörtern Alternativen und Strategien einer umwelt- und<br />
naturverträglichen Lebensweise im Sinne der Nachhaltigkeit<br />
Wetter und Klima Umgang mit Fachwissen<br />
- verbinden Windentstehung aufgrund unterschiedlicher<br />
Sonneneinstrahlung<br />
- erklären die Wolkenbildung durch die Anwendung der Kenntnisse über<br />
Energie und Phasenübergänge<br />
- verbinden Sachverhalte aus der Technik mit entsprechenden<br />
Sachverhalten in der Natur<br />
- erklären die ungleichmäßige Verteilung der Sonnenenergie auf der<br />
Erde unter Anwendung physikalischer Konzepte<br />
- beschreiben Beispiele für die direkte Nutzung der Sonnenenergie<br />
- erklären die unterschiedliche Erwärmung von Boden und Wasser unter<br />
Anwendung physikalischer Konzepte<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- erklären die Windentstehung als Folge von Druckunterschieden<br />
- untersuchen den Zus<strong>am</strong>menhang zwischen Strahlung und Temperatur<br />
des Strahles<br />
- erklären den Treibhauseffekt mit der Wechselwirkung von<br />
Sonnenstrahlung und Atmosphäre<br />
Kommunikation<br />
- präsentieren Ergebnisse Adressanten- und situationsgerecht mit<br />
angemessenem Medieneinsatz<br />
- nutzen verschiede Darstellungen zur Veranschaulichung von<br />
Temperaturgängen<br />
Bewertung<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Bedeutung von Wetter und Klima,<br />
Wetterelemente: Temperatur, Luftdruck,<br />
Windrichtung, Windstärke, Regenmenge,<br />
Wettererklärungen von früher,<br />
Wetterbeobachtung/Wetterkarte<br />
• Energiestrom der Sonne, Absorption,<br />
Energieverteilung, Spektrum des<br />
Sonnenlichtes<br />
• Gefahren und Schutz (Ozonschicht),<br />
Ozonloch und Treibhauseffekt – Klimatod,<br />
Infrarotstrahlen<br />
• Geschichte: Horror vacue, Otto von<br />
Guericke (Magdeburger Halbkugeln,<br />
Luftdruckmesser), Eigenschaften,<br />
Messgerät Barometer, Zus<strong>am</strong>menhänge,<br />
Inversion/Smog<br />
• Hoch- und Tiefdruckgebiete, Winde als<br />
Folge von Luftdruckunterschieden<br />
• Wolkenentstehung und Wolkenarten,<br />
relative Luftfeuchtigkeit/Taupunkt<br />
• Tau, Reif, Nebel, Föhn, Entstehung von<br />
Regen, Graupel, Hagel, Schnee<br />
• Wasserkreislauf der Erde,<br />
Wirbelstürme(Taifun, Hurrikan, Tornado),<br />
Wetterphänome<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
System: IR-Strahlen, UV-<br />
Strahlen,<br />
Treibhauseffekt,<br />
Wasserkreislauf<br />
Wechselwirkung:<br />
Absorption und Reflexion<br />
Energie: Sonnenenergie,<br />
Windenergie,<br />
Wasserenergie,<br />
Farbspektrum (IR bis UV)<br />
20
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
- diskutieren und bewerten Maßnahmen zur Reduzierung des<br />
Treibhauseffekts<br />
- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Erdkunde: Wetter u.a.) her<br />
Kernphysik,<br />
Radioaktivität 12<br />
Umgang mit Fachwissen<br />
- beschreiben Eigenschaften, Wirkungen und Nachweismöglichkeiten<br />
verschiedener Arten radioaktiver Strahlung und Röntgenstrahlung<br />
- erläutern die Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie<br />
- erklären Anwendungen, Gefahren und Schutzmaßnahmen der<br />
ionisierten Strahlung<br />
- definieren statische Zerfallsprozesse von Atomkernen als Ursache von<br />
Halbwertszeiten<br />
- beschreiben die Veränderungen in Gesellschaft durch die Entdeckung<br />
radioaktiver Strahlung und Kenspaltung<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
- beschreiben den Aufbau des Atomkerns, die Bildung von Isotopen, die<br />
radioaktive Zerfallsprozesse, die Kernspaltung und die Kernfusion mit<br />
einem angemessenen Atommodell<br />
- werten Daten zur Halbwertszeit aus<br />
- nutzen Zerfallskurven und Halbwertszeiten zur Vorhersage von<br />
Zerfallsprozessen<br />
Kommunikation<br />
- recherchieren Verfahren zum Einsatz von ionisierender Strahlung in<br />
der Technik und in der Medizin<br />
- recherchieren die Ursachen der natürlichen Strahlenbelastung<br />
- recherchieren und präsentieren Referate zu verschiedenen Themen<br />
wie „Atomwaffen“, ihren Einsatz, ihrer Verbreitung, „Kernkraftwerke“,<br />
Problemen der Endlagerung und Weiteraufbereitung, „Strahlenbelastung<br />
durch Kraftwerksunfälle“<br />
- erläutern die Probleme der Nutzung der Kernenergie und der<br />
Behandlung von radioaktiven Abfällen und stellen die daraus<br />
resultierenden physikalischen, technischen und gesellschaftlichen<br />
Fragestellungen differenziert dar<br />
- planen, strukturieren und präsentieren ihre Arbeiten im Te<strong>am</strong><br />
Bewertung<br />
- bewerten und gegenüberstellen Risiken und Nutzen der ionisierenden<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
• Entdeckung der natürlichen Radioaktivität<br />
(Becquerel, Curie), Kernspaltung<br />
• Kernstrahlungsarten(α, β, χ),<br />
Strahlungsnachweis, Aufbau und Funktion<br />
des Geiger-Müller-Zählrohr<br />
• Reichweite und Durchdringungsvermögen,<br />
Schutz vor Strahlung, biologische Wirkung,<br />
Schaden und Nutzen, Reaktorunfall von<br />
Fukushima und Tschernobyl, Castor-<br />
Transporte<br />
• Zerfallsgleichungen, Halbwertzeit, Aktivität<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
System: Kernkraftwerke,<br />
Kettenreaktion,<br />
Halbwertzeiten<br />
Wechselwirkung:<br />
Kernkräfte, α-, β- und ϒ-<br />
Strahlung,<br />
Röntgenstrahlung<br />
Energie: Kernenergie,<br />
Energie ionisierende<br />
Strahlung<br />
Struktur der Materie:<br />
Atome, Atomkerne,<br />
Kernspaltung,<br />
radioaktiver Zerfall<br />
12 Strahlenschutzverordnung beachten, um eine Gefährdung für die Schüler auszuschließen. Experimente sind nur mit gültigem Strahlenschutznachweis und der Berufung zum<br />
Strahlenschutzbevollmächtigten erlaubt. (Fortbildungen der Bezirksregierung und der GUVV)<br />
21
Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />
(Kompetenzbereiche)<br />
Strahlung in der Medizin<br />
- nehmen Stellung zur Nutzung der Kernenergie ein und geben Kriterien<br />
an<br />
- diskutieren die Verantwortung von Wissenschaftlern <strong>am</strong> Beispiel der<br />
Kernspaltung und anderer historischer Beispiele<br />
- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Chemie: Aufbau von Atomen,<br />
Massenzahl, Kernladungszahl, Isotope, Symbolschreibweise, Biologie u.a.) her<br />
Vorschlag für fachliche Inhalte<br />
(Schwerpunkte)<br />
Entwicklung der<br />
Basiskonzepte<br />
22