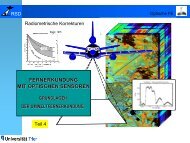(Werner) [pdf 444 kB, 22 Seiten] - Universität Trier
(Werner) [pdf 444 kB, 22 Seiten] - Universität Trier
(Werner) [pdf 444 kB, 22 Seiten] - Universität Trier
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Werner</strong> B4<br />
3.2 Wirkungsmonitoring<br />
Sowohl bei der Wiesenflockenblume als auch bei den Pappel- und Kleeklonen<br />
konnten nach Ozonepisoden Schadsymptome nachgewiesen werden.<br />
So konnte Gehenzig (2000) an allen Messstationen sichtbare Blattschäden an<br />
Centaurea jacea unterschiedlicher Herkunft nachweisen, jedoch ergab die<br />
Verteilung der Schäden je nach Herkunft und Expositionsort kein einheitliches<br />
Bild. Gehenzig (2000) vermutet, dass die sichtbaren Blattschäden nicht allein<br />
auf die Höhe der Ozonkonzentrationen zurückzuführen sind, sondern eine<br />
Überlagerung mit lokalklimatischen Effekten stattgefunden hat. Auch die<br />
Exposition unterschiedlich ozonempfindlicher Centaureen im Jahr 2001 brachte<br />
kein einheitliches Ergebnis bezüglich des Zeitpunktes und des Ausmaßes des<br />
Schadenseintritts. Allerdings konnten im Freiland an spontan wachsenden<br />
Individuen in den Jahren 2000 und 2001 auf Wiesen der Höhenlagen der<br />
Region Ozonschäden beobachtet und fotografiert werden. Diese Schäden traten<br />
an den Fabaceen Trifolium repens., T. pratense, Lathyrus linifolius, sowie an<br />
den krautigen Arten Knautia arvensis, Plantago lanceolata und Centaurea jacea<br />
auf.<br />
Anders sieht es bei den Pappelklonen aus: Weber (2000) konnte anhand des<br />
Anteils geschädigter Pappel-Blätter an der Gesamtblattzahl sehr gut die<br />
Abstufung der Ozonbelastung der drei Stationen, wie sie durch den AOT40 -<br />
Index charakterisiert wird, nachvollziehen (<strong>Werner</strong> et al., 2002). Es zeigte sich,<br />
dass chlorotische Veränderungen an den Blättern der Pappel -Stecklinge<br />
zeitversetzt zur Phase der höchsten Ozonkonzentration auftraten. Außerdem<br />
erwies sich bei allen Pappelklonen die frühzeitige Seneszenz durch verfrühten<br />
Blattwurf als sicheres Wirkungskriterium. Jedoch setzte auch diese Wirkung erst<br />
sehr stark zeitversetzt ein, so dass die Pappel als Indikator für Abschätzungen<br />
von landwirtschaftlichen Ertragseinbußen an Kulturpflanzen ungeeignet ist<br />
(<strong>Werner</strong> et al., 2002).<br />
Als geeignetstes Verfahren für den Nachweis ozoninduzierter Blattschäden und<br />
für ein quantitatives auf Produktionseinbußen abzielendes Ozon-Biomonitoring<br />
hat sich der Vergleich verschieden sensitiver Klone (NC -R und NC-S) des<br />
Weißklees erwiesen. Das von Heagle et al. (1994) entwickelte Moni toring-<br />
System wird im Rahmen der Untersuchungen des ICP -Vegetation seit 1996<br />
europaweit eingesetzt (Mills et al. 2000), u.a. auch in <strong>Trier</strong>. Neben der<br />
eindeutigen Reaktion des NC-S-Klons auf Ozon durch das Auftreten von<br />
Blattschäden kurz nach Ozonepisoden und dem Fehlen dieser Schäden an den<br />
Blättern des NC-R-Klons zeichnet sich der Weißklee durch die Möglichkeit aus,<br />
Biomasseeinbußen zu bestimmen. Die Ertragseinbußen als Quotient der NC-S-<br />
zur NC-R-Biomasse könnten zur Kalibrierung der Ertragseinbußen an<br />
110


![(Werner) [pdf 444 kB, 22 Seiten] - Universität Trier](https://img.yumpu.com/10995450/12/500x640/werner-pdf-444-kb-22-seiten-universitat-trier.jpg)

![(Montada) [pdf 78 kB, 19 Seiten] - Universität Trier](https://img.yumpu.com/21594691/1/184x260/montada-pdf-78-kb-19-seiten-universitat-trier.jpg?quality=85)
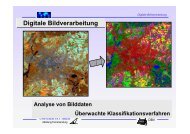
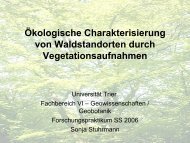
![(Emmerling) [pdf 133 kB, 23 Seiten] - Universität Trier](https://img.yumpu.com/10995464/1/184x260/emmerling-pdf-133-kb-23-seiten-universitat-trier.jpg?quality=85)
![B10 (Baumhauer) [pdf 262 kB, 30 Seiten] - Universität Trier](https://img.yumpu.com/10995455/1/184x260/b10-baumhauer-pdf-262-kb-30-seiten-universitat-trier.jpg?quality=85)


![B11 (Schäfer) [pdf 201 kB, 19 Seiten]](https://img.yumpu.com/10995437/1/184x260/b11-schafer-pdf-201-kb-19-seiten.jpg?quality=85)