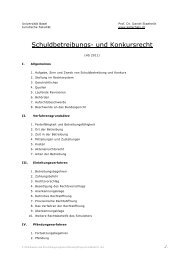Tracking Stocks
Tracking Stocks
Tracking Stocks
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Christophe Scheidegger<br />
<strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong><br />
Die Realisierbarkeit im schweizerischen Aktienrecht<br />
Zitiervorschlag: Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
ISSN 1424-7410, www.jusletter.ch, Weblaw AG, info@weblaw.ch, T +41 31 380 57 77<br />
www.jusletter.ch<br />
Das innovative Finanzierungsinstrument der <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> ist dem schweizerischen Aktienrecht<br />
unbekannt. Es verschafft einem Unternehmen die Möglichkeit, Aktien eines einzelnen<br />
Unternehmensteils herauszugeben, ohne die rechtliche Einheit des Unternehmens aufgeben<br />
zu müssen. Der vorliegende Beitrag untersucht die rechtlichen Hürden, die sich bei der Einführung<br />
von <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> nach geltendem Recht stellen.<br />
Rechtsgebiet(e): Aktienrecht
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
Inhaltsübersicht<br />
Erster Teil: Einleitung und Grundlagen<br />
§ 1 Einleitung<br />
§ 2 Grundlagen<br />
I. Eigenschaften<br />
II. Vor- und Nachteile<br />
1. Vorteile<br />
1.1. Steigerung des Unternehmenswerts<br />
1.2. Vorteile gegenüber einer rechtlichen Verselbständigung<br />
1.3. Akquisitionszahlungsmittel<br />
1.4. Mitarbeiterbeteiligung<br />
1.5. Eigenkapitalbeschaffung<br />
2. Nachteile<br />
2.1. Erhöhung der Komplexität<br />
2.2.Interessenkonflikte<br />
2.3. Haftung<br />
Zweiter Teil: Allgemeine Beurteilung der Realisierbarkeit<br />
§ 3 <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> in anderen Rechtsordnungen<br />
§ 4 Eingliederung in das schweizerische Aktienrecht<br />
I. Bestehende Instrumente<br />
II. Besondere Aktienkategorie<br />
§ 5 Privatautonomie und ihre Schranken<br />
I. Privatautonomie<br />
II. Schranken der Privatautonomie<br />
1. Grundstruktur der Aktiengesellschaft<br />
2. Gemeinsamer Zweck<br />
3. Gleichbehandlungs- und Sachlichkeitsgebot<br />
Dritter Teil: Konkrete Beurteilung der Realisierbarkeit<br />
§ 6 Einführung einer TS-Struktur<br />
I. Spartenorganisation<br />
II. Spartenrechnungslegung<br />
1. Funktionen und Grundproblem<br />
2. Spartenrechnungslegung im amerikanischen und deutschen Recht<br />
3. Spartenrechnungslegung in der Schweiz<br />
3.1. Gesetzliche Grundlage<br />
3.2. Freiwillige Einführung<br />
3.2.1. Zuständigkeiten<br />
3.2.2. Publikation<br />
3.2.3. Kontrolle<br />
III. Konkrete Einführungsmöglichkeiten<br />
1. Einführung bei der Gründung<br />
2. Einführung bei einer bestehenden Gesellschaft<br />
2.1. Generelle Beschlüsse<br />
2.2.Einführungsmöglichkeit ohne Zufluss von neuem Kapital<br />
2.2.1. Aktiensplit<br />
2.2.2. Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln<br />
2.2.3. Ausschüttung einer Sachdividende<br />
2.2.4. Verschmelzung mit einer Tochtergesellschaft<br />
2.3.Einführungsmöglichkeiten mit Zufluss von neuem Kapital<br />
§ 7 Die Rechtstellung der TS-Aktionäre<br />
I. Pflichten<br />
II. Vermögensrechte<br />
1. Gewinnausschüttung<br />
1.1. Allgemein<br />
1.2. Zulässigkeit einer spartenbezogenen Gewinnverteilung<br />
1.3. Beschränkung der Ausschüttung<br />
1.3.1. Rückgriff auf Reserven<br />
1.3.2. Dividendennachbezug<br />
1.3.3. Abspaltung<br />
1.3.4. Rückabwicklung<br />
1.4. Spezialfälle<br />
1.4.1. Close <strong>Tracking</strong> und loose <strong>Tracking</strong><br />
2<br />
1.4.2. Retained Interest<br />
2. Bezugsrecht<br />
2.1. Probleme eines allgemeinen Bezugsrechts<br />
2.2. Lösungsmöglichkeiten<br />
2.2.1. Kapitalerhöhung in beiden Sparten mit gekreuztem Bezugsrechtsausschluss<br />
2.2.2. Kapitalerhöhung in einer Sparte mit einseitigem Bezugsrechtsausschluss<br />
3. Anteil am Liquidationserlös<br />
3.1. Zulässigkeit eines spartenbezogenen Liquidationsanteils<br />
3.2. Gestaltungsmöglichkeiten<br />
3.2.1. Verteilung gemäss dem Spartenvermögen<br />
3.2.2. Verteilung gemäss einem Verteilschlüssel<br />
III. Stimmrechte<br />
1. Die Ausübung des Stimmrechts<br />
1.1. Gefahr von Konflikten zwischen den Aktionären<br />
1.2. Lösungsmöglichkeiten<br />
1.2.1. Sonderversammlungen<br />
1.2.2. Erschwerte Beschlussfassung<br />
1.2.3. Treuepflicht der Aktionäre<br />
2. Stimmkraft<br />
2.1. Grundproblem<br />
2.2. Amerikanische Lösung<br />
2.3. Variables Stimmrecht in der Schweiz<br />
§ 8 Die Rechtsstellung des Verwaltungsrates<br />
I. Vergleich mit konventionellem Verwaltungsrat<br />
II. Gefahr der unfairen Behandlung<br />
III. Schutzmöglichkeiten<br />
1. Amerikanisches Recht<br />
2. Schweizerisches Recht<br />
2.1. Pflichten des Verwaltungsrates<br />
2.2.Direkte Einflussnahme der Sparten<br />
2.2.1. Ernennung eines Sachverständigen<br />
2.2.2. Vertretung im Verwaltungsrat<br />
2.2.3. Verweigerung der Entlastung<br />
2.2.4. De lege ferenda: Art. 716b E-OR<br />
§ 10 Auflösung der TS-Struktur<br />
I. Amerikanisches Recht<br />
II. Schweizerisches Recht<br />
1. Umwandlung<br />
2. Spaltung<br />
3. Bedingte oder befristete Einführung<br />
Vierter Teil: Ergebnisse<br />
Literaturverzeichnis<br />
Materialienverzeichnis<br />
Erster Teil: Einleitung und Grundlagen<br />
§ 1 Einleitung<br />
[Rz 1] Der Börsenkurs eines Unternehmens kann sehr stark<br />
auf die schlechten Ergebnisse einzelner Divisionen reagieren.<br />
Die Sparte «Investment Bank» der UBS AG wies in<br />
den Jahren 2007 und 2008 zusammen einen Verlust von<br />
CHF 50'969 Mio. aus, währenddem die anderen Sparten<br />
einen Gewinn von CHF 19'812 Mio. erwirtschafteten 1 . Die<br />
1 Geschäftsbericht 2008 der UBS AG (angepasste Version vom 20. Mai<br />
2009), S. 283, 285.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
Aktionäre mussten aufgrund der schlechten Ergebnisse der<br />
Investmentbank einen Wertverlust ihrer Aktie von annähernd<br />
80 % hinnehmen. Die Wahl, ob sie sich an der Investmentbank<br />
beteiligen wollen, stand den Aktionären dagegen nicht<br />
zu 2 . Diese Entscheidungsfreiheit soll den Anlegern durch die<br />
Ausgabe von <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> (TS) ermöglicht werden.<br />
[Rz 2] <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> sind Erfindungen des US-amerikanischen<br />
Gesellschaftsrechts und dem schweizerischen Kapitalmarkt<br />
unbekannt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es<br />
daher, die Realisierbarkeit von <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> im geltenden<br />
schweizerischen Aktienrecht abzuklären. Dazu folgt auf ein<br />
Grundlagenkapitel, welches die Eigenschaften dieses Finanzierungsinstruments<br />
skizziert, eine generelle Betrachtung<br />
der Realisierbarkeit. Darauf aufbauend wird konkret auf die<br />
massgebenden Aspekte der Realisierbarkeit eingegangen.<br />
Der Umfang dieser Arbeit liess es jedoch nicht zu, dass sämtliche<br />
relevanten Rechtsgebiete hätten berücksichtigt werden<br />
können. Deshalb musste insbesondere auf eine eingehende<br />
Betrachtung des Steuer- und Börsenrechts verzichtet werden.<br />
Zudem muss für ökonomische 3 und historische 4 Aspekte<br />
auf die vorhandene Literatur verwiesen werden.<br />
§ 2 Grundlagen<br />
I. Eigenschaften<br />
[Rz 3] Der Begriff <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> wird nirgends allgemein<br />
gültig definiert 5 . Im Gegenteil: Es existiert eine Fülle von Definitionen<br />
6 und Begriffe 7 . Nachfolgend soll deshalb kurz auf die<br />
wichtigsten Eigenschaften dieses Finanzierungsinstruments<br />
eingegangen werden.<br />
[Rz 4] <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> sind Aktien, deren grundlegende<br />
Eigenschaft darin besteht, dass ihre Vermögensrechte auf<br />
einen Unternehmensteil beschränkt sind, währenddem die<br />
rechtliche Einheit des emittierenden Unternehmens unberührt<br />
bleibt 8 . Erstes Merkmal ist daher eine Einschränkung<br />
der Vermögensrechte. Die Vermögensrechte dieser Aktien<br />
werden dahingehend modifiziert, dass sie sich entweder<br />
auf eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft oder<br />
auf einen unselbständigen Unternehmensteil beziehen 9 . Mit<br />
2 Vgl. Kun z , Aktienrechtsrevision, N 157.<br />
3 Vgl. dazu: Ja e g e r , S. 131 ff.; na t u s c h , S. 187 ff.<br />
4 Vgl. dazu: to n n e r , S. 33 ff.; Bau e r , S. 45 ff.<br />
5 TS werden auch in der aktuellen Aktienrechtsrevision nicht erwähnt. Vgl.<br />
Kun z , Aktienrechtsrevision, N 156.<br />
6 Für eine Übersicht siehe: Bau e r , S. 31 ff.<br />
7 Grundsätzlich wird im Englischen zwischen «Alphabet Stock» oder «Letter<br />
Stock» sowie «Targeted Stock» oder «<strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>» unterschieden.<br />
Bezüglich der Unterschiede: Ja e g e r , s. 15 ff.; Log u e /se w a r d /wa L s h , s. 47;<br />
na t u s c h , 46 f. Im Deutschen werden die Begriffe «Spartenaktien», «Segmentsaktien»,<br />
«Geschäftsbereichsaktien» und «divisionalisierte Aktien»<br />
verwendet. Siehe dazu: Böc K L i , Aktienrecht, § 4 N 434; Kuh n , S. 1.<br />
8 Vgl. Fuc h s , S. 171; Bau e r , S. 33.<br />
9 Fuc h s , S. 168. Im ersten Fall spricht man von «Subsidiary Shares» und im<br />
3<br />
anderen Worten: Die Vermögensrechte der TS sind mit einem<br />
genau definierten Unternehmensteil verknüpft 10 . Das Dividendenrecht<br />
als wichtigstes Vermögensrecht hängt damit<br />
grundsätzlich nicht mehr von der Performance des Gesamtunternehmens<br />
ab, sondern vom wirtschaftlichen Erfolg oder<br />
Misserfolg einer Unternehmenssparte 11 .<br />
[Rz 5] Zweites Merkmal ist der Erhalt der rechtlichen Einheit<br />
des Unternehmens. TS stellen Eigenkapital des Gesamtunternehmens<br />
dar, mithin werden keine neuen rechtlichen Einheiten<br />
kreiert 12 . TS-Aktionäre sind damit Aktionäre des Gesamtunternehmens<br />
mit der Folge, dass sich ihr Stimmrecht<br />
auf das gesamte Unternehmen bezieht 13 . Es findet daher nur<br />
eine Generalversammlung statt, welche einen für das gesamte<br />
Unternehmen zuständigen Verwaltungsrat wählt 14 . Die<br />
Rechtsstellung der Gläubiger ist von der Einführung einer TS-<br />
Struktur nicht betroffen 15 . Ihnen stehen aufgrund der rechtlichen<br />
Einheit weiterhin sämtliche Vermögenswerte der Gesellschaft<br />
zur Deckung ihrer Forderungen zur Verfügung 16 .<br />
[Rz 6] Diese Struktur stellt damit in gewisser Weise das Spiegelbild<br />
einer Konzernstruktur dar. Der Konzern ist eine wirtschaftliche<br />
Einheit, bestehend aus rechtlich selbständigen<br />
Gesellschaften 17 . Das TS-Unternehmen wird demgegenüber<br />
durch eine spartenbezogene Rechnungslegung wirtschaftlich<br />
gespalten, währenddem es rechtlich eine Einheit bleibt 18 .<br />
[Rz 7] In der deutschen Literatur ist umstritten, wie sich die<br />
Einführung von TS auf die bestehenden Aktien auswirkt 19 .<br />
Fraglich ist, ob neben den TS noch «gewöhnliche» Aktien<br />
existieren können 20 . In dieser Frage ist grundsätzlich To n n e r<br />
zuzustimmen, der darlegt, dass neben TS keine Stammaktien<br />
mehr bestehen können 21 . Die Ausgabe von TS bewirkt<br />
nämlich, dass die bisherigen Aktien auf einen Unternehmensteil<br />
vermögensrechtlich keinen Zugriff mehr haben 22 .<br />
Mit anderen Worten: Durch die Emission von TS werden die<br />
bisherigen Aktien selbst in TS umgewandelt, weil sich deren<br />
Vermögensrechte nicht mehr auf das ganze Unternehmen<br />
zweiten von «Divisional Shares». Eine gute Übersicht bezüglich der Unterscheidung<br />
bieten: Kuh n , S. 6 ff.; to n n e r , S. 9 ff.<br />
10 Vgl. st e i n B e r g e r /ha s s , S. 525; na t u s c h , S. 47.<br />
11 Vgl. Fuc h s , S. 167; Bau m s , S. 19.<br />
12 Vgl. Fuc h s , S. 171; th i e L , S. 9; Bau m s , S. 21f; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 525.<br />
13 Vgl. Bau m s , S. 22; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 525. Nach has s , II.A.2. stellen die<br />
Sparten das gesellschaftsrechtliche Äquivalent zu Siamesischen Zwillingen<br />
dar. Verbunden durch das Stimmrecht, getrennt im Vermögensrecht.<br />
14 Vgl. Fuc h s , S. 171 f.; wu n s c h , S. 7.<br />
15 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 526.<br />
16 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 526. Vgl. im Übrigen auch: Ja e g e r , S. 14; Bau m s , S.<br />
22.<br />
17 Vgl. me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 24 N 36.<br />
18 Vgl. to n n e r , S. 6; na t u s c h , S. 50.<br />
19 Vgl. Kuh n , S. 9.<br />
20 Bejahend: sie g e r /ha s s e L B a c h , S. 1278; Ablehnend: to n n e r , S. 11.<br />
21 Vgl. to n n e r , S. 11 ff.<br />
22 Vgl. to n n e r , S. 13.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
beziehen 23 . Dieser Grundsatz kann allerdings durch die Beteiligung<br />
einer Sparte am Gewinn einer oder mehreren anderen<br />
Sparten (sog. «Retained Interest») relativiert werden 24 .<br />
II. Vor- und Nachteile<br />
1. Vorteile<br />
1.1. Steigerung des Unternehmenswerts<br />
[Rz 8] Eines der Hauptziele einer TS-Emission besteht darin,<br />
eine Steigerung des Unternehmenswerts (sog. «Shareholder<br />
Value») hervorzurufen, obwohl der Gesellschaft durch die<br />
blosse wirtschaftliche Spaltung keine neuen Vermögenswerte<br />
zufliessen 25 . Diese Steigerung beruht auf zwei Ursachen.<br />
Einerseits werden die Investoren quantitativ besser gestellt,<br />
da sich ihre Investitionsmöglichkeiten deutlich vergrössern.<br />
Durch die Spartenbildung stehen den Investoren nun mehrere<br />
Anlagemöglichkeiten innerhalb eines Unternehmens zur<br />
Verfügung, was ihnen erlaubt, ihre Investitionsentscheide<br />
stärker anhand ihrer spezifischen Anlagebedürfnisse und Risikoneigungen<br />
zu fällen 26 . Die Investoren werden aber auch<br />
qualitativ besser gestellt. Die Spartenrechnungslegung verschafft<br />
nämlich mehr Transparenz und erhöht damit die Informationsmenge<br />
27 . Das gesamte Unternehmen wird dadurch<br />
fairer bewertet, weil eine separate Bewertung der einzelnen<br />
Sparten zu einer Reduktion des für divisionalisierte Unternehmen<br />
typischen Bewertungsabschlags (sog. «Conglomerate<br />
Discount») führt 28 . Zusammenfassend kann gesagt werden,<br />
dass die spezifischeren Kapitalanlagemöglichkeiten,<br />
verbunden mit einer transparenteren Rechnungslegung, zu<br />
einer Erhöhung der Nachfrage und damit zu einem höheren<br />
Marktpreis führen 29 . Eine höhere Börsenkapitalisierung vermindert<br />
zudem die Chancen von feindlichen Übernahmen 30 .<br />
1.2. Vorteile gegenüber einer rechtlichen Verselbständigung<br />
[Rz 9] Die Ausgabe von TS bietet im Vergleich zur rechtlichen<br />
Verselbständigung einer Sparte erhebliche Vorteile. Erwähnenswert<br />
ist dabei etwa der Erhalt von Synergieeffekten 31<br />
sowie der Vorteil der uneingeschränkten Kontrolle über die<br />
23 Vgl. Kuh n , S. 10; to n n e r , S. 11. Zur Umwandlung siehe hinten §6/III/2.1.<br />
24 Vgl. Kuh n , s. 11. Zum Retained Interest siehe hinten §7/II/1.4.2.<br />
25 Vgl. Kuh n , S. 17; to n n e r , S. 15.<br />
26 Vgl. Fuc h s , S. 173; to n n e r , S. 17.<br />
27 Vgl. Kuh n , s. 24. Auch die Anzahl Analysten steigt. Vgl. dazu: Log u e /se-<br />
w a r d /wa L s h , s. 54 f.<br />
28 Vgl. Kuh n , S. 17 f.; Fuc h s , S. 173; wu n s c h , S. 12 f.; to n n e r , S. 16 m.w.H.<br />
29 Vgl. th i e L , S. 20.<br />
30 wu n s c h , s. 13. Allgemein zum Einsatz von TS bei Übernahmen: Kuh n , s. 32<br />
ff.<br />
31 Synergieeffekte bestehen z.B. in der zentralen Abwicklung von Verwaltungsaufgaben<br />
(Personalabteilung, Buchhaltung) oder darin, dass nur<br />
eine Generalversammlung durchgeführt und nur ein Verwaltungsrat bestellt<br />
werden muss. Vgl. wu n s c h , s. 11. Kritisch dazu: Kuh n , s. 22.<br />
4<br />
Sparte 32 . Die Einführung von TS verursacht zudem nicht die<br />
gleich hohen Restrukturierungskosten wie eine rechtliche<br />
Verselbständigung 33 . Nicht zu unterschätzen ist auch, dass<br />
nach der Einführung von TS dem Unternehmen weiterhin alle<br />
Restrukturierungsmöglichkeiten offen stehen 34 und sich die<br />
Rückabwicklung der TS-Struktur einfacher gestaltet als die<br />
Reintegration einer selbständigen Sparte 35 . Ausserdem findet<br />
auf die Sparte weiterhin das Kredit-Rating des gesamten<br />
Unternehmens Anwendung, was zu besseren Konditionen<br />
bei der Kapitalbeschaffung führt 36 . Beachtlich sind zudem<br />
die steuerlichen Vorteile. Obwohl ein ähnliches Resultat wie<br />
mit einer Unternehmensspaltung erreicht wird, muss ein TS-<br />
Emittent keine Rücksicht auf die Beschränkungen nehmen,<br />
die Art. 61 DBG 37 in Bezug auf die Auflösung von stillen Reserven<br />
festlegt.<br />
1.3. Akquisitionszahlungsmittel<br />
[Rz 10] <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> eignen sich zudem hervorragend als<br />
Akquisitionswährung 38 . Einerseits dürfte die Zustimmung der<br />
Aktionäre der Zielgesellschaft zu einem Aktientausch eher<br />
vorhanden sein, wenn ihnen TS anstelle von Stammaktien<br />
angeboten werden. Die Aktionäre können dadurch nämlich<br />
weiterhin exklusiv an ihrem Unternehmen partizipieren 39 . Andererseits<br />
wird argumentiert, dass die Übernahmeprämien<br />
geringer ausfallen, weil das Gewinnentwicklungspotenzial<br />
des Unternehmens nicht durch die anderen Sparten verwässert<br />
wird 40 .<br />
1.4. Mitarbeiterbeteiligung<br />
[Rz 11] Das TS-Modell eröffnet zudem interessante Möglichkeiten<br />
in Bezug auf die Ausgestaltung von Aktienoptionsprogrammen<br />
für Mitarbeiter. Die Tauglichkeit solcher Programme<br />
ist namentlich in diversifizierten Unternehmen fraglich, da<br />
sich der wirtschaftliche Erfolg einer Sparte nicht unbedingt im<br />
Börsenkurs des Gesamtunternehmens widerspiegelt 41 . Mit<br />
der Ausgabe von Optionen auf TS (sog. «TS-Options») kann<br />
ein Mitarbeiter dieser Sparte unmittelbar belohnt werden,<br />
wenn seine Entscheidungen positive Auswirkungen auf den<br />
Aktienkurs der Sparte haben 42 . Sinkt hingegen der Börsen-<br />
32 Insbesondere fallen keine Klagen von Minderheitsaktionären an. Vgl. th i e L ,<br />
s. 13.<br />
33 Vgl. Ja e g e r , S. 115 f.<br />
34 Ja e g e r , S. 108.<br />
35 Ja e g e r , S. 108.<br />
36 Vgl. Kuh n , S. 21 f.; Ja e g e r , S. 112 ff.<br />
37 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (SR<br />
642.11).<br />
38 Kuh n , S. 30.<br />
39 Vgl. to n n e r , S. 23; th i e L , S. 17.<br />
40 Vgl. Kuh n , S. 31; wu n s c h , S. 14 f.; has s , I.B.1.<br />
41 Vgl. Kuh n , S. 26 f.; to n n e r , S. 26.<br />
42 Vgl. to n n e r , S. 27.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
kurs, bleibt ihm die Möglichkeit der Ausübung verwehrt, auch<br />
bei einem ansonsten guten Resultat der Gesellschaft 43 .<br />
1.5. Eigenkapitalbeschaffung<br />
[Rz 12] Als letzter Punkt ist noch auf die Vorteile in Bezug<br />
auf die Eigenkapitalbeschaffung hinzuweisen 44 . In casu sind<br />
zwei Punkte erwähnenswert: Zum einen ermöglichen es TS<br />
der Gesellschaft die Eigenkapitalerhöhung in der Sparte<br />
durchzuführen, welche augenblicklich die besten Chancen<br />
auf dem Kapitalmarkt besitzt 45 . Zum anderen können TS als<br />
Sanierungsinstrument für Not leidende Sparten benutzt werden<br />
46 . Die Begründung liegt darin, dass die Risikokapitalgeber<br />
eher bereit sind Kapital aufzuwenden, wenn sie bei Erfolg<br />
der Sparte auch exklusiv beteiligt werden 47 .<br />
2. Nachteile<br />
[Rz 13] So verlockend die Vorteile auch klingen mögen, die<br />
wirtschaftliche Spaltung eines Unternehmens birgt beträchtliche<br />
Gefahren und Nachteile in sich 48 . Nachfolgend sollen<br />
drei dieser Nachteile kurz skizziert werden.<br />
2.1. Erhöhung der Komplexität<br />
[Rz 14] Die Ausgabe von TS erhöht erstens die Komplexität<br />
der Gesellschaftsstruktur 49 . Diese Komplexität führt zu<br />
einem externen Mehraufwand, der sich in einem erhöhten<br />
Erklärungsaufwand gegenüber Gläubigern und Investoren<br />
manifestiert. Hinzu kommt ein interner Mehraufwand, da für<br />
jede Sparte eine akkurate Spartenrechnungslegung erstellt<br />
werden muss.<br />
2.2. Interessenkonflikte<br />
[Rz 15] Aus der komplexeren Kapitalstruktur ergibt sich der<br />
zweite Kritikpunkt: Das Konfliktpotenzial innerhalb der Gesellschaft<br />
wird durch die Emission von TS massiv erhöht 50 .<br />
Das Grundproblem besteht nämlich darin, dass die Sparten<br />
u.U. verschiedene Interessen verfolgen 51 . Bedingt durch die<br />
unterschiedliche Interessenausrichtung, besteht unter den<br />
Aktionären, in der Unternehmensleitung 52 , ja selbst unter den<br />
Arbeitnehmern 53 , die Gefahr von Konflikten. Die unter den<br />
Vorteilen abgehandelten TS-Options 54 könnten dabei zu einer<br />
Verschärfung dieser Konflikte beitragen.<br />
43 Vgl. th i e L , S. 24.<br />
44 Weiterführendes bei Ja e g e r , s. 105 ff.<br />
45 Vgl. Kuh n , S. 29; wu n s c h , S. 15; na t u s c h , S. 72.<br />
46 Kuh n , S. 29; wu n s c h , S. 15; Bau m s , S. 20.<br />
47 Vgl. Kuh n , S. 29; wu n s c h , S. 15.<br />
48 noL t e , S. 36.<br />
49 Fuc h s , S. 176.<br />
50 Vgl. Fuc h s , S. 176; Bau m s , S. 27.<br />
51 Vgl. noL t e , S. 37; to n n e r , S. 31.<br />
52 Vgl. wu n s c h , S. 16; Bau m s , S. 27.<br />
53 Vgl. wu n s c h , S. 16.<br />
54 Siehe vorne §2/II/1.4.<br />
5<br />
2.3. Haftung<br />
[Rz 16] Abschliesend ist noch auf einen Nachteil hinzuweisen,<br />
der für die Aktionäre ein finanzielles Risiko mit sich bringt.<br />
Dadurch, dass bei der Ausgabe von TS nur eine wirtschaftliche<br />
Trennung stattfindet, das Unternehmen jedoch rechtlich<br />
weiterhin eine Einheit bildet, bleibt die Haftung gegenüber<br />
Gläubigern des Gesamtunternehmens für alle Sparten bestehen<br />
55 . Die Aktionäre einer rentablen Sparte dürfen sich<br />
damit nicht in Sicherheit wiegen, da ein extrem hoher Verlust<br />
einer anderen Sparte das ganze Unternehmen in den Konkurs<br />
führen kann. Aufgrund dessen wurde auch schon auf<br />
die Einführung von TS verzichtet 56 .<br />
Zweiter Teil: Allgemeine Beurteilung der<br />
Realisierbarkeit<br />
§ 3 <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> in anderen Rechtsord-<br />
nungen<br />
[Rz 17] Ausgangspunkt einer kurzen rechtsvergleichenden<br />
Untersuchung muss das amerikanische Recht bilden. In<br />
einer grossen Vielfalt wurden dort in den letzten 20 Jahren<br />
TS-Emissionen durchgeführt 57 . Grund dafür ist die rechtliche<br />
Gestaltungsfreiheit, welche die Gesellschaften bei der Ausgestaltung<br />
ihrer Struktur sowie der Rechtstellung der Aktionäre<br />
geniessen 58 . Gemäss § 151 (a) des Delaware General<br />
Corporation Law z.B., obliegt es dem «certificate of incorporation»,<br />
d.h. den Statuten, die Rechte der Aktionäre zu definieren<br />
59 . Dies eröffnet beliebige Gestaltungsmöglichkeiten 60 .<br />
Ein in Bezug auf TS wichtiger Ausfluss der Gestaltungsfreiheit<br />
besteht darin, dass heute die meisten Gliedstaaten auf<br />
das Erfordernis eines Mindestkapitals verzichten 61 . Dies erleichtert<br />
die Implementierung einer TS-Struktur erheblich,<br />
insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung des Stimmrechts<br />
62 . Auf der anderen Seite legt die Gestaltungsfreiheit<br />
dem Verwaltungsrat («Board of Directors») auch eine immense<br />
Machtfülle in die Hände. Die Aktionäre sind dem Willen<br />
des Verwaltungsrates fast völlig ausgeliefert 63 .<br />
[Rz 18] Anders präsentiert sich die Lage in Deutschland. Dort<br />
ist zwar die juristische Aufarbeitung des Themas sehr weit<br />
fortgeschritten, TS-Emissionen haben allerdings noch nicht<br />
55 Vgl. to n n e r , S. 31; wu n s c h , S. 19.<br />
56 Dies war bei dem US-Unternehmen RJR Nabisco der Fall. Vgl. dazu: to n -<br />
n e r , s. 32.<br />
57 Für eine Übersicht siehe: to n n e r , S. 389 ff.; th i e L , S. 319 ff.; na t u s c h , S.<br />
248 ff.<br />
58 noL t e , S. 44.<br />
59 noL t e , S. 46.<br />
60 noL t e , S. 46.<br />
61 me r K t /gö t h e L , N 320.<br />
62 Siehe hinten §7/III/2.2.<br />
63 Siehe hinten §8/III/1.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
stattgefunden. Die Zulässigkeit einer TS-Struktur wurde von<br />
Beginn an bejaht 64 und ist auch in der letzten, umfassenden<br />
Beurteilung durch Ku h n wieder bestätigt worden 65 . Das deutsche<br />
Recht lässt aber eine uneingeschränkte Übernahme<br />
des amerikanischen TS-Modells nicht zu 66 . Hauptverantwortlich<br />
ist dabei das Prinzip der aktienrechtlichen Satzungsstrenge<br />
(§ 23 Abs. 5 AktG 67 ) 68 . Danach ist eine Abweichung<br />
von der gesetzlichen Regelung nur dann zulässig, wenn das<br />
Gesetz dies ausdrücklich gestattet. Damit wird die Gestaltungsfreiheit<br />
massiv eingeschränkt und die Einführung neuer<br />
und innovativer Finanzierungsinstrumente gehemmt.<br />
[Rz 19] In Bezug auf die Länder Belgien, Niederlande, England<br />
und Frankreich untersuchte Th i e l die Zulässigkeit einer<br />
TS-Struktur 69 . Sie hat dabei festgestellt, dass keine dieser<br />
Rechtsordnungen das Institut TS ausdrücklich vorsieht, jedoch<br />
alle eine TS-Emission grundsätzlich zulassen würden.<br />
§ 4 Eingliederung in das schweizerische Akti-<br />
enrecht<br />
[Rz 20] Die Zulässigkeit von TS ist in der Schweiz noch nicht<br />
endgültig geklärt 70 . Umstritten ist insbesondere, ob die Einführung<br />
mittels Vorzugsaktien oder verschiedener Kategorien<br />
von Stammaktien geschehen soll. Nachfolgend soll daher<br />
abgeklärt werden, ob TS durch ein bestehendes Instrument<br />
eingeführt werden können oder ob es dazu eine Erweiterung<br />
des Instrumentariums bedarf.<br />
I. Bestehende Instrumente<br />
[Rz 21] Vorab ausgeschlossen werden können die Beteiligungsformen<br />
der Genuss- oder Partizipationsscheine 71 . Sowohl<br />
der Genussschein 72 als auch der Partizipationsschein 73<br />
gewähren kein Stimmrecht. Die Konsequenz daraus wäre,<br />
dass in einer TS-Gesellschaft, in der grundsätzlich nur TS<br />
vorhanden sind, kein Gesellschafter mehr ein Stimmrecht<br />
hätte.<br />
[Rz 22] Zu prüfen ist daher, ob sich die TS-Struktur mit einer<br />
der drei bekannten Aktienkategorien, Stimmrechts-,<br />
Vorzugs- oder Stammaktien, verwirklichen lässt. Die Stimmrechtsaktie<br />
verschafft dem Stimmrechtsaktionär gegenüber<br />
64 Br a u e r , S. 334.<br />
65 Vgl. Kuh n , S. 250.<br />
66 Vgl. Kuh n , S. 51.<br />
67 (Deutsches) Aktiengesetz vom 6. September 1965 in der am 31.7.2009<br />
geltenden Fassung.<br />
68 Vgl. Kuh n , S. 51; to n n e r , S. 48 f.<br />
69 Vgl. th i e L , S. 143 ff.<br />
70 Kun z , Aktienrechtsrevision, N 155.<br />
71 Gl.M. rih m , S. 49.<br />
72 Vgl. Art. 657 Abs. 2 OR (Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend<br />
die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; SR 220) und zur<br />
Rechtsnatur: me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 16 N 328.<br />
73 Art. 656a Abs. 1, Art. 656c Abs. 1 OR.<br />
6<br />
dem Stammaktionär bei gleichem Kapitaleinsatz einen höheren<br />
Stimmanteil 74 . Die TS zielen jedoch nicht auf eine<br />
Verbesserung des Stimmrechts ab, sondern enthalten eine<br />
Modifikation der Vermögensrechte. Die Stimmrechtsaktie ist<br />
daher nicht das geeignete Instrument für die Realisation einer<br />
TS-Struktur.<br />
[Rz 23] Das Instrument für die Modifikation der Vermögensrechte<br />
ist die Vorzugsaktie gemäss Art. 654 ff. OR 75 . In der<br />
Tat wird die Einführung von TS mittels Vorzugsaktien in der<br />
Lehre diskutiert. Die Eignung befürworten die Autoren Büc<br />
h i 76 , Bohrer 77 , Bö c K l i 78 , Me i e r-h ay o z /Fo r s T M o s e r 79 , li eB i 80 und<br />
Vo g T/li eB i 81 . Demgegenüber verneinen Ba u e r 82 , Rihm 83 und<br />
wahrscheinlich auch Kä g i 84 die Tauglichkeit der Vorzugsaktie<br />
für die Begründung einer TS-Struktur. Nach Art. 656 Abs. 1<br />
OR geniessen die Vorzugsaktien gegenüber den Stammaktien<br />
die Vorrechte, welche ihnen in den ursprünglichen Statuten<br />
oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt<br />
werden. Laut dem Gesetzestext werden die Vorzugsaktien<br />
also gegenüber den Stammaktien privilegiert. Dies setzt<br />
aber voraus, dass in der Gesellschaft nicht privilegierte Aktien,<br />
d.h. Stammaktien, vorhanden sind. Dies ist aber in einer<br />
TS-Struktur grundsätzlich nicht gegeben 85 . Die Gesellschaft<br />
würde damit nur aus Vorzugsaktien bestehen. Eine solche<br />
Struktur liesse sich wohl mit dem bestehenden Gesetzestext<br />
nicht vereinbaren 86 . Die Vorzugsaktien sollten, entgegen<br />
der Mehrheit der Lehre, auch aufgrund ihrer Eigenschaften<br />
nicht die rechtliche Grundlage für die Ausgestaltung einer<br />
TS-Struktur bilden. Das Charakteristikum der Vorzugsaktien<br />
besteht nämlich darin, dass sie den Vorzugsaktionären einen<br />
überschiessenden Sondervorteil gewähren 87 . Die Vorrechte<br />
sind dabei als «ein Zusatzkomplex, zu einem allen Aktien<br />
gemeinsamen Rechtskomplex zu verstehen» 88 . Nach diesen<br />
Umschreibungen wird klar, dass die Vorzugsaktien grundsätzlich<br />
die gleichen Rechte wie die Stammaktien gewähren,<br />
jedoch mit einem Mehranspruch verbunden sind. Genau<br />
dies ist allerdings nicht die Idee hinter den TS. Diese gewähren<br />
gerade nicht die gleichen Rechte wie die Stammaktien,<br />
74 Vgl. Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 24 N 100.<br />
75 Vgl. Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 41 N 26.<br />
76 Vgl. Büc h i ra F F a e L , Spin-off (Diss. Bern, 2001), S. 13.<br />
77 Vgl. Boh r e r an d r e a s , Corporate Governance and Capital Market Transac-<br />
tions in Switzerland, Zürich 2005, § 14 N 910.<br />
78 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 4 N 440.<br />
79 Vgl. me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 16 N 272.<br />
80 Vgl. Li e B i , N 36.<br />
81 Vgl. BsK or ii-Vo g t /Li e B i , Art. 654-656 N 13.<br />
82 Vgl. Bau e r , S. 158.<br />
83 Vgl. rih m , S. 49.<br />
84 Vgl. K ä g i , S. 8.<br />
85 Siehe vorne §2/I.<br />
86 Vgl. Bau e r , S. 157; rih m , S. 49.<br />
87 Li e B i , N 184 m.w.H.<br />
88 K ä g i , S. 3.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
nämlich das Recht auf den gesamten ausschüttungsfähigen<br />
Bilanzgewinn, sondern ihre Vermögensrechte sind auf einen<br />
Teil des Unternehmens beschränkt. Nach der Konzeption<br />
von Vorzugsaktien würden die TS einen Anspruch auf den<br />
ganzen Gewinn gewähren, verbunden mit dem Vorzug auf<br />
den Spartengewinn. Dies ist nicht realisierbar. Damit kann<br />
festgehalten werden, dass Vorzugsaktien kein geeignetes<br />
Mittel für die Begründung einer TS-Struktur darstellen 89 .<br />
[Rz 24] Die letzte bekannte Aktienkategorie bildet die Stammaktie.<br />
Tatsächlich schlagen Ba u e r 90 und ri hM 91 vor, die TS-<br />
Struktur mittels der Ausgabe von verschiedenen Gattungen<br />
von Stammaktien herzustellen. Die Stammaktie wird im Gesetz<br />
nirgends definiert. Die Lehre umschreibt sie unter anderem<br />
als Aktien, die nicht mit Vorrechten ausgestattet sind 92 ,<br />
d.h. es sind reguläre Aktien mit allen Rechten und Pflichten 93 ,<br />
wobei für Stammaktionäre nichts Besonderes gilt 94 . Die TS<br />
gewähren zwar ein normales Stimmrecht, ihre Vermögensrechte<br />
sind aber auf einen Unternehmensteil beschränkt.<br />
Aufgrund dieser Beschränkung kann man weder von regulären<br />
Aktien sprechen noch von Aktionären, für die nichts Besonderes<br />
gilt. Der Begriff «Stammaktie» sollte daher für Aktien<br />
reserviert bleiben, die in keiner Weise modifiziert sind.<br />
[Rz 25] Aufgrund der speziellen Eigenschaften der TS und<br />
der Schwierigkeit, sie in eine dem schweizerischen Recht<br />
bekannte Form zu giessen, sollten TS eine eigene Aktienkategorie<br />
darstellen. Ob dies möglich ist, soll im nächsten<br />
Abschnitt diskutiert werden.<br />
II. Besondere Aktienkategorie<br />
[Rz 26] Das deutsche Recht sieht in § 11 AktG ausdrücklich<br />
die Möglichkeit vor, verschiedene Aktiengattungen zu schaffen.<br />
Danach können Aktien verschiedene Rechte gewähren,<br />
namentlich bei der Verteilung des Gewinns und des Gesellschaftsvermögens.<br />
Aktien mit gleichen Rechten bilden dabei<br />
eine Gattung. Nach h.L. in Deutschland stellen die TS auch<br />
eine eigene Aktiengattung dar 95 .<br />
[Rz 27] Anders ist die Rechtslage in der Schweiz. Im Obligati-<br />
89 Für weiter Gründe, insbesondere, dass bei schlechter Performance der<br />
Sparte gar kein Vorzug besteht, siehe: Bau e r , S. 157 f. Ähnlich auch K ä g i ,<br />
S. 8.<br />
90 Vgl. Bau e r , S. 163 f.<br />
91 Vgl. rih m , S. 49.<br />
92 BSK OR II-Bau d e n B a c h e r , Art. 620 N 25; Fe h L m a n n , S. 62.<br />
93 sc h n e i d e r Jü r g e n , Die Aktiengesellschaft im schweizerischen Recht, Frank-<br />
furt am Main usw. 1996,S. 21.<br />
94 guh L th e o /dr u e y Je a n ni c o L a s , § 67 N 18 in: Theo Guhl, Das Schweizerisches<br />
Obligationenrecht, bearbeitet von Alfred Koller/Anton K. Schnyder/<br />
Jean Nicolas Druey, 9. Auflage, Zürich 2000.<br />
95 Die konkrete Ausgestaltung ist jedoch umstritten. Für einen Teil der Lehre<br />
stellen TS eine eigene Aktiengattung dar: wu n s c h , S. 2; Bau m s , S. 28 f.;<br />
Br a u e r , S. 326. Der andere Teil sieht in TS weitere Gattungen von Stamm-<br />
oder Vorzugsaktien: Kuh n , S. 11 f.; Fuc h s , S. 168; th i e L , S. 256 ff.<br />
7<br />
onenrecht wird der Begriff «Aktienkategorie» nicht definiert 96 .<br />
Das Gesetz geht jedoch an mehreren Orten davon aus, dass<br />
es verschiedene Aktienkategorien gibt 97 . Grundlegend ist<br />
dabei Art. 709 Abs. 1 OR. Dieser präzisiert, welche Faktoren<br />
als kategorienbildend anerkannt werden 98 . Erfasst wird<br />
einerseits eine Differenzierung im Stimmrecht, andererseits<br />
die Modifikation der vermögensrechtlichen Ansprüche 99 . Allgemein<br />
werden Aktienkategorien durch die Verleihung verschiedener<br />
Rechte oder verschiedener Masse von Rechten<br />
geschaffen 100 . Dabei genügt die Gewährung tatsächlicher<br />
Vorteile nicht zur Begründung einer Aktienkategorie, ohne<br />
dass dadurch der Inhalt des Aktienrechts verändert wird 101 .<br />
Wichtig ist, dass die besondere Ausgestaltung ausdrücklich<br />
in den Statuten festgelegt wird und nicht kurzfristig, sondern<br />
dauerhaft ist 102 . Generell ist zu beachten, dass das Bundesgericht<br />
eine enge Auslegung des Begriffs verlangt 103 . Fraglich<br />
ist, ob TS diese Voraussetzungen zu erfüllen vermögen. Wie<br />
im vorangegangen Abschnitt herausgefunden wurde, unterscheiden<br />
sich TS erheblich von den bekannten Aktienkategorien.<br />
Ihr Vermögensrecht, also ein kategorienbegründender<br />
Faktor, wird dahingehend modifiziert, dass sich dieses Recht<br />
nur noch auf einen bestimmten Teil des Unternehmens bezieht.<br />
Damit wird nicht nur ein tatsächlicher Vorteil gewährt,<br />
sondern es wird in den Inhalt des Rechts eingegriffen. Diese<br />
Ausgestaltung wird in den Statuten festgehalten und ist<br />
grundsätzlich auch von Dauer. Selbst mit einer restriktiven<br />
Auslegung dürften TS die Rechtsstellung der TS-Aktionäre<br />
genügend stark beeinflussen, so dass diese als eigene Aktienkategorie<br />
zu betrachten sind.<br />
§ 5 Privatautonomie und ihre Schranken<br />
I. Privatautonomie<br />
[Rz 28] Das Obligationenrecht sieht <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> nicht<br />
vor. Im vorangegangenen Abschnitt wurde herausgefunden,<br />
dass TS am besten als besondere Aktienkategorie in das<br />
schweizerische Gesellschaftsrecht eingefügt werden sollten.<br />
Fraglich bleibt nun, ob eine solche Aktienkategorie de lege<br />
lata im schweizerischen Recht grundsätzlich zulässig ist.<br />
[Rz 29] Das Gesellschaftsrecht basiert, wie das Privatrecht<br />
im Allgemeinen, auf dem Prinzip der Privatautonomie 104 . Die-<br />
96 Li e B i , N 357.<br />
97 Art. 627 Ziff. 9, 630 Ziff. 1, 650 Abs. 2 Ziff. 2, 652a Abs. 1 Ziff. 2, 653b<br />
Abs. 1 Ziff. 5, 653g Abs. 1, 656f Abs. 2, 660 Abs. 3, 689e Abs. 1, 702<br />
Abs. 2 Ziff. 1, 709 Abs. 1, 745 Abs. 1 OR.<br />
98 hom B u r g e r , N 187.<br />
99 hom B u r g e r , N 187.<br />
100 Fe h L m a n n , S. 61.<br />
101 Vgl. Fe h L m a n n , S. 61.<br />
102 Li e B i , N 357; hom B u r g e r , N 187; BGE 120 II 47 E. 2c S. 51.<br />
103 Vgl. BGE 120 II 47 E. 2c S. 50.<br />
104 Vgl. duB s , 363; Kun z , Minderheitenschutz, § 6 N 172; me i e r -sc h a t z , S. 358;<br />
KoL L e r , S. 106.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
ses Prinzip stellt sicher, dass die Rechtssubjekte in allen privatrechtlichen<br />
Rechtsangelegenheiten generell frei handeln<br />
können 105 . Die Gesellschafter besitzen damit die Möglichkeit,<br />
die konkrete Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse selber zu<br />
gestalten 106 . Insbesondere sind sie nicht auf eine ausdrückliche<br />
gesetzliche Grundlage angewiesen 107 . Die Einführung einer<br />
TS-Struktur ist damit nicht von einer gesetzlichen Grundlage<br />
abhängig, sondern liegt grundsätzlich in den Händen<br />
der Aktionäre. Entspricht es dem Willen der Gesellschafter,<br />
haben diese die Möglichkeit, eine Struktur zu wählen, welche<br />
die Beschränkung der Vermögensrechte auf einen Teil des<br />
Unternehmens vorsieht. Aus der Privatautonomie lässt sich<br />
damit die generelle Zulässigkeit von TS ableiten 108 . Die Privatautonomie<br />
gilt allerdings nicht unbegrenzt, sondern muss<br />
sich gewissen Schranken beugen. Auf diese ist nachfolgend<br />
einzugehen.<br />
II. Schranken der Privatautonomie<br />
[Rz 30] Die Privatautonomie findet ihre Grenze im zwingenden<br />
Recht 109 . Die Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Kategorienbildung<br />
endet nämlich dort, wo grundlegende Sätze des<br />
Aktienrechts verletzt werden 110 .<br />
1. Grundstruktur der Aktiengesellschaft<br />
[Rz 31] Fraglich ist, ob durch die Schaffung von TS die<br />
Grundstruktur einer Aktiengesellschaft dahingehend missachten<br />
wird, dass ein solcher Einführungsbeschluss gemäss<br />
Art. 706b Ziff. 3 OR nichtig wäre. Für das Aktienrecht sind<br />
die Bestellung der Organe sowie deren Kompetenzverteilung,<br />
ein Aktienkapital, das in Titel zerlegt ist, welche einen<br />
Nennwert aufweisen, und die fehlende Nachschusspflicht<br />
der Aktionäre bzw. deren begrenzte Haftung zwingend vorgeschrieben<br />
111 . Diese Punkte werden durch die Einführung<br />
einer TS-Struktur nicht tangiert. Berücksichtig man ausserdem<br />
die Zurückhaltung der Lehre und des Bundesgerichts<br />
bei der Anwendung der Nichtigkeit 112 , dürfte die Schaffung<br />
von TS kaum die Nichtigkeit evozieren 113 .<br />
2. Gemeinsamer Zweck<br />
[Rz 32] Die Grundlage einer jeden Gesellschaft bildet die gemeinsame<br />
Zweckverfolgung 114 . In einer Aktiengesellschaft mit<br />
einer TS-Struktur könnte die gemeinsame Zweckverfolgung<br />
105 Vgl. duB s , S. 363.<br />
106 Vgl. duB s , S. 363; KoL L e r , S. 115.<br />
107 Vgl. duB s , 363; me i e r -sc h a t z , S. 358.<br />
108 Gl.M. rih m , S. 49.<br />
109 Vgl. duB s , 364; Ku n z , Minderheitenschutz, § 6 N 173; KoL L e r , s. 115.<br />
110 Fe h L m a n n , S. 61.<br />
111 rih m , S. 49.<br />
112 Vgl. dazu: Böc K L i , Aktienrecht, § 16 N 157 m.w.H.<br />
113 Gleiches Ergebnis in Deutschland, wo kein Verstoss gegen das Wesen der<br />
Aktiengesellschaft gesehen wird. Vgl. dazu: Kuh n , s. 40 ff. m.w.H.<br />
114 Vgl. dazu: me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 1 N 65 ff.<br />
8<br />
deshalb in Frage gestellt sein, weil sich das Interesse der TS-<br />
Aktionäre primär auf den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Sparte<br />
bezieht 115 . Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Motive,<br />
d.h. die persönlichen Beweggründe der Beteiligten, vom<br />
gemeinsamen Zweck zu unterscheiden sind 116 . Die Spartenaktionäre<br />
verfolgen trotz unterschiedlicher Interessen dennoch<br />
einen gemeinsamen Zweck, nämlich denjenigen, den<br />
sie in den Statuten umschrieben haben. Dies ergibt sich aus<br />
der rechtlichen Einheit, die von der TS-Struktur unberührt<br />
bleibt 117 . Die Spartenaktionäre haben zudem neben ihren eigenen<br />
Interessen auch ein erhebliches Interesse daran, dass<br />
es den anderen Sparten und damit dem Unternehmen insgesamt<br />
gut geht 118 . Dies zum einen, weil eine gemeinsame<br />
Haftung aller Sparten bezüglich den Unternehmensschulden<br />
besteht, und zum anderen, weil keine Sparte eine Dividende<br />
erhält, wenn der Bilanzgewinn negativ ist 119 . Damit kann<br />
festgehalten werden, dass die Einführung einer TS-Struktur<br />
keinen Einfluss auf die gemeinsame Zweckverfolgung der<br />
Gesellschafter hat 120 .<br />
3. Gleichbehandlungs- und Sachlichkeitsgebot<br />
[Rz 33] Das Gleichbehandlungsprinzip stellt ein selbständiger<br />
Grundsatz des Aktienrechts dar, der in Art. 706 Abs. 2 Ziff. 3<br />
OR und in Art. 717 Abs. 2 OR kodifiziert ist 121 . Im Rahmen des<br />
Gleichbehandlungsprinzips muss zwischen der relativen und<br />
der absoluten Gleichbehandlung unterschieden werden 122 .<br />
Von der absoluten Gleichbehandlung werden die Kernbereiche<br />
der aktienrechtlichen Mitgliedschaft gemäss Art. 706b<br />
Abs. 1 und 2 OR erfasst 123 . In diesem Kernbereich ist eine<br />
Differenzierung strengstens verboten 124 . Die Vermögensrechte<br />
werden davon nicht erfasst und fallen deshalb unter die<br />
relative Gleichbehandlung 125 . Die Generalversammlung ist<br />
damit grundsätzlich befugt, die Vermögensrechte zu modifizieren<br />
126 . Die Einführung einer TS-Struktur führt in casu aber<br />
zu einer Benachteiligung der bisherigen Aktionäre, weil sich<br />
deren Vermögensrecht nicht mehr auf alle Unternehmensteile<br />
bezieht. Damit liegt eine Ungleichbehandlung vor, die nach<br />
Art. 706 Abs. 1 Ziff. 3 OR nur zulässig ist, wenn sie durch den<br />
Gesellschaftszweck gerechtfertigt werden kann 127 . Die Frage<br />
115 wu n s c h , S. 45.<br />
116 Vgl. me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 1 N 70; th i e L , S. 228.<br />
117 Siehe vorne §2/I.<br />
118 Vgl. wu n s c h , S. 47.<br />
119 Siehe hinten §7/II/1.3.<br />
120 Vgl. rih m , 49. Gl.M. für das deutsche Recht: wu n s c h , S. 48; th i e L , S. 228;<br />
Br a u e r , S. 327.<br />
121 Vgl. Li e B i , n 147 m.w.H.<br />
122 Vgl. dazu: hug u e n i n Ja c o B s , S. 37 ff.<br />
123 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 69. Vgl. auch: Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 39<br />
N 71 ff.<br />
124 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 37.<br />
125 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 81 f.<br />
126 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 71.<br />
127 Die h.L. versteht unter Gesellschaftszweck nicht den thematischen Zweck,
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
der Rechtfertigung kann abstrakt nicht beantwortet werden;<br />
dies kann nur durch eine konkrete Interessenabwägung geschehen<br />
128 . Verfolgt das Unternehmen jedoch das Interesse,<br />
seinen Börsenwert zu steigern oder eine Akquisition zu tätigen,<br />
ist die Einführung von TS sicher ein geeignetes Mittel,<br />
um diese legitime Ziele zu erreichen 129 . Das Bundesgericht<br />
stellt ausserdem fest, dass die ökonomischen Konsequenzen<br />
nicht für alle Aktionäre dieselben sein müssen 130 .<br />
[Rz 34] Die Einschränkung von Aktionärsrechten muss, selbst<br />
wenn das Gleichbehandlungsprinzip gewahrt bleibt 131 , dem<br />
Sachlichkeitsgebot gemäss Art. 706 Abs. 1 Ziff. 2 OR entsprechen<br />
132 . Eine abschliessende Beurteilung ist auch hier<br />
nicht möglich. Diese hängt wiederum von der konkreten Interessenabwägung<br />
ab 133 . Es kann jedoch festgestellt werden,<br />
dass die Motive, die mit der Einführung von TS verfolgt werden,<br />
grundsätzlich die Interessen der Gesellschaft verfolgen<br />
und nicht nur zur Verfolgung persönlicher Ziele dienen. Zu<br />
beachten ist auch, dass die Unternehmensübernahme und<br />
die Beteiligung der Mitarbeiter, beides mögliche Motive für<br />
die Einführung von TS, wichtige Gründe gemäss Art. 652b<br />
Abs. 2 OR darstellen. Diese Gründe legitimieren den Entzug<br />
eines Vermögensrechts und sollten daher auch sachliche<br />
Gründe für die Beschränkung von Vermögensrechten allgemein<br />
bilden.<br />
Dritter Teil: Konkrete Beurteilung der Reali-<br />
sierbarkeit<br />
§ 6 Einführung einer TS-Struktur<br />
I. Spartenorganisation<br />
[Rz 35] TS verfolgen die wirtschaftliche Entwicklung eines<br />
Unternehmensteils. Damit dies überhaupt möglich ist, muss<br />
der verfolgte Unternehmensteil genau definiert und vom restlichen<br />
Unternehmen abgegrenzt werden 134 . Dazu dient die<br />
Spartenorganisation 135 . Darunter versteht man die interne<br />
Aufteilung einer Aktiengesellschaft in weitgehend autonome<br />
Geschäftsbereiche 136 . Die Aufteilung kann dabei nach Pro-<br />
sondern die Gesellschaftsinteressen. Vgl. dazu: Li e B i , n 152 m.w.H.<br />
128 Vgl. Kun z , Minderheitenschutz, § 9 N 84.<br />
129 Für die Zurückhaltung der Gerichte bei der Beurteilung von Mehrheitsent-<br />
scheiden: Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 16 N 117.<br />
130 BGE 117 II 290 E. 6b S. 312.<br />
131 Das Verhältnis zwischen Sachlichkeitsgebot und Gleichbehandlungsprin-<br />
zip ist umstritten. Vgl. dazu: Li e B i , N 154.<br />
132 Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 39 N 87; Li e B i , N 155.<br />
133 Vgl. Kun z , Minderheitenschutz, § 9 N 80.<br />
134 Vgl. Fuc h s , S. 178.<br />
135 Für die Abgrenzung zur Funktionalorganisation siehe: noL t e , s. 182.<br />
136 Vgl. th i e L , S. 214.<br />
9<br />
dukten, Kunden oder Absatzregionen erfolgen 137 . Fraglich<br />
ist, welches Organ für die Implementierung einer Spartenorganisation<br />
zuständig ist. Die Festlegung der Organisation<br />
der Gesellschaft gehört gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 2 OR<br />
zu den Aufgaben des Verwaltungsrats. Diese Aufgabe beinhaltet<br />
zum einen die Festlegung der Spitzenorganisation 138 ,<br />
zum anderen aber auch die Festlegung der Grundstruktur<br />
des Unternehmens 139 . Ein Bestandteil der Festlegung der<br />
Grundstruktur besteht in der Organisation der Gesellschaft<br />
in funktionaler und spartenbezogener Hinsicht 140 . Der Verwaltungsrat<br />
entscheidet daher über die Einführung und den<br />
Umfang jeder Sparte 141 . Zu beachten ist, dass diese Aufgabe<br />
einerseits unübertragbar und andererseits unentziehbar<br />
ist. Damit ist weder die Delegation dieser Entscheidung an<br />
das Management noch der Entzug dieser Kompetenz durch<br />
die Generalversammlung gestattet 142 . Der Verwaltungsrat erhält<br />
damit eine immense Macht, weil er grundsätzlich alleine<br />
entscheiden kann, welche Vermögenswerte einer Sparte zukommen.<br />
Es wird zu untersuchen sein, ob es dazu ein Korrektiv<br />
gibt 143 .<br />
II. Spartenrechnungslegung<br />
1. Funktionen und Grundproblem<br />
[Rz 36] Eine Spartenrechnungslegung verfolgt grundsätzlich<br />
zwei Funktionen 144 . Zum einen übernimmt sie eine Ausschüttungsbemessungsfunktion<br />
145 . Die Spartenrechnungslegung<br />
grenzt den Spartengewinn, welcher von der konkreten Sparte<br />
erwirtschaften wurde und damit grundsätzlich nur den Spartenaktionären<br />
zusteht, vom restlichen Unternehmensgewinn<br />
ab. Damit wird die Grundlage für eine rechtmässige Dividendenausschüttung<br />
geschaffen 146 . Zum anderen übernimmt sie<br />
auch eine wichtige Rechenschafts- und Informationsfunktion<br />
147 . Die TS-Aktionäre, aber auch allfällige Investoren können<br />
sich ein genaues Bild von der wirtschaftlichen Lage der<br />
jeweiligen Sparte machen 148 . Eine umfassende Information<br />
verkleinert zudem den Spielraum des Verwaltungsrats und<br />
reduziert damit die Gefahr einer Ungleichbehandlung 149 .<br />
137 Vgl. noL t e , S. 182.<br />
138 Vgl. dazu: Böc K L i , Kernkompetenzen, S. 24.<br />
139 Vgl. Böc K L i , Kernkompetenzen, S. 25.<br />
140 Vgl. Böc K L i , Kernkompetenzen, S. 25.<br />
141 Allgemeine Grundsätze zur Spartenbildung bei: Pr i n z /sc h ü r n e r , s. 766.<br />
142 Vgl. Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 30 N 35. Weiterführendes bei: Böc K L i ,<br />
Kernkompetenzen, S. 31 ff.<br />
143 Siehe hinten §8/III/2.<br />
144 Allgemein bezüglich den Rechnungslegungsfunktionen siehe: PF i F F n e r ,<br />
n 222 ff.<br />
145 Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />
146 Vgl. Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />
147 Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />
148 Vgl. Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />
149 Vgl. to n n e r , S. 227.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
[Rz 37] Das Grundsatzproblem der Spartenrechnungslegung<br />
besteht darin, dass sie nicht kodifiziert ist. Die meisten<br />
europäischen Länder 150 sowie die International Financial Reporting<br />
Standards (IFRS) 151 und die United States Generally<br />
Accepted Accounting Principles (US GAAP) 152 sehen zwar<br />
eine Pflicht zur sog. «Segmentsberichtserstattung» vor. Diese<br />
stellt jedoch nach h.L. kein Äquivalent zu einer Spartenrechnungslegung<br />
dar, weil sie keine Vorschriften über die<br />
Handhabung von Gemeinschaftskosten sowie -aktiva enthält<br />
und damit für die Gewinnermittlung ungeeignet ist 153 . Zudem<br />
muss die vorgeschriebene Segmentaufteilung nicht der<br />
Spartenaufteilung entsprechen 154 .<br />
2. Spartenrechnungslegung im amerikanischen und<br />
deutschen Recht<br />
[Rz 38] Im amerikanischen Recht wurden trotz fehlender<br />
gesetzlicher Spartenrechnungslegung, TS erfolgreich emittiert<br />
155 . Die praktische Umsetzung der Spartenrechungslegung<br />
erfolgte dahingehend, dass die TS-Emittenten neben<br />
dem Konzernabschluss drei separate Spartenabschlüsse<br />
(sog. «Financial Statements»), bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung<br />
und Kapitalflussrechnung, für den jeweils getrackten<br />
Bereich erstellt haben und diese von unabhängigen<br />
Wirtschaftsprüfern kontrolliert liessen 156 . Die amerikanische<br />
Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission),<br />
hat diese Art der Berichterstattung geprüft und für zulässig<br />
befunden 157 . Die SEC verlangt jedoch, dass die Spartenabschlüsse<br />
immer mit dem Konzernabschluss an die Aktionäre<br />
verteilt werden und in den Spartenabschlüssen ausdrücklich<br />
darauf hingewiesen wird, dass diese nur im Zusammenhang<br />
mit dem Konzernabschluss gelesen werden dürfen 158 . Dies<br />
sei notwendig, um die Spartenaktionäre daran zu erinnern,<br />
dass sie immer noch am Gesamtunternehmen beteiligt sind<br />
und daher auch die Verluste der anderen Sparten mit zu tragen<br />
haben 159 .<br />
[Rz 39] In Deutschland wurden noch keine TS emittiert. Die<br />
Ausführungen zur Spartenrechnungslegung basieren daher<br />
auf theoretischen Überlegungen. Es wurde eingehend untersucht,<br />
ob sich eine Spartenrechnungslegung aus den bestehenden<br />
gesetzlichen Grundlagen ergibt. Sowohl die Seg-<br />
150 Vgl. th i e L , S. 191 ff.<br />
151 IFRS 8.<br />
152 Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 131.<br />
153 Vgl. Kuh n , s. 210 m.w.H.<br />
154 Vgl. to n n e r , S. 240.<br />
155 Vgl. to n n e r , s. 239. Für eine kurze Zusammenfassung der rechtlichen<br />
Grundlagen der amerikanischen Rechnungslegung siehe: noL t e , s. 67 ff.<br />
und th i e L , s. 78 ff.<br />
156 Vgl. to n n e r , S. 240; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 761; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 526.<br />
157 Vgl. to n n e r , S. 240; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 761.<br />
158 Vgl. to n n e r , s. 240 f.m.w.H. Für eine Formulierung siehe: th i e L , s. 86<br />
(FN 381).<br />
159 Vgl. noL t e , S. 80.<br />
10<br />
mentsberichtserstattung im Anhang (§ 285 Abs. 4 HGB 160 ) 161<br />
als auch die Generalklausel von § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB 162<br />
erfüllen jedoch die Anforderungen an eine Spartenrechnungslegung<br />
nicht. Ba u M s stellte aufgrund dieser fehlenden<br />
gesetzlichen Grundlage fest, dass das deutsche Recht auf<br />
Einführung von TS nicht vorbereitet sei 163 . Die notwendige<br />
Publizität könne nach ihm nicht auf der Ebene eines einzelnen<br />
Unternehmens hergestellt werden, sondern diesbezüglich<br />
sei eine Weiterentwicklung des Handelsrechts notwendig<br />
164 . Demgegenüber vertritt die h.L. die Meinung, dass eine<br />
freiwillige Spartenrechnungslegung nach amerikanischem<br />
Vorbild für die Einführung von TS ausreiche 165 . Dazu werden<br />
in der Satzung detaillierte Rechnungslegungsstandards in<br />
Bezug auf die Verteilung der Aktiven und Passiven sowie der<br />
Verrechnungspreise definiert 166 . Die nach den Satzungsbestimmungen<br />
ermittelten Spartenabschlüsse werden danach<br />
als separate Spartenabschlüsse veröffentlicht 167 . Umstritten<br />
ist, ob das deutsche Börsenrecht eine Kontrollfunktion übernehmen<br />
kann 168 .<br />
3. Spartenrechnungslegung in der Schweiz<br />
3.1. Gesetzliche Grundlage<br />
[Rz 40] Das schweizerische Obligationenrecht schweigt sich<br />
sowohl über eine Segmentsberichterstattung als auch über<br />
eine Spartenrechnungslegung aus 169 . Eine Segmentsberichterstattung<br />
sehen jedoch die Swiss GAAP FER vor. Swiss<br />
GAAP FER 30 (2009) Ziff. 42 verlangt eine Aufgliederung der<br />
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen nach geographischen<br />
Märkten und Geschäftsbereichen. Diese Regelung<br />
entspricht damit etwa derjenigen von § 285 Abs. 4 HGB und<br />
eignet sich daher nicht für eine Spartenrechnungslegung.<br />
Eine Pflicht zur Segmentsberichterstattung ergibt sich zudem<br />
für Publikumsgesellschaften. Nach Art. 6 RLR 170 sind Gesellschaften,<br />
die im Hauptsegment kotiert sind, verpflichtet, IFRS<br />
oder US-GAAP als Rechnungslegungsstandard zu verwenden.<br />
Wie bereits festgestellt wurde, sehen diese Standards<br />
keine Spartenrechnungslegung vor. Die Ausgangslage entspricht<br />
damit etwa derjenigen in Deutschland und Amerika.<br />
160 (Deutsches) Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 in der am 31.7.2009<br />
geltenden Fassung.<br />
161 Vgl. to n n e r , s. 231 f.; Pr i n z /sc h ü r n e r , s. 762f. Für § 297 Abs.1 Satz 2 HGB<br />
siehe: Kuh n , s. 209 f.<br />
162 Vgl. Kuh n , S. 211 f.m.w.H.; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 764.<br />
163 Vgl. Bau m s , S. 35.<br />
164 Bau m s , S. 34.<br />
165 Vgl. Kuh n , S. 214 f.; to n n e r , S. 241; th i e L , s. 285.<br />
166 Kuh n , S. 221.<br />
167 Vgl. dazu: Kuh n , S. 219 ff.<br />
168 Pro: to n n e r , s. 242 ff.; Kontra: Kuh n , s. 213 f., 220 f.<br />
169 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 8 N 437. Daran ändert auch die Aktienrechtsre-<br />
vision nichts.<br />
170 Richtlinie betreffend Rechnungslegung (RLR) vom 29. Oktober 2008 der<br />
SIX Swiss Exchange.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
Es muss somit geprüft werden, ob eine freiwillige Spartenrechnungslegung<br />
eingeführt werden könnte.<br />
3.2. Freiwillige Einführung<br />
[Rz 41] Bei der freiwilligen Einführung einer Spartenrechnungslegung<br />
stellen sich drei Grundfragen. Erstens muss<br />
untersucht werden, wer für die inhaltliche Gestaltung zuständig<br />
ist. Zweitens muss die Form der Publikation festgelegt<br />
werden und drittens ist abzuklären, wer eine solche Spartenrechnungslegung<br />
kontrolliert.<br />
3.2.1. Zuständigkeiten<br />
[Rz 42] Nach dem vermeintlich klaren Wortlaut von Art. 716a<br />
Abs. 1 Ziff. 3 OR ist die Ausgestaltung der Rechnungslegung<br />
eine Kernkompetenz des Verwaltungsrates. Die Qualifikation<br />
dieser Aufgabe als Kernkompetenz hat zur Folge, dass die<br />
GV keine Entscheidungsbefugnis besitzt. Damit wäre eine<br />
Festlegung der Spartenorganisation in den Statuten, wie<br />
es das deutsche und amerikanische Recht vorsehen, nicht<br />
möglich. Diese Meinung wird insbesondere durch Bö c K l i vertreten,<br />
welcher der Generalversammlung sämtliche Zuständigkeiten<br />
auf dem Gebiet der Rechnungslegung abspricht 171 .<br />
Dieser Ansicht widerspricht hingegen Be r T s c h i n g e r, der für<br />
eine restriktive Auslegung von Art. 716a OR eintritt 172 . Ihm<br />
folgt PF iF F n e r, der aufgrund der Rechenschaftsfunktion der<br />
Jahresrechnung sogar einen Interessenkonflikt sieht, wenn<br />
der Verwaltungsrat selbst die Regeln festlegt, nach welchen<br />
er beurteilt wird 173 . Auch die Aktienrechtsrevision geht in diese<br />
Richtung, indem sie in Art. 962 Abs. 2 E-OR vorsieht, dass<br />
die Zuständigkeit mittels Statuten auf die Generalversammlung<br />
übertragen werden kann 174 .<br />
[Rz 43] In Bezug auf die Einführung einer Spartenrechnungslegung<br />
sollte es der Generalversammlung möglich sein, auf<br />
dem Gebiet der Rechnungslegung Beschlüsse zu fassen.<br />
Dies einerseits, weil damit die Vormachtstellung des Verwaltungsrates<br />
etwas beschränkt und andererseits durch die<br />
Festlegung von mehrheitsfähigen Grundsätzen allfälligen<br />
Konflikten zwischen den Aktionären vorgebeugt werden<br />
kann. Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass eine<br />
detaillierte Regelung der Rechnungslegung in den Statuten<br />
nicht das Ziel sein kann. Die Statuten müssten sich auf die<br />
Festlegung von Grundsätzen beschränken 175 . Besondere<br />
Aufmerksamkeit sollte dabei der Festlegung von Grundsatzangaben<br />
in Bezug auf die Verteilung der Aktiven und Passiven<br />
und der Regelung der Transferpreise geschenkt wer-<br />
171 Böc K L i , Aktienrecht, § 12 N 34, 13 N 343.<br />
172 Be r t s c h i n g e r ur s , Ausgewählte Fragen zur Einberufung, Traktandierung<br />
und Zuständigkeit der Generalversammlung, AJP 8 (2001), S. 901 ff., S.<br />
90 ff.<br />
173 PF i F F n e r , N 273.<br />
174 Vgl. Bot s c h a F t aK t i e n r e c h t 2007, S. 1720. Siehe auch Art. 716a Abs. 1 Ziff.<br />
3 E-OR.<br />
175 A.M. to n n e r , S. 225.<br />
11<br />
den 176 . Die detaillierte Ausgestaltung dieser Grundsätze fällt<br />
demgegenüber in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates<br />
gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3 OR.<br />
3.2.2. Publikation<br />
[Rz 44] In Bezug auf die Publikation der Abschlüsse jeder<br />
Sparte sollte dem amerikanischen und deutschen Recht<br />
gefolgt und für jede Sparte ein separater Geschäftsbericht<br />
veröffentlicht werden. Diese Art der Publikation ist einerseits<br />
der Eingliederung der Spartenabschlüsse in den Anhang der<br />
Konzernrechnung und andererseits der Untergliederung der<br />
einzelnen Bilanzpositionen vorzuziehen. Dies darum, weil der<br />
Anhang vorwiegend der Erläuterung und Ergänzung dient 177<br />
und eine Untergliederung der einzelnen Positionen die Übersichtlichkeit<br />
beeinträchtigt 178 . Ein separat veröffentlichter<br />
Spartenabschluss dürfte im Einklang mit den Grundsätzen<br />
von Art. 662a OR stehen. Die Möglichkeit der Beurteilung der<br />
Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft wird durch separate<br />
Publikationen der einzelnen Sparten stark verbessert.<br />
Gleich wie im amerikanischen Recht sollten jedoch die jeweiligen<br />
Spartengeschäftsberichte immer mit dem Konzernabschluss<br />
an die Aktionäre verteilt werden.<br />
3.2.3. Kontrolle<br />
[Rz 45] Da in einer TS-Gesellschaft mindestens zwei verschiedene<br />
Gruppen von Aktionären bestehen, ist eine intensive<br />
Kontrolle der Rechnungslegung unerlässliche Voraussetzung<br />
für die Vermeidung von Interessenkonflikten. Das<br />
schweizerische Aktienrecht sieht für die Kontrolle der Rechnungslegung<br />
die Revisionsstelle gemäss Art. 727 ff. OR vor.<br />
Im Zusammenhang mit TS ist insbesondere auf Art. 731a<br />
Abs. 1 OR hinzuweisen. Dieser bestimmt, dass die Statuten<br />
und die Generalversammlung die Aufgaben der Revisionsstelle<br />
erweitern können. Dies wird einerseits nötig sein, um<br />
die einzelnen Spartenabschlüsse einer Revision zu unterstellen<br />
179 . Andererseits sollten die TS-Aktionäre von dieser<br />
Möglichkeit intensiv Gebrauch machen und so z.B. die Prüfungsintensität<br />
erhöhen oder die Berichterstattungspflicht<br />
erweitern 180 . Damit wird mehr Transparenz geschaffen und<br />
der Spielraum für Ungleichbehandlungen verkleinert, was<br />
zu einer Reduktion von Konfliktsituationen führt. Weiter ist<br />
zu beachten, dass die Revisionsstelle der Revisionshaftung<br />
nach Art. 755 OR untersteht.<br />
[Rz 46] Im amerikanischen Recht wird die Rechnungslegung<br />
zudem durch die Börsenaufsicht SEC überprüft. Die Einhaltung<br />
der Rechnungslegung wird auch in der Schweiz durch<br />
die Börse kontrolliert und bei Verletzung mit Sanktionen be-<br />
176 Näheres bei: Kuh n , S. 222 ff.; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 762, 766 f.<br />
177 Böc K L i , Aktienrecht, § 8 N 360.<br />
178 Vgl. Kuh n , S. 218 f.<br />
179 Art. 728a Abs. 1 Ziff. 1 OR umfasst vom Wortlaut her keine<br />
Spartenabschlüsse.<br />
180 Vgl. PF i F F n e r , N 1091 ff.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
straft 181 . Geht man von der Annahme aus, dass die meisten<br />
Gesellschaften, die TS ausgeben, börsenkotiert sind, so wird<br />
die Rechnungslegung damit durch zwei voneinander unabhängigen<br />
Instanzen kontrolliert.<br />
III. Konkrete Einführungsmöglichkeiten<br />
1. Einführung bei der Gründung<br />
[Rz 47] Die Einführung von TS bei der Gründung einer Aktiengesellschaft<br />
sollte keine grösseren Schwierigkeiten bereiten<br />
182 . Wie schon festgestellt wurde, gehören die Vermögensrechte<br />
nicht zu den zwingenden Aktionärsrechten 183 .<br />
Die Gründer können damit bei der Errichtung der Gesellschaft<br />
bestimmen, dass ihr eine TS-Struktur zugrunde gelegt<br />
wird 184 . Dabei sind zwei Punkte zu beachtet: Erstens ist die<br />
Zeichnung nach Art. 630 OR nur gültig, wenn die Kategorie<br />
der Aktien angegeben wird. Die Gründer müssen daher ausdrücken,<br />
dass sie TS zeichnen. Zweitens müssen die TS in<br />
den Statuten umschrieben werden. Die Schaffung einer TS-<br />
Struktur sollte zum einen im Zweckartikel der Gesellschaft<br />
berücksichtigt werden 185 . Zum anderen sollten analog zur<br />
Schaffung von Vorzugsaktien gemäss Art. 627 Ziff. 9 OR die<br />
Rechte der TS-Aktionäre in den Statuten umschrieben werden.<br />
Zu beachten ist, dass die Festlegung der Statuten bei<br />
der Gründung einstimmig zu erfolgen hat 186 .<br />
2. Einführung bei einer bestehenden Gesellschaft<br />
[Rz 48] Die Einführung von TS bei einer bestehenden Gesellschaft<br />
ist gegenüber der Schaffung in der Gründungsphase<br />
mit erheblich grösseren Problemen belastet. Zu prüfen ist<br />
vorerst, welche Grundsatzbeschlüsse die Generalversammlung<br />
treffen muss, wenn sie die Einführung von TS erwägt.<br />
Anschliessend werden konkrete Einführungsmöglichkeiten<br />
diskutiert.<br />
2.1. Generelle Beschlüsse<br />
[Rz 49] Werden TS bei einer bestehenden Aktiengesellschaft<br />
eingeführt, so benötigt dies grundsätzlich drei generelle Beschlüsse<br />
der Generalversammlung. Die ersten beiden Beschlüsse<br />
betreffen die Statuten und sind dieselben wie bei<br />
der Einführung in der Gründungsphase. Danach muss auch<br />
bei einer bestehenden Gesellschaft der Zweckartikel angepasst<br />
und die Rechte der TS-Aktionäre in den Statuten umschrieben<br />
werden.<br />
[Rz 50] In den meisten Fällen kommt noch ein dritter Beschluss<br />
hinzu. Durch die Einführung von TS werden grundsätzlich<br />
181 Art. 49-51 und 59 ff. KR (Reglement über die Zulassung von Effekten an<br />
der SIX Swiss Exchange vom 24. Januar 1996). Allgemein dazu siehe:<br />
Böc K L i , Aktienrecht, § 7 N 32a ff.<br />
182 to n n e r , S. 247 m.w.H.<br />
183 Siehe vorne §5/II/3.<br />
184 Bezüglich der Freiheit der Gründer siehe auch: hug u e n i n Ja c o B s , s. 32 f.<br />
185 Vgl. rih m , S. 49.<br />
186 BSK OR II-sc h e n K e r , Art. 629 N 6.<br />
12<br />
sämtliche Aktien zu TS 187 . Daher müssen die bestehenden<br />
Aktien in TS umgewandelt werden 188 . Das Aktienrecht sieht<br />
die Umwandlung von Inhaber in Namenaktien und umgekehrt<br />
gemäss Art. 622 Abs. 3 OR und die Umwandlung von<br />
Stammaktien in Vorzugsaktien gemäss Art. 654 Abs. 1 OR<br />
vor 189 . In casu wird nicht eine Aktienart in eine andere, sondern<br />
es werden Aktienkategorien umgewandelt. Fraglich ist<br />
damit, ob Art. 654 Abs. 1 OR analog auf die Umwandlung<br />
von Stammaktien in <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> angewendet werden<br />
kann. Entscheidend für eine analoge Anwendung ist, dass<br />
die beiden Sachverhalte gleichwertig sind 190 . Die Gleichwertigkeit<br />
sollte in casu kein Problem darstellen, weil beide Fälle<br />
die Umwandlung einer Aktienkategorie zum Gegenstand haben.<br />
Die Umwandlung von Stammaktien in TS sollte damit<br />
grundsätzlich durch eine analoge Anwendung von Art. 654<br />
Abs. 1 OR möglich sein 191 . In diesem Zusammenhang muss<br />
noch erwähnt werden, dass das Bundesgericht es abgelehnt<br />
hat, dem Aktionär ein wohlerworbenes Recht auf die<br />
Beibehaltung der Aktienkategorie zu verschaffen 192 . Neben<br />
diesen generellen Beschlüssen sind weitere Beschlüsse nötig,<br />
je nachdem welche Art der Einführung gewählt wird. Eine<br />
Auswahl dieser Einführungsmöglichkeiten wird nachfolgend<br />
dargestellt.<br />
2.2. Einführungsmöglichkeit ohne Zufluss von neuem<br />
Kapital<br />
[Rz 51] Sollen TS nur im Rahmen der Reorganisation eingeführt<br />
werden, stehen drei Möglichkeiten im Vordergrund.<br />
2.2.1. Aktiensplit<br />
[Rz 52] Die Generalversammlung hat gemäss Art. 623 OR<br />
die Möglichkeit, ihre Aktien in solche von kleinerem Nennwert<br />
zu zerlegen, wobei das Aktienkapital unverändert bleibt.<br />
Die Herabsetzung des Nennwerts hat der Aktionär grundsätzlich<br />
hinzunehmen 193 . Damit könnte ein Untenehmen, das<br />
in zwei Sparten organisiert ist, den Nennwert halbieren und<br />
jedem Aktionär eine Aktie der Sparte A und eine der Sparte<br />
B aushändigen 194 . Dies würde einen Generalversammlungsbeschluss<br />
gemäss Art. 703 OR bedingen. Der Aktiensplit ist<br />
jedoch nicht möglich, wenn die Gesellschaft bereits den Mindestnennwert<br />
von einem Rappen gemäss Art. 622 Abs. 4 OR<br />
erreicht hat 195 .<br />
187 Siehe vorne §2/I.<br />
188 NoL t e , S. 275. Für eine automatische Umwandlung: Kuh n , s. 10.<br />
189 Vgl. dazu: BSK OR II-Vo g t /Li e B i , Art. 654-656 N 56.<br />
190 me i e r -ha y o z , Art. 1 N 347.<br />
191 Fraglich ist, ob der Umwandlungsbeschluss auch durch den VR aufgrund<br />
einer statutarischen Kompetenzbestimmung gefällt werden könnte. Vgl.<br />
Li e B i , n 348.<br />
192 BGE 120 II 47 E. 2b S. 49.<br />
193 BsK or ii-Bau d e n B a c h e r , Art. 623 N 6 (mit Hinweis auf BGE 86 II 79, E. 3 S.<br />
82).<br />
194 Für ein Beispiel siehe: wu n s c h , S. 79 f.<br />
195 Gemäss Art. 622 Abs. 4 E-OR darf der Nennwert zukünftig unter einem<br />
Rappen liegen, muss aber grösser als Null sein. Vgl. dazu Bot s c h a F t
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
2.2.2. Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln<br />
[Rz 53] Die Gesellschaft kann nach Art 652d Abs. 1 OR das<br />
Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital<br />
erhöhen. In einem Unternehmen mit zwei Sparten<br />
würde z.B. das bisherige Kapital der Sparte A zugewiesen,<br />
währenddem das neue Kapital der Sparte B zugute käme.<br />
Den Aktionären würden damit im Verhältnis zu ihrem bisherigen<br />
Anteil neue Aktien zugewiesen. Die Schwierigkeit dieser<br />
Variante besteht offensichtlich darin, dass die Gesellschaft<br />
genügend frei verwendbares Eigenkapital besitzen muss.<br />
2.2.3. Ausschüttung einer Sachdividende<br />
[Rz 54] Die TS-Struktur könnte auch durch die Ausschüttung<br />
einer Sachdividende eingeführt werden. Im Gegensatz<br />
zum deutschen Recht 196 sieht das schweizerische Recht die<br />
Ausschüttung einer Sachdividende jedoch nicht ausdrücklich<br />
vor 197 . Die Ausschüttung wird aber als zulässig erachtet,<br />
wenn die Gleichbehandlung gewahrt wird, die Sache bargeldnah<br />
oder leicht verwertbar sowie werthaltig ist und ein<br />
sachlicher Grund besteht 198 . Diese Voraussetzungen dürften<br />
bei der gleichmässigen Ausschüttung der TS, die leicht verwertbar<br />
und werthaltig sind, durchaus gegeben sein.<br />
2.2.4. Verschmelzung mit einer Tochtergesellschaft<br />
[Rz 55] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das<br />
Unternehmen, das die Einführung von TS plant, ein neues<br />
Unternehmen gründet und dort bereits eine TS-Struktur implementiert<br />
199 . Danach übernimmt diese Tochtergesellschaft<br />
die Muttergesellschaft mittels einer Absorptionsfusion 200 .<br />
Der Nachteil dieser Variante besteht im grossen rechtlichen<br />
Aufwand 201 .<br />
2.3. Einführungsmöglichkeiten mit Zufluss von neuem<br />
Kapital<br />
[Rz 56] Eine Aktiengesellschaft kann ihr Aktienkapital grundsätzlich<br />
mittels der ordentlichen 202 , der genehmigten 203 oder<br />
aK t i e n r e c h t 2007, S. 1637.<br />
196 Vgl. § 58 Abs. 5 AktG. Eingehend für das deutsche Recht: Pr i n z uL r i c h /<br />
sc h ü r n e r ca r L th o m a s , <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> und Sachdividenden - ein neues<br />
Gestaltungsinstrument für spartenbezogene Gesellschaftsrechte?, Deutsches<br />
Steuerrecht (DStR) (6) 2003, S. 181 ff.<br />
197 Allg. siehe: Pe t e r For s t m o s e r , Sachausschüttungen im Gesellschaftsrecht,<br />
in: Pe t e r Fo r s t m o s e r usw. (Hrsg.), Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag,<br />
Zürich 1989, S. 702 ff.<br />
198 Böc K L i , Aktienrecht, § 12 N 536.<br />
199 Eingehend für das deutsche Recht: to n n e r , s. 276 ff.<br />
200 Umstritten ist, ob dieser Typus der Fusion auch unter Art. 23 FusG (Bundesgesetz<br />
vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und<br />
Vermögensübertragung; SR 221.301) fällt und damit von Art. 24 FusG profitieren<br />
kann. Vgl. dazu: Böc K L i , Aktienrecht, § 3 N 192a.<br />
201 Vgl. to n n e r , s. 276.<br />
202 Art. 650 OR.<br />
203 Art. 651 f. OR. Dabei ist zu beachten, dass die genehmigte Kapitalerhöhung<br />
im Entwurf durch das Kapitalband ersetzt wird. Vgl. Bot s c h a F t aK t ie<br />
n r e c h t 2007, S. 1652.<br />
13<br />
der bedingten Kapitalerhöhung 204 aufstocken 205 . Bei allen<br />
drei Varianten werden die neuen Aktien durch alte oder neue<br />
Aktionäre liberiert, wodurch der Gesellschaft zusätzliche Mittel<br />
zufliessen. Diese drei Instrumente eignen sich auch für<br />
die Einführung von TS, indem sich das Vermögensrecht der<br />
neu ausgegebenen Aktien auf eine Sparte beschränkt. Zu<br />
beachten ist, dass den bisherigen Aktionären grundsätzlich<br />
ein Bezugsrecht auf die neu ausgegebenen TS zusteht. Dieses<br />
Bezugsrecht kann jedoch unter der Voraussetzung eines<br />
wichtigen Grundes ausgeschlossen werden. Einer der<br />
wichtigsten Einführungsgründe für TS, nämlich die Unternehmensakquisition,<br />
anerkennt das Gesetz sogar ausdrücklich<br />
in Art. 652b Abs. 2 OR.<br />
§ 7 Die Rechtstellung der TS-Aktionäre<br />
I. Pflichten<br />
[Rz 57] Der Ausgangspunkt für die Beurteilung der Pflichten<br />
der TS Aktionäre bildet Art. 680 OR. Danach ist jeder<br />
Aktionär verpflichtet, den für den Bezug einer Aktie bei ihrer<br />
Ausgabe festgesetzten Betrag zu leisten. Das OR sieht dabei<br />
keine weiteren Pflichten vor 206 . Umstritten ist allerdings, ob<br />
den Aktionären durch die Statuten weitere Pflichten auferlegt<br />
werden können 207 . Vorläufig kann festgehalten werden, dass<br />
auch die TS-Aktionäre als einzige gesetzliche Pflicht der Liberierungspflicht<br />
gemäss Art. 680 Abs. 1 OR unterstehen 208 .<br />
II. Vermögensrechte<br />
1. Gewinnausschüttung<br />
1.1. Allgemein<br />
[Rz 58] Nachfolgend soll untersucht werden, inwiefern den<br />
TS-Aktionären ein Recht auf den Gewinnanteil zusteht. Im<br />
amerikanischen Recht, wo die meisten TS emittiert wurden,<br />
ist dieses Recht unterschiedlich ausgestaltet worden 209 .<br />
Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich der Board of Directors<br />
alleine entscheidet, ob eine Dividende an die Akti-<br />
204 Art. 653 ff. OR.<br />
205 Grundsätzlich ist die Einführung auch durch das Instrument der «Harmonika»<br />
möglich. Fraglich ist nur, ob sämtliche Aktionäre wieder ihre Aktien<br />
zeichnen. Vgl. auch sie g e r /ha s s e L B a c h , s. 1280.<br />
206 BSK OR II-Kur e r , Art. 680 N 7; me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 16 N 153. Demgegenüber<br />
sieht das BEHG (Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die<br />
Börsen und den Effektenhandel; SR 954.1) weitere Aktionärspflichten vor<br />
(Art. 20 und 32 BEHG).<br />
207 Z.B. Treuepflichten, Konkurrenzverbote usw. Vgl. dazu: BSK OR II-Kur e r ,<br />
Art. 680 N 9. Eindeutig ist hingegen, dass den Aktionären keine weiteren<br />
vermögensmässigen Pflichten auferlegt werden dürfen. Statt aller: Kun z ,<br />
Minderheitenschutz, § 8 N 38.<br />
208 Die Einführung einer Treuepflicht soll noch einmal unter dem Aspekt des<br />
Stimmrechts aufgegriffen werden. Siehe hinten §7/III/1.2.3.<br />
209 Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Dividendenrecht bei General<br />
Motors und US West siehe: noL t e , s. 57 ff. Für einen allg. Überblick<br />
siehe: na t u s c h , s. 258 ff., 284 ff.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
onäre ausgeschüttet wird oder nicht 210 . Bei manchen TS-<br />
Emissionen hat die Unternehmensleitung von Beginn weg<br />
definiert, dass in nächster Zukunft keine Dividenden gezahlt<br />
werden 211 ; in einem Fall haben die TS-Aktionäre überhaupt<br />
kein Recht auf eine Dividende 212 . Im Gegensatz dazu, entscheidet<br />
im schweizerischen Recht nicht der Verwaltungsrat<br />
über die Dividendenausschüttung, sondern dies stellt eine<br />
unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar 213 .<br />
Der jährliche Dividendenanspruch ist überdies ein absolut<br />
wohlerworbenes Aktionärsrecht, dessen vorsorglicher Entzug<br />
nichtig wäre 214 . Damit ist vorgängig festzustellen, dass<br />
den TS-Aktionären ein Dividendenrecht zusteht, über das die<br />
Generalversammlung entscheidet.<br />
1.2. Zulässigkeit einer spartenbezogenen Gewinnverteilung<br />
[Rz 59] In Deutschland bestimmt § 60 Abs. 3 AktG, dass die<br />
Satzung eine andere Art der Gewinnverteilung bestimmen<br />
kann als diejenige nach Anteilen am Grundkapital. Die h.L.<br />
nimmt diesen Absatz als Grundlage für die Änderung des<br />
Gewinnbezugsrechts 215 .<br />
[Rz 60] Nach Art. 660 Abs. 1 OR hat jeder Aktionär grundsätzlich<br />
einen Anspruch auf einen verhältnismässigen Anteil<br />
am Bilanzgewinn. Dieser verhältnismässige Anteil bemisst<br />
sich gemäss Art. 661 OR prinzipiell nach dem nominellen<br />
einbezahlten Aktienkapital 216 . Das Vermögensrecht der TS<br />
ist jedoch gemäss ihrer Definition auf einen Teil des Unternehmens<br />
beschränkt 217 . Daraus folgt, dass sich auch eine allfällige<br />
Dividende nur aufgrund des Gewinns, der in dem definierten<br />
Unternehmensteil erzielt wurde, bemisst. Infolge der<br />
rechtlichen Einheit des TS-Unternehmens gibt es nur einen<br />
ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn. Dieser besteht aus den<br />
konsolidierten Gewinnen der einzelnen Sparten. Fraglich ist<br />
daher, ob das schweizerische Recht die Möglichkeit vorsieht,<br />
den Dividendenanspruch dahingehend zu modifizieren, dass<br />
sich dieser nur noch auf den Gewinn eines Unternehmensteils<br />
bezieht. Ausgangspunkt einer solchen Abklärung bildet<br />
Art. 661 OR. Danach können die Statuten eine vom Nennwertprinzip<br />
abweichende Berechnungsart in den Statuten<br />
vorsehen. Damit wird ersichtlich, dass die Berechnung des<br />
Dividendenanspruchs aufgrund des Nennwerts dispositiver<br />
Natur ist 218 und für eine Aktienkategorie anders definiert werden<br />
kann 219 . Aber nicht eine Abweichung vom Nennwertprin-<br />
210 me r K t /gö t h e L , N 534.<br />
211 Bei Kmart, Seagull Energy und Genzyme. na t u s c h , s. 78.<br />
212 Bei Alaska Interstate Company. na t u s c h , s. 258.<br />
213 Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR.<br />
214 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 12 N 512 m.w.H; Kun z , Minderheitenschutz, § 1<br />
N 213.<br />
215 Vgl. Kuh n , s. 60 m.w.H.<br />
216 BSK OR II-ne u h a u s /BL ä t t L e r , Art. 660 N 12.<br />
217 Siehe vorne §2/I.<br />
218 Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 40 N 61; hug u e n i n Ja c o B s , S. 78 f.<br />
219 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 4 N 438.<br />
14<br />
zip ist entscheidend, sondern es muss die Basis der Berechnung,<br />
mithin der Bilanzgewinn, verändert werden. Für die<br />
Ausschüttung der Dividenden muss dieser wieder in Spartengewinne<br />
aufgeteilt werden. Innerhalb dieser Spartengewinne<br />
erfolgt die Verteilung nämlich wieder nach dem Nennwertprinzip.<br />
Eine solche Modifikation beinhaltet Art. 661 OR<br />
nicht. Eine Abänderung des Dividendenanspruchs könnte<br />
sich jedoch direkt auf Art. 660 Abs. 1 OR stützen. Dieser sieht<br />
vor, dass den Aktionären nur dann ein Anspruch auf einen<br />
verhältnismässigen Anteil am Bilanzgewinn zusteht, wenn<br />
der Bilanzgewinn nach dem Gesetz oder den Statuten zur<br />
Verteilung unter den Aktionären bestimmt ist. Grundsätzlich<br />
bezieht sich der Vorbehalt auf die gesetzlichen oder statutarischen<br />
Reservezuweisungsvorschriften 220 . Dem offen formulierten<br />
Wortlaut kann dagegen nicht entnommen werden,<br />
dass sich dieser Vorbehalt nur auf die Reservezuweisung beschränkt.<br />
Zudem ist anzumerken, dass die Vermögensrechte<br />
der Aktionäre grundsätzlich nicht zwingender Natur sind 221 .<br />
Eine Beschränkung der Bemessungsgrundlage sollte daher<br />
im Rahmen der Privatautonomie möglich sein. Damit könnte<br />
in den Statuten festgesetzt werden, dass die TS-Aktionäre<br />
nur in dem Umfang einen Anspruch auf den Bilanzgewinn<br />
haben, in dem ihre Sparte dazu beigetragen hat.<br />
[Rz 61] Fraglich ist, ob sich diese Statutenbestimmung auch<br />
auf Art. 660 Abs. 3 OR stützen lässt. Dies ist deshalb zu verneinen,<br />
weil Art. 660 Abs. 3 OR vorsieht, dass die in den<br />
Statuten für einzelne Kategorien von Aktien festgesetzten<br />
Vorrechte vorbehalten bleiben. Der Begriff Vorrechte bezieht<br />
sich auf die Bestimmungen über die Vorzugsaktien 222 . Da TS<br />
jedoch nicht mittels Vorzugsaktien eingeführt werden können,<br />
eignet sich Art. 660 Abs. 3 OR nicht als Grundlage für<br />
die Modifikation der Vermögensrechte. Dieser müsste wohl<br />
dahingehend geändert werden, dass er nicht mehr von Vorrechten,<br />
sondern nur noch von Rechten spricht.<br />
1.3. Beschränkung der Ausschüttung<br />
[Rz 62] In Art. 675 Abs. 2 OR wird der Grundsatz statuiert,<br />
dass Dividenden nur aus dem Bilanzgewinn oder aus dafür<br />
gebildeten Reserven ausgeschüttet werden dürfen. Dieser<br />
Grundsatz spielt im Zusammenhang mit TS eine wichtige<br />
Rolle. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Erwirtschaftet<br />
in einem Unternehmen mit zwei Sparten die eine Sparte<br />
einen Gewinn von 10 Mio., die andere jedoch einen Verlust<br />
von 20 Mio., besteht auf Unternehmensebene ein Verlust<br />
von 10 Mio. Fraglich ist, ob in dieser Situation eine Dividende<br />
an die erfolgreiche Sparte ausbezahlt werden kann. Dies<br />
muss aufgrund Art. 675 Abs. 2 OR grundsätzlich verneint<br />
werden 223 . Damit offenbart sich ein weiteres Mal ein Grund<br />
220 Vgl. BSK OR II-ne u h a u s /BL ä t t L e r , Art. 660 N 13.<br />
221 Siehe vorne §5/II/3.<br />
222 Vgl. BSK OR II-ne u h a u s /BL ä t t L e r , Art. 660 N 21.<br />
223 Gleiche Folge im deutschen Recht gemäss § 57 Abs. 3 AktG. Vgl. dazu:<br />
Kuh n , s. 63. Anders ist die Rechtslage in den USA, wo diese Beschränkung<br />
nicht besteht. Vgl. to n n e r , s. 66.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
für die angesprochene Gefahr von Aktionärskonflikten. Die<br />
Aktionäre der erfolgreichen Sparte werden nicht erfreut darüber<br />
sein, dass ihr Gewinnanspruch durch den Verlust einer<br />
anderen Sparte vernichtet wird, an der sie nicht einmal beteiligt<br />
sind. Fraglich ist, ob ein solcher Interessenkonflikt durch<br />
statutarische Regelungen vermieden werden kann, wobei<br />
festzuhalten ist, dass ein Verstoss gegen Art. 675 Abs. 2<br />
OR zur Nichtigkeit des Ausschüttungsbeschlusses führt 224 .<br />
Nachfolgend ist daher nach alternativen Möglichkeiten zu<br />
suchen, die den Grundgehalt von Art. 675 Abs. 2 OR nicht<br />
beeinträchtigen.<br />
1.3.1. Rückgriff auf Reserven<br />
[Rz 63] Gemäss Art. 675 Abs. 2 OR darf die Dividende auch<br />
aus dafür geschaffenen Reserven ausgeschüttet werden 225 .<br />
Damit kann zum einen aus den freien Reserven 226 , aber auch<br />
aus dem die Hälfte des Nennkapitals übersteigende Teil<br />
der allgemeinen gesetzlichen Reserven 227 eine Dividende<br />
entrichtet werden. Zum anderen können die Statuten gemäss<br />
Art. 672 Abs. 2 OR weitere Reserven vorsehen, deren<br />
Zweckbestimmung dabei frei festgelegt werden kann 228 . Dadurch<br />
könnten die Statuten für jede Sparte sog. «Dividendenreserven»<br />
vorsehen. Die Sparten werden verpflichtet, jedes<br />
Jahr einen gewissen Anteil des Gewinns diesen Reserven<br />
zuzuweisen und sie damit bis zu einem gewissen Betrag zu<br />
äufnen.<br />
[Rz 64] Der Rückgriff auf Reserven klingt verlockend, kann<br />
aber auch gefährlich sein. Problematisch wird dieser Rückgriff<br />
insbesondere dann, wenn er dazu missbraucht wird,<br />
eine verlustbringende Sparte mit den Reserven einer gewinnbringenden<br />
Sparte zu subventionieren 229 . Diesbezüglich<br />
würde wohl ein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot<br />
vorliegen und ein allfälliger Generalversammlungsbeschluss<br />
wäre wohl anfechtbar.<br />
1.3.2. Dividendennachbezug<br />
[Rz 65] Die Idee hinter dem Dividendennachbezug besteht<br />
darin, dass die Aktionäre der gewinnbringenden Sparte,<br />
denen aufgrund des Verlusts einer anderen Sparte keine<br />
Dividende ausgeschüttet werden konnte, diese in einem<br />
Folgejahr erhalten 230 . Art. 656 Abs. 2 OR sieht ein solches<br />
Nachbezugsrecht für Vorzugsaktien ausdrücklich vor 231 . Eine<br />
analoge Anwendung dieses Instituts auf TS sollte aufgrund<br />
der Gleichwertigkeit der in Frage stehenden Sachverhalte<br />
möglich sein. Die Statuten haben dabei das Recht eingehend<br />
224 BSK OR II-Kur e r , Art. 675 N 28 m.w.H.<br />
225 Für eine Übersicht siehe: BSK OR II-Kur e r , Art. 675 N 16 ff.<br />
226 Vgl. BSK OR II-Kur e r , Art. 675 N 21.<br />
227 Vgl. BSK OR II-Kur e r , Art. 675 N 16.<br />
228 Vgl. BSK OR II-ne u h a u s /Ba L K a n y i , Art. 672 N 6.<br />
229 to n n e r , S. 72.<br />
230 Vgl. to n n e r , S. 67.<br />
231 Vgl. dazu: Li e B i , n 259 ff.<br />
15<br />
zu umschreiben, insbesondere bezüglich Umfang, Dauer<br />
und Rangordnung.<br />
1.3.3. Abspaltung<br />
[Rz 66] Erwirtschaftet ein Unternehmensteil dauerhaft negative<br />
Ergebnisse, können sowohl die Reserven als auch<br />
das Nachbezugsrecht keine Hilfe mehr leisten. Fraglich ist<br />
daher, ob sich die Aktionäre der erfolgreichen Sparte mittels<br />
Spaltung von der verlustbringenden Sparte trennen können.<br />
Grundsätzlich ist eine solche Trennung nach dem FusG möglich<br />
232 . Praktisch wird sie jedoch kaum durchführbar sein. Da<br />
die Aktionäre der verlustbringenden Sparte gerade keine Anteile<br />
an der übernehmenden Gesellschaft erhalten sollen, ist<br />
diese Abspaltung in der Form der asymmetrischen Spaltung<br />
nach Art. 31 Abs. 2 Lit. b FusG durchzuführen. Art. 43 Abs. 3<br />
FusG verlangt dafür die Zustimmung von mindestens 90 %<br />
aller Aktionäre der übertragenden Gesellschaft, die über ein<br />
Stimmrecht verfügen. Die Aktionäre der verlustreichen Sparte<br />
werden einem solchen Beschluss wohl kaum zustimmen.<br />
1.3.4. Rückabwicklung<br />
[Rz 67] Die Gesellschaft könnte bei der Einführung vorsehen,<br />
dass die Struktur wieder rückgängig gemacht wird, sobald<br />
eine Sparte über eine längere Zeit negative Ergebnisse produziert<br />
233 . Diese Unsicherheit dürfte sich allerdings negativ<br />
auf den Börsenkurs auswirken.<br />
1.4. Spezialfälle<br />
[Rz 68] Nachfolgend soll noch auf zwei Spezialfälle eingegangen<br />
werden, die bei der Verwirklichung der TS in den<br />
USA häufig anzutreffen sind.<br />
1.4.1. Close <strong>Tracking</strong> und loose <strong>Tracking</strong><br />
[Rz 69] Das amerikanische Recht unterscheidet zwei verschiedene<br />
Gestaltungsvarianten bei der Berechnung der Gewinnausschüttung.<br />
Beim sog. «close tracking» knüpft das Dividendenrecht<br />
ausschliesslich am Erfolg einer Sparte an 234 .<br />
Der Betrag, der an die TS-Aktionäre ausgeschüttet wird, entspricht<br />
damit dem wirklich angefallenen Spartengewinn 235 .<br />
Die Sparte wird faktisch als rechtlich selbständiges Unternehmen<br />
behandelt 236 . Der Vorteil einer solch nahen Verfolgung<br />
der Sparte liegt darin, dass das Gleichbehandlungsgebot<br />
am besten gewahrt wird und damit klare Strukturen herrschen.<br />
Der Nachteil besteht dagegen in der zeitintensiven<br />
Ermittlung der spartenbezogenen Unternehmenskennzahlen<br />
237 . Von diesem «close tracking» ist das «loose tracking»<br />
abzugrenzen. Dabei lehnt sich das Dividendenrecht nicht<br />
ausschliesslich an das tatsächliche Ergebnis einer Sparte<br />
an, sondern der Unternehmensgewinn wird kraft eines in<br />
232 Abspaltung gemäss Art. 29 Lit. b FusG.<br />
233 Vgl. to n n e r , s. 77. Zur bedingten Einführung siehe hinten §10/II/3.<br />
234 th i e L , S. 52; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 531.<br />
235 Kuh n , S. 8.<br />
236 Kuh n , S. 8; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 532.<br />
237 Kuh n , S. 8.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
den Statuten festgelegten Schlüssels verteilt 238 . Das loose<br />
tracking ermöglicht daher eine Dividendenzahlung an eine<br />
Sparte, selbst wenn diese einen Verlust erwirtschaftet hat 239 .<br />
Hinzu kommt der Vorteil, dass eine Ermittlung der spartenbezogenen<br />
Unternehmenskennzahlen nicht mehr notwendig<br />
ist. Der Nachteil dieser Variante ist offensichtlich. Entspricht<br />
der festgelegte Verteilschlüssel nicht mehr den tatsächlichen<br />
Verhältnissen, ergeben sich massive Ungleichbehandlungen,<br />
weil eine Aktiengattung bevorzugt und die andere benachteiligt<br />
wird 240 . Dies würde eine ständige Anpassung der Statuten<br />
an die jeweiligen tatsächlichen Gegebenheiten bedingen. In<br />
dieser Arbeit wurde bisher der Ansatz des close trackings<br />
verfolgt. Dieser ist mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot<br />
und in Bezug auf eine ordnungsgemässe Rechnungslegung<br />
sicher zu bevorzugen.<br />
1.4.2. Retained Interest<br />
[Rz 70] Das Retained Interest ist ein Instrument, um eine<br />
Sparte am Gewinn einer anderen Sparte teilhaben zu lassen<br />
241 . Diese Gestaltungsvariante dürfte die Einführung von<br />
TS erheblich vereinfachen, da der Einschnitt in die Vermögensrechte<br />
der bisherigen Aktionäre weniger stark ausfällt<br />
und diese damit eher bereit sein dürften, einem solchen Beschluss<br />
zuzustimmen. Fraglich ist die Modalität der Einführung.<br />
Im amerikanischen Recht wird das Retained Interest<br />
dadurch erreicht, dass nicht alle Aktien der neu geschaffenen<br />
Sparte ausgegeben werden 242 . Die nicht ausgegebenen Aktien<br />
werden dann einer anderen Sparte zugewiesen, wodurch<br />
diese durch die Dividenden vom Gewinn der anderen Sparte<br />
profitieren kann 243 . Ein Stimmrecht ist mit diesen zurückbehaltenen<br />
Aktien nicht verbunden 244 . Nach schweizerischem<br />
Recht stellen diese zurückbehaltenen Aktien eigene Aktien<br />
nach Art. 659 OR dar. Fraglich ist deshalb, ob im schweizerischen<br />
Recht das Retained Interest durch eigene Aktien<br />
hergestellt werden könnte. Grundsätzlich ist dies möglich,<br />
da auf den eigenen Aktien nur das Stimmrecht, nicht aber<br />
das Dividendenrecht ruht 245 . Die Dividenden könnten somit<br />
dem Gewinnpool einer anderen Sparte zugerechnet und<br />
ausgeschüttet werden. Einer solchen Konstruktion stehen<br />
jedoch zwei Hindernisse entgegen: Zum einen darf der<br />
Kauf nur aus frei verwendbarem Eigenkapital geschehen 246<br />
und es muss gleichzeitig eine Reserve in der Höhe des An-<br />
238 Kuh n , S. 8.<br />
239 st e i n B e r g e r /ha s s , s. 532. Natürlich nur im Rahmen von Art. 675 Abs. 2<br />
OR.<br />
240 Kuh n , S. 9.<br />
241 wu n s c h , S. 154.<br />
242 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 530.<br />
243 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 530.<br />
244 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 530.<br />
245 Art. 659a Abs. 1 OR. Zum Dividendenrecht: Böc K L i , Aktienrecht, § 4<br />
N 244.<br />
246 Art. 659 Abs. 1 OR.<br />
16<br />
schaffungswerts gebildet werden 247 . Zum anderen darf der<br />
Umfang der gekauften eigenen Aktien 10 % des Aktienkapitals<br />
nicht übersteigen 248 . Diese beiden Schranken dürften<br />
der Errichtung des Retained Interests mittels eigener Aktien<br />
grundsätzlich im Wege stehen 249 . Eine alternative Möglichkeit<br />
schlagen Wu n s c h 250 und Ku h n 251 vor. Sie sehen vor, dass die<br />
Vermögensrechte der jeweiligen TS nicht 100 % des Gewinnes<br />
der getrackten Sparte gewähren, sondern z.B. nur 80 %,<br />
während die anderen 20 % einer andern Sparte als Retained<br />
Interest zustehen würden 252 . Damit beteiligt sich eine TS-<br />
Gattung direkt an einer anderen und der Umweg über den<br />
Kauf eigener Aktien wird nicht benötigt. Fraglich ist, ob diese<br />
Variante, von Ku h n als «Mischbeteiligungsmodell» bezeichnet<br />
253 , auch in der Schweiz möglich ist. Wie schon festgestellt<br />
wurde, ist Art. 660 Abs. 1 OR dispositiver Natur 254 . Er erlaubt<br />
den Anspruch auf einen Teil des Bilanzgewinns einzuschränken.<br />
Es sollte daher auch möglich sein, das Gewinnrecht einer<br />
Sparte weiter einzuschränken und den frei werdenden<br />
Teil einer anderen Sparte zuzuweisen, respektive das Gewinnrecht<br />
einer anderen Sparte zu erweitern. Das Retained<br />
Interest könnte wohl über eine weitere Modifikation der Vermögensrechte<br />
auch in der Schweiz eingeführt werden.<br />
2. Bezugsrecht<br />
2.1. Probleme eines allgemeinen Bezugsrechts<br />
[Rz 71] Das Bezugsrecht nach Art. 652b OR schützt den<br />
Aktionär vor Verwässerung seines Kapital- und auch seines<br />
Mitverwaltungsanteils 255 . Gemäss Art. 652b Abs. 1 OR steht<br />
darum jedem Aktionär ein Bezugsrecht zu, wobei die Generalversammlung<br />
dieses Bezugsrecht nur, aber immerhin, aus<br />
wichtigen Gründen aufheben kann. Im Zusammenhang mit<br />
TS kann ein allgemeines Bezugsrecht allerdings zu Problemen<br />
führen.<br />
[rz 72] no lT e untersuchte die Auswirkungen einer Kapitalerhöhung<br />
mit einem allgemeinen Bezugsrecht auf die einzelnen<br />
Sparten. Er hat dabei festgestellt, dass die Aktionäre, deren<br />
Aktienkapital erhöht wird, eine erhebliche Schwächung<br />
ihres Dividendenrechts hinnehmen müssen, obwohl sie ihr<br />
Bezugsrecht ausüben können 256 . Demgegenüber werden die<br />
Aktionäre der anderen Sparten, die keine Kapitalerhöhung<br />
durchführen, wirtschaftlich besser gestellt 257 . Die Problematik<br />
verschärft sich zudem, wenn die Kapitalerhöhung in einer<br />
247 Art. 659a Abs. 2 OR.<br />
248 Art. 659 Abs. 1 OR.<br />
249 Ebenso für das deutsche Recht: Kuh n , S. 14.<br />
250 Vgl. wu n s c h , S. 156 ff.<br />
251 Vgl. Kuh n , S. 14 ff.<br />
252 Weitere Beispiele: wu n s c h , S. 156; Kuh n , S. 15.<br />
253 Kuh n , S. 11.<br />
254 Siehe vorne §7/II/1.2.<br />
255 BSK OR II-zi n d e L /is L e r , Art. 652b, N 2 m.w.H.<br />
256 Vgl. die Berechnungen bei: noL t e , s. 234.<br />
257 noL t e , S. 235.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
kleinen Sparte durchgeführt wird und eine grosse Sparte<br />
auch zum Bezug der Aktien berechtigt ist 258 . Die Ursache<br />
dieses Problems liegt in der unterschiedlichen Bezugsbasis<br />
von Bezugsrecht und Dividendenrecht 259 . Das Bezugsrecht<br />
bezieht sich auf das gesamte Aktienkapital, währenddem<br />
sich das Dividendenrecht nur auf einen bestimmten Teil des<br />
Aktienkapitals bezieht 260 . Damit wird deutlich, dass aus einem<br />
nachlassenden Anteil am Aktienkapital nicht mehr automatisch<br />
eine Schädigung des Dividendenrechts resultiert 261 .<br />
Entscheidend ist vielmehr, ob sich der Anteil an der jeweiligen<br />
Aktienkategorie vermindert 262 . Auf der anderen Seite<br />
bleibt der Umfang des Stimmrechts immer derselbe 263 .<br />
[Rz 73] Die Aktionäre der betroffenen Sparte werden wohl<br />
eine solche Benachteiligung nicht unbedingt hinnehmen und<br />
deshalb einem Kapitalerhöhungsbeschluss ihre Zustimmung<br />
verweigern 264 . Nachfolgend soll daher kurz auf mögliche Lösungsvarianten<br />
eingegangen werden, um eine Blockade bei<br />
der Kapitalversorgung zu verhindern.<br />
2.2. Lösungsmöglichkeiten<br />
[Rz 74] Der Vergleich mit dem amerikanischen Recht ist in<br />
dieser Thematik nicht sehr hilfreich. Die meisten Gliedstaaten<br />
überlassen es den Statuten der Gesellschaft, ob den Aktionären<br />
ein sog. «preemptive right» zugestanden wird 265 . In<br />
den USA wurde dementsprechend in keiner TS-Gesellschaft<br />
den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt 266 . Im schweizerischen<br />
Recht ist die Aufhebung oder Beschränkung des Bezugsrechts<br />
in den Statuten nicht zulässig 267 . Nachfolgend soll<br />
kurz auf zwei Möglichkeiten eingegangen werden, die das<br />
Bezugsrecht durch einen Generalversammlungsbeschluss<br />
aufheben.<br />
2.2.1. Kapitalerhöhung in beiden Sparten mit gekreuztem<br />
Bezugsrechtsausschluss<br />
[Rz 75] Diese Lösungsmöglichkeit sieht eine gleichmässige<br />
Kapitalerhöhung in beiden Sparten vor, wobei das Bezugsrecht<br />
auf die Aktien der jeweils anderen Sparte ausgeschlossen<br />
wird 268 . Ein solcher gekreuzter Bezugsrechtsausschluss<br />
wird in der deutschen Lehre allgemein und bezogen auf TS<br />
für zulässig erachtet, da kein Eingriff in die mitgliedschaftliche<br />
und vermögensrechtliche Stellung der jeweiligen Aktionäre<br />
258 noL t e , S. 234.<br />
259 noL t e , S. 235.<br />
260 Vgl. noL t e , S. 235.<br />
261 noL t e , S. 235.<br />
262 noL t e , S. 235.<br />
263 Hier stimmt die Bezugsbasis wieder mit dem Bezugsrecht überein. noL t e ,<br />
s. 235.<br />
264 Vgl. noL t e , S. 237.<br />
265 noL t e , S. 92. Weiterführend: me r K t /gö t h e L , N 488 ff.<br />
266 noL t e , S. 233.<br />
267 Vgl. BSK OR II-zi n d e L /is L e r , Art. 652b N 11 m.w.H. Gleich im deutschen<br />
Recht: noL t e , s. 239.<br />
268 Vgl. noL t e , S. 241 f.<br />
17<br />
gegeben ist 269 . Unter diesen Voraussetzungen dürfte eine<br />
solche Konstruktion auch nach schweizerischem Recht zulässig<br />
sein, insbesondere, da das Gleichbehandlungsgebot<br />
durch den beidseitigen Ausschuss nicht beeinträchtigt wird 270 .<br />
Der gekreuzte Bezugsrechtsausschluss bietet jedoch keine<br />
adäquate Lösung, wenn nur in einer Sparte Bedarf nach Kapital<br />
besteht 271 . In diesem Fall muss geprüft werden, ob die<br />
Kapitalerhöhung auch nur in einer Sparte, unter Ausschluss<br />
der anderen Kategorie, durchgeführt werden kann.<br />
2.2.2. Kapitalerhöhung in einer Sparte mit einseitigem<br />
Bezugsrechtsausschluss<br />
[Rz 76] Nehmen die Aktionäre in dieser Variante ihr Bezugsrecht<br />
wahr, so droht ihnen keine Verwässerung ihres Dividendenrechts<br />
272 . Der Nachteil dieser Variante liegt jedoch<br />
darin, dass sich eine Veränderung der Stimmenverhältnisse<br />
ergibt 273 . Dadurch, dass die Gesellschaft rechtlich eine<br />
Einheit bildet und manche Aktionäre von dem Bezug neuer<br />
Aktien ausgeschlossen werden, erhöht sich der Stimmenanteil<br />
derjenigen Aktionäre, die ihr Bezugsrecht wahrnehmen<br />
können 274 . Fraglich ist, ob unter diesen Umständen ein Bezugsrechtsausschluss<br />
möglich ist. Ein solcher ist grundsätzlich<br />
zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und durch die<br />
Aufhebung niemand in unsachlicher Weise begünstigt oder<br />
benachteiligt wird 275 .<br />
[Rz 77] Als erstes muss somit ein wichtiger Grund vorliegen.<br />
Neben den in Art. 652b Abs. 2 OR ausdrücklich genannten<br />
Gründen könnte in casu auch die flexible Finanzierung einen<br />
solchen wichtigen Grund darstellen. Da selten die Situation<br />
vorliegen wird, dass sich eine Kapitalerhöhung in beiden<br />
Sparten als sinnvoll erweist, muss die Gesellschaft die<br />
Möglichkeit haben, die Kapitalerhöhung bloss in einer Sparte<br />
durchzuführen. Eine Kapitalerhöhung ohne Ausschluss des<br />
Bezugsrechts für die andere Aktienkategorie bewirkt jedoch<br />
eine erhebliche Beeinträchtigung der Vermögensrechte der<br />
Aktionäre der emittierenden Sparte. Diese könnten damit<br />
ihre Zustimmung zu einer notwendigen Kapitalerhöhung verweigern<br />
und dadurch u.U. das Wohlergehen der Gesellschaft<br />
riskieren. Es liegt daher im Interesse der Gesellschaft, dass<br />
sie sich situationsgerecht mit Kapital versorgen kann und<br />
dient damit letztlich auch dem Schutz der Aktionäre 276 . Ob<br />
die flexible Kapitalisierung als wichtiger Grund im Sinne von<br />
Art. 652b Abs. 2 OR anerkannt wird, kann hier nicht abschliessend<br />
beurteilt werden. Es kann jedoch festgehalten werden,<br />
dass die flexible Kapitalbeschaffung sicher nicht diametral<br />
269 Vgl. Kuh n , S. 111; noL t e , S. 242; to n n e r , S. 139.<br />
270 Das Bezugsrecht wird in casu allen Aktionären auf die gleiche Weise ent-<br />
zogen. Vgl. auch: BGE 117 II 290, E.4e S. 302.<br />
271 Kuh n , S. 112; noL t e , S. 243; to n n e r , S. 139.<br />
272 Vgl. noL t e , S. 243.<br />
273 noL t e , S. 243; to n n e r , S. 140.<br />
274 Kuh n , S. 115.<br />
275 Art. 652b Abs. 2 Satz 1 und 2 OR.<br />
276 noL t e , S. 244.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
zum Interesse der Gesellschaft und damit auch den Aktionären<br />
steht.<br />
[Rz 78] Zweitens darf keine unsachliche Begünstigung oder<br />
Benachteiligung vorliegen. Verlangt wird mit dieser Voraussetzung,<br />
dass die Aktionäre gleichbehandelt werden 277 . In<br />
diesem Fall wird das Bezugsrecht nicht sämtlichen Aktionären<br />
entzogen, sondern nur der nicht emittierenden Sparte.<br />
Damit liegt grundsätzlich eine Ungleichbehandlung vor, die<br />
dazu führt, dass die ausgeschlossenen Aktionäre in Bezug<br />
auf das Stimmrecht benachteiligt werden. Es muss daher<br />
eine Interessenabwägung zwischen den beiden Aktienkategorien<br />
stattfinden 278 . Die massgeblichen Interessen dieser<br />
Abwägung sind auf der einen Seite die Beeinträchtigung der<br />
Vermögensrechte und auf der anderen Seite der Verlust der<br />
Stimmrechte. Als Hilfskriterium könnte dabei gemäss no lT e<br />
auf die Grösse der jeweiligen Aktienkategorien abgestellt<br />
werden 279 . Sind die beiden Kategorien nämlich annähernd<br />
gleich gross, rechtfertigt sich ein Bezugsrechtsausschluss<br />
der anderen Kategorie nicht 280 . Die Auswirkungen auf die<br />
Vermögensrechte sind nur minimal, dagegen wird der Stimmanteil<br />
der ausgeschlossenen Aktionäre erheblich vermindert<br />
281 . Anders ist die Situation zu beurteilen, wenn eine<br />
kleine Sparte Aktien emittiert. In dieser Situation sollte der<br />
Bezugsrechtsausschluss einer grossen Sparte möglich sein,<br />
weil sich hier eine erhebliche Beeinträchtigung der Vermögensrechte<br />
einer eher geringen Verschiebung der Stimmrechtsverhältnisse<br />
gegenüber steht 282 . In dieser Konstellation<br />
ist die Stimmrechtsverschiebung hinzunehmen, um die<br />
Minderheitsaktionäre vor dem fast vollständigen Verlust ihrer<br />
wirtschaftlichen Beteiligung zu schützen 283 .<br />
[Rz 79] Zusammenfassend kann damit festgehalten werden,<br />
dass das Bezugsrecht einer Kategorie nur dann ausgeschlossen<br />
werden kann, wenn dieser Ausschluss auf einem<br />
wichtigen Grund beruht und sich die beiden Kategorien in ihrer<br />
Grösse erheblich unterscheiden und Aktien der kleineren<br />
Sparte ausgegeben werden 284 .<br />
3. Anteil am Liquidationserlös<br />
3.1. Zulässigkeit eines spartenbezogenen Liquidationsanteils<br />
[Rz 80] Die Aktionäre einer sich auflösenden Gesellschaft<br />
haben, soweit die Statuten nichts anderes vorsehen,<br />
gemäss Art. 660 Abs. 2 OR einen Anspruch auf einen<br />
277 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 2 N 289; BSK OR II-zi n d e L /is L e r , Art. 652b<br />
N 22.<br />
278 Vgl. Kun z , Minderheitenschutz, § 9 N 83.<br />
279 Vgl. noL t e , S. 246.<br />
280 noL t e , S. 246.<br />
281 Vgl. noL t e , S. 246.<br />
282 Vgl. noL t e , S. 246.<br />
283 noL t e , S. 246.<br />
284 Vgl. noL t e , S. 246.<br />
18<br />
verhältnismässigen Anteil am Ergebnis der Liquidation.<br />
Die Berechnung entspricht derjenigen des Dividendenanspruchs<br />
285 . Soll das Recht auf einen Liquidationsanteil derogiert<br />
werden, ist die Zustimmung sämtlicher Aktionäre notwendig<br />
286 . Im Zusammenhang mit TS soll dieses Recht nicht<br />
abgeschafft, sondern gleich wie das Dividendenrecht nur<br />
modifiziert werden. Da dem Gesetz die Konzeption der TS<br />
fremd ist, müssen die Statuten die notwendigen Vorkehrungen<br />
treffen. Aus Art. 660 Abs. 2 OR ergibt sich, dass die Statuten<br />
eine abweichende Regelung treffen können. Damit ist<br />
auch die Regelung bezüglich des Liquidationsanteils dispositiver<br />
Natur 287 . Somit kann statutarisch eine Verteilung nach<br />
Sparten festgehalten werden. Nachfolgend soll kurz auf die<br />
verschiedenen Möglichkeiten einer solchen Verteilung eingegangen<br />
werden.<br />
3.2. Gestaltungsmöglichkeiten<br />
3.2.1. Verteilung gemäss dem Spartenvermögen<br />
[Rz 81] In dieser Variante wird die Spartenrechnungslegung<br />
zur entscheidenden Berechnungsbasis. Der Liquidationsanteil<br />
wird in casu nämlich durch die Gegenüberstellung von<br />
Aktiven und Passiven innerhalb einer Sparte ermittelt 288 . Die<br />
TS-Aktionäre erhalten demnach nur den Liquidationserlös,<br />
der sich aus der Liquidation der Vermögenswerte ihres Unternehmensteils<br />
ergibt 289 . Ein Anspruch auf allfällige Liquidationsüberschüsse<br />
aus anderen Sparten steht ihnen nicht zu 290 .<br />
Damit wird die Illusion der wirtschaftlichen Unabhängigkeit<br />
einer Sparte auch in der Liquidation aufrechterhalten.<br />
3.2.2. Verteilung gemäss einem Verteilschlüssel<br />
[Rz 82] Die Mehrheit der amerikanischen TS-Gesellschaften<br />
gewähren den TS-Aktionären einen Liquidationsanspruch,<br />
welcher sich auf das Vermögen der Gesamtgesellschaft bezieht<br />
291 . Dabei sind zwei Berechnungsarten üblich 292 : Bei der<br />
ersten Möglichkeit wird der Liquidationsanteil einer Sparte<br />
dergestalt berechnet, dass dieser dem Verhältnis der Summe<br />
der umlaufenden Aktien dieser Sparte zu der Summe der<br />
umlaufenden Aktien insgesamt entspricht 293 . Hat die Sparte<br />
A z.B. 1 Mio. Aktien im Umlauf und die Gesellschaft insgesamt<br />
10 Mio., so hat die Sparte einen Anspruch auf 10 %<br />
des Liquidationsüberschusses der Gesellschaft. Bei der<br />
zweiten Möglichkeit wird demgegenüber auf die Börsenwerte<br />
abgestellt. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden<br />
285 Art. 661 und 745 Abs. 1 OR. Vgl. BSK OR II-ne u h a u s /BL ä t t L e r , Art. 660<br />
N 20.<br />
286 BSK OR II-ne u h a u s /BL ä t t L e r , Art. 660 N 20.<br />
287 Vgl. Fr a n c o ma u r e r , Das Recht auf den Liquidationsanteil bei der Ak tienge-<br />
sellschaft (Diss. Bern 1951), S. 53.<br />
288 Vgl. to n n e r , S. 86.<br />
289 Vgl. Kuh n , S. 74.<br />
290 Vgl. to n n e r , S. 86.<br />
291 to n n e r , S. 84.<br />
292 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 535.<br />
293 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 535.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
im Verhältnis des Börsenwerts der eigenen Sparte zu dem<br />
Börsenwert der anderen Sparten verteilt 294 . Zur Bestimmung<br />
des Börsenwerts kann entweder auf den Zeitpunkt der Aktienausgabe,<br />
auf den durchschnittlichen Börsenwert während<br />
einer gewissen Zeitperiode oder auf den Zeitpunkt der Liquidation<br />
abgestellt werden 295 .<br />
[Rz 83] Damit wird ersichtlich, dass der Gesellschaft beliebig<br />
viele Möglichkeiten zur Verteilung des Liquidationsüberschusses<br />
offen stehen. Ein Verteilschlüssel, der sich sachlich<br />
nicht rechtfertigen lässt, dürfte aber gegen das Gleichbehandlungsgebot<br />
verstossen und damit anfechtbar werden.<br />
III. Stimmrechte<br />
[Rz 84] Das Stimmrecht dürfte bei der Ausgestaltung der TS<br />
eines der grössten Hindernisse darstellen. Im Folgenden soll<br />
auf die zwei Hauptprobleme, nämlich die Konflikte bei der<br />
Stimmausübung und die Schwierigkeiten bei der Bestimmung<br />
der Stimmkraft eingegangen werden.<br />
1. Die Ausübung des Stimmrechts<br />
1.1. Gefahr von Konflikten zwischen den Aktionären<br />
[Rz 85] In einer TS-Gesellschaft wird aufgrund der rechtlichen<br />
Einheit nur eine Generalversammlung durchgeführt 296 .<br />
Dies bedeutet, dass die wirtschaftlich selbständigen Sparten<br />
gemeinsam über die Anliegen der einzelnen Sparten abstimmen<br />
297 . Die angesprochene Konstellation birgt viel Potenzial<br />
für mögliche Konflikte zwischen den Aktionären. Dies wird<br />
umso deutlicher, wenn man den Katalog von Art. 698 Abs. 2<br />
OR betrachtet. Die Festlegung der Statuten, die Wahl des<br />
Verwaltungsrates und insbesondere der Beschluss über die<br />
Verwendung des Bilanzgewinns - allesamt Punkte, die auch<br />
in einer herkömmlichen Aktiengesellschaft umstritten sind,<br />
werden in einer TS-Struktur zu wahrlichen Minenfelder. Das<br />
Problem liegt darin, dass bei einer ungleichen Verteilung der<br />
Aktienanzahl auf die Sparten die grössere Sparte die kleinere<br />
Sparte u.U. dominieren kann. Die dominante Sparte kann<br />
z.B. ihr wohlgesinnte Verwaltungsräte bestellen, die Statuten<br />
zu ungunsten der anderen Sparte redigieren oder sogar den<br />
Gewinnverwendungsbeschluss in ihrem Sinne fällen. Besteht<br />
für beide Sparten die gleiche Anzahl Aktien, so kann<br />
zwar keine Sparte dominieren 298 , jedoch besteht die Gefahr,<br />
dass die Gesellschaft durch die Pattsituation gelähmt wird.<br />
Es müssen daher gewisse Vorkehrungen getroffen werden,<br />
damit solche Ungleichbehandlungen oder die angesprochene<br />
Pattsituation möglichst verhindert werden kann.<br />
294 Kuh n , S. 74; to n n e r , S. 85; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 535.<br />
295 Kuh n , S. 75 f.<br />
296 to n n e r , S. 91.<br />
297 to n n e r , S. 91.<br />
298 Mit Ausnahme der Situation, dass die Aktionäre einer Sparte nicht an der<br />
Generalversammlung teilnehmen und diese Sparte damit ständig untervertreten<br />
ist.<br />
19<br />
1.2. Lösungsmöglichkeiten<br />
[Rz 86] Im amerikanischen Recht kann das Stimmrecht einzelner<br />
Klassen entzogen werden, solange mindestens eine<br />
Klasse von Aktien stimmberechtigt bleibt 299 . Im schweizerischen<br />
Recht dürfen die Statuten gemäss Art. 692 Abs. 2<br />
Satz 2 OR die Stimmenzahl der Besitzer mehrerer Aktien<br />
beschränken, jedem Aktionär steht jedoch mindestens eine<br />
Stimme zu 300 . Der Entzug dieses Mindeststimmrechts ist<br />
nach Art. 706b Ziff. 1 OR nichtig.<br />
1.2.1. Sonderversammlungen<br />
[Rz 87] Eine dieser Lösungsmöglichkeiten könnte die Einführung<br />
von Sonderversammlungen sein. Die Sonderversammlung<br />
ist das zentrale Institut, welches das Gesetz zum Schutz<br />
der verschiedenen Kategorien von Aktionären vorsieht 301 .<br />
Kodifiziert ist die Sonderversammlung in Art. 654 Abs. 2<br />
OR für die Vorzugsaktien und in Art. 656f Abs. 4 OR für die<br />
Partizipationsscheine. Die Sonderversammlung stellt dabei<br />
ein separates Beschlussgremium dar, das mit selbständiger<br />
Beschlussfassungskompetenz ausgestattet ist 302 . Der Beschluss<br />
einer solchen Sonderversammlung bildet jedoch nur<br />
eine notwendige Bedingung für die Gültigkeit eines damit zusammenhängenden<br />
Generalversammlungsbeschlusses und<br />
kann letzteren nicht substituieren 303 . Zu prüfen ist, ob solche<br />
Sonderversammlungen auch in einer TS-Gesellschaft Anwendung<br />
finden.<br />
[Rz 88] Da die TS nach Meinung des Autors keine Vorzugsaktien<br />
und auch keine Partizipationsscheine darstellen, kommt<br />
eine direkte Anwendung des Instituts der Sonderversammlung<br />
nicht in Betracht. Fraglich ist, ob in casu eine analoge<br />
Anwendung geboten ist. Zu untersuchen ist daher, ob die<br />
Situation eines Spartenaktionärs gleichwertig ist mit derjenigen<br />
eines Vorzugsaktionärs. Die Sonderversammlung soll<br />
den Vorzugsaktionär in erster Linie vor dem Verlust seiner<br />
Vorrechten schützen 304 . Die Idee hinter der Einführung einer<br />
Sonderversammlung in einer TS-Struktur ist dagegen eine<br />
andere. Hier wird nicht der Schutz von Vorrechten bezweckt,<br />
die TS-Aktionäre besitzen gar keine Vorrechte, sondern es<br />
sollen strukturbedingte Defizite ausgeglichen werden. Die<br />
Sonderversammlung soll den einzelnen Sparten ein Mitbestimmungsrecht<br />
in Angelegenheiten geben, welche sie direkt<br />
tangieren 305 . Der Schutz von Rechten, die allen Aktionären<br />
gleichermassen zustehen ist jedoch gerade nicht ratio legis<br />
299 Vgl. Bau e r , s. 75; na t u s c h , s. 28. Auch im amerikanischen Recht darf es<br />
keine Unternehmen ohne stimmberechtigte Aktionäre geben. Vgl. dazu:<br />
me r K t /gö t h e L , n 457.<br />
300 Art. 692 Abs. 2 Satz 1 OR.<br />
301 Kun z , Minderheitenschutz, § 1 N 180. Für eine Definition siehe: hor B e r , s.<br />
18.<br />
302 hor B e r , S. 16.<br />
303 Vgl. hor B e r , S. 17 f.<br />
304 Art. 654 Abs. 2 und 3 OR. Vgl. auch hor B e r , s. 15.<br />
305 Z.B. bei Veränderungen im Vermögens- oder Stimmrecht oder bei Verwal-<br />
tungsratswahlen. Vgl. rih m , S. 49.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
von Art. 654 Abs. 2 OR 306 . Damit kann festgehalten werden,<br />
dass de lege lata keine gesetzliche Pflicht für eine TS-Sonderversammlung<br />
besteht.<br />
[Rz 89] Die Idee der Sonderversammlung kann jedoch auf<br />
dem statutarischen Weg verwirklicht werden 307 . Aufgrund<br />
der Gestaltungsfreiheit sollte es der Gesellschaft möglich<br />
sein, mittels einer Statutenbestimmung Sonderversammlungen<br />
für die Sparten vorzusehen. Dabei müssten die Generalversammlungsbeschlüsse,<br />
deren Gültigkeit von einer<br />
Sonderversammlung abhängig gemacht werden sollten,<br />
genau umschrieben werden. Der organisatorische Ablauf<br />
dürfte sich dabei an den bekannten Sonderversammlungen<br />
orientieren 308 .<br />
1.2.2. Erschwerte Beschlussfassung<br />
[Rz 90] Die GV fasst ihre Beschlüsse gemäss Art. 703 OR<br />
grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der vertretenen<br />
Aktienstimmen. Die Statuten können die Beschlussfassung<br />
jedoch erschweren 309 . Eine TS-Gesellschaft könnte einerseits<br />
ein Stimmenquorum einführen 310 , welches vorsieht,<br />
dass die absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen jeder<br />
Sparte dem Beschluss zustimmen muss. Andererseits könnte<br />
die Beschlussfassung auch von der Anwesenheit einer<br />
bestimmten Anzahl von Personen oder Stimmen abhängig<br />
gemacht werden 311 . Auch eine Mischung dieser beiden Varianten<br />
ist möglich 312 . Die Einführung von erhöhten Quoren ist<br />
jedoch immer mit der Gefahr der Beschlussunfähigkeit der<br />
Gesellschaft verbunden 313 . Insbesondere bei Publikumsgesellschaften<br />
ist daher grösste Vorsicht geboten.<br />
1.2.3. Treuepflicht der Aktionäre<br />
[Rz 91] Ein weiteres Instrument zur Verhinderung von Konflikten<br />
zwischen den Sparten könnte die Treuepflicht der Aktionäre<br />
darstellen. Sowohl im amerikanischen als auch im deutschen<br />
Recht unterstehen die Aktionäre einer Treuepflicht und<br />
eine Verletzung derselben ist auch sanktionierbar 314 . Fraglich<br />
ist, ob eine solche Treuepflicht nach schweizerischem<br />
Rechtsverständnis zulässig ist. In der Schweiz untersteht<br />
der VR einer gesetzlichen Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1<br />
OR. Eine Treuepflicht der Aktionäre lehnt die Mehrheit der<br />
Autoren und auch das Bundesgericht mit dem Hinweis auf<br />
Art. 680 Abs. 1 OR ab 315 . Demgegenüber vertritt eine Minderheit<br />
die Ansicht, dass die Treuepflicht in gewissen Situationen<br />
306 Vgl. BsK or ii-Vo g t /Li e B i , Art. 654-656 N 68.<br />
307 rih m , S. 49.<br />
308 Vgl. dazu: hor B e r , S. 44 ff.<br />
309 Böc K L i , Aktienrecht, § 12 N 409 m.w.H.<br />
310 Vgl. dazu: ta n n e r , § 2 N 7 ff.<br />
311 Sog. Präsenzquorum. Vgl. dazu: ta n n e r , § 2 n 4 ff.<br />
312 ta n n e r , § 2 N 11.<br />
313 Vgl. ta n n e r , § 5 N 30.<br />
314 Vgl. Kun z , Minderheitenschutz, § 8 N 48.<br />
315 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 1 N 19 (FN 69) m.w.H.; Kun z , Minderheiten-<br />
schutz, § 8 N 31 m.w.H.<br />
20<br />
durchaus Anwendung finden könnte 316 . Dabei wird zwischen<br />
gesetzlichen und statutarischen Treuepflichten unterschieden<br />
317 . Eine gesetzliche Treuepflicht sieht das Aktienrecht<br />
nicht vor 318 . Die Festlegung einer Treuepflicht dürfte jedoch<br />
in den Statuten durchaus möglich sein 319 . Die statutarische<br />
Einführung greift allerdings massiv in die Rechtsstellung der<br />
Aktionäre ein; folglich müsste ein solcher Beschluss die Zustimmung<br />
sämtlicher Aktionäre voraussetzen 320 . Die Zustimmung<br />
sämtlicher Aktionäre dürfte hingegen bei Publikumsgesellschaften,<br />
die wohl die Mehrzahl der TS-Emittenten<br />
darstellt, praktisch ausgeschossen sein. Auch ist offen, wie<br />
die Situation nach der Aktienrechtsrevision aussehen wird.<br />
Nach dieser erfährt nämlich Art. 680 Abs. 1 OR dahingehend<br />
eine Änderung, dass den Aktionären durch die Gesellschaft<br />
nur noch Pflichten auferlegt werden können, die im Gesetz<br />
vorgesehen sind 321 . Die Konsequenz aus dieser Neuformulierung<br />
dürfte sein, dass eine statutarische Begründung einer<br />
Treuepflicht dem Wortlaut von Art. 680 Abs. 1 E-OR widerspräche<br />
und daher nicht mehr zulässig wäre.<br />
[Rz 92] Wenn man die Einführung einer Treuepflicht befürwortet,<br />
muss noch deren Inhalt definiert werden. Dieser<br />
kann nicht allgemein gültig festgelegt werden, sondern ist<br />
grundsätzlich aus dem Gesellschaftszweck abzuleiten 322 .<br />
Dabei sollte als Maxime gelten, dass die Einflussnahme eines<br />
Aktionärs nicht dem Unternehmensinteresse widersprechen<br />
darf 323 . In einer TS-Gesellschaft sollte im Zweckartikel<br />
festgelegt werden, dass die Gesellschaft eine TS-Struktur<br />
zum Verfolgen ihrer Ziele benutzt. Damit bezieht sich auch<br />
eine allfällige Treuepflicht auf die Bewahrung einer solchen<br />
Struktur. Gemäss To n n e r sollen die TS-Aktionäre dabei einer<br />
Rücksichtsnahme- und einer Förderungspflicht unterstehen<br />
324 . Die Rücksichtsnahmepflicht gebietet die grundsätzliche<br />
Rücksichtsnahme auf die Belange der anderen<br />
Aktionäre 325 . Die Förderungspflicht verlangt demgegenüber<br />
die Zustimmung der jeweiligen Sonderversammlungen zu<br />
gewissen Beschlüssen, denen ein Blockadepotenzial zukommt<br />
326 . Diese Förderungspflicht darf jedoch nur restriktiv<br />
316 Vgl. Kun z , Minderheitenschutz, § 8 N 33 m.w.H.<br />
317 Kun z , Minderheitenschutz, § 8 N 33.<br />
318 Kun z , Minderheitenschutz, § 8 N 46. Dies im Gegensatz zum Recht der<br />
GmbH (Art. 803 OR) und der Genossenschaft (Art. 866 OR).<br />
319 Kun z , Minderheitenschutz, § 8 N 35. Auch Art. 680 Abs. 1 OR sollte dieser<br />
Statutenbestimmung nicht im Wege stehen, da sich dieser auf die Liberierung<br />
bezieht und nicht jegliche Gesellschafterpflicht umfasst. Vgl. dazu:<br />
Kun z , Minderheitenschutz, § 8 N 34.<br />
320 Kun z , Minderheitenschutz, § 8 N 36.<br />
321 Vgl. Bot s c h a F t aK t i e n r e c h t 2007, S. 1664.<br />
322 ne n n i n g e r , S. 110.<br />
323 ne n n i n g e r , S. 113.<br />
324 to n n e r , S. 99.<br />
325 to n n e r , s. 99. Insbesondere sind darunter Beschlüsse zu erfassen, welche<br />
einer Sparte unzulässigerweise mit den Mitteln einer anderen Sparte finanzieren.<br />
Vgl. dazu: to n n e r , s. 100.<br />
326 Vgl. to n n e r , S. 100 f.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
angewendet werden, und zwar immer dann, wenn der Verweigerung<br />
der Zustimmung keine sachliche Rechtfertigung<br />
zugrunde liegt. Ansonsten hat eine Sparte natürlich das<br />
Recht, ihr Blockadepotenzial auszunutzen 327 .<br />
2. Stimmkraft<br />
2.1. Grundproblem<br />
[Rz 93] Neben dem Interessenkonflikt der Aktionäre gibt es<br />
im Zusammenhang mit dem Stimmrecht noch ein weiteres,<br />
sehr spezifisches TS-Problem. Als Beispiel soll ein Unternehmen<br />
mit zwei Sparten dienen. Entwickeln sich nun die<br />
Aktienkurse beider Sparten gegenläufig, kann die Situation<br />
eintreten, dass durch den Zukauf der billigen Aktien auch die<br />
teure Sparte übernommen werden kann 328 . Der Nennbetrag<br />
widerspiegelt nämlich nur noch innerhalb einer Sparte den<br />
Beteiligungsumfang und damit das wirtschaftliche Risiko<br />
zuverlässig 329 . Es kann somit zur Situation kommen, in der<br />
die Mehrheit der Stimmen in der Generalversammlung nicht<br />
mehr die Mehrheit des Börsenwertes aller Anteile der Gesellschaft<br />
ausdrückt 330 . Zwischen den Sparten müsste daher ein<br />
anderer Massstab gelten, der die unterschiedlichen Wertentwicklungen<br />
der Sparten mitberücksichtigt 331 .<br />
2.2. Amerikanische Lösung<br />
[Rz 94] In den USA begegnet man diesem Problem mit Aktien,<br />
die ein variables Stimmrecht verbriefen 332 . Diese sog.<br />
«floating voting rights» gewähren in Abhängigkeit von bestimmten<br />
wirtschaftlichen Parametern eine unterschiedliche<br />
Stimmkraft 333 . In Bezug auf TS wird zumeist das Stimmrecht<br />
einer Sparte fixiert, z.B. auf eine Stimme pro Aktie, währenddem<br />
das Stimmrecht der anderen Gattung in einem bestimmten<br />
Zeitpunkt im Verhältnis zum Börsenwert der beiden<br />
Sparten angepasst wird 334 . Diese variable Ausgestaltung<br />
der Stimmrechte wird dadurch ermöglicht, dass im amerikanischen<br />
Recht auf das Nennwertprinzip verzichtet werden<br />
kann 335 . Die Aktionärsrechte sind damit nicht mehr an ein<br />
festes Grundkapital gebunden, woraus eine grössere Flexibilität<br />
resultiert 336 .<br />
2.3. Variables Stimmrecht in der Schweiz<br />
[Rz 95] In der Schweiz üben die Aktionäre ihr Stimmrecht<br />
nach dem Verhältnis des gesamten Nennwerts der ihnen<br />
327 Zur Sanktionierung einer Treuepflichtverletzung siehe: ne n n i n g e r , s. 115<br />
ff.<br />
328 Vgl. Log u e /se w a r d /wa L s h , S. 46.<br />
329 to n n e r , S. 104.<br />
330 wu n s c h , S. 48.<br />
331 to n n e r , S. 104.<br />
332 to n n e r , S. 106.<br />
333 to n n e r , S. 106.<br />
334 to n n e r , S. 106; na t u s c h , S. 87; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 534.<br />
335 Vgl. dazu: me r K t /gö t h e L , N 456 ff.<br />
336 Für eine Aufzählung der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten siehe:<br />
th i e L , s. 56 f.<br />
21<br />
gehörenden Aktien aus 337 . Damit wird deutlich, dass das<br />
Stimmrecht in der Schweiz sich grundsätzlich nach der Kapitalbeteiligung<br />
richtet bzw. auf dem Nennwertprinzip beruht 338 .<br />
Die Einführung von nennwertlosen Aktien verstösst zudem<br />
gegen die Grundstruktur der AG 339 . Die einzige Möglichkeit,<br />
die das geltende Recht vorsieht, um die Stimmkraft eines<br />
Aktionärs zu erhöhen, ist mittels unechten Stimmrechtsaktien<br />
gemäss Art. 693ff. OR 340 . Im Gegensatz dazu ist die Einführung<br />
von echten Stimmrechtsaktien, d.h. Aktien, die bei<br />
gleichem Nennwert mehrere Stimmen auf sich vereinigen,<br />
unzulässig 341 . Damit besteht grundsätzlich dieselbe Rechtslage<br />
wie in Deutschland, wo ein variables Stimmrecht auch<br />
nicht zulässig ist 342 .<br />
[Rz 96] Eine Lösungsmöglichkeit für das vorliegende Problem<br />
zu finden gestaltet sich aufgrund der Starrheit des Gesetzes<br />
als schwierig. Eine Möglichkeit wäre die Anpassung<br />
der Anzahl der Aktien mittels Aktiensplit gemäss Art. 623<br />
Abs. 1 OR 343 . Dies basiert auf der Idee, dass durch einen<br />
Aktiensplit in einer Sparte der Wert pro Aktie dem Wert pro<br />
Aktie einer anderen Sparte angepasst werden kann 344 . Diese<br />
Möglichkeit bedingt jedoch eine ausserordentliche Generalversammlung<br />
vor jeder ordentlichen Generalversammlung,<br />
die einen Beschluss über den Aktiensplit fällt. Aufgrund dessen<br />
und weiterer rechtlicher Schwierigkeiten wird diese Möglichkeit<br />
von der Lehre als zu kompliziert und praxisuntauglich<br />
angesehen 345 .<br />
[Rz 97] Es kann daher nur unter komplizierten Bedingungen<br />
ein Massstab hergestellt werden, der die Wertverhältnisse<br />
beider Sparten berücksichtigt. Ku h n weist jedoch mit Recht<br />
darauf hin, dass es nicht ersichtlich ist, warum der Verfall des<br />
Kurses einer Aktienkategorie zwingend mit dem Verlust von<br />
Stimmrechten einhergehen soll 346 .<br />
§ 8 Die Rechtsstellung des Verwaltungsrates<br />
I. Vergleich mit konventionellem Verwaltungsrat<br />
[Rz 98] Die Stellung des TS-Verwaltungsrates unterscheidet<br />
sich grundsätzlich nicht von derjenigen eines konventionellen<br />
Verwaltungsrates. Aufgrund der rechtlichen Einheit ist auch<br />
dieser für die ganze Gesellschaft, also für sämtliche Sparten<br />
337 Art. 692 Abs. 1 OR.<br />
338 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 4 N 10.<br />
339 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 16 N 168. Dieses Dogma wird auch durch die<br />
Aktienrechtsrevision nicht umgestossen. Vgl. dazu: Bot s c h a F t aK t i e n r e c h t<br />
2007, 1616 f.<br />
340 Vgl. Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 24 N 100.<br />
341 Vgl. rih m , s. 19; Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 24 N 101.<br />
342 Vgl. Kuh n , S. 86; to n n e r , S. 108.<br />
343 Vgl. dazu: wu n s c h , s. 50 ff.<br />
344 wu n s c h , S. 50.<br />
345 Kuh n , S. 87; Bau e r , S. 159.<br />
346 Kuh n , S. 89.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
zuständig. Der entscheidende Unterschied besteht allerdings<br />
darin, dass der Verwaltungsrat in einer TS-Gesellschaft zwei<br />
Gruppen von Aktionären untersteht. Er ist folglich «Diener<br />
mehrerer Herren» 347 . Daraus ergeben sich gewisse Konflikte,<br />
die nachfolgend umrissen werden sollen. In einem zweiten<br />
Teil sollen Schutzmöglichkeiten der TS-Aktionäre gegenüber<br />
dem Verwaltungsrat aufgezeigt werden.<br />
II. Gefahr der unfairen Behandlung<br />
[rz 99] ha s s untersuchte für das amerikanische Recht eingehend<br />
die Probleme, die sich auf Stufe des Verwaltungsrates<br />
einer TS-Gesellschaft stellen können. Er lokalisierte dabei<br />
sechs kritische Beschlüsse 348 :<br />
1. Aufteilung der knappen Ressourcen und der gemeinsamen<br />
Kosten des Unternehmens, Aufteilung der<br />
Chancen sowie Mergers&Acquisitons,<br />
2. Kommunikationsentscheide,<br />
3. Dividendenentscheid,<br />
4. Ausgestaltung der internen Transaktionen,<br />
5. Entscheide bezüglich Umwandlung von <strong>Tracking</strong><br />
<strong>Stocks</strong>,<br />
6. Verteilung des neu aufgenommenen Kapitals und der<br />
Erträge daraus.<br />
[Rz 100] Die Liste könnte noch weitergeführt werden; gemeinsam<br />
ist jedoch allen diesen Beschlüssen, dass sich der<br />
Verwaltungsrat meistens nur zugunsten einer Sparte und damit<br />
zuungunsten einer anderen Sparte entscheiden kann 349 .<br />
Solche Beschlüsse müssen gefällt werden, der VR besitzt jedoch<br />
diesbezüglich ein erheblicher Ermessenspielraum. Die<br />
Gefahr besteht nun, dass der VR diesen Ermessenspielraum<br />
missbraucht und damit eine Sparte unfair behandelt. Diese<br />
Gefahr kann sich zudem erhöhen, wenn die Verwaltungsräte<br />
selber an den Sparten beteiligt sind 350 . Besitzt ein Verwaltungsrat<br />
eine schwergewichtige Beteiligung an einer Sparte,<br />
dürften seine Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad<br />
durch die eigenen Interessen beeinflusst werden 351 . Es muss<br />
daher nach rechtlichen Instrumenten gesucht werden, welche<br />
die Aktionäre der Sparten vor unfairer Behandlung durch<br />
den Verwaltungsrat schützen.<br />
III. Schutzmöglichkeiten<br />
1. Amerikanisches Recht<br />
[Rz 101] Dem Verwaltungsrat obliegt im amerikanischen<br />
Recht eine umfassende Sorgfaltspflicht (sog. «Duty of<br />
Care») und eine umfangreiche Treuepflicht (sog. «Duty of<br />
347 has s , I.A.3.<br />
348 has s , II.B.; noL t e , S. 121.<br />
349 Vgl. noL t e , S. 121.<br />
350 Die Ausgabe von TS-Options kann dazu führen. Siehe hinten §2/II/1.4.<br />
351 Vgl. has s , II.C.<br />
22<br />
Loyalty») 352 . Die Duty of Care befasst sich mit der Frage, welchen<br />
Sorgfaltsanforderungen die Verwaltungsräte bei ihren<br />
Entscheidungen zu genügen haben 353 . Die gerichtliche Anwendung<br />
dieser Duty of Care wird jedoch erheblich durch<br />
die sog. «business judgment rule» eingeschränkt 354 . Danach<br />
überprüft ein Gericht die Entscheidung eines Verwaltungsrates<br />
nicht, wenn dieser gewisse Mindestanforderungen 355 bei<br />
der Entscheidfindung berücksichtigt 356 . Die Duty of Loyalty<br />
verpflichtet die Mitglieder des Verwaltungsrates im besten<br />
Interesse der Gesellschaft zu handeln und sich nicht auf deren<br />
Kosten zu bereichern 357 . Die beiden Institute brauchen<br />
allerdings nicht näher beschrieben zu werden, da ha s s überzeugend<br />
darlegt, dass damit die beschriebenen Konfliktsituationen<br />
nicht gelöst werden können 358 . Er schlägt deshalb<br />
die Einführung einer dritten Pflicht vor, die sog. «Duty of<br />
Fairness» 359 . Das Ziel dieser Duty of Fairness ist es, zu vermindern,<br />
dass der Verwaltungsrat seine Macht missbraucht<br />
und dadurch gewisse Sparten unfair behandelt, währenddem<br />
er sich hinter der business judgment rule verstecken kann 360 .<br />
Gemäss der Duty of Fairness wird vermutet, dass eine Entscheidung<br />
dann fair sei, wenn der Entscheid (i) durch eine<br />
Mehrheit von nicht mit einem Interessenkonflikt belasteten<br />
Verwaltungsräte gefällt wurde, (ii) alle notwendigen Informationen<br />
berücksichtigt wurden und (iii) der Verwaltungsrat aufgrund<br />
der Informationen glaubte, dass die Entscheidung für<br />
alle Sparten fair sei 361 . Sind diese Bedingungen nicht erfüllt,<br />
so ist die Entscheidung dennoch als fair zu betrachten, wenn<br />
sie durch zustimmende Sonderbeschlüsse aller Sparten bestätigt<br />
wird oder wenn die Verwaltungsräte selber den Beweis<br />
erbringen können, dass die Entscheidung fair gewesen<br />
ist 362 . no lT e befürwortet die These von Ha s s, weil damit eine<br />
praxisgerechte Leitung der Gesellschaft möglich bleibt 363 . Die<br />
amerikanischen Gerichte hatten, soweit ersichtlich, in zwei<br />
Fällen die Entscheidungen eines Verwaltungsrats mit Blick<br />
auf eine TS-Struktur zu prüfen 364 . Obwohl dabei die Duty of<br />
Fairness nicht zur Anwendung kam, hatten die Gerichte aber<br />
aufgrund der Duty of Loyalty teilweise ähnliche Überlegun-<br />
352 me r K t /gö t h e L , N 821.<br />
353 noL t e , S. 126. Weiterführend: me r K t /gö t h e L , N 827 ff.<br />
354 Vgl. me r K t /gö t h e L , N 830.<br />
355 Vgl. dazu: Kun z , Minderheitenschutz, § 6 N 116.<br />
356 noL t e , S. 127.<br />
357 noL t e , S. 128. Weiterführend: me r K t /gö t h e L , N 877 ff.<br />
358 Vgl. has s , iV.a.2. und IV.B.2.<br />
359 has s , V.B.<br />
360 has s , V.B.<br />
361 has s , V.B.<br />
362 has s , V.B.<br />
363 Vgl. noL t e , S. 136.<br />
364 In re General Motors Class H Shareholders Litigation, 734 A.2d 611 Delaware<br />
Court of Chancery (Del.Ch. 1999) und Solomon v. Armstrong, 747<br />
A.2d 1098 (Del. Ch. 1999). Eine Besprechung der Urteile findet sich bei:<br />
Fuc h s , s. 196 ff. und Nolte, S. 142 ff.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
gen angestellt 365 . Dabei wurde jedoch die business judgment<br />
rule ohne weitere Modifikationen auf die TS-Struktur angewendet<br />
366 . Daraus resultierte in beiden Fällen eine Abweisung<br />
der Klagen. Somit kann festgestellt werden, dass im<br />
amerikanischen Recht der Schutz der Aktionäre gegenüber<br />
dem Verwaltungsrat aufgrund der Vermutung der business<br />
judgment rule nur schwach ausgeprägt ist.<br />
2. Schweizerisches Recht<br />
2.1. Pflichten des Verwaltungsrates<br />
[Rz 102] Die Verwaltungsräte unterstehen auch im schweizerischen<br />
Recht einer Sorgfalts- und einer Treuepflicht 367 .<br />
Ergänzt werden diese beiden Pflichten durch das Gleichbehandlungsgebot<br />
in Art. 717 Abs. 2 OR. Diese Trias von<br />
Verwaltungsratspflichten bildet die Ausgangslage für die Betrachtung<br />
der Schutzmöglichkeiten nach schweizerischem<br />
Recht. Fraglich ist allerdings, welchen Lösungsbeitrag diese<br />
Pflichten mit Blick auf die spezielle Struktur der TS zu leisten<br />
vermögen. Die Sorgfalts- und die Treuepflicht dürften nämlich,<br />
ebenso wie im amerikanischen Recht die Duty of Care<br />
und die Duty of Loyalty, keine grosse Hilfestellung leisten. In<br />
Bezug auf die Sorgfaltspflicht muss festgestellt werden, dass<br />
ein Entscheid, der eine Sparte unfair behandelt, durchaus<br />
in einem ordentlichen Verfahren zustande gekommen und<br />
inhaltlich vertretbar sein kann 368 . Auch die Treuepflicht vermag<br />
die spezifischen Probleme grundsätzlich nicht zu lösen.<br />
Danach hat der Verwaltungsrat nämlich die Interessen der<br />
Gesellschaft in guten Treuen zu wahren und damit alles zu<br />
unterlassen, was der Gesellschaft schaden könnte 369 . Dabei<br />
geht es insbesondere darum, solche Handlungen zu verhindern,<br />
bei denen das eigene Interesse der VR-Mitglieder mit<br />
demjenigen der AG kollidiert 370 . In casu ist aber nicht die Beziehung<br />
zwischen dem einzelnen Verwaltungsrat und der gesamten<br />
Gesellschaft entscheidend, sondern es geht um einen<br />
Auswahlentscheid des Verwaltungsrates zwischen den<br />
Sparten. Die beschriebene Konstellation entspricht vielmehr<br />
der dritten Pflicht, nämlich der Pflicht zur Gleichbehandlung.<br />
Danach hat der Verwaltungsrat die Aktionäre unter gleichen<br />
Voraussetzungen gleich zu behandeln. Er darf dabei von der<br />
Gleichbehandlung nur abweichen, sofern dafür ein sachlicher<br />
Grund vorliegt und der Eingriff nicht unverhältnismässig ist 371 .<br />
Die hier besprochenen Entscheidungen tangieren immer die<br />
Gleichbehandlung 372 . Entscheidend ist daher, ob sie sich<br />
365 Fuc h s , S. 196.<br />
366 Kritik bei: noL t e , s. 147 f.<br />
367 Art. 717 Abs. 1 OR.<br />
368 Vgl. bezüglich den Anforderungen an einen Verwaltungsratsentscheid unter<br />
schweizerischem Recht: Böc K L i , Aktienrecht, § 13 N 584.<br />
369 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 13 N 596 m.w.H.<br />
370 BSK OR II-wa t t e r /ro t h Pe L L a n d a , Art. 717 N 15.<br />
371 BSK OR II-wa t t e r /ro t h Pe L L a n d a , Art. 717 N 23.<br />
372 Die Ungleichbehandlung ist dem <strong>Tracking</strong> Stock-Modell inhärent. Vgl. noL-<br />
t e, s. 133.<br />
23<br />
sachlich rechtfertigen lassen. Dies dürfte grundsätzlich der<br />
Fall sein, da der Verwaltungsrat selten eine Allokationsentscheidung<br />
ohne sachlichen Grund treffen wird. Neben einem<br />
sachlichen Grund muss die Entscheidung aber auch verhältnismässig<br />
sein. Darin könnte das von ha s s angesprochene<br />
Element der Fairness enthalten sein. Die Entscheidung muss<br />
nämlich geeignet, erforderlich und zumutbar sein 373 . Die Eignung<br />
wird wohl selten fehlen, wenn ein sachlicher Grund vorliegt.<br />
Interessanter sind die zwei anderen Elemente. Bei der<br />
Erforderlichkeit ist darzulegen, dass kein milderes, jedoch<br />
gleich wirksames Mittel vorhanden ist. Hier ist deutlich der<br />
zweite Punkt von ha s s wieder zuerkennen, dass nämlich der<br />
VR bei seiner Entscheidungsfindung sämtliche Informationen<br />
zu berücksichtigt hat. Schliesslich muss der Entscheid<br />
auch zumutbar sein. Im Sinne von Hass wird hier geprüft,<br />
ob der Entscheid für alle Sparten fair ist. Damit kann festgestellt<br />
werden, dass zwischen der Duty of Fairness und dem<br />
Gleichbehandlungsprinzip grosse Parallelen bestehen. Wird<br />
ein Beschluss als verhältnismässig qualifiziert, dürfte er wohl<br />
auch als fair gelten. Das Gleichbehandlungsprinzip ist damit<br />
ein adäquates Mittel, um die Fairness zwischen den Sparten<br />
zu gewährleisten. Verletzt der Verwaltungsrat dieses Gebot,<br />
steht den Aktionären grundsätzlich die Verantwortlichkeitsklage<br />
nach Art. 754 OR offen 374 .<br />
2.2. Direkte Einflussnahme der Sparten<br />
2.2.1. Ernennung eines Sachverständigen<br />
[Rz 103] Nach Art. 731a Abs. 3 OR kann die Generalversammlung<br />
zur Prüfung der Geschäftsführung Sachverständige<br />
ernennen. Obwohl die praktische Bedeutung dieses<br />
Instituts sehr gering ist 375 , könnte es zur Lösung des hier<br />
behandelten Problems durchaus seinen Beitrag leisten.<br />
Die Generalversammlung besitzt nämlich die Möglichkeit,<br />
ein unabhängiges Gremium 376 zu konstituieren, das die Geschäftsführer<br />
in Bezug auf die Gleichbehandlung der Sparten<br />
überprüfen soll. Die GV kann die Prüfung eines bestimmten<br />
Sachverhalts verlangen; es ist ihr aber auch möglich, eine<br />
ständige Überwachung anzuordnen 377 . Obwohl es einem<br />
solchen Gremium nicht zusteht, den exekutiven Organen Instruktionen<br />
oder Ratschläge zu erteilen 378 , könnte es durch<br />
seine Präsenz und insbesondere durch seine Berichterstattung<br />
an die Generalversammlung 379 einen gewissen Einfluss<br />
auf die Entscheidungen der Geschäftsführer nehmen. Es ist<br />
daher den Aktionären einer TS-Gesellschaft zu empfehlen,<br />
einen solchen ständigen Prüfungsrat einzurichten und ihn<br />
373 BSK OR II-wa t t e r /ro t h Pe L L a n d a , Art. 717 N 23.<br />
374 Vgl. dazu: hug u e n i n Ja c o B s , S. 210 ff.<br />
375 tr u F F e r, S. 406 m.w.H.<br />
376 Bestehend aus natürlichen oder juristischen Personen. tr u F F e r, s. 416.<br />
377 tr u F F e r, S. 418.<br />
378 tr u F F e r, S. 418 f.<br />
379 Vgl. dazu: tr u F F e r, s. 423 ff. Diese kann im Gegensatz zur Sonderprüfung<br />
auch Elemente der Beurteilung und Würdigung enthalten. Vgl. tr u F F e r, s.<br />
419.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
mit der Überwachung der Geschäftsführung in Bezug auf die<br />
Gleichbehandlung der Sparten zu beauftragen.<br />
2.2.2. Vertretung im Verwaltungsrat<br />
[Rz 104] Die Stellung der Sparten könnte zudem durch das<br />
Vertretungsrecht nach Art. 709 Abs. 1 OR gestärkt werden 380 .<br />
Bestehen nämlich mehrere Aktienkategorien, müssen die<br />
Statuten den Aktionären jeder Kategorie die Wahl wenigstens<br />
eines Vertreters im Verwaltungsrat garantieren 381 . Die<br />
Anwendung dieser Norm auf TS-Strukturen könnte aufgrund<br />
deren Wortlauts problematisch sein. Dieser fordert nämlich<br />
«mehrere Kategorien von Aktien». In einer TS-Gesellschaft<br />
gibt es jedoch nur eine Kategorie von Aktien, nämlich <strong>Tracking</strong><br />
<strong>Stocks</strong>. Die TS unterscheiden sich zwar umfangmässig,<br />
weil die Spartenergebnisse unterschiedlich hoch<br />
ausfallen können, jedoch begründen solche tatsächlichen<br />
Unterschiede noch keine verschiedenen Aktienkategorien 382 .<br />
Damit kann Art. 709 Abs. 1 OR nicht direkt angewendet<br />
werden, sondern es ist eine analoge Anwendung zu prüfen.<br />
Voraussetzung für eine analoge Anwendung ist die Gleichwertigkeit<br />
der Tatbestände 383 . Der Sinn der Norm liegt darin,<br />
dass den Aktionären ein Mitspracherecht bei Entscheidungen<br />
eingeräumt werden soll, die unmittelbare Auswirkungen<br />
auf den Ertrag ihrer Beteiligungen haben könnten 384 . Eine<br />
Verbesserung des Mitspracherechts wird jedoch auch bei<br />
TS-Aktionären angestrebt. Die TS-Aktionäre sollen vor unfairen<br />
Behandlungen geschützt werden, die ihre Gewinnaussichten<br />
schmälern. Damit sind die Tatbestände gleichwertig<br />
und eine analoge Anwendung gerechtfertigt. Die Statuten<br />
einer TS-Gesellschaft sollten damit ein Vertretungsrecht der<br />
Sparten vorsehen.<br />
2.2.3. Verweigerung der Entlastung<br />
[Rz 105] Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass die Generalversammlung<br />
dem Verwaltungsrat die Entlastung verweigert<br />
385 . Die Aktionäre können damit zwar nicht unmittelbar<br />
auf den Verwaltungsrat einwirken, die Verweigerung dürfte<br />
jedoch einem Warnschuss gleichkommen, der mittelbar gewisse<br />
Wirkungen entfalten könnte 386 . Sinnvollerweise müsste<br />
der Entlastungsbeschluss auch in den Sonderversammlungen<br />
gefällt werden, da sonst eine grössere Sparte die Entlastung<br />
im Alleingang gewähren könnte 387 .<br />
2.2.4. De lege ferenda: Art. 716b E-OR<br />
[Rz 106] Art. 716b E-OR sieht die Möglichkeit vor, dass<br />
bestimmte Entscheide des Verwaltungsrats der GV zur<br />
380 Vgl. rih m , S. 19.<br />
381 BSK OR II-wer n L i , Art. 709 N 5.<br />
382 Vgl. Li e B i , n 357 m.w.H.<br />
383 Vgl. me i e r -ha y o z , Art. 1 N 347.<br />
384 BSK OR II-wer n L i , Art. 709 N 4.<br />
385 Art. 698 Abs. 2 Ziff. 5 OR.<br />
386 Vgl. to n n e r , S. 221.<br />
387 Vgl. to n n e r , S. 221.<br />
24<br />
Genehmigung unterbreitet werden können 388 . Die genehmigungspflichtigen<br />
Beschlüsse müssen in den Statuten genau<br />
umschrieben werden, wobei zu beachten ist, dass nicht<br />
sämtliche Beschlüsse des VR zur Disposition stehen 389 . Diese<br />
Genehmigungspflicht dürfte auch für TS-Gesellschaften<br />
ein interessantes Instrument sein. Insbesondere könnten damit<br />
Veränderungen in der Spartenorganisation von der Genehmigung<br />
der GV abhängig gemacht werden.<br />
§ 10 Auflösung der TS-Struktur<br />
I. Amerikanisches Recht<br />
[Rz 107] Die meisten TS-Gesellschaften haben in ihren Statuten<br />
ausführliche Bestimmungen zur Auflösung der TS-Struktur<br />
aufgenommen 390 . Typischerweise wird dabei zwischen<br />
dem freiwilligen (optional) und dem zwingenden (mandatory)<br />
Umtausch (exchange) unterschieden 391 . Beim freiwilligen<br />
Umtausch steht es im Ermessen des Verwaltungsrates, für<br />
einen Aufpreis Aktien einer TS-Kategorie gegen alle übrigen<br />
ausstehenden Aktien einzutauschen 392 . Demgegenüber wird<br />
der zwingende Umtausch durch den Verkauf aller oder wichtiger<br />
Vermögenswerte einer Sparte ausgelöst 393 .<br />
II. Schweizerisches Recht<br />
[Rz 108] Nachfolgend soll kurz auf die verschiedenen Möglichkeiten<br />
der Auflösung nach schweizerischem Recht eingegangen<br />
werden. Gemeinsam ist allen Optionen, dass sie<br />
eine Zweckänderung voraussetzen und ein Beschluss in den<br />
Sonderversammlungen gefällt werden muss.<br />
1. Umwandlung<br />
[Rz 109] Die einfachste Möglichkeit der Rückabwicklung einer<br />
TS-Struktur besteht in der Umwandlung der TS-Aktien<br />
in Stammaktien. Konkret bedeutet dies, dass die Generalversammlung,<br />
in analoger Anwendung von Art. 654 Abs. 1<br />
OR, einen Beschluss fassen muss, der die Modifikation der<br />
Vermögensrechte rückgängig macht 394 .<br />
2. Spaltung<br />
[Rz 110] Die TS-Struktur kann durch eine Spaltung der Gesellschaft<br />
aufgelöst werden. Dies kann einerseits durch die<br />
Aufspaltung und andererseits durch die Abspaltung gesche-<br />
388 Vgl. Bot s c h a F t aK t i e n r e c h t 2007, S. 1686.<br />
389 Vgl. Bot s c h a F t aK t i e n r e c h t 2007, S. 1686.<br />
390 noL t e , s. 103. Für eine Übersicht siehe: na t u s c h , s. 262 ff., 290 ff.<br />
391 Vgl. st e i n B e r g e r /ha s s , s. 533. Für weitere Möglichkeiten der Umgestaltung<br />
der Eigenkapitalstruktur im US-Recht siehe: No L t e , s. 103 ff.<br />
392 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 533.<br />
393 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 533.<br />
394 Siehe vorne §6/III/2.1.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
hen 395 . Zu beachten ist das erforderliche Quorum nach Art. 18<br />
Abs. 1 Lit. a FusG.<br />
3. Bedingte oder befristete Einführung<br />
[Rz 111] Eine weitere Möglichkeit könnte die bedingte Einführung<br />
der Struktur sein 396 . Die Einführungsbeschlüsse der<br />
Generalversammlung wären gemäss Art. 154 OR auflösend<br />
bedingt, d.h. dass mit dem Zeitpunkt, in dem die Bedingung<br />
in Erfüllung ginge, die TS-Struktur wieder aufgelöst und nur<br />
noch Stammaktien bestehen würden. Die Zulässigkeit von<br />
aufschiebend bedingten Generalversammlungsbeschlüssen<br />
wird grundsätzlich bejaht 397 . Demgegenüber weist Bö c K l i<br />
darauf hin, dass auflösend bedingte Beschlüsse besonders<br />
heikel sind, und er verneint die Zulässigkeit von Statutenänderungen<br />
unter einer solchen Bedingung wohl aufgrund der<br />
Rechtssicherheit 398 . Wird jedoch in den Statuten klar kommuniziert,<br />
welche Ereignisse die Bedingung auszulösen vermögen,<br />
könnte die Rechtssicherheit nicht tangiert und damit<br />
eine auflösend bedingte Statutenänderung zulässig sein 399 .<br />
Fraglich bleibt in diesem Fall, welche Ereignisse die Rückabwicklung<br />
auslösen können. Von besonderem Interesse<br />
ist, ob die Rückabwicklung von einem Beschluss des Verwaltungsrates<br />
abhängig gemacht werden könnte 400 . Damit<br />
würde auf dem Weg der Bedingung dem Verwaltungsrat die<br />
Entscheidung bezüglich der Rückabwicklung der TS-Struktur<br />
in die Hände gelegt. Da mit der Rückabwicklung der Struktur<br />
zahlreiche Statutenänderungen, insbesondere auch die<br />
Zweckänderung, verbunden sind, wäre wohl die Delegation<br />
dieser Entscheidung an den Verwaltungsrat nicht zulässig,<br />
u.U. auch rechtsmissbräuchlich. Demgegenüber sind zufällige<br />
Bedingungen, d.h. solche, welche nicht vom Willen des<br />
Verwaltungsrates abhängen, wohl zulässig 401 . Die TS-Struktur<br />
könnte damit von der Bedingung abhängig gemacht werden,<br />
dass keine Sparte über eine gewisse Zeit ein negatives<br />
Ergebnis erzielen dürfte.<br />
[Rz 112] Von der bedingten Einführung ist die befristete abzugrenzen.<br />
Diese dürfte grundsätzlich zulässig sein, da sie die<br />
Rechtssicherheit nicht tangiert 402 .<br />
Vierter Teil: Ergebnisse<br />
[Rz 113] Die Untersuchungen dieser Arbeit führten zu folgenden<br />
Ergebnissen:<br />
[Rz 114] Erstens ist festzuhalten, dass TS als besondere<br />
395 Art. 29 FusG.<br />
396 Vgl. wu n s c h , S. 101.<br />
397 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 12 N 201. Für eine allgemeine Zulässigkeit:<br />
duB s , s. 362.<br />
398 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, N 206 f.<br />
399 Vgl. duB s , S. 373.<br />
400 Vgl. wu n s c h , S. 101.<br />
401 Vgl. duB s , S. 374.<br />
402 Vgl. duB s , S. 368.<br />
25<br />
Aktienkategorie zu betrachten sind. Das Hauptcharakteristikum<br />
dieser Aktienkategorie besteht nämlich darin, dass ihre<br />
Vermögensrechte, unter Wahrung der rechtlichen Einheit des<br />
emittierenden Unternehmens, auf einen Unternehmensteil<br />
beschränkt sind. Dies lässt sich unter keine der bestehenden<br />
Aktienkategorien subsumieren.<br />
[Rz 115] Zweitens ist die Realisation einer TS-Struktur im<br />
schweizerischen Aktienrecht de lege lata möglich.<br />
[Rz 116] Das Aktienrecht lässt sowohl eine Spartenorganisation<br />
als auch eine Spartenrechnungslegung zu und bietet<br />
eine Mehrzahl von Möglichkeiten für die konkrete Einführung<br />
einer TS-Struktur. Auch die Untersuchung der Rechtsstellung<br />
der TS-Aktionäre ergab keine Hindernisse, die gegen eine<br />
Einführung einer TS-Struktur sprechen. In dieser Hinsicht<br />
kann nämlich festgestellt werden, dass die Beschränkung<br />
des Dividenden- und Liquidationsanteilsrechts auf einen Unternehmensteil<br />
infolge der dispositiven Natur von Art. 660<br />
Abs. 1 OR und der Privatautonomie möglich ist. Schwierigkeiten<br />
bereitet hingegen ein allgemeines Bezugsrecht. Dem<br />
kann u.U. mit Bezugsrechtsausschlüssen entgegengetreten<br />
werden. Problematischer erscheint die Ausgestaltung des<br />
Stimmrechts. Zwar kann den auftretenden Interessenkonflikten<br />
unter den Aktionären durch statutarische Bestimmungen<br />
Einhalt geboten werden; aber gegen eine divergierende<br />
Börsenkursentwicklung der Sparten stehen keine Mittel zur<br />
Verfügung. Allfällige unfaire Behandlungen durch den Verwaltungsrat<br />
können durch das Gleichbehandlungsprinzip<br />
beurteilt und sanktioniert werden. Daneben müssen die Aktionäre<br />
aber auch aktiv auf die Unternehmensführung einwirken.<br />
Das Aktienrecht stellt ausserdem geeignete Mittel für die<br />
Rückabwicklung dieser Struktur zur Verfügung.<br />
[Rz 117] Der Weg für die Einführung von TS ist zwar schwierig,<br />
bleibt jedoch einem willigen Unternehmen nicht verschlossen.<br />
Das Hauptproblem dürfte dabei die sorgfältige Statutenredaktion<br />
sein. Hier könnte der Gesetzgeber der Praxis einen<br />
grossen Dienst erweisen, wenn er TS kodifizieren würde. Er<br />
könnte z.B. nach den Regeln über die Vorzugsaktien einen<br />
vierten Abschnitt einfügen, der die <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> behandelt.<br />
Dabei braucht es keine umfassende Regelung der Thematik,<br />
sondern nur punktuelle Eingriffe 403 . Auf diese Weise<br />
könnten Unsicherheiten beseitigt und der Einführung dieses<br />
faszinierenden Finanzierungsinstruments zum Durchbruch<br />
verholfen werden.<br />
Literaturverzeichnis<br />
Zitierweise: Nur einmal verwendete Quellen werden vollständig<br />
in den Fussnoten zitiert und sind im Literaturverzeichnis<br />
nicht aufgeführt. Mehrfach verwendete Quellen werden abgekürzt<br />
zitiert: Nachname des Autors (der Autoren), genaue<br />
403 Vgl. für einen Gesetzesvorschlag für das deutsche Recht: to n n e r , S. 378.
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
Fundstelle. Ausnahmen von diesem Muster sind in Klammern<br />
gekennzeichnet.<br />
Ba u e r Ma n u e l, Targeted <strong>Stocks</strong> als Alternative zu Desinvestitionen,<br />
Diss. Freiburg (Breisgau), Bern/Stuttgart/Wien 2000<br />
= Bank- und finanzwirtschaftliche Forschung Band 310.<br />
Ba u M s Th e o d o r, Spartenorganisation, «<strong>Tracking</strong> Stock» und<br />
deutsches Aktienrecht, in: Verantwortung und Gestaltung,<br />
Festschrift für Karlheinz Boujong zum 65. Geburtstag, ca r s-<br />
T e n Th o M a s eB e n r o T h /di eT e r he s s e l B e r g e r /Ma n F r e d eB e r h a r d<br />
ri n n e (Hrsg.), München 1996.<br />
Bö c K l i Pe T e r, Schweizer Aktienrecht, 4. Auflage, Zürich 2009.<br />
(Zit.: Bö c K l i, Aktienrecht)<br />
Bö c K l i Pe T e r, Die unentziehbaren Kernkompetenzen des<br />
Verwaltungsrates, Zürich 1994 = Schriften zum neuen Aktienrecht<br />
Band 7. (Zit.: Bö c K l i, Kernkompetenzen)<br />
Br a u e r ul r i c h g.h., Die Zulässigkeit der Ausgabe von sog.<br />
«<strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>» durch Aktiengesellschaften nach deutschem<br />
Aktienrecht, Aktiengesellschaft (AG) 7 (1993), S.<br />
324 ff.<br />
du B s di eT e r, Die bedingte Beschlussfassung der Aktionäre<br />
an der Generalversammlung, in: Festschrift für Jean Nicolas<br />
Druey, ra i n e r J. sc h W e i z e r/he r B e r T Bu r K e r T/ur s ga s s er<br />
(Hrsg.), Zürich 2002.<br />
Fe h l M a n n Ku r T, Die Aktie im anglo-amerikanischen und kontinentalen<br />
Recht in rechtsvergleichender Darstellung, Diss.<br />
Bern 1950.<br />
Fo r s T M o s e r Pe T e r /Me i e r-hay o z ar T h u r /no B e l Pe T e r, Schwei-<br />
zerisches Aktienrecht, Bern 1996.<br />
Fu c h s an d r e a s, <strong>Tracking</strong> Stock – Spartenaktien als Finanzierungsinstrument<br />
für deutsche Aktiengesellschaften, Zeitschrift<br />
für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR) 2<br />
(2003), S. 167 ff.<br />
ha s s JeFFr e y J., Directorial Fiduciary Duties in a <strong>Tracking</strong><br />
Stock Equity Structure: The Need for a Duty of Fairness, in:<br />
Michigan Law Review, Vol. 94 (1996), S. 2089 ff.<br />
ho M B u r g e r er i c, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen<br />
Privatrecht, Teilband V 5b: Der Verwaltungsrat - Art. 707-726,<br />
Zürich 1997.<br />
he i n r i c h ho n s e l l /ne d iM Pe T e r Vo g T/ro l F WaT T e r (Hrsg.), Basler<br />
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht<br />
II, Art. 530-1186 OR, 3. Auflage, Basel 2008. (Zit.<br />
BSK OR II-Be a r B e iT e r /in)<br />
ho r B e r Fe l i x, Die Sonderversammlung im Aktienrecht, Zürich<br />
1995 = Schriften zum neuen Aktienrecht Band 9.<br />
hu g u e n i n Ja c o B s cl a i r e, Das Gleichbehandlungsprinzip im<br />
Aktienrecht, Habil. Zürich 1994.<br />
Ja e g e r ch r i sT o P h e r, Targeted Stock als Restrukturierungsin-<br />
strument, Diss. Koblenz, Wiesbaden 1999.<br />
26<br />
Kä g i ar T h u r, Die Prioritätsaktie nach schweizerischem und<br />
deutschem Recht, Diss. Zürich, Aarau 1918.<br />
Ko l l e r ar n o l d, Grundfragen einer Typuslehre im Gesell-<br />
schaftsrecht, Diss. Freiburg 1967.<br />
Ku h n chrisTian, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> im deutschen Aktienrecht,<br />
Diss. Hamburg 2007 = Schriften zum Handels- und Gesellschaftsrecht<br />
Band 19.<br />
Ku n z Pe T e r V., Aktienrechtsrevision 20xx, in: Jusletter 2. Feb-<br />
ruar 2009. (Zit.: Ku n z, Aktienrechtsrevision)<br />
Ku n z Pe T e r V., Der Minderheitenschutz im schweizerischen Aktienrecht,<br />
Habil. Bern 2001. (Zit. Ku n z, Minderheitenschutz)<br />
li eB i Ma r T i n, Vorzugsaktien, Diss. Zürich 2008 = Schweizer<br />
Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht Band 269.<br />
lo g u e de n n i s e./se W a r d Ja M e s K./Wa l s h Ja M e s P., Rearranging<br />
Residual Claims: A Case for Targeted Stock, Financial<br />
Management, Vol. 25, No. 1, Spring 1996, S. 43 ff.<br />
Me i e r-hay o z ar T h u r, Berner Kommentar zum Schweizerischen<br />
Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-10 ZGB, Bern<br />
1962.<br />
Me i e r-hay o z ar T h u r /Fo r s T M o s e r Pe T e r, Schweizerisches Ge-<br />
sellschaftsrecht, 10. Auflage, Bern 2007.<br />
Me i e r-sc h aT z chrisTian J., Die Zulässigkeit aussergesetzlicher<br />
Rechtsformwechsel im Gesellschaftsrecht, Zeitschrift<br />
für Schweizerisches Recht (ZSR) 5 (1994), S. 353 ff.<br />
Me r K T ha n n o/gö T h e l sT e P h a n r., us-amerikanisches Gesellschaftsrecht,<br />
2. Auflage, Frankfurt am Main 2006.<br />
naT u s c h in g o, «<strong>Tracking</strong> Stock» als Instrument der Beteiligungsfinanzierung<br />
diversifizierter Unternehmen, Diss. Münster,<br />
Köln 1995 = Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung<br />
Band 26.<br />
ne n n i n g e r Jo h n, Der Schutz der Minderheit in der Aktiengesellschaft<br />
nach schweizerischem Recht, Diss. Basel, Basel/<br />
Stuttgart 1974 = Basler Studien zur Rechtswissenschaft Heft<br />
105.<br />
no lT e al e x a n d e r F., <strong>Tracking</strong> Stock Strukturen im US-amerikanischen<br />
und deutschen Aktienrecht, Diss. Berlin 2004 =<br />
Schriften zum Wirtschaftsrecht Band 171.<br />
PF iF F n e r da n i e l chrisTian, Revisionsstelle und Corporate<br />
Governance, Diss. Zürich 2008 = Schweizer Schriften zum<br />
Handels- und Wirtschaftsrecht Band 275.<br />
Pr i n z ul r i c h/sc h ü r n e r ca r l Th o M a s, Rechnungslegung bei<br />
<strong>Tracking</strong> Stock-Strukturen in Deutschland - Grundfragen und<br />
Gestaltungsüberlegungen, Deutsches Steuerrecht (DStR) 18<br />
(2001), S. 759 ff.<br />
ri hM Th o M a s, Die gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen<br />
Aspekte von Unternehmenssegmentsaktien in der Schweiz<br />
(Teil II) - Knacknuss ist das variable Stimmrecht, Finanz und<br />
Wirtschaft vom 1.11.2000 (Nr. 87), S. 19. (Zit: ri hM, s. 19)
Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />
ri hM Th o M a s, Gesellschafts- und kapitalmarktrechtliche Aspekte<br />
von Unternehmenssegmentsaktien (<strong>Tracking</strong> bzw.<br />
Targeted <strong>Stocks</strong>) in der Schweiz - Privatautonomie erlaubt<br />
<strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, Finanz und Wirtschaft vom 28.10.2000 (Nr.<br />
86), S. 49. (Zit: ri hM, S. 49)<br />
si e g e r Jü r g e n J./ha s s e l B ac h Ka i, «<strong>Tracking</strong> Stock» im deutschen<br />
Aktienrecht, Betriebsberater (BB) 25 (1999), S.<br />
1277 ff.<br />
sT e i nB e r g e r er i c a h./ha s s JeFFr e y J., Introduction to <strong>Tracking</strong><br />
<strong>Stocks</strong>, in: Acquisitions, Mergers, Spin-Offs and other<br />
Restructurings, Practising Law Institute (Hrsg.), New York<br />
1993.<br />
Ta n n e r Br i g iT T e, Quoren für die Beschlussfassung in der Aktiengesellschaft,<br />
Diss. Zürich 1987 = Schweizer Schriften zum<br />
Handels- und Wirtschaftsrecht Band 100.<br />
Th i e l sa n d r a, Spartenaktien für deutsche Aktiengesellschaften,<br />
Diss. Berlin, Köln usw. 2001 = Abhandlungen zum deutschen<br />
und europäischen Handels- und Wirtschaftsrecht<br />
Band 126.<br />
To n n e r Ma r T i n, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, Diss. Bonn, Köln usw. 2002<br />
= Abhandlungen zum deutschen und europäischen Handels-<br />
und Wirtschaftsrecht Band 131.<br />
Tr u FFer ro l a n d, Die Sachverständigen zur Prüfung der<br />
Geschäftsführung (Art. 731a Abs. 3 OR), in: Unternehmen-<br />
Transaktion-Recht: liber Amicorum für Rolf Watter zum 50.<br />
Geburtstag, ne d iM P. Vo g T/er i c sT u P P/di eT e r du B s (Hrsg.),<br />
Zürich 2008.<br />
Wu n s c h Th o M a s, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> – Geschäftsbereichsbezogene<br />
Gewinnbeteiligungen bei Aktiengesellschaften, Diss.<br />
Bayreuth, Frankfurt am Main 2002 = Schriften zum Gesellschafts-<br />
und Kapitalmarktrecht Band 4.<br />
Materialienverzeichnis<br />
Botschaft zur Änderungen des Obligationenrechts (Aktienrecht<br />
und Rechnungslegungsrecht sowie Anpassungen<br />
im Recht der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im<br />
GmbH-Recht, Genossenschafts-, Handelsregister- sowie<br />
Firmenrecht) vom 21. Dezember 2007; Bundesblatt (BBl)<br />
2007, S. 1589 ff. (Zit. Bo T s c h a F T aK T i e n r e c hT 2007)<br />
Christophe Scheidegger, MLaw Universität Bern. Der Autor<br />
absolviert momentan das Gerichtspraktikum in Schlosswil,<br />
Kanton Bern.<br />
Vorliegender Beitrag wurde als Masterarbeit bei Prof. Peter<br />
V. Kunz am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Bern<br />
eingereicht.<br />
27<br />
* * *