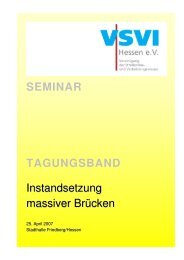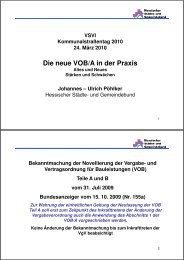Dr.-Ing. Zichner, Dr.-Ing. Duda, KHP Frankfurt - VSVI Hessen
Dr.-Ing. Zichner, Dr.-Ing. Duda, KHP Frankfurt - VSVI Hessen
Dr.-Ing. Zichner, Dr.-Ing. Duda, KHP Frankfurt - VSVI Hessen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
König und Heunisch Planungsgesellschaft<br />
Beratende <strong>Ing</strong>enieure für Bauwesen<br />
<strong>VSVI</strong>-Seminar <strong>Hessen</strong> 2010<br />
Friedberg<br />
26.05.2010<br />
Ertüchtigung der Talbrücken<br />
Döllbach, Salzbach und Sechshelden<br />
<strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. T. <strong>Zichner</strong> / <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. H. <strong>Duda</strong><br />
<strong>KHP</strong> König und Heunisch Planungsgesellschaft mbH & Co. KG · Oskar-Sommer-Str. 15-17 · 60596 <strong>Frankfurt</strong> am Main · HR <strong>Frankfurt</strong> a. M. A 42774<br />
Komplementär: <strong>KHP</strong> Beteiligungsgesellschaft mbH · Sitz wie vor · Geschäftsführer: <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. H. <strong>Duda</strong>, <strong>Dr</strong>.-<strong>Ing</strong>. T. Faust · HR <strong>Frankfurt</strong> a. M. B 75826<br />
Du/Zr/hm<br />
19.4.2010<br />
2.101_FB
<strong>VSVI</strong>-Seminar 2010<br />
Seite 2<br />
1 Allgemeines<br />
Nach der in den Bauwerksunterlagen dokumentierten Tragfähigkeit genügen ca. 65 % des<br />
Brückenbestandes in Deutschland nicht der Brückenklasse 60/30 nach DIN 1072 oder dem<br />
LM1 nach DIN-FB 101. Zur Sicherung des Bestandes und damit zur Aufrechterhaltung eines<br />
funktionstüchtigen Straßensystems müssen diese Bauwerke hinsichtlich ihrer maximal mögli-<br />
chen Tragfähigkeit nachgerechnet werden. Derzeit liegt in Deutschland noch keine auf die<br />
speziellen Anforderungen der Nachrechnung abgestimmte Richtlinie vor. Sie ist noch in Be-<br />
arbeitung, so dass die Nachrechnung zurzeit nach den vorhandenen Normen bzw. Fachbe-<br />
richten erfolgen muss. Abweichungen von diesen Grundlagen bei der Einstufung in eine Be-<br />
lastungsklasse sind daher nur im Rahmen einer "ingenieurmäßigen Beurteilung" der Nach-<br />
rechnungsergebnisse möglich.<br />
Nachfolgend soll auf die Nachrechnung von Brücken eingegangen werden, denen nur noch<br />
eine begrenzte Nutzungsdauer zugewiesen wird, weil sie z.B. in ein künftiges Verkehrsnetz<br />
mit steigenden Verkehrsbelastungen nicht zu integrieren sind. Für die Zeitspanne geht man<br />
von einer verbleibenden Restnutzungsdauer von 15 - 20 Jahren aus.<br />
Die Nachrechnung kann zu einem Ergebnis führen, das einer der drei Kategorien angehört:<br />
- Höhere Einstufung in Bkl 60/30<br />
- Notwendigkeit einer moderaten Ertüchtigung/Verstärkung zur Einstufung in Bkl 60/30<br />
- Erneuerung mit erhöhter Tragfähigkeit (LM1)<br />
Wunschziel ist natürlich, möglichst viele Bauwerke in die erste, mindestens aber in die zweite<br />
Kategorie einordnen zu können. Das ist aber nicht ohne Weiteres möglich, da viele der Brü-<br />
cken noch aus den 50-er bis 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen, für die Nach-<br />
weise aber das bis 2003 gültige Normenwerk zu Grunde zu legen ist.<br />
Grundsätzlich muss der Bearbeitungsumfang bei der Nachrechnung ebenso ausgeprägt sein<br />
wie bei einer Genehmigungsstatik, d.h. die relevanten Nachweise für den Überbau sind in<br />
Längs- und Querrichtung zu erbringen.<br />
Mit dem bis 2003 gültigen Normenwerk ergeben sich einige Verschärfungen bei den Nach-<br />
weisen gegenüber den früher maßgebenden Vorschriften. So ist z.B. der Lastfall Tempera-<br />
turunterschied sowie der Nachweis der Dauerhaftigkeit von Koppelfugen hinzugekommen,<br />
auch wurde der Nachweis der Schubtragfähigkeit umgestellt und bei spannungsrisskorro-<br />
sionsgefährdetem Spannstahl (St 145/160) ein Nachweis des Vorankündigungsverhaltens [1]<br />
eingeführt.
<strong>VSVI</strong>-Seminar 2010<br />
Seite 3<br />
Eine höhere Einstufung ist deshalb nur dann zu erwarten, wenn entweder Tragfähigkeitsre-<br />
serven aus der Bemessung oder aus der Berechnung wegen auf der sicheren Seite liegen-<br />
der Systemannahmen vorhanden sind. Es ist daher von besonderer Bedeutung, das Trag-<br />
verhalten wirklichkeitsnah nachzumodellieren (Krümmung, mehrzellige Kastenquerschnitte,<br />
mitwirkende Plattenbreite, Schiefe im Grundriss), die Spanngliedführung nach den Ausfüh-<br />
rungsplänen einzugeben und den Bauablauf chronologisch nachzubilden. Natürlich kann<br />
diese genauere Berechnung auch zu dem Ergebnis führen, dass die Bemessungsschnittgrö-<br />
ßen nicht günstiger sondern ungünstiger werden.<br />
Bei der ingenieurmäßigen Bewertung der Nachrechnungsergebnisse sollte die Tragfähigkeit<br />
und Standsicherheit höchste Priorität genießen. Bauwerken, die bezüglich Begrenzung der<br />
Zugspannungen und der Mindestbewehrung nicht die Kriterien der Bemessungsvorschriften<br />
erfüllen, aber sonst hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit kein auffälliges<br />
Erscheinungsbild aufweisen, z.B. keine Risse zeigen, sollte nicht allein aus diesen Gründen<br />
eine Höherstufung abgesprochen werden. Diese Forderungen dienen nämlich in erster Linie<br />
als Hilfsmittel, die bei Einhaltung in der Planungs- und Ausführungsphase erwarten lassen,<br />
dass das Bauwerk die Bedingungen zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit und Gebrauchs-<br />
tauglichkeit während der Nutzungsphase erfüllt. Eine Abstimmung mit dem Bauherrn ist bei<br />
dieser Entscheidung unerlässlich.<br />
Sofern die Nachrechnung ein Ergebnis der Kategorie 2 liefert, nach der das Bauwerk mit<br />
moderaten Ertüchtigungsmaßnahmen hochgestuft werden kann, so stehen hierfür zur<br />
Verfügung:<br />
- Ergänzungsbeton (bewehrt, unbewehrt)<br />
- Bewehrter Spritzbeton<br />
- Externe Vorspannung<br />
} Kombination {<br />
ohne Verbund mit Umlenkung<br />
mit Verbund ohne Umlenkung<br />
- Eingeschlitzte CFK-Lamellen.
<strong>VSVI</strong>-Seminar 2010<br />
Seite 4<br />
2 Ausgeführte Maßnahmen<br />
2.1 Döllbachtalbrücke<br />
Die Döllbachtalbrücke überführt südlich von Fulda die BAB A 7 über den Döllbach und meh-<br />
rere Wirtschaftswege. Die Gesamtlänge des über 12 Felder durchlaufenden Spannbeton-<br />
hohlkastens beträgt 576 m, die Feldlängen betragen im Regelfeld 46 m und in einem Son-<br />
derfeld 70 m. Das Bauwerk ist in Abbildung 1 in Längsschnitt und <strong>Dr</strong>aufsicht dargestellt.<br />
Abbildung 1 Döllbachtalbrücke<br />
Die Dauerhaftigkeit der Spanngliedkopplungen ließ sich weder auf Grundlage der Hand-<br />
lungsanweisung [2] noch mit genaueren Rechenverfahren unter Zugrundelegung der Scha-<br />
densakkumulation nach Palmgren-Miner und realitätsnahen Annahmen zur bisherigen und<br />
zukünftigen Verkehrsbelastung der Brücke nachweisen. Je nach Rechenmodell lag die theo-<br />
retisch ermittelte mögliche Gesamtnutzungsdauer der Brücke unter dem in Realität vorhan-<br />
denen Alter des Bauwerks. Zusätzlich wurden Korrosionsschäden an den Längs- und Quer-<br />
spanngliedern und der Betonstahlbewehrung, nicht oder unzureichend verpresste Hüllrohre<br />
sowie offene, wasserführende querverlaufende Risse in der Fahrbahnplatte festgestellt.<br />
Angesichts der oben beschriebenen Situation wurde ein Abbruch und Neubau der Brücke als<br />
technisch und wirtschaftlich sinnvollste Variante gewählt.<br />
Die oben beschriebenen Schäden beziehen sich dem Grunde nach auf die beiden parallel<br />
laufenden Überbauten, wobei der Ostüberbau im Vergleich einen geringfügig besseren Bau-<br />
werkszustand aufweist. Aus diesem Grund wird im ersten Bauabschnitt der Westüberbau<br />
durch einen Neubau ersetzt. Während dieser Bauphase ist eine 4+0 Verkehrsführung auf<br />
dem Ostüberbau erforderlich. Da angesichts des Bauwerkszustandes die Verkehrssicherheit<br />
mit einer 4+0 Verkehrsführung auf dem Ostüberbau nicht sichergestellt war, wurde der Ost-<br />
überbau zunächst durch Vorspannung mit Verbund, Stahlbetonergänzungen und aufgeklebte
<strong>VSVI</strong>-Seminar 2010<br />
Seite 5<br />
bzw. in Schlitzen eingeklebte CFK-Lamellen verstärkt. Diese Maßnahme zielte nur darauf,<br />
die Verkehrssicherheit für eine beschränkte Zeit wieder herzustellen, eine Verstärkung im<br />
Sinne einer Erhöhung der Tragfähigkeit der Brücke war nicht vorgesehen.<br />
Da Zweifel an der Standsicherheit des Bauwerks nicht unbegründet waren, eine Sperrung<br />
der Brücke aber vor Baubeginn als ausgeschlossen anzusehen war, wurde im Sommer des<br />
Jahres 2007 ein umfangreiches Bauwerksmonitoring-System installiert. Die Rissbreiten aller<br />
Koppelfugen und der Querrisse in der Fahrbahnplatte wurden kontinuierlich überwacht. Es<br />
wurden Grenzwerte festgelegt, bei deren Überschreitung automatische Alarmmeldungen<br />
generiert wurden. Durch die durchgeführten Messungen konnte der Bauwerkszustand vor<br />
und nach der Verstärkung sowie die Wirksamkeit der Verstärkung messtechnisch<br />
dokumentiert werden. Die Arbeiten zur Verstärkung wurden im Jahre 2008 abgeschlossen.<br />
2.2 Salzbachtalbrücke<br />
Die Salzbachtalbrücke überführt die BAB A 66 bei Wiesbaden über die BAB A 671, die DB,<br />
den Salzbach und einen Wirtschaftsweg. Die Gesamtlänge des über 5 Felder durchlaufen-<br />
den zweistegigen Plattenbalkens beträgt 304 m, die Feldlängen liegen zwischen 46 m und<br />
70 m. Das Bauwerk ist in Abbildung 2 in Längsschnitt und <strong>Dr</strong>aufsicht dargestellt.<br />
Abbildung 2 Salzbachtalbrücke<br />
Wie bei der Döllbachtalbrücke ließ sich die Dauerhaftigkeit der Spanngliedkopplungen nicht<br />
nachweisen. Zusätzlich wurde spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl verwendet,<br />
50 % der entnommenen Spannstahlproben versagten im Zugversuch spröde. In Teilberei-<br />
chen der Brücke ist weniger Schubbewehrung vorhanden als rechnerisch erforderlich. Der<br />
allgemeine Bauwerkszustand ist aber relativ gut, signifikante Mängel wie Korrosion oder<br />
Risse sind nicht vorhanden. Im Zuge des Ausbaus der BAB A 66 ist mittelfristig eine Verbrei-<br />
terung auf 3 Fahrstreifen je Richtungsfahrbahn vorgesehen. Aus diesem Grund wurde die<br />
Verstärkung auf eine beschränkte Restnutzungsdauer ausgelegt. Hauptziel der Verstärkung
<strong>VSVI</strong>-Seminar 2010<br />
Seite 6<br />
war die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit der Spanngliedkopplungen. Es wurde eine poly-<br />
gonzugförmig geführte Verstärkung mit externen Spanngliedern ohne Verbund ausführt.<br />
Hierdurch konnte zusätzlich die Schubtragfähigkeit verbessert werden. Die Arbeiten wurden<br />
im Jahr 2009 abgeschlossen.<br />
2.3 Talbrücke Sechshelden<br />
Die Talbrücke Sechshelden überführt die BAB A 45 bei Sechshelden über das Dilltal, die<br />
B 277 und die DB. Die Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken je Richtungsfahrbahn mit<br />
einer Gesamtlänge von cirka 912 m bzw. 947 m. Alle vier Teilbauwerke wurden als über 8<br />
bis 10 Felder durchlaufende zweistegige Spannbetonplattenbalken ausgeführt, die<br />
Feldlängen liegen zwischen 32 m und 74 m. Im Grundriss verläuft die Brücke in Kreisbögen<br />
und Klothoiden mit einem kleinsten Radius von 600 m.<br />
Die Problemstellung und die gewählte Lösung sind bei der Talbrücke Sechshelden und der<br />
Salzbachtalbrücke sehr ähnlich. Wieder ist die Dauerhaftigkeit der Spanngliedkopplungen<br />
nicht sichergestellt. Auch die Talbrücke Sechshelden soll mittelfristig beim Ausbau der BAB<br />
A 45 durch einen Neubau ersetzt werden. Auch für dieses Bauwerk wurde eine externe, po-<br />
lygonzugförmig geführte Vorspannung ohne Verbund projektiert. Auf Grund der Grundriss-<br />
krümmung der Brücke müssen die Spannglieder hier aber nicht nur vertikal sondern auch<br />
horizontal umgelenkt werden. Mit der Ausführung der Arbeiten soll in diesem Jahr begonnen<br />
werden.<br />
3 Zusammenfassung<br />
Es wurden drei Bauwerke vorgestellt, bei denen teilweise sehr umfangreiche Verstärkungs-<br />
maßnahmen durchgeführt wurden bzw. geplant sind. Bei allen Bauwerken bestanden Be-<br />
denken im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit der Spanngliedkopplungen, hinzu kamen teilweise<br />
Unterdeckungen der Schubbewehrung, Korrosion und spannungsrisskorrosionsgefährdeter<br />
Spannstahl. Durch den Einbau zusätzlicher Spannglieder und andere Maßnahmen konnten<br />
die Bauwerke so weit ertüchtigt werden, dass sie für die vorgesehene beschränkte Dauer<br />
noch genutzt werden können.
<strong>VSVI</strong>-Seminar 2010<br />
Seite 7<br />
Literatur<br />
[1] Empfehlungen zur Überprüfung und Beurteilung von Brückenbauwerken, die mit vergü-<br />
tetem Spannstahl St 145/160 Neptun N40 vor 1965 hergestellt wurden, Bundesanstalt<br />
für Verkehr, 1993<br />
[2] Handlungsanweisung zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit vorgespannter Bewehrung<br />
von älteren Spannbetonüberbauten, Bundesanstalt für Straßenbau, 8/1998