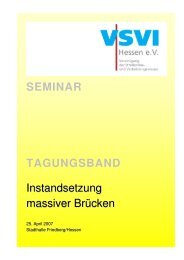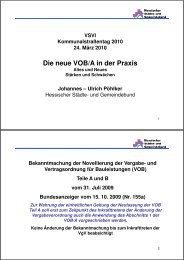PDF File - VSVI Hessen
PDF File - VSVI Hessen
PDF File - VSVI Hessen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Planung und Ausschreibung typisierter Bauweisen<br />
bei der Deutschen Bahn AG<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Agenda<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
1 Überblick Brücken der DB AG<br />
2 Datenbasis und Planung<br />
3 Standardisierungsmöglichkeiten<br />
4 Optimierung der Beschaffung<br />
5 Sonstiges<br />
1<br />
2<br />
Deutsche Bahn AG<br />
Jens Müller<br />
VEC3<br />
Frankfurt, 21.04.2008
Überblick<br />
Anlagenbestand<br />
Brücken erfüllen einen profanen Zweck, keine Strecke von A nach B ohne die<br />
Querung von Tälern, Flüssen und Kanälen bzw. die Kreuzung von Straßen und<br />
Wegen, deshalb besitzt die DB Netz AG z.Zt. ca. 26.800 Eisenbahnbrücken mit<br />
einer Überbaufläche von rd. 9,2 Mio m² (Auszug SAP R/3 Netz Stand Jan 2007).<br />
Die Eisenbahnbrücken stellen eines der größten Anlagenvermögen der DB AG dar.<br />
Um dieses zu erhalten, bedarf es einer gezielten Planung und Steuerung der<br />
Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen.<br />
Zielsetzung<br />
Die Brücken der DB Netz AG müssen nach den quantitativen und qualitativen<br />
Anforderungen der Anwender, sowie den technischen Sicherheitsbelangen auch<br />
zukünftig in gutem funktionsgerechtem Zustand erhalten werden.<br />
Hierfür sind die Brücken unter Beachtung der wirtschaftlicher Grundsätze und dem<br />
Stand der Technik turnusmäßig zu erneuern, bzw. die Stilllegung oder der Rückbau<br />
nicht mehr benötigter Anlagen zu veranlassen.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Altersstruktur der Eisenbahnbrücken<br />
Die älteste noch genutzte Eisenbahnbrücke der DB AG wurde im Jahr 1838 gebaut. In<br />
den nachfolgenden Jahren wurden weitere Gewölbe, Stahl und Stahlbetonbrücken<br />
errichtet. Eine „Blütezeit“ des Eisenbahnbaus war Ende des 19. Jahrhundert was in der<br />
Altersstruktur erkennbar ist.<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
1840<br />
1845<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
1850<br />
1855<br />
1860<br />
1865<br />
1870<br />
1875<br />
1880<br />
1885<br />
1890<br />
1895<br />
1900<br />
1905<br />
1910<br />
1915<br />
1920<br />
1925<br />
1930<br />
1935<br />
1940<br />
3<br />
4<br />
1945<br />
1950<br />
1955<br />
1960<br />
1965<br />
1970<br />
Stahlbrücken Stb / Beton Spannbeton Verbund u. WIB Gew ölbe Sonstige<br />
1975<br />
1980<br />
1985<br />
1990<br />
1995<br />
2000<br />
2005<br />
Der 200 € Schein<br />
zeigt auf der<br />
Rückseite eine<br />
Eisenbahnbrücke,<br />
wie sie zu Beginn<br />
des 20.<br />
Jahrhunderts<br />
überall in Europa<br />
gebaut wurde<br />
Die bilanzielle<br />
Nutzungsdauer von<br />
Eisenbahnbrücken<br />
beträgt 75 Jahre<br />
(Gewölbe/ Rahmen),<br />
ansonsten für den<br />
Überbau 60 Jahre<br />
und Widerlager<br />
90 Jahre<br />
(EBA Fax 326))
Projekt „Brückenstrategie“<br />
Ziel:<br />
Datenbasis erzeugen<br />
Konsolidierte Datenbasis über den Bestand der Eisenbahnbrücken schaffen<br />
Streckenscharfe Vorgehensweise<br />
Erneuerungsbedarf räumlich und zeitlich darstellen<br />
Technische Hebel der Standardisierung ausarbeiten und bewerten<br />
Klärung Anwendung und Anpassung Regelwerk (warum und wieviele Abweichungen)<br />
Beschränkung auf bewährte Bauteile<br />
Ansätze für eine weiterführende Standardisierung (Vorfertigung ermöglichen)<br />
Darstellen eines hohen Brückenpotenziales mit einheitlichen Merkmalen und Definieren von<br />
vertretbaren Abweichungen (incl. Typenstatik)<br />
Beschaffungsprozess für Brücken optimieren<br />
Reduktion der Komplexität des heutigen Beschaffungsprozesses<br />
Frühzeitige Verzahnung von Planung und Beschaffung zur wechselseitigen Optimierung der<br />
Wirksamkeit technischer und kaufmännischer Hebel<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
1 Überblick Brücken der DB AG<br />
2 Datenbasis und Planung<br />
3 Standardisierungsmöglichkeiten<br />
4 Optimierung der Beschaffung<br />
5 Sonstiges<br />
5<br />
6
Datenbasis und Planung<br />
Auf Grundlage der Datenstruktur der DB AG wurde der Erneuerungsbedarf genau definiert.<br />
Die Auswahl wurde mit Hilfe der Systeme BauSys Control, DB Brücken und SAP getroffen. Die<br />
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass alle relevanten Daten, wie Stützweite, Bauform und Bauhöhe<br />
abgeleitet werden können.<br />
Im nächsten Schritt wurde ein Abgleich der Ergebnisse des IST-Zustandes gegen das Bau-SOLL<br />
erstellt.<br />
Die Daten können in der vorliegenden Form zu sinnvollen Cluster zusammen gefasst werden, aus<br />
denen dann eine Pilotanwendung gewählt wird.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Die Längenverteilung zeigt ein deutliches Übergewicht der kurzen<br />
Eisenbahnüberführungen<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
7<br />
8
Die Altersverteilung nach Längengruppen, zeigt dass die kurzen<br />
Eisenbahnüberführungen vergleichsweise alt sind<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Die Beitenverteilung zeigt ein deutliches Übergewicht der zweigleisigen<br />
Eisenbahnüberführungen<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
9<br />
10
Das Längen-Breiten-Portfolio unterstreicht den Bereich der zweigleisigen<br />
Eisenbahnüberführungen bis 15m Länge<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Standardisierungsmöglichkeiten –<br />
Bauarten der „kurzen Spannweiten“<br />
Brückenbestand – Bauwerksart und Stützweite erneuert 1996 – 2000<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
BWA EBR-Typ 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 -10 gesamt i.M.p.a. % i.M.<br />
451 WiB 8 35 37 33 113 23 15,5%<br />
511 Gewölbe 21 23 12 5 61 12 8,4%<br />
531 Vollplatte, Stb. 16 16 11 9 52 10 7,1%<br />
561 Vollrahmen 162 144 61 28 395 79 54,1%<br />
563 Halbrahmen 16 35 36 22 109 22 14,9%<br />
11<br />
223 253 157 97 730 146 100,0%<br />
12<br />
Anzahl
Standardisierungsmöglichkeiten –<br />
Bauarten bis 30 m Spannweite<br />
Datenbasis BauSysControl - Brückenbauwerke Baujahr 1996 oder jünger<br />
min Stützweite<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Walzträger<br />
WiB<br />
Gewölbe<br />
Breiter Balken<br />
2,00-4,00 0 6 1 7 256 0 0 0 1 0<br />
4,01-6,00 3 14 1 10 197 0 0 0 0 0<br />
6,01-8,00 0 9 1 14 123 2 0 0 0 22<br />
8,01-10,00 3 12 0 19 58 0 2 0 0 2<br />
10,01-12,00 1 35 0 14 75 0 1 0 1 0<br />
12,01-14,00 0 32 1 21 71 2 2 1 0 0<br />
14,01-16,00 0 28 1 23 43 4 0 0 0 1<br />
16,01-18,00 0 29 0 15 40 2 0 0 0 1<br />
18,01-20,00 0 22 0 20 12 3 0 0 0 0<br />
20,01-25,00 1 27 0 22 22 6 0 3 0 3<br />
25,01-30,00 0 3 0 13 4 2 3 1 0 0<br />
Standardisierungsmöglichkeiten<br />
Datenbasis BauSysControl - Ergebnisse<br />
Rahmen<br />
13<br />
Der Vollrahmen ist die häufigste derzeit gebaute Bauwerksart in den untersuchten Stützweitengruppen.<br />
Für den Vollrahmen liegt eine Typenstatik für die Stützweiten 2,5 m, 3,0 m und 4,0 m vor (Modul<br />
804.9040), die verlängert werden muss. Planungs- und Einbauhinweise sind zu ergänzen.<br />
Walzträger in Beton (WiB) kommen ebenfalls sehr häufig vor. Hierfür existieren Richtzeichnungen<br />
(Modul 804.9010) und ein Bemessungsmodul (Modul 804.4302).<br />
Neben WIB`s kommen Vollplatten häufig vor.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
14<br />
Vollwandträger<br />
Trägerrost<br />
Dauerbehelf<br />
Fachwerk<br />
Hohlkasten
TP Datenbasis<br />
Datenbasis Feststellungen<br />
Gewölbebrücken, WIB`s und Vollwandträger stellen den größten Teil der<br />
Erneuerungsmaßnahmen dar.<br />
Bei Stützweiten bis 10 m ist der größte Handlungsbedarf.<br />
Widerlager und Pfeiler weisen oftmals eine bessere eine bessere Zustandsbewertung als der<br />
Überbau auf.<br />
Datenbasis MiFri (Mittelfristplanung) - Empfehlungen<br />
In der MiFri sollten die geplanten Brücken mit Bezug auf die zu ersetzende Brücke bezeichnet<br />
werden.<br />
Das Soll der Brücken (z.B Typ, Stützweiten- oder Gradientenänderungen) sollte in der MiFri<br />
angegeben werden.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
1 Überblick Brücken der DB AG<br />
2 Datenbasis und Planung<br />
3 Standardisierungsmöglichkeiten<br />
4 Optimierung der Beschaffung<br />
5 Sonstiges<br />
15<br />
16
Technische Grundlagen<br />
Regelwerk<br />
Richtlinien<br />
Abweichungen von Richtlinien und eingeführten Regelwerken bedürfen einer UiG<br />
(unternehmensinternen Genehmigung), diese müssen hinsichtlich der gleichen Sicherheit<br />
begründet und dokumentiert werden.<br />
Richtzeichnungen stellen praxiserprobte Konstruktionen dar, die angewendet werden sollen<br />
(Empfehlungen), Abweichungen sind vom Anwender begründet zu dokumentieren.<br />
Die Einhaltung der Regelwerke und Anwendung der Richtzeichnungen wird durch den<br />
Bauvorlageberechtigten überwacht.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Vorhandene Standardisierung<br />
Beschränkung auf bewährte Teile<br />
vorhandene Standardisierung, Bauwerke (804.9040)<br />
Für Rahmenbauwerke wurde die Standardisierung bis zur Typenstatik durchgeführt. (muss noch<br />
auf die Vorgaben des DIN- Fachbericht angepasst werden).<br />
vorhandene Standardisierung, Hilfsbrücken (804.9050)<br />
Für nachfolgende Bauteile wurden die Standardisierung bis zur<br />
Typenstatik durchgeführt:<br />
- Zwillingsträger-Hilfsbrücke in Stützweiten 7,2 - 24 m<br />
- Anhängevorrichtung, Oberbaubefestigung, Geländer<br />
- Lagerung, Einbauhinweise<br />
- Zusatzmaßnahmen bei 90 < v £ 120 km/h<br />
- Schwellenersatzträgerverfahren (804.9051)<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
17<br />
18
Vorhandene Standardisierung<br />
vorhandene Standardisierung, Talbrücken (804.9020)<br />
Für die Brückensysteme kurze Talbrücke und lange Talbrücke wurde eine ausführliche<br />
Rahmenplanung mit Detailrichtzeichnungen ausgearbeitet. Eine Typenstatik ist für Bauteile nicht<br />
zielführend.<br />
vorhandene Standardisierung, Module massive EBR (804.9030)<br />
Für nachfolgende Bauteile wurden Standardisierungen bis zur Elementrichtzeichnung erarbeitet.<br />
Eine Typenstatik ist für Bauteile nicht zielführend.<br />
- Bahn- / Schutzerdung<br />
- Kabeltröge, Randkappen<br />
- Übergänge / Fugen<br />
vorhandene Standardisierung, Stahlbrücken (804.9010)<br />
Für nachfolgende Bauwerksarten wurden Standardisierungen bis zur Elementrichtzeichnung<br />
erarbeitet. Eine Typenstatik ist für wegen der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle nicht<br />
zielführend. - Fachwerkbrücken<br />
- Hohlkastenbrücken<br />
- Stabbogenbrücken<br />
- Trogbrücken<br />
- Vollwandträger<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Standardisierungsmöglichkeiten – Analyse von Vollrahmen<br />
Analyse von Vollrahmen - weitere Schritte<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
19<br />
Da Vollrahmen im niedrigen Stützweitenbereich dominieren, wurde untersucht wie sich bei einer<br />
Standardisierung die unterschiedlichen Radsatzlasten auf die Streckenklassen bei der Stahlmenge<br />
der Bewehrung auswirken. Dabei wurde die kleinste (16 t) und die größte (22,5 t) Radsatzlast zu<br />
Grunde gelegt.<br />
Außerdem wurden verschiedene Bauverfahren beim Einbau von Vollrahmen nach den Kriterien<br />
Behelfskosten, Betriebserschwernis und Zeit analysiert (Darstellung bei „Optimierungsmöglichkeiten<br />
im Planungs- und Erstellungsprozess“)<br />
20
Standardisierungsmöglichkeiten – Analyse von Vollrahmen<br />
TP 3 Analyse von Vollrahmen - statischer Vergleich RSL 22,5 zu RSL 16,5<br />
Lichte Weite (L w ) [m]<br />
Dicke (d) [cm]<br />
Verhältnis der Bewehrungseinsparung, wenn jeder<br />
Rahmen einzeln geplant und statisch berechnet<br />
werden müsste (RSLmax. / RSLmin.)<br />
∑M 16,0 / ∑M 22,5<br />
AS 22,5E [cm 2 /m]<br />
Stahlgewicht / m 2 [kg/m 2 ]<br />
Stahlkosten / m 2 bei einem Tonnenpreis von 1000 €<br />
Mehrkosten Stahl bei Bemessung des Rahmens für<br />
RSL 25 statt RSL 16 pro m 2<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
d<br />
Lw<br />
21<br />
2<br />
35<br />
20 %<br />
3,6<br />
2,7<br />
3 €<br />
1 €<br />
Breite = 1,00 m<br />
20 %<br />
10,35<br />
Standardisierungsmöglichkeiten - Analyse von Vollrahmen<br />
13,8<br />
11 €<br />
2 €<br />
19 %<br />
29,0<br />
21,75<br />
Analyse von Vollrahmen – statischer Vergleich RSL 22,5 zu RSL 16,5<br />
Da Vollrahmen im niedrigen Stützweitenbereich dominieren, wurde untersucht wie sich bei einer<br />
Standardisierung die unterschiedlichen Radsatzlasten auf die Streckenklassen bei der<br />
Stahlmenge der Bewehrung auswirken. Dabei wurde die kleinste (16 t) und die größte (22,5 t)<br />
Radsatzlast zu Grunde gelegt.<br />
Die nachfolgende Tabelle ist dabei so zu interpretieren, dass bei einer maximalen Bemessung<br />
(also Radsatzlast 22,5 to) des Rahmens ein entsprechender Mehrpreis an Bewehrung gegenüber<br />
Radsatzlast 16,5 to notwendig sind.<br />
Der Mehrpreis an Bewehrung kann in Kauf genommen werden, da dieser marginal ist.<br />
Als Beispiel für einen 4 m - Rahmen (4,4 m Breite entspricht einem Überbau): Der Stahlmehrpreis<br />
beläuft sich auf ca. 35 €.<br />
Bei einer Standardisierung könnte also immer mit der maximalen Radsatzlast bemessen werden,<br />
was eine erhebliche Vereinfachung bedeutet.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
22<br />
4<br />
35<br />
6<br />
35<br />
22 €<br />
5 €<br />
8<br />
40<br />
18 %<br />
50,3<br />
37,73<br />
38 €<br />
7 €<br />
10<br />
40<br />
17 %<br />
76,5<br />
57,38<br />
60 €<br />
11 €
Standardisierungsmöglichkeiten – Stahlüberbau<br />
Ansätze für eine weiterführende Standardisierung<br />
Geplante Standardisierung, variable Einfeldträger (vEF)<br />
Für einen begrenzten Stützweitenbereich sollen variable Einfeldträger<br />
konstruiert, vorgefertigt und im Bedarfsfall eingebaut werden. Diese vEF<br />
sollen nachfolgende Funktionen erfüllen:<br />
- für eingleisige und mehrgleisige Bauwerke einsetzbar<br />
- prinzipgleich für unterschiedliche Stützweiten<br />
- auf Bahn und Straße transportierbar<br />
- für rationelle Herstellung optimierbar<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Standardisierungsmöglichkeiten – Modularisierten Überbau<br />
Eingleisiger Überbau, mit Randkappe (Querschnitt)<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
23<br />
ÜBERBAU<br />
Der modulare Überbau mit montierter Randkappe, welche sich einfach und schnell montieren lässt.<br />
24<br />
S CHOTTERWAND<br />
KLEMMPLATTE, GUMMIBES CHICHTET<br />
KONS OLE, GUMMIBES CHICHTET
Standardisierungsmöglichkeiten – Modularisierten Überbau<br />
Zwei- und mehrgleisiger Überbau, mit Randkappe (Querschnitt)<br />
Der modulare Überbau als zweigleisiger Überbau mit montierter Randkappe.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
ÜBERBAU<br />
Standardisierungsmöglichkeiten – Modularisierten Überbau<br />
Anbau der Schotterbegrenzung bzw. der Randkappe<br />
Der Überbau mit anmontierter Stützkonstruktion.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
25<br />
26<br />
ÜBERBAU<br />
SCHOTTERWAND<br />
KLEMMPLATTE, GUMMIBESCHICHTET<br />
KONSOLE, GUMMIBES CHICHTET
Standardisierungsmöglichkeiten – Modularisierten Überbau<br />
Anbau der Schotterbegrenzung bzw. der Randkappe<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
SCHNITT B - B<br />
Standardisierungsmöglichkeiten – Überblick<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
27<br />
28<br />
Der Überbau mit<br />
Stützkonstruktion,<br />
Schotterbegrenzung<br />
und kompletter<br />
Randkappe.
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
1 Überblick Brücken der DB AG<br />
2 Datenbasis und Planung<br />
3 Standardisierungsmöglichkeiten<br />
4 Optimierung der Beschaffung<br />
5 Sonstiges<br />
Modularisierten Überbau<br />
Bereits in 2004 wurden Untersuchungen zur Vergabe mehrerer Brücken<br />
durchgeführt<br />
• aus der Industrie sind für einen Piloten 12 Angebote eingegangen<br />
(Grundlage 16m Stützweite, Konstruktion frei wählbar,<br />
der Preis für 1; 5; 10; 20; 30 Überbauten)<br />
• die Stahlbrücken waren (damals)<br />
schon am teuersten<br />
• Spannbetonlösungen waren am<br />
günstigsten<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
29<br />
30
Kostenersparnis durch Bündelung und Standardisierung<br />
Phase 1 Planung<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Einsparungen bei : A) Bündelung B) Standardisierung C) A + B<br />
Entwurfsvermessung nach § 96, § 97 HOAI Einsatzbündelung keine A<br />
Baugrundgutachten nach § 91 ff. HOAI Einsatzbündelung keine A<br />
Objektplanung nach HOAI § 55 / 56<br />
Wiederholungsplanung gem. § 22 Nr. (2) -> 50 (bzw . 60)% Vereinfachung der Planung (vereinheitlichte Bauw erke) - A + B<br />
-> Lph. 3 bis 6<br />
der v.H.-Sätze der Lph.; -> Verkürzung der Planungszeiten > Nutzung von Richtzeichnungen; -> Reduzierg.<br />
Honorarzone ; -> Verkürzung der Planungszeiten<br />
Tragwerksplanung nach HOAI § 64 / 65<br />
bei konstruktiv vergleichb. Tragw erken Anw endg. § 66 HOAI Vereinfachung der statischen Berechnungen -> A + B<br />
-> Lph. 3 bis 6<br />
Nr. (2) u. (3) -> 50 (bzw . 60)% der v.H.-Sätzen der Lph.; Nutzung standard. Berechnungen; -> Reduzierg.<br />
Zeitverkürzung w ie vor<br />
Honorarzone ; -> Verkürzung der Planungszeiten<br />
EBA-Gebühren<br />
keine Vereinfachung des Prüfverfahrens; Verkürzung<br />
B<br />
(Genehmigung, Prüfung, Abnahmen)<br />
Genehmigungszeit<br />
Phase 2 Bauvorbereitung u. -durchführung<br />
Bauvermessung nach § 96, § 98 HOAI Einsatzbündelung keine A<br />
Bauüberwachung nach § 55 HOAI (Lph. 8) i.V.m. §<br />
Überw achungsbündelung Vereinfachung des Überw achungsaufw andes A + B<br />
Baustelleneinrichtung 57<br />
(BE) bei örtlicher Nähe ggf. nur eine BE keine A<br />
Gründung höhere Rabattfaktoren bei Mehrmengen/techn. Synergien Vereinfachung A + B<br />
Widerlager höhere Rabattfaktoren bei Mehrmengen/techn. Synergien Vereinfachung / Bauzeitverkürzung A + B<br />
Überbau höhere Rabattfaktoren bei Mehrmengen/techn. Synergien Vereinfachung und Vorhaltung (Lagerfertigung)<br />
standardisierter Teile möglich; Bauzeitverkürzungen<br />
A + B<br />
Baubehelfe / Betriebskosten ggf. gemeinsame Nutzung von Sperrfenstern möglich ggf. Entfall Baubehelfe; Sperrzeitreduzierungen A + B<br />
zeitabhängige Baustellengemeinkosten (BGK) /<br />
keine Verkürzung der Bauzeit / Verkürzung der Einsatz- u. B<br />
Baustellensicherung inkl. Sipo<br />
Vorhaltezeiten<br />
Phase 3 Unterhaltung / Instandhaltung / (LCC)<br />
Brückenprüfung keine ja B<br />
Instandhaltung / Unterhaltung keine ja B<br />
Untersuchung verschiedene Formen der Beschaffung standardisierter<br />
Brückenbauwerke - Ausrichtung auf Rahmenverträge<br />
Zusammenfassung<br />
wirtschaftlicher Vorund<br />
Nachteile<br />
Normalvergabe<br />
ohne Typenstatik<br />
Vergabe entspr.<br />
Typenstatik als<br />
Einzelvergabe<br />
Rahmenvertrag<br />
(RV) mit Preisstaffel<br />
entsprechend<br />
Stückzahl<br />
Rahmenvertrag<br />
mit fester Stückzahl<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
31<br />
Vorteile Nachteile<br />
• Reaktion auf kurzfristigen Kundenbedarf möglich<br />
• Reaktion auf Materialpreisschwankungen möglich<br />
• Kopplung mit tangierender Maßnahmen, z.B.<br />
Gleisbau<br />
• wie , außerdem<br />
• vereinfachte Einzelplanung und Prüfung<br />
• Senkung Nachtragsrisiken<br />
• erhöhte Kostensicherheit ggü. <br />
• durch Preisstaffel Optimierung bei noch unklaren<br />
Abnahmemengen<br />
• mit RV hohe Kostensicherheit<br />
• vereinfachte Vertragsgestaltung / Reduzierung<br />
AG-seitiger Aufwendungen<br />
• Vorfertigung und Lagerung möglich<br />
• durch feste Stückzahl größtes Einsparpotential<br />
• sehr hohe Kostensicherheit für AG<br />
• vereinfachte Vertragsgestaltung / Reduzierung<br />
AG-seitiger Aufwendungen<br />
• Vorfertigung und Lagerung möglich<br />
32<br />
• wirtschaftliche Einsparpotentiale geringer<br />
• gesonderte Einzelplanung und Prüfung notwendig<br />
• Nachtragsrisiken durch vergessene Leistungen<br />
• geringe Kostensicherheit für AG<br />
• Einsparpotentiale geringer als bei RV<br />
• weniger Kostensicherheit als bei RV, da das<br />
Wettbewerbsergebnis marktabhängig ist (Saisonschwankungen;<br />
Materialpreisschwankungen)<br />
• Bedarf muss frühzeitig mit hinreichender Genauigkeit<br />
(Bandbreite) feststehen<br />
• Reaktion auf Materialpreisschwankungen (Stahlpreis)<br />
eingeschränkt<br />
• Bedarf muss frühzeitig sehr genau feststehen<br />
• ggf. Malus bei Unterschreiten der festen Stückzahl<br />
• Reaktion auf Materialpreisschwankungen wie
Untersuchung verschiedene Formen der Beschaffung standardisierter<br />
Brückenbauwerke - Ausrichtung auf Rahmenverträge (2/2)<br />
Vergleich der 4 Beauftragungsformen nach :<br />
Aufwand bei AG<br />
Marktpreisabhängigkeit / Flexibilität<br />
Mengenabhängigkeit<br />
Kostensicherheit für den AG<br />
- Bedarf frühzeitig bekannt / bzw. gesichert Rahmenvertrag<br />
- Bedarf frühzeitig bekannt / bzw. gesichert Rahmenvertrag<br />
(RV<br />
(RV<br />
mit<br />
mit<br />
fester<br />
fester<br />
Stückzahl;<br />
Stückzahl;<br />
ggf.<br />
ggf.<br />
mit<br />
mit<br />
Bonus-/Malusregeln<br />
Bonus-/Malusregeln<br />
für<br />
für<br />
Mengenänderungen)<br />
Mengenänderungen)<br />
- kurzfristiger individueller Kundenbedarf Einzelvergabe<br />
- kurzfristiger individueller Kundenbedarf Einzelvergabe<br />
(möglichst<br />
(möglichst<br />
unter<br />
unter<br />
Verwendung<br />
Verwendung<br />
von<br />
von<br />
Typenstatiken)<br />
Typenstatiken)<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Vorschläge für Bündelungen und Standardisierungen<br />
33<br />
Kostensicherheit<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Aufwand bei AG<br />
<br />
Preisreduzierung durch<br />
Erhöhung der Abnahmemengen<br />
Zur Verdeutlichung von Bündelungs- und Standardisierungspotentialen wurden beispielhaft<br />
Brückenobjekte in der NL Süd ausgewählt<br />
die bislang verwendete tabellarische Darstellung besitzt nur eine eingeschränkte Aussagekraft<br />
=> visuelle Darstellung in einer Streckenkarte für die weiterführende strategische Planung konkreter Bündelungsund<br />
Standardisierungspakete<br />
( geplant ist: Eintrag der Brückenobjekte in eine genauere Strecken- und Betriebsstellenkarte )<br />
Kartendarstellung auf Basis tabellarischer Daten ist das geeignete Instrument für mehr Übersichtlichkeit<br />
daraus abgeleitet Beispiele für Bündelungs- und Standardisierungspakete<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
34<br />
<br />
<br />
<br />
Bedarfsflexibilität/<br />
Reaktion auf Marktpreis
Stützweiten<br />
4,01 – 4,5 m<br />
4,51 – 5,0 m<br />
5,01 – 5,5 m<br />
5,51 – 6,0 m<br />
6,01 – 6,3 m<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Würzburg<br />
gepl. Baubeginn<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
NL Süd<br />
Lindau<br />
5230<br />
Ulm / Neu-Ulm<br />
5102<br />
Schweinfurt<br />
5910<br />
Bamberg<br />
Fürth<br />
Augsburg<br />
Lichtenfels<br />
Nürnberg<br />
35<br />
Bayreuth<br />
5903<br />
5850<br />
5851<br />
Ingolstadt<br />
Bad Tölz<br />
5633<br />
Lenggries<br />
5505<br />
5510<br />
Hof<br />
Langenbach<br />
(Obb.)<br />
Schirnding<br />
Weiden<br />
Schwandorf<br />
Regensburg<br />
Landshut<br />
5703<br />
Rosenheim<br />
5702<br />
Kiefersfelden<br />
Vorschläge für Bündelungen und Standardisierungen<br />
Beispiele für Bündelungs- und Standardisierungspakete<br />
Stützweiten optimieren ( z.B. Aufrunden von Stützweiten )<br />
Verschiebung der geplanten Zeitfenster ( z.B. Vorziehen der geplanten Baumaßnahmen )<br />
Paketvorschläge:<br />
– Rosenheim - Kiefersfelden 3 Brücken gleicher Stützweite und Baujahr Bündelung (und ggf. Standardisierung)<br />
– Lindau (2 Str.) und Rosenheim (2 Str.) 5 Brücken gleicher Stützweite und Baujahr und 3 Brücken ähnlicher Stützweite<br />
(Stützweite erhöhen auf ) Standardisierung (und Bündelung der Maßnahmen bei Lindau und Rosenheim) + Verschieben<br />
einer Brückenbaumaßnahme bei Rosenheim in das Jahr 2010 und Bündelung mit umliegenden Vorhaben<br />
– Raum Würzburg 9 Maßnahmen in 2010 und zusätzl. 1 Maßnahme in 2009 Verschieben in 2010 und Bündelung;<br />
weiterhin 2 Standardisierungspakete bilden : und durch geringf. Vergrößern der Stützweiten Zusammenfassung + +<br />
– Regensburg - Nürnberg 5 Brücken Baujahr anpassen auf 2009 (Bündelung) und mit Stützweitenanpassung 2 Standardisierungspakete<br />
bilden + und<br />
nächster Schritt:<br />
Prüfung der Umsetzbarkeit der Paketvorschläge mit den Verantwortlichen vor Ort = Workshop mit allen Beteiligten in<br />
der NL München zur Verifizierung der Daten und Klärung der Detailumstände<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
36<br />
5830<br />
Plattling<br />
Freilassing<br />
Passau
Kostenersparnis im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Aufzeigen verschiedener Bauverfahren für die Erstellung eines Rahmens<br />
Nachfolgend werden exemplarisch verschiedene Möglichkeiten für die Erstellung eines Rahmens<br />
aufgezeigt.<br />
Dabei wurden derzeit gebaute Rahmenbauwerke betrachtet. Gleichzeitig wurden Planer nach den<br />
unterschiedlichen Bauverfahren abgefragt.<br />
Dabei wurden die Bauverfahren speziell nach den Kosten für die Betriebserschwernis untersucht.<br />
Dabei wurde berücksichtigt, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit 160 km/h beträgt.<br />
Bei einer Baumaßnahme mit Hilfsbrückeneinsatz muss dabei auf eine zulässige Geschwindigkeit<br />
von 90 - 120 km/h (Hilfsbrückenabhängig) abgebremst werden.<br />
Der durchschnittliche Geschwindigkeitsverlust beträgt etwa 50 km/h, was bei einer<br />
durchschnittlichen Zugbelegung von 6 Zügen pro Stunde ein Fahrzeitverlust von 1 Minute<br />
bedeutet. Pro Tag etwa 20 Minuten, pro Monat etwa 600 Minuten.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Kostenersparnis im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Vergleich von Bauverfahren – B 1<br />
Die Baumaßnahme erfolgt unter der Hilfsbrücke.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
37<br />
Sperrzeiten beim Einbau der Hilfsbrücke, reduzierte Geschwindigkeit durch Hilfsbrücken (v = 90<br />
– 120 km/h), schwierige Bauverhältnisse.<br />
38<br />
Beispiel:<br />
Wuppertal-Vohwinkel, km 109,5
Optimierungsmöglichkeiten im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Vergleich von Bauverfahren – B 2<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Optimierungsmöglichkeiten im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
39<br />
40<br />
Die Baumaßnahme erfolgt<br />
neben der zu erneuernden<br />
Brücke.<br />
Die zu erneuernde Brücke<br />
wird abgebrochen und durch<br />
eine Hilfsbrücke während der<br />
Bauphase ersetzt.<br />
Sperrpausen sind für den<br />
Abbruch der zu erneuernden<br />
Brücke und für den Einschub<br />
notwendig<br />
Während des<br />
Hilfsbrückeneinsatzes muss<br />
die Geschwingigkeit auf 90 –<br />
120 km/h abgebremst werden<br />
Beispiel:<br />
5902, Nürnberg-Schnelldorf, km 68,186<br />
Vergleich von Bauverfahren – B 3 Die Baumaßnahme erfolgt<br />
neben der zu erneuernden<br />
Brücke.<br />
Die Baumaßnahme wird<br />
ohne Hilfsbrücken<br />
durchgeführt. Innerhalb<br />
einer Sperrpause wird ein<br />
Teil der alten Brücke<br />
abgebrochen und ein<br />
neuer Rahmen<br />
eingeschoben.<br />
Vorteile: Minimale<br />
Sperrpausen und keine<br />
Geschwindigkeitsreduzierung.<br />
Beispiel:<br />
5703, Rosenheim-Freilassing, km 56,178
Optimierungsmöglichkeiten im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Vergleich von Bauverfahren – B 3 Ursprungszustand. Überbau als<br />
Vollwandträger und Widerlager sehr<br />
marode (Zustand 4).<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
41<br />
42<br />
Baugrube wurde für Erstellung des<br />
Rahmens ausgehoben. Überbau bleibt<br />
während der Bauphase bestehen<br />
(Vorteil: keine zusätzlichen<br />
Sperrpausen und keine<br />
Geschwindigkeitsreduzierungen).<br />
Schalung des neuen Bauwerkes<br />
(Rahmen) neben dem zu ersetzenden<br />
Überbau.<br />
Fertiges neues Bauwerk mit<br />
Schrägflügeln. Bereit für den Einschub.<br />
Optimierungsmöglichkeiten im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Vergleich von Bauverfahren – B 3<br />
Abbruch des alten Brückenbauwerkes.<br />
Herausheben des Überbaus<br />
(Vollwandträger).<br />
Abbruch des alten Widerlagers.<br />
Verschub eines Vollrahmens in einer<br />
48-Stündigen Sperrpause<br />
(Wochenende).<br />
Fertig eingeschobener neuer Rahmen.<br />
Fertiges Bauwerk mit neuem Oberbau.
Optimierungsmöglichkeiten im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Bezeichnung<br />
B1<br />
B2<br />
B3<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Erläuterung / Bauablauf Vorteile Nachteile Betriebserschwernis Sonstige Kosten<br />
• Bauen am zu ersetzenden Bauwerk<br />
• Verbau und Hilfsbrücke wird eingebaut (Sperrpause<br />
notwendig)<br />
• Bestehende Brücke wird mit Widerlagern unter<br />
Hilfsbrücke abgerissen (Sperrpausen notwendig)<br />
• Widerlager und Brücke werden unter der Hilfsbrücke<br />
erstellt => dadurch verhältnismäßig lange<br />
Bauzeit (erfahrungsgemäß zwischen 9 und 18 Monaten)<br />
• Bauen neben der zu ersetzenden Brücke<br />
• Baumaßnahme wird mit Verbau und Hilfsbrücke<br />
wird eingebaut (Sperrpause notwendig)<br />
• Bestehende Brücke wird mit Widerlagern unter<br />
Hilfsbrücke abgerissen (Sperrpausen notwendig)<br />
• Bauzeit (erfahrungsgemäß zwischen 6 und 12<br />
Monaten)<br />
• Bauen neben der zu ersetzenden Brücke<br />
• Zu ersetzendes Bauwerk bleibt so lange erhalten,<br />
bis neues Bauwerk eingeschoben werden kann.<br />
• Für den Einschub ist eine Sperrpause von 36 – 60<br />
Std. notwendig<br />
• Bauzeit beträgt erfahrungsgemäß zwischen 6 und<br />
12 Monaten<br />
• Wenn nur sehr<br />
kurze Sperrpausen<br />
(bis zu 6<br />
Std.) zur Verfügung<br />
stehen<br />
• Wenn nur sehr<br />
kurze Sperrpausen<br />
(bis zu 6<br />
Std.) zur Verfügung<br />
stehen<br />
• Wenn bestehendesschwierig<br />
abzubrechen<br />
ist<br />
• Neues Bauwerk<br />
ist gut zugäng-<br />
lich<br />
• Neues Bauwerk<br />
ist gut zugänglich<br />
• Betriebserschwerniskosten<br />
verhälnitsmäßig<br />
gering<br />
• Keine Hilfsbrücken<br />
• schwierige Bauverhältnisse<br />
• Geschwindigkeit<br />
muss bei Hilfsbrückeneinsatz<br />
(v = 90 – 120<br />
km/h) abgebremst<br />
werden<br />
• hohe Baukosten<br />
• hohe Zusatzkosten<br />
• Geschwindigkeit<br />
muss bei Hilfsbrücken<br />
(v = 90<br />
– 120 km/h) abgebremstwerden<br />
• hohe Zusatzkosten<br />
• Lange Sperrpause<br />
von 36 bis<br />
60 Std.<br />
43<br />
• durch Sperrpausen (während dieser Zeit Schienenersatzverkehr)<br />
nicht aufgeführt<br />
• durch herunterbremsen (es wird im Mittelwert durchschnittlich<br />
um 50 km/h reduziert)<br />
• dadurch etwa 2 Minuten Fahrzeitverlust pro Stunde<br />
• bei einer Bauzeit von 9 Monaten => 5400 Minuten<br />
Fahrzeitverlust<br />
• der Betrieb gibt die Minute Fahrzeitverlust mit 150 €<br />
an<br />
• Gesamt 150 € x 5400 Minuten = 810.000 €<br />
• durch Sperrpausen (während dieser Zeit Schienenersatzverkehr)<br />
nicht aufgeführt<br />
• durch herunterbremsen (es wird im Mittelwert durchschnittlich<br />
um 50 km/h reduziert)<br />
• dadurch etwa Minute Fahrzeitverlust pro Stunde<br />
• bei einer Bauzeit von 6 Monaten => 3600 Minuten<br />
Fahrzeitverlust<br />
• der Betrieb gibt die Minute Fahrzeitverlust mit 150 €<br />
an<br />
• Gesamt 150 € x 3600 Minuten = 540.000 €<br />
• Während der Sperrpausen ist Schienenersatzverkehr<br />
notwendig<br />
Optimierungsmöglichkeiten im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Optimierungsmöglichkeiten - Ergebnisse<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
44<br />
• Kosten für Hilfsbrücke<br />
belaufen<br />
sich auf etwa<br />
30.000 €<br />
• Kosten für Hilfsbrücke<br />
belaufen<br />
sich auf etwa<br />
30.000 €<br />
Die reinen Baukosten kommen bei einem Bauwerk nur zu einem Teil zum tragen. Im gesamten<br />
setzen sich die Projektkosten aus Planungskosten, Bauwerkskosten, Kosten für Bauhilfsmaßnahmen<br />
sowie Betriebserschwerniskosten zusammen. Die Erfahrung zeigt, dass mit der Wahl des<br />
Bauverfahrens die Gesamtkosten erheblich beeinflusst werden können.<br />
Die verschiedenen Bauverfahren sind sehr unterschiedlich.
Optimierungsmöglichkeiten im Planungs- und Erstellungsprozess<br />
Empfehlungen:<br />
Da die Bauverfahren doch zu einem erheblichen Teil in der Gesamtkostenbetrachtung eine<br />
Rolle spielen, wird empfohlen ein zusätzliches Regelwerk (Modul der Ril 804) zu schaffen, in<br />
welchem Planer verpflichtet werden unter bestimmten Kriterien das günstigste Bauverfahren zu<br />
wählen.<br />
DB Netz und Einkauf sollten in regelmäßigen Abständen untersuchen, ob sich durch örtliche<br />
Bündelungen zusätzliches Ratiopotential durch Einkauf von Bauwerken aus Fertigteilen ergibt.<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
Deutsche Bahn AG,VEC 3<br />
45<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit<br />
46