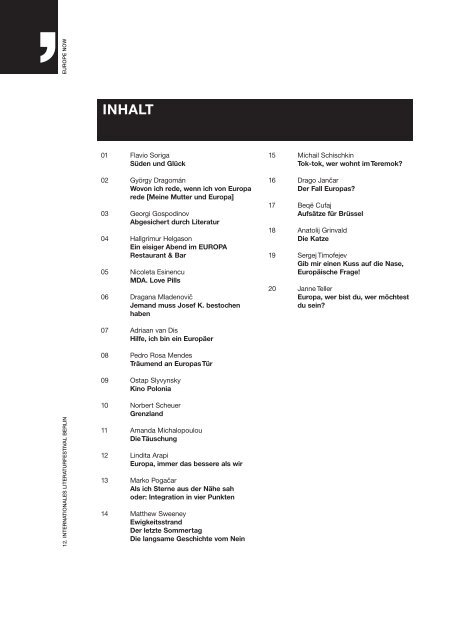Literarischer Rettungsschirm.pdf - Internationales Literaturfestival ...
Literarischer Rettungsschirm.pdf - Internationales Literaturfestival ...
Literarischer Rettungsschirm.pdf - Internationales Literaturfestival ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
INHALT<br />
01 Flavio Soriga<br />
Süden und Glück<br />
02 György Dragomán<br />
Wovon ich rede, wenn ich von Europa<br />
rede [Meine Mutter und Europa]<br />
03 Georgi Gospodinov<br />
Abgesichert durch Literatur<br />
04 Hallgrímur Helgason<br />
Ein eisiger Abend im EUROPA<br />
Restaurant & Bar<br />
05 Nicoleta Esinencu<br />
MDA. Love Pills<br />
06 Dragana Mladenovič<br />
Jemand muss Josef K. bestochen<br />
haben<br />
07 Adriaan van Dis<br />
Hilfe, ich bin ein Europäer<br />
08 Pedro Rosa Mendes<br />
Träumend an Europas Tür<br />
09 Ostap Slyvynsky<br />
Kino Polonia<br />
10 Norbert Scheuer<br />
Grenzland<br />
11 Amanda Michalopoulou<br />
Die Täuschung<br />
12 Lindita Arapi<br />
Europa, immer das bessere als wir<br />
13 Marko Pogačar<br />
Als ich Sterne aus der Nähe sah<br />
oder: Integration in vier Punkten<br />
14 Matthew Sweeney<br />
Ewigkeitsstrand<br />
Der letzte Sommertag<br />
Die langsame Geschichte vom Nein<br />
15 Michail Schischkin<br />
Tok-tok, wer wohnt im Teremok?<br />
16 Drago Jančar<br />
Der Fall Europas?<br />
17 Beqë Cufaj<br />
Aufsätze für Brüssel<br />
18 Anatolij Grinvald<br />
Die Katze<br />
19 Sergej Timofejev<br />
Gib mir einen Kuss auf die Nase,<br />
Europäische Frage!<br />
20 Janne Teller<br />
Europa, wer bist du, wer möchtest<br />
du sein?
,EUROPE NOW<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN<br />
VORWORT<br />
ULRICH SCHREIBER [Festivalleiter]<br />
UND THOMAS BÖHM [Programmleiter]<br />
IN KLEINER MÜNZE<br />
Wer über Europa spricht, erzählt gerne von Großem: einem geeinten Europa, das Vorbild für die ganze<br />
Welt ist, von der nie dagewesenen, andauernden Krise, vom Scheitern der Idee Europas. Nennt exorbitante<br />
Geldsummen, ruft Zeugen, Bürgen, Fachleute herbei. Dabei wird oft die vorhandene, diskriminierende<br />
Darstellung von »Geberländern« und »Nehmerländern« noch verschärft, erleben nationalistische<br />
Vorurteile eine Renaissance, wird die Idee von Europa reduziert auf ein finanzielles Problem.<br />
Angesichts dieser Erzählungen und der Krisenszenarien, die das Sprechen über Europa beherrschen,<br />
entstand eine Idee: Wie wäre es, AutorInnen aus ganz Europa zu einem »literarischen <strong>Rettungsschirm</strong>«<br />
einzuladen? Sie um eine [autobiographische] Geschichte über das Erleben Europas zu bitten, ein<br />
Gedicht, einen Essay – kurz: einen literarisch gestalteten Gedanken, der die Idee Europas pointiert,<br />
um eine Verständigungsebene erweitert, literarische Mittel ins Spiel bringt, die in Ton und Thema europäisch<br />
ist, ohne die Last der dominanten Themen »Krise«, »Bürokratismus« tragen zu müssen.<br />
Texte, die die Leserinnen und Leser dazu einladen, über ihr Europa, ihre europäischen Geschichten<br />
nachzudenken. Diese eigenen Geschichten sind die kleinen »Euro-Münzen«, die jede und jeder von<br />
uns bei sich trägt, für die man allerorts einen Kaffee kriegt, bei dem sich ins Gespräch kommen, die<br />
Geschichten weitererzählen lässt.<br />
Uns kam es auf Vielstimmigkeit, auf Unterschiedlichkeit der Text- und Redebeiträge an. Andere Stand -<br />
punkte als Gewinn zu betrachten, heißt auch: Europa mit den Mitteln der Literatur zu verstehen und<br />
es weiterzuerzählen.<br />
Die Beiträge des literarischen <strong>Rettungsschirm</strong>s werden vom 14. bis 16. September 2012 beim internationalen<br />
literaturfestivals berlin im Rahmen des Fokus »Europe Now« von den Autorinnen und Autoren<br />
vorgestellt und diskutiert – in einem großen europäischen Gespräch.<br />
Wir danken der Stiftung Mercator und der Allianz Kulturstiftung für die Unterstützung und Zusammen -<br />
arbeit in der Realisation dieses Projekts.
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
VORWORT<br />
BERNHARD LORENTZ<br />
PROJEKTNAME »EIN LITERARISCHER<br />
RETTUNGSSCHIRM FÜR EUROPA«<br />
[Geschäftsführer der Stiftung Mercator]<br />
Wenn wir der Berichterstattung Glauben schenken dürfen, steht die große Idee »Europa« kurz vor ih -<br />
rem Ende. Bankenkrise, Schuldenkrise, Staatskrise – nationale Haushalte geraten in die Zahlungsunfähigkeit<br />
und das »Sparen« wird zum neuen Diktum einer ganzen Generation, insbesondere in Südeuropa.<br />
Vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Debatte verwandelt sich die einst so stolze euro<br />
päische Integration in ein Kaleidoskop volkswirtschaftlicher Schlüsselbegriffe, die vor wenigen Jahren<br />
nur ausgebuffte Experten aus dem Ärmel schütteln konnten.<br />
Für mich ist klar: Europa ist mehr als eine Patchwork-Gemeinschaft von Handel, Binnenmarkt, Bankenund<br />
Haftungsunion. Europa ist nicht nur einer der wichtigsten Bezugspunkte deutscher Politik, sondern<br />
auch der zentrale Garant für die individuelle Entfaltung seiner Bürger. Wer kann schon von sich<br />
behaupten, bisher nicht in den Genuss einer der vielen Vorteile des grenzenlosen Kontinents geworden<br />
zu sein? Friedenssicherung, Bildungsförderung und Verbraucherschutz – Europa bietet seinen<br />
Bürgern zahlreiche Errungenschaften. Diese sind allerdings für viele zu einer Selbstverständlichkeit<br />
geworden. Angesicht der aktuellen Herausforderungen gilt es, sich das bereits Erreichte und den da -<br />
mit verbundenen Nutzen bewusst zu machen.<br />
Genau an dieser Stelle möchten wir als eine der großen deutschen privaten Stiftungen wirken. Wir<br />
glauben, dass die Europäische Union weiterhin das bestmögliche Zukunftsmodell für unseren Kontinent<br />
ist. Nur gemeinsam können wir Europäer in einer komplexen multipolaren Welt einen entscheidenden<br />
Beitrag zur Lösung von globalen Herausforderungen leisten. Der jeglicher Träumerei unver -<br />
däch tige Helmut Schmidt hat hierzu kürzlich im Rahmen unserer Kampagne »Ich will Europa« festgestellt:<br />
»Wir Europäer können im globalisierten Weltgefüge nur gemeinsam bestehen, nur gemeinsam werden<br />
wir unsere Werte von Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit behaupten. Die europäische Integration<br />
ist im Interesse aller europäischen Völker. Deshalb müssen wir für Europa kämpfen. Mit Herz, Verstand<br />
und mit dem notwendigen Respekt voreinander.« Um dem wachsenden Desinteresse an Euro -<br />
pa und einem erstarkenden Nationalismus entgegenzuwirken, sind vor allem Zukunftsvisionen notwendig,<br />
die Europa einen Fokus geben und mehr Emotionen wecken.<br />
Der literarische <strong>Rettungsschirm</strong> leistet genau das. Er liefert einen positiven Kontrapunkt zur gegenwärtigen<br />
Krisenrhetorik. Indem seine Autoren ein subjektiv-emotionales Bild über ihr Europa zeichnen,<br />
nimmt die komplexe Idee des europäischen Zusammenwachsens Gestalt an. Europa erfahrbar<br />
machen! Das ist das Ziel der vorliegenden Kollektion von Essays. Die individuellen, teils kritisch-reflektierenden<br />
Zugänge, mit welchen die Autoren dem Europaverständnis gegenüber treten, machen<br />
eines deutlich: Europa ist eben nicht das ferne Gebilde. Es materialisiert sich ganz konkret in der Le -<br />
benspraxis seiner Menschen. Die emotionale Tragweite Europas muss ein jeder Leser für sich selbst<br />
hinterfragen. Wenn der vorliegende Band einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann, ist schon<br />
einiges erreicht.
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
FLAVIO SORIGA<br />
SÜDEN UND GLÜCK<br />
Um diesen Artikel oder Tagebucheintrag oder Erzähl- oder Bekenntnistext zu schreiben, habe ich eine<br />
Tango-CD in die Stereoanlage geschoben. Weil ich aus Buenos Aires bin, auch wenn ich noch nie<br />
einen Fuß in die Stadt gesetzt habe: trotzdem ist sie meine, so, als wäre sie’s. Vor allem nämlich bin<br />
ich aus dem Süden und kenne mich aus mit den Nachmittagen im Viertel Palermo, den Spaziergängen<br />
am Hafen, der wunderbaren Hitze im Hochsommer, wenn du keine Luft mehr kriegst und nur noch<br />
schwitzen und träumen und dich mit einer kalten Wassermelone zum Ausruhen still auf eine Bank<br />
setzen und dir die Zukunft ausmalen kannst, weit weg von hier, woanders, du weißt nicht wo, aber<br />
es gibt sie, noch heißer als hier und schöner denn je.<br />
Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal in Sevilla gewesen und fühlte mich gleich zu Hause: die Kellner<br />
ruppig, die Leute nörgelig, alte Frauen mit dem Rosenkranz in der Hand, die Cafés voll von properen,<br />
melancholischen alten Männern, die Orangen, das Brot, die Tomaten. Ich bin Südländer und ich bin<br />
Europäer und Italiener und Sarde. Jede dieser Zugehörigkeiten ist zugleich wahr und erfunden, wirklich<br />
und erträumt, zufällig und gewollt. Vor allem bin ich Sarde: geboren und aufgewachsen auf einer<br />
großen Insel, zu der ich immer gehören werde, weit weg vom übrigen Italien und von Europa, einer<br />
Insel, von der jahrhundertelang niemand erzählt hat, und als man damit anfing, hieß es, sie sei das<br />
Patagonien Italiens, unermesslich weites, unendlich stilles Land, voll wilder Natur und träger, kränklicher,<br />
wo nicht durch und durch bösartiger Bewohner.<br />
Ich komme von Sardinien und heute, wo die Regierungen vom Norden des Kontinents den Staaten<br />
des Südens alle naselang mit dem Ausschluss aus Europa drohen, merke ich, dass mich diese Drohungen<br />
im Grunde vollkommen kaltlassen: Denn ich bin außerhalb von Europa aufgewachsen. Ich<br />
bin wirklich sehr weit weg von euch aufgewachsen, weiter weg, als ihr euch vorstellen könnt, wie ein<br />
Grieche auf einer der allerkleinsten und gottverlassensten Inseln, wie ein Aborigine, wie eine Rothaut.<br />
Tatsächlich bin ich, auch wenn ich euch jetzt nicht erklären kann warum und weshalb und das bisher<br />
noch niemand geschafft hat, auch wenn ihr diese Idee vielleicht lachhaft findet und vielleicht denkt,<br />
ich übertreibe aus lauter Übermut, tatsächlich bin ich, wie alle Sarden aus den Dörfern Sardiniens,<br />
eine Rothaut. Ein Indianer, aufgewachsen in einem Dorf, das mir vorkam wie ein Gefängnis und natürlich<br />
keines war, sondern ein verwunschenes Gehege, Traum und Wunder, wie in Wahrheit alle, fast<br />
alle Orte, an denen wir aufgewachsen sind, jedenfalls wenn wir uns als Erwachsene, oder noch mehr<br />
im Alter, nur daran erinnern. Ich bin in Uta aufgewachsen, das, vielleicht sagt es schon der Name,<br />
wie ein Sioux-Reservat war, mit den sardischen Rothäuten aus der Campidano-Ebene bei Cagliari,<br />
von Berlin, Rom oder Barcelona Hunderttausende von Kilometern entfernt.<br />
Ich lebe zwar in Rom, bin aber Argentinier, Grieche, Lusitanier und vor allem Sarde, und immer noch<br />
schaue ich auf das Leben als ein Sarde, der in die Welt gezogen ist, mit dieser dunklen, ledrigen Haut<br />
eines stolzen und ein bisschen großspurigen Indianers, mit allen Schwächen und Unsicherheiten<br />
aller Rothäute der Welt. Was also hat Europa mit mir zu tun?<br />
Eine ganze Menge, denn Europa ist, glaube ich, was wir sein wollen, wir alle, die wir in den letzten<br />
vierzig Jahren geboren wurden und aufgewachsen sind mit Erasmus, den Billigflügen, dem Basic<br />
English, das wir allesamt so einigermaßen beherrschen, Inselindianer und Frankfurter Bürger, die sich<br />
die gleiche Musik anhören, im Kino die gleichen Filme anschauen und zum Arbeiten die gleichen Com -<br />
puter benutzen. Es ist etwas sehr Schönes, dass dieses Festival Schriftsteller dazu aufgefordert hat,<br />
über ihre Idee von Europa zu schreiben. Denn Völker werden zwar, das stimmt, durch Währungen ge -<br />
prägt, aber auch durch Geschichten, in denen sie einen Teil von sich wiedererkennen, Geschichten,<br />
die sie dazu bringen, sich als Teil einer Gruppe – beispielsweise eben eines Volkes – zu sehen und zu<br />
fühlen. Für gewöhnlich sind es von den Regierungen bezahlte Schriftsteller, die einige – Tausende und<br />
Abertausende von Menschen – dazu bringen, eine Uniform anzuziehen, ein Gewehr in die Hand zu<br />
nehmen und für Volk und Vaterland [in jeder Sprache großgeschrieben] zu sterben. »Hoch lebe Italien,<br />
Tod den Österreichern!« [Oder den Spaniern, den Russen oder den Deutschen oder wem auch immer,<br />
irgendeinen gibt es immer, den man fürs bedrohte Volk und zum Ruhm des Vaterlandes töten soll.]<br />
Unser heutiges Europa ruft zum Glück niemanden dazu auf, zum Gewehr zu greifen. Aber trotzdem<br />
gibt es unfähige Regierende, bequeme Journalisten und andere Übelwollende, die Slogans brüllen<br />
wie im Krieg, die den vermeintlichen Feinden Vorwürfe entgegenschleudern, verstaubte Begriffe aus<br />
Schlacht und Schützengraben hervorkramen und im Fernsehen reden, als würden sie von einem fa-
FLAVIO SORIGA ,EUROPE NOW<br />
talen Balkon herab eine Ansprache an die Massen halten. Und wir Indianer aus der Provinz, wir Schrift -<br />
steller mit mehr oder weniger lauter Stimme, wir können in unseren Erzählungen und auf den Festivals,<br />
wo wir zu Gast sind, nur immer wieder unsere kleinen, unsicheren Wahrheiten vorbringen. Wäre<br />
ich also in der Nachkriegszeit Schriftsteller gewesen und hätte etwas über die Lage Europas schreiben<br />
sollen, dann hätte ich gesagt, dass niemand die Deutschen anrühren soll. Dass nur ja niemand<br />
denken soll, das unendliche Leid, das eine Gruppe psychotischer Regierender der Welt angetan hat,<br />
müsse vergolten werden, müsse dem Schneider aus Frankfurt, dem Landwirt aus München oder sei -<br />
ner Frau, die zwei Söhne verloren hat, heimgezahlt werden, all den einfachen Leuten, die den Krieg<br />
durchgemacht haben. Dass niemand die in Deutschland lebenden Menschen mit dem deutschen<br />
Volk verwechseln darf. Und wenn ich heute etwas über Europa sagen soll, dann ist es mehr oder<br />
minder dasselbe: dass es kein Volk von Südländern gibt, das in Saus und Braus lebte, während die<br />
fleißigen Völker des Nordens eifrig gearbeitet haben.<br />
Mein Onkel, der sein ganzes Leben in der Fabrik malocht hat, genauso wie ein Arbeiter in Stuttgart,<br />
nur mit weniger Lohn als ein Arbeiter in Stuttgart, mein Onkel hat nicht, wie einige Leute bei der EZB<br />
denken, über seine Verhältnisse gelebt. Er hat nie eine Boutique betreten, nie einen Mercedes gekauft,<br />
sein Haus hat er nach seinen Möglichkeiten gebaut. Mein Vater, der sein ganzes Leben lang italienischer<br />
Staatsangestellter war, ohne je eine Krankheit vorzuschützen, ohne je einen Tag blauzumachen,<br />
mein Vater ist kein reicher italienischer Prasser, der die Ersparnisse der Holländer aufgezehrt hat, Italiens<br />
Bevölkerung ist kein Volk von Nichtstuern, das italienische Volk gibt es nicht: Es gibt Italiener, die<br />
arbeiten und Steuern zahlen, und hartgesottene Steuerhinterzieher, Italiener, die ihre Schulden zurückzahlen,<br />
und ausgekochte Betrüger, nicht anders als in Deutschland, in Portugal und in London.<br />
Es gibt kein tüchtiges deutsches Volk, das sich gegen ein griechisches Volk wehren muss, welches<br />
wiederum für seine Fehler und Mogeleien bezahlen muss, genauso wenig, wie es je ein Volk gegeben<br />
hat, das als Ganzes für die Kriegsverbrechen seiner Regierenden einzustehen hätte: Jeder hat seine<br />
eigenen, persönlichen Fehler und nur für die muss er bezahlen.<br />
Und wenn man ein großes, freundliches, friedliches Vaterland bauen will, ein besseres als die Länder,<br />
an deren Stelle es treten könnte, wenn man so etwas wie ein europäisches Vaterland bauen will, dann<br />
müsste man vor allem eins tun: die Kriegsphrasen, ihre Rhetorik – das Gerede von Griechen gegen<br />
Deutsche, Den-Gürtel-enger-Schnallen, verstärkten Sparanstrengungen, Revanche –, müsste all die se<br />
Kampfblattphrasen ad acta legen. Andernfalls, wenn es Europa nicht geben wird, kehre ich eben in<br />
die Camps in meinem Reservat zurück. Irgendwie werde ich mich mit meinem kleinen Volk auf der<br />
großen Insel schon durchschlagen. Wenigstens werden wir im Sommer ans Meer gehen und in Richtung<br />
Afrika schauen. Wie wir es im Grunde immer gemacht haben.<br />
Uta, 1. August 2012<br />
[Übersetzt aus dem Italienischen von Martina Kempter]
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />
GYÖRGY DRAGOMÁN<br />
WOVON ICH REDE, WENN ICH VON EUROPA<br />
REDE [MEINE MUTTER UND EUROPA]<br />
Meine Mutter steht vor den Trümmern der Mauer am Potsdamer Platz, Hand in Hand mit meinem vier -<br />
jährigen Sohn, und sie heult und heult, so sehr, wie ich sie noch nie heulen gesehen habe, um uns<br />
Touristen, wie wir auch, aber nur meine Mutter weint, ihr Gesicht ist voller Tränen. Sie weint aus Freu de,<br />
aus Wut und aus Trauer, sie weint, weil sie es nicht für möglich gehalten hätte, das einmal zu erleben,<br />
diesen Moment, hier zu stehen, ohne dass es die Mauer gibt, sie weint vor Wut, dass ein so beschis -<br />
senes Stück Beton es geschafft hat, ihr Leben und ihre Jugend zu zerstören, sie weint wegen der<br />
Vergangenheit und der verlorenen, unwiederbringlichen Freiheit, wegen der Hausdurchsuchungen,<br />
der verweigerten Reisepässe, der beschlagnahmten Bücher, der Verhöre, sie beweint den Verlust mei -<br />
nes Vaters, sie weint ihretwegen, meinetwegen. Sie heult, berührt mit der Hand ein Stück Mauer, als<br />
könnte sie es nicht glauben und müsste sie anfassen, um es glauben zu können, dann lässt sie sie<br />
los, dann berührt sie sie wieder.<br />
Wie soll man das erzählen können, dieses Weinen, damit man es versteht und es nicht bloß Jammer<br />
ist, klagender Kummer, sondern schmerzendes Glück, wie damals im September 2006, als meine<br />
Mutter das erste Mal mit ihren eigenen Augen die Spuren der Mauer sah. Meine Mutter blickt mich<br />
an und sagt nichts, das muss sie auch nicht, denn ich verstehe alles, glaube ich zumindest, ich verstehe,<br />
was ich verstehen kann, und so stehen wir da, frei seit fast zwanzig Jahren, freie europäische<br />
Bürger, doch schon ein Stück Beton genügt, um uns an all die Bitterkeit der Gefangenschaft und natürlich<br />
an die alles hinwegfegende Freude der Freiheit zu erinnern.<br />
Meine Mutter weint vor Schmerz und wegen der schlimmen Erinnerungen, und weil es vorbei ist und<br />
wir davongekommen sind. Ich umarme sie. Wir sind davongekommen und doch sind wir es nicht, irgendwie<br />
leben wir immer noch mit der Mauer zusammen, es wird immer so bleiben, wir werden sie<br />
nie vergessen, der Anblick ihrer zerfallenden Reste voller Graffiti wäre gar nicht nötig, wir würden uns<br />
auch so erinnern, jeden Augenblick.<br />
Man muss weinen, denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir hier stehen, mitnichten<br />
notwendig, dass alles so geschehen ist, wie es geschehen ist, wir müssen weinen, weil wir am Le ben<br />
sind. Weil wir frei sein dürfen – ein unbegreifliches und unerzählbares Gefühl.<br />
Für mich bedeutet Europa dies, die plötzliche und immer wieder von Neuem auf mich einstürzende,<br />
unermesslich schwere Freiheit, ich durchlebe sie tagtäglich von Neuem, in kleinen wie in großen Dingen,<br />
ich durchlebe sie, wenn ich eine zweifarbige Zahnpaste auf meine Zahnbürste drücke, wenn ich,<br />
ohne nachzudenken und unumwunden, aussprechen kann, was mir gerade in den Sinn kommt, oder<br />
wenn ich mich an einen Tisch im Café setzen und einen Kaffee bestellen kann und man mir ihn mit<br />
einer Madeleine und einem Glas Wasser tatsächlich auch bringt, lauter Absurditäten, über die ich<br />
selbst lachen muss, ich bin immer noch imstande, beim Anblick der exotischen Früchte auf dem Tresen<br />
eines Supermarkts lange und gerührt dazustehen, so sammle ich die Augenblicke der Freiheit<br />
auf wie Gefangene die halb aufgerauchten Zigarettenkippen, keine einzige lasse ich auf dem Boden<br />
liegen. Ich stehe in der Mitte der Bibliothek und atme den Duft der Bücher und ich weiß, dass sich<br />
in den Regalen alles befindet, was sich dort nur befinden kann, und ich darf entscheiden, was ich<br />
lesen will, keiner schreibt es mir vor, es gibt keine Behörde, die mir vorkauen würde, was ich zu denken<br />
und zu sagen habe, keiner zwingt mich, die Wirklichkeit in die einzige ihm genehme Ideologie zu<br />
übersetzen.<br />
Die Erinnerung an die Diktatur ist wie eine merkwürdige seelische Alzheimer-Krankheit, ich weiß, dass<br />
ich frei bin, doch es ist, als würde ich es immer wieder vergessen, und der Schmerz des Ganzen<br />
stürzt immer wieder auf mich nieder.<br />
Für mich bedeutet Europa Freiheit, bedeutet die Tränen meiner Mutter, es bedeutet, dass sie frei weinen<br />
kann, dass sie aus Freude weinen kann, dass sie nur ihren eigenen Gefühlen ausgeliefert ist und<br />
nicht der Geschichte, höchstens der Erinnerung an sie. Europa bedeutet Glück, ein kitschig rührendes,<br />
für andere vielleicht gar nicht merkliches, langweiliges Glück, das sogar die Auslage einer verwitterten<br />
Zeitungsbude am Stadtrand funkelnd im Grau um sie herum erstrahlen lässt, weil sie die ge -<br />
samte Weltpresse ohne Einschränkung und unzensiert zur Verfügung hat, es bedeutet, dass ich zu<br />
der frisch erworbenen Zeitung morgens um vier eine Zitrone kaufen kann und den Gemüsehändler,<br />
dessen Laden Tag und Nacht geöffnet ist, plötzlich bitten kann, mir zu der Zitrone auch eine Feige<br />
zu geben, die er mir dann auch gibt, Europa bedeutet, dass ich die beiden Früchte in meiner Mantel -
GYÖRGY DRAGOMÁN ,EUROPE NOW<br />
tasche spüre und den noch dunklen Park durchquere und es nicht abwarten kann, nicht abwarten<br />
kann und nicht abwarten will, bis ich zu Hause bin, und sofort in beide hineinbeiße, weil ich hier und<br />
jetzt den aromatischen sauren Geschmack der Zitrone durch ihre bittere Schale hindurch schmecken<br />
will und dazu die hervorbrechende Süße der weichen Feigenkerne.<br />
Das ist unerzählbar. Und doch kann ich von nichts anderem erzählen, wenn ich von Europa reden<br />
will, muss ich immer hier anfangen, wer das versteht, erfasst den Sinn. Wir müssen, wenn wir von<br />
der Rettung Europas sprechen wollen, irgendwo hier anfangen, Europa ist für mich niemals ein geografischer<br />
oder ökonomischer Begriff, für mich wird es stets den Abbau der inneren und äußeren<br />
Grenzen bedeuten, es bedeutet, dass der schon beinahe metaphysische Beweis der Möglichkeit der<br />
Freiheit trotz allem erbracht werden konnte.<br />
Denn mit den Erfahrungen der Diktaturen im Rücken ist es offensichtlich, dass dies der einzige Sinn<br />
von Europa sein kann, die immer wieder von Neuem durchlebte Freiheit, dafür ist das Ganze da, dafür,<br />
dass jeder europäische Bürger sie erlebe. Man darf niemals vergessen, dass das keineswegs<br />
selbstverständlich ist, die Möglichkeit der Freiheit und des Glücks ist nicht selbstverständlich, das<br />
Ziel muss sein, da sie trotz allem entstanden ist, sie irgendwie auch aufrechtzuerhalten.<br />
Wenn ich von Europa spreche, spreche ich von Freiheit. Aber es ist meine Mutter, an die ich denke.<br />
[Übersetzt aus dem Ungarischen von Lacy Kornitzer]
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />
GEORGI GOSPODINOV<br />
SHORT POLITICAL HISTORY OF THE<br />
RADIO SCALE [RADIO-MADE]<br />
[PREWAR EUROPE]<br />
Vienna Bordeau<br />
Luxembourg<br />
Berlin Brussels Paris<br />
Prague Lisbon London<br />
[RADIO 1939]<br />
Warsaw Madrid Turin<br />
Riga Roma Milan<br />
Sofia Budapest Bucharest<br />
Berlin Berlin<br />
Berlin Berlin<br />
Berlin Berlin<br />
Berlin Berlin<br />
Berlin
GEORGI GOSPODINOV ,EUROPE NOW<br />
[AN EASTERN POSTWAR RADIO]<br />
[EURADIO NOW]<br />
м<br />
москва<br />
москва москва<br />
москва москва москва<br />
москва москва москва москва<br />
москва москва москва<br />
москва москва<br />
москва москва москва<br />
москва москва<br />
москва москва<br />
мос ква<br />
Crises Crises Crises<br />
Crises Crises Crises<br />
Crises Crises Crises<br />
Crises Brussels Crises<br />
Crises Crises Crises<br />
Crises Crises Crises
,EUROPE NOW<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN<br />
GEORGI GOSPODINOV<br />
ABGESICHERT DURCH LITERATUR<br />
Mein erstes Europa war ein altes Radio, eines aus Holz. Die Lämpchen, die Namen der Städte, die<br />
weich auf der Skala aufleuchteten. Die Erwartung, wenn ich London einstelle, tatsächlich die Stimme<br />
Londons zu hören – Droschken, Dickens, eine leicht neblige und verregnete Stimme, heiser von<br />
Sherlock Holmes’ Pfeifenrauch. Einmal, als ich ein wenig mit dem alten Radio allein war, stellte ich<br />
London ein und ... nichts. Man hörte nichts. Nur undeutliches Knacken und Rauschen. Europa war<br />
stumm. London existierte nicht. Ebenso wenig Paris, wie ich kurz darauf feststellen musste. Oder<br />
aber wir hatten unser Gehör verloren.<br />
Das Europa meines Vaters bestand aus einem neueren Transistorradio und einer Küche mit einem Rie -<br />
gel an der Tür. Das waren die Minimalvoraussetzungen dafür, dass Europa erschien – ein Transistorradio<br />
und eine abschließbare Küche. Es musste Abend sein. Und es durfte auch niemand in der Nähe<br />
sein oder zumindest durfte der Nachbar nicht lauschen. Nur unter diesen Voraussetzungen, inmitten<br />
von viel Rauschen und Stimmengewirr, ließ sich ein kaum hörbares Freies Europa vernehmen. Am<br />
realsten war das Europa meines Großvaters. Er war ein Glückskind. Ihm sei das Glück in die Wiege<br />
gelegt worden, sagte meine Großmutter immer, die ihn heimlich darum beneidete, dass er die »halbe<br />
Welt« bereist hatte. Die halbe Welt, das waren Serbien und Ungarn während des Zweiten Weltkriegs.<br />
Wahrlich ein Glückskind. Sein Europa stellte ein altes Grammofon mit Trichter dar, das er in einem un -<br />
garischen Haus spielen gehört hatte, zwischen den Kampfhandlungen. Die Leute hörten Musik aus<br />
einem Trichtergrammofon und tranken Tee aus Gläsern, das würde er nie wieder vergessen. Es gelang<br />
meinem Großvater allerdings auch nie, sich ein Grammofon zu kaufen, das heißt sein Traum von<br />
Europa ging nicht in Erfüllung, wie das nun mal mit echten Träumen so ist.<br />
So hatte jeder von uns dreien sein erträumtes und unerreichbares Europa. Ein Europa, das ich mir<br />
anhand der Geräusche aus dem alten Radio und anhand von Dickens, Andersen, Arthur Conan Doyle<br />
und allen Büchern in unserem Bücherschrank zusammenreimte ... Ein Europa, das ich zum ersten<br />
Mal besuchen konnte, als ich einundzwanzig war; die Mauer war gefallen und ich blickte mich voller<br />
Durst um, mit den ganzen angehäuften und unerfüllten Wünschen meiner Kindheit und Jugend. Ein<br />
Europa, das mein Vater als einen Ort der Freiheit erdichtete. Ein Europa, das für meinen Großvater ein<br />
Grammofon mit Trichter und Musik war. Ein Europa, in das er aufgrund des Ausbleibens eines weite ren<br />
Kriegs nicht wieder eingeladen worden war. Unser persönliches, biografisches, erträumtes Europa.<br />
Doch stellen wir jetzt einen anderen Sender ein. Was geschieht, wenn wir das europäische Radio<br />
heute, im Jahr 2012, einschalten? Inzwischen sind alle Radiosender zugänglich, da ist London, da<br />
Paris, da Berlin ... Wollen wir doch einmal hören, was sie auf diesem Sender sagen – aha, die EZB,<br />
dreißig Milliarden, Krise, die spanischen Banken, <strong>Rettungsschirm</strong>, wird es Eurobonds geben? ...<br />
Wechseln wir den Sender ... Eurobonds, <strong>Rettungsschirm</strong>, Krise, die spanischen Banken ... Und du<br />
begreifst, dass du den Sender nicht wechseln kannst.<br />
Jemand hat sich das Mikrofon geschnappt und erzählt in einer unverständlichen Finanz-Bilanz-Banken-<br />
Sprache von Europa, irgendein Abrakadabra aus Fachbegriffen, von denen ich die Hälfte nicht verstehe.<br />
Liquidität, Fiskalität, faule Kredite, Hypotheken, Giro, Stipulant [das sagt mir gleich gar nichts]<br />
usw. Diese Sprache verwirrt mich. Ich stelle mir vor, wie ich den Betreffenden über mittelalterliche<br />
Dichtung abfrage: Tagelieder, Minstrels, Sonettkränze, Stanzen, tonischer und syllabotonischer Versbau.<br />
Etwas in der Welt hat sich verändert, doch die Politiker, die Finanziers und die Eurokraten haben es<br />
nicht mitbekommen ... Etwas, das man nicht mit Fiskalpolitik, auch nicht mit Fiskalordnung, weder<br />
mit Budgetdefiziten noch mit einem makroökonomischen Rahmen messen kann. Mein Finanzminister<br />
versucht, mich über dasselbe Radio zu überzeugen, dass dieser Rahmen bei uns sehr gut sei (trotzdem<br />
sind wir einer der ärmsten Staaten der EU]. Aber mein Leben ist nicht makroökonomisch. Die<br />
heutige Krise ist ein Scheitern just dieser Expertensprache und dieses Expertendenkens. Ja, die<br />
Krise in Europa ist auch eine Krise der Sprache, die wir für sie verwenden. Denn als Philologe weiß<br />
ich, dass wir im Rahmen einer Sprache denken. Denn als Leser weiß ich [von Heidegger], dass die<br />
Sprache das Haus des Seins ist. Aber das, was ich höre, ist nicht mein Haus. Und was in einer abstrusen<br />
makroökonomischen Sprache als Krise beschrieben wird, ist nicht meine Krise. Seltsam ist,<br />
dass jene, die in die Krise verwickelt sind, der Homo oeconomicus, die Leute aus der Finanz, dieselben<br />
sind, die mir jetzt die Krise erklären wollen. Mit derselben Überzeugung, zu wissen, wovon sie
,<br />
GEORGI GOSPODINOV ,EUROPE NOW<br />
sprechen. Ich glaube nicht an überzeugte Menschen. Die Menschen, auf die ich bei meiner Krise ver -<br />
traue, kommen aus dem Bereich der Literatur und der Unsicherheit, des Zögerns und des seelischen<br />
Schmerzes. Denn sie sind die wahren Experten für Krisen, sowohl heute als auch im 20. Jahrhundert.<br />
Ihre Namen sind Pessoa, Kafka, Eliot oder Borges, um nur einige von ihnen zu nennen.<br />
Europa ist viel zu wichtig, um es den Finanziers und Politikern zu überlassen. Der Mythos ist das<br />
Nichts, das alles ist, sagt Pessoa. Dem altgriechischen Mythos zufolge war Europa ein schönes Mäd -<br />
chen, entführt von Zeus höchstpersönlich, der sich in einen weißen Stier verwandelt hatte. Heute<br />
müssen wir uns Europa zurückholen, entführt von einem anderen Stier, dem Stier der Banken [siehe<br />
die Bronzeskulptur in der Wall Street], von Finanzexperten und Eurokraten.<br />
Europa ist ohne das »Nichts« des Mythos unmöglich, ohne das neuerliche Erfinden unseres Verlangens<br />
nach ihm, ohne zumindest ein bisschen Leidenschaft [die des weißen Stiers]. Die Krise ist eine Krise<br />
der Art und Weise, wie wir Europa erdichten, eine Krise unserer Erzählung von Europa. Und hier, wie<br />
immer, wenn die Dinge hoffnungslos werden, können wir sagen: Bühne frei für die Literatur. Nicht zu -<br />
letzt wegen ihrer alten Funktion – um zu trösten, eine Geschichte zu erzählen, die das Ende hinauszögert,<br />
so wie es Scheherazade tut. Das Hinauszögern des Endes ist eine alltägliche und allnächtliche<br />
Angelegenheit, weiß die Literatur. Das geht nicht ein für alle Mal. Es gibt keinen Einmalkredit, der<br />
groß genug wäre, als dass er plötzlich und für immer jede Krise lösen könnte. Aber die Banker und<br />
Politiker lesen Scheherazade nicht oder haben sie vergessen.<br />
Es ist kein Zufall, dass man mitten in Europa auf dem besten Weg ist, das Higgs-Boson zu entdecken<br />
[oder man hat es schon entdeckt, Gott schweigt dazu], dieses verbindende Teilchen, ohne welches,<br />
behaupten die Physiker, unsere Welt in alle Richtungen davonfliegen würde.<br />
Das Defizit an Zukunft wiegt schwerer als das Defizit an finanziellen Mitteln. Das Zur-Neige-Gehen<br />
der Sinnvorkommen ist schlimmer als das Zur-Neige-Gehen der Ölvorkommen. Der Verlust des Traums<br />
von Europa ist irreparabler als der Verfall des Eurokurses. Oder zumindest hängt all das zusammen.<br />
Wir stehen vor Dingen, die man nicht mit wirtschaftlichen Fachbegriffen berechnen kann, die ökonomische<br />
Waage fängt sie nicht ein, auch nicht die fiskalen Apparate, diese Dinge haben keinen Strich -<br />
code. Es gibt keine Möglichkeit, die europäische Trauer, die Freude, den Sinn oder das Gefühl von<br />
Scheitern zu messen ... Hier bedarf es eines anderen Expertentums und einer anderen Bildung. Ich<br />
behaupte, die Literatur weiß mehr über die Krise.<br />
Regierungen kommen und gehen, würde ein heutiges Buch Kohelet sagen. Auch die größten Banken<br />
können Insolvenz anmelden. Sogar Staaten können pleitegehen. Nicht einmal die EU ist von Dauer.<br />
Nur eines kann keinen Bankrott erklären – gute Literatur.<br />
Ich stelle mir eine Literarische Europäische Union vor. Einen Ort, wo Wertpapiere einfach wertvolle<br />
Bücher sind. An den Wertpapierbörsen wird mit Geschichten gehandelt, der Markt ist stabil nach dem<br />
Index von Joyce. Die Wirtschaftsbeilagen der Zeitungen werden zu Literaturbeilagen. Die »Finan cial<br />
Times« wird zur Börsennotierung der gefragtesten Bücher. Die Premierminister der europäischen Staa -<br />
ten diskutieren bei langen nächtlichen Sitzungen die maßgeblichen Tendenzen im spanischen Ro man<br />
und die Rolle der neu aufgenommenen osteuropäischen Literaturen. Angela Merkel rezitiert begeistert<br />
Kavafis’ Gedicht »Warten auf die Barbaren«. Der griechische Regierungschef antwortet mit einem so -<br />
eben von Günter Grass geschriebenen Gedicht. Und die »FAZ« erscheint mit dem Aufmacher »Und<br />
nun, was sollen wir ohne Probleme tun?«, mit dem sie den griechischen Dichter paraphrasiert.<br />
Vom literarischen Bruttoinlandsprodukt her betrachtet katapultieren sich einige Staaten, von denen man<br />
bis vor Kurzem noch der Meinung war, sie befänden sich in Schwierigkeiten, an die Spitze. Irland, Spa -<br />
nien und Griechenland suchen nach Möglichkeiten, um ihre literarischen Überschüsse zu inves tieren.<br />
Ich schalte mein altes Radio aus Holz ein, drehe an den Knöpfen und höre, wie alle europäischen Sen -<br />
der ihre zentralen Nachrichtensendungen mit einem Gedicht beginnen. Ehemalige Banker und Finan -<br />
ziers haben umgeschult und erklären die letzten Börsenbewegungen in Hexametern. Das wird ihr<br />
Fegefeuer sein.<br />
Wenn Sie das heute für unmöglich halten, dann sprechen wir morgen noch einmal darüber. In jedem<br />
Fall besitzt Europa keine dauerhafteren Aktiva als seine Literatur [also gut, seine Kultur]. Europa, abgesichert<br />
durch Literatur.<br />
[Übersetzt aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann]
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />
HALLGRÍMUR HELGASON<br />
EIN EISIGER ABEND IM EUROPA<br />
RESTAURANT & BAR<br />
In den Tagen des Euro-Wahnsinns es war,<br />
Ich war gerade zurück aus fern-fernen Landen:<br />
»Im berühmten Europa Restaurant & Bar<br />
Ist die Lesung«, hat in der Mail gestanden.<br />
Der Taxifahrer – von der Schnauzbartfraktion –<br />
Mit Bleifuß, flucht’ an jeder Ampel extrem<br />
»Ich kennen«, sprach er in mir fremdem Idiom:<br />
»Das Bar, da gibt manchmal Problem.«<br />
Er bog grinsend in eine Sackgasse ein<br />
Geschickt, wie es nun mal nur Ausländer sind,<br />
Griff feixend nach meinem Euroschein,<br />
Der zitterte wie ein Wachslicht im Wind.<br />
In der Bar war’s krachvoll, draußen saß eine Schar,<br />
Laut redend und singend auf Griechisch am Tisch.<br />
Ringsum war es finster, fast wie am Polar-<br />
Kreis, von wo ich grad kam, und man aß Fisch.<br />
Drin war’s ganz gemütlich, schön alt, sehr charmant.<br />
Die Münder voll Wurst, voll Lärm und Gelache.<br />
Jeder Tisch war das Abbild von einem Land,<br />
Und jeder Tisch sprach seine eigene Sprache.<br />
Da dinierte die English-Breakfast-Partei,<br />
Die Schwulen von Finnair bestellten indessen<br />
»Bakaardi Briser«. Aus der Slowakei<br />
Das Pärchen war gerade fertig mit Essen.<br />
An der Bar sprang ein pummliger Kahlkopf auf,<br />
Mit ’nem tiefblauer Button am roten Jackett,<br />
’nem Button mit zig gelben Sternen darauf.<br />
Rief: »Der Dichter ist da! Na, das ist ja nett!«<br />
»Andy Freude, mein Name. Willkommen im Club!«<br />
Er schien halb Deutscher, halb Pitbull zu sein,<br />
Sah aus wie der Wirt von ’nem Irischen Pub.<br />
»Unser Isländer«, rief er, »traf endlich ein.«<br />
»Liest du Isländisch? Ich hol dir ’n Drink! Setz dich her!«<br />
Und obwohl ich das Ganze echt spannend fand,<br />
Dieses wimmelnde, lachende Ländermeer,<br />
Schien mir dennoch die Luft zum Zerreißen gespannt.<br />
Von draußen kam eine mit wehenden Haar<br />
Und ernstem Gesicht, raunt’ dem Kahlkopf ins Ohr,<br />
Der Tisch von Italien sei »pleite - beinah«.<br />
Ich half aus und nahm dann Andys Bierchen mir vor.<br />
»Sorry, Mann! Unser Team, sag ich dir, schont sich kaum,<br />
Ist grenzüberschreitend Tag und Nacht bereit
HALLGRÍMUR HELGASON ,EUROPE NOW<br />
Wir verwirklichen den Europäischen Traum<br />
»Ein Herz, ein Ziel, een gezelligheid«.<br />
»Wir glauben, dass durch den Zusammenschluss<br />
Verschiedener Länder bei verschiedenen Dingen<br />
Die Verschiedenheit sich unterscheiden muss<br />
Von dem, was die Verschiedenen an Unterschied bringen.«<br />
Ich nickte. Hätt fast mich verschluckt um ein Haar.<br />
»Und jeder hier war mit an Bord bei dem Fest,<br />
Als das Schiff unsres Kontinents dieses Jahr<br />
Im Frühling von Brest ist gefahren nach Brest.«<br />
Plötzlich war da ein Kellner, der aufgeregt sprach:<br />
»Die Leute da draußen, die wollen nicht zahlen.«<br />
Gleich sah Andy Freude zum Fenster hin: »Ach!<br />
Und wieso? Was sind denn das für Vandalen?«<br />
Die sagen, sie gehören auch mit zu der Gruppe.<br />
Die Rechnung sagt aber was anderes. Hier steht’s.<br />
Statt wie alle Würstchen zu essen und Suppe<br />
Ham die Pommes bestellt und Steak Béarnaise.<br />
»’s sind die Griechen«, rief die mit den Haaren, den langen,<br />
»sind besoffen«, schrei’n »Kreditklemme, alles es perdü«,<br />
Von Österreichs Flagge glühn rot ihre Wangen.<br />
Drauf der Kellner: »Die sitzen hier schon seit heut früh.«<br />
»Die sagen, ihr Deutschen ihr müsst blechen«,<br />
Beharrte der Kellner und schwang seinen Block.<br />
»Wie unartig, so von Europa zu sprechen ...«,<br />
Rief eisig der Mann im knallroten Rock.<br />
»Warum sollen andre ihr Essen bezahlen?!<br />
Warum nicht sie selbst?! Die gehn mir auf die Nerven!«<br />
»Weil ihnen die Bosse das Reisegeld stahlen.<br />
Darum wollen sie jetzt Knete aus unseren Reserven.«<br />
Worauf Andy Freude sich gar nicht mehr freute.<br />
Die Gusche tiefblau, gelbe Zähnen, recht grob.<br />
Ihm stand’s auf der Stirn: Also, nein, diese Leute ...<br />
Ein Regen aus Schuppen ins All hinauf stob.<br />
Gedankenschwer schwieg er, dann sprach er: »Na schön.<br />
Ich rede mal mit der Angela.«<br />
»Wo steckt sie?« Der Öst’reicher hat sie gesehn,<br />
Bei Nicolas, äh, ich meine ... François.<br />
Im Nu warn sie bei ihnen, alle zusamm’,<br />
Frau Merkel, François, Andy Freude und Co.<br />
Indes von der Theke der Wirt gerannt kam<br />
Für’n Plausch über Staatsanleihen und so.
HALLGRÍMUR HELGASON ,EUROPE NOW<br />
Da kam, bei dem rasch arrangierten Treffen,<br />
Aus der Küche ein kränkliches Kellnerduett,<br />
Das tat große Schüsseln mit die Schokocreme schleppen,<br />
Ein dritter bracht’ Calvados auf dem Tablett.<br />
»Wer bestellte hier Nachtisch?«, rief die Angela streng.<br />
»Bloß Kaffee, kein Pudding!« Sie zog einen Flunsch.<br />
Das Trio blieb stehn: »Na die lustige Gang<br />
Da draußen«, sprach einer, »die hatten den Wunsch.«<br />
»Wir warn doch für Kappung der Reisekosten«,<br />
Die dralle Frau Merkel fast außer sich ruft.<br />
Und das Ausrufezeichen der bitter Erbosten<br />
Jagt jählings die ganze Bar in die Luft.<br />
Sie rennen hinaus und stürmen, o Gott ,<br />
Den griechischen Tisch, dass er beinah fällt,<br />
Man zeigt mit dem Finger [und fasst ins Kompott]<br />
Und schmettert: »Bitte! Wir haben kein Geld!«<br />
Sogleich war verlassen das ganze Europa.<br />
Alle weg, nur der einsame Schriftteller blieb.<br />
Ég fylgdist með og fékk mér annan sopa.<br />
Statt dem Schlachtfeld gibt’s heut den verbalen Krieg.<br />
Da kam Andy Freude zurück. Er schrie: »Sorry!«<br />
Sie hätten ihm beinah die Schulter zerschlagen.<br />
»Wär eigentlich Zeit für ’ne eis-coole Story,<br />
Doch ich fürchte, wir müssen die Lesung vertagen.«<br />
»Dein Honorar kriegst Du natürlich trotzdem.«<br />
Er zog ein Kuvert aus der Tasche. ’s war bloß -<br />
Mir war nicht danach, es anzunehmen,<br />
Doch es nicht anzunehmen, war hoffnungslos.<br />
Dann ging er aufs Klo, und ich fragte den Ober,<br />
Wieviel das auf Griechisch wär, der Betrag.<br />
Der blinzelte. »Dreihundertneunundvierzig«, schnob er.<br />
Ich riss das Kuvert auf und zählte nach.<br />
Es reichte, und wir waren quitt, alles fein.<br />
Der Kellner rennt raus und schreit: »Ist OK!<br />
Ist alles bezahlt!«. Und stürzt gleich wieder rein<br />
Und fragt: »Und mit wessen Portemonnaie?«<br />
Ich spürte, sie wollten mir irgendwas sagen,<br />
Und sprang auf ’nen Stuhl und sagte schnell:<br />
»Wer hat nun gezahlt, und wer wollte nicht zahlen?«<br />
Dazu braucht’s keinen Doktor in VWL.
HALLGRÍMUR HELGASON ,EUROPE NOW<br />
In den Augen, den bunt interkontinentalen,<br />
Stand Verwirrung von sehr egonomischer Art<br />
Was will dieser Eis-Insulaner uns sagen?<br />
Ich aber sprach weiter, einmal in Fahrt:<br />
Eine Lesung kann manchmal viel größ’ren Wert haben<br />
Als Essen, selbst wenn sie nicht stattfand. Ich bin<br />
Geholt worden, um eure Seelen zu laben,<br />
Doch ihr hattet nichts als das Essen im Sinn.<br />
Und jetzt: alles alle, es gibt nur noch das,<br />
Was umsonst ist im Leben. Ich hab gedacht,<br />
Wenn ihr wollt, dann les ich euch trotzdem noch was.<br />
Was, worauf mich euer Gemecker gebracht:<br />
Wir schulden den Griechen alles, was wir wissen,<br />
Obwohl sie selbst alles vergessen haben.<br />
Kein Wunder, dass die nun glauben, wir müssen<br />
Sie jetzt ins Euro-Kaufland einladen.<br />
So ging eine eisige Nacht warm zu Ende<br />
Mit ’nem Gruß von der Dichtung, wie ich hier steh.<br />
Das Wort, heißt die Botschaft, die ich euch sende,<br />
Hat größere Macht als das Portemonnaie.<br />
[Aus dem Englischen von Christa Schuenke]
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />
NICOLETA ESINESCU<br />
MDA. LOVE PILLS<br />
Meine Mutter ist 86 Jahre alt. Sie sagt, sie lebt im Jahr<br />
1975 in der UdSSR. Sie sagt auch, dass ihre Eltern nicht<br />
gestorben sind. Und ich glaube, was meine Mutter sagt,<br />
hat sogar eine gewisse Logik. 1975 waren meine<br />
Großeltern nämlich noch am Leben.<br />
Meine Mutter hatte einen Gehirnschlag.<br />
Meine Mutter lebt im Jahr 1976 in der UdSSR und das<br />
Ganze findet sie eigentlich ziemlich gut.<br />
»Mama, welches Jahr haben wir? Willst du, dass ich es<br />
dir sage?«<br />
»Nicoleta, ganz ehrlich. Das interessiert mich nicht! Ich<br />
will es gar nicht wissen. Ich finde es so sehr gut«,<br />
und meine Mutter klaut immer noch Zigaretten von<br />
meinem Vater.<br />
Damit meine Mutter auch nur die geringste<br />
Überlebenschance hat, braucht der Professor für<br />
Neurochirurgie, der sie operiert:<br />
ein Skalpell, für den Anfang,<br />
er muss es sich selbst aus Deutschland oder Japan<br />
besorgen, oder woher er eben will.<br />
Das letzte Skalpell, das ihm das Gesundheitsministerium<br />
gekauft hat, stammt ungefähr aus dem Jahr, in dem<br />
meine Mutter jetzt lebt.<br />
Damit meine Mutter auch nur die geringste<br />
Überlebenschance hat, braucht der Professor für<br />
Neurochirurgie, der sie operiert,<br />
Titanclips – zwei Stück.<br />
Preis: 400 Euro das Stück<br />
Herstellungsland: Deutschland<br />
»Zwei Clips à 400 Euro«, sagt der Arzt zu mir, »ich hole<br />
sie selber aus Deutschland, damit ich operieren kann.«<br />
Damit du sagen kannst, du bist Arzt, du bist Chirurg und<br />
kannst auch wirklich operieren, bleibt dir nichts anderes<br />
übrig, als dir selbst alles zu kaufen, was du brauchst.<br />
Und außerdem versuchst du, das Ganze mit einem<br />
Gehalt von 300 Euro zu bewerkstelligen. Du versuchst ja<br />
sogar, mit einer Rente von 50 Euro am Leben zu<br />
bleiben – ungefähr so viel Rente bekommt meine Mutter.<br />
Meine Mutter war zehn Tage auf der Intensivstation.<br />
Zehn Tage lang habe ich jeden Morgen und Abend<br />
dieselben Sätze gehört.
NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />
»Bringen Sie flüssige Seife mit, Apfelsaft, Kefir, trockene<br />
Tücher, feuchte Tücher, stilles Wasser, Windeln für<br />
Erwachsene … apropos, Windeln können Sie hier<br />
kaufen, hier auf der Station. Gestern ist jemand<br />
gestorben und die Verwandten haben angefragt, ob wir<br />
sie nicht verkaufen können.«<br />
»Wie viel?«, frage ich, obwohl ich schon weiß, dass ich<br />
wieder meine Windeln kaufe, die Windeln, die ich meiner<br />
Mutter auch gestern mitgebracht habe.<br />
»Gib ihnen ein bisschen Geld, damit immer jemand bei<br />
ihr Wache hält. Weißt du, am häufigsten ersticken sie an<br />
ihrer eigenen Spucke, weil niemand da ist«, sagt eine<br />
befreundete Ärztin.<br />
»Meine Mutter hat eine Krankenversicherung …«<br />
»Ja und?«, die Krankenschwester lacht. »Ich habe auch<br />
eine Krankenversicherung. Glaubst du, ich zahle nicht,<br />
wenn ich zum Arzt gehe? Mein Tipp: Am besten sagst du<br />
gar nicht erst, dass du versichert bist, wenn die sehen,<br />
dass du eine Versicherung hast, dann stehst du erst mal<br />
richtig lange an.«<br />
»Lies mir noch mal vor, was auf der Krankenkarteikarte<br />
unter Geburtsort steht!«, sagt sie weiter lachend.<br />
Krankenkarteikarte<br />
Einweisungsdatum: August 2011<br />
Geburtsort: MDA<br />
Geburtsort: Hmtjaaaah,<br />
denke ich,<br />
das klingt irgendwie unsicher und zwielichtig,<br />
als stünde da<br />
Geburtsort: Brrrr Geburtsort: Hmm<br />
Geburtsort: Oops Geburtsort: Yeah<br />
Geburtsort: Ouch Geburtsort: Phew<br />
Geburtsort: Ey Geburtsort: Shh<br />
Geburtsort: Mmmtjaaa<br />
In Wirklichkeit hat MDA ebenfalls einen Gehirnschlag erlitten.<br />
Ich glaube, dass MDA sogar mehrmals einen hatte.<br />
So lässt sich das jedenfalls aus den Symptomen schließen,<br />
die es zeigt, und aus seinem Verhalten.<br />
Am Anfang waren da<br />
schlimme Kopfschmerzen,<br />
sie kamen zusammen mit der Unabhängigkeit<br />
und dem Verlust von Geld auf dem Knijka-Sparbuch und<br />
dem Zusammenbruch der UdSSR,<br />
mit der FREI-HEIT!!! in lateinischer Schreibweise<br />
und Чемодан! вокзал! Россия! in kyrillische<br />
Cu говори на человеческом языке! , und nur noch
NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />
tiefgekühlte Ananas in allen Geschäften,<br />
dann<br />
plötzlich kamen Sprach- und Verständnisschwierigkeiten.<br />
Sie tauchten in allen Sprachen gleichermaßen auf,<br />
sowohl im Rumänischen als auch im Moldauischen und<br />
Gagausischen,<br />
und die Verständnisschwierigkeiten führten zu einem<br />
Konflikt in Gagausien<br />
und zum Krieg in Transnistrien.<br />
Tod den Kasachen!<br />
Mолдаване быдло!<br />
Die haben uns schon wieder das Gas abgedreht.<br />
Dann folgten Sehprobleme und Schwindelanfälle.<br />
1 Leu = 1000 Coupons.<br />
Wiedererlangung der rumänischen Staatsbürgerschaft<br />
und Verkauf von Vaterlandsrückführungen,<br />
5000 Leute stehen Schlange bei der Eröffnung des<br />
ersten Supermarktes<br />
und Schwarzarbeit in Italien [zu Fuß, mit rumänischem<br />
Pass, mit gefälschtem Pass, mit Sportler- oder<br />
Künstlervisum für Trainingslager oder Tourneen, mit<br />
Touristenvisum – wenn man Glück hat – oder mit einem<br />
anderen Namen im Pass – wenn man kein Glück hat].<br />
Danach kam der Verlust des Gleichgewichts.<br />
Morgens mit den Russen, abends mit den Rumänen,<br />
in between sind wir Moldauer,<br />
neuerdings gehen wir auch in die Kirche.<br />
Morgens in die rumänische Kirche, abends in die<br />
russische.<br />
Manchmal wollen wir in die Europäische Union,<br />
manchmal in die Euroasiatische Union. Aber ginge es<br />
nicht auch in beide? Oder sogar in alle drei? Plus NATO!<br />
Vielleicht verstehen wir uns ja?<br />
Und jetzt<br />
Verwirrung und Bewusstseinsveränderung.<br />
Man geht wählen, um die Verbrechen des Kommunismus<br />
zu verurteilen und die kommunistischen Symbole zu<br />
verbieten, weil die Kommunisten mit 44 Prozent in der<br />
Opposition sitzen,<br />
für das Gesetz der Lustration wird nicht gestimmt,<br />
denn unser Land ist zu klein<br />
und wir wären dann unsere ganze politische Elite los und<br />
die Schriftsteller auch,<br />
das Land braucht doch Helden!<br />
Die Slogans auf den Häuserwänden in der Vorstadt<br />
wechseln jede Nacht.<br />
Moldova ist Rumänien! Rumänien durchgestrichen,<br />
ussland hingeschrieben. Russland durchgestrichen.
NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />
Moldova durchgestrichen.<br />
Meine Mutter lebt im Jahr 1977 in der UdSSR.<br />
Sie klaut Zigaretten von meinem Vater und sagt zu mir,<br />
es wäre wohl an der Zeit, dass ich mich mal wieder<br />
kämme.<br />
Meine Mutter hat noch mal von vorne angefangen. Sie<br />
hat noch mal gelernt, wie man einen Löffel hält, wie man<br />
isst, wie man geht, wie man liest, wie man schreibt, wie<br />
man redet und noch viele andere Dinge, wie man …<br />
Wie man behält, wo man die Zigarette hingelegt hat, die<br />
man meinem Vater geklaut hat.<br />
MDA hat alles vergessen. MDA hat eine gestörte<br />
Wahrnehmung. Aufgrund von Verhaltensstörung und<br />
Denkstörungen hat es alles vergessen.<br />
MDA erinnert sich an nichts und versteht nicht mehr, was<br />
die Russen bei ihm im Land zu suchen haben.<br />
MDA erinnert sich nicht an die Existenz der UdSSR.<br />
MDA erinnert sich nicht daran, wie und wohin die Juden<br />
aus den Dörfern verschwunden sind.<br />
Oder aus Chișinău.<br />
MDA erinnert sich nicht einmal an den Krieg in<br />
Transnistrien.<br />
MDA hat alles aus seinem Gedächtnis gelöscht. Alles,<br />
was ihm nicht gefällt.<br />
Sogar noch mehr.<br />
Im Gegensatz zu meiner Mutter, die behauptet, sie lebt in<br />
der Vergangenheit, ist MDA das Land, das in der Zukunft<br />
lebt.<br />
So steht es zumindest auf den Milchflaschen und auf den<br />
Butterpäckchen, die in MDA hergestellt wurden.<br />
Herstellungsdatum: Oktober 2013.<br />
Meine Mutter lebt im Jahr 1978 in der UdSSR.<br />
Sie klaut Zigaretten von meinem Vater, der immer<br />
vergisst, wo er sie hingelegt hat.<br />
»Mama, was für ein Jahr haben wir grade?«<br />
»1978.«<br />
»Und in welchem Jahr bin ich geboren?«<br />
»Auch 1978«, sagt meine Mutter lachend, »ihr habt<br />
meinen Kopf ganz verdreht.«<br />
Meine Mutter weiß, dass Breschnew Generalsekretär ist,<br />
und trotzdem weiß sie gleichzeitig auch, wer gerade<br />
Präsident der Republik Moldau ist.<br />
Der Präsident,<br />
der Parlamentspräsident,<br />
der Premierminister von MDA<br />
kann,<br />
wer auch immer er ist,<br />
von welcher Partei auch immer,
NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />
einfach alles:<br />
mit dem Autoscooter fahren,<br />
Klimmzüge am Reck,<br />
Lilia aus dem Kinderheim zu sich ins Büro einladen<br />
und ihr einen Fernseher schenken,<br />
vor allem wenn gerade ein Journalist in der Nähe ist,<br />
er kann vor den Wahlen mit einem Geldumschlag und<br />
einer Visitenkarte zu Schauspielern, Schriftstellern und<br />
Müttern mit vielen Kindern gehen,<br />
er kann mit Veteranen Fußball spielen,<br />
weiße Blumen kaufen,<br />
kann vor Julio Iglesias niederknien,<br />
kann auf dem Berg Athos beten,<br />
kann Autos verschenken,<br />
kann Medaillen verleihen,<br />
die nie jemand ablehnt,<br />
»Ich habe diesen Orden wirklich verdient! Mein ganzes<br />
Leben habe ich für dieses Land geschuftet. Warum<br />
sollte ich ihn ablehnen? Vielleicht andere, die ihn nicht<br />
verdient haben.«<br />
– dieses Programm<br />
des Präsidenten,<br />
des Parlamentspräsidenten,<br />
des Premierministers,<br />
wer auch immer er ist,<br />
von welcher Partei auch immer,<br />
heißt<br />
Europäische Integration<br />
und für die Europäische Integration werden die Gesetze<br />
gleich in ganzen Paketen gewählt.<br />
Es unterliegt der Wahl ... Gewählt!<br />
Es tritt in Kraft, sobald es im Gesetzesblatt<br />
veröffentlicht ist.<br />
Bitte nicht zur Kenntnis nehmen: Es wird respektiert,<br />
sobald es im Gesetzesblatt veröffentlicht ist.<br />
In MDA kann man einen Menschen umbringen,<br />
man kann zu einer Haftstrafe von siebzehn Jahren<br />
verurteilt werden,<br />
der Gerichtshof kann von siebzehn auf fünf Jahre<br />
heruntergehen, weil man Geschäftsmann ist und die<br />
Kalaschnikow, mit der man fünf Mal geschossen hat,<br />
LEGAL dabeihatte – neben den anderen hundertzwanzig<br />
Feuerwaffen.<br />
Und solange man auf die Begnadigung durch den<br />
Präsidenten wartet, knipst man ein paar Fotos im Knast:<br />
ein Bild, wie man Fleischspieße grillt; eins, wie man<br />
Whiskey trinkt; eins, wie man Zigarre raucht ...<br />
und, warum auch nicht,<br />
eins, auf dem man die Jacke des Justizobersten trägt,<br />
die Jacke hat man vom Oberst des Gefängnisses
NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />
ausgeliehen.<br />
KommunistenIndenMüll@ hat das Bild kommentiert: Auf<br />
der ganzen Welt herrscht Krise, und der säuft Whiskey<br />
und raucht Zigarre.<br />
NichiforAusGrozești@ hat das Bild kommentiert:<br />
меня кризис не касается, лично мне он даже нравится …<br />
Meine Mutter lebt im Jahr 1979 in der UdSSR.<br />
Sie klaut immer noch Zigaretten von meinem Vater und<br />
versteckt sie in allen Jackentaschen.<br />
»Ich versteh’ nicht ganz ... tu’ ich jetzt Jacken in die<br />
Wäsche oder Zigaretten?«, fragt mein Vater.<br />
Meine Mutter erinnert sich an: Религия это опиум для<br />
народа!<br />
Wir sind auch Christen und haben Werte und Traditionen.<br />
Glaubt ihr, das ist uns egal? Wenn wir in die Europäische<br />
Union wollen, müssen wir auch mal was wählen, was uns<br />
nicht gefällt. Die sind eben nicht Menschen wie wir, aber<br />
wir kommen nicht um das Syntagma der sexuellen<br />
Orientierung herum, wenn wir ein freizügiges<br />
Visumsrecht wollen.<br />
Wenn ihr in unserem orthodoxen Land die Arschficker<br />
wählt und dass sie heiraten, dann werden wir nicht mehr<br />
für euch beten und für eure Familien auch nicht.<br />
Fürchtet den Herrn!<br />
pussyriot@ schrieb: срань, срань, срань Господня!<br />
Wenn ihr den Islam in unserem Land legalisiert, dann<br />
werden wir nie mehr für die Regierung dieses Landes<br />
beten.<br />
OrthodoxerChrist@ schrieb: Habt ihr gesehen, wie Gott<br />
die Japaner gestraft hat, weil die bei sich eine Gay Pride<br />
veranstaltet haben? Wollt ihr, dass die Natur sich auch<br />
gegen euch wendet?<br />
Wenn ihr den Religionsunterricht aus dem Lehrplan<br />
streicht und Sexualkunde einführt, dann sollt ihr und eure<br />
Kinder verflucht sein!<br />
Und gleichzeitig:<br />
Ein sechzehnjähriges Mädchen entschuldigt sich im<br />
Unterricht, geht nach Hause und bringt ein Kind zur Welt.<br />
Sie hat erst bemerkt, dass sie schwanger war, als sie das<br />
Kind bekommen hat.<br />
Der Vater des Kindes ist ihr sechsundzwanzigjähriger
,<br />
NICOLETA ESINESCU EUROPE NOW<br />
Onkel, der seit ihrem zwölften Lebensjahr eine sexuelle<br />
Beziehung mit ihr führt.<br />
MDA ist groß geworden. Es hat Abitur über Torrents<br />
gemacht. Es hat einen Doktor in Copy-Paste.<br />
MDA hat eine Abschlussarbeit geschrieben.<br />
Anzeige: Wir schreiben auf Bestellung<br />
Abschlussarbeiten,<br />
Masterarbeiten, Semesterarbeiten. Die Arbeit wird nach<br />
allen wissenschaftlichen Kriterien fertiggestellt und einer<br />
an den Universitäten der Republik Moldau üblichen<br />
Redaktion unterzogen. Die Arbeiten werden von<br />
Lehrenden aus Rumänien und der Republik Moldau<br />
verfasst. Höchste Vertraulichkeit! Kontakt [Tel.]:<br />
079518874<br />
MDA hat einen rumänischen Pass.<br />
Anzeige: Verkaufe zwei gültige rumänische Pässe ohne<br />
Vermerke. Preis: 400 Euro. Kontakt [Tel.]:<br />
0040749632981<br />
MDA hat Nieren.<br />
Anzeige: Verkaufe eine Niere nach Ihren Wünschen. Ich<br />
bin 22 Jahre alt. Ich bin gesund. Ich verkaufe eine Niere.<br />
Ich habe die Blutgruppe A positiv. Kosten: 15.000 $, aber<br />
wir können noch verhandeln. Kontakt [Tel.]: 068165507<br />
Meine Mutter lebt im Jahr 1980 in der UdSSR.<br />
Sie klaut meinem Vater Zigaretten, aber sie vergisst,<br />
auch das Feuerzeug zu klauen.<br />
»Mal sehen, was sie in den Nachrichten bringen«, sagt<br />
sie, um ihn abzulenken.<br />
Zehnjähriges Kind erhängt aufgefunden.<br />
Vierzehnjährige hat sich erhängt.<br />
Ein Dreizahnjähriger wurde erhängt vorgefunden.<br />
Seine Eltern sind zum Arbeiten nach Russland<br />
gegangen.<br />
Die Eltern sind zum Arbeiten nach Italien gegangen.<br />
Er ist bei den Großeltern aufgewachsen, da die Eltern<br />
zum Arbeiten im Ausland sind.<br />
Unsere Mutter hat auf die Kinder aufgepasst, sagen die<br />
Nachbarn.<br />
Sie hatten immer etwas zum Anziehen und zu essen.<br />
Die Verwandten sagen, dem Jungen habe es an nichts<br />
gefehlt, da seine Eltern ihm regelmäßig Geld schickten.<br />
Die Eltern schicken alles regelmäßig.<br />
Hunderttausende von Minibussen, beladen für ihre<br />
Kinder. Regelmäßig.<br />
Millionen von Päckchen und Paketen. Regelmäßig.<br />
So kommunizieren wir mit unseren Kindern. Regelmäßig.<br />
Über Päckchen. Regelmäßig. Voll mit allem Möglichen.
,<br />
NICOLETA ESINESCU EUROPE NOW<br />
Mit Süßigkeiten und Spielsachen. Voller Pesto und Pasta.<br />
Mit Panettone und Geld.<br />
Geld für die Prüfungen und das Abitur, für die Diplome<br />
und Abschlussarbeiten.<br />
Regelmäßig. Und Briefe auch regelmäßig.<br />
Дражеле меле, Ноуэ таре ни-й дор де вой. Деграбэ о<br />
сэ веним акасэ. Яка май стрынжем олякэ де бань ши<br />
не ынтоарчем. Ла дынший ый кризис. Да пе ной ну не<br />
о афектат. Ной трэим бине. кяр дакэ ши ной авем<br />
паспорт ромынеск пе ной аичь ну не принеск ка пе<br />
ромынь. адикэ ну не зиче нимень кэ сунтем цигань.<br />
кэ ной сунтем май бэлэйорь. Ши ну арэтэм кэ авем<br />
паспорт ромынеск. арэтэм нума пе чел молдовенеск.<br />
Ши де аста не респектэ. кэ ной сунтем май пресус.<br />
кяр ку кытева капурь май сус декыт италиений. Ной<br />
кяр ши лимба лор о штим. Таре самэнэ ку а ноастрэ.<br />
Ла ной ый бунэ зиуа ла дынший се зиче бон жорно. Да<br />
яка руший ничь пынэ азь лимба ноастрэ но ынвацат.<br />
Тата востру о зыс кэ яка о сэ се ынтоаркэ ши се фаче<br />
примар. Ши о сэ конструяскэ чя май маре касэ де ла<br />
ной дин сат. Таре ний дор де сат. Таре ний дор де<br />
касэ. Де Патрия ноастрэ. Де Патря мамэ кум с-ар<br />
зиче. Патрия аста ый ка ун наркотик. Тот тимпу ай<br />
невое ай невое. Ну те поць дезбэйра. вой сэ фиць<br />
куминць. Наркотише сэ ну луаць ши сэ аскултаць де<br />
буника. аичь ынкей мика ме скрисоаре. мама ши тата<br />
востру. Ши сэ цинець минте Патрия ну поате фи<br />
луатэ пе тэлпиле пантофилор. Нэстика спер кэ ну о<br />
крескут аша репеде кишиору ши о сэць винэ<br />
пантофий маримя 34.<br />
MDA ist wirklich eine Droge.<br />
Eine Droge mit psychoaktiver Wirkung, Love Pills, ein<br />
Derivat des Amphetamins MDA löst im Subjekt einen<br />
Zustand besonderer Offenheit für die Umwelt und der<br />
Selbsterkenntnis aus. Er manifestiert sich in einem<br />
besonderen Interesse für zwischenmenschliche<br />
Beziehungen.<br />
Es existieren Gegenanzeigen bei MDA-Konsum:<br />
Muskelverspannungen [besonders im Halsbereich],<br />
nächtliches Zähneknirschen, unnormales und unstetes<br />
Verhalten, Delirium, temporäre Amnesie,<br />
neuropsychische Verwirrung. Es wurden auch Todesfälle<br />
gemeldet.<br />
Regelmäßige Einnahme von MDA ist<br />
charakteristischerweise begleitet von:<br />
1. psychischer Abhängigkeit – »craving«, dem intensiven<br />
Wunsch, die Wirkungen der psychoaktiven Substanz<br />
noch einmal zu erleben,
,<br />
NICOLETA ESINESCU EUROPE NOW<br />
2. Toleranz – das heißt der Notwendigkeit bedeutend<br />
höherer Dosen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen,<br />
3. körperlicher Abhängigkeit – der Organismus arbeitet<br />
nicht mehr normal ohne die regelmäßige Einnahme der<br />
Substanz,<br />
4. Entzugserscheinungen – treten auf bei der<br />
Herabsetzung der Drogendosis,<br />
5. Halluzinationen.<br />
Die Behandlung fordert den Entzug der Droge,<br />
im Bedarfsfall die Unterstützung der Atmungsorgane,<br />
die Vergabe von Substituten,<br />
beispielsweise eines anderen Landes.<br />
Meine Mutter lebt im Jahr 1981 in der UdSSR.<br />
»Moldova ist Rumänien«, sie liest die Schrift auf unserer<br />
Hauswand laut vor.<br />
»Mmmtjaaa«, sagt sie lächelnd, »Moldova ist Rumänien.<br />
Rumänien ist Ungarn,<br />
Ungarn ist Österreich,<br />
Österreich ist Deutschland,<br />
Deutschland ist Polen,<br />
Polen ist die Ukraine,<br />
die Ukraine ist Moldova.«<br />
»Und wie heißen die alle zusammen?«<br />
»Das kannst du nennen, wie du willst. Manche sagen<br />
dazu Sowjetunion! Andere sagen Europäische Union!«,<br />
sagt sie und holt eine Zigarette aus der Jackentasche.<br />
»Willst du Feuer?«<br />
»Hab’ ich selber.«<br />
Meine Mutter klaut Zigaretten von meinem Vater<br />
und erinnert sich sehr gut daran, wo sie sie versteckt.<br />
[Übersetzt aus dem Moldawischen von Eva Ruth Wemme]
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />
DRAGANA MLADENOVIĆ<br />
JEMAND MUSS JOSEF K.<br />
BESTOCHEN HABEN<br />
Gelegentliche Sommerurlaube in Griechenland einmal ausgenommen, habe ich die Länder der Euro -<br />
päischen Union erst im Alter von zwanzig Jahren betreten. Das war im Jahr 1997, das in der Bundes -<br />
republik Jugoslawien [SRJ], oder besser gesagt in den Resten der einstigen großen SFRJ [Sozialistischen<br />
Föderativen Republik Jugoslawien], so elend war. Dem Jahr waren die finstersten Tage der<br />
neueren serbischen Geschichte vorausgegangen – sinnlose Kriege und entsetzliche Verbrechen. Der<br />
serbische Alltag war in diesen Tagen von Isolation, Geldmangel, Inflation, Stromsparen, Visum-Bürokratie,<br />
von Schlangen beim Warten auf Grundnahrungsmittel, von ständiger Indoktrinierung durch die<br />
Medien und von Studentendemonstrationen geprägt…<br />
Zu dieser Zeit reisten nur reiche Leute [für die das Milošević-Regime in der Regel kein Problem darstellte],<br />
dann Leute mit einem Ticket nur in eine Richtung, junge Männer, die vorübergehend vor der<br />
Einberufung flüchteten, Flüchtlinge aus Kroatien und Bosnien oder diejenigen, denen es gelungen<br />
war, einen Platz bei einer günstigen Gruppenreise zu ergattern. Ich zählte zu den Letzteren. Von Belgrad<br />
fuhr ich mit etwa vierzig Oberstufenschülern und ihren Lehrern mit dem Bus los. Ich kannte kei -<br />
nen von ihnen.<br />
In der Reiseroute war die Besichtigung von Wien, Paris, Mailand, Verona und Venedig in sieben Tagen<br />
enthalten. Da meine Pilgerfahrt nach Europa hauptsächlich im Bus stattfand, versuchte ich, die hormonellen<br />
Störungen meiner Teenager-Reisegefährten und ihre entsetzliche Turbofolk-Tortur als »all in -<br />
clusive« aufzufassen. Neben mir saß ein Professor für serbische Sprache und Literatur, der, wie ich<br />
später erfahren habe, so oft von Kafka sprach, dass ihm die Schüler den Namen Josef K. verpasst<br />
hatten. Da er schweigsam war, überraschte mich seine heftige Reaktion darauf, dass der Fahrer von<br />
jedem Fahrgast eine Mark verlangte, da das Benzin über Nacht teurer geworden war und er nicht vor -<br />
hatte, 50 Mark aus eigener Tasche zu bezahlen.<br />
»Wie unterstehen Sie sich, Kinder auszurauben! Der Preis wurde im Vorhinein vereinbart! Lassen Sie<br />
den Blödsinn!«, schrie Professor K. Der Fahrer blieb aber stur. Um die Reise so schnell wie möglich<br />
fortzusetzen, hatten wir die verlangte Summe schnell beisammen. Josef wollte nicht daran teilnehmen.<br />
»Wenn man im Modergeruch lebt, stinkt man irgendwann selbst danach«, meinte er wütend. Von<br />
meiner Heimat habe ich kurz vor der Grenze zu Ungarn Abschied genommen, in der Kabine eines<br />
türkischen Klos, an dessen Tür »Serbien bringt mich um« stand. Obwohl es auf der Toilette weder<br />
warmes Wasser noch Seife, noch Papierhandtücher gab, musste man für die Benutzung natürlich<br />
bezahlen. Ich hatte mir etwas anderes gewünscht.<br />
Wenn ich in diesem Moment mein erstes Erlebnis von Europa wieder zum Leben zu erwecken versuche,<br />
fallen mir ständig die Windräder auf dem Weg nach Wien ein, von denen es damals weniger gab als<br />
heute, und Toiletten, die, je weiter wir in die entwickelte Welt vordrangen, immer mehr sensorische<br />
Möglichkeiten boten. Den stärksten Eindruck hinterließ jedoch eine warme Raststätte am Fuße der<br />
Alpen. Es war dunkel, die Luft war kalt und herb. Wir machten etwa eine Viertelstunde halt. Das Motel<br />
oder die Gaststätte oder das Geschäft, oder was immer dieses hübsche Holzhäuschen war, war beleuchtet<br />
und warm. Alles darin war sehr gemütlich. Es roch nach Kaffee und Zimt und die Regale wa -<br />
ren prall gefüllt mit bunten Waren. Ungeachtet all dessen, was ich in den nächsten Tagen auf meiner<br />
ersten Europareise sehen sollte, blieb dieser Raum in meinem Bewusstsein das Symbol für diese fei -<br />
ne, wohl versorgte und nach menschlichen Maßstäben geschneiderte Union.<br />
Josef K. verbrachte die alpine Pause im Bus. Ich war sicher, dass er sich schlafend gestellt hatte.<br />
Vierzehn Jahre später. Weder ist Serbien so, wie es unter dem Milošević-Regime war, noch haben sich<br />
unsere Hoffnungen zur Gänze erfüllt. Den Mund voll Europa, die Ohren voll Kosovo. Die Verwaltung,<br />
die alles bremst, die Bestechungsgelder, die alles beleben. Der Polizist hat das Vergehen für 20 Euro<br />
nicht gesehen, der Arzt hat die Hüfte nicht operiert – 300 Euro, die Krankenschwester hat die Wun -<br />
de nicht verbunden – 50 Euro sind zu wenig, der Ankläger hat die Akte nicht versteckt – 1000 Euro,<br />
der Richter hat keinen Freispruch verkündet – 1500 Euro, keiner hat die Prostituierte auf der Brücke<br />
gesehen, keiner hat sie auch nur angerührt. Den Mund voll Kosovo, die Ohren voll Europa.<br />
Mein Mann und ich eilen durch die Straßen von München. Um 17 Uhr fährt der Bus nach Belgrad. Wir<br />
beeilen uns im naiven Glauben, dass auch dieser Bus, wie alle Züge, mit denen wir Deutschland bereist<br />
haben, pünktlich sein wird. Die Bahnsteige befinden sich unten, im Untergeschoss des Gebäu-
DRAGANA MLADENOVIĆ ,EUROPE NOW<br />
des. Es ist dunkel, wir schauen uns verstohlen um. Es stehen zwielichtige Gestalten herum. Ein mus -<br />
kulöser Glatzkopf mit einer schweren Halskette, eine betrunkene, männlich wirkende Dame, junge<br />
und alte Frauen, ihre Männer, Koffer, die kaum zugegangen sind, Umarmungen, jene, die wegfahren,<br />
die, die sich von ihnen verabschieden …<br />
»Gastarbeiter«, flüstere ich meinem Mann zu; er bedeutet mir aber, still zu sein. Vom unterirdischen<br />
Bahnhof fahren nur zwei Busse ab. Der eine nach Kroatien, der andere nach Serbien. Beide fahren<br />
um 17 Uhr los. Beide haben Verspätung. Ein junger Mann in leuchtend gelber Weste, einer vom Busunternehmen,<br />
wiederholt ständig:<br />
»Leute, habt ein bisschen Geduld, der Bus kommt gleich!«<br />
»Gibt es sicher genug Platz für alle?«, fragt ein Mann mit Geheimratsecken.<br />
»Wenn Sie eine Fahrkarte haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen«, versichert ihm der<br />
leuchtend gelbe Bursche.<br />
Wir warten, schweigen und spähen in die Dunkelheit. Der leuchtend Gelbe überbringt in der Rolle des<br />
Fahrdienstleiters die Nachricht: »Der Bus nach Kroatien kommt in zehn Minuten, der nach Serbien in<br />
einer halben Stunde. «<br />
»Gibt es aber wirklich genug Platz?«, fragt wieder der Geheimrat.<br />
»Na, sicher.«<br />
Eine Stunde später kommt auch unser Bus. Während wir die Koffer abgeben, hören wir den Typen<br />
abermals fragen, ob es im Bus genug Platz für alle gebe. Wir müssen lachen; was für eine Nervensäge!<br />
Beim Einsteigen zeigt sich allerdings, dass der Geheimrat nicht grundlos besorgt war. Wir se -<br />
hen, dass nur einzelne Sitze frei sind, das heißt, dass mein Mann und ich uns trennen müssen. Es<br />
ist eine lange und womöglich nicht sehr angenehme Fahrt. Wir sind schon zu sehr im Verzug. Der Fah -<br />
rer beruhigt meinen Mann:<br />
»Gleich nach der Grenze steigen eine Frau und ihr Sohn aus, dann kriegen Sie Ihre Plätze …«<br />
Wütend setze ich mich auf den ersten freien Sitz. Mein Mann sitzt irgendwo vorne. Nie wieder mit dem<br />
Bus, nie wieder – ich versuche mich zu beruhigen. Dann schaue ich nach links, zu meinem Sitznach -<br />
barn. Ich bin erstaunt. Das ist doch Josef K.!<br />
»Entschuldigen Sie«, sage ich, »sind Sie nicht vielleicht Serbischprofessor an einem Belgrader Gymnasium?«<br />
»Nein!«, entgegnet er grob.<br />
»Verzeihen Sie. Ich hatte das Gefühl, dass wir schon einmal zusammen gereist sind …«<br />
»Sie haben mich sicher mit jemandem verwechselt.«<br />
»Vielleicht«, sage ich und weiß, dass es nicht stimmt. Diese Haltung, diese Arroganz, diese Stimme.<br />
Josef K., Professor Josef K.!<br />
Ich muss lächeln und sehe, dass auf den kleinen Bildschirmen der Vorspann eines idiotischen serbischen<br />
Films erscheint, von einem jener Filme, die man ohne Gehirn versteht. Ich kann die Pause kaum abwar -<br />
ten, um meinem Mann zu erzählen, was für einen Reisegefährten wir da haben. Das ist keine Kleinigkeit.<br />
Wir fahren durch das Dunkel.<br />
Plötzlich beginnt der halbe Bus unruhig hin- und herzurutschen. Die Leute greifen nach ihren Geldbörsen,<br />
die Münzen klingeln. Ich frage eine füllige Dame in meiner Nähe, was los sei.<br />
»Jetzt geht der Plastikbecher herum. Da muss man drei Euro für die ungarischen Zöllner reinwerfen.<br />
Besser, wir geben es ihnen, als dass sie uns traktieren.«<br />
Bei der Abgabe seiner drei Euro knirscht Josef K. mit den Zähnen.<br />
Ein Jahr später. Ich habe in der Zeitung etwas Erstaunliches gelesen.<br />
»Jovan Krstić, Professor an einem Belgrader Gymnasium, verlangte von der Mutter einer Schülerin<br />
200 Euro für eine positive Note. Die Frau hatte das Treffen mit ihm mit dem Handy gefilmt und die<br />
Aufnahme an unsere Redaktion geschickt. Die Polizei hat immer noch nichts unternommen.«<br />
Der Modergeruch ist echt ansteckend.<br />
[Übersetzt aus dem Serbischen von Jelena Dabić]
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />
ADRIAAN VAN DIS<br />
HILFE, ICH BIN EIN EUROPÄER<br />
Wo kann ich offiziell Europäer werden? Gibt es eine Behörde, wo ich meinen niederländischen Pass<br />
ein tauschen kann? Nicht, weil ich nicht mehr in meinem Land leben möchte. Ich liebe den niederländischen<br />
Himmel, seine Wolken und die Dünen. Ich schreibe auf Niederländisch. Aber ich will zu<br />
einer größeren Welt gehören. Und vor allem keine Angst vor ihr haben. Ich will raus aus meinem Kä fig.<br />
Mangels Weltbürgerschaft entscheide ich mich für Europa. Als ersten Schritt. Die Münzen brennen<br />
schon in meinem Portemonnaie. Jetzt will ich auch einen echten europäischen Pass haben, eine euro -<br />
päische Krankenversicherung und europäische Steuern zahlen.<br />
Die Niederlande galten lange als gastfreies und offenes Land. Ein Klischee, an das auch wir gern<br />
glauben wollten. Der große Historiker Johan Huizinga beschrieb unser Land als ein Haus, offen für<br />
die Anerkennung des »Werts des Fremden« (»Nederland’s Geestesmerk«, 1934]. »Wir haben alle Fen -<br />
ster unseres Hauses offen stehen und lassen den See- und den Landwind frei hindurchblasen.« Jahr -<br />
hundertealte Handelskontakte, mit unseren Nachbarn und mit Übersee, haben uns mit dem Fremden<br />
vertraut gemacht. Die Niederlande existieren dank der freien Grenzen. Kontakt mit dem Fremden hat<br />
unser geistiges Leben bereichert und am wichtigsten: Wir haben damit viel Geld verdient.<br />
Nationalismus war bis vor Kurzem nie salonfähig in meinem Land. Es zeugte von gutem Geschmack,<br />
ein bisschen spöttisch von seinem »kleinen, nassen Froschländchen« zu sprechen. Obwohl in der Ver -<br />
kleinerung sicher auch Stolz mitschwang. Nach einem langen Frieden konnten wir ohne patriotische<br />
Prahlerei zurechtkommen. Die Niederlande begrüßten Europa wegen des Profits. [Polen, die zusahen,<br />
wie ihr Land in Kriegen aufgeteilt wurde, und die ihre Freiheit und Unabhängigkeit einem politisch ge -<br />
einten Europa verdanken, denken garantiert anders darüber.] Meine Familie konnte jahrhundertelang<br />
gehen und stehen, wo sie wollte. Ich stamme aus einem Geschlecht von Bauern und Soldaten der<br />
Kolonialtruppen – Knechtschaft haben wir nie gekannt. Sehr wohl aber Knechte.<br />
Zu Hause habe ich den distanzierten Blick auf die Niederlande erlernt. Dazwischen liegt ein Krieg.<br />
Meine Mutter ist eine Bauerntochter aus Brabant, die mit 22 Jahren 1932] einen Offizier des Königlich<br />
Niederländischen Indischen Heers heiratete. Das Wort »Indonesier« war damals kaum bekannt;<br />
das Land war noch nicht unabhängig. Der erste Ehemann meiner Mutter wurde damals herablassend<br />
als »Eingeborener« bezeichnet. Meine Mutter hatte über die Farbgrenze hinweg geheiratet. Für eine<br />
Frau etwas ziemlich Einzigartiges. Auch in den Augen der Holländer in der Kolonie. Sie würdigten meine<br />
Mutter keines Blickes, weil sie sich mit ihrer Heirat gesellschaftlich außerhalb der europäischen Gemeinschaft<br />
gestellt hatte. Aber auch die einheimische Bevölkerung misstraute ihr. In ihren Augen gehörte<br />
meine Mutter zur Kolonialmacht – das heißt zu den Besatzern.<br />
Der Zweite Weltkrieg traf auch die niederländische Kolonie am Äquator. Japan marschierte ein und<br />
alle Europäer wurden in Lagern interniert. [Außer den Deutschen, denn die gehörten zu einer befreun -<br />
deten Macht.] Der Mann meiner Mutter gründete eine Widerstandsgruppe und entschied sich für<br />
Königin und Mutterland. Schwülstige Worte, die zu seinem Status gehörten: ein auserwählter, dunkler<br />
Sohn von den Banda-Inseln, der in den Niederlanden eine hohe militärische Ausbildung erhalten<br />
hatte. [Er war einer von noch nicht einmal zehn einheimischen Offizieren.] Die Japaner sperrten ihn<br />
ein und schlugen ihm den Kopf ab.<br />
Nach dreieinhalb Jahren Internierung in einem japanischen Konzentrationslager auf Sumatra kehrte<br />
meine Mutter mit drei schönen braunen Töchtern in die Niederlande zurück. Eine frischgebackene<br />
Witwe, aber noch einmal schwanger von einem anderen Soldaten, der sie ein bisschen zu wirkungsvoll<br />
getröstet hatte. Ich wurde das Friedenskind. Mein Vater ging als Weißer durch, aber die koloniale<br />
Familie, aus der er stammte, hatte über die Jahrhunderte immer wieder mal sichtbar einen dunklen<br />
Anstrich abbekommen.<br />
Meine Mutter musste fünf Jahre lang für die Anerkennung ihres ersten Mannes kämpfen. Er war ein<br />
Widerstandsheld, aber in den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man sich nicht vorstellen,<br />
dass ein »Eingeborener« sich auf die Seite der Niederlande geschlagen hatte. Die Indonesier<br />
hatten sich doch nach dem Krieg massenhaft gegen die niederländische Kolonialmacht gestellt und<br />
einseitig die Unabhängigkeit ausgerufen. Nein, Braun war die Farbe des Verrats.<br />
Diese Kränkung und ihre in den Tropen gemachten Erfahrungen auf der anderen Seite der Farbgrenze<br />
brachten meine Mutter dazu, anders auf Holland zu schauen. [Leute aus den Kolonien sprachen nie
ADRIAAN VAN DIS ,EUROPE NOW<br />
von den Niederlanden, immer nur von Holland.] Es gab nur ein Volk, das im Krieg gelitten hatte, und<br />
das waren die Holländer. Und sie waren allesamt im Widerstand gewesen [obwohl mehr Niederländer<br />
freiwillig der SS beitraten als in irgendeinem anderen europäischen Land]. Und jeder von ih nen hatte<br />
Juden gerettet [obwohl mit Unterstützung der niederländischen Polizei und der Niederländischen<br />
Staatsbahnen mehr Juden deportiert wurden als sonst wo in Westeuropa.] Ja, die Holländer! Wer<br />
wollte schon zu den Holländern gehören. Wir nicht! Mein Vater spie das Wort aus. [Holländer: wooden<br />
shoes, wooden heads, wooden manners. Ein geflügeltes Wort bei uns zu Hause.] Dieselben Holländer<br />
hatten ihm, als er nach dreieinhalb Jahren Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit völlig entkräftet<br />
den Militärdienst quittierte, noch die Rechnung für eine abhandengekommene Uniform ge schickt. Er,<br />
der mit nichts als einem Lendenschurz aus dem Lager kam. Die Holländer!<br />
Meine Schwestern emigrierten schon bald. Die Niederlande waren ihnen fremd. Mein Vater starrte jah -<br />
relang nervenkrank aus dem Fenster und verzehrte sich nach seiner Geburtstadt Surabaya. Er starb<br />
als gebrochener Mann, ich war zehn Jahre alt. Und ich blieb mit einer Mutter zurück, die bis zu ihrem<br />
hundertsten Geburtstag an den Holländern herumkrittelte. Die Holländer. Ich bin einer von ihnen.<br />
Durch und durch. Aber nicht von Herzen. Und jetzt will ich auf meine alten Tage Europäer werden.<br />
Wann habe ich mich zum ersten Mal als Europäer gefühlt? Nicht auf Reisen in Europa, da war ich<br />
immer Niederländer. In Afrika? Nein, dort war ich weiß. In China? Dort gehörte ich zu den Westlern.<br />
Mein europäisches Bewusstsein begann sich zu entwickeln, als ich 1984 als fellow des Marshall<br />
Fund sechs Wochen mit einer Gruppe young upcoming European intellectuals durch die Vereinigten<br />
Staaten von Amerika reisen durfte. Zwei Franzosen, zwei Deutsche, eine Dänin und ich. Die Dänin<br />
war eine bekannte Fernsehjournalistin, beliebt in ihrem Land, schwanger und bewusst unverheiratet.<br />
Die Amerikaner, bei denen wir unterkamen – oft gastfreundliche Familien in der Provinz – konnten es<br />
gar nicht fassen: eine schwangere Person des öffentlichen Lebens. Ohne Ehemann! Akzep tierten ihre<br />
Zuschauer das denn? Ja. Aber in Amerika, versicherte man uns damals, wäre das garantiert unmög -<br />
lich. Bei einem Arbeitsfrühstück mit den Lyons in Arkansas sprachen die anwesenden Damen sogar<br />
mit Empörung über diese Schande.<br />
Die dänische Lebenseinstellung kam mir total normal vor. Die Deutschen dachten nicht anders darü -<br />
ber. Nur die Franzosen fanden es gewagt, aber akzeptabel. Das Unverständnis der Amerikaner riss<br />
die Grenzen zwischen Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Dänemark nieder. In Arkansas<br />
fühlte ich mich zum ersten Mal als Europäer.<br />
Zurück in den Niederlanden, flaute dieses Bewusstsein wieder ab. Ich machte eine Reise nach der<br />
anderen und suchte für meine Bücher eine Kulisse in Südafrika, Mosambik und New York. Ich wurde<br />
wieder weiß und in mehr oder weniger ausgeprägtem Maße zum Niederländer. Bis ich 2003 nach<br />
Paris umzog – nicht aus negativen Gründen. Es war ein alter Traum, ich wollte schon immer in einer<br />
echten Weltstadt leben und unsichtbar sein; für mich eine Voraussetzung, um schreiben zu können.<br />
In Paris wurde ich mehr zum Niederländer, als ich es je gewesen war. Selbst zum Bataver. Die Pariser<br />
rieben es mir fast täglich unter die Nase, dass ich nicht dazugehörte. Der bürokratische Weg, den<br />
ein Ausländer, der sich in Paris niederlassen möchte, zurücklegen muss, ist steinig. Allein schon der<br />
Papierkram: Was ich alles für die Bank, die Miete, Gas und Licht, für Telefon und fürs Finanzamt ausfüllen<br />
musste. [Die Franzosen bezeichnen Bürokratie nicht umsonst als »milles feuilles«, tausend Blätter.]<br />
Europa mit all seinen Brüsseler Gesetzen bestand den Praxistest noch nicht. Banken berechneten<br />
unberechtigte Gebühren, wozu sie nach den Brüsseler Vorschriften kein Recht hatten. Meine niederländische<br />
Krankenversicherung zweifelte jede französische Arztrechnung an.<br />
Während ich mich fast überschlug, Pariser zu werden, war Frankreich heftig damit beschäftigt, noch<br />
mehr Frankreich zu werden. Zwei Jahre nach meiner Ankunft fand ein entscheidendes Referendum<br />
zum europäischen Grundgesetz statt [2005]. Frankreich stimmte en masse dagegen. Die Niederlande<br />
auch. Das schuf ein Band. Die beiden Länder hatten aber offenbar noch mehr Gemeinsamkeiten.<br />
Frankreich quoll der Mund von französischen Normen und Werten immer mehr über. Le Pen führte<br />
den Begriff français de souche ein – des sogenannten reinrassigen Franzosen. Frankreich verfärbte<br />
sich angeblich, Brüssel bedrohe die französische Autonomie. Politiker nutzten die Ängste und forder -<br />
ten eine nationale Debatte über die französische Identität. Nach der Wahl Sarkozys zum Präsidenten<br />
wurden in Dutzenden Verwaltungsgebäuden der Departements und Gemeinden Debatten über die
ADRIAAN VAN DIS ,EUROPE NOW<br />
Frage geführt: »Was heißt es heute, französisch zu sein?« Die Franzosen fühlten sich offenbar bedroht.<br />
Die Migration und die Globalisierung waren die großen Bösewichte, aber auch Google, Hollywood<br />
und McDonald’s. [In Frankreich gibt es die meisten Macdo-Filialen von ganz Europa.] Sarkozy hatte<br />
gut zugehört und meldete die französische Küche als bedrohtes kulturelles Erbe bei der Unesco.<br />
In den Niederlanden packte man es schlichter an: Jedes Problem wurde islamisiert. Verbrechen, Pro -<br />
blemkieze, schlechter Unterricht – an allem war der Islam schuld. [Schon vorher hatte der 2002 ermordete<br />
Politiker Pim Fortuyn den Islam als »zurückgebliebene Religion« bezeichnet.] Die Linke ha be<br />
zu lange zu viel schöngeredet. Die multikulturelle Gesellschaft sei eine Farce. Auch die Niederländer<br />
müssten besser wissen, wer sie eigentlich seien. Akademiker entwickelten einen literarischen und<br />
historischen Kanon. Bücher und Fakten, die man als Niederländer zu kennen habe. Städte schlossen<br />
sich an. Und die Bibel wurde in Twenter Dialekt übersetzt. Not lehrt beten.<br />
Ich beobachtete das alles – aus der Distanz, von meiner Mansarde aus, fünfter Stock, über den Zink -<br />
dächern von Paris. Meine neue Stadt verweigerte den Kopftüchern den Zutritt zu öffentlichen Gebäuden.<br />
Die Burka wurde verboten und ich sah an Freitagnachmittagen Hunderte von Männern auf<br />
der Rue de la Poissonnière beten, weil der Bau von Moscheen bürokratisch verschleppt wurde.<br />
Nach Fortuyn bekamen die Niederlande eine neue Partei mit einem einzigen Programmpunkt: dem<br />
Islam. Mit einem Schlag wurde sie zur zweitgrößten Partei des Landes. Nein, ich nenne den Namen<br />
des blond gefärbten Führers nicht.<br />
Und dann kam die Finanzkrise. Banken gerieten ins Wanken. Offenbar hielten sich nicht alle Länder<br />
an die finanziellen Vorschriften. Die Portugiesen, die Italiener, Griechen, Spanier. Die PIGS. Die Knob -<br />
lauchländer. Der Euro steht schwer unter Druck. Unsere Renten drohen sich in Luft aufzulösen! Brüssel<br />
fordert Geld und Solidarität von den nördlichen Ländern. Der niederländische Staat bürgt, aber die<br />
Bürger murren. Der große blonde Führer fand einen neuen Buhmann: Brüssel. Kein Cent mehr für die<br />
Knoblauchfresser! Wir wollen unseren Gulden wiederhaben! Macht die Grenzen zu! [Und der Islam<br />
kam auf die Reservebank.]<br />
Nicht nur äußerst rechts, auch äußerst links fängt man jetzt mit einem Anti-Europa-Programm Stimmen.<br />
Laut Wahlprognose werden die zwei größten politischen Parteien in den Niederlanden antieuropäisch<br />
sein. Die Niederlande verrammeln ihre Fenster. Erst mal sind wir dran! Die Niederlande den Niederländern!<br />
Ich habe auch einen Traum: den vom Ende des Nationalstaats. Der Nationalstaat, der gerade jetzt mit<br />
so viel Wehmut und Romantik besungen wird. [Der Historiker H. W. von der Dunk schrieb am 5. Juli<br />
2012 darüber im »NRC Handelsblad«.]. Der Nationalstaat ist auch nur eine Konstruktion, oftmals von<br />
oben auferlegt, häufig nach blutigen Kämpfen und auf Kosten regionaler Identitäten und Dialekte wie<br />
Friesisch, Bretonisch, Katalanisch und Baskisch. (Es ist übrigens zu beobachten, dass in einem vereinten<br />
Europa das Interesse an diesen Sprachen wieder auflebt.] Nationalgefühl ist angelernt, wie intensiv<br />
es auch erfahren wird. Ist die Verherrlichung des Nationalstaats nicht ein Aufbäumen, ein letzter<br />
Widerstand gegen die Folgen von Migration und Globalisierung? Nationale Gefühle gehen durch<br />
das Ende des Nationalstaats nicht verloren, dafür wurden Fußballstadien gebaut und auch die Welt<br />
des Internets bietet dafür Raum. Dasselbe Internet, das unsere Grenzen verwischt.<br />
Auch Kultur ist oft grenzüberschreitend. Literatur kann größer sein als eine einzige Sprache. Ibsen ist<br />
größer als Norwegen. Beethoven gehört uns allen. Europäer haben ein gemeinsames kulturelles Erbe.<br />
Mehrstaatlichkeit ist meine Identität. Ich glaube an Vermischung und Verfärbung. Und wer nicht da -<br />
ran glaubt, muss die Augen weiter aufmachen. Das multikulturelle Europa ist schon längst ein Fakt,<br />
ob es uns nun passt oder nicht. Auch die Migranten, die heute noch ein eingefrorenes Bild von ih -<br />
rem Land im Kopf haben und ihre Satellitenschüsseln auf antike Anschauungen richten, werden nach<br />
drei, vier Generationen Europäer sein.<br />
Migranten wissen, was Diskriminierung ist. Ihre Zuflucht muss größer sein als ein einziges Land. Ein<br />
Land ist zu verwundbar, ein einziger unberechenbarer Machthaber kann ein ganzes Volk zwingen, sich<br />
zu beugen. Sehen Sie nur, wie sich halb Holland verbeugt. Allein ein mehrstaatliches Europa kann<br />
Schutz bieten. Natürlich tut die Transformation weh. Und sie wird viel kosten. Aber es bleibt uns nichts<br />
anderes übrig. Vaarwel Nederland. Auf Wiedersehen Deutschland. Au revoir France. Hallo Europa.
ADRIAAN VAN DIS ,EUROPE NOW<br />
Erst jetzt wird mir bewusst: Nicht Huizingas offene Niederlande haben aus mir einen Europäer gemacht,<br />
sondern die dumpfen, zagenden Niederlande. Ich sehne mich nach frischem Wind. Europa<br />
ist für mich zur Lebensnotwendigkeit geworden. Wann kann ich meinen Pass abholen?<br />
Postskriptum<br />
Was ist Europa? Früher, vor 1989, hatte man ein freies Westeuropa und ein unfreies Osteuropa, aber<br />
diese übersichtliche Zweiteilung ist zeitgleich mit der Mauer verschwunden. Ost und West haben sich<br />
neu erfunden, aber bilden wir heute die Vereinigten Staaten von Europa? Haben wir, genau genommen,<br />
genug Gemeinsamkeiten? Und wie groß soll das neue Europa werden? Noch größer als die jetzigen<br />
27 [und in zwei Jahren 28] Staaten? Gehört die Türkei dazu? Für den Europarat und für die NATO ist<br />
das Pufferland offenbar gut genug, aber gehört sie auch zum aufgeklärten Westen? Komplexe Fragen.<br />
Je größer, desto stärker, scheint mir. Mein Europa ist eine Föderation eigenwilliger Länder, in<br />
denen kulturelle Traditionen gedeihen können, mit einem direkt gewählten Parlament und einer direkt<br />
gewählten Regierung. Einheit ist nicht dasselbe wie Uniformität.<br />
[Übersetzt aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
PEDRO ROSA MENDES<br />
TRÄUMEND AN EUROPAS TÜR<br />
Ende der siebziger Jahre war »Europa« ein Haus mit vorhersehbaren Gewohnheiten beziehungsweise<br />
festen Öffnungszeiten. Wenn ich mich recht erinnere, schloss es seine Tore um 10 Uhr abends und<br />
öffnete sie erneut um 6 Uhr morgens. Zumindest als Kind hatte ich diesen Eindruck, bestätigt durch<br />
die Nächte, die wir im Niemandsland zwischen dem Zoll von Vilar Formoso und Fuentes de Oñoro<br />
verbrachten, dem Hauptgrenzübergang zwischen Portugal und Spanien. »Europa« war verbunden mit<br />
dieser diffusen Zeit: der Zeit des Wartens. Damals wartete man zugleich auf den Morgen und das<br />
Morgen. Das Morgen und die Grenze verschmolzen miteinander, wurden zu einer Art Schwelle, einem<br />
Ort, weder innen noch außen, da er genau jenes unsichtbare Gebiet des Hindurchs ist. In diesen unterbewussten<br />
Zuständen wohnen die Träume. Ich komme aus einem Land, in dem die Grenze vor<br />
noch nicht allzu langer Zeit [der Zeit meiner Eltern] ein existenzielles Thema war: springen oder bleiben,<br />
springen oder sterben, springen oder verzichten?<br />
Die Zeit meiner Kindheit und Jugend war ein kurzes Hindurch in einer neunhundertjährigen Geschichte,<br />
eine diffuse Passage zwischen zwei Abkürzungen, dem PREC1 und der EWG. Ich gehöre der Ge -<br />
ne ration an, die in Portugal weder die Mutter noch das Kind der Demokratie ist. 1968, unter der Diktatur,<br />
geboren, kam ich 1974, im Jahr der Nelkenrevolution, in die Schule und begann 1986, im Jahr<br />
von Portugals Beitritt zur Europäischen Union, mein Universitätsstudium. Historisch gesehen hat mei -<br />
ne Generation nichts zuwege gebracht, obgleich sie mit allem gesegnet ist: mit Freiheit, Demokratie<br />
und Wohlstand – kurz gesagt, mit »Europa«. Mit diesen Segnungen bestens versehen, stellen wir uns<br />
selten oder so gut wie nie die Frage, ob Portugal sich nicht vielleicht besser aus der Affäre hätte ziehen<br />
können.<br />
Hindurch ist kein Ort und zugleich die Möglichkeit aller Orte: eine Hoffnung, eine Prophezeiung, eine<br />
Lüge. Man ist noch nicht dort, aber dort ist schon hier. Es ist ein Schlaf und ein Unterbrechen dieses<br />
Schlafes, die Schwelle zwischen Traum und Bewusstsein. Auf den Rücksitz unseres Wagens gekuschelt,<br />
fuhr ich manchmal so verwirrt aus dem Schlaf hoch wie jemand, der beim Aufwachen nicht<br />
gleich weiß, wo er sich befindet,<br />
– Sind wir schon da?<br />
draußen war es dunkel, bis auf die Neonlichter der Läden, in denen man Karamellbonbons und Sevilla -<br />
puppen kaufen konnte und aus denen mein Vater mit Chorizo, Serranoschinken, anderen »Tapas«<br />
und einer Flasche Orangeade Marke La Casera zurückkam,<br />
– Noch nicht, träum noch ein bisschen,<br />
hinter uns stauten sich die Wagen in einer langen Schlange, irgendwo vor uns befand sich der Zollposten,<br />
wo im brenzligsten Moment der Reise, nämlich wenn es zurück nach Hause ging, ein Mann<br />
in Uniform, dessen Beruf das Misstrauen war, in jeden Wagen hineinfragte:<br />
– Etwas zu verzollen?<br />
ja, was könnte es denn zu verzollen geben, Herr Zollwachtmeister, eine Flasche Whiskey?, ein tragbares<br />
Tonbandgerät?, eine Kaffeemaschine?, unbedeutende Luxusartikel, erstanden auf einem der<br />
obligaten Streifzüge durch die Läden von Andorra,<br />
– Wir waren mit dem Jungen in einer Klinik in Barcelona.<br />
ja, was könnte es denn geben im Auto einer Familie der Mittelklasse?, keine Mittelklasse in Europa,<br />
sondern in Portugal, mittelmäßig besorgt, mittelmäßig ärztlich versorgt, mittelmäßig ehrfurchtsvoll,<br />
was an »Schmuggelware« könnte es geben?
,<br />
PEDRO ROSA MENDES EUROPE NOW<br />
Die Grenze war ein Filter. In welcher Richtung man sie auch passierte, hier fuhr »Europa« durch, auf<br />
diesem Asphaltstreifen zwischen Beira-a-Pobre und Castela-a-Velha, wo das Esperanto der Identifikationszeichen<br />
TIR an den Lastwagen eine prosaische, aber deutliche Vorstellung von freiem Warenverkehr<br />
verwirklichte. Diese Vorstellung von zirkulierender Freiheit war ein »singendes«, nahezu ideologisches<br />
Morgen in einem ewig armen Land, das noch immer nicht lesen und schreiben konnte und<br />
noch immer in der Klemme steckte, ein low-cost Vaterland, das sich eben erst – gezwungenermaßen<br />
und hastig – seines Kolonialreiches und seiner Diktatur entledigt hatte. Das portugiesische Kolonialreich<br />
besteht erst seit Kurzem nicht mehr. Seit vorgestern. Seit so kurzer Zeit, dass Portugal bisher<br />
noch keine Zeit fand, zu begreifen, was es bedeutet, in »Europa« zu sein. Oder besser, dass es sich<br />
mit falscher Leichtigkeit in »Europa« integrierte: Seit Gründung der NATO war es bereits im »Atlantik«<br />
und musste »Afrika« daher auch nur abstoßen [dieses ewige Laster imaginärer Geografien, vielleicht<br />
ein imperialer Reflex, alles ist generisch, nichts ist konkret und nur wenig genau], um erneut »seinen<br />
historisch angestammten Platz« auf dem Kontinent einzunehmen [das erzählen sie uns als Kindern<br />
und selbst noch als Erwachsenen]. »Europa« war eine einfache Reise. Portugal war ein Erfolg, es ent -<br />
wickelte sich zum Musterschüler Brüssels. Oder etwa nicht? Plötzlich ein Scherbenhaufen, aus der<br />
Traum. Das Land ist zahlungsunfähig, mit einem Mal ist von einer schwachen Produktionsstruktur<br />
die Rede, einer absurd hohen Verschuldung der privaten Haushalte, einem schwerfälligen Beamtenapparat,<br />
von wirtschaftlichen Indikatoren und einem sozialen Ungleichgewicht, das die Wirtschaftswissenschaftler<br />
als »auf dem Niveau eines Entwicklungslandes« einstufen.<br />
– Etwas zu verzollen?<br />
jetzt wird der IWF gerufen, die Regierung macht, von der Troika legitimiert, die Konterrevolution<br />
– Sind wir schon da?<br />
und die von der »Krise« legitimierte Troika, Staat und Troika im Verbund, antwortet in einem Kreuzzug<br />
von Steuer- und Arbeitsterror, besessen von der Notwendigkeit »einzusparen«, um jeden Preis »einzusparen«.<br />
– Noch nicht, träum noch ein bisschen.<br />
Der Sofortkredite beraubt und mit der Schwäche der Realwirtschaft des »europäischen Musterschülers«<br />
konfrontiert, entdecken die Lusitaner, wie mir ein Freund bei der Investmentbank sagte, »dass<br />
ein portugiesischer Euro nicht denselben Wert besitzt wie ein deutscher Euro«. Und als wäre dies<br />
nicht schon genug, fordern unsere Regierenden die Portugiesen auch noch offen zur Emigration auf.<br />
All dies ist schockierend für ein Volk, das glaubte, es sei kein Auswandererland mehr, und das, während<br />
es seinen Mythos vom Neureichen unter den Armen nährte, letztlich nicht das Notwendige unternahm,<br />
damit wir aufhören zu sein, was wir fraglos sind, nämlich der »Altarme« unter den Reichen.<br />
Die öffentliche Debatte forderte, während der goldenen Jahre der Strukturfonds und der »Konvergenz«,<br />
eine Identifikation mit »Europa«; der Erfolg verbarg die schockierende Tatsache der Abwanderung<br />
von Portugiesen aus ihrem Land. Aber die Zahlen der Bank von Portugal waren für den, der lesen<br />
wollte, immer einsehbar: Die letzte Generation portugiesischer Auswanderer [insbesondere derer nach<br />
»Europa« oder genauer nach Frankreich, Deutschland und in die Schweiz] schickte Beträge in Höhe<br />
des jährlichen portugiesischen Inlandsprodukts in ihre Heimat. Jetzt ist der Aderlass der Emigration<br />
zumindest sichtbar und dem, der noch daran zweifelt, empfehle ich aus pädagogischen Gründen ei -<br />
nen morgendlichen Ausflug in die Pariser Banlieue, damit er all die Kombis von Familienunternehmen<br />
zählen kann, die »Fensterrahmen und Aluminiumteile«, »Reparaturen am Haus« oder »Maurer- und<br />
Putzarbeiten« anbieten, die Kennzeichen – und die Reklameschilder! – noch immer portugiesisch.<br />
2011 haben 120 000 Portugiesen ihr Land verlassen. Die Portugiesen, die über eine qualifizierte Aus -<br />
bildung verfügen – eine goldene Generation mit dem höchsten Bildungsgrad, den es je in der portu-
,<br />
PEDRO ROSA MENDES EUROPE NOW<br />
giesischen Geschichte gab –, gehen nach London, Paris oder Genf. Sie versuchen in »Europa« jene<br />
kritische Masse zu verkaufen, von der sie in ihrem eigenen Land keinen Gebrauch machen können.<br />
Einem Land, in dem heute zum Beispiel 500 Euro ein großzügiges Arbeitsangebot für einen jungen<br />
Architekten darstellen.<br />
Portugal ist kein Krisenland, sondern ein Land, in dem einiges nicht stimmt, wo die Zurschaustellung<br />
über die Würde siegt und das Strebertum fast immer über den Anspruch. Aus einer kürzlich erstellten<br />
Analyse von Stellenanzeigen ging hervor, dass ein Schlosser oder ein Klempner mehr verdienen kann<br />
als ein Ingenieur. Man kam sogar zu dem Schluss, dass Stellenbewerber, um ihre Chancen zu verbes -<br />
sern, ihre Kenntnisse und Qualifikationen verbergen. Tragischerweise setzt sich die Überzeugung fest,<br />
dass »studieren zu nichts nützte ist« in einem Land, das mit Analphabetentum und einem ausgepräg -<br />
ten Mangel an Bildung zu kämpfen hat.<br />
An der anderen Front der Fluchtbewegung aus diesem geografischen Rechteck, das sich von »Europa«<br />
entfernt, zieht eine Schar von Arbeitslosen der geplatzten Baublase und der Billiglohnsektoren nach<br />
Süden Richtung Angola. Von Angola, dem ehemaligen »Schmuckstück der portugiesischen Krone«,<br />
sagt die Propaganda beider Länder, es sei ein Land der »günstigen Gelegenheiten«. Das entspricht<br />
der Wahrheit für den, der keine Skrupel hat. Was man aber in den Medien von Luanda, Lissabon<br />
und »Europa« verschweigt, das oft nicht einmal weiß, wo dieses Land überhaupt liegt, ist die Tatsache,<br />
dass es in Angola kein sauberes Geld gibt und dass jede »Investition«, die man dort tätigt, eine<br />
direkte oder indirekte Geldwäsche ist. Um den mutigen angolanischen Rapper MCK mit seinem wun -<br />
derbaren Gedicht, das genau diesen Sachverhalt thematisiert, zu zitieren: »Im Land von Papa Banana<br />
haben sie aus dem Elend ein einträgliches Geschäft gemacht.« Angola ist heute ein Circus Maximus<br />
neuer kolonialer Ausbeutung in einem Projekt des Raubtierkapitalismus unter der Ägide eines stalinistisch<br />
geprägten Regimes. Die Ausbeutung dieses luso-tropischen Binoms aber hat sich ins Gegenteil<br />
verkehrt und dazu geführt, dass die Geschichte sich rächt. Die Söhne und Enkel der portugie -<br />
sischen Kolonisten sind heute – in Werften, Steinbrüchen und im Baugewerbe – die Halbsklaven der<br />
Nachkommen der vormaligen »Eingeborenen« und »Assimilierten« aus der »Überseeprovinz«, Salazars<br />
ganzer Stolz.<br />
Aber Angola ist nicht nur das Ziel unserer Billigkräfte. Nach einem vierzig Jahre währenden Ausflug<br />
nach »Europa« steht das demokratische Portugal heute genau dort, wo sich das Portugal der Perestroika<br />
Marcello Caetanos befand, des Thronfolgers Salazars, der das Land in einer längst vergangenen<br />
Zeit festzuhalten suchte. Portugal, und dies ist eine schmerzliche Feststellung, ist ohne Angola<br />
nicht lebensfähig, was wiederum, wie in den siebziger Jahren, die Frage nach der Souveränität aufwirft,<br />
diesmal nicht mehr der Angolas, sondern der unseren. Aus Luanda kommt seit einigen Jahren<br />
der Zustrom von Kapital und Investitionen – besagte »günstigen Gelegenheiten« –, der Portugal auf<br />
»europäischem« Minimalniveau hält, ohne dass Portugal ehrlicherweise Schiffbruch bekennen müsste.<br />
Im Gegenzug muss Portugal die zunehmende Kontrolle durch angolanische Interessen akzeptieren,<br />
und zwar in so lebenswichtigen Bereichen wie dem Bankenwesen, der Energiewirtschaft und, hélas!,<br />
dem Handel und den Medien. Das Versagen von Portugal in Europa sowie umgekehrt das Versagen<br />
von Europa in Portugal lässt sich nicht nur und auch nicht vor allem aus dem Fehlen von wirtschaftlich-sozialer<br />
Konvergenz ableiten, sondern auch aus dem Fehlen einer moralischen und ethischen Kon -<br />
vergenz in der politischen Praxis und in der Zivilkultur. »Europa« erlaubt an seiner Südflanke ein gewisses<br />
Maß an politischer Korruption, schlechter Regierungsführung und täglicher antidemo kratischer<br />
Praktiken und erachtet für normal, was in den Ländern des Nordens – oder selbst des Ostens –<br />
niemals ungeahndet bliebe. Dies ist eine Art schlecht bemäntelter Willfährigkeit von jemandem, der<br />
in den achtziger und neunziger Jahren, in Brüssel Paris oder Bonn, nicht verstand, weil er es nicht<br />
wollte, den gebührenden Einfluss auf die aufsteigenden politischen Klassen auszuüben, die ihre Klien -<br />
tel aufbauten und finanzierten, indem sie die »Kohäsionsfonds« verteilten und verschleuderten, und<br />
zwar zugunsten eines Entwicklungsmodells, das sich nie von dem entfernte, was in dieser Zeit für<br />
die »Großen« des »europäischen Projekts« von Vorteil war.<br />
Dies ist übrigens eine für »Europa« durchaus vorteilhafte Amnesie. It’s the history, stupid: Portugal<br />
hat nicht zu »Europa« gefunden, als es sollte und konnte, da »Europa« und »Amerika«, mit anderen<br />
Worten die westlichen Demokratien, nach 1945 der Ansicht waren, dass es sich letztlich nicht lohne,
,<br />
PEDRO ROSA MENDES EUROPE NOW<br />
zu viel Druck auf Salazar [und Franco] auszuüben. Die großen Protagonisten des »europäischen Projekts«<br />
und der Atlantischen Allianz erachteten es als akzeptabel, dass Portugiesen [sowie Spanier<br />
und Griechen] weiterhin unter protofaschistischen Regimen lebten, unter der Zwangsherrschaft von<br />
Gewalt und Unwissen, die sie für ihre eigenen Völker nie geduldet hätten. Der Diskurs, den wir heute<br />
hören, diffus, aber zunehmend mutiger, der Diskurs eines europäischen Mezzogiorno, geführt von<br />
Anrainern eines Mittelmeers, das den Maghreb letztendlich auf beiden Seiten hat, ist nur das jüngste<br />
Echo der alten Strategien und eine schräge Vorstellung der ehrenwerten Führer von »Europa«. Diese<br />
Väter der »europäischen Integration« gehören zu denen, die bewusst Regime wie den portugiesischen<br />
Estado Novo haben fortbestehen lassen, für die unser Volk einen unermesslich hohen Preis zahlen<br />
musste – historisch als Kollektiv und biologisch als Individuen.<br />
Die demokratische Konsolidierung im Herzen »Europas« – eine Zeit des Friedens und somit eine Zeit<br />
der Saat und der Ernte – wurde zum Teil mit dem Zins der Totalisierung mehrerer Länder an der Peripherie<br />
bezahlt, einschließlich des Landes, in dem ich geboren wurde. »Europa«, das schnell urteilt<br />
und brandmarkt, sollte nicht vergessen, dass es, bevor es [wie man uns heute sagt] die »Integration«<br />
Portugals bezahlte, dessen Ausgrenzung befördert und davon profitiert hat. Auf unterschiedlichste<br />
Art und Weise, einschließlich derer, die niemand zugeben will: Bei einem Streifzug, den ich vor Kurzem<br />
durch die sowjetischen Archive in Moskau im Rahmen einer akademischen Arbeit über die Afrikapolitik<br />
des ehemaligen Warschauer Paktes unternommen habe, stieß ich wiederholt auf Hinweise für den<br />
ruhmreichen Beitrag der BRD zu den Kriegsanstrengungen Portugals in Afrika … Nichts ist umsonst<br />
im Leben. Der Kalte Krieg hatte einen zweiten Eisernen Vorhang nach Westen, und zwar in den Pyrenäen:<br />
den Eisernen Vorhang der Reaktion, symmetrisch zu dem Eisernen Vorhang der Revolution im<br />
Osten. Und wenn sich der Übergang auf der Iberischen Halbinsel nicht, wie auf dem Balkan, in einer<br />
sichtbaren Explosion vollzog, ist das in erster Linie auf endogene Faktoren und eine überraschende<br />
Reife der beteiligten gesellschaftlichen Kräfte zurückzuführen. Die für jeden Portugiesen unangenehme<br />
Wahrheit ist: Wir müssen uns heute von Leuten Lektionen in Haushaltsführung anhören, die es<br />
nicht verstanden, uns zu gegebener Zeit Lektionen in Freiheit zu erteilen.<br />
Von der Reise durch Spanien vor dreißig Jahren habe ich zwischen Lérida/Lleida und Ciudad Rodrigo<br />
eine trostlose Landschaft von kleinen Städten mit ärmlichen Ziegelbauten und eine triste Hochebene<br />
aus dicht aufeinanderfolgenden, verschlafenen pueblos wie in einem Western in Erinnerung. Ein befremdlicher<br />
Eindruck: Spanien im Westen von Katalonien eine Wüste. Wer kannte schon Valladolid?<br />
Wo lag Zaragoza? … Auf der portugiesischen Seite war das Land trotz der seit Generationen ländlichen<br />
Rückständigkeit der Beiras [einer zentralen Region Portugals] besiedelt und produktiv, ein bevölkerungsreicher<br />
Gürtel im Grenzbereich, seit Jahrhunderten – von der christlichen Reconquista an –<br />
wirtschaftlich genutzt, mit alten Industriezentren wie dem Textilstandort Covilhã, dem »portugiesischen<br />
Manchester« [einer meiner Großväter war Lumpensammler, das heißt. er lieferte den großen Wollfabri -<br />
ken Stoffabfälle als Rohmaterial]. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals Olivenöl, Honig oder<br />
Käse gekauft hätten. All das kam von den kleinen Parzellen der Familie. Meine Großeltern haben ihre<br />
Minifundien bearbeitet, bis sie starben. Und ich habe gelernt, mit der Hacke umzugehen, noch bevor<br />
ich lesen und schreiben lernte. Güter des täglichen Bedarfs wurden zu Hause oder innerhalb des<br />
Dorfes hergestellt.<br />
Die von »Europa« finanzierte und vorgezeichnete »Entwicklung«, die im Küstengebiet unseres Landes<br />
Kristallkugeln produziert, dem Aushängeschild für die portugiesische Modernität, hat diese ländliche<br />
Welt Stück um Stück zerstört. Sie hat dies auf eine perverse Art bewerkstelligt, durch Subventionen,<br />
Quoten, »Anreize« zum Anbau von was auch immer, jedes Jahr etwas anderes [Tabak, wo Weinreben<br />
standen, Kiwis, wo es Olivenhaine gab, und Eukalyptus, wo Pinien wuchsen …], bis schließlich die Kom<br />
bination von Wirtschaftspolitik und Missmanagement der Behörden vor Ort das Landesinnere entvölkerte<br />
und neuen Blutes beraubte. Und das Motiv für all die »Anreize«? Die Bedürfnisse des Räder -<br />
werks der Gemeinsamen Agrarpolitik [GAP], die zum Vorteil der industriellen Landwirtschaft von »Euro -<br />
pa« nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein kulturelles Ökosystem zerstört und ein melan cholisch<br />
stimmendes Szenarium mit Golfplätzen und Jagdrevieren aus ihm gemacht hat. Ein unersetzlicher<br />
Verlust, eine anthropologische Erosion. Um diesen Kontrast zu verdeutlichen: In Deutschland zum<br />
Beispiel gibt es Tabuwörter, die Dinge benennen, die niemand vergessen darf, das Wörterbuch der
,<br />
PEDRO ROSA MENDES EUROPE NOW<br />
portugiesischen Sprache hingegen ist voller Wörter, die immer weniger Leute kennen. Sie benennen<br />
Gegenstände und Tätigkeiten eines entvölkerten [und nicht etwa verödeten] Universums: die ländliche<br />
Welt. Was bedeutet das Verb jäten? Was das Substantiv Gewann? Meine Eltern redeten mit mir in<br />
einer Sprache, die ich mit meinen Töchtern bereits nicht mehr sprechen kann, da eine ganze auf dem<br />
Land geborene Generation auf ihrer europäischen Reise in die Städte an der Küste abgewandert ist.<br />
Ich erinnere ich mich noch daran, in meinem Schlaf, hinter Vilar Formoso, hinter dem Zollposten:<br />
– Etwas zu verzollen?<br />
der letzte Teil der Reise, bis Beira Baixa waren es nur noch wenige Stunden, verlief ausgelassen und<br />
heiter, Erleichterung lag in der Luft, und es kam mir vor, als glitte unser Opel Kadett Caravan auf der<br />
Gegenspur zu Europa schneller dahin. Eines Tages fragte ich meinen Vater, warum er nicht fortgegan -<br />
gen sei, warum er nicht, wie man sagte, den Sprung gewagt habe, mit anderen Worten, aus dem<br />
Land von Salazar geflohen sei,<br />
– Sind wir schon da?<br />
rechtzeitig, um nicht nach Afrika in den Krieg ziehen zu müssen,<br />
– Etwas zu verzollen?<br />
rechtzeitig, um vielleicht zu studieren und nicht nur seine Ausbildung zum Volksschullehrer zu machen,<br />
rechtzeitig, um in »Europa« zu leben und nicht in der Mittelmäßigkeit,<br />
– Noch nicht, träum noch ein bisschen.<br />
aber er hat nicht geantwortet und ich habe nie mehr gefragt.Bis heute habe ich das Gefühl, ich habe<br />
ihn verletzt. Oder aber er war es, der mich nicht verletzen wollte. Mit anderen Worten: Seine Generation<br />
muss die letzte in Portugal gewesen sein, die »ins Ausland gehen« nicht von Fahnenflucht unter -<br />
scheiden konnte. Deshalb blieb mein Vater auf der Schwelle. Ich hingegen habe es gelernt. Anderes<br />
habe ich »Europa« nicht zu verdanken.<br />
Genf, Juli 2012<br />
[Übersetzt aus dem Portugiesischen von Inés Koebel]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
OSTAP SLYVYNSKY<br />
KINO POLONIA<br />
Das erste Buch meines Lebens war das polnische »elementarz«, die ABC-Fibel.Ich weiß bis heute<br />
nicht genau, warum es so kam. Ich kann nur Vermutungen darüber anstellen. Meine Eltern hatten kei -<br />
ne besondere Affinität zu Polen. Ganz und gar nicht. Es gab keine Polen in der Familie, zumindest<br />
weiß niemand etwas davon. Deshalb ist dieser Auftritt der polnischen ABC-Fibel eher als ein Kunststückchen<br />
für Gäste einzuordnen. Wenn während eines Festessens der richtige Moment kam [die ersten<br />
Wodkagläser geleert, die ersten Salate verzehrt und die Gäste bereit für eine Show], gab mir der<br />
Vater ein Buch in die Hand, ich kletterte auf einen Hocker [na gut, einen Hocker gab es nicht, das ist<br />
ein Klischee aus dem kollektiven Bewusstsein] und ich las, stotternd, die Silben dehnend und purpurrot<br />
im Gesicht, vor:<br />
Na tym placu jest kino.<br />
Ala i mama idą do kina.<br />
Nad kinem jest napis.<br />
KINO POLONIA.<br />
Ich las bis zu diesen Worten, die ich nicht verstand, dann lief ich unter dem zustimmenden Schnalzen<br />
und dem Applaus der Gäste aus dem Zimmer. Der Nimbus eines Wunderkindes leuchtete über meinem<br />
Kopf auf wie eine Girlande am Weihnachtsbaum. Ich glaube, kein einziger Gast wäre auf den Ge -<br />
danken gekommen, dass dieser Kleine noch nicht mal die Kyrilliza, das kyrillische Alphabet, beherrscht.<br />
Mein Vater strahlte. Er schaffte es, alle auszutricksen. Außer meiner Mutter, versteht sich, die Bescheid<br />
wusste, aber solidarisch schwieg.Alle, das heißt nicht nur die beschwipsten Gäste. Das wäre kein<br />
Grund zum Strahlen. Alle heißt alle.Ich denke, dass man in der Sowjetunion des Jahres 1983 glaubte,<br />
dass all das noch über Generationen hinweg so weitergehen würde. Ich kann mir diesen Zustand<br />
von Halb-Leben im Wasser eines abgestandenen Tümpels schwer vorstellen: Eine Apathie, aus der<br />
man nur gelegentlich durch einen Funken Freude – einen Funken, den man dank besonderer Fertigkeiten<br />
schlagen kann – zeitweilig herausgerissen wird.<br />
Eine neue Jeanshose, ein Ferienscheck nach Bulgarien konnten einem ein solches Fest bereiten. Auch<br />
wenn mein Vater diese Freude bei seinen Familienmitgliedern schweigend und skeptisch zur Kenntnis<br />
nahm: Der Kult des Materiellen, der unter den Bedingungen des totalen Defizits üppig aufblühte,<br />
bereitete ihm großes moralische Leid. Sein Interesse galt ausschließlich Büchern.<br />
Kürzlich hat jemand gesagt, dass die Sowjetunion unsinnigerweise das Image des Landes habe, in<br />
dem am meisten gelesen wurde. Nicht, weil man nicht gelesen hätte, sondern, weil das Gelesene im<br />
Nirgendwo versickerte, wie Wasser im trockenen Sand. Man las, weil man nichts zu tun hatte. Man<br />
wollte doch nicht Stunden um Stunden untätig in stumpfsinnigen staatlichen Büros hocken. Also hat<br />
man gelesen. Und wenn du liest, um die Zeit totzuschlagen, dann ist es eigentlich egal, was du liest,<br />
ob Gorki oder Conan Doyle. Dabei spielte auch das standardisierte Design sowjetischer Möbel eine<br />
nicht zu unterschätzende Rolle. Es waren normalerweise zwei Regale vorgesehen, eins für Kristallglas<br />
und eins für Bücher. Viele solcher Schränke sind heute mit Büchern aus den siebziger und achtziger<br />
Jahren vollgestellt, in denen niemals geblättert wurde. Ich habe es gesehen.<br />
Es gab, natürlich, auch eine Antithese: Die Kaste der Jünger von Márquez, Borges, Hesse, Yi Jing,<br />
die unter der Hand völlig zerlesene Bücher weiterreichten und nachts Texte von jungen rebellischen<br />
Poeten und ermordeten Klassikern auf ihren Schreibmaschinen abtippten. Einer von ihnen wurde<br />
nach dem Zerfall der Sowjetunion Verkäufer auf dem Büchermarkt, einer ein öffentlicher Intellektueller,<br />
ein dritter sitzt im Parlament. In der Sowjetzeit erkannten sie einander an einem kaum sichtbaren<br />
nervösen Leuchten über dem Scheitel. Es galt die Regel, nicht anzuhalten und sich nicht zu grüßen,<br />
solange man sich ohne Deckung auf freiem Feld bewegte.<br />
Mein Vater gehörte in dieser Zeit weder zu den einen noch zu den anderen. Er hat nicht Gorki gelesen,<br />
gehörte aber auch nicht zum Kreis von Lesern, die Bücher weitergaben. Er hatte sein eigenes Projekt.<br />
Er baute Europa. Aus Büchern.<br />
Das war weder einfach noch schwierig. Es verlangte Ausdauer und Regelmäßigkeit. Beinahe wöchent -<br />
lich ging mein Vater in die Buchhandlung »Druschba« neben dem Brunnen am Mickiewiczplatz. Dort<br />
wurden Bücher in den Sprachen befreundeter sozialistischer Länder verkauft. Er brachte jedes Mal
,<br />
OSTAP SLYVYNSKY EUROPE NOW<br />
etwas Neues mit und bereitete sich innerlich auf den Küchenkampf mit Familienangehörigen vor, die<br />
letzte Bereiche ihres Territoriums vor dem Angriff der Bücher verteidigten. Manchmal waren es ganze<br />
Buchreihen, wie zum Beispiel kleine Bände ausländischer Prosa in markanten einfarbigen Umschlägen<br />
mit der Nike von Samothrake auf dem Cover. Oder schwarze Bände von Existentialisten, die mit<br />
Imitationen einer Druckerschrift geschmückt waren. Ab und zu brachte mein Vater ein besonderes<br />
Geschenk für mich mit: einen Bildatlas des menschlichen Körpers unter dem Titel »Merkwürdige Maschine«<br />
oder ein Album mit Luftschiffen, angeführt von der »Hindenburg«. All das gab es in polnischen<br />
Übersetzungen. Das Beste gab es damals in polnischen Übersetzungen.<br />
Sogar den Tschechen Hrabal gab es nur auf Polnisch. Polen verdarb die Reinheit des kommunistischen<br />
Experiments in Osteuropa, blieb aber trotzdem »befreundet«. Deshalb durften polnische Bücher<br />
in sowjetischen Buchhandlungen nicht fehlen, auch wenn sie nur in »spezialisierten« Geschäften<br />
geführt wurden. Ich war sicher ein Teil des Projektes meines Vaters.<br />
Mehr sogar, mir scheint, er realisierte es für mich. Er hat selbst nicht viel davon gelesen, weil er zu<br />
der seltenen Sorte der Menschen in der Sowjetunion gehörte, denen Zeit zum Lesen fehlte. Bücher<br />
kaufen, das Kind vom Kindergarten abholen, ihm Polnisch beibringen: Darin bestand sein stilles Dissidententum.<br />
Allerdings, als die Sowjetunion zusammenbrach, hat mein Vater nie die Möglichkeit wahr -<br />
genommen, über die westliche Grenze der Ukraine hinauszukommen. Auch nicht nach Polen, obwohl<br />
er die Sprache perfekt beherrschte. In den neunziger Jahren konnte man als ehemaliger Sowjetbürger<br />
einfach mit einem Reisepass nach Polen fahren, wenn man Lust dazu hatte. Er hat nie einen<br />
Reisepass besessen, bis heute nicht. Sein Europa war aus Papier. In einem Dutzend Bücherregale.<br />
Er hat es selber aufgebaut, so wie er es wollte.<br />
Das heutige ukrainische »Europa« besteht aus Papier und Pappe, es ist zusammengebastelt aus den<br />
Buchstaben offizieller Erklärungen zur »Europäischen Wahl«, die jahrelang nach demselben Muster<br />
geschrieben wurden. Es besteht aus den Bannern der Wahlplakate, aus Transparenten und Secondhandkleidung.<br />
Meinem Vater ist das gut gelungen. Er hat das Baumaterial sorgfältig ausgewählt.<br />
Der polnische Dichter Adam Zagajewski schrieb 1984: »So existiert Europa in uns – als Europa der<br />
Vorstellungen, Illusionen, Hoffnungen, Wünsche ...« Diese Worte treffen auf die heutigen Ukrainer<br />
noch mehr zu als auf die Polen vor zwanzig Jahren. Ich würde nur auf das Wort »Illusionen« einen Ak -<br />
zent setzen.<br />
Es ist erstaunlich, aber weder die Strapazen illegaler Arbeitsmigranten noch hinter der westlichen Gren -<br />
ze verschollene Verwandte, weder die Willkür europäischer Grenzer, Zöllner und anderer Funktionäre<br />
noch die bescheidenen Verdienste im Ausland oder all die geplatzten Träume sind imstande, bei den<br />
Ukrainern den Mythos »Europa« aufzulösen. Es ist eine Frage des Glaubens und man sollte sie in re -<br />
ligiösen Kategorien betrachten. Nichts kann das rettende Licht des gelobten Landes verdüstern:<br />
Geodizee, »Rechtfertigung der Geografie«. Die vorhandenen Grenzen und der fehlende Alltagskomfort<br />
sollen die Ungläubigen nur auf die Probe stellen. Die Verheißung Europa erfüllt sich allein für diejenigen,<br />
die bis zum Ende durchhalten. So ist ein Glaube, der durch jede Verleugnung nur bestätigt<br />
wird. Es sei denn, die Ukraine wird einst selbst Europa.<br />
Es ist nicht so, dass es in der Ukraine keine Gegenströmung zu dieser Religion gäbe. Es gibt, natürlich,<br />
auch den Glauben der »Antipoden«. Für sie ist Europa die Quelle alles sichtbaren und unsichtba -<br />
ren Bösen. Und alles funktioniert genauso, nur umgekehrt: Jede europäische Wohltat wird als Tücke<br />
und als Versuch wahrgenommen, uns noch tiefer zu verstricken.<br />
Der postsowjetische Mensch ist ein tief mythisches, utopisches Wesen. Das Fundament einer totalitären<br />
Propaganda bildet die felsenfeste Überzeugung, dass das Unsichtbare real existiert. Ukrainer<br />
gewöhnten sich im Lauf der Jahrzehnte daran, das zu sehen, was es nicht gibt: insbesondere ein<br />
Europa, von dessen Existenz niemand außer ihnen etwas ahnt. Ein Europa, in dem sehnliche Wünsche<br />
in Erfüllung gehen. Oder ein Europa der bösen Absichten.<br />
Die Überzeugung, dass das Unsichtbare existiert, will missbraucht werden. Denn die unsichtbare Re -<br />
alität ist ein Bild, zu dem jeder hinzufügen kann, was er will, sie ist eine Art Idol aus Knete. »Der<br />
samtene Vorhang« an der Ostgrenze der EU wird immer dichter, man sieht kaum noch etwas. Die<br />
Ukraine rückte keinen einzigen Meter nach Osten, was viele bedauern, sie ist nach wie vor gleich hin -
,<br />
OSTAP SLYVYNSKY EUROPE NOW<br />
ter der Mauer, auf der anderen Seite. Ich male mir ein Bild aus, wie eine primitive Zeitungskarikatur:<br />
Eine Menschenmenge auf der Außenseite lauscht den Geräuschen hinter der Mauer, versucht etwas<br />
zu verstehen, es kommt zum Streit. Und wie so oft taucht in diesem Moment derjenige auf, der alles<br />
erklären kann, ein Typ im Anzug und mit Krawatte. Mit offiziellem Gesichtsausdruck greift er nach<br />
dem Megafon und interpretiert die undeutlichen Stimmen hinter der Mauer.<br />
Ja, das ukrainische Europa ist ein gefälschter Geldschein, mit dem der Staat jedes Mal versucht, mit<br />
seinem Volk abzurechnen. Dem echten Europa würde er ihn auch gerne andrehen, doch dort wird<br />
dieser Schein vorsichtshalber nicht angenommen.<br />
Um gerecht zu bleiben: Die neue Trennlinie Europas ist keine Linie, auf der der östliche Mythos über<br />
die europäische Realität die Oberhand gewinnt. Es ist eine Konfliktlinie zwischen verschiedenen Mythen.<br />
Dort findet der Zusammenstoß kalter und warmer Luftmassen statt, prallen Illusionen aufeinander,<br />
begegnen sich zwei fundamental unterschiedliche Stereotypien.<br />
Ich habe einen Bekannten, der Literatur und Sendungen über Kriege, Konflikte und andere Katastrophen<br />
liebt. Er ist beinahe besessen davon. Sie können sagen, das ist ja nichts Besonderes, sondern<br />
eine klassische Form des Schlechte-Welt-Syndroms. Dennoch gibt es nicht so oft die Möglichkeit,<br />
so etwas aus der Nähe zu betrachten. Dieser Bekannte hat mir gestanden: Je näher die Katastrophe<br />
an hin heranrückt, desto mehr interessiert sie ihn. Der Krieg in Bosnien interessiert ihn mehr als der<br />
Krieg in Palästina und dieser mehr als Konflikte in Papua-Neuguinea. »Weißt du, ich glaube, es geht<br />
hier nicht um geografische, sondern um kulturelle Nähe«, versuchte ich mir die Maske eines Amateur-<br />
Psychoanalytikers aufzusetzen, »es interessiert dich, weil es an deine Welt erinnert und dir selbst so<br />
etwas theoretisch auch passieren kann.« – »Danke, dass du für mich Amerika entdeckt hast«, lachte<br />
der Bekannte. Nein, als Psychoanalytiker würde ich es nicht weit bringen.<br />
Aber es scheint mir heute tatsächlich so zu sein, dass Europa am »Mean World Syndrom« leidet: Je<br />
mehr seine stabile Existenz infrage gestellt ist, desto düsterer werden äußere Katastrophen dargestellt,<br />
die eigentlich gar nicht bedrohlich sind. Es ist wie mit einem Gewitter, das draußen tobt und die häus -<br />
liche Gemütlichkeit noch behaglicher erscheinen lässt. Das Beispiel Irak oder Afghanistan ist kein<br />
rechter Trost, weil dort alles anders ist. Dafür sind die Ukraine oder Albanien viel geeigneter. Diese Welt<br />
ist »vertraut anders«: ein Nachbar, der ständig hinter der Wand Lärm macht, ständig seine Mö bel um -<br />
stellt. Man ist gezwungen, ihm im Treppenhaus zu begegnen und seinen höflichen Gruß zu erwidern.<br />
Der berüchtigte BBC-Film »Stadien des Hasses« über Rassismus und Xenophobie in Osteuropa, in<br />
welchem der Ex-Spieler der englischen Nationalmannschaft Sol Campbell an westliche Fans appelliert,<br />
nicht in die Ukraine zu fahren, weil man in einem Sarg zurückkehren könnte, oder Artikel des<br />
deutschen Journalisten Matthias Marburg in der »Bild am Sonntag«, in denen die Ukraine »Land der<br />
Prostituierten« genannt wird, sind nur zwei Beispiele für die Dämonisierung des barbarischen Nachbarn.<br />
Diese Produktionen sind keine Lügen. Die BBC-Doku wurde nicht willkürlich geschnitten oder inszeniert,<br />
all das ist tatsächlich passiert. Der Artikel von Marburg ist aufgrund eines Gesprächs mit einer<br />
[?] ukrainischen Prostituierten entstanden, die berichtete, wie andere Frauen den Profis die Arbeit<br />
während der EM wegnehmen.<br />
Es gab keine Lüge, es gab nur eine negative Auswahl von Fakten. Damit das Bild eintönig dunkel<br />
wird, ohne helle Streifen.Damit es furchterregend wird. Damit man sich hier nicht mehr fürchtet.<br />
Die meisten Ukrainer wissen davon aber leider nichts. Davon, dass die Ukraine zu »diesem europäischen<br />
Es geworden ist, sie ist die Angst, die nachts das schlafende Paris, London und Frankfurt am<br />
Main heimsucht« 1<br />
Sie wissen nicht, was tatsächlich hinter der Mauer passiert. Weil die meisten nicht mehr verreisen.<br />
Aber es findet sich immer jemand, der ihnen sagt, wie sie Europa zu lieben oder nicht zu lieben<br />
haben.Deshalb hat mein Vater wohl nicht die schlechteste von den schlechten Varianten gewählt. Er<br />
schaut sich seinen Film über Europa an, sein altertümliches »Kino Polonia«. Und niemand kann sich<br />
einmischen.<br />
1_ Andrzej Stasiuk: Unterwegs nach Babadag. Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall.<br />
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 114 [Das Originalzitat bezieht sich auf Albanien; Anm. d. Ü.]<br />
[Übersetzt aus dem Ukrainischen von Sofia Onufriv]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
NORBERT SCHEUER<br />
GRENZLAND<br />
Ende Oktober 2011 fuhr Karl mit dem Zug in Richtung Westeifel; er wollte in ein Dorf, direkt an der bel -<br />
gischen Grenze, wo er beabsichtigte, einige Tage in einem abgelegenen Gasthof zu verbringen. Der<br />
Gast hof gehörte Julia, einer Freundin, die Karl lange nicht mehr gesehen hatte. Karl hatte Julia im<br />
Sommersemester 1979 an der Universität kennengelernt. Julia hatte sich in einem Seminar neben<br />
ihn gesetzt, ihre ledernen Handschuhe ausgezogen und sie sorgfältig auf das Pult gelegt; Handschuhe<br />
waren eine ihrer Marotten, ihr persönlicher Stil, wie sie zu sagen pflegte. Ihre Hände waren klein und<br />
zart. Obwohl sie nicht verheiratet war, trug sie einen altgoldenen Ehering an der rechten Hand. Karl<br />
hatte erst ihre schmalen Hände betrachtet, dann in ihre Augen geblickt. Sie hatte blaugrüne Iris und<br />
blondes, strähniges Haar, das über ihre Schultern fiel. Sie waren eine Zeit lang zusammen gewesen.<br />
Julia verlangte, dass er ihr den Ring abzog, bevor sie sich liebten. Sie hatte ihm einmal erzählt, es<br />
sei der Ehering ihres Großvaters, der Zöllner an der belgischen Grenze gewesen war. Es war wunder -<br />
bar gewesen, mit Julia zu schlafen, sie war unkomplizierter als alle Frauen, die er nach ihr kennenge -<br />
lernt hatte. Je länger die Zeit mit Julia zurücklag, desto schöner erschien sie ihm. Er blickte entgegen<br />
der Fahrtrichtung aus dem Zugfenster. Was in seinem Blickfeld erschien, war bereits Vergangenheit.<br />
Kieshalden, ausrangierte Container am Rande der Gleise, Silos hinter einem Durchfahrtsbahnhof,<br />
ein Schrottplatz, rostige Autos aus den siebziger und achtziger Jahren, aus der Zeit, in der er jung<br />
gewesen war. Karl dachte daran, dass die Griechen das Reich der Toten, den Hades, auch rückwärts<br />
betraten, was sie vor sich gehabt hatten, war ihre Vergangenheit. Auf den Höhenrücken drehten sich<br />
Windräder, am Himmel schwebten Kranichzüge zu ihren Winterquartieren, die Wälder leuchteten berauschend<br />
bunt, der Zug fuhr in einen Tunnel, danach ein Industriegebiet, vom Bahndamm sah er auf<br />
dicht aneinandergedrängte Hausdächer einer Ortschaft hinunter.<br />
Julias Eltern starben kurz nacheinander und sie kehrte in ihr Heimatdorf zurück, das nicht weit von<br />
hier, irgendwo direkt an der belgischen Grenze, lag. Julia hatte, wie Karl später von Freunden hörte,<br />
ihr Studium abgebrochen, hatte geheiratet und war in der Eifel geblieben, um die Gaststätte ihrer Eltern<br />
weiterzuführen. Achtundzwanzig Jahre später, Karls damalige Frau Miriam hatte ihn nach vielen<br />
Ehejahren verlassen, rief er Julia an. Karl hatte abends im Büro auf die Ergebnisse eines noch laufen -<br />
den Testprogramms gewartet, als er sie anrief. Sie hatte während des Telefonats hinter der Theke gestanden.<br />
Im Hintergrund hörte Karl Musik und laute Gesprächsfetzen. Julia schien wenig überrascht<br />
über seinen Anruf. »Heute Abend sind der Musik- und Kegelverein hier, dann ist immer viel los.« Sie<br />
bat ihn, zu warten, da sie in die Küche musste. »Ich rufe später wieder an«, sagte Karl. Er hatte sie<br />
nicht mehr angerufen – vielleicht wegen Sandra, die er einige Tage später kennengelernt hatte und<br />
mit der er sich über Miriam hinwegtröstete. Sandra und Karl trafen sich seit seiner Trennung an den<br />
Wochenenden, besuchten Konzerte, hatten zusammen eine Kreuzfahrt gemacht, auf der sie sich zu<br />
oft wegen Kleinigkeiten gestritten hatten.<br />
Zwei Jahre waren seit jenem Telefonat vergangen, Karl saß im Zug, der eine Gegend durchquerte, die<br />
er nur aus Julias Erzählungen und von Fotografien kannte. Damals interessierte sich Julia sehr für Fo -<br />
tografie, hatte ihm erklärt, für sie sei eine Fotografie ein Tropfen aus dem Meer der Wirklichkeit. Auf<br />
guten Fotos könne man Umrisse einer Wahrheit erkennen, die sonst unsichtbar bliebe. Karl wusste<br />
nicht, warum er seiner Vergangenheit hinterherfuhr. In einer Woche musste er wieder im Rechenzentrum<br />
sein, wegen einer schon seit einem Jahr geplanten Softwareumstellung. In den letzten Monaten<br />
hatte er fast ohne Unterbrechung gearbeitet. Er war jetzt Mitte fünfzig und musste aufhören, jeder<br />
technischen Neuerung hinterherzujagen. Während der Zugfahrt bemerkte er zum ersten Mal, wie viel<br />
Zeit vergangen war, Zeit, die sich in seiner Erinnerung weiter veränderte, von der er fälschlicherweise<br />
geglaubt hatte, sie verschwinde spurlos.<br />
Die Busse fuhren vom Kaller Bahnhofsvorplatz zu den großen Stauseen des Nationalparks und weiter<br />
bis zur belgischen Grenze. Auf den Treppenstufen vor dem Bahnhofsgebäude hockten Jugendliche,<br />
in der Bahnhofsstraße drängten sich Geschäfte, eine kleine Spielhalle und ein Reisebüro, gegenüber<br />
vom Bahnhof lehnte eine Frau mit kurzem rotem Haar an ihrem Taxi und rauchte. Karl ging an ihr vorü -<br />
ber zur Bushaltestelle. Bis sein Bus fuhr, hatte er eine halbe Stunde Zeit. Er kaufte in der Cafeteria<br />
des Supermarkts einen Becher Kaffee und setzte sich an einen Terrassentisch, seinen Rucksack mit<br />
Kulturbeutel, Unterwäsche und Strümpfen stellte er an das Tischbein. Neben ihm saß ein Junge mit<br />
seiner Mutter. Wie man an ihrem Kittel erkennen konnte, arbeitete sie im Supermarkt. Sie sprach mit
,<br />
NORBERT SCHEUER EUROPE NOW<br />
ihm über die anstehenden Abiturprüfungen. Der Junge weckte in Karl Erinnerungen an seine Jugend,<br />
er glaubte, etwas von sich in ihm zu erkennen. Vor dem Supermarkt lag ein großer Parkplatz, auf der<br />
anderen Seite der Bahngleise ragten hinter den Häusern rote Sandsteinfelsen auf, in die sich das he -<br />
rablaufende Regenwasser über die Jahrzehnte kleine Rinnen gegraben hatte. Auf dem Plateau wuchsen<br />
dürre Kiefern. Als Karl auf der Terrasse in der Sonne saß, sah er Hunderte Kraniche nach Westen<br />
fliegen. Er erinnerte sich daran, wie er am frühen Morgen in der Stadt von ihrem Kreischen geweckt<br />
worden war. Der Junge interessierte sich nicht für das, was seine Mutter sagte, er blickte gespannt<br />
zum Himmel und sah den Kranichen nach. Als sie aus seinem Blickfeld verschwanden, nahm er sein<br />
Fahrrad und radelte hinter ihnen her; seine Mutter stand auf, bezahlte und ging wieder zur Arbeit in<br />
den Supermarkt.<br />
Die letzten Kilometer von Schleiden bis zur Grenze war Karl der einzige Fahrgast im Bus. Äcker und<br />
Wiesen erstreckten sich ins Tal und wurden nur von einzelnen Feldgehölzen und Wäldern unterbrochen,<br />
ein Rumpfhochland, das sich aus dem durch Erosion abgetragenen Urgebirge, aus der variszischen<br />
Gebirgsbildungsphase und späterer erneuter Hebung entwickelt hatte. Reste gesprengter Bunkeranlagen.<br />
Aus den Wiesen ragten die Betonzähne einer Panzersperre, die Teil von Hitlers Westwall, einer<br />
Grenzbefestigung, gewesen war. Der Frontverlauf hatte sich in dieser Gegend ständig verändert.<br />
Julia hatte erzählt, die Amerikaner seien schon in ihrem Dorf gewesen, als die Ardennenoffensive los -<br />
brach. Sie erwähnte eine Fotografin, die jedes Jahr einige Wochen bei ihnen gewohnt hatte. Sie sei<br />
viel gewandert, habe abends am Tisch in der Gaststätte gesessen und Julia ihre Fotografien gezeigt.<br />
Jahre nach dem Krieg hatte die Fotografin die alte Dorfschule gekauft und dort gewohnt. Sie hatte<br />
ein Verhältnis mit einem der belgischen Zöllner und dieser Zöllner sei Julias Großvater gewesen. Die<br />
Fotografin hatte den Grenzverlauf aufgenommen, alte Verstecke der jüdischen Flüchtlinge in Erdkellern<br />
und Heuschobern, sie hatte Bauern porträtiert, die ihr erzählten, dass sie noch vor der Besetzung<br />
und der Verschiebung der Grenze nach Eupen Juden nach Brüssel geschleust hatten, von wo sie<br />
nach England, Amerika oder Argentinien emigrierten. Sie hatte das Schmuggeln von Kaffee und Zigaretten<br />
in Beinprothesen dokumentiert. Fotografien von Viehherden, die im Winter durch die Grenzwälder<br />
nach Belgien getrieben wurden, Bilder vom Schneetreiben und von Kranichen, die im Herbst<br />
auf der anderen Seite der Grenze rasteten, um dann zum Überwintern an die Talsperren der Champagne<br />
und weiter nach Andalusien zu ziehen.<br />
In der Gaststätte saßen Waldarbeiter – Kettensägen, Arbeitshandschuhe und Helme lagen auf dem<br />
Boden vor der Theke. Der Gastwirt kam aus der Küche. Er war ungefähr in Karls Alter, einige Zentimeter<br />
kleiner, hatte ein rundes Gesicht, einen Schnauzbart und nur wenige graue, dünne Haare. Karl<br />
wusste nicht, ob Julia mit diesem Mann verheiratet war, wusste nicht, wie er rechtfertigen sollte, dass<br />
er gekommen war. Er fragte nach einem Zimmer. Der Mann nahm einen Schlüssel vom Brett hinter<br />
der Theke, bat Karl, ihm zu folgen, und stieg die knarzenden Treppenstufen hinauf. Die Fotos, die im<br />
Treppenhaus an der Wand hingen, zeigten Grenzhäuschen, von Granaten zerstörte Gebäude und<br />
Wälder, Zöllner, an einem Schlagbaum stehend, amerikanische Soldaten, die auf ihren Panzern posier -<br />
ten und Schokolade an Kinder verteilten. Der Wirt schloss ein Zimmer am Ende des Flurs auf. Der<br />
Raum hatte eine kleine Dachgaube, ein dicht an die Wand gerücktes schmales Bett, ein Sessel stand<br />
an einem kleinen runden Tisch. An der gegenüberliegenden Wand hing ein Waschbecken.<br />
»Toilette und Dusche befinden sich auf dem Flur, den meisten Wanderern genügt das«, erklärte der<br />
Gastwirt. »Wollen Sie auch zu den Kranichen?« Der Wirt erzählte, die Leute kämen zu dieser Jahreszeit,<br />
um die Kraniche an ihrem Rastplatz auf den Feldern hinter der Grenze zu beobachten. Er schwärm -<br />
te von ihrem Aufbruch im Morgengrauen, wie anmutig sie sich im Nebel über den flachen Gewässern<br />
erhöben, um sich über den Birken zu sammeln und Formationen für ihre Reise zu bilden. Nachdem<br />
der Wirt gegangen war, setzte Karl sich auf das Bett. Die Abendsonne schien durch die dünne Gardine<br />
auf den Teppichboden. Er ging zum Fenster und sah über die Felder, die direkt an die Gärten des<br />
Hauses grenzten. Weiter unten im Tal lag ein kleines belgisches Dorf. Die Kraniche waren nicht zu se -<br />
hen, aber er hörte ihre Rufe, einen Wirbel aus seltsamem Schreien und Trompeten. Karl setzte sich<br />
in den Sessel, legte seine Hände auf die Lehne, stand nach einiger Zeit wieder auf, ging zum Bett,<br />
sah in die Schublade der Nachtkommode, in der eine Bibel und ein zerlesener Roman lagen. Er streck -<br />
te sich auf dem Bett aus, blätterte durch die Romanseiten, bis er eine verblasste, sepiafarbene Fo-
,<br />
NORBERT SCHEUER EUROPE NOW<br />
tografie von einer jungen Frau entdeckte, die mit einem Mädchen neben einem Zöllner am Schlagbaum<br />
stand. Die Aufnahme schien am frühen Morgen entstanden zu sein, Nebelschwaden stiegen<br />
aus dem Wald, in den der Weg jenseits des Schlagbaums führte. Im anliegenden Grenzpostenhäuschen<br />
saß ein weiterer Zöllner über einen Schreibtisch gebeugt. Die Personen waren zu weit entfernt,<br />
als dass man ihre Gesichter hätte erkennen können. Karl betrachtete die Fotografie lange, schlief<br />
schließlich darüber ein und wurde von Geräuschen im Nebenzimmer geweckt, jemand ging dort auf<br />
knarrenden Dielen auf und ab, sprach unaufhörlich. Karl überlegte kurz, ob er Sandra anrufen sollte,<br />
sie hatten seit zwei Wochen nicht miteinander gesprochen, hatten abgemacht, sich eine Zeit lang<br />
nicht zu sehen. Sie würde sich über seinen Anruf wundern und Fragen stellen, die er nicht beantwor -<br />
ten wollte. Er stand auf, ging zum Waschbecken, drehte den Hahn auf, hielt seine Hände unter das<br />
kalte Wasser und wusch sein Gesicht, befeuchtete seine Haare, kämmte sie nach hinten, setzte sich<br />
wieder auf das Bett, zog seine Schuhe an. Er nahm den Roman vom Nachttisch, legte die auf den<br />
Boden gefallene Fotografie hinein, steckte das Buch in seine Jackentasche und ging nach unten in<br />
den Gastraum.<br />
An der Theke standen Arbeiter, die ein Haus in der Nähe renovierten, sie sprachen über den Käufer,<br />
einen Holländer, dessen Landsleute alle leer stehenden Häuser in der Gegend aufkauften. An einem<br />
Tisch in der Ecke saß eine Gruppe Wanderer über eine Karte gebeugt, die sie zusammenfalteten, als<br />
das Essen von Julia serviert wurde. Karl bestellte bei ihr ein Bier, ein Schnitzel und einen Salat. Sie<br />
hatte ein schmales, gealtertes Gesicht, lange blonde Haare, die mit einem Haargummi zusammengebunden<br />
waren. Wäre Karl ihr irgendwo in der Stadt begegnet, hätte er sie nicht wiedererkannt, so,<br />
wie sie ihn jetzt nicht erkannte. Julia notierte seine Bestellung auf einem Block, ging zur Theke und<br />
reichte den Zettel in die Küche. Ein Bauer kam in den Gastraum. An der Theke erzählte er von seiner<br />
Kuh, die am Nachmittag von einer Weide ausgebüxt war, in einem Nachbardorf im Fenster einer Terrassentür<br />
ihr Spiegelbild entdeckte, zum Angriff überging, durch das Glas ins Wohnzimmer sprang<br />
und dann verstört im Haus herumlief. Es war schwer, sie zu überwältigen. Sie bekam vom herbeigerufenen<br />
Tierarzt eine Beruhigungsspritze, rannte aus dem Haus auf ein benachbartes Grundstück,<br />
fiel dort ins Gras und schlief ein. Der Bauer nahm sein Handy aus der Hosentasche und zeigte eine<br />
Fotografie von der Kuh im Wohnzimmer. Nach dem Essen las Karl im Roman. Er hatte seit Jahren<br />
keinen Roman mehr gelesen. Die Geschichte spielte im 19. Jahrhundert, in einem Eifeldorf, in dem<br />
ausschließlich Frauen, Kinder und Alte lebten. Die jungen Männer arbeiteten monatelang in den Städten<br />
des Ruhrgebiets und kamen nur zur Erntezeit für einige Wochen nach Hause. Julia zapfte Bier hinter<br />
der Theke. Sie erschien ihm älter, als er sich selbst vorkam. Als Julia an seinen Tisch trat, sagte er, er<br />
gehe spazieren und komme später wieder. Er ließ das Buch auf dem Tisch liegen.<br />
Lastwagen brausten die Straße entlang. Die Tankstelle mit dem Bistro am Ende des Dorfes hatte die<br />
ganze Nacht geöffnet. Im Bistro kaufe Karl einen Kaffee und setzte sich an einen Tisch auf der Veran -<br />
da. Immer noch hörte man leises Kranichrufen, ohne die Tiere in der Dunkelheit sehen zu können. Die<br />
Leute strömten in den Abendstunden in den Supermarkt auf der anderen Straßenseite. Sie tankten,<br />
nachdem sie ihre Einkäufe verstaut hatten, ihre Autos, denn in Grenznähe gab es billigeren Diesel.<br />
Karl fragte sich, ob er hier Arbeit bekommen würde, überlegte, wie lange er täglich in der Tankstelle<br />
oder im Supermarkt arbeiten müsste, um hier leben zu können. Vielleicht könnte er auch den Bauern<br />
bei der Ernte helfen. Er fragte sich, warum er nicht bereits vor dreißig Jahren hierhergekommen war,<br />
damals, als er Julia vermisst hatte. Der Junge, den er in Kall mit dessen Mutter gesehen hatte, kam<br />
mit zwei älteren Männern auf die Veranda und setzte sich mit ihnen an einen Tisch. Der Junge hatte<br />
ein Fernglas um den Hals hängen. Die beiden Männer trugen teure Fotoapparate, die sie behutsam<br />
vor sich auf den Tisch legten. »Über tausend Kraniche habe ich gezählt«, sagte der Junge. »Du müss -<br />
test eigentlich längst schlafen, morgen ist doch deine Prüfung«, sagte einer der Männer. Sie wollten<br />
statt in ihren Betten einige Stunden im Auto schlafen, um in der Nähe der Kraniche zu sein, die sie<br />
im Morgengrauen beobachten und fotografieren wollten. »Mein Enkel schafft das schon, der ist klüger<br />
als die anderen«, sagte der ältere der beiden Männer. »Er ähnelt seinem Großvater, der hat auch<br />
immer alles notiert und keine Fotos gemacht, er meinte, beim Ansehen einer Fotografie würde er<br />
sich weniger an die Dinge erinnern, als wenn er sie niederschriebe.« Es regnete jetzt und der Mann<br />
sagte, die Wolken bildeten sich am Tag über der belgischen Küste, stiegen auf und trieben zur Gren-
,<br />
NORBERT SCHEUER EUROPE NOW<br />
ze, wo sie in der Nacht ankommen und in Eifelgebirgen abregnen würden. Vielleicht machen die Kraniche<br />
deswegen hier Rast. »Und vielleicht auch wegen der Wacholderbeeren, die sie gerne fressen«,<br />
sagte der Junge.<br />
Karl wechselte die Straßenseite. Holzlaster donnerten vorbei, es duftete nach frischem Harz. Er folgte<br />
einem Feldweg, der in einen Fichtenwald führte, zu einer verfallenen Grenzstation, die der auf der<br />
Fotografie glich. Da es nun heftig regnete, hatte Karl die Kapuze seines Parkas in die Stirn gezogen.<br />
Er trat in Pfützen, Wasser sickerte in seine Schuhe. Als er aus dem Wald auf die Hochebene kam,<br />
hatte es aufgehört zu regnen, silbriges Mondlicht schien auf vereinzelte Birken, Ginsterbüsche und<br />
flache Gewässer, in deren Nähe die Kraniche sich gesammelt hatten. Er hörte sie auffliegen und mit<br />
hohen, krächzenden Stimmlauten miteinander kommunizieren. Vielleicht hatten sie ihn bemerkt. Karl<br />
bekam Angst vor den vielen in der Dunkelheit schwirrenden Vögeln.<br />
Er lief zum Gasthof zurück. An der Theke standen Fernfahrer, die im Haus übernachteten. Julia brach -<br />
te ihm Schnaps. Er versuchte, ihre Hand zu berühren, und sagte leise ihren Namen. Das Buch lag<br />
noch auf dem Tisch. Er nahm es und ging nach oben. Im Zimmer zog er seine nassen Kleider aus,<br />
die Strümpfe legte er über den Waschbeckenrand, seine Hose zum Trocknen über die Sessellehne,<br />
dann hockte er sich auf die Bettkante, der Schnaps säuselte in seinem Kopf und wie immer, wenn er<br />
etwas getrunken hatte, sprach er leise mit sich selbst. Schließlich ging er zum Waschbecken, legte<br />
die noch nassen Socken beiseite, wusch sich, putzte seine Zähne und legte sich schlafen. Am frühen<br />
Morgen klopfte es an seine Tür. Er stand auf, stolperte durch den dunklen Raum. Als er die Tür öffne -<br />
te, erlosch das Flurlicht und Julia flüsterte, sie habe nicht früher kommen können. Sie habe gewartet,<br />
bis ihr Mann mit Freunden zum Rastplatz der Vögel gefahren sei. Die Männer beobachteten dort je -<br />
des Jahr, wie die Kraniche mit dem Sonnenaufgang zu Tausenden aufflögen und weiterzögen. Karl<br />
umarmte und küsste Julia. Sie setzten sich auf die Bettkante. Karls Fuß stand auf dem Buch, das er<br />
vor dem Einschlafen auf den Boden gelegt hatte. Er schob es vorsichtig zur Seite, zog Julias Ring<br />
ab und hielt ihn in der Faust. Ein Auto auf dem Parkplatz startete, danach hörten sie wieder das<br />
Schreien der Kraniche.
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
LINDITA ARAPI<br />
EUROPA – IMMER DAS BESSERE ALS WIR<br />
EINE REFLEXION [JUNI 2012]<br />
Es gab eine Zeit, in der Europa wie ein weit entfernter Planet war, vom Schleier des Unerreichbaren<br />
um hüllt, bekannt einfach als eine geografische Angabe auf der Weltkarte. Es war der andere, mit<br />
Menschen bevölkerte Planet, die womöglich wie wir aussahen, sicherlich aber schönere Gestalten,<br />
klügere, vollkommener nach Parfüm riechende Kreaturen und ohne Zweifel bessere Menschen. Das<br />
Wir lebte in einem Open-Air-Gefängnis mit einer Fläche vom 28.748 Quadratmetern. Die Mauer rund -<br />
um hoch, den Rest der Welt sahen wir nur als Himmel. Wir starrten keine Löcher, wir malten in den<br />
Himmel unseren Traum von Europa. Harmlos, wie ein menschlicher Traum im Grunde ist, würdig, solange<br />
er keine Träumerei wurde.<br />
Das Wir waren die Albaner, die mit dem Rest des Kontinents etwas gemeinsam hatten, die Vorstellung<br />
des anderen Planeten voneinander. Nachdem die Mauern um uns gefallen waren, wurde dieser Traum<br />
in einem Satz laut ausgerufen: »Wir wollen Albanien wie Europa.«<br />
Wie ein Europäer aussah, konnten wir nicht wissen. Auch heute noch weiß man nicht, wie er aussieht.<br />
Wir erträumten ihn nur, tun es heute noch, das Ideal des Europäers und des Europa, das immer<br />
noch nicht eine Realität ist: Ein freier Mensch, der nicht nur frei reist, sondern von den Schranken<br />
der Unmündigkeit befreit ist, selbstverständlich ein Demokrat, zivilisiert, willensfrei und urteilsfähig.<br />
Ein kritisch hinterfragender Bürger. Er ist ein Optimist, weil sein Europa ihm Chancengleichheit sichert.<br />
Der erträumte Europäer ist tolerant – und das ist nicht eine Überlegenheitsgeste gegenüber Flüchtlingen<br />
und Schwächeren, sondern seine Überzeugung. Weil er selbst viele Möglichkeiten hat, schließt<br />
er sie nicht für andere aus. Der Europäer ist nicht ausländerfeindlich, weil seine Wurzeln vielfältig<br />
und breit sind. Er ist Christ, aber warum soll er auch nicht Muslim sein? Ihm schmeckt das Leben<br />
wie einem Franzosen und er kann ernsthaft wie ein Deutscher arbeiten, aber warum soll er nicht wie<br />
ein Italiener fühlen und wie ein Grieche feiern? Er kann viele Sprachen sprechen, dennoch haben sie<br />
alle einen Klang, europäisch. Er kann in Amsterdam, Stockholm, Lissabon, München, Warschau und<br />
überall leben, weil seine Heimat Europa ist und nicht die Europäische Union. Wenn es in seinem Eu -<br />
ropa turbulent zugeht, dann geht es ihm nicht gut. So viel zum Traum!<br />
Als der Moment kam und der Planet Europa erreichbar wurde, wollten wir, die Albaner, es sehen, sei -<br />
ne mächtigen Länder, die über unser Schicksal entschieden haben, besuchen. Wir wollten seine berühmten<br />
Städte berühren, seine Menschen kennenlernen, egal wie, ohne zu merken, dass man nicht<br />
sehr willkommen war. Der Drang war so stark, dass manche Schiffe Richtung Europa enterten, manche<br />
überquerten das Meer mit Booten, andere durch falsche Pässe und wiederum andere bezahlten<br />
den Traum mit ihrem Leben. Nur wenige waren die Glücklichen, die ganz normal an den Toren Euro -<br />
pas klopften, von einem Polizisten gemustert wurden, bevor man mit einem Nicken die Tore öffnete.<br />
Danach wurden die Tore wieder geschlossen. Europa war und blieb ein Traum für zwanzig Jahre.<br />
Die europäische Luft wollten wir einatmen, als wäre sie die bessere Luft, die die Gesichter verändern<br />
und uns zu anderen Menschen machen konnte, mit mehr Wohlwollen von Europa akzeptiert zu werden.<br />
Ein Albaner mit europäischem Gesicht hieß, eine Stufe höher auf dem Weg der Zivilisierung zu<br />
kommen, verglichen mit einem, dessen Gesicht Furchen der fast fünfzig Jahre Armut und Minderwer -<br />
tigkeit trug. Ja, wir wollten angenommen werden. Wir wollten dazugehören und nicht mehr die Aussätzigen<br />
am letzten Winkel sein.<br />
Europa war und ist eine nationale Sehnsucht! Geografisch lagen wir unmissverständlich im gelobten<br />
Land, umgeben waren wir auch von europäischen Nachbarn, dennoch fragten und fragen wir uns<br />
selbst ständig wie kein anderes Nachbarvolk: Sind wir Europäer oder Halbeuropäer und Halborientalen?<br />
Sind wir vielleicht Orientalen? Sind wir genug europäisch? Sollten wir uns noch mehr europä -<br />
ische Eigenschaften aneignen?<br />
Die Unsicherheit resultiert in zwei Arten von Antworten: Die eine ist eine mythische, gern übersteigert,<br />
um das Selbstwertgefühl zu stärken. Diese Antwort erlaubt nicht gern kritische Hinterfragungen nach<br />
dem albanischen Selbstverständnis, weil die Fragen sich gar nicht stellen. Weil wir ja Europa waren,<br />
als es Europa noch nicht gab. Wir sind ein altes, zivilisiertes Volk, Pelasger, Illyrer, wir verkehrten mit<br />
den Römern und haben Europa im Mittelalter den christlichen Kämpfer Skanderbeg gegeben, der die<br />
osmanische Invasion Richtung Europa aufgehalten hat. Somit sind wir Märtyrer Europas. Zwar haben<br />
wir muslimisches Erbe in unserer Kultur, unsere Identität ist dennoch europäisch geprägt. Das Erbe<br />
der Diktatur schütteln wir schnell ab von uns, damit wir ungehindert zu reinen Demokraten wachsen.
,<br />
LINDITA ARAPI EUROPE NOW<br />
Europa hat sogar eine Mitschuld an unserem Zustand. Es hat uns 500 Jahre lang vergessen, dazu<br />
rechnet man die fünfzig Jahre kommunistische Herrschaft. Nun hat es das Tor für drei Monate ohne<br />
Visum geöffnet, danach müssen wir wieder draußen warten. Wie lange dauert es noch, bis Europa<br />
uns, die ältesten europäisch Verwurzelten, annimmt?<br />
Die andere Begegnung mit dem Europäischen wird nicht so oft gehört, und mehr als eine Antwort<br />
sind es kritische Fragen, oft als eine Haltung derer kritisiert, die das Land schlechtmachen wollen:<br />
Wir sind zwar ein altes, zivilisiertes Volk, aber was hat das bei den heutigen EU-Integrationsanforderungen<br />
zu sagen? Wir sind zwar in Europa, haben aber die europäischen Entwicklungen der drei letz -<br />
ten Jahrhunderte nicht mitverfolgen können. Die Aufklärung konnte in unserer Kultur nicht wirken. All<br />
das, was im fernen Europa geschah, war nur bruchstückhaft angekommen. Wir waren lange von Eu -<br />
ropa getrennt durch die Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich und haben uns viel mehr die Bakschischkultur<br />
angewöhnt, als uns lieb ist.<br />
Wir haben uns noch einmal, wegen der kommunistischen Diktatur, von Europa getrennt und haben<br />
viel zu lange geübt, den Andersdenkenden zu beseitigen. Wir kannten die Diktatur des Proletariats<br />
und die Demokratie existierte nur als Wort im Wörterbuch, deshalb haben wir es nicht leicht, den Dia -<br />
log zu finden und den politischen Gegner zu respektieren. Wir haben zwar die Diktatur hinter uns ge -<br />
lassen, aber sie nicht aufgearbeitet. Schließlich müssen wir das Lehrbuch »Europa für Albaner« weiter<br />
studieren und dann die Prüfungen bestehen. So lange dauert es noch, bis Europa uns annimmt.
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
MARKO POGAČAR<br />
ALS ICH STERNE AUS DER NÄHE SAH ODER:<br />
INTEGRATION IN VIER PUNKTEN<br />
Beitrittskapitel eins<br />
Es war Ende der neunziger Jahre, die Panzerspuren der vierten Brigade, die die guten und schlechten<br />
Jungs der Militäroperation Sturm nach Hause brachte, waren schon etwas verwischt, die Geräusche<br />
der Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher und Stereoanlagen der falschen Nationalität,<br />
die ihnen noch monatelang auf überladenen Lkw-Anhängern und Traktoren folgten, waren bis zur Hör -<br />
barkeitsschwelle verklungen und mir ging das alles am Arsch vorbei. Ich war genau halb so alt wie<br />
jetzt und irgendwie nicht richtig integriert. Die Typen aus dem Gymnasium waren damals auf drei<br />
Sachen scharf: Fußballklub Hajduk, Kroatien und Oasis. Der Mechanismus nicht kompliziert. Auf<br />
Hajduk fuhren dort, seit man denken kann, mehr oder weniger alle ab und es gab sogar mal eine Zeit,<br />
als das sinnvoll war. Bevor er ein drittklassiger Provinzfußballklub geworden war und seine Anhänger<br />
eine Bande kahl geschorener Faschisten, konnte dieses Team auf europäischen Cups abräumen: 1944<br />
gewannen sie noch als Mannschaft der Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens, in Split besiegten sie<br />
die unerreichte britische Mannschaft. Ich hatte zwei linke Beine und keine Lust, im Tor zu stehen, in<br />
Stadions zu gehen oder überhaupt etwas in Verbindung mit Fußball zu tun.<br />
Auch Kroatien geriet in diesen Jahren unweigerlich in den Mittelpunkt, noch viel mehr als jetzt. Es<br />
stimmt zwar, dass wir ein schlechtes Leben hatten, in dieser erbärmlichen turbo-katholischen, nationalistischen<br />
Autokratie, aber, hey, wir hatten unseren Staat! Weder damals noch heute begriff ich, wel -<br />
chen Wert ein Staat an sich haben soll, also ging mir auch das am Arsch vorbei. Das kommt möglicherweise<br />
daher, dass ich das ungetaufte Kind eines slowenischen Jugo-Offiziers bin, der sich bei<br />
Kriegsbeginn in seine Republik absetzte und einer kroatischen Postbeamtin, die geblieben ist; und<br />
solche, das weiß man ja, waren immer die Feinde, sie waren vielmehr die Verräter Unserer Sache. Wenn<br />
ich es recht bedenke – ich hatte noch Glück gehabt.<br />
Das hatte alles eine wirtschaftliche und politische Grundlage, es ist die Folge von ein paar hässlichen<br />
Ideen und dumpfen Menschen; und Oasis? Tja, das werde ich wohl nie verstehen. Die Chronologie<br />
ist jedenfalls offensichtlich: Ein paar Jahre zuvor konnten wir zum ersten Mal MTV-Signale empfangen<br />
[man sagte, nicht ganz zu Unrecht, die Satellitenschüsseln hätten die UdSSR gestürzt] und die<br />
Hyperinflation der Spektakel, denen wir tagtäglich ausgesetzt waren, erhielt endlich auch ihre popkulturelle<br />
Gestalt. Also, im Rahmen, oder besser im Kern, einer ähnlich geschaffenen großen Geschichte<br />
– jener damals absolut dominanten Geschichte der Reintegration und Homogenisierung der »kro -<br />
atischen nationalen Identität und ihres Wesens«, dieses sehr unklaren, aber allgegenwärtigen Spros ses<br />
unserer jahrhundertelang ersehnten Eigenständigkeit – ereignete sich meine erste wichtige Integrationserfahrung.<br />
Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. An der Hosentasche meiner Armee-Cargohose trug<br />
ich einen Cripple-Bastards-Anstecker, auf dem T-Shirt die Aufschrift »Mirjana liebt nur echten Ärger<br />
und Punk«. Der General war gerade erst abgekratzt. Die mit Gesichtern und Slogans übermalten Wän -<br />
de waren mit den eigenen Gesichtern retuschiert und eine Nation verliebter Politiker stand vor den<br />
Wahlen. In manche Viertel konnte man nicht einfach so gehen; früher oder später geriet man an Skin -<br />
headgruppen und Fußballfans, die einem im kurzen Prozess die Haut in den Nationalfarben gerbten.<br />
Wir blieben deshalb im Rudel, bis nur wir zwei übrig blieben. Wir, ein glänzendes Tandem, entdeckten<br />
an einer Wand ein kroatisches Wappen und machten uns mit Händen und Füßen daran zu schaffen,<br />
weil wir von diesem Wappen [nonstop] die Nase voll hatten, wir wollten es von dieser Wand reißen<br />
und dieses Abreißen dauerte, es ging nicht, denn das Wappen war schwer und hing fest; und<br />
dann legte sich plötzlich über alles Finsternis.<br />
Und ich sah am blauen Himmel alle Sterne, hauptsächlich gelbe, doch irgendwie merkwürdig verstreut,<br />
und ich integrierte mich sofort in den Boden. Der dreitürige Schrank, der uns am Genick hielt<br />
und mit uns auf den Asphalt schlug, öffnete mein erstes Beitrittskapitel: Es zeigte sich, dass das Wap -<br />
pen im Eingang der Polizeistation in der Petrinska-Straße gestanden hatte, und in dieser Nacht lernte<br />
ich hinter verschlossenen Türen alles, was ich über meine bis dahin klug verborgene Eigenständigkeit<br />
wissen musste. Und die nationale Integration war, das war klar, sine qua non: der erste Schritt in<br />
Richtung Europa.
,<br />
MARKO POGAČAR EUROPE NOW<br />
Beitrittskapitel zwei<br />
Wenn sich meine erste, protoeuropäische Integration im verfaulten Herzen des jahrhundertealten<br />
Schutzwalls des Christentums abspielte, dann ereignete sich die zweite, wenn auch ihrer Absicht nach<br />
viel europäischere, in ihrem scheinbaren völligen Gegensatz am geografischen und politischen Rand<br />
Europas, im ausgeschlossenen Istanbul am Bosporus. Ich kam dort als junger Student an, zur Silves -<br />
terfeier, mit meiner Freundin und Freunden, nach fünfunddreißigstündigem Geholper im Bus einer Fe -<br />
rienorganisation. Istanbul ist im Winter verführerisch; Istanbul am Morgen, Istanbul in der Nacht, es<br />
stinkt nach Brausegetränk, Fisch und Rauch, es webt einen dichten Lichtgobelin, der sich wie ein rie -<br />
siges Delta in die kluge Finsternis Asiens gießt; eine Stadt, deren Körper jeden Augenblick Gramm<br />
für Gramm Seelen ausatmen, Tonnen für Tonnen Scheiße ins Meer ablassen. So ein Istanbul; ein nack -<br />
tes und wildes Phantasma, das Taksim Square in der Neujahrsnacht.<br />
Diese glänzende Discokugel verstreute sich in Nebenstraßen, die Lautsprecher krächzten und klapperten,<br />
wir waren zu fünft und blieben zusammen. Plötzlich schrien die Mädchen, das Gedränge<br />
war unerträglich, es trug uns fort und wir sahen die Quellen des Geschreis nicht mehr; wo noch vor<br />
einem Augenblick ihre Köpfe ragten, war ein Bündel Männer zusammengekommen, das von Sekunde<br />
zu Sekunde größer wurde. Wir kehrten zu den Stimmen zurück, schlugen uns nach hinten durch –<br />
eine lag schon am Boden, an der anderen zogen und zerrten fünfzehn Typen. Wir schoben die Menschen<br />
zur Seite, stießen und schlugen, wo es nötig war, bis wir sie endlich befreit und in eine Neben -<br />
straße gezogen hatten. Sie waren regelrecht abgetatscht worden, brannten vor Wut und befanden<br />
sich in einem leichten Schockzustand, doch die Nacht lebte weiter; sie pulsierte und floss in den<br />
Morgen, pulsierte mit den betrunkenen Zellen und löschte in ihrem Strom Erinnerungen aus, sie vertrieb<br />
den Schatten eines ganzen Jahres.<br />
Am Abend des darauffolgenden Tages kehrten wir in unsere Herberge zurück, dort wurde ein Film ge -<br />
dreht. Fünf oder sechs Reportagewagen standen vor dem Eingang, ein Haufen Scheinwerfer und<br />
Technik. Es stellte sich jedoch heraus, dass es um eine Reality-Show ging und die europäischen Stars<br />
darin waren wir. Den Vorfall, den wir fast vergessen hätten, haben TV-Kameras gefilmt – Journalisten<br />
haben uns gefunden und versteckt an der Rezeption gewartet. Wir gaben für die Hauptnachrichten<br />
Interviews, für ein paar Boulevardsendungen, mitsamt Beitrag zu Imkerei und Jagd, und für alle wich -<br />
tigen Zeitungen: Am nächsten Tag war es in der Fünfzehnmillionenstadt unmöglich, hundert Meter zu<br />
gehen, ohne dass man von jemandem aufgehalten wurde, ohne dass sich jemand im Namen des gan -<br />
zen türkischen Volkes entschuldigte, dass die Kurden für alles beschuldigt wurden, dass sie einem<br />
warme Brezeln in die Hand drückten und Ähnliches. Mein Gesicht – in Großaufnahme sah es wie<br />
eine ganz anständige Schlägerei aus – landete durch Zufall auf den Titelseiten der auflagenstärksten<br />
Tageszeitungen.<br />
Moment mal, wer spinnt hier?, fragte ich den ältlichen Berichterstatter, ein erfahrenes Ass in Fischer -<br />
weste. Wer hatte Interesse an der Fabrizierung eines Ereignisses, in das man uns absichtlich verwikkelt<br />
hatte? Wer wurde instrumentalisiert und wozu? Ein Land mit so vielen schlimmen, insbesondere<br />
innenpolitischen Problemen müsste ganz andere brennende Themen haben als ...<br />
Der Fischerwestenmensch musterte mich von Kopf bis Fuß, zündete sich eine Zigarette an und sag -<br />
te eiskalt, als würden den ganzen Tag lang vom Himmel gesandte Karpfen anbeißen: Integration. Europäische<br />
Integration. Wegen der großen proeuropäischen Kampagne in der Türkei haben sie die Ge -<br />
legenheit genutzt, die Botschaft zu senden, dass Studenten aus den europäischen Ländern solche<br />
Sachen mitten in Istanbul nicht passieren dürften, und wenn sie dennoch passierten, dann stießen<br />
sie auf einstimmige Verurteilung. Wenn ihr nicht aus der Europäischen Union wärt, würde kein Hahn<br />
nach euch krähen, fuhr der Fischerwestenmensch fort und blies Rauch aus. Und ich brachte es einfach<br />
nicht übers Herz, ihn zu enttäuschen, seine Geschichte zu verderben, zu sagen: Ju nou, ajm<br />
from d Balkans ...<br />
So wurde ich zum zweiten Mal, gegen meinen Willen, am Genick gepackt und in die Sterne gestoßen.
,<br />
MARKO POGAČAR EUROPE NOW<br />
Kapitel drei<br />
Mit der Aneinanderreihung für mich bedeutender eurointegrativer Augenblicke fahre ich weiter innen<br />
im Kontinent fort, auf süßem Wasser.<br />
Sei präziser; wo war das genau? In Polen, weit im Nordwesten, bei Bydgoszcz. Was wolltest du dort?<br />
Ich habe an einem Lyrikfestival teilgenommen, ich wollte nichts. Wie bist du dorthin gekommen? Ich<br />
wurde in einem Auto hingefahren. Aus Berlin hat mich ein Freund mitgenommen, ein Pole, der die<br />
Spra che kennt und die Straßen. Auf dem Weg fuhren wir durch den Ort Bagdad. Welche Marke hat -<br />
te das Auto? Ich weiß nicht. Was ist mit dieser Dichtung? Handelte es sich um Chiffren? Ja und nein.<br />
Es gab alle Arten von Dichtung, wie das bei Lyrikfestivals so ist. Die schlechte war wirklich schlecht.<br />
Gab es Eskalationen in dieser Hinsicht? Nein, dafür sind wir zu gut erzogen. Noch immer engt uns<br />
der warme Pullunder des Kleinbürgertums ein. Das ist unsere Rettung. Gab es in anderen Fragen ei -<br />
ne Eskalation? Ist das eine Fangfrage? In Ordnung, sind die Polen große Katholiken? Die Polen sind<br />
sehr große Katholiken. Was muss jeder anständige polnische Ort außer einer Kirche, einem Feuerwehrheim<br />
und einer Kneipe haben? Ein Haus des Heiligen Vaters Johannes Paul II. Kann man das<br />
auf dein Land übertragen? Ja, bis auf das erwähnte Haus. Bei uns hängt der Papst an einem Ehrenplatz<br />
zwischen dem Staatswappen und dem Logo des Sponsorenbieres. Außerdem ist kaum etwas<br />
in diesem Land mein. Was mögen Polen in kleinen Orten überhaupt nicht? Sie mögen es nicht, wenn<br />
man den Papst bei seinem Vornamen nennt. Wojtyła hören sie nicht gern. Was ist deine Meinung?<br />
Ich denke, dass der Besagte ein gefährlicher Krimineller ist, so wie hauptsächlich alle seine Vorgänger,<br />
zusammen mit der dazugehörenden Firma. Was mögen Polen in kleinen Orten sonst noch nicht?<br />
Sie mögen es nicht, wenn sie dich bei einer Unterhaltung mit Serben und Muslimen ertappen. Denn<br />
wir Kroaten sind okay, Brüder, aber diese Muslime, diese Orthodoxen, Russen, wir haben doch gegeneinander<br />
Krieg geführt – wie können wir jetzt am selben Tisch sitzen? Was mögen sie noch nicht?<br />
Slowenen, die fließend Polnisch sprechen. Übersetzer. Erklär mir das. Željko sprach ein viel zu fließendes<br />
Polnisch. In der Bar, beim Abschluss des Lyrikfestivals. Der mit der verdächtigen Dichtung?<br />
Ja, aber jedes Festival ist so. Was ist weiter passiert? Nach ein paar Pils haben sie es ihm nicht mehr<br />
abgenommen, dass er kein Pole ist. Sie verlangten, dass er mit der Provokation aufhören solle. Dass<br />
er seine Papiere zeigen solle. Und dann? Er hat sich geweigert, seine Papiere zu zeigen, er hatte sie<br />
sowieso nicht bei sich. Und? Sie verlangten, dass er in ihrer Begleitung ins Hotel gehe und ihnen<br />
seine Papiere zeige. Er sollte beweisen, dass er kein Pole war. Oder dass er sofort mit der Provokation<br />
aufhören solle. Aufhören und sich entschuldigen. Und dann? Er hat sich nicht entschuldigt. Er ist<br />
aufgestanden und hat eine Fortsetzung des Gesprächs abgelehnt. Und sie? Sie haben ihn bedrängt,<br />
ihn geohrfeigt und am Kragen gezerrt. Und du? Ich habe ihn unter die Arme gefasst, gehalten, um<br />
eine allgemeine Scheiße abzuwenden. Und sie? Während ich ihn hielt, hat ihn einer mit dem Bein in<br />
das Gesicht geschlagen, mit einem high kick. Was ist danach geschehen? Allgemeine Kacke. Eine<br />
Massenschlägerei zum Abschluss des Lyrikfestivals, weshalb ich mich mit wer weiß wem integriert<br />
habe, denn die Beleuchtung war schlecht. In der Dunkelheit sehen alle Entitäten gleich aus, wenn<br />
sie zusammenstoßen. Wie endete es? Nach der allgemeinen und außerordentlich erfolgreichen Integration<br />
erwischte ich in Bydgoszcz den Zug nach Berlin und schlief im selben Moment ein.<br />
Beitrittskapitel vier, vorerst das letzte<br />
Diese Liste wichtiger Integrationen ist natürlich willkürlich und könnte anders aussehen. Sie folgt vor -<br />
läufig einer vorgezeichnete Richtung – dem feuchten Traum eines jeden nicht integrierten Europäers:<br />
von der Peripherie bis zum Zentrum. Die europäischen Sterne überschütteten mich beim vierten Mal<br />
näher an der Wolkenmitte, dieses Mal integrierte ich mich vertikal. Und wieder hat meine mit beiden<br />
Armen angenommene Integration [wegen spezifischer Umstände konnte ich sie nämlich nicht anders<br />
annehmen] einen vollkommen vorhersehbaren Katalysator und eine Handlungsrichtung: Sie kam erzwungen,<br />
von oben herab, seitens Ordnung und Gesetz.<br />
Ich ging wieder auf Dichterreise, nach Kopenhagen, genauer – ich kam von dort zurück. Alles war in<br />
bester Ordnung: Ich ging entspannt in der Stadt spazieren, mit dem Fahrrad fuhr ich kreuz und quer
,<br />
MARKO POGAČAR EUROPE NOW<br />
durch Nørrebro, feierte in speziellen Wohnungen »für Unterhaltung und Entspannung«, die jedes neue -<br />
re Gebäude in Vesterbro hatte, las [Nekropoetik!] an den Gräbern von H. C. Andersen und Kierkegaard,<br />
lungerte tagelang in Christiania herum und was nicht alles. Seit Anfang der siebziger Jahre beheima -<br />
tet diese halbextraterritoriale Oase eine lebendige Bildwirkerei nicht integrierter Typen – von alt gewordenen<br />
Hippies, Punks und delogierten Hausbesetzern, über nonstop zugekiffte Rastas und nur<br />
nonstop Zugekiffte bis zu militanten Veganern, Fruktariern und verschiedenen Aktivisten für alles, was<br />
Schatten warf. Doch sobald man Christiania verließ [Schilder verrieten ordentlich, dass man sich wie -<br />
der auf dem Gebiet der Union befand], war man wieder im Herzen Europas – in jenem feuchten<br />
Traum – und aus dem Traum musste man irgendwie nach Hause finden.<br />
Dieser Prozess wird gewöhnlich als Aufwachen bezeichnet; Transtormer sagt: Aufwachen ist ein Fallschirmsprung<br />
aus dem Traum. So fand ich mich vom Bett auf dem Flughafen wieder. Und auf dem<br />
Flughafen tat ich ein, zwei Stunden lang Dinge, die man an Flughäfen gewöhnlich tut – hauptsächlich<br />
nichts. Und dann näherte ich mich, gestärkt vom Traum, dem Riesenvogel: Ich nahm alles Metallische<br />
aus den Taschen, legte das Laptop in die Kunststoffwanne und ging wie eine Million Mal bisher auch<br />
ganz ruhig durch den Metalldetektor. Und dann riefen sie mich zurück und fragten, ob meine Tasche<br />
wirklich meine sei. Ich sagte: So richtig wirklich. Und sie fragten, ob es eine Möglichkeit gebe, dass<br />
jemand etwas hineingetan habe. Ich sagte, es bestehe überhaupt keine Möglichkeit. Und dann fragten<br />
sie, ob mir bewusst sei, dass ich Waffen bei mir hätte, und ich starrte sie an. Und dann fiel es<br />
mir ein und ich lachte und ich griff in die Seitentasche, um das Schweizermesser herauszuholen, das<br />
ich sonst zum Flaschenöffnen und Zahnstochern benutze, ich hatte es im Handgepäck vergessen,<br />
dann gingen zwei zweitürige Polizisten auf mich los, drängten mich mit aller Kraft gegen die Wand,<br />
in die ich meine Nägel bohrte, und es wurde plötzlich dunkel; eine warme Dunkelheit, in der wie eine<br />
vollkommene Aureole lebendige gelbe Sterne blinkten.<br />
Sobald ich zu mir kam, fragten sie. Wo haben Sie die Waffe her?, fragten sie. Was hatten Sie mit der<br />
Waffe vor?, fragten sie. Kennen Sie jemanden auf dieser Liste?, fragten sie; wissen Sie, dass es in<br />
Dänemark ...<br />
Und ich wusste zum ersten Mal. Alles war mir endlich klar, doch ich war zu aufgeregt, um mitzuarbei -<br />
ten. Ich lächelte geheimnisvoll, was meine Wohltäter noch mehr aus der Bahn warf. Ich wollte nicht<br />
abfliegen. Ich dachte: Das ist Schicksal! Ich wollte alt werden und sterben in dem Land, in dem ein<br />
Korkenzieher eine Waffe war, dafür war ich bereit zu kämpfen. Ich schwieg weiterhin wie ein Grab,<br />
bis sie mich mit fiesen Fragen herumkriegten. Mir rutschte heraus, dass ich als Schriftsteller in Däne -<br />
mark war. Was für ein Schriftsteller?, fragten sie. Dichter, sagte ich kaum hörbar. Dichter – ach, zum<br />
Teufel mit dem, sagten sie und wiesen mit dem Bein zum Ausgang und ich lächelte immer noch se -<br />
lig. Es gab keine Literatur mehr, um mich freizukaufen. Doch die Sternchen, die ich sah, waren dieses<br />
Mal hundert Prozent europäisch und endlich konnte ich aufatmen. Ich, integriert.<br />
[Übersetzt aus dem Kroatischen von Blažena Radas]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
MATTHEW SWEENEY<br />
EWIGKEITSSTRAND / DER LETZTE SOMMER-<br />
TAG / DIE LANGSAME GESCHICHTE VOM NEIN<br />
EWIGKEITSSTRAND<br />
Ich stehe am Ballyliffin-Strand,<br />
dem bekannten Ende des Universums,<br />
bewundere das seltsame Licht,<br />
gefiltert durch eine rosa Wolkenbank,<br />
die sicher in der Hölle<br />
entstand, am andern Ende der Ewigkeit.<br />
Ich verstehe, was es heißt, Ewigkeit,<br />
wenn ich runterkomme, an diesen Strand,<br />
um über ein Meer zu blicken, das die Hölle<br />
nicht unterbringt in ihrem Universum –<br />
das sich gegen eine Sandbank<br />
schleudert, damit es entsteht, das kuriose Licht.<br />
Maler reisen an wegen des Lichts.<br />
Sie kommen seit einer Ewigkeit –<br />
und deponieren ihre Arbeit auf der Bank,<br />
unzählige Porträts vom Strand,<br />
manchmal porträtiert wie eine Hölle<br />
aus allen Gelbtönen im Universum,<br />
mit allen Blaus des Universums<br />
da oben hingeschmiert, und jenes Licht<br />
strömt aus für alle Ewigkeit,<br />
sickert sogar hinunter in die Hölle.<br />
Ah, wie viel Glück hat doch die Bank,<br />
sie hat diese Meisterstücke von Strand,<br />
diese Visionen eines perfekt gebogenen Strands,<br />
er trage in sich das Universum<br />
[ein Zitat des Managers dieser Bank] –<br />
und reflektiert und filtert das Sonnenlicht,<br />
suggeriert bisweilen eine Hitze, nach der die Hölle<br />
trachtete, bis in alle Ewigkeit.<br />
Nein, es gibt kein anderes Symbol für Ewigkeit<br />
als diesen umwerfenden Bogen von Strand,<br />
keinen anderen Schnappschuss der Hölle<br />
irgendwo im bekannten Universum,<br />
ungeachtet all seiner Quellen von Licht –<br />
und dies ist wohlbekannt in der Bank.<br />
Sie nennen ihn Ewigkeitsstrand.<br />
Sie sagen, er zeige die Hölle im Universum.<br />
Sie behaupten, sie seien die Bank des Lichts.
,<br />
MATTHEW SWEENEY EUROPE NOW<br />
DER LETZTE SOMMERTAG<br />
Sie erhängten die Katze im Morgengrauen am letzten Sommertag.<br />
Sie skandierten ein Totenlied, als sie aufhörte zu treten,<br />
dann schleuderten alle zusammen ihre Flaschen in den See.<br />
Miko hielt eine Hand hoch, zerfetzt von den Katzenklauen,<br />
als wär sie eine Trophäe. Sie knipsten sie mit den Handys,<br />
nur er durfte den Leichnam, den schwingenden, schlagen.<br />
»Was jetzt?«, schrie Heike. »Der Tag ist noch jung.<br />
Morgen verstreuen wir uns in diesem großartig riesigen Land.<br />
Dieser Tagesbeginn soll unsere Winterabende erheitern.«<br />
»Einverstanden«, sagten die riesigen Zwillinge, »bringen wir einen um.«<br />
Eine Lachsalve schüttelte die baumelnde Katze,<br />
als ein ältlicher Jogger in rotem Anzug in Sicht kam.
,<br />
MATTHEW SWEENEY EUROPE NOW<br />
DIE LANGSAME GESCHICHTE VOM NEIN<br />
Sing uns eine Zigeunerweise,<br />
lass das Akkordeon spielen<br />
und der Tuica soll fließen,<br />
wir stimmen, wenn du willst, mit ein,<br />
das Lied erfinden wir dabei,<br />
aber wir folgen dir, wenn du dann<br />
mit einem karpatischen Heuler<br />
die langsame Geschichte erzählst vom Nein –<br />
kein Mercedes auf dem Gras,<br />
kein schnauzbärtiger Mann,<br />
der sich für das Säubern bedankt,<br />
gleich bei der Sammelbox für Glas.<br />
Nein, das geschah organisch dort,<br />
wie eine Mäuseleiche rottet.<br />
Keine großen Komplotte.<br />
Die Räder rollten fort.<br />
Türen und Fenster gingen,<br />
die Ledersitze flogen<br />
über den Tau am Morgen.<br />
Keine Schaulustigen gafften.<br />
Der Motor, der pochte<br />
und riss sich nach oben,<br />
wie ein Raumschiff flog er<br />
in eine weitere Woche.<br />
Lass den Wind blasen<br />
durch das Chassis, das musste bleiben,<br />
lass Kinder darauf steigen,<br />
während alte Männer klagten,<br />
und kein dürres graues Pferd<br />
mampfte Gras, bis<br />
sein Anhänger gefüllt ist –<br />
mit natürlich nichts,<br />
und kein Mercedes auf dem Gras,<br />
die langsame Geschichte vom Nein.<br />
[Übersetzt aus dem Englischen von Dörte Eliass]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
MICHAIL SCHISCHKIN<br />
TOK-TOK, WER WOHNT IM TEREMOK?<br />
Jeder Russe kennt seit Kindertagen das Märchen vom »Teremok«, vom Häuschen im Wald. Es ist ein<br />
kleines, behagliches Häuschen, in dem die Tiere wohnen. Da kommt zum Beispiel der Frosch Quak,<br />
klopft an die Tür und spricht: »Tok-tok! Wer wohnt im Teremok? Lasst mich ein und bei euch wohnen!«<br />
Man lässt ihn ein und alle haben es drinnen gemütlich. Ebenso werden die Haselmaus und der Hahn<br />
Kikeriki eingelassen – für alle ist im Häuschen Platz. Dann kommt der Bär. Wie das Märchen endet,<br />
erzähle ich später.<br />
Europa erinnert sehr an dieses Tierhäuschen. Es ist gemütlich und nett, alle möchten hinein. Es geht<br />
zwar eng zu, aber politisch korrekt. Man zankt sich gelegentlich mit den Nachbarn um die Schulden,<br />
aber was sich liebt, das neckt sich eben. Denn die europäischen Tiere wissen genau: Die Deutschen<br />
haben viel Geld, es reicht für alle. Kurzum, im Häuschen sind alle miteinander vertraut. Aber ist es<br />
auch der Bär? Man lebt schließlich im selben Wald … Doch dieser Bär hat eine rätselhafte Seele.<br />
Man weiß nicht, was er ausheckt. Und wie er riecht …<br />
Mischka, den Bären, quälen sein Leben lang Zweifel: Ist er nun Europäer oder doch keiner? Der Wald<br />
ist natürlich derselbe, aber der Bär geht einen Sonderweg. Er ist irgendwie seltsam – kein Tier, eher<br />
Hamlet. Mal zermalmt und frisst er alle um sich herum, dann wieder fällt er in tiefen Schlaf und quält<br />
sich mit Reue und Grübelei. Und will mit aller Macht die Welt retten. Im Schlafen wie im Wachen<br />
dünkt ihn, seine Höhle sei das Dritte Rom, multipliziert mit der Dritten Internationalen. Er dichtet:<br />
»Alle wissen, dass die Erde am Kreml beginnt.« Und leidet ohne Ende: Mal hat er Sodbrennen vom<br />
Größenwahn, mal Verdauungsstörungen vom Minderwertigkeitskomplex.<br />
Nach den Tataren war Europa der Feind Nummer eins für Russland.<br />
Peter der Große hatte keineswegs vor, das Reich im Hinterland des Kontinents zu »europäisieren«. Er<br />
brauchte die westliche Militärtechnik, um mit ebendiesem Westen Krieg zu führen. Doch mit dem Zu -<br />
strom der »Gastarbeiter« vom Rhein an Newa und Moskwa begann notgedrungen die Wertediffusion.<br />
Unter den Block des totalitären russischen Bewusstseins wurde eine Zeitbombe gelegt – das Primat<br />
der Werte des Privatlebens.<br />
Das nichttotalitäre Bewusstsein findet seinen Ausdruck in der Literatur, die im 18. Jahrhundert zusam -<br />
men mit der Idee der Menschenwürde aus dem Westen kommt. Das erste Jahrhundert der russischen<br />
Literatur ist im Grunde von Übersetzungen und Nachahmungen bestimmt. Um das individuelle Bewusstsein<br />
auszudrücken, fehlt das verbale Instrumentarium. Man muss es erst erzeugen. Die in die<br />
russische Sprache hineingeborenen Schriftsteller führen die fehlenden Begriffe ein: Gesellschaft, Ver -<br />
liebtheit, Menschlichkeit, Literatur.<br />
In Russland entsteht individuelles Bewusstsein und die klügsten Köpfe blicken sich um, erschrecken<br />
und überlegen: Wer sind wir? Woher kommen wir? Warum sind wir Sklaven?<br />
Pjotr Tschaadajew verblüffte die im Entstehen begriffene Gesellschaft mit einer einfachen Idee: Die<br />
Russen sind kein von Gott auserwähltes Volk. Russland ist nicht das Dritte Rom, sondern ein Missverständnis.<br />
Das Unglück des Vaterlandes bestehe darin, schrieb er in einem offenen Brief auf Französisch<br />
an eine Dame, dass wir nicht den römisch-katholischen, sondern den byzantinisch-orthodoxen<br />
Glauben angenommen und uns damit von Europa und seiner historischen Entwicklung abgeschnit ten<br />
hätten. Die Zeitschrift musste ihr Erscheinen einstellen, der Herausgeber Nadeschdin wurde verbannt<br />
und Tschaadajew auf Befehl des Monarchen für verrückt erklärt. Doch die »Philosophischen<br />
Briefe« des Verrückten aus Moskau erschienen im damaligen Samisdat und wurden zur Grundlage<br />
für eine der beiden Hauptrichtungen des russischen Denkens – des »Westlertums«. Der Kampf auf<br />
den ideologischen Barrikaden ist bis heute nicht zum Erliegen gekommen, die russische Hauptfrage<br />
ist immer noch nicht beantwortet: War die ganze russische Geschichte eine Sackgasse, müssen wir<br />
zu den europäischen Werten und in den Schoß der europäischen Zivilisation zurückkehren oder geht<br />
Russland einen Sonderweg?<br />
In Russland ist seither eine einzigartige Situation entstanden. Zwei geistig und kulturell vollkommen<br />
verschiedene Nationen teilen sich dasselbe Territorium, obwohl die eine wie die anderen Russen<br />
sind und dieselbe Sprache sprechen. Der eine Teil des Volkes lebt hauptsächlich in der Provinz – er
,<br />
MICHAIL SCHISCHKIN EUROPE NOW<br />
zählt viele Millionen armer, ungebildeter, trunksüchtiger Menschen, die mental im Mittelalter leben.<br />
Der andere, größere Teil konzentriert sich in den beiden russischen Metropolen – es sind gebildete,<br />
wohlhabende Menschen, die die ganze Welt bereist und europäische Vorstellungen von einer demokratischen<br />
Gesellschaftsstruktur haben. Für die einen kann nur Vater Zar mit eiserner Hand Ordnung<br />
in Russland herstellen. Für die anderen ist die ganze russische Geschichte ein blutiger Sumpf, aus<br />
dem das Land herausgeholt und zu einer liberalen europäischen Gesellschaftsordnung geführt werden<br />
muss. Wozu dieser Widerspruch im Jahr 1917 geführt hat, wissen wir. Bis heute haben wir die<br />
Folgen dieser verheerenden russischen Katastrophe nicht überwunden.<br />
In Russland wird noch immer dasselbe Spiel für drei Spieler gespielt: Das Volk schweigt, die im Entstehen<br />
begriffene Gesellschaft fordert für sich eine »schweizerische« Volksherrschaft und erklärt der<br />
Regierung den Krieg und der Staatsmacht bleibt nur, abzudanken oder die Schrauben fester anzuziehen.<br />
1917 dankte die Staatsmacht bis zur Selbstauflösung ab und das Land versank in einer derartigen<br />
Anarchie, dass es der bis dahin ungekannten Diktatur Stalins bedurfte, um wieder Ordnung<br />
herzustellen.<br />
Im wohl russischsten Text der russischen Literatur, in den »Toten Seelen«, vergleicht Gogol meine Hei -<br />
mat mit einer rasenden Troika, die die anderen Länder und Staaten überholt: »Wohin stürmst du,<br />
Russland? Gib Antwort! Du schweigst.« Jedes Schulkind kennt diese Zeilen. Sie haben Generationen<br />
von russischen Lesern Hoffnung gemacht. Wohin stürmt denn die Troika – in die lichte Zukunft?<br />
Seit Gogol sind anderthalb Jahrhunderte vergangen. Das Land hat historische und das Volk genetische<br />
Erfahrung gesammelt. Die epochalen sozialen Befreiungsexperimente haben zu noch grausamerer<br />
Diktatur geführt, unter jedem Regime wurde der begabteste und aktivste Teil der Bevölkerung<br />
entweder vernichtet oder in die Emigration gezwungen. Ach, im Besitz dieser bitteren Erfahrung wür -<br />
de der große Schriftsteller Russland heute mit einem Metrozug vergleichen, der vom einen Ende des<br />
Tunnels zum anderen fährt – von der Diktaturordnung zur Anarchodemokratie und zurück. Das ist sei -<br />
ne Strecke. Kein anderes Ziel erreicht man in diesem Zug.<br />
Meiner Generation war es vergönnt, in beiden Richtungen durch den russischen Tunnel zu rollen. Die<br />
Perestroika und die Schwäche der Staatsmacht haben das Land ins Chaos der neunziger Jahre gestürzt,<br />
dann fuhr der Zug in die Gegenrichtung und wir fanden uns im neuen Putin-Imperium wieder.<br />
Vergleicht man die gegenwärtigen Ereignisse in Russland mit der Geschichte Europas, so stehen die<br />
Russen wieder einmal kurz vor einer bürgerlichen Revolution. Aber wird sie gelingen? Meine Eltern<br />
lebten in der kommunistischen Sklavenhalterordnung und setzten mich als sowjetischen Sklaven in<br />
die Welt. Der unverhoffte Tod der drei letzten Generalsekretäre der KPdSU führte Russland zur »Demokratie«,<br />
die sich in das patriarchalische Feudalsystem Putins verwandelte: Die Macht ist von oben<br />
nach unten auf der persönlichen Ergebenheit des Vasallen [Gouverneurs, Bürgermeisters, Bezirksprä -<br />
fekten usw. bis zum kleinen Bullen] seinem Souverän gegenüber aufgebaut. Dieses System ist sehr<br />
haltbar und ich fürchte, nicht nur eine russische Generation wird in ihm geboren werden und mit ihm<br />
leben müssen.<br />
Was soll die »europäische« Minderheit in Russland tun? Versuchen, die Regierung zu bekämpfen?<br />
Auswandern? Und zu guter Letzt: Wenn man die demokratische Willensbekundung der Mehrheit als<br />
einzig richtige Entscheidung anerkennt, dann muss man sich damit abfinden, dass in Russland selbst<br />
in den freiesten Wahlen wiederum Putin siegen wird. Für die feudale Mentalität der Bevölkerungsmehr -<br />
heit unseres riesigen Landes ist die Staatsmacht wie eh und je sakral, weil sie die Macht ist. Deshalb<br />
wird auch für die Macht gestimmt.<br />
Alle Ereignisse der letzten Zeit belegen, dass in Russland die Schrauben wieder fester angezogen<br />
werden. Die Regierung hat nicht vor, auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Allen, denen es nicht<br />
gefällt, in Putins System zu leben, wird unzweideutig nahegelegt, das Land zu verlassen – die Grenzen<br />
sind offen. Wir stehen auf der Schwelle zu einer neuen Großen Völkerwanderung. Sie hat schon<br />
eingesetzt. In den nächsten Jahren werden Hunderttausende von Menschen aus Russland nach<br />
Europa einströmen.<br />
Kehren wir nun zum »Teremok« zurück. Alle Versuche des Bären, sich in das Tierhäuschen zu zwängen,<br />
müssen natürlich scheitern. Der Bär wird wütend und setzt sich auf das Häuschen. Damit ist es mit<br />
dem Häuschen und dem Märchen aus.
,<br />
MICHAIL SCHISCHKIN EUROPE NOW<br />
Auf das Häuschen Europa setzen sich aber mit aller Macht noch andere Bären – der afrikanische<br />
und der asiatische.<br />
Und kein <strong>Rettungsschirm</strong> wird das europäische Häuschen retten. Das Europa des 21. Jahrhunderts<br />
ist zu klein geworden, um im eigenen Saft zu schmoren und nur an sich selbst zu denken. Bevor es<br />
zu spät ist, müssen sich die »europäischen Tiere« aus ihrem engen europäischen Denken befreien,<br />
um die globalen Probleme zu lösen, die vor Europa und der ganzen Menschheit stehen. Unser Häus -<br />
chen ist ja unsere ganze Erde.<br />
[Übersetzt aus dem Russischen von Annelore Nitschke]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
DRAGO JANČAR<br />
DER FALL EUROPAS?<br />
Nun gut, wenn Nicolas Sarkozy meint, Europa explodiert, wenn der Euro explodiert, und hinzufügt,<br />
den Euro zu verteidigen bedeute, Europa zu verteidigen, können wir diese Aussagen cum grano salis<br />
nehmen; die Rhetorik des bekannten französischen Politikers verträgt so manches und so manches<br />
vertragen auch unsere an so mancherlei gewöhnten europäischen Ohren auf unseren in letzter Zeit<br />
immer ratloseren europäischen Köpfen. Wenn aber die pragmatische und rationale Angela Merkel et -<br />
was noch Dramatischeres äußert, nämlich: Zerbricht der Euro, dann zerbricht Europa, müssen sich<br />
auch jene von uns Gedanken machen, die sich nicht dem Mysterium der Finanzströme und Bankora -<br />
kel widmen. Bisher dachten wir nämlich, das heutige Europa habe in seinen Grundfesten ein stärkeres<br />
Bindemittel als das liebe Geld eingebaut, das uns allen so sehr am Herzen liegt. Allein schon<br />
aus dem Grund, weil wir am Flughafen schon lange nicht mehr zur Wechselstube rennen müssen, kei -<br />
ne Wechselkurse mehr berechnen müssen, in unseren Brieftaschen keine Geldscheine mit Abbildungen<br />
verschiedener berühmter historischer Persönlichkeiten wohl begründeter europäischer Nationen<br />
und Staaten mehr herumtragen und mit verschiedensten Münzen in den Hosentaschen klimpern müs -<br />
sen. Nun aber erfahren wir plötzlich, dass der Euro mehr als nur Geld ist, dass wir in unseren Taschen<br />
sozusagen etwas Schicksalhaftes tragen: To be or not to be.<br />
Unlängst wähnten wir noch, nach all den ideologischen und nationalistischen Irrungen und Wirrungen<br />
des 20. Jahrhunderts in Europa, endlich den sicheren Hafen der Zusammenarbeit, des Wissens, des<br />
Wohlstands und der Toleranz erreicht zu haben; zwar nicht gerade das Gelobte Land, aber zumindest<br />
die große alte und zugleich neue Heimat, in der sich die Menschen nicht gegenseitig an die Gur -<br />
gel gehen, nur weil sie verschiedene Sprachen sprechen, sich auf ihre großen Kulturen berufen oder<br />
weil sie anders über soziale Fragen und Gesellschaftsordnungen denken. Die letzte Debatte über die<br />
Fundamente Europas, nämlich die Diskussion über Gott in der Europäischen Verfassung, war verhält -<br />
nismäßig unschuldig im Verhältnis zu den apokalyptischen Zeitungsüberschriften und Fotos, die wir<br />
heute zu sehen kriegen. So zum Beispiel unlängst auf dem Titelblatt des »Spiegel«, auf dem eine<br />
wohl mehrere Tonnen schwere Euromünze vom Himmel auf die Akropolis fällt, als ob diese von Zeus<br />
selbst geschickt worden wäre: Es besteht kein Zweifel, dass nur Ruinen übrig bleiben werden, wenn<br />
die Münze zu Boden kracht; dann fällt Griechenland, dann wird der Parthenon zerstört, dann fällt<br />
das Sinnbild der europäischen Zivilisation, dann fällt Europa. Die Ahnung einer Explosion, die dem<br />
Fall des Euro auf die Akropolis folgen sollte, ist viel schlimmer als die, die es dort tatsächlich schon<br />
einmal gegeben hat. Bekannt ist, dass die Türken, die sich, nachdem sie Griechenland besetzt hatten,<br />
der Kultur und Tradition gegenüber respektlos verhielten, in dieser heiligen Stätte Schießpulver<br />
aufbewahrten. Die noch respektloseren christlichen Venezianer, die wussten, dass sich dort ein Pulvermagazin<br />
befand, und die sich ebenso wenig wie die Türken darum scherten, dass hier das symbolische<br />
Fundament Europas stand, richteten ihre Kanonen auf die Akropolis, man schrieb das Jahr<br />
1687, die Kanonen spien Feuer, das europäische Heiligtum explodierte und brannte zwei Tage lang<br />
lichterloh. Als es abgebrannt war, plünderten es die Venezianer auch noch schamlos. Anfang des 19.<br />
Jahrhunderts machte sich schließlich der britische Botschafter im Osmanischen Reich, Thomas Bruce,<br />
7. Earl of Elgin, über das her, was übrig geblieben war, indem er mit Erlaubnis des osmanischen Sultans<br />
einen Großteil der Marmorskulpturen nach England brachte und sie im Britischen Museum in<br />
London ausstellen ließ. Dann kam das europäische 20. Jahrhundert, das Jahrhundert des großen<br />
wissenschaftlichen und kulturellen Fortschritts, zugleich aber auch das Jahrhundert, in dem es fast<br />
keine Stadt und kein Dorf in Europa gab ohne geschwärzte Mauern und Türme, die aus zahlreichen<br />
Ruinen ragten, in dem nicht nur Pulvermagazine, sondern auch Schulen und Krankenhäuser in die<br />
Luft gejagt wurden.<br />
Ehe Sarkozy behauptete, Europa würde explodieren, wenn der Euro explodiert, und ehe uns Angela<br />
Merkel mit ihrer Aussage erschreckte, Europa würde zerbrechen, wenn der Euro zerbricht, waren wir<br />
überzeugt, dass der letzte Fall, den wir gesehen und erlebt hatten, der Fall der kommunistischen Dik -<br />
taturen, der Fall der Berliner Mauer gewesen sei, und damals dachten wir schon, nun könne nichts<br />
mehr fallen.<br />
In seliger Ruhe widmeten wir uns der Suche nach der Zauberformel einer europäischen Identität, wir<br />
sprachen vom Alten und Neuen Europa, davon, in Vielfalt geeint zu sein. Besonders die Osteuropäer
,<br />
DRAGO JANČAR EUROPE NOW<br />
freuten sich darüber, die im Geiste der Erwartung eines kommunistischen Eldorados erzogen waren,<br />
für die sich diese Fata Morgana jedoch bald in Luft auflöste – Paradise Lost. So blickten sie hoffnungsvoll<br />
ins, ach, Europa, das neue himmlische Land, wo all ihre Probleme gelöst würden. Auch<br />
suchten wir die »Seele Europas«, nach der Jacques Delors, einer ihrer Begründer und geistigen Vä -<br />
ter, trachtete.<br />
All diese Diskussionen waren nicht sonderlich fruchtbar, denn der wirtschaftliche und liberale Pragmatismus,<br />
der der gemeinsame Nenner Europas ist, verhält sich diesbezüglich eher zurückhaltend,<br />
er geht jeglicher Interpretation aus dem Weg, was Europa sei beziehungsweise zu sein wünsche. Interpretation<br />
muss in der modernen Welt, in der verschiedene Werte und Sichtweisen des Lebens koexistieren,<br />
zwangsläufig auch Konfrontation bedeuten, die in einer Welt des freien Handels und der<br />
Börsenmentalität niemand brauchen kann, nicht einmal auf gedanklicher Ebene. Ein ideeller Konflikt<br />
kann schnell in einen politischen Konflikt übergehen, und das ist das Letzte, was sich die Wirtschafts -<br />
pragmatiker wünschen. Kein Pathos also, keine »Seele«, kein tieferer Sinn. So blieb das höchste Ziel<br />
des vereinten Europas etwas ziemlich Einfaches: Seine wirtschaftliche Macht sollte in kürzester Zeit<br />
eine Konkurrenz für die amerikanische und chinesische werden, sie sollte in allen globalen Prozessen<br />
stark und unabhängig sein. Es verstehe sich von selbst, meinen die Pragmatiker, dass der wirtschaft -<br />
liche Aufschwung neben materiellem Wohlstand auch ein besseres Gesundheitswesen und bessere<br />
Schulen mit sich bringe, mehr Geld für Kultur, mehr Freizeit, und dass materieller Wohlstand automatisch<br />
auch eine höhere Toleranzstufe der europäischen Staatsbürger mit sich bringen werde. Angesichts<br />
einer solch optimistischen Perspektive klingt der Aufruf von Jacques Delors, dem ehemaligen<br />
Präsidenten der EU-Kommission, der Anfang der neunziger Jahre appellierte, »Europa eine Seele<br />
zu geben«, nur noch wie ein fernes Echo einer Idee, vom Winde des wohltuenden Pragmatismus ver -<br />
weht. Die »Seele Europas« könnte auch bedeuten, dass ihre Staatsbürger ihre Geschichte, Kultur,<br />
Geistigkeit, die Polarisierungen der Werte und der Ethik, die Erfahrungen mit Diktatur und Totalitarismus,<br />
die Ursprünge und Prinzipien der Demokratie, den Individualismus mit den persönlichen Freiheiten<br />
und zugleich das Streben nach gemeinsamem Wohl verstehen. Das sind für die neuzeitlichen<br />
Pragmatiker allerdings Abstraktionen, ihrer Meinung nach werden zwischenmenschliche Beziehungen<br />
in einer Gemeinschaft am besten von den gleichen Verhältnissen geregelt, wie sie am Kapitalmarkt<br />
herrschen: mit einer so großen Permissivität und einer so geringen Konfliktträchtigkeit wie möglich.<br />
Der gegenwärtige wirtschaftliche und politische Pragmatismus unterschätzt die Macht der Ideen. Er<br />
betrachtet die Abstraktion der Kultur und Philosophie von oben herab, vor allem aber die Fragen der<br />
menschlichen Geistigkeit. Er erkennt die Konflikte der wirtschaftlichen und sogenannten nationalen<br />
Interessen an und versucht, auf kürzestem Wege jeden zumindest gedanklichen Konflikt und damit<br />
auch jeden latenten gesellschaftlichen Konflikt auf diesem Gebiet mit politischen Mitteln zu beseitigen.<br />
Gerade deswegen befinden wir uns nun vor einer apokalyptischen Vision: Wenn der Euro fällt.<br />
Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir uns in wohltuender Ruhe einer weiteren aufregenden<br />
Debatte widmeten, nämlich der Frage, ob das Wort »Gott« in die Europäische Verfassung eingetragen<br />
werden soll oder ob in der Verfassungspräambel zusätzlich auch das Christentum erwähnt werden<br />
soll. Eine solche Diskussion ist nur in ruhigen Zeiten und im Wohlstand möglich, wenn wir eigentlich<br />
keine anderen ernsten Probleme mehr haben, wie die Frage nach Europa und der Ewigkeit. Und alle,<br />
die wir in Europa leben, haben Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes. Es gibt wahrscheinlich kein<br />
europäisches Volk, das es irgendwann in der Geschichte nicht für notwendig erachtet hätte, Gott in<br />
die engste Verbindung mit der eigenen Existenz zu bringen. Einige Völker schrieben Gott sogar in ih -<br />
re Hymne ein, so zum Beispiel die Engländer: God Save the Queen, oder die Serben: Gott der Gerechtigkeit;<br />
oder gleich alle Völker der Habsburger Monarchie: Gott erhalte, Gott beschütze / Unsern<br />
Kaiser, unser Land! ... Deutsche Bataillone hielten Gott auf ihren Kriegsbannern fest, in der Überzeugung,<br />
Gott sei mit ihnen: Gott mit uns. Einige dachten, Gott habe ganz besonders mit ihnen zu tun:<br />
Gott und die Kroaten. Oder die Slowenen: Mutter – Heimat – Gott. Nun, wir Slowenen haben Gott<br />
auch in einem Sprichwort, das ganz gut eine gewisse Charaktereigenschaft beschreibt: Leise steh,<br />
abseits geh, zu Boden schau flott und hüt dich vor Gott.<br />
Die Amerikaner vertrauen auf Gott noch mehr als die Europäer, sie übergaben sogar ihr Geld in Gottes<br />
wohlmeinende Obhut: In God We Trust, wie es auf den Dollarscheinen steht. Und das half ihnen auch
,<br />
DRAGO JANČAR EUROPE NOW<br />
nicht, den Fall der Lehman Brothers Holdings Inc. zu verhindern. Und es dräute und es dräut noch<br />
immer, dass der Euro und mit ihm Europa fallen soll. Mit Gott auf den Geldscheinen und in der Verfassung<br />
oder auch ohne.<br />
Und nun blicken wir ein wenig schizophrenen Blickes gen Himmel, von wo der Euro auf die Akropolis<br />
fällt, und fragen uns, was denn hier eigentlich vor sich geht. Denn wir gewöhnliche Sterbliche, die<br />
nicht in die Orakel der Börsen und Banken eingeweiht sind, verstehen überhaupt nichts mehr. Finanz -<br />
transaktionen, Finanzmärkte, Börsenabschwung und -aufschwung, Ratingagenturen, ein ganzes<br />
Konglomerat an für die Augen unsichtbaren Geldsummen und -flüssen sind in den Augen von uns<br />
Unwissenden, die von einer europäischen Kultur gesprochen haben, eine Abstraktion geworden, die<br />
uns heute auch Karl Marx oder Slavoj Žižek schwerlich erklären könnten. Früher wussten wir, dass<br />
es Kapitaleigentümer gab, das heißt Kapitalisten, mit der Familie Krupp konnte man ja noch etwas<br />
aushandeln, doch wie soll man mit abstrakten Finanzflüssen verhandeln, wo kein Eigentümer mehr<br />
zu sehen ist? Früher erfuhren wir von der Enteignung der Enteigner, die Unwissendsten von uns la -<br />
sen Ödon von Horváth, der in seinem Roman »Der ewige Spießer« seinem Helden, Kaufmann Schmitz,<br />
folgende Worte in den Mund legt: »Ich, Rudolf Schmitz, bin überzeugt, dass es zwischen den europäischen<br />
bürgerlichen Großmächten zu keinem Krieg mehr kommen wird, weil man heutzutage eine<br />
Nation auf kaufmännisch-friedliche Art bedeutend billiger ausbeuten kann.« Das haben wir irgendwie<br />
verstanden, während wir heute mit angsterfüllter Brust ins Menetekel blicken: Zerbricht der Euro,<br />
dann zerbricht Europa.<br />
Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die alte Legende zu vertrauen: Europa reitet auf ei nem<br />
weißen Stier, der im Meer in Richtung Kreta schwimmt. Wir hoffen, dass sie nicht fällt, wir wissen,<br />
dass sie es nicht tut, zumindest nicht ins Meer. Was allerdings dort auf Kreta geschieht, ist für Euro -<br />
pa eine zwar ein wenig traurige, aber dennoch recht optimistische Fortsetzung.<br />
[Übersetzt aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
BEQË CUFAJ<br />
AUFSÄTZE FÜR BRÜSSEL<br />
Kreshnik ist ein Achtzehnjähriger und lebt in Prishtina, der Hauptstadt des Kosovo. Ich kenne ihn nicht<br />
persönlich, erhalte aber hin und wieder Post von ihm. Als treuer Leser der kosovarischen Tageszeitung,<br />
für die ich eine wöchentliche Kolumne verfasse, hat er sich angewöhnt, mir seine Meinung zu<br />
meinen Texten zu sagen.<br />
Vor einigen Monaten, genauer gesagt im Mai, habe ich von Kreshnik einen elektronischen Brief bekom -<br />
men, in dem es nicht um Zeitungsthemen ging. Vielmehr bat er mich um meinen Kommentar zu ei -<br />
nem eigenen Text, den er beigelegt hatte. Es handelte sich um einen Aufsatz: seinen Beitrag zu einem<br />
Wettbewerb, der vom kosovarischen Bildungsministerium für Schüler in den Abschlussklassen der<br />
kosovarischen Oberschulen ausgeschrieben worden ist.<br />
Das Aufsatzthema lautet: »Der Balkan in der Europäischen Union«. Den fünf Siegern des Wettbewerbs<br />
winkt als Preis eine einwöchige Reise nach Brüssel. Die Gastgeber aus der europäischen Hauptstadt<br />
sorgen für das Visum, die Unterbringung und Verpflegung der Preisträger und geben ihnen die Möglichkeit<br />
zu Besuchen in wichtigen europäischen Einrichtungen.<br />
Kreshniks Aufsatz hat mich beeindruckt. Nicht nur, weil der Verfasser sich erstaunlich gut informiert<br />
zeigt, sondern auch, weil er klare Vorstellungen entwickelt, was den Zeitpunkt und die Bedingungen<br />
einer Integration des Kosovo in die Europäische Union anbelangt. Kreshnik meint, dass die Völker<br />
und Länder der Region zunächst ihre regionale Zusammenarbeit verstärken und Brücken untereinander<br />
schlagen müssen, wenn sie die Forderungen, die Brüssel stellt, erfüllen wollen. Und er scheut<br />
sich auch nicht, ein Problem anzusprechen, das man auf dem Balkan gerne von sich herschiebt: die<br />
allumfassende Herrschaft von Korruption und organisierter Kriminalität.<br />
Ich las den Aufsatz ein zweites Mal und fand meinen ersten Eindruck bestätigt: dass nämlich dieser<br />
Achtzehnjährige offenbar eine weit klarere Vorstellung von den Erfordernissen der europäischen Integration<br />
hat als die erdrückende Mehrheit derer, die sich als politische Klasse des Kosovo verstehen.<br />
Bleibt die Frage, wie viele Altersgenossen Kreshniks es geben mag, die ähnlich gut wie er über die<br />
EU informiert sind und die Notwendigkeit von Integrationsschritten in der Region als Vorbedingung<br />
für die Annäherung an Europa so klar sehen wie er.<br />
Darauf ging ich in meiner Antwort an Kreshnik aber nicht ein. Ich beschränkte mich darauf, ihm zu sei -<br />
nem Aufsatz zu gratulieren und ihm viel Glück für den Wettbewerb zu wünschen.<br />
Er bedankte sich für das Lob, war aber nicht sehr optimistisch, was eine Auszeichnung anbetraf: »die<br />
dort oben«, also die Bürokraten im Kulturministerium und in der Auswahlkommission, würden schon<br />
dafür sorgen, dass die Preise an Bekannte gingen. Ich zog es vor, keinen weiteren Kommentar dazu<br />
abzugeben.<br />
Was hätte ich ihm auch sagen sollen? Dass es nun einmal nicht einfach ist, wenn man in der ärmsten<br />
und korruptesten Region Europas lebt? Dass seine Generationsgenossen aus Polen, Tschechien,<br />
Ungarn oder der Slowakei, aber auch Rumänien und Bulgarien – also fast Balkan – in einem Europa<br />
leben, in das er, den Sieg im Aufsatzwettbewerb vorausgesetzt, für eine Woche hineinschnuppern<br />
dürfte?<br />
Kreshniks Geschichte erinnert mich an meine eigene. Ich war ungefähr in seinem Alter, als die Bürger<br />
Ex-Jugoslawiens Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts neue Urlaubsländer<br />
für sich zu entdecken begannen. Titos Staat war sozusagen das Paradies unter den sozialistischen<br />
Ländern. Der Alte, wie ihn ein paar unverbesserliche Nostalgiker noch immer zu nennen pflegen, hat -<br />
te feste Beziehungen zum Westen hergestellt, was den Bürgern seines Staates unter anderem auch<br />
Visumsfreiheit bei Reisen in westliche Staaten einbrachte. Zugleich wurden aber auch die nach dem<br />
Bruch mit der Sowjetunion eingeschlafenen Kontakte zu einigen Ostblockländern wiederbelebt: der<br />
[damaligen] Tschechoslowakei, Polen und Ungarn.<br />
Ich werde nie vergessen, wie ein paar meiner Lehrer nach der Rückkehr von einem Besuch in Polen<br />
von diesem »billigen« [nicht »armen«] Land schwärmten, denn sie hatten dort gewissermaßen als<br />
reiche Touristen auftreten und in den Geschäften Dinge einkaufen können, die für ihre einheimischen<br />
Kollegen absolut unerschwinglich waren.<br />
Zwanzig Jahre später haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Polen wurde untrennbarer Bestandteil<br />
Europas, während es den Menschen in den Staaten, die aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen<br />
sind, in der Regel schlechter geht als den Polen damals in den achtziger Jahren.
,<br />
BEQË CUFAJ EUROPE NOW<br />
Die Aufhebung der Autonomie des Kosovo im Jahr 1989 verbot nicht nur das eigenständige politische<br />
Leben wie nirgendwo sonst in Europa, sondern bezeichnete auch den Beginn des blutigsten Krieges<br />
in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und während die militärisch-polizeiliche Maschinerie von<br />
Slobodan Milošević die Kosovaren unter Kontrolle brachte, liefen die Provokationen weiter und lös -<br />
ten anschließend Kriege in allen Gebieten des ehemaligen Jugoslawien aus. Im Jahr 1991 schickte<br />
er die Armee für einige Stunden gegen die Slowenen, die er dann aber »ziehen ließ«. Es folgte ein blu -<br />
tiger Krieg in Kroatien, wo Orte wie Vukovar und Knin in der Krajina zum Synonym für Massentötungen,<br />
systematische Vertreibung und unüberschaubare Flüchtlingskolonnen werden sollten. Dann beschloss<br />
er, in Bosnien-Herzegowina weiterzumachen, wo das junge Europa von 1992 bis 1995 seinen<br />
bis dahin grausamsten Krieg nach dem Ende des Kalten Krieges erleben sollte. Dort wurde die Haupt -<br />
stadt Sarajevo zum Synonym für die längste Umzingelung und Belagerung einer Stadt seit Jahrzehn -<br />
ten. Und die Stadt Srebrenica im Osten der einstigen jugoslawischen Teilrepublik wurde zum Syno -<br />
nym für das schlimmste Massaker in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges: Binnen 48 Stun den<br />
nach dem Fall der einstigen muslimischen Enklave im Juli 1995 ließen dort Radovan Karadžić, der<br />
politische Kommissar von Milošević, und General Mladić, der militärische Vollstrecker, auf Befehl Bel -<br />
grads 8000 unschuldige Männer und Jungen massakrieren.<br />
Während all dieser blutigen Jahre, während welcher Milošević in Slowenien, Kroatien und Bosnien-<br />
Herzegowina kämpfen ließ und sich erst im allerletzten Augenblick dem militärischen Gegendruck<br />
beugte, blieb das Kosovo unter der Knute Belgrads.<br />
Die Verluste in Kroatien und Bosnien-Herzegowina, wo die Nato nach Srebrenica doch mit ihren Bom -<br />
ben eingegriffen hatte, hatten Milošević stark geschwächt. Zumal die Wirtschaft Serbiens so schwer<br />
getroffen war, dass er einen neuen Krieg brauchte. Im Kosovo dagegen sah die albanische Jugend<br />
ihre Hoffnungen auf Ibrahim Rugova und den Westen enttäuscht.<br />
Die Situation im Kosovo Anfang 1997 war identisch mit jener in Bosnien-Herzegowina Anfang 1992,<br />
nur hatte es Milošević in diesem Fall noch eiliger, die Sache rasch fertig zu bringen, solange die kosovo-albanische<br />
UÇK den serbischen Soldaten und Paramilitärs nicht standhalten konnte. Der Kosovo-Krieg<br />
begann schon im Frühling 1997, eskalierte 1998 und endete in der Nacht zum 10. Juni<br />
1999, als in Kumanovo in Mazedonien die Serben ihre Kapitulation nach dem monatelangen Nato-<br />
Bombardement unterschrieben.Dann kam die Nachkriegszeit.<br />
Das Milošević-Regime in Belgrad wurde gebrochen. Im Kosovo war und ist die massive Präsenz der<br />
internationalen Zivilmissionen der UN, der EU, der OSZE sowie die Militärmission der Nato dazu da,<br />
den Behörden und Institutionen dieser jungen und zerbrechlichen Republik beim Wiederaufbau zu<br />
helfen und sie zugleich zu überwachen.<br />
Auch zwölf Jahre nach dem Krieg sind die Probleme mannigfaltig – von der beängstigenden Armut<br />
über die Korruption bis zum immens schwierigen Wiederaufbau der Kommunikationsbrücken zwischen<br />
der albanischen Mehrheit und der serbischen Minderheit, die weiter in der serbischen Hauptstadt<br />
Belgrad die Rettung und in der kosovarischen Hauptstadt Prishtina die Bedrohung ihrer Exis -<br />
tenz sieht.<br />
Wir alle südlich von Kroatien, ob es nun in Serbien, Montenegro, Mazedonien oder Kosovo ist, ha -<br />
ben schwer nicht nur an der Ausgrenzung aus Europa zu tragen, sondern auch an der regionalen<br />
Zerrissenheit. Am bittersten ist, dass für die untereinander zerstrittenen, unfähigen politischen Eliten<br />
in den betreffenden Ländern der Anschluss an Europa nicht mehr als ein Objekt der Spekulation ist,<br />
während es die Mafia-Organisationen dort längst gelernt haben, sich im Interesse ihres eigenen Wohl -<br />
ergehens über nationalistische Beschränkungen hinwegzusetzen. In ihrem Business, dem Menschen-,<br />
Zigaretten- und Rauschgiftschmuggel, funktioniert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.<br />
Wir auf dem Balkan sind noch weit entfernt von einer wirklichen Annäherung an Europa. Vermutlich<br />
werden wir noch Jahrzehnte brauchen. Nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile, die diese Region hat te,<br />
sind in den zehn Jahre mörderischer Kriege zerstört worden, sondern auch die Hoffnung, dass sich<br />
in den postkommunistischen, postnationalistischen Gesellschaften rasch eine starke und wirksame<br />
proeuropäische Bewegung entwickeln könnte.<br />
Trägt Europa eine Mitschuld an der Situation, unter der wir immer noch zu leiden haben? Ja und nein.<br />
Ja, weil es absurd ist, dass sich die Diplomaten Europas gewissermaßen um den Balkan herumbe-
,<br />
BEQË CUFAJ EUROPE NOW<br />
wegen, wenn sie in die Türkei reisen, um Bedingungen für eine Mitgliedschaft in der EU auszuhandeln.<br />
Nein, weil den Völkern auf dem Balkan, besonders aber ihren politischen und intellektuellen Eliten<br />
niemand die Entscheidung für eine Zukunft in Europa abnehmen kann.<br />
Der Aufsatzwettbewerb, an dem Kreshnik aus Prishtina, Hauptstadt des Kosovo, teilnimmt, in allen<br />
Ehren, aber eigentlich müssten aus Brüssel mehr und effektivere Initiativen kommen, was die Heranführung<br />
des Balkans an Europa betrifft. Vielleicht ist man in der europäischen Hauptstadt aber auch<br />
der Meinung, dass erst auf Kreshnik und seine Generation gesetzt werden kann?
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
ANATOLIJ GRINVALD<br />
DIE KATZE<br />
1. Die Völkerschlacht bei Leipzig<br />
Du tratst auf die Straße und begannst, Verse vorzutragen. Die Straße befand sich in Leipzig und das<br />
erste Gedicht handelte von dieser Stadt:<br />
Arm ist mein Leipzig. Und der arme Bach<br />
schleppt sich durch Leipzig im zerlumpten Hemd.<br />
Unpopulär. Gejagt. Unglücklich in der Ehe.<br />
Redet Touristen an, schnorrt Zigaretten.<br />
Goethe im schmutzigen Keller trinkt Kadarka.<br />
Faust stürmt herein, die beiden prügeln sich.<br />
Ein Sanitäter kommt mit einem Rollstuhl.<br />
Mit Gurten wird, wie ein Geschenk mit Bändern,<br />
Goethe umschnürt und dann hinausbefördert<br />
und in ein Krankenhaus gebracht am Stadtrand.<br />
Dort die Luft so klar, die Sterne sichtbar.<br />
Dort wird ein netter Arzt mit spitzem Bärtchen,<br />
der stark an Mephistopheles gemahnt<br />
durch seine Art, die Seele und die Haut<br />
mit Wort und Nadel zu zerpicken, nachts<br />
erscheinen und verrückte Fratze schneiden.<br />
Dort ist es schlimm. Der Leib vom Krampf geschüttelt.<br />
Dort fließen alle Formen ineinander,<br />
werden zu einem matten Fleck im Spiegel.<br />
Niemand schmiss etwas in deinen blank geputzten Hut eines vom Leben gebeutelten Gentleman. Es<br />
blieb nicht einmal jemand stehen, bis auf ein Mädel, das in Eile über die Schulter »Scheiße« keuch te.<br />
Aber Russen geben so schnell nicht auf, nicht wahr? Insbesondere die Deutschrussen. Ihnen ist es<br />
schnurz, wo sie sterben sollen – ob bei Moskau, bei Stalingrad, bei Berlin oder bei Leipzig. Also<br />
hast du weiter und weiter gelesen. Bis dir klar wurde, dass Straßenpoesie wohl bessere Orte kennt<br />
als Leipzig.<br />
2. Fatalismus als treibende Kraft der Dichtung<br />
Das Hungern hast du dir angewöhnt. Schon im früheren Leben, in Kasachstan, kehrtest du oft dieser<br />
ganzen provinziellen Zivilisation den Rücken und fuhrst zur Datscha eines treuen Freundes – was<br />
wiederum bedeutete: vier, fünf Tage lang ohne Futter. Nur mit Tee und Zigaretten. So schriebst du ein -<br />
mal: »Zigaretten unterdrücken den Gedanken ans Essen wie Pornos den Gedanken an echte Liebe«.<br />
Das Hungergefühl legte sich am dritten Tag. Am sechsten Tag packte dich ein furchtbarer Durst. Also<br />
fuhrst du vom schneebedeckten Außenbezirk zu einem anderen, nicht weniger treuen Freund. Und:<br />
ein Liter Wodka für zwei. Auf leeren Magen haute es einen schon nach dem ersten Stamper um.<br />
Oder waren etwa die Stamper so groß? Wir lasen uns eigene Verse vor. In der Art: »Küsse, die ohne<br />
Liebe gezeugt sind, liegen wie Raureif auf den Lippen.« Und gingen die dritte Flasche holen. Nach<br />
der dritten eilte der Freund gewöhnlich, sich vor den nächsten Zug zu schmeißen. Und natürlich liefst<br />
du ihm anfangs noch hinterher und bewahrtest ihn davor. Dann warst du es leid, ihm nachzuhetzen.<br />
Er kam auch so jedes Mal zurück. Ein wenig platt, aber nicht durch die Räder, und mit wildem Flakkern<br />
in den Augen. Wahrscheinlich hatte der Zug andauernd Verspätung oder es war jedes Mal der<br />
verkehrte. Oder er hatte es endlich kapiert, dass der Stoff seit »Anna Karenina« abgenudelt ist. Aber<br />
es blieb nicht bei dem Spiel mit dem Zug. Manchmal wurde auch eine Patrone genommen und – in<br />
Ermangelung einer Pistole – auf den heißen Herd gesetzt. Und die Kugel sauste noch lange herum,<br />
von allem abprallend, durch die kleine Küche, wie eine Hummel, die ins Fenster hereingeflogen war,
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
und erstarb schließlich unter dem faszinierten Blick des Freundes. Er aber saß und rauchte beglückt.<br />
Und das, obwohl Rauchen schädlich ist. Ja, dort war Selbstmord Nationalsport. Der Freund hatte im -<br />
merzu Pech in der Liebe. Außerdem wurde er nie gedruckt. Du wurdest gedruckt. Manche städtische<br />
und regionale Zeitungen haben sogar mal was springen lassen. Ein Honorar reichte meistens für ein<br />
paar Brote oder drei Flaschen Wodka oder einige Schachteln Billigzigaretten. Du entschiedst dich für<br />
Letzteres. Und blicktest dann sinnend zum Fenster hinaus, dem Freund nach, der sich abermals vor<br />
den Zug werfen wollte. Echte Poesie.<br />
Apropos. Eine für dich passende Definition von Poesie hattest du damals noch nicht gefunden. Erst<br />
hier, in Deutschland [das weißt du noch ganz genau], zwischen der fünften und der sechsten Flasche<br />
Bier hast du mit zitternden Händen notiert: »Poesie ist die Konzentration und die Weitergabe positiver<br />
Energie [Energie plus] von Mensch zu Mensch mittels eines äußerst kompakten Texts [das heißt,<br />
durch eine große Anzahl assoziativer Lösungen].«<br />
3. Der Sonnenmaler<br />
Mit Arbeit sieht es in Leipzig übel aus. Vor allem für einen russischen Dichter. Zig Versuche, irgendwo<br />
als Copyrighter unterzukommen, sind allesamt glänzend gescheitert. Obwohl das Portfolio gar nicht<br />
mal schlecht war:<br />
Portfolio<br />
Napoleon: »Vereinigtes Europa«.<br />
Stalin: »Unvergessliche Reisen nach Kolyma«.<br />
Putin: »VIP-Urlaub im Norden Russlands«.<br />
Stolypin: »Reisen mit Komfort«.<br />
Dschingis Khan: »Reise entlang des Goldenen Rings«.<br />
Boris Becker: »Verwenden Sie Kondome von Durex«.<br />
Michael Jackson: »Duf-Seife macht Sie wirklich weiß«.<br />
Galileo: »Sie würde sich nicht drehen, hätte ich kein Omegon-Teleskop«.<br />
Väter der Heiligen Inquisition: »Fäsch-Entflammer für Feuer und Grill«.<br />
Maria Scharapowa: »So stöhne ich unter dem Vaginal-Stimulator Big-Bob!«<br />
Santana: »Ich habe mir bloß ein Gitarrenlehrbuch gekauft«.<br />
Lenin: »Küchengeräte für Hausfrauen zum Regieren eines Staats«.<br />
Russische Zeitungen zahlten auch nichts. Obwohl du sogar den verzweifelten und für einen Dichter<br />
ganz und gar ungehörigen Schritt unternahmst und an Hochglanzmagazine für Herren eine Auswahl<br />
von Gedichten mit eindeutig erotischem Inhalt schicktest:<br />
Matura<br />
wer fiel wer viel vergoss an blut<br />
hat roten mohn auf seiner iris<br />
wie weh gedichte schreiben tut<br />
der oberfläche des papiers<br />
gebrandmarkt auch das schulterblatt<br />
ein schnapsglas-auge blickt verdrossen<br />
wo man auf uns gewartet hat<br />
ist wegen inventur geschlossen<br />
glimmstängel durch die wolken ziehn<br />
ein wenig chatten kaffee breakfast<br />
den göttern haben wir verziehn
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
wir waren selber götter etwas<br />
heißt können vor dem scheiß-TV<br />
grimassen schneiden und da unten<br />
die mädels lecken fast schon wie<br />
ein straßenköter seine wunden<br />
Und abends lasen wir Tschechow<br />
Püppchen, lebendes, zartes, kleines;<br />
bis zum Himmel die Schleife und der Sommer noch nicht zu Ende.<br />
Zurück kehrt die Nacht und näht in ihr schwarzes Leinen<br />
einfach alles ein: Umrisse, Stimmen, Atem und Hände.<br />
Ein Datschenroman mit bunten Bildern und Regen,<br />
samt Schaukelstuhl und einem alten Empfänger ...<br />
Live-Übertragung von Adams Fall aus dem Garten Eden ...<br />
Er braucht sehr lange ... Er braucht viel länger ...<br />
Und dann – erinnerst du dich – beim Abendessen –<br />
an den rassigen Streuner – den braven?<br />
Du trugst Wrangler, du warst noch ein Mädchen, eine Prinzessin,<br />
ganz eingeengt, dort wo die Nähte sich trafen.<br />
Wir tranken Bier und ich erzählte dir von Konfuzius.<br />
Ich erzählte: Konfuzius habe gesagt, es sei schwer,<br />
eine schwarze Katze in einem dunklen Zimmer zu finden,<br />
vor allem dann, wenn sie gar nicht dort ist.<br />
Danach löschten wir das Licht<br />
und im Zimmer wurde es sehr, sehr dunkel.<br />
Ich küsste dich so heftig,<br />
dass mein Nachbar von deinem Gestöhn<br />
nicht einschlafen konnte.<br />
Und du küsstest mich so heftig,<br />
als hätten deine Lippen nur auf mich gewartet.<br />
So waren wir bemüht, Liebe zu finden –<br />
eine schwarze Katze in einem dunklen Zimmer,<br />
die möglicherweise gar nicht dort war.<br />
Offenbar war der erotische Inhalt dieser Gedichte nicht eindeutig genug. Denn eine Antwort erhieltst<br />
du nicht. Dafür zeigte eine russische Zeitung Interesse an deinem Essay »Der Deutsche«:<br />
Der Deutsche<br />
Es wird behauptet, die Deutschen hätten keinen Sinn für Humor.<br />
Ich treffe meinen Professor von der Uni. Und sage ihm: Hallöchen, Herr Professor! Ich hab Sie erst<br />
vor Kurzem gesehen. In einem Video-Chat. Sie trugen Damenunterwäsche und masturbierten. Da<br />
läuft er rot an und wird aus irgendeinem Grund verlegen. Als wäre er das wirklich gewesen. Aber nein,<br />
Herr Professor, der war ohne Brille. Es war ein anderer. Also ehrlich jetzt. Mensch, es war doch nur<br />
ein Scherz. Die Deutschen haben keinen Sinn für Humor. Sie glauben mir nicht? Ich gehe zur Post,<br />
will etwas absenden. Frage: Geht das auch per Brieftaube? Das Fräulein runzelt verwundert die Stirn.<br />
Und beginnt zu erklären, Brieftauben seien schon seit mehreren Jahrhunderten außer Betrieb. Es<br />
gehe nur per Auto. Verdirbt mir einfach die ganze Romantik ... Dabei war der Brief für meine Liebste
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
gedacht. So etwas geht nur mit Taubenpost. Oder Folgendes: Ich stehe an der Kasse, um Wodka,<br />
Socken, ein Schachspiel und Präservative zu erwerben. Zahle mit der Karte. Unterschreibe. Die Verkäuferin<br />
vergleicht die Unterschriften. Sieht täuschend echt aus, nicht wahr?, frage ich sie. Ich hab<br />
auch die ganze Nacht geübt ... Aber nein, auch sie hat keinen Sinn für Humor. Ruft die Bullen. Die<br />
fragen mich auf dem Revier: Warum machen Sie solche Witze? – Tja, ich wollte nur aufs Revier gelangen,<br />
ihr Herren Polizisten. In meinem Magen stecken drei Kilo Sprengstoff. Allahu akbar. Die prügelten<br />
mich noch ziemlich lange. Aber erst nachdem die Spezialabteilung abgerückt war. Nein, dieser<br />
Sinn ist den Deutschen einfach nicht gegeben. Später im Krankenhaus fragen die mich: Was möchten<br />
Sie frühstücken? – Gebratene Grashüpfer, antworte ich. Hab ich bekommen. Aber dafür muss<br />
ich jetzt nach Feierabend Sozialdienst leisten, um die Grashüpfer abzubezahlen. Die kamen nämlich,<br />
wie sich herausstellte, aus einem China-Restaurant. Grashopferus seltenus. Eine aussterbende Art.<br />
Bei der Arbeit frage ich: Sag mal, Ramona, im Bankomaten, da sitzt doch so ein lieber Onkel drin<br />
und gibt armen Leuten Geld, nicht wahr? Hat’s nicht kapiert. Rief die Klapse an. Da liege ich also in<br />
der Klapse. Warum auch immer, in der Abteilung für Drogensüchtige. Wird ein Neuer eingeliefert. Der<br />
hängt zwei Tage lang am Tropf und schweigt. Am dritten wacht er auf, macht große Augen und fragt:<br />
Sag mal, Bruder, wo sind wir eigentlich? – Wir fliegen zum Mars, antworte ich. Als Freiwillige. Sechs<br />
Jahre sind bald um. Langsam erwachen wir aus der Anabiose. Geh mal und hol dir beim Expeditions -<br />
leiter einen Raumanzug. Um das Raumschiff verlassen zu können. Den Flur entlang, die vorletzte Tür<br />
rechts. Das heißt, ich schicke ihn geradewegs zum Chefarzt. Er glaubt mir. Marschiert also los. Und<br />
tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Hat wohl das Raumschiff verlassen können ... Als ich entlassen wur -<br />
de, haben alle geweint. Vor Glück und Freude. Komm ich also aus der Klapse raus und stehe an der<br />
Haltestelle. Warte auf die Straßenbahn. Neben mir eine junge Frau. Ich will sie kennenlernen. Klarer<br />
Fall: Das geht am besten mit einem Scherz. Oder mit einem Kompliment. Ich beschließe, beides zu<br />
kombinieren. Also komm ich näher und sag ihr: Du bist so schön wie eine Kalaschnikow ... Und gleich<br />
dazu, bevor sie antworten kann: Erkennst du mich etwa nicht wieder? Haben zusammen in Tschetschenien<br />
gekämpft. Seite an Seite. Waren beide Scharfschützen. Weiß Gott. – Hat’s nicht kapiert.<br />
Ist abgehauen. Und ich hinterher: Sei vorsichtig, Schwester! Die Tschetschenen sind uns auf der Spur ...<br />
Nein, die Deutschen haben keinen Sinn für Humor. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Schließlich bin<br />
ja selbst ein Deutscher. Oder beinahe. Meine Oma hat mit einem deutschen Schäferhund geschlafen.<br />
Aber die Korrespondenz mit dem Sekretär des Redakteurs brach abrupt ab, sobald du das Honorar<br />
erwähnt hast. Auch die Russen haben keinen Sinn für Humor.<br />
4. And a Bottle of Rum<br />
Deutsche Katzen sind wohlgenährt. Wenn ich auf der Straße eine wohlgenährte Katze erblicke, erinnere<br />
ich mich an eine Geschichte, die mir meine Oma erzählt hat. »Ich war sieben Jahre alt, als der<br />
Krieg begann. Wie alle Russlanddeutschen wurden wir vertrieben. Wir waren drei Kinder in der Familie:<br />
ich, mein Bruder Konstantin und meine Schwester Elvira. Was haben wir Kinder uns gefreut, als<br />
uns die Eltern sagten, wir müssten verreisen. Denn wir waren bis dahin nie fort gewesen und hatten<br />
auch keine Ahnung, dass wir niemals zurückkehren würden. Nach einem kleinen Zwischenhalt im Kaukasus<br />
wurden alle Deutschen auf ein vierstöckiges Schiff verfrachtet, das ins Kaspische Meer stechen<br />
sollte. Es hieß, es sei eine Jungfernfahrt, sodass niemand von der Leitung wusste, ob der Tanker<br />
überhaupt seetauglich ist. Darum folgte ihm ein anderes, kleineres, auf jeden Fall sturmfestes<br />
Boot. Die Leute sagten, es sei für die Leiter bestimmt, falls unser Schiff doch sinken sollte. Dabei war<br />
es Herbst, es hat stark gestürmt, der Tanker neigte sich bei jeder Welle und jedes Mal schien es, gleich<br />
geht er unter. Die Menschen hatten Angst, sie weinten, und dann ließ man das Schiff anhalten.<br />
Wenn es stand, wurde es nicht mehr so hin und her geschaukelt. Ich weiß nicht genau, wie lange wir<br />
unterwegs waren, aber es kam mir sehr lange vor. Etliche Menschen starben auf dem Schiff vor Hun -<br />
ger und Krankheit. Die wurden dann über Bord geworfen. Greise und Kinder ... Dem Tanker folgten<br />
immer einige Schweinswale. Eine Frau wollte sich von der Leiche ihrer Tochter nicht trennen, während
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
die Schweinswale den Geruch des toten Mädchens witterten und gegen die Flanken des Schiffs trom -<br />
melten, um es umzustoßen. Also rissen die Leiter ihr die Tochter aus den Armen und warfen sie über<br />
Bord. Kaum war der Leib im Wasser, verschwand er. Nur der schwarze Rücken eines Schweinswals<br />
blitzte kurz auf.<br />
In Astrachan mussten wir in einen Zug steigen, der war eigentlich für den Viehtransport gedacht. Es<br />
gab weder Toiletten noch Schlafgelegenheiten. Die Menschen schliefen und aßen am Boden, hier<br />
verrichteten sie auch ihre Notdurft. Die Fahrt dauerte über einen Monat. Auch hier starben etliche<br />
unterwegs. In Kasachstan wurden wir immer wieder in fremden Häusern untergebracht [das nannte<br />
man Umsiedlung]. Nach diesen Schikanen landeten wir in einem kleinen Badehaus. Vater wurde schon<br />
damals zum Arbeitsdienst einberufen. Ein Überlebender erzählte mir später, Vater hätte einen Fluchtversuch<br />
unternommen. Dabei wurde er gefangen und zu Tode geprügelt. Wir aber mussten die gan -<br />
ze Zeit hungern. Wir zogen von Hof zu Hof und bettelten um wenigstens ein paar Kartoffelschalen.<br />
Mutter briet und zerstampfte sie und kochte daraus eine Suppe. Jeder von uns bekam eine kleine<br />
Schöpfkelle von dieser Brühe, allein Konstantin, der große Bruder, bekam zwei Schöpfkellen. Wir<br />
weinten und fragten, warum er mehr bekomme als wir, und die Mutter erklärte, er sei ein Junge und<br />
brauche mehr, sonst müsste er sterben. Wir antworteten, wir müssten auch sterben. Und bei unserer<br />
Nachbarin starb tatsächlich der Junge ... Auch sie hatte zwei Töchter und einen ältern Sohn. Doch<br />
war die Suppe gerecht unter den Kindern aufgeteilt worden. Später weinte sie und sagte unserer<br />
Mutter: Warum hast du mich nicht gewarnt, dass der Junge zwei Schöpflöffel bekommen soll, vielleicht<br />
wäre er nicht gestorben! Mutter wusste darauf nichts zu erwidern. Eines Tages gingen Oma<br />
und ich in ein Nachbardorf, um dort zu betteln. Da bewarfen uns die Kinder mit Steinen und riefen<br />
uns »Faschisten« nach. Ein Stein traf Oma am Kopf. Sie schaffte es eben noch nach Hause, legte<br />
sich hin, aber stand nicht mehr auf. Und im Winter haben die Wölfe den Hund unserer Nachbarn angegriffen.<br />
Jemand kam ihnen wohl dazwischen, sodass noch etwas übrig blieb. Diese Reste gaben<br />
die Nachbarn uns.<br />
Einmal kam in unser Badehaus eine Katze. Sie sah Konstantin und dachte sich wahrscheinlich, wo<br />
ein Mensch ist, da ist auch Futter. Während Konstantin seinerseits dachte, eine Katze bedeutet etwas<br />
zu essen. Er rief sie vorsichtig, und als sie kam, begann er sie zu würgen. Aber die Katze wollte nicht<br />
sterben. Sie kratzte ihm ein Auge aus, doch er ließ sie immer noch nicht los und drückte umso fester<br />
zu. Er schrie vor Schmerz, aber ließ nicht locker, bis sie tot war. Mama brachte Matlina Paas, eine<br />
Medizinfrau, mit. Die hielt einen Löffel in die Flamme und presste ihn dann gegen das auslaufende<br />
Auge. Dann pflegte sie die Wunde mit irgendwelchen Kräutern und gab Konstantin etwas zu trinken,<br />
was ebenfalls aus Kräutern gemacht war – das sollte seine Schmerzen lindern. Als wir die Katze aßen,<br />
fragte Konstantin zufrieden: Nicht wahr, Mama, jetzt bin ich ein echter Pirat? Alle Welt kannte ihn damals.<br />
Konstantin? Der mit nur einem Auge? Ein guter Mann. So redeten über ihn die Leute.«<br />
5. Die Kunst, Steine bewegungslos zu machen<br />
Anfangs hast du in Deutschland als Möbelpacker gearbeitet. Dann als Elektriker. Bis heute ist es dir<br />
schleierhaft, wie du, völlig untauglich für solcherlei Tätigkeiten, nicht an einem Stromschlag gestorben<br />
bist. Welches Kabel durchschneiden? Das blaue? Das rote? Wie, ein Minenentschärfer, Teufel<br />
noch mal! Dann hast du eine russische Zeitung herausgegeben. Die einzige Einnahmequelle waren<br />
die Werbeanzeigen. Eines Tages brachte ein Reklameagent die Anzeige eines russischen Autoverkäufers.<br />
Eine Woche nach dem Erscheinen des Blattes wurde der Händler verhaftet. Er hatte wohl mit<br />
gestohlenen Fahrzeugen gehandelt. An dem Einsatz nahmen etwa zweihundert Polizisten teil. Sowie<br />
einige Hubschrauber. Damit war die Zeitung erledigt. Sprachkurse hast du keine bekommen, schließ -<br />
lich hattest du sie schon zuvor besucht. Und zwar ein ganzes halbes Jahr lang. Das schimpfte sich<br />
Stufe A 1. Und so kamst du zur Uni: ohne Deutschkenntnisse. Die Dozenten freuten sich von Herzen,<br />
als dein Studium abgeschlossen war. Jetzt hast du den Titel eines MA in Slawistik und Schulden bei<br />
der Bank.
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
6. Wir, die Europäer<br />
Nichts bindet die Menschen stärker zusammen als gemeinsame Arbeit. Blut und Schweiß. Blut von<br />
den geplatzten Schwielen an den Händen. Schweiß [in Kasachstan haben wir im Winter oft eine Tem -<br />
peratur von minus fünfundvierzig Grad und der Schweiß gefriert im Gesicht zu einer dünnen Kruste].<br />
Da war es absolut egal, wer du bist: ein Russe, ein Kasache oder ein Deutscher. Der Arbeitseifer ver -<br />
band alle miteinander. In Deutschland herrscht Arbeitslosigkeit. Ein guter Teil der Russen, der Türken,<br />
der Deutschen sitzen zu Hause und hassen einander im Stillen. Die Deutschen hassen die anderen<br />
im Stillen dafür, dass sie Arbeitslosengeld kassieren. Wenn die anderen jedoch arbeiten gehen, dann<br />
heißt es, dass sie den Deutschen ihre Arbeitsplätze wegnehmen. Die anderen mögen die Deutschen<br />
nicht, weil diese so arrogant sind. Und auch nicht besonders kontaktfreudig. Ja, Deutschland ist ei -<br />
ne geschlossene Gesellschaft. Die Fremden stehen verzweifelt im Abseits und rauchen. Verrauchen<br />
das ganze Geld der arbeitenden deutschen Steuerzahler. Und der Ausweg? Du glaubst, ihn gefunden<br />
zu haben: ein vierstündiger Arbeitstag. Zumal eine Volksweisheit sagt, die Sklaverei sei nicht aufgehoben,<br />
sondern lediglich durch achtstündige Arbeitstage ersetzt worden. Natürlich wurden über den<br />
vierstündigen Arbeitstag bereits unzählige Bücher geschrieben, die alle Vor- und Nachteile aufzeigen.<br />
Für den größten Vorteil hältst du zum Beispiel das inflationäre und abgenutzte Wort »Integration«.<br />
Und wenn der Strom der Emigranten und Aussiedler aus Osteuropa allmählich nachlässt, so wird doch<br />
die Flut der Leute aus Afrika und dem Nahen Osten größer und größer. Aber Gott sei Dank bist du<br />
kein Politiker.<br />
Europa will ein gemeinsames Haus Europa errichten. Die Geschichte kennt da einige Präzedenzfälle.<br />
Der älteste ist wohl der Turmbau zu Babel. Was Gott damals tat, das wissen wir alle. Nun, solange<br />
Europa keine einheitliche Staatssprache hat, wird daraus nichts werden. Dasselbe betrifft die Identität.<br />
Solange in deinem Ausweis steht, du bist ein Deutscher, ein Franzose, ein Türke oder ein Russe,<br />
wirst du kein Europäer sein. Ja, im Pass sollte »Europäer« stehen. Das ist ein unumgängliches Opfer.<br />
Denn alle Umbrüche geschehen zuerst im Bewusstsein. Dort beginnt auch die Integration eines<br />
jeden einzelnen Staatsbürgers in ein gemeinsames europäisches Bewusstsein.<br />
7. Warum die UdSSR zugrunde ging oder: Hallo, Georgi Petrowitsch<br />
In der UdSSR gab es alles. Fast alles. Es gab eine gemeinsame Sprache, es gab einen gemeinsamen<br />
Glauben – an Lenin und an seine Ideen. Der Glaube an eine ephemere Zukunft unter der Bezeichnung<br />
»Kommunismus« ersetzte den Glauben an Gott. Nur eine Kleinigkeit gab es nicht: Es gab keine<br />
Milch und keine Wurst. Diese Kleinigkeit aber war entscheidend. Du weißt es noch ganz genau, wie<br />
du morgens um fünf aufstehen musstest, um Milch für ein neugeborenes Brüderchen zu kaufen.<br />
Das Geschäft öffnete um sieben, aber es galt, schon viel früher dort zu sein, um sich einen Platz in<br />
der Schlange zu sichern. Denn für alle reichte Milch nur auf dem Papier: Es gab da entsprechende<br />
Tabellen in Erdkunde-Lehrbüchern. Tja, in Wirklichkeit mussten die Menschen draußen bei minus drei -<br />
ßig oder minus vierzig Grad über zwei Stunden lang frieren. Und sobald das Geschäft öffnete, wur de<br />
es im Sturm genommen, wie der Winterpalast 1917. Das Gedränge war derart stark, dass die Blechkanne<br />
deinen noch schwachen neunjährigen Händen von hungernden Volksmassen regelrecht entrissen<br />
wurde, sie verschwand dann im brodelnden Menschenstrudel. Wurst und Butter bekam man nur bei<br />
Vorlage von speziellen Lebensmittelkarten. Ein Kilo Wurst pro Person pro Monat. Und ein halbes<br />
Kilo Butter.<br />
In der Schule warst du ein Politaufklärer. Einige entfernte Verwandte und Freunde der Familie lebten<br />
bereits, trotz des Eisernen Vorhangs, in Deutschland. Und eines Tages [da warst du dreizehn Jahre<br />
alt] führtest du eine Informationsveranstaltung durch, bei welcher du über die Vorzüge des Lebens<br />
im Kapitalismus am Beispiel einfacher Arbeiter sprachst. Eigentlich nichts Besonderes. Du hast bloß<br />
die Einkommenshöhe verglichen sowie einige Kostenfaktoren. Milch, Wurst, Fleisch, Kleidung. Das<br />
Ganze war dann ein Riesenskandal. Man wollte dich gleich der Schule verweisen. Aus dem Bund<br />
der Pioniere rauswerfen. Erschießen, erhängen, in den Gulag schicken. Doch leider warst du noch
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
keine vierzehn. Und somit noch nicht strafmündig. Die darauffolgende politische Informationsveranstaltung<br />
wurde vom Historiker und Geografen Georgi Petrowitsch durchgeführt. Er bewies anhand<br />
von Tabellen sehr eindrucksvoll die Vorzüge des Lebens im Sozialismus. Bei dieser Veranstaltung wa -<br />
ren sowohl der Schuldirektor als auch der pädagogische Leiter zugegen. Bei jedem Wort von Georgi<br />
Petrowitsch nickten sie zustimmend. Aber kaum war der Eiserne Vorhang gefallen, da reiste Georgi<br />
Petrowitsch nach Deutschland aus. Wohlgemerkt: als einer der Ersten. Es stellte sich heraus, dass<br />
seine Frau eine Russlanddeutsche war. Es heißt, er sei jetzt irgendwo hier in einer leitenden Position.<br />
Zwar in keiner besonders wichtigen, aber immerhin in einer leitenden.<br />
Doch es waren nicht Wurst und Butter, woran die Sowjetunion zerbrach. Du vermutest [und es ist<br />
nicht nur deine Meinung], das Sowjetsystem mit seiner Propaganda wurde von den Beatles besiegt.<br />
Oder genauer: von jenem Geist der Freiheit, der in ihren Lieder wehte.<br />
8. Die neue Religion zum privaten Gebrauch<br />
Nun, der Kommunismus verlor für dich an Reiz, als du noch ein Teenager warst. Aber auch andere<br />
Religionen fanden keinen Platz in deinem Herzen. Also hast du dir eine eigene ausgedacht. Sozusagen:<br />
zur inneren Anwendung. Ra-Yoga oder Sonnenyoga. Yoga für Astralreisende. Im Prinzip überhaupt<br />
nichts Neues. Eine Synthese aus Agni-Yoga, einer Reihe tibetischer Übungen zum Erwecken<br />
des Kundalini und der Techniken zum Betreten der astralen Welt. Überhaupt nichts Neues. Im Prinzip.<br />
In alten Zeiten beherrschten das alle Jungs. So bist du dir sicher, dass die geheimnisvollen Zeich -<br />
nungen aus der Wüste Nazca in Südamerika von den Burschen zur Orientierung während ihrer Astral -<br />
reisen verwendet wurden. Dasselbe gilt für ägyptische Pyramiden. Du bist überzeugt, dass selbst<br />
Nostradamus dieses Wissen nutzte, als er seine Prophezeiungen schrieb. Keine Astrologie, allein die<br />
Astralwelt. Er verließ seinen Körper und tauchte in die Zukunft. Da liegt alles ganz offen auf der Ober -<br />
fläche. Es ist, als würde er dort noch jetzt von seinem 16. Jahrhundert aus schreiben. Irgendwann<br />
muss ich ihn mal besuchen.<br />
9. Russland<br />
Im Grunde glaubst du, dass an allem, was gerade in Russland geschieht, die USA und Europa schuld<br />
sind. Denn wo bewahren diese Menschenartigen und der Tyrann selbst ihr Geld auf? Richtig, in euro -<br />
päischen Banken. Hier kaufen sie Immobilien en gros, hier erholen sie sich von ihrer netten Beschäftigung<br />
– dem Diebstahl. Hier schicken sie ihre Sprösslinge zur Ausbildung hin ...<br />
Aber von Russland sollte man besser in Versen sprechen:<br />
Ich habe dir den Weg gezeigt, oh Wanderer ...<br />
Aber mein Finger schmerzt vor Eiseskälte ...<br />
Du suchst nach Gott ... mein Gott ... dann sei es selber ...<br />
Ich wär es selbst ... wär ich nur etwas jünger ...<br />
Du suchst nach Wahrheit? Die ist schlicht, mein Junge ...<br />
Hier ist sie, in zwei Worten, wenn ich mich<br />
noch recht entsinne: Es ist Sturm ... eine Galeere ...<br />
Es wankt der Mast ... und wir sind angekettet ...<br />
Du fragst nach Liebe ... Gut, so höre zu:<br />
Du brauchst dein Leben lang keinen zu lieben ...<br />
Liebe ist schön, doch sind Hetären schöner ...<br />
Vielseitiger, wenn auch ein wenig teurer ...<br />
Der Sinn des Lebens? Nun, ein blanker Unsinn ...<br />
So in der Art: Du sollst in Würde sterben ...<br />
Und dann? Die Götter, die du angebetet,
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
die nehmen dich in ihrer Hölle auf ...<br />
Zeter und Fluch ... Hier aber waltet Cäsar ...<br />
Und wie ein Weib liegt unter ihm Judäa ...<br />
Wir sind nur Pöbel, dem Visionen fehlen ...<br />
Und Gott in Rom ist lasterhaft und böse ...<br />
Und rings Visagen abgestumpfter Sklaven ...<br />
Und römische geharnischte Kohorten ...<br />
Was also tun? Geh, kauf dir eine Eselin ...<br />
Steig auf und reite in die nächste Stadt ...<br />
10. Liebe<br />
Herrn<br />
Dr. med Thomas Paschke<br />
Schlehenweg 30<br />
04329 Leipzig<br />
Abteilung für innere Medizin,<br />
Neurologie und Dermatologie<br />
Universitätsklinik Leipzig<br />
Reanimation<br />
Leitender Arzt<br />
Sirak Petros<br />
Leipzig, den 23. April 2011<br />
Patient: Anatolij Grinvald<br />
Geburtsdatum: 30. Juni 1972<br />
Vorgang: 0012837717<br />
Sehr geehrter Herr Dr. Paschke,<br />
anbei einige Informationen über den Patienten, der vom 22.04.2011 bis zum 23.04.2011 in stationärer<br />
Behandlung war.<br />
Aktuelle Diagnose:<br />
Koma vom übermäßigen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum<br />
Alkohol- und Tablettenvergiftung<br />
Prozedur<br />
8-930<br />
Verlauf:<br />
Herr Grinvald wurde mit einem Verdacht auf Vergiftung in die Reanimation eingeliefert. Er wurde von<br />
der Polizei im unansprechbaren Zustand vor seiner Wohnungstür aufgefunden. Äußere Verletzungen<br />
wurden nicht festgestellt. In der Wohnung fand sich eine leere Packung Seroquel sowie eine leere<br />
Packung Zolpidem. Anfangs zeigte der Patient keine Reaktion auf äußere Reize. Dank der von uns<br />
durchgeführten Maßnahmen konnte sein Zustand deutlich verbessert werden. Dennoch blieb die Ori -<br />
entierungfähigkeit nach wie vor stark beeinträchtigt. Nach Aussage des Patienten hat er nach einem<br />
Streit mit seiner Freundin zwei Flaschen Wein getrunken, konnte nicht einschlafen und nahm 2–3
,<br />
ANATOLIJ GRINVALD EUROPE NOW<br />
Zolpidem-Tabletten ein. Wie er das Bewusstsein verlor, daran erinnert er sich nicht. Bei seiner Befragung<br />
wies Herr Grinvald den Verdacht eines Selbstmordversuchs zurück. Bei einer Stabilisierung sei -<br />
nes Zustands werden wir Herrn Grinvald zur weiteren Beobachtung an Sie überweisen.<br />
11. Ein gewöhnliches Wunder<br />
Ja, du bist nicht mehr der Jüngste. Früher konntest du mit Leichtigkeit fünf, sechs Tage ohne Essen<br />
auskommen. Jetzt schaffst du mit Mühe drei oder vier. Jesus kam auf vierzig Tage, so schreiben es<br />
seine Biografen. Cooler Typ. Den muss ich mal besuchen. Aber für den Anfang sollte ich leere Flaschen<br />
in Brot verwandeln. Im Supermarkt, fünf Minuten von hier. Sieben leere Bierflaschen. Fünfundsechzig<br />
Cent. Das reicht für eine Packung Brötchen.<br />
Du gingst auf die Straße und da war sie. Eine Katze. Wohlgenährt. Genauso wie alle deutschen Katzen.<br />
»Mieze-Mieze«, riefst du sie vorsichtig. Sie blieb einige Sekunden lang nachdenklich stehen und<br />
überlegte, ob sie kommen soll, und tat dann voll Grazie einen Schritt auf dich zu. Du wolltest sie<br />
doch nur streicheln. Nur streicheln.<br />
[Übersetzt aus dem Russischen von Alexander Nitzberg]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
SERGEJ TIMOFEJEV<br />
GIB MIR EINEN KUSS AUF DIE NASE,<br />
EUROPÄISCHE FRAGE!<br />
Wenn Sie sich entschließen, ein Haus zu bauen,<br />
rufen Sie bei der Polizei durch. Wenn Sie sich mit der Absicht tragen,<br />
einen Kuchen zu backen, lassen Sie einfach eine Strickleiter<br />
aus dem Fenster herab. Wenn Ihnen die<br />
Augen tränen, genügt es, drei Radkappen zu kaufen<br />
und sie einen Hügel hinunterzurollen.<br />
Der fernste Ort, den die Radkappen erreichen,<br />
bezeichnen Sie mit Rom.<br />
Die Rinde des gebackenen Kuchens bezeichnen Sie mit Athen.<br />
Das Zimmer im Haus, wo ein Korbsessel und ein Radio stehen,<br />
bezeichnen Sie mit Berlin.<br />
Dann nehmen Sie am Fenster in der Küche Platz,<br />
kneten melancholisch Brotkügelchen zwischen ihren Fingern<br />
und machen sich so Ihre Gedanken zu Europa. Hat es eine Zukunft?<br />
Sind die Europäer einander verbunden? Sollte ich mir einen neuen Herd anschaffen?<br />
Gibt es Menschen, deren Hautfarbe dunkler ist als meine? Sollte man sie<br />
überhaupt die Schwelle der Wohnung übertreten lassen? Wird das Jahr 2055 ein glückliches?<br />
In mein eigenes europäisches Land jedenfalls rollen Lastzüge<br />
aus Deutschland mit massiven Eichentischen, Stühlen mit gedrechselten Füßen,<br />
Kästen mit Bierkrügen, Kerzenhaltern, Kaffeemühlen nebst Puppen<br />
aus den Siebzigern.<br />
Das alles wird zu Billigpreisen verramscht. Auch ich suche in diesen Haufen<br />
nach Verstärkern und Geschirr für Picknick-Ausflüge im Sommer.<br />
Versuche ich jedoch zu begreifen, welch ein Teil dieser Welt Europa ist<br />
und wie wir diesen verstehen sollen, finde ich mich vor einer<br />
kilometerlangen und stummen Mauer, der Europäischen Mauer, der<br />
Mauer meiner eigenen Unfähigkeit, der Mauer eines tiefen Unverständnisses, wieder.<br />
Ich frage mich: Was geschieht tatsächlich,<br />
was verbirgt sich hinter den Ereignissen und wie erreichen wir trocken<br />
das rettende Ufer?<br />
Sollte ich etwa den gesamten Karl Marx durchlesen? Mich in die Werke<br />
des heiligen Augustinus vertiefen? Auf die Straße gehen oder es mir<br />
im Zimmer in meinem Korbstuhl vor dem Radio gemütlich machen?<br />
Ich knabbere die Rinde des Kuchens auf. Das ist mein Athen.<br />
Ich werfe mit Steinen auf die Radkappen. Das ist mein Rom.<br />
Da taucht hinter dem Hügel ein Alter auf,<br />
in Leinenhosen mit Hosenträgern.<br />
In der einen Hand hält er eine Uhr an einer Kette, in der anderen –<br />
einen Stapel weißer Flyer, worauf zu lesen ist:
,<br />
SERGEJ TIMOFEJEV EUROPE NOW<br />
»Europa ist eine Handvoll Regeln<br />
des Zusammenwohnens<br />
in dicht besiedelten Gebieten<br />
[für die Millionen Menschen ihr Leben ließen].<br />
PS. Vergesst das nicht.<br />
PPS. Versucht, das nicht zu vergessen.«<br />
»Ist das nicht ein wenig naiv, Opa?«, frage ich ihn.<br />
»Die Zeiten haben sich geändert …«<br />
Da fördert der Alte aus der Gesäßtasche<br />
seiner Leinenhose eine Tüte mit billigen Bonbons zutage<br />
und drückt sie mir in die Hand:<br />
»Hier, mein Guter, mir fällt keine Antwort ein,<br />
mir fällt einfach nichts Besseres ein …«<br />
[Übersetzt aus dem Russischen von Martina Jakobson]
,<br />
12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />
JANNE TELLER<br />
EUROPA –<br />
WER BIST DU? WER MÖCHTEST DU SEIN?<br />
Wir brauchen eine echte europäische Identität, ein Ideal, das Europa heute und in Zukunft zusammen -<br />
hält. Ich schlage vor: diskrete Qualität.<br />
»Wann wird man Europäer? Wie denkt ein Europäer? Wie sieht ein Europäer aus? Wie klingt ein Euro -<br />
päer? Wie riecht, fühlt, schmeckt ein Europäer …?« Das fragt ein Kriegschirurg aus der Karibik in ei -<br />
nem meiner Romane wie ein Echo der Fragen, die ich von vielen Nichteuropäern rund um den Erdball<br />
gehört habe. Unterdessen habe ich so gut wie nie gehört, dass sich Europäer über gemeinsame<br />
Charakteristika Gedanken gemacht haben. Dagegen scheinen wir in ganz Europa – und das leider in<br />
steigendem Maße – davon besessen, unsere nationalen Identitäten zu definieren und zu verteidigen,<br />
ohne zu berücksichtigen, dass das ein überholtes und in die Vergangenheit gerichtetes Bestreben ist,<br />
das im Vorhinein zum Scheitern verurteilt ist, während es einen Glückschrein der Pandora für Extremisten<br />
öffnet, denen die derzeitige Desorientierung ein schönes Leben im Überfluss ermöglicht.<br />
Und was noch schlimmer ist: Es lässt Europas gemeinsame und somit unser aller Zukunft in den Hän -<br />
den von Politikern und Technokraten, die größtenteils bereits demonstriert haben, dass sie – beziehungsweise<br />
das System, in dem sie operieren – sich nicht um unsere Zukunft kümmern können.<br />
Die Wirtschaftskrise – kombiniert mit einem kleinen, aber stetigen Strom von Immigranten und Flücht -<br />
lingen aus weniger wohlhabenden Teilen der Welt – hat den Schleier vor einem Europa gelüftet, das<br />
in den fünfzig Jahren seiner vereinten Existenz nur eine geringe gemeinsame Identität und Solidarität<br />
entwickelt hat. Die Geschichte des Kontinents scheint vergessen und die Führer der europäischen<br />
Staaten verfallen mit wenigen Ausnahmen einer nationalistischen und xenophoben Rhetorik. Es ist<br />
die Intoleranz der radikalen Rechten, angeführt von Leuten wie Marine Le Pen, Geert Wilders und<br />
Pia Kjærsgaard, die die Tagesordnung der Mainstreampolitiker festsetzen, und nicht umgekehrt. In<br />
Teilen Osteuropas haben ehemalige Bürgerrechtsvorkämpfer wie der ungarische Staatsminister Viktor<br />
Orbán und der slowakische Staatsminister Robert Fico die freie Marktwirtschaft so gut studiert, dass<br />
sie kurzen Prozess gemacht haben: die Rhetorik der radikalen Rechten ist heute ihre eigene Machtbastion.<br />
Doch was gaukeln wir uns vor, welche Probleme unsere populistischen Politiker für uns lösen, wenn<br />
sie in die nationalen Exklusionstrompeten blasen – heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts?<br />
Ungeachtet, ob wir das wollen oder nicht, leben wir bereits in einer multikulturellen Welt [sehen Sie<br />
sich um, wenn sich nicht jemand noch einen Völkermord in Europa wünscht, wird sich daran nichts<br />
ändern]. Europas Staaten sind heute so miteinander verflochten und voneinander abhängig, dass<br />
wir keine wesentlichen Probleme in einem Land lösen können, ohne auf Europa als Ganzes zu schauen.<br />
Ob wir das wollen oder nicht, wird der Druck auf Europas Grenzen kontinuierlich zunehmen, solange<br />
es wesentliche Unterschiede im Lebensstandard und in der Sicherheit zwischen uns und anderen Tei -<br />
len der Welt gibt. Ob wir es wollen oder nicht, tragen wir einen nicht unwesentlichen Teil der Verantwortung<br />
für unsere weniger begüterten Mitmenschen, nicht nur weil unser Teil der Welt reicher ist, son -<br />
dern auch weil wir, die Europäer, mit der Globalisierung angefangen haben. Dem jahrhundertelangen<br />
brutalen Kolonialismus folgten Jahrzehnte des rauen Kalten Kriegs und der wirtschaftsegoistischen<br />
Aufteilungspolitik. Natürlich ist ein Teil der Probleme von lokaler Beschaffenheit. Doch der größte Teil<br />
der Diktatoren, vor denen die Menschen flüchten [oder gegen die sie im »arabischen Frühling« zurzeit<br />
aufbegehren], wird direkt oder indirekt von unseren europäischen Regierungen unterstützt.<br />
Statt der derzeitigen Parolen wie »Haltet sie draußen«, »Schickt sie zurück«, »Wer hierher kommt, muss<br />
genauso werden wie wir« und »Schieb das Problem [ = die Menschen und/oder die Länder in Not]<br />
deinem Nachbarn zu« oder »Die Deutschen bezahlen!« brauchen wir eine seriöse, weitsichtige und<br />
allumfassende Vision für ein EUROPA DER BÜRGER, die sowohl für Europa als auch für die Welt außerhalb<br />
Europas die Bedürfnisse Europas abdeckt, die aus fünf Hauptelementen bestehen:<br />
I. EUROPÄER SEIN<br />
Wir als Europäer müssen zuallererst Europa annehmen! Vergessen Sie Technokraten, Politiker und Ver -<br />
träge und erinnern Sie sich, was Europa zuallererst ist: unsere Region, die wir bevölkern und von der
,<br />
JANNE TELLER EUROPE NOW<br />
wir abhängig sind, ungeachtet, ob wir im Süden, Norden, Osten oder Westen leben. Es gibt sehr viel<br />
mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ein Großteil von uns hat [wie auch ich] eine gemischte<br />
DNA und Kultur über nationale Grenzen hinweg, genau wie auch unsere Geschichte, unsere Traditionen<br />
und unsere Kultur das haben. Wie viel [über einige unserer Sprachen hinaus] kann real einer und<br />
nur einer Nation zugeordnet werden?<br />
Nationalstaaten sind ein Konstrukt. Die meisten existieren nicht länger als ein paar Jahrhunderte. Die<br />
gefühlsmäßigen Bande, die wir zu unserer Herkunftsregion, der Landschaft und der Lebensweise<br />
knüpfen, würden auch ohne eine nationale Zugehörigkeit bestehen. Es ist lediglich unsere Identifikation<br />
mit dem Illusionsbukett aus den Charakteristika, die wir gelernt haben, mit unserem Nationalstaat<br />
zu verbinden, die sich uns eher dem Nationalbegriff als unserem Kontinent ]und was das angeht,<br />
unseren Mitmenschen] zugehörig fühlen lässt.<br />
Der Umzug in einen anderen Nationalstaat macht einen nicht zu einem anderen Menschen, obwohl<br />
man sich notwendigerweise vielleicht anders verhalten muss, um sich verständlich zu machen und<br />
in die andere Kultur einzupassen. Weil unsere inneren menschlichen Charaktereigenschaften ungeachtet<br />
unserer Nationalität dieselben bleiben. Ob man ein guter Mensch ist oder nicht, ehrlich, mutig,<br />
höflich, fleißig, großzügig oder geizig, manipulierend, boshaft, faul, feige und so weiter – das hat mit<br />
den persönlichen Charakterzügen zu tun, egal welcher Sprache und welcher kulturellen Codes man<br />
sich bedient. Und nicht damit, bei welcher Fußballnationalmannschaft man Tränen in den Augen hat,<br />
wenn sie gewinnt.<br />
Wenn wir verhindern wollen, dass Europa mit allem, was sich daraus ergeben kann, auseinanderbricht,<br />
müssen wir uns jetzt entscheiden, an erster Stelle Europäer zu sein und dann erst Staatsbürger. Jetzt<br />
müssen wir zeigen, dass wir eine Gemeinschaft und bereit sind, einander beizustehen. Statt bei dem<br />
Projekt Europa die Handbremse zu ziehen, sollten sich wirtschaftlich stärkere Länder außerhalb der<br />
Eurozone wie unter anderem Dänemark ihm anschließen. Wir müssen dem tschechischen Präsidenten<br />
Václav Klaus und Gleichdenkenden erklären, dass seine Skepsis gegenüber Europa in den Müllcontainer<br />
für verdorbenes Essen und längst überholte politische Optionen gehört.<br />
Die Bevölkerung Europas muss hier und jetzt zusammenstehen und von ihren Politikern fordern, dass<br />
sie den Rahmen unseres Europas nicht einschränken. Die Wirtschaftskrise darf keine Entschuldigung<br />
dafür sein, Europa zugunsten eines neuen Nationalismus zu zerstören. Die Krise muss dort gelöst<br />
werden, wo sie entstanden ist: im Finanzsektor!<br />
Das Scheunentor für wahnsinnige Pyramidenspiele aus finanziellen Spekulationen, das die Deregulie -<br />
rung des Finanzsektors geöffnet hat, muss wieder geschlossen werden. Nicht Europas Grenzen!<br />
II. ETHISCH ZUSAMMENHÄNGENDE POLITIK<br />
Europa braucht einen zusammenhängenden und ethisch verantwortlichen wirtschaftlichen und politischen<br />
Zugang zu der Welt außerhalb Europas – egal was uns das auf kurze Sicht kostet. Das ist die<br />
einzige Art und Weise, wie wir auf längere Sicht in Übereinstimmung mit den demokratischen Werten,<br />
für die wir zu stehen behaupten, zu einem würdigen Europa kommen können. Das ist auch – wenn<br />
man das will – die einzige Art und Weise, wie wir jemals auf eine mitmenschlich verantwortliche Wei -<br />
se den Strom von Flüchtlingen und Immigranten nach Europa eindämmen können.<br />
Keine Zäune können verzweifelte Menschen, die oft mehrere Jahre unterwegs waren und die ihr Le -<br />
ben aufs Spiel gesetzt haben, um über das Mittelmeer zu kommen, davon abhalten, einen Weg nach<br />
Europa hinein zu finden. Doch selbst wenn eine ausreichend hohe, mit Stacheldraht versehene Betonmauer<br />
wirklich notleidende Menschen draußen halten könnte, wollten wir so leben? Eingezäunt<br />
in unserem reichen Tennisklub auf der »richtigen« Seite eines globalen Apartheidssystems? Zu was<br />
für [Un-]Menschen macht ein solches System uns selbst?<br />
Es geht nicht darum, extrateure Pflaster aus Entwicklungshilfe auf blutende Wunden zu kleben. Wir<br />
müssen unsere Handelsregime überprüfen, unsere Agrarpolitik, unsere Wirtschafts-, Umwelt- und Kli -<br />
ma politik usw. und nicht zuletzt unsere politischen Allianzen und sehen, welche den Menschen dienen<br />
und welche nicht.<br />
Wir müssen von unseren Regierungen und Unternehmen fordern, dass sie nicht länger in Diktaturen<br />
investieren oder diese mit Militärhilfe und auf andere Weise unterstützen. Ebenso müssen wir unser
,<br />
JANNE TELLER EUROPE NOW<br />
Handelssystem radikal umstellen, sodass ein gleiches Zollsystem für Rohwaren und verarbeitete Wa -<br />
ren geschaffen wird, in dem besonderes Gewicht darauf gelegt wird, dass die verarbeiteten Mineralien,<br />
Landwirtschaftsprodukte, Textilien und anderes, mit dem die armen Länder mit uns konkurrieren<br />
können, nicht auf unüberwindbare Handelshindernisse treffen. Gleiches gilt für alle anderen Gebiete:<br />
Wie können wir behaupten, an die Menschenrechte und die Gleichberechtigung der Frau zu glauben,<br />
wenn wir weiterhin schamlos Öl in Saudi-Arabien kaufen und so das frauenfeindlichste Regime der<br />
Welt unterstützen? Wie können wir behaupten, dass wir die Umwelt schützen wollen, wenn wir unsere<br />
giftigen und chemischen Abfälle in ungeschützten Müllkippen im Senegal, in Nigeria und anderen<br />
Ländern Afrikas entsorgen?<br />
III. FUNKTIONALITÄTSBASIERTE INTEGRATIONSPOLITIK<br />
Wir brauchen einen inkludierenden, einen einschließenden Zugang für unsere neuen Mitbürger, der<br />
auf Funktionalität basiert. Ziel muss es sein, allen die Möglichkeit zu geben, zu aktiven Bürgern in<br />
Europa zu werden und sich als positiver Teil ihrer neuen Heimat zu fühlen.<br />
Statt endlos Kultur- und Religionsunterscheide zu diskutieren [jede Religion lässt sich auf ebenso vie -<br />
le Arten interpretieren, wie sie Anhänger hat], muss sich eine neue europäische Integrationspolitik<br />
auf Funktionalität konzentrieren: Wenn ein Verhalten – und das ungeachtet der kulturellen oder religi -<br />
ösen Begründung – gegen die demokratischen oder die Freiheitsrechte des einzelnen Menschen ver -<br />
stößt oder auf eine andere Weise unvereinbar ist mit der Funktion der Gesellschaft, kann es nicht ak -<br />
zeptiert werden. Umgekehrt besteht kein Grund, eine Verhaltensweise überhaupt zu diskutieren, wenn<br />
sie nicht gegen diese verstößt.<br />
Auf dieser Grundlage lassen sich viele emotionsbelastete Dilemmata ganz einfach auflösen: Die Beschneidung<br />
von Mädchen ist sowohl Kindesmisshandlung als auch ein Verstoß gegen das Recht der<br />
einzelnen Frau, über ihren Körper selbst zu bestimmen, und kann deshalb nicht geduldet werden.<br />
Sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe ist im Gegensatz dazu eine Entscheidung, über die sich »Nichtsexuell-Enthaltsame«<br />
nicht zum Richter machen dürfen. Einer mündigen Person mit einer Zwangsehe<br />
zu drohen ist ebenso inakzeptabel wie alle anderen Formen von Bedrohung und Zwang. Burkas<br />
stellen in Europa ein Problem dar, weil bei uns die Gesichtskennung der Identifikation dient. Deshalb<br />
kann die Verschleierung des Gesichts in öffentlichen Räumen nicht akzeptiert werden. Hijab [oder was<br />
das angeht, Kreuz, Kalotte, Turban], Verzicht auf Schweinefleisch, Halal oder koschere Speisen, Moscheen,<br />
muslimische Grabstätten usw. verstoßen dagegen in keiner Weise gegen die Funktion der Ge -<br />
sellschaft, hier geht es genau wie bei anderen Fragen lediglich um persönliche Entscheidungen. Gewalt<br />
oder die Androhung von Gewalt ist inakzeptabel, ungeachtet von wem, gegen wen oder aus<br />
welchem Grund.<br />
IV. EUROPÄISCHE IDENTITÄTSDEFINITION: DISKRETE QUALITÄT<br />
Um irgendetwas des Vorgenannten verwirklichen zu können, benötigen wir eine klare Idee, was es<br />
heißt, Europäer zu sein: eine europäische Identitätsdefinition, die für uns alle Platz hat – nicht zuletzt<br />
für alle neu hinzugekommenen Europäer.<br />
Der Grund dafür, dass die USA sehr viel leichter Immigranten absorbieren können als Europa, ist der,<br />
dass ihre Identitätsdefinition fluid ist, sodass sie alle Menschen, ungeachtet ihres Hintergrunds, annehmen<br />
können: The American dream to make it.<br />
In Europa definieren die einzelnen Länder und Subkulturen sich in kleinen normativen Schubladen, ab -<br />
hängig davon, wie wir gekleidet sind, beten [oder nicht], Weihnachten und andere Feste feiern, von un -<br />
seren Traditionen und Vorvätern, unserer Geschichte. Eine Identitätsdefinition, die so verknöchert ist,<br />
dass sie Risse bekommt, sobald sie in Kontakt mit anderen Normen gerät. Zugleich kann die dazugehörige<br />
persönliche Selbstdefinition sich den neuen Kulturen, die jetzt unsere Region bewohnen,<br />
weder anpassen noch diese absorbieren. »Ich bin Däne, deshalb bin ich weiß, Christ, esse Schweinefleischfrikadellen<br />
und trinke Bier, habe Sex, bevor ich fünfzehn bin, feiere Weihnachten und Os tern,<br />
habe Ahnen, die auf einem Hof gelebt haben, und trage, egal ob ich ein Junge oder ein Mädchen<br />
bin, Jeans …«
,<br />
JANNE TELLER EUROPE NOW<br />
Wir brauchen eine europäische Identität, auf die sich alle beziehen können, ungeachtet ihrer Hautfarbe<br />
oder Kultur, Religion, ihrer Traditionen, Ess- oder anderer Gewohnheiten.<br />
Nachdem ich in vielen Ländern in und außerhalb von Europa gelebt habe, schlage ich als besonderes<br />
Kennzeichen unserer Region die besondere Freude an »Diskreter Qualität« vor. Wir prahlen nicht<br />
[wenn wir am besten sind!], wir brauchen nicht das Größte, das Schnellste oder das Reichste, wir brau -<br />
chen es vor allem nicht zu zeigen; wir lieben die ganz eigene Schönheit der Diskretion, die Grö ße,<br />
die in echter Qualität liegt, die Aufmerksamkeit dem Detail gegenüber, das gerade eben mit den Sinnen<br />
erahnt wird, das man jedoch nicht laut hinausposaunt.<br />
Diese Suche nach diskreter Qualität hat sich zeitgleich mit der Entwicklung unserer europäischen Ku -<br />
ltur, unserer Architektur, unserer Denker und unserer Kunst über die Jahrhunderte entwickelt. Man<br />
trifft sie überall, in den Mustern des Parkettbodens, in Kristallglas und Porzellan, in Möbeln, Mode,<br />
Essen, Skulpturen, Filmen, Städteplanung, Gartenbepflanzung und nicht zuletzt in unserem Verhalten.<br />
Diskrete Qualität ist kein verschließender äußerer Rahmen, sondern ein inneres Ideal. Nationale und<br />
lokale Eigenheiten Europas sind nicht bedroht, sondern erhalten mehr Platz in dem Augenblick, in<br />
dem sie sich öffnen und auch was andersartig ist innerhalb ihrer eigenen Lokalität Platz einräumen.<br />
Zu dem Stolz, den wir angesichts unserer schönsten Schlösser und besten Philosophen, unserer Wei -<br />
ne und unserer Literatur empfinden – und nicht zuletzt zu dem Stolz auf deren unfassbare Variations -<br />
breite –, können alle neu hinzugekommenen Europäer auf die eine oder andere Weise beitragen: mit<br />
einer besonders verlockenden afghanisch-europäischen Musik, einem besonders interessanten afrikanisch-europäischen<br />
Möbelstück, einer schönen arabisch-europäischen Poesie, der Architektur, ei -<br />
nem Restaurant, einem Stil, ja, mit was auch immer, solange das Ziel echte diskrete Qualität ist.<br />
V. EUROPAS FUSSSPUREN SIND WIR<br />
Schließlich ist es höchste Zeit, dass wir uns daran erinnern, wie Denken und Tun zusammenhängen:<br />
Das, was wir denken, bestimmt, wohin wir treten können, doch erst das, was wir tun, bestimmt, welche<br />
Fußspuren wir hinterlassen – und damit, wer wir sind.<br />
Wenn wir unsere Umwelt und unsere Mitmenschen weiterhin so heuchlerisch behandeln, wie wir das<br />
im Moment tun, unterminieren wir auf lange Sicht unsere eigenen wirtschaftlichen und politischen In -<br />
teressen – doch wir höhlen auch den Wert gerade der Lehrsätze aus, die wir ansonsten als die zentralsten<br />
unserer europäischen Zivilisation ansehen: »Alle Menschen sind gleich geboren« und »Behandle<br />
deinen Nachbarn, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest«. Um Erbe eines Gedan kens<br />
zu sein, muss man ihm auch nacheifern – oder ihn sich zumindest bei allem, was man tut, zum Maß -<br />
stab und Kompass nehmen.<br />
An dem Tag, an dem wir uns nicht durch unsere Hautfarbe ]ja, die Europäer waren einmal weiß, aber<br />
das sind wir nicht mehr!] und andere äußerliche Kennzeichen identifizieren, sondern durch ein gemein -<br />
sames Ideal und wie sich dieses auf die Essenz unseres Charakters auswirkt und damit auf unsere<br />
Handlungen, wird Europa nicht mehr im Konflikt mit sich selbst sein – oder mit seinen neu hinzugekommenen<br />
Miteuropäern. Sondern stattdessen zu einer vielstimmigen Symphonie werden, einer unendlichen<br />
Variation des gemeinsamen Themas: diskrete Qualität.<br />
An dem Tag, an dem wir uns erinnern, dass diskrete Qualität auch bedeutet, in Übereinstimmung mit<br />
unseren eigenen Werten zu handeln, wagen wir vielleicht selbst die Frage zu stellen und zu beantwor -<br />
ten: EUROPA, wer bist du? Wer möchtest du sein?<br />
2012