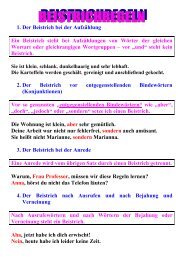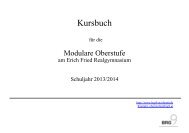Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Leiden des jungen <strong>Werther</strong> (1774) – Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1765)<br />
Entstehungsgeschichte des <strong>Werther</strong>s!<br />
Vierfacher Hintergrund: Zunächst einmal die wichtigste Parallele, Goethes Dreiecksverhältnis mit Christian Kestner und Charlotte<br />
Buff, dann der Selbstmord Jerusalems, schließlich die Anschlussliebe zu Maximiliane La Roche und zum Schluss eine<br />
allgemeine melancholische Lebenskrise Goethes. Goethe selbst hat seinen Roman, nachdem er ihn sich von der Seele geschrieben<br />
hatte, gemieden. Während er aus anderen seiner Werken vorgelesen hat, so hört man diesbezüglich nichts über den <strong>Werther</strong>.<br />
• Zu Punkt 1, zu Kestner/Buff: Sommermonate 1772: Gemeinsam mit dem Roman das Kennen lernen auf einem Ball (Goethe<br />
weiß aber zunächst nichts von der Verlobung!), gemeinsam auch das Problem mit dem an sich durchaus großzügigen Verlobten<br />
und Abschied nach einem langen Abschiedsgespräch über existenzielle Fragen; gemeinsam auch der Schattenriss Charlottes<br />
sowie deren mütterliche Funktion in der Familie; die beiden Wetzlarer fanden sich auch zu gut widergespiegelt, wobei<br />
Christian in der Erstfassung relativ schlecht wegkam.<br />
• Zu Punkt 2: Entscheidend ist, dass Goethe nicht umkam, sondern Literatur draus machte; das tragische Ende stammt aus einer<br />
anderen Quelle, nämlich dem Schicksal eines jungen Beamten namens Jerusalem, der sich wegen unerwiderter Liebe erschoss.<br />
Goethe hat sich durch Kestner sehr genau darüber informieren lassen und die Selbstmordumstände fast identisch übernommen.<br />
In den Quellenkomplex Jerusalem gehört auch die Gesandtschaftsepisode. Auch Jerusalem hatte Schwierigkeiten mit seinem<br />
Vorgesetzten.<br />
• Quellkomplex 3: Goethe verliebte sich schon 1772 in eine andere junge Frau (Maximiliane La Roche) kennen, die aber 1774<br />
einen anderen heiratete, den um 20 Jahre älteren Kaufmann Peter Anton Brentano, mit dem sie Bettina und Clemens Brentano,<br />
zwei der wichtigsten Vertreter der deutschen Romantik, bekam.<br />
• Dazu kommt, dass Goethe sich ganz allgemein in dieser Zeit in einer Lebenskrise befand, einer Art Melancholie, die spielt<br />
auch hinein. Entscheidend ist, dass Goethe das schaffte, was <strong>Werther</strong> nicht schaffte, nämlich sich wirklich zu lösen, gewissermaßen<br />
die unglücklich Geliebte hinter sich zu lassen (etwas, was Goethe überhaupt sehr gut konnte!). Außerdem hatte er noch<br />
einen zweiten Vorteil gegenüber <strong>Werther</strong>, er konnte seine Gefühle, sein Leiden in Literatur verwandeln. Ein Literaturwissenschaftler<br />
hat es so formuliert: "<strong>Werther</strong> musste sterben: gleichsam stellvertretend."<br />
Rezeptionsgeschichte: Kritik und Anerkennung für den <strong>Werther</strong><br />
Der Roman rief bei Kritikern wie bei Befürwortern äußerst emotionale Reaktionen hervor. Dies liegt darin begründet, dass Goethe<br />
mit <strong>Werther</strong> eine Person in den Mittelpunkt seines Romans stellt, die den bürgerlichen Normen völlig widerspricht. Das<br />
bürgerliche Publikum sah <strong>Werther</strong> als Störer des Ehefriedens, als Rebell und Freigeist an - ein völliger Widerspruch zu ihren<br />
Vorstellungen. Es erwartete in Literatur vielmehr etwas Nützliches und Unterhaltsames - Goethes Roman war in ihren Augen<br />
jedoch keines von beiden. Das "Nützliche" wurde von ihnen direkt im Geschehen gesucht, sie wollten eine Person haben, mit der<br />
sie sich identifizieren und aus dessen Handlungen sie lernen konnten. Der Roman endet jedoch mit einem Suizid - gemäß bürgerlicher<br />
Normen nicht vorstellbar. Viele Bürger kritisierten Goethes Werk schlicht, weil die Hauptperson nicht ihren Vorstellungen<br />
entsprach und sie so ihre Normen in Gefahr sahen. Für sie stellte "Die Leiden des jungen <strong>Werther</strong>s" einen Bruch mit der<br />
traditionellen Literatur dar - einen Bruch, den sie nicht wollten. Sie sahen das Buch als eine Verherrlichung von Normen an, die<br />
ihren Interessen widersprachen, sowie als Verherrlichung des Suizids. Die Kritik der Verherrlichung des Suizids kam auch in<br />
großem Maße von der Kirche und von einigen zeitgenössischen Dichtern. Grund für diese Kritik war unter anderem, dass zahlreiche<br />
Jugendliche die Tat nachahmten, was man daran erkannte dass sie in der typischen, blaugelben "<strong>Werther</strong>kleidung" Suizid<br />
begingen. Es kam sogar zu einem Prozess, in dem die Kirche die Zahl der Suizide jedoch so geschickt übertrieb, dass bis heute<br />
nicht klar ist, wie viele es nun wirklich waren. Es kam erwiesenermaßen zu Nachahmungssuiziden, jedoch weit weniger als die<br />
Kirche behauptete. In einigen Regionen (z. B. Leipzig, Kopenhagen, Mailand) wurde das Buch sogar verboten. Goethe selbst<br />
argumentierte sinngemäß, er gebe durch sein eigenes Überleben das beste Beispiel ab: Man müsse sich seinen Kummer vom<br />
Herzen schreiben.<br />
Während Goethe von kirchlich-bürgerlicher Seite viel Entrüstung und Kritik hinnehmen musste, gab es auch begeisterte Anhänger<br />
des Briefromans. Vor allem unter den Jugendlichen brach ein regelrechtes "<strong>Werther</strong>-Fieber" aus, das <strong>Werther</strong> zu einer Kultfigur<br />
werden ließ. Es gab die <strong>Werther</strong>-Mode (gelbe Hose, gelbe Weste, blauer Rock), die berühmte <strong>Werther</strong>-Tasse, die in keinem<br />
bildungsbeflissenen Haushalt fehlen durfte, und sogar ein Eau de <strong>Werther</strong>. Szenen aus "<strong>Werther</strong>s Leiden“ schmückten Tee- und<br />
Kaffeekannen, Tassen, Keksschalen und Teedosen. Dem Bildungsbürgertum dieser Jahrzehnte wurde die tägliche Tee- und<br />
Kaffeestunde zur stimmungsvollen Begegnung mit zeitgenössischer Literatur. Berichte, nach denen es auch Suizide gab, wie<br />
Goethe es beschrieb, wurden zwar nie bestätigt, dürften aber durchaus der Wahrheit entsprechen. Ferner sollte vermieden werden,<br />
<strong>Werther</strong> - und somit Goethe - homosexuelle Neigungen zuzusprechen.<br />
Anhänger fand und findet der Roman vor allem unter den Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation wie <strong>Werther</strong> befinden<br />
und so direkt angesprochen werden. Diejenigen, die Goethe richtig verstanden haben, können ihre Situation so mit etwas Abstand<br />
reflektieren und in den Leiden, die <strong>Werther</strong> quasi stellvertretend auszutragen hat, Erbauung und Trost finden.<br />
Hierauf zielt auch der Herausgeber-Hinweis, der sich im Buch noch vor dem ersten Brief befindet: "Was ich von der Geschichte<br />
des armen <strong>Werther</strong>s nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's<br />
danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Tränen<br />
nicht versagen. Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinen Leiden, und laß das Büchlein<br />
deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nähern finden kannst!"<br />
Inhalt von Goethes Roman „Die Leiden des jungen <strong>Werther</strong>“ (Kurzfassung – ersetzt KEINE Lektüre)<br />
• Größter Teil der Handlung ist in Briefen erzählt, die die Hauptfigur, der 20jährige <strong>Werther</strong>, an seinen Freund Wilhelm richtet.<br />
1
• <strong>Werther</strong> ist sich nicht schlüssig, welchen Sinn er seinem Leben geben und welchen Beschäftigungen er nachgehen soll, er<br />
flieht aus der bürgerlichen Welt in eine kleine Stadt, wo er die Natur genießt und sich im Zeichnen übt. Eines Tages wird er auf<br />
einen Ball eingeladen, auf welchem er Lotte begegnet, über die er zu dem Zeitpunkt bereits weiß, dass sie verlobt ist. Lotte<br />
sorgt für ihre zahlreichen Geschwister, seit ihre Mutter gestorben ist. Lotte und <strong>Werther</strong> entdecken viele Gemeinsamkeiten und<br />
verbringen höchst glückliche Stunden miteinander. Neben höchstem Glück gibt es auch vielfältige Schwierigkeiten bei einer<br />
solchen Dreierbeziehung, schließlich verlässt <strong>Werther</strong> Lotte nach langem Zögern und versucht sich in einem bürgerlichen Beruf<br />
als Sekretär bei einem Gesandten. Er kann sich aber nicht ein- und unterordnen und geht schließlich auch hier. Er kehrt<br />
noch einmal zu Lotte und Albert zurück, wird immer schwermütiger und melancholischer und erschießt sich schließlich nach<br />
einer stürmischen Liebesszene mit Lotte und einem langen Gespräch mit den Beiden mit einer Pistole, die er sich von Albert<br />
ausgeliehen hat. Am nächsten Morgen findet man <strong>Werther</strong> in der charakteristischen blau-gelben Kleidung im Sterben liegend.<br />
• Zu der besonderen Liebesbeziehung zwischen <strong>Werther</strong> und Lotte und dem Scheitern im Beruf geht es in diesem Roman vor<br />
allem um die Natur. Im ersten Teil erscheint sie äußerst positiv, ist Gegenstand intensiver Schwärmerei - im zweiten Teil erscheint<br />
sie entsprechend <strong>Werther</strong>s Seelenlage düster und verstärkt seine Schwermut. Statt des "hellen" Homer ist es nun der<br />
"düstere" Ossian, in dessen Gesängen sich <strong>Werther</strong> meint wieder zu finden.<br />
Welche Bedeutung hat die Form des Romans – der ein Briefroman ist?<br />
• Der Aspekt der Legitimation: Der Briefroman stellte einen Versuch dar, dem noch nicht voll legitimierten Roman durch<br />
scheinbare Sachlichkeit und Wirklichkeitstreue Ansehen zu verschaffen.<br />
• Kultureller Kontext: Zugleich entsprach er in seinem starken Dialogansatz einem Kernanliegen der Empfindsamkeit.<br />
• Funktion des Herausgebers: Eine wichtige Rolle beim Bestreben um scheinbare Sachlichkeit spielt der Herausgeber.<br />
• Goethes Wendung ins Monologische: Goethe übersteigert aber auch die Gattung des Briefromans - weil er eigentlich <strong>Werther</strong><br />
monologisieren lässt. Man kann den "<strong>Werther</strong>" durchaus teilweise als Tagebuchroman bezeichnen.<br />
• <strong>Werther</strong>s Scheitern und Verstummen: <strong>Werther</strong> scheitert dabei immer wieder beim Versuch der Verständigung - dementsprechend<br />
verstummt er zusehends.<br />
• Romaninterne Relativierung von <strong>Werther</strong>s Perspektive: <strong>Werther</strong>s Perspektive wird durch die besondere Form des Romans<br />
stark relativiert, zum einen durch Widersprüche zwischen Sagen und Tun bei <strong>Werther</strong>, dann durch Wilhelm, schließlich durch<br />
den Herausgeber.<br />
• Goethes Distanz zu <strong>Werther</strong>: Insgesamt spricht einiges dafür, dass Goethe selbst mehr Distanz zu seinem <strong>Werther</strong> gehalten hat<br />
als mancher Leser.<br />
Wie ist die Ausgangssituation von <strong>Werther</strong>?<br />
• <strong>Werther</strong> befindet sich auf der Flucht, wenngleich noch ein "Geschäft" für seine Mutter mitspielt; Gleich im ersten Brief (vom<br />
4. Mai) werden zwei zentrale Elemente deutlich, nämlich seine Begeisterung für die wilde Natur und sein gleichfalls wildes<br />
Herz. Neben dem Wilden steht die Idylle, wie die nächsten beiden Briefe vom 10. und 23. Mai verraten: <strong>Werther</strong> fühlt sich in<br />
vollkommener Harmonie mit der Natur und erlebt an einem Brunnen idyllische Szenen, die ihn an "patriarchalische" Zeiten<br />
erinnern.<br />
• Wie einsam <strong>Werther</strong> ist, zeigt der Brief vom 17. Mai: In ihm gedenkt <strong>Werther</strong> einer jüngst verstorbenen Freundin, die ihm viel<br />
bedeutet hat - zugleich wird erstmals Lottes Familie ganz nebenbei erwähnt, was die spätere Zuneigung vorbereitet.<br />
• Die Einsamkeit bedeutet auch Distanz zu der ihn umgebenden Gesellschaft, hier ist <strong>Werther</strong> im Brief vom 22. Mai sehr kritisch,<br />
sieht vor allem Selbstbetrug, erneut wird der Gedanke der Flucht aufgenommen, diesmal in das eigene Innere - als letzter<br />
Ausweg aus dem "Kerker" wird erstmals der Gedanke des Selbstmords geäußert.<br />
Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen <strong>Werther</strong> und Lotte im ersten Teil?<br />
• Während Lotte sich eher im ersten Teil zurückhält, <strong>Werther</strong> höchstens ein wenig mit Andeutungen von Vertraulichkeit und<br />
Freundschaft neckt, gerät dieser zunehmend in ein Feuer der Leidenschaft - mit der ständigen bangen Frage: Liebt sie mich<br />
oder nicht?<br />
• Er vergleicht die Wirkung von Liebe mit einer „Zauberlaterne“: Damit ist sowohl das Positive bezeichnet (die Welt sieht anders,<br />
schöner aus) als auch das Problematische: Die Welt sieht nur so aus, eigentlich handelt es sich um sehr flüchtige „Phantome“.<br />
Ein anderes sehr ausdrucksstarkes Bild ist das des Magnetbergs, das zum einen die Stärke der Beziehung zu Lotte zeigt,<br />
aber die Vernichtung des Angezogenen einschließt (Vorverweis auf das Ende).<br />
• Die Rückkehr Alberts verkompliziert die Situation, erhöht bei allem Bemühen um Freundschaft die Verkrampfungen. <strong>Werther</strong><br />
weicht einer klaren Entscheidung aus (Brief vom 8. August) und vergleicht seine Situation bereits mit der eines Kranken (inneres<br />
Verhalten). Auch das Tagebuch zeigt <strong>Werther</strong> deutlich das Missverhältnis zwischen Einsicht und Verhalten.<br />
• Schließlich zeigen die beiden Briefe vom 3. und 10. September <strong>Werther</strong> am vorläufigen Tief- und zugleich scheinbaren Wendepunkt<br />
seiner Existenz: <strong>Werther</strong> hat sich aufgerafft, Lotte zu verlassen, aber schon sein schmerzliches langes Abschiedsgespräch<br />
mit Lotte und Albert (ohne dass diese von seinen Plänen wissen) zeigt, wie stark das Band ist, das <strong>Werther</strong> an Lotte<br />
bindet – und später wieder zurückbringen wird.<br />
Hätte eine Beziehung zwischen <strong>Werther</strong> und Lotte eine Chance gehabt?<br />
• Lotte selbst spricht die Vermutung aus, dass <strong>Werther</strong> sie nur liebt, weil er sie als verlobte und dann verheiratete Frau nicht<br />
erreichen kann. Vieles spricht dafür - letztlich ist <strong>Werther</strong> ein so großer Egozentriker, so sehr mit sich selbst und seinen Gefühlen<br />
beschäftigt, dass er wohl kaum ein normales Familienleben führen könnte - was ja auch eine Fülle von Verpflichtungen bedeutet.<br />
• Auch darf man nicht vergessen, unter welchen Umständen sich Lotte und <strong>Werther</strong> kennen gelernt haben: Als der Bauernbursche<br />
<strong>Werther</strong> von seiner Liebe zu einer Witwe erzählt, ist <strong>Werther</strong> nachhaltig beeindruckt und „seine innerste Seele glüht“, er<br />
2
entzündet sich am Bild dieser Treue und Zärtlichkeit und „lechzt“ und „schmachtet“ danach. Das heißt, noch vor der Begegnung<br />
mit Lotte ist <strong>Werther</strong> in der Stimmung sich zu verlieben. Dann erfährt er von Lotte und davon, dass sie verlobt ist und als<br />
er ihr das erste Mal begegnet, erblickt er sie in einem weißen Kleid mit blaßroten Schleifen umringt von Kindern, denen sie<br />
Brot gibt.<br />
• Lotte entscheidet sich denn auch recht deutlich für die Sicherheit einer bürgerlichen Existenz, will <strong>Werther</strong> gewissermaßen nur<br />
als Freund und Verehrer, als Sahnehäubchen auf dem Kaffee ihrer Hausfrauen- und Mutterexistenz. Scheitern würde eine<br />
wirkliche Beziehung vor allem auch, weil <strong>Werther</strong> in Lotte nur seine Träume hineinprojiziert - solche Träume von Intensität<br />
und Idylle zugleich können nur scheitern.<br />
• <strong>Werther</strong> hat auch wenige Probleme damit, andere Frauen attraktiv zu finden (z.B. Tochter des Pfarrers oder Fräulein von B.)<br />
Wieso scheitert <strong>Werther</strong>s Eintritt in die Berufswelt?<br />
• <strong>Werther</strong> nimmt eine Stelle bei einem Gesandten an - und zunächst scheint es auch, dass die Entfernung von Lotte zu einer<br />
Beruhigung führt. Auch lernt er in dem Fräulein von B. eine neue Bekannte kennen - mit der er sich aber bezeichnenderweise<br />
nur schwärmerisch über Lotte unterhält - hier wird schon deutlich, dass <strong>Werther</strong> Lotte nicht vergessen kann.<br />
• Dazu kommen Probleme mit seinem Vorgesetzten und mit anderen Leuten - eine deutliche Zurücksetzung des nicht-adligen<br />
<strong>Werther</strong> in feudaler Gesellschaft bringt dann das Fass zum Überlaufen - <strong>Werther</strong> flieht auch hier, wie er überhaupt eine sehr<br />
geringe "Frustrationstoleranz" hat, wie die Psychologen sagen würden - er hält Stress mit anderen Menschen nicht gut aus.<br />
Welche Rolle spielt die Natur in Goethes Roman?<br />
• Die Natur ist zunächst einmal ein Gegenmodell zur Stadt - hier scheint sich das Individuum frei entfalten, sein "Wahlheim"<br />
finden zu können. Zur Natur gehört zunächst die unendliche Vielfalt des natürlichen Lebens, dazu gehört aber auch die<br />
(scheinbare) Idylle der einfachen Menschen.<br />
• Man merkt hier, dass Ideen des französischen Philosophen Rousseau hier mitschwingen, der forderte: "Zurück zur Natur".<br />
Zivilisation verdarb für ihn nur den einfachen Menschen.<br />
• Das Bild der Natur verändert sich im Laufe des Romans - sie spiegelt gewissermaßen die Seelenlandschaft <strong>Werther</strong>s: So wie<br />
die Gefühlsflut <strong>Werther</strong> zunehmend unterminiert und zerstört, so wird auch die Natur zerstörerisch, zerstört bezeichnenderweise<br />
auch <strong>Werther</strong>s Lieblingsplatz.<br />
Welche Bedeutung hat der Selbstmord in Goethes Roman?<br />
• Zunächst einmal muss man berücksichtigen, dass Selbstmord zu Goethes Zeiten vor allem in den Augen der Kirche noch etwas<br />
Unmoralisches war - dementsprechend wurden Selbstmörder auch nicht normal beerdigt.<br />
• Umso erstaunlicher, mit welcher Selbstverständlichkeit von Anfang an der Selbstmord für <strong>Werther</strong> als Fluchtmöglichkeit im<br />
Spiel ist. Aber er ist nichts Schönes, Befreiendes, vielmehr eher eine "Krankheit zum Tode".<br />
• Dies bedeutet eine moralfreie, eher medizinische Sicht des Todes - dementsprechend fordert <strong>Werther</strong> auch am Beispiel einer<br />
Selbstmörderin die Erforschung der Ursachen einer solchen Tat und zeigt im Gegensatz zu Albert viel Verständnis.<br />
• Für <strong>Werther</strong> selbst ist der Selbstmord am Schluss ohne Alternative - nur so kann er seinem (und in gewisser Weise auch dem<br />
Leiden der Freunde) ein Ende machen.<br />
• <strong>Werther</strong>s Tod: <strong>Werther</strong> erschießt sich mit der Pistole, die er von Albert holen ließ; Bericht von seinem Tod fällt nüchtern aus;<br />
Nachbar hat um Mitternacht den Schuss gehört, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Am nächsten Morgen findet der Diener<br />
<strong>Werther</strong> im sterben, läuft sofort zu einem Arzt und zu Albert. Lotte fällt in Ohnmacht und ist sogar dem Tode nah, Albert<br />
ist bestürzt, hat er doch einen Selbstmord nie für möglich gehalten. <strong>Werther</strong> stirbt mittags und wird bei Nacht beerdigt, ohne<br />
dass ein Geistlicher seinen Sarg begleitet. Der sehr kurze, knapp gehaltene und ohne Gefühlsregungen wiedergegebene Bericht<br />
lässt auch die drastischen Umstände eines solchen Selbstmordes nicht aus ("das Gehirn war herausgetrieben", Ansätze von Todeskampf,<br />
relativ langes Sterben). Das Verhalten des alten Amtmannes und seiner Söhne zeigt, dass <strong>Werther</strong> im Sterben doch<br />
nicht so allein ist, wie er häufig angenommen hat, er bedeutet der Familie viel, gerade auch den Teilen, die für ihn nicht immer<br />
im Vordergrund standen. Der Amtmann sorgt auch dafür, dass man <strong>Werther</strong> seinen Wünschen entsprechend begräbt.<br />
• Anmerkung: Seit den 1970er Jahren befasst sich die Psychologie mit dem Phänomen von "medial vermittelten Nachahmungs-<br />
Suiziden", das unter dem Namen <strong>Werther</strong>-Effekt bekannt ist.<br />
Welche Parallelgeschichten gibt es in Goethes Roman?<br />
• Bedeutung der Parallelgeschichten: Zur Struktur des Romans gehören auch die Parallelgeschichten, einmal die des Bauernburschen,<br />
dann die junge Mutter aus Wahlheim, schließlich der wahnsinnig gewordene Schreiber von Lottes Vater.<br />
• Was den Bauernburschen angeht, so ergibt sich ein wesentlicher Unterschied bei ähnlicher Ausgangslage: Beim Bauernburschen<br />
wird zu Mord, was bei <strong>Werther</strong> zu Selbstmord wird. Eine dritte traurige Konsequenz unglücklicher Liebe zeigt sich beim<br />
Schreiber, dieser endet im Wahnsinn.<br />
• Fehlen einer dauerhaften Idylle: Insgesamt zeigen sie, dass es die von <strong>Werther</strong> beschworene und erhoffte Idylle in diesem<br />
Roman nicht gibt.<br />
Inwieweit enthält Goethes Roman Gesellschaftskritik?<br />
• <strong>Werther</strong> äußert vielfältige Kritik an der adligen oder auch bürgerlichen Gesellschaft, vor allem an ihrem Standes- bzw. Karrieredenken.<br />
Aber schon diese enge Verbindung zweier sehr unterschiedlicher Kritikobjekte zeigt, dass es im <strong>Werther</strong> eigentlich<br />
nicht um Gesellschaftskritik geht.<br />
• <strong>Werther</strong> scheitert nicht an der Gesellschaft, sondern an sich selbst. Er würde an jeder Gesellschaft scheitern. Allerdings verstärken<br />
die gesellschaftlichen Umstände <strong>Werther</strong>s Probleme - sie wirken gewissermaßen als Katalysatoren.<br />
3
Wodurch ist <strong>Werther</strong> vor allem gekennzeichnet?<br />
• Lebt in nahezu völliger Ungebundenheit, anscheinend frei von allen sozialen, beruflichen Pflichten<br />
• Zu seiner Mutter hat er anscheinend ein recht distanziertes Verhältnis; Wilhelm wird zwar immer wieder Freund genannt, es<br />
handelt sich aber nicht erkennbar um eine echte Beziehung des Austausches, der Gegenseitigkeit<br />
• Wichtiges Kennzeichen ist eine gewisse Ziellosigkeit, dilettiert als Maler, ergeht sich in der Natur, knüpft oberflächliche Bekanntschaften<br />
an, im Vordergrund stehen eine intensive Lektüre und das Briefeschreiben<br />
• Verhältnis zu den anderen Menschen hängt sehr von seiner Stimmung ab, lediglich zu den Kindern hat er ein gleich bleibend<br />
gutes Verhältnis; Überhaupt spielen diese Stimmungen eine entscheidende Rolle.<br />
Welche Bedeutung hat Lotte für <strong>Werther</strong>?<br />
• <strong>Werther</strong> genießt und lebt zwar seine Ungebundenheit, sehnt sich aber doch ach nach einer intensiven Gefühlsbeziehung. Diese<br />
scheint ihm zu Lotte möglich zu sein: Hintergrund sind die verschiedenen Rollen, die sie repräsentiert und die sie für <strong>Werther</strong><br />
attraktiv macht: ältere Schwester und Ersatzmutter für die Geschwister; sie ist gleichsam Zentrum einer bürgerlichen Familie,<br />
die <strong>Werther</strong> fehlt; besonders als liebende Verlobte ist sie auch für <strong>Werther</strong> interessant, ihr Reiz scheint gerade auch in der<br />
Unerreichbarkeit zu liegen<br />
• Lotte kann seinem vagabundierenden Lebensentwurf nicht gefährlich werden, weil ihre Beziehung nicht in eine Ehe münden<br />
kann. (Anmerkung: Besonders hier werden biografische Bezüge zu Goethe deutlich, der ja viele Jahrzehnte vor jeder festen<br />
Bindung an eine Frau davongelaufen ist, bis er bei Christiane Vulpius spät seinen Frieden fand.)<br />
• „Seine Liebe zu Lotte ist eine unbedingte, d.h. sie kennt kein Gesetz außer sich selbst. <strong>Werther</strong> lebt in keiner Gemeinschaft, die<br />
ihn trägt und der er verpflichtet ist – eben darum ist die Form des Buches ein Monolog. Weder eine Freundschaft (maximal die<br />
zu Wilhelm) noch Familie oder Vaterland binden den Liebenden. Er kennt nur eine Gemeinschaft, das ist die, die er sucht, die<br />
Verbindung mit Lotte. Und weil ihm diese versagt bleibt, geht er aus der Welt.“ (Reclam)<br />
Welche Bedeutung hat <strong>Werther</strong> für Lotte?<br />
• Lotte ist sicher „glücklich“ mit ihrem Albert, aber dies wohl nur in einem sehr normalen Sinne; zu Albert gehört eben auch<br />
eine gewisse Eintönigkeit. Hier bietet ein Verehrer wie <strong>Werther</strong> Abwechslung, Spannung, kann vor allem den Mangel an<br />
Phantasie bei Albert ausgleichen. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass Lotte jemals daran denkt, Albert zu verlassen, dafür<br />
bietet er ihr zuviel Sicherheit – und genau die könnte sie nie von <strong>Werther</strong> bekommen; damit ist das Dreiecksverhältnis für Lotte<br />
eigentlich ideal, wenn, ja wenn nicht auch Sprengkraft darin läge.<br />
Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen <strong>Werther</strong> und Albert?<br />
• Im zweiten Buch kommt es zu einer deutlichen Abkühlung des Verhältnisses: Bei <strong>Werther</strong> geht das sogar so weit, dass er den<br />
Tod des Konkurrenten herbeiwünscht, Albert zieht sich von <strong>Werther</strong> stärker zurück, versucht auch, sich und seine Frau stärker<br />
von <strong>Werther</strong> zu lösen. Letztlich hält <strong>Werther</strong> Albert für einen Bürger im negativen Sinne (vgl. Seine Darstellung im Brief vom<br />
26. Mai.).<br />
Wie entwickelt sich die Personenkonstellation insgesamt?<br />
• In der ersten Hälfte gibt es noch eine Art Gleichgewicht.<br />
• In er zweiten Hälfte kommt es dann zur Katastrophe, weil dieses Gleichgewicht zunehmend verloren geht. Lotte und Albertz<br />
heiraten, damit ist Lotte endgültig für <strong>Werther</strong> verloren und begibt sich ganz in die für <strong>Werther</strong> fremde Welt der Bürgerlichkeit.<br />
Gleichzeitig kommt es zu einer Gegenbewegung, <strong>Werther</strong> gesteht immer offener ein, dass er Lotte liebt und begehrt, seine<br />
Zurückhaltung nimmt ab: Dies gipfelt in der leidenschaftlichen letzten Begegnung. <strong>Werther</strong>s Selbstmord stellt dann das<br />
Gleichgewicht wieder her – wenn auch zu einem hohen Preis.<br />
Inwieweit entspricht Goethes Roman der Epoche des „Sturm und Drangs“?<br />
• Der "Sturm und Drang" war vor allem eine Genieperiode - und das trifft voll zu. Der Brief vom 26. Mai beschäftigt sich vor<br />
allem mit der Kunst - präsentiert werden typische Sturm und Drang-Prinzipien gegen die der Aufklärung, wo man „Genie hatte“,<br />
nicht Genie "war". Das heißt, es kam auf die mehr handwerkliche Einhaltung von Kunstregeln an, nicht so sehr auf die<br />
Formung von Gefühlen zu Kunst.<br />
• Dies zeigt sich besonders in der Kunstauffassung, wo auf feste Regeln wie in der Aufklärung verzichtet wird.<br />
• Dazu kommt der Vorrang des "Herzens", der Gefühle. Ebenso spielt das Bemühen um Natürlichkeit, um Ursprünglichkeit eine<br />
Rolle, verbunden mit der Ablehnung von Zivilisation und Gesellschaft.<br />
• <strong>Werther</strong> selbst ist der typische Vertreter der „Empfindsamkeit“, einer literarischen Epoche, die zeitlich von 1740 bis 1780<br />
eingegrenzt wird und die auf die Epoche des Sturm und Drangs vorbereitet und durch sie beendet wird.<br />
Aufbau des Romans!<br />
• Dreigliederung beider Bücher des Romans; grundsätzlich symmetrischer Aufbau, wie ja auch der Herausgeber das erste und<br />
das letzte Wort hat.<br />
• Das erste Buch im Detail: Exposition (Einleitung): Briefgruppe vom 4.-10.Mai und 22. – 30. Mai; LeserIn wird mit der Lebenssituation<br />
<strong>Werther</strong>s vertraut gemacht, erfährt von dessen Stand und Herkunft und seiner Vergangenheit; erster Eindruck in<br />
die Gefühlswelt <strong>Werther</strong>s wird gegeben („Wie froh bin ich, dass ich weg bin!“), Motiv der Flucht taucht gleich zu Beginn auf,<br />
wird später wieder kehren; <strong>Werther</strong> scheint von den unerfüllten Hoffnungen einer Frau geflohen zu sein; will jetzt die Gegenwart<br />
genießen; Lieblingsplatz ist die freie Natur („Man möchte zum Maikäfer werden“); beruft sich im Herzen Brief mehrere<br />
Male auf sein „Herz“, stellt sich als junger, gefühlvoller Mann da, der sich nach Kontakt mit einfachen Menschen sehnt; Einschränkungen<br />
im Leben und auch in der Kunst lehnt er ab. <strong>Werther</strong>s Glück: Briefgruppe vom 16. Juni - 26. Juli; erstes Zu-<br />
4
sammentreffen mit Lotte, der Tochter eines fürstlichen Amtmannes, wird erzählt; wichtige Veränderung in <strong>Werther</strong>s Leben<br />
beginnt; <strong>Werther</strong> verliebt sich in das natürliche und charmante Mädchen; bis dahin hat er eher ein einsames und ungeselliges<br />
Leben geführt; nun ist er fast täglich mit Leuten zusammen; im Mittelpunkt seiner Überlegungen steht die Liebe sowie das<br />
Verhältnis zwischen Mann und Frau, Briefe sind von einer euphorischen Stimmung geprägt; einziger Wehrmutstropfen ist Lottes<br />
Verlobung; der Abschnitt des Romans endet mit einem deutlichen Verweis auf das bevorstehende Scheitern und stellt die<br />
sicherlich glücklichste Periode in <strong>Werther</strong>s Leben dar. <strong>Werther</strong> scheint den Bezug zur Realität langsam zu verlieren. Die Ankunft<br />
des Verlobten und <strong>Werther</strong>s Abschied: Briefe vom 30. Juli - 10. September; dieser Teil des ersten Buches ist von düsteren<br />
Empfindungen und Veränderungen geprägt; die unerfüllte Liebe und die damit verbundene Verzweiflung spiegeln sich in<br />
einer völlig veränderten Naturerfahrung wieder; das Thema Selbstmord tritt nun offen zu Tage, lange Diskussion mit Albert,<br />
<strong>Werther</strong> ergreift erneut die Flucht und verlässt Lotte.<br />
• Das zweite Buch: Vorgesetzte und die Adelsgesellschaft - <strong>Werther</strong>s Reise: Briefe vom 20. Oktober - 15. Juni; <strong>Werther</strong> geht<br />
endlich einer Beschäftigung nach und man erfährt von seinen negativen Erfahrungen mit seinem Vorgesetzten und der Adelsgesellschaft;<br />
Inhalt der Briefe ist die Adelsgesellschaft, die Liebe zu Lotte tritt in den Hintergrund; <strong>Werther</strong>s kritische Einstellung<br />
der Gesellschaft gegenüber kommt zum Ausdruck; nach einer Demütigung ergreift er erneut die Flucht und landet nach<br />
einigen Zwischenstationen wieder bei Lotte; seine Erfahrungen bestätigen seine Abneigung gegen eine berufliche Tätigkeit;<br />
möchte auch nicht auf eine ungehemmte Darstellung seiner Persönlichkeit verzichten; Lotte ist mittlerweile mit Albert verheiratet.<br />
Melancholie und Verzweiflung: Briefe vom 29. Juli - 6. Dezember; vergeblicher Versuch <strong>Werther</strong>s die glücklichen Zeiten<br />
wieder herauf zu beschwören; seine Leidenschaft wird immer unkontrollierbarer; Selbstmordgedanken treten noch stärker<br />
in den Vordergrund; sein Schicksal spiegelt sich in den Erzählungen von der Schulmeistertochter und dem Bauernburschen<br />
wieder (27. Mai); sein Verhältnis zu Lotte ist getrübt, sein Verhalten wird immer unausgeglichener; Verhältnis zur Natur ist<br />
nun völlig verändert; <strong>Werther</strong> nimmt nur mehr Zerstörung, Unglück, Verlust und Wahnsinn war; intensive Lektüre Ossians.<br />
Die letzten Wochen <strong>Werther</strong>s: hinterlassene Briefe, Auszeichnungen, eingeschobene Teile des Herausgebers; Herausgeber<br />
schaltet sich ein und rekonstruiert die letzten Wochen <strong>Werther</strong>s bis zu seinem Selbstmord.<br />
Stelle die beiden Charaktere <strong>Werther</strong> und Albert einander gegenüber!<br />
• <strong>Werther</strong> nennt sich selbst unstet und unruhig. Er ist es gewohnt, Wünschen und Launen nachzugehen. „Auch halte ich mein<br />
Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet“. Hauptkennzeichen ist seine Sensibilität, er weint z.B. über einen<br />
Toten, den er kaum gekannt hat oder bricht in Tränen aus, wenn Lotte während eines Gewitters den Dichter Klopstock erwähnt.<br />
Letztendlich zerbricht er an seiner Empfindsamkeit und seiner Schwermut.<br />
• In seinen guten Phasen ist <strong>Werther</strong> positiv eingestellt und vertraut auf sein Herz, z.B. im Gespräch mit dem Pfarrer und dessen<br />
Tochter warnt er davor, dass man sich zu oft durch Unsinnigkeiten den Tag verderben lässt (was hier eine Anspielung auf die<br />
Eifersucht des Mannes der Tochter ist). Allerdings ist er dann nicht mehr in der Lage sich zu kontrollieren, wird unpassend laut<br />
und pathetisch und erkennt nicht den Moment, da er sich zurückziehen sollte. Auch Lotte warnt ihn davor, zu sehr an allem<br />
Anteil zu nehmen, da er daran noch zugrunde gehen könne. Zunehmend verdüstert sich seine Stimmung und schon bald – noch<br />
vor dem Eintreffen Alberts – schreibt er davon sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Seine Laune wird melancholisch und<br />
er ist innerlich zerrissen. Kurz darauf wird die Situation wieder verherrlicht, was seine Wankelmütigkeit bestätigt. Seine Liebe<br />
wird auch zur Obsession, als er einen Brief küsst und ihm Sand zwischen die Zähe gerät. Ebenso zeigt sich in der Szene, in der<br />
Lotte den Kanarienvogel küsst und ihn dann an <strong>Werther</strong> weiterreicht, was diesen völlig aus der Fassung bringt.<br />
• In einem Streitgespräch zwischen Albert und <strong>Werther</strong> kommen deren unterschiedliche Persönlichkeiten gut zum Ausdruck.<br />
Albert nennt Selbstmörder töricht, wogegen sich <strong>Werther</strong> wehrt, da es eine Verallgemeinerung sei. Die inneren Ursachen seien<br />
zu berücksichtigen. Albert repräsentiert hier und auch stark den Vertreter der Aufklärung, der dem „leidenschaftlichen“ Stürmer<br />
und Dränger gegenübersteht. <strong>Werther</strong> pocht auf Verständis für die Unglücklichen, der sich selbst das Leben nehmen will<br />
und führt als Beispiel an, dass man auch jemandem, der seine Familie vor dem Hungertod retten will und deshalb einen Diebstahl<br />
begeht, nicht als Verbrecher bezeichnen darf. Albert entgegnet, dass dies nicht vergleichbar sei. Ein Mensch, den seine<br />
Leidenschaft beherrschen könne, müsse als Wahnsinniger angesehen werden. Betonung der Vernunft. Albert erkennt auch,<br />
dass <strong>Werther</strong> hier stark übertreibt und den Selbstmord als eine große Tat hinstellen möchte. Er selbst halte es jedoch für eine<br />
Schwäche. <strong>Werther</strong> bringt wieder eher unpassende Beispiele, was Albert auch sofort durchschaut. <strong>Werther</strong> versteht den<br />
Selbstmord in weiterer Folge als eine „Krankheit zum Tode“. Er widerspricht sich mehrmals, was Albert ebenfalls nicht entgeht.<br />
Schlussendlich führt <strong>Werther</strong> das Beispiel des Mädchens an, das vor kurzem aus dem Wasser geholt worden war. Sie war<br />
von ihrem Geliebten verlassen worden und daraufhin hat sie keinen Ausweg mehr gesehen, als ihrem Leben ein Ende zu bereiten.<br />
Albert verweist ihn hier nur darauf, dass er von einem recht einfältigen Mädchen gesprochen hätte. <strong>Werther</strong> verlässt Albert<br />
plötzlich, da er merkt, dass es zu keiner Verständigung kommen kann.<br />
• Albert steht vor allem als Bürger dar; scheint seinen Geschäften mit Sorgfalt und Fleiß nachzugehen und auch Erfolg zu haben.<br />
Hat ein eher ausgeglichenes Temperament, Emotionen werden kaum sichtbar. Ein wichtiger Beleg ist sein Streit mit <strong>Werther</strong><br />
über die Frage des Selbstmords: Hier nimmt er eine<br />
aufgeklärte Position ein, präsentiert „gesunden Menschenverstand“,<br />
was <strong>Werther</strong> ihm als Kälte und Beschränktheit<br />
auslegt. Wichtig ist Alberts Großzügigkeit und Freundlichkeit,<br />
vor allem auch gegenüber dem sehr intensiven Freund<br />
seiner Verlobten – dies zeigt sich gerade auch in dem Geschenk<br />
zu <strong>Werther</strong>s Geburtstag; interessant ist, dass <strong>Werther</strong><br />
eine solche großzügige Position für sich selbst ausschließt.<br />
Der Grund für Alberts Großzügigkeit liegt wohl in<br />
seinem fest gefügten Weltbild: Er kann sich eine Gefährdung<br />
seiner Beziehung zu seiner Verlobten gar nicht vorstellen.<br />
5