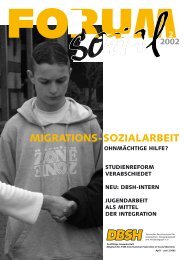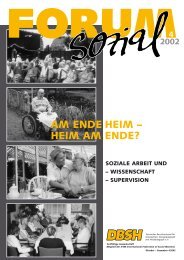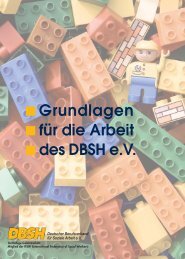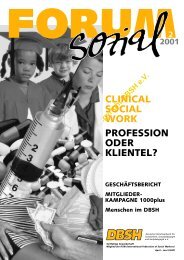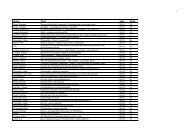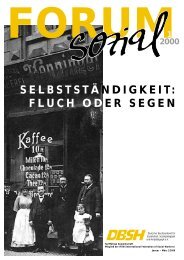Abschlussbericht Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in ...
Abschlussbericht Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in ...
Abschlussbericht Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Abschlussbericht</strong><br />
<strong>Sozialer</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Ergebnisse der zweiten Welle des Alterssurveys<br />
Clemens Tesch-Römer (Hrsg.)<br />
Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
Manfred-von-Richthofen-Straße 2<br />
12101 Berl<strong>in</strong><br />
Telefon +49 (0)30 – 26 07 400<br />
Telefax +49 (0)30 - 78 54 350<br />
E-Mail dza@dza.de
Das Forschungsprojekt "Alterssurvey – 2. Welle"<br />
Das diesem Bericht zugr<strong>und</strong>e liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums<br />
für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (BMFSFJ) gefördert. Die Verantwortung<br />
für den Inhalt der Veröffentlichung liegt bei den Autor<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Autoren.
Vorwort<br />
Dieser Bericht gibt e<strong>in</strong>en Überblick über zentrale Ergebnisse der zweiten Welle des Alterssurveys.<br />
Ziel des Alterssurveys ist e<strong>in</strong>e umfassende Beobachtung der Lebensumstände von Menschen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Im Jahr 1996 wurde die Ersterhebung des Alterssurveys mit<br />
der Befragung von 40- bis 85-jährigen Deutschen <strong>in</strong> Privathaushalten durchgeführt. Nun liegt<br />
mit der zweiten Welle e<strong>in</strong> <strong>in</strong> mehrfacher H<strong>in</strong>sicht erweiterter Datensatz vor. Erstens wurden<br />
Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Teilnehmer der ersten Welle des Alterssurvey im Jahr 2002 erneut befragt,<br />
um Veränderungen ihrer Lebenssituation im Verlauf der seitdem vergangenen sechs Jahre<br />
untersuchen zu können. Zweitens wurde 2002 e<strong>in</strong>e neue Stichprobe 40- bis 85-Jähriger gezogen,<br />
um ihre Lebensumstände mit der Situation jener Personen zu vergleichen, die im Jahr<br />
1996, also sechs Jahre zuvor, im selben Alter waren. Drittens wurde erstmals e<strong>in</strong>e Stichprobe<br />
älter werdender Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit befragt, um deren spezifische Lebenslage<br />
der Situation von deutschen Bürgern gegenüberstellen zu können. Der erweiterte Untersuchungsplan<br />
macht sowohl die Beobachtung sozialen <strong>Wandel</strong>s als auch die Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte möglich. Der Alterssurvey liefert damit Beiträge<br />
zur wissenschaftlichen Alternsforschung <strong>und</strong> zur Alterssozialberichterstattung im Längsschnitt.<br />
Beide Erhebungswellen des Alterssurveys wurden vom B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren,<br />
Frauen <strong>und</strong> Jugend (BMFSFJ) gefördert. Die Datenerhebung beider Wellen wurde von<br />
<strong>in</strong>fas – Institut für angewandte Sozialwissenschaft, Bonn, durchgeführt. Die vorliegende Arbeit<br />
an der zweiten Welle des Alterssurveys baut auf der von der Forschungsgruppe Altern <strong>und</strong> Lebenslauf<br />
(FALL) der Freien Universität Berl<strong>in</strong> (Mart<strong>in</strong> Kohli) <strong>und</strong> der Forschungsgruppe Psychogerontologie<br />
der Universität Nijmegen (Freya Dittmann-Kohli) konzipierten ersten Welle<br />
des Alterssurveys auf. Die Arbeiten an der zweiten Welle des Alterssurveys wurden vom<br />
BMFSFJ an das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) vergeben. Die Forschungsgruppe<br />
am DZA hat die <strong>in</strong>haltliche Arbeit der erste Welle kont<strong>in</strong>uierlich fortgesetzt. Durch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>ladung<br />
an Harald Künem<strong>und</strong> zur Beteiligung am Beirat <strong>und</strong> der Mitarbeit an der Berichtserstellung<br />
haben wir versucht, personelle Kont<strong>in</strong>uität zu wahren.<br />
Es ist e<strong>in</strong>e schöne Tradition, am Ende e<strong>in</strong>es Projektes wie dem Alterssurvey all jenen zu danken,<br />
die zum Gel<strong>in</strong>gen der Arbeit beigetragen haben. Unser erster Dank gebührt Norbert Feith<br />
<strong>und</strong> Gabriele Müller-List aus dem B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend,<br />
die unsere Arbeit aufmerksam begleitet haben <strong>und</strong> für alle aus der Projektarbeit entstehenden<br />
Probleme e<strong>in</strong> offenes Ohr hatten. Unser herzlicher Dank gilt auch Gisela van der Laan<br />
für die exzellente Unterstützung bei der Lösung aller abwicklungstechnischen Fragen des Projekts.<br />
Das Projekt „Alterssurvey, 2. Welle“ wurde während se<strong>in</strong>er Durchführung von e<strong>in</strong>em wissenschaftlichen<br />
Beirat begleitet, dessen Mitglieder sich während mehrerer Sitzungen für das Gel<strong>in</strong>gen<br />
des Projekts sehr engagierten <strong>und</strong> uns auch außerhalb der Sitzungsterm<strong>in</strong>e mit Rat <strong>und</strong> Tat<br />
zur Seite standen. Dem Beirat gehörten an: Gertrud Backes, Walter Bien, Reg<strong>in</strong>a Claussen,<br />
Sigrun-Heide Filipp, Charlotte Höhn, Francois Höpfl<strong>in</strong>ger, Peter Krause, Harald Künem<strong>und</strong>,<br />
He<strong>in</strong>z-Herbert Noll, Doris Schaeffer, Ralf Schwarzer, Jacqui Smith, Michael Wagner, Hans-<br />
I
II<br />
Werner Wahl. Den Mitgliedern des Beirats danken wir herzlich für ihre Unterstützung. Besonders<br />
hervorheben möchten wir die außerordentlich wertvolle Unterstützung durch den Vorsitzenden<br />
des Beirats, Michael Wagner, der jederzeit bereit war, uns bei schwierigen Entscheidungen<br />
zu beraten.<br />
Die zweite Welle des Alterssurveys wurde durch das für die Datenerhebung zuständige Feldforschungs<strong>in</strong>stitut<br />
<strong>in</strong>fas <strong>in</strong> kompetenter <strong>und</strong> bewährter Weise unterstützt. Unser besonderer Dank<br />
gilt Stefan Schiel für die äußerst aufmerksame <strong>und</strong> zuvorkommende Kooperation <strong>in</strong> der alltäglichen<br />
Kommunikation <strong>in</strong> Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der Datenerhebung. Re<strong>in</strong>er Gilberg,<br />
Doris Hess <strong>und</strong> Menno Smid sei für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre ebenfalls<br />
herzlich gedankt.<br />
E<strong>in</strong> Projekt dieser Größenordnung stellt besonders hohe Anforderungen an die Arbeitsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> Kooperationsbereitschaft aller unmittelbar <strong>und</strong> mittelbar am Projekt Beteiligten. Das betrifft<br />
vor allem unsere Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kollegen am Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA), die<br />
uns bei der Diskussion von Zwischenergebnissen unserer Arbeit mit wertvollen H<strong>in</strong>weisen sehr<br />
geholfen haben. Unser besonderer Dank gilt Barbara Grönig, Peter Köster <strong>und</strong> Helga Nagy für<br />
ihre unschätzbare Unterstützung bei der Abwicklung der f<strong>in</strong>anziellen Seite des Projektes. Die<br />
Phase der Fertigstellung dieses Berichts stellte e<strong>in</strong>e besondere Herausforderung nicht nur für die<br />
Autoren <strong>und</strong> Autor<strong>in</strong>nen dar, sondern auch für die Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> den Sekretariaten. Unser<br />
herzlicher Dank für die Unterstützung <strong>in</strong> dieser „heißen Phase“ gilt Daniela Hagemeister, Angela<br />
Hesse, Elke Dettmann <strong>und</strong> Annett Baschek.<br />
Besonders herzlich möchten wir uns bei unseren studentischen Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
Sonja Christmann, Cornelia Schmidt <strong>und</strong> René Hohmann bedanken. Alle drei haben sich<br />
über die Jahre h<strong>in</strong>weg <strong>in</strong> uneigennütziger Weise <strong>und</strong> weit über das erwartbare Maß für das Projekt<br />
engagiert. Ohne die hervorragende Arbeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen der<br />
Projektgruppe – Susanne Wurm, Andreas Hoff <strong>und</strong> Heribert Engstler – hätte dieses komplexe<br />
Projekt nicht zu e<strong>in</strong>em guten Ende geführt werden können. Ihnen möchte ich von Herzen danken!<br />
Last but not least gilt unser besonderer Dank den mehr als 5.000 Befragten, die sich für die<br />
Teilnahme am Alterssurvey zwei oder mehr St<strong>und</strong>en Zeit genommen haben. Ohne sie wäre<br />
dieses Projekt nie zustande gekommen. Wir wissen ihren Beitrag hoch zu schätzen <strong>und</strong> fühlen<br />
uns ihnen sehr verpflichtet.<br />
Clemens Tesch-Römer<br />
Berl<strong>in</strong>, im August 2004
Inhalt<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff,<br />
Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Der Alterssurvey: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s<br />
<strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen .................................................................... 1<br />
Heribert Engstler <strong>und</strong> Susanne Wurm<br />
Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik ..................................................................................... 33<br />
Heribert Engstler<br />
Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
<strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand ............................................................................... 65<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Materielle Lagen alter Menschen: Verteilungen <strong>und</strong><br />
Dynamiken <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ......................................................................... 123<br />
Andreas Hoff<br />
Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong> .................................................... 209<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand .................................................................... 267<br />
Susanne Wurm <strong>und</strong> Clemens Tesch-Römer<br />
Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung ...................................................................... 291<br />
Susanne Wurm<br />
Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ............................................. 357<br />
Clemens Tesch-Römer <strong>und</strong> Susanne Wurm<br />
Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong><br />
Lebensqualität <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte .................................................................... 395<br />
Helen Krumme <strong>und</strong> Andreas Hoff<br />
Die Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländer <strong>in</strong> Deutschland ....................................................................................... 455<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff,<br />
Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik ..................... 501<br />
III
1. Der Alterssurvey:<br />
Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s<br />
<strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff,<br />
Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
1.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Der demografische <strong>Wandel</strong> verändert die Struktur von Gesellschaften, stellt die Sozialpolitik<br />
vor neue Aufgaben <strong>und</strong> birgt Herausforderungen für die Sozial- <strong>und</strong> Verhaltenswissenschaften.<br />
Wichtigster Bestandteil der „schleichenden Revolution“ des demografischen <strong>Wandel</strong>s ist die<br />
Alterung der Gesellschaft: Nicht alle<strong>in</strong> die absolute Zahl alter <strong>und</strong> hochaltriger Menschen, sondern<br />
<strong>in</strong>sbesondere ihr relativer Anteil an der Bevölkerung steigt <strong>und</strong> wird <strong>in</strong> den nächsten Jahrzehnten<br />
– bei <strong>in</strong> Deutschland zugleich schrumpfender Gesamtbevölkerungszahl – stärker als je<br />
zuvor zunehmen (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2003). Die altersbezogenen Auswirkungen des demografischen<br />
<strong>Wandel</strong>s auf die Struktur der Gesellschaften ist mit dem Konzept des „Altersstrukturwandels“<br />
bezeichnet <strong>und</strong> mit den Schlagworten der Verjüngung, Entberuflichung, Fem<strong>in</strong>isierung,<br />
S<strong>in</strong>gularisierung des Alters <strong>und</strong> der Zunahme der Hochaltrigkeit charakterisiert<br />
worden (Niederfranke, 1997; Tews, 1993).<br />
Gegenwärtig ist noch nicht abzusehen, ob alle diese Merkmale des Altersstrukturwandels auch<br />
zukünftig Bestand haben werden. Es ist zwar davon auszugehen, dass auch <strong>in</strong> Zukunft die<br />
Mehrheit älterer Menschen weiblichen Geschlechts se<strong>in</strong> wird (Fem<strong>in</strong>isierung des Alters). Die<br />
Zahl älterer Männer wird jedoch zunehmen, da der E<strong>in</strong>fluss der kriegsbed<strong>in</strong>gten Verluste auf die<br />
Geschlechterstruktur im Alter abnimmt, die höhere Zahl von Männern unter den älter werdenden<br />
Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen der ersten Generation sich auswirkt, <strong>und</strong> sich <strong>in</strong> Zukunft die<br />
geschlechtsspezifischen Unterschiede <strong>in</strong> der Lebensdauer möglicherweise langsam verr<strong>in</strong>gern<br />
werden (nachdem sie sich im letzten Jahrh<strong>und</strong>ert zugunsten der Frauen vergrößert hatten). Zukünftige<br />
Generationen älterer Menschen werden auch weiterh<strong>in</strong> häufig alle<strong>in</strong> im eigenen Haushalt<br />
wohnen (S<strong>in</strong>gularisierung), allerd<strong>in</strong>gs unterscheiden sich die Trends für Männer <strong>und</strong> Frauen.<br />
Nach neueren Modellrechnungen kann erwartet werden, dass sich der Trend der S<strong>in</strong>gularisierung<br />
bei Männern verstärken, bei Frauen jedoch abschwächen wird (BMFSFJ, 2001a, S.<br />
219f.) Die eigentliche demografische Revolution ist jedoch die Zunahme der Zahl <strong>und</strong> des Anteils<br />
sehr alter (über 80-jähriger) Menschen (Hochaltrigkeit), <strong>und</strong> dieser Trend wird sich <strong>in</strong> Zukunft<br />
noch verstärken.<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf Verjüngung <strong>und</strong> Entberuflichung des Alters zeichnet sich jedoch seit Kurzem<br />
e<strong>in</strong>e Trendwende ab. Die Konzepte der Verjüngung <strong>und</strong> Entberuflichung bezeichnen die paradoxe<br />
Situation, dass trotz steigender Lebenserwartung die Beendigung des Erwerbslebens <strong>und</strong><br />
der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnt dazu geführt hatte, dass nachfolgende<br />
Geburtskohorten <strong>in</strong> jüngerem Alter den Übergang <strong>in</strong> die Altersphase machten. Die Aussicht<br />
1
2<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
e<strong>in</strong>es Arbeitskräftemangels (Schulz, 2000) stellt die Fortsetzung des bisherigen Trends zu e<strong>in</strong>em<br />
immer früheren Ausscheiden aus dem Berufsleben <strong>in</strong> zukünftigen Alterskohorten <strong>in</strong> Frage. Die<br />
Anhebung von Ruhestandsgrenzen <strong>in</strong> Anpassung an die sich verändernde fernere Lebenserwartung<br />
hat bereits begonnen <strong>und</strong> wird weiter erwogen. Es ist zwar unsicher, wie sich der Arbeitsmarkt<br />
für ältere Arbeitnehmer <strong>in</strong> Zukunft entwickeln wird. Im Vergleich zur heutigen Situation,<br />
<strong>in</strong> der nicht wenige Betriebe kaum mehr Beschäftigte im Alter von 50 <strong>und</strong> mehr Jahren haben,<br />
wird der Anteil älterer Erwerbstätiger <strong>in</strong> Zukunft jedoch sehr wahrsche<strong>in</strong>lich wieder steigen.<br />
Diese Trends, <strong>in</strong>sbesondere die Tatsache, dass sich ihre endgültige <strong>Entwicklung</strong> – <strong>und</strong> damit<br />
ihre Konsequenzen für das Leben künftiger Generationen – aus heutiger Perspektive schwer<br />
abschätzen lassen, begründen die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen<br />
Dauerbeobachtung älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen. Der Alterssurvey widmet sich der Lebenssituation<br />
von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Zeitlicher Bezugsrahmen für „die<br />
zweite Lebenshälfte“ ist jener Lebensabschnitt, der mit e<strong>in</strong>em Alter von 40 Jahren beg<strong>in</strong>nt. Die<br />
erste Welle des Alterssurveys wurde im Jahr 1996 mit e<strong>in</strong>er repräsentativen Stichprobe durchgeführt.<br />
Anhand dieser Daten wurden die Lebenssituationen 40- bis 85-Jähriger Menschen im<br />
Querschnitt umfassend beschrieben (Kohli & Künem<strong>und</strong>, 2000; Dittmann-Kohli et al., 2001).<br />
Die zweite Welle des Alterssurveys wurde sechs Jahre später, im Jahr 2002 durchgeführt. Der<br />
Alterssurvey ist nun <strong>in</strong> der Anlage e<strong>in</strong>e Kohortensequenzstudie mit zwei Erhebungszeitpunkten<br />
(1996 <strong>und</strong> 2002), die es ermöglicht, sowohl Tendenzen des sozialen <strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
<strong>Wandel</strong>s <strong>in</strong> den Lebenssituationen älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen zu erk<strong>und</strong>en als auch<br />
Veränderungen <strong>in</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Lebensläufen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte zu analysieren. Zudem<br />
werden <strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys nicht alle<strong>in</strong> Bürger der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland berücksichtigt, sondern es wird auch die Situation jener Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte <strong>in</strong> den Blick genommen, die – ohne die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen –<br />
<strong>in</strong> Deutschland leben. Der vorliegende Band ist empirischen Analysen aus der zweiten Welle<br />
des Alterssurveys <strong>in</strong> den Bereichen Erwerbstätigkeit <strong>und</strong> Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand, materielle<br />
Lagen, Familienbeziehungen, gesellschaftliche Partizipation, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
gewidmet. Der Alterssurvey ist – auch angesichts des sehr umfassenden Untersuchungsansatzes<br />
<strong>in</strong> der ersten Welle – <strong>in</strong> verschiedener H<strong>in</strong>sicht komplexer <strong>und</strong> damit begründungsbedürftig<br />
geworden.<br />
In diesem E<strong>in</strong>leitungskapitel 1 wird der Alterssurvey im Kontext se<strong>in</strong>er zwei Hauptfunktionen –<br />
se<strong>in</strong>es Beitrags zur längsschnittbezogenen gerontologischen Forschung <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er politikberatenden<br />
Funktion im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Alterssozialberichterstattung im Längsschnitt – vorgestellt. Im<br />
zweiten Abschnitt dieses Kapitels wird der Kontext des demografischen <strong>Wandel</strong>s diskutiert. Im<br />
dritten Abschnitt werden die zentralen Fragestellungen des gegenwärtigen gerontologischen<br />
Diskurses vorgestellt, zu denen der Alterssurvey e<strong>in</strong>en Beitrag zu leisten versucht: Lebensqualität<br />
im Erwachsenenalter, <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>sbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte, Generationen- <strong>und</strong> Kohortenanalysen sowie Unterschiede <strong>und</strong> Ungleichheiten im<br />
Lebenslauf. Im dritten Teil wird das Forschungsdesign der zweiten Welle des Alterssurveys<br />
vorgestellt <strong>und</strong> der Beitrag des Alterssurveys zur gerontologischen Längsschnittforschung <strong>und</strong><br />
1 Dieses Kapitel beruht auf Publikationen der Autor/<strong>in</strong>nen (Tesch-Römer, Wurm, Hoff & Engstler, 2002b; Hoff,<br />
Tesch-Römer, Wurm, & Engstler, 2003).
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
zur Alterssozialberichterstattung im Längsschnitt detailliert diskutiert. Im abschließenden Ausblick<br />
wird der Nutzen längsschnittanalytischer Forschung für die <strong>Entwicklung</strong> der Diszipl<strong>in</strong><br />
evaluiert.<br />
1.2 Demografischer <strong>und</strong> gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong><br />
Die demografische <strong>Entwicklung</strong> ist e<strong>in</strong>e der bedeutsamen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die gesellschaftliche<br />
Situation älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen. Die Zahl älterer Menschen <strong>und</strong> ihr<br />
Anteil an der Gesamtbevölkerung haben gesellschafts-, wirtschafts- <strong>und</strong> sozialpolitische Implikationen.<br />
Beispielsweise wird dies deutlich an der Bedeutung älterer Menschen als Wähler/<strong>in</strong>nen,<br />
als Konsument/<strong>in</strong>nen oder als Nutzer/<strong>in</strong>nen von sozialen <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Dienstleistungen.<br />
Daher soll zu Beg<strong>in</strong>n dieses Kapitels auf die aktuellen demografischen <strong>Entwicklung</strong>en<br />
e<strong>in</strong>gegangen werden (Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, Krause & Künem<strong>und</strong>, 2004). Die demografische<br />
<strong>Entwicklung</strong> wird im wesentlichen durch drei demografische Faktoren bestimmt: Zunehmende<br />
Lebensdauer, abnehmende Fertilität <strong>und</strong> diskont<strong>in</strong>uierliche Migration (Hoffmann, 2002). Im<br />
Rahmen der 10. koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes<br />
(Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2003) wurden verschiedene Prognosevarianten zur Bevölkerungsentwicklung<br />
für die nächsten 50 Jahre erstellt, die sich durch unterschiedliche Annahmen zur Höhe<br />
der künftigen Lebenserwartung e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> des künftigen Außenwanderungsgew<strong>in</strong>ns andererseits<br />
auszeichnen. Zusätzlich wird von e<strong>in</strong>er konstant niedrigen Geburtenhäufigkeit von 1,4<br />
K<strong>in</strong>dern pro Frau ausgegangen. Die „mittlere“ Variante 5 geht z.B. von e<strong>in</strong>er Zunahme der Lebenserwartung<br />
Neugeborener über den Prognosezeitraum bis 2050 um etwa sechs Jahre aus <strong>und</strong><br />
unterstellt e<strong>in</strong>en jährlichen Außenwanderungsgew<strong>in</strong>n von etwa 200 000 Personen.<br />
Das Statistische B<strong>und</strong>esamt ermittelt <strong>in</strong> allen Varianten im Mittel e<strong>in</strong>e Schrumpfung der Gesamtbevölkerungsgröße<br />
<strong>in</strong> den nächsten fünf Dekaden. Dabei ist die Bandbreite möglicher <strong>Entwicklung</strong>en<br />
relativ groß, <strong>und</strong> e<strong>in</strong>ige der Modellvarianten lassen auch e<strong>in</strong>en künftigen leichten<br />
Anstieg der Bevölkerungszahl annehmen. Die Ergebnisse der mittleren Variante 5 zeigen für<br />
den gesamten Vorausberechnungszeitraum, dass – wie schon <strong>in</strong> den letzten drei Jahrzehnten des<br />
vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts – die Zahl der Todesfälle die Zahl der Geburten deutlich übersteigen<br />
wird <strong>und</strong> sich trotz des angenommenen erheblichen Zuwanderungsgew<strong>in</strong>ns e<strong>in</strong> sukzessives<br />
Abs<strong>in</strong>ken der Bevölkerungszahl von heute r<strong>und</strong> 82,5 Millionen auf etwa 81 Millionen Menschen<br />
im Jahr 2030 ergibt. Dieses Abs<strong>in</strong>ken wird sich der Prognose zufolge bis 2050 weiter<br />
beschleunigen, so dass 2050 lediglich noch 75 Millionen Menschen <strong>in</strong> Deutschland leben werden.<br />
Andere Varianten prognostizieren dagegen bis 2030 e<strong>in</strong>en Anstieg auf bis zu 84 Millionen<br />
oder e<strong>in</strong> Abs<strong>in</strong>ken auf lediglich 75,5 Millionen Menschen (Abbildung 1.1). Die Prognosen s<strong>in</strong>d<br />
damit von e<strong>in</strong>er gewissen Unbestimmtheit gekennzeichnet, wenn sich die Vorausberechnungen<br />
zwischen e<strong>in</strong>er Bevölkerungszunahme von etwa zwei Prozent <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Bevölkerungsabnahme<br />
von etwa sieben Prozent bewegen.<br />
3
4<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Abbildung 1.1:<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Bevölkerung bis 2030 – Schätzwerte der 10. Bevölkerungsvorausberechnung<br />
2003 des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes<br />
Bevölkerung<strong>in</strong>1.000<br />
84.000<br />
82.000<br />
80.000<br />
78.000<br />
76.000<br />
Variante 1<br />
Variante 2<br />
Variante 3<br />
Variante 4<br />
Variante 5<br />
Variante 6<br />
Variante 7<br />
Variante 8<br />
Variante 9<br />
2001 2010 2020 2030<br />
Jahr<br />
Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2003). Bevölkerung Deutschlands bis 2050. 10. koord<strong>in</strong>ierte Bevölkerungsvorausberechnung.<br />
Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt. Varianten 1-9 (vgl. auch Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, Krause & Künem<strong>und</strong>, 2004).<br />
Die Bevölkerungsvorausberechnung berücksichtigt jedoch nicht alle<strong>in</strong> Veränderung der Bevölkerungsgröße,<br />
sondern nimmt <strong>in</strong>sbesondere die Bewegungen <strong>in</strong> der Altersstruktur der Bevölkerung<br />
Deutschlands <strong>in</strong> den Blick. So erhöht sich der „Altenquotient“– das Verhältnis der über 60-<br />
Jährigen zu den 20- bis unter 60-Jährigen – gemäß Variante 5 bis 2050 von 44 Prozent auf 78<br />
Prozent. Allerd<strong>in</strong>gs sollte man diese Erhöhung nicht unbed<strong>in</strong>gt als e<strong>in</strong>e Zunahme von Menschen<br />
im Ruhestand gleichsetzen. Der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand ist – aufgr<strong>und</strong> der Abhängigkeit<br />
von der auf 60 Jahre gesetzten Ruhestandsmarke – weit mehr als Fertilität <strong>und</strong> Mortalität e<strong>in</strong>e<br />
politisch <strong>und</strong> wirtschaftlich bee<strong>in</strong>flussbare Größe: Die gesetzliche Altersgrenze ist Gegenstand<br />
politischer Aushandlung, <strong>und</strong> die faktischen Ruhestandsalter werden <strong>in</strong> erheblichem Maße<br />
durch das Geschehen auf den Arbeitsmärkten bestimmt. Für e<strong>in</strong>e Abschätzung der künftigen<br />
Bevölkerungsentwicklung ist allerd<strong>in</strong>gs die Verwendung von Altersgrenzen dennoch s<strong>in</strong>nvoll,<br />
um die möglichen künftigen Veränderungen von Planungsgrößen wie der Größe bestimmter<br />
Populationen vorzuzeichnen.<br />
Der Umfang der künftigen Altenpopulation <strong>in</strong> Deutschland wird <strong>in</strong> allen Varianten weitgehend<br />
ähnlich geschätzt, so dass hier von e<strong>in</strong>er soliden Planungsgr<strong>und</strong>lage ausgegangen werden kann.<br />
Im Jahr 2030 werden demnach r<strong>und</strong> 27 bis 28 Millionen 60-Jährige <strong>und</strong> Ältere <strong>und</strong> 21 bis 22<br />
Millionen 65-Jährige <strong>und</strong> Ältere <strong>in</strong> Deutschland leben. Die Zahlen werden bis 2050 weiter ansteigen.<br />
Bis 2030 ist damit von e<strong>in</strong>er Zunahme der Zahl älterer Menschen im Alter von 60 <strong>und</strong><br />
mehr Jahren um 36 bis 43 Prozent bzw. im Alter von 65 <strong>und</strong> mehr Jahren um etwa 48 bis 57<br />
Prozent auszugehen.<br />
Die demografische <strong>Entwicklung</strong> liefert e<strong>in</strong>en Rahmen für all jene Veränderungen, die als<br />
„Strukturwandel des Alters“ bezeichnet werden <strong>und</strong> die für die Analyse der Lebenslagen älterer
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Menschen bedeutsam s<strong>in</strong>d. Um e<strong>in</strong> vollständigeres Bild zu zeichnen, müssen der Bedeutungswandel<br />
der Altersphase im Lebenslauf bzw. des Alters <strong>in</strong>sgesamt sowie sozialstrukturelle Veränderungen<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Gruppe der Älteren Berücksichtigung f<strong>in</strong>den. Wenn die Altersphase<br />
immer weniger Restzeit <strong>und</strong> immer mehr geplanter Lebensweg mit Wünschen, Zielen <strong>und</strong> Planungen<br />
ist, so verschiebt sich damit auch die Bedeutung materieller Ressourcen <strong>und</strong> die Bedarfe<br />
im späteren Lebenslauf. Historisch betrachtet haben die demografischen Veränderungen <strong>und</strong> der<br />
Trend zum frühen Ruhestand zu e<strong>in</strong>er markanten Ausweitung der Altersphase im Lebenslauf<br />
geführt. Noch zu Beg<strong>in</strong>n des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts gab es zum e<strong>in</strong>en wesentlich weniger ältere Menschen<br />
als heute, zum anderen konnte das Erreichen des höheren Lebensalters <strong>in</strong>dividuell nicht<br />
als wahrsche<strong>in</strong>lich angesehen werden. Seither ist die durchschnittliche Lebenserwartung gestiegen<br />
<strong>und</strong> ihre Varianz hat drastisch abgenommen. Erst hierdurch wurde die „Lebensphase Alter“<br />
(Backes & Clemens, 1998) zu e<strong>in</strong>em erwartbaren <strong>und</strong> selbstverständlich planbaren Bestandteil<br />
des <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Lebenslaufs.<br />
Zusätzlich br<strong>in</strong>gen die zukünftigen Älteren andere Voraussetzung für die Gestaltung dieser Lebensphase<br />
mit als Vorgängerkohorten. Die <strong>in</strong> näherer Zukunft Älteren s<strong>in</strong>d im „Wirtschaftsw<strong>und</strong>er“<br />
aufgewachsen <strong>und</strong> haben – zum<strong>in</strong>dest im Westen Deutschlands – frühzeitig Erfahrungen<br />
mit demokratischer Politik <strong>und</strong> entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten gemacht. Insbesondere<br />
aber verändert sich zunächst e<strong>in</strong>mal zukünftig das durchschnittliche Bildungsniveau<br />
Älterer: Die zukünftigen Älteren erreichen die nachberufliche Lebensphase im Schnitt mit zunehmend<br />
besserer Bildung wie Analysen auf Gr<strong>und</strong>lage der ersten Welle des Alterssurvey zeigen<br />
können (Motel, 2000). Der Zusammenhang von objektiven Lagen <strong>und</strong> ihren subjektiven<br />
Bewertungen sollte damit auch unter dem E<strong>in</strong>fluss dieser Wandlungsprozesse stehen.<br />
Diese Verschiebungen s<strong>in</strong>d stets im Auge zu behalten, wenn über die Situation älterer Menschen<br />
gesprochen wird. Die zahlenmäßige Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung<br />
wird nicht notwendiger Weise <strong>und</strong> automatisch zu e<strong>in</strong>er Veränderung der gesellschaftlichen<br />
Position älterer Menschen <strong>in</strong> der Gesellschaft führen. Dennoch ist anzunehmen,<br />
dass die Lebenslagen älterer Menschen durch diese demografischen Veränderungen betroffen<br />
se<strong>in</strong> werden. Zunächst ist hierbei an die Veränderung familialer <strong>und</strong> anderer sozialer Netzwerke<br />
zu denken: Ger<strong>in</strong>ge Fertilität bedeutet, dass sich <strong>in</strong>tergenerationale Beziehungen verändern.<br />
Aber auch das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit <strong>und</strong> ehrenamtlichen Engagement wird durch<br />
den demografischen <strong>Wandel</strong> betroffen se<strong>in</strong>. Die materielle Lage h<strong>in</strong>sichtlich E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong><br />
Vermögen sowie das wirtschaftliche Handeln älterer Menschen wird ebenfalls vom demografischen<br />
<strong>Wandel</strong> berührt. Diese betrifft schließlich auch ältere Menschen als Konsumenten von<br />
Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen sowie als Nutzer von sozialen <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Dienstleistungen.<br />
5
6<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
1.3 Theoretischer Rahmen<br />
Die Erörterungen zum demografischen <strong>Wandel</strong> haben deutlich gemacht, <strong>in</strong> welcher Breite das<br />
Thema Altern <strong>und</strong> Alter <strong>in</strong> gesellschaftlicher <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Perspektive zu diskutieren ist.<br />
Der Alterssurvey unternimmt es, die Perspektiven sozialen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong><br />
aufe<strong>in</strong>ander zu beziehen. Dabei geht es stets um die Frage, wie sich die Lebenslage älter<br />
werdender Menschen im Verlauf der historischen Zeit <strong>und</strong> im Verlauf des biografischen Prozesses<br />
„Altern“ verändert. Gegenstand dieses Abschnitts s<strong>in</strong>d zentrale Fragestellungen der aktuellen<br />
gerontologischen Forschung, die sich auf diese Perspektiven sozialen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r<br />
<strong>Entwicklung</strong> beziehen. Nachfolgend werden vier theoretische Rahmenperspektiven vorgestellt,<br />
die für die Konzeptualisierung des Alterssurveys entscheidend s<strong>in</strong>d: (1.) Zunächst werden<br />
Überlegungen zu objektiven <strong>und</strong> subjektiven Dimensionen der Lebenssituation vorgestellt.<br />
Hierbei geht es um die Beschreibung von Veränderungen <strong>und</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>in</strong> objektiven <strong>und</strong> subjektiven<br />
Merkmalen der Lebenssituation sowie um den Zusammenhang zwischen diesen Bereichen.<br />
An dieser Stelle wird auch der Begriff der Lebensqualität e<strong>in</strong>geführt. (2.) In e<strong>in</strong>em zweiten<br />
Schritt wird diskutiert, welche <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>sbed<strong>in</strong>gungen im<br />
mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter zu beobachten s<strong>in</strong>d. Dabei soll auch danach gefragt<br />
werden, welche Bedeutung Statuspassagen <strong>und</strong> kritische Lebensereignisse <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
haben <strong>und</strong> ob die Unterscheidung dist<strong>in</strong>kter Altersphasen gerechtfertigt ist. (3.) Drittens<br />
wird die Frage aufgeworfen, wie <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>und</strong> soziale Veränderungsprozesse<br />
zu differenzieren s<strong>in</strong>d, um die wechselseitige Bed<strong>in</strong>gtheit zwischen Mikro- <strong>und</strong><br />
Makroebene adäquat beschreiben zu können. Hierbei wird auch die – konzeptuell-methodische<br />
– Frage der Konf<strong>und</strong>ierung von Alter, Periode <strong>und</strong> Geburtskohorte diskutiert. (4.) Schließlich<br />
wird viertens die Frage nach Ungleichheit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte gestellt, wobei materielle<br />
<strong>und</strong> immaterielle Dimensionen der Ungleichheit berücksichtigt werden sollen. In diesem Zusammenhang<br />
wird auch der Frage nachgegangen, <strong>in</strong>wieweit <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte durch Tendenzen <strong>in</strong> Richtung von zunehmender oder abnehmender Variabilität<br />
gekennzeichnet s<strong>in</strong>d. Diese mit dem theoretischen Konzept des differentiellen Alterns beschriebenen<br />
<strong>Entwicklung</strong>strends können <strong>in</strong> horizontaler Perspektive (Unterschiedlichkeit von Lebensstilen)<br />
oder <strong>in</strong> vertikaler Perspektive (Ungleichheit von Lebenslagen) untersucht werden.<br />
1.3.1 Objektive <strong>und</strong> subjektive Dimensionen der Lebenssituation<br />
Bereits <strong>in</strong> der ersten Welle des Alterssurveys wurde hervorgehoben, dass es gerade <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte von Bedeutung ist, die Lebenssituation von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
nicht alle<strong>in</strong> mit Blick auf objektive Lebenszusammenhänge oder mit Blick auf subjektive<br />
Selbst- <strong>und</strong> Lebenskonzepte zu untersuchen. In soziologischer Perspektive geht es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
um Lebenslagen, Ressourcenflüsse <strong>und</strong> soziale E<strong>in</strong>bettungen, <strong>in</strong> psychologischer Perspektive<br />
dagegen um kognitive Prozesse, emotionale Reaktionen <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Handlungszusammenhänge.<br />
Mit Blick auf die zweite Lebenshälfte sollten aber nicht re<strong>in</strong> soziologische oder psychologische<br />
Forschungsfragen verfolgt, sondern e<strong>in</strong>e Integration diszipl<strong>in</strong>ärer Fragestellungen<br />
angestrebt werden, da gerade mit dem Übergang <strong>in</strong> das dritte Lebensalter kanalisierende Strukturen<br />
von Beruf <strong>und</strong> Familie entfallen <strong>und</strong> größere Handlungsspielräume entstehen können
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
(Kohli, 2000, S. 24). Neben der je diszipl<strong>in</strong>ären Beschreibung von Veränderung <strong>und</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>in</strong><br />
objektiven <strong>und</strong> subjektiven Dimensionen der Lebenssituation ist daher die <strong>in</strong>ter-diszipl<strong>in</strong>äre<br />
Vernetzung <strong>und</strong> Erk<strong>und</strong>ung von Beziehungen zwischen objektiver Lebenssituation <strong>und</strong> subjektiver<br />
Lebensbewertung von hohem Interesse.<br />
Mit dem Begriff „Lebensqualität“ steht e<strong>in</strong> Konzept zur Verfügung, das objektive Dimensionen<br />
der Wohlfahrt <strong>und</strong> subjektive Dimensionen des Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>in</strong>tegriert. Der Begriff steht für<br />
e<strong>in</strong> Wohlfahrtskonzept, das sich seit Ende der 1960er Jahre mehr <strong>und</strong> mehr durchgesetzt hat.<br />
Bis dah<strong>in</strong> standen die mit dem Begriff des Wohlstands bzw. des Lebensstandards beschriebenen<br />
materiellen, sogenannten objektiven Dimensionen der Wohlfahrt – also die Verfügung über<br />
E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen oder der Besitz <strong>und</strong> Konsum von Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen – im<br />
Vordergr<strong>und</strong> der Betrachtung. Demgegenüber stand das Konzept des Wohlbef<strong>in</strong>dens, das sich<br />
auf subjektive Wohlfahrts<strong>in</strong>terpretationen konzentrierte, die von <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Wahrnehmungen,<br />
Situationsdef<strong>in</strong>itionen, kognitiven Bewertungen <strong>und</strong> Emotionen bee<strong>in</strong>flusst werden (Noll,<br />
1989). Im Gegensatz dazu vere<strong>in</strong>t die Lebensqualität objektive <strong>und</strong> subjektive bzw. materielle<br />
<strong>und</strong> immaterielle Dimensionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Konzept: „Unter Lebensqualität verstehen wir ... gute<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen, die mit e<strong>in</strong>em positiven subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den zusammengehen.“<br />
(Zapf, 1984; S. 23) Gleichzeitig lenkt dieses Konzept den Fokus von der quantitativen Betrachtung<br />
auf qualitative Aspekte <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Wohlfahrt (Noll, 2000). Gemessen werden beide Dimensionen<br />
mit Hilfe von sozialen Indikatoren, welche die Ausprägungen des Outputs – <strong>und</strong><br />
nicht des Inputs – sozialer Prozesse auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Ebene messen. Angewandt auf die gerontologische<br />
Forschung heißt das, dass es neben der Erfassung der objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>und</strong> Ressourcen älter werdender Menschen ebenso bedeutsam ist, die subjektive Bewertung<br />
ihrer <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Lebenslage bzw. Lebensbed<strong>in</strong>gungen zu berücksichtigen (Smith et al., 1996;<br />
Kahneman et al., 1999). Vielfach s<strong>in</strong>d es weniger die objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen als vielmehr<br />
die subjektiv wahrgenommenen Lebenssituationen, also der Grad der Zufriedenheit oder<br />
Unzufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen, die das Erleben <strong>und</strong> Verhalten von Menschen<br />
bee<strong>in</strong>flussen. Demzufolge muss e<strong>in</strong>e Dauerbeobachtung der Lebenssituation älterer Menschen,<br />
die e<strong>in</strong> umfassendes Abbild ihrer Lebensverhältnisse wiederzugeben anstrebt, auch e<strong>in</strong>e<br />
Komponente des <strong>Wandel</strong>s subjektiver Bewertungen der eigenen Lebensumstände enthalten<br />
(Noll & Schöb, 2002).<br />
Sozialberichterstattung hat nach Noll die primäre Funktion, „Zustand <strong>und</strong> Veränderungen der<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> der Lebensqualität der Bevölkerung auf e<strong>in</strong>er adäquaten empirischen<br />
Datenbasis... zu beobachten, zu beschreiben <strong>und</strong> zu analysieren“ (Noll, 1998, S. 634). Gruppenspezifische<br />
Sozialberichterstattung über die Bevölkerung im mittleren <strong>und</strong> höheren Lebensalter<br />
kann zur allgeme<strong>in</strong>en Aufklärung über die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Wohlfahrt der Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte, ihrer Stellung <strong>in</strong> der Gesellschaft <strong>und</strong> ihrer Wohlfahrtsentwicklung beitragen.<br />
Zugleich sollen – entsprechend der allgeme<strong>in</strong>en Zielsetzung der Sozialberichterstattung – relevante<br />
Informationen für den politischen Diskurs <strong>und</strong> die politische Entscheidungsf<strong>in</strong>dung zur<br />
Verfügung gestellt werden. E<strong>in</strong> Hauptziel von Alterssozialberichterstattung ist die Untersuchung<br />
des Niveaus, der Verteilung <strong>und</strong> des <strong>Wandel</strong>s der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Wohlfahrt bzw. Lebensqualität<br />
(im Zusammenspiel von objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den)<br />
<strong>und</strong> der gruppenspezifischen Wohlfahrtslagen. Somit gilt es auch, neue oder sich verschärfende<br />
soziale <strong>Entwicklung</strong>en aufzuspüren <strong>und</strong> mitzuteilen sowie empirisch gestützte E<strong>in</strong>schät-<br />
7
8<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
zungen zu erfolgten oder erwartbaren Auswirkungen politischer Reformen auf die Lebenssituationen<br />
der Menschen abzugeben. Altersbezogene Sozialberichterstattung hat <strong>in</strong> den vergangenen<br />
zehn Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen: Mittlerweile liegen vier Berichte zur Lebenssituation<br />
älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland vor (BMFSFJ, 1993; BMFSFJ, 1998; BMFSFJ, 2001a;<br />
BMFSFJ, 2002), die Enquete-Kommission „Demografischer <strong>Wandel</strong>“ hat zwei Zwischenberichte<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>en Abschlußbericht vorgelegt (Enquete-Kommission, 1994; Enquete-Kommission,<br />
1998; Enquete-Kommission, 2002) <strong>und</strong> im Rahmen des neuformulierten Weltaltenplans hat es<br />
e<strong>in</strong>en deutschen Beitrag gegeben (BMFSFJ, 2001b). Auch Daten aus der ersten Welle des Alterssurveys<br />
haben E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> diese Sozialberichterstattung gef<strong>und</strong>en (Kohli & Künem<strong>und</strong>,<br />
2001).<br />
Gerade der Anspruch, dass Sozialberichterstattung nicht alle<strong>in</strong> über das Niveau <strong>und</strong> die Verteilung,<br />
sondern <strong>in</strong>sbesondere über die <strong>Entwicklung</strong> der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Wohlfahrt bzw. Lebensqualität<br />
zu berichten habe, impliziert die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Längsschnittbetrachtung (Zapf et al.,<br />
1996). Dabei ist es jedoch wichtig, zwischen Trend- <strong>und</strong> Panelstudien 2 zu unterscheiden. Für<br />
e<strong>in</strong>e Dauerbeobachtung der <strong>Entwicklung</strong> von Niveau <strong>und</strong> Verteilung objektiver <strong>und</strong> subjektiver<br />
Wohlfahrtserträge zur Ermittlung allgeme<strong>in</strong>er Trends, wie sie etwa im Wohlfahrtssurvey realisiert<br />
wird, s<strong>in</strong>d wiederholte Querschnittsuntersuchungen völlig ausreichend (Habich & Zapf,<br />
1994). Wiederholte repräsentative Querschnittsuntersuchungen können gr<strong>und</strong>legende Trend<strong>in</strong>formationen<br />
zur Sozialstruktur <strong>und</strong> zum Wohlbef<strong>in</strong>den liefern. E<strong>in</strong> solches Design hat allerd<strong>in</strong>gs<br />
den Nachteil, dass es ke<strong>in</strong>e Informationen über <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen <strong>und</strong> Kont<strong>in</strong>uitäten<br />
liefern kann. Um <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen <strong>in</strong> der Zeit erfassen, beschreiben <strong>und</strong> erklären<br />
zu können, ist e<strong>in</strong> sogenanntes Paneldesign (auch „echtes“ Längsschnittdesign) (Schnell et<br />
al., 1999), das heißt die wiederholte Messung von Merkmalsausprägungen derselben Individuen<br />
zu unterschiedlichen Messzeitpunkten, unabd<strong>in</strong>gbar. Hierbei ist e<strong>in</strong>em prospektiven Paneldesign<br />
der Vorzug zu geben gegenüber e<strong>in</strong>em retrospektiven Kohortendesign, da vor allem <strong>in</strong><br />
Bezug auf subjektive Indikatoren Wahrnehmungsverzerrungen auftreten können, wenn sie retrospektiv<br />
erfragt werden (Brückner, 1994). E<strong>in</strong>e kausalanalytische Ermittlung von Ursache <strong>und</strong><br />
Wirkung ist nur mittels prospektiver Längsschnittdesigns realisierbar (Schupp et al., 1996).<br />
Mit der E<strong>in</strong>führung kausalanalytischer Analyse<strong>in</strong>tentionen vollzieht sich der Schritt von der<br />
deskriptiven Sozialberichterstattung h<strong>in</strong> zu Beiträgen sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlicher<br />
Alternsforschung, bei der es um die Analyse von Bed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Ursachen von (sich verändernder)<br />
Lebensqualität <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte geht (Schaie & Hofer, 2001). Es ist nicht<br />
alle<strong>in</strong> bedeutsam, e<strong>in</strong>en breiten Erhebungsansatz h<strong>in</strong>sichtlich objektiver Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>und</strong> subjektiver Lebensbewertungen zu verfolgen, sondern <strong>in</strong>sbesondere die Frage zu stellen,<br />
welche Faktoren die Lebensqualität im Erwachsenenalter bee<strong>in</strong>flussen. Hierbei sollten nicht<br />
alle<strong>in</strong> sozialstrukturelle Merkmale (Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, regionale<br />
Besonderheiten) <strong>in</strong> die Analyse e<strong>in</strong>fließen, sondern auch Faktoren wie etwa biografischer Lebensstil,<br />
Handlungskompetenzen <strong>und</strong> Zielvorstellungen der betroffenen Personen berücksichtigt<br />
2 In der psychologischen Literatur werden die Begriffe ‚Längsschnitt’ <strong>und</strong> ‚Panel’ oft synonym gebraucht, da Untersuchungen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich auf Individuen gerichtet s<strong>in</strong>d. Aus soziologischer Perspektive werden Panelstudien jedoch<br />
als Teilmenge des Oberbegriffs ‚Längsschnitte’ aufgefasst, da hier auch die Beschreibung allgeme<strong>in</strong>er sozialer<br />
Trends ohne Bezugnahme auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong> möglich ist.
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
werden. Die Analyse komplexer Faktorenkonstellationen ist dabei nicht alle<strong>in</strong> unter dem Gesichtspunkt<br />
sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlicher Alternsforschung von Interesse, sondern<br />
kann als e<strong>in</strong> Schritt h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er besser begründeten Sozialberichterstattung verstanden werden<br />
1.3.2 <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>sphasen im<br />
Erwachsenenalter<br />
Die Betrachtung der zweiten Lebenshälfte legt die Frage nahe, wie dieser Lebensabschnitt sozial<br />
konstruiert <strong>und</strong> <strong>in</strong>dividuell erlebt wird. Aus theoretischer Sicht stehen zwei mite<strong>in</strong>ander verflochtene<br />
Fragestellungen im Mittelpunkt: Erstens ergibt sich aus entwicklungstheoretischer<br />
Perspektive die Frage, durch welche Prozesse <strong>und</strong> Mechanismen altersbezogene Veränderungen<br />
bewirkt werden. Neben biologischen Faktoren stehen vor allem soziale Kontexte <strong>und</strong> Strukturen,<br />
ökologische Bed<strong>in</strong>gungen sowie personale Handlungskompetenzen als potentielle <strong>Entwicklung</strong>sfaktoren<br />
im Mittelpunkt der Analysen. H<strong>in</strong>sichtlich sozialer Kontexte s<strong>in</strong>d proximale<br />
(„nahe“) Faktoren, wie etwa Familie, Arbeitsplatz <strong>und</strong> Nachbarschaft sowie distale („entfernte“)<br />
Faktoren, wie etwa sozialstrukturelle, politische <strong>und</strong> kulturelle Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu berücksichtigen.<br />
Daneben <strong>in</strong>teressiert zweitens die Frage, ob die zweite Lebenshälfte <strong>in</strong> verschiedene<br />
Altersphasen gegliedert werden kann. Aus soziologischer Perspektive bieten sich die Konzepte<br />
der altersbezogenen Rollenzuweisung sowie des Status <strong>und</strong> der Vergesellschaftung von Individuen<br />
an, aus psychologischer Perspektive die Konzepte alterskorrelierter Herausforderungen,<br />
Chancen <strong>und</strong> Belastungen. In engem Zusammenhang dazu steht die Frage nach der Art der zeitlichen<br />
Strukturierung des Lebenslaufs durch kritische Lebensereignisse, Statuspassagen <strong>und</strong><br />
Altersnormen.<br />
In der jüngsten entwicklungspsychologischen Literatur wird der Ansatz der lebenslangen <strong>Entwicklung</strong><br />
(„life-span theory“) als e<strong>in</strong> theoretisches Metamodell favorisiert <strong>und</strong> dessen Implikationen<br />
für <strong>Entwicklung</strong> im hohen Alter expliziert (Baltes & Smith, 1999). Seit e<strong>in</strong>igen Jahren<br />
f<strong>in</strong>det dieses Modell auch E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> die (noch recht junge) Forschung zum mittleren Erwachsenenalter<br />
(Staud<strong>in</strong>ger, 2001). Neben den Gr<strong>und</strong>annahmen, dass <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong> lebenslanger<br />
Prozess ist, sich als dynamisches Wechselspiel von Gew<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Verlusten darstellt <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
soziale, historische <strong>und</strong> ökologische Kontexte e<strong>in</strong>gebettet ist, wird auch auf die Relevanz kultureller<br />
Faktoren <strong>und</strong> die Bedeutsamkeit biologischer Alternsprozesse h<strong>in</strong>gewiesen. Paul Baltes<br />
<strong>und</strong> Kollegen/Kolleg<strong>in</strong>nen postulieren, dass mit wachsendem Lebensalter der E<strong>in</strong>fluss negativer<br />
biologischer Faktoren zunimmt <strong>und</strong> die Notwendigkeit für stützende <strong>und</strong> protektive Maßnahmen<br />
(„Kultur“) wächst. Individuelle Ressourcen werden mit zunehmendem Alter immer weniger<br />
<strong>in</strong> Prozesse des Wachstums oder des Aufrechterhaltens von Funktionen, sondern immer<br />
stärker <strong>in</strong> die Regulation von Verlusten <strong>in</strong>vestiert. Diese Überlegungen münden <strong>in</strong> das Postulat<br />
e<strong>in</strong>es sogenannten vierten Alters, das mit circa 80 Jahren beg<strong>in</strong>nt <strong>und</strong> durch e<strong>in</strong>e zunehmend<br />
negativ werdende Bilanz von Gew<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Verlusten gekennzeichnet ist (Baltes, 1997). Da es<br />
sich beim Übergang vom dritten <strong>in</strong>s vierte Alter um e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Verschlechterung verschiedener<br />
Funktionen handelt, ist es schwierig, e<strong>in</strong>en genauen Übergangszeitpunkt anzugeben.<br />
Gerade <strong>in</strong> Bezug auf Veränderungen im hohen Alter ist zu fragen, ob <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> diesem<br />
Altersabschnitt kont<strong>in</strong>uierlich oder diskont<strong>in</strong>uierlich verläuft (Baltes et al., 1996). Der Kernpunkt<br />
ist dabei die Frage, ob es Veränderungen gibt, die sich als qualitativer <strong>Entwicklung</strong>s-<br />
9
10<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
sprung <strong>in</strong>terpretieren lassen <strong>und</strong> <strong>in</strong>wieweit <strong>in</strong> der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Biografie liegende Merkmale<br />
e<strong>in</strong>er Person ihre <strong>Entwicklung</strong> im hohen Alter vorherzusagen vermögen.<br />
E<strong>in</strong> weiteres bedeutsames Forschungsgebiet stellt die Analyse der <strong>Entwicklung</strong>srelevanz kritischer<br />
Lebensereignisse (Reese & Smyer, 1983; Filipp, 1990) sowie deren Bewältigung dar<br />
(Tesch-Römer et al., 1997). Bei weitem nicht alle kritischen Lebensereignisse s<strong>in</strong>d durch Unvorhersehbarkeit<br />
<strong>und</strong> ger<strong>in</strong>ge Auftretenswahrsche<strong>in</strong>lichkeit gekennzeichnet. Gerade im mittleren<br />
<strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter treten e<strong>in</strong>e Reihe von Lebensereignissen mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
auf <strong>und</strong> haben zum Teil sogar normativen Charakter im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Statuspassage.<br />
Beispiele s<strong>in</strong>d der Auszug des letzten K<strong>in</strong>des aus dem elterlichen Haushalt („empty nest“),<br />
der Tod des Partners (dies betrifft <strong>in</strong>sbesondere Frauen) sowie das Auftreten von Erkrankungen<br />
im höheren Lebensalter (wobei die im hohen Erwachsenenalter typischen Erkrankungen häufig<br />
chronisch <strong>und</strong> damit weniger e<strong>in</strong> zeitlich präzise bestimmbares „Ereignis“ als vielmehr e<strong>in</strong>e<br />
Dauerbelastung s<strong>in</strong>d). Kritische Lebensereignisse können also – <strong>und</strong> zwar sowohl aus der Sicht<br />
der betroffenen Personen als auch im S<strong>in</strong>ne theoretischer Analyse – den Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es neuen<br />
Lebensabschnitts markieren <strong>und</strong> dementsprechend als „organisierendes Erklärungspr<strong>in</strong>zip für<br />
ontogenetischen <strong>Wandel</strong> über die Lebensspanne h<strong>in</strong>weg“ <strong>in</strong>terpretiert werden (Filipp, 1981: S.<br />
7-8). Der Lebensspannen-Ansatz verweist auch auf die Idee der <strong>Entwicklung</strong>snormen, worunter<br />
die Vorstellung sozial erwünschter chronologischer Zeitpunkte oder Zeiträume für das Erreichen<br />
bestimmter <strong>Entwicklung</strong>szustände zu verstehen ist (Dannefer, 1998). „Transitional Events“<br />
(Neugarten, 1968) haben <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den von ihnen verursachten Veränderungen<br />
von Selbstkonzept <strong>und</strong> Identität Bedeutung. Abweichungen von kulturell vorgegebenen chronologischen<br />
<strong>Entwicklung</strong>szeiten („off-time“) können negative Konsequenzen <strong>in</strong> der <strong>Entwicklung</strong>,<br />
zum Beispiel Lebenskrisen, nach sich ziehen (Heckhausen, 1990).<br />
Auch die soziologische Alter(n)sforschung hat sich <strong>in</strong>tensiv mit Statuspassagen <strong>und</strong> Altersphasen<br />
beschäftigt, wenn auch aus e<strong>in</strong>em anderen Blickw<strong>in</strong>kel <strong>und</strong> unter Verfolgung anderer Forschungs<strong>in</strong>teressen.<br />
Die Ause<strong>in</strong>andersetzung mit der – recht e<strong>in</strong>seitig am männlichen Muster<br />
orientierten –Dreiteilung des Lebenslaufs <strong>in</strong> „Bildung“ (K<strong>in</strong>dheit <strong>und</strong> Jugend), „Erwerbstätigkeit“<br />
(junges <strong>und</strong> mittleres Erwachsenenalter) <strong>und</strong> „Ruhestand“ (höheres Alter) kennzeichnet<br />
die Lebenslaufsoziologie (Settersten, 2002). Von besonderer Bedeutung für die Betrachtung der<br />
zweiten Lebenshälfte s<strong>in</strong>d die Phasen des „zweiten“ <strong>und</strong> „dritten Alters“: Das „zweite Alter“ ist<br />
durch die Teilhabe am Erwerbsleben gekennzeichnet, die <strong>in</strong> westlichen Gesellschaften der wichtigste<br />
Mechanismus zur Vergesellschaftung von Individuen ist. Im Gegensatz dazu setzt das<br />
„dritte Alter“ erst am Übergang von der Phase der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> den Ruhestand an. Diese<br />
Transition kann vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Institutionalisierung des Lebenslaufs verstanden<br />
werden (Kohli, 1985) 3 . Mart<strong>in</strong> Kohli argumentiert, dass die historische Institutionalisierung e<strong>in</strong>e<br />
zunehmend klarere Gliederung nach Lebensphasen <strong>und</strong> Altersgruppen mit sich gebracht habe<br />
(Kohli, 1998). Das soziale Sicherungssystem <strong>in</strong> den Wohlfahrtsstaaten Europas, also auch <strong>in</strong><br />
Deutschland, ist auf die Trennung zwischen Erwerbsphase <strong>und</strong> Ruhestandsphase h<strong>in</strong> angelegt<br />
<strong>und</strong> trägt durch rechtliche Regelungen entscheidend zur sozialen Def<strong>in</strong>ition dieser Lebensabschnitte<br />
bei. Auch <strong>in</strong> der historischen Soziologie wird argumentiert, dass die Phasen des „ers-<br />
3 Kohli wies jedoch bereits an dieser Stelle auf E<strong>in</strong>schränkungen des Institutionalisierungsprozesses h<strong>in</strong>.
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
ten“, „zweiten“ <strong>und</strong> „dritten Alters“ erst im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert aufgr<strong>und</strong> des <strong>Wandel</strong>s der Arbeitswelt,<br />
der Etablierung sozialer Sicherungssysteme <strong>und</strong> Veränderungen der durchschnittlichen<br />
Lebensdauer entstanden s<strong>in</strong>d (Laslett, 1989/1995).<br />
In den vergangenen Jahrzehnten haben jedoch <strong>in</strong> Deutschland zwei Prozesse den Übergang vom<br />
Erwerbsleben <strong>in</strong> den Ruhestand verändert: Zum e<strong>in</strong>en ließ sich e<strong>in</strong> Trend zu e<strong>in</strong>em immer früheren<br />
Austritt aus dem Erwerbsleben beobachten, zum anderen haben sich für viele Arbeitnehmer<br />
zwischen die Phase der Erwerbstätigkeit <strong>und</strong> des Ruhestands Phasen der Arbeitslosigkeit,<br />
des Vorruhestands oder der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geschoben, so<br />
dass sich der ehemals rasche Statusübergang für nicht wenige Menschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en mehr oder<br />
weniger langen Durchgang durch unsichere, prekäre Lebenssituationen gewandelt hat (Behrend,<br />
2001). Diese allgeme<strong>in</strong>e Tendenz zur De<strong>in</strong>stitutionalisierung, Pluralisierung <strong>und</strong> Destandardisierung<br />
wird <strong>in</strong> der Lebenslaufsoziologie mit ökonomischen Veränderungen (Flexibilisierung,<br />
Globalisierung) <strong>und</strong> sozialen Veränderungen von Wertewandel, Individualisierungsprozessen<br />
<strong>und</strong> Bildungsexpansion <strong>in</strong> Zusammenhang gebracht (Mayer, 1998). Wird die Teilhabe an der<br />
Arbeitswelt als zentraler Mechanismus der Vergesellschaftung von Individuen konzipiert, so<br />
stellt sich das Problem, welche Vergesellschaftungsmechanismen <strong>in</strong> der Phase des „Ruhestands“<br />
von Bedeutung s<strong>in</strong>d. Dieses Festhalten an der zentralen Bedeutung der Arbeitsgesellschaft<br />
wird von e<strong>in</strong>igen Autoren als „Wurzel des bl<strong>in</strong>den Flecks der Soziologie gegenüber der<br />
gesellschaftlichen Bedeutung des Alter(n)s heute“ gesehen (Backes & Clemens, 1998). Konsequenz<br />
dieser Überlegungen ist es, neben der Dichotomie von Arbeit <strong>und</strong> Ruhestand auch andere<br />
Lebensbereiche <strong>und</strong> deren Bedeutung für den Lebenslauf zu analysieren: Die E<strong>in</strong>bettung <strong>in</strong><br />
familiale <strong>und</strong> andere private Netzwerke, bürgerschaftliches Engagement sowie die Übernahme<br />
von nicht auf E<strong>in</strong>kommenserwerb gerichteten produktiven Tätigkeiten s<strong>in</strong>d Lebensbereiche, die<br />
potentiell reichhaltige – bislang wissenschaftlich jedoch noch zu wenig analysierte – Vergesellschaftungsoptionen<br />
für älter werdende Menschen bieten.<br />
Um <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>und</strong> -bed<strong>in</strong>gungen empirisch adäquat beschreiben zu können, ist e<strong>in</strong><br />
Längsschnittdesign zw<strong>in</strong>gend erforderlich. E<strong>in</strong> wesentlicher Vorteil von Panelstudien ist, dass<br />
sie die Erfassung von <strong>Entwicklung</strong>en, das heißt von Veränderungen <strong>und</strong> Kont<strong>in</strong>uitäten über<br />
e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum h<strong>in</strong>weg erlauben. Im Gegensatz zu Querschnittsanalysen können<br />
<strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Differenzen gleichermaßen erfasst werden<br />
(Baltes, 1967). H<strong>in</strong>zu kommt, dass für die Auswertung von Daten aus abhängigen Stichproben<br />
statistisch effizientere Verfahren als bei unabhängigen Stichproben zur Verfügung stehen<br />
(Roth & Holl<strong>in</strong>g, 1999). Diese Vorteile überwiegen die Nachteile, zu denen e<strong>in</strong>e mehr oder<br />
m<strong>in</strong>der hohe Panelmortalität, die Möglichkeit des Auftretens sogenannter Paneleffekte (Lern-<br />
<strong>und</strong> Er<strong>in</strong>nerungseffekten) <strong>und</strong> die Gefahr e<strong>in</strong>geschränkter Repräsentativität durch den wiederholten<br />
E<strong>in</strong>satz derselben Stichprobe gehören. Wenn diese Nachteile jedoch von Beg<strong>in</strong>n an berücksichtigt<br />
werden, kann ihre Wirkung erheblich verm<strong>in</strong>dert werden. So ist es bei Paneluntersuchungen<br />
üblich, <strong>in</strong> der ersten Erhebungswelle e<strong>in</strong>e ausreichend große Stichprobe zu ziehen,<br />
die zukünftige Ausfälle antizipiert. Das Auftreten von Paneleffekten ist unvermeidlich, kann<br />
jedoch durch Selektivitätsanalysen sowie Replikationsdesigns empirisch analysiert werden.<br />
11
12<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
1.3.3 <strong>Sozialer</strong> <strong>und</strong> gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong><br />
Die Analyse von Altersveränderungen <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>sprozessen macht es notwendig, Personen<br />
im Lauf der Zeit wiederholt zu untersuchen, um <strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen feststellen<br />
<strong>und</strong> analysieren zu können. Das Verstreichen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Lebenszeit geht aber e<strong>in</strong>her mit Prozessen<br />
sozialen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> historischen Veränderungen (Kohli & Szydlik, 2000). Daher sollte<br />
<strong>in</strong> Längsschnittuntersuchungen stets der Frage nachgegangen werden, <strong>in</strong>wieweit empirisch<br />
nachweisbare <strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Unterschiede durch lebenslaufbezogene<br />
Faktoren, historisch s<strong>in</strong>guläre Ereignisse <strong>und</strong> kohortenbezogene Prozesse oder<br />
sozialen <strong>Wandel</strong> geprägt wurden. Dies macht es notwendig, (a) <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Lebenszeit e<strong>in</strong>erseits<br />
(Mikroebene) <strong>und</strong> sozialen <strong>Wandel</strong> andererseits (Makroebene) zu unterscheiden <strong>und</strong> (b)<br />
die Abfolge von Generationen als e<strong>in</strong>en möglichen Mechanismus zur Vermittlung <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r<br />
Veränderungen <strong>in</strong> aggregierter Form im Verhältnis zu Prozessen des sozialen <strong>Wandel</strong>s genauer<br />
zu betrachten.<br />
Wie bereits mehrfach erwähnt, s<strong>in</strong>d umfassende Paneluntersuchungen e<strong>in</strong>e notwendige Voraussetzung<br />
dafür, <strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen <strong>in</strong>nerhalb der Lebenszeit von Individuen empirisch<br />
nachzuweisen. Allerd<strong>in</strong>gs kann <strong>in</strong> Zeiten sozialen <strong>Wandel</strong>s nicht davon ausgegangen werden,<br />
dass alle festgestellten <strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Veränderungen auf alterskorrelierte Bed<strong>in</strong>gungsfaktoren<br />
zurückgeführt werden können (Alter als „quasi-kausaler“ Erklärungsfaktor). Vielmehr<br />
ist stets die Möglichkeit zu beachten, dass markante historische Ereignisse oder Prozesse des<br />
sozialen <strong>Wandel</strong>s als Verursacher dieser Unterschiede zwischen Messwerten e<strong>in</strong>es Individuums<br />
zu zwei Zeitpunkten geführt haben könnten. Das Konstrukt der Zeit umfasst also Wandlungs-<br />
<strong>und</strong> Veränderungsprozesse auf zwei Ebenen: (1.) Auf der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ebene ist es notwendig,<br />
die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Lebenszeit zu betrachten, die mit biologischen Prozessen, alterskorrelierten<br />
<strong>Entwicklung</strong>saufgaben oder selbst gesetzten Lebenszielen verknüpft ist. (2.) Auf sozialer Ebene<br />
ist es notwendig, die Auswirkungen historischer Ereignisse <strong>und</strong> des sozialen <strong>Wandel</strong>s auf die<br />
Lebenssituationen älter werdender Menschen zu betrachten. Bei der Durchführung von Panelstudien<br />
ergeben sich stets zwei methodische Probleme: Zum e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d Alter <strong>und</strong> Messzeitpunkt<br />
konf<strong>und</strong>iert <strong>und</strong> zum anderen kann von der Betrachtung nur e<strong>in</strong>er Kohorte nicht auf die<br />
<strong>Entwicklung</strong> anderer Kohorten geschlossen werden (Kohortenspezifität von Ergebnissen). Bei<br />
der Kausalanalyse <strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen kommt es also darauf an, alterskorrelierte<br />
<strong>Entwicklung</strong>sfaktoren von den Auswirkungen historischer Ereignisse sowie Prozessen des sozialen<br />
<strong>Wandel</strong>s zu unterscheiden, die direkt oder <strong>in</strong>direkt Auswirkungen auf die Lebenssituation<br />
<strong>und</strong> Lebensqualität im Alter haben. Diese Überlegungen machen es notwendig, nicht alle<strong>in</strong> Panelstudien<br />
an e<strong>in</strong>zelnen Kohorten durchzuführen, sondern zeitversetzte Panelstudien <strong>in</strong> unterschiedlichen<br />
Kohorten zu realisieren (kohortensequentielles Design), um auf diese Weise dem<br />
Ziel näher zu kommen, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen <strong>und</strong> Prozesse sozialen <strong>Wandel</strong>s vone<strong>in</strong>ander<br />
zu trennen <strong>und</strong> ihre jeweiligen Bed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Auswirkungen zu analysieren. In Zeiten<br />
raschen sozialen <strong>Wandel</strong>s wird die Halbwertzeit e<strong>in</strong>mal festgestellter Merkmale der Lebenssituation<br />
älterer Menschen immer ger<strong>in</strong>ger <strong>und</strong> kann nicht mehr ohne weiteres auf die kommenden<br />
Generationen übertragen werden. Deshalb müssen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Alterungsverläufe kont<strong>in</strong>uierlich<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der Kohortenabfolge beobachtet werden.
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Mathilda <strong>und</strong> John Riley haben bereits vor geraumer Zeit den Zusammenhang von <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>m<br />
Lebenslauf <strong>und</strong> sozialem <strong>Wandel</strong> analysiert (Riley et al., 1972; Riley & Riley, 1992). Ausgangspunkt<br />
ihrer Argumentation ist die These, dass mit Hilfe des (chronologischen) Alters sowohl<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Lebensläufe als auch soziale Strukturen <strong>in</strong> Schichten e<strong>in</strong>geteilt werden („age<br />
stratification“). Diese Altersschichtung unterliegt jedoch Dynamisierungsprozessen. So können<br />
sich die Lebensläufe von Individuen unterschiedlicher Kohorten erheblich vone<strong>in</strong>ander unterscheiden.<br />
Aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher Rhythmisierungen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Lebensläufe <strong>und</strong> sozialer<br />
Strukturen kann es zu deutlichen Asynchronien kommen, etwa wenn die Bedürfnisse <strong>und</strong> Wünsche<br />
älter werdender Menschen mit den Angeboten der sozialen Struktur nicht übere<strong>in</strong>stimmen<br />
(Riley et al., 1999). Gesellschaftspolitisch ebenfalls von hoher Bedeutung ist die Frage, wie die<br />
Solidarität zwischen den Generationen <strong>in</strong> Zukunft gesichert werden kann <strong>und</strong> zwar unter Berücksichtigung<br />
des demografischen <strong>Wandel</strong>s, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>und</strong> familialer Faktoren sowie deren<br />
Spannungsverhältnis zur gesamtgesellschaftlichen <strong>Entwicklung</strong>. Gesellschaftliche Solidarität<br />
basiert auf anderen Gr<strong>und</strong>lagen als die auf persönlichen Beziehungen beruhende familiale Solidarität.<br />
Gesellschaftliche Solidarität impliziert die Erwartung, dass Mitmenschen verlässlich<br />
s<strong>in</strong>d, dass sie bestehende Normen <strong>und</strong> die daraus folgenden Pflichten anerkennen, dass andere<br />
Personen sich auf ihre Kooperationsbereitschaft <strong>und</strong> ihren E<strong>in</strong>satz für geme<strong>in</strong>same Interessen<br />
verlassen können. Solidarität wirkt <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne sozial steuernd, das heißt, sie motiviert<br />
Menschen zu Empathie <strong>und</strong> zu eigene <strong>und</strong> fremde Interessen ausbalancierender Verantwortung.<br />
Praktisch äußert sich gesellschaftliche Solidarität im Verzicht auf eigennützige Handlungen auf<br />
Kosten anderer, wie zum Beispiel (<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em wohlfahrtsstaatlichen Kontext) Steuerflucht,<br />
Schwarzarbeit oder missbräuchliche Inanspruchnahme von Sozialleistungen (Kaufmann, 1997).<br />
Jedoch können auch wohlfahrtsstaatliche Institutionen, wie etwa die Alterssicherungssysteme,<br />
durch die Schaffung lebenszeitlicher Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Reziprozität moralische B<strong>in</strong>dungen begründen<br />
(„Moralökonomie“) (Kohli, 1987). In diesem S<strong>in</strong>ne ist es von hoher Bedeutung, das<br />
Verhältnis zwischen e<strong>in</strong>ander nachfolgenden Generationen empirisch zu untersuchen.<br />
Voraussetzung für die Analyse sozialen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong> ist e<strong>in</strong>e klare<br />
Unterscheidung zwischen Alters-, Perioden- <strong>und</strong> Kohorteneffekten. Jeder der genannten Effekte<br />
zeichnet sich durch e<strong>in</strong>en bestimmten Zeitbezug aus, der konzeptuell von den beiden anderen<br />
unterschieden werden kann <strong>und</strong> muss. Auf operationaler Ebene besteht e<strong>in</strong>e l<strong>in</strong>eare Beziehung<br />
zwischen Alter, Periode <strong>und</strong> Kohorte (vgl. auch Haagenaars, 1990). Alter ist gleich der Differenz<br />
zwischen Beobachtungszeitraum (Periode) <strong>und</strong> Geburtsdatum (Kohorte). Sobald zwei dieser<br />
drei Größen Alter, Periode <strong>und</strong> Kohorte bekannt s<strong>in</strong>d, ist der dritte quasi fixiert. Zwei Personen<br />
desselben Alters gehören immer auch derselben Geburtskohorte an – <strong>in</strong>folgedessen kann<br />
der dritte Faktor nicht unabhängig von den anderen beiden Faktoren variieren. Obgleich verschiedene<br />
technische Lösungen zur Lösung dieses als „Identifikationsproblem“ bekannt gewordenen<br />
Sachverhalts vorgeschlagen wurden (vgl. Donaldson & Horn, 1992; Haagenaars, 1990)<br />
kann es auf operationaler, methodischer Ebene nicht gelöst werden. Die Erkenntnis der Konf<strong>und</strong>ierung<br />
dieser Effekte führte schließlich zur schnell wachsenden Popularität von Längsschnittstudien,<br />
da man me<strong>in</strong>te, das Problem damit zu beseitigen. Doch auch Longitud<strong>in</strong>alerhebungen<br />
s<strong>in</strong>d nicht vor der Konf<strong>und</strong>ierung von Effekten gefeit. Auch Veränderungen im Längsschnitt<br />
können nicht e<strong>in</strong>deutig dem Alter zugeschrieben werden, sondern können ebenso aus konkreten<br />
historischen <strong>Entwicklung</strong>sbed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>er bestimmten Alterskohorte resultieren. Mit Hilfe<br />
13
14<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
statistischer Verfahren kann das Problem der Konf<strong>und</strong>ierung von Alters- mit Perioden- <strong>und</strong><br />
Kohorteneffekten bis heute nicht gelöst werden – es bleibt im Kern e<strong>in</strong> Identifikationsproblem<br />
(Glenn, 2003). Umso wichtiger ist e<strong>in</strong>e klare konzeptuelle Trennung.<br />
Mit dem Begriff der Alterseffekte s<strong>in</strong>d Wirkungen auf das zu untersuchende Merkmal bezeichnet,<br />
die der Position der Zielperson im Lebenslauf zugeordnet werden können. Es ist e<strong>in</strong>e alltägliche<br />
Tatsache, dass sich Menschen mit zunehmendem Alter verändern. Diese Veränderungen<br />
werden beim Vergleich von Unterschieden zwischen jüngeren <strong>und</strong> älteren Menschen identifiziert<br />
(Alw<strong>in</strong> & McCammon, 2003). Auslöser dieser Veränderung können biologische, psychologische<br />
<strong>und</strong> soziale Faktoren se<strong>in</strong>. Die zweite Quelle <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderung s<strong>in</strong>d Periodeneffekte.<br />
Periodeneffekte können def<strong>in</strong>iert werden als <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Reaktionen auf historische<br />
Ereignisse <strong>und</strong> Prozesse, welche die gesamte Gesellschaft <strong>in</strong> gleicher Weise betreffen (Alw<strong>in</strong> &<br />
McCammon, 2003). Periodeneffekte betreffen alle zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt <strong>in</strong> der Gesellschaft lebenden<br />
Menschen gleichermaßen, unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht oder anderen<br />
Merkmalen. Beispiele für besonders ausgeprägten Periodeneffekt s<strong>in</strong>d der Zweite Weltkrieg<br />
oder die Weltwirtschaftskrise (zu den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise bzw. im angelsächsischen<br />
Sprachraum „The Great Depression“ vgl. die Arbeiten von Elder, 1974; 1999). E<strong>in</strong>e<br />
dritte mögliche E<strong>in</strong>flussgröße betrifft Kohorteneffekte. Die Zugehörigkeit von Menschen zu<br />
e<strong>in</strong>er Kohorte wird durch den Zeitbezug zu e<strong>in</strong>em bestimmten Ausgangsereignis def<strong>in</strong>iert (z.B.<br />
Geburtskohorten über das Geburtsjahr, Heiratskohorten über das Heiratsdatum). Bezogen auf<br />
e<strong>in</strong>en historischen Kontext s<strong>in</strong>d Kohorten Gruppen von Personen, die <strong>in</strong>nerhalb desselben Zeitabschnitts<br />
bestimmte historische Ereignisse erlebt haben bzw. deren Leben von <strong>in</strong> demselben<br />
Zeitabschnitt erlebten historischen Ereignissen entscheidend geprägt wurde. Hier ist das Konzept<br />
der „Generation“ erkennbar, das bereits von Mannheim (1928) geprägt wurde. Während als<br />
„Kohorteneffekte“ die Gesamtheit jener Effekte bezeichnet wird, die aus der Geburt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
bestimmten historischen Kontext resultieren, setzt – im Gegensatz dazu – die Zugehörigkeit zu<br />
e<strong>in</strong>er Generation e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same, identitätsbildende, <strong>in</strong>terpretative Konstruktion voraus, welche<br />
sich durch identifizierbare Lebensstile auszeichnet. Kohorten folgen e<strong>in</strong>ander im Zeitverlauf<br />
kont<strong>in</strong>uierlich, das heißt, frühere Geburtskohorten werden Schritt für Schritt durch spätere abgelöst.<br />
Im Gegensatz zu Alters- <strong>und</strong> Periodeneffekten resultiert diese Veränderung jedoch nicht<br />
aus <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>m <strong>Wandel</strong>, sondern aus <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Stabilität (Alw<strong>in</strong> & McCammon, 2003).<br />
Die Biografie <strong>und</strong> die sich im Lebensverlauf ergebenden Möglichkeiten <strong>und</strong> Zwänge für die<br />
Mitglieder e<strong>in</strong>er bestimmten Geburtskohorte wurden durch die gleichen historischen Kontextbed<strong>in</strong>gungen<br />
geprägt. Dazu gehören neben e<strong>in</strong>schneidenden historischen Ereignissen wie Kriegen<br />
oder Wirtschaftskrisen auch periodenspezifische Erfahrungen, wie zum Beispiel Erziehungsstile<br />
oder die Gültigkeit bestimmter Normen <strong>und</strong> Werte. Doch nicht nur das, die Mitglieder<br />
derselben Geburtskohorte durchlaufen auch die Stationen des Lebenszyklus ungefähr zur<br />
gleichen Zeit. Sie erleben im ähnlichen Alter <strong>und</strong> <strong>in</strong> vergleichbaren historischen Zeitabschnitten<br />
ihre K<strong>in</strong>dheit, werden erwachsen, gründen Familien <strong>und</strong> werden pensioniert. Allerd<strong>in</strong>gs hat sich<br />
der so beschriebene idealtypische Lebensverlauf <strong>in</strong> den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert<br />
<strong>und</strong> ist vielfältiger <strong>und</strong> damit weniger normativ geworden (Dannefer, 1998). Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus entwickeln Kohorten ihre eigenen, ganz spezifischen Eigenschaften, die ihre Angehörigen<br />
von jenen anderer unterscheidet. So hat Easterl<strong>in</strong> (1987) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Reihe viel beachteter Studien<br />
herausgearbeitet, wie Angehörige der sogenannten „Babyboom“-Kohorte alle<strong>in</strong> aufgr<strong>und</strong>
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
der Größe ihrer Kohorte – <strong>und</strong> der daraus resultierenden, im Vergleich zu den vorherigen <strong>und</strong><br />
nachfolgenden Kohorten größeren Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt – <strong>in</strong> sozioökonomischer<br />
H<strong>in</strong>sicht benachteiligt wurden (Easterl<strong>in</strong>, 1987). Umgekehrt stellen heute gerade diese Geburtskohorten<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer relativen Größe im Vergleich zu jüngeren Kohorten bei ihrem E<strong>in</strong>tritt<br />
<strong>in</strong>s Rentenalter die auf dem Umlageverfahren basierenden Rentenversicherungssysteme vor<br />
F<strong>in</strong>anzierungsprobleme.<br />
1.3.4 Unterschiede <strong>und</strong> Ungleichheiten <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
E<strong>in</strong>ige der bislang diskutierten Konzepte zu <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong> sozialem <strong>Wandel</strong><br />
haben geme<strong>in</strong>sam, dass sie charakteristische Altersveränderungen postulieren. In der empirischen<br />
Literatur spiegelt sich diese Orientierung am typischen Altersverlauf <strong>in</strong> der weitverbreiteten<br />
Praxis der Bildung von altersbezogenen Mittelwerten wider, anhand derer Unterschiede<br />
zwischen Altersgruppen oder Veränderungen <strong>in</strong>nerhalb bestimmter Zeiträume illustriert <strong>und</strong><br />
belegt werden. Übersehen wird hierbei jedoch leicht, dass bei Personen e<strong>in</strong>es bestimmten Alters<br />
oft e<strong>in</strong>e beträchtliche Variabilität h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>es gemessenen Merkmales vorliegt. Ist diese<br />
<strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Varianz größer als die durch Altersunterschiede aufgeklärte Varianz, stellt sich<br />
die Frage, wie erhellend das Postulieren e<strong>in</strong>es typischen Alternsverlaufs mit Bezug auf dieses<br />
Merkmal noch ist. Gerade Ansätze <strong>in</strong>nerhalb der Lebenslaufsoziologie (Settersten, 2002) <strong>und</strong><br />
der Psychologie der Lebensspanne (Baltes & Baltes, 1994) verweisen auf hohe <strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Unterschiede im Verlauf des mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalters. Mit Bezug auf gesellschaftliche<br />
Veränderungen kann zudem gefragt werden, ob Verteilungen über die historische<br />
Zeit stabil bleiben oder sich verändern. Gr<strong>und</strong>sätzlich kann das Thema des differentiellen Alters<br />
<strong>in</strong> unterschiedlicher Weise thematisiert werden (Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2001): Zum e<strong>in</strong>en können<br />
Unterschiede zwischen Personen im S<strong>in</strong>ne von Ungleichartigkeit konzeptualisiert werden. Diese<br />
Ungleichartigkeit ist vor allem im deskriptiven S<strong>in</strong>ne geme<strong>in</strong>t. Zum anderen kann differentielles<br />
Altern aber auch als Ungleichheit im S<strong>in</strong>ne von Ungleichwertigkeit verstanden werden. Unterschiede<br />
zwischen Personen verweisen <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne auf die unterschiedliche Ausstattung mit<br />
Ressourcen, das heißt auf Bevorrechtigung bzw. Benachteiligung oder auf Begünstigung bzw.<br />
Schlechterstellung. Soziale Ungleichheit impliziert also e<strong>in</strong>e Evaluation <strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Unterschiede.<br />
Unterschiede im Lebenslauf (horizontale Betrachtungsweise): In der <strong>Entwicklung</strong>spsychologie<br />
der Lebensspanne wird schon seit langem darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass die <strong>Entwicklung</strong> im Erwachsenenalter<br />
<strong>und</strong> hohen Alter nicht für alle Menschen <strong>in</strong> gleicher Weise verläuft, sondern<br />
dass erhebliche Unterschiede zwischen Menschen gleichen Alters bestehen (Baltes, 1979; Baltes,<br />
1987; Thomae, 1959; Thomae, 1983). Dies bedeutet jedoch nicht, dass man ganz auf Aussagen<br />
zu Regelmäßigkeiten <strong>in</strong> Bezug auf die Erklärung des Erlebens <strong>und</strong> Verhaltens im höheren<br />
Erwachsenenalter verzichten müsste. Vielmehr soll verdeutlicht werden, dass chronologisches<br />
Altern nicht pauschal dazu dienen kann, die Gesamtvarianz von Alternsprozessen oder Altersgruppen<br />
abzubilden <strong>und</strong> auch nicht als Quelle für Alternsveränderungen <strong>in</strong>terpretiert werden<br />
sollte. In der gerontologischen Literatur f<strong>in</strong>det man verschiedene Ansätze, um <strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Unterschiede methodisch <strong>und</strong> theoretisch zu fassen. Meist wird versucht, Varianzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Altersgruppe mit Hilfe weiterer Variablen zu erklären. So weist Maddox darauf h<strong>in</strong>, dass Ver-<br />
15
16<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
haltensweisen <strong>und</strong> Bef<strong>in</strong>dlichkeit <strong>in</strong> höherem Alter weit stärker durch den sozioökonomischen<br />
Status determ<strong>in</strong>iert werden als durch das chronologische Alter (Maddox, 1987). Doch kann man<br />
nicht nur Unterschiede <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Altersgruppe durch andere Variablen erklären, man kann<br />
auch die Variabilität selbst als abhängige Variable untersuchen. Der Begriff des differentiellen<br />
Alterns muss sich aber nicht nur auf die Variation e<strong>in</strong>es Merkmals beziehen, es kann damit auch<br />
geme<strong>in</strong>t se<strong>in</strong>, dass Alternsverläufe für unterschiedliche Merkmale unterschiedlich erfolgen. Dies<br />
wird häufig mit dem Begriff der Multidimensionalität beschrieben. Das Konzept des Lebensstils<br />
ist e<strong>in</strong> Beispiel für die Analyse sozialer Differenzierung, bei dem nicht die normative Bewertung<br />
von Unterschiedlichkeiten im Vordergr<strong>und</strong> steht (Berger & Hradil, 1990; Schwenk, 1996).<br />
In kultursoziologischen Ansätzen verweist der Begriff des Lebensstils auf die Zugehörigkeit zu<br />
e<strong>in</strong>em bestimmten sozialen Milieu, das durch spezifische kulturelle Praktiken, Überzeugungen<br />
<strong>und</strong> Selbstrepräsentationen gekennzeichnet ist. Von Interesse ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die<br />
Frage, welche Formen von Lebensstilen sich <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte empirisch nachweisen<br />
lassen, ob diese Gruppierungen über verschiedene Altersgruppen <strong>und</strong> Messzeitpunkte stabil s<strong>in</strong>d<br />
<strong>und</strong> welche Beziehung zwischen Lebensstil <strong>und</strong> Lebenslage besteht.<br />
Ungleichheiten im Lebenslauf (vertikale Betrachtungsweise): Damit steht die Frage nach der<br />
Verschiedenheit von Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> sozialen Lagen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.<br />
Als soziale Ungleichheiten werden nach Hradil solche Differenzierungen bezeichnet, bei<br />
denen Menschen aufgr<strong>und</strong> ihrer Stellung <strong>in</strong> sozialen Beziehungsgefügen von den „wertvollen<br />
Gütern“ e<strong>in</strong>er Gesellschaft regelmäßig mehr bzw. weniger als andere erhalten (Hradil, 1999).<br />
Ungleichheiten können sich auf unterschiedliche Bereiche der Lebenslage beziehen, etwa auf<br />
E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen (Motel, 2000), Familienbeziehungen (Szydlik, 2002), Zugang zu<br />
neuen Technologien (Mollenkopf, 2001) oder Ges<strong>und</strong>heit (Mielck, 2003). Als Entstehungszusammenhänge<br />
für Ungleichheit werden nicht alle<strong>in</strong> Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>er sozialen Schicht<br />
(Schneider, 2003), sondern auch Alter (Dieck & Naegele, 1978) <strong>und</strong> Geschlecht (G<strong>in</strong>n, 2003;<br />
Schäfgen, 2002) diskutiert.<br />
Zum Zusammenhang zwischen Altern <strong>und</strong> sozialer Ungleichheit lassen sich vier Annahmen<br />
formulieren (Mayer & Wagner, 1996; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2001). Erstens kann danach gefragt<br />
werden, ob ältere Menschen im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen strukturell benachteiligt<br />
s<strong>in</strong>d (Hypothese der Altersbed<strong>in</strong>gtheit sozialer Ungleichheit). Die These der Altersbed<strong>in</strong>gtheit<br />
basiert auf der Annahme, dass Altern mit dem Nachlassen physischer <strong>und</strong> psychischer<br />
Leistungsfähigkeit e<strong>in</strong>hergeht <strong>und</strong> dass diese Verluste nachteilige Wirkungen auf die Lebenslagen<br />
älter werdender Menschen haben. Zudem verweist dieser Ansatz auf altersbezogene Unterschiede<br />
<strong>in</strong> der wohlfahrtsstaatlichen Versorgung. In diesem Zusammenhang kann auch auf die<br />
negativen Wirkungen von Altersstereotypen verwiesen werden, die beispielsweise ältere Menschen<br />
ab e<strong>in</strong>em bestimmten Lebensalter vom Arbeitsmarkt fernhalten. E<strong>in</strong>e zweite Hypothese<br />
besagt, dass Ungleichheiten im Alter auf bereits zuvor bestehende Unterschiede <strong>in</strong> den <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Lebenslagen zurückgeführt werden können (Hypothese der sozioökonomischen Differenzierung<br />
sozialer Ungleichheit im Alter). Dies würde e<strong>in</strong>e Kont<strong>in</strong>uität sozialer Unterschiede<br />
im Lebenslauf bedeuten. Ursachen für Ungleichheit im Alter s<strong>in</strong>d demzufolge <strong>in</strong> früheren Phasen<br />
des Lebenslaufs zu suchen. Drittens kann postuliert werden, dass sich lebenslang wirksame,<br />
schichtspezifische Unterschiede im Alter verstärken (Kumulationshypothese sozialer Ungleichheit<br />
im Alter). In diesem Zusammenhang kann darauf verwiesen werden, dass altersbed<strong>in</strong>gte
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Risikolagen <strong>in</strong> unterschiedlichen Lebensbereichen (etwa Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> materielle Lage) nicht<br />
nur geme<strong>in</strong>sam auftreten (Kovariation), sondern sich auch gegenseitig verstärken können (Interaktion).<br />
Das Ergebnis wäre e<strong>in</strong>e Verschärfung von Unterschieden, die bereits lebenslang bestehen.<br />
In deutlichem Gegensatz zu diesen drei Hypothesen steht schließlich viertens die Homogenisierungs-<br />
bzw. Entstrukturierungshypothese, die von e<strong>in</strong>er Vere<strong>in</strong>heitlichung von Lebenslagen<br />
im Alter aufgr<strong>und</strong> von <strong>in</strong>stitutionellen Regelungen ausgeht. Dieser These zufolge werden im<br />
Alter frühere Zugehörigkeiten <strong>und</strong> Differenzierungen von altersspezifischen Ähnlichkeiten der<br />
Lebenssituation überlagert. Die aus dem Erwerbsleben resultierende Ungleichheit wird nivelliert,<br />
während zugleich die <strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Heterogenität aufgr<strong>und</strong> der Ausdifferenzierung über<br />
den Altersverlauf zunimmt.<br />
1.3.5 Zwischenresümee<br />
In diesem Abschnitt wurden theoretische Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Forschungsfragen gerontologischer<br />
Längsschnittanalyse expliziert. Dazu ist e<strong>in</strong>e Verankerung im aktuellen theoretischen Diskurs<br />
der relevanten Wissenschaftsdiszipl<strong>in</strong>en unverzichtbar. Die Verknüpfung soziologischer <strong>und</strong><br />
entwicklungspsychologischer Theorien kann durch die Bündelung der jeweiligen fachspezifischen<br />
Kompetenz e<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag dazu leisten. Beide Diszipl<strong>in</strong>en haben sich – <strong>in</strong>sbesondere<br />
im Bereich der <strong>Entwicklung</strong>spsychologie der Lebensspanne <strong>und</strong> der Lebenslaufsoziologie<br />
– <strong>in</strong> Interaktion mite<strong>in</strong>ander, e<strong>in</strong>ander wechselseitig befruchtend, entwickelt, obwohl sie <strong>in</strong><br />
unterschiedlichen Denktraditionen verankert s<strong>in</strong>d. Ke<strong>in</strong>e wissenschaftliche E<strong>in</strong>zeldiszipl<strong>in</strong> kann<br />
für sich <strong>in</strong> Anspruch nehmen, den Altersstrukturwandel <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Konsequenzen für Individuum<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft alle<strong>in</strong> mit ihrem fachspezifischen Instrumentarium adäquat beschreiben<br />
zu können. Die Komb<strong>in</strong>ation von soziologischen <strong>und</strong> entwicklungspsychologischen Forschungstraditionen<br />
nimmt objektive <strong>und</strong> subjektive Aspekte der Lebensqualität älter werdender<br />
Menschen gleichermaßen ernst. Im folgenden soll nun dargestellt werden, wie diese konzeptuellen<br />
Erwägungen <strong>in</strong> Design <strong>und</strong> Themen des Alterssurveys e<strong>in</strong>geflossen s<strong>in</strong>d.<br />
1.4 Design <strong>und</strong> Themen des Alterssurveys<br />
Der Alterssurvey ist der umfassenden Untersuchung der „zweiten Lebenshälfte“, also des mittleren<br />
<strong>und</strong> höheren Erwachsenenalters gewidmet. Im Jahre 1996 wurde die erste Welle des Alterssurveys<br />
erhoben (Infas, 1997; Kohli & Künem<strong>und</strong>, 2000; Dittmann-Kohli et al., 2001). Im<br />
Jahr 2002 fand die Datenerhebung der zweiten Welle des Alterssurveys statt (s. zu den methodischen<br />
E<strong>in</strong>zelheiten Kapitel 2 dieses Berichts). Bei der Überarbeitung der Erhebungs<strong>in</strong>strumente<br />
für die zweite Welle wurde großer Wert auf Kont<strong>in</strong>uität gelegt, um <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>en<br />
der Panelteilnehmer <strong>in</strong> den vergangenen sechs Jahren nachvollziehen zu können. Zudem bildete<br />
die weitgehende Kont<strong>in</strong>uität der Instrumente die Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der<br />
Basisstichprobe mit der 2002 neu gezogenen Replikationsstichprobe 40- bis 85-Jähriger mit<br />
dem Ziel, auch <strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage von Kohortenanalysen untersuchen<br />
zu können. Die Instrumente wurden <strong>in</strong> Teilbereichen verändert <strong>und</strong> erweitert, viele Fragen<br />
wurden jedoch unverändert übernommen. Auch der Ablauf der Erhebung <strong>und</strong> die Erhebungsme-<br />
17
18<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
thoden wurden weitgehend beibehalten, mit Ausnahme des Verzichts auf das <strong>in</strong> der ersten Welle<br />
verwendete Satzergänzungsverfahren zur Erfassung der Selbst- <strong>und</strong> Lebensvorstellungen (SE-<br />
LE-Instrument) (Dittmann-Kohli et al., 2001). E<strong>in</strong>e vollständige Dokumentation der Instrumente<br />
liegt vor (Tesch-Römer et al., 2002a). Im Folgenden werden das methodische Design <strong>und</strong> die<br />
zentralen Fragestellungen des Alterssurvey vorgestellt.<br />
1.4.1 Design des Alterssurveys<br />
In der ersten Welle des Alterssurveys wurden r<strong>und</strong> 5.000 Personen im Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85<br />
Jahren befragt, wobei nach Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Region (Ost/West) disproportional geschichtet<br />
wurde (Basisstichprobe, Abbildung 1.2). Es wurden drei Altersgruppen unterschieden: Die<br />
Altersgruppe der 40- bis 54-Jährigen repräsentiert die Gruppe der im Arbeitsleben stehenden<br />
Menschen, die sich aber möglicherweise bereits mit dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand ause<strong>in</strong>ander<br />
setzen <strong>und</strong> zum Teil für die Pflege älterer Angehöriger verantwortlich s<strong>in</strong>d. Die Altersgruppe<br />
der 55- bis 69-Jährigen repräsentiert die Gruppe jener Personen, die am Übergang <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand stehen oder <strong>in</strong> diesen vor nicht allzu langer Zeit e<strong>in</strong>getreten s<strong>in</strong>d. Die Altersgruppe<br />
der 70- bis 85-Jährigen schließlich repräsentiert die Gruppe der Personen, die bereits langjährig<br />
im Ruhestand leben <strong>und</strong> sich auf das hohe Alter vorbereiten oder es bereits erfahren. Mit Fragekomplexen<br />
zu Erwerbsstatus, E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen, Wohnen, Generationenbeziehungen<br />
<strong>und</strong> sozialen Netzwerken, produktiven Tätigkeiten <strong>und</strong> sozialer Integration, subjektiver Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den sowie zu S<strong>in</strong>n- <strong>und</strong> Lebensentwürfen wurden bedeutsame Lebensbereiche<br />
älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen erhoben.<br />
Abbildung 1.2:<br />
Design des Alterssurveys<br />
Alter<br />
85<br />
70<br />
55<br />
40<br />
Basisstichprobe<br />
100 n = 4.838<br />
1996<br />
Erste Welle<br />
Panelstichprobe<br />
n = 1.524<br />
Replikationsstichprobe<br />
n = 3.084<br />
Neu<br />
2002<br />
Zweite Welle<br />
Stichprobe der<br />
Nicht-Deutschen<br />
n = 586<br />
Neu
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Der Alterssurvey 2002 umfasst drei Stichproben (die grauen Balken <strong>in</strong> Abbildung 1.2). Die<br />
Panelstichprobe umfasst jene Befragungsteilnehmer, die bereits an der ersten Welle des Alterssurveys<br />
im Jahr 1996 teilgenommen hatten (n=1.524). Die Replikationsstichprobe ist e<strong>in</strong>e erneute<br />
repräsentative Stichprobe der <strong>in</strong> Privathaushalten lebenden Deutschen im Alter von 40 bis<br />
85 Jahren (n=3.084). Drittens werden – als Neuerung gegenüber der ersten Welle – anhand e<strong>in</strong>er<br />
Stichprobe von <strong>in</strong> Privathaushalten lebenden Nicht-Deutschen 4 im Alter von 40 bis 85 Jahren<br />
die Lebensumstände der ausländischen Bevölkerung dieses Alters untersucht (Ausländerstichprobe,<br />
n=586). Damit trägt der Alterssurvey der Tatsache Rechnung, dass die Generation<br />
ausländischer Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Migranten, die im Zuge der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte<br />
<strong>in</strong> den 50er- <strong>und</strong> 60er-Jahren nach Deutschland gekommen waren, <strong>in</strong>zwischen das Rentenalter<br />
erreicht haben. Für die Befragung wurden ausschließlich deutschsprachige Fragebögen<br />
e<strong>in</strong>gesetzt. Voraussetzung für die Teilnahme an der Befragung war dementsprechend die Beherrschung<br />
der deutschen Sprache bzw. die Unterstützung durch e<strong>in</strong>e Person, die des Deutschen<br />
mächtig ist <strong>und</strong> Übersetzungshilfe leisten kann. Die Ziehung der Ausländerstichprobe erfolgte<br />
analog zur Ziehung der Replikationsstichprobe, jedoch unter Aufhebung der Schichtungskriterien,<br />
da der Anteil hochaltriger Nicht-Deutscher an der deutschen Wohnbevölkerung (<strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland) sehr ger<strong>in</strong>g ist. Die Teilnehmer der Replikations- <strong>und</strong> der Ausländerstichprobe<br />
bilden zusammen die Zusatzstichprobe der im Jahr 2002 erstmals befragten Teilnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Teilnehmer des Alterssurveys. Weitere methodische Informationen f<strong>in</strong>den<br />
sich <strong>in</strong> Kapitel 2.<br />
Die Komb<strong>in</strong>ation aus Wiederholungsbefragung der Panelteilnehmer <strong>und</strong> Erstbefragung der Zusatzstichprobe<br />
ermöglicht sowohl die Erforschung der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>Entwicklung</strong>en im Prozess<br />
des Älterwerdens (Längsschnitt- oder Panelvergleich) als auch den Vergleich identischer Altersgruppen<br />
zu unterschiedlichen Zeitpunkten anhand der Gegenüberstellung der Bef<strong>und</strong>e aus<br />
der Erstbefragung im Jahr 1996 mit denen der Zweitbefragung im Jahr 2002 (Kohortenvergleich).<br />
Zudem ermöglicht das methodische Design die Untersuchung von Altersunterschieden<br />
(Querschnittsperspektive), von Altersveränderungen (Längsschnittsperspektive) <strong>und</strong> von Unterschieden<br />
zwischen Zeitpunkten (Perspektive des Zeitwandels). Dieses Untersuchungsdesign<br />
ermöglicht die Umsetzung der zentralen Ziele des Alterssurveys, Kont<strong>in</strong>uitäten <strong>und</strong> Diskont<strong>in</strong>uitäten<br />
im Alternsverlauf aufzuzeigen sowie – zum<strong>in</strong>dest ansatzweise – Alters-, Kohorten- <strong>und</strong><br />
Testzeiteffekte differenzieren zu können. Mit der Zusatzstichprobe wird zudem der Gr<strong>und</strong>ste<strong>in</strong><br />
für die prospektive Untersuchung der Lebensverläufe <strong>und</strong> Vorstellungen aufe<strong>in</strong>ander folgender<br />
Panels gelegt, vorausgesetzt, die im Jahr 2002 erstmals Befragten werden im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
Fortführung des Alterssurveys <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Jahren erneut befragt (zukünftiger Panelvergleich).<br />
4 Im folgenden werden die Begriffe „Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer“ <strong>und</strong> „Nicht-Deutsche“ synonym verwendet.<br />
Die Problematik der Def<strong>in</strong>ition <strong>und</strong> Verwendung dieser Begriffe sowie die Abgrenzung zu dem Begriff „Migrant<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Migranten“ wird <strong>in</strong> Kapitel 10 dieses Berichts ausführlich erörtert.<br />
19
20<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
1.4.2 Themenbereiche des Alterssurveys<br />
Die oben beschriebenen theoretischen Konzepte, auf denen der Alterssurvey beruht, haben deutlich<br />
gemacht, dass zur Realisierung e<strong>in</strong>er Alterssozialberichterstattung im Längsschnitt e<strong>in</strong>e<br />
Reihe unterschiedlicher Lebensbereiche zu berücksichtigen s<strong>in</strong>d. Die folgende Tabelle 1 gibt<br />
e<strong>in</strong>en Überblick über die thematischen Inhalte des Alterssurveys. Die thematischen Bereiche, zu<br />
denen der Alterssurvey Daten bereitstellt, s<strong>in</strong>d außerordentlich breit angelegt, um die Lebenssituation<br />
von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte umfassend beschreiben zu können. In der<br />
Lebenslaufsoziologie werden als bedeutsame, aufe<strong>in</strong>ander bezogene Lebensbereiche Bildung,<br />
Arbeit, Familie <strong>und</strong> Freizeit genannt. Insbesondere die drei letztgenannten Bereiche s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
H<strong>in</strong>blick auf <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte von Bedeutung, aber auch der Bildung<br />
kommt im S<strong>in</strong>ne des „lebenslangen Lernens“ immer mehr Bedeutung zu. Aus psychologischer<br />
Perspektive s<strong>in</strong>d die Bereiche Persönlichkeit, Selbst <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den sowie Kognition von<br />
Bedeutung. Darüber h<strong>in</strong>aus werden Daten zur Erfassung <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Ges<strong>und</strong>heit erhoben, die<br />
entscheidend für die Beschreibung von Lebenssituation <strong>und</strong> die Evaluation von Lebensqualität<br />
im Alter s<strong>in</strong>d.<br />
Im Detail werden im Alterssurvey die folgenden sozialen <strong>und</strong> personalen <strong>Entwicklung</strong>sbereiche<br />
untersucht: Erwerbstätigkeit <strong>und</strong> Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand, materielle Lebensbed<strong>in</strong>gungen,<br />
soziale Netze, Freizeitaktivitäten <strong>und</strong> gesellschaftliche Partizipation, Selbstkonzept <strong>und</strong> Lebensziele,<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den sowie Ges<strong>und</strong>heit, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten <strong>und</strong> Pflegebedürftigkeit. Zu Beg<strong>in</strong>n<br />
dieses Aufsatzes wurde das, objektive Lebenslagen <strong>und</strong> subjektive Bewertungen gleichermaßen<br />
umfassende, Konzept der Lebensqualität als Instrument der Wohlfahrtsmessung im Alterssurvey<br />
e<strong>in</strong>geführt. Im Alterssurvey untersuchte Aspekte subjektiver Lebensqualität schließen<br />
allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> bereichsspezifische Bewertungen ebenso e<strong>in</strong> wie e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Skalen zur Messung der affektiven Komponente des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens. Im<br />
Alterssurvey wird auch der Versuch unternommen, Selbstkonzepte, Lebensziele sowie <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Kontrollüberzeugungen zu erheben, welche die Person <strong>in</strong> die Lage<br />
versetzen, ihre Lebenssituation zu verändern oder sich an diese anzupassen. Diese Betonung der<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Handlungskompetenz ist e<strong>in</strong>e Besonderheit des Alterssurveys, die über vergleichbare<br />
Surveys h<strong>in</strong>ausweist.<br />
Um Vergleiche mit der ersten Welle zu ermöglichen, wurden <strong>in</strong> der zweiten Welle gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
dieselben Fragen verwendet. E<strong>in</strong>e zentrale Veränderung bestand dar<strong>in</strong>, das Satzergänzungverfahren<br />
SELE (Dittmann-Kohli et al., 2002) gegen standardisierte Erhebungs<strong>in</strong>strumente auszutauschen<br />
(Bereich „Selbst <strong>und</strong> Lebensziele“). Die Bereiche „Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> Übergang<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand“, „Lebensqualität <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den“, „Ges<strong>und</strong>heit, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten,<br />
ges<strong>und</strong>heitliche Versorgung“ sowie „Pflegebedürftigkeit <strong>und</strong> pflegerische Versorgung“<br />
erhielt <strong>in</strong> der zweiten Welle mit e<strong>in</strong>em größeren Umfang an Fragen e<strong>in</strong> höheres Gewicht<br />
<strong>in</strong>nerhalb des Untersuchungs<strong>in</strong>struments (s. Tabelle 1.1).
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Tabelle 1.1:<br />
Überblick über Themenbereiche der zweiten Welle des Alterssurveys<br />
Thema Veränderung 1. 2. Welle<br />
Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Aktivitäten <strong>und</strong> gesellschaftliche Partizipation<br />
Materielle Lage<br />
Wohnsituation<br />
Familie – Herkunftsfamilie, Familienstand, Partnerschaft, K<strong>in</strong>der<br />
Private Netzwerke <strong>und</strong> soziale Integration<br />
Selbst <strong>und</strong> Lebensziele<br />
Lebensqualität, Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
Ges<strong>und</strong>heit, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten, ges<strong>und</strong>heitliche Versorgung<br />
Pflegebedürftigkeit <strong>und</strong> pflegerische Versorgung<br />
größerer Umfang<br />
gleicher Umfang<br />
gleicher Umfang<br />
gleicher Umfang<br />
gleicher Umfang<br />
gleicher Umfang<br />
modifiziert<br />
größerer Umfang<br />
größerer Umfang<br />
größerer Umfang<br />
Der Alterssurvey bietet anhand der Untersuchungsstichprobe <strong>und</strong> der erfragten Themenbereiche<br />
e<strong>in</strong>e breite Datenbasis für die Untersuchung von Statusübergängen <strong>und</strong> kritischen Lebensereignissen,<br />
kont<strong>in</strong>uierlichen <strong>und</strong> diskont<strong>in</strong>uierlichen Veränderungen sowie der zeitlichen Strukturierung<br />
der zweiten Lebenshälfte. Durch die Längsschnittperspektive kann mit Hilfe des Alterssurveys<br />
die Lebenssituation jener Personen analysiert werden, die zwischen Erst- <strong>und</strong> Zweiterhebung<br />
Übergänge oder kritische Lebensereignisse erlebt haben. Von besonderer Bedeutung ist<br />
dabei die Untersuchung des Übergangs von der Phase der Erwerbsarbeit <strong>in</strong> die Phase des Ruhestandes<br />
(s. Kapitel 3 dieses Berichts). Hierzu wurden prospektive <strong>und</strong> retrospektive Fragen zur<br />
Vorbereitung auf bzw. zur Verarbeitung des Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand erhoben. Daneben<br />
können e<strong>in</strong>e Reihe anderer Transitionen untersucht werden, wie zum Beispiel der Wechsel der<br />
beruflichen Tätigkeit sowie der E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die bzw. die Beendigung der Arbeitslosigkeit; Veränderungen<br />
der E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Vermögensstruktur; der Erhalt von Erbschaften <strong>und</strong> Umbrüche<br />
bei den Ausgaben (z.B. aufgr<strong>und</strong> von Pflegebedürftigkeit); Veränderungen der Familienstruktur,<br />
wie beispielsweise der Auszug des letzten K<strong>in</strong>des aus dem elterlichen Haushalt („empty<br />
nest“) sowie Trennung vom oder Tod des Partners oder der Partner<strong>in</strong>. Schließlich können die<br />
Auswirkungen nicht-vorhersehbarer kritischer Lebensereignisse wie schwerer Erkrankungen<br />
oder Unfälle untersucht werden. Der Alterssurvey kann zudem Beiträge zu e<strong>in</strong>er Diskussion der<br />
E<strong>in</strong>teilung des Lebenslaufs <strong>in</strong> dist<strong>in</strong>kte Phasen leisten. So kann der Frage nachgegangen werden,<br />
ob die – für viele Menschen mehrere Jahrzehnte umfassende – Ruhestandsphase <strong>in</strong> weitere<br />
Altersabschnitte gegliedert werden kann, für die jeweils andere sozialpolitische Interventionen<br />
s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong> könnten.<br />
In Bezug auf differentielles Altern können mit den Daten des Alterssurveys Angaben zur Variationsbreite<br />
verschiedener Merkmale <strong>in</strong> bestimmten Altersgruppen gemacht werden. Auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage der Längsschnittdaten können Hypothesen zur Veränderung dieser Variationsbreite<br />
(oder Ungleichheit) im Verlauf der zweiten Lebenshälfte getestet werden. E<strong>in</strong>e Stärke des Alterssurveys<br />
ist zudem die Aufdeckung von Kohorteneffekten durch den Vergleich von Basis-<br />
21
22<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
<strong>und</strong> Replikationsstichprobe. Neben der Durchführung von Interkohortenanalysen können Alters-,<br />
Zeit- <strong>und</strong> Kohorteneffekte isoliert werden. Aber auch h<strong>in</strong>sichtlich der Frage der Ungleichheiten<br />
im Alternsprozess kann der Alterssurvey Bef<strong>und</strong>e beisteuern. Neben den oben diskutierten<br />
Hypothesen der Altersbed<strong>in</strong>gtheit, der sozioökonomischen Differenzierung <strong>und</strong> der Kumulation<br />
von Ungleichheiten kann auch die Frage gestellt werden, ob sich für unterschiedliche<br />
Kohorten das Ausmaß <strong>und</strong> die Bed<strong>in</strong>gungen sozialer Ungleichheiten verändern. Hierbei ist <strong>in</strong>sbesondere<br />
an die Veränderung der materiellen Lagen von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
zu denken (s. Kapitel 4 des vorliegenden Berichts).<br />
E<strong>in</strong> weiterer wichtiger Themenbereich, zu dem der Alterssurvey Daten zur Verfügung stellt, ist<br />
die <strong>Entwicklung</strong> von Generationenbeziehungen im Zeitverlauf (s. hierzu Kapitel 5 des vorliegenden<br />
Berichts). Theoretisch <strong>und</strong> gesellschaftspolitisch s<strong>in</strong>d Generationenbeziehungen auf der<br />
Mikroebene <strong>und</strong> das Verhältnis zwischen den Generationen auf der Makroebene der Gesellschaft<br />
e<strong>in</strong> Thema, das von Beg<strong>in</strong>n an die Fragestellungen, Analysen <strong>und</strong> Publikationen im Kontext<br />
des Alterssurveys bestimmt hat (Kohli et al., 2000b). Gerade die Betrachtung von Haushaltsstrukturen<br />
<strong>und</strong> Wohnentfernungen, Kontakthäufigkeit <strong>und</strong> Beziehungsenge sowie Hilfeleistungen<br />
<strong>und</strong> Transfers haben gezeigt, dass auch Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte lebendige<br />
Beziehungen <strong>und</strong> Unterstützungsstrukturen aufweisen (Kohli et al., 2000a). Mit Hilfe von Alterssurvey-Daten<br />
wird die Erforschung der <strong>Entwicklung</strong> von Beziehungen im Zeitverlauf ermöglicht,<br />
so dass Fragen h<strong>in</strong>sichtlich der Stabilität von Unterstützungsstrukturen beantwortet<br />
werden können. Von besonderer sozialpolitischer Relevanz ist dabei die Analyse von <strong>in</strong>tergenerationeller<br />
Unterstützung im Bereich der häuslichen Pflege. H<strong>in</strong>zu kommt die Untersuchung<br />
von sozialen Beziehungen, die von den Befragten als negativ oder ambivalent e<strong>in</strong>geschätzt werden<br />
(z.B. aufgr<strong>und</strong> von Sorgen, Streitigkeiten, Bevorm<strong>und</strong>ung). Im Vergleich der Erhebungszeitpunkte<br />
kann schließlich – zum<strong>in</strong>dest ansatzweise – der Frage nachgegangen werden, ob <strong>und</strong><br />
gegebenenfalls <strong>in</strong> welcher Weise sich das Verhältnis der Generationen über e<strong>in</strong>en Zeitraum von<br />
sechs Jahren verändert hat.<br />
In der gesellschaftlichen Diskussion wird den Potentialen des Alters seit e<strong>in</strong>iger Zeit verstärkt<br />
Aufmerksamkeit gewidmet (vgl. etwa den Arbeitsauftrag der Kommission des Fünften Altenberichts<br />
„Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft“). Dabei s<strong>in</strong>d neben der gestiegenen<br />
durchschnittlichen Lebenserwartung vor allem die durchschnittlich recht frühe Beendigung der<br />
Erwerbsphase <strong>und</strong> die im historischen Vergleich günstigere Ressourcenausstattung älterer Menschen<br />
zu beachten: Die „jungen Alten“ haben gegenwärtig <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> bessere Bildung als frühere Generationen von Ruheständlern. Dieses Potential älterer Menschen<br />
kann <strong>in</strong> so verschiedenen Bereichen wie bürgerschaftlichem Engagement, Selbsthilfeorganisationen,<br />
Unterstützung <strong>in</strong>nerhalb von Familien (Betreuung von K<strong>in</strong>dern, Pflegetätigkeiten)<br />
sowie Partizipation an Bildungsangeboten realisiert werden. E<strong>in</strong>en entsprechenden Überblick<br />
f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Kapitel 6 dieses Berichts.<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Alltagskompetenz entscheiden maßgeblich über die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Lebensqualität<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte sowie über die Möglichkeit, auch im fortgeschrittenen Alter e<strong>in</strong>e<br />
selbstständige Lebensführung aufrecht erhalten zu können. Mit Daten des Alterssurveys kann<br />
nun untersucht werden, wie sich der Ges<strong>und</strong>heitszustand aus Sicht der Personen darstellt, die<br />
sich <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte bef<strong>in</strong>den. Berücksichtigt werden bei den Analysen der altersabhängige<br />
Anstieg körperlicher Erkrankungen, die damit verb<strong>und</strong>enen Beschwerden, funktio-
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
nelle E<strong>in</strong>schränkungen. sowie die subjektive Ges<strong>und</strong>heit. Zudem kann dargestellt werden, <strong>in</strong><br />
welchem Ausmaß Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte mediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> andere Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen<br />
<strong>in</strong> Anspruch nehmen. Aufgr<strong>und</strong> der Veränderungen des Erhebungs<strong>in</strong>struments<br />
ist dabei e<strong>in</strong> Vergleich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nicht für alle Bereiche möglich. Kapitel<br />
7 dieses Berichts stellt vor allem den Ges<strong>und</strong>heitszustand der Menschen zwischen 40 <strong>und</strong> 85<br />
Jahren im Jahr 2002 ausführlich dar.<br />
In Kapitel 8 werden zudem die Bed<strong>in</strong>gungsfaktoren für Veränderungen im ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
Bef<strong>in</strong>den analysiert. Dabei geht es darum, die Bed<strong>in</strong>gungsfaktoren für Veränderungen im Ges<strong>und</strong>heitsstatus<br />
nicht allzu stark e<strong>in</strong>zuschränken, wie dies <strong>in</strong> diszipl<strong>in</strong>ären Studien häufig getan<br />
wird. Häufig beschränken sich entsprechende Untersuchungen zur Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung im<br />
Alter auf soziologische, psychologische oder verhaltensmediz<strong>in</strong>ische Modelle. Eher die Ausnahme<br />
s<strong>in</strong>d dagegen Arbeiten, <strong>in</strong> denen unterschiedliche Erklärungsansätze <strong>in</strong>tegriert werden.<br />
Im vorliegenden Kapitel werden deshalb verschiedene soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>s<br />
Ges<strong>und</strong>heitsverhalten sowie schließlich auch kognitive Vorstellungen zum Älterwerden<br />
bei der Erklärung von Veränderungen im Ges<strong>und</strong>heitsstatus berücksichtigt.<br />
Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität s<strong>in</strong>d – neben den bereits erwähnten objektiven<br />
Merkmalen der Lebenslage – bedeutsame Kriterien für die Bewertung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s.<br />
Der Alterssurvey erlaubt es, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>und</strong> gesellschaftliche Veränderungen<br />
h<strong>in</strong>sichtlich subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>und</strong> Lebensqualität zu analysieren. Dabei<br />
kann im S<strong>in</strong>ne der Sozialberichterstattung der <strong>Wandel</strong> subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 beschrieben werden. Zudem kann untersucht werden, <strong>in</strong> welcher Weise Merkmale<br />
der objektiven Lebenslage mit subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den korrelieren, wobei auch Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der objektiven Lebenssituation mit Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen Bewertungen<br />
sowie Veränderungen <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Lebenszufriedenheit <strong>in</strong> Beziehung gesetzt werden<br />
können. Kapitel 9 des vorliegenden Berichts befasst sich mit diesen Fragestellungen zum subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den.<br />
E<strong>in</strong> letzter – <strong>und</strong> thematischer übergreifender – Fragekomplex betrifft Ähnlichkeiten <strong>und</strong> Unterschiede<br />
zwischen Menschen mit oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte.<br />
Es stellt sich hier die Frage, ob es Unterschiede h<strong>in</strong>sichtlich der Wohlfahrtslage <strong>und</strong> den<br />
Vergesellschaftungsformen zwischen älteren Deutschen <strong>und</strong> Ausländern (bzw. Menschen mit<br />
oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft) gibt. Dabei könnte man e<strong>in</strong>erseits annehmen, dass Menschen<br />
ausländischer Herkunft aufgr<strong>und</strong> ihrer MigrationsBiografie <strong>und</strong> der diskrim<strong>in</strong>ierenden<br />
Lebensumstände <strong>in</strong> der Ankunftsgesellschaft e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Lebensqualität <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren<br />
Vergesellschaftungsgrad aufweisen, andererseits aber auch darauf verweisen, dass die Lebensqualität<br />
<strong>und</strong> der Vergesellschaftungsgrad bei älteren Nichtdeutschen bzw. Migranten größer<br />
ist, da sie über bestimmte migrations- oder kulturbed<strong>in</strong>gte Ressourcen verfügen, auf die E<strong>in</strong>heimische<br />
nicht zurückgreifen können. Der deskriptiven Darstellung der Lebenssituation von<br />
älteren Ausländer/<strong>in</strong>nen bzw. Nicht-Deutschen sowie der Beantwortung der hier gestellten Fragen<br />
widmet sich Kapitel 10 des vorliegenden Berichts.<br />
23
24<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
1.5 Die Bedeutung des Alterssurveys für Sozialberichterstattung <strong>und</strong><br />
Alternsforschung<br />
Ziel dieses Kapitels war es, Design <strong>und</strong> Fragestellungen des Alterssurvey vorzustellen <strong>und</strong> zu<br />
begründen. Dank se<strong>in</strong>er Verankerung im gerontologischen, entwicklungspsychologischen <strong>und</strong><br />
soziologischen Diskurs bietet der Alterssurvey e<strong>in</strong>e breite Datenbasis zur Erforschung e<strong>in</strong>er<br />
Vielfalt von Fragestellungen im Bereich der Alternssoziologie <strong>und</strong> -psychologie. Se<strong>in</strong> methodisches<br />
Design ermöglicht sowohl die Erforschung <strong>in</strong>dividuenbezogener <strong>Entwicklung</strong>en als auch<br />
die Analyse allgeme<strong>in</strong>er, gesellschaftlicher Trends. Gleichermaßen stellt der Alterssurvey<br />
reichhaltiges Datenmaterial zur Beratung politischer Entscheidungsträger bereit. Das Konzept<br />
der Lebensqualität wurde als <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>s Wohlfahrtsmaß vorgestellt, das objektive Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den gleichberechtigt berücksichtigt. Anschließend wurden<br />
Vor- <strong>und</strong> Nachteile von Quer- <strong>und</strong> Längsschnittdesigns erörtert <strong>und</strong> festgestellt, dass nur Längsschnittuntersuchungen<br />
dem Ziel e<strong>in</strong>er umfassenden Dauerbeobachtung von Kont<strong>in</strong>uitäten <strong>und</strong><br />
Veränderungen im Lebensverlauf gerecht werden können. Der Alterssurvey kann dank se<strong>in</strong>er<br />
Längsschnittperspektive e<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag zu e<strong>in</strong>er umfassenden, an <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>und</strong> sozialem <strong>Wandel</strong> gleichermaßen orientierten Alterssozialberichterstattung leisten.<br />
Das dem Alterssurvery zugr<strong>und</strong>e liegende kohortensequenzielle Design kann wichtige Erkenntnisse<br />
für die gerontologische Forschung <strong>und</strong> die Gestaltung sozialpolitischer Maßnahmen liefern.<br />
Der rasche Altersstrukturwandel verb<strong>und</strong>en mit Individualisierungs-, De<strong>in</strong>stitutionalisierungs-<br />
<strong>und</strong> Destandardisierungsprozessen begründet die Dr<strong>in</strong>glichkeit e<strong>in</strong>er Alterssozialberichterstattung<br />
im Längsschnitt, die sowohl <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sdynamik als auch sozialen<br />
<strong>Wandel</strong> angemessen berücksichtigen kann. Die zukünftige <strong>Entwicklung</strong> von Gesellschaften<br />
wird auch davon abhängen, wie es gel<strong>in</strong>gen wird, die zunehmende Zahl älterer, alter <strong>und</strong> sehr<br />
alter Menschen sozial zu <strong>in</strong>tegrieren, ihnen geeignete Aktivitäts- <strong>und</strong> Partizipationsoptionen zu<br />
öffnen, ihnen notwendige Unterstützung zu gewähren <strong>und</strong> dabei gleichzeitig die Bedürfnisse der<br />
nachwachsenden Generationen zu berücksichtigen. Für die gel<strong>in</strong>gende lebenslange <strong>Entwicklung</strong><br />
von Individuen <strong>in</strong> allen Altersstufen s<strong>in</strong>d gesellschafts- <strong>und</strong> sozialpolitisch geeignete Vorkehrungen<br />
zu treffen. Wissenschaftliche Erkenntnisse bereitzustellen, die diesem Ziel verpflichtet<br />
s<strong>in</strong>d, ist die zentrale Aufgabe e<strong>in</strong>er Alterssozialberichterstattung, die es unternimmt, dynamische<br />
<strong>Entwicklung</strong>en auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>und</strong> gesellschaftlicher Ebene zu beschreiben <strong>und</strong> zu analysieren.<br />
Die im Alterssurvey berücksichtigte Themenvielfalt, die Kont<strong>in</strong>uität <strong>in</strong> Form größtenteils unveränderter<br />
Erhebungs<strong>in</strong>strumente <strong>und</strong> das mit der zweiten Welle realisierte Längsschnittdesign<br />
erlauben e<strong>in</strong>e effektive sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftliche Dauerbeobachtung. Das methodische<br />
Design – hierbei ist besonders die dreifache Stichprobenziehung von Panel-, Replikations-<br />
<strong>und</strong> Ausländerstichprobe zu nennen – ermöglicht panel- <strong>und</strong> kohortenspezifische Analysen<br />
gleichermaßen. Damit s<strong>in</strong>d gr<strong>und</strong>sätzlich die Voraussetzungen gegeben, Kont<strong>in</strong>uitäten <strong>und</strong> Diskont<strong>in</strong>uitäten<br />
im Alternsverlauf aufzuzeigen sowie Alters-, Kohorten- <strong>und</strong> Testzeiteffekte zum<strong>in</strong>dest<br />
ansatzweise analysieren zu können. Mit der Replikationsstichprobe wird zudem der<br />
Gr<strong>und</strong>ste<strong>in</strong> für die mögliche zukünftige Untersuchung der Lebensverläufe <strong>und</strong> Lebenskonzepte<br />
aufe<strong>in</strong>ander folgender Panels gelegt. Zudem wird mit der Ziehung e<strong>in</strong>er gesonderten Ausländerstichprobe<br />
e<strong>in</strong>em wichtigen Tatbestand der Bevölkerungsentwicklung <strong>in</strong> Deutschland Rechnung
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
getragen, nämlich dem Zuzug <strong>und</strong> der langfristigen Integration von Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Arbeitnehmern ausländischer Herkunft <strong>in</strong> die deutsche Gesellschaft. Der Alterssurvey hat somit<br />
das Potential, zu e<strong>in</strong>em wichtigen Instrument der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung<br />
<strong>und</strong> der Alterssozialberichterstattung im Längsschnitt <strong>in</strong> Deutschland zu werden.<br />
Die <strong>in</strong> diesem Berichtsband vorgelegten Bef<strong>und</strong>e s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> erster Schritt auf diesem Weg.<br />
25
26<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
1.6 Literatur<br />
Alw<strong>in</strong>, D. F., & McCammon, R. J. (2003). Generations, cohorts, and social change. In J. T.<br />
Mortimer & M. S. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 3-22). New York:<br />
Kluwer Academic.<br />
Antonucci, T. C. (1985). Social support: Theoretical advances, research f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs and press<strong>in</strong>g<br />
issues. In I. G. Sarason & B. R. Sarason (Eds.), Social support: Theory, research and<br />
applications (pp. 21-37). The Hague: Mar<strong>in</strong>us Nijhof.<br />
Antonucci, T. C., & Akiyama, H. (1995). Convoys of social relations: Family and friendships<br />
with<strong>in</strong> the life span context. In R. Blieszner & V. H. Bedford (Eds.), Handbook of ag<strong>in</strong>g<br />
and the family (pp. 355-371). Westport: CT: Greenwood Press.<br />
Backes, G. & Clemens, W. (1998). Lebensphase Alter. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die sozialwissenschaftliche<br />
Alternsforschung. We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Baltes, P. B. & Baltes, M. M. (1994). Gerontologie: Begriff, Herausforderung <strong>und</strong> Brennpunkte.<br />
In P.B. Baltes, J. Mittelstrass & U.M. Staud<strong>in</strong>ger (Hrsg.), Alter <strong>und</strong> Altern. (pp. 1-34).<br />
Berl<strong>in</strong>: de Gruyter.<br />
Baltes, P. B. & Smith, J. (1999). Multilevel and systemic analyses of old age: Theoretical and<br />
empirical evidence for a Fourth Age. In V.L. Bengtson & K.W. Schaie (Eds.), Handbook<br />
of theories of ag<strong>in</strong>g (pp. 153-173). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Baltes, P. B. (1967). Längsschnitt- <strong>und</strong> Querschnittsequenzen zur Erfassung von Alters- <strong>und</strong><br />
Generationseffekten. Dissertation, vorgelegt an der Philosophischen Fakultät. Saarbrücken:<br />
Universität des Saarlandes.<br />
Baltes, P. B. (1979). Life-span developmental psychology: Some converg<strong>in</strong>g observations on<br />
history and theory. In P.B. Baltes & O.G. Brim, Jr. (Eds.), Life-span development and<br />
behavior (pp. 255-279). New York: Academic Press.<br />
Baltes, P. B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology. On the<br />
dynamics between growth and decl<strong>in</strong>e. Developmental Psychology, 23, 611-626.<br />
Baltes, P. B. (1997). On the <strong>in</strong>complete architecture of human ontogenesis: Selection, optimization,<br />
and compensation as fo<strong>und</strong>ation of developmental theory. American Psychologist,<br />
52, 366-381.<br />
Baltes, P. B., Mayer, K. U., Helmchen, H. & Ste<strong>in</strong>hagen-Thiessen, E. (1996). Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
(BASE): Überblick <strong>und</strong> E<strong>in</strong>führung. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Hrsg.),<br />
Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 21-54). Berl<strong>in</strong>: Akademie Verlag.<br />
Behrend, C. (2001). Erwerbsarbeit im <strong>Wandel</strong>, Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer<br />
<strong>und</strong> Übergänge <strong>in</strong> den Ruhestand. In Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hrsg.), Erwerbsbiographien<br />
<strong>und</strong> materielle Lebenssituation im Alter (pp. 11-129). Opladen:<br />
Leske + Budrich.<br />
Berger, P. A. & Hradil, S. (Hrsg.) (1990). Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile. Gött<strong>in</strong>gen:<br />
Schwartz.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hrsg.) (1993). Erster<br />
Altenbericht: Die Lebenssituation älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland. Bonn: BMFSFJ.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hrsg.) (1998). Zweiter<br />
Bericht zur Lage der älteren Generation <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland: Wohnen<br />
im Alter. Bonn: BMFSFJ.
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hrsg.) (2001a). Alter<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft. Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. Bonn: BMFSFJ (zugleich B<strong>und</strong>estagsdrucksache 14/5130).<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (ed.) (2001b). The age<strong>in</strong>g<br />
society as a global challenge - German impulses. Berl<strong>in</strong>: Federal M<strong>in</strong>istry for Family<br />
Affairs, Senior Citizens, Women, and Youth.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hrsg.) (2002). Vierter<br />
Bericht zur Lage der älteren Generation <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland: Risiken,<br />
Lebensqualität <strong>und</strong> Versorgung Hochaltriger - unter besonderer Berücksichtigung dementieller<br />
Erkrankungen. Bonn: BMFSFJ (zugleich B<strong>und</strong>estagsdrucksache 14/8822).<br />
Brückner, E. (1994). Erhebung ereignisorientierter Lebensverläufe als retrospektive Längsschnittkonstruktion.<br />
In R. Hauser et al. (Hrsg.), Mikroanalytische Gr<strong>und</strong>lagen der Gesellschaftspolitik.<br />
Band 2 (pp. 38-69). Berl<strong>in</strong>: Akademie-Verlag.<br />
Clausen, J. A. (1986). The life course: A sociological perspective. Englewood Cliffs: Prentice-<br />
Hall.<br />
Dannefer, D. (1996). Age norms and the structur<strong>in</strong>g of consciousness. The social organization<br />
of diversity and the normative organization of age. The Gerontologist, 36(2), 174-177.<br />
Dieck, M. & Naegele, G. (Hrsg.) (1978). Sozialpolitik für ältere Menschen. Heidelberg: Quelle<br />
& Meyer.<br />
Dittmann-Kohli, F., Bode, C. & Westerhof, G. J. (Hrsg.) (2001). Die zweite Lebenshälfte - Psychologische<br />
Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Donaldson, G., & Horn, J. L. (1992). Age, cohort, and time developmental muddles: Easy <strong>in</strong><br />
practice, hard <strong>in</strong> theory. Experimental Ag<strong>in</strong>g Research, 18(4), 213-222.<br />
Easterl<strong>in</strong>, R. A. (1987). Birth and fortune: The impact of numbers on personal welfare. Chicago:<br />
University of Chicago Press.<br />
Elder, G. H. J. (1974). Children of the great depression: Social change <strong>in</strong> life experience. Chicago:<br />
University of Chicago Press.<br />
Elder, G. H. J. (1999). Children of the great depression: Social change <strong>in</strong> life experience. 25th<br />
anniversary edition. Boulder: Westview Press.<br />
Elder, G. H. J., Kirkpatrick Johnson, M., & Crosnoe, R. (2003). The emergence and development<br />
of life course theory. In J. T. Mortimer & M. S. Shanahan (Eds.), Handbook of the<br />
life course (pp. 3-22). New York: Kluwer Academic.<br />
Enquete-Kommission (1994). Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Demografischer<br />
<strong>Wandel</strong>": Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den e<strong>in</strong>zelnen<br />
<strong>und</strong> die Politik. Bonn: Deutscher B<strong>und</strong>estag.<br />
Enquete-Kommission (1998). Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Demografischer<br />
<strong>Wandel</strong>": Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den e<strong>in</strong>zelnen<br />
<strong>und</strong> die Politik. Bonn: Deutscher B<strong>und</strong>estag.<br />
Enquete-Kommission (2002). Schlussbericht der Enquete-Kommission "Demografischer <strong>Wandel</strong><br />
- Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den e<strong>in</strong>zelnen <strong>und</strong><br />
die Politik". Berl<strong>in</strong>: Deutscher B<strong>und</strong>estag.<br />
Filipp, S.-H. (Hrsg.) (1981). Kritische Lebensereignisse. München: Urban & Schwarzenberg.<br />
Filipp, S.-H. (Hrsg.) (1990). Kritische Lebensereignisse. München: Urban & Schwarzenberg.<br />
27
28<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Fry, C. L., & Keith, J. (1982). The life course as a cultural unit. In M. W. Riley & R. P. Abeles<br />
& M. S. Teitelbaum (Eds.), Age<strong>in</strong>g from birth to death (pp. 51-70). Boulder: Westview<br />
Press.<br />
G<strong>in</strong>n, J. (2003). Gender, pensions and the lifecourse. How pensions need to adapt to chang<strong>in</strong>g<br />
family forms. Bristol: The Policy Press.<br />
Glenn, N. D. (2003). Dist<strong>in</strong>guish<strong>in</strong>g age, period, and cohort effects. In J. T. Mortimer & M. S.<br />
Shanahan (Eds.), Handbook of the Life Course (pp. 465-476). New York: Kluwer Academic.<br />
Haagenaars, J. A. (1990). Categorical Longitud<strong>in</strong>al Data. Log-l<strong>in</strong>ear panel, trend, and cohort<br />
analysis. Newbury Park: Sage.<br />
Habich, R. & Zapf, W. (1994). Gesellschaftliche Dauerbeobachtung - Wohlfahrtssurveys: Instrument<br />
der Sozialberichterstattung. In R. Hauser et al. (Hrsg.), Mikroanalytische<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Gesellschaftspolitik. Band 2 (pp. 13-37). Berl<strong>in</strong>: Akademie-Verlag.<br />
Hareven, T. K., & Adams, K. (1996). The generation <strong>in</strong> the middle: Cohort comparisons <strong>in</strong> assistance<br />
to ag<strong>in</strong>g parents <strong>in</strong> an American community. In T. K. Hareven (Ed.), Ag<strong>in</strong>g and<br />
generational relations over the life course: A historical and cross-cultural perspective<br />
(pp. 272-293). Berl<strong>in</strong>: Walter de Gruyter.<br />
Heckhausen, J. (1990). Erwerb <strong>und</strong> Funktion normativer Vorstellungen über den Lebenslauf.<br />
E<strong>in</strong> entwicklungspsychologischer Beitrag zur sozio-psychischen Konstruktion von Biographien.<br />
In K.U. Mayer (Hrsg.), Lebensläufe <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong> (pp. 351-373).<br />
Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Hoff, A., Tesch-Römer, C., Wurm, S., & Engstler, H. (2003). "Die zweite Lebenshälfte" - der<br />
Alterssurvey zwischen gerontologischer Längsschnittanalyse <strong>und</strong> Alterssozialberichterstattung<br />
im Längsschnitt. In F. Karl (Ed.), Sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftliche Gerontologie<br />
(pp. 185-204). We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Hoffmann, E. (2002). Der demografische Strukturwandel <strong>in</strong> Deutschland - e<strong>in</strong>ige Anmerkungen<br />
dargestellt mit Daten des Statistischen Informationssystems GeroStat. In C. Tesch-<br />
Römer (Hrsg.), Gerontologie <strong>und</strong> Sozialpolitik (pp. 43-60). Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Hradil, S. & Schiener, J. (1999). Soziale Ungleichheit <strong>in</strong> Deutschland (8. Aufl.). Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
Hu<strong>in</strong><strong>in</strong>k, J. (1995). Warum noch Familie? Zur Attraktivität von Partnerschaft <strong>und</strong> Elternschaft<br />
<strong>in</strong> unserer Gesellschaft. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Infas (1997). Alterssurvey - Lebensentwürfe, E<strong>in</strong>stellungen, Bedürfnislagen <strong>und</strong> S<strong>in</strong>nstrukturen<br />
älterwerdender Menschen. Methodenbericht zur ersten Welle. Bonn: Infas.<br />
Jackson, J. S., Antonucci, T. C., & Gibson, R. C. (1990). Cultural, racial and ethnic <strong>in</strong>fluences<br />
on ag<strong>in</strong>g. In J. Birren & K. W. Schaie (Eds.), Handbook of psychology of ag<strong>in</strong>g (pp.<br />
103-123). San Diego: Academic Press.<br />
Kahn, R. L., & Antonucci, T. C. (1980). Convoys over the life course: Attachment, roles, and<br />
social support. In P.B. Baltes & O.G. Brim, Jr. (Eds.), Life span development, and behavior.<br />
Vol. 3 (pp. 253-286). New York: Academic Press.<br />
Kahneman, D., Diener, E. & Schwarz, N. (Eds.) (1999). Well-be<strong>in</strong>g: The fo<strong>und</strong>ations of hedonic<br />
psychology. New York: Russell Sage Fo<strong>und</strong>ation.<br />
Kaufmann, F.-X. (1997). Herausforderungen des Sozialstaates. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Suhrkamp.<br />
Kertzer, D. I. (1983). Generation as a sociological problem. In R. H. Turner & J. F. Short Jr.<br />
(Eds.), Annual Revies of Sociology (pp. 125-149). Palo Alto: Annual Reviews Corp.
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Kohli, M. & Künem<strong>und</strong>, H. (2001). Partizipation <strong>und</strong> Engagement älterer Menschen. Bestandsaufnahme<br />
<strong>und</strong> Zukunftsperspektiven. In Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
(Hrsg.), Lebenslagen, soziale Ressourcen <strong>und</strong> gesellschaftliche Integration im Alter (pp.<br />
117-234). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M. & Künem<strong>und</strong>, H. (Hrsg.) (2000). Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong><br />
Partizipation im Spiegel des Alters-Survey. Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M. (1985). Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> theoretische<br />
Argumente. Kölner Zeitschrift für Soziologie, 37, 1-29.<br />
Kohli, M. (1986). Social organization and subjective construction of the life course. In A. B.<br />
Sorenson & F. E. We<strong>in</strong>ert & L. R. Sherrod (Eds.), Human development and the life<br />
course: Multidiscipl<strong>in</strong>ary perspectives (pp. 271-292). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.<br />
Kohli, M. (1987). Ruhestand <strong>und</strong> Moralökonomie. In K. He<strong>in</strong>emann (Hrsg.), Soziologie wirtschaftlichen<br />
Handelns (pp. 393-416). Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Kohli, M. (1998). Alter <strong>und</strong> Altern der Gesellschaft. In B. Schäfers & W. Zapf (Hrsg.), Handwörterbuch<br />
zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen: Leske+Budrich, 1-11.<br />
Kohli, M. (2000). Der Alters-Survey als Instrument wissenschaftlicher Beobachtung. In M.<br />
Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Hrsg.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong><br />
Partizipation im Spiegel des Alters-Survey (pp. 10-32). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A. & Szydlik, M. (2000a). Generationenbeziehungen. In M.<br />
Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Hrsg.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong><br />
Partizipation im Spiegel des Alters-Survey (pp. 176-211). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A. & Szydlik, M. (2000b). Gr<strong>und</strong>daten zur Lebenssituation<br />
der 40-85jährigen deutschen Bevölkerung. Ergebnisse des Alters-Survey. Berl<strong>in</strong>: Weißensee-Verlag.<br />
Kohli, M., & Szydlik, M. (Eds.). (2000). Generationen <strong>in</strong> Familie <strong>und</strong> Gesellschaft. Opladen:<br />
Leske + Budrich.<br />
Laslett, P. (1989/1995). A fresh map of life. London: Weidenfeld & Nicholson (dt. Das dritte<br />
Alter. We<strong>in</strong>heim: Juventa, 1995).<br />
Maddox, G. L. (1987). Ag<strong>in</strong>g differently. The Gerontologist (5) 27, 557-564.<br />
Mannheim, K. (1928). Das Problem der Generationen. Kölner Vierteljahresschrift für Soziologie,<br />
7, 154-184, 309-330.<br />
Mayer, K. U. & Wagner, M. (1996). Lebenslagen <strong>und</strong> soziale Ungleichheit im hohen Alter. In<br />
K.U. Mayer & P.B. Baltes (Hrsg.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 251-275). Berl<strong>in</strong>: Akademie<br />
Verlag.<br />
Mayer, K. U. (1990). Lebensverläufe <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong>. Anmerkungen zu e<strong>in</strong>em Forschungsprogramm.<br />
In K. U. Mayer (Ed.), Lebensverläufe <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong> (pp. 7-<br />
21). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Mayer, K.-U. (1998). Lebensverlauf. In B. Schäfers & W. Zapf (Hrsg.), Handwörterbuch zur<br />
Gesellschaft Deutschlands (pp. 438-451). Opladen: Leske+Budrich.<br />
Mielck, A. (2003). Sozial bed<strong>in</strong>gte Ungleichheit von Ges<strong>und</strong>heitschancen. Zeitschrift für Sozialreform,<br />
49(3), 370-375.<br />
Mollenkopf, H. (2001). Technik - e<strong>in</strong> "knappes Gut?" Neue soziale Ungleichheiten im Alter<br />
durch unterschiedliche Zugangs- <strong>und</strong> Nutzungschancen. In G. M. Backes, W. Clemens<br />
29
30<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
& K. R. Schroeter (Eds.), Zur Konstruktion sozialer Ordnungen des Alter(n)s (pp. 223-<br />
238). Opladen.<br />
Motel, A. (2000). E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen. In M. Kohli, & H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite<br />
Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-Survey.<br />
(pp. 41-101). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. (2000). Alter <strong>und</strong> Generationenvertrag im <strong>Wandel</strong> des Sozialstaats. Alterssicherung<br />
<strong>und</strong> private Generationenbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Berl<strong>in</strong>:<br />
Weißensee.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. (2001). Lebensqualität <strong>und</strong> Ungleichheit. In G. Backes & W. Clemens<br />
(Hrsg.), Zur Konstruktion sozialer Ordnungen des Alter(n)s (pp. 187-221). Opladen:<br />
Leske + Budrich.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., Krause, P., & Künem<strong>und</strong>, H. (2004). Alterse<strong>in</strong>kommen der Zukunft (Diskussionspapiere<br />
Nr. 43). Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
Neugarten, B. L. (ed.) (1968). Middle age and ag<strong>in</strong>g. Chicago: University of Chicago Press.<br />
Niederfranke, A. (1997). Sozialberichterstattung zur Situation älterer Menschen. In H.-H. Noll<br />
(Hrsg.), Sozialberichterstattung <strong>in</strong> Deutschland: Konzepte, Methoden <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
für Lebensbereiche <strong>und</strong> Bevölkerungsgruppen (pp. 195-212). We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Noll, H. H. & Schöb, A. (2002). Lebensqualität im Alter. In Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
(Ed.), Expertisen zum vierten Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung, Band I: Das hohe<br />
Alter. Konzepte, Forschungsfelder, Lebensqualität (pp. 229-313). Hannover: V<strong>in</strong>centz<br />
Noll, H.-H. (1989). Indikatoren des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens: Instrumente für die gesellschaftliche<br />
Dauerbeobachtung. ZUMA-Nachrichten, 24, 26-41.<br />
Noll, H.-H. (1998). Sozialstatistik <strong>und</strong> Sozialberichterstattung. In B. Schäfers & W. Zapf<br />
(Hrsg.), Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands (pp. 632-641). Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
Noll, H.-H. (2000). Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität <strong>und</strong> "neue" Wohlfahrtskonzepte<br />
(Bericht P00-505). Berl<strong>in</strong>: Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung.<br />
Reese, H. W. & Smyer, M. A. (1983). The dimensionalization of life events. In E.E. Calahan &<br />
K.A. McCluskey (Eds.), Life span developmental psychology: Non-normative life<br />
events (pp. 1-33). NewYork: Academic Press.<br />
Riley, M. W. & Riley, J. W., Jr (1992). Individuelles <strong>und</strong> gesellschaftliches Potential des Altern.<br />
In P.B. Baltes & J. Mittelstraß (Hrsg.), Zukunft des Alterns <strong>und</strong> gesellschaftliche <strong>Entwicklung</strong><br />
(pp. 437-459). Berl<strong>in</strong>: de Gruyter.<br />
Riley, M. W. (1985). Age strata <strong>in</strong> social systems. In R. H. B<strong>in</strong>stock & E. Shanas (Eds.), Handbook<br />
of ag<strong>in</strong>g and the social sciences (2nd ed., pp. 369-411). New York: Academic<br />
Press.<br />
Riley, M. W., Foner, A. & Riley, J. W. J. (1999). The ag<strong>in</strong>g and society paradigm. In V.L.<br />
Bengtson & K.W. Schaie (Eds.), Handbook of theories of ag<strong>in</strong>g (pp. 327-343). New<br />
York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Riley, M., Johnson, M. & Foner, A. (1972). Ag<strong>in</strong>g and society, Vol. 3. A sociology of age stratification.<br />
New York: Russel Sage.<br />
Roth, E. & Holl<strong>in</strong>g, H. (1999). Sozialwissenschaftliche Methoden. München: Oldenbourg.
Kapitel 1: Beobachtung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> Analyse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen<br />
Ryder, N. B. (1965). The cohort as a concept <strong>in</strong> the study of social change. American Sociological<br />
Review, 30, 843-861.<br />
Schäfgen, K. (2002). Ungleichheit <strong>und</strong> Geschlechterverhältnisse. In V. Hammer & R. Lutz<br />
(Eds.), Weibliche Lebenslagen <strong>und</strong> soziale Benachteiligung (pp. 45-66). Frankfurt/M.<br />
Schaie, K. W., & Hofer, S. M. (2001). Longitud<strong>in</strong>al studies <strong>in</strong> ag<strong>in</strong>g research. In J. E. Birren &<br />
K. W. Schaie (Eds.), Handbook of the psychology of ag<strong>in</strong>g (5 ed., pp. 53-77). San<br />
Diego, CA: Academic Press.<br />
Schneider, S. (2003). Schichtzugehörigkeit <strong>und</strong> Mortalität <strong>in</strong> der BRD. Empirische Überprüfung<br />
theoretischer Erklärungsansätze. <strong>Sozialer</strong> Fortschritt, 52(3), 64-73.<br />
Schnell, R., Hill, P. B. & Esser, E. (1999). Methoden der empirischen Sozialforschung. München:<br />
Oldenbourg.<br />
Schulz, E. (2000). Migration <strong>und</strong> Arbeitskräfteangebot <strong>in</strong> Deutschland bis 2050. DIW-<br />
Wochenbericht 48/00.<br />
Schupp, J., Habich, R. & Zapf, W. (1996). Sozialberichterstattung im Längsschnitt - Auf dem<br />
Weg zu e<strong>in</strong>er dynamischen Sicht der Wohlfahrtsproduktion. In W. Zapf, J. Schupp & R.<br />
Habich (Hrsg.), Lebenslagen im <strong>Wandel</strong>: Sozialberichterstattung im Längsschnitt (pp.<br />
11-45). Frankfurt: Campus.<br />
Schwenk, O. G. (Hrsg.) (1996). Lebensstil zwischen Sozialstrukturanalyse <strong>und</strong> Kulturwissenschaft.<br />
Opladen: Leske + Budrich.<br />
Settersten, R. A. (2002). Propositions and controversies <strong>in</strong> life-course scholarship. In R.A. Settersten<br />
(Ed.), Invitation to the life course: toward new <strong>und</strong>erstand<strong>in</strong>gs of later life (pp.<br />
15-45). Amityville, NY: Baywood Publish<strong>in</strong>g.<br />
Smith, J., Fleeson, W., Geiselmann, B., Settersten, R. & Kunzmann, U. (1996). Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
im hohen Alter: Vorhersagen aufgr<strong>und</strong> objektiver Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektiver<br />
Bewertung. In K.U. Mayer & P.B. Baltes (Hrsg.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 497-<br />
523). Berl<strong>in</strong>: Akademie Verlag.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2000). Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bis zum Jahr 2050.<br />
Ergebnisse der 9. koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden: Statistisches<br />
B<strong>und</strong>esamt.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (2003). Bevölkerung Deutschlands bis zum Jahr 2050. Ergebnisse der<br />
10. koord<strong>in</strong>ierte Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt<br />
Staud<strong>in</strong>ger, U. (2001). A view on midlife development from life-span theory. In M.E. Lachman<br />
(Ed.), Handbook of midlife development (pp. 3-39). New York: Wiley.<br />
Szydlik, M. (2002). Familie - Lebenslauf - Ungleichheit. Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte. Beilage<br />
zur Wochenzeitung "Das Parlament"(B22/23), 7-9.<br />
Tesch-Römer, C., Salewski, C. & Schwarz, G. (Hrsg.) (1997). Psychologie der Bewältigung.<br />
We<strong>in</strong>heim: Psychologie Verlags Union.<br />
Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A. & Engstler, H. (2002a). Die zweite Welle des Alterssurveys.<br />
Erhebungsdesign <strong>und</strong> Instrumente. Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A. & Engstler, H. (2002b). Alterssozialberichterstattung im<br />
Längsschnitt: Die zweite Welle des Alterssurveys. In A. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel & U. Kelle<br />
(Hrsg.), Perspektiven der empirischen Alternssoziologie (pp. 155-189). Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
31
32<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Tews, H. P. (1993). Neue <strong>und</strong> alte Aspekte des Strukturwandels des Alters. In G. Naegele &<br />
H.P. Tews (Hrsg.), Lebenslagen im Strukturwandel des Alters (pp. 15-42). Opladen:<br />
Westdeutscher Verlag.<br />
Thomae, H. (1959). <strong>Entwicklung</strong>sbegriff <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>stheorie. In H. Thomae (Hrsg.),<br />
Handbuch der Psychologie: <strong>Entwicklung</strong>spsychologie (1-20). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.<br />
Thomae, H. (1983). Alternsstile <strong>und</strong> Alternsschicksale. Bern: Huber.<br />
White, H. (1992). Succession and generations: Look<strong>in</strong>g back on cha<strong>in</strong>s of opportunities. In H.<br />
A. Becker (Ed.), Dynamics of cohort and generations research (pp. 31-51). Amsterdam:<br />
Thesis.<br />
Zapf, W. & Habich, R. (1996). E<strong>in</strong>leitung. In W. Zapf & R. Habich (Eds.), Wohlfahrtsentwicklung<br />
im vere<strong>in</strong>ten Deutschland. Sozialstruktur, sozialer <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Lebensqualität (pp.<br />
11-21). Berl<strong>in</strong>: Sigma.<br />
Zapf, W. (1984). Individuelle Wohlfahrt: Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> wahrgenommene Lebensqualität.<br />
In W. Glatzer & W. Zapf (Hrsg.), Lebensqualität <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Objektive Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den (pp. 13-26). Frankfurt/Ma<strong>in</strong>:<br />
Campus.<br />
Zapf, W., Schupp, J. & Habich, R. (1996). Lebenslagen im <strong>Wandel</strong>: Sozialberichterstattung im<br />
Längsschnitt. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.
2. Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Heribert Engstler <strong>und</strong> Susanne Wurm<br />
2.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Mit dem Alterssurvey werden zwei gr<strong>und</strong>legende Aufgaben verfolgt: Zum e<strong>in</strong>en dient er dazu, die<br />
Sozialberichterstattung <strong>in</strong> Deutschland durch e<strong>in</strong>e Alterssozialberichterstattung zu ergänzen <strong>und</strong> zu<br />
bereichern (Tesch-Römer, Wurm, Hoff & Engstler 2002). Dies ist besonders <strong>in</strong> Anbetracht der<br />
demographischen <strong>Entwicklung</strong> von hoher Bedeutung. Dabei zeichnet sich der Alterssurvey gegenüber<br />
bislang verfügbaren Surveys (z.B. SOEP, ALLBUS, Wohlfahrtssurvey, Familiensurvey)<br />
durch se<strong>in</strong>e Konzentration auf das mittlere <strong>und</strong> höhere Lebensalter sowie durch die Komb<strong>in</strong>ation<br />
von soziologischen <strong>und</strong> psychologischen Erhebungsbereichen aus. Zum anderen bildet der Alterssurvey<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Gr<strong>und</strong>lage, zu ausgewählten Fragen vertiefende Forschung zu ermöglichen –<br />
hierzu zählen unter anderem Fragen zu objektiver wie subjektiver Lebensqualität, <strong>Entwicklung</strong>sprozessen,<br />
sozialen Unterschieden <strong>und</strong> Ungleichheiten sowie zu Generationenbeziehungen <strong>und</strong><br />
Generationenverhältnissen (vgl. Kapitel 1).<br />
Nachfolgend wird zunächst e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Überblick über das Erhebungsdesign, die erhobenen<br />
Inhalte <strong>und</strong> die Analysemöglichkeiten im Quer- <strong>und</strong> Längsschnitt gegeben. Im Anschluss daran<br />
werden die drei Stichproben der Erhebung aus dem Jahr 2002 – die Panel-, Replikations- <strong>und</strong> Ausländerstichprobe<br />
– genauer beschrieben. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausschöpfung <strong>und</strong> Gewichtung<br />
der Stichproben.<br />
2.2 Das Untersuchungsdesign im Überblick<br />
Das Projekt "Alterssurvey" begann im Jahr 1994 unter der Federführung der Freien Universität<br />
Berl<strong>in</strong> (Forschungsgruppe Altern <strong>und</strong> Lebenslauf, Leitung Prof. Mart<strong>in</strong> Kohli) sowie der Universität<br />
Nijmegen (Forschungsgruppe Psychogerontologie, Leitung Prof. Freya Dittmann-Kohli). Auftraggeber<br />
war das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend. Für diese erste<br />
Erhebungswelle des Alterssurveys wurden drei Instrumente konzipiert <strong>und</strong> mit Hilfe von Pilotstudien<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>em Pretest im Vorfeld der Hauptuntersuchung getestet: E<strong>in</strong> mündliches Interview, e<strong>in</strong><br />
Fragebogen zum Selbstausfüllen sowie e<strong>in</strong> halboffenes Satzergänzungsverfahren, das sogenannte<br />
SELE-Instrument (Dittmann-Kohli, Kohli & Künem<strong>und</strong> 1995). Die Erhebung wurde 1996 vom<br />
<strong>in</strong>fas Institut für angewandte Sozialwissenschaft durchgeführt. Der Repräsentativbefragung lag e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>wohnermeldestichprobe zugr<strong>und</strong>e, die disproportional nach Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil<br />
(Ost/West) geschichtet wurde. Die Schichtung der Stichprobe wurde vorgenommen, um auch für<br />
die Analyse von Personengruppen mit relativ ger<strong>in</strong>gem Bevölkerungsanteil, wie den ostdeutschen<br />
Männern höheren Alters, e<strong>in</strong>e ausreichende Fallzahl verfügbar zu haben. Dem disproportionalen<br />
Stichprobenansatz wurde durch e<strong>in</strong>e entsprechende Datengewichtung Rechnung getragen<br />
33
34<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
(Künem<strong>und</strong> 2000, S.34). Insgesamt stehen aus dieser Basisstichprobe 4838 auswertbare mündliche<br />
Interviews von <strong>in</strong> Privathaushalten lebenden Deutschen im Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren (Geburtsjahrgänge<br />
1911 bis 1956) zur Verfügung. Über die E<strong>in</strong>zelheiten des Untersuchungsdesigns der<br />
ersten Welle <strong>in</strong>formieren mehrere Publikationen (Dittmann-Kohli et al. 1997; Kohli 2000;<br />
Künem<strong>und</strong> 2000; Kohli & Tesch-Römer 2003).<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage dieser Basisstichprobe von 1996 begann fünf Jahre nach der Ersterhebung die<br />
Planung der zweiten Erhebungswelle des Alterssurveys. Diese zweite Erhebungswelle steht im<br />
Zentrum der vorliegenden Publikation. Die wissenschaftliche Leitung übernahm das Deutsche<br />
Zentrum für Altersfragen <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> (Leitung: Prof. Clemens Tesch-Römer). Mit dem „Alterssurvey,<br />
zweite Welle“ wurden mehrere Ziele verfolgt, die sich über (1) den Stichprobenansatz, (2) die <strong>in</strong>haltliche<br />
Ausrichtung sowie (3) die Analysemöglichkeiten beschreiben lassen.<br />
2.2.1 Stichprobenansatz<br />
E<strong>in</strong> zentrales Ziel der zweiten Welle des Alterssurveys war es, ihn zum Instrument e<strong>in</strong>er Alterssozialberichterstattung<br />
<strong>und</strong> Alternsforschung im Längsschnitt auszubauen. Dies bedeutete zum e<strong>in</strong>en,<br />
möglichst viele Personen der ersten Erhebung von 1996 erneut zu befragen, um <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sverläufe<br />
betrachten zu können. Personen, die für die Wiederholungsbefragung erneut<br />
gewonnen werden konnten, bilden die „Panelstichprobe“ der zweiten Welle des Alterssurveys.<br />
Die Zahl der potentiell wieder befragbaren Personen war allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>geschränkt: E<strong>in</strong>erseits durch<br />
e<strong>in</strong>e bei höheren Altersgruppen bekannte Zunahme von Morbidität <strong>und</strong> Mortalität (d.h. Personen<br />
waren krankheitsbed<strong>in</strong>gt nicht mehr befragbar oder waren <strong>in</strong> der Zwischenzeit verstorben), andererseits<br />
durch die Tatsache, dass bereits bei der Erstbefragung weniger als zwei Drittel der Befragten<br />
e<strong>in</strong>er Wiederholungsbefragung zugestimmt hatte (vgl. Kapitel 2.3).<br />
Neben dem Aufbau e<strong>in</strong>er Panelstichprobe wurde das Ziel e<strong>in</strong>er Altersberichterstattung <strong>und</strong> -<br />
forschung im Längsschnitt durch den zusätzlichen Aufbau e<strong>in</strong>er neuen Stichprobe von Personen<br />
(„Replikationsstichprobe“) verfolgt, die mit der Basisstichprobe von 1996 vergleichbar se<strong>in</strong> sollte.<br />
Auch diese Befragten sollten zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren alt se<strong>in</strong>, allerd<strong>in</strong>gs nicht im Jahr 1996,<br />
sondern im Jahr 2002 <strong>und</strong> stellen somit jüngere Geburtskohorten gleichen Alters dar. Die Stichprobenziehung<br />
der Replikationsstichprobe erfolgte analog zur Basisstichprobe. Dies bedeutete unter<br />
anderem, dass wie bereits <strong>in</strong> der ersten Welle e<strong>in</strong>e Schichtung der Stichprobe nach Alter, Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Landesteil erfolgte.<br />
Schließlich kam <strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys noch e<strong>in</strong>e dritte Stichprobe zum E<strong>in</strong>satz,<br />
die im folgenden als „Ausländerstichprobe“ bezeichnet wird. In der ersten Erhebungswelle wurden<br />
ausschließlich Personen deutscher Staatsangehörigkeit berücksichtigt. Da <strong>in</strong>zwischen jedoch <strong>in</strong><br />
Deutschland e<strong>in</strong>e größere Zahl ausländischer Migranten das Rentenalter erreicht haben, wurde<br />
angestrebt, durch die Erhebung e<strong>in</strong>er repräsentativen Stichprobe der nicht-deutschen Bevölkerung<br />
im Alter von 40 bis 85 Jahren auch die Lebenssituation der wachsenden Bevölkerungsgruppe älterer<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer untersuchen zu können. E<strong>in</strong>e kurze Übersicht über Charakteristika<br />
dieser drei Stichproben der zweiten Welle des Alterssurveys enthält Tabelle 2.1. Detailliertere<br />
Darstellungen der drei Stichproben – Panelstichprobe, Replikationsstichprobe <strong>und</strong> Ausländerstichprobe<br />
– erfolgen <strong>in</strong> den nachfolgenden Abschnitten (Kapitel 2.3, 2.4 <strong>und</strong> 2.5).
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Tabelle 2.1: Erhebungsdesign der ersten <strong>und</strong> zweiten Welle des Alterssurveys<br />
Welle 1 Welle 2 Welle 2 Welle 2<br />
Basisstichprobe Panelstichprobe Replikationsstichprobe Ausländerstichprobe<br />
Nicht-Deutsche im Alter<br />
von 40 bis 85 Jahren<br />
(Geburtsjahrgänge 1917-<br />
1962)<br />
Deutsche im Alter von 40 bis<br />
85 Jahren (Geburtsjahrgänge<br />
1917-1962)<br />
Panelbereite Teilnehmer von Welle<br />
1, Alter zum 2. MZP: 46-91J.<br />
Deutsche im Alter von 40 bis 85<br />
Jahren (Geburtsjahrgänge<br />
1911-1956)<br />
Zielgruppe / Gr<strong>und</strong>gesamtheit<br />
Personen <strong>in</strong><br />
Privathaushalten<br />
Personen <strong>in</strong><br />
Privathaushalten<br />
Personen <strong>in</strong> Privathaushalten<br />
<strong>und</strong> solche, die zwischenzeitlich <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong> Heim umgezogen s<strong>in</strong>d<br />
Wohnform Personen <strong>in</strong><br />
Privathaushalten<br />
E<strong>in</strong>wohnermeldestichprobe<br />
<strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den der<br />
ersten Welle;<br />
Zufallsauswahl ohne<br />
Schichtung<br />
E<strong>in</strong>wohnermeldestichprobe <strong>in</strong><br />
den Geme<strong>in</strong>den der ersten<br />
Welle;<br />
Disproportionale Schichtung<br />
wie <strong>in</strong> Welle 1<br />
Alle panelbereiten Zielpersonen von<br />
Welle 1 (ohne Verstorbene bzw.<br />
unbekannt verzogene Personen)<br />
Stichprobe E<strong>in</strong>wohnermeldestichprobe <strong>in</strong><br />
290 Geme<strong>in</strong>den; disproportionale<br />
Schichtung nach<br />
(a) Region (Ost: West=1:2),<br />
(b) 3 Altersgruppen (je 1/3):<br />
40-54, 55-69, 70-85 Jahre<br />
(c) Geschlecht (1:1)<br />
Mündliches Interview mit standardisiertem Fragebogen,<br />
schriftliche Befragung („drop-off“),<br />
schriftlicher Kurztest der kognitiven Leistungsfähigkeit<br />
Mündliches Interview mit standardisiertem<br />
Fragebogen, schriftliche<br />
Befragung („drop-off“),<br />
Fragebogen mit Satzergänzungsverfahren<br />
(SELE-Instrument)<br />
Erhebungsmethode<br />
<strong>und</strong> -<strong>in</strong>strumente<br />
Erhebungsjahr 1996 2002 2002 2002<br />
Erhebungssprache deutsch deutsch deutsch deutsch<br />
586 mündliche Interviews,<br />
484 schriftliche Fragebögen<br />
3084 mündliche Interviews,<br />
2787 schriftliche Fragebögen<br />
1524 mündliche Interviews (W1+2)<br />
1437 schriftliche Fragebögen (W2),<br />
1286 schriftliche Fragebögen (Welle<br />
1 <strong>und</strong> 2)<br />
Auswertbare Fallzahl 4838 mündliche Interviews,<br />
4034 schriftliche Fragebögen<br />
35
2.2.2 Inhalte <strong>und</strong> Ablauf der Erhebung<br />
36<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Neben e<strong>in</strong>er gegenüber der ersten Erhebungswelle deutlichen Ausweitung des Stichprobenansatzes,<br />
erfolgten <strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys zudem <strong>in</strong>haltliche Modifikationen. Um e<strong>in</strong>e Betrachtung<br />
von Veränderungen im Längsschnitt zu ermöglichen, wurde allerd<strong>in</strong>gs darauf geachtet,<br />
die Befragung <strong>in</strong> großen Teilen so zu belassen, wie sie bereits <strong>in</strong> der Ersterhebung durchgeführt<br />
wurde. Dies bedeutete auch, dass die <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Ausrichtung des Alterssurveys beibehalten<br />
wurde, so dass das Erhebungs<strong>in</strong>strument soziologische, sozialpolitische, ökonomische <strong>und</strong> psychologische<br />
Fragen abdeckt. Die deutlichste Veränderung gegenüber der Ersterhebung bestand im<br />
Wegfall des SELE-Instrumentes. Dieses Satzergänzungsverfahren war durch se<strong>in</strong>en Charakter als<br />
halboffenes Verfahren für die nachträgliche Aufbereitung sehr aufwändig, da die <strong>in</strong> offener Weise<br />
gegebenen Antworten transkribiert <strong>und</strong> anhand e<strong>in</strong>es komplexen Schemas codiert werden mussten<br />
(Bode, Westerhof & Dittmann-Kohli 2001). Aus diesem Gr<strong>und</strong> waren bereits <strong>in</strong> der Basisstichprobe<br />
(1. Welle) nur die Angaben e<strong>in</strong>er Teilstichprobe von Personen vercodet worden. In der zweiten<br />
Welle des Alterssurveys wurde auf das halboffene Verfahren vollständig verzichtet <strong>und</strong> an se<strong>in</strong>er<br />
Stelle verschiedene standardisierte Erhebungs<strong>in</strong>strumente e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Zudem erfolgte <strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys e<strong>in</strong>e Anpassung von Fragebereichen an<br />
aktuelle sozialpolitische Fragen. Hierzu zählte beispielsweise die Aufnahme von neuen Fragen zu<br />
pflegerischer Versorgung (Leistung/Erhalt von Hilfe oder Pflege), nachdem <strong>in</strong> den Jahren 1995/96<br />
<strong>in</strong> Deutschland die Pflegeversicherung (SGB XI) e<strong>in</strong>geführt worden war. Erweitert wurden unter<br />
anderem auch die Erhebungsfragen zu Ges<strong>und</strong>heit, wobei Aspekte körperlicher <strong>und</strong> psychischer<br />
Ges<strong>und</strong>heit sowie Lebensqualität gleichermaßen berücksichtigt wurden. Erstmals erhoben wurde<br />
die kognitive Leistungsfähigkeit der Befragten, die durch den Zahlen-Symbol-Test erfasst wurde.<br />
Es handelt sich hierbei um e<strong>in</strong>en Power-Speed-Test, der mit ger<strong>in</strong>gem Zeitaufwand verb<strong>und</strong>en ist<br />
(90 Sek<strong>und</strong>en) <strong>und</strong> im Gegensatz zu Demenz-Screen<strong>in</strong>g-Instrumenten (z.B. M<strong>in</strong>i Mental State<br />
Exam<strong>in</strong>ation – MMSE, Folste<strong>in</strong>, Folste<strong>in</strong> & McHugh 1975) üblicherweise <strong>in</strong> allen Altersgruppen,<br />
die der Alterssurvey umfasst, e<strong>in</strong>gesetzt wird.<br />
Das Erhebungs<strong>in</strong>strumentarium der zweiten Welle des Alterssurveys untergliedert sich dadurch <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>sgesamt drei Instrumente: Das standardisierte, persönliche Interview (PAPI-Methode), e<strong>in</strong>en<br />
anschließenden Kurztest zu kognitiver Leistungsfähigkeit (Zahlen-Symbol-Test) sowie e<strong>in</strong>en Fragebogen<br />
zum Selbstausfüllen (sog. „drop-off“). Letzterer konnte je nach Wunsch des Befragten<br />
geme<strong>in</strong>sam mit dem Interviewer ausgefüllt werden oder der Fragebogen wurde vom Interviewer<br />
zurückgelassen <strong>und</strong> später wieder abgeholt. Ablauf <strong>und</strong> Inhalte der Befragung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Kurzform <strong>in</strong><br />
Abbildung 2.1 aufgelistet.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Abbildung 2.1:<br />
Erhebungsablauf <strong>und</strong> Erhebungsbereiche: Alterssurvey, zweite Welle<br />
I. Persönliches, mündliches Interview<br />
- Herkunftsfamilie<br />
- Schulische <strong>und</strong> berufliche Ausbildung, erste Berufstätigkeit, Erwerbsunterbrechungen<br />
- Erwerbstätigkeit <strong>und</strong> Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
- Familienstand <strong>und</strong> Partnerschaft<br />
- K<strong>in</strong>der, Enkel <strong>und</strong> weitere Verwandte<br />
- Haushaltszusammensetzung<br />
- Migrationserfahrungen <strong>und</strong> -pläne<br />
- Wohnsituation<br />
- Freizeitgestaltung, gesellschaftliches Engagement <strong>und</strong> Partizipation<br />
- Lebensziele <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
- Hilfe <strong>und</strong> Pflege<br />
- Persönliches Netzwerk<br />
- Soziale Unterstützung<br />
- F<strong>in</strong>anzielle Transfers <strong>und</strong> Lebensstandard<br />
- Interviewere<strong>in</strong>schätzungen<br />
II. Kognitiver Leistungstest (Zahlen-Symbol-Test)<br />
III. Schriftliche Befragung (Drop-Off)<br />
- Selbstkonzepte<br />
- Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
- Werte <strong>und</strong> Normen<br />
- Mediennutzung<br />
- Soziale Beziehungen<br />
- Ges<strong>und</strong>heit<br />
- Wohnen<br />
- Materielle Lage<br />
Erhebungsablauf <strong>und</strong> Erhebungsbereiche waren <strong>in</strong> allen drei Stichproben – Panelstichprobe, Replikationsstichprobe<br />
<strong>und</strong> Ausländerstichprobe – weitgehend gleich. Lediglich <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelaspekten unterschieden<br />
sich die Befragungen vone<strong>in</strong>ander: Die Panelstichprobe erhielt e<strong>in</strong> eigenes Erhebungs<strong>in</strong>strument<br />
für das persönliche Interview, Replikations- <strong>und</strong> Ausländerstichprobe erhielten geme<strong>in</strong>sam<br />
e<strong>in</strong> anderes, während alle drei Stichproben den gleichen kognitiven Leistungstest sowie die<br />
gleichen schriftlichen Befragungsunterlagen erhielten. Das mündliche Interview der Panelteilnehmer<br />
wurde primär aus zwei Gründen abweichend vom Instrument der anderen beiden Stichproben<br />
konzipiert: Zum e<strong>in</strong>en, da Panelpersonen e<strong>in</strong>zelne Fragen nicht mehr erhielten, sofern sich seit der<br />
Erstbefragung ke<strong>in</strong>e Veränderungen ergeben hatten bzw. haben konnten (letztes gilt für Angaben<br />
wie beispielsweise die Geburtsjahre der Elternpersonen). Dies diente dazu, die teils hochbetagten<br />
37
38<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Panelteilnehmer von verzichtbaren Fragen zu entlasten. E<strong>in</strong> weiterer Gr<strong>und</strong> war, dass <strong>in</strong> der zweiten<br />
Erhebungswelle auch Personen e<strong>in</strong>bezogen werden sollten, die nach der Erstbefragung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
stationäre Altene<strong>in</strong>richtung umgezogen s<strong>in</strong>d. Ziel war es, möglichst viele Personen im Längsschnitt<br />
zu verfolgen, unabhängig davon, ob sie weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Privathaushalt leben (dies war e<strong>in</strong> Auswahlkriterium<br />
für die Basisstichprobe) oder <strong>in</strong> der Zwischenzeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e andere Wohnform gewechselt<br />
s<strong>in</strong>d. Heimbewohner wurden zu bestimmten Themenbereichen nicht oder <strong>in</strong> modifizierter Weise<br />
befragt, da e<strong>in</strong>zelne Fragen (z.B. zur Wohnsituation) für sie nicht oder nur mit abweichender<br />
Fragestellung beantwortbar waren.<br />
Für das mündliche Interview von Personen der Replikations- <strong>und</strong> der Ausländerstichprobe wurde<br />
e<strong>in</strong> identischer Fragebogen verwendet. Dieser war <strong>in</strong>sgesamt etwas umfangreicher als jener für die<br />
Panelstichprobe <strong>und</strong> enthielt unter anderem e<strong>in</strong>ige Zusatzfragen zu Migrationserfahrungen <strong>und</strong><br />
Migrationsplanungen. Diese Fragen wurden besonders <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Ausländerstichprobe<br />
aufgenommen. Alle Personen erhielten das Interview sowie die schriftliche Befragung ausschließlich<br />
<strong>in</strong> deutscher Sprache. Dadurch konnten nur Personen an der Befragung teilnehmen, wenn sie<br />
des Deutschen ausreichend mächtig waren oder Angehörige hatten, die Übersetzungshilfen leisten<br />
konnten. Unzureichende Sprachkenntnisse führten bereits <strong>in</strong> der Ersterhebung, die nur mit Personen<br />
deutscher Staatsangehörigkeit vorgenommen wurde, zu Stichprobenausfällen <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>em Umfang<br />
– diese Ausfälle lagen erwartungsgemäß <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe deutlich höher (vgl. Abschnitt<br />
2.5).<br />
Vor Durchführung der Haupterhebung fand e<strong>in</strong>e Pretestung aller Erhebungs<strong>in</strong>strumente (mündliches<br />
Interview, Zahlen-Symbol-Test sowie Fragebogen zum Selbstausfüllen) mit anschließender<br />
Überarbeitung statt. Der Pretest im Jahr 2001 basierte auf e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>wohnermeldestichprobe von<br />
n=111 Personen deutscher <strong>und</strong> nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. Die Haupterhebung wurde,<br />
ebenso wie der Pretest, von Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft durchgeführt <strong>und</strong> fand<br />
im Jahr 2002 statt. An die Datenerhebung, elektronische Datenerfassung <strong>und</strong> -prüfung durch <strong>in</strong>fas<br />
schloss sich e<strong>in</strong>e längere Phase umfangreicher Datenbere<strong>in</strong>igung <strong>und</strong> Datenedition an, die vom<br />
Projektteam am Deutschen Zentrum für Altersfragen durchgeführt wurde.<br />
2.2.3 Analysemöglichkeiten<br />
Die Komb<strong>in</strong>ation aus e<strong>in</strong>er Wiederholungsbefragung der Panelteilnehmer <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Erstbefragung<br />
der Replikations- sowie der Ausländerstichprobe eröffnet zahlreiche Analysemöglichkeiten, die im<br />
folgenden kurz erläutert werden sollen. E<strong>in</strong>e graphische Veranschaulichung der Analysemöglichkeiten<br />
f<strong>in</strong>det sich nachfolgend <strong>in</strong> Abbildung 2.2.<br />
(a) Längsschnitt-Vergleich: Mit Hilfe der Panelstichprobe können <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Verläufe betrachtet<br />
werden. Dies macht es möglich, neben zeitlich ungerichteten Zusammenhängen (z.B. zwischen<br />
sozialer Integration <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den) auch zeitlich gerichtete Vorhersagemodelle zu betrachten<br />
(z.B. zu untersuchen, wie gut soziale Integration Wohlbef<strong>in</strong>den vorhersagen kann). Während dies<br />
e<strong>in</strong> unschätzbarer Vorteil von Panelstichproben ist, liegt e<strong>in</strong> Nachteil <strong>in</strong> der Stichprobenselektivität.<br />
Bereits querschnittbezogene Stichproben wie die Basisstichprobe des Alterssurveys s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere<br />
zugunsten jüngerer, gesünderer <strong>und</strong> besser gebildeter Personen selektiert. Diese Selektion<br />
verstärkt sich <strong>in</strong> Panelstichproben wie jener des Alterssurveys (vgl. Abschnitt 2.3.2). Teilweise
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
bietet sich statt der Betrachtung <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong>en deshalb an, Längsschnitt-Vergleiche<br />
im S<strong>in</strong>ne von Trendstudien vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um den Vergleich von wiederholt<br />
durchgeführten Querschnittstudien (Zeitreihen). Diese s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e Dauerbeobachtung der <strong>Entwicklung</strong><br />
von Niveau <strong>und</strong> Verteilung objektiver <strong>und</strong> subjektiver Wohlfahrtserträge geeignet (Habich,<br />
1994), lassen jedoch ke<strong>in</strong>e Aussagen über <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>en zu. Die prospektive<br />
Beobachtung persönlicher <strong>Entwicklung</strong>en ist daher e<strong>in</strong>e der Stärken des Alterssurveys.<br />
Abbildung 2.2:<br />
Analysemöglichkeiten mit den Stichproben des Alterssurveys<br />
Alter Alter<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
(a) Längsschnitt-Vergleich<br />
Panelstichprobe<br />
70-85<br />
55-69<br />
40-54<br />
1996<br />
1. Welle<br />
76-91<br />
61-75<br />
46-60<br />
2002<br />
2. Welle<br />
100 100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60 60<br />
50<br />
40<br />
(b) Kohorten-Vergleich<br />
Basis- vs. Replikations-SP<br />
1996<br />
1. Welle<br />
70-85 Jahre<br />
55-69 Jahre<br />
40-54 Jahre<br />
2002<br />
2. Welle<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60 60<br />
50<br />
40<br />
(c) Gruppen-Vergleich<br />
Deutsche vs. Nicht-Deutsche<br />
2002<br />
2. Welle<br />
70-85 Jahre<br />
55-69 Jahre<br />
40-54 Jahre<br />
2002<br />
2. Welle<br />
(b) Kohorten-Vergleich: Durch den Aufbau der Replikationsstichprobe <strong>in</strong> der zweiten Welle des<br />
Alterssurveys ist es möglich, neben <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Verlaufsuntersuchungen (Panelstichprobe) <strong>und</strong><br />
Querschnittsuntersuchungen auch Kohortenvergleiche vorzunehmen. In diesem Fall werden unterschiedliche<br />
Personen mite<strong>in</strong>ander verglichen, die zu unterschiedlichen Messzeitpunkten das gleiche<br />
Alter haben. Da die Replikationsstichprobe Personen umfasst, deren Geburtsjahre je sechs Jahre<br />
später liegen (1917-1962) als jene der Basisstichprobe (1911-1956), können zwischen den beiden<br />
Stichproben Kohortenvergleiche unter Kontrolle des Alters vorgenommen werden. Mit Hilfe von<br />
Kohortenvergleichen lässt sich beispielsweise der Frage nachgehen, ob später geborene Geburtskohorten<br />
im Durchschnitt e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit als früher geborene Kohorten haben, wenn sie im<br />
gleichen Alter s<strong>in</strong>d (vgl. Kapitel 7). Wegen des Sechsjahres-Abstands der beiden Erhebungszeitpunkte<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>en trennscharfen Kohortenvergleich die Befragten jeweils <strong>in</strong><br />
sechs Jahre umfassende Alters- bzw. Geburtsjahrgangsgruppen zu unterteilen. Mit dieser Gruppenbildung<br />
wird verh<strong>in</strong>dert, dass e<strong>in</strong>zelne Geburtsjahrgänge zu beiden Messzeitpunkten der gleichen<br />
Altersgruppe angehören. E<strong>in</strong>en Überblick zur Umsetzung für die Daten des Alterssurveys gibt<br />
nachfolgende Tabelle 2.2.<br />
Im Rahmen von Kohortenvergleichen lassen sich der Alters- bzw. Lebensverlaufseffekt kontrollieren.<br />
Feststellbare Merkmalsunterschiede der Angehörigen verschiedener Kohorten im gleichen<br />
Alter können Ausdruck veränderten Verhaltens oder veränderter Strukturen bei jüngeren Geburtsjahrgängen<br />
se<strong>in</strong> (Kohorteneffekt). Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass bestehende Unterschiede<br />
mitbed<strong>in</strong>gt s<strong>in</strong>d durch Besonderheiten des jeweiligen Messzeitpunkts, deren E<strong>in</strong>fluss sich auf alle<br />
39
40<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Altersgruppen erstrecken <strong>und</strong> von nur vorübergehender Natur se<strong>in</strong> kann (Periodeneffekt). In nachfolgenden<br />
Analysen f<strong>in</strong>den somit zwei Formen der Altersgruppen-Unterteilung Berücksichtigung.<br />
Zum e<strong>in</strong>en die Aufteilung <strong>in</strong> jene drei Altersgruppen, nach denen die Stichprobenschichtung erfolgte.<br />
Diese wird angewendet, wenn Altersgruppen mite<strong>in</strong>ander verglichen werden sollen. Ergänzend<br />
werden die hier dargestellten sieben Altersgruppen verwendet, um Kohortenvergleiche vornehmen<br />
zu können.<br />
Tabelle 2.2:<br />
Sechsjahres-Gruppen für Kohortenvergleiche im Alterssurvey<br />
Stichproben, Messzeitpunkt <strong>und</strong> Geburtsjahrgänge<br />
Altersgruppe Basisstichprobe Replikationsstichprobe Panelstichprobe Panelstichprobe<br />
1996<br />
2002<br />
1996<br />
2002<br />
40-45 Jahre 1951-1956 1957-1962 1951-1956 /<br />
46-51 Jahre 1945-1950 1951-1956 1945-1950 1951-1956<br />
52-57 Jahre 1939-1944 1945-1950 1939-1944 1945-1950<br />
58-63 Jahre 1933-1938 1939-1944 1933-1938 1939-1944<br />
64-69 Jahre 1927-1932 1933-1938 1927-1932 1933-1938<br />
70-75 Jahre 1921-1926 1927-1932 1921-1926 1927-1932<br />
76-81 Jahre 1915-1920 1921-1926 1915-1920 1921-1926<br />
82-87 Jahre / / / 1915-1920<br />
Anmerkung: Bei Personen der Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe sowie der Panelstichprobe des Jahres 1996 bleiben die<br />
Altersgruppen der 82- bis 85-Jährigen bei e<strong>in</strong>em Sechsjahres-Kohortenvergleich unberücksichtigt.<br />
(c) Gruppen-Vergleich von deutschen <strong>und</strong> nicht-deutschen Personen: Schließlich ist als weitere<br />
Analyseebene e<strong>in</strong>e vergleichende Betrachtung von Personen mit deutscher bzw. nicht-deutscher<br />
Staatsangehörigkeit möglich. Damit kann der Frage nachgegangen werden, wie <strong>und</strong> unter welchen<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit <strong>in</strong> Deutschland älter werden <strong>und</strong><br />
ob sie sich hierbei von deutschen Personen unterscheiden.<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass <strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys e<strong>in</strong>e deutliche<br />
Erweiterung der Stichproben (Panelstichprobe, Replikations- <strong>und</strong> Ausländerstichprobe) erfolgte.<br />
Die verschiedenen Stichproben sowie die Ausweitung vorhandener Befragungs<strong>in</strong>halte eröffnen<br />
vielfältige Analysemöglichkeiten, denen im Rahmen von Panel- <strong>und</strong> Längsschnittuntersuchungen<br />
sowie Kohortenvergleichen nachgegangen werden kann. Mit der zweiten Welle des Alterssurveys<br />
wurde e<strong>in</strong>e Gr<strong>und</strong>lage für e<strong>in</strong> kohortensequentielles Untersuchungsdesign geschaffen. Mit e<strong>in</strong>em<br />
solchen sequentiellen Design lassen sich Alters-, Kohorten- <strong>und</strong> Testzeite<strong>in</strong>flüsse methodisch adäquat<br />
vone<strong>in</strong>ander trennen. In diesem S<strong>in</strong>ne wäre es wünschenswert, den Alterssurvey durch weitere<br />
Erhebungswellen zu ergänzen <strong>und</strong> damit auch die Replikations- <strong>und</strong> Ausländerstichprobe durch<br />
e<strong>in</strong>e erneute Befragung der Teilnehmer zu Längsschnittdatensätzen auszubauen.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
2.3 Die Panelstichprobe<br />
2.3.1 Stichprobenbeschreibung <strong>und</strong> Ausschöpfung<br />
An der ersten Welle des Alterssurveys haben – wie gezeigt – 4.838 Personen mit auswertbaren<br />
Interviews teilgenommen. Gr<strong>und</strong>sätzlich wäre es wünschenswert gewesen, alle davon bei der Vorbereitung<br />
der zweiten Welle <strong>in</strong> die Bruttostichprobe der zweiten Welle aufzunehmen. Aus formalen<br />
Gründen war dies jedoch nicht möglich. Voraussetzung für die Teilnahme der Befragten an e<strong>in</strong>er<br />
zweiten Welle war, dass sie der Speicherung ihrer Adressen zum Zweck e<strong>in</strong>er Wiederholungsbefragung<br />
schriftlich zugestimmt <strong>und</strong> diese Panelbereitschaftserklärung zwischenzeitlich nicht widerrufen<br />
hatten. H<strong>in</strong>zu kommt das Problem der sogenannten „Panelmortalität“, d.h. des zeitweisen<br />
oder dauerhaften Ausfalls von Befragungspersonen. Ausfälle können beispielsweise durch Wegzug,<br />
Krankheit oder Tod begründet se<strong>in</strong>. Direkt im Anschluss an die Erstbefragung 1996 lag dem<br />
Feldforschungs<strong>in</strong>stitut <strong>in</strong>fas von 2.873 der 4.838 Befragten die Panelbereitschaftserklärung vor<br />
(vgl. Tabelle 2.3). Insbesondere mit dem Ziel der Adressaktualisierung <strong>und</strong> der Steigerung bzw.<br />
des Erhalts der Teilnahmemotivation an e<strong>in</strong>er Wiederholungsbefragung führte das <strong>in</strong>fas-Institut bis<br />
2001 zwei Panelpflegeaktionen durch. Im Zuge dieser Panelpflege kamen e<strong>in</strong>erseits per Saldo weitere<br />
165 Panelbereitschaftserklärungen h<strong>in</strong>zu, andererseits mussten – ohne die zwischenzeitlich als<br />
verstorben Gemeldeten – 471 Personen als zum<strong>in</strong>dest zeitweise Ausfälle erachtet werden, hauptsächlich<br />
aufgr<strong>und</strong> nicht mehr gültiger Adressen. Daher erfolgte kurz vor Beg<strong>in</strong>n der zweiten Welle<br />
e<strong>in</strong>e Adressrecherche bei den E<strong>in</strong>wohnermeldeämtern nach den als ‚unbekannt’ verzogenen Zielpersonen,<br />
für die e<strong>in</strong>e Panelbereitschaftserklärung vorlag. Diese führte zu 405 neuen Adressangaben.<br />
Unter Berücksichtigung aller Zu- <strong>und</strong> Abgänge bei den panelbereiten Zielpersonen ergab sich<br />
damit für die zweite Welle des Alterssurveys e<strong>in</strong>e Bruttostichprobe von 2.972 Personen (siehe Tabelle<br />
2.3, Zeile 6).<br />
Nach erfolgter oder versuchter Kontaktierung aller Zielpersonen der Bruttostichprobe musste diese<br />
noch etwas um die neutralen Ausfälle der nicht Erreichbaren nach unten bere<strong>in</strong>igt werden: 236<br />
Personen wohnten nicht mehr an der zuletzt bekannten Adresse; für 249 Personen g<strong>in</strong>g die Information<br />
e<strong>in</strong>, dass sie <strong>in</strong> der Zwischenzeit verstorben waren. Dieser Verstorbenenanteil von 8,4 Prozent<br />
liegt unter der zu erwartenden Quote von r<strong>und</strong> 15 Prozent, wenn man die Sterbetafel 1997/99<br />
des Statistischen B<strong>und</strong>esamts zugr<strong>und</strong>e legt. Es ist also davon auszugehen, dass die Zahl der Verstorbenen<br />
tatsächlich höher lag <strong>und</strong> zum Teil <strong>in</strong> den Ausfällen wegen unbekannter Adressen enthalten<br />
se<strong>in</strong> dürfte. Wird die Bruttostichprobe um diese neutralen Ausfälle bere<strong>in</strong>igt, ergibt sich e<strong>in</strong><br />
Stichprobenansatz von 2.487 Personen. Mit 900 dieser Personen konnte ke<strong>in</strong> Interview geführt<br />
werden. Hauptgründe für die systematischen Ausfälle war das Vorliegen e<strong>in</strong>er dauerhaften Erkrankung<br />
oder Beh<strong>in</strong>derung sowie Verweigerungen (ohne Nennung näherer Gründe, d.h. hier können<br />
weitere krankheitsbed<strong>in</strong>gte Ausfälle enthalten se<strong>in</strong>). Aufgr<strong>und</strong> der Ergebnisse der Interviewkontrolle<br />
<strong>und</strong> der Datenprüfung wurden 63 der 1.587 durchgeführten Interviews als nicht auswertbar deklariert,<br />
so dass im Ergebnis für die Panelstichprobe 1.524 auswertbare Interviews vorliegen.<br />
Die Ausschöpfung der Wiederholungsbefragung im Rahmen der zweiten Welle des Alterssurveys<br />
beträgt damit 61,3 Prozent der bere<strong>in</strong>igten Bruttostichprobe. Sie liegt deutlich über dem von<br />
Mohler, Koch & Gabler (2003, S.10) kritisierten Erfahrungswert, "... dass heutzutage <strong>in</strong> Deutsch-<br />
41
42<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
land auch qualitätsorientierte Umfragen faktisch kaum e<strong>in</strong>e Ausschöpfungsquote von mehr als 50%<br />
erzielen". Bezogen auf alle Teilnehmer der Erstbefragung s<strong>in</strong>d es allerd<strong>in</strong>gs nur 31,5 Prozent, da<br />
weniger als zwei Drittel ihr E<strong>in</strong>verständnis zur Adressspeicherung gegeben hatten. Angesichts des<br />
langen Zeitraums von sechs Jahren zwischen der ersten <strong>und</strong> zweiten Welle <strong>und</strong> dem höheren Alter<br />
der Stichprobe ist die Ausschöpfungsquote dennoch als akzeptabel zu bewerten.<br />
Tabelle 2.3:<br />
Ausschöpfung der Panelstichprobe<br />
Zeile Population Anzahl<br />
1 Interviews der ersten Welle 4.838<br />
2 Davon:<br />
Mit vorliegender Panelbereitschaft<br />
2.873<br />
3 + Saldo aus nachträglich erklärten <strong>und</strong> widerrufenen Panelbereitschaften<br />
im Zuge von 2 Panelpflegeaktionen<br />
4 - Ausfälle im Zuge der Panelpflege (ohne Verstorbene),<br />
hpts. aufgr<strong>und</strong> nicht mehr gültiger Adressen<br />
5 + erfolgreiche Adressrecherche von unbekannt Verzogenen<br />
kurz vor Beg<strong>in</strong>n der zweiten Welle<br />
+ 165<br />
- 471<br />
+ 405<br />
6 = Bruttostichprobe für die zweite Welle 2.972<br />
7 - Neutrale Ausfälle<br />
ZP verstorben: n=249<br />
ZP unbekannt: n=236<br />
- 485<br />
8 = Bere<strong>in</strong>igter Stichprobenansatz 2.487<br />
9 - Systematische Ausfälle<br />
darunter: ZP verweigert: n=597<br />
- 900<br />
10 = Durchgeführte mündliche Interviews 1.587<br />
11 - Nicht auswertbare Interviews - 63<br />
12 = Auswertbare mündliche Interviews der zweiten Welle<br />
<strong>in</strong> % von Zeile 1 (Interviews Welle 1)<br />
<strong>in</strong> % von Zeile 6 (Bruttostichprobe Welle 2)<br />
<strong>in</strong> % von Zeile 8 (Bere<strong>in</strong>igte Bruttostichprobe Welle 2)<br />
Quelle: Eigene Zusammenstellung aus Angaben <strong>in</strong>: <strong>in</strong>fas, 2003<br />
1.524<br />
31,5 %<br />
51,3 %<br />
61,3 %<br />
E<strong>in</strong>e nach Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil differenzierte Betrachtung der neutralen <strong>und</strong> systematischen<br />
Ausfälle lieferte folgende Ergebnisse (näheres hierzu <strong>in</strong>: <strong>in</strong>fas, 2003): Mit steigendem Alter<br />
nahm der Anteil neutraler <strong>und</strong> systematischer Ausfälle zu, hauptsächlich aufgr<strong>und</strong> des steigenden<br />
Morbiditäts- <strong>und</strong> Mortalitätsrisikos (d.h. Ausfälle wegen Todes, Erkrankung <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derung),<br />
während der Anteil verweigerter Interviews <strong>in</strong> der höchsten Altersgruppe deutlich ger<strong>in</strong>ger war als<br />
<strong>in</strong> der mittleren <strong>und</strong> jüngeren Altersgruppe. Die Ausschöpfungsquote (<strong>in</strong> Prozent des bere<strong>in</strong>igten<br />
Stichprobenansatzes) sank von 65,9 Prozent bei den Geburtsjahrgängen 1942/56 auf 52,9 Prozent<br />
bei den 1911 bis 1926 Geborenen.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Die Ausschöpfungsquote der Männer ist mit 61,8 Prozent ger<strong>in</strong>gfügig höher als die der Frauen<br />
(60,7 Prozent). Hauptgr<strong>und</strong> war die ger<strong>in</strong>gere Verweigerungsquote der Männer. Allerd<strong>in</strong>gs gab es<br />
bei den Männern aufgr<strong>und</strong> ihrer ger<strong>in</strong>geren Lebenserwartung mehr neutrale Ausfälle.<br />
Ostdeutsche weisen zwar e<strong>in</strong>en höheren Anteil neutraler Ausfälle auf als Westdeutsche, der Anteil<br />
systematischer Ausfälle <strong>und</strong> nicht auswertbarer Interviews war jedoch <strong>in</strong> Ostdeutschland ger<strong>in</strong>ger<br />
als im Westen, wodurch die Ausschöpfungsquote im Osten mit 63,9 Prozent um 4 Prozentpunkte<br />
über dem früheren B<strong>und</strong>esgebiet lag.<br />
Die Bereitschaft der Befragten, nach dem längeren mündlichen Interview (mit e<strong>in</strong>er durchschnittlichen<br />
Dauer von 82 M<strong>in</strong>uten) noch den schriftlichen Fragebogen auszufüllen, war sehr hoch. 94,4<br />
Prozent haben diesen Fragebogen („drop-off“) ausgefüllt. In 84 Prozent der Fälle liegt zudem e<strong>in</strong><br />
bearbeitetes Aufgabenblatt des kognitiven Leistungstests „Zahlen-Symbol-Test“ vor.<br />
2.3.2 Die Selektivität der Teilnahme an der Wiederholungsbefragung<br />
Insbesondere mit Blick auf die <strong>in</strong>haltliche Analyse von Veränderungen im Längsschnitt zwischen<br />
Welle 1 <strong>und</strong> Welle 2 stellt sich die Frage, ob <strong>und</strong> gegebenenfalls <strong>in</strong> welcher Weise die Teilnahmeausfälle<br />
zwischen beiden Wellen die Struktur der Panelstichprobe bee<strong>in</strong>flusst <strong>und</strong> gegenüber der<br />
Basisstichprobe verändert haben. Nicht zu erwarten, aber von Vorteil wäre, wenn die Ausfälle <strong>in</strong><br />
Bezug auf untersuchungsrelevante Merkmale zufällig erfolgt <strong>und</strong> die Panelmortalität damit zu ignorieren<br />
wäre. Ob dies der Fall ist, kann durch e<strong>in</strong>e Analyse möglicher Selektivitäten erk<strong>und</strong>et<br />
werden.<br />
E<strong>in</strong>en ersten H<strong>in</strong>weis gibt die ungewichtete Verteilung auf die zwölf Zellen der komb<strong>in</strong>ierten<br />
Schichtungsmerkmale der Basisstichprobe 1996 im Vergleich zur Panelstichprobe 2002. Bei diesem<br />
Vergleich kommen, anders als bei der Betrachtung der Ausschöpfungsquoten, auch die Unterschiede<br />
<strong>in</strong> den abgegebenen Erklärungen zur Panelbereitschaft <strong>und</strong> den neutralen Ausfällen zum<br />
Tragen.<br />
Tabelle 2.4 zeigt, dass die älteste der drei Altersgruppen <strong>in</strong> der Wiederholungsbefragung <strong>in</strong> weit<br />
ger<strong>in</strong>gerem Ausmaß vertreten ist als <strong>in</strong> der Erstbefragung (16,9 vs. 27,7 Prozent), wobei die Differenz<br />
im Westen Deutschlands größer als im Osten ist. Die mittlere Altersgruppe ist nur <strong>in</strong> den neuen<br />
Ländern stärker beteiligt als <strong>in</strong> der ersten Welle, die jüngere Altersgruppe <strong>in</strong> beiden Landesteilen<br />
deutlich häufiger, am ausgeprägtesten bei den westdeutschen Männern. Es gibt demnach e<strong>in</strong>e<br />
erkennbare Altersselektivität, die jedoch nicht l<strong>in</strong>ear verläuft <strong>und</strong> deren Stärke nach Geschlecht <strong>und</strong><br />
Landesteil variiert.<br />
Um mögliche Selektivitäten genauer erfassen zu können, wurde der E<strong>in</strong>fluss verschiedener Merkmale<br />
auf die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, dass Befragte der Welle 1 auch an Welle 2 teilgenommen haben,<br />
multivariat untersucht. Dafür eignet sich das Verfahren der b<strong>in</strong>ären logistischen Regression. Berechnet<br />
wird dabei der eigenständige E<strong>in</strong>fluss verschiedener Prädiktoren auf das Verhältnis zwischen<br />
Teilnahme- <strong>und</strong> Nicht-Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit an Welle 2. Die Stärke des E<strong>in</strong>flusses<br />
lässt sich anhand der exponierten Regressionskoeffizienten exp (ß) der e<strong>in</strong>zelnen Prädiktoren, den<br />
sogenannten „odds ratios“ ausweisen. Bei kategorialen Prädiktoren geben die „odds ratios“ an, auf<br />
welches Vielfache sich die Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit durch das Vorliegen e<strong>in</strong>er bestimmten<br />
43
44<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Prädiktorenkategorie gegenüber der Referenzkategorie unter Kontrolle der anderen Prädiktoren<br />
erhöht oder verr<strong>in</strong>gert. So bedeutet beispielsweise der <strong>in</strong> der Tabelle 2.5 ausgewiesene exponierte<br />
Regressionskoeffizient 1,474 für die Kategorie „Abitur, Hochschulreife“, dass e<strong>in</strong> solcher Schulabschluss<br />
die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Teilnahme an der zweiten Welle (gegenüber der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
der Nicht-Teilnahme) im Vergleich zu Personen, die ke<strong>in</strong>en oder nur e<strong>in</strong>en Hauptschulabschluss<br />
haben, auf das 1,474-fache, bzw. um 47,4 Prozent erhöht.<br />
Tabelle 2.4:<br />
Verteilung der Interviewfälle nach Geschlecht, Geburtsjahr <strong>und</strong> Landesteil <strong>in</strong> der Panelstichprobe<br />
2002 (<strong>und</strong> <strong>in</strong> Klammern: Verteilung <strong>in</strong> der Basisstichprobe 1996); Angaben <strong>in</strong> Prozent<br />
Landesteil Geschlecht Geburtsjahr Gesamt<br />
1942-56 1927-41 1911-26<br />
Ost männlich 7,3 (5,5) 7,6 (6,8) 3,7 (4,2) 18,6 (16,5)<br />
weiblich 7,5 (5,6) 7,4 (6,3) 2,6 (4,5) 17,6 (16,5)<br />
West<br />
zusammen 14,8 (11,1) 15,0 (13,1) 6,3 (8,7) 36,2 (33,0)<br />
männlich 15,7 (12,1) 13,6 (13,0) 5,4 (9,3) 34,7 (34,4)<br />
weiblich 13,9 (12,4) 10,0 (10,6) 5,2 (9,6) 29,1 (32,6)<br />
zusammen 29,6 (24,5) 23,6 (23,6) 10,6 (18,9) 63,8 (67,0)<br />
Gesamt 44,5 (35,5) 38,6 (36,8) 16,9 (27,7) 100 (100)<br />
Quelle Alterssurvey, ungewichtet; Abweichung zu 100 bei Summenbildungen s<strong>in</strong>d r<strong>und</strong>ungsbed<strong>in</strong>gt.<br />
Bei metrischen Prädiktoren beziehen sich die „odds ratios“ auf den Effekt bei Erhöhung der unabhängigen<br />
Variable um e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit. Zum Beispiel bedeutet das <strong>in</strong> Tabelle 2.5 ausgewiesene „odds<br />
ratio“ <strong>in</strong> Höhe von 0,992 des Altersabstands zwischen Interviewer <strong>und</strong> Interviewtem, dass Befragte,<br />
die e<strong>in</strong> Jahr älter waren als der Interviewer e<strong>in</strong>e etwas ger<strong>in</strong>gere Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
hatten als Befragte, die genauso alt wie der Interviewer waren. E<strong>in</strong>e Altersdifferenz von 10 Jahren<br />
verr<strong>in</strong>gert die Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit auf das 0,992 10 -fache (=0,923). 1<br />
Die <strong>in</strong> Tabelle 2.5 enthaltenen Prädiktoren s<strong>in</strong>d das Ergebnis e<strong>in</strong>er schrittweisen Vere<strong>in</strong>fachung<br />
e<strong>in</strong>es theoretisch <strong>und</strong> empirisch begründeten Ausgangsmodells. Zunächst wurde e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
möglicher E<strong>in</strong>flussgrößen e<strong>in</strong>bezogen, um die Gefahr des "omitted variable errors", d.h. der Nicht-<br />
Berücksichtigung signifikanter E<strong>in</strong>flussgrößen ger<strong>in</strong>g zu halten. Allerd<strong>in</strong>gs erwiesen sich viele<br />
davon als statistisch unbedeutsam <strong>und</strong> konnten schrittweise ausgeschlossen werden, da sie ke<strong>in</strong>en<br />
signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Erklärungskraft des Gesamtmodells leisteten. 2 Dies traf<br />
unter anderem auf folgende Merkmale zu: Familienstand, K<strong>in</strong>derzahl, Haushaltsgröße, Erwerbssta-<br />
1 E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Methode der logistischen Regression bietet unter anderem Backhaus, Erichson, Pl<strong>in</strong>ke & Wei-<br />
ber (2000).<br />
2 Für die statistische Analyse wurde die SPSS-Prozedur Logistic Regression e<strong>in</strong>gesetzt. Die schrittweise Reduzierung<br />
des Regressionsmodells um irrelevante Prädiktoren erfolgte anhand des Kriteriums der „log-likelihood ratio“, welches<br />
von SPSS als bestes Kriterium e<strong>in</strong>gestuft wird, um zu entscheiden, welche unabhängigen Variablen aus dem Modell<br />
entfernt werden können.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
tus, Geschlecht des Interviewers. Dem Pr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>er am Ende möglichst sparsamen Modellierung<br />
<strong>und</strong> der Beschränkung auf <strong>in</strong>haltlich deutbare E<strong>in</strong>flüsse folgend, wurde zudem mit e<strong>in</strong>er Ausnahme<br />
auf die Modellierung von Interaktionseffekten verzichtet. Diese Ausnahme betraf die Bildung der<br />
12 Stichprobenschichtungsmerkmale aus der ersten Welle <strong>in</strong> der Komb<strong>in</strong>ation aus Alter, Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Landesteil. Ebenso wurde auf die Bildung e<strong>in</strong>es komplexen Sozialschicht<strong>in</strong>dikators<br />
zugunsten des E<strong>in</strong>bezugs von E<strong>in</strong>zelmerkmalen verzichtet.<br />
Wie die Koeffizienten <strong>in</strong> Tabelle 2.5 erkennen lassen, hat die komb<strong>in</strong>ierte Ausprägung dieser drei<br />
Merkmale auch unter Kontrolle anderer Prädiktoren e<strong>in</strong> hohen signifikanten E<strong>in</strong>fluss auf die Teilnahme<br />
der Welle-1-Teilnehmer an der Wiederholungsbefragung. Die höchste Wahrsche<strong>in</strong>lichkeitssteigerung<br />
gegenüber der Referenzgruppe der westdeutschen alten Männer haben jedoch nicht die<br />
Angehörigen der jüngsten, sondern der mittleren Altersgruppe. Die höchste Wiederholungsteilnahme<br />
f<strong>in</strong>det sich bei ostdeutschen Frauen der mittleren Altersgruppe (Alter <strong>in</strong> Welle 1: 55- bis 69<br />
Jahre). Auffällig ist e<strong>in</strong> Unterschied <strong>in</strong>nerhalb der höchsten Altersgruppe: Die ostdeutschen Männer<br />
haben e<strong>in</strong>e um den Faktor 1,86 höhere Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit gegenüber den westdeutschen<br />
Männern dieses Alters. Abgesehen vom Ost-West-Unterschied konnten nur vere<strong>in</strong>zelte E<strong>in</strong>flüsse<br />
der regionalen Zugehörigkeit festgestellt werden. Bezogen auf die <strong>in</strong> der Umfrageforschung häufig<br />
angewandte BIK-Regionsgrößenklassene<strong>in</strong>teilung 3 zeigt sich e<strong>in</strong>e – gegenüber Großregionen –<br />
signifikant ger<strong>in</strong>gere Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit von Befragten <strong>in</strong> Regionen zwischen 50.000<br />
<strong>und</strong> 500.000 E<strong>in</strong>wohnern.<br />
Als signifikante sozialstrukturelle E<strong>in</strong>flüsse auf die Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit erwiesen sich das<br />
Haushaltse<strong>in</strong>kommen, der Schulabschluss <strong>und</strong> die berufliche Ausbildung. Je ger<strong>in</strong>ger das Haushaltse<strong>in</strong>kommen<br />
1996 war, desto niedriger ist (unter Kontrolle der anderen E<strong>in</strong>flüsse) die Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
an der Wiederholungsbefragung 4 . Die ger<strong>in</strong>gere Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der untersten<br />
E<strong>in</strong>kommensgruppe ist jedoch statistisch nicht signifikant. H<strong>in</strong>gegen nahmen jene Personen<br />
deutlich seltener erneut teil, die ke<strong>in</strong>e Angaben zum E<strong>in</strong>kommen gemacht haben. Offen ist dementsprechend,<br />
ob dies Befragte mit eher hohem, mittleren oder ger<strong>in</strong>gem E<strong>in</strong>kommen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>en starken<br />
Zusammenhang der Teilnahme an der Wiederholungsbefragung gibt es mit dem Ausbildungsniveau<br />
der Befragten. Gegenüber Hauptschulabsolventen <strong>und</strong> Personen ohne Schulabschluss hatten<br />
Personen mit Realschul- oder gymnasialem Schulabschluss e<strong>in</strong>e höhere Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
(<strong>in</strong> Relation zur Nichtteilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit) um 35 bis 47 Prozent. Personen mit abgeschlossener<br />
(nicht-akademischer) beruflicher Ausbildung hatten ebenfalls e<strong>in</strong>e etwas höhere Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit.<br />
Ebenso bee<strong>in</strong>flusste auch die Größe des sozialen Netzwerks die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit,<br />
an der zweiten Welle des Panels teilzunehmen. Personen, die <strong>in</strong> der Erstbefragung<br />
nur e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es Netzwerk angaben (ke<strong>in</strong>e bis maximal drei Netzwerkpersonen), haben e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere<br />
Bereitschaft zu e<strong>in</strong>er Wiederholungsbefragung als Personen mit e<strong>in</strong>em Netzwerk von vier <strong>und</strong><br />
mehr Personen. Bei fehlenden Angaben zur Netzwerkgröße war die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>er erneuten<br />
Befragungsteilnahme am ger<strong>in</strong>gsten.<br />
3 Näheres hierzu <strong>in</strong> BIK Aschpurwis+Behrens GmbH (2001) <strong>und</strong> unter http://www.bik-gmbh.de<br />
4 Als "Haushaltsnettoe<strong>in</strong>kommen" wurde e<strong>in</strong>e von Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel berechnete Variable verwendet, <strong>in</strong> der alle <strong>in</strong> Welle<br />
1 verfügbaren E<strong>in</strong>kommens<strong>in</strong>formationen im Interview <strong>und</strong> im drop-off berücksichtigt wurden (vgl. hierzu Motel-<br />
Kl<strong>in</strong>gebiel, Kapitel 4).<br />
45
Tabelle 2.5:<br />
Logistische Regression auf die Teilnahme am Interview der Welle 2 1<br />
Prädiktor (Welle-1-Merkmal) odds ratio<br />
exp (ß)<br />
46<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Prädiktor (Welle-1-Merkmal) odds ratio<br />
exp (ß)<br />
Schichtungszelle Netzwerkgröße<br />
70-85, Mann, West Referenzgr. 0 Personen 0,741*<br />
70-85, Frau, West 1,168 1 Person 0,709**<br />
70-85, Mann, Ost 1,864** 2 Personen 0,768*<br />
70-85, Frau, Ost 1,341 3 Personen 0,802*<br />
55-69, Mann, West 1,998*** 4 <strong>und</strong> mehr Personen Ref.<br />
55-69, Frau, West 1,820*** ke<strong>in</strong>e Angabe, verweigert 0,650*<br />
55-69, Mann, Ost 2,237***<br />
55-69, Frau, Ost 2,558*** Höchster Schulabschluss<br />
40-54, Mann, West 1,981*** bis Hauptschule Ref.<br />
40-54, Frau, West 1,602** Mittlere oder FHS-Reife 1,352***<br />
40-54, Mann, Ost 2,144*** Abitur, Hochschulreife 1,474**<br />
40-54, Frau, Ost 2,197***<br />
Höchster Ausbildungsabschluss<br />
Haushaltsnettoe<strong>in</strong>kommen (DM) ke<strong>in</strong> Abschluss/ke<strong>in</strong>e Angabe Ref.<br />
1 – 1399 0,747 nicht akademischer Abschluss 1,242*<br />
1400 – 1799 0,493*** abgeschlossenes Studium 1,330<br />
1800 – 2499 0,734**<br />
2500 – 3499 0,819* Subjektive Wohnsituation<br />
3500 u. höher Ref. gut, sehr gut 1,669***<br />
ke<strong>in</strong>e Angabe 0,544*** mittel Ref.<br />
Regionsgrößenklasse, aggregiert (BIK)<br />
unter 5000 E<strong>in</strong>w. 0,891 Antwortbereitschaft<br />
schlecht, sehr schlecht 1,034<br />
5000 – unter 50.000 E<strong>in</strong>w. 1,003 gut 2,202***<br />
50.000 – unter 500.000 E<strong>in</strong>w. 0,788** mittelmäßig Ref.<br />
500.000 <strong>und</strong> mehr E<strong>in</strong>w. Ref. schlecht 2 0,921<br />
Subjektive Ges<strong>und</strong>heit Fehlender Drop-off 0,593***<br />
gut, sehr gut 1,108<br />
mittel Ref. Altersabstand zum Interviewer<br />
schlecht, sehr schlecht 0,756* Alter ZP - Alter Interviewer 0,992***<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basisstichprobe des Alterssurveys, n=4.838; Pseudo-R 2 (Nagelkerkes): 0,152;<br />
Signifikanzniveau: *p
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
E<strong>in</strong>en deutlichen E<strong>in</strong>fluss auf die Teilnahme an der zweiten Welle hat die <strong>in</strong> der Erstbefragung<br />
angegebene subjektive Ges<strong>und</strong>heit. Wurde 1996 der eigene Ges<strong>und</strong>heitszustand als schlecht oder<br />
sehr schlecht e<strong>in</strong>gestuft, verr<strong>in</strong>gerte dies die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, im Jahr 2002 nochmals befragt zu<br />
werden, gegenüber Personen mit subjektiv mittlerem Ges<strong>und</strong>heitsniveau merklich. Die Teilnahme<br />
an der Wiederholungsbefragung unterliegt e<strong>in</strong>er positiven Selektion der (subjektiv) Gesünderen. Es<br />
ist anzunehmen, dass Personen mit e<strong>in</strong>er schlechten Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung vor allem aus ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
Gründen <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>es höheren Mortalitätsrisikos seltener an der Wiederholungsbefragung<br />
sechs Jahre später teilnehmen konnten. Die <strong>in</strong> den Kontaktprotokollen festgehaltenen<br />
Ausfallgründe bestätigen diese Vermutung: Die Ausfallgründe Tod, Krankheit <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derung<br />
werden bei den Nicht-Teilnehmern mit e<strong>in</strong>em bei der Erstbefragung subjektiv schlechten oder<br />
sehr schlechten Ges<strong>und</strong>heitszustand mit 49,5 Prozent weit häufiger aufgeführt als im Durchschnitt<br />
aller Ausfälle (29,1%).<br />
Als äußerst relevant erwies sich auch die subjektiv empf<strong>und</strong>ene Qualität der Wohnsituation. Wurde<br />
diese 1996 als gut oder sehr gut bewertet, erhöhte dies die Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit auf das<br />
1,6-fache gegenüber e<strong>in</strong>er mittleren E<strong>in</strong>stufung der Wohnsituation. Neben Zusammenhängen mit<br />
dem Wohlstand, den Wohnbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> der sozialen Integration e<strong>in</strong>er Person könnte der teilnahmesteigernde<br />
Effekt e<strong>in</strong>er subjektiv hohen Wohnqualität auch für e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Wegzugswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
<strong>und</strong> damit Erreichbarkeit für die Wiederholungsbefragung sprechen. Dafür spricht,<br />
dass der Ausfallgr<strong>und</strong> "Zielperson wohnt nicht mehr dort" bei den Nicht-Teilnehmern, die <strong>in</strong> Welle<br />
1 ihre Wohnsituation als schlecht oder sehr schlecht e<strong>in</strong>gestuft hatten, mit 34,6 Prozent deutlich<br />
häufiger genannt wird als im Durchschnitt aller Ausfälle (14,8%).<br />
Die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, nach der ersten auch an der zweiten Welle des Alterssurveys teilzunehmen,<br />
hängt nicht nur von Merkmalen der Befragten ab, sondern auch von Merkmalen der Interviewer<br />
<strong>und</strong> der Interviewsituation. Je jünger <strong>in</strong> Welle 1 die befragende im Vergleich zur befragten<br />
Person war, desto unwahrsche<strong>in</strong>licher wurde es, dass die <strong>in</strong>terviewte Person an der nächsten Welle<br />
teilnahm. E<strong>in</strong>e hohe Vorhersagekraft besitzt auch die vom Interviewer zu Protokoll gegebene Antwortbereitschaft<br />
der Befragten. War diese gut, erhöhte sich die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, an der Wiederholungsbefragung<br />
teilzunehmen, auf das 2,2-fache gegenüber e<strong>in</strong>er als mittelmäßig e<strong>in</strong>gestuften<br />
Antwortbereitschaft. In die gleiche Richtung weist die Tatsache, dass das Fehlen des schriftlichen<br />
Fragebogens, der auch im Jahr 1996 nach dem mündlichen Interview ausgefüllt werden sollte, mit<br />
e<strong>in</strong>er auffälligen M<strong>in</strong>derung der Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit an Welle 2 e<strong>in</strong>her geht. E<strong>in</strong> Verzicht<br />
auf das Ausfüllen des drop-offs ist e<strong>in</strong> klarer Indikator für e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Teilnahmemotivation.<br />
Dies lässt sich auch daran erkennen, dass die Hälfte der <strong>in</strong>sgesamt 804 Befragten, die nach dem<br />
mündlichen Interview ke<strong>in</strong>en schriftlichen Fragebogen mehr ausgefüllt haben, auch ke<strong>in</strong> schriftliches<br />
E<strong>in</strong>verständnis zur Speicherung ihrer Daten für den Fall e<strong>in</strong>er erneuten Befragung erteilten.<br />
Die festgestellten Bef<strong>und</strong>e zum E<strong>in</strong>fluss des Alters der Interviewer sowie der Antwortbereitschaft<br />
der Befragten auf die Teilnahme an e<strong>in</strong>er erneuten Befragung decken sich mit Ergebnissen e<strong>in</strong>er<br />
Untersuchung der Panelteilnahme von Mika (2002). Dort waren dies sogar die stärksten E<strong>in</strong>flussgrößen.<br />
Mika geht deshalb davon aus, dass e<strong>in</strong>e positiv verlaufende Kommunikation während der<br />
ersten Befragung e<strong>in</strong> entscheidendes Merkmal für die Bereitschaft der Interviewten zur Teilnahme<br />
an e<strong>in</strong>er erneuten Befragung ist. Die hier dargestellten Ergebnisse des Alterssurveys weisen ebenfalls<br />
<strong>in</strong> diese Richtung.<br />
47
48<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass – gemessen am Pseudo-R 2 nach Nagelkerkes – mit allen<br />
aufgeführten unabhängigen Variablen nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Varianzanteil des Ausfalls e<strong>in</strong>er erneuten<br />
Befragungsteilnahme erklärt werden kann. Ohne den E<strong>in</strong>bezug der Merkmale der Interviewsituation<br />
ist die Erklärungskraft noch ger<strong>in</strong>ger. Dies ist positiv zu bewerten, da es darauf h<strong>in</strong>weist, dass<br />
das Ausfallgeschehen <strong>in</strong>sgesamt als wenig systematisch anzusehen ist. Auch wenn weitere unbeobachtete,<br />
gleichwohl systematische Selektivitäten nicht auszuschließen s<strong>in</strong>d, halten sich die beobachteten<br />
Verzerrungen <strong>in</strong> Grenzen <strong>und</strong> können durch geeignete Verfahren der Datengewichtung<br />
abgemildert werden.<br />
2.3.3 Datengewichtung 5<br />
Ausgangspunkt der Bestimmung e<strong>in</strong>es Gewichts zum Ausgleich systematischer E<strong>in</strong>flüsse auf das<br />
Ausfallgeschehen zwischen Welle 1 <strong>und</strong> Welle 2 bildet das logistische Regressionsmodell, dessen<br />
Ergebnisse <strong>in</strong> Tabelle 2.5 dargestellt wurden. Unter E<strong>in</strong>satz der Regressionskoeffizienten <strong>und</strong> der<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ausprägungen der unabhängigen Variablen wurde für jede befragte Person der Welle<br />
1 der Koeffizient p W 2 als vorhergesagte bed<strong>in</strong>gte Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit an Welle 2 berechnet.<br />
6 Das Gewicht gew W 2 zur Kompensation systematischer Ausfälle entspricht dem Kehrwert<br />
der vorhergesagten Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit, dividiert durch das arithmetische Mittel dieses<br />
Gewichts bei allen 1524 Teilnehmern der Welle 2.<br />
( 1)<br />
gew =<br />
W 2<br />
1/<br />
x<br />
p<br />
W 2<br />
( 1/<br />
pW 2)<br />
Mittels der Division durch das arithmetische Mittel wird erreicht, dass das Gewicht ke<strong>in</strong>e Hochrechnung<br />
auf die ursprünglichen 4838 Fälle bewirkt, sondern nur e<strong>in</strong>e relative Gewichtung jedes<br />
E<strong>in</strong>zelfalls <strong>in</strong>nerhalb der 1524 Teilnehmer an Welle 2, ohne dass sich bei Anwendung des Gewichts<br />
die Gesamtfallzahl erhöht.<br />
Hauptzweck der Bildung e<strong>in</strong>es Gewichtungsfaktors für die Paneldaten ist der Ausgleich systematischer<br />
Ausfälle zwischen beiden Wellen. Zudem wurde aber für jeden Fall der Basisstichprobe 1996<br />
– <strong>und</strong> damit auch für jeden Panelteilnehmer – bereits e<strong>in</strong> Designgewicht gew W1<br />
zum Ausgleich der<br />
disproportionalen Stichprobenziehung der Welle 1 gebildet, so dass viele Ergebnisse der Welle 1<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage der gewichteten Daten der Basisstichprobe publiziert wurden.<br />
5 Wir danken Dr. habil. Mart<strong>in</strong> Spieß von der SOEP-Gruppe des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung für se<strong>in</strong>e<br />
kompetente Beratung zur Frage der Gewichtung der Panelstichprobe.<br />
6 Dabei wurden auch jene Personen als Nicht-Teilnehmer <strong>in</strong> die Teilnahme-Vorhersage mite<strong>in</strong>bezogen, bei denen bekannt<br />
war, dass ihre Nichtteilnahme mortalitätsbed<strong>in</strong>gt ist. Dies erfolgte, da für e<strong>in</strong>e weitere, unbekannte Zahl von Personen<br />
davon auszugehen ist, dass ihre Nicht-Teilnahme ebenfalls darauf begründet dies, dass diese Personen <strong>in</strong> der<br />
Zwischenzeit verstorben s<strong>in</strong>d. Um zusätzliche Verzerrungen zu vermeiden, zählen somit zu den Nicht-Teilnehmern<br />
auch bekannt wie unbekannt Verstorbene.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurde zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse das nach Formel (1) entwickelte<br />
Ausfallgewicht der Panelstichprobe gew W 2 mit dem vorliegenden Designgewicht gew W1<br />
multiplikativ zum Gesamtgewicht gew W1*<br />
W 2 verknüpft.<br />
( 2)<br />
gew W1<br />
* W 2 = gewW<br />
1 * gewW<br />
2<br />
Für die Teilnahme am Interview <strong>und</strong> an der schriftlichen Befragung der Welle 2 s<strong>in</strong>d getrennte<br />
Gewichte berechnet worden. Dabei wurden für die Schätzung der Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeiten<br />
am drop-off die gleichen Prädiktoren e<strong>in</strong>gesetzt wie für die Teilnahme am Interview. 7 Da über 94<br />
Prozent der Interviewten <strong>in</strong> Welle 2 auch den drop-off ausgefüllt haben, unterschieden sich die<br />
Regressionskoeffizienten <strong>in</strong> ihrer Stärke nur ger<strong>in</strong>gfügig. Im Ergebnis reicht die Bandbreite der<br />
Werte des Gewichtungsfaktors gew W1*<br />
W 2 für das Interview von 0,142 bis 5,435 <strong>und</strong> für den dropoff<br />
von 0,135 bis 6,184, bei e<strong>in</strong>em jeweiligen arithmetischen Mittelwert (AM) von „1“. Bandbreite<br />
<strong>und</strong> Streuung (SD) s<strong>in</strong>d beim re<strong>in</strong>en Ausfallgewicht etwas ger<strong>in</strong>ger als beim Gesamtgewicht.<br />
Tabelle 2.6:<br />
Gewichtung der Panelstichprobe<br />
Interview:<br />
Gewicht zum Ausgleich systematischer<br />
Panelausfälle (gewW2)<br />
Gesamtgewicht (gewW1*W2) 1<br />
M<strong>in</strong>. Max. AM SD<br />
0,469 6,850 1 0,547<br />
0,142 5,435 1 0,628<br />
Drop-off:<br />
Gewicht zum Ausgleich systematischer<br />
Panelausfälle (gewW2)<br />
0,466 6,922 1 0,551<br />
Gesamtgewicht (gewW1*W2) 0,135 6,184 1 0,646<br />
1 vgl. Formel (1)<br />
Um e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druck von den Auswirkungen der Gewichtung auf die Merkmalsverteilungen zu erhalten,<br />
wird nachfolgend die relative Häufigkeit e<strong>in</strong>iger Merkmale des mündlichen Interviews der<br />
ersten Welle für die 1.524 Panelteilnehmer ungewichtet <strong>und</strong> – mit dem Gesamtgewicht – gewichtet<br />
gegenübergestellt. Ergänzt wird dies durch e<strong>in</strong>en Vergleich mit den gewichteten Daten der Basisstichprobe<br />
von 1996 (siehe Tabelle 2.7). Die Darstellungen machen deutlich, dass die gewichtete<br />
Panelstichprobe <strong>in</strong> wesentlichen Verteilungskriterien vergleichbar ist mit jenen der gewichteten<br />
Basisstichprobe.<br />
7 Bei der Modellierung der logistischen Regression war im H<strong>in</strong>blick auf die Berechnung e<strong>in</strong>es darauf basierenden Ausfallgewichts<br />
zudem darauf geachtet worden, die Bildung von ger<strong>in</strong>g besetzten Extremkategorien zu vermeiden, die den<br />
Gewichtungsfaktor besonders stark nach oben oder unten treiben könnten.<br />
49
50<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Bezogen auf die Merkmale Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil wird durch die Gewichtung sowohl<br />
die disproportionale Ziehung der Basisstichprobe als auch – teilweise – der Ausfall zwischen den<br />
beiden Wellen ausgeglichen. Die Verteilung der gewichteten Panelstichprobe weicht daher weniger<br />
von der Basisstichprobe ab als die der ungewichteten Panelstichprobe. Jedoch können <strong>und</strong> sollen<br />
die überdurchschnittlichen Ausfälle der obersten Altersgruppe durch die Gewichtung nur teilweise<br />
kompensiert werden. Sie sollen nicht vollständig kompensiert werden, da schwerkranke, nichtbefragbare<br />
Hochaltrige nicht durch gesündere, befragbare Hochaltrige repräsentiert werden können.<br />
Das im Gesamtgewicht enthaltene Ausfallgewicht zielt statt dessen – um beim gleichen Beispiel<br />
zu bleiben – auf e<strong>in</strong>e verbesserte Repräsentanz der im Jahr 2002 Hochaltrigen mit starken<br />
ges<strong>und</strong>heitlichen Bee<strong>in</strong>trächtigungen, die nicht an der Wiederholungsbefragung teilnehmen konnten<br />
oder wollten, durch jene Hochaltrigen mit starken ges<strong>und</strong>heitlichen Bee<strong>in</strong>trächtigungen, die an<br />
dieser Wiederholungsbefragung teilgenommen haben.<br />
Durch die Gewichtung nähert sich zudem der Anteil der Erwerbstätigen <strong>in</strong> der Panelstichprobe<br />
stärker ihrem Anteil <strong>in</strong> der Basisstichprobe <strong>und</strong> es steigt der Anteil der sonstigen Nicht-<br />
Erwerbstätigen. Die Veränderungen <strong>in</strong> den Anteilen der schulischen <strong>und</strong> beruflichen Abschlüsse<br />
kompensiert teilweise den Mittelschicht-Bias der Panelteilnahme. Bezogen auf das Haushaltse<strong>in</strong>kommen<br />
führt die Gewichtung hauptsächlich zu e<strong>in</strong>em höheren Anteil derjenigen, die ke<strong>in</strong>e Angaben<br />
zur Höhe ihres E<strong>in</strong>kommens gemacht hatten sowie – <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gem Umfang – der Personen mit<br />
niedrigem E<strong>in</strong>kommen. Durch die Gewichtung s<strong>in</strong>kt der Anteil der Personen, die <strong>in</strong> den 12 Monaten<br />
vor der Ersterhebung materielle Hilfen an andere gegeben hatten; er nähert sich dadurch der<br />
Quote <strong>in</strong> der Basisstichprobe.<br />
Bezogen auf den Familienstand, die Haushaltsgröße <strong>und</strong> die K<strong>in</strong>derzahl führt die Gewichtung zu<br />
e<strong>in</strong>er besseren Anpassung an die Anteile <strong>in</strong> der Basisstichprobe. Auffällig ist die Anteilsverschiebung<br />
bei der Netzwerkgröße von den Personen mit 4 <strong>und</strong> mehr zu den mit weniger Netzwerkangehörigen.<br />
Diese Veränderungen <strong>in</strong> der Merkmalsverteilung durch die Gewichtung führen jeweils zu<br />
e<strong>in</strong>er besseren Anpassung an die Ausgangsverteilung <strong>in</strong> der Basisstichprobe.<br />
Die Überrepräsentanz der Personen <strong>in</strong> Welle 2 mit subjektiv gutem <strong>und</strong> sehr gutem Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
wird durch die Gewichtung beseitigt, ebenso die von Personen mit subjektiv guter <strong>und</strong> sehr<br />
guter Wohnsituation <strong>und</strong> derjenigen, die ihren Lebensstandard als gut oder sehr gut bewerten. Ke<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>fluss hat die Gewichtung auf den Partizipations<strong>in</strong>dikator der Mitgliedschaft <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er – nicht<br />
seniorenspezifischen – Organisation oder Gruppe.<br />
Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei Gewichtung die Struktur der Panelstichprobe (Welle<br />
1) mehr der Ausgangsstruktur <strong>in</strong> Welle 1 entspricht. Verzerrungen durch systematische Ausfälle<br />
zwischen den beiden Wellen werden <strong>in</strong> etwa kompensiert <strong>und</strong> bei H<strong>in</strong>zunahme des Designgewichts<br />
auch die disproportionale Ziehung der Basisstichprobe ausgeglichen. Die Verwendung gewichteter<br />
Daten der Panelstichprobe sollte jedoch allgeme<strong>in</strong>en deskriptiven Darstellungen <strong>und</strong> Vergleichen<br />
vorbehalten se<strong>in</strong>. Bei multivariaten Analysen kann darauf verzichtet werden. Dort sollten statt dessen<br />
Merkmale mit starkem systematischen E<strong>in</strong>fluss auf die Teilnahmewahrsche<strong>in</strong>lichkeit an der<br />
zweiten Welle sowie die Merkmale, nach denen die Basisstichprobe geschichtet wurde, zur statistischen<br />
Kontrolle <strong>in</strong> die jeweiligen Analysen e<strong>in</strong>bezogen werden.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Tabelle 2.7:<br />
Ungewichtete <strong>und</strong> gewichtete Merkmalsverteilung <strong>in</strong> der Panelstichprobe 1996 im Vergleich zur<br />
Basisstichprobe 1996 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Merkmal (Ausprägung im Jahr 1996 zum<br />
Zeitpunkt der Erstbefragung)<br />
Panelstichprobe<br />
(ungewichtet)<br />
N=1524<br />
Panelstichprobe<br />
(gewichtet) 1<br />
N=1524<br />
Basisstichprobe<br />
(gewichtet) 2<br />
N=4838<br />
Geschlecht:<br />
Männlich 53,3 49,2 48,0<br />
Weiblich 46,7 50,8 52,0<br />
Landesteil:<br />
Früheres B<strong>und</strong>esgebiet 63,8 80,1 80,9<br />
Neue Länder <strong>und</strong> Berl<strong>in</strong>-Ost 36,2 19,9 19,1<br />
Alter <strong>in</strong> Jahren:<br />
40 – 54 44,5 47,6 45,6<br />
55 – 69 38,6 36,5 36,4<br />
70 – 85 16,9 16,0 18,0<br />
Erwerbsstatus:<br />
Erwerbstätig (ohne Erw. im Ruhestand) 49,3 47,8 46,9<br />
Im Ruhestand (<strong>in</strong>kl. Erw. im Ruhestand) 32,2 29,6 31,4<br />
Sonstige Nicht-Erwerbstätige 18,4 22,6 21,7<br />
Höchster Schulabschluss:<br />
Bis Hauptschule 53,3 59,8 62,1<br />
Mittlere oder FHS-Reife 29,5 26,8 25,0<br />
Abitur, Hochschulreife 17,2 13,4 12,9<br />
Höchster Berufsausbildungsabschluss:<br />
Nicht-Akademische Ausbildung 68,7 68,0 67,7<br />
Abgeschlossenes Studium 20,3 15,4 14,5<br />
Ke<strong>in</strong> Abschluss, ke<strong>in</strong>e Angabe 11,0 16,6 17,8<br />
Haushaltse<strong>in</strong>kommen (<strong>in</strong> DM):<br />
1 – 1799 5,2 6,9 7,7<br />
1800 – 2499 10,7 10,7 11,4<br />
2500 – 3499 22,0 21,4 20,2<br />
3500 <strong>und</strong> höher 54,9 49,1 47,9<br />
Ke<strong>in</strong>e Angabe 7,3 12,0 12,8<br />
Familienstand:<br />
Ledig 4,0 4,7 5,6<br />
Verheiratet Zusammenlebend 79,8 76,8 75,4<br />
Getrenntlebend, geschieden 7,3 8,0 7,4<br />
Verwitwet 8,9 10,5 11,5<br />
51
Tabelle 2.7 (fortgesetzt; Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Merkmal (Ausprägung im Jahr 1996 zum Zeitpunkt<br />
der Erstbefragung)<br />
52<br />
Panelstichprobe<br />
(ungewichtet)<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Panelstichprobe<br />
(gewichtet) 1<br />
Basisstichprobe<br />
(gewichtet) 2<br />
Haushaltsgröße (Personenzahl):<br />
1 12,5 14,7 16,2<br />
2 49,0 45,5 44,4<br />
3 18,5 19,5 19,1<br />
4 <strong>und</strong> mehr 20,0 20,3 20,4<br />
K<strong>in</strong>derzahl:<br />
0 11,2 13,0 13,1<br />
1 23,8 23,0 22,1<br />
2 39,0 37,9 38,5<br />
3 16,9 16,5 16,3<br />
4 <strong>und</strong> mehr 9,2 9,5 9,9<br />
Netzwerkgröße (Personenzahl):<br />
0 6,0 7,8 7,5<br />
1 6,0 7,1 7,6<br />
2 10,7 13,1 12,0<br />
3 13,8 14,9 14,6<br />
4 <strong>und</strong> mehr 61,0 53,9 54,4<br />
Ke<strong>in</strong>e Angabe 2,5 3,3 3,8<br />
Mitgliedschaft <strong>in</strong> nicht-seniorenspezifischer<br />
Gruppe oder Organisation:<br />
Ja 53,5 53,8 48,9<br />
Ne<strong>in</strong>, k.A. 46,5 46,2 51,1<br />
Gegebene materielle Hilfe an andere<br />
<strong>in</strong> den letzten 12 Monaten:<br />
Ja 36,5 33,7 30,7<br />
Ne<strong>in</strong>, weiß nicht, k.A. 63,5 66,3 69,3<br />
Subjektive Ges<strong>und</strong>heit:<br />
Gut, sehr gut 60,4 56,8 56,4<br />
Mittel 32,0 33,0 32,3<br />
Schlecht, sehr schlecht 7,6 10,2 11,3<br />
Subjektive Wohnsituation:<br />
Gut, sehr gut 87,9 84,1 84,2<br />
Mittel 9,3 11,7 12,1<br />
Schlecht, sehr schlecht 2,9 4,2 3,7<br />
Subjektive Bewertung d. Lebensstandards:<br />
Gut, sehr gut 69,2 65,6 64,8<br />
Mittel 27,4 29,8 30,6<br />
Schlecht, sehr schlecht 3,4 4,6 4,7<br />
1 Gewichtet mit dem Gesamtgewicht gewW1*W2; 2 Gewichtet mit dem Designgewicht gewW1.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
2.4 Die Replikationsstichprobe<br />
2.4.1 Stichprobenbeschreibung <strong>und</strong> -ausschöpfung<br />
Das Stichprobendesign der Replikationsstichprobe 2002 folgt weitgehend dem der Basisstichprobe<br />
von 1996. Die Replikationsstichprobe ist erneut e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>wohnermeldeamtsstichprobe <strong>und</strong> zwar <strong>in</strong><br />
den selben Geme<strong>in</strong>den wie 1996 8 . Gr<strong>und</strong>gesamtheit ist wiederum die 40- bis 85-jährige Bevölkerung<br />
<strong>in</strong> Privathaushalten. Da zusätzlich e<strong>in</strong>e ungeschichtete Ausländerstichprobe geplant war, wurde<br />
vom <strong>in</strong>fas-Institut bei den Geme<strong>in</strong>den zunächst e<strong>in</strong> Adresspool von ca. 60.000 E<strong>in</strong>wohnern im<br />
Alter von 40 bis 85 Jahren gezogen, dessen Größe sich an der als notwendig erwarteten Adressenzahl<br />
zur Realisierung e<strong>in</strong>er Ausländerstichprobe von ca. 900 Interviews mit Nicht-Deutschen orientierte.<br />
Dieser per Zufallsauswahl gezogene Adresspool wurde anhand der von den Geme<strong>in</strong>den mitgelieferten<br />
Informationen zur Staatsangehörigkeit der Personen unterteilt <strong>in</strong> den Pool der Deutschen<br />
<strong>und</strong> den der Nicht-Deutschen. Die Ziehung der Bruttostichprobe für die Replikationsstichprobe<br />
erfolgte aus dem Pool der Deutschen 9 entsprechend der beabsichtigten disproportionalen<br />
Stratifizierung (Verteilung der drei Altersgruppen zu je e<strong>in</strong>em Drittel, gleiche Anteile von<br />
Männern <strong>und</strong> Frauen, Verteilung Ost/West: zwei Drittel zu e<strong>in</strong> Drittel). Da angestrebt wurde, <strong>in</strong>sgesamt<br />
ca. 3.000 Interviews zu realisieren, folgten auf die Zufallsziehung der ersten E<strong>in</strong>satztranche,<br />
für e<strong>in</strong>zelne der zwölf Ziehungszellen bis zu zwei weitere Zufallsziehungen, nachdem sich zeigte,<br />
dass die angestrebte Fallzahl mit der ersten Tranche nicht erreicht werden konnte 10 . Insgesamt ergab<br />
sich e<strong>in</strong>e Bruttostichprobe von 8.826 Zielpersonen. Ohne die neutralen Ausfälle der an der mitgeteilten<br />
Adresse nicht erreichbaren oder im Heim lebenden Zielpersonen beträgt die bere<strong>in</strong>igte Bruttostichprobe<br />
8.164 Personen (Tabelle 2.8).<br />
Ingesamt konnten 5.011 der 8.164 Zielpersonen nicht befragt werden, 124 Interviews erwiesen sich<br />
als nicht auswertbar. Hauptausfallgr<strong>und</strong> war die Verweigerung der Teilnahme durch die Zielperson<br />
oder durch die Kontaktperson des Haushalts. R<strong>und</strong> 600 Personen konnten wegen dauerhafter Erkrankung<br />
oder starker Beh<strong>in</strong>derung nicht an der Untersuchung teilnehmen.<br />
Erst nach Erhalt der ersten Interviews stellte sich heraus, dass die altersbezogene Auswahl der<br />
Replikationsstichprobe ger<strong>in</strong>gfügig von der altersbezogenen Auswahl der Basisstichprobe abwich.<br />
Während <strong>in</strong> die Basiserhebung Personen e<strong>in</strong>bezogen wurden, die im Laufe des Erhebungsjahrs,<br />
jedoch nicht unbed<strong>in</strong>gt vor dem Interviewzeitpunkt den Term<strong>in</strong> ihres 40. bis 85. Geburtstages hatten,<br />
waren für die Replikationsstichprobe (<strong>und</strong> die Ausländerstichprobe) Personen ausgewählt worden,<br />
die im Jahr vor der Erhebung das 40. bis 85. Lebensjahr vollendet hatten, also mit diesem<br />
vollendeten Alter <strong>in</strong> das Erhebungsjahr g<strong>in</strong>gen. Konkret bedeutete dies, dass für die Erhebung 1996<br />
die Geburtsjahrgänge 1911 bis 1956, für die Erhebung 2002 die Geburtsjahrgänge 1916 bis 1961<br />
8 Aufgr<strong>und</strong> von Geme<strong>in</strong>dereformen <strong>in</strong> Ostdeutschland waren drei ehemals eigenständige Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> größere, ebenfalls<br />
<strong>in</strong> der Stichprobe enthaltene Orte e<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>det worden. Die Zahl der Geme<strong>in</strong>den verr<strong>in</strong>gerte sich dadurch von<br />
290 auf 287.<br />
9 Nach Auskunft von <strong>in</strong>fas mussten nur 235 Personen (0,4%) vor dieser Ziehung aus der Gr<strong>und</strong>gesamtheit der r<strong>und</strong><br />
57.100 Deutschen entfernt werden, da sie bereits an der ersten Welle teilgenommen hatten.<br />
10 Für weitere Details der Stichprobenziehung siehe <strong>in</strong>fas (2003).<br />
53
54<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
gezogen wurden. Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
wurde daher entschieden, die 1962 Geborenen <strong>in</strong> die Untersuchung aufzunehmen<br />
<strong>und</strong> die 19 Befragten des Jahrgangs 1916 aus dem Sample zu entfernen. Es kam daher zur zusätzlichen<br />
Ziehung von Angehörigen des Geburtsjahrgangs 1962 <strong>und</strong> der Realisierung von 74 Interviews<br />
mit Deutschen dieses Jahrgangs. 11 Insgesamt liegen 3.084 Interviews mit Angehörigen der Geburtsjahrgänge<br />
1917 bis 1962 vor. 2,4 Prozent davon entfallen auf den jüngsten Jahrgang. Von den Interviewten<br />
haben 2.787 (=90,4%) auch den schriftlichen Fragebogen ausgefüllt.<br />
Im bivariaten Vergleich der beiden Geschlechter, der drei Altersgruppen <strong>und</strong> der beiden Landesteile<br />
kam es zu e<strong>in</strong>er leicht unterdurchschnittlichen Ausschöpfung bei den Frauen, den Älteren <strong>und</strong><br />
westdeutschen Befragten. Der Ost-West-Unterschied erwies sich jedoch <strong>in</strong> der logistischen Regressionsanalyse<br />
der Befragungsteilnahme als statistisch nicht signifikant.<br />
Tabelle 2.8:<br />
Ausschöpfung der Replikationsstichprobe<br />
Zeile Population Anzahl<br />
1 = Bruttostichprobe (Jahrgänge 1916-1961) 8.826<br />
2 – Neutrale Ausfälle<br />
- 662<br />
darunter:<br />
ZP verstorben: 82<br />
ZP unbekannt: 504<br />
ZP im Heim: 39<br />
ZP/HH spricht nicht deutsch: 19<br />
3 = Bere<strong>in</strong>igter Stichprobenansatz 8.164<br />
4 - Systematische Ausfälle<br />
- 5.011<br />
darunter:<br />
Ke<strong>in</strong> Kontakt zum Haushalt: 421<br />
ZP verweigert: 3.436<br />
ZP dauerhaft krank: 440<br />
ZP stark beh<strong>in</strong>dert: 158<br />
Interview durch Dritte verh<strong>in</strong>dert: 513<br />
5 = Durchgeführte mündliche Interviews 3.153<br />
6 – Nicht auswertbare Interviews - 124<br />
7 = Auswertbare mündl. Interviews (Jahrgänge 1916-1961)<br />
3.029<br />
<strong>in</strong> % von Zeile 3 (Bere<strong>in</strong>igte Bruttostichprobe)<br />
37,1%<br />
8 + Nacherhobene Interviews beim Jahrgang 1962 + 74<br />
9 – Ausgeschlossene Interviews des Jahrgangs 1916 1 - 19<br />
10 = Auswertbare mündl. Interviews (Jahrgänge 1917-1962) 3.084<br />
Quelle: <strong>in</strong>fas 2003; 1 nicht zur Zielgruppe gehörende 86-Jährige<br />
11 Näheres hierzu <strong>in</strong> <strong>in</strong>fas (2003).
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
2.4.2 Datengewichtung<br />
Zum Ausgleich der disproportionalen Ziehung der Replikationsstichprobe wurde von <strong>in</strong>fas – wie <strong>in</strong><br />
Welle 1 – e<strong>in</strong>e Gewichtungsvariable zur Designgewichtung der Daten gebildet. Die vorgenommene<br />
Gewichtung besteht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Randanpassung der Stichprobe an die relative Häufigkeit der 12 Merkmalskomb<strong>in</strong>ationen<br />
aus Altersgruppe, Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil an die Verteilung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Referenzstatistik.<br />
Dieser Gewichtungsrahmen ist – ebenfalls wie <strong>in</strong> Welle 1 – die Statistik der Bevölkerungsfortschreibung<br />
des Statistischen B<strong>und</strong>esamts. Basis ist der Bevölkerungsstand am 31.12.2001.<br />
Die Geschlechts- <strong>und</strong> Altersgruppenverteilung sowie die Anteile ost- <strong>und</strong> westdeutscher Personen<br />
<strong>in</strong> der Replikationsstichprobe entspricht daher bei Anwendung der Gewichtungsfaktoren exakt der<br />
Verteilung <strong>in</strong> der deutschen Bevölkerung am Jahresende 2001. Es wurde e<strong>in</strong>e getrennte Gewichtung<br />
für mündliche Interviews <strong>und</strong> schriftliche Fragebögen erstellt. Die Bandbreite des Gewichtungsfaktors<br />
für das Interview reicht von 0,288 bis 1,578 mit dem Mittelwert 1 <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Standardabweichung<br />
von 0,384.<br />
Tabelle 2.9:<br />
Designgewichtung (Interview) der Replikationsstichprobe<br />
Landesteil Geschlecht<br />
40-54 55-69 70-85<br />
West<br />
männlich<br />
weiblich<br />
1,578<br />
1,370<br />
1,242<br />
1,320<br />
0,602<br />
1,038<br />
Ost<br />
Altersgruppe 1<br />
männlich 0,715 0,636 0,288<br />
weiblich 0,776 0,727 0,494<br />
Quelle: <strong>in</strong>fas; 1 Alter = Erhebungsjahr m<strong>in</strong>us Geburtsjahr<br />
Der E<strong>in</strong>satz der Gewichtung ist vor allem für allgeme<strong>in</strong>e deskriptive Darstellungen <strong>und</strong> Aussagen<br />
notwendig, da die Gesamtergebnisse sonst zu stark vom überproportionalen E<strong>in</strong>bezug der Personen<br />
zwischen 70 <strong>und</strong> 85 Jahren sowie der ostdeutschen Befragten bee<strong>in</strong>flusst werden. Bei Analysen, <strong>in</strong><br />
denen e<strong>in</strong>e Differenzierung nach diesen drei Stratifizierungsmerkmalen erfolgt, kann auf e<strong>in</strong>e Gewichtung<br />
der Replikationsstichprobe verzichtet werden.<br />
55
2.5 Die Ausländerstichprobe<br />
2.5.1 Stichprobenbeschreibung <strong>und</strong> –ausschöpfung<br />
56<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Als Neuerung gegenüber Welle 1 enthält der Alterssurvey des Jahres 2002 neben der Panel- <strong>und</strong><br />
der Replikationsstichprobe auch e<strong>in</strong>e Stichprobe Nicht-Deutscher, die im weiteren der E<strong>in</strong>fachheit<br />
halber als Ausländerstichprobe bezeichnet wird. Angestrebt wurde e<strong>in</strong>e Nettostichprobe von ca.<br />
900 Interviews mit <strong>in</strong> Privathaushalten lebenden Personen im Alter von 40 bis 85 Jahren, die nicht<br />
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Da für die Befragung die gleichen deutschsprachigen<br />
Fragebögen wie für die Replikationsstichprobe e<strong>in</strong>gesetzt wurden, war die Voraussetzung e<strong>in</strong>er<br />
erfolgreichen Teilnahme das ausreichende Beherrschen der deutschen Sprache oder die Unterstützung<br />
durch e<strong>in</strong>e Person, die des Deutschen ausreichend mächtig waren <strong>und</strong> Übersetzungshilfe leisten<br />
konnte. Damit umfasste die Gr<strong>und</strong>gesamtheit die 40- bis 85-jährigen Nicht-Deutschen <strong>in</strong> Privathaushalten<br />
mit ausreichenden Deutsch-Kenntnissen.<br />
Die Auswahl der Bruttostichprobe erfolgte durch e<strong>in</strong>e Zufallsziehung aus den Registern der E<strong>in</strong>wohnermeldeämter<br />
jener Geme<strong>in</strong>den, die auch die Adressen für die Replikationsstichprobe lieferten.<br />
Wie bereits beschrieben, erfolgte die Adressziehung <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den aus Kostengründen als<br />
e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Zufallsauswahl der 40- bis 85-Jährigen. Die Gesamtzahl war so hoch angesetzt<br />
worden, dass der Erwartungswert der dar<strong>in</strong> enthaltenen Zahl der Nicht-Deutschen ausreichen sollte,<br />
die angestrebte Zahl von ca. 900 Interviews zu realisieren. Tatsächlich enthielt der Adressenpool<br />
3.255 Personen, die nach Angaben der E<strong>in</strong>wohnermeldeämter Nicht-Deutsche waren. Diese 3.255<br />
Personen bildeten die Bruttostichprobe des Ausländer-Sample.<br />
Wie erwartet waren viele davon unter der angegebenen Adresse nicht erreichbar. Es ist bekannt,<br />
dass die Daten der E<strong>in</strong>wohnermeldeämter bei Ausländern <strong>in</strong> höherem Maße als bei Deutschen nicht<br />
auf dem aktuellen Stand s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> dafür s<strong>in</strong>d unterbliebene Abmeldungen bei Rückkehr <strong>in</strong><br />
das Herkunftsland. E<strong>in</strong> weiterer Gr<strong>und</strong> für die im Vergleich zu den Deutschen häufigere Nichterreichbarkeit<br />
älterer Ausländer dürfte die Pendelmigration mit abwechselnden längeren Aufenthalten<br />
im In- <strong>und</strong> Ausland se<strong>in</strong>. 17,1 Prozent der Zielpersonen der Ausländerstichprobe konnten nicht<br />
befragt werden, da sie unter der angegebenen Adresse nicht bekannt waren (vgl. Tabelle 2.10).<br />
Zum Vergleich: In der Replikationsstichprobe betrug dieser Anteil nur 5,7 Prozent (vgl. Tabelle<br />
2.8). E<strong>in</strong> weiterer zahlenmäßig bedeutsamer Ausfallgr<strong>und</strong> waren mangelnde Deutschkenntnisse: 10<br />
Prozent der 3.255 Zielpersonen der Ausländerstichprobe konnten explizit mit der Begründung nicht<br />
befragt werden, dass sie ke<strong>in</strong> deutsch verstehen bzw. sprechen. Diese wurden als neutrale Ausfälle<br />
e<strong>in</strong>gestuft. Unter Abzug aller neutralen Ausfälle verr<strong>in</strong>gerte sich die Bruttostichprobe auf e<strong>in</strong>en<br />
bere<strong>in</strong>igten Ansatz von 2.343 Personen. Davon konnten 628 <strong>in</strong>terviewt werden, von denen 40 jedoch<br />
nicht auswertbar waren. Insgesamt konnten damit trotz e<strong>in</strong>es hohen Bruttoansatzes nur 588<br />
auswertbare Interviews realisiert werden. Dies s<strong>in</strong>d deutlich weniger als geplant <strong>und</strong> nur 25,1 Prozent<br />
der bere<strong>in</strong>igten Bruttostichprobe.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Im Vergleich zur Replikationsstichprobe ist der <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe hohe Anteil nicht realisierbarer<br />
Interviews wegen nicht erreichter Kontaktherstellung (trotz mehrmonatiger Feldzeit) auffällig<br />
(31,5 vs. 5,2% der bere<strong>in</strong>igten Bruttostichprobe). H<strong>in</strong>gegen liegt der Verweigereranteil mit<br />
32,7 Prozent bei den Ausländern unter dem entsprechenden Anteil der Deutschen (42,1 Prozent).<br />
Auch Ausfälle wegen dauerhafter Krankheit oder starker Beh<strong>in</strong>derung kommen <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe<br />
prozentual seltener vor als <strong>in</strong> der Replikationsstichprobe (2,2 vs. 7,3%), was auf den<br />
ger<strong>in</strong>geren Anteil Hochaltriger zurückzuführen se<strong>in</strong> dürfte.<br />
Tabelle 2.10:<br />
Ausschöpfung der Ausländerstichprobe<br />
Zeile Population Anzahl<br />
1 = Bruttostichprobe (Jahrgänge 1916-1961) 3.255<br />
2 – Neutrale Ausfälle<br />
- 912<br />
darunter:<br />
Zielperson verstorben: 15<br />
Zielperson unbekannt: 559<br />
Zielperson im Heim: 9<br />
Zielperson/Haushalt spricht nicht deutsch: 326<br />
3 = Bere<strong>in</strong>igter Stichprobenansatz 2.343<br />
4 – Systematische Ausfälle<br />
- 1.715<br />
darunter:<br />
Ke<strong>in</strong> Kontakt zum Haushalt: 738<br />
Zielperson verweigert: 767<br />
Zielperson dauerhaft krank: 43<br />
Zielperson stark beh<strong>in</strong>dert: 9<br />
Interview durch Dritte verh<strong>in</strong>dert: 149<br />
5 = Durchgeführte mündliche Interviews 628<br />
6 – Nicht auswertbare Interviews - 40<br />
7 = Auswertbare mündl. Interviews (Jahrgänge 1916-1961)<br />
588<br />
<strong>in</strong> % von Zeile 3 (Bere<strong>in</strong>igte Bruttostichprobe)<br />
25,1%<br />
8 + Nacherhobene Interviews beim Jahrgang 1962 6<br />
9 – Ausgeschlossenes Interview des Jahrgangs 1916 1 - 1<br />
10 – Ausgeschlossene Interviews Deutscher 2<br />
7<br />
11 = Auswertbare mündl. Interviews (Jahrgänge 1917-1962) 586<br />
Quelle: <strong>in</strong>fas 2003<br />
1<br />
nicht zur Zielgruppe gehörende 86-jährige Person<br />
2<br />
Personen, die anhand ihrer Interviewangaben mit hoher Plausibilität Deutsche ohne ausländische Herkunft s<strong>in</strong>d<br />
(vgl. Kapitel 2.5.2)<br />
57
58<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Wegen der gleichen Geburtsjahrvorgaben für die Adressziehung wie bei der Replikationsstichprobe<br />
(siehe Kapitel 2.4.1), wurde auch für die Ausländerstichprobe e<strong>in</strong>e Nachziehung <strong>und</strong> Erhebung bei<br />
den 1962 Geborenen durchgeführt. Es wurden sechs Interviews nacherhoben <strong>und</strong> das Interview<br />
e<strong>in</strong>er 1916 geborenen Person gestrichen. Zudem wurden sieben nachträglich wegen erheblicher<br />
Zweifel an der Zugehörigkeit zur Stichprobe der Nicht-Deutschen ausgeschlossen (siehe Kapitel<br />
2.5.2). Damit stehen für die Auswertung der Ausländerstichprobe <strong>in</strong>sgesamt 586 mündliche Interviews<br />
zur Verfügung. Von diesen 586 Personen haben 484 Befragte (82,6 Prozent) auch den<br />
schriftlichen Fragebogen ausgefüllt.<br />
E<strong>in</strong>e zusätzlich erfolgte, nach Altersgruppen, Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil differenzierte, Betrachtung<br />
der neutralen <strong>und</strong> systematischen Ausfälle <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe lässt folgendes erkennen:<br />
• Die neutralen Ausfälle kamen bei Männern per Saldo etwas häufiger vor als bei Frauen, da die<br />
Adressen der Männer seltener gültig waren, während Frauen häufiger wegen der Sprachprobleme<br />
nicht <strong>in</strong>terviewt werden konnten. Der Gesamtanteil systematischer Ausfälle – bezogen<br />
auf die bere<strong>in</strong>igte Bruttostichprobe – ist bei beiden Geschlechtern h<strong>in</strong>gegen nahezu gleich<br />
hoch.<br />
• Von den drei Altersgruppen wies die mittlere Gruppe der 55- bis 69-Jährigen den höchsten<br />
Anteil neutraler Ausfälle auf, vor allem wegen größerer Adressprobleme <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em überdurchschnittlichen<br />
Anteil nicht deutsch sprechender Zielpersonen. Auch der Anteil systematischer<br />
Ausfälle war <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe etwas höher. Am ger<strong>in</strong>gsten war er – trotz mehr<br />
Ausfällen aufgr<strong>und</strong> von Krankheit <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derung – <strong>in</strong> der obersten Altersgruppe. Gr<strong>und</strong> dafür<br />
ist die ger<strong>in</strong>gere Verweigerungsquote der 70- bis 85-Jährigen.<br />
• In Ostdeutschland war aufgr<strong>und</strong> der größeren Adressprobleme <strong>und</strong> von anteilig mehr Fällen<br />
mit nicht ausreichenden Sprachkenntnissen der Anteil neutraler Ausfälle deutlich höher als im<br />
Westen. Systematische Ausfälle kamen – bezogen auf die um neutrale Ausfälle bere<strong>in</strong>igte<br />
Stichprobe – <strong>in</strong> den neuen Ländern h<strong>in</strong>gegen seltener vor als <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern.<br />
Ohne die nacherhobenen <strong>und</strong> nachträglich entfernten Interviews ergaben sich die nachfolgend <strong>in</strong><br />
Tabelle 2.11 dargestellten Ausschöpfungsquoten.<br />
Dabei zeigt sich, dass es kaum Unterschiede <strong>in</strong> der Ausschöpfung gibt, vergleicht man Personen<br />
unterschiedlicher Altersgruppen, Geschlechter bzw. Regionen (Ost/West). H<strong>in</strong>sichtlich der unbere<strong>in</strong>igten<br />
Bruttostichprobe (Ergebnisspalte 1) gibt es e<strong>in</strong>e leichte Unterrepräsentanz der mittleren<br />
Altersgruppe (55-69 Jahre). Auffällige regionale Unterschiede zeigen sich <strong>in</strong> der bere<strong>in</strong>igten Bruttostichprobe.<br />
Hier lag die Ausschöpfungsquote der ostdeutschen Länder deutlich höher als jene der<br />
westdeutschen B<strong>und</strong>esländer.<br />
Für die Ausländerstichprobe wurde ke<strong>in</strong>e Gewichtungsvariable gebildet, da die Ziehung dieser<br />
Stichprobe im Unterschied zur Replikationsstichprobe nicht disproportional erfolgte.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Tabelle 2.11: Ausschöpfung der Ausländerstichprobe nach Geschlecht, Alter <strong>und</strong> Landesteil<br />
Population Unbere<strong>in</strong>igte<br />
Bruttostichprobe<br />
Ausschöpfungsquote <strong>in</strong> Prozent 1<br />
Bere<strong>in</strong>igte<br />
Bruttostichprobe<br />
Geschlecht<br />
Männer 17,9 25,2<br />
Frauen 18,3 25,0<br />
Alter<br />
40 bis 54 Jahre 18,5 25,0<br />
55 bis 69 Jahre 17,1 25,0<br />
70 bis 85 Jahre 18,6 26,2<br />
Landesteil<br />
Neue Länder <strong>und</strong> Berl<strong>in</strong>-Ost 18,9 34,2<br />
Alte Länder <strong>und</strong> Berl<strong>in</strong>-West 18,0 24,6<br />
Gesamt 18,1 25,1<br />
Quelle: <strong>in</strong>fas 2003; eigene Berechnungen; 1 ohne Berücksichtigung der Nacherhebung.<br />
2.5.2 Zum Ausländerstatus der Befragten<br />
Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, wurde die Gesamtmenge der von den E<strong>in</strong>wohnermeldeämtern<br />
gezogenen Adressen anhand der von den Ämtern mitgelieferten Informationen zur Staatsangehörigkeit<br />
<strong>in</strong> die beiden Adressgruppen der Deutschen (als Basis für die Replikationsstichprobe) <strong>und</strong><br />
der Nicht-Deutschen (als Basis für die Ausländerstichprobe) unterteilt. Kriterium für die Ziehung<br />
<strong>in</strong> der Ausländerstichprobe war das Fehlen e<strong>in</strong>er deutschen Staatsangehörigkeit (zum Zeitpunkt der<br />
Adressziehung).<br />
Im mittleren Teil des Interviews wurden alle Befragte auch nach ihren aktuellen Staatsangehörigkeiten<br />
befragt. 129 der 593 Personen (e<strong>in</strong>schließlich der danach ausgeschlossenen Fälle) haben<br />
dabei angegeben, im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit zu se<strong>in</strong>, darunter 36 Personen, die<br />
nach eigener Aussage noch e<strong>in</strong>e andere Staatsangehörigkeit besitzen. Diese festgestellten Diskrepanzen<br />
zwischen der Stichprobenzuordnung <strong>und</strong> den Selbstangaben können verschiedene Ursachen<br />
haben. Es könnten die übermittelten Angaben der Meldeämter fehlerbehaftet oder zum Zeitpunkt<br />
des Interviews wegen zwischenzeitlich erfolgter E<strong>in</strong>bürgerungen veraltet gewesen se<strong>in</strong>. Es können<br />
aber auch Fehler bei der Beantwortung der Frage vorliegen. Beispielsweise kann rechtlich die deutsche<br />
Staatsangehörigkeit fehlen, aber die befragte Person sich nach ihrem subjektiven Verständnis<br />
als Deutsche verstehen. Welche Ursache im E<strong>in</strong>zelfall vorliegt, kann im Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> nicht festgestellt<br />
werden. 12 Durch das H<strong>in</strong>zuziehen weiterer Angaben der Befragten lassen sich jedoch Plausibi-<br />
12 E<strong>in</strong>e Nachfrage bei den Befragten war aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Der Datenschutz verbietet<br />
es entsprechend auch, den E<strong>in</strong>wohnermeldeämtern Informationen über Angaben der Interviewten zu geben, auch nicht<br />
zur Klärung von Diskrepanzen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er möglichen Beseitigung von Fehlern im Register.<br />
59
60<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
litätsannahmen für die Gültigkeit der im Interview angegebenen deutschen Staatsangehörigkeit<br />
f<strong>in</strong>den. Der Großteil der 129 Fälle mit angegebener deutscher Staatsangehörigkeit wurde e<strong>in</strong>er<br />
E<strong>in</strong>zelfallprüfung unterzogen. Anhand der Angaben zur Teilnahme an der B<strong>und</strong>estagswahl 1998,<br />
der Nationalität der Eltern, dem Land der Geburt <strong>und</strong> des Aufwachsens der Befragten <strong>und</strong> – bei<br />
E<strong>in</strong>gewanderten – dem Jahr ihres Zuzugs nach Deutschland wurden die <strong>in</strong> Tabelle 2.12 aufgeführten<br />
Gruppen unterschieden. Nach genauer Prüfung wurden die sieben Angehörigen der Gruppe 1<br />
nachträglich aus der Stichprobe entfernt, da sie mit hoher Plausibilität von Geburt an oder seit vielen<br />
Jahren Deutsche s<strong>in</strong>d.<br />
Tabelle 2.12:<br />
Ausgewählte Zusatzangaben von 129 Personen der Ausländerstichprobe mit angegebener<br />
deutscher Staatsangehörigkeit*<br />
Gruppe Teilnahme an<br />
B<strong>und</strong>estagswahl<br />
1998?<br />
M<strong>in</strong>d. e<strong>in</strong><br />
deutsches<br />
Elternteil?<br />
Nur dtsch.<br />
Staatsangehörigkeit?<br />
In Dtschld.<br />
oder früheren<br />
Ostgebieten<br />
geboren?<br />
In Dtschld./<br />
früheren Ostgebietenaufgewachsen?<br />
Seit wann <strong>in</strong><br />
Dtschld. (wenn<br />
woanders<br />
geboren)<br />
1 ja ja ja ja ja – 7<br />
2 ja ja ja ja ne<strong>in</strong> m<strong>in</strong>d. 10 J. 1<br />
3 ja ja ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> m<strong>in</strong>d. 10 J. 10<br />
4 ja ja ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> unter 10 J. 3<br />
5 ja ja ne<strong>in</strong> ja – – 2<br />
6 ja ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> m<strong>in</strong>d. 10 J. 2<br />
7 ja ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> unter 10 J. 1<br />
8 ja ne<strong>in</strong> ja ja – – 3<br />
9 ja ne<strong>in</strong> ja ne<strong>in</strong> ja m<strong>in</strong>d. 10 J. 1<br />
10 ja ne<strong>in</strong> ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> m<strong>in</strong>d. 10 J. 11<br />
11 ja ne<strong>in</strong> ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> unter 10 J. 6<br />
12 ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> ja – 1<br />
13 ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> – 8<br />
14 ne<strong>in</strong> ja ja ja – – 7<br />
15 ne<strong>in</strong> ja ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> – 11<br />
16 ne<strong>in</strong> ja ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> – 3<br />
17 ne<strong>in</strong> ne<strong>in</strong> – – – – 52<br />
* Die Kategorie "ne<strong>in</strong>" kann vere<strong>in</strong>zelt auch Fälle mit fehlenden Angaben enthalten<br />
– = ke<strong>in</strong>e weitere Differenzierung nach diesem Merkmal vorgenommen<br />
Fallzahl
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
Die Anzahl der auswertbaren Interviews der Ausländerstichprobe verr<strong>in</strong>gerte sich dadurch, wie<br />
bereits berichtet, auf 586 Befragte. Die restlichen Fälle mit abweichender Selbstangabe zur Staatsangehörigkeit<br />
gegenüber den Angaben der E<strong>in</strong>wohnermeldeämter, die die Gr<strong>und</strong>lage der Stichprobenzuordnung<br />
bildeten, wurden trotz dieser Inkonsistenz <strong>in</strong> der Stichprobe der Nicht-Deutschen<br />
(Ausländerstichprobe) belassen.<br />
Wie e<strong>in</strong> Vergleich der Verteilung e<strong>in</strong>iger soziodemographischer Merkmale der Ausländerstichprobe<br />
mit den auf Ausländer bezogenen Daten des Mikrozensus 2002 zeigt, stimmen diese Merkmale<br />
trotz des Problems der Staatsangehörigkeit <strong>und</strong> der Teilnahmeselektivität aufgr<strong>und</strong> der erforderlichen<br />
deutschen Sprachkenntnisse erstaunlich gut übere<strong>in</strong> (Tabelle 2.13).<br />
Tabelle 2.13:<br />
Verteilung ausgewählter Merkmale <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe des Alterssurveys <strong>und</strong> im Mikrozensus<br />
2002 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Ausländerstichprobe<br />
Alterssurvey 2002<br />
Ausländer im<br />
Mikrozensus 2002 1<br />
Alter:<br />
40 – 54 59,2 59,2<br />
55 – 69 32,1 34,7<br />
70 – 85 (bzw. 70+) 8,7 6,1 2<br />
Geschlecht:<br />
männlich 52,0 54,0<br />
weiblich 48,0 46,0<br />
Landesteil:<br />
West 93,7 97,4<br />
Ost 6,3 2,6<br />
Familienstand:<br />
ledig 5,8 6,3<br />
verheiratet 78,0 80,4<br />
geschieden, verwitwet 16,2 13,4<br />
Erwerbsstatus:<br />
erwerbstätig 51,4 50,1<br />
nicht erwerbstätig 48,6 49,9<br />
Haushaltsgröße:<br />
1 Person 14,7 15,5 3<br />
2 <strong>und</strong> mehr 85,3 84,5 3<br />
Quellen: Ausländerstichprobe des Alterssurveys, 2002 (N=586); Deutsches Zentrum für Altersfragen – Gerostat;<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2003a, S.109; 2003b, S.47)<br />
1 2 3<br />
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung; 70 <strong>und</strong> mehr Jahre alt; Haushalte mit deutscher Bezugsperson<br />
61
62<br />
Heribert Engstler, Susanne Wurm<br />
Die hohe Übere<strong>in</strong>stimmung zwischen den Ausländerstichproben von Alterssurvey <strong>und</strong> Mikrozensus<br />
kann zum Teil daran liegen, dass die Mikrozensus-Befragungen ebenfalls <strong>in</strong> deutscher Sprache<br />
erfolgen, so dass auch hier e<strong>in</strong>e Selektion zugunsten von Personen mit deutschen Sprachkenntnissen<br />
vorliegt. Die Teilnahme an diesen Befragungen ist im Gegensatz zum Alterssurvey allerd<strong>in</strong>gs<br />
Pflicht. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Ausländerstichprobe des Alterssurveys<br />
die nichtdeutsche Bevölkerung im Alter von 40 bis 85 Jahren recht gut repräsentiert, sieht<br />
man von sprachbed<strong>in</strong>gten Selektivitäten ab, die auch beim Mikrozensus bestehen.
Kapitel 2: Datengr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methodik<br />
2.6 Literatur<br />
Backhaus, K., Erichson, B., Pl<strong>in</strong>ke, W., & Weiber, R. (2000). Multivariate Analysemethoden. E<strong>in</strong>e<br />
anwendungsorientierte E<strong>in</strong>führung (9 ed.). Berl<strong>in</strong> u.a.: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
BIK Aschpurwis+Behrens GmbH. (2001). BIK-Regionen. Methodenbeschreibung zur Aktualisierung<br />
2000. Hamburg: BIK Aschpurwis+Behrens GmbH (http://www.bik-gmbh.de).<br />
Bode, C., Westerhof, G., & Dittmann-Kohli, F. (2001). Methoden. In F. Dittmann-Kohli & C. Bode<br />
& G. Westerhof (Eds.), Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven (pp. 37-76).<br />
Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., & Künem<strong>und</strong>, H. (1995). Lebenszusammenhänge, Selbstkonzepte<br />
<strong>und</strong> Lebensentwürfe. Die Konzeption des Deutschen Alters-Surveys (Forschungsbericht<br />
47). Berl<strong>in</strong>: Forschungsgruppe Altern <strong>und</strong> Lebenslauf (Fall).<br />
Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A., Ste<strong>in</strong>leitner, C., & Westerhof, G. (1997).<br />
Lebenszusammenhänge, Selbst- <strong>und</strong> Lebenskonzeptionen - Erhebungsdesign <strong>und</strong> Instrumente<br />
des Alters-Survey (Forschungsbericht 61). Berl<strong>in</strong>: Forschungsgruppe Altern <strong>und</strong> Lebenslauf<br />
(Fall).<br />
Folste<strong>in</strong>, M. F., Folste<strong>in</strong>, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "M<strong>in</strong>i Mental State": A practical method<br />
for grad<strong>in</strong>g the cognitive state of patients for the cl<strong>in</strong>ician. Journal of Psychiatric Research,<br />
12, 189-198.<br />
Habich, R., & Zapf, W. (1994). Gesellschaftliche Dauerbeobachtung - Wohlfahrtssurveys: Instrument<br />
der Sozialberichterstattung. In R. e. a. Hauser (Ed.), Mikroanalytische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
der Gesellschaftspolitik (Vol. 2, pp. 13-37). Berl<strong>in</strong>: Akademie-Verlag.<br />
<strong>in</strong>fas. (2003). Alterssurvey - Die zweite Lebenshälfte. Methodenbericht zur Erhebung der zweiten<br />
Welle 2002. Bonn: <strong>in</strong>fas - Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH.<br />
Kohli, M. (2000). Der Alters-Survey als Instrument wissenschaftlicher Beobachtung. In M. Kohli<br />
(Ed.), Die zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des<br />
Alters-Survey (pp. 10-32). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M., & Tesch-Römer, C. (2003). Der Alters-Survey. ZA-Information(52), 146-156.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2000). Datengr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> Methoden. In M. Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die<br />
zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-<br />
Survey (pp. 33-40). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Mika, T. (2002). Wer nimmt teil an Panel-Befragungen? Untersuchung über die Bed<strong>in</strong>gungen der<br />
erfolgreichen Kontaktierung für sozialwissenschaftliche Untersuchungen. ZUMA Nachrichten,<br />
26(51), 38-48.<br />
Mohler, P. P., Koch, A., & Gabler, S. (2003). Alles Zufall oder? E<strong>in</strong> Diskussionsbeitrag zur Qualität<br />
von face to face-Umfragen <strong>in</strong> Deutschland. ZUMA-Nachrichten, 27(53), 10-15.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (2003a). Haushalte <strong>und</strong> Familien 2002. Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (2003b). Stand <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong> der Erwerbstätigkeit 2002. Wiesbaden:<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt.<br />
Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A., & Engstler, H. (2002). Alterssozialberichterstattung im<br />
Längsschnitt: Die zweite Welle des Alterssurveys. In A. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel & U. Kelle<br />
(Eds.), Perspektiven der empirischen Alter(n)ssoziologie (pp. 155-189). Opladen:<br />
Leske+Budrich.<br />
63
3. Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
<strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Heribert Engstler<br />
3.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
In den vergangenen Jahren hat das öffentliche <strong>und</strong> wissenschaftliche Interesse an den älteren<br />
Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmern <strong>und</strong> der Beendigung des Erwerbslebens stark zugenommen.<br />
In der Diskussion geht es dabei oft um die Frage nach e<strong>in</strong>em längeren Verbleib im<br />
Erwerbsleben <strong>und</strong> wie dieser herbei zu führen sei. Die wichtigsten dabei angesprochenen H<strong>in</strong>tergründe<br />
<strong>und</strong> Begründungen für dieses Ziel s<strong>in</strong>d die demografisch bed<strong>in</strong>gten Veränderungen<br />
des Arbeitskräftepotenzials, die F<strong>in</strong>anzierbarkeit des gesetzlichen Rentensystems, vor allem die<br />
Stabilisierung des Beitragssatzes, die betriebliche <strong>und</strong> volkswirtschaftliche Nutzung der „Humanressourcen“<br />
älterer Arbeitnehmer, die Sicherung der Innovations- <strong>und</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Wirtschaft mit alternden Belegschaften, der Grad der Lebensstandardsicherung im Alter,<br />
die Generationengerechtigkeit, die Leistungsfähigkeit älterer Menschen, das Verbot der<br />
Diskrim<strong>in</strong>ierung aufgr<strong>und</strong> des Alters <strong>und</strong> das nachberufliche Engagement als gesellschaftliche<br />
Ressource (vgl. Bäcker & Naegele, 1995; Barkholdt, 2001; Behrend, 2002; Behrens, Morschhäuser,<br />
Viebrok & Zimmermann, 1999; Bellmann, Hilpert, Kistler & Wahse, 2003; Clemens,<br />
2001; Glover & Bran<strong>in</strong>e, 2002; Gussone, Huber, Morschhäuser & Petrenz, 1999; Lehr, 1990;<br />
Pack, Buck, Kistler & Mendius, 1999; Rothkirch, 2000; Verband Deutscher Rentenversicherungsträger,<br />
2004; Wachtler, Franke & Balcke, 1997).<br />
In die Kritik geraten ist <strong>in</strong>sbesondere das hohe Ausmaß der Frühausgliederungen aus dem Erwerbsleben<br />
<strong>und</strong> der Frühverrentungen. In den letzten Dekaden des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts hatte sich<br />
im früheren B<strong>und</strong>esgebiet der Übergangszeitpunkt <strong>in</strong> den Ruhestand biografisch immer weiter<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> jüngeres Alter verlagert (vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, 2003;<br />
Koller, 2001; Behrend, 2001; Jacobs & Kohli, 1990). Im Verb<strong>und</strong> mit der steigenden Lebenserwartung<br />
führte dies zu e<strong>in</strong>er historisch e<strong>in</strong>maligen Verlängerung der nachberuflichen Lebensphase,<br />
damit auch zur Verlängerung der Rentenlaufzeiten <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er steigenden Zahl von Rentenempfängern.<br />
E<strong>in</strong>geläutet wurde der Trend zum frühen Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand im früheren<br />
B<strong>und</strong>esgebiet unter anderem durch die E<strong>in</strong>führung der flexiblen Altersgrenze 1973. Lange<br />
Zeit war der Trend zur Frühausgliederung aus dem Erwerbsleben von e<strong>in</strong>em korporatistischen<br />
Konsens zwischen Staat, Arbeitgeberverbänden <strong>und</strong> Gewerkschaften getragen worden. Dieser<br />
bestand dar<strong>in</strong>, nach Auslaufen des lange Währenden Wirtschaftsaufschwungs der Nachkriegsdekaden<br />
<strong>und</strong> dem Zwang zur Neustrukturierung der Volkswirtschaft den strukturell begründeten<br />
Anstieg der Arbeitslosigkeit durch das Mittel der sozial verträglichen Frühverrentung zu mildern<br />
(vgl. George, 2000; Oswald, 2001; Teipen, 2003). Der Trend zum frühen Übergang <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand erfuhr e<strong>in</strong>e weitere Steigerung <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>in</strong> den Jahren nach der Wiedervere<strong>in</strong>igung.<br />
B<strong>in</strong>nen kurzer Zeit wurden zur Entlastung des Arbeitsmarkts die meisten Beschäftig-<br />
65
66<br />
Heribert Engstler<br />
ten im Alter ab 57 Jahren, viele schon ab 55 Jahren <strong>in</strong> den Vorruhestand mit anschließendem<br />
Rentenbezug geschickt (vgl. Kretschmar & Wolf-Valerius, 1996; Ernst, 1996). Die Frühverrentungen<br />
erfuhren <strong>in</strong> dieser Zeit nochmals e<strong>in</strong>en Höhepunkt, obwohl die Diskussion zur Verlängerung<br />
der Lebensarbeitszeit – vor allem aus Gründen der F<strong>in</strong>anzierung des gesetzlichen Rentensystems<br />
– schon massiv e<strong>in</strong>gesetzt <strong>und</strong> der Staat unter anderem mit dem Rentenreformgesetz<br />
1992 bereits Maßnahmen zur Senkung der Anreize für e<strong>in</strong>e frühe Verrentung getroffen hatte.<br />
Denn die frühzeitige Verabschiedung aus dem Erwerbsleben belastete <strong>in</strong> starkem Maße die Arbeitslosenversicherung<br />
<strong>und</strong> die Rentenkassen. In der Folge stellte der Staat den korporatistischen<br />
Frühverrentungskonsens immer mehr <strong>in</strong>frage <strong>und</strong> erließ – wie <strong>in</strong> vielen OECD-Ländern<br />
(vgl. OECD, 2000) – Gesetze, die den Trend zur Frühausgliederung stoppen oder zum<strong>in</strong>dest die<br />
f<strong>in</strong>anziellen Folgen e<strong>in</strong>er frühen Verrentung für die Rentenkasse mildern sollen. 1 Zentrale Maßnahmen<br />
hierzu waren <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d die Anhebung der Altersgrenzen, das E<strong>in</strong>führen von Abschlägen<br />
bei frühzeitigem Rentenbeg<strong>in</strong>n, die Verschärfung von Anspruchsvoraussetzungen <strong>und</strong> das Senken<br />
des Rentenniveaus, hauptsächlich durch Änderungen an der Rentenformel <strong>und</strong> der E<strong>in</strong>schränkung<br />
ausbildungsbezogener Anwartschaften (e<strong>in</strong>en Überblick zur Anhebung der Altersgrenzen<br />
gibt Tabelle A3.1 im Anhang).<br />
Auch wurde versucht, durch Änderungen im Arbeitsförderungsrecht die Anreize für e<strong>in</strong>e Frühausgliederung<br />
zu Lasten der Arbeitslosenversicherung zu verr<strong>in</strong>gern (u.a. durch die Abschaffung<br />
des Altersübergangsgeldes, die Verschärfung der Sperrzeit bei Aufhebung von Arbeitsverträgen,<br />
die Anrechnung von Abf<strong>in</strong>dungen auf den Anspruch von Arbeitslosenunterstützung, die<br />
Erstattungspflicht durch den Ex-Arbeitgeber sowie die Förderung der Qualifizierung <strong>und</strong> E<strong>in</strong>stellung<br />
älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer). Allerd<strong>in</strong>gs dienen nicht alle sozialrechtlichen<br />
Reformmaßnahmen der letzten Jahre konsequent dem Ziel e<strong>in</strong>es längeren Verbleibs im<br />
Erwerbsleben. Teilweise wurden auch Regelungen erlassen oder geplant, die Anreize für e<strong>in</strong>e<br />
Beibehaltung der Frühausgliederung <strong>und</strong> Frühverrentung enthalten, beispielsweise die Ausgestaltung<br />
<strong>und</strong> Verlängerung der Förderung von Altersteilzeit oder das erst im Vermittlungsausschuss<br />
gestoppte Brückengeld für ältere Arbeitslose.<br />
Mit Blick auf die demografische <strong>Entwicklung</strong> (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2003a), Erkenntnissen<br />
<strong>und</strong> Befürchtungen über negative betriebs- <strong>und</strong> volkswirtschaftliche Folgen der Frühausgliederung<br />
älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer (siehe z.B. Bull<strong>in</strong>ger, 2002; Köchl<strong>in</strong>g, Astor,<br />
Fröhner & Hartmann, 2000) <strong>und</strong> den Anstieg des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung<br />
(vgl. die regelmäßigen Berichte der B<strong>und</strong>esregierung zur Rentenversicherung, zuletzt:<br />
B<strong>und</strong>esregierung, 2003) traten auch die Arbeitgeberverbände für e<strong>in</strong>e Verlängerung der Lebensarbeitszeit<br />
e<strong>in</strong> (B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 2000). Schließlich<br />
schlossen sich nach e<strong>in</strong>igem H<strong>in</strong> <strong>und</strong> Her 2 auch die Gewerkschaften dieser neuen Maxime an,<br />
unter Betonung des Ziels des Beschäftigungserhalts für ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer<br />
<strong>und</strong> der Lebensstandardsicherung im Alter. Inzwischen hat <strong>in</strong> Deutschland – wie <strong>in</strong><br />
vielen anderen europäischen Ländern – e<strong>in</strong> Paradigmenwechsel von der Frühverrentung zum<br />
längeren Verbleib im Erwerbsleben stattgef<strong>und</strong>en, unterstützt durch zahlreiche Neuregelungen<br />
1 E<strong>in</strong>e Übersicht der wichtigsten Gesetzesreformen hierzu seit 1996 f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Engstler (2004, S. 26ff.).<br />
2 Zu er<strong>in</strong>nern ist beispielsweise an die gescheiterte IG-Metall-Forderung der Rente mit 60.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
im Arbeits- <strong>und</strong> Sozialrecht. Se<strong>in</strong>en prom<strong>in</strong>enten Ausdruck fand dieser Paradigmenwechsel im<br />
Bündnis für Arbeit (Bündnis für Arbeit, 2001).<br />
Auf EU-Ebene mündete diese Neuorientierung <strong>in</strong> die vom Europäischen Rat <strong>in</strong> Stockholm,<br />
2001 festgelegte Zielsetzung, bis zum Jahr 2010 <strong>in</strong> möglichst jedem EU-Mitgliedsland zu erreichen,<br />
dass die Hälfte der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig ist (Europäischer Rat, 2001). Für<br />
Deutschland wird zu dieser Zielerreichung e<strong>in</strong> Anstieg der Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-<br />
Jährigen um 10 Prozentpunkte notwendig se<strong>in</strong>, d.h. e<strong>in</strong>e Erhöhung um e<strong>in</strong> Viertel des jetzigen<br />
Niveaus (siehe Abbildung 3.1).<br />
Abbildung 3.1:<br />
Erwerbstätigenquote der Männer <strong>und</strong> Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren, 1991-2003<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
%<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
47,9<br />
39,4<br />
31,0<br />
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003<br />
Männer Frauen Insgesamt<br />
Quellen: Deutsches Zentrum für Altersfragen – Gerostat; Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2004<br />
Daten: Statistisches B<strong>und</strong>esamt, Mikrozensus<br />
Unterstützt wird der vom Staat <strong>und</strong> den Tarifparteien vorangetriebene Paradigmenwechsel zum<br />
längeren Verbleib im Erwerbsleben durch zahlreiche Wortmeldungen aus der Wissenschaft <strong>und</strong><br />
den Medien (für e<strong>in</strong>en Überblick über die <strong>Entwicklung</strong> der wissenschaftlichen Beschäftigung<br />
mit diesem Thema <strong>in</strong> Deutschland siehe Herfurth, Kohli & Zimmermann (2003) <strong>und</strong> Gravalas<br />
(1999). Fast alle neueren Sachverständigengutachten <strong>und</strong> Kommissionsberichte zu den Themen<br />
Wirtschaft, Arbeit, Demographie <strong>und</strong> soziale Sicherheit enthalten Empfehlungen zur Verlängerung<br />
der Lebensarbeitszeit <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en späteren Rentene<strong>in</strong>tritt. Zu nennen s<strong>in</strong>d vor allem die Berichte<br />
der B<strong>und</strong>estags-Enquete-Kommission "Demografischer <strong>Wandel</strong>", der Kommission "Moderne<br />
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" (Hartz-Kommission), der Kommission "Nachhaltigkeit<br />
<strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzierung der Sozialen Sicherungssysteme" (Rürup-Kommission), der Kommission<br />
"Soziale Sicherheit" (Herzog-Kommission), der Sachverständigenkommission für den 3.<br />
Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung <strong>und</strong> mehrere Berichte des Sachverständigenrats zur Begutachtung<br />
der gesamtwirtschaftlichen Lage. E<strong>in</strong> Großteil der Vorschläge der Rürup-Kommission<br />
(B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung, 2003) wurde vom Gesetzgeber aufgegriffen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> das im Juni 2004 verabschiedete Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz<br />
<strong>in</strong>tegriert, unter anderem die Anhebung der Altersgrenze für den frühestmöglichen Beg<strong>in</strong>n der<br />
67
68<br />
Heribert Engstler<br />
vorzeitigen Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit sowie die weitere Senkung<br />
des Rentenniveaus durch die E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Nachhaltigkeitsfaktors <strong>in</strong> die Rentenformel<br />
(B<strong>und</strong>estagsdrucksache 15/2149 <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit B<strong>und</strong>esratsdrucksache 191/04).<br />
Während sich der Staat <strong>und</strong> die Tarifparteien also weitgehend e<strong>in</strong>ig dar<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d, die Lebensarbeitszeit<br />
zu verlängern, <strong>und</strong> sich hauptsächlich über das Tempo, die Ansatzpunkte <strong>und</strong> die geeigneten<br />
Interventionen ause<strong>in</strong>andersetzen, wird die Ausgliederung älterer Arbeitnehmer deutlich<br />
vor Erreichen der Regelaltersgrenze <strong>in</strong> den Betrieben weiterh<strong>in</strong> als Mittel zur Umstrukturierung<br />
<strong>und</strong> Verr<strong>in</strong>gerung des Personalbestands angewandt. So fiel die Erwerbstätigenquote der<br />
55- bis 64-jährigen Männer auch zwischen 1995 <strong>und</strong> 2000 noch um 2 Prozentpunkte. Da der<br />
Anteil erwerbstätiger Frauen dieses Alters allerd<strong>in</strong>gs seit 1993 steigt <strong>und</strong> auch bei den Männern<br />
seit 2000 e<strong>in</strong> leichter Anstieg zu beobachten ist (Abbildung 3.1), sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e Trendwende e<strong>in</strong>gesetzt<br />
zu haben oder zum<strong>in</strong>dest der bisherige Trend s<strong>in</strong>kender Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte<br />
gestoppt zu se<strong>in</strong>. Zwischen 2001 <strong>und</strong> 2003 stieg der Anteil Erwerbstätiger unter den<br />
55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong>sgesamt – trotz der anhaltenden Beschäftigungskrise – um 1,6 Prozentpunkte<br />
auf 39,4 Prozent während die Erwerbstätigenquote der 15- bis 54-Jährigen um 1,8 Prozentpunkte<br />
(auf 71,0%) zurückg<strong>in</strong>g. In der Literatur wird allerd<strong>in</strong>gs darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass<br />
der momentane leichte Anstieg durch die außergewöhnlich schwache Besetzung der um 1945<br />
geborenen Jahrgänge begünstigt wurde (Kistler, 2004). Ob dieser Anstieg den Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>er<br />
längerfristigen Zunahme der Erwerbsbeteiligung Älterer markiert, wird sich erst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Jahren<br />
zeigen, wenn die stärker besetzten Kohorten der Babyboomer <strong>in</strong> das höhere Erwerbsalter<br />
kommen. E<strong>in</strong> demografisch bed<strong>in</strong>gter Rückgang des gesamten Erwerbspersonenpotenzials wird<br />
erst für die Zeit nach 2015 erwartet (Bellmann, Hilpert, Kistler & Wahse, 2003).<br />
3.2 Fragestellung <strong>und</strong> Methodik<br />
3.2.1 Fragestellung<br />
Auswirkung des Abbaus von Anreizen zum frühen Ausstieg aus dem Erwerbsleben<br />
In der wissenschaftlichen Diskussion zur Erklärung der gesellschaftlichen <strong>Entwicklung</strong> des<br />
Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand <strong>und</strong> des <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Verhaltens überwiegen ökonomische <strong>und</strong><br />
soziologische Ansätze. Die ökonomischen Theorien lassen sich dabei danach unterscheiden, wie<br />
sehr sie das Arbeitsangebot oder die Arbeitsnachfrage als verantwortlich für das Arbeitsmarktgeschehen<br />
<strong>und</strong> somit auch für die Beteiligung Älterer am Erwerbsleben <strong>und</strong> den Übergang <strong>in</strong><br />
den Ruhestand erachten. Die mikroökonomische Forschung zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben<br />
<strong>in</strong> Deutschland stützt sich vorwiegend auf Arbeitsangebotstheorien (vgl. Schmidt,<br />
1995; Viebrok, 1997; Börsch-Supan, Kohnz & Schnabel, 2002; S<strong>in</strong>g, 2003). Diese gehen entsprechend<br />
des neoklassischen Ma<strong>in</strong>streams davon aus, dass sich die Art <strong>und</strong> der Umfang der<br />
Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie aus dem Willen e<strong>in</strong>es Individuums bestimmt, se<strong>in</strong>e Arbeitskraft<br />
anzubieten. Im Allgeme<strong>in</strong>en wird dabei unterstellt, dass die Menschen gut <strong>in</strong>formierte,<br />
rational handelnde <strong>und</strong> nutzenmaximierende Individuen mit weitgehender Wahlfreiheit s<strong>in</strong>d. Sie<br />
erstreben für sich e<strong>in</strong> Optimum an E<strong>in</strong>kommen (als Voraussetzung für Konsum) <strong>und</strong> Freizeit
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
<strong>und</strong> bieten ihre Arbeitskraft – <strong>in</strong>nerhalb natürlicher Grenzen – <strong>in</strong> dem zeitlichen Ausmaß an, das<br />
zur Erreichung dieses Ziels notwendig ersche<strong>in</strong>t. Wichtig ist, dass <strong>in</strong> neueren angebotsorientierten<br />
Ansätzen das Pr<strong>in</strong>zip der Nutzenmaximierung als e<strong>in</strong>e Orientierung am Gesamtnutzen über<br />
die Lebenszeit h<strong>in</strong>weg angenommen wird (d.h. unter anderem am erwarteten Restlebense<strong>in</strong>kommen)<br />
<strong>und</strong> sich die Entscheidungssituation immer wieder neu unter Berücksichtigung der<br />
sich zwischenzeitlich eventuell geänderten Parameter stellen kann. E<strong>in</strong> zentraler E<strong>in</strong>fluss auf die<br />
Arbeitsangebotsentscheidung älterer Arbeitskräfte wird <strong>in</strong> den mikroökonomischen Ansätzen<br />
dem Zugang zu alternativen E<strong>in</strong>kommensquellen <strong>und</strong> deren Ausgestaltung zugemessen. Daher<br />
richtet sich das Interesse zahlreicher mikroökonomischer Studien auf die f<strong>in</strong>anzielle Ausgestaltung<br />
<strong>und</strong> Anreizfunktionen der Alterssicherungs- <strong>und</strong> anderer Lohnersatzsysteme (v.a. der Arbeitslosen-<br />
<strong>und</strong> Vorruhestandsunterstützung) für den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand (e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>ternationalen<br />
Überblick geben Gruber & Wise, 2004). E<strong>in</strong> wichtiger Anreiz, der dem b<strong>und</strong>esdeutschen<br />
System der gesetzlichen Rentenversicherung zugeschrieben wurde <strong>und</strong> teilweise noch<br />
wird, war die E<strong>in</strong>führung der vorgezogenen Altersrenten ohne Abschläge der Rentenhöhe zu<br />
Beg<strong>in</strong>n der 1970er Jahre (z.B. Börsch-Supan, 2000). Dadurch fällt die abgez<strong>in</strong>ste Gesamtrente<br />
bis zum Lebensende bei vorzeitigem Rentenbeg<strong>in</strong>n deutlich höher aus als bei späterem Rentenbeg<strong>in</strong>n,<br />
was entsprechend <strong>in</strong>formierte <strong>und</strong> rational handelnde Menschen davon abhalten wird,<br />
länger als nötig zu arbeiten. Die E<strong>in</strong>führung solcher Abschläge verr<strong>in</strong>gert oder elim<strong>in</strong>iert nach<br />
der Logik dieses Ansatzes – <strong>in</strong> Abhängigkeit von der Höhe des Abschlags – diesen f<strong>in</strong>anziellen<br />
Anreiz zum frühzeitigen Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. In e<strong>in</strong>er mikroökonomischen Simulationsrechnung<br />
gelangen Berkel & Börsch-Supan (2003) zu dem Schluss, dass durch die mit dem<br />
Rentenreformgesetz 1992 zeitverzögert e<strong>in</strong>geführten Abschläge 3 das durchschnittliche Rentene<strong>in</strong>trittsalter<br />
der Männer auf lange Sicht um knapp zwei Jahre ansteigen werde. E<strong>in</strong>e Erhöhung<br />
aller Altersgrenzen der Gesetzlichen Rentenversicherung, wie von der Rürup-Kommission vorgeschlagen,<br />
würde nach diesen Simulationsberechnungen das durchschnittliche Rentene<strong>in</strong>trittsalter<br />
um weitere acht Monate ansteigen lassen. E<strong>in</strong>e Erhöhung der Rentenabschläge von 3,6 auf<br />
6 Prozent je vorgezogenem Jahr des Rentenbeg<strong>in</strong>ns, was von den beiden Autoren als versicherungsmathematisch<br />
fairer Abschlag angesehen wird, würde zu e<strong>in</strong>em Anstieg des durchschnittlichen<br />
Rentene<strong>in</strong>trittsalters um knapp zwei Jahre führen. Von Experten der Rentenversicherungsträger<br />
wird jedoch – auf der Basis von Gesamtwertkalkulationen – die Auffassung zurückgewiesen,<br />
die Höhe der derzeit geltenden Abschläge sei versicherungsmathematisch unzureichend<br />
(Ohsmann, Stolz & Thiede, 2003).<br />
Die dem alle<strong>in</strong> auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Nutzenmaximierung angelegten mikroökonomischen Handlungsmodell<br />
<strong>in</strong>härente Annahme, der durchschnittliche ältere Arbeitnehmer sei <strong>in</strong> der Lage,<br />
solche Berechnungen anzustellen, wozu auch die adäquate Schätzung der eigenen Lebenserwartung<br />
Voraussetzung wäre, ersche<strong>in</strong>t unrealistisch. Dies wird von Vertretern dieser Theorierichtung<br />
bisweilen auch selbstkritisch zugestanden <strong>und</strong> zwischen der Existenz solcher Anreize, dem<br />
Kenntnisstand der Betroffenen <strong>und</strong> den Auswirkungen auf das Verhalten unterschieden (z.B.<br />
Viebrok, 1997, S.133). Allgeme<strong>in</strong> ist denn auch die realitätsferne Konstruktion des "homo oeconomicus"<br />
– neben der Ausblendung anderer Faktoren der Erwerbsbeteiligung – e<strong>in</strong>er der<br />
Hauptkritikpunkte an der angebotsorientierten mikroökonomischen Theorie. Beispielsweise<br />
3 Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat der Inanspruchnahme vor der Regelaltersgrenze.<br />
69
70<br />
Heribert Engstler<br />
ergab sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er repräsentativen Untersuchung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge<br />
(Höllger & Sobull, 2001), dass über zwei Drittel der 30- bis 59-jährigen Frauen ihren Rentenanspruch<br />
erheblich höher e<strong>in</strong>stufen, als er nach jetzigem Stand se<strong>in</strong> wird. 21 Prozent der Frauen<br />
<strong>und</strong> 11 Prozent der Männer überschätzten ihren Rentenanspruch um mehr als die Hälfte. Zwar<br />
ist zu erwarten, dass sich der Kenntnisstand über die Höhe der eigenen Rentenansprüche bei<br />
Erreichen des rentennahen Alters verbessert (maßgeblich aufgr<strong>und</strong> des Erhalts der Rentenvorausberechnung<br />
durch den Träger der GRV), dennoch dürfte die Annahme des voll oder zum<strong>in</strong>dest<br />
gut <strong>in</strong>formierten Individuums nicht der Realität entsprechen. Dies trifft wohl auch auf die<br />
vorausgesetzten Lebensziele <strong>und</strong> Kalküle zu. So konstatiert D<strong>in</strong>kel (1988, S.133ff.):<br />
"Bei deutschen Versicherten sollte man als Zielfunktion von e<strong>in</strong>er Lebensstandardsicherung anstelle<br />
der Lebense<strong>in</strong>kommensmaximierung sprechen. ... E<strong>in</strong> potentieller Rentner ... will nicht se<strong>in</strong>en Lebenskonsum<br />
maximieren, sondern er will zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er relativen E<strong>in</strong>kommensposition möglichst gar nicht oder doch so wenig wie möglich zurückfallen.<br />
... Wer e<strong>in</strong>en ausreichend hohen Rentenanspruch erworben hat, nimmt den frühestmöglichen Rentene<strong>in</strong>tritt<br />
<strong>in</strong> Anspruch, wessen Rentenansprüche noch zu ger<strong>in</strong>g s<strong>in</strong>d, arbeitet so lange weiter als nötig."<br />
Als empirischen Indikator für die Gültigkeit des Kriteriums der Lebensstandardsicherung für die<br />
Wahl des Rentene<strong>in</strong>trittsalters verweist D<strong>in</strong>kel (S.137) auf den äußerst ger<strong>in</strong>gen Anteil derer,<br />
die erst nach dem vollendeten 65. Lebensjahr <strong>in</strong> Rente gehen, obwohl der Aufschub des Rentenbeg<strong>in</strong>ns<br />
über die Regelaltersgrenze h<strong>in</strong>aus mit e<strong>in</strong>em Zuschlag von damals 4 0,6 Prozent je<br />
h<strong>in</strong>ausgeschobenem Monat des Rentene<strong>in</strong>tritts <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Rentensteigerung durch die zusätzliche<br />
Beitragszeit verb<strong>und</strong>en ist.<br />
Unabhängig davon, ob sich Versicherte bei der Wahl ihres Rentene<strong>in</strong>trittsalters an der Sicherungshöhe<br />
des Lebensstandards oder der Lebense<strong>in</strong>kommensmaximierung orientieren, ist davon<br />
auszugehen, dass die erfolgte Anhebung der Altersgrenzen für den vollen Bezug e<strong>in</strong>er Altersrente,<br />
die E<strong>in</strong>führung der Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeg<strong>in</strong>n <strong>und</strong> die verschiedenen Maßnahmen,<br />
die zu e<strong>in</strong>er relativen Absenkung des Rentenniveaus führen (Änderungen an der Rentenformel<br />
<strong>und</strong> den rentenrechtlichen Zeiten) Anreizfunktion für e<strong>in</strong>en längeren Verbleib im<br />
Erwerbsleben haben. Dies schlägt sich – so die forschungsleitende Annahme – <strong>in</strong> den Plänen<br />
der Erwerbstätigen nieder. Bestandteil der Untersuchung ist daher der Vergleich der Erwerbsbeendigungspläne<br />
zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten 1996 <strong>und</strong> 2002. In diesem Zeitraum<br />
begannen wesentliche Änderungen des Rentenreformgesetzes 1992 zu greifen <strong>und</strong> wurde e<strong>in</strong>e<br />
Reihe weiterer Gesetze mit Anreizen für e<strong>in</strong>en späteren Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand verabschiedet<br />
(vgl. Engstler, 2004, S.26ff.). Es wird daher davon ausgegangen, dass im Jahr 2002 weniger<br />
Erwerbstätige e<strong>in</strong>en frühzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben beabsichtigen bzw. für sich<br />
erwarten als im Jahr 1996.<br />
4 Gegenwärtig beträgt dieser Zuschlag 0,5 Prozent.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Homogenität <strong>und</strong> Heterogenität des Ausstiegsalters <strong>und</strong> der Übergangswege<br />
H<strong>in</strong>ge die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte ausschließlich von ihrer Erwerbsneigung ab<br />
<strong>und</strong> würde diese <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie von der Höhe der Rentenanwartschaften <strong>und</strong> der Lohnhöhe bee<strong>in</strong>flusst,<br />
hätte vermutlich bereits <strong>in</strong> den 90er Jahren die Erwerbsbeteiligung der 55- bis 69-<br />
Jährigen zunehmen müssen, was zum<strong>in</strong>dest bei den Männern nicht der Fall war (siehe<br />
Abbildung 3.1). Hält man sich zudem den massiven Beschäftigungse<strong>in</strong>bruch <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
<strong>in</strong> den ersten Jahren der Wiedervere<strong>in</strong>igung <strong>und</strong> die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit vor Augen,<br />
wird offensichtlich, dass die Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> die Beendigung des Erwerbslebens nicht<br />
nur von Arbeitsangebotsfaktoren gesteuert wird. Die soziologischen Ansätze heben demgegenüber<br />
die E<strong>in</strong>flüsse anderer Akteure, die Zwänge des Arbeitsmarkts, den E<strong>in</strong>fluss sozialer Normen<br />
<strong>und</strong> Werte sowie die gesellschaftlichen Regulierungen des Lebenslaufs, speziell auch des<br />
Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand hervor, erkennen dem Individuum aber durchaus e<strong>in</strong>en Handlungsspielraum<br />
zu (für e<strong>in</strong>en Überblick siehe S<strong>in</strong>g, 2003, S.134ff.; Kohli & Re<strong>in</strong>, 1991). Institutionalisierte<br />
Ruhestands-Altersgrenzen fungieren dabei nach Kohli nicht nur als E<strong>in</strong>kommen<br />
schaffendes Anreizsystem der Rentenversicherung, sondern als umfassendes gesellschaftliches<br />
Regulativ <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Lebenslaufgestaltung mit folgenden vier Funktionen:<br />
"Sie regelt den Austritt aus dem ("regulären") Erwerbsleben, also die Beendigung des Arbeitsvertrages<br />
(Arbeitsmarktfunktion). Sie regelt den Zugang zu bestimmten Leistungen des Systems sozialer Sicherung,<br />
z.B. <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er Altersrente als Lohnersatz (sozialpolitische Funktion). Sie gibt e<strong>in</strong>en Orientierungspunkt<br />
für die subjektive Gliederung <strong>und</strong> Planung des Lebens (kognitive Funktion). Sie liefert e<strong>in</strong><br />
Kriterium für den legitimen Abschluss – <strong>und</strong> damit den "Erfolg" – des Arbeitslebens (moralische Funktion)."<br />
(Kohli, 2000, S.16).<br />
Empirische Zeitvergleiche der Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben<br />
bis zur Mitte der 1990er Jahre, die sich hauptsächlich auf Westdeutschland beziehen, lassen<br />
Kohli von e<strong>in</strong>er gewissen Tendenz zur De<strong>in</strong>stitutionalisierung <strong>und</strong> Flexibilisierung des Übergangs<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand sprechen. Diese beschränke sich jedoch auf die größere zeitliche Varianz<br />
des Übergangs <strong>und</strong> die Herausbildung neuer <strong>in</strong>stitutioneller Pfade zwischen Erwerbsleben<br />
<strong>und</strong> Rente, während empirisch ke<strong>in</strong>e Flexibilisierung im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es gleitenden Übergangs <strong>in</strong><br />
den Ruhestand stattgef<strong>und</strong>en habe. Entsprechende Möglichkeiten werden hauptsächlich für den<br />
frühzeitigen vollständigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben genutzt (vgl. Kohli, 2000, S.18ff.).<br />
E<strong>in</strong>e Zunahme der Erwerbsbeendigung vor dem Übergang <strong>in</strong> die reguläre Altersrente mit entsprechend<br />
<strong>in</strong>direkten Wegen <strong>in</strong> den Ruhestand war bereits zu Beg<strong>in</strong>n der 1990er Jahre für verschiedene<br />
westliche Industrienationen festgestellt worden (Kohli, Re<strong>in</strong>, Guillemard & Gunsteren,<br />
1991). Diese Zwischenphasen entstanden hauptsächlich aufgr<strong>und</strong> von Arbeitslosigkeit,<br />
Vorruhestand, Krankheit <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derung mit je unterschiedlichen Formen der E<strong>in</strong>kommenssicherung.<br />
Es stellt sich die Frage, ob <strong>und</strong> <strong>in</strong> welcher Form sich die Entkoppelung zwischen der<br />
Erwerbsbeendigung <strong>und</strong> dem E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Altersrente <strong>in</strong> Deutschland seither fortgesetzt hat.<br />
Dies ist <strong>in</strong>sbesondere vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der raschen Veränderungen der Erwerbsbeteiligung<br />
<strong>und</strong> des Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand <strong>in</strong> Ostdeutschland von Interesse. Da zum Abbau des Arbeitskräfteüberhangs<br />
nicht nur die unmittelbar Altersrentenberechtigten ab 60 Jahren <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand entlassen wurden, sondern auch große Teile der 50- bis 60-Jährigen zuerst über Vorruhestandsregelungen,<br />
anschließend zunehmend über Arbeitslosigkeit aus dem Erwerbsleben<br />
ausgegliedert wurden, ist <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern von markanten Veränderungen der Über-<br />
71
72<br />
Heribert Engstler<br />
gangspfade auszugehen. Bei der Betrachtung der Wege <strong>in</strong> die Altersrente darf zudem e<strong>in</strong> – unter<br />
Umständen langjähriges – Vorstadium nicht vergessen werden, das hauptsächlich westdeutsche<br />
Frauen durchlaufen: die Tätigkeit als Hausfrau <strong>und</strong> Mutter, d.h. die Konzentration der eigenen<br />
Arbeit auf die Haushaltsproduktion (vgl. Allmend<strong>in</strong>ger, Brückner & Brückner, 1992). Da der<br />
Anteil k<strong>in</strong>derloser Frauen steigt <strong>und</strong> immer mehr Mütter nach familienbed<strong>in</strong>gter Erwerbsunterbrechung<br />
<strong>in</strong>s Erwerbsleben zurückkehren, ist <strong>in</strong> der Abfolge der weiblichen Geburtsjahrgänge<br />
e<strong>in</strong> Rückgang des Rentenzugangs nach vorheriger Hausfrauentätigkeit zu erwarten. 5<br />
Push- <strong>und</strong> Pull-Faktoren der Erwerbsbeendigung<br />
Die Vielzahl der <strong>in</strong> empirischen Untersuchungen festgestellten E<strong>in</strong>flüsse auf die Erwerbsbeteiligung<br />
Älterer <strong>und</strong> den Ausstieg aus dem Erwerbsleben stützt die Vermutung, dass der Übergang<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand e<strong>in</strong> multifaktorielles Geschehen ist, das sich der e<strong>in</strong>fachen Erklärung durch<br />
den e<strong>in</strong>en bestimmenden Kausalzusammenhang entzieht (vgl. Behrend, 1992; Voges, 1994;<br />
Clemens, 1997; Clemens, 2001). Die e<strong>in</strong>zelnen wissenschaftlichen Diszipl<strong>in</strong>en legen ihr Augenmerk<br />
dabei entsprechend ihrer Hauptfragestellungen <strong>und</strong> theoretischen Gr<strong>und</strong>ausrichtung<br />
jeweils auf bestimmte Zusammenhänge <strong>und</strong> E<strong>in</strong>flüsse, wie Ekerdt (2002, S.37) im Lichte se<strong>in</strong>er<br />
jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Gebiet Ruhestandsforschung feststellt:<br />
"Everyone acknowledges health as an explanation for retirement, but economists have a theoretical <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ation<br />
to look at f<strong>in</strong>ancial factors, sociologists add occupational and family variables, and social psychologists<br />
exam<strong>in</strong>e preferences and expectations."<br />
Clemens (2001, S.92f.) nennt als zentrale E<strong>in</strong>flussgrößen der Berufsaufgabe die Variablen Alter,<br />
Geschlecht, Bildungsstand, f<strong>in</strong>anzielle Bed<strong>in</strong>gungen, Ges<strong>und</strong>heit, Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen, Berufse<strong>in</strong>stellungen,<br />
subjektive Erwartungen an den Ruhestand <strong>und</strong> den präferierten Ruhestandszeitpunkt.<br />
In e<strong>in</strong>er neueren empirischen Untersuchung zu Bestimmungsgründen des Ausscheidens<br />
aus dem Erwerbsleben unterscheidet Oswald (2001, S.146) vier Gruppen von E<strong>in</strong>flussgrößen:<br />
"1. Ökonomische <strong>und</strong> sozialrechtliche Anreize, 2. Humankapital <strong>und</strong> Arbeitsplatzcharakteristika,<br />
3. Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> andere <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Merkmale sowie 4. Haushalts- <strong>und</strong> Familienzusammenhänge."<br />
In der Literatur unterschieden wird bisweilen, ob es sich bei den verschiedenen<br />
E<strong>in</strong>flüssen eher um "Pull"- oder "Push"-Faktoren handelt (Clemens, 2001). Push-Faktoren s<strong>in</strong>d<br />
dabei jene Kräfte, die primär als Druck zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit wirken (Verlassen des<br />
Negativen), während Pull-Faktoren das "H<strong>in</strong>e<strong>in</strong>ziehen" <strong>in</strong> den Ruhestand fördern (Aufsuchen<br />
des Positiven).<br />
5 Andererseits hat die Verbesserung der Bewertung <strong>und</strong> Anrechnung von K<strong>in</strong>dererziehungszeiten <strong>in</strong> der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung dazu geführt, dass k<strong>in</strong>derreiche langjährige Hausfrauen erst durch die Rentenanwartschaften<br />
für geleistete K<strong>in</strong>dererziehung <strong>in</strong> den Genuss e<strong>in</strong>er – wenn auch niedrigen – Altersrente mit 65 Jahren kommen <strong>und</strong><br />
damit überhaupt erst <strong>in</strong> den Status der Altersrentenempfänger<strong>in</strong> gelangen. Diese zusätzlichen Übergänge aus dem<br />
Hausfrauen- <strong>in</strong> den Altersrentner<strong>in</strong>nenstatus dürften jedoch den Gesamttrend kaum bee<strong>in</strong>flussen.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Forschungsfragen <strong>und</strong> Hypothesen<br />
Forschungsgegenstand s<strong>in</strong>d <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong> Faktoren der Erwerbsbeteiligung im mittleren <strong>und</strong><br />
fortgeschrittenen Erwachsenenalter (40+) <strong>und</strong> der Erwerbsbeendigung. Aus den vorangegangenen<br />
Schilderungen <strong>und</strong> dem Anspruch des Alterssurveys, sowohl Beiträge zur Sozialberichterstattung<br />
als auch zur altersbezogenen Verhaltensforschung zu leisten, ergeben sich – wie teilweise<br />
schon erwähnt – folgende Themenstellungen, Forschungsfragen <strong>und</strong> forschungsleitenden<br />
Annahmen für den empirischen Teil der Untersuchung:<br />
Zum <strong>Wandel</strong> des geplanten <strong>und</strong> tatsächlichen Alters der Erwerbsbeendigung:<br />
Es <strong>in</strong>teressiert, wie sich gegenwärtig die allgeme<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong> der Erwerbsbeteiligung von<br />
älteren Arbeitskräften <strong>und</strong> des Ausstiegsalters darstellt <strong>und</strong> welche Unterschiede dabei zwischen<br />
Männern <strong>und</strong> Frauen sowie zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland zu beobachten s<strong>in</strong>d. Gibt es<br />
Anhaltspunkte dafür, dass sich gegenwärtig e<strong>in</strong>e Trendwende h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em längeren Verbleib<br />
im Erwerbsleben abzeichnet? Zentraler Ausgangspunkt ist die Vermutung, dass die zahlreichen<br />
gesetzlichen Maßnahmen der vergangenen Jahre zur Verr<strong>in</strong>gerung der Anreize für e<strong>in</strong>e frühzeitige<br />
Ausgliederung älterer Arbeitnehmer aus dem Erwerbsprozess <strong>und</strong> den frühen Übergang <strong>in</strong><br />
den Ruhestand erste Wirkungen entfalten, die sich besonders <strong>in</strong> den Erwerbsbeendigungsplänen,<br />
aber erst wenig <strong>in</strong> den Erwerbstätigenquoten der an der Rentenschwelle bef<strong>in</strong>dlichen Altersgruppen<br />
zeigen. Es wird davon ausgegangen, dass die Erwartung abnimmt, schon relativ<br />
früh (mit 60 Jahren) aus dem Erwerbsleben auszusteigen. E<strong>in</strong> spezieller Effekt wird von der<br />
Anhebung der Altersgrenzen für den Bezug der verschiedenen Altersrenten erwartet: Da diese<br />
Altersgrenzen über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum h<strong>in</strong> steigen, es aus Vertrauensschutzgründen Ausnahmeregelungen<br />
gibt, so dass für die Angehörigen der rentennahen Jahrgänge je nach Geburtsdatum<br />
<strong>und</strong> anderen persönlichen Merkmalen unterschiedliche Altersgrenzen gelten, <strong>und</strong> sie<br />
durch die Möglichkeit ihrer Unterschreitung bei Inkaufnahme von Rentenabschlägen de facto<br />
flexibilisiert wurden, wird davon ausgegangen, dass die von Kohli (2000) betonte kognitive<br />
Funktion der Altersgrenzen als Orientierungspunkte für die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Lebensplanung (hier:<br />
der Ruhestandsplanung) vorübergehend geschwächt ist. Die formalen Rentenaltersgrenzen s<strong>in</strong>d<br />
gegenwärtig im Fluss. H<strong>in</strong>zu kommt die Diskussion um die Anhebung der Regelaltersgrenze<br />
von 65 auf 67 Jahre. Man kann davon ausgehen, dass viele Erwerbstätige sich nicht sicher s<strong>in</strong>d,<br />
welche Altersgrenze für sie gilt oder später gelten wird. Dies müsste dazu führen, dass vorübergehend<br />
die Zahl der Erwerbstätigen zunimmt, die die Frage, bis zu welchem Alter sie planen<br />
erwerbstätig zu bleiben, nicht beantworten können.<br />
Da die Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> -beendigung nicht nur von den Absichten der Arbeitnehmer,<br />
sondern wesentlich auch vom Verhalten der Arbeitgeber <strong>und</strong> den betrieblichen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
abhängt, ist nicht zu erwarten, dass sich die geschilderten staatlichen Maßnahmen zur Förderung<br />
e<strong>in</strong>es längeren Verbleibs im Erwerbsleben <strong>in</strong> gleicher Stärke auf die Erwerbsbeteiligung wie auf<br />
die Beendigungspläne niederschlägt. Insbesondere der weiterh<strong>in</strong> bestehende Druck zur Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der Personalausgaben – <strong>und</strong> damit auch oft des Personalbestandes – dürfte als Faktor<br />
gegen den längeren Verbleib im Erwerbsleben wirken <strong>und</strong> die von den Rentenreformmaßnahmen<br />
ausgehenden Effekte teilweise kompensieren. Bis zum Beobachtungsende im Jahr 2002<br />
73
74<br />
Heribert Engstler<br />
wird daher ke<strong>in</strong> oder allenfalls e<strong>in</strong> schwacher Anstieg der Erwerbstätigenquote der über 60-<br />
Jährigen erwartet.<br />
Zur zeitlichen Entkoppelung zwischen Erwerbsbeendigung <strong>und</strong> Altersrentenbeg<strong>in</strong>n<br />
Wie bereits erwähnt, ist die Arbeitslosenquote älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer<br />
überdurchschnittlich hoch <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d ältere Arbeitslose auch überdurchschnittlich häufig langzeitarbeitslos.<br />
Die Entlassung <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> den Vorruhestand als zeitliche Brücke<br />
zum Ruhestand ist e<strong>in</strong> häufig angewandtes Mittel zur Verr<strong>in</strong>gerung <strong>und</strong> Verjüngung des Personalbestands<br />
von Unternehmen. Bis <strong>in</strong> die jüngste Vergangenheit h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> wurde <strong>in</strong> Zeiten hoher<br />
Arbeitslosigkeit der Vorruhestand mit anschließender vorgezogener Altersrente durch entsprechende<br />
staatliche Leistungen gefördert. In extremer Weise geschah dies <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>in</strong><br />
der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Auch der Weg <strong>in</strong> die vorgezogene Altersrente für Schwerbeh<strong>in</strong>derte<br />
stellt – <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit dem vorgeschalteten Bezug e<strong>in</strong>er Invalidenrente – zum Teil<br />
e<strong>in</strong> Ventil zur Entlastung des Arbeitsmarkts dar. Es wird daher vermutet, dass <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong><br />
wachsender Teil der Bevölkerung nicht nahtlos aus der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Altersrente gelangt.<br />
Ausgehend von e<strong>in</strong>em hohen Niveau des direkten Übergangs <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>in</strong> der<br />
Zeit vor der Wiedervere<strong>in</strong>igung wird für die Zeit danach e<strong>in</strong> besonders starker Rückgang bei<br />
beiden Geschlechtern konstatiert. Für Westdeutschland wird demgegenüber e<strong>in</strong>e gegenläufige<br />
<strong>Entwicklung</strong> bei den Frauen erwartet, da der Anteil k<strong>in</strong>derloser erwerbstätiger Frauen steigt <strong>und</strong><br />
immer mehr Mütter nach familienbed<strong>in</strong>gter Erwerbsunterbrechung <strong>in</strong>s Erwerbsleben zurückkehren.<br />
Dadurch müsste der Übergang <strong>in</strong> die Altersrente nach vorheriger Hausfrauentätigkeit quantitativ<br />
an Bedeutung verlieren.<br />
Zu Faktoren der Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> des Übergangs <strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit<br />
Unter der Annahme vielfältiger E<strong>in</strong>flüsse auf die Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> den Übergang <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand soll <strong>in</strong> der empirischen Analyse der Vorzug des Alterssurveys genutzt werden, dass<br />
relativ viele Merkmale aus verschiedenen Lebensbereichen erhoben wurden. Dadurch lassen<br />
sich vergleichsweise viele der <strong>in</strong> der Literatur genannten E<strong>in</strong>flussgrößen <strong>in</strong> die Prädiktion der<br />
Ausübung e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit <strong>und</strong> des Wechsels <strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit e<strong>in</strong>beziehen<br />
<strong>und</strong> die wesentlichen Determ<strong>in</strong>anten herausarbeiten. Die Zusammenhangs- bzw. Vorhersageanalyse<br />
hat dabei ke<strong>in</strong>e hypothesentestende Funktion. Das primäre Ziel besteht im Nachweis<br />
des Ruhestandsübergangs als multifaktoriell verursachtes Geschehen <strong>und</strong> der Quantifizierung<br />
der verschiedenen E<strong>in</strong>flüsse.<br />
3.2.2 Datengr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> Vorgehensweise<br />
Der empirische Teil der Untersuchung stützt sich auf die Daten der Basis-, der Replikations-<br />
<strong>und</strong> der Panelstichprobe des Alterssurveys (e<strong>in</strong>e Beschreibung der Stichproben des Alterssurveys<br />
enthält der Beitrag von Engstler & Wurm, Kapitel 2 im vorliegenden Band). Die Ausländerstichprobe<br />
wurde nicht e<strong>in</strong>bezogen, da es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um die Darstellung <strong>und</strong> Analyse der<br />
Veränderungen im Vergleich der beiden Erhebungswellen von 1996 <strong>und</strong> 2002 geht. Ausgangspunkt<br />
sowohl für Kohortenvergleiche als auch für die Betrachtung der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Erwerbssta-
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
tuswechsel zwischen den beiden Messzeitpunkten bildet die Erhebung von 1996, <strong>in</strong> die die ausländische<br />
Bevölkerung nicht e<strong>in</strong>bezogen war. Querschnittsergebnisse zum Erwerbsstatus im<br />
Jahr 2002 der ausländischen, <strong>in</strong> Privathaushalten lebenden Bevölkerung im Alter von 40 bis 85<br />
Jahren im Vergleich zur deutschen Bevölkerung enthält der Beitrag von Krumme & Hoff <strong>in</strong><br />
diesem Band.<br />
Für die Untersuchung werden die nachfolgend aufgeführten zentralen Konstrukte verwendet.<br />
Sofern sie für Vergleiche zwischen den beiden Wellen dienen, beruhen sie auf Angaben, die <strong>in</strong><br />
beiden Wellen – bis auf wenige Ausnahmen – <strong>in</strong> identischer Weise abgefragt wurden. Auf vere<strong>in</strong>zelte<br />
m<strong>in</strong>imale Abweichungen wird an den entsprechenden Stellen h<strong>in</strong>gewiesen. Der komplette<br />
Fragebogen für die mündliche <strong>und</strong> schriftliche Erhebung bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Tesch-Römer,<br />
Wurm, Hoff & Engstler (2002).<br />
(a) Alter: Differenz zwischen Erhebungs- <strong>und</strong> Geburtsjahr.<br />
(b) Erwerbsstatus (5 Kategorien):<br />
Altersrentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Altersrentner: Personen ab 60 Jahren, die nach eigener Angabe e<strong>in</strong>e<br />
Altersrente oder Pension aus eigener Erwerbstätigkeit beziehen, unabhängig davon, ob sie<br />
daneben noch erwerbstätig s<strong>in</strong>d. Erwerbstätige Altersrentenbezieher werden als Untergruppe<br />
dieser Kategorie ausgewiesen.<br />
Erwerbstätige: Personen, die hauptberuflich teilzeit oder vollzeit erwerbstätig (auch ABM)<br />
oder unregelmäßig, ger<strong>in</strong>gfügig oder nebenerwerbstätig s<strong>in</strong>d. Da 96 Prozent (Replikationsstichprobe)<br />
dieser Kategorie hauptberuflich erwerbstätig s<strong>in</strong>d, wird auch die Bezeichnung<br />
"Hauptberuflich Erwerbstätige" verwendet. Nicht <strong>in</strong> dieser Kategorie enthalten s<strong>in</strong>d<br />
Personen, die e<strong>in</strong>e Altersrente oder Pension beziehen <strong>und</strong> daneben noch erwerbstätig s<strong>in</strong>d.<br />
Arbeitslos, Vorruhestand: Personen, die sich selbst als arbeitslos oder im Vorruhestand bef<strong>in</strong>dlich<br />
bezeichnen.<br />
Frührente, -pension: Personen, die angeben, Frührentner oder Frührentner<strong>in</strong> zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente zu beziehen. In Welle 2 war (für Personen unter 60<br />
Jahren) zusätzlich die Antwortmöglichkeit "frühpensioniert" gegeben.<br />
Sonstige Nicht-Erwerbstätige: Hausfrauen <strong>und</strong> Hausmänner, Personen <strong>in</strong> Umschulung/ Weiterbildung<br />
oder im Mutterschafts-/Erziehungsurlaub, Personen <strong>in</strong> der Freistellungsphase der<br />
Altersteilzeit (nur <strong>in</strong> Welle 2 erhoben <strong>und</strong> nur m<strong>in</strong>imal besetzt (n=7)), aus anderen Gründen<br />
nicht Erwerbstätige (e<strong>in</strong>schließlich nie hauptberuflich erwerbstätig Gewesene).<br />
(c) Ruhestand: Zusammenfassung der Kategorien "Altersrente/Pension" <strong>und</strong> "Frührente/pension".<br />
(d) Nicht-Erwerbstätig: Sofern – wie <strong>in</strong> Kapitel 3.3.1 – die Kategorien des Erwerbsstatus auf<br />
drei Gruppen reduziert werden (erwerbstätig, im Ruhestand, nicht erwerbstätig), handelt es<br />
sich um die Zusammenfassung der Kategorien "Arbeitslos/Vorruhestand" <strong>und</strong> "Sonstige<br />
Nicht-Erwerbstätige". Sofern h<strong>in</strong>sichtlich des Erwerbsstatus nur zwischen erwerbstätig <strong>und</strong><br />
nicht-erwerbstätig unterschieden wird, umfasst diese Kategorie alle Personen außer den Erwerbstätigen.<br />
Diese dichotome Unterscheidung kommt bei der Untersuchung multipler E<strong>in</strong>flüsse<br />
auf die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Erwerbsausübung (Kapitel 3.2) <strong>und</strong> der Erwerbsbeendigung<br />
(Kapitel 3.4) zum E<strong>in</strong>satz.<br />
75
76<br />
Heribert Engstler<br />
Der Ergebnisteil beg<strong>in</strong>nt mit e<strong>in</strong>er Darstellung des Erwerbsstatus 2002 nach Alter (bis 70 Jahre),<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil (Kapitel 3.3.1). Es folgt – unter E<strong>in</strong>satz logistischer Regressionsmodelle<br />
–die Analyse der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit erwerbstätig zu se<strong>in</strong>. Untersucht wird dabei<br />
für Männer <strong>und</strong> Frauen getrennt der Zusammenhang mit sozioökonomischen <strong>und</strong> betriebsstrukturellen<br />
Merkmalen (Kapitel 3.3.2). Anschließend wird die Veränderung des Erwerbsstatus<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 im Kohortenvergleich dargestellt, mit e<strong>in</strong>er Differenzierung nach Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Landesteil (Kapitel 3.3.3). Zunächst beschrieben <strong>und</strong> anschließend mittels logistischer<br />
Regression analysiert werden die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Übergänge von der Erwerbs- <strong>in</strong> die Nicht-<br />
Erwerbstätigkeit bei den Panelteilnehmern zwischen den beiden Messzeitpunkten (Kapitel<br />
3.3.4).<br />
In beiden Wellen wurde das geplante Alter der Erwerbsbeendigung von Erwerbstätigen erfragt,<br />
die noch ke<strong>in</strong>e Altersrente beziehen 6 . Von den Rentenempfänger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentenempfängern<br />
<strong>und</strong> den anderen Nicht-Erwerbstätigen (z.B. Arbeitslosen) wurde das Jahr des Ausscheidens aus<br />
der Erwerbstätigkeit erhoben. In Kapitel 3.4.1 werden auf Gr<strong>und</strong>lage der Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
die Ausstiegspläne der Erwerbstätigen ab 40 Jahren des Jahres 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
verglichen. Dies soll Aufschluss geben über Art <strong>und</strong> Ausmaß, mit dem die öffentliche Diskussion<br />
über e<strong>in</strong>e Verlängerung der Lebensarbeitszeit <strong>und</strong> die <strong>in</strong> den vergangenen Jahren auf dieses<br />
Ziel ausgerichteten gesetzlichen Maßnahmen ihren Niederschlag <strong>in</strong> den <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Erwartungen<br />
<strong>und</strong> Plänen zum Ruhestandsbeg<strong>in</strong>n gef<strong>und</strong>en haben. Danach wird unter Verwendung der<br />
Längsschnittdaten der Panelstichprobe untersucht, <strong>in</strong>wieweit der Erwerbsstatus der Panelteilnehmer<br />
im Jahr 2002 mit ihren 1996 geäußerten Plänen der Erwerbsbeendigung konform geht.<br />
Bei nicht mehr Erwerbstätigen wird darüber h<strong>in</strong>aus die zeitliche Übere<strong>in</strong>stimmung zwischen<br />
dem geplanten <strong>und</strong> dem realisierten Ausstiegszeitpunkt untersucht, bei weiterh<strong>in</strong> Erwerbstätigen<br />
die Stabilität der Ausstiegspläne 1996 <strong>und</strong> 2002.<br />
Anschließend werden die Ergebnisse der deskriptiven Untersuchung zum Alter des Ausscheidens<br />
aus dem Erwerbsleben im Kohortenvergleich der nicht mehr Erwerbstätigen berichtet (Kapitel<br />
3.4.2). Indikator dafür ist die <strong>in</strong> jedem Altersjahr aus dem angegebenen Beendigungsalter<br />
ermittelte Erwerbstätigenquote zwischen dem 55. <strong>und</strong> 65. Lebensjahr bei jeder Kohortengruppe.<br />
Mittels der kohortenspezifischen Verläufe der Erwerbstätigenquote im Hauptübergangsalter <strong>in</strong><br />
den Ruhestand lassen sich neben der allgeme<strong>in</strong>en <strong>Entwicklung</strong> auch die enormen Veränderungen<br />
des Erwerbsbeendigungsalters seit der Wiedervere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Ostdeutschland aufzeigen.<br />
Schließlich wird noch die These des seltener werdenden nahtlosen Übergangs von der Erwerbstätigkeit<br />
<strong>in</strong> die Rente anhand der kohortenspezifischen <strong>Entwicklung</strong> der verschiedenen Zugangswege<br />
<strong>in</strong> die Rente empirisch geprüft (Kapitel 3.5). Informationsgr<strong>und</strong>lage dafür s<strong>in</strong>d die<br />
Auskünfte der Altersrentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -rentner zur Situation vor dem Rentenbeg<strong>in</strong>n.<br />
Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst <strong>und</strong> diskutiert<br />
(Kapitel 3.6).<br />
6 Der Wortlaut der Frage lautete: Mit welchem Alter planen Sie, Ihre Erwerbstätigkeit zu beenden? Als Antwort<br />
konnten die Befragten e<strong>in</strong> konkretes Altersjahr nennen (mit ... Jahren) oder die Antwort "weiß noch nicht" geben.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
3.3 Die Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
3.3.1 Alters- <strong>und</strong> geschlechtsspezifischer Erwerbsstatus 2002<br />
Der Prozess des Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand f<strong>in</strong>det weitgehend im Alter von Mitte 50 bis Mitte<br />
60 mit e<strong>in</strong>er starken Konzentration auf das 60. bis 65. Lebensjahr statt. Dies lässt sich bereits im<br />
Querschnitt bei e<strong>in</strong>em Blick auf die Erwerbsbeteiligung der verschiedenen Altersgruppen erkennen<br />
(Tabelle 3.1). Bis zu den 50- bis 54-Jährigen s<strong>in</strong>d die altersgruppenspezifischen Unterschiede<br />
des Anteils Erwerbstätiger 7 eher ger<strong>in</strong>g. Die mit 77 Prozent etwas niedrigere Erwerbstätigenquote<br />
der 50- bis 54-Jährigen gegenüber den 45- bis 49-Jährigen resultiert aus e<strong>in</strong>er etwas<br />
höheren Arbeitslosigkeit, e<strong>in</strong>em leicht höheren Anteil an Frühverrenteten <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er etwas höheren<br />
Quote sonstiger Nicht-Erwerbstätiger, worunter sich überwiegend Hausfrauen bef<strong>in</strong>den.<br />
Von den fünf Jahre Älteren, den 55- bis 59-Jährigen s<strong>in</strong>d nur noch zwei Drittel (66%) erwerbstätig;<br />
der Anteil Arbeitsloser <strong>und</strong> Vorruheständler erreicht <strong>in</strong> diesem Alter se<strong>in</strong> Maximum<br />
(12%), ebenso die Quote Frühverrenteter (7%) <strong>und</strong> der Anteil der sonstigen Nicht-<br />
Erwerbstätigen (15%). Deren um 5 Prozentpunkte höhere Quote gegenüber den 50- bis 54-<br />
Jährigen beruht hauptsächlich auf e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> dieser Altersgruppe höheren Hausfrauenanteil im<br />
Westen Deutschlands: Von den 50- bis 54-jährigen westdeutschen Frauen s<strong>in</strong>d 16 Prozent<br />
Hausfrauen, von den 55- bis 59-Jährigen h<strong>in</strong>gegen 25 Prozent. Inwieweit es sich hierbei um<br />
e<strong>in</strong>en Kohortenunterschied handelt <strong>und</strong> <strong>in</strong> welchem Ausmaß biografische Übergänge <strong>in</strong> den<br />
Hausfrauenstatus bei den über 50-Jährigen zu dieser höheren Quote beitragen, wird die<br />
längsschnittliche Betrachtung der Erwerbsverläufe zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 zeigen (vgl. Kapitel<br />
3.3.3).<br />
Tabelle 3.1:<br />
Erwerbsstatus der 40- bis 69-Jährigen nach Alter, 2002 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Gesamt<br />
Erwerbstätig 1 84,2 80,2 77,1 66,2 19,8 1,8 55,9<br />
Arbeitslos, Vorruhestand 7,4 7,5 8,4 11,9 7,4 0,3 7,2<br />
Frührente, -pension 0,7 3,2 4,8 7,2 7,2 1,2 4,0<br />
Altersrente, Pension (ab 60) – – – – 51,1 88,6 22,3<br />
darunter: erwerbstätig 3,4 8,4 1,8<br />
Sonstige Nicht-Erwerbstätige 2<br />
7,7 9,1 9,8 14,7 14,6 8,1 10,6<br />
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002 – Replikationsstichprobe (n=2080), gewichtet<br />
1 Erwerbstätige ohne Bezug e<strong>in</strong>er Altersrente/Pension<br />
2<br />
u.a. Hausfrauen/-männer, Umschulung/Weiterbildung, Freistellungsphase der Altersteilzeit<br />
Altersspezifische Unterschiede statistisch signifikant (Chi²-Test, p
78<br />
Heribert Engstler<br />
Ab den 60-Jährigen ist die Erwerbsbeteiligung drastisch niedriger: nur noch 20 Prozent der 60-<br />
bis 64-Jährigen s<strong>in</strong>d hauptberuflich erwerbstätig. Unter E<strong>in</strong>bezug der erwerbstätigen Altersrentner<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> –rentner, die jedoch überwiegend ger<strong>in</strong>gfügig beschäftigt s<strong>in</strong>d 8 , beträgt die<br />
Erwerbstätigenquote 23 Prozent. Die Hälfte (51%) der 60- bis 64-Jährigen bezieht e<strong>in</strong>e Altersrente<br />
oder Pension 9 , 7 Prozent bezeichnen sich als Frührentner. Durch den Wechsel <strong>in</strong> vorgezogene<br />
Altersrenten s<strong>in</strong>kt der Anteil Arbeitsloser <strong>und</strong> Vorruheständler, während der Anteil sonstiger<br />
Nicht-Erwerbstätiger gleich bleibt, da viele Hausfrauen wegen nicht ausreichender Versicherungsjahre<br />
erst mit 65 Jahren Altersrente erhalten können. Mit Vollendung des 65. Lebensjahres<br />
gehen nahezu alle bis dah<strong>in</strong> noch Erwerbstätigen <strong>in</strong> den Ruhestand: Von den 65- bis 69-<br />
Jährigen s<strong>in</strong>d nur noch 2 Prozent hauptberuflich erwerbstätig, 98 Prozent bef<strong>in</strong>den sich im Ruhestand,<br />
90 Prozent beziehen Rente. Knapp e<strong>in</strong> Zehntel der 65- bis 69-jährigen Altersrentner<br />
s<strong>in</strong>d jedoch nach dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand noch <strong>in</strong> der e<strong>in</strong>en oder anderen Form erwerbstätig,<br />
wodurch die Gesamterwerbstätigenquote dieser Altersgruppe 10 Prozent beträgt.<br />
Es fällt auf, dass die Erwerbsbeteiligung der Rentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentner zwischen 65 <strong>und</strong> 70<br />
Jahren höher ist als die der 60- bis 64-jährigen Altersrentenempfänger (Tabelle 3.2). Dies hängt<br />
vermutlich damit zusammen, dass der Übergang <strong>in</strong> die vorgezogene Altersrente häufiger aus der<br />
Arbeitslosigkeit, dem Vorruhestand oder wegen e<strong>in</strong>geschränkter Erwerbsfähigkeit erfolgt <strong>und</strong><br />
damit seltener mit der Möglichkeit verb<strong>und</strong>en ist, nach dem Wechsel <strong>in</strong> die Rente gelegentlich<br />
oder mit verr<strong>in</strong>gerter Arbeitszeit beim bisherigen Arbeitgeber erwerbstätig zu se<strong>in</strong>.<br />
Tabelle 3.2<br />
Anteil Erwerbstätiger unter den Beziehern von Altersrente, 2002 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Alter der<br />
Rentenbezieher<br />
Männer Frauen West Ost Gesamt<br />
60-64 5,8 7,4 6,7 6,0 6,6<br />
65-69 11,0 8,7 10,2 8,6 9,5<br />
70-74 7,7 3,8 6,0 4,3 5,6<br />
75-79 6,5 3,8 6,1 2,1 4,9<br />
80-85 2,0 3,3 2,6 3,8 2,8<br />
Gesamt 7,2 5,6 6,7 5,0 6,3<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n=1438), gewichtet<br />
*) Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen s<strong>in</strong>d statistisch signifikant (Chi²-Test, p
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Von dieser Besonderheit abgesehen gilt: Je älter die Rentenbezieher s<strong>in</strong>d, desto seltener s<strong>in</strong>d sie<br />
noch – ger<strong>in</strong>gfügig – erwerbstätig. Aber selbst von den über 75-Jährigen üben noch e<strong>in</strong>ige e<strong>in</strong>e<br />
Erwerbstätigkeit aus. Dabei handelt es sich überdurchschnittlich oft um (ehemalige) Selbstständige<br />
<strong>und</strong> mithelfende Familienangehörige.<br />
Nachzutragen bleibt, dass e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit ohne gleichzeitigen Bezug e<strong>in</strong>er Rente ab dem<br />
70. Lebensjahr äußerst selten ist: Von den 70- bis 74-Jährigen s<strong>in</strong>d nur noch 0,4 Prozent erwerbstätig<br />
<strong>und</strong> beziehen ke<strong>in</strong>e Rente.<br />
Durch die starke Konzentration der Beendigung des Erwerbslebens <strong>und</strong> des Übergangs <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand auf das Alter von Mitte 50 bis Mitte 60 weist dieser 10-Jahres-Abschnitt <strong>in</strong>nerhalb<br />
der zweiten Lebenshälfte die größte Heterogenität <strong>in</strong> der Erwerbsbeteiligung auf. H<strong>in</strong>zu kommen<br />
ausgeprägte Unterschiede zwischen Männern <strong>und</strong> Frauen sowie zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland<br />
(Abbildung 3.2).<br />
Abbildung 3.2:<br />
Erwerbsstatus der 55- bis 64-jährigen Männer <strong>und</strong> Frauen<br />
<strong>in</strong> West- <strong>und</strong> Ostdeutschland, 2002<br />
%<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
33,2<br />
8,6<br />
9,4 20,3<br />
46,3<br />
27,1 29,7<br />
9,3<br />
40,7<br />
3,8<br />
31,4<br />
5,5<br />
29,7<br />
37,0<br />
13,0<br />
12,0<br />
31,5<br />
West Ost West Ost<br />
Männer Frauen*<br />
Altersrente<br />
Frührente, -pension<br />
Sonstige Nicht-Erw erbst.<br />
Arbeitslos, Vorruhestand<br />
Erw erbstätig<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n=706)<br />
West: Früheres B<strong>und</strong>esgebiet; Ost: Neue Länder <strong>und</strong> Berl<strong>in</strong>-Ost.<br />
* = Ost-West-Unterschied bei den Frauen statistisch signifikant (Chi²-Test, p
80<br />
Heribert Engstler<br />
familienbed<strong>in</strong>gte Erwerbsunterbrechungen zurück als die Frauen <strong>in</strong> Westdeutschland, der Anteil<br />
Selbstständiger ist im Osten Deutschlands niedriger als im Westen, der ostdeutsche Arbeitsmarkt<br />
ist angespannter <strong>und</strong> zu se<strong>in</strong>er Entlastung wurden während der 1990er Jahre besondere<br />
befristete Möglichkeiten der Frühausgliederung älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer <strong>in</strong><br />
den Vorruhestand geschaffen, die noch nachwirken.<br />
3.3.2 Ausgewählte Faktoren der Erwerbsbeteiligung 2002<br />
Ausgehend von verschiedenen Bef<strong>und</strong>en der <strong>in</strong> den Kapiteln 3.1 <strong>und</strong> 3.2 genannten Studien <strong>und</strong><br />
den vorhandenen Informationen im Alterssurvey werden die folgenden potenziellen E<strong>in</strong>flüsse<br />
auf die Ausübung e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit der 40- bis 64-jährigen Männer <strong>und</strong> Frauen näher untersucht:<br />
der E<strong>in</strong>fluss der soziodemografischen Merkmale Alter, Haushaltstyp, Landesteil <strong>und</strong><br />
Regionsgröße, der sozioökonomischen Merkmale Sozialschicht <strong>und</strong> Qualifikationsniveau, der<br />
betrieblichen Merkmale Branchenzugehörigkeit <strong>und</strong> Betriebsgröße (Beschäftigtenzahl) der letzten<br />
oder aktuellen Erwerbstätigkeit sowie der Selbste<strong>in</strong>schätzung des Ges<strong>und</strong>heitszustands.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der erwarteten Unterschiedlichkeit dieser E<strong>in</strong>flüsse bei Männern <strong>und</strong> Frauen erfolgten<br />
die Analysen getrennt für beide Geschlechter.<br />
Die Untersuchung bedient sich des <strong>in</strong> der Soziologie häufig verwendeten Verfahrens der b<strong>in</strong>omialen<br />
logistischen Regression. Abhängiges Merkmal ist die Ausübung e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit<br />
ohne gleichzeitigen Bezug e<strong>in</strong>er Altersrente, genauer: das logarithmierte Verhältnis zwischen<br />
der Ausübungswahrsche<strong>in</strong>lichkeit <strong>und</strong> der Nichtausübungswahrsche<strong>in</strong>lichkeit (L = ln(p/1-p)).<br />
E<strong>in</strong>e mögliche Erwerbstätigkeit im Ruhestand bleibt <strong>in</strong> dieser Analyse unbeachtet, da die Faktoren<br />
für e<strong>in</strong>e Erwerbsausübung im Gegensatz zur Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit des Ruhestands oder e<strong>in</strong>es<br />
– sonstigen – Nichterwerbsstatus untersucht werden sollen.<br />
Gut veranschaulichen lassen sich Stärke <strong>und</strong> Richtung der e<strong>in</strong>zelnen Prädiktoren, wenn die ß-<br />
Koeffizienten zu sogenannten „odds-ratio“-Werten bzw. Effektkoeffizienten transformiert werden:<br />
odds ratio = exp(ßi). Deren Abweichung von 1 gibt an, um welches Vielfache sich – unter<br />
Konstanthaltung der anderen Prädiktoren – das Verhältnis zwischen Erwerbs- <strong>und</strong> Nichterwerbswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
ändert, wenn der Wert der unabhängigen Variable (Prädiktor) um e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>heit erhöht wird, z.B. wenn das Alter e<strong>in</strong> Jahr höher ist. Bei nicht-metrischen Merkmalen<br />
(z.B. Haushaltstyp) drückt der Effektkoeffizient den Unterschied gegenüber der Referenzkategorie<br />
aus (z.B. Paare mit K<strong>in</strong>dern vs. Paare ohne K<strong>in</strong>der). Je größer die Relation des Koeffizienten<br />
zum Wert 1 ist, desto stärker ist der negative (1) der zugehörigen<br />
Variable/Kategorie auf die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Ausübung e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
ist dabei immer auch auf die unterschiedliche Skalenbreite der Prädiktoren zu achten. Der<br />
Pseudo-R²-Koeffizient (nach Nagelkerke) gibt Auskunft über die Erklärungs- bzw. Vorhersagekraft<br />
e<strong>in</strong>es Modells. Je näher das Maß an den Wert 1 reicht, desto höher die Erklärungskraft des<br />
Modells (vgl. Backhaus, Erichson, Pl<strong>in</strong>ke & Weiber 2000, S.133).<br />
Die Analyse zeigt, dass die neun e<strong>in</strong>bezogenen Merkmale zusammen 42 Prozent (Männer) bis<br />
43 Prozent (Frauen) der Varianz aufklären (vgl. nachfolgende Tabelle 3.3).
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Tabelle 3.3:<br />
Prädiktoren der Erwerbstätigkeit von 40- bis 64-jährigen Männern <strong>und</strong> Frauen<br />
(Logistische Regression) 1<br />
Signifikanzniveau: ° = p
82<br />
Heribert Engstler<br />
Erwartungsgemäß hat das Alter bei beiden Geschlechtern e<strong>in</strong>en starken negativen E<strong>in</strong>fluss.<br />
Auch <strong>in</strong> Ostdeutschland zu wohnen, führt zu e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit erwerbstätig<br />
zu se<strong>in</strong>; statistisch signifikant ist dieser Effekt allerd<strong>in</strong>gs nur bei den Männern. 11 Dies<br />
trifft auch auf den E<strong>in</strong>fluss der Regionsgröße zu: In weniger dicht besiedelten Regionen zu leben<br />
(BIK-Regionen mit weniger als 5000 E<strong>in</strong>wohnern) erhöht bei Männern die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
erwerbstätig zu se<strong>in</strong>, bei den Frauen hat der Urbanitäts- <strong>und</strong> Zentralitätsgrad der Wohnregion<br />
ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf die Erwerbsbeteiligung.<br />
Auffällig ist der gegensätzliche Effekt des Vorhandense<strong>in</strong>s von K<strong>in</strong>dern im Haushalt auf die<br />
Erwerbsbeteiligung der <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Paarbeziehung lebenden Frauen <strong>und</strong> Männer. Während Frauen<br />
mit K<strong>in</strong>dern im Haushalt auch jenseits des 40. Lebensjahrs (bzw. nach der Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>dphase)<br />
erheblich seltener erwerbstätig s<strong>in</strong>d als die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Paarbeziehung lebenden Frauen ohne K<strong>in</strong>der,<br />
geht die Existenz von K<strong>in</strong>dern im Haushalt bei den Männern mit e<strong>in</strong>er deutlichen Steigerung<br />
ihrer Erwerbswahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>her. In diesem Gegensatz kommt die verbreitete geschlechtsspezifische<br />
Arbeitsteilung bei Paaren mit K<strong>in</strong>dern zum Ausdruck. Etwas beunruhigend<br />
ist die Tatsache, dass besonders bei Frauen die Führung e<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>personenhaushalts mit e<strong>in</strong>er<br />
im Vergleich zum Paarhaushalt ger<strong>in</strong>geren Erwerbswahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>her geht. Denn dies<br />
bedeutet auch das Fehlen von Erwerbse<strong>in</strong>künften bei gleichzeitig <strong>in</strong> diesem Alter erst zum Teil<br />
vorhandenem E<strong>in</strong>kommen aus Alterssicherungssystemen. Dass alle<strong>in</strong>lebende Frauen unter 65<br />
Jahren unter Kontrolle der anderen E<strong>in</strong>flüsse sogar seltener als Frauen mit K<strong>in</strong>dern erwerbstätig<br />
s<strong>in</strong>d, lässt zudem negative Auswirkungen auf die zu erwartende Höhe ihrer Altersrente erwarten.<br />
Tendenziell geht das Alle<strong>in</strong>leben auch bei Männern mit e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>geren Erwerbsbeteiligung<br />
e<strong>in</strong>her, wenn auch der Effekt statistisch nicht signifikant, d.h. mit e<strong>in</strong>er höheren Irrtumswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
behaftet ist.<br />
Nur bei den Frauen hängt die Erwerbsbeteiligung signifikant vom Qualifikationsniveau ab.<br />
Frauen mit Hochschulabschluss s<strong>in</strong>d zu e<strong>in</strong>em wesentlich höheren Grad erwerbstätig als andere<br />
Frauen. Studiert zu haben erhöht das Verhältnis zwischen Erwerbs- <strong>und</strong> Nichterwerbswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
um r<strong>und</strong> das Dreifache zugunsten der Erwerbstätigkeit. Die Unterschiede zwischen<br />
den anderen Qualifikationsniveaus s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen ger<strong>in</strong>g.<br />
11 Der deskriptive Vergleich der Alterssurveydaten zeigt ebenfalls, dass die Erwerbstätigenquote der 40- bis 64jährigen<br />
Männer <strong>und</strong> Frauen <strong>in</strong> Ostdeutschland etwas niedriger als <strong>in</strong> Westdeutschland ist. Dies bestätigen auch<br />
eigene Berechnungen aus den veröffentlichten Zahlen des Mikrozensus 2003 (Statistisches B<strong>und</strong>esamt 2003b)..<br />
Danach liegt die Erwerbstätigenquote der westdeutschen Männer um 10 Prozentpunkte, die der westdeutschen<br />
Frauen um 1 Prozentpunkt über der <strong>in</strong> Ostdeutschland. Bei den Frauen kommt dieser leichte Gesamtunterschied<br />
durch die ger<strong>in</strong>ge Erwerbsbeteiligung der 60- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern zustande, während im<br />
darunter liegenden Alter die Erwerbstätigenquote der ostdeutschen Frauen um r<strong>und</strong> 2 Prozentpunkte über der <strong>in</strong><br />
Westdeutschland liegt.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Die Erwerbsbeteiligung der Männer hängt nicht vom Qualifikationsniveau, sondern von der –<br />
an der beruflichen Stellung festgemachten – Schichtzugehörigkeit ab: Je höher die soziale<br />
Schicht, desto höher ist auch die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Männer erwerbstätig zu se<strong>in</strong>. Bei den<br />
Frauen ist dieser Zusammenhang nur schwach ausgeprägt. 12<br />
Mit e<strong>in</strong>er markanten Ausnahme haben die Branchenzugehörigkeit <strong>und</strong> die Größe des Betriebs,<br />
<strong>in</strong> dem man aktuell oder zuletzt gearbeitet hat, ke<strong>in</strong>en nennenswerten E<strong>in</strong>fluss auf die Erwerbsbeteiligung<br />
der Männer <strong>und</strong> Frauen. Die Ausnahme ist die Tätigkeit von Frauen im Öffentlichen<br />
Dienst. E<strong>in</strong> Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst erhöht die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Berufsausübung<br />
der Frauen ab 40 Jahren erheblich (verglichen mit e<strong>in</strong>em Industriearbeitsplatz um den<br />
Faktor 2,4).<br />
Offenbar begünstigen die im Öffentlichen Dienst relativ guten Beurlaubungs- <strong>und</strong> Teilzeitmöglichkeiten<br />
sowie die höhere Arbeitsplatzsicherheit die Rückkehr von Frauen <strong>in</strong> die Erwerbstätigkeit<br />
nach der Familienphase.<br />
Bei beiden Geschlechtern besteht e<strong>in</strong> starker Zusammenhang zwischen dem subjektiven Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
<strong>und</strong> der Erwerbsbeteiligung: Je schlechter nach eigener E<strong>in</strong>schätzung der Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
ist, desto seltener üben die Befragten e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit aus.<br />
Ke<strong>in</strong>e signifikanten Zusammenhänge ergaben sich h<strong>in</strong>gegen mit den subjektiven E<strong>in</strong>schätzungen<br />
anderer Lebensaspekte, wie den Paar- <strong>und</strong> Familienbeziehungen, dem Verhältnis zu Fre<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> Bekannten, der Freizeitgestaltung, der Wohnsituation <strong>und</strong> der E<strong>in</strong>schätzung des eigenen<br />
Lebensstandards. 13<br />
Insgesamt zeigt sich e<strong>in</strong> deutlicher Zusammenhang der Erwerbsbeteiligung der über 40-Jährigen<br />
mit sozialstrukturellen <strong>und</strong> (familien)biografischen Merkmalen, während der E<strong>in</strong>fluss betriebsstruktureller<br />
Merkmale sehr begrenzt war. Dies kann daran liegen, dass mit der Branchenzugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> Betriebsgröße nur zwei allgeme<strong>in</strong>e betriebliche Merkmale mit zugleich fallzahlbed<strong>in</strong>gter<br />
grober E<strong>in</strong>teilung untersucht wurden. Die querschnittliche Untersuchung von Faktoren<br />
der Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der relativ breiten Altersspanne der 40- bis 64-Jährigen ist zudem<br />
nur als erster E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Analyse des Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand zu verstehen. E<strong>in</strong>en genaueren<br />
E<strong>in</strong>blick wird die längsschnittliche Untersuchung der Erwerbsbeendigung der Panelteilnehmer<br />
ergeben, die 1996 <strong>und</strong> 2002 befragt werden konnten (vgl. hierzu Kapitel 3.3.4). Zuvor<br />
soll jedoch die allgeme<strong>in</strong>e Veränderung der Erwerbsbeteiligung zwischen diesen beiden<br />
Jahren anhand der Daten des Alterssurveys sowohl im Kohortenvergleich als auch <strong>in</strong> den <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Verläufen dargestellt werden.<br />
12 Dieser geschlechtsspezifische Unterschied bleibt auch erhalten, wenn <strong>in</strong> das Modell jeweils nur die Schichtzugehörigkeit<br />
oder nur das Qualifikationsniveau e<strong>in</strong>bezogen wird. Die Rangkorrelation zwischen Schicht <strong>und</strong> Qualifikation<br />
hält sich <strong>in</strong> Grenzen (Kendalls taub: .40 (Frauen), .47 (Männer), p
3.3.3 <strong>Entwicklung</strong> der Erwerbsbeteiligung zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
Veränderungen im Kohortenvergleich<br />
84<br />
Heribert Engstler<br />
Die Betrachtung von <strong>Entwicklung</strong>en im Kohortenvergleich ist e<strong>in</strong> häufiges Verfahren zur Erfassung<br />
des sozialen <strong>Wandel</strong>s, da sich dieser oft <strong>in</strong> Form veränderter Verhaltensweisen der nachfolgenden<br />
Geburtsjahrgänge vollzieht (vgl. Alw<strong>in</strong> & McCammon, 2003). Damit kohortenspezifische<br />
Veränderungen ause<strong>in</strong>ander gehalten werden können von <strong>Entwicklung</strong>en, die mit dem<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Prozess des Alterns verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d, ist es s<strong>in</strong>nvoll, das Verhalten verschiedener<br />
Geburtsjahrgänge im jeweils gleichen Alter zu beobachten. Für den Vergleich der Erwerbsbeteiligung<br />
unterschiedlicher Geburtsjahrgänge werden daher die Befragten der Basisstichprobe von<br />
1996 ebenso wie die Befragten der Replikationsstichprobe 2002 <strong>in</strong> sechsjährige Altersgruppen<br />
unterteilt <strong>und</strong> mite<strong>in</strong>ander verglichen. Mit dieser Gruppenbildung wird verh<strong>in</strong>dert, dass e<strong>in</strong>zelne<br />
Geburtsjahrgänge zu beiden Messzeitpunkten der gleichen Altersgruppe angehören. Diese E<strong>in</strong>teilung<br />
ermöglicht e<strong>in</strong>en trennscharfen Vergleich unterschiedlicher Kohorten im jeweils gleichen<br />
Alter, wie <strong>in</strong> Abbildung 3.3 dargestellt. Dabei festzustellende Verhaltensunterschiede der<br />
Angehörigen verschiedener Kohorten im gleichen Alter können Ausdruck veränderter Erwerbsbiografien<br />
bei jüngeren Geburtsjahrgängen se<strong>in</strong> (Kohorteneffekt). Es ist jedoch nicht auszuschließen,<br />
dass zu den Unterschieden auch mögliche Besonderheiten des jeweiligen Messzeitpunkts<br />
beitragen, deren E<strong>in</strong>fluss sich auf alle Altersgruppen erstrecken oder nur vorübergehender<br />
Natur se<strong>in</strong> kann (Periodeneffekt).<br />
Abbildung 3.3:<br />
Erwerbsstatus nach Alter, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
100<br />
80<br />
60<br />
%<br />
40<br />
20<br />
0<br />
19,5 14,9 18,3 16,3<br />
80,0 83,7 80,5 79,8<br />
Erw erbstätig Nicht-Erw erbstätig Ruhestand<br />
28,5<br />
66,2<br />
21,5<br />
74,6<br />
32,8<br />
33,6<br />
44,7<br />
23,8<br />
33,5 31,4<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
40-45* 46-51* 52-57* 58-63* 64-69<br />
Alter<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n=3498) <strong>und</strong> 2002 (Replikationsstichprobe, n=2080), gewichtet<br />
* = Unterschied im Erwerbsstatus 2002 gegenüber 1996 statistisch signifikant (Chi²-Test, p
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Abbildung 3.4:<br />
Anteil erwerbstätiger* Männer <strong>und</strong> Frauen <strong>in</strong> West- <strong>und</strong> Ostdeutschland, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
%<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
West<br />
Männer 1996<br />
Männer 2002<br />
Frauen 1996<br />
Frauen 2002<br />
40-45 46-51 52-57 58-63 64-69<br />
Alter<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Männer 1996<br />
Männer 2002<br />
Frauen 1996<br />
Frauen 2002<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n=3498) <strong>und</strong> 2002 (Replikationsstichprobe, n=2080)<br />
* ohne erwerbstätige Rentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentner.<br />
%<br />
Ost<br />
40-45 46-51 52-57 58-63 64-69<br />
Alter<br />
Die Gegenüberstellung der Ergebnisse von 1996 <strong>und</strong> 2002 zeigt, dass <strong>in</strong> nahezu jeder der betrachteten<br />
Altersgruppen <strong>in</strong> der Kohortenabfolge signifikante Veränderungen der Erwerbsbeteiligung<br />
stattgef<strong>und</strong>en haben. Bei den 40- bis 45-Jährigen nahm der Anteil Erwerbstätiger um<br />
knapp 4 Prozentpunkte zu, allerd<strong>in</strong>gs bei gegensätzlicher <strong>Entwicklung</strong> zwischen Männern <strong>und</strong><br />
Frauen: Während die Erwerbstätigenquote der Frauen stieg, fiel die der Männer, am stärksten<br />
die der ostdeutschen Männer (m<strong>in</strong>us 8 Prozentpunkte). Der Gesamtanstieg <strong>in</strong> dieser Altersgruppe<br />
resultiert weitgehend aus der beträchtlichen Steigerung des Erwerbstätigenanteils der westdeutschen<br />
Frauen um 15 Prozentpunkte (Abbildung 3.4 <strong>und</strong> Abbildung 3.5). Auch bei den 46-<br />
bis 51-Jährigen verbirgt sich h<strong>in</strong>ter dem leichten Rückgang der Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong>sgesamt<br />
die gegensätzliche <strong>Entwicklung</strong> bei Männern <strong>und</strong> Frauen, vor allem im Westen Deutschlands.<br />
Den höchsten Gesamtzuwachs erfuhr die Erwerbsbeteiligung der 52- bis 57-Jährigen: deren<br />
Erwerbstätigenquote stieg zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 von 66 auf knapp 75 Prozent. In dieser Altersgruppe<br />
nahm auch der Anteil erwerbstätiger Männer leicht zu. Die größte Steigerung weisen<br />
mit e<strong>in</strong>em Anstieg um 17 Prozentpunkte wiederum die westdeutschen Frauen auf.<br />
Bei den 58- bis 63-Jährigen g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> den sechs Jahren der Erwerbstätigenanteil leicht zurück<br />
(-2%-Punkte). Die Hauptveränderung <strong>in</strong> dieser Altersgruppe betrifft die Verschiebung <strong>in</strong>nerhalb<br />
der Nicht-Erwerbstätigen von den noch nicht im Ruhestand Bef<strong>in</strong>dlichen zu denen im Ruhestand:<br />
Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 erhöhte sich bei den 58- bis 63-Jährigen der Anteil der im Ruhestand<br />
Bef<strong>in</strong>dlichen von 33 auf 45 Prozent, während der Anteil der Nicht-Erwerbstätigen ohne<br />
Rentenbezug von 34 auf 24 Prozent sank. Betrachtet man die <strong>Entwicklung</strong> auch <strong>in</strong> dieser Altersgruppe<br />
differenziert nach Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil fällt auf, dass es zu ke<strong>in</strong>er gegensätzlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong> zwischen Männern <strong>und</strong> Frauen, sondern zwischen Ost <strong>und</strong> West gekommen<br />
ist: die Erwerbstätigenquote der Westdeutschen ist zurück gegangen, die der Ostdeutschen hat<br />
zugenommen, am stärksten bei den ostdeutschen Männern (plus 12 Prozentpunkte). Offenbar ist<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland die Talsohle nach dem <strong>in</strong> der ersten Hälfte der 1990er Jahre erfolgten E<strong>in</strong>-<br />
85
86<br />
Heribert Engstler<br />
bruch der Erwerbsbeteiligung bei den rentennahen Jahrgängen durchschritten <strong>und</strong> die älteren<br />
Arbeitnehmer <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern bleiben wieder länger im Erwerbsleben.<br />
Abbildung 3.5:<br />
Veränderung des Anteils erwerbstätiger* Männer <strong>und</strong> Frauen <strong>in</strong> West- <strong>und</strong> Ostdeutschland,<br />
2002 gegenüber 1996 (<strong>in</strong> %-Punkten)<br />
%-Punkte<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-4,8<br />
-8,0<br />
15 ,4<br />
2,8<br />
-6,0<br />
-1,9<br />
6,3<br />
0,7<br />
1,7<br />
0,6<br />
16 ,9<br />
9,2<br />
-5,0<br />
12,3<br />
-3,9<br />
7,4<br />
4,5<br />
0,8<br />
-0,4<br />
40-45 46-51 52-57<br />
Alter<br />
58-63 64-69<br />
0,0<br />
Männer-West<br />
Männer-Ost<br />
Frauen-West<br />
Frauen-Ost<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n=3498) <strong>und</strong> 2002 (Replikationsstichprobe, n=2080)<br />
* Erwerbstätige, die noch nicht im Ruhestand s<strong>in</strong>d.<br />
Zahlenangabe im Fettdruck= Anteilsveränderung statistisch signifikant (Chi²-Test, p
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
<strong>und</strong> 14 Prozent waren weder erwerbstätig noch im Ruhestand, die meisten davon arbeitslos oder<br />
<strong>in</strong> den Vorruhestand gewechselt. Erwartungsgemäß sank der Anteil der noch im Erwerbsleben<br />
Stehenden mit dem Alter: Von den nun 58- bis 63-Jährigen haben 57 Prozent im Laufe der<br />
sechs Jahre ihre hauptberufliche Erwerbstätigkeit beendet, von den jetzt 64- bis 69-Jährigen<br />
waren es 95 Prozent (Abbildung 3.6). Aber auch <strong>in</strong> den jüngeren Altersgruppen ist es zu Übergängen<br />
<strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit gekommen. 12 Prozent der im Jahr 1996 40- bis 45jährigen<br />
Erwerbstätigen übten im Jahr 2002 ke<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit aus, hauptsächlich aufgr<strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>getretener Arbeitslosigkeit (8%). Von den erwerbstätigen 46- bis 51-Jährigen des Jahres<br />
1996 nahmen sechs Jahre später 17 Prozent nicht am Erwerbsleben teil, 6 Prozent weil sie <strong>in</strong>zwischen<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand gewechselt waren, 8 Prozent aufgr<strong>und</strong> von Arbeitslosigkeit, 3 Prozent<br />
aus sonstigen Gründen.<br />
Am höchsten ist der Anteil derer, die zwar ihre Erwerbstätigkeit beendet haben, sich jedoch<br />
noch nicht im Altersruhestand mit Bezug e<strong>in</strong>er Versichertenrente oder Pension bef<strong>in</strong>den, bei<br />
den <strong>in</strong>zwischen 58- bis 63-Jährigen. Etwa e<strong>in</strong> Viertel (24%) bef<strong>in</strong>det sich im Jahr 2002 nach<br />
vorheriger Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> dieser Zwischenphase, die Hälfte davon ist arbeitslos oder im<br />
Vorruhestand (zusammen 13%). H<strong>in</strong>zu gerechnet werden könnten noch 5 Prozent, die <strong>in</strong> diesem<br />
Alter bereits den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand vollzogen haben, aber nicht direkt aus der Erwerbstätigkeit<br />
<strong>in</strong> die Rente wechselten, sondern zuvor arbeitslos geworden waren. Diese Ergebnisse<br />
weisen darauf h<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> bemerkenswerter Teil der Erwerbstätigen nicht unmittelbar aus<br />
der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> den Ruhestand wechselt, sondern bis zum Rentenbeg<strong>in</strong>n noch e<strong>in</strong>e Zwischenphase<br />
zu überbrücken hat. Wie häufig dies vorkommt, welche <strong>Entwicklung</strong> dieses Übergangsmuster<br />
genommen hat <strong>und</strong> wie lange diese Zwischenphase dauert, wird <strong>in</strong> Kapitel 3.5<br />
näher untersucht.<br />
Abbildung 3.6:<br />
Erwerbsstatus 2002 der im Jahr 1996 Erwerbstätigen*, nach Alter<br />
100<br />
80<br />
60<br />
%<br />
40<br />
20<br />
0<br />
11,8<br />
11,3<br />
87,7 82,5<br />
32,7<br />
24,1<br />
43,2<br />
91,6<br />
4,8<br />
22,3<br />
14,4<br />
63,3<br />
46-51 52-57 58-63 64-69 46-69<br />
Alter im Jahr 2002<br />
Erwerbsstatus 2002:<br />
Erwerbstätig* Nicht-Erwerbstätig Ruhestand<br />
Quelle: Alterssurvey 1996/2002 (Panelstichprobe, n=750), gewichtet<br />
* ohne erwerbstätige Rentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentner<br />
87
88<br />
Heribert Engstler<br />
Dass der Wechsel <strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit im rentennahen Alter meist den endgültigen<br />
Abschied aus dem Erwerbsleben bedeutet, verdeutlicht auch die ger<strong>in</strong>ge Rückkehrquote der<br />
über 50-jährigen Nicht-Erwerbstätigen <strong>in</strong> das Erwerbsleben. Von den 52- bis 57-Jährigen des<br />
Jahres 1996 ohne Job waren sechs Jahre später im Alter von 58 bis 63 Jahren nur 15 Prozent<br />
erwerbstätig, 36 Prozent vollzogen bis dah<strong>in</strong> den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand, 49 Prozent waren<br />
weiterh<strong>in</strong> ohne Rentenbezug nicht erwerbstätig (Abbildung 3.7). Allgeme<strong>in</strong> gilt dabei: Je älter<br />
die Menschen ohne Erwerbsarbeit s<strong>in</strong>d, desto seltener werden sie nochmals erwerbstätig. Gemessen<br />
am Erwerbsstatus 2002 betrug die Erwerbsaufnahmequote der 46- bis 51-Jährigen 54<br />
Prozent, der 52- bis 57-Jährigen 29 Prozent <strong>und</strong> der 58- bis 63-Jährigen – wie erwähnt – 15<br />
Prozent. Von den noch Älteren wurde so gut wie niemand nochmals hauptberuflich erwerbstätig.<br />
Insgesamt bestätigen die Ergebnisse des Alterssurveys zu den altersspezifischen Wechseln <strong>in</strong><br />
die Nicht-Erwerbstätigkeit <strong>und</strong> die Rückkehr <strong>in</strong> die Erwerbsarbeit Bef<strong>und</strong>e der Arbeitsmarktforschung,<br />
dass die im Querschnitt zu beobachtende höhere Arbeitslosenquote älterer Arbeitnehmer<br />
(vgl. Tabelle 3.1) weniger die Folge e<strong>in</strong>es höheren E<strong>in</strong>trittsrisikos <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit,<br />
sondern e<strong>in</strong>es höheren Verbleibsrisikos <strong>in</strong> der Arbeitslosigkeit ist (vgl. Koller, Bach & Brixy<br />
2003).<br />
Abbildung 3.7:<br />
Erwerbsstatus 2002 der im Jahr 1996 noch nicht im Ruhestand bef<strong>in</strong>dlichen Nicht-<br />
Erwerbstätigen, nach Alter<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
%<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
44,6<br />
53,6<br />
Erwerbsstatus 2002:<br />
60,0<br />
29,2<br />
36,4<br />
48,9<br />
14,8<br />
82,4<br />
15,3<br />
37,4<br />
40,8<br />
21,8<br />
46-51 52-57 58-63 64-69 46-69<br />
Alter im Jahr 2002<br />
Erwerbstätig* Nicht-Erwerbstätig Ruhestand<br />
Quelle: Alterssurvey 1996/2002 (Panelstichprobe, n=246), gewichtet<br />
* ohne erwerbstätige Rentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentner<br />
Mit zunehmendem Alter wird Arbeitslosigkeit dann auch im Selbstverständnis der Betroffenen<br />
zu e<strong>in</strong>er zeitlichen Brücke <strong>in</strong> den Ruhestand: Im Jahr 2002 wollten von den 50- bis 57-jährigen<br />
Arbeitslosen 80 Prozent, von den Arbeitslosen ab 58 Jahren jedoch nur 34 Prozent sobald wie<br />
möglich wieder erwerbstätig werden. E<strong>in</strong> Drittel der älteren Arbeitslosen ab 58 Jahren erhielt <strong>in</strong><br />
Verb<strong>in</strong>dung mit dem Ausscheiden aus dem Betrieb e<strong>in</strong>e Abf<strong>in</strong>dung oder regelmäßige Geldleistung<br />
des Arbeitgebers; unter E<strong>in</strong>bezug der im Vorruhestand Bef<strong>in</strong>dlichen waren es 40 Prozent
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
(Ergebnis der Replikationsstichprobe). In diesen Fällen dürfte die Erwerbsbeendigung für viele<br />
Betroffene mit der Perspektive des Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand erfolgt se<strong>in</strong>.<br />
3.3.4 Faktoren der Erwerbsbeendigung oder -unterbrechung<br />
In diesem Abschnitt wird untersucht, welchen E<strong>in</strong>fluss ausgewählte soziale, regionale <strong>und</strong> betriebliche<br />
Merkmale auf den Wechsel der erwerbstätigen Panelteilnehmer <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
bzw. die Nicht-Erwerbstätigkeit ausüben. Diese Analyse knüpft an die <strong>in</strong> Kapitel 3.3.2 erfolgte<br />
Untersuchung ausgewählter Faktoren der Erwerbsbeteiligung an, nun jedoch fokussiert auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Veränderungen. Die Analyse bedient sich wiederum des Verfahrens der b<strong>in</strong>omialen<br />
logistischen Regression. Abhängige Größe ist – grob gesprochen – die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, mit<br />
der die Erwerbstätigen von 1996 im Jahr 2002 nicht mehr hauptberuflich erwerbstätig s<strong>in</strong>d. 14 Da<br />
e<strong>in</strong> solcher Wechsel im Erwerbsstatus für die Älteren häufiger als für die Jüngeren den endgültigen<br />
Ausstieg aus dem Erwerbsleben bedeutet <strong>und</strong> teilweise anderen E<strong>in</strong>flüssen unterliegt als<br />
Erwerbsunterbrechungen, wird die allgeme<strong>in</strong>e Analyse über den gesamten Altersbereich ergänzt<br />
durch getrennte Modelle für die 40- bis 49-Jährigen <strong>und</strong> die im Jahr 1996 Erwerbstätigen ab 50<br />
Jahren. Auf e<strong>in</strong>e zusätzliche getrennte Untersuchung der Wirkfaktoren bei Männern <strong>und</strong> Frauen<br />
muss wegen der ger<strong>in</strong>gen Fallzahl verzichtet werden. Das Geschlecht wird jedoch als Prädiktor<br />
e<strong>in</strong>bezogen.<br />
Die nachfolgende Tabelle 3.4 gibt Auskunft über Richtung, Stärke <strong>und</strong> statistische Signifikanz<br />
der untersuchten E<strong>in</strong>flussgrößen. Unter anderem zeigt sich der bekannte Alterseffekt: Je später<br />
geboren bzw. je jünger die Panelteilnehmer s<strong>in</strong>d, desto unwahrsche<strong>in</strong>licher ist es, dass sie im<br />
Jahr 2002 nicht mehr erwerbstätig s<strong>in</strong>d. 15 Man kann es auch umgekehrt formulieren: Je älter sie<br />
1996 waren, desto wahrsche<strong>in</strong>licher erfolgte der Wechsel von der Erwerbs- <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit.<br />
Wie der Vergleich zwischen den Personen unter <strong>und</strong> ab 50 Jahren zeigt, existiert dieser<br />
Alterse<strong>in</strong>fluss nur bei der älteren der beiden Altersgruppen. Dies zeigt, dass das Alter hauptsächlich<br />
für den endgültigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben e<strong>in</strong>e signifikante Rolle spielt, während<br />
die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Beendigung e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit im rentenferneren Alter, die<br />
e<strong>in</strong>e kurz- oder langfristige Unterbrechung se<strong>in</strong> kann, nicht signifikant mit dem Alter assoziiert<br />
ist. Wie alle nachfolgend kommentierten Bef<strong>und</strong>e zu Unterschieden <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>samkeiten der<br />
E<strong>in</strong>flüsse zwischen den beiden Altersgruppen ist allerd<strong>in</strong>gs auch dieser Bef<strong>und</strong> zurückhaltend<br />
zu <strong>in</strong>terpretieren, da die Ergebnisse auf e<strong>in</strong>er relativ ger<strong>in</strong>gen Fallzahl beruhen <strong>und</strong> nur der Erwerbsstatus<br />
zu zwei Messzeitpunkten, nicht jedoch der vollständige Verlauf untersucht wird.<br />
14 Die exakte abhängige Größe ist das logarithmierte Verhältnis der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, im Jahr 2002 nicht mehr<br />
hauptberuflich erwerbstätig zu se<strong>in</strong>, zur Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit des Gegenteils.<br />
15 Die mögliche Ausübung e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit im Ruhestand wird hier nicht berücksichtigt, da die Faktoren der<br />
Beendigung der hauptberuflichen Erwerbstätigkeit im Vordergr<strong>und</strong> des Interesses stehen.<br />
89
Tabelle 3.4:<br />
Prädiktoren der Nicht-Erwerbstätigkeit 2002 der im Jahr 1996 erwerbstätigen<br />
Panelteilnehmer (Logistische Regression) 1<br />
Signifikanzniveau: ° = p
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
In beiden Altersgruppen gibt es e<strong>in</strong>e Geschlechtsabhängigkeit der Erwerbsbeendigung oder<br />
-unterbrechung: Unter Kontrolle der anderen Faktoren weisen Frauen e<strong>in</strong>e erheblich höhere<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit als Männer auf, nach sechs Jahren nicht mehr Erwerbstätigkeit zu se<strong>in</strong>. Der<br />
Effekt ist bei den Frauen ab 50 Jahren stärker als im darunter liegenden Alter. Dies dürfte teilweise<br />
mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme der vorgezogenen Altersrente für Frauen zusammenhängen,<br />
aber auch den Wechsel <strong>in</strong> den Hausfrauenstatus be<strong>in</strong>halten. Dafür spricht, dass<br />
die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit des Wechsels <strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit auch bei den unter 50-<br />
Jährigen vom Geschlecht bee<strong>in</strong>flusst wird.<br />
Insgesamt stützen diese geschlechtsdifferierenden Ergebnisse die Vermutung, dass die <strong>in</strong> Kapitel<br />
3.3.1 beschriebenen altersspezifischen Unterschiede der Hausfrauenquote nicht nur auf Kohortenunterschiede<br />
zurückzuführen, sondern zum Teil auch Ergebnis biografischer Wechsel von<br />
der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> den Hausfrauenstatus im mittleren Erwachsenenalter ist.<br />
Während die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, ob man im Alter von 40 bis 64 Jahren überhaupt erwerbstätig<br />
ist, durchaus davon abhängt, ob man <strong>in</strong> Ost- oder Westdeutschland lebt (vgl. Kapitel 3.3.2),<br />
hängt die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Erwerbsbeendigung <strong>in</strong>nerhalb des Untersuchungszeitraums<br />
von 1996 bis 2002 nicht signifikant vom Landesteil ab. Ostdeutsche dieses Alters stehen zwar<br />
etwas seltener im Erwerbsleben als Westdeutsche; diejenigen ab 40, die <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
e<strong>in</strong>en Arbeitsplatz hatten, unterlagen jedoch nach 1996 – unter Kontrolle der anderen<br />
E<strong>in</strong>flüsse – ke<strong>in</strong>em erhöhten Risiko mehr, ihn zu verlieren bzw. <strong>in</strong> den Ruhestand zu wechseln.<br />
Als bedeutsamer für die Erwerbsbeendigung als der Ost-West-Unterschied erweist sich der Urbanitäts-<br />
bzw. Zentralitätsgrad der Region, wobei der Zusammenhang nicht l<strong>in</strong>ear ist. Zu e<strong>in</strong>er<br />
höheren Ausstiegswahrsche<strong>in</strong>lichkeit kommt es nur bei Personen, die <strong>in</strong> peripheren ländlichen<br />
Regionen ohne Anb<strong>in</strong>dung an e<strong>in</strong> Zentrum leben (BIK-Regionsgrößenklasse: < 5000 E<strong>in</strong>wohner).<br />
Zwischen den anderen Regionsklassen gibt es ke<strong>in</strong>e nennenswerten Unterschiede. Der<br />
E<strong>in</strong>fluss der Regionsgröße bzw. -zentralität ist zudem statistisch nur signifikant bei den ab 50-<br />
Jährigen, d.h. er richtet sich im wesentlichen auf den Zeitpunkt des endgültigen Ausstiegs aus<br />
dem Erwerbsleben. Der Zusammenhang der Verbleibswahrsche<strong>in</strong>lichkeit mit der Regionsgröße<br />
unterscheidet sich von dem <strong>in</strong> Kapitel 3.3.2 festgestellten Zusammenhang zwischen Erwerbstätigenquote<br />
<strong>und</strong> Regionsgröße, der auf e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> ländlichen Geme<strong>in</strong>den höhere Erwerbsbeteiligung<br />
der Männer verwies. Allerd<strong>in</strong>gs wurden dort ke<strong>in</strong>e getrennten Analysen für die beiden Altersgruppen,<br />
sondern für die beiden Geschlechter durchgeführt. Die unterschiedlichen Bef<strong>und</strong>e<br />
müssen allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>en Widerspruch bedeuten, da bei e<strong>in</strong>er höheren regionalen Erwerbsbeteiligung<br />
auch mehr Übergänge <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit möglich s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> die – unter Kontrolle<br />
der anderen Faktoren – überdurchschnittliche Erwerbstätigenquote dennoch erhalten bleibt.<br />
E<strong>in</strong>e vertiefende Betrachtung dieser Zusammenhänge soll hier nicht erfolgen, sondern muss<br />
zukünftigen Analysen vorbehalten se<strong>in</strong>.<br />
Die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Erwerbsbeendigung hängt nur bei der älteren der beiden Erwerbstätigengruppen<br />
<strong>und</strong> auch bei dieser nur schwach signifikant mit der Netzwerkgröße zusammen:<br />
Erwerbstätige ab 50 Jahren, die im Jahr 1996 viele Personen angaben, mit denen sie regelmäßig<br />
Kontakt haben <strong>und</strong> die ihnen wichtig s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d mit größerer Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit auch im Jahr<br />
2002 erwerbstätig als diejenigen mit e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en Personennetzwerk. Die Aussicht darauf,<br />
nach dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand weiterh<strong>in</strong> vielfältige Kontakte pflegen zu können <strong>und</strong><br />
91
92<br />
Heribert Engstler<br />
nicht <strong>in</strong> die soziale Isolation zu geraten, fördert demnach nicht die Neigung zum Ausstieg aus<br />
dem Erwerbsleben. E<strong>in</strong> großes soziales Netzwerk zu haben steigert vielmehr die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit,<br />
im Erwerbsprozess zu bleiben. E<strong>in</strong>e höhere Ausstiegswahrsche<strong>in</strong>lichkeit haben h<strong>in</strong>gegen<br />
Personen mit kle<strong>in</strong>em privatem Netzwerk. Inwieweit Erwerbstätige mit e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen<br />
Netzwerkgröße nach der Erwerbsbeendigung e<strong>in</strong>em erhöhten Risiko der sozialen Isolation ausgesetzt<br />
s<strong>in</strong>d, kann hier nicht untersucht werden.<br />
E<strong>in</strong>en starken E<strong>in</strong>fluss auf die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit des Wechsels <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit hat<br />
die Schichtzugehörigkeit. Ob jemand, der 1996 erwerbstätig war, dies im Jahr 2002 nicht mehr<br />
ist, hängt wesentlich von der sozialen Position bzw. der beruflichen Stellung ab. Je nach Alter<br />
weisen die Angehörigen der Unterschicht <strong>und</strong> unteren Mittelschicht gegenüber den Angehörigen<br />
der oberen Mittelschicht e<strong>in</strong> vier- bis fünffach höheres Risiko des zwischenzeitlich erfolgten<br />
Übergangs <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit auf. Die Schichtabhängigkeit ist <strong>in</strong> beiden Altersgruppen<br />
vorhanden. Der E<strong>in</strong>fluss der beruflichen Stellung richtet sich daher nicht nur auf den<br />
Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand, sondern betrifft auch Übergänge <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit aus<br />
anderen Gründen, <strong>in</strong>sbesondere aufgr<strong>und</strong> von Arbeitslosigkeit.<br />
In ähnlicher Weise gestaltet sich der Zusammenhang mit der Branchenzugehörigkeit. Von den<br />
unter 50-Jährigen haben die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes <strong>und</strong> die Erwerbstätigen im<br />
Handel <strong>und</strong> Dienstleistungsbereich e<strong>in</strong>e erheblich höhere Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit als die anderen,<br />
auch im Jahr 2002 noch erwerbstätig zu se<strong>in</strong>. Dar<strong>in</strong> spiegelt sich das ger<strong>in</strong>ge Arbeitslosigkeitsrisiko<br />
im Öffentlichen Dienst <strong>und</strong> die gegenüber dem sek<strong>und</strong>ären Sektor bessere Arbeitsmarktsituation<br />
des tertiären Sektors sowie der höhere Selbstständigenanteil <strong>in</strong> diesem Wirtschaftszweig<br />
wider. Auf die Bleibewahrsche<strong>in</strong>lichkeit der über 50-Jährigen hat – unter Kontrolle der<br />
anderen Faktoren – die Branchenzugehörigkeit h<strong>in</strong>gegen ke<strong>in</strong>en signifikanten E<strong>in</strong>fluss. Die<br />
höhere Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit bei Angehörigen des Öffentlichen Dienstes<br />
beruht daher nicht auf e<strong>in</strong>em späteren Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand, sondern auf dem ger<strong>in</strong>gen<br />
Arbeitslosigkeitsrisiko, dem selteneren Stellenwechsel (unter Inkaufnahme von temporärer<br />
Nicht-Erwerbstätigkeit) <strong>und</strong> den besseren Rückkehrmöglichkeiten nach familienbed<strong>in</strong>gter Erwerbsunterbrechung<br />
(siehe auch Kapitel 3.3.2).<br />
Bezogen auf die Betriebsgröße ergibt sich e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziger signifikanter Zusammenhang: 1996 <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Betrieb mit mehr als 200 Beschäftigten gearbeitet zu haben, erhöht gegenüber Kle<strong>in</strong>betrieben<br />
die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Erwerbsbeendigung bis 2002 von über 50-Jährigen auf das<br />
Dreifache (im Vergleich zur Fortführungswahrsche<strong>in</strong>lichkeit). Dieses Ergebnis verw<strong>und</strong>ert<br />
nicht. Es s<strong>in</strong>d vor allem Großbetriebe, die bis <strong>in</strong> die jüngste Vergangenheit zum Zweck des Abbaus<br />
<strong>und</strong> der Umstrukturierung des Personals Vorruhestandsprogramme aufgelegt haben<br />
(George, 2000; S<strong>in</strong>g, 2003).<br />
Beschäftigte, die Anspruch auf e<strong>in</strong>e Betriebsrente oder Leistungen aus der Zusatzversorgung<br />
des Öffentlichen Dienstes haben, können nach dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand auf e<strong>in</strong> zusätzliches<br />
regelmäßiges <strong>und</strong> gesichertes E<strong>in</strong>kommen (neben den Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
<strong>und</strong> eventuell vorhandenen privaten E<strong>in</strong>kommensquellen) zurückgreifen. Da überwiegend<br />
langjährig <strong>und</strong> gut qualifizierte Beschäftigte Betriebsrentenansprüche haben, lässt<br />
dieses Vorhandense<strong>in</strong> zudem auch überdurchschnittliche Anwartschaften aus der Gesetzlichen
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Alterssicherung <strong>und</strong> die häufigere Erfüllung der Wartezeit für die Inanspruchnahme vorgezogener<br />
Altersrenten erwarten.<br />
Die Aussicht auf dieses Zusatze<strong>in</strong>kommen im Alter führt dennoch zu ke<strong>in</strong>er Wahrsche<strong>in</strong>lichkeitserhöhung<br />
der Erwerbsbeendigung. Im Gegenteil: Die Existenz e<strong>in</strong>es Betriebsrentenanspruchs<br />
verr<strong>in</strong>gert signifikant die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit des Übergangs <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit<br />
im Beobachtungszeitraum, besonders stark bei den unter 50-Jährigen (<strong>und</strong> nur bei diesen<br />
statistisch signifikant). Dies spricht dafür, dass mit diesem Merkmal nicht der positive Effekt<br />
auf das zu erwartende Alterse<strong>in</strong>kommen operationalisiert wird, sondern die höhere Arbeitsplatzsicherheit<br />
der Beschäftigten mit Betriebsrentenanspruch. 16<br />
Die Ausstiegswahrsche<strong>in</strong>lichkeit aus dem Beruf hängt nicht nur von objektiven Strukturmerkmalen<br />
der Erwerbstätigkeit ab, sie wird darüber h<strong>in</strong>aus auch von der subjektiven E<strong>in</strong>schätzung<br />
der beruflichen Situation <strong>und</strong> den persönlichen Plänen der Erwerbstätigen bee<strong>in</strong>flusst.<br />
Wurde die eigene berufliche Situation bei der Erstbefragung im Jahr 1996 nur als mittel oder als<br />
schlecht bis sehr schlecht e<strong>in</strong>gestuft, erhöht dies die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit beträchtlich, im Jahr<br />
2002 nicht mehr erwerbstätig zu se<strong>in</strong>. Dieser Zusammenhang besteht allerd<strong>in</strong>gs statistisch gesichert<br />
nur bei den Erwerbstätigen ab 50 Jahren. E<strong>in</strong>e vergleichsweise schlechte subjektive Bewertung<br />
der beruflichen Situation fördert daher besonders dann den Wechsel <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit,<br />
wenn dieser altersbed<strong>in</strong>gt den endgültigen Abschied aus dem Erwerbsleben <strong>und</strong><br />
den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand ermöglicht. Ältere Arbeitskräfte forcieren ihren Ausstieg aus<br />
der Erwerbsarbeit, wenn sie ihre berufliche Situation als weniger gut e<strong>in</strong>schätzen.<br />
Etwas überraschend hatte e<strong>in</strong>e 1996 als schlecht empf<strong>und</strong>ene subjektive Ges<strong>und</strong>heit nur tendenziell<br />
e<strong>in</strong>en beschleunigenden Effekt auf die Erwerbsbeendigung. Überraschend deshalb, da <strong>in</strong><br />
Kapitel 3.3.2 e<strong>in</strong> starker negativer Zusammenhang zwischen der Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung <strong>und</strong><br />
der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit festgestellt werden konnte. Bezogen auf den<br />
Verbleib <strong>in</strong> der Erwerbstätigkeit weist der Effektkoeffizient <strong>in</strong> Tabelle 3.4 zwar auf e<strong>in</strong>en –<br />
sogar kräftigen – E<strong>in</strong>fluss e<strong>in</strong>er subjektiv schlechten Ges<strong>und</strong>heit auf die Erwerbsbeendigung<br />
h<strong>in</strong>, der jedoch unter Kontrolle der anderen E<strong>in</strong>flüsse se<strong>in</strong>e statistische Signifikanz e<strong>in</strong>büßt. 17<br />
Dies könnte jedoch der ger<strong>in</strong>gen Fallzahl geschuldet se<strong>in</strong>. Immerh<strong>in</strong> wird der Zusammenhang<br />
bei e<strong>in</strong>er akzeptierten Irrtumswahrsche<strong>in</strong>lichkeit von p
94<br />
Heribert Engstler<br />
(ohne Nachweis), hatte ke<strong>in</strong>en zusätzlichen signifikanten Effekt auf das Ausstiegsverhalten der<br />
Panelteilnehmer im Beobachtungszeitraum.<br />
H<strong>in</strong>gegen tragen die 1996 geäußerten Angaben der Befragten, <strong>in</strong> welchem Alter sie ihre Erwerbstätigkeit<br />
zu beenden planen, erheblich zu e<strong>in</strong>er Verbesserung der Vorhersage ihrer Erwerbsbeteiligung<br />
im Jahr 2002 bei. Wurde damals geplant, bis spätestens 2002 <strong>in</strong> die Nicht-<br />
Erwerbstätigkeit zu wechseln, erhöht dies die Ausstiegs- versus Verbleibswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
auf das 3,8-fache gegenüber jenen Befragten, die länger zu arbeiten planten (siehe Tabelle A3.2<br />
im Anhang). Hervorzuheben ist, dass das H<strong>in</strong>zufügen der Erwerbsbeendigungspläne als Prädiktor<br />
zu ke<strong>in</strong>er wesentlichen Änderung der Stärke <strong>und</strong> Signifikanz der anderen E<strong>in</strong>flussgrößen<br />
führt <strong>und</strong> die Erklärungskraft des Modells verbessert. Lediglich der Alters- <strong>und</strong> Geschlechtse<strong>in</strong>fluss<br />
verr<strong>in</strong>gert sich dadurch etwas. Die Erwerbsbeendigungspläne der Arbeitskräfte s<strong>in</strong>d somit<br />
ke<strong>in</strong>e bloße Funktion ihrer soziodemografischen <strong>und</strong> sozioökonomischen Situation, durch die<br />
sie determ<strong>in</strong>iert würden. Sie s<strong>in</strong>d vielmehr als offener, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Ausdruck der Lebensplanung<br />
<strong>und</strong> -bewertung <strong>und</strong> als e<strong>in</strong>e eigenständige E<strong>in</strong>flussgröße auf das Übergangsalter <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand zu begreifen. Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich daher näher mit der Veränderung<br />
der Erwerbsbeendigungspläne <strong>und</strong> deren Realisierung im Zeitraum zwischen 1996 <strong>und</strong><br />
2002.<br />
3.4 Das Ausstiegsalter aus dem Erwerbsleben<br />
3.4.1 Geplantes <strong>und</strong> realisiertes Ausstiegsalter<br />
Es gibt Anzeichen dafür, dass die jahrzehntelange Praxis der sozialverträglichen <strong>und</strong> für die<br />
Betroffenen f<strong>in</strong>anziell relativ gut abgesicherten Frühausgliederung aus dem Erwerbsleben bei<br />
den Beschäftigten zur Herausbildung, eventuell auch Verfestigung der Orientierung auf e<strong>in</strong>en<br />
frühen Ruhestand geführt hat. So weist S<strong>in</strong>g (2003) auf e<strong>in</strong>e von polis durchgeführte repräsentative<br />
Me<strong>in</strong>ungsumfrage aus dem Jahr 2002 h<strong>in</strong>, bei der nahezu zwei Drittel der Berufstätigen<br />
wünschten, mit 55 Jahren oder zwischen 55 <strong>und</strong> 60 Jahren <strong>in</strong> Rente zu gehen. Allerd<strong>in</strong>gs kann<br />
von solchen Wünschen nicht unmittelbar auf handlungsleitende Pläne geschlossen werden. In<br />
den Wünschen kommt das zum Ausdruck, was Menschen gerne machen würden, wenn sie konfligierende<br />
Ziele, Erwartungen Anderer <strong>und</strong> vorhandene Restriktionen nicht zu beachten hätten.<br />
Realistischer s<strong>in</strong>d geäußerte Erwartungen <strong>und</strong> konkret genannte Pläne zum Übergang <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand. So konnte <strong>in</strong> amerikanischen <strong>und</strong> britischen Verlaufsstudien nachgewiesen werden,<br />
dass der tatsächliche Ruhestandsbeg<strong>in</strong>n bei etwa zwei Dritteln maximal 1 Jahr vor oder nach<br />
dem zuvor erwarteten Übergangsalter erfolgt <strong>und</strong> das subjektiv geplante E<strong>in</strong>trittsalter <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand e<strong>in</strong>e hohe Vorhersagekraft für das nachfolgende Übergangsalter besitzt (Haider &<br />
Stephens, 2004; Disney & Tanner 1999; Bernheim 1989). Das geplante Alter der Erwerbsbeendigung<br />
ist nach diesen Studien e<strong>in</strong> guter Indikator für das spätere tatsächliche Beendigungsalter.<br />
Nachfolgend wird untersucht, wie ausgeprägt <strong>in</strong> Deutschland bei Erwerbstätigen ab 40 Jahren<br />
die Erwartung e<strong>in</strong>er frühzeitigen Beendigung des Erwerbslebens vor Erreichen der Regelaltersgrenze<br />
von 65 Jahren ist <strong>und</strong> ob es <strong>in</strong> den vergangenen Jahren zu Veränderungen <strong>in</strong> Richtung
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
e<strong>in</strong>es erwarteten längeren Verbleibs im Erwerbsleben gekommen ist. Damit soll der Frage<br />
nachgegangen werden, ob <strong>und</strong> wie deutlich die Erwerbstätigen den von Staat, Tarifparteien,<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Medien propagierten Paradigmenwechsel zum längeren Verbleib im Erwerbsleben<br />
<strong>in</strong> ihren Absichten <strong>und</strong> Handlungen nachvollziehen. Indikator dafür ist die <strong>Entwicklung</strong><br />
der <strong>in</strong> beiden Wellen des Alterssurveys erhobenen Pläne zur Erwerbsbeendigung. Die Frage an<br />
alle noch nicht im Ruhestand bef<strong>in</strong>dlichen Erwerbstätigen lautete: "Mit welchem Alter planen<br />
Sie, Ihre Erwerbstätigkeit zu beenden?" Genannt werden konnte entweder e<strong>in</strong> konkretes Altersjahr<br />
(mit ... Jahren) oder die Antwort "Weiß noch nicht". Erwartet wird e<strong>in</strong> Rückgang geplanter<br />
Frühausstiege.<br />
Die Darstellung der neueren <strong>Entwicklung</strong> der Erwerbsbeendigungspläne im Vergleich der Querschnitte<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 der deutschen Erwerbstätigen ab 40 Jahren wird ergänzt durch die Untersuchung<br />
des Verhältnisses zwischen dem geplanten <strong>und</strong> realisierten Ausstiegsalter sowie der<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Stabilität von Beendigungsplänen bei den weiterh<strong>in</strong> erwerbstätigen Panelteilnehmern.<br />
Dies lässt zum e<strong>in</strong>en auf die Relevanz <strong>und</strong> Prognosekraft des geplanten Ausstiegsalters<br />
für das tatsächliche Alter der Erwerbsbeendigung schließen, zum anderen liefert es H<strong>in</strong>weise,<br />
<strong>in</strong>wieweit Änderungen <strong>in</strong> den Rahmenbed<strong>in</strong>gungen die persönlichen Kalküle bee<strong>in</strong>flussen können.<br />
Erwartet wird e<strong>in</strong> hoher Übere<strong>in</strong>stimmungsgrad zwischen dem geplanten <strong>und</strong> realisierten<br />
Beendigungsalter bzw. die Ausübung e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit im Jahr 2002, wenn der Ausstieg<br />
für e<strong>in</strong> späteres Jahr geplant war. Erwartet wird zudem bei weiterh<strong>in</strong> Erwerbstätigen im<br />
Durchschnitt e<strong>in</strong>e Verlagerung ihres geplanten Wechsels <strong>in</strong> die Nichterwerbstätigkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong><br />
etwas höheres Alter.<br />
Die querschnittliche Veränderung der Ausstiegspläne zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
Sofern konkrete Vorstellungen zum geplanten Alter der Erwerbsbeendigung vorhanden s<strong>in</strong>d,<br />
konzentrieren sich diese auf e<strong>in</strong>zelne Altersjahre, die stark mit den Altersuntergrenzen für die<br />
Inanspruchnahme der verschiedenen gesetzlichen Altersrenten korrespondieren: Im Jahr 1996<br />
nannten 38 Prozent der Erwerbstätigen ab 40 Jahren das 60. Lebensjahr 18 als geplantes Ausstiegsalter,<br />
10 Prozent das 63. Lebensjahr, <strong>und</strong> 17 Prozent beabsichtigten, mit 65 Jahren aus<br />
dem Erwerbsleben auszuscheiden (Abbildung 3.8). 19 Andere Altersjahre werden nur selten genannt,<br />
am häufigsten noch das 55. <strong>und</strong> 58. Lebensjahr. Fasst man die e<strong>in</strong>zelnen Altersjahre zu<br />
Kategorien zusammen, plante im Jahr 1996 die Hälfte, mit spätestens 60 Jahren aus dem Erwerbsleben<br />
auszuscheiden. Nur 19 Prozent beabsichtigten, bis zum Alter von 65 Jahren erwerbstätig<br />
zu bleiben; 18 Prozent konnten noch ke<strong>in</strong> genaues Altersjahr nennen.<br />
18 Wenn vom Lebensjahr die Rede ist, wird das Jahr genannt, das bei der entsprechenden Altersjahrangabe vollendet<br />
wird (z.B. beim Alter 60 das 60. Lebensjahr).<br />
19 E<strong>in</strong>e etwas anders aufgebaute Darstellung dieses Sachverhalts mit den Daten der ersten Welle des Alterssurveys<br />
f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Kohli 2000. Die ger<strong>in</strong>gen altersspezifischen Unterschiede <strong>in</strong> den Ausstiegsplänen führten ihn zur<br />
Vermutung e<strong>in</strong>er fehlenden Tendenz zur Verlängerung der geplanten Lebensarbeitszeit.<br />
95
96<br />
Heribert Engstler<br />
Abbildung 3.8:<br />
Geplantes Erwerbsbeendigungsalter der Erwerbstätigen ab 40 Jahren, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
(Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
%<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
unter<br />
55<br />
5,1<br />
3,5<br />
1996<br />
2002<br />
4,5<br />
2,2<br />
37,7<br />
27,0<br />
9,5<br />
7,5<br />
18,8<br />
17,1<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66<br />
<strong>und</strong><br />
älter<br />
Geplantes Beendigungsallter der Erw erbstätigkeit (<strong>in</strong> Jahren)<br />
18,3<br />
31,6<br />
Weiß<br />
noch<br />
nicht<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n=1871)<strong>und</strong> 2002 (Replikationsstichprobe, n=1114), gewichtet<br />
Erwerbstätige ohne Bezug e<strong>in</strong>er Altersrente/Pension<br />
%<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
18,3<br />
18,7<br />
12,7<br />
50,3<br />
31,6<br />
19,9<br />
13,6<br />
35,0<br />
1996 2002<br />
weiß noch nicht<br />
mit 65 J. oder später<br />
mit 61 - 64 Jahren<br />
mit 60 J. oder früher<br />
Sechs Jahre später, im Jahr 2002, sehen die Austrittspläne der Erwerbstätigen ab 40 Jahren deutlich<br />
anders aus: Nur noch 35 Prozent planen, spätestens mit 60 Jahren aus dem Erwerbsleben<br />
auszuscheiden. Dieser starke Rückgang um 15 Prozentpunkte bei den geplanten Frühausstiegen<br />
führte jedoch nur zu e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen Zunahme des Anteils derer, die e<strong>in</strong> späteres Beendigungsalter<br />
nennen. Insgesamt stieg der Anteil der Befragten mit e<strong>in</strong>em geplanten Beendigungsalter<br />
jenseits des 60. Lebensjahres nur um 2 Prozentpunkte auf 33,5 Prozent. Statt dessen kam es fast<br />
zu e<strong>in</strong>er Verdoppelung des Anteils derer, die ke<strong>in</strong>e konkreten Angaben zum geplanten Erwerbsbeendigungsalter<br />
machen können (von 18 auf 32%).<br />
Diese <strong>Entwicklung</strong> wird folgendermaßen gedeutet: E<strong>in</strong>erseits haben die zwischen 1996 <strong>und</strong><br />
2002 e<strong>in</strong>geführten Rentenreformmaßnahmen (<strong>in</strong>sbesondere die schrittweise Erhöhung des Berechtigungsalters<br />
für e<strong>in</strong>en vollen Bezug vorgezogener Altersrenten <strong>und</strong> das Erschweren der<br />
Frühausgliederung zu Lasten der Arbeitslosenversicherung) <strong>und</strong> die öffentliche Diskussion über<br />
die Notwendigkeit e<strong>in</strong>es längeren Verbleibs älterer Arbeitnehmer im Erwerbsleben bei den Betroffenen<br />
zu e<strong>in</strong>er markanten Abkehr von der Perspektive des frühen Ruhestands beigetragen.<br />
Andererseits konkretisiert sich dieser Perspektivwechsel noch nicht <strong>in</strong> klaren Erwartungen darüber,<br />
bis zu welchem Alter man persönlich weiter erwerbstätig se<strong>in</strong> wird.<br />
Diese wachsende Ungewissheit hat nicht nur die Erwerbstätigen mittleren Alters erfasst, sondern<br />
auch rentennähere Altersgruppen. So verdoppelte sich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 bei den<br />
55- bis 59-Jährigen der Anteil derer (von 12 auf 23%), die nicht sagen können, <strong>in</strong> welchem<br />
Alter sie aus dem Arbeitsprozess auszuscheiden planen (Abbildung 3.9).
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Abbildung 3.9:<br />
Anteil Erwerbstätiger, die mit 60 Jahren oder früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden<br />
beabsichtigen oder noch ke<strong>in</strong> geplantes Ausstiegsalter nennen können, nach Alter<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)*<br />
% mit 60 J. oder früher<br />
52,4<br />
54,2<br />
52,7<br />
49,8<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
38,9<br />
35,7<br />
40,4<br />
31,3<br />
40-44 45-49 50-54 55-59<br />
Alter der Befragten<br />
% Weiß noch nicht<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
23,0<br />
38,9<br />
19,1<br />
36,8<br />
17,6<br />
27,0<br />
11,9<br />
22,6<br />
1996<br />
2002<br />
15,1<br />
13,4<br />
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64<br />
Alter der Befragten<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n=1340-1756) <strong>und</strong> 2002 (Replikationsstichprobe, n=842-1019), gewichtet<br />
* Die Unterschiede zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 s<strong>in</strong>d für alle Altersgruppen außer den 60- bis 64-Jährigen<br />
statistisch signifikant (Chi²-Test, p
Tabelle 3.5:<br />
Geplantes Ausstiegsalter aus der Erwerbstätigkeit der 40- bis 59-jährigen Frauen<br />
<strong>und</strong> Männer <strong>in</strong> Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland, 1996 <strong>und</strong> 2002 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
98<br />
Heribert Engstler<br />
Geplantes Männer - West Männer - Ost Frauen - West Frauen - Ost<br />
Ausstiegsalter 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
mit 60 J. oder früher 49,3 35,2 29,9 32,5 57,3 36,3 75,5 55,3<br />
mit 61-64 Jahren 16,2 11,9 7,1 4,9 6,8 12,6 5,4 12,3<br />
mit 65 J. oder später 20,3 22,0 46,4 35,0 8,0 12,0 10,3 12,3<br />
Weiß noch nicht 14,2 30,9 16,5 27,6 27,9 39,1 8,7 20,2<br />
Zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n=1340) <strong>und</strong> 2002 (Replikationsstichprobe, n=842), gewichtet<br />
Zu dieser erheblichen Verr<strong>in</strong>gerung hat sicherlich die Anhebung der Altersgrenze für die vorgezogene<br />
– abschlagsfreie – Frauenaltersrente von 60 auf 65 Jahre beigetragen. 20 Hervorzuheben<br />
ist, dass der Rückgang geplanter Frühausstiege bei den Frauen zudem häufiger als bei den Männern<br />
(die ebenfalls von Altersgrenzenanhebungen betroffen s<strong>in</strong>d) zu e<strong>in</strong>er Zunahme derjenigen<br />
geführt hat, die zwischen dem 61. bis 65. Lebensjahr <strong>in</strong> den Ruhestand zu gehen beabsichtigen.<br />
Während bei den Männern bis 2002 <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Verunsicherung zugenommen hat, aber<br />
bis dah<strong>in</strong> nicht mehr Männer als 1996 angaben, voraussichtlich über das 60. Lebensjahr h<strong>in</strong>aus<br />
zu arbeiten, haben die Frauen die Altersgrenzenanhebung subjektiv bereits <strong>in</strong> höherem Maße<br />
nachvollzogen; sie nennen jetzt häufiger e<strong>in</strong> konkretes geplantes Ausstiegsalter zwischen dem<br />
61. <strong>und</strong> 65. Lebensjahr.<br />
Abbildung 3.10:<br />
Differenz 2002 gegenüber 1996 <strong>in</strong> den Angaben zum geplanten Erwerbsbeendigungsalter<br />
nach Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil (<strong>in</strong> Prozent-Punkten)<br />
Veränderung <strong>in</strong> %-Punkten<br />
20<br />
16,7<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-15<br />
-20<br />
-25<br />
-14,1<br />
2,6<br />
11,1 11,3 11,5<br />
-21,0<br />
-20,3<br />
M-West M-Ost F-West F-Ost<br />
mit 60 J. oder früher<br />
mit 61 - 64 Jahren<br />
mit 65 J. oder später<br />
weiß noch nicht<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n=1340) <strong>und</strong> 2002 (Replikationsstichprobe, n=842), gewichtet;<br />
Erwerbstätige im Alter von 40 bis 59 Jahren.<br />
20 E<strong>in</strong>en Überblick über die Altersgrenzenanhebungen gibt Tabelle A3.1 im Anhang.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Gegen den allgeme<strong>in</strong>en Trend e<strong>in</strong>er Abkehr von frühzeitigen Ausstiegsplänen äußern sich die<br />
ostdeutschen Männer. Bei ihnen erhöhte sich die Quote derer, die davon ausgehen, mit spätestens<br />
60 Jahren aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Auch nehmen 2002 deutlich weniger als<br />
1996 an, bis zum 65. Lebensjahr zu arbeiten. Bei dieser abweichenden <strong>Entwicklung</strong> der Ausstiegspläne<br />
ist jedoch zu berücksichtigen, dass ostdeutsche Männer 1996 mit 46 Prozent weit<br />
häufiger als die anderen Gruppen geplant hatten, bis zum 65. Lebensjahr zu arbeiten, <strong>und</strong> dass<br />
das Arbeitslosigkeitsrisiko im Osten stärker zugenommen hat als im Westen. Dennoch planten<br />
die ostdeutschen Männer auch im Jahr 2002 mit 35 Prozent immer noch häufiger e<strong>in</strong> Arbeiten<br />
bis zur Regelaltersgrenze als die westdeutschen Männer oder die ost- <strong>und</strong> westdeutschen Frauen.<br />
Der Abstand hat sich allerd<strong>in</strong>gs verkle<strong>in</strong>ert.<br />
Insgesamt beabsichtigten diejenigen mit konkreten Vorstellungen zum Ausstiegsalter bei der<br />
Erhebung 2002 im Durchschnitt mit 61,6 Jahren aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Frauen<br />
planen e<strong>in</strong> früheres Erwerbsende als Männer, Westdeutsche e<strong>in</strong> früheres als Ostdeutsche. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
s<strong>in</strong>d die Geschlechts- <strong>und</strong> Ost-West-Unterschiede <strong>in</strong> den vergangenen Jahren kle<strong>in</strong>er geworden.<br />
Am stärksten angestiegen ist das geplante Beendigungsalter im Ost-West- <strong>und</strong> Geschlechtervergleich<br />
bei den westdeutschen Frauen (vgl. Engstler, 2004, S.13).<br />
Geplantes <strong>und</strong> tatsächliches Ausstiegsalter im <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Erwerbsverlauf<br />
In welchem Verhältnis stehen die geäußerten Pläne der Beendigung bzw. Fortführung der Erwerbstätigkeit<br />
mit dem weiteren Handeln der Befragten? Setzen sie ihre Pläne <strong>in</strong> die Tat um?<br />
Steigen sie früher aus oder bleiben sie länger erwerbstätig als geplant? Ändern sich ihre Pläne?<br />
Zur Klärung dieser Fragen werden als erstes die 1996er Angaben der im Jahr 2002 erneut befragten<br />
Panelteilnehmer mit ihrem Erwerbsstatus zum Zeitpunkt der zweiten Befragung <strong>und</strong> –<br />
sofern e<strong>in</strong> Ausstieg erfolgte – dem realisierten Beendigungsjahr ihrer Erwerbstätigkeit verglichen.<br />
Dabei lassen sich drei Gruppen unterscheiden: 21<br />
Gruppe 1 (G1): Geplantes Ausstiegsalter zum Zeitpunkt der Befragung 2002 bereits erreicht<br />
Gruppe 2 (G2): Geplantes Ausstiegsalter noch nicht erreicht<br />
Gruppe 3 (G3): Befragte, die 1996 noch ke<strong>in</strong> geplantes Ausstiegsalter nennen konnten<br />
Tabelle 3.6 gibt Auskunft darüber, welchen Erwerbsstatus diese drei Gruppen der Panelteilnehmer<br />
zum Zeitpunkt der Zweitbefragung im Jahr 2002 hatten. Unterschieden werden aktiv Erwerbstätige<br />
(ohne im Ruhestand bef<strong>in</strong>dliche Erwerbstätige <strong>und</strong> Personen <strong>in</strong> der Freistellungsphase<br />
der Altersteilzeit), Personen im Ruhestand (ungeachtet e<strong>in</strong>er evtl. vorliegenden Erwerbstätigkeit)<br />
<strong>und</strong> sonstige Nicht-Erwerbstätige.<br />
Es zeigt sich, dass der Erwerbsstatus 2002 weitgehend konform geht mit den im Jahr 1996 gemachten<br />
Angaben zum geplanten Beendigungsalter. 81 Prozent derer, die 1996 planten, ihre<br />
Erwerbstätigkeit im Laufe der nächsten sechs Jahre zu beenden, haben dies auch getan; 94 Prozent<br />
davon bef<strong>in</strong>den sich im Ruhestand. Umgekehrt g<strong>in</strong>gen 78 Prozent derer, die beabsichtigten,<br />
21 Die Zuordnung zur Gruppe G1 oder G2 erfolgte unter der Annahme, dass der geplante Beendigungszeitpunkt am<br />
Ende des Monats liegt, <strong>in</strong> dem die Befragten das genannte Altersjahr vollenden. Dieses Vorgehen lässt sich damit<br />
begründen, dass der Rentene<strong>in</strong>tritt überwiegend im Monat nach Vollendung e<strong>in</strong>es Altersjahres erfolgte.<br />
99
100<br />
Heribert Engstler<br />
noch m<strong>in</strong>destens sechs Jahre erwerbstätig zu bleiben, zum Zeitpunkt der Zweitbefragung im<br />
Jahr 2002 tatsächlich e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit nach. Nur 7 Prozent waren entgegen anderslautender<br />
Pläne bereits im Ruhestand, 14 Prozent jedoch aus anderen Gründen nicht erwerbstätig, vor<br />
allem aufgr<strong>und</strong> von Arbeitslosigkeit. E<strong>in</strong> Drittel derer, die 1996 noch ke<strong>in</strong>e konkreten Vorstellungen<br />
darüber hatten, bis zu welchem Alter sie voraussichtlich erwerbstätig bleiben werden,<br />
s<strong>in</strong>d im Jahr 2002 nicht mehr erwerbstätig; allerd<strong>in</strong>gs bef<strong>in</strong>den sich nur 12 Prozent im Ruhestand,<br />
22 Prozent s<strong>in</strong>d aus anderen Gründen nicht erwerbstätig, häufig aufgr<strong>und</strong> von Arbeitslosigkeit/Vorruhestand.<br />
Tabelle 3.6:<br />
Erwerbsstatus 2002 der im Jahr 1996 erwerbstätigen Panelteilnehmer, je nach<br />
ursprünglich geplantem Ausstiegszeitpunkt (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
1996 geplantes Ausstiegsalter<br />
ist bei Zweitbefragung<br />
2002...:<br />
Aktiv<br />
erwerbstätig 1<br />
Erwerbsstatus 2002<br />
Im<br />
Ruhestand 2<br />
Sonstige<br />
Nicht-<br />
Erwerbstätige<br />
Gesamt<br />
(= 100%)<br />
bereits erreicht (G1) 18,8 76,5 4,7 149<br />
noch nicht erreicht (G2) 78,2 7,3 14,4 436<br />
1996 ke<strong>in</strong> Jahr genannt (G3) 66,2 12,2 21,6 139<br />
Gesamt 63,7 22,5 13,8 724<br />
Quelle: Alterssurvey 1996/2002 – Panelstichprobe (n=751), gewichtet<br />
1 ohne im Ruhestand bef<strong>in</strong>dliche Erwerbstätige <strong>und</strong> ohne Personen <strong>in</strong> der Freistellungsphase der Altersteilzeit<br />
2 Bezieher von Altersrente/Pension oder Frührente, ungeachtet e<strong>in</strong>er evtl. Erwerbstätigkeit<br />
Insgesamt setzte also die große Mehrheit ihre Ausstiegspläne <strong>in</strong> die Tat um. Allerd<strong>in</strong>gs war<br />
2002 immerh<strong>in</strong> e<strong>in</strong> gutes Fünftel (22%) nicht erwerbstätig, obwohl dies nach ihren eigenen Plänen<br />
erst später e<strong>in</strong>treten sollte. Der Anteil der – entgegen damaliger Pläne – nicht mehr Erwerbstätigen<br />
ist dabei <strong>in</strong> Ostdeutschland mit 31 Prozent signifikant höher als <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern<br />
(19%), während es ke<strong>in</strong>en signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern<br />
gibt.<br />
Für die zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 von der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit gewechselten<br />
Panelteilnehmer lässt sich als Zweites die zeitliche Differenz zwischen dem geplanten<br />
<strong>und</strong> tatsächlichen Zeitpunkt der Erwerbsbeendigung angeben.<br />
Wie nachfolgende Abbildung 3.11 zeigt, beendeten 44 Prozent der nicht mehr Erwerbstätigen<br />
mit vormals konkreten Vorstellungen zum Austrittsalter ihre Erwerbstätigkeit maximal e<strong>in</strong> Jahr<br />
früher oder später als geplant. Von denen, die <strong>in</strong> den Ruhestand gewechselt s<strong>in</strong>d, beendeten 60<br />
Prozent ihre Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> etwa zum geplanten Zeitpunkt. Demgegenüber erfolgte der<br />
Wechsel <strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit derer, die 2002 noch nicht im Ruhestand s<strong>in</strong>d, größtenteils<br />
früher als geplant. Hauptgr<strong>und</strong> dafür war der E<strong>in</strong>tritt von Arbeitslosigkeit. Diese Arbeitslosen<br />
s<strong>in</strong>d im Durchschnitt 54 Jahre alt. Vermutlich wird dieser Übergang für die meisten von<br />
ihnen den endgültigen Abschied vom Erwerbsleben bedeuten, da die Rückkehrwahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
von Arbeitslosen <strong>in</strong> diesem Alter ger<strong>in</strong>g ist (vgl. Koller, Bach & Brixy, 2003).
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Abbildung 3.11:<br />
Zeitliche Differenz* zwischen geplantem <strong>und</strong> realisiertem Ausstiegsalter bei Panelteilnehmern,<br />
die zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 ihre hauptberufliche Erwerbstätigkeit beendet haben<br />
%<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
7,2 9,2<br />
7,0<br />
26,1<br />
11,1<br />
21,7<br />
26,9<br />
Panelteilnehmer<br />
mit beendeter<br />
Erwerbstätigkeit,<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
8,8<br />
37,4<br />
13,6<br />
19,2<br />
12,0<br />
Personen im<br />
Ruhestand<br />
3,2<br />
27,1<br />
59,1<br />
10,6<br />
Sonstige Nicht-<br />
Erw.tätige<br />
Erwerbsbeendigung<br />
2-4 J. später<br />
1 Jahr später<br />
wie geplant<br />
1 Jahr früher<br />
2 bis 5 J. früher<br />
6 u.mehr J. früher<br />
als geplant<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 <strong>und</strong> 2002 (Panelteilnehmer), gewichtet<br />
* Zeitliche Differenz = Ausstiegsjahr – Kalenderjahr des geplanten Ausstiegsalters<br />
64 Prozent der 1996 erwerbstätigen Panelteilnehmer waren auch im Jahr 2002 erwerbstätig.<br />
Diese wurden erneut gefragt, mit welchem Alter sie planen, ihre hauptberufliche Erwerbstätigkeit<br />
zu beenden. Zwei Drittel davon haben bei beiden Befragungen e<strong>in</strong> konkretes Altersjahr<br />
genannt. Im Durchschnitt haben diese Personen ihr geplantes Ausstiegsalter um knapp 1 Jahr<br />
nach oben verändert. Während sie 1996 mit 61 Jahren aufzuhören planten, beabsichtigten sie<br />
2002, mit 62 Jahren aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. H<strong>in</strong>ter diesem Anstieg des Mittelwerts<br />
stehen jedoch Veränderungen <strong>in</strong> beide Richtungen. So planten 23 Prozent im Jahr 2002<br />
e<strong>in</strong>en früheren Ausstieg als 1996, 39 Prozent e<strong>in</strong>en späteren; 39 Prozent nannten das gleiche<br />
Alter wie 1996.<br />
Bezieht man auch diejenigen e<strong>in</strong>, die 1996 ke<strong>in</strong> konkretes Beendigungsalter nennen konnten,<br />
ergibt sich folgendes Bild: Von den im Jahr 2002 unter 60-Jährigen Erwerbstätigen, die 1996<br />
planten, mit spätesten 60 Jahren ihre Erwerbstätigkeit zu beenden, blieben 55 Prozent bei dieser<br />
Absicht des frühen Ausstiegs; 28 Prozent möchten nun länger arbeiten (Tabelle 3.7). 39 Prozent<br />
derer, die ursprünglich bis zum Alter 65 arbeiten wollten, planen nun e<strong>in</strong>en früheren Ausstieg.<br />
Exakt die Hälfte derer, die 1996 noch ke<strong>in</strong>e konkreten Pläne nennen konnten, haben 2002 konkrete<br />
Vorstellungen zum Ausstiegsalter; die Mehrzahl davon beabsichtigt mit spätestens 60<br />
Jahren aufzuhören. Interessant ist, dass umgekehrt r<strong>und</strong> 16 Prozent der Panelteilnehmer, die<br />
1996 e<strong>in</strong> konkretes Altersjahr für ihre geplante Erwerbsbeendigung nennen konnten, im Jahr<br />
2002 mit „weiß noch nicht“ antworten. Am häufigsten erfolgte dieser Wechsel <strong>in</strong> die Offenheit,<br />
wenn ursprünglich e<strong>in</strong> früher Ausstieg geplant war. Hier zeigt sich erneut, dass die Abkehr von<br />
e<strong>in</strong>em früh vorgesehenen Ausstieg aus dem Erwerbsleben bis 2002 nur teilweise mit neuen<br />
konkreten Vorstellungen darüber e<strong>in</strong>hergeht, wie lange man voraussichtlich erwerbstätig se<strong>in</strong><br />
wird.<br />
101
102<br />
Heribert Engstler<br />
Tabelle 3.7:<br />
Im Jahr 2002 geplantes Ausstiegsalter der Panelteilnehmer unter 60 Jahren, je nach deren<br />
geplantem Ausstiegsalter im Jahr 1996 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Geplantes Beendigungsalter<br />
1996<br />
mit 60 J.<br />
oder früher<br />
Geplantes Beendigungsalter 2002<br />
mit 61-64<br />
Jahren<br />
mit 65 J.<br />
oder später<br />
Weiß noch<br />
nicht<br />
Gesamt<br />
(= 100%)<br />
mit 60 J. oder früher 54,5 13,0 15,0 17,5 200<br />
mit 61-64 Jahren 29,2 37,5 22,9 10,4 48<br />
mit 65 J. oder später 21,3 17,5 47,5 13,8 80<br />
Weiß noch nicht 31,7 11,0 7,3 50,0 82<br />
Gesamt 40,5 16,3 20,7 22,4 410<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 <strong>und</strong> 2002 (Panelteilnehmer), gewichtet<br />
Alles <strong>in</strong> allem blieb – gemessen an den Alterskategorien der geplanten Erwerbsbeendigung –<br />
r<strong>und</strong> die Hälfte der weiterh<strong>in</strong> erwerbstätigen Panelteilnehmer bei ihren 1996 gemachten Angaben<br />
(siehe durch Fettdruck hervorgehobene Werte <strong>in</strong> Tabelle 3.7).<br />
Änderungen <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>es längeren Verbleibs im Erwerbsleben kommen häufiger vor als<br />
umgekehrt. Zudem nimmt mit dem Älterwerden der Anteil derer ab, die noch ke<strong>in</strong>e konkreten<br />
Vorstellungen zum geplanten Ausstiegsalter haben. Dennoch ist e<strong>in</strong> Teil der Befragten im Laufe<br />
der sechs Jahre wieder unsicherer geworden.<br />
Fazit<br />
Die 1996 festgestellten Erwerbsbeendigungspläne standen noch ganz im Zeichen der Erwartungshaltung,<br />
frühzeitig aus dem Erwerbsleben <strong>in</strong> den Ruhestand zu wechseln: Damals plante<br />
die Hälfte der Erwerbstätigen ab 40 Jahren, mit spätestens 60 Jahren auszuscheiden. Selbst von<br />
den 40- bis 49-Jährigen beabsichtigte jeder Zweite die Beendigung der Erwerbstätigkeit im Alter<br />
von 60 Jahren oder früher. Der durch Änderungen im Renten- <strong>und</strong> Arbeitsförderungsrecht<br />
begleitete Paradigmenwechsel vom frühen zum späteren Ausstieg aus dem Erwerbsleben auf<br />
der Makroebene führte anschließend jedoch zu e<strong>in</strong>em bemerkenswerten E<strong>in</strong>bruch <strong>in</strong> den Erwartungen<br />
e<strong>in</strong>es frühen Ruhestands. Allerd<strong>in</strong>gs konkretisierte sich die Abkehr von der Perspektive<br />
des Frühausstiegs zum<strong>in</strong>dest bis 2002 noch nicht <strong>in</strong> klaren Erwartungen darüber, wie viel länger<br />
man voraussichtlich im Arbeitsprozess verbleiben wird. Statt dessen nahm bei den Erwerbstätigen<br />
die Ungewissheit über die voraussichtliche Länge ihres Erwerbslebens zu. E<strong>in</strong>erseits ist den<br />
Erwerbstätigen bewusst, dass die Zeit der Frühausgliederungen <strong>und</strong> Frühverrentungen ihren<br />
Zenit überschritten hat; vielen fehlten jedoch zum<strong>in</strong>dest im Jahr 2002 noch neue biografische<br />
Orientierungspunkte für den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. Teilweise wird noch an unrealistisch<br />
frühen Ausstiegsplänen festgehalten, die vermutlich nicht oder nur mit erheblichen E<strong>in</strong>bußen<br />
des Alterse<strong>in</strong>kommens realisiert werden können. Dies lässt vermuten, dass viele die Relevanz<br />
der bereits gesetzten Rechtsänderungen für ihre zukünftigen Möglichkeiten des Erwerbsaus-
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
stiegs noch nicht richtig erkannt haben. E<strong>in</strong>e verbesserte Aufklärung über die Rechtssituation<br />
<strong>und</strong> die Neuregelungen könnte Abhilfe schaffen.<br />
Es ist zu erwarten, dass die im Jahr 2002 zu beobachtende Verunsicherung allmählich e<strong>in</strong>er<br />
Neuorientierung auf e<strong>in</strong>en längeren Verbleib im Erwerbsleben mit konkreteren Vorstellungen<br />
zum Zeitpunkt des Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand weicht. Die angehobenen Altersgrenzen für den<br />
– abschlagsfreien – Beg<strong>in</strong>n der vorgezogenen Altersrenten <strong>und</strong> die steigende Bedeutung der<br />
Regelaltersgrenze für den Rentenzugang dürften als neue biografische Orientierungspunkte<br />
aufgegriffen werden. Die Frauen orientieren sich daran offensichtlich jetzt schon stärker als die<br />
Männer.<br />
Bestätigt hat sich die Vermutung e<strong>in</strong>er weitgehenden Übere<strong>in</strong>stimmung zwischen dem geplanten<br />
<strong>und</strong> dem nachfolgend realisierten Beendigungsalter: Von denen, die 1996 planten, höchstens<br />
noch 6 Jahre erwerbstätig zu se<strong>in</strong>, standen im Jahr 2002 tatsächlich 81 Prozent nicht mehr im<br />
Erwerbsleben. Von denen, die <strong>in</strong> den Ruhestand gewechselt s<strong>in</strong>d, beendeten 60 Prozent ihre<br />
Erwerbstätigkeit maximal 1 Jahr vor oder nach dem 1996 geplanten Beendigungszeitpunkt. Die<br />
Ausstiegspläne der älteren Erwerbstätigen s<strong>in</strong>d damit e<strong>in</strong> guter Indikator für den späteren Übergang<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand. Demgegenüber erfolgte die Erwerbsbeendigung derer, die 2002 noch<br />
nicht im Ruhestand s<strong>in</strong>d, größtenteils früher als geplant. Hauptgr<strong>und</strong> dafür war der E<strong>in</strong>tritt von<br />
Arbeitslosigkeit.<br />
3.4.2 Das Alter der Erwerbsbeendigung verschiedener Ruhestandsgenerationen<br />
Im Folgenden wird abschließend die bisherige <strong>Entwicklung</strong> des Beendigungsalters <strong>in</strong> der Abfolge<br />
der Geburtsjahrgänge dargestellt, die sich bereits vollständig oder zu großen Teilen im<br />
Ruhestand bef<strong>in</strong>den. Gr<strong>und</strong>lage s<strong>in</strong>d die Angaben der Bezieher<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Bezieher von Altersrente<br />
<strong>und</strong> der anderen nicht mehr erwerbstätigen Personen ab 60 Jahren zum Beendigungsalter<br />
ihrer – hauptberuflichen – Erwerbstätigkeit. 22 Anhand dieser Angaben lässt sich die kohortenspezifische<br />
Verteilung der Ausstiegszeitpunkte auf die e<strong>in</strong>zelnen Altersjahre ermitteln <strong>und</strong> feststellen,<br />
wie viel Prozent der jetzt im Ruhestand Bef<strong>in</strong>dlichen e<strong>in</strong>es Geburtsjahrgangs <strong>in</strong> jedem<br />
e<strong>in</strong>zelnen zurückliegenden Altersjahr noch erwerbstätig waren.<br />
Abbildung 3.12 gibt Auskunft darüber, welchen Verlauf die Erwerbstätigenquote der Geburtskohorten<br />
1917 bis 1942 (d.h. der 60- bis 85-Jährigen) zwischen dem 55. <strong>und</strong> 65. Lebensjahr<br />
nahm. Zu berücksichtigen ist dabei, dass bei der Erhebung im Jahr 2002 e<strong>in</strong> Fünftel der jüngsten<br />
Kohortengruppe (Jahrgänge 1938/42) ihre hauptberufliche Erwerbstätigkeit noch nicht beendet<br />
hatte (siehe Tabelle 3.1 auf Seite 77) <strong>und</strong> die Ergebnisse der ältesten Geburtsjahrgänge<br />
(1917/22) aufgr<strong>und</strong> der geschlechtsspezifischen Unterschiede der Lebenserwartung <strong>in</strong> höherem<br />
Maße durch die Erwerbsbiografien der Frauen geprägt s<strong>in</strong>d.<br />
22 Die Frage lautete: "Bis zu welchem Jahr waren Sie hauptberuflich erwerbstätig?". Nicht e<strong>in</strong>bezogen s<strong>in</strong>d Personen,<br />
die – nach e<strong>in</strong>er möglichen Berufsausbildung – nie hauptberuflich erwerbstätig gewesen s<strong>in</strong>d: Diese können<br />
ke<strong>in</strong>e Angaben zum Beendigungszeitpunkt machen <strong>und</strong> wurden daher auch nicht danach gefragt. Deren Anteil ist<br />
<strong>in</strong>sgesamt ger<strong>in</strong>g. Von den 40- bis 85-Jährigen des Jahres 2002 waren es nur 2,5%.<br />
103
104<br />
Heribert Engstler<br />
Die Verläufe dieser beiden Kohortengruppen s<strong>in</strong>d daher mit denen der anderen Geburtsjahrgänge<br />
nur e<strong>in</strong>geschränkt vergleichbar. Um dennoch e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druck von der zu erwartenden Gesamtverteilung<br />
der Austrittsalter <strong>in</strong> der jüngsten Kohortengruppe zu erhalten, wurde das Beendigungsalter<br />
der noch erwerbstätigen 60- bis 64-Jährigen anhand des bekannten Beendigungsalters<br />
der über das 60. Lebensjahr h<strong>in</strong>aus erwerbstätig gewesenen 65- bis 69-Jährigen geschätzt.<br />
Unter E<strong>in</strong>bezug dieser Schätzung ergibt sich für die Geburtsjahrgänge 1938/42 der mit gestrichelter<br />
L<strong>in</strong>ie dargestellte erwartete altersspezifische Rückgang der Erwerbstätigenquote.<br />
Betrachtet man zunächst nur die allgeme<strong>in</strong>e kohortenspezifische <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong> lässt die besonders<br />
bei den älteren Kohorten bestehenden geschlechtsspezifischen Verlaufsunterschiede<br />
<strong>und</strong> die Ost-West-Differenzen vorerst noch außer acht, belegen die Verlaufskurven den allgeme<strong>in</strong>en<br />
Trend zur Vorverlagerung des Ausstiegs aus dem Erwerbsleben <strong>in</strong> den vergangenen<br />
Jahrzehnten. 23 Die Erwerbsbeteiligung der 1933/37 Geborenen g<strong>in</strong>g nach dem 55. Lebensjahr<br />
stärker zurück als bei den beiden vorherigen Kohortengruppen. Über das 60. Lebensjahr h<strong>in</strong>aus<br />
hauptberuflich erwerbstätig waren von den Jahrgängen 1933/37 nur 33 Prozent, gegenüber 42<br />
Prozent der Jahrgänge 1928/32 <strong>und</strong> 46 Prozent der Jahrgänge 1923/27.<br />
Abbildung 3.12:<br />
Beendigungsalter der hauptberuflichen Erwerbstätigkeit nach Alter<br />
bzw. Kohortenzugehörigkeit<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
% 40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
1938/42 (geschätzt)<br />
1938/42<br />
1933/37<br />
1928/32<br />
1923/27<br />
1917/22<br />
0<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65<br />
Anteil der AltersrentnerInnen <strong>und</strong> Nicht-Erw erbstätigen ohne Altersrente,<br />
die über e<strong>in</strong> Alter von ... Jahren h<strong>in</strong>aus erw erbstätig w aren<br />
Quelle: Alterssurvey 2002 - Replikationsstichprobe (n=1533), gewichtet<br />
23 Dies zeigen auch die <strong>in</strong> ähnlicher Weise aufbereiteten Daten der ersten Welle des Alterssurveys (vgl. Kohli 2000;<br />
Künem<strong>und</strong> 2001, S.56).
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Von den bereits im Ruhestand bef<strong>in</strong>dlichen oder aus anderen Gründen nicht Erwerbstätigen der<br />
Geburtsjahrgänge 1938/42 waren nur 17 Prozent über das 60. Lebensjahr h<strong>in</strong>aus erwerbstätig<br />
gewesen. Zählt man allerd<strong>in</strong>gs die noch im Arbeitsprozess Stehenden dieser Geburtsjahrgänge<br />
h<strong>in</strong>zu, s<strong>in</strong>d es 35 Prozent. Mit 63 Jahren s<strong>in</strong>d von den Jahrgängen 1938/42 voraussichtlich nur<br />
noch 10 Prozent hauptberuflich erwerbstätig, verglichen mit 15 Prozent der Jahrgänge 1933/37<br />
<strong>und</strong> 25 Prozent der Jahrgänge 1923/27. Wie die Zahlen der älteren Kohorten zeigen, blieb auch<br />
<strong>in</strong> früheren Jahrzehnten nur e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>derheit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze erwerbstätig.<br />
Selbst von den heute 75- bis 85-Jährigen (Geburtsjahrgänge 1917/27) waren nur 19 Prozent bis<br />
zum 65. Lebensjahr hauptberuflich erwerbstätig. Die oft gehörte Forderung, es sollten wieder<br />
mehr Menschen bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze im Arbeitsprozess bleiben, geht häufig<br />
von falschen Vorstellungen über das Erwerbsbeendigungsalter früherer Generationen aus. Diese<br />
Forderung mag aus vielerlei Gründen berechtigt se<strong>in</strong>, der Verweis auf die Vergangenheit liefert<br />
jedenfalls ke<strong>in</strong>e ausreichende Begründung. Dies würde erst recht für den Vorschlag des H<strong>in</strong>ausschiebens<br />
des Ruhestandsbeg<strong>in</strong>ns über das 65. Lebensjahr gelten. 24 Denn auch die älteren Jahrgänge<br />
befanden sich mit spätestens 65 Jahren nahezu komplett im Ruhestand. Dieses Muster hat<br />
sich seither verfestigt.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> der jüngsten betrachteten Geburtsjahrgangsgruppe (Jahrgänge 1938/42) lässt<br />
noch ke<strong>in</strong>e Umkehr, aber e<strong>in</strong>e spürbare Abschwächung des Trends zum frühzeitigen Übergang<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand erkennen. Die kohortenspezifisch aufbereiteten Zahlen des Alterssurveys<br />
zeichnen damit e<strong>in</strong> noch nicht ganz so optimistisches Bild wie die <strong>in</strong> Abbildung 3.1 auf Seite 67<br />
berichteten Zeitreihenergebnisse des Mikrozensus zur Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-<br />
Jährigen. Da die Bef<strong>und</strong>e des Alterssurveys zum Erwerbsbeendigungsalter der 60- bis 64-<br />
Jährigen (Jahrgänge 1938/42) zum Teil auf Schätzungen beruhen, für die das Ausstiegsverhalten<br />
der etwas älteren Jahrgänge herangezogen wurde, ist e<strong>in</strong>e weitere Verzögerung der Erwerbsbeendigung<br />
nicht auszuschließen. Es zeichnet sich ab, dass der Trend zum frühen Übergang <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand se<strong>in</strong> - vorläufiges – Ende gef<strong>und</strong>en hat. Man kann erwarten, dass zukünftig mehr<br />
Frauen <strong>und</strong> Männer über das 60. Lebensjahr h<strong>in</strong>aus im Beruf bleiben <strong>und</strong> auch mehr Menschen<br />
wieder bis zum Erreichen der derzeitigen Regelaltersgrenze erwerbstätig se<strong>in</strong> werden, zumal als<br />
nächstes die außergewöhnlich schwach besetzten Geburtsjahrgänge 1943 bis 1947 folgen. Dass<br />
allerd<strong>in</strong>gs mehr Menschen freiwillig erst nach dem 65. Lebensjahr <strong>in</strong> die Rente gehen werden,<br />
ersche<strong>in</strong>t angesichts der berichteten Erwerbsbeendigungspläne <strong>und</strong> der nahezu fehlenden Praxis<br />
e<strong>in</strong>es solch späten Übergangs <strong>in</strong> der jüngeren Vergangenheit sowie der überaus ger<strong>in</strong>gen Inanspruchnahme<br />
der Teilrente (vgl. Künem<strong>und</strong>, 2001, S.58) eher unwahrsche<strong>in</strong>lich.<br />
Bei den <strong>in</strong> Abbildung 3.12 dargestellten kohortenspezifischen Rückgängen der Erwerbsbeteiligung<br />
mit steigendem Alter handelt es sich um Durchschnittswerte aus dem Ausstiegsverhalten<br />
aller Angehörigen der jeweiligen Geburtsjahrgänge. Dah<strong>in</strong>ter verbergen sich teilweise erhebliche<br />
Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen.<br />
24 Die Forderung nach e<strong>in</strong>er Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre wird jedoch meist mit der besseren Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Leistungsfähigkeit der heute <strong>und</strong> zukünftig 65-Jährigen oder schlicht mit der Notwendigkeit zur Stabilisierung<br />
des Beitragssatzes <strong>in</strong> der Gesetzlichen Rentenversicherung begründet (vgl. B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Soziale Sicherung, 2003).<br />
105
106<br />
Heribert Engstler<br />
Bedeutsame Differenzen bestehen – wie bereits erwähnt – zwischen Männern <strong>und</strong> Frauen <strong>und</strong><br />
zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland. Zur Verdeutlichung dieser Differenzen werden <strong>in</strong> Abbildung<br />
3.13 die Erwerbsbeteiligungsverläufe der im Jahr 2002 65- bis 69-jährigen <strong>und</strong> 70- bis<br />
74-jährigen Männer <strong>und</strong> Frauen <strong>in</strong> den alten <strong>und</strong> neuen B<strong>und</strong>esländern zwischen dem 55. <strong>und</strong><br />
65. Lebensjahr gegenüber gestellt. Ersichtlich wird der starke Rückgang des Erwerbsbeendigungsalters<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>und</strong> die im Westen besonders ausgeprägte Geschlechterdifferenz.<br />
Die 1928/32 geborenen ostdeutschen Männer waren mit 55 Jahren nahezu alle noch erwerbstätig<br />
(97%). Bis zum Alter von 59 Jahren verr<strong>in</strong>gerte sich dieser Anteil auf 84 Prozent, um anschließend<br />
rapide zurückzugehen. Die meisten Wechsel <strong>in</strong> die Nacherwerbsphase erfolgten mit<br />
60 <strong>und</strong> mit 65 Jahren. Bei den ostdeutschen Frauen der Jahrgänge 1928/32 konzentrierte sich<br />
die Erwerbsbeendigung – ausgehend von e<strong>in</strong>er ähnlich hohen Erwerbsbeteiligung wie die der<br />
Männer – sehr stark auf das 60. Lebensjahr: Vom 59. auf das 60. Altersjahr fiel ihre Erwerbstätigenquote<br />
von 72 auf 18 Prozent, wofür <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie der Wechsel <strong>in</strong> die vorgezogene Altersrente<br />
für Frauen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr verantwortlich war. Die fünf Jahre später<br />
geborenen ostdeutschen Frauen <strong>und</strong> Männer standen schon mit 55 Jahren wesentlich häufiger<br />
nicht mehr im Erwerbsleben, wobei der Rückgang bei den Frauen stärker war (von 96 auf 67%)<br />
als bei den Männern (von 97 auf 82%). Am starken Abfall der Erwerbsbeteiligung zeigt sich<br />
deutlich die massenhafte Frühausgliederung der älteren ostdeutschen Arbeitskräfte aus dem<br />
Erwerbsleben im Zuge der Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft nach der Wiedervere<strong>in</strong>igung.<br />
Abbildung 3.13:<br />
Beendigungsalter der hauptberuflichen Erwerbstätigkeit der 65- bis 74-Jährigen des Jahres<br />
2002, nach Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
%<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
West<br />
M 1928/32<br />
M 1933/37<br />
F 1928/32<br />
F 1933/37<br />
0<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65<br />
Anteil der AltersrentnerInnen <strong>und</strong> Nicht-<br />
Erw erbstätigen ohne Altersrente, die über e<strong>in</strong> Alter<br />
von ... Jahren h<strong>in</strong>aus erw erbstätig w aren<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
%<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Ost<br />
M 1933/37<br />
M 1928/32<br />
F 1933/37<br />
F 1928/32<br />
0<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65<br />
Anteil der AltersrentnerInnen <strong>und</strong> Nicht-<br />
Erw erbstätigen ohne Altersrente, die über e<strong>in</strong> Alter<br />
von ... Jahren h<strong>in</strong>aus erw erbstätig w aren<br />
Quelle: Alterssurvey 2002 - Replikationsstichprobe, n=450 (West), n=230 (Ost)
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Die große Mehrheit der heute 65- bis 69-Jährigen Ostdeutschen beendete ihr Erwerbsleben<br />
schon vor Vollendung des 60. Lebensjahrs <strong>und</strong> damit vor dem potenziellen Bezug e<strong>in</strong>er vorgezogenen<br />
Altersrente. Mit 59 Jahren waren nur noch 35 Prozent der Frauen <strong>und</strong> 45 Prozent der<br />
Männer dieser ostdeutschen Jahrgänge erwerbstätig. Immer weniger konnten e<strong>in</strong>en nahtlosen<br />
Übergang vom Erwerbsleben <strong>in</strong> die Altersrente realisieren, immer mehr gelangten erst nach<br />
e<strong>in</strong>er Zwischenphase der Arbeitslosigkeit oder des Vorruhestands <strong>in</strong> die Rente (nähere Informationen<br />
hierzu <strong>in</strong> Kapitel 3.5). Das Erwerbsbeendigungsalter <strong>in</strong> Ostdeutschland ist zuletzt wieder<br />
etwas heterogener geworden. Dies zeigt sich auch an der <strong>Entwicklung</strong> der Standardabweichung,<br />
die die Streuung um den Mittelwert misst (Tabelle 3.8). Die Streuung ist <strong>in</strong>sbesondere bei den<br />
ostdeutschen Männern wieder größer geworden, auch wenn das Ausmaß der Heterogenität nach<br />
wie vor am stärksten bei den westdeutschen Frauen ist.<br />
Im Westen Deutschlands war das Alter der Erwerbsbeendigung schon <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
heterogener als im Osten. Dies beruht vor allem auf den unterschiedlichen Erwerbsbiografien<br />
der Männer <strong>und</strong> Frauen. Von den 1933/37 geborenen Frauen waren mit 55 Jahren nur 67 Prozent<br />
erwerbstätig, da viele ihre Erwerbsarbeit im Zuge der Familiengründung <strong>und</strong> -erweiterung<br />
aufgegeben <strong>und</strong> nicht mehr <strong>in</strong>s Erwerbsleben zurückgekehrt s<strong>in</strong>d bzw. e<strong>in</strong>e dauerhafte Rückkehr<br />
nicht mehr gelungen ist. Hier<strong>in</strong> unterscheiden sie sich auch nur ger<strong>in</strong>gfügig von den fünf Jahre<br />
vor ihnen geborenen Frauen, die zwischen dem 55. <strong>und</strong> 62. Lebensjahr sogar etwas häufiger<br />
erwerbstätig waren (Abbildung 3.13).<br />
Verglichen mit den ostdeutschen Frauen der Jahrgänge 1933/37 war die weibliche Erwerbsbeteiligung<br />
<strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern bis zum Alter von 59 Jahren ger<strong>in</strong>ger, danach jedoch höher<br />
als im Osten. Mitverantwortlich dafür s<strong>in</strong>d die wesentlich länger andauernden Erwerbsunterbrechungen<br />
der Frauen im Westen während der Familienphase, die dazu beitragen, dass die bis<br />
zum 60. Lebensjahr erworbenen Rentenansprüche niedriger s<strong>in</strong>d als im Osten. Dies führt dazu,<br />
dass den älteren erwerbstätigen Frauen im Westen der frühzeitige Wechsel <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
häufiger mangels ausreichender Versicherungsjahre versperrt ist oder angesichts der ger<strong>in</strong>geren<br />
Rentenanwartschaften nicht attraktiv ersche<strong>in</strong>t. Die etwas höhere Erwerbsbeteiligung im Westen<br />
nach dem 60. Lebensjahr dürfte zudem durch die bessere Arbeitsmarktsituation <strong>in</strong> den alten<br />
B<strong>und</strong>esländern gefördert werden. Dafür spricht die bei den Jahrgängen 1933/37 durchgängig<br />
über alle betrachteten Altersjahre höhere Erwerbsbeteiligung der westdeutschen Männer gegenüber<br />
den ostdeutschen Männern, die bei den fünf Jahre Älteren noch nicht gegeben war. Dennoch<br />
war auch bei den westdeutschen Männern im Kohortenvergleich der Trend zur Vorverlagerung<br />
des Übergangs <strong>in</strong> die Nacherwerbsphase noch nicht beendet. Ab e<strong>in</strong>em Alter von 58<br />
Jahren lag die Erwerbstätigenquote der Jahrgänge 1933/37 jeweils etwas unter jener der 1928/32<br />
Geborenen.<br />
107
Tabelle 3.8:<br />
Durchschnittliches Alter der Erwerbsbeendigung der ost- <strong>und</strong> westdeutschen Frauen<br />
<strong>und</strong> Männer nach Kohortenzugehörigkeit<br />
Geburtsjahrgang<br />
108<br />
M 1<br />
West Ost Deutschland<br />
Heribert Engstler<br />
F Zus. M F Zus. M F Zus.<br />
Durchschnittliches Beendigungsalter (arithm. Mittel, <strong>in</strong> Jahren):<br />
1917/22 61,3 49,0 53,5 64,5 60,1 61,4 61,8 51,3 55,0<br />
1923/27 60,6 52,1 55,8 63,2 58,4 59,9 61,0 53,6 56,7<br />
1928/32 60,9 49,9 54,9 61,6 58,7 60,0 61,1 51,5 55,9<br />
1933/37 61,1 49,4 55,0 58,1 55,7 56,8 60,4 50,8 55,4<br />
Standardabweichung (<strong>in</strong> Jahren):<br />
1917/22 7,7 15,8 14,6 3,2 7,1 6,5 7,2 15,1 13,8<br />
1923/27 6,5 15,6 13,1 3,1 8,2 7,3 6,1 14,4 12,2<br />
1928/32 6,2 16,5 14,0 2,8 6,8 5,5 5,7 15,6 13,0<br />
1933/37 3,2 15,9 13,0 6,2 7,9 7,2 4,2 14,7 12,0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002 - Replikationsstichprobe (n=1.533), gewichtet<br />
1 M=Männer, F=Frauen, Zus.=Zusammen<br />
Insgesamt belegen die Bef<strong>und</strong>e zu den kohortenspezifischen Verläufen der Erwerbsbeteiligung<br />
ab dem 55. Lebensjahr <strong>und</strong> der <strong>Entwicklung</strong> des Erwerbsbeendigungsalters den langjährigen<br />
Trend zur Vorverlagerung des Ausstiegs aus dem Arbeitsleben, der zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern<br />
beendet sche<strong>in</strong>t. Deutlich hervor treten auch die enormen Umbrüche im ostdeutschen<br />
Beschäftigungssystem nach der Wiedervere<strong>in</strong>igung, die zu e<strong>in</strong>er massenhaften Ausgliederung<br />
älterer Arbeitnehmer aus dem Erwerbsprozess geführt haben. Erfolgte diese Ausgliederung<br />
anfangs noch über den frühzeitigen Wechsel von der Erwerbsarbeit <strong>in</strong> die Altersrente, wurden<br />
im weiteren Verlauf immer mehr ältere Arbeitskräfte bereits vor dem Rentenberechtigungsalter<br />
aus dem Arbeitsleben verabschiedet, d.h. <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit oder den Vorruhestand entlassen.<br />
Dies führt zu e<strong>in</strong>er Änderung der Übergangspfade von der Erwerbsarbeit <strong>in</strong> den Ruhestand.<br />
Es kommt häufiger zu e<strong>in</strong>er zeitlichen Lücke zwischen dem Ausstieg aus dem Beruf <strong>und</strong> dem<br />
E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Rente. Der Ausbreitung, Länge <strong>und</strong> Art dieser Zwischenphase widmet sich das<br />
nachfolgende Kapitel.<br />
3.5 Übergangspfade von der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Altersrente<br />
Die Ergebnisse zum jahrzehntelangen Rückgang des Erwerbsbeendigungsalters, <strong>in</strong>sbesondere<br />
zum gestiegenen Anteil derer, die bereits vor Vollendung des 60. Lebensjahres ausgeschieden<br />
s<strong>in</strong>d, verweisen auf e<strong>in</strong>e gewachsene zeitliche Lücke zwischen dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben<br />
<strong>und</strong> dem Übergang <strong>in</strong> die Altersrente. Mit den Daten des Alterssurveys kann dieses<br />
Phänomen empirisch untersucht werden. Denn alle Personen ab 60 Jahren, die e<strong>in</strong>e Altersrente<br />
oder Pension aus eigener Erwerbstätigkeit beziehen, wurden nicht nur nach dem Jahr ihrer Erwerbsbeendigung<br />
<strong>und</strong> dem Startzeitpunkt des Bezugs von Altersrente/Pension gefragt, sondern
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
gaben auch Auskunft zur Situation unmittelbar vor Beg<strong>in</strong>n der Altersrente. 25 Dadurch lässt sich<br />
untersuchen, wie sich <strong>in</strong> der Abfolge der untersuchten Geburtsjahrgänge der Anteil derjenigen<br />
entwickelt hat, die direkt aus der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Rente gewechselt s<strong>in</strong>d, aus welchem<br />
Status die restlichen Personen <strong>in</strong> die Altersrente kamen <strong>und</strong> wie sich die Dauer zwischen Erwerbsende<br />
<strong>und</strong> Altersrentenbeg<strong>in</strong>n entwickelt hat. Dabei ist zu beachten, dass <strong>in</strong> der jüngsten<br />
betrachteten Gruppe der 1938/42 Geborenen (60- bis 64-Jährige) zum Zeitpunkt der Befragung<br />
erst 51 Prozent Altersrente/Pension erhielten. Der Zugang zu vorgezogenen Altersrenten ist an<br />
bestimmte Übergangspfade geb<strong>und</strong>en. Vorgezogene Altersrenten stehen im wesentlichen nach<br />
Arbeitslosigkeit, Vorruhestand, Altersteilzeit sowie Schwerbeh<strong>in</strong>derten, langjährig Versicherten<br />
<strong>und</strong> Frauen mit längerer Erwerbsbiografie offen. Dies führt dazu, dass unter den 60- bis 64jährigen<br />
Altersrentenbeziehern zwangsläufig überdurchschnittlich viele Personen s<strong>in</strong>d, die aus<br />
vorheriger Arbeitslosigkeit, nach dem Vorruhestand oder im Anschluss an den Bezug e<strong>in</strong>er<br />
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente <strong>in</strong> die Altersrente gewechselt s<strong>in</strong>d. Der Wechsel nach<br />
vorheriger Hausfrauentätigkeit ist dagegen relativ selten, da Hausfrauen oft nicht die Voraussetzungen<br />
für den Zugang zu e<strong>in</strong>er vorgezogenen Altersrente erfüllen. Dies lässt e<strong>in</strong>en Vergleich<br />
mit den Übergangswegen der über 65-Jährigen nur bed<strong>in</strong>gt zu. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurde die<br />
Verteilung der bereits erfolgten Übergänge der Geburtsjahrgänge 1938/42 ergänzt durch die<br />
erwartete Gesamtverteilung unter E<strong>in</strong>bezug des aktuellen Erwerbsstatus der noch nicht Altersrente<br />
beziehenden 60- bis 64-Jährigen (siehe hierzu auch Tabelle 3.1, Seite 77). 26<br />
Aus Abbildung 3.14 ist erkennbar, dass <strong>in</strong>sgesamt tatsächlich immer weniger Personen direkt<br />
aus der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Altersrente gelangen. Waren von den heute 75- bis 79-Jährigen<br />
74 Prozent bis unmittelbar vor Beg<strong>in</strong>n ihrer Altersrente erwerbstätig gewesen, beträgt diese<br />
Quote bei den 60- bis 64-Jährigen voraussichtlich nur noch 53 Prozent. Stark zugenommen hat<br />
der Anteil derer, die vor dem Übergang <strong>in</strong> die Rente e<strong>in</strong>e Phase der Arbeitslosigkeit oder des<br />
Vorruhestands h<strong>in</strong>ter sich brachten. Von den Jährgängen 1923/27 waren nur 4 Prozent vor Beg<strong>in</strong>n<br />
der Rente arbeitslos oder im Vorruhestand gewesen, bis zu den Jahrgängen 1938/42 verfünffachte<br />
sich diese Quote auf ca. 23 Prozent.<br />
Der Anteil derer, die als Hausfrauen (selten als Hausmänner) <strong>in</strong> die Altersrente wechseln, verr<strong>in</strong>gerte<br />
sich kont<strong>in</strong>uierlich bis zu den Jahrgängen 1933/37. Der sich nun abzeichnende höhere<br />
Anteil e<strong>in</strong>er vorgeschalteten Hausfrauenphase bei den 60- bis 64-Jährigen gegenüber den 65- bis<br />
69-Jährigen ist vermutlich mit darauf zurückzuführen, dass mehr langjährige Hausfrauen mit 65<br />
Jahren die Voraussetzungen für den Bezug e<strong>in</strong>er Altersrente erfüllen, unter anderem aufgr<strong>und</strong><br />
der verbesserten Anrechnung von Erziehungszeiten <strong>und</strong> dem abnehmenden Anteil an Frauen,<br />
die sich <strong>in</strong> jungen Jahren ihre Rentenversicherungsbeiträge haben ausbezahlen lassen.<br />
25 Die Antwortvorgaben waren: Ich war zuvor erwerbstätig, <strong>in</strong> der Freistellungsphase der Altersteilzeit, arbeitslos, im<br />
Vorruhestand (auch Altersübergang), Hausfrau/-mann, <strong>in</strong> Umschulung, Aus- oder Weiterbildung, länger krank <strong>und</strong><br />
habe Geld von der Krankenkasse erhalten, habe e<strong>in</strong>e Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente (Invalidenrente) bezogen<br />
oder war zuvor Sonstiges.<br />
26 Aufgr<strong>und</strong> von Auswertungsergebnissen zum Übergangsverhalten der Panelteilnehmer <strong>in</strong> den Ruhestand erfolgte<br />
dies unter der Annahme, dass ca. 81% der 60- bis 64-jährigen Hausfrauen/-männer <strong>und</strong> 100% aller anderen Nicht-<br />
Erwerbstätigen <strong>und</strong> Erwerbstätigen dieses Alters später Altersrente beziehen werden.<br />
109
Abbildung 3.14:<br />
Situation vor Beg<strong>in</strong>n der Altersrente nach Geburtsjahrgang<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
%<br />
20<br />
0<br />
110<br />
6,5 7,9 6,8 9,2 7,0<br />
5,0<br />
18,4 13,7<br />
10,9 8,5<br />
2,8<br />
4,4<br />
10,9<br />
72,3 74,0 71,4<br />
19,0<br />
28,5<br />
63,3 59,5<br />
1917/22 1923/27 1928/32 1933/37 1938/42<br />
aktuell<br />
12<br />
12<br />
23<br />
53<br />
1938/42<br />
erw artet<br />
80-85 75-79 70-74 65-69 60-64 60-64<br />
Geburtsjahrgang/Alter<br />
Übergang <strong>in</strong> die Altersrente:<br />
aus sonstigem Status<br />
nach Tätigkeit als Hausfrau/-mann<br />
aus der Arbeitslosigkeit oder dem Vorruhestand<br />
direkt aus der Erw erbstätigkeit*<br />
Quelle: Alterssurvey 2002 (Replikationsstichprobe, n=1.211), gewichtet<br />
* e<strong>in</strong>schl. aus Freistellungsphase der Altersteilzeit<br />
Heribert Engstler<br />
E<strong>in</strong> leichter Wiederanstieg ist beim Anteil jener zu erwarten, die weder aus der Erwerbsarbeit,<br />
noch aus der Arbeitslosigkeit, dem Vorruhestand oder der Tätigkeit als Hausfrau/-mann <strong>in</strong> die<br />
Altersrente wechseln. Von den 60- bis 64-Jährigen werden voraussichtlich 12 Prozent aus e<strong>in</strong>em<br />
anderen Status <strong>in</strong> die Altersrente kommen. Über die Gründe dafür kann an dieser Stelle nur<br />
spekuliert werden, da e<strong>in</strong>e weitere Differenzierung wegen der ger<strong>in</strong>gen Fallzahl <strong>und</strong> der teilweisen<br />
Schätzung der Anteile nicht möglich ist. Es könnte se<strong>in</strong>, dass die Zahl derer zugenommen<br />
hat bzw. zunimmt, die nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zunächst e<strong>in</strong>e Invalidenrente<br />
beziehen, um anschließend nach Erreichen des Berechtigungsalters <strong>in</strong> die Altersrente zu<br />
wechseln.<br />
Die Übergangspfade von der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> den Ruhestand weisen markante Unterschiede<br />
zwischen den Geschlechtern auf, die sich jedoch bei den jüngeren Generationen verr<strong>in</strong>gert haben<br />
(Abbildung 3.15). 27 Männer s<strong>in</strong>d häufiger als Frauen bis zum Beg<strong>in</strong>n der Altersrente erwerbstätig,<br />
der Abstand ist jedoch kle<strong>in</strong>er geworden. Sie s<strong>in</strong>d auch etwas häufiger arbeitslos<br />
bzw. im Vorruhestand, wobei sich auch dieser Unterschied <strong>in</strong> der Kohortenabfolge verr<strong>in</strong>gert<br />
hat, da dieses Muster bei den Frauen erheblich zunahm: der Anteil der Frauen, die unmittelbar<br />
vor Beg<strong>in</strong>n der Altersrente arbeitslos oder im Vorruhestand waren, stieg von 3 Prozent (Jahrgänge<br />
1923/27) auf 19 Prozent (Jahrgänge 1933/37). Abgenommen hat – bis zu den 65- bis 69-<br />
Jährigen – der Übergang aus dem Hausfrauenstatus <strong>in</strong> die Altersrente.<br />
27 Der Geschlechter- <strong>und</strong> Ost-West-Vergleich beschränkt sich auf die Jahrgänge mit weitgehend abgeschlossenen<br />
Erwerbsbiografien, d.h. die Personen ab 65 Jahren.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Abbildung 3.15:<br />
Situation vor Beg<strong>in</strong>n der Altersrente nach Geschlecht <strong>und</strong> Landesteil<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
%<br />
20<br />
0<br />
Frauen<br />
6,6 7,5 3,8 6,0<br />
28,6<br />
62,6<br />
22,4<br />
3,0<br />
67,2<br />
20,6 16,7<br />
7,6<br />
67,9<br />
18,7<br />
58,7<br />
1917/22 1923/27 1928/32 1933/37<br />
80-85 75-79 70-74 65-69<br />
Geburtsjahrgang/Alter<br />
Übergang ...<br />
aus sonstigem Status<br />
nach Tätigkeit als Hausfrau<br />
aus der Arbeitslosigkeit oder dem Vorruhestand<br />
direkt aus der Erw erbstätigkeit*<br />
100<br />
%<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
West<br />
5,3 7,8 6,5 8,4<br />
22,8<br />
16,2<br />
5,0<br />
13,4 10,7<br />
7,5 11,1<br />
69,3 70,9 72,6 69,8<br />
1917/22 1923/27 1928/32 1933/37<br />
80-85 75-79 70-74 65-69<br />
Geburtsjahrgang/Alter<br />
Übergang ...<br />
aus sonstigem Status<br />
nach Tätigkeit als Hausfrau/-mann<br />
aus der Arbeitslosigkeit oder dem Vorruhestand<br />
direkt aus der Erw erbstätigkeit*<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
%<br />
20<br />
0<br />
Männer<br />
6,3 8,6 10,3 12,5<br />
91,7<br />
6,5<br />
83,9<br />
14,5<br />
75,2<br />
19,4<br />
68,1<br />
1917/22 1923/27 1928/32 1933/37<br />
80-85 75-79 70-74 65-69<br />
Übergang ...<br />
Geburtsjahrgang/Alter<br />
aus sonstigem Status<br />
nach Tätigkeit als Hausmann<br />
aus der Arbeitslosigkeit oder dem Vorruhestand<br />
direkt aus der Erw erbstätigkeit*<br />
100<br />
%<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
12,0 8,7 8,5 11,6<br />
88,0 87,0<br />
Ost<br />
25,5<br />
66,0<br />
44,9<br />
42,0<br />
1917/22 1923/27 1928/32 1933/37<br />
80-85 75-79 70-74 65-69<br />
Übergang ...<br />
Geburtsjahrgang/Alter<br />
aus sonstigem Status<br />
nach Tätigkeit als Hausfrau/-mann<br />
aus der Arbeitslosigkeit oder dem Vorruhestand<br />
direkt aus der Erw erbstätigkeit*<br />
Quelle: Alterssurvey 2002 (Replikationsstichprobe), n=651 (Männer), n=560 (Frauen), n=801 (West),<br />
n=410 (Ost), gewichtet<br />
*e<strong>in</strong>schl. aus Freistellungsphase der Altersteilzeit<br />
111
112<br />
Heribert Engstler<br />
Im Ost-West-Vergleich fällt der vormals höhere Anteil des Arbeitens bis zur Rente <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
auf, der auf der höheren Erwerbsbeteiligung der Frauen <strong>und</strong> dem systembed<strong>in</strong>gten<br />
Fehlen der Arbeitslosigkeit <strong>in</strong> der früheren DDR beruhte. In nur wenigen Jahren änderten sich<br />
die ostdeutschen Übergangspfade f<strong>und</strong>amental. Von den 65- bis 69-Jährigen waren nur noch 42<br />
Prozent bis zum Altersrentenbeg<strong>in</strong>n erwerbstätig, 45 Prozent waren zuvor arbeitslos oder im<br />
Vorruhestand, verglichen mit nur 11 Prozent der westdeutschen Rentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentner dieser<br />
Jahrgänge. Das im Westen Deutschlands zwar lange Zeit rückläufige, aber immer noch vorhandene<br />
Muster des Übergangs <strong>in</strong> die Altersrente aus dem Status der Hausfrau fehlt im Osten<br />
nahezu gänzlich. Daran hat auch der Wegfall vieler Arbeitsplätze <strong>und</strong> die Frühausgliederung<br />
älterer Arbeitskräfte kaum etwas geändert. Nicht erwerbstätige ostdeutsche Frauen im rentennahen<br />
Alter def<strong>in</strong>ieren sich nur selten als Hausfrau. Sie s<strong>in</strong>d überwiegend erwerbsorientiert <strong>und</strong><br />
tauchen nur selten <strong>in</strong> die „Stille Reserve“ ab. Dies zeigt sich auch retrospektiv <strong>in</strong> den Aussagen<br />
der Altersrentner<strong>in</strong>nen zu ihrer Nichterwerbssituation unmittelbar vor Rentenbeg<strong>in</strong>n. Auffällig<br />
ist die im Westen über die Kohorten weitgehend konstant gebliebene Häufigkeit des Übergangs<br />
<strong>in</strong> die Altersrente direkt aus der Erwerbstätigkeit. Diese relative Konstanz wird durch die Zunahme<br />
der Erwerbsbeteiligung älterer Frauen verursacht, die auch zu e<strong>in</strong>em – zum<strong>in</strong>dest bis zu<br />
den Jahrgängen 1933/37 beobachtbaren – Rückgang des Rentene<strong>in</strong>tritts nach vorheriger Hausfrauentätigkeit<br />
führte. Ohne die gestiegene Erwerbsbeteiligung der Frauen wäre auch <strong>in</strong> den<br />
alten B<strong>und</strong>esländern das Muster des nahtlosen Übergangs von der Erwerbsarbeit <strong>in</strong> die Rente<br />
seltener geworden, wie an der Anteilszunahme der Arbeitslosigkeit, des Vorruhestands <strong>und</strong> der<br />
sonstigen Nichterwerbstätigkeit vor dem Altersrentenbeg<strong>in</strong>n erkennbar wird.<br />
Trotz der häufigeren Rückkehr der westdeutschen Frauen <strong>in</strong> die Erwerbsarbeit nach der Familienphase<br />
<strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Ausweitung ihrer Erwerbsbeteiligung im rentennahen Alter<br />
blieben <strong>in</strong> der Abfolge der untersuchten Geburtsjahrgänge <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> Deutschland immer<br />
weniger Menschen bis zum Beg<strong>in</strong>n der Altersrente erwerbstätig. Hauptgr<strong>und</strong> dafür war die<br />
frühzeitige Entlassung <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit oder den Vorruhestand. Dadurch erlebten mehr<br />
<strong>und</strong> mehr Menschen e<strong>in</strong> Ause<strong>in</strong>anderfallen des Zeitpunkts der Erwerbsbeendigung vom Zeitpunkt<br />
des Altersrentenbeg<strong>in</strong>ns. Bei <strong>in</strong>sgesamt höherer Prävalenz hat sich die durchschnittliche<br />
Dauer dieser Nichterwerbsphase bis zum Rentene<strong>in</strong>tritt allerd<strong>in</strong>gs verkürzt. Wie Tabelle 3.9<br />
zeigt, betrug sie bei den Geburtsjahrgängen 1917/27 im Durchschnitt noch 18 Jahre, bei den<br />
Jahrgängen 1933/37 nur 11 Jahre. Dieser Rückgang geht weitgehend auf das Konto der s<strong>in</strong>kenden<br />
Zahl an Frauen, die nach e<strong>in</strong>er kurzen Phase der Erwerbstätigkeit Hausfrau geworden <strong>und</strong><br />
bis zum Rentene<strong>in</strong>tritt geblieben s<strong>in</strong>d. Zieht man die Übergänge <strong>in</strong> die Rente nach vorheriger<br />
Tätigkeit als Hausfrau/-mann ab, schrumpft die durchschnittliche Dauer der nachberuflichen<br />
Phase bis zum Altersrentenbeg<strong>in</strong>n erheblich. Im Durchschnitt haben jene 28 Prozent der 65- bis<br />
69-Jährigen, die nicht direkt aus der Erwerbstätigkeit oder als Hausfrau/-mann <strong>in</strong> die Altersrente<br />
gegangen s<strong>in</strong>d, nach Beendigung ihrer hauptberuflichen Tätigkeit 4,6 Jahre auf den Beg<strong>in</strong>n ihrer<br />
Altersrente gewartet. Dies ist zwar weniger lang als bei den <strong>in</strong> gleicher Weise Betroffenen der<br />
75- bis 85-Jährigen aber länger als bei den 70- bis 74-Jährigen. Unter Abzug der Rentenübergänge<br />
aus dem Hausfrauendase<strong>in</strong> ist die Phase zwischen der Erwerbsbeendigung <strong>und</strong> dem Altersrentenbeg<strong>in</strong>n<br />
(nicht zu verwechseln mit dem Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>er eventuell vorgeschalteten Erwerbs-<br />
oder Berufsunfähigkeitsrente) seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre demnach wieder
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
etwas länger geworden. 28 Dazu beigetragen hat die steigende Zahl älterer Langzeitarbeitsloser<br />
(vgl. auch Koller, Bach & Brixy, 2003).<br />
Tabelle 3.9:<br />
Mittlere Anzahl der Jahre zwischen Erwerbsbeendigung <strong>und</strong> Beg<strong>in</strong>n der Altersrente bei Altersrentner<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Altersrentnern ohne direkten Übergang aus der Erwerbstätigkeit, 2002<br />
Geburtsjahrgang (Alter) Personen mit Zwischenphase,<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Personen mit Zwischenphase,<br />
ohne vorherige Hausfrauen<br />
bzw. Hausmänner<br />
Jahre Jahre<br />
1917/27 (75-85) 18,0 6,2<br />
1928/32 (70-74) 14,3 3,8<br />
1933/37 (65-69) 11,2 4,6<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n=427, 327), gewichtet<br />
Mittelwertdifferenz zwischen den Kohorten 1933/37 (11,2 J.) <strong>und</strong> 1917/27 (18,0 J.) statistisch signifikant.<br />
3.6 Zusammenfassung <strong>und</strong> Fazit<br />
In der Untersuchung standen zwei Fragen im Vordergr<strong>und</strong>: (1.) Gibt es Anhaltspunkte dafür,<br />
dass sich gegenwärtig <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e Trendwende h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em längeren Verbleib im Erwerbsleben<br />
vollzieht? Schlägt sich der von zahlreichen Reformmaßnahmen begleitete Paradigmenwechsel<br />
bereits im Beschäftigungssystem nieder? (2.) Lockert sich die enge Verb<strong>in</strong>dung<br />
zwischen dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben <strong>und</strong> dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand? Tritt<br />
zwischen der Aufgabe der Berufstätigkeit <strong>und</strong> dem E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Rente häufiger e<strong>in</strong>e zu überbrückende<br />
Nichterwerbsphase?<br />
Die Frage nach Anhaltspunkten für e<strong>in</strong>e Trendwende h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em späteren Ausstieg aus dem<br />
Erwerbsleben wurde erstens anhand der <strong>Entwicklung</strong> der alters- <strong>und</strong> kohortenspezifischen Erwerbsbeteiligung<br />
<strong>und</strong> -beendigung untersucht; zweitens wurde untersucht, ob sich die Menschen<br />
<strong>in</strong> ihren Plänen <strong>und</strong> Erwartungen bereits auf e<strong>in</strong>en längeren Verbleib im Erwerbsleben<br />
e<strong>in</strong>stellen. Ausgangspunkt war die Annahme, dass die zahlreichen gesetzlichen Maßnahmen der<br />
vergangenen Jahre zur Verr<strong>in</strong>gerung der Anreize für e<strong>in</strong>en frühzeitigen Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
erste Wirkungen entfalten, die sich zunächst vor allem <strong>in</strong> den Erwerbsbeendigungsplänen,<br />
aber noch nicht <strong>in</strong> gleicher Weise <strong>in</strong> der Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> dem Ausstiegsalter niederschlagen.<br />
E<strong>in</strong>em längeren Verbleib im Arbeitsprozess entgegen wirkt – so die Annahme – der<br />
nach wie vor hohe Druck zur Rationalisierung <strong>und</strong> zur Senkung der Personalkosten.<br />
Die Ergebnisse bestätigen im Großen <strong>und</strong> Ganzen diese Annahmen. Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
kam es zu e<strong>in</strong>em regelrechten E<strong>in</strong>bruch <strong>in</strong> den Erwartungen e<strong>in</strong>es frühen Ruhestandes. Der Anteil<br />
der Erwerbstätigen im Alter von 55 bis 59 Jahren, die planen, mit spätestens 60 Jahren ihre<br />
28 Die Differenz ist jedoch statistisch nicht signifikant.<br />
113
114<br />
Heribert Engstler<br />
Erwerbstätigkeit zu beenden, fiel <strong>in</strong> nur sechs Jahren von 53 auf 31 Prozent. Allerd<strong>in</strong>gs konkretisierte<br />
sich die Abkehr von der Perspektive e<strong>in</strong>es frühen Ruhestands noch nicht <strong>in</strong> klaren Erwartungen<br />
darüber, bis zu welchem Alter man persönlich weiter erwerbstätig se<strong>in</strong> wird. Die<br />
gestiegene Ungewissheit über den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschieds aus dem Erwerbsleben<br />
entspricht der E<strong>in</strong>gangs geäußerten Vermutung, dass die kognitive Funktion der Rentenaltersgrenzen<br />
als Orientierungspunkte der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ruhestandsplanung geschwächt ist. Angesichts<br />
der zahlreichen Änderungen der Altersgrenzenregelung im Zuge der vergangenen Rentenreformen<br />
verw<strong>und</strong>ert dies nicht. Es kann erwartet werden, dass nach Abschluss der laufenden<br />
Anhebungsphase der Rentenaltersgrenzen mit ihren vielen Übergangsregelungen die neue relativ<br />
e<strong>in</strong>heitliche Altersgrenze 65 als Orientierungspunkt für die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ruhestandsplanungen<br />
fungieren wird. Sollte die öffentliche Diskussion über e<strong>in</strong>e weitere Anhebung jedoch <strong>in</strong>tensiver<br />
werden, kann dieser Orientierungspunkt durchaus auch wieder verloren gehen.<br />
Während sich <strong>in</strong> den Erwartungen <strong>und</strong> Plänen bereits e<strong>in</strong>e deutliche Abkehr vom frühen Ausscheiden<br />
aus dem Erwerbsleben zeigt, ist e<strong>in</strong>e solche Trendwende bei Betrachtung der altersspezifischen<br />
Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> des tatsächlichen Ausstiegsalters erst im Ansatz zu erkennen.<br />
Im Vergleich der Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002 stagnierte <strong>in</strong>sgesamt die Erwerbstätigenquote der<br />
58- bis 63-Jährigen, allerd<strong>in</strong>gs bei gegensätzlicher <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland<br />
<strong>und</strong> zwischen den Geschlechtern. Der vorangegangene E<strong>in</strong>bruch der Erwerbsbeteiligung Ostdeutscher<br />
im rentennahen Alter konnte überw<strong>und</strong>en werden <strong>und</strong> wurde gefolgt von e<strong>in</strong>em spürbaren<br />
Beschäftigungsanstieg dieser Altersgruppe. In den alten B<strong>und</strong>esländern g<strong>in</strong>g die Erwerbstätigenquote<br />
der 58- bis 63-Jährigen h<strong>in</strong>gegen noch etwas zurück. E<strong>in</strong>e gestiegene Erwerbsbeteiligung<br />
war im Westen allerd<strong>in</strong>gs bei den Mittfünfzigern zu beobachten, besonders stark bei<br />
den Frauen. Ob dieser Anstieg dazu führen wird, dass auch mehr Frauen über das 60. Lebensjahr<br />
h<strong>in</strong>aus erwerbstätig bleiben werden, muss abgewartet werden. Bei den westdeutschen Männern<br />
deutet sich e<strong>in</strong>e Zweiteilung an: e<strong>in</strong>erseits scheiden mehr westdeutsche Männer bereits vor<br />
dem 60. Lebensjahr aus dem Erwerbsprozess aus als Mitte der 1990er Jahre, andererseits s<strong>in</strong>d<br />
die Verbleibenden dann häufiger bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze erwerbstätig.<br />
Später als mit 65 Jahren geht aktuell fast niemand <strong>in</strong> den Ruhestand, es plant auch nahezu niemand<br />
länger zu arbeiten, <strong>und</strong> es blieb auch <strong>in</strong> der beobachteten Vergangenheit kaum jemand<br />
länger erwerbstätig, wie die Angaben der befragten Rentner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentner gezeigt haben.<br />
Von den 75- bis 85-Jährigen war zudem nur e<strong>in</strong> Fünftel bis zum 65. Lebensjahr hauptberuflich<br />
erwerbstätig gewesen. Dass <strong>in</strong> Zukunft mehr Menschen freiwillig erst nach dem 65. Lebensjahr<br />
<strong>in</strong> Rente gehen werden, ersche<strong>in</strong>t angesichts der fehlenden Praxis auch <strong>in</strong> der jüngeren Vergangenheit<br />
<strong>und</strong> den geäußerten Erwerbsbeendigungsplänen der Menschen unwahrsche<strong>in</strong>lich.<br />
Die Bef<strong>und</strong>e zu den kohortenspezifischen Verläufen der Erwerbsbeteiligung im Alter ab 55<br />
Jahren konnten den lange anhaltenden Trend zur Vorverlagerung des Ruhestands, aber auch<br />
se<strong>in</strong>e Verlangsamung verdeutlichen. Offensichtlich wurde dar<strong>in</strong> auch die massenhafte Frühausgliederung<br />
älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer <strong>in</strong> Ostdeutschland nach der Wiedervere<strong>in</strong>igung.<br />
Erfolgte diese Ausgliederung anfangs noch über den frühzeitigen direkten Wechsel<br />
von der Erwerbsarbeit <strong>in</strong> die Altersrente, wurden im weiteren Verlauf immer mehr ältere Arbeitskräfte<br />
bereits vor dem Rentenberechtigungsalter <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit oder den Vorruhestand<br />
entlassen. In nur wenigen Jahren änderten sich die ostdeutschen Übergangspfade <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand f<strong>und</strong>amental: Waren von den 1923/27 Geborenen noch 87 Prozent direkt aus der
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Altersrente gewechselt, haben von den 1933/37 Geborenen nur noch 42<br />
Prozent bis zum Altersrentenbeg<strong>in</strong>n gearbeitet; 45 Prozent wurden vorher arbeitslos oder g<strong>in</strong>gen<br />
<strong>in</strong> den Vorruhestand (im Westen: 11%). In den alten B<strong>und</strong>esländern blieb der Anteil der direkten<br />
Übergänge <strong>in</strong> die Altersrente <strong>in</strong> der Abfolge der betrachteten Geburtsjahrgänge weitgehend<br />
stabil. Diese Stabilität verdankt der Westen jedoch der Tatsache, dass mehr Frauen vor dem<br />
Rentenbeg<strong>in</strong>n erwerbstätig s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> dadurch die Übergänge <strong>in</strong> die Altersrente aus der Hausfrauentätigkeit<br />
seltener wurden. Ohne die gestiegene Erwerbsbeteiligung der Frauen im rentennahen<br />
Alter wäre auch <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern das Muster des nahtlosen Übergangs von der Erwerbsarbeit<br />
<strong>in</strong> die Rente seltener geworden. Insgesamt bestätigen die Bef<strong>und</strong>e die These e<strong>in</strong>er<br />
häufigeren zeitlichen Entkoppelung der Erwerbsbeendigung vom Altersrentenbeg<strong>in</strong>n. Mehr <strong>und</strong><br />
mehr Menschen schieden aus, bevor sie die Altersrente erhielten. Hauptgr<strong>und</strong> dafür war die<br />
Entlassung <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit oder den Vorruhestand. Die Dauer dieser zu überbrückenden<br />
Phase bis zum Altersrentenbeg<strong>in</strong>n betrug zuletzt – ohne die Rentenzugänge aus vorheriger Tätigkeit<br />
als Hausfrau oder Hausmann – durchschnittlich 4,6 Jahre mit steigender Tendenz.<br />
Ob <strong>in</strong> Zukunft noch mehr Menschen e<strong>in</strong> Ause<strong>in</strong>anderfallen des Zeitpunkts ihres Ausscheidens<br />
aus dem Erwerbsleben vom Zeitpunkt des Altersrentenbeg<strong>in</strong>ns erleben <strong>und</strong> bewältigen müssen,<br />
wird wesentlich davon abhängen, wie die Betriebe <strong>und</strong> die Beschäftigten auf die Anhebung der<br />
Rentenaltersgrenzen, die Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I <strong>und</strong> die allmähliche<br />
Verr<strong>in</strong>gerung des Rentenniveaus reagieren. H<strong>in</strong>ge die Erwerbsbeteiligung nur von der Arbeitsbereitschaft<br />
der Arbeitnehmer ab, würde die Entkoppelung zwischen Erwerbsende <strong>und</strong><br />
Rentene<strong>in</strong>tritt durch die getroffenen Gesetzesmaßnahmen vermutlich nicht weiter forciert werden.<br />
Da e<strong>in</strong> längerer Verbleib im Beschäftigungssystem jedoch e<strong>in</strong>e entsprechende Nachfrage<br />
nach älteren Arbeitskräften voraussetzt, s<strong>in</strong>d Zweifel angebracht. Im schlimmsten Fall, d.h. bei<br />
weiter praktizierter Frühausgliederung der Betriebe verlängert sich nur die Dauer der Arbeitslosigkeit<br />
bis zum Rentene<strong>in</strong>tritt bei zugleich verschlechterter f<strong>in</strong>anzieller Absicherung. Maßnahmen,<br />
die <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie darauf abzielen, den Druck zum Anbieten der eigenen Arbeitskraft zu<br />
erhöhen, werden vermutlich nicht ausreichen, um das von der Europäischen Union vorgegebene<br />
Ziel e<strong>in</strong>er Erwerbstätigenquote von 50 Prozent der älteren Arbeitskräfte bis 2010 zu erreichen.<br />
Sie bedürfen der Ergänzung durch Maßnahmen, die die Arbeitsfähigkeit fördern <strong>und</strong> die Nachfrage<br />
nach älteren Arbeitskräften stimulieren. Ob diese Nachfrage ausgerechnet durch die Beseitigung<br />
des Kündigungsschutzes gesteigert werden könnte, wie derzeit von manchen gefordert,<br />
ist jedoch ungewiss. Zunächst ist davon auszugehen, dass dies die Möglichkeiten der Ausgliederung<br />
älterer Arbeitskräfte erleichtert. Ob dies wettgemacht würde durch den von Arbeitgeberseite<br />
propagierten Abbau der Hemmnisse zur Wiedere<strong>in</strong>stellung älterer Arbeitsloser, ist unsicher.<br />
Wichtigste Voraussetzung für e<strong>in</strong> Gel<strong>in</strong>gen des Umsteuerns zu e<strong>in</strong>em längeren Verbleib im<br />
Erwerbsleben <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Akzeptanz bei Beschäftigten <strong>und</strong> Betrieben wird die Überw<strong>in</strong>dung der<br />
Wachstumsschwäche, e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Entspannung des Arbeitsmarkts, der Abbau von Vorbehalten<br />
gegenüber älteren Arbeitskräften sowie die Verbesserung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong><br />
die Förderung ihrer Arbeitsfähigkeit <strong>und</strong> -motivation se<strong>in</strong>.<br />
115
3.7 Literatur<br />
116<br />
Heribert Engstler<br />
Allmend<strong>in</strong>ger, J., Brückner, H., & Brückner, E. (1992). Ehebande <strong>und</strong> Altersrente oder: Vom<br />
Nutzen der Individualanalyse. Soziale Welt, 43(1), 90-116.<br />
Alw<strong>in</strong>, D. F., & McCammon, R. J. (2003). Generations, cohorts, and social change. In J. T.<br />
Mortimer & M. J. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 23-49). New York<br />
u.a.: Kluwer Academic / Plenum Publishers.<br />
Bäcker, G., & Naegele, G. (1995). Ältere Arbeitnehmer zwischen Langzeitarbeitslosigkeit <strong>und</strong><br />
Frühverrrentung. WSI-Mitteilungen(12), 777-784.<br />
Backhaus, K., Erichson, B., Pl<strong>in</strong>ke, W., & Weiber, R. (2000). Multivariate Analysemethoden.<br />
E<strong>in</strong>e anwendungsorientierte E<strong>in</strong>führung (9 ed.). Berl<strong>in</strong> u.a.: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Barkholdt, C. (2001). Prekärer Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.<br />
Behrend, C. (1992). Früh<strong>in</strong>validisierung <strong>und</strong> soziale Sicherung <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
Behrend, C. (2001). Erwerbsarbeit im <strong>Wandel</strong>, Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer<br />
<strong>und</strong> Übergänge <strong>in</strong> den Ruhestand. In Deutsches Zentrum für Altersfragen (Ed.), Erwerbsbiographien<br />
<strong>und</strong> materielle Lebenssituation im Alter (Vol. 2, pp. 11-129). Opladen:<br />
Leske + Budrich.<br />
Behrend, C. (Ed.) (2002). Chancen für die Erwerbsarbeit im Alter. Opladen: Leske u. Budrich.<br />
Behrens, J., Morschhäuser, M., Viebrok, H., & Zimmermann, E. (1999). Länger erwerbstätig -<br />
aber wie? Opladen: Leske + Budrich.<br />
Bellmann, L., Hilpert, M., Kistler, E., & Wahse, J. (2003). Herausforderungen des demografischen<br />
<strong>Wandel</strong>s für den Arbeitsmarkt <strong>und</strong> die Betriebe. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-<br />
<strong>und</strong> Berufsforschung, 36(2), 133-149.<br />
Berkel, B., & Börsch-Supan, A. (2003). Pension reform <strong>in</strong> Germany: the impact on retirement<br />
decisions (NBER WP 9913). Cambridge: National Bureau of Economic Research.<br />
Bernheim, D. B. (1989). The tim<strong>in</strong>g of retirement: a comparison of expectations and realizations.<br />
In D. A. Wise (Ed.), The economics of ag<strong>in</strong>g (pp. 259-285). Chicago/London:<br />
University of Chicago Press.<br />
BIK Aschpurwis+Behrens GmbH (2001). BIK-Regionen. Methodenbeschreibung zur Aktualisierung<br />
2000. Hamburg: BIK Aschpurwis+Behrens GmbH.<br />
Börsch-Supan, A. (2000). Incentive effects of social security on labour force participation: evidence<br />
<strong>in</strong> Germany and across Europe. Journal of Public Economics, 78, 25-49.<br />
Börsch-Supan, A., Kohnz, S., & Schnabel, R. (2002). Micro model<strong>in</strong>g of retirement decisions <strong>in</strong><br />
Germany (mea Diskussionspapiere Nr.20-2002). Mannheim: mea - Mannheimer Forschungs<strong>in</strong>stitut<br />
Ökonomie <strong>und</strong> Demographischer <strong>Wandel</strong>.<br />
Bull<strong>in</strong>ger, H.-J. (Ed.) (2002). Zukunft der Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft. Stuttgart:<br />
Fraunhofer IAO.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung (Ed.). (2003). Nachhaltigkeit <strong>in</strong> der<br />
F<strong>in</strong>anzierung der sozialen Sicherungssysteme. Bericht der Kommission. Berl<strong>in</strong>: BMGS.<br />
B<strong>und</strong>esregierung (2003). Bericht der B<strong>und</strong>esregierung über die gesetzliche Rentenversicherung,<br />
<strong>in</strong>sbesondere über die <strong>Entwicklung</strong> der E<strong>in</strong>nahmen <strong>und</strong> Ausgaben, der Schwankungsreserve<br />
sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes <strong>in</strong> den künftigen 15 Kalenderjahren<br />
gemäß § 154 SGB VI. Rentenversicherungsbericht 2003. Berl<strong>in</strong>: B<strong>und</strong>esregierung.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2000). Erhöhung der Erwerbsbeteiligung<br />
älterer Arbeitnehmer. Köln: BDA.<br />
Bündnis für Arbeit (2001). Geme<strong>in</strong>same Erklärung des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung <strong>und</strong><br />
Wettbewerbsfähigkeit zu den Ergebnissen des 7. Spitzengesprächs am 4. März 2001.<br />
Unpublished manuscript.<br />
Clemens, W. (1997). Frauen zwischen Arbeit <strong>und</strong> Rente. Lebenslagen <strong>in</strong> später Erwerbstätigkeit<br />
<strong>und</strong> frühem Ruhestand. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Clemens, W. (2001). Ältere Arbeitnehmer im sozialen <strong>Wandel</strong>. Von der verschmähten zur gefragten<br />
Humanressource? Opladen: Leske + Budrich.<br />
D<strong>in</strong>kel, R. H. (1988). Ökonomische E<strong>in</strong>flußfaktoren für die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Entscheidung des<br />
Übertritts <strong>in</strong> den Ruhestand. In W. Schmähl (Ed.), Verkürzung oder Verlängerung der<br />
Erwerbsphase? Zur Gestaltung des Übergangs vom Erwerbsleben <strong>in</strong> den Ruhestand <strong>in</strong><br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland (pp. 128-150). Tüb<strong>in</strong>gen: Mohr.<br />
Disney, R., & Tanner, S. (1999). What can we learn from retirement expectations data? (Work<strong>in</strong>g<br />
Paper W99/17). London: Institute for Fiscal Studies.<br />
Ekerdt, D. J. (2002). The fruits of retirement research. Contemporary Gerontology, 9(2), 35-39.<br />
Engstler, H. (2004). Geplantes <strong>und</strong> realisiertes Austrittsalter aus dem Erwerbsleben (DZA Diskussionspapiere<br />
Nr.41). Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
Ernst, J. (1996). Vom Vorruhestand <strong>in</strong> den Ruhestand - <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Stabilität der sozialen Lage<br />
ostdeutscher Frührentner. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 29(5), 352-355.<br />
Europäischer Rat (2001). Europäischer Rat (Stockholm) 23. <strong>und</strong> 24. März 2001. Schlussfolgerungen<br />
des Vorsitzes (Press Release, Nr. 100/1/01). Stockholm.<br />
George, R. (2000). Beschäftigung älterer Arbeitnehmer aus betrieblicher Sicht. Frühverrentung<br />
als Personalstrategie <strong>in</strong> <strong>in</strong>ternen Arbeitsmärkten. München/Mer<strong>in</strong>g: Hampp.<br />
Glover, I., & Bran<strong>in</strong>e, M. (Eds.) (2002). Ageism <strong>in</strong> work and employment. Burl<strong>in</strong>gton: Ashgate.<br />
Gravalas, B. (1999). Ältere Arbeitnehmer: e<strong>in</strong>e Dokumentation. Berl<strong>in</strong>, Bonn: B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stitut für<br />
Berufsbildung.<br />
Gruber, J., & Wise, D. A. (Eds.) (2004). Social security programs and retirement aro<strong>und</strong> the<br />
world. Chicago: University of Chicago Press.<br />
Gussone, M., Huber, A., Morschhäuser, M., & Petrenz, J. (1999). Ältere Arbeitnehmer. Altern<br />
<strong>und</strong> Erwerbsarbeit <strong>in</strong> rechtlicher, arbeits- <strong>und</strong> sozialwissenschaftlicher Sicht. Frankfurt<br />
am Ma<strong>in</strong>: B<strong>und</strong>-Verlag.<br />
Haider, S. J., & Stephens, M. J. (2004). Is there a retirement-consumption puzzle? Evidence<br />
us<strong>in</strong>g subjective retirement expectations (NBER WP 10257). Cambridge: National Bureau<br />
of Economic Research.<br />
Herfurth, M., Kohli, M., & Zimmermann, K. F. (Eds.) (2003). Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft.<br />
Problembereiche <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>stendenzen der Erwerbsbeteiligung Älterer.<br />
Opladen: Leske + Budrich.<br />
Höllger, T., & Sobull, D. (2001). Frauen <strong>und</strong> ihre Altersvorsorge II. Wunsch <strong>und</strong> Wirklichkeit.<br />
Köln: Deutsches Institut für Altersvorsorge.<br />
Jacobs, K., & Kohli, M. (1990). Der Trend zum frühen Ruhestand. WSI Mitteilungen, 43(8),<br />
498-509.<br />
117
118<br />
Heribert Engstler<br />
Kistler, E. (2004). Demographischer <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Arbeitsmarkt. Die Debatte muss ehrlicher<br />
werden. WSI-Mitteilungen, 57(2), 71-77.<br />
Köchl<strong>in</strong>g, A., Astor, M., Fröhner, K.-D., & Hartmann, E. A. (Eds.) (2000). Innovation <strong>und</strong> Leistung<br />
mit älterwerdenden Belegschaften. München: Hampp.<br />
Kohli, M. (2000). Altersgrenzen als gesellschaftliches Regulativ <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Lebenslaufgestaltung:<br />
e<strong>in</strong> Anachronismus? Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 33 (Suppl.1),<br />
I/15-/23.<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A., & Szydlik, M. (2000). Soziale Ungleichheit. In M. Kohli<br />
& H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation<br />
im Spiegel des Alters-Survey (pp. 318-336). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M., & Re<strong>in</strong>, M. (1991). The chang<strong>in</strong>g balance of work and retirement. In M. Kohli & M.<br />
Re<strong>in</strong> & A.-M. Guillemard & H. v. Gunsteren (Eds.), Time for retirement (pp. 1-35).<br />
Cambridge: Cambridge University Press.<br />
Kohli, M., Re<strong>in</strong>, M., Guillemard, A.-M., & Gunsteren, H. v. (Eds.). (1991). Time for retirement.<br />
Comparative studies of early exit from the labor force. Cambridge: Cambridge University<br />
Press.<br />
Koller, B. (2001). Das Rentenalter wurde angehoben - zieht der Arbeitsmarkt mit? IAB-<br />
Werkstattbericht (7/29.6.2001).<br />
Koller, B., Bach, H.-U., & Brixy, U. (2003). Ältere ab 55 Jahren - Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit<br />
<strong>und</strong> Leistungen der B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit (IAB Werkstattbericht 5/2003):<br />
B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit.<br />
Kretschmar, A., & Wolf-Valerius, P. (1996). Vorruhestand - e<strong>in</strong>e neue soziale Realität <strong>in</strong> Ostdeutschland.<br />
In H. Bertram & S. Hradil & Kommission für die Erforschung des sozialen<br />
<strong>und</strong> politischen <strong>Wandel</strong>s <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern (Eds.), <strong>Sozialer</strong> <strong>und</strong> demographischer<br />
<strong>Wandel</strong> <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern (pp. 361-379). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2001). Gesellschaftliche Partizipation <strong>und</strong> Engagement <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte.<br />
Empirische Bef<strong>und</strong>e zu Tätigkeitsformen im Alter <strong>und</strong> Prognosen ihrer zukünftigen<br />
<strong>Entwicklung</strong>. Berl<strong>in</strong>: Weißensee Verlag.<br />
Lehr, U. (1990). Ältere Arbeitnehmer heute <strong>und</strong> morgen: Berufliche Leistungsfähigkeit <strong>und</strong><br />
Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. In L. Späth & U. Lehr (Eds.), Altern als Chance <strong>und</strong> Herausforderung,<br />
Bd. 1: Aktives Altern (pp. 97-124). Stuttgart.<br />
Mayer, K.-U., & Wagner, M. (1999). Lebenslagen <strong>und</strong> soziale Ungleichheit im hohen Alter. In<br />
K.-U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 251-275). Berl<strong>in</strong>: Akademie<br />
Verlag.<br />
OECD (2000). Reforms for an age<strong>in</strong>g society. Paris: OECD.<br />
Ohsmann, S., Stolz, U., & Thiede, R. (2003). Rentenabschläge bei vorgezogenem Rentenbeg<strong>in</strong>n:<br />
Welche Abschlagssätze s<strong>in</strong>d "richtig"? Die Angestelltenversicherung, 50(4), 171-<br />
179.<br />
Oswald, C. (2001). Das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben <strong>in</strong> Deutschland <strong>und</strong> <strong>in</strong> Großbritannien.<br />
Frankfurt a.M.: Peter Lang.<br />
Pack, J., Buck, H., Kistler, E., & Mendius, H. G. (1999). Zukunftsreport demographischer<br />
<strong>Wandel</strong>. Innovationsfähigkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft. Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Bildung <strong>und</strong> Forschung.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Rothkirch, C. v. (Ed.) (2000). Altern <strong>und</strong> Arbeit: Herausforderung für Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft.<br />
Beiträge, Diskussionen <strong>und</strong> Ergebnisse e<strong>in</strong>es Kongresses mit <strong>in</strong>ternationaler Beteiligung.<br />
Berl<strong>in</strong>: Ed. Sigma.<br />
Schmidt, P. (1995). Die Wahl des Rentenalters: theoretische <strong>und</strong> empirische Analyse des Rentenzugangsverhaltens<br />
<strong>in</strong> West- <strong>und</strong> Ostdeutschland. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>: Peter Lang.<br />
S<strong>in</strong>g, D. (2003). Gesellschaftliche Exklusionsprozesse beim Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. Frankfurt<br />
am Ma<strong>in</strong> u.a.: Peter Lang.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2003a). Bevölkerung Deutschlands bis 2050. Ergebnisse der 10. koord<strong>in</strong>ierten<br />
Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2003b). Stand <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong> der Erwerbstätigkeit 2002. Wiesbaden:<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt.<br />
Teipen, C. (2003). Die Frühverrentung im <strong>Wandel</strong> betrieblicher Strategien. München <strong>und</strong> Mer<strong>in</strong>g:<br />
Ra<strong>in</strong>er Hampp Verlag.<br />
Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A., & Engstler, H. (2002). Die zweite Welle des Alterssurveys.<br />
Erhebungsdesign <strong>und</strong> Instrumente (DZA Diskussionspapiere Nr.35). Berl<strong>in</strong>: Deutsches<br />
Zentrum für Altersfragen.<br />
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (2003). Rentenversicherung <strong>in</strong> Zeitreihen.<br />
Frankfurt a.M.: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger .<br />
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Ed.) (2004). Generationengerechtigkeit - Inhalt,<br />
Bedeutung <strong>und</strong> Konsequenzen für die Alterssicherung (Vol. 51, DRV-Schriften). Frankfurt<br />
am Ma<strong>in</strong>: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger .<br />
Viebrok, H. (1997). Das Arbeitsangebot im Übergang von der Beschäftigung <strong>in</strong> den Ruhestand.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong>: Peter Lang.<br />
Voges, W. (1994). Missbrauch des Rentensystems? Invalidität als Mittel der Frühverrentung.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong>/New York: Campus.<br />
Wachtler, G., Franke, H., & Balcke, J. (1997). Die Innovationsfähigkeit von Betrieben angesichts<br />
alternder Belegschaften. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.<br />
119
120<br />
Heribert Engstler<br />
Tabelle A3.1:<br />
Anhebung der Altersgrenzen für die vorgezogenen Altersrenten <strong>in</strong> der Gesetzlichen Rentenversicherung<br />
Rentenart Schrittweise<br />
Anhebung der<br />
Altersgrenze<br />
von... auf ...<br />
Jahre<br />
Altersrente wegen<br />
Arbeitslosigkeit<br />
oder Altersteilzeit 1<br />
Altersrente für<br />
Frauen1<br />
Altersrente für<br />
Schwerbeh<strong>in</strong>derte<br />
Altersrente für<br />
langjährig<br />
Versicherte<br />
Anhebungsphase<br />
Von<br />
schrittweiser<br />
Anhebung<br />
betroffene<br />
Jahrgänge<br />
Erster von<br />
voller<br />
Anhebung<br />
betroffener<br />
Jahrgang<br />
Jahrgänge, die<br />
die Rente mit<br />
Abschlägen vorzeitig<br />
<strong>in</strong> Anspruch nehmen<br />
können<br />
60 auf 65 1997 – 2001 1937 – 1941 1942 1937-1945 (ab 60)<br />
1946-1948 (6063)<br />
1949-1951 (ab 63)<br />
60 auf 65 2000 – 2005 1940 – 1944 1945 1940-1951 (ab 60)<br />
60 auf 63 2001 – 2003 1941 - 1943 1944 1941 <strong>und</strong> später<br />
(ab 60)<br />
63 auf 65 2000 – 2001 1937 – 1938 1939 1937 <strong>und</strong> später<br />
(ab 62)<br />
Quelle: Eigene Zusammenstellung<br />
Die 1952 <strong>und</strong> später Geborenen können die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit <strong>und</strong> die Altersrente für<br />
Frauen nicht mehr <strong>in</strong> Anspruch nehmen.
Kapitel 3: Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>und</strong> der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Tabelle A3.2:<br />
Prädiktoren der Nicht-Erwerbstätigkeit 2002 der im Jahr 1996 erwerbstätigen<br />
Panelteilnehmer (Logistische Regression) 1<br />
Signifikanzniveau: ° = p
122
4. Materielle Lagen alter Menschen - Verteilungen<br />
<strong>und</strong> Dynamiken <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
4.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Die alternde Gesellschaft wird heute noch kaum abschätzbare Herausforderungen stellen, aber<br />
auch vielfältige neue Chancen bieten. Obwohl sie die Bed<strong>in</strong>gungen des menschlichen Zusammenlebens<br />
f<strong>und</strong>amental verändern wird, haben jedoch lange Zeit weder Politik noch Wirtschaft<br />
darauf <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Weise reagiert, die die erheblichen Potenziale <strong>und</strong> Probleme des Alters angemessen<br />
<strong>in</strong> den Blick genommen hätte. Erst seit wenigen Jahren deutet sich hier e<strong>in</strong> <strong>Wandel</strong> an: Altersfragen<br />
<strong>und</strong> entsprechende Reformen gelten als gesellschaftliche Zukunftsprojekte. Dies betrifft<br />
z.B. die relative Bedeutung der älteren Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt <strong>und</strong> das politische<br />
Gewicht der Älteren sowie <strong>in</strong>sbesondere ihre Rolle als Nachfrager <strong>und</strong> Anbieter von Gütern <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen. In der Diskussion um die Reform sozialer Sicherungssysteme rückt darüber<br />
h<strong>in</strong>aus die Frage nach der gesellschaftlichen Verteilung von Ressourcen zwischen Personen<br />
verschiedenen Alters <strong>und</strong> zwischen früher oder später Geborenen <strong>in</strong> den Mittelpunkt der Betrachtung.<br />
Immer häufiger werden Aspekte der Gerechtigkeit von Ressourcenallokation <strong>und</strong><br />
ihrer Effizienz diskutiert <strong>und</strong> mit Fragen des Altersstrukturwandels verb<strong>und</strong>en. In der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Öffentlichkeit spielt dabei der Begriff der Generationengerechtigkeit e<strong>in</strong>e zentrale Rolle.<br />
Dieser von konzeptioneller Widersprüchlichkeit <strong>und</strong> empirischer Fragwürdigkeit gekennzeichnete<br />
Gedanke dom<strong>in</strong>iert derzeit weite Teile der populären politischen Debatten um Abbau, Umbau<br />
oder Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme. Diese Debatte geht weder spurlos<br />
am deutschen System der Alterssicherung vorbei noch lässt sie die wissenschaftlichen Diskussionen<br />
unbee<strong>in</strong>druckt. Sie hat damit auch Konsequenzen für die materiellen Lagen der heutigen<br />
<strong>und</strong> künftigen Älteren <strong>und</strong> deren wissenschaftliche Erforschung.<br />
Die Reformen sozialer Alterssicherung werden jedoch nicht nur politisch <strong>und</strong> wissenschaftlich<br />
diskutiert, sondern f<strong>in</strong>den bereits ihre gesetzgeberische Umsetzung. Zwischen den Erhebungen<br />
des Alterssurveys <strong>in</strong> den Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002 lag e<strong>in</strong> im Zuge des Regierungswechsels Ende<br />
1998 widerrufener Reformversuch (das Rentenreformgesetz (RRG) 1999) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e durchgesetzte<br />
Reform (RRG 2001). In beiden Fällen wurde – mit im Detail unterschiedlichen Maßnahmen,<br />
Gewichtungen, Argumentationen <strong>und</strong> Term<strong>in</strong>ologien – der Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e (Teil-)Privatisierung<br />
sozialer Sicherung <strong>und</strong> <strong>in</strong> die deutliche Absenkung der Sicherungsniveaus der Gesetzlichen<br />
Rentenversicherung (GRV) beschritten. Von beiden Maßnahmen ist anzunehmen, dass sie e<strong>in</strong>erseits<br />
die Partizipation älterer Menschen am gesellschaftlichen Wohlstand betreffen (also die<br />
Relationen zwischen Altersgruppen) <strong>und</strong> andererseits auch auf die Ungleichverteilung von Ressourcen<br />
im Alter auswirken (also auf die Ungleichheiten <strong>in</strong>nerhalb von Altersgruppen).<br />
Reformpolitiken der sozialen Sicherung wie auch Gesellschaftspolitik im Allgeme<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d auf<br />
vorausschauende Szenarien künftiger <strong>Entwicklung</strong>en sowie auf zielgenaue Projektionen der<br />
123
124<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
künftigen Auswirkungen von aktuellen Entscheidungen angewiesen. Allerd<strong>in</strong>gs kann dabei die<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Wirtschaft oder der Arbeitsmärkte nicht langfristig <strong>und</strong> mit h<strong>in</strong>reichender Genauigkeit<br />
prognostiziert werden. Dies ist e<strong>in</strong> Unsicherheitsfaktor, der sowohl die zukünftigen<br />
E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen wie auch die Rentenanwartschaften, Z<strong>in</strong>serwartungen usw. betrifft<br />
<strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>schneidende Folgen für die Möglichkeit der Abschätzung von Niveau <strong>und</strong> Verteilung<br />
der <strong>in</strong>teressierenden Größen hat. Sozialberichterstattung hat daher die Aufgabe, den stattf<strong>in</strong>denden<br />
<strong>Wandel</strong> zu begleiten. In e<strong>in</strong>er gesellschaftlichen Dauerbeobachtung zu Altersfragen,<br />
s<strong>in</strong>d Wandlungstendenzen kritisch zu betrachten <strong>und</strong> zu verfolgen. Für sozialpolitische Schlussfolgerung<br />
s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs nicht lediglich Querschnittsanalysen nutzbr<strong>in</strong>gend. Vielmehr s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
der gesellschaftlichen Dauerbeobachtung längsschnittliche Betrachtungen des sozialen <strong>Wandel</strong>s<br />
vonnöten, um e<strong>in</strong>e Art gesellschaftliches Frühwarnsystem für das Alter zu etablieren. Zugleich<br />
ist zielgenaue <strong>und</strong> damit effiziente sozialpolitische Intervention darauf angewiesen, Bestimmungsgründe<br />
für begünstigte oder benachteiligte Lebenssituationen zu analysieren <strong>und</strong> Fehlentwicklungen<br />
frühzeitig abzuschätzen. Gesellschaftspolitisch relevante Veränderungen der<br />
materiellen Lagen Älterer s<strong>in</strong>d vor allem h<strong>in</strong>sichtlich dreier <strong>Entwicklung</strong>en zu untersuchen:<br />
• Erstens können Ressourcen <strong>und</strong> Kaufkraft aber auch die Bedeutung von Problemlagen der<br />
Gruppe Älterer alle<strong>in</strong> durch Veränderungen ihrer absoluten Zahl variieren. Hierzu liegen –<br />
neben zahlreichen anderen Prognosen – die vergleichsweise belastbaren Bevölkerungsvorausberechnungen<br />
der amtlichen Statistik vor, die vor allem Variationen <strong>in</strong> der <strong>Entwicklung</strong><br />
von Lebenserwartung <strong>und</strong> Migration modellieren. Diese demografische Perspektive soll im<br />
Folgenden kurz geschildert werden.<br />
• Zweitens s<strong>in</strong>d Veränderungen der durchschnittlichen E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen älterer<br />
Menschen plausibel anzunehmen, die sich sowohl absolut als auch relativ zu jenen jüngerer<br />
Gesellschaftsmitglieder zeigen könnten. Zentral hierfür dürfte sowohl die <strong>Entwicklung</strong> der<br />
Alterssicherung e<strong>in</strong>schließlich der H<strong>in</strong>wendung zu kapitalgedeckten Vorsorgekomponenten,<br />
wie auch die <strong>Entwicklung</strong> der sonstigen Vermögen se<strong>in</strong>. Hierbei steht <strong>in</strong>sbesondere auch die<br />
Frage nach den Vermögensübertragungen durch Erbschaft oder Inter-Vivos-Transfers derzeit<br />
im Zentrum des Interesses. Die <strong>Entwicklung</strong>en relativer <strong>und</strong> absoluter E<strong>in</strong>kommenslagen<br />
sowie die <strong>in</strong>tergenerationalen Übertragungen werden nachfolgend untersucht.<br />
• Drittens s<strong>in</strong>d Verschiebungen von Verteilungen <strong>in</strong>nerhalb der Gruppe älterer Menschen zu<br />
erwarten. Solche sukzessiven Veränderungen von Verteilungsparametern s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs –<br />
wie gesellschaftsvergleichende Betrachtungen plausibel annehmen lassen – aufgr<strong>und</strong> der<br />
vielen <strong>in</strong> die Betrachtung e<strong>in</strong>fließenden Parameter nur schwer prognostisch zu quantifizieren<br />
<strong>und</strong> nicht exakt abzubilden. Sie s<strong>in</strong>d sowohl <strong>in</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Längsschnitten als auch im<br />
Kohortenvergleich der Beobachtung <strong>und</strong> Analyse zugänglich zu machen. Beide dynamischen<br />
Perspektiven auf Verteilungen stehen nachfolgend im Blickfeld der Analysen.<br />
Die zentrale Bedeutung der Analysen materieller Lagen im höheren Lebensalter liegt dar<strong>in</strong> begründet,<br />
dass es zu den Aufgaben wohlfahrtsstaatlicher Politik <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik gehört,<br />
die Ressourcen zu e<strong>in</strong>er aktiven Gestaltung der Lebensphase des Ruhestands auch nach Ausscheiden<br />
aus dem Erwerbsleben aufgr<strong>und</strong> von Alter <strong>und</strong> nachlassender Erwerbsfähigkeit sowie<br />
zur Bewältigung der negativen Auswirkungen des Alterns bereitzustellen <strong>und</strong> zu sichern (Zacher,<br />
1992; Motel & Wagner, 1993; Motel & Künem<strong>und</strong>, 1996). Insofern s<strong>in</strong>d wissenschaftliche
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Analysen immer auch mit Blick auf die mit den sozialstaatlichen Zielsetzungen verb<strong>und</strong>enen<br />
sozialpolitischen Interventionen vorzunehmen. Die h<strong>in</strong>reichende Absicherung erweist sich als<br />
wichtig für die Integrationsleistung der Gesellschaft (vgl. Bäcker, Bisp<strong>in</strong>ck, Hofemann, & Naegele,<br />
2000; Kohli, 1989). Sie stellt zugleich e<strong>in</strong>e wesentliche Gr<strong>und</strong>lage der familiären Unterstützungsleistungen<br />
Älterer dar (Attias-Donfut, 1995; Motel & Spieß, 1995; Motel, 1997; Motel<br />
& Szydlik, 1999; Kohli, 1999b; Künem<strong>und</strong> & Re<strong>in</strong>, 1999; Künem<strong>und</strong> & Motel, 2000), die zur<br />
Stabilisierung von Altersrollen moderner Gesellschaften <strong>und</strong> zur familialen Unterstützung Jüngerer<br />
beitragen können.<br />
Die laufenden Diskussionen um die materiellen Lagen im Alter lassen sich an zwei Hauptstreitpunkten<br />
festmachen. E<strong>in</strong>erseits kreisen sie um die eher ökonomischen Fragen, <strong>in</strong>wieweit die<br />
Alterssicherung nach wie vor auf dem bisherigen Niveau wohlfahrtsstaatlich gewährleistet werden<br />
sollte oder ob e<strong>in</strong> vollständiger oder teilweiser Rückzug des Staates aus dieser Verantwortung<br />
s<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> möglich ist. Dabei wird auf die Bedrohung des Generationenvertrages durch<br />
den demografischen <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> die <strong>Entwicklung</strong> auf dem Arbeitsmarkt verwiesen. Zudem<br />
wird die Zunahme privater Vermögen betont <strong>und</strong> hier mögliche Potenziale privater Sicherung<br />
vermutet. Andererseits ist e<strong>in</strong>e vor allem gesellschaftspolitische Debatte über Verteilungsziele<br />
<strong>und</strong> -normen <strong>in</strong> Gang gekommen. Sie stellt – durchaus verwoben mit dem ersten Diskussionsstrang<br />
– unter Rückgriff auf die subtile Argumentationsfigur der Generationengerechtigkeit<br />
(vgl. Bäcker, 2003; Bäcker & Koch, 2003; Leiser<strong>in</strong>g & Motel, 1997; Leiser<strong>in</strong>g, 2002; Miegel,<br />
Wahl, & Hefele, 2002; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel & Backes, 2004; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel & Tesch-Roemer,<br />
2004; Schmähl, 2004; Schmähl, Himmelreicher, & Viebrok, 2003) die bisher gleichwertige<br />
Teilhabe Älterer an den gesellschaftlichen Ressourcen <strong>in</strong>frage: Sollen Ältere <strong>in</strong> der nachberuflichen<br />
Lebensphase <strong>in</strong> gleicher Weise sozialstaatlich garantiert am gesellschaftlichen Reichtum<br />
teilhaben oder muss es vielmehr das vorrangige Ziel se<strong>in</strong>, gleichwertige Lebensbilanzen zu sichern?<br />
Soll darauf abgezielt werden, Vor- <strong>und</strong> Nachgeborenen ähnliche Renditen zu sichern,<br />
auch wenn dies zu E<strong>in</strong>schnitten <strong>in</strong> bestimmten Lebensphasen führen kann? Wie s<strong>in</strong>d beide Zielsetzungen<br />
mite<strong>in</strong>ander vere<strong>in</strong>bar? Inwieweit überhaupt Spielräume für solche Systemmodifikationen<br />
bestehen, wenn zum<strong>in</strong>dest das Ziel der weitreichenden Sicherung gegen Armut aufrechterhalten<br />
werden soll, ist empirisch allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e weith<strong>in</strong> offene Frage. Es s<strong>in</strong>d daher die aktuelle<br />
wirtschaftliche Lage der Älteren <strong>und</strong> deren <strong>Entwicklung</strong>stendenzen zu untersuchen. Der<br />
Alterssurvey bietet hierzu die derzeit beste verfügbare empirische Basis. Aus gerontologischer<br />
Sicht ist e<strong>in</strong> zweiter Punkt von Bedeutung: Die verfügbaren wirtschaftlichen Mittel determ<strong>in</strong>ieren<br />
nicht lediglich die Chancen e<strong>in</strong>er aktiven Lebensführung im Alter; vielmehr wirken sie auch<br />
auf die Entstehung von Lebensentwürfen älterer Menschen e<strong>in</strong>, da <strong>in</strong> diesem Prozess bereits e<strong>in</strong><br />
subjektiver Abgleich mit den Chancen ihrer E<strong>in</strong>lösung stattf<strong>in</strong>det.<br />
Die wirtschaftlichen Lagen im Alter bestimmen wesentlich die Lebenssituation <strong>und</strong> die Möglichkeiten<br />
e<strong>in</strong>er aktiven Lebensführung. Sie stellen <strong>in</strong> der Perspektive des Lebenslaufs e<strong>in</strong> Ergebnis<br />
von vergangenem Handeln auf Arbeits- oder Heiratsmärkten, von E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> wohlfahrtsstaatliche<br />
Sicherungsnetze <strong>und</strong> <strong>in</strong> familiale Transfersysteme dar (Kohli, 1985; Mayer &<br />
Blossfeld, 1990; Allmend<strong>in</strong>ger, 1994; Mayer, 1995). Ihre Dynamik ist wesentlich durch aktuelle<br />
Lebenssituationen <strong>und</strong> die Erwerbs- bzw. Ruhestandslage aber auch durch familiale Transfers<br />
<strong>und</strong> den Zufluss von Erbschaften bestimmt. Außerdem prägen der objektive Lebensstandard<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong> über die Zeit die aktuelle Bewertung des Lebensstandards <strong>und</strong> den<br />
125
126<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
subjektiven Blick auf dessen künftige <strong>Entwicklung</strong> bzw. se<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong>smöglichkeiten. Sie<br />
bee<strong>in</strong>flussen damit wesentlich die aktuellen <strong>und</strong> künftigen Lebensentwürfe für das Alter.<br />
Aus e<strong>in</strong>er eher ökonomischen Sicht ergibt sich e<strong>in</strong>e weitere, dritte Perspektive auf die materiellen<br />
Lagen im Alter. Die zunehmende Zahl älterer Menschen mit ihren Bedarfen <strong>und</strong> Ressourcen<br />
erweist sich als e<strong>in</strong> erhebliches Marktpotenzial für die Anbieter von Konsumgütern <strong>und</strong> Dienstleistungen.<br />
Auch aus dieser Sicht ist es von erheblichem Interesse, zu verfolgen, wie sich die<br />
materiellen Lagen im Alter entwickeln, <strong>und</strong> welche Gruppen aktuell <strong>und</strong> künftig über so umfangreiche<br />
Ressourcen verfügen können, dass sie im Zentrum lohnender Angebotsstrategien<br />
stehen. Dies beschränkt sich aktuell <strong>und</strong> vor allem auch künftig nicht alle<strong>in</strong> auf die Palette der<br />
Dienstleistungen für Ältere im Bereich von Hilfe-, Unterstützungs- <strong>und</strong> Pflegedienstleistungen,<br />
sondern nimmt auch im immer stärkeren Maße den höherwertigen Konsum <strong>in</strong> den Blick – neben<br />
den <strong>Wandel</strong> der objektiven Ressourcen <strong>und</strong> ihrer subjektiven Bewertung ist hier auch der<br />
<strong>Wandel</strong> von Lebensentwürfen <strong>und</strong> -planungen aktueller <strong>und</strong> künftiger Altengenerationen von<br />
Bedeutung. Die objektive materielle Lage älterer Menschen, ihre absehbaren <strong>Entwicklung</strong>stendenzen,<br />
ihre subjektive Bewertung durch die Betroffenen <strong>und</strong> die Zusammenhänge dieser Dimensionen<br />
s<strong>in</strong>d Gegenstand der folgenden Analysen. Dabei wird wie folgt vorgegangen:<br />
• Erstens werden nach e<strong>in</strong>em kurzen Überblick über die Forschungslage die objektiven ökonomischen<br />
Lagen <strong>und</strong> die subjektiven Bewertungen des Lebensstandards im Querschnitt<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> ihrer Dynamik über die Zeit empirisch untersucht. Dabei muss unterschieden werden<br />
zwischen den <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Dynamiken über den Lebenslauf auf der e<strong>in</strong>en Seite, die <strong>in</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Längsschnitten zu untersuchen s<strong>in</strong>d, <strong>und</strong> dem sozialen <strong>und</strong> wirtschaftlichen <strong>Wandel</strong><br />
auf der anderen Seite, der <strong>in</strong> der Perspektive e<strong>in</strong>er Kohortensequenzanalyse analysiert<br />
werden muss. Beiden dynamischen Perspektiven soll im vorliegenden Beitrag nachgegangen<br />
werden. Der Schwerpunkt wird dabei auf die Perspektive des sozialen <strong>Wandel</strong>s gelegt.<br />
• Zweitens geht der Beitrag der Frage nach, wie sich verb<strong>und</strong>en mit den E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong><br />
Vermögenslagen das Sparen, die Vermögensauflösungen sowie die privaten Flüsse von<br />
Geld- <strong>und</strong> Sachwerten wie Erbschaften <strong>und</strong> Transfers zu Lebzeiten der Geber gestalten. Es<br />
wird vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der umfangreichen Querschnittsanalysen auf der Basis der ersten<br />
Welle des Alterssurveys <strong>in</strong>sbesondere gefragt, ob sich historische Stabilität <strong>in</strong> den 1996<br />
vorgef<strong>und</strong>enen Mustern der wirtschaftlichen Ausgestaltung familialer Beziehungen f<strong>in</strong>den<br />
lässt oder ob diese Gegenstand von <strong>Wandel</strong>ungsprozessen s<strong>in</strong>d.<br />
• Drittens werden die Bewertungen der vergangenen <strong>und</strong> die Erwartungen künftiger <strong>Entwicklung</strong>en<br />
des Lebensstandards betrachtet. Auch hier steht e<strong>in</strong>er für die Bewertung aktueller<br />
Problemlagen bedeutenden Querschnittsbetrachtung e<strong>in</strong>e dynamische Perspektive auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Verläufe subjektiver Bewertung sowie auf Kohortendynamiken, also Veränderungen<br />
der Lage verschiedener Altersgruppen über die historische Zeit gegenüber.<br />
Insbesondere werden im vorliegenden Beitrag die Höhe des verfügbaren E<strong>in</strong>kommens, se<strong>in</strong>e<br />
Zusammensetzung, se<strong>in</strong>e Verteilung – <strong>in</strong>sbesondere Armut <strong>und</strong> Reichtum – <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Dynamik<br />
auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>und</strong> Kohortenebene betrachtet sowie Sparen <strong>und</strong> Entsparen, Vermögensbesitz<br />
<strong>und</strong> Verschuldung, Zu- <strong>und</strong> Abflüsse durch private Transfers <strong>und</strong> subjektive Bewertungen des
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Lebensstandards im historischen <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuell dynamischer Perspektive untersucht.<br />
1 Ziel des Beitrags ist es dabei vor allem, gr<strong>und</strong>legende Kennziffern <strong>in</strong> der Breite des<br />
Themenfeldes bereitzustellen. E<strong>in</strong>e vertiefte Detailanalyse e<strong>in</strong>zelner Aspekte muss an anderer<br />
Stelle h<strong>in</strong>zugefügt werden.<br />
4.2 Gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Alterssicherung<br />
4.2.1 Demografische <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong><br />
Die aktuellen <strong>und</strong> künftigen <strong>Entwicklung</strong>en der Anzahl älterer Menschen <strong>und</strong> ihres Anteils an<br />
der Gesamtbevölkerung s<strong>in</strong>d zentrale E<strong>in</strong>flussgrößen bei der Abschätzung der künftigen Bedeutung<br />
Älterer als Konsumenten bzw. als Problemgruppe. Das Verhalten der Anbieter von Gütern<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen wie auch die Strategien sozialpolitischer Intervention stehen entscheidend<br />
auch unter dem E<strong>in</strong>fluss der absoluten Größenordnung der Population Älterer. Um diese <strong>Entwicklung</strong>en<br />
abzuschätzen, wurden im Rahmen der 10. koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung<br />
des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2003) verschiedene Varianten<br />
der Bevölkerungsprognose über e<strong>in</strong>en Zeitraum von 50 Jahren gerechnet. 2<br />
Das Statistische B<strong>und</strong>esamt geht bei se<strong>in</strong>en Varianten im Mittel von e<strong>in</strong>er Schrumpfung des<br />
Umfangs der Gesamtbevölkerung aus. Die Bevölkerungsvorausberechnung quantifiziert jedoch<br />
nicht lediglich die Veränderung der Bevölkerungsgröße, sondern <strong>in</strong>sbesondere auch die Bewegungen<br />
<strong>in</strong> der Altersstruktur der Bevölkerung Deutschlands. So erhöht sich der „Altenquotient“–<br />
das Verhältnis der Bevölkerung im Rentenalter zu jener im Erwerbsalter – gemäß Variante<br />
5 bis 2050 von 44 Prozent auf 78 Prozent, sofern das Rentenzugangsalter konstant bei 60<br />
Jahren liegt. Die gesetzliche Altersgrenze ist allerd<strong>in</strong>gs Gegenstand politischer Aushandlung<br />
<strong>und</strong> die faktischen Ruhestandsalter werden <strong>in</strong> erheblichem Maße durch das Geschehen auf den<br />
Arbeitsmärkten bestimmt. Dies ist für e<strong>in</strong>e Abschätzung des Konsumverhaltens älter Menschen<br />
von erheblicher Bedeutung, da der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand nicht lediglich die verfügbaren<br />
f<strong>in</strong>anziellen Ressourcen, sondern auch die spezifischen Bedarfe <strong>und</strong> das verfügbare Zeitbudget<br />
bee<strong>in</strong>flusst.<br />
1 Wirtschaftliches Handeln sowie Wohnen <strong>und</strong> Wohnkosten werden <strong>in</strong> diesem Kapitel nicht gesondert analysiert.<br />
2 Sie zeichnen sich durch unterschiedliche Annahmen zur Höhe der künftigen Lebenserwartung e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> des<br />
künftigen Außenwanderungsgew<strong>in</strong>ns andererseits aus. Ansonsten wird von e<strong>in</strong>er weitgehend konstant <strong>und</strong> zugleich<br />
niedrigen Geburtenhäufigkeit von 1,4 K<strong>in</strong>dern pro Frau ausgegangen. Die „mittlere“ Variante 5 geht z.B. von e<strong>in</strong>er<br />
Zunahme der Lebenserwartung Neugeborener über den Prognosezeitraum bis 2050 um etwa sechs Jahre aus <strong>und</strong><br />
unterstellt e<strong>in</strong>en jährlichen Außenwanderungsgew<strong>in</strong>n von etwa 200 000 Personen.<br />
127
128<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Abbildung 4.1:<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Zahl der 60- bzw. 65-Jährigen <strong>und</strong> Älteren bis 2030 – Schätzwerte der 10.<br />
koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung 2003 des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes<br />
Bevölkerung <strong>in</strong> 1.000<br />
30.000<br />
28.000<br />
26.000<br />
24.000<br />
22.000<br />
20.000<br />
Variante 1<br />
Variante 2<br />
Variante 3<br />
Variante 4<br />
Variante 5<br />
Variante 6<br />
Variante 7<br />
Variante 8<br />
Variante 9<br />
60-Jährige <strong>und</strong> Ältere 65-Jährige <strong>und</strong> Ältere<br />
2001 2010 2020 2030<br />
Jahr<br />
Bevölkerung<strong>in</strong>1.000<br />
24.000<br />
22.000<br />
20.000<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
Variante 1<br />
Variante 2<br />
Variante 3<br />
Variante 4<br />
Variante 5<br />
Variante 6<br />
Variante 7<br />
Variante 8<br />
Variante 9<br />
2001 2010 2020 2030<br />
Jahr<br />
Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2003. Bevölkerung Deutschlands bis 2050. 10. koord<strong>in</strong>ierte Bevölkerungsvorausberechnung.<br />
Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt. Varianten 1-9.<br />
Wenn über Verteilungen <strong>in</strong>nerhalb der Gruppe Älterer gesprochen wird, s<strong>in</strong>d diese quantitativen<br />
Verschiebungen stets zu berücksichtigen: Selbst e<strong>in</strong> über die Zeit konstanter Anteil z.B. besonders<br />
Vermögender an der Gesamtgruppe der Älteren wird zu e<strong>in</strong>er gesellschaftlichen Bedeutungszunahme<br />
des Besitzes von Vermögen im Alter führen – ganz ähnlich sieht sie im H<strong>in</strong>blick<br />
auf benachteiligte Lebenslagen aus. Diese Sichtweise ist besonders dann von Relevanz, wenn<br />
über Ältere als Konsumenten von Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen <strong>und</strong> die <strong>Entwicklung</strong> von Altersmärkten<br />
gesprochen wird.<br />
Die demografische <strong>Entwicklung</strong> liefert e<strong>in</strong>en Rahmen für all jene Veränderungen, die als<br />
„Strukturwandel des Alters“ bezeichnet werden <strong>und</strong> die für die Analyse der materiellen Lagen<br />
ebenfalls bedeutsam s<strong>in</strong>d. Um e<strong>in</strong> vollständigeres Bild zu zeichnen, müssen der Bedeutungswandel<br />
der Altersphase im Lebenslauf bzw. des Alters <strong>in</strong>sgesamt sowie sozialstrukturelle Veränderungen<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Gruppe der Älteren Berücksichtigung f<strong>in</strong>den. Wenn die Altersphase<br />
immer weniger Restzeit <strong>und</strong> immer mehr geplanter Lebensweg mit Wünschen, Zielen <strong>und</strong> Planungen<br />
ist, so verschiebt sich damit auch die Bedeutung materieller Ressourcen <strong>und</strong> die Bedarfe<br />
im späteren Lebenslauf.<br />
Zusätzlich br<strong>in</strong>gen die zukünftigen Älteren andere Voraussetzungen für die Gestaltung dieser<br />
Lebensphase mit, als Vorgängerkohorten. Neben der Generationenlagerung – die <strong>in</strong> näherer<br />
Zukunft Älteren s<strong>in</strong>d im „Wirtschaftsw<strong>und</strong>er“ <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Aufbauphase des Sozialismus aufgewachsen<br />
(Kohli, 2003) <strong>und</strong> haben frühzeitig Erfahrungen mit entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten<br />
gemacht – ändert sich zunächst e<strong>in</strong>mal zukünftig das durchschnittliche Bildungsniveau<br />
Älterer: Die künftigen Älteren erreichen die nachberufliche Lebensphase im Schnitt mit<br />
zunehmend besserer Bildung, wie Analysen auf Gr<strong>und</strong>lage der ersten Welle des Alterssurveys<br />
zeigen können (vgl. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, Krause, & Künem<strong>und</strong>, 2004). Mit der Zunahme von Zahl<br />
<strong>und</strong> Niveau formaler Bildungsabschlüsse dürfte e<strong>in</strong> gewisser Anstieg der durchschnittlichen<br />
E<strong>in</strong>kommen (<strong>und</strong> damit tendenziell auch der durchschnittlichen Alterse<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen)<br />
korrespondieren, auch wenn die Bildungsrenditen <strong>in</strong>sgesamt eher rückläufig se<strong>in</strong> sollten.<br />
Gleichzeitig s<strong>in</strong>d damit aber auch Bedarfe <strong>und</strong> Ansprüche an das Leben im Alter <strong>in</strong> Fluss gera-
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
ten. Die E<strong>in</strong>kommensverwendung sowie auch der Zusammenhang von objektiven Lagen <strong>und</strong><br />
ihren subjektiven Bewertungen sollte damit auch unter dem E<strong>in</strong>fluss dieser Wandlungsprozesse<br />
stehen. Die Analyse materieller Lagen muss daher auch diese, oftmals aus der Analyse ausgeblendeten,<br />
Aspekte gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>in</strong> die Interpretation ihrer Ergebnisse <strong>in</strong> Rechnung<br />
stellen.<br />
4.2.2 <strong>Entwicklung</strong>sl<strong>in</strong>ien des Alterssicherungssystems<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> des Alterssicherungssystems <strong>in</strong> Deutschland stellt e<strong>in</strong>e entscheidende E<strong>in</strong>flussgröße<br />
für die künftige <strong>Entwicklung</strong> materieller Ressourcen älterer Menschen dar. Alle<br />
Prognosen gehen davon aus, dass auch <strong>in</strong> absehbarer Zukunft die Transfere<strong>in</strong>kommen aus dem<br />
öffentlichen Umlageverfahren den größten Anteil der Alterse<strong>in</strong>kommen ausmachen werden,<br />
auch wenn ihre relative Bedeutung sukzessive abnehmen dürfte (Albrecht & Polster, 1999). So<br />
haben derzeit knapp 95 Prozent der Westdeutschen bzw.100 Prozent der Ostdeutschen der Geburtsjahrgänge<br />
1936 bis 1955 e<strong>in</strong> Versichertenkonto bei der GRV . Diese Werte liegen damit <strong>in</strong><br />
den alten B<strong>und</strong>esländern sogar über jenen, die von früheren Geburtsjahrgängen bekannt s<strong>in</strong>d<br />
(Roth, 2000). Die Studie „Altersvorsorge <strong>in</strong> Deutschland 1996“ (AVID) (Verband Deutscher<br />
Rentenversicherungsträger, 1999) prognostiziert noch ohne Berücksichtigung der späteren Rentenreform<br />
2001 <strong>und</strong> der folgenden Debatten um weitere Systemänderungen beispielsweise für<br />
Ehepaare der Geburtsjahrgänge 1936 bis 1940 für das 65. Lebensjahr des Ehemannes e<strong>in</strong>en<br />
Anteil der Anwartschaften aus der GRV am Gesamte<strong>in</strong>kommen von 76,6 Prozent (West) bzw.<br />
92,7 Prozent (Ost). Die prognostizierten Anteile betragen für die zwischen 1951 <strong>und</strong> 1955 Geborenen<br />
(also für die jeweils 65-Jährigen der Jahre 2016 bis 2020) 72,3 Prozent (West) bzw.<br />
78,7 Prozent (Ost) (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, 1999, S.140). Die E<strong>in</strong>führung<br />
der Riester-Rente mit Absenkung der Niveaus der GRV-Renten dürfte hier sicherlich für<br />
die Zukunft e<strong>in</strong>en erheblichen Schub <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>er Bedeutungszunahme privater Alterssicherung<br />
auslösen (Bulmahn, 2003). Der Anteil der Riester-Rente am Gesamtversorgungsniveau<br />
e<strong>in</strong>es Standardrentners dürfte laut entsprechender Prognose im Jahr 2030 mit maximal etwa<br />
13,8 Prozent zu Buche schlagen (2040: 18,6 Prozent, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
Soziale Sicherung, 2003, S.108), so dass künftig von e<strong>in</strong>em Anteil der GRV-Renten am Gesamtalterse<strong>in</strong>kommen<br />
von etwa 50 bis 60 Prozent auszugehen se<strong>in</strong> wird. 3 Neben der Bedeutungszunahme<br />
privater Alterssicherung <strong>und</strong> der Absenkung der durch die GRV bereitgestellten<br />
Renten wirken sich dabei Veränderungen <strong>in</strong> den Erwerbsbiografien aus. In anderer Perspektive<br />
ist auch von Wirkungen der Reformvorhaben auf die Erwerbsbiografien auszugehen. Insbesondere<br />
Entscheidungen zum Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand stehen im Fokus der Etablierung, <strong>in</strong>sbesondere<br />
von versicherungsmathematischen Abschlägen für frühe Übergänge (Berkel & Börsch-<br />
Supan, 2003). Auch hieraus können sich Veränderungen <strong>in</strong> Niveau <strong>und</strong> Verteilung der E<strong>in</strong>kommen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ergeben.<br />
3 Diese Größenordnungen korrespondieren mit Ergebnissen alternativer Szenarien des Deutschen Instituts für Altersvorsorge<br />
(DIA) auf Basis der E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Verbrauchsstichprobe 1998 (Miegel et al., 2002: 77).<br />
129
130<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Bereits seit der Rentenreform 1992 wurden empf<strong>in</strong>dliche E<strong>in</strong>schnitte <strong>in</strong> die künftig erwartbaren<br />
Anstiege der Alterssicherungse<strong>in</strong>kommen aus der GRV vorgenommen. H<strong>in</strong>zugekommen ist mit<br />
der Rentenreform 2001 die staatlich geförderte freiwillige kapitalgedeckte Altersvorsorge, die<br />
massive E<strong>in</strong>schnitte kompensieren sowie zugleich Nachhaltigkeit des Systems <strong>und</strong> die Generationengerechtigkeit<br />
verbessern helfen soll (Himmelreicher & Viebrok, 2003). Die derzeitigen<br />
Trends deuten somit deutlich auf e<strong>in</strong>e Absenkung der Niveaus der öffentlichen Transfere<strong>in</strong>kommen<br />
der Älteren <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Bedeutungszunahme privater Alterssicherung h<strong>in</strong>.<br />
Die aktuellen Reformvorhaben weisen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e ähnliche Richtung. So hat die vom B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung (BMGS) e<strong>in</strong>gesetzte Kommission für die Nachhaltigkeit<br />
<strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzierung der Sozialen Sicherungssysteme e<strong>in</strong>e Reihe von Vorschlägen<br />
vorgelegt. 4 Die angestrebten Wirkungen s<strong>in</strong>d zum e<strong>in</strong>en die E<strong>in</strong>haltung e<strong>in</strong>es maximalen Beitragssatzes<br />
von 22 Prozent der Erwerbse<strong>in</strong>kommen. Durch die Kommissionsvorschläge ergibt<br />
sich e<strong>in</strong>e rechnerische Beitragssatzersparnis von <strong>in</strong>sgesamt 2,2 Prozentpunkten. Zum anderen ist<br />
e<strong>in</strong>e sukzessive Absenkung des Bruttorentenniveaus von derzeit 48 Prozent auf 40 Prozent beabsichtigt,<br />
wobei sich lediglich zwei Prozentpunkte aus den aktuellen Vorschlägen der Kommission<br />
ableiten lassen. 5 Die zeitweilig diskutierte e<strong>in</strong>malige Aussetzung der regelmäßigen Rentenanpassungen<br />
zur Behebung akuter F<strong>in</strong>anzierungsprobleme der GRV kann sich künftig ebenfalls<br />
langfristig dämpfend auf die Rentenzahlbeträge der GRV auswirken. 6<br />
Die ergänzende E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>er staatlich geförderten, freiwilligen kapitalgedeckten Altersvorsorge<br />
wird idealerweise die Ausfälle aufgr<strong>und</strong> der Reformen des Umlageverfahrens kompensieren<br />
(Bulmahn, 2003). Allerd<strong>in</strong>gs setzt dies e<strong>in</strong>e vollständige Inanspruchnahme durch alle Förderungsberechtigten<br />
voraus, die gemäß aktueller Forschungsergebnisse (Bertelsmann Stiftung,<br />
2003a, 2003b) sicherlich nicht als gegeben angenommen werden kann. Im Gegenteil spricht<br />
e<strong>in</strong>iges dafür, dass untere E<strong>in</strong>kommensschichten <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Ausmaß derart vorsorgen <strong>und</strong><br />
die Ungleichverteilung der E<strong>in</strong>kommen unter den zukünftigen Älteren dadurch weiter verstärkt<br />
wird (s.u.). Zudem s<strong>in</strong>d Kapitale<strong>in</strong>künfte allgeme<strong>in</strong> ungleicher verteilt, als wir es von den heutigen<br />
Rentene<strong>in</strong>kommen kennen. Die zunehmende Dom<strong>in</strong>anz des Versicherungspr<strong>in</strong>zips privater<br />
Sicherung führt zu e<strong>in</strong>er Schwächung der Umverteilung zwischen Erwerbstätigen <strong>und</strong> Nicht-<br />
4 Konkret handelt es sich im Gr<strong>und</strong>satz um die folgenden Vorschläge: Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf<br />
e<strong>in</strong>e Regelaltersgrenze von 67 Jahren; e<strong>in</strong>e Reihe flankierender Maßnahmen zur Anhebung der Altersgrenzen (die<br />
E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>er Altersrente für langjährig Versicherte mit Abschlägen, die Beschränkung von Erwerbsm<strong>in</strong>derungsrenten<br />
auf mediz<strong>in</strong>ische Aspekte unter Ausschluss des Arbeitsmarktgeschehens sowie die langfristige Abschaffung<br />
der Altersrente für Schwerbeh<strong>in</strong>derte); die E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Nachhaltigkeitsfaktors <strong>in</strong> die Rentenanpassungsformel<br />
zur Justierung des Verhältnisses von Beitragszahlen <strong>und</strong> Leistungsempfängern mit dem Effekt der<br />
langfristigen Absenkung der Alterse<strong>in</strong>kommen aus dem Umlageverfahren; die mittelfristige (Wieder-)Aufstockung<br />
der Schwankungsreserve bei h<strong>in</strong>reichender wirtschaftlicher Lage, wobei hier Gew<strong>in</strong>ne zur Aufstockung verwendet<br />
<strong>und</strong> nicht an die Leistungsempfänger weitergereicht werden sollen. Gleichzeitig sollen die Rentenanpassungen um<br />
e<strong>in</strong> halbes Jahr verschoben werden, was ebenfalls beitragssatz- <strong>und</strong> rentenm<strong>in</strong>dernd wirkt.<br />
5 Abschläge von sechs Prozentpunkte resultieren aus den künftig erwartbaren Wirkungen bereits heute geltenden<br />
Rechts <strong>und</strong> müssen somit derzeit als sozialrechtliche Gegebenheit <strong>in</strong> aktuelle Prognoseszenarien e<strong>in</strong>gehen.<br />
6 Daneben ist e<strong>in</strong>e Verlängerung der Lebensarbeitszeit <strong>in</strong>tendiert, wobei die angewendeten Mittel vor allem bei<br />
ger<strong>in</strong>gen Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer ebenfalls e<strong>in</strong>e m<strong>in</strong>dernde Wirkung auf die E<strong>in</strong>kommen Älterer<br />
entfalten dürften.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Erwerbstätigen <strong>in</strong>nerhalb von Generationen (G<strong>in</strong>n & Arber, 2000), was künftig ebenfalls zu<br />
e<strong>in</strong>er Spreizung der Verteilung der Alterse<strong>in</strong>kommen beitragen dürfte.<br />
4.2.3 Szenarien zur <strong>Entwicklung</strong> der Ruhestandse<strong>in</strong>kommen<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> der E<strong>in</strong>kommen aus den öffentlichen Alterssicherungssystemen ist von besonderer<br />
Bedeutung für das E<strong>in</strong>kommen Älterer. Im Folgenden soll daher auf die Szenarien der<br />
Kommission für die Nachhaltigkeit <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzierung der Sozialen Sicherungssysteme zurückgegriffen<br />
werden, die Basis ihrer Empfehlungen zur Weiterentwicklung der GRV s<strong>in</strong>d. 7<br />
Basis der hier vorgestellten Überlegungen ist e<strong>in</strong> Anstieg der Durchschnittsentgelte der Erwerbstätige<br />
<strong>in</strong> Westdeutschland von 2.435 € im Jahr 2003 auf 3.567 € im Jahr 2030, der sich je<br />
nach Szenario <strong>in</strong> Anstiegen der faktischen Zahlbeträge von 1.924 € im Jahr 2003 auf 2.788 €<br />
oder 2.845 € im Jahr 2030 widerspiegelt. Entsprechend ist e<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong> der Bruttostandardrenten<br />
<strong>und</strong> der Rentenzahlbeträge der GRV zu schätzen: Die Kommission nimmt hier für die<br />
Bruttostandardrenten Anstiege von 1.170 € im Jahr 2003 auf 1.496 € bzw. 1.429 € im Jahr 2030<br />
an. Für die Rentenzahlbeträge des Standardrentners werden künftige Anstiege von 1.176 € im<br />
Jahr 2003 auf 1.368 € bzw. 1.291 € im Jahr 2030 errechnet. Niedrigere Werte für die Ruheständler<br />
bzw. höhere für die Erwerbstätigen ergeben sich jeweils <strong>in</strong> dem Szenario, das die vollständige<br />
Umsetzung der Kommissionsempfehlungen voraussetzt. Auch wenn e<strong>in</strong>e solche vollständige<br />
Umsetzung angesichts der politischen Verhältnisse <strong>in</strong> Deutschland unwahrsche<strong>in</strong>lich<br />
ersche<strong>in</strong>t, so weist das Reformszenario doch <strong>in</strong> jene Richtung, über die <strong>in</strong> Expertenkreisen im<br />
Gr<strong>und</strong>satz E<strong>in</strong>igkeit besteht: Relative Absenkung der GRV-Renten <strong>und</strong> Etablierung e<strong>in</strong>es stärker<br />
gemischten Systems der Alterssicherung mit wachsender Bedeutung kapitalgedeckter, privater<br />
Altersvorsorge mit staatlicher Absicherung. Die <strong>in</strong> den o.g. Zahlen zum Ausdruck kommende<br />
Dämpfung der Anstiege der GRV-Renten wird seit der Rentenreform 2001 durch die freiwillige<br />
kapitalgedeckte Zusatzvorsorge kompensiert, die mit staatlicher Förderung den Aufbau<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Alterssicherung jenseits der GRV unterstützen soll. Über die gesamte Laufzeit des<br />
Szenarios dürfte das Niveau der Zahlbeträge bei e<strong>in</strong>er Orientierung an der Standardrente überschätzt<br />
se<strong>in</strong>, da heute nur etwa 50 Prozent der Männer <strong>und</strong> fünf Prozent der Frauen die Voraussetzungen<br />
für e<strong>in</strong>e Standardrente überhaupt erfüllen.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>führung der freiwilligen kapitalgedeckten Zusatzvorsorge im Alter kann<br />
von zwei Hauptwirkungen auf Höhe <strong>und</strong> Verteilung der Alterse<strong>in</strong>kommen ausgegangen werden.<br />
Zum e<strong>in</strong>en kann angenommen werden, dass der Anstieg der Alterse<strong>in</strong>kommen aufgr<strong>und</strong> der<br />
Integration der kapitalgedeckten Komponenten der E<strong>in</strong>kommen überschätzt wird, wenn e<strong>in</strong>e<br />
vollständige Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten zur Gr<strong>und</strong>lage der Berechnungen gemacht<br />
wird, da aufgr<strong>und</strong> der Freiwilligkeit der Vorsorge absehbar nur Teile der Bevölkerung<br />
dieses Vorsorgeangebot <strong>in</strong> Anspruch nehmen werden. Zum anderen ist es wahrsche<strong>in</strong>lich, dass<br />
7 Alle folgenden Angaben gelten <strong>in</strong> € pro Monat wobei diese jeweils preisbere<strong>in</strong>igt zum Ausgangsjahr 2003 angegeben<br />
werden. Die Abschätzungen nehmen e<strong>in</strong>e über den Betrachtungszeitraum konstante Inflationsrate von 1,5 Prozent<br />
an <strong>und</strong> schätzen die E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Sozialbeiträge der Erwerbstätigen (Rentenversicherung, Pflegeversicherung,<br />
Krankenversicherung <strong>und</strong> Arbeitslosenversicherung) gemäß eigener Projektionen <strong>und</strong> deren Annahmen (vgl.<br />
ausführlich B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung, 2003).<br />
131
132<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
die (Nicht-)Inanspruchnahme der freiwilligen kapitalgedeckten Zusatzvorsorge im Alter auch<br />
sozial selektiv vonstatten geht. So unterlässt derzeit r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Drittel der Befragten e<strong>in</strong>e private<br />
Zusatzvorsorge aus Geldmangel (Bertelsmann Stiftung, 2003a). Dies s<strong>in</strong>d vor allem Teilzeitbeschäftigte<br />
oder Nicht-Erwerbstätige, <strong>in</strong>sgesamt also Personengruppen, die ohneh<strong>in</strong> nur ger<strong>in</strong>ge<br />
Leistungen aus dem Umlageverfahren erwarten können. Auch darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d für Durchschnittshaushalte<br />
die Möglichkeiten zur (zusätzlichen) privaten Altersvorsorge begrenzt. Sie<br />
unterbleibt <strong>in</strong>sbesondere bei f<strong>in</strong>anziellen Belastungen, wodurch letztlich Bevorzugungen <strong>und</strong><br />
Benachteiligungen über den Lebenslauf kumulieren. Es wird so deutlich, dass „die Leistungen<br />
aus der privaten Altersvorsorge vor allem Haushalten mit höherem <strong>und</strong> hohem E<strong>in</strong>kommen<br />
zufließen“ werden, so Schmähl <strong>und</strong> Fach<strong>in</strong>ger (Schmähl & Fach<strong>in</strong>ger, 1998, S.31) bereits Ende<br />
der 90er Jahre. Gemäß der bereits genannten Umfrage der Bertelsmann-Stiftung wollte bis Ende<br />
2002 lediglich jeder Sechste se<strong>in</strong>e Altersvorsorge durch Abschluss e<strong>in</strong>er Riester-Rente verbessern<br />
<strong>und</strong> mittelfristig jeder Vierte e<strong>in</strong>en solchen Vertrag abschließen (Bertelsmann Stiftung,<br />
2003a). Langfristig ist daher wohl bestenfalls davon auszugehen, dass die Hälfte der Berechtigten<br />
hiervon Gebrauch machen wird.<br />
Weiterh<strong>in</strong> ist davon auszugehen, dass die Verlagerung vom Umlageverfahren zur privat organisierten,<br />
an Kapitaldeckung orientierten Alterssicherung mit der politisch <strong>und</strong> wirtschaftlich gewünschten<br />
verstärkten Orientierung der Alterse<strong>in</strong>kommen an f<strong>in</strong>anziellen Vorleistungen (Versicherungspr<strong>in</strong>zip)<br />
bereits im Gange ist. Zwar wurde ihre spezifische Förderung im Rahmen der<br />
Altersvorsorge erst <strong>in</strong> der Reform 2001 <strong>in</strong>stitutionell implementiert, doch ist sie darüber h<strong>in</strong>aus<br />
im Zuge der Infragestellung der Sicherheit der Arrangements der GRV spätestens seit Anfang/Mitte<br />
der 90er Jahre – teilweise langfristig fiskalisch gefördert – im größerem Umfang<br />
Gegenstand <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Sicherungsstrategien. Diese Verlagerung wird sukzessive die Komponenten<br />
des <strong>in</strong>tragenerationalen Ausgleichs <strong>in</strong> der Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland schwächen.<br />
Hierbei ergeben sich möglicherweise weitere Gew<strong>in</strong>ne für f<strong>in</strong>anziell ohneh<strong>in</strong> besser Gesicherte<br />
<strong>und</strong> absehbar Verluste unter denjenigen Gruppen, die vormals aufgr<strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gerer Ansprüche<br />
aufgr<strong>und</strong> von Erwerbsarbeit von der Umverteilung profitiert haben (G<strong>in</strong>n & Arber, 2000).<br />
Schließlich gilt, dass die Alterse<strong>in</strong>kommen auf Kapitalerträgen- <strong>und</strong> Auflösungen generell ungleicher<br />
verteilt s<strong>in</strong>d, als Erwerbse<strong>in</strong>kommen oder E<strong>in</strong>kommen aus dem öffentlichen Umlageverfahren.<br />
8<br />
Dies alles berechtigt zu der Annahme, dass kapitalgedeckte Komponenten der Alterssicherung<br />
zu e<strong>in</strong>er sukzessiven Verstärkung der Ungleichverteilung der E<strong>in</strong>kommen Älterer beitragen<br />
wird. Diese Tendenz kann bereits im Vergleich der deutschen E<strong>in</strong>kommensverteilungen von<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 feststellbar se<strong>in</strong>.<br />
Die europäisch vergleichende Analyseperspektive kann diese Annahmen stützen. So zeigen<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel & Backes, 2004) im Vergleich zwischen Deutschland, Norwegen <strong>und</strong> England<br />
e<strong>in</strong>e stärkere Differenzierung von E<strong>in</strong>kommen – aber auch von subjektiven Maßen des<br />
Lebensstandards <strong>und</strong> der Lebensqualität – im stärker marktlich organisierten System mit ger<strong>in</strong>-<br />
8 Bekanntermaßen f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Deutschland im Vergleich mit dem E<strong>in</strong>kommen im Ergebnis e<strong>in</strong>e etwa doppelt so<br />
starke Konzentration der Vermögen, was auch Resultat von Steuerpolitik <strong>und</strong> -praxis ist (Huster & Eissel, 2001;<br />
<strong>in</strong>ternational vergleichend zur Bedeutung des Steuersystems für Verteilungen im Ruhestand (vgl. Keenay & Whitehouse,<br />
2003).
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
gerer Ausgleichskomponente wie <strong>in</strong> England bzw. Großbritannien. Dies geht e<strong>in</strong>her mit e<strong>in</strong>er<br />
relativ ger<strong>in</strong>geren sozialstrukturellen Determ<strong>in</strong>iertheit der Verteilungen <strong>in</strong> diesen Gesellschaften.<br />
9 Es sche<strong>in</strong>t plausibel anzunehmen, dass diese <strong>Entwicklung</strong> auch für Deutschland relevant<br />
se<strong>in</strong> könnten, sollten die durch die Reformdiskussionen abgestoßenen Verschiebungen auch<br />
weiterh<strong>in</strong> (zum<strong>in</strong>dest teilweise) <strong>in</strong> Richtung marktlich, jenseits des Sozialstaats organisierter<br />
Lösungen gehen. Inwieweit dies gegenwärtig oder künftig der Fall ist, kann empirisch überprüft<br />
werden.<br />
Zusammengefasst bedeutet dies, dass der für die Alterse<strong>in</strong>kommen vergleichsweise günstige<br />
Verlauf des von der Rürup-Kommission (Szenario 7 <strong>in</strong> Abbildung 4.2; vgl. auch B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung, 2003) angegebenen Zukunftsszenarios „Rentenzahlbeträge<br />
mit Reform <strong>und</strong> Anpassung <strong>und</strong> Riesterrente“ mehrere Probleme aufwirft. Gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
unterschätzen Szenarien der Rentenzahlbeträge die Niveaus der Gesamte<strong>in</strong>kommen, da<br />
lediglich Teilaspekte der E<strong>in</strong>kommenslage E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> die Analysen f<strong>in</strong>den. H<strong>in</strong>sichtlich der<br />
skizzierten <strong>Entwicklung</strong>en kann es darüber h<strong>in</strong>aus zum e<strong>in</strong>en als tendenziell überschätzt gelten,<br />
da die Riester-Rente nur bed<strong>in</strong>gt <strong>in</strong> Anspruch genommen wird. Zum anderen dürften zu den <strong>in</strong><br />
die Kommissionsberechnungen e<strong>in</strong>gehenden Riester-Renten künftig <strong>in</strong> vermehrtem Maße weitere<br />
E<strong>in</strong>künfte aus Kapitale<strong>in</strong>kommen treten, was wiederum zu e<strong>in</strong>er Erhöhung der mittleren<br />
Gesamte<strong>in</strong>kommen beitragen sollte.<br />
Daneben ist im Vergleich zur heutigen Situation künftig von e<strong>in</strong>er Spreizung der E<strong>in</strong>kommensverteilung<br />
auszugehen, die aus der <strong>in</strong> den Rürup-Szenarien gewählten Mittelwertdarstellung<br />
(Abbildung 4.2) nicht ersichtlich ist. Dies ist <strong>in</strong> der M<strong>in</strong>derung der relativen Bedeutung der<br />
Umverteilungskomponenten <strong>in</strong> der GRV <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Bedeutungszunahme von ungleich verteilten<br />
Kapitale<strong>in</strong>künften begründet. Beides zusammen dürfte zu ger<strong>in</strong>geren Anstiegen <strong>in</strong> den unteren<br />
Segmenten der Verteilung <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>er Ausdifferenzierung im Bereich vor allem mittlerer<br />
<strong>und</strong> höherer E<strong>in</strong>kommen beitragen. Es ist zu untersuchen , ob sich die angesprochenen künftigen<br />
Tendenzen bereits <strong>in</strong> der heutigen Verteilung materieller Lagen wiederf<strong>in</strong>den lassen. In<br />
jedem Falle s<strong>in</strong>d diese Tendenzen künftig im Rahmen der Alterssozialberichterstattung e<strong>in</strong>er<br />
kont<strong>in</strong>uierlichen Prüfung zu unterziehen, um die Zielerreichung der Systemänderung zu überprüfen<br />
<strong>und</strong> um ggf. rechtzeitig sozialpolitisch <strong>in</strong>tervenieren zu können.<br />
9 Auch der erweiterte Gesellschaftsvergleich kann hierzu e<strong>in</strong>en hilfreichen Beitrag leisten: Bereits heute lassen sich<br />
ungleichheitsverschärfende Tendenzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Reihe von Staaten (z.B. Großbritannien, Australien oder USA) aufzeigen,<br />
die bereits e<strong>in</strong>en höheren <strong>und</strong> weiter wachsenden Anteil des E<strong>in</strong>kommens aus privater Alterssicherung zu<br />
verzeichnen haben. Hier zeigt sich, dass das arithmetische Mittel der Alterse<strong>in</strong>kommen moderat angestiegen ist,<br />
was auf zunehmend hohe Alterse<strong>in</strong>kommen e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>derheit von Ruheständlern zurückgeht, während die unteren<br />
Alterse<strong>in</strong>kommen von der <strong>Entwicklung</strong> ausgenommen s<strong>in</strong>d, was sich auch <strong>in</strong> recht stabilen Armutsraten ausdrückt,<br />
die <strong>in</strong> den genannten Ländern allerd<strong>in</strong>gs teilweise erheblich über den derzeit <strong>in</strong> Deutschland bekannten liegen<br />
(Casey & Yamada, 2003).<br />
133
Abbildung 4.2:<br />
Prognose der künftigen <strong>Entwicklung</strong> von Rentenzahlbeträgen (Standardrentner)<br />
gemäß verschiedenen Reformszenarien bis 2030<br />
Beträge<strong>in</strong>€<br />
134<br />
1.600<br />
1.500<br />
1.400<br />
1.300<br />
1.200<br />
1.100<br />
1.000<br />
0<br />
1 2<br />
3 4<br />
5 6<br />
7<br />
2003 2010 2020 2030<br />
Jahr<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
In €/Monat, <strong>in</strong> Preisen von 2003, Inflationsrate 1,5% p.a., Standardrente alte B<strong>und</strong>esländer, Sozialbeiträge=PV, KV;<br />
Höhe: PV gemäß Projektionen, KV: konstant 14,3%, <strong>in</strong>kl. Ausgleichsbeitrag <strong>und</strong> nach Berücksichtigung der Erträge aus<br />
dem privaten Pflegekonto.<br />
Szenario 1: ohne Reform (gelt. Recht)<br />
Szenario 2: ohne Reform (gelt. Recht) + Riester-Rente (50% Inanspruchnahme)<br />
Szenario 3: ohne Reform (gelt. Recht) + Riester-Rente (100% Inanspruchnahme)<br />
Szenario 4: mit Reform (Kommission Nachhaltigkeit <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzierung der Soz. Sicherungssyst.)<br />
Szenario 5: mit Reform (KNidF) + Anpassung 1)<br />
Szenario 6: mit Reform (KNidF) + Anpassung 1) + Riester-Rente (50% Inanspruchnahme)<br />
Szenario 7: mit Reform (KNidF) + Anpassung 1) + Riester-Rente (100% Inanspruchnahme).<br />
1) Es wird e<strong>in</strong> Anstieg der rentenrelevanten Entgeltpunkte entsprechend der Anhebung der Altersgrenze unterstellt.<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung, 2003.<br />
4.2.4 Materielle Lagen <strong>und</strong> Generationentransfers<br />
Das System der öffentlichen Alterssicherung – oft auch allgeme<strong>in</strong>er als der öffentliche Generationenvertrag<br />
bezeichnet – steht seit geraumer Zeit im Mittelpunkt des allgeme<strong>in</strong>en Interesses.<br />
Doch diese Debatte blendet weiterh<strong>in</strong> wichtige Voraussetzungen des Generationenvertrages als<br />
Teil e<strong>in</strong>es Gesellschaftsvertrages oftmals aus (vgl. Leiser<strong>in</strong>g & Motel, 1997; Kohli, 2003). Sie<br />
suggeriert, die öffentlichen Transferleistungen an die Älteren seien von anderen gesellschaftlichen<br />
B<strong>in</strong>dungen <strong>und</strong> traditionellen Sicherungsformen losgelöst. Inwieweit den sozialstaatlichen,<br />
öffentlichen Leistungsströmen private Transfersysteme gegenüberstehen <strong>und</strong> ob diese die öffentlichen<br />
ergänzen oder ihre Verteilungswirkungen erweitern, wird <strong>in</strong> den aktuellen Debatten<br />
um den Sozialstaat traditionell selten betrachtet.<br />
Diesen Fragen ist der Alterssurvey bereits auf der Gr<strong>und</strong>lage der Daten der ersten Befragungswelle<br />
nachgegangen (Kohli, Künem<strong>und</strong>, Motel, & Szydlik, 2000; Künem<strong>und</strong>, Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel,<br />
& Kohli, 2004; Künem<strong>und</strong> & Motel, 1999; Motel & Szydlik, 1999; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000)<br />
<strong>und</strong> auch darüber h<strong>in</strong>aus liegen neuere Untersuchungen zum Thema vor (vgl. z.B. Attias-Donfut
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
& Wolff, 2000a; 2000b; Brown, 2003; Lerman & Sorensen, 2001; Reil-Held, 2002; Shuey &<br />
Hardy, 2003 Denn mit der Frage nach dem Zusammenhang der öffentlichen <strong>und</strong> privaten Ebene<br />
eröffnet sich e<strong>in</strong>e erweiterte Sicht auf die Verteilungsgerechtigkeit <strong>und</strong> die Effizienz der sozialpolitischen<br />
Interventionen (vgl. Barr, 1993; Barr, 2002). Die Analyse dieser Zusammenhänge –<br />
so Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000 – ist von besonderer Bedeutung, wenn es gel<strong>in</strong>gen soll, unter der<br />
Bed<strong>in</strong>gung zunehmender Mittelknappheit die Resultate wohlfahrtsstaatlicher Leistungen <strong>in</strong> sozialer<br />
<strong>und</strong> politischer H<strong>in</strong>sicht tatsächlich zu optimieren <strong>und</strong> die Debatten um die (mögliche)<br />
Reformierung des Sozialstaats nicht zum Gegenstand bloßer <strong>in</strong>teressen- oder parteipolitischer<br />
Instrumentalisierung werden zu lassen. Damit ist auch weiterh<strong>in</strong> besonderes Augenmerk auf die<br />
familialen Unterstützungs- <strong>und</strong> Hilfeleistungen zu richten, die e<strong>in</strong> wichtiger Aspekt familialer<br />
Funktionen s<strong>in</strong>d (vgl. Kaufmann, 1997).<br />
Die <strong>in</strong> diesem Kapitel vorgestellten Analysen stellen e<strong>in</strong>e vor allem deskriptive Weiterführung<br />
der Darstellungen von Motel & Szydlik (1999), Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel (2000) sowie Kohli et al.<br />
(2000) dar. Für detailliertere konzeptionelle Ausführungen sei allgeme<strong>in</strong> auf Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
(2000) verwiesen.<br />
Im Mittelpunkt der Transferanalysen anhand der zweiten Befragungswelle steht vor allem die<br />
Frage nach den Auswirkungen des sozialen <strong>Wandel</strong>s auf die Ausgestaltung <strong>in</strong>tergenerationaler<br />
familialer Beziehungen. Es wird vor allem gefragt, wie sich sechs Jahre nach der ersten Datenerhebung,<br />
auf der die zahlreichen umfangreichen Alterssurveyanalysen aufsetzen, die familialen<br />
Ressourcenflüsse vorf<strong>in</strong>den lassen – die Analysen der ersten Querschnittsdaten zeichneten e<strong>in</strong><br />
durchaus positives Bild des <strong>in</strong>tergenerationalen Austauschgeschehens. Etwa jeder dritte über<br />
40-Jährige vergab damals <strong>in</strong>nerhalb von zwölf Monaten Geld- oder Sachtransfers an e<strong>in</strong>es se<strong>in</strong>er<br />
K<strong>in</strong>der. Selbst unter den über 60-Jährigen lag die Quote noch bei mehr als 25 Prozent <strong>und</strong><br />
die Leistungen hatten <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>en Wert von sechs Prozent der gesamten Alterse<strong>in</strong>künfte<br />
bzw. r<strong>und</strong> acht Prozent der E<strong>in</strong>kommen aus den Alterssicherungssystemen (vgl. Kohli, 1999b;<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000). Lässt sich dieses auch für die Folgekohorten <strong>und</strong> unter sich wandelnden<br />
wirtschaftlichen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen (vgl. Kapitel 1) aufrechterhalten<br />
oder s<strong>in</strong>d heute bereits erhebliche E<strong>in</strong>schränkungen der familialen Unterstützung zu registrieren,<br />
die e<strong>in</strong>en gesellschaftlichen Krisendiskurs der Familie <strong>und</strong> ihrer Funktionen rechtfertigen<br />
würden?<br />
4.3 Anmerkungen zum Forschungsstand<br />
Die materielle Lage älterer <strong>und</strong> jüngerer Menschen ist bereits seit langem Gegenstand von wissenschaftlichen<br />
<strong>und</strong> sozialpolitischen Analysen (vgl. z.B. Münke, 1956). Die Ausrichtung der<br />
alternswissenschaftlichen Befassung mit materiellen Lagen älterer Menschen hat sich dabei <strong>in</strong><br />
den vergangenen Jahrzehnten genauso verändert, wie sich die gesellschaftlichen Diagnosen<br />
verschoben haben. In den 90er-Jahren wurde – ganz anders als noch <strong>in</strong> den 70er-Jahren, wo von<br />
e<strong>in</strong>er besonderen Benachteiligung Älterer die Rede war – überwiegend e<strong>in</strong>e Ähnlichkeit der<br />
E<strong>in</strong>kommenssituation zwischen den Altersgruppen konstatiert. Dies basiert auch darauf, dass<br />
sich die E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Vermögenssituation der älteren Bevölkerungsgruppen seit der Mitte<br />
des vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts erheblich verbessert hat (vgl. B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong><br />
135
136<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Sozialordnung, 2001; Glatzer, 1992; Hauser & Becker, 2003; Hauser & Wagner, 1992). Mit<br />
dem Verweis auf die stetige Verbesserung der Wohlfahrtslagen alter Menschen <strong>in</strong> den alten<br />
B<strong>und</strong>esländern g<strong>in</strong>g bisher auch die Erwartung e<strong>in</strong>her, dass die älteren Menschen auch <strong>in</strong> der<br />
näheren Zukunft nicht mehr <strong>in</strong> besonderem Maß von Armut betroffen se<strong>in</strong> werden. Neuere<br />
Überlegungen h<strong>in</strong>gegen nehmen nicht zuletzt auch angesichts der Reformen der Alterssicherungssysteme<br />
die Altersarmut wieder <strong>in</strong> den Blick (vgl. z.B. Butrica, Smith, & Toder, 2002;<br />
Hauser, 1999; Hungerford, 2001; Vartanian & McNamara, 2002). Auch <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
hat sich <strong>in</strong> der ersten Hälfte der 90er-Jahre die erhebliche relative <strong>und</strong> absolute Verbesserung<br />
der Wohlfahrtslage von Ruheständlern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er abnehmenden Betroffenheit von Altersarmut<br />
niedergeschlagen (Müller, Hauser, Frick, & Wagner, 1995, S.98ff). Bevölkerungsrepräsentative<br />
Studien wie das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) <strong>und</strong> der Alterssurvey zeigen dann<br />
auch, dass E<strong>in</strong>kommensarmut <strong>in</strong> ostdeutschen Haushalten mit e<strong>in</strong>em Haushaltsvorstand im Alter<br />
von über 65 Jahren <strong>in</strong>sgesamt seltener ist, als <strong>in</strong> den Haushalten Jüngerer. Sicherlich ist diese<br />
optimistische Aussage angesichts der verbleibenden, wenn auch ger<strong>in</strong>gen Quote etwas überzogen.<br />
Empirische Studien weisen nach wie vor bedeutende Armutsgruppen aus. So z.B. bei alten<br />
westdeutschen Frauen, bei den Geschiedenen sowie bei denjenigen, die bereits vor dem Ruhestand<br />
niedrige E<strong>in</strong>kommen bezogen haben (Habich & Krause, 1997; Motel, 2000). Verwitwete<br />
s<strong>in</strong>d unter den Armen nicht überdurchschnittlich häufig vertreten, obwohl die Verwitwung von<br />
Frauen im Alter traditionell als ökonomisches Risiko betrachtet wird (Backes, 1993; Hungerford,<br />
2001). Doch sicher hat Altersarmut <strong>in</strong> den 90er Jahren im Vergleich zur Armut anderer<br />
Altersgruppen generell an Bedeutung verloren. Inwieweit sich dieser aus alternswissenschaftlicher<br />
<strong>und</strong> -politischer Sicht positive Trend, der auch im Zusammenhang mit dem Analysefokus<br />
auf monetäre Ressourcen <strong>und</strong> den gewählten Berechnungsmethoden <strong>in</strong>terpretiert werden muss,<br />
stabilisiert oder aber bereits umkehrt ist e<strong>in</strong>e offene Frage, die die Alterssozialberichterstattung<br />
kont<strong>in</strong>uierlich verfolgen muss.<br />
Die Sichtweisen der dynamischen Alterns- <strong>und</strong> Lebenslaufforschung hatten <strong>in</strong> den 90er-Jahren<br />
auch zu e<strong>in</strong>er Dynamisierung der Analysen der materiellen Lagen im Alter beigetragen. Hier<br />
eröffnet sich e<strong>in</strong>e neue, bisher wenig beachtete Problemlage. Denn gerade Altersarmut ist oftmals<br />
Ausdruck länger andauernder Deprivation (Berger, 1994; Wagner & Motel, 1998). Dies<br />
steht im Kontrast zur Armut Jüngerer, deren hohe Dynamik seit Beg<strong>in</strong>n der 90er Jahre von vielen<br />
Autoren aufgr<strong>und</strong> von Analysen mit nunmehr verfügbaren Paneldaten hervorgehoben wird<br />
(Buhr, 1995; Leibfried et al., 1995), wobei Ansätze der Lebenslauf- <strong>und</strong> der Biografieforschung<br />
mit solchen der Ungleichheits- <strong>und</strong> Armutsforschung verb<strong>und</strong>en werden (vgl. Kohli, 1999a).<br />
Verbesserungen der relativen wirtschaftlichen Lage werden nach dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
zumeist über Veränderungen der Haushaltsstruktur vollzogen. E<strong>in</strong>e besondere Rolle spielt<br />
hierbei – neben der <strong>in</strong>tergenerationalen Koresidenz – die Verwitwung. Es konnte darüber h<strong>in</strong>aus<br />
gezeigt werden (vgl. Wagner & Motel, 1998), dass die verbleibende Dynamik der Alterse<strong>in</strong>kommen<br />
erheblich durch die jeweilige Quelle des Alterse<strong>in</strong>kommens determ<strong>in</strong>iert. Haushalte<br />
älterer Menschen, deren E<strong>in</strong>kommen ausschließlich aus Renten der GRV besteht, <strong>und</strong> Bezieher<br />
von Sozialhilfeleistungen haben nicht nur im Durchschnitt ger<strong>in</strong>gere E<strong>in</strong>kommen (vgl. B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung, 2001), sondern partizipieren im späten<br />
Teil des Lebenslaufs auch <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maße an allgeme<strong>in</strong>en Zuwächsen als Bezieher von<br />
Alterse<strong>in</strong>kommen aus anderen öffentlichen <strong>und</strong> privaten Sicherungssystemen.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Prognosen für die weitere <strong>Entwicklung</strong> der ökonomischen Lage der Älteren fallen optimistisch<br />
aus, sofern e<strong>in</strong> Status Quo <strong>in</strong>stitutioneller <strong>und</strong> wirtschaftlicher Rahmenbed<strong>in</strong>gungen postuliert<br />
wird, jedoch existiert gegenwärtig ke<strong>in</strong> geschlossenes ökonomisches Modell, das alle Faktoren,<br />
die auf die materielle Lage Älterer <strong>und</strong> ihre <strong>Entwicklung</strong> wirken, umfassend berücksichtigt oder<br />
gar ihr Zusammenwirken erklärt (vgl. Schmähl & Fach<strong>in</strong>ger, 1998, S.95ff). Die Auswirkungen<br />
der Reformen der Alterssicherung s<strong>in</strong>d nur schwer abzuschätzen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e empirische Dauerbeobachtung,<br />
wie sie mit dem Alterssurvey möglich wird, ist daher von außerordentlich großer<br />
Bedeutung. Der angesprochene Status Quo wird vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> zeitweise rückläufiger<br />
Reallöhne, den demografischen Veränderungen, der Situation auf dem Arbeitsmarkt, der damit<br />
e<strong>in</strong>hergehenden Erhöhung der Inaktivenquoten <strong>und</strong> der daraus entstehenden langfristigen Probleme<br />
der Rentenf<strong>in</strong>anzierung von <strong>in</strong>teressierter Seite bereits seit längerem <strong>in</strong>frage gestellt (hierzu<br />
kritisch: Leiser<strong>in</strong>g, 1996; Leiser<strong>in</strong>g, 2002). Trotz der vielfältigen Kritik am gegenwärtigen<br />
Alterssicherungssystem ist jedoch e<strong>in</strong>e trag- <strong>und</strong> vor allem konsensfähige Alternative bislang<br />
nicht <strong>in</strong> Sicht. Auch steht letztlich e<strong>in</strong>e gesellschaftliche Verständigung über deren Sicherungsziel<br />
<strong>und</strong> -niveau bis heute aus (vgl. Leiser<strong>in</strong>g & Motel, 1997). Zu fragen ist, ob <strong>und</strong> <strong>in</strong> welcher<br />
Form sich diese neue strukturelle Unsicherheit <strong>in</strong> den Lebensperspektiven derjenigen Kohorten<br />
niederschlägt, die sich an der Schwelle zum Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand bef<strong>in</strong>den (vgl. hierzu<br />
Kapitel 3).<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der ökonomischen Lagen bestehen zudem weiterh<strong>in</strong> erhebliche Unterschiede zwischen<br />
den alten <strong>und</strong> neuen B<strong>und</strong>esländern (Ebert, 1995; Grabka, 2000; Hanesch, Krause, Bäcker,<br />
& <strong>und</strong> andere, 2000; Schwenk, 1995, S.16ff; Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2002). Zugleich<br />
lassen sich Konvergenztendenzen vor allem <strong>in</strong> den Verteilungen zeigen, weniger jedoch <strong>in</strong> den<br />
Niveaus. Diejenigen älteren Menschen, die sich bereits Ende 1989 im Ruhestand befanden,<br />
werden bis Mitte der 90er-Jahre zumeist als Gew<strong>in</strong>ner der Wiedervere<strong>in</strong>igung beschrieben (vgl.<br />
Hanesch et al. 1994; Bäcker 1995; Müller et al. 1995, S.100; Schwitzer 1995). Die Erwerbskarrieren<br />
dieser Kohorten waren geprägt durch Vollbeschäftigung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e hohe berufliche Aufwärtsmobilität.<br />
Durch die Überleitung von <strong>in</strong> der DDR erworbenen Rentenansprüchen entstanden<br />
relativ hohe Ansprüche an die b<strong>und</strong>esdeutsche Rentenversicherung. Zudem wurde das Niveau<br />
der ostdeutschen Renten schnell jenem der Renten <strong>in</strong> Westdeutschland angeglichen. Hierbei<br />
handelt es sich aber wohl um Periodeneffekte des Systemübergangs, so dass mehr als fraglich<br />
se<strong>in</strong> dürfte, ob sich die Ruheständler <strong>in</strong> Ostdeutschland auch weiterh<strong>in</strong> als begünstigte<br />
Gruppe werden halten können.<br />
Auch sagen Durchschnittswerte wenig über die Verteilung der E<strong>in</strong>kommen aus – hier ist <strong>in</strong>sbesondere<br />
auch auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern h<strong>in</strong>zuweisen. Zwar lag die Erwerbsbeteiligung<br />
von Frauen <strong>in</strong> allen DDR-Kohorten erheblich über jener der B<strong>und</strong>esrepublik.<br />
Doch wurden die E<strong>in</strong>kommensdifferenzen zwischen den Geschlechtern nicht überw<strong>und</strong>en –<br />
Frauen arbeiteten trotz der Gleichstellungsbemühungen <strong>in</strong> der DDR bevorzugt trotz ähnlichem<br />
formalem Ausbildungsniveau <strong>in</strong> weiblich dom<strong>in</strong>ierten Branchen <strong>und</strong> Berufen mit ger<strong>in</strong>geren<br />
Löhnen. Auch oblag den Frauen <strong>in</strong> der DDR überwiegend alle<strong>in</strong> die Aufgabe der K<strong>in</strong>dererziehung,<br />
was allerd<strong>in</strong>gs durch staatliche <strong>und</strong> betriebliche Regelungen erleichtert wurde. Frauen<br />
waren durch die hohe weibliche Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> der Lage, eigenständige Rentenansprüche<br />
zu erwerben, was sich <strong>in</strong> höheren Rentenanwartschaften alter Frauen <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
niederschlägt. Dagegen haben die Männer <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern – vor allem aufgr<strong>und</strong><br />
137
138<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
des Fehlens von Betriebsrenten – niedrigere Anwartschaften aus eigener Erwerbstätigkeit als<br />
ihre Altersgenossen <strong>in</strong> den alten Ländern (vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger,<br />
1999). Inwieweit sich diese Konstellationen auch für neuere Ruhestandskohorten werden fortschreiben<br />
lassen, ist angesichts der Verschiebungen auf den Arbeitsmärkten <strong>und</strong> <strong>in</strong> den rentenrechtlichen<br />
Regelungen fraglich. Mitte der 90er-Jahre schien absehbar, dass „mit der Anpassung<br />
des Arbeitsmarktes an westdeutsche Strukturen (...) e<strong>in</strong>e Angleichung an westdeutsche geschlechtsspezifische<br />
Disparitäten erfolgen wird“ (Hanesch et al., 1994, S. 107). Es ist zu prüfen,<br />
ob sich dieses 2002 bereits abzuzeichnen beg<strong>in</strong>nt.<br />
Was die zukünftige <strong>Entwicklung</strong> betrifft, ist auch daran zu er<strong>in</strong>nern, dass die durchschnittlichen<br />
Erwerbse<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern seit der Vere<strong>in</strong>igung deutlich unter den Niveaus<br />
der alten Länder liegen. Zugleich ist der Anteil erwerbsloser Männer <strong>und</strong> Frauen langfristig<br />
deutlich höher. Dieses wird dauerhaft negative Auswirkungen auf die <strong>Entwicklung</strong> der Niveaus<br />
der Altersrenten haben. Auch kann mit Blick auf den unteren Rand der Alterse<strong>in</strong>kommensverteilung<br />
davon ausgegangen werden, dass das Phänomen ger<strong>in</strong>ger Altersarmut <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
nur befristeter Natur ist, denn der Wegfall von Übergangsregelungen wie dem Sozialzuschlag<br />
<strong>und</strong> dem Auffüllbetrag Mitte der 90er Jahre wird wahrsche<strong>in</strong>lich sukzessive zu<br />
e<strong>in</strong>er weiteren Ausdifferenzierung der E<strong>in</strong>kommensverteilung an ihrem unteren Rand <strong>und</strong> damit<br />
zu e<strong>in</strong>er Zunahme des Sozialhilfebezuges <strong>und</strong> des Anteils von Beziehern von relativen Niedrige<strong>in</strong>kommen<br />
führen müssen. Dies sollte sich <strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys bereits<br />
messbar manifestieren. Es ist auch e<strong>in</strong>e offene Frage, <strong>in</strong> welcher Weise sich die bereits heute<br />
antizipierbaren <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> den Perspektiven älterer Menschen <strong>in</strong> Ostdeutschland niederschlagen.<br />
Neben dem E<strong>in</strong>kommen ist das Geldvermögen der privaten Haushalte <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Verteilung e<strong>in</strong><br />
wichtiger Indikator der materiellen Lage. Das Vermögen stellt neben dem E<strong>in</strong>kommen aus Renten-<br />
<strong>und</strong> Pensionsansprüchen e<strong>in</strong>e zweite mögliche f<strong>in</strong>anzielle Ressource im Alter dar. Vermögen<br />
<strong>und</strong> Vermögense<strong>in</strong>kommen s<strong>in</strong>d aber deutlich ungleicher verteilt als die E<strong>in</strong>kommen aus<br />
Erwerbsarbeit sowie die E<strong>in</strong>kommen aus öffentlichen Alterssicherungssystemen (vgl. z.B. Hauser<br />
& Becker, 2003, S. 83ff; e<strong>in</strong>e Ausnahme machen hier sicher die E<strong>in</strong>künfte aus selbständiger<br />
Tätigkeit, die <strong>in</strong> ähnlicher Weise ungleich verteilt s<strong>in</strong>d wie Vermögense<strong>in</strong>kommen). Der Analyse<br />
des Vermögens kommt im H<strong>in</strong>blick auf die Lebenslagen älterer Menschen <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
<strong>in</strong> mehrfacher H<strong>in</strong>sicht Bedeutung zu: So ist das Vermögen <strong>in</strong> Längsschnittperspektive<br />
jenseits der Querschnittserhebung des Sparverhaltens <strong>und</strong> der Höhe der Netto-Sparquoten e<strong>in</strong>e<br />
notwendige Analysedimension des Sparens als e<strong>in</strong>e Strategie privater Alterssicherung. Der<br />
Vermögensbesitz kann dabei <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang mit <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n E<strong>in</strong>schätzungen zum<br />
Sozialstaat <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Leistungsfähigkeit sowie der Erwartungen künftiger <strong>Entwicklung</strong>en des<br />
Lebensstandards gestellt werden. So dürften <strong>in</strong>sbesondere E<strong>in</strong>schätzungen der Leistungsfähigkeit<br />
des Sozialversicherungssystems entscheidenden E<strong>in</strong>fluss auf Entscheidungen zur privaten<br />
Vorsorge haben. Die Handlungsrelevanz dieser E<strong>in</strong>schätzung dürfte aber <strong>in</strong> erheblichem Maße<br />
an das Vorhandense<strong>in</strong> ausreichender Ressourcen geb<strong>und</strong>en se<strong>in</strong>. Darüber h<strong>in</strong>aus steht die Vermögensbildung<br />
<strong>in</strong> Konkurrenz zu f<strong>in</strong>anziellen Transfers an K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> Enkel, wobei gleichzeitig<br />
die Existenz e<strong>in</strong>es gewissen Vermögens e<strong>in</strong>e Voraussetzung dieser Transfers ist, da Leistungen<br />
an die K<strong>in</strong>der häufig aus diesem Ressourcenpool getätigt werden.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
H<strong>in</strong>sichtlich des <strong>in</strong>tergenerationalen Transfergeschehens konnten die Analysen des Alterssurveys<br />
bisher e<strong>in</strong>drucksvoll die Reichhaltigkeit des Austauschs von Leistungen <strong>in</strong>nerhalb der Familien<br />
belegen. Sie verlaufen gemäß e<strong>in</strong>es unvollständigen Kaskadenmodells, <strong>in</strong> dem die<br />
Haupttransfers von Eltern an ihre K<strong>in</strong>der fließen. Daneben f<strong>in</strong>den sich aber auch Leistungen<br />
über zwei Generationen von Großeltern an ihre Enkel sowie – <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gem Ausmaß – auch<br />
Rücktransfers von Geld- <strong>und</strong> Sachwerten. Künem<strong>und</strong>, Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, & Kohli, (2003) konnten<br />
<strong>in</strong>zwischen zeigen, dass sich Transfers von Geld- <strong>und</strong> Sachwerten, je nachdem, ob sie als<br />
kle<strong>in</strong>ere Transfers, große e<strong>in</strong>malige Leistungen <strong>und</strong> Schenkungen oder als Erbschaften fließen,<br />
ganz unterschiedlich auf die Strukturen sozialer Ungleichheit auswirken mögen. Während kle<strong>in</strong>ere<br />
Transfers trotz ihres hohen Gesamtumfangs kaum Wirkungen auf die Ungleichverteilung<br />
zu haben sche<strong>in</strong>en – bestenfalls wirken sie leicht nivellierend, wenn vor allem K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> spezifischen<br />
Bedarfslagen unterstützt werden – so gehen die größeren Leistungen <strong>und</strong> vor allem die<br />
Erbschaften vorrangig an die K<strong>in</strong>der wohlhabender Eltern, ohne dass sich e<strong>in</strong>e spezifische Bedarfsorientierung<br />
nachweisen lässt, was die Ungleichverteilung von Ressourcen <strong>in</strong> der K<strong>in</strong>dergeneration<br />
verstärken sollte. In jedem Falle steht die Transfervergabe unter dem E<strong>in</strong>fluss der<br />
Verfügbarkeit von Ressourcen auf Seiten der Geber – wohlhabende Eltern geben nicht nur<br />
mehr, sondern auch mit größerer Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit Ressourcen an ihre K<strong>in</strong>der weiter. Bef<strong>in</strong>det<br />
sich die Ressourcenausstattung im <strong>Wandel</strong>, so kann von e<strong>in</strong>er negativen Rückwirkung auf<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit <strong>und</strong> Umfang der Transfers an erwachsene K<strong>in</strong>der ausgegangen werden (vgl.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000). Absolut oder auch relativ s<strong>in</strong>kende Alterse<strong>in</strong>kommen könnten zu e<strong>in</strong>er<br />
Abnahme von Transfers von alten Eltern an ihre erwachsenen K<strong>in</strong>der führen, während h<strong>in</strong>gegen<br />
sogar e<strong>in</strong>e Zunahme der Rücktransfers denkbar wäre. E<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Schwächung der <strong>in</strong>tergenerationalen<br />
B<strong>in</strong>dungen könnte zu Abnahmen der Transfers <strong>in</strong> beiden Richtungen beitragen. Es<br />
ist daher zu untersuchen, wie sich das private Transfergeschehen über die Zeit entwickelt.<br />
4.4 Datenerhebung <strong>und</strong> Konzepte<br />
Vor der Präsentation von Analysen ist es notwendig, e<strong>in</strong>ige der zentralen Konzepte der Erhebung<br />
genauer zu beschreiben. Dem soll im Folgenden nachgekommen werden. Im Rahmen der<br />
folgenden Analysen werden Angaben aus den mündlichen <strong>und</strong> schriftlichen, standardisierten<br />
Befragungen des Alterssurvey <strong>in</strong> den Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002 verwendet. Gr<strong>und</strong>sätzlich zu unterscheiden<br />
s<strong>in</strong>d Analysen im Querschnittsvergleich <strong>und</strong> Längsschnittanalysen. Querschnittsanalysen<br />
beziehen sich auf die unabhängigen, repräsentativen, geschichteten Stichproben der 40- bis<br />
85-jährigen Wohnbevölkerung <strong>in</strong> privaten Haushalten mit deutscher Staatsbürgerschaft der beiden<br />
Wellen des Alterssurveys – die Basisstichprobe <strong>und</strong> die Replikationsstichprobe (vgl. Kapitel<br />
2). Deskriptive Aussagen auf dieser Gr<strong>und</strong>lage s<strong>in</strong>d auf die entsprechende Population übertragbar,<br />
wenn die Daten entsprechend der disproportionalen Stratifizierung gewichtet werden.<br />
Die Längsschnittanalysen beziehen sich auf e<strong>in</strong> gewichtetes Sample derjenigen Personen der<br />
Geburtsjahrgänge 1911 bis 1956, die zu beiden Erhebungszeitpunkten 1996 <strong>und</strong> 2002 befragt<br />
wurden – die Panelstichprobe. Ziel ist es hier, längsschnittlich dynamische Prozesse über den<br />
Lebenslauf <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte zu untersuchen – als Beispiel s<strong>in</strong>d hier E<strong>in</strong>kommensdynamiken<br />
zu nennen.<br />
139
140<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Analysen der Stichprobenselektivitäten zwischen den jeweiligen Stichproben <strong>und</strong> den Samples<br />
der mündlichen <strong>und</strong> schriftlichen Befragung (vgl. Kapitel 2) sowie die Überprüfungen der Itemselektivität<br />
der E<strong>in</strong>kommenserhebung ergeben nur wenige <strong>und</strong> schwache Effekte – <strong>in</strong>sbesondere<br />
im H<strong>in</strong>blick auf die Bildung <strong>und</strong> die subjektive Ges<strong>und</strong>heit der Befragten. Die vorgef<strong>und</strong>enen<br />
Effekte entsprechen weitgehend jenen der Selektivitätsanalysen vergleichbarer Studien wie z.B.<br />
der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (vgl. hierzu L<strong>in</strong>denberger, Gilberg, Pötter, Little, & Baltes, 1996) oder<br />
auch OASIS (Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, Tesch-Roemer, & von Kondratowitz, 2003) <strong>und</strong> deuten nicht<br />
auf spezielle Befragungsprobleme im Alterssurvey h<strong>in</strong>.<br />
4.4.1 E<strong>in</strong>kommenserhebung<br />
In den beiden standardisierten Befragungsteilen des Alterssurveys – dem mündlichen Interview<br />
der schriftlichen Erhebung – wurde das Haushaltse<strong>in</strong>kommen der Befragten erhoben. In der<br />
mündlichen Befragung wurde zur Abfrage des E<strong>in</strong>kommens e<strong>in</strong>e Standardformulierung verwendet,<br />
wie sie im Rahmen der Empfehlung des Arbeitskreises Deutscher Marktforschungs<strong>in</strong>stitute,<br />
der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Sozialwissenschaftlicher Institute <strong>und</strong> des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes<br />
erarbeitet wurde (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 1993, 1999). In der schriftlichen Erhebung<br />
wurde h<strong>in</strong>gegen darauf abgezielt, auch die Zusammensetzung des Haushaltse<strong>in</strong>kommens zu<br />
erfragen. Hier wurde daher e<strong>in</strong>e Detailabfrage aller Komponenten des Haushaltse<strong>in</strong>kommens<br />
unternommen. Zusätzlich wurden für die E<strong>in</strong>kommen des Befragten <strong>und</strong> ggf. se<strong>in</strong>es Partners<br />
sowie für E<strong>in</strong>kommen, die ausschließlich auf Haushaltsebene erfragt werden können, wie Leistungen<br />
nach dem B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz, auch die Beträge dieser Komponenten erfasst. Die<br />
Reliabilität der Abfrage erweist sich als hoch: Die Test-Retest-Korrelation beider Abfragen des<br />
Haushaltse<strong>in</strong>kommens liegt zu beiden Messzeitpunkten trotz der methodischen Differenzen <strong>in</strong><br />
der Abfrage mit r1996=0,92 (p
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Intervalls <strong>in</strong> die Berechnungen e<strong>in</strong>. Sie be<strong>in</strong>halten somit e<strong>in</strong>en gewissen Messfehler im S<strong>in</strong>ne<br />
e<strong>in</strong>er systematischen Verr<strong>in</strong>gerung der Varianz der Angaben. Jedoch ermöglicht dieses Vorgehen<br />
e<strong>in</strong>e erhebliche Senkung des Anteils fehlender Werte. Die so erstellte E<strong>in</strong>kommensvariable<br />
hat e<strong>in</strong>en Anteil fehlender Werte von weniger als zwölf Prozent (1996) bzw. zehn Prozent<br />
(2002) (vgl. Motel, 2000).<br />
Das Geldvermögen wurde, wie auch die Verschuldung, im schriftlichen Teil der Erhebung erfragt.<br />
In beiden Fällen wurde – wie schon bei der Erhebung des E<strong>in</strong>kommens <strong>in</strong> der mündlichen<br />
Befragung – auf e<strong>in</strong>e kategoriale Abfrage zurückgegriffen. Der Anteil fehlender Werte ist jeweils<br />
sehr ger<strong>in</strong>g <strong>und</strong> liegt bei zehn Prozent für die Vermögensabfrage <strong>und</strong> vier Prozent bei der<br />
Frage nach Verschuldung. Ähnliches gilt für den Immobilienbesitz, der ebenfalls im schriftlichen<br />
Erhebungsteil erfragt wurde. Bei weniger als e<strong>in</strong>em Prozent der Fälle fehlt die Antwort auf<br />
die Frage, ob sie solche Liegenschaften besitzen oder nicht. In e<strong>in</strong>em zweiten Schritt wurden<br />
auch die verschiedenen Formen von Immobilien wie Wohnungen, E<strong>in</strong>- oder Zweifamilienhäuser,<br />
Mehrfamilienhäuser, Ferienhäuser/-wohnungen <strong>und</strong> sonstige Gr<strong>und</strong>stücke erhoben. Auch<br />
hier liegt der Anteil fehlender Werte mit knapp vier Prozent sehr niedrig. Die subjektiven Bewertungen<br />
des Lebensstandards, se<strong>in</strong>er vergangenen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er künftigen <strong>Entwicklung</strong> erfolgten<br />
analog der Erhebung der Bewertungen <strong>in</strong> anderen Schwerpunktbereichen des Alterssurveys.<br />
4.4.2 E<strong>in</strong>kommenskonzept<br />
Wird vor allem e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung der wirtschaftlichen Lage der Betroffenen, d.h. ihrer relativen<br />
Wohlstandsposition, angestrebt, so ist das Äquivalenze<strong>in</strong>kommen das am häufigsten verwendete<br />
E<strong>in</strong>kommenskonzept. Ihm liegt die Idee zugr<strong>und</strong>e, dass „aussagekräftige Wohlstandsuntersuchungen<br />
(...) die Normierung der realiter vorf<strong>in</strong>dbaren, unterschiedlichen Haushaltsstrukturen“<br />
(Faik, 1995, S. 28; auch Faik, 1997) erfordern. Diese Normierung erfolgt über e<strong>in</strong>e differenzierte<br />
Gewichtung der Bedarfe unterschiedlicher Haushaltstypen, die zum e<strong>in</strong>en auf der Summe der<br />
von allen Mitgliedern e<strong>in</strong>es Haushaltes erzielten persönlichen Nettoe<strong>in</strong>kommen, zum anderen<br />
auf der Größe des Haushalts <strong>und</strong> zumeist auch auf der Altersstruktur se<strong>in</strong>er Mitglieder basiert.<br />
Verbrauchsorientiert berechnete Skalen, die im europäischen Raum aber bisher nur sehr selten<br />
verwendet werden, berücksichtigen darüber h<strong>in</strong>aus oft auch zusätzlich das Geschlecht, den Familienstand<br />
<strong>und</strong> den Erwerbsstatus der Haushaltsmitglieder. Das so berechnete Äquivalenze<strong>in</strong>kommen<br />
ist für die Ermittlung von Wohlfahrtspositionen aussagekräftiger als das von e<strong>in</strong>er<br />
Person, beispielsweise durch eigene Erwerbstätigkeit oder aufgr<strong>und</strong> von Renten- bzw. Pensionsansprüchen<br />
erzielte, persönliche E<strong>in</strong>kommen. Aufgr<strong>und</strong> der Integration der allgeme<strong>in</strong> angenommenen<br />
Kostendegression <strong>in</strong> größeren Haushalten ist diese Größe auch der e<strong>in</strong>fachen Summierung<br />
der persönlichen E<strong>in</strong>kommen zum Haushaltse<strong>in</strong>kommen überlegen (B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung, 1999; Danziger & Taussig, 1979). Der Berechnung des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens<br />
liegt die Erhebung des Haushaltsnettoe<strong>in</strong>kommens sowie der Haushaltszusammensetzung<br />
als Basis der Kalkulation der Bedarfsgewichte zugr<strong>und</strong>e.<br />
Zur Normierung der Haushaltsstrukturen wird dabei jeweils e<strong>in</strong> Faktor der Bedarfsgewichtung<br />
e<strong>in</strong>geführt. Die Gesamtheit der jeweils verwendeten Gewichtungsfaktoren wird als „Äquivalenzskala“<br />
bezeichnet. Die Auswahl der verwendeten Skala ist nicht unproblematisch, denn sie<br />
141
142<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
bee<strong>in</strong>flusst die berechnete sozialstrukturelle Verteilung der Wohlfahrtspositionen (vgl. Aaberge<br />
& I., 1998; Buhmann, Ra<strong>in</strong>water, Schmaus, & Smeed<strong>in</strong>g, 1988; Citro & Michael, 1995; Coulter,<br />
Cowell, & Jenk<strong>in</strong>s, 1992; Faik, 1995; Faik, 1997; Piachaud, 1992; Schwarze, 2000). Unter<br />
den verschiedenen, <strong>in</strong> der Literatur beschriebenen Skalen ist ganz allgeme<strong>in</strong> zwischen E<strong>in</strong>- <strong>und</strong><br />
Zwei-Parameter-Äquivalenzskalen zu unterscheiden. Erstere berücksichtigen üblicherweise<br />
ausschließlich die Zahl der Haushaltsmitglieder zur Bedarfsgewichtung, während die letzteren<br />
meistens zusätzlich das Lebensalter der Haushaltsmitglieder, zum<strong>in</strong>dest aber die Frage, ob es<br />
sich bei den Personen im Haushalt um K<strong>in</strong>der oder um erwachsene Personen handelt - was die<br />
Präzision des Verfahrens erhöht (vgl. Fig<strong>in</strong>i, 1998).<br />
Trotz der ausführlichen Diskussionen über dieses Problem weichen die häufig verwendeten<br />
Äquivalenzskalen stark vone<strong>in</strong>ander ab – <strong>und</strong> zwar <strong>in</strong> Abhängigkeit davon, nach welchen Kriterien<br />
die jeweiligen Gewichtungen vorgenommen werden (Atk<strong>in</strong>son, 1983; Citro & Michael,<br />
1995; Fig<strong>in</strong>i, 1998). Institutionelle Skalen s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong>e Reihe von Problemen gekennzeichnet.<br />
Sie s<strong>in</strong>d kaum empirisch-statistisch f<strong>und</strong>iert <strong>und</strong> <strong>in</strong> ihrer Aussagekraft auf bestimmte, eher<br />
niedrige Wohlfahrtsbereiche beschränkt. Trotzdem werden sie <strong>in</strong> der empirischen Forschung<br />
häufig verwendet (Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000, S. 124ff). Denn ihre Alternative – empirisch begründete,<br />
„verbrauchsorientierte“ Skalen – s<strong>in</strong>d von Mängeln geprägt. So s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Wirkungen faktisch stets vorhandener Budgetbeschränkungen auf die jeweiligen Ausgabenstrukturen<br />
ungeklärt. Es ist offen <strong>in</strong>wieweit <strong>und</strong> <strong>in</strong> welcher Form nicht lediglich Konsumpräferenzen<br />
sondern auch die beschränkte Verfügbarkeit von Ressourcen auf die empirisch vorgef<strong>und</strong>enen<br />
Ausgabenstrukturen der Haushalte wirken, aus denen die Verbrauchsskalen abgeleitet<br />
werden. Sie werden daher hier zugunsten der Berücksichtigung gängiger Expertenskalen nicht<br />
detailliert diskutiert <strong>und</strong> auch im Rahmen der empirischen Analysen <strong>in</strong> diesem Kapitel nicht<br />
angewendet.<br />
Aus der Menge gängig verwendeter Expertenskalen s<strong>in</strong>d jene der OECD hervorzuheben (Piachaud,<br />
1992). Die sogenannte alte OECD-Skala bestimmt den Bedarf weiterer erwachsener<br />
Personen im Haushalt mit dem Faktor 0,7 <strong>und</strong> den Bedarf von K<strong>in</strong>dern mit dem Wert 0,5. Der<br />
Haushaltsvorstand geht auch hier mit dem Wert 1 e<strong>in</strong>. Die neue Variante der OECD-Skala postuliert<br />
dagegen stärkere Ersparnisse durch die geme<strong>in</strong>same Haushaltsführung <strong>und</strong> weist den<br />
weiteren Erwachsenen den Faktor 0,5 <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern e<strong>in</strong> Bedarfsgewicht von 0,3 zu. Ähnlich<br />
starke Effizienzgew<strong>in</strong>ne nimmt beispielsweise auch die Expertenskala an, die den spezifischen<br />
Bedarf e<strong>in</strong>es Haushaltes mit der Quadratwurzel der Zahl der Haushaltsmitglieder bestimmt.<br />
Hierbei handelt es sich um e<strong>in</strong>e vere<strong>in</strong>fachte Skala, die wohl auch aufgr<strong>und</strong> ihrer E<strong>in</strong>fachheit<br />
e<strong>in</strong>ige Beachtung <strong>in</strong> neueren Analysen f<strong>in</strong>det. Hier werden Bedarfsgewichte bestimmt, ohne das<br />
Alter der Personen zu berücksichtigen – es handelt sich also um e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>faktorielle Skala. Der<br />
Bedarf des Haushaltsvorstands (d.h. der ersten Person im Haushalt) ist demnach 1, während für<br />
das zweite Haushaltsmitglied e<strong>in</strong> Wert von ca. 0,41, für das dritte von 0,32 angenommen wird<br />
usw. Im Unterschied zu den OECD-Skalen nimmt diese Skala e<strong>in</strong>e fortschreitende Degression<br />
des relativen Bedarfs bei weiter wachsenden Haushalten an. Beispielsweise Citro <strong>und</strong> Michael<br />
<strong>in</strong>tegrieren diese Vorgehensweise beider Ansätze <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Skalenentwurf (Citro &<br />
Michael, 1995). Dieser differenziert e<strong>in</strong>erseits nach Alter der Haushaltsmitglieder <strong>und</strong> führt<br />
andererseits <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Exponentialkonstruktion e<strong>in</strong>e Kostendegression nach Haushaltsgröße auch<br />
jenseits der Schwelle zwischen E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Mehrpersonenhaushalten e<strong>in</strong>. Da diese Skala allerd<strong>in</strong>gs
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
bisher <strong>in</strong> Deutschland nur selten Verwendung f<strong>in</strong>det, wird sie <strong>in</strong> den Analysen das Alterssurveys<br />
nicht zur Anwendung gebracht. Die bis h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> <strong>in</strong> die späten 90er-Jahre <strong>in</strong> deutschen empirischen<br />
Studien der vergangenen beiden Jahrzehnte häufig verwendete Skala, die auf dem B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz<br />
aufsetzt (vgl. Motel & Wagner, 1993, S. 436 ff, <strong>in</strong>sbesondere Tabelle 1)<br />
verliert seit e<strong>in</strong>igen Jahren erheblich an Bedeutung, so dass sie für die Analysen im Alterssurvey<br />
ebenfalls nicht (mehr) <strong>in</strong>frage kommen kann. 12 Für e<strong>in</strong>e Auswahl des Berechnungsverfahrens<br />
des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens gibt es ke<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>en wissenschaftlichen oder gar politischen<br />
Vorgaben. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen stellen letztlich e<strong>in</strong>e Konvention dar – mit<br />
zum Teil erheblichen Konsequenzen für die Durchschnittse<strong>in</strong>kommen verschiedener Haushaltstypen.<br />
Für die Berechnung der Äquivalenze<strong>in</strong>kommen werden im Folgenden gr<strong>und</strong>sätzlich die Äquivalenzgewichte<br />
gemäß der neuen OECD-Skala verwendet. Andere Skalen werden nur zur Überprüfung<br />
der Effekte verschiedener Berechnungsmodi verwendet. Diese Entscheidung erfolgt<br />
<strong>in</strong> Anlehnung an die derzeitigen Trends der E<strong>in</strong>kommens-, Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsanalyse. Sie<br />
nimmt letztlich e<strong>in</strong>e Inkonsistenz zu den Analysen der ersten Welle <strong>in</strong> Kauf, die ganz überwiegend<br />
die BSHG-Skala herangezogen haben. Allerd<strong>in</strong>gs wurden bereits damals die OECD-<br />
Skalen für Vergleichsberechnungen von Mittelwerten, Quoten <strong>und</strong> Verteilungen herangezogen<br />
<strong>und</strong> die Werte auch für 1996 <strong>in</strong> diesem Beitrag gemäß der aktuell verwendeten Skala neu berechnet,<br />
so dass Vergleiche s<strong>in</strong>nvoll möglich s<strong>in</strong>d.<br />
4.4.3 Konzeption <strong>und</strong> Messung von Armut <strong>und</strong> Wohlstand<br />
So allgeme<strong>in</strong> Armut als gesellschaftlicher Missstand anerkannt wird, so problematisch s<strong>in</strong>d ihre<br />
konzeptionelle Abgrenzung <strong>und</strong> ihre empirische Bestimmung (vgl. Motel, 2000). Schon 1988<br />
unterscheiden Hagenaars <strong>und</strong> de Vos Def<strong>in</strong>itionen objektiver absoluter Armut, objektiver relativer<br />
Armut <strong>und</strong> subjektiver Armut <strong>und</strong> berechnen anhand e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zigen Datensatzes unter Verwendung<br />
verschiedener Armutsmaße Quoten von 5,7 Prozent bis zu 33,5 Prozent. E<strong>in</strong>e theoretisch<br />
begründete Def<strong>in</strong>ition ist daher unabd<strong>in</strong>gbare Voraussetzung von empirischen Analysen<br />
<strong>und</strong> ihrer Interpretation. E<strong>in</strong>e solche Armutsdef<strong>in</strong>ition hat zum<strong>in</strong>dest drei Aspekte zu berücksichtigen:<br />
Das Problem der Ressourcen bzw. des Ressourcenmangels, jenes des (relativen) Bedarfs<br />
<strong>und</strong> schließlich, dass Armut ke<strong>in</strong>eswegs als bloßes Problem physischer Existenz gedacht<br />
werden kann, sondern sozialwissenschaftlich immer auch die Relativität der Armutslage sowie<br />
der Aspekt der sozialen Deprivation zu berücksichtigen ist. Direkte Armutsdef<strong>in</strong>itionen heben<br />
auf Outcomes des Handelns von Personen mit ihnen zugänglichen Ressourcen ab <strong>und</strong> haben die<br />
Seite der Ressourcenverwendung im Blick (Sen, 1983; Sen, 1987). Indirekte Def<strong>in</strong>itionen zielen<br />
12 Sie gewichtet den f<strong>in</strong>anziellen Bedarf der Haushaltsmitglieder gemäß ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Altersgruppen<br />
<strong>in</strong> Anlehnung an jene Skala, die implizit <strong>in</strong> den Regelsätzen nach §22 B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz enthalten<br />
ist. Die Skala gibt dem Haushaltsvorstand e<strong>in</strong> Gewicht von 1, zusätzlichen Erwachsenen e<strong>in</strong> Gewicht von 0,8 sowie<br />
K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Jugendlichen je nach Alter Gewichte zwischen 0,5 <strong>und</strong> 0,9 (bis 1990 zwischen 0,45 bis 0,9 bei<br />
ger<strong>in</strong>gfügig abweichender Altersgruppierung). Zuletzt f<strong>in</strong>den sich Bestrebungen zur <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>er modifizierten<br />
Sozialhilfeskala, die die Wohnkostendegression stärker e<strong>in</strong>bezieht (Faik, 1997). Sie unterscheidet sich graduell<br />
durch etwas ger<strong>in</strong>gere Personengewichte von der ursprünglichen Sozialhilfeskala.<br />
143
144<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
dagegen auf die verfügbaren Ressourcen e<strong>in</strong>er Person ab (vgl. Andreß et al., 1996; B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung, 1999). Die direkte Bestimmung verzichtet dabei auf die<br />
Annahme allgeme<strong>in</strong> verb<strong>in</strong>dlicher Präferenzen, die der Ressourcenverwendung zugr<strong>und</strong>eliegen,<br />
eröffnet aber mit der Diskussion über die Struktur der Präferenzen, ihre Entstehung <strong>und</strong> Bestimmung<br />
e<strong>in</strong> neues Problemfeld. Zudem ist auch die Annahme e<strong>in</strong>es allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichen<br />
Lebensstandards problematisch. Für die empirische Analyse s<strong>in</strong>d also stets voraussetzungsvolle<br />
Annahmen vonnöten. Zwar ist der den Armutsdef<strong>in</strong>itionen zugr<strong>und</strong>e liegende Ressourcenbegriff<br />
nur bed<strong>in</strong>gt auf das E<strong>in</strong>kommen zu beschränken, doch gilt, dass den materiellen Gr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>und</strong> hier vor allem der E<strong>in</strong>kommenslage e<strong>in</strong>e im Vergleich mit anderen Lebenslagen zentrale<br />
Bedeutung zukommt (Backes & Clemens, 1998, S. 10). Zudem ist das E<strong>in</strong>kommen der zentrale<br />
Ansatzpunkt sozialstaatlicher Intervention <strong>in</strong> Deutschland. Dies gilt <strong>in</strong>sbesondere für die Alterssicherung.<br />
Der Begriff der Armut wird daher im Folgenden auf den Aspekt der ressourcenbezogenen<br />
Armut beschränkt.<br />
In der neueren deutschen Armutsforschung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere zwei Operationalisierungen von<br />
Armut verbreitet: Die Konzepte von Sozialhilfe <strong>und</strong> relativer E<strong>in</strong>kommensarmut. Die Bestimmung<br />
von Armut aufgr<strong>und</strong> des Erhalts von Sozialhilfeleistungen schließt an Subsistenzkonzepte<br />
an, die um die Bed<strong>in</strong>gungen der soziokulturellen Existenz erweitert werden. So def<strong>in</strong>ierte Armut<br />
ist auf den im B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz (BSHG) bestimmten Bereich staatlicher Unterstützungsleistungen<br />
beschränkt. 13 Zum Empfang von „Hilfen zum Lebensunterhalt“ oder von „Hilfen<br />
<strong>in</strong> besonderen Lebenslagen“ berechtigte Personen werden so als arm bezeichnet. Oftmals<br />
wird trotz der dah<strong>in</strong>ter stehenden Dunkelziffern, also der unbekannten Verbreitung verdeckter<br />
Armut (s.u.), alle<strong>in</strong> schon die Sozialhilfequote als Armutsmaß verwendet. Im S<strong>in</strong>ne des BSHG<br />
gelten die Empfänger dieser staatlichen Transferleistungen allerd<strong>in</strong>gs nicht als arm, da hier Armut<br />
bereits erfolgreich durch die Leistungsbewilligung „bekämpft“ wird. Armut besteht dann<br />
nur für jenen Bevölkerungsteil, der im S<strong>in</strong>ne des B<strong>und</strong>essozialhilfegesetzes anspruchsberechtigt<br />
ist, diese Leistungen aber nicht <strong>in</strong> Anspruch nimmt. Bei Verwendung des Sozialhilfebezugs wie<br />
auch der Sozialhilfebedürftigkeit als Armuts<strong>in</strong>dikator begibt sich die Untersuchung <strong>in</strong> die Abhängigkeit<br />
von politischer Def<strong>in</strong>itionsmacht. E<strong>in</strong> politisch motiviertes Absenken des Anspruchsniveaus<br />
für Sozialhilfeleistungen führt paradoxerweise zu e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung von so<br />
def<strong>in</strong>ierter Armut.<br />
Mit der Def<strong>in</strong>ition von Armut als Sozialhilfebezug konkurriert das Konzept der „relativen E<strong>in</strong>kommensarmut“,<br />
das sich am gesellschaftlichen Durchschnittse<strong>in</strong>kommen orientiert. Es geht<br />
hierbei um e<strong>in</strong>e Skala relativer Wohlfahrtslagen, wie sie mit Hilfe e<strong>in</strong>es Äquivalenze<strong>in</strong>kommens<br />
berechnet werden kann (s.o.) <strong>und</strong> deren untere Positionen als Lagen relativer E<strong>in</strong>kommensarmut<br />
zu def<strong>in</strong>ieren s<strong>in</strong>d (vgl. Piachaud, 1992). E<strong>in</strong>e Person wird dann als arm angesehen, sofern ihr –<br />
im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt – der Zugriff auf materielle Ressourcen (E<strong>in</strong>kommen)<br />
<strong>in</strong> erheblicher Weise verschlossen bleibt. Die so bestimmten Armutsgrenzen s<strong>in</strong>d proble-<br />
13 Es handelt es sich hier nicht um e<strong>in</strong> Konzept, das Armut an e<strong>in</strong>em absoluten physischen Existenzm<strong>in</strong>imum verankert.<br />
Die Sozialhilfegesetzgebung berücksichtigt auch die Dimension e<strong>in</strong>er angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen<br />
Leben. Es ist aber <strong>in</strong> dem S<strong>in</strong>ne absolut, dass diese Def<strong>in</strong>ition nicht direkt auf das Wohlstandsniveau<br />
der Gesellschaftsmitglieder im allgeme<strong>in</strong>en Bezug nimmt, sondern die Armutsgrenze als Setzung e<strong>in</strong>es absoluten<br />
Bedarfs von Individuen bestimmt wird.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
matisch – wie letztlich alle normativen Setzungen von Expertenstandards (Statistisches B<strong>und</strong>esamt,<br />
2002).<br />
Armut wird im Folgenden durchgängig als relative E<strong>in</strong>kommensarmut def<strong>in</strong>iert. Sofern nichts<br />
anderes angegeben wird, bezieht sich der Begriff auf e<strong>in</strong> auf Gr<strong>und</strong>lage der neuen OECD-Skala<br />
berechnetes Äquivalenze<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> Höhe von bis zu 50 Prozent des arithmetischen Mittelwertes<br />
des E<strong>in</strong>kommens <strong>in</strong> der gesamten B<strong>und</strong>esrepublik. E<strong>in</strong>e Berechnung unterschiedlicher<br />
Durchschnittse<strong>in</strong>kommen für Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland <strong>und</strong> damit die Verwendung unterschiedlicher<br />
Armutsgrenzen für beide Landesteile wird verworfen. Dieses Vorgehen wurde<br />
aufgr<strong>und</strong> der weit vorangeschrittenen Integration <strong>und</strong> der Angleichung der Strukturen <strong>in</strong> den<br />
Lebenshaltungsaufwendungen, durch die e<strong>in</strong>e Verwendung unterschiedlicher Referenzpunkte<br />
zur relationalen Bewertung von E<strong>in</strong>kommenslagen nicht geboten ersche<strong>in</strong>t, bereits für die Analysen<br />
der ersten Welle des Alterssurveys im Jahre 1996 gewählt. Seitdem ist die Angleichung<br />
<strong>und</strong> Integration weiter vorangeschritten, so dass ke<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> zur Revision der vormaligen Entscheidungen<br />
besteht. Dies entspricht dem derzeitigen Standard (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2002).<br />
Die e<strong>in</strong>kommensbasierte Messung von relativem Wohlstand oder Reichtum im Alter schließt<br />
sich an die Def<strong>in</strong>ition relativer E<strong>in</strong>kommensarmut an. Oftmals wird Wohlstand als Bezug e<strong>in</strong>es<br />
E<strong>in</strong>kommens <strong>in</strong> Höhe von 200 Prozent oder mehr des gesellschaftlichen Durchschnittse<strong>in</strong>kommens<br />
bestimmt (vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 1990; Huster & Eissel, 2001),<br />
sofern Reichtum auf Gr<strong>und</strong>lage der E<strong>in</strong>kommenslage gemessen wird. Bei der Bewertung dieser<br />
Grenze ist aus gerontologischer <strong>und</strong> sozialpolitischer Perspektive allerd<strong>in</strong>gs zu beachten, dass<br />
e<strong>in</strong> so bestimmter Geldbetrag gerade dazu ausreichen dürfte, bei Unterstützung durch die Pflegeversicherung<br />
e<strong>in</strong>en Platz <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em durchschnittlichen Pflegeheim ohne Vermögensauflösungen<br />
oder weitere Hilfen zur Pflege zu f<strong>in</strong>anzieren (Wagner, Motel, Spieß, & Wagner, 1996, S.<br />
284). Die Anmerkungen zur Def<strong>in</strong>ition der relativen E<strong>in</strong>kommensarmut gelten dabei im Folgenden<br />
s<strong>in</strong>ngemäß auch für die Def<strong>in</strong>ition des relativen Wohlstands.<br />
4.4.4 Zur Erhebung weiterer Indikatoren<br />
Geld- <strong>und</strong> Sachtransfers – Die Erhebung materieller Geld- <strong>und</strong> Sachtransfers hat mit Geldgeschenken,<br />
größeren Sachgeschenken <strong>und</strong> regelmäßigen f<strong>in</strong>anziellen Unterstützungen möglichst<br />
alle übertragbaren Formen materieller Güter zu umfassen. Zudem muss die Abfrage e<strong>in</strong>en genau<br />
umrissenen Zeitraum def<strong>in</strong>ieren, um e<strong>in</strong>deutige Zuordnungen des Transfergeschehens zu ermöglichen.<br />
Die Zahl möglicher Vorbilder war im deutschen Sprachraum zum Zeitpunkt der<br />
ersten Erhebungswelle des Alterssurveys mit der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (BASE) <strong>und</strong> dem Soziooekonomischen<br />
Panel (SOEP) ger<strong>in</strong>g. Auf dieser Basis lagen e<strong>in</strong>ige wenige Publikationen vor<br />
(vgl. Croda, 1998; Jürges, 1998; Motel & Spieß, 1995). Die Erhebung <strong>in</strong> der ersten Befragungswelle<br />
von 1996 hat sich bewährt (vgl. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000). Sie wurde <strong>in</strong> der zweiten<br />
Welle 2002 wiederholt. Lediglich auf die abermalige langfristige Abfrage umfangreicher Transfers<br />
wurde aufgr<strong>und</strong> der konzeptuellen Unschärfe der erzielbaren Ergebnisse verzichtet.<br />
Zur Erhebung der aktuellen privaten Transfers wird den Befragungspersonen des Alterssurveys<br />
daher zunächst folgende Frage gestellt: „Viele Menschen machen anderen Geld- oder Sachgeschenke<br />
oder unterstützen diese f<strong>in</strong>anziell? Dabei kann es sich z.B. um Eltern, K<strong>in</strong>der, Enkel<br />
145
146<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
oder andere Verwandte, aber auch um Fre<strong>und</strong>e oder Bekannte handeln. Wie ist das bei Ihnen?<br />
Haben Sie <strong>in</strong> den vergangenen 12 Monaten jemandem Geld geschenkt, größere Sachgeschenke<br />
gemacht oder jemanden regelmäßig f<strong>in</strong>anziell unterstützt?“. Wenn dies zutrifft, wird nach dem<br />
ersten Empfänger gefragt, der dann auf e<strong>in</strong>er „Personenkarte“ identifiziert werden soll. Hierbei<br />
wird zwischen bestimmten Verwandten wie Mutter, Schwiegermutter, Schwiegertochter, Partner,<br />
Schwester, Schwäger<strong>in</strong>, Tante, Kus<strong>in</strong>e, Nichte, 1. K<strong>in</strong>d, 2. K<strong>in</strong>d usw., nach Enkelk<strong>in</strong>d,<br />
bestimmten Fre<strong>und</strong>en, Arbeitskollegen usw. sowie anderen Personen differenziert, für die unter<br />
Verwendung von Personencodes Daten jeweils getrennt erhoben wurden (Tesch-Römer, Wurm,<br />
Hoff, & Engstler, 2002). Des weiteren wird nach der Art der Transfers (Geldgeschenke, größere<br />
Sachgeschenke, regelmäßige f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung oder anderes), nach der Transferhöhe <strong>in</strong><br />
den letzten 12 Monaten sowie danach gefragt, ob diese Zuwendung größer, ger<strong>in</strong>ger oder etwa<br />
genauso groß war wie im Jahr zuvor. Wenn Transfers an weitere Personen erfolgen, werden<br />
dieselben Fragen für die nächste Person gestellt. Diese Informationen werden für bis zu vier<br />
Empfänger erhoben, bei weiteren drei Empfängern wird lediglich noch die Person <strong>und</strong> ihre Stellung<br />
zum Geber erfragt. Entsprechend wird auch im H<strong>in</strong>blick auf den Erhalt von Transfers verfahren.<br />
Der Anteil fehlender Werte liegt bei beiden Transferrichtungen für die Frage nach Transfervergabe<br />
oder -erhalt bei knapp e<strong>in</strong>em Prozent. Werden diese Fragen bejaht, so fehlen bei weniger<br />
als 0,5 Prozent Angaben zu den begünstigten Personen. Der Wert der Vergaben wird h<strong>in</strong>gegen<br />
häufiger nicht angegeben: So fehlen <strong>in</strong> den Querschnittsstichproben z.B. bei der ersten begünstigten<br />
Person <strong>in</strong> beiden Wellen jeweils etwas mehr als 15 Prozent der Fälle die Wertangaben,<br />
was zu etwa gleichen Teilen auf Verweigerungen <strong>und</strong> Nichtwissen zurückgeht. Diese Größenordnungen<br />
s<strong>in</strong>d aus der e<strong>in</strong>fachen Abfrage der Haushaltse<strong>in</strong>kommen bekannt, wobei die<br />
Werte der Transfers häufig dann nicht angegeben werden, wenn auch die E<strong>in</strong>kommensangaben<br />
fehlen, so dass die Ergebnisse zur Itemselektivität der E<strong>in</strong>kommenserhebung <strong>in</strong> gewissem Maße<br />
fortgelten. Daneben s<strong>in</strong>d es oft f<strong>in</strong>anziell Bessergestellte <strong>und</strong> Personen mit höherem sozialem<br />
Status bzw. Prestige, die ke<strong>in</strong>e Angaben machen. Insofern ist es möglich, dass es zu e<strong>in</strong>er gewissen<br />
Unterschätzung des Umfangs des Transfergeschehens kommen kann. Die im Folgenden<br />
vorrangig untersuchte Verbreitung der <strong>in</strong>tergenerationalen Transfers ist hiervon allerd<strong>in</strong>gs nicht<br />
berührt.<br />
Erbschaften – In ganz ähnlicher Weise wurde die Erbschaftserhebung strukturiert. Auch sie<br />
wurde weitestgehend unverändert zu beiden Befragungen verwendet. Während aber die Transfers<br />
zu Lebzeiten jeweils Bestandteil des mündlichen Interviews s<strong>in</strong>d, f<strong>in</strong>den sich die Fragen zu<br />
Erbschaften getrennt davon im schriftlichen Fragebogen e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en <strong>in</strong> den Befragungsteil, der<br />
Angaben zu Vermögen <strong>und</strong> Verschuldung sowie zu Sparen <strong>und</strong> Entsparen erhebt. Ausgehend<br />
von e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>stiegsfrage („Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner schon e<strong>in</strong>mal etwas geerbt? Bitte<br />
denken Sie dabei auch an kle<strong>in</strong>ere Nachlässe.“) werden bei Vorliegen e<strong>in</strong>er Erbschaft die Erblasser<br />
sowie grob kategorial der heutige Wert dieser Erbschaften erfragt. Zusätzlich wird <strong>in</strong><br />
beiden Erhebung die Frage nach künftig erwarteten Erbschaften <strong>und</strong> ihrem geschätzten Wert<br />
gestellt. Ähnlich wie bei den Transfers zu Lebzeiten ist der Anteil fehlender Werte bei der E<strong>in</strong>stiegsfrage<br />
ger<strong>in</strong>g (Welle 1: 2,1 Prozent; Welle 2: 1,7 Prozent), steigt aber wiederum deutlich<br />
bei der Abfrage des Erbschaftswertes an (Welle 1: 3,8 Prozent; Welle 2: 5,0 Prozent).
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Sparen <strong>und</strong> Entsparen – In ganz ähnlicher Weise wurde zu beiden Befragungszeitpunkten bei<br />
der Abfrage von Spar- <strong>und</strong> Entsparprozessen verfahren: E<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>stiegsfrage s<strong>in</strong>d<br />
hier Sparziele bzw. Verwendungszwecke nachgestellt. Die Abfrage wird durch die Erhebung<br />
kategorialer Angaben der Summen abgeschlossen. Die Anteile fehlender Werte liegen hier bei<br />
den Betragsangaben mit knapp 10 Prozent über jenen bei den Erbschaften. H<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>stiegsfragen<br />
ergeben sich ke<strong>in</strong>e Unterschiede.<br />
4.5 Die materielle Lage der 40- bis 85-Jährigen<br />
Im Folgenden werden die Verteilungen von E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen – <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Differenzen zwischen den Altersgruppen <strong>und</strong> Geschlechtern sowie Unterschiede zwischen Ost-<br />
<strong>und</strong> Westdeutschen – dargestellt. Dabei wird auch die Verbreitung von Armut <strong>und</strong> Reichtum<br />
erörtert sowie die Frage von Erbschaften <strong>und</strong> Transfers zu Lebezeiten von Gebern <strong>und</strong> Nehmern<br />
diskutiert. Zentral ist dabei neben e<strong>in</strong>er Deskription der Situation im Jahr 2002 die Diskussion<br />
der Veränderungen der Parameter über die Zeit. Zweitens wird die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Dynamik der<br />
objektiven Lagen untersucht. Hierbei steht die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> E<strong>in</strong>kommensentwicklung über die<br />
Zeit im Zentrum der Überlegungen. Drittens werden vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> subjektive Aspekte<br />
materieller Lagen beschrieben. Neben subjektiven Bewertungen der vergangenen <strong>Entwicklung</strong>en,<br />
des heutigen Niveaus <strong>und</strong> der erwarteten künftigen Veränderungen des persönlichen<br />
Lebensstandards <strong>und</strong> ihren Veränderungen, steht die Relation von Erwartungen <strong>und</strong> tatsächlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong>en im Fokus der Analysen.<br />
4.5.1 Verteilung relativer E<strong>in</strong>kommenslagen<br />
Der arithmetische Mittelwert des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens der 40- bis 85-Jährigen <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
liegt nach Berechnungen des Alterssurvey im Jahr 2002 bei r<strong>und</strong> 1.530 € (Westdeutschland:<br />
1.610 €, Ostdeutschland: 1.230 €; vgl. Abbildung 4.3) <strong>und</strong> damit um 170 € über<br />
dem vom Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) ausgewiesenen Wert für die gesamte B<strong>und</strong>esrepublik<br />
(1.360 €) 14 .<br />
14 E<strong>in</strong> herzlicher Dank für die Bereitstellung der Berechnungen verschiedener Mittelwertangaben aufgr<strong>und</strong> des SOEP<br />
geht an Peter Krause (DIW, Berl<strong>in</strong>). Diese Mittelwertberechnungen stellen auch die Bemessungsgr<strong>und</strong>lage der<br />
Quoten von E<strong>in</strong>kommensarmut <strong>und</strong> Wohlstand dar.<br />
147
Abbildung 4.3:<br />
Mittlere Äquivalenze<strong>in</strong>kommen (OECD neu) nach Region, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
arithm. Mittelwert <strong>in</strong>€<br />
148<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland Gesamt<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.275/2.686), gewichtet.<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Dieser Unterschied ist plausibel, da die Angabe des SOEP auch die ger<strong>in</strong>geren E<strong>in</strong>kommen der<br />
Haushalte jüngerer, unter 40-jähriger Personen <strong>und</strong> von E<strong>in</strong>wohnern ohne deutsche Staatsbürgerschaft<br />
e<strong>in</strong>schließt. Die sehr deutlichen Niveauunterschiede zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland<br />
(Abbildung 4.3; vgl. auch Anhangstabelle A.4.1) bestehen <strong>in</strong> allen Altersgruppen (Abbildung<br />
4.4). So verfügt beispielsweise e<strong>in</strong> 40- bis 54-jähriger Mann <strong>in</strong> den westlichen B<strong>und</strong>esländern<br />
im Jahr 2002 durchschnittlich über e<strong>in</strong> Äquivalenze<strong>in</strong>kommen von ca. 1.700 €, während<br />
e<strong>in</strong> gleichaltriger Mann im Osten Deutschlands nur e<strong>in</strong> monatliches Äquivalenze<strong>in</strong>kommen von<br />
etwas über 1.300 € zur Verfügung hat.<br />
Abbildung 4.4:<br />
Mittlere Äquivalenze<strong>in</strong>kommen (OECD neu) nach Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Region,<br />
1996 <strong>und</strong> 2002<br />
arithm. Mittelwert <strong>in</strong>€<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85 Zeile 7 40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85<br />
Männer Frauen Männer Frauen<br />
Westdeutschland Ostdeutschland<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.275/2.686), gewichtet.<br />
1996<br />
2002
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Insgesamt lässt sich im zeitlichen Verlauf e<strong>in</strong>e weitgehende Stabilität der E<strong>in</strong>kommensverteilung<br />
über die Altersgruppen <strong>und</strong> letztlich auch zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland zeigen.<br />
Ausnahmen f<strong>in</strong>den sich bei den 55- bis 69-jährigen Männern im Westen, deren E<strong>in</strong>kommenslage<br />
sich deutlich überdurchschnittlich verbessert darstellt <strong>und</strong> bei der Gruppe 70- bis 85-jährigen<br />
Frauen <strong>in</strong> Ostdeutschland, deren E<strong>in</strong>kommenssituation bereits 1996 im Mittel vergleichsweise<br />
schlecht war, <strong>und</strong> die über den sechsjährigen Beobachtungszeitraum – gefolgt von den gleich<br />
alten ostdeutschen Männern – auch die ger<strong>in</strong>gsten nom<strong>in</strong>ellen, d.h. nicht <strong>in</strong>flations- oder kaufkraftbere<strong>in</strong>igten<br />
Zuwächse aufweisen. Da dies <strong>in</strong> schwächerem Ausmaß auch für die ostdeutschen<br />
Männer gilt, hat sich die Verteilung unter den Ostdeutschen so jener <strong>in</strong> Westdeutschland<br />
angepasst – wenngleich nur relativ h<strong>in</strong>sichtlich der Altersgruppenverteilung <strong>und</strong> noch nicht<br />
deutlich h<strong>in</strong>sichtlich der Niveaus: Auch im Jahr 2002 liegt der arithmetische Mittelwert für die<br />
neuen Länder <strong>in</strong> allen Altersgruppen deutlich unter jenem <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern, auch<br />
wenn sich die West-Ost-Relation sich <strong>in</strong>sgesamt von 1,35:1 im Jahr 1996 auf 1,31:1 im Jahr<br />
2002 zu Gunsten der Ostdeutschen verr<strong>in</strong>gert hat (vgl. Anhangstabelle A.4.1). Diese Veränderung<br />
der Relationen geht vor allem auf die Angleichung der E<strong>in</strong>kommen der 40- bis 54-Jährigen<br />
zurück (1996: 1,39; 2002: 1,29). Unter den 55- bis 69-Jährigen ist die Relation konstant (1996:<br />
1,35; 2002: 1,35) <strong>und</strong> unter den 70- bis 85-Jährigen hat sich die relative Differenz zwischen<br />
West- <strong>und</strong> Ostdeutschen sogar verschärft (1996: 1,24; 2002: 1,32).<br />
Die relative schlechte E<strong>in</strong>kommenslage älterer Frauen vor allem <strong>in</strong> Westdeutschland wurde für<br />
1996 als Ergebnis e<strong>in</strong>es Kohorteneffekts gedeutet (Motel, 2000). Es wurde argumentiert, dies<br />
sei e<strong>in</strong> Ergebnis der im Westen Deutschlands ger<strong>in</strong>geren Erwerbsbeteiligung der Frauen dieser<br />
frühen Geburtsjahrgänge <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Effekt der H<strong>in</strong>terbliebenengesetzgebung, die Witwen bei ungleichen<br />
Erwerbsbiografien letztlich schlechter stellt als Witwer (vgl. auch Wagner & Motel,<br />
1998). Da sich im Zeitvergleich zeigt, dass sich die ostdeutsche Verteilung der E<strong>in</strong>kommen<br />
jener im Westen mit ihrer Schlechterstellung älterer Frauen anzugleichen sche<strong>in</strong>t, ist nach den<br />
möglichen Gründen zu fragen. Bestätigten die Analysen für 1996 die Auswirkungen der für die<br />
Betroffenen günstigen Modalitäten der Überleitung der DDR-Alterssicherung <strong>in</strong> das b<strong>und</strong>esdeutsche<br />
Rentenrecht – ostdeutsche Ruheständler konnten hier zurecht als Gew<strong>in</strong>ner der E<strong>in</strong>heit<br />
bezeichnet werden – so erweisen sich offenbar vor allem die mittleren Altersgruppen <strong>in</strong> gewisser<br />
Weise als Gew<strong>in</strong>ner der Folgezeit, während es den bereits im Ruhestand bef<strong>in</strong>dlichen Gruppen<br />
nicht gel<strong>in</strong>gt, hier Schritt zu halten.<br />
Insgesamt sche<strong>in</strong>t sich e<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong> zuungunsten der Älteren <strong>in</strong> Ostdeutschland anzudeuten.<br />
Die nom<strong>in</strong>ellen Zuwächse unter den 70- bis 85-Jährigen liegen durchgängig unter dem<br />
Durchschnitt der betrachteten Altersgruppen, während Jüngere entsprechend im Mittel meist<br />
überdurchschnittliche Zuwächse verbuchen können. Relativ betrachtet jedoch können die über<br />
70-Jährigen im Westen ihre Position zum Durchschnitt der zweiten Lebenshälfte behaupten<br />
(1996: 0,87; 2002: 0,88). H<strong>in</strong>gegen ist der Trend im Osten Deutschlands – aufgr<strong>und</strong> der Gestaltung<br />
<strong>in</strong>stitutioneller Regelungen <strong>und</strong> der bekannten <strong>Entwicklung</strong> der Erwerbs- <strong>und</strong> Alterssicherungse<strong>in</strong>kommen<br />
über die Zeit – erwartungsgemäß deutlich. Vormals mit E<strong>in</strong>kommensressourcen<br />
ausgestattet, die den anderen Altersgruppen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte durchaus ähnlich<br />
waren, s<strong>in</strong>ken die Ostdeutschen Alten ab (1996: 0,95; 2002: 0,87) <strong>und</strong> die Altersgruppenverteilung<br />
pendelt sich recht genau beim westdeutschen Muster e<strong>in</strong>.<br />
149
150<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
E<strong>in</strong>erseits sagen Mittelwertangaben wenig über die gesellschaftliche Verteilung der f<strong>in</strong>anziellen<br />
Ressourcen aus. Andererseits ist zu fragen, <strong>in</strong>wieweit sich Veränderungen über die Zeit <strong>in</strong> der<br />
Verteilung über Altersgruppen auch <strong>in</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Verläufen spiegeln <strong>und</strong> welche Gruppen an<br />
den E<strong>in</strong>kommenszuwächsen partizipieren konnten bzw. welche hier nicht zum Zuge kamen. Es<br />
stellt sich also die Frage nach der Ungleichverteilung von E<strong>in</strong>kommen, ihren Veränderungen<br />
über die Zeit <strong>und</strong> den Bed<strong>in</strong>gungen von E<strong>in</strong>kommensdynamiken im Lebenslauf zu fragen. Beide<br />
dynamischen Perspektiven s<strong>in</strong>d schon seit längerem <strong>in</strong> der Diskussion (vgl. z.B. Berntsen,<br />
1992; Dannefer, 2003; Easterl<strong>in</strong> & Schaeffer, 1999; Gustafsson & Johansson, 1997; Motel-<br />
Kl<strong>in</strong>gebiel, 2004; Pris, 2000; Wagner & Motel, 1998). Dem soll im Folgenden nachgegangen<br />
werden.<br />
Tabelle 4.1:<br />
G<strong>in</strong>i- <strong>und</strong> Variationskoeffizienten15 des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens (OECD neu)<br />
nach Erhebungsjahr <strong>und</strong> Region<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
G<strong>in</strong>i-Koeffizient<br />
1996 0.281 0.195 0.265<br />
2002 0.273 0.246 0.274<br />
Variationskoeffizient<br />
1996 0.625 0.387 0.615<br />
2002 0.580 0.532 0.585<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.275/2.686), gewichtet.<br />
Die Ungleichverteilung der E<strong>in</strong>kommen wird mit G<strong>in</strong>i- <strong>und</strong> Variationskoffizienten gemessen.<br />
Tabelle 4.1 zeigt die Werte für beide Maße nach Region <strong>und</strong> ihre Veränderung über die Zeit.<br />
Die hier geschilderten Werte korrespondieren mit Größenordnungen wie wir sie z.B. aus Analysen<br />
mit Daten der E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Verbrauchsstichprobe kennen (Hauser & Becker, 2003, S.<br />
100). Die Verteilungsparameter für Westdeutschland zeigen über die Zeit nur ger<strong>in</strong>ge Abweichungen<br />
an (G<strong>in</strong>i1996/West:0.281; G<strong>in</strong>i2002/West: 0.273). Lagen die Ungleichheitsparameter 1996 <strong>in</strong><br />
Ostdeutschland noch deutlich unter den Westmarken (G<strong>in</strong>i1996/Ost:0.195), so f<strong>in</strong>den wir im Beobachtungszeitraum<br />
e<strong>in</strong>e zunehmende Annäherung der Werte an das Westniveau (G<strong>in</strong>i2002/Ost:<br />
0.246). Die Zunahme der Ungleichverteilung über die sechs Jahre zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 <strong>in</strong><br />
Ostdeutschland ist also sehr deutlich <strong>und</strong> f<strong>in</strong>det se<strong>in</strong>en Ausdruck unabhängig von der Wahl des<br />
Koeffizienten. Auf die Schilderung weiterer Koeffizienten wie den Perzentilsrelationen oder<br />
15 G<strong>in</strong>i- <strong>und</strong> Variationskoeffizient s<strong>in</strong>d gebräuchliche Maße zur Bestimmung der Ungleichheit e<strong>in</strong>er Verteilung. Der<br />
G<strong>in</strong>i-Koeffizient ist def<strong>in</strong>iert als Fläche zwischen e<strong>in</strong>er Lorenzkurve <strong>und</strong> der Gleichverteilungsgeraden, dividiert<br />
durch die Fläche unter der Gleichverteilungsgeraden. Der Koeffizient variiert zwischen null <strong>und</strong> e<strong>in</strong>s. E<strong>in</strong> Wert von<br />
‚0‘ steht dabei für e<strong>in</strong>e vollkommene Gleichverteilung z.B. der E<strong>in</strong>kommen, während e<strong>in</strong> Wert von ‚1‘ für e<strong>in</strong>e<br />
vollkommen ungleiche Verteilung stehen würde, bei der sich alle E<strong>in</strong>kommensressourcen <strong>in</strong> der Hand nur e<strong>in</strong>es<br />
Akteurs bef<strong>in</strong>den. Der Variationskoeffizient h<strong>in</strong>gegen relativiert die Standardabweichung am Mittelwert <strong>und</strong><br />
drückt die Standardabweichung <strong>in</strong> Mittelwertse<strong>in</strong>heiten aus. Er variiert theoretisch zwischen null <strong>und</strong> ∞. Beide<br />
Maße br<strong>in</strong>gen mit steigenden Werten e<strong>in</strong>e größere Ungleichheit der Verteilung zum Ausdruck.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
dem Atk<strong>in</strong>sonmaß wurde an dieser Stelle aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet, da sie <strong>in</strong><br />
der Überprüfung nur analoge Ergebnisse abbilden.<br />
E<strong>in</strong> Blick auf die altersdifferenzierte Darstellung (Abbildung 4.5 <strong>und</strong> Abbildung 4.6) zeigt, dass<br />
es <strong>in</strong> Westdeutschland vor allem unter den Ältesten <strong>in</strong> den vergangenen sechs Jahren zu e<strong>in</strong>er<br />
Abnahme der Ungleichverteilung gekommen ist, die beg<strong>in</strong>nend von e<strong>in</strong>em höheren Ausgangsniveau<br />
unter den Männern stärker war als unter den Frauen, wo die Bewegung aber auch die<br />
mittlere der betrachteten Altersgruppen betrifft. Es f<strong>in</strong>den sich also gewisse Nivellierungstendenzen<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich. H<strong>in</strong>gegen blieb sie unter den 40- bis 54-Jährigen stabil <strong>und</strong> nimmt<br />
sogar leicht zu, während es unter den 55- bis 69-Jährigen zu noch deutlicheren Ausdifferenzierungen<br />
gekommen ist. Die <strong>in</strong> der alters<strong>und</strong>ifferenzierten Betrachtung ausgewiesene Stabilität<br />
der Ungleichheitsmaße <strong>in</strong> Westdeutschland ist also Ergebnis durchaus divergenter <strong>Entwicklung</strong>en<br />
<strong>in</strong> den verschiedenen Altersgruppen <strong>und</strong> unter den Geschlechtern.<br />
Abbildung 4.5:<br />
G<strong>in</strong>ikoeffizienten des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens (OECD neu) nach Alter,<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Region<br />
arithm. Mittelwert <strong>in</strong>€<br />
0,35<br />
0,30<br />
0,25<br />
0,20<br />
0,15<br />
0,10<br />
0,05<br />
0,00<br />
40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85 Zeile 7 40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85<br />
Männer Frauen Männer Frauen<br />
Westdeutschland Ostdeutschland<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.275/2.686), gewichtet.<br />
In Ostdeutschland s<strong>in</strong>d die Zunahmen der Ungleichverteilung unter den ältesten Männern auf<br />
niedrigem Niveau relativ ger<strong>in</strong>g. Dies gilt auch bei e<strong>in</strong>er geschlechts<strong>in</strong>differenten Betrachtung<br />
über alle Älteren h<strong>in</strong>weg. H<strong>in</strong>gegen steigen die Kennziffern unter den Frauen <strong>und</strong> den Männern<br />
im Erwerbsalter deutlich an. Die allgeme<strong>in</strong>e Zunahme der Ungleichverteilung <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
geht damit ganz offensichtlich vor allem auf die Menschen im erwerbsfähigen Alter <strong>und</strong> <strong>in</strong> der<br />
Übergangsphase <strong>in</strong> den Ruhestand sowie daneben auch auf die bereits länger im Ruhestand<br />
bef<strong>in</strong>dlichen Frauen zurück. Die Altersgruppendifferenz der <strong>Entwicklung</strong>en ist <strong>in</strong> beiden Landesteilen<br />
also etwas ähnlich. Die <strong>Entwicklung</strong>en f<strong>in</strong>den aber auf unterschiedlichem Niveau statt<br />
<strong>und</strong> s<strong>in</strong>d im Osten durch Prozesse der sukzessiven Anpassung an westdeutsche Verteilungskonstellationen<br />
<strong>und</strong> Ungleichheitsniveaus überlagert.<br />
1996<br />
2002<br />
151
Abbildung 4.6:<br />
Variationskoeffizienten des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens (OECD neu) nach Alter,<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Region<br />
arithm. Mittelwert <strong>in</strong>€<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
152<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85 Zeile 7 40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85<br />
Männer Frauen Männer Frauen<br />
Westdeutschland Ostdeutschland<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.275/2.686), gewichtet.<br />
4.5.2 E<strong>in</strong>kommensdynamik<br />
Im Vergleich der E<strong>in</strong>kommensverteilung <strong>und</strong> der E<strong>in</strong>kommensentwicklung nach Alter (Abbildung<br />
4.7) zeigt sich, das im Vergleich zur <strong>Entwicklung</strong> des gesellschaftlichen Durchschnitts der<br />
E<strong>in</strong>kommenspositionen alle Älteren im Alter von 52 <strong>und</strong> mehr Jahren (Alter zum ersten Erhebungszeitpunkt<br />
1996) <strong>in</strong> der Zeit zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 im Mittel relative E<strong>in</strong>kommensverluste,<br />
also relative Abstiege h<strong>in</strong>nehmen mussten. Wie die vorangehenden Analysen zeigen<br />
konnten, geht dies aber meist nicht mit absoluten E<strong>in</strong>bußen h<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>kommen e<strong>in</strong>her,<br />
sondern resultiert daraus, dass im Mittel lediglich Zugew<strong>in</strong>ne realisiert werden konnten, die<br />
unter dem gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt liegen. E<strong>in</strong>e Ausnahme mag der Übergang <strong>in</strong><br />
den Ruhestand darstellen, der im <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Verlauf überwiegend mit E<strong>in</strong>kommense<strong>in</strong>bußen<br />
e<strong>in</strong>hergeht. Daher fällt <strong>in</strong> der Darstellung der E<strong>in</strong>kommensverteilungen über die Lebensalter zu<br />
allen Zeitpunkten der Knick der Verteilung um das 60. Lebensjahr auf.<br />
Sie bestätigen sich auch längsschnittlich als <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Abstiege über das Lebensereignis des<br />
Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand. Ruhestandsübergangsneutral verlieren <strong>in</strong> jedem Falle jene, die<br />
1996 bereits 64 Jahre <strong>und</strong> älter waren – sich also ganz überwiegend bereits damals im Ruhestand<br />
befanden. Starke Gew<strong>in</strong>ne zeigen sich im <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Längsschnitt vor allem bei den im<br />
Jahr 1996 unter 52-Jährigen – also jenen Personen, die über den gesamten Betrachtungszeitraum<br />
im Erwerbsalter waren. Insgesamt ist der Altersgradient (durchgezogene lange Geraden <strong>in</strong> Abbildung<br />
4.7) <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte 2002 stärker negativ, als noch sechs Jahre zuvor. Offenbar<br />
hat <strong>in</strong> diesem Zeitraum e<strong>in</strong>e sukzessive Verschiebung der E<strong>in</strong>kommensverteilung stattgef<strong>und</strong>en,<br />
<strong>in</strong> der sich die Relation zwischen den E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> der Erwerbsphase <strong>und</strong> der Ruhestandphase<br />
zuungunsten Letzterer verändert hat. Die E<strong>in</strong>kommenszuwächse der Ältesten konn-<br />
1996<br />
2002
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
ten nicht mit jenen der Jüngeren Schritt halten. Dies gilt übere<strong>in</strong>stimmend für die Querschnittsbetrachtung<br />
wie auch für die längsschnittliche Sichtweise.<br />
Abbildung 4.7:<br />
<strong>Entwicklung</strong> mittlerer relativer Äquivalenze<strong>in</strong>kommen (OECD neu) nach Alter I<br />
Mittleres relatives Äquivalenze<strong>in</strong>kommen<br />
1,3<br />
1,2<br />
1,1<br />
1,0<br />
0,9<br />
0,8<br />
1996<br />
2002<br />
40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 70-75 76-81 82-85<br />
Alter <strong>in</strong> Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
Mittleres relatives Äquivalenze<strong>in</strong>kommen<br />
1,3<br />
1,2<br />
1,1<br />
1,0<br />
0,9<br />
0,8<br />
1996<br />
2002<br />
40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 70-75 76-81 82-85<br />
Alter <strong>in</strong> Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
Mittlere Äquivalenze<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>heiten des gesamtgesellschaftlichen arithmetischen Mittelwertes nach SOEP. Die <strong>in</strong><br />
der rechten der Abbildungen dargestellten Geraden repräsentieren l<strong>in</strong>eare Regressionsfunktionen für die jeweiligen<br />
Jahre. Quelle: Panelstichprobe des Alterssurveys (n= 1.286), gewichtet.<br />
Abbildung 4.8 verdeutlicht diese <strong>Entwicklung</strong> nochmals. Klar zu erkennen s<strong>in</strong>d die erheblichen<br />
relativen Abstiege der Ruhestandsübergangsjahrgänge <strong>und</strong> die moderaten relativen Niveauverluste<br />
bei den Ältesten, die auf ohneh<strong>in</strong> vergleichsweise niedrigen Niveaus stattf<strong>in</strong>den.<br />
Abbildung 4.8:<br />
<strong>Entwicklung</strong> mittlerer relativer Äquivalenze<strong>in</strong>kommen (OECD neu) nach Geburtskohorten<br />
Mittleres relatives Äquivalenze<strong>in</strong>kommen<br />
1,3<br />
1,2<br />
1,1<br />
1,0<br />
0,9<br />
0,8<br />
1996 2002<br />
Erhebungszeitpunkt<br />
1951-56<br />
1945-50<br />
1939-44<br />
1933-38<br />
1927-32<br />
1921-26<br />
1915-20<br />
Mittlere Äquivalenze<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>heiten des gesamtgesellschaftlichen arithmetischen Mittelwertes nach SOEP<br />
Quelle: Panelstichprobe des Alterssurveys (n= 1.286), gewichtet.<br />
153
154<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Insgesamt stellt sich im Jahr 2002 die Verteilung über Altersgruppen bzw. Geburtsjahrgänge<br />
heterogener dar als noch 1996, was sowohl <strong>in</strong> der <strong>in</strong> Abbildung 4.7 dargestellten Verschiebung<br />
der Altersgradienten zum Ausdruck kommt, als auch im Querschnittsvergleich bei der Betrachtung<br />
der Ungleichheitsmaße zum Ausdruck kam.<br />
E<strong>in</strong> differenzierterer Blick auf die E<strong>in</strong>kommensdynamik über die vergangenen sechs Jahre zeigt<br />
zum e<strong>in</strong>en erhebliche Altersgruppendifferenzen (nachfolgende Tabelle 4.2): Aufstiege wurden<br />
vor allem von der jüngsten Kohorte der 1942- bis 1956 Geborenen realisiert, während Abstiege<br />
hier seltener waren. Den größten Anteil an Personen mit weitgehend konstanten E<strong>in</strong>kommen<br />
f<strong>in</strong>den wir unter den Ältesten, die bereits 1996 70 bis 85 Jahre alt waren (2002: 76-91 Jahre).<br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs die Unterschiede zwischen West- <strong>und</strong> Ostdeutschland zu betonen: Die<br />
Ältesten <strong>in</strong> Ostdeutschland gehören besonders selten zur Gruppe der Aufsteiger <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>kommensverteilung,<br />
während hier besondere häufig Abstiege zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d. Dies ist angesichts der<br />
<strong>in</strong>zwischen endgültig ausgelaufenen Übergangsregelungen (Auffüllbetrag, Sozialzuschlag) zu<br />
erwarten gewesen, die anfangs im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Bestandsschutzes die nom<strong>in</strong>elle Rentenhöhe der<br />
Ost-Rentner sicherstellten, jedoch nicht dynamisiert waren <strong>und</strong> im Zuge der Rentenanpassungen<br />
lediglich die relativen Abstiege dämpfen halfen – e<strong>in</strong> Prozess der im Laufe der 90er-Jahre zum<br />
Abschluss gekommen ist. Zugleich wurden die Rentenzahlbeträge vergleichsweise schnell nahe<br />
an das Westniveau gebracht, während die Erwerbse<strong>in</strong>kommen erst langsam nachholten. Auch<br />
dieser Prozess kommt <strong>in</strong> den Angaben zur E<strong>in</strong>kommensdynamik zum Ausdruck.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Tabelle 4.2:<br />
Aufstiege <strong>und</strong> Abstiege 1996-2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Aufstieg >20%<br />
Aufstieg >5% ≤20%<br />
Konstanz ≤5%<br />
Abstieg >5% ≤20%<br />
Abstieg >20%<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Geburtskoh. Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1942-56 30,9 32,7 31,8 31,3 34,4 32,8 31,0 33,1 32,0<br />
1927-41 15,4 21,5 18,2 19,6 16,7 18,1 16,2 20,4 18,2<br />
1911-26 28,1 23,6 25,4 5,8 9,8 8,1 23,6 21,1 22,1<br />
Gesamt 24,5 27,1 25,8 23,9 23,6 23,8 24,4 26,4 25,4<br />
1942-56 16,8 17,1 16,9 13,0 15,1 14,0 16,0 16,6 16,3<br />
1927-41 19,0 8,5 14,2 16,5 23,1 20,0 18,6 11,8 15,4<br />
1911-26 8,7 7,1 7,8 17,6 3,3 9,3 10,5 6,4 8,0<br />
Gesamt 16,6 12,1 14,4 14,8 16,1 15,5 16,3 13,0 14,6<br />
1942-56 12,7 13,8 13,2 7,3 6,5 6,9 11,6 12,2 11,9<br />
1927-41 14,2 10,0 12,3 20,3 9,4 14,6 15,3 9,9 12,7<br />
1911-26 21,2 17,7 19,1 16,1 21,3 19,1 20,2 18,4 19,1<br />
Gesamt 14,4 13,3 13,8 13,1 10,1 11,5 14,1 12,6 13,4<br />
1942-56 18,0 18,5 18,3 16,4 24,3 20,2 17,7 19,7 18,7<br />
1927-41 27,0 35,7 31,0 24,6 26,7 25,7 26,5 33,7 29,9<br />
1911-26 17,0 27,4 23,4 36,1 36,0 36,0 20,8 29,0 25,8<br />
Gesamt 21,4 26,1 23,7 21,8 27,2 24,6 21,5 26,3 23,9<br />
1942-56 21,6 18,0 19,8 31,9 19,8 26,1 23,8 18,4 21,1<br />
1927-41 24,4 24,4 24,4 19,0 24,0 21,6 23,4 24,3 23,8<br />
1911-26 24,9 24,1 24,4 24,4 29,7 27,5 24,8 25,1 25,0<br />
Gesamt 23,1 21,4 22,2 26,3 23,0 24,7 23,7 21,7 22,7<br />
Abweichungen 1996-2002 relativ zum arithmetischen Mittelwert der Bevölkerung<br />
Quelle: Panelstichprobe des Alterssurveys (n= 1.286), gewichtet<br />
4.5.3 Armut <strong>und</strong> Wohlstand<br />
Armut <strong>und</strong> Wohlstand s<strong>in</strong>d extreme Verteilungspositionen. Auf der e<strong>in</strong>en Seite werden damit<br />
besondere Benachteiligungen, verm<strong>in</strong>derte Lebenschancen <strong>und</strong> Exklusionsrisiken verb<strong>und</strong>en,<br />
auf der anderen Seite stellt sich mit Blick auf hohe E<strong>in</strong>kommenspositionen die Frage nach den<br />
Entstehungsbed<strong>in</strong>gungen solcher Lagen <strong>und</strong> nach der Gerechtigkeit <strong>und</strong> der Effizienz der gesellschaftlichen<br />
Ressourcenallokation. Wenn im Folgenden von Armut <strong>und</strong> Wohlstand / Reichtum<br />
gesprochen wird, so wird auf relative E<strong>in</strong>kommensarmut <strong>und</strong> -wohlstand Bezug genommen<br />
(s.o.). Als arm wird e<strong>in</strong>e Person def<strong>in</strong>iert, wenn das ihr zur Verfügung stehende bedarfsgewichtete<br />
Nettohaushaltse<strong>in</strong>kommen pro Kopf 50 Prozent oder weniger des gesamtgesellschaftlichen<br />
155
156<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
arithmetischen Mittelwertes beträgt. Analog dazu wird Wohlstand als e<strong>in</strong>e Position bestimmt, <strong>in</strong><br />
der das entsprechende E<strong>in</strong>kommen 200 Prozent des Mittels oder mehr beträgt.<br />
Tabelle 4.3:<br />
E<strong>in</strong>kommensarmut (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Veränderung<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 2,1 7,1 4,5 9,4 11,2 10,3 3,6 8,0 5,7<br />
55-69 Jahre 4,4 6,9 5,6 8,7 6,6 7,6 5,3 6,8 6,0<br />
70-85 Jahre 8,1 8,8 8,6 2,5 8,4 6,2 7,1 8,7 8,1<br />
Gesamt 3,8 7,4 5,6 8,3 8,9 8,6 4,7 7,7 6,2<br />
40-54 Jahre 6,4 4,5 5,5 14,9 12,2 13,6 8,2 6,1 7,2<br />
55-69 Jahre 5,8 8,6 7,3 9,0 10,3 9,7 6,5 9,0 7,8<br />
70-85 Jahre 4,4 7,7 6,4 6,3 14,4 11,4 4,8 9,1 7,4<br />
Gesamt 5,8 6,8 6,3 11,3 12,0 11,7 6,9 7,9 7,4<br />
40-54 Jahre 4,3 -2,6 1,0 5,5 1,0 3,3 4,6 -1,9 1,5<br />
55-69 Jahre 1,4 1,7 1,7 0,3 3,7 2,1 1,2 2,2 1,8<br />
70-85 Jahre -3,7 -1,1 -2,2 3,8 6,0 5,2 -2,3 0,4 -0,7<br />
Gesamt 2,0 -0,6 0,7 3,0 3,1 3,1 2,2 0,2 1,2<br />
Äquivalenzskala: OECD (neu); Armutsgrenze: 50% des arithmetischen Mittelwertes<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.275/2.686), gewichtet<br />
Verbreitung von Armut<br />
Die durchschnittliche Armutsquote liegt <strong>in</strong> der 40- bis 85-jährigen deutschen Wohnbevölkerung<br />
im Jahr 2002 bei 7,4 Prozent (Tabelle 4.3). Die Quote ist damit über die vergangenen sechs<br />
Jahre leicht angestiegen – sie betrug im Jahr 1996 noch 6,2 Prozent. 16 Von strenger Armut betroffen<br />
s<strong>in</strong>d im Jahr 2002 3,6 Prozent der Deutschen zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren – sie verfügen<br />
über höchstens 40 Prozent des Durchschnittse<strong>in</strong>kommens. Immerh<strong>in</strong> 14 Prozent der 40- bis 85jährigen<br />
Männer <strong>und</strong> Frauen leben <strong>in</strong> gemäßigter Armut <strong>und</strong> können auf e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>kommen von<br />
bis zu 60 Prozent des Durchschnitts der B<strong>und</strong>esrepublik zurückgreifen (vgl. Anhangstabelle<br />
A.4.2). Armut <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ist <strong>in</strong> Ostdeutschland weiter verbreitet als <strong>in</strong> Westdeutschland.<br />
Während die Armutsquote <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern bei 6,3 Prozent liegt, f<strong>in</strong>det<br />
sich <strong>in</strong> den neuen Ländern e<strong>in</strong>e Quote von 11,7 Prozent. Dabei lassen sich Geschlechtsdifferen-<br />
16 Die Ergebnisse weichen aufgr<strong>und</strong> der veränderten Berechnungsgr<strong>und</strong>lage des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens teilweise<br />
von jenen Resultaten ab, die <strong>in</strong> der ersten Welle des Alterssurveys diskutiert wurden (vgl. Motel, 2000). So betrug<br />
die Armutsquote <strong>in</strong> der auf der BSHG-Skala gestützten Berechnung im Jahr 1996 7,4 Prozent während der Wert<br />
aufgr<strong>und</strong> der Berechnungen mit der neuen OECD-Skala nunmehr für 1996 um 1,2 Prozentpunkte niedriger angegeben<br />
wird. Selbstverständlich werden für die Vergleiche zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 im vorliegenden Beitrag analoge<br />
Berechnungen verwendet.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
zen <strong>in</strong> beiden Landsteilen vor allem unter den 70- bis 85-Jährigen zeigen. Zwischen den Altersgruppen<br />
f<strong>in</strong>den sich 2002 (im Gegensatz zu 1996) nur ger<strong>in</strong>ge Differenzen im Niveau der Armutsbetroffenheit,<br />
was aus stärkeren Zunahmen zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 unter den Jüngeren<br />
resultiert. Mit Blick auf die Verteilungen <strong>in</strong> beiden Teilen Deutschlands allerd<strong>in</strong>gs zeigen sich<br />
unterschiedliche Altersgruppeneffekte im Niveau <strong>und</strong> bei den Veränderungen über die Zeit. In<br />
Westdeutschland s<strong>in</strong>d die 55- bis 69-Jährigen mit 7,3 Prozent die Hauptbetroffenengruppe, dicht<br />
gefolgt von den 70- bis 85-Jährigen. Hier haben also die Ältesten zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 die<br />
Hauptbetroffenheit an die mittlere Altersgruppe abgegeben. H<strong>in</strong>gegen weisen die 55- bis 69-<br />
Jährigen im Osten Deutschlands mit 9,7 Prozent gerade die niedrigsten Armutsquoten <strong>in</strong> dieser<br />
Region auf. Hier s<strong>in</strong>d die 40- bis 54-Jährigen mit 13,6 Prozent <strong>und</strong> die 70- bis 85-Jährigen mit<br />
11,4 Prozent weitaus häufiger von Armut betroffen. Die Veränderungstendenzen divergieren<br />
zwischen West <strong>und</strong> Ost. In Westdeutschland lassen sich Zunahmen der Armutsbetroffenheit vor<br />
allem <strong>in</strong> der mittleren <strong>und</strong> jüngeren der untersuchten Altersgruppen nachweisen, während die<br />
Quoten im höheren Alter abs<strong>in</strong>ken. Dagegen f<strong>in</strong>den sich die stärksten Zuwächse gerade unter<br />
den 70- bis 85-Jährigen <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>und</strong> die Anstiege unter den beiden jüngeren Gruppen<br />
s<strong>in</strong>d ger<strong>in</strong>ger. Zeigte sich noch 1996 e<strong>in</strong>e für Ostdeutschland nach der Vere<strong>in</strong>igung spezifische,<br />
ganz herausragende Armutsbetroffenheit der noch im Erwerbsleben stehenden Gruppen, so<br />
haben die ältesten Ruheständler nunmehr gleichgezogen. Dieser Trend entspricht den zuvor<br />
angesichts der wirtschaftlichen <strong>und</strong> rechtlichen Verschiebungen formulierten Erwartungen.<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich überdurchschnittliche Anstiege der Verbreitung<br />
von Armut vor allem unter den Ältesten <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>und</strong> unter 40- bis 54-jährigen<br />
Männern <strong>in</strong> beiden Landesteilen f<strong>in</strong>den lassen. Aufgr<strong>und</strong> der Altersdifferenzen <strong>in</strong> Ehen- <strong>und</strong><br />
anderen Partnerschaften ist plausibel anzunehmen, dass die Quoten unter jüngeren Frauen <strong>in</strong><br />
den nächsten Jahren nachziehen können. Es deuten sich hier neue Problemgruppen an: Ältere,<br />
die mit der E<strong>in</strong>kommensentwicklung der Jüngeren nicht Schritt halten können <strong>und</strong> Personen im<br />
Erwerbsleben, die ke<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichenden E<strong>in</strong>kommen erzielen können. Hiermit korrespondieren<br />
auch die zuvor genannten Ergebnisse zur allgeme<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>kommens-Ungleichheit.<br />
Verbreitung von Wohlstand<br />
Fragen nach Reichtum <strong>und</strong> Wohlstand <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft – die Analyse besonders vorteilhaft<br />
situierter Gruppen <strong>und</strong> der Mechanismen ihrer Bevorzugung – s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den letzten Jahren stärker<br />
<strong>in</strong> das Bewusstse<strong>in</strong> von Forschung <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik gerückt worden (Nollmann & Strasser,<br />
2002). Als Beispiel hierfür können die Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsberichte der B<strong>und</strong>esregierung<br />
<strong>und</strong> die darum rankende wissenschaftliche Aktivität gelten (B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit<br />
<strong>und</strong> Sozialordnung, 2001; Merz, 2001; Huster & Eissel, 2001). Allgeme<strong>in</strong> werden jedoch Fragen<br />
des Zusammenhangs von Reichtum <strong>und</strong> Alter <strong>in</strong> der Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsberichterstattung<br />
des B<strong>und</strong>es weitgehend ignoriert. Im Zentrum stehen hier konventionellerweise Erwerbstätige.<br />
Mit Blick auf das Alter f<strong>in</strong>den sich bestenfalls Feststellungen, die Sicherung der Alterse<strong>in</strong>kommen<br />
sei zentrales Politikziel (sogleich ergänzt <strong>und</strong> relativiert durch die Absicht, die Sozialversicherungsbeiträge<br />
stabil zu halten) (B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung,<br />
2001: XIX) oder die Bekämpfung verschämter Altersarmut sei e<strong>in</strong> bedeutendes Politikziel<br />
(XXIII). Differenzierung nach Alter f<strong>in</strong>den sich nur selten <strong>und</strong> ggf. nur alternswissenschaftlich<br />
unzureichend grob kategorisierend (vgl. z.B. Schupp & Wagner, 2003, S.60).<br />
157
158<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Die Frage nach der Verbreitung von Reichtum ist aber auch aus der Perspektive der sozial- <strong>und</strong><br />
verhaltenswissenschaftlichen Altersforschung relevant. Zugleich stellt sie e<strong>in</strong>en zentralen Bestandteil<br />
der allgeme<strong>in</strong>eren Untersuchung sozialer Ungleichheit dar. Es stellt sich auch sozialpolitisch<br />
aus Sicht der laufenden Debatten vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der Bestrebungen zur Reform der<br />
GRV<strong>und</strong> der F<strong>in</strong>anzierungsnöte von B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Gebietskörperschaften die sozialpolitische Frage,<br />
ob es e<strong>in</strong>e große Gruppe alter Menschen gibt, die über derart hohe wirtschaftliche Ressourcen<br />
verfügt, dass beispielsweise spezifische <strong>und</strong> gezielte Beschränkungen von Leistungen der<br />
öffentlichen Alterssicherungssysteme möglich s<strong>in</strong>d. Zugleich ließe sich fragen, <strong>in</strong>wieweit sich<br />
besonders bevorzugte Alternslagen ihren Niederschlag <strong>in</strong> spezifischen Planungen <strong>und</strong> Bewertungen<br />
f<strong>in</strong>den, oder ob solche Begünstigungen eher nur ger<strong>in</strong>ge Auswirkungen auf Alternsverläufe<br />
<strong>und</strong> Planungen haben. Differenzierende Analysen s<strong>in</strong>d also auch aus der Sicht der Alternsforschung<br />
wünschenswert. Nachfolgend soll aber alle<strong>in</strong> die Verteilung begünstigter E<strong>in</strong>kommenslagen<br />
beschrieben werden. Weitergehende Analysen s<strong>in</strong>d an anderer Stelle vorzustellen.<br />
Bislang vorliegenden Analysen zum Wohlstand im Alter zeigen, dass der Anteil der Wohlhabenden<br />
unter den Alten ger<strong>in</strong>g ist <strong>und</strong> – wie auch <strong>in</strong> anderen Altersgruppen – im Bereich der<br />
Armutsquoten oder noch darunter liegt (vgl. B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung,<br />
2001). Der Anteil über 65-Jähriger mit mehr als dem zweifachen Durchschnittse<strong>in</strong>kommen ist<br />
auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels wegen zu ger<strong>in</strong>ger Fallzahlen kaum nachweisbar.<br />
Der Alterssurvey stellte hier 1996 erstmals die für solche Analysen notwendigen Items <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
ausreichend großen, repräsentativen Stichprobe bereit (Künem<strong>und</strong>, 2000; Motel, 2000) <strong>und</strong><br />
belegte nur ger<strong>in</strong>ge Quoten des Wohlstands <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. So überhaupt quantitativ<br />
bedeutsam nachweisbar, häuften sie sich <strong>in</strong> der Mitte der 90er-Jahre Reichtumslagen unter<br />
Erwerbstätigen <strong>in</strong> Westdeutschland. In Ostdeutschland war die Verbreitung von Reichtumslagen<br />
als überhaupt nur marg<strong>in</strong>al zu bezeichnen.<br />
E<strong>in</strong>kommensreichtum, gemessen als die Verfügung über e<strong>in</strong> Äquivalenze<strong>in</strong>kommen von m<strong>in</strong>destens<br />
200 Prozent des arithmetischen Mittel der Gesamtbevölkerung (s.o.), ist im Jahr 2002<br />
unter den 40- bis 85-Jährigen <strong>in</strong> Deutschland ähnlich häufig verbreitet wie die E<strong>in</strong>kommensarmut.<br />
Die Quote beträgt 7,8 Prozent (relative E<strong>in</strong>kommensarmut: 7,4 Prozent) <strong>und</strong> hat sich zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 ger<strong>in</strong>gfügig erhöht (Tabelle 4.4). Die Geschlechtsdifferenzen s<strong>in</strong>d<br />
deutschlandweit vor allem <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe der 55- bis 69-Jährigen relevant. Unter<br />
den 40- bis 54-Jährigen zeigen sich generell ähnliche Quoten. Dies war zu erwarten, da Geschlechtsdifferenzen<br />
ohneh<strong>in</strong> vor allem von den Alle<strong>in</strong>lebenden – hier vor allem von den Witwen<br />
– herrühren. Die Wohlstandsquote nimmt über die Altersgruppen stark ab. Während 9,4<br />
Prozent der 40- bis 85-Jährigen als e<strong>in</strong>kommensreich oder wohlhabend zu bezeichnen s<strong>in</strong>d, gilt<br />
dies nur für 4,2 Prozent der 70- bis 85-Jährigen. Die Unterschiede zwischen West- <strong>und</strong> Ostdeutschland<br />
s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> stark ausgeprägt. 9,1 Prozent der Westdeutschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
aber nur 2,8 Prozent der gleich alten Ostdeutschen s<strong>in</strong>d reich bzw. wohlhabend. Erstaunlich<br />
ersche<strong>in</strong>t, dass der bereits im Jahr 1996 verschw<strong>in</strong>dend ger<strong>in</strong>ge Anteil von 0,5 Prozent<br />
unter den 70- bis 85-Jährigen <strong>in</strong> Ostdeutschland bis 2002 stabil bleibt. Altersreichtum kommt<br />
auch zu Beg<strong>in</strong>n des neuen Jahrtausends <strong>in</strong> Ostdeutschland kaum vor.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Tabelle 4.4:<br />
E<strong>in</strong>kommensreichtum (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Veränderg.<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 12,8 10,3 11,6 1,6 1,7 1,7 10,6 8,5 9,6<br />
55-69 Jahre 7,8 6,2 7,0 1,0 0,7 0,8 6,5 4,9 5,7<br />
70-85 Jahre 7,6 4,7 5,8 0,5 0,5 0,5 6,4 3,9 4,8<br />
Gesamt 10,2 7,6 8,9 1,2 1,1 1,2 8,4 6,3 7,3<br />
40-54 Jahre 11,2 10,3 10,8 3,6 4,7 4,1 9,6 9,1 9,4<br />
55-69 Jahre 12,9 6,6 9,7 4,5 0,7 2,5 11,1 5,4 8,1<br />
70-85 Jahre 6,7 4,1 5,1 0,0 0,7 0,4 5,5 3,4 4,2<br />
Gesamt 11,0 7,4 9,1 3,4 2,3 2,8 9,4 6,3 7,8<br />
40-54 Jahre -1,6 0,0 -0,8 2,0 3,0 2,4 -1,0 0,6 -0,2<br />
55-69 Jahre 5,1 0,4 2,7 3,5 0,0 1,7 4,6 0,5 2,4<br />
70-85 Jahre -0,9 -0,6 -0,7 -0,5 0,2 -0,1 -0,9 -0,5 -0,6<br />
Gesamt 0,8 -0,2 0,2 2,2 1,2 1,6 1,0 0,0 0,5<br />
Äquivalenzskala: OECD (neu); Reichtumsgrenze: 200% des arithmetischen Mittelwertes.<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.275/2.686), gewichtet.<br />
In der Betrachtung des zeitlichen <strong>Wandel</strong>s zeigen sich aber <strong>in</strong> den Niveaus allgeme<strong>in</strong>e Nivellierungstendenzen<br />
zwischen den Landesteilen. Der Anteil <strong>in</strong> Westdeutschland ist nämlich über die<br />
Zeit nahezu konstant geblieben, wenngleich sich auch im Westen ger<strong>in</strong>gfügige Verschiebungen<br />
<strong>in</strong> der Verteilung des Wohlstands zeigen, die mit den allgeme<strong>in</strong>eren Ergebnissen zur <strong>Entwicklung</strong><br />
der E<strong>in</strong>kommensungleichheit korrespondieren. Zunahmen des Anteils f<strong>in</strong>den sich vor allem<br />
unter den 55- bis 69-Jährigen Männern, die ihre hohen E<strong>in</strong>kommen offenbar <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
mitnehmen können (solche Effekte s<strong>in</strong>d für Frauen aufgr<strong>und</strong> der Altersdifferenzen wohl<br />
eher nachlaufend zu erwarten), während sich leichte Abnahmen vor allem unter den über 70-<br />
Jährigen nachweisen lassen. Im Gegensatz zur westdeutschen <strong>Entwicklung</strong> hat sich der Anteil<br />
besonders wohlhabender Personen mit mehr als dem doppelten Durchschnittse<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong><br />
Ostdeutschland auf sehr niedrigem Niveau verdoppelt – die West-Ost-Ratio von r<strong>und</strong> 7,4:1<br />
(1996) verr<strong>in</strong>gert sich damit bis zum Jahr 2002 deutlich auf etwa 3,3:1. Die Altersgruppendifferenzen<br />
verschärfen sich <strong>in</strong> Ostdeutschland im Betrachtungszeitraum, denn die Niveaugew<strong>in</strong>ne<br />
gehen alle<strong>in</strong> auf die jüngste Altersgruppe – bei den Männern auch auf die mittlere Gruppe –<br />
zurück. Die geschlechtsdisparate <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> der mittleren der Altersgruppen (die sich letztlich<br />
ja bereits <strong>in</strong> den westdeutschen Quoten zeigte) verschärft dann auch die bestehenden Geschlechterdifferenzen<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland – e<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong>, die sich moderater auch <strong>in</strong> Westdeutschland<br />
abzeichnet. In beiden Landesteilen zeigt sich h<strong>in</strong>sichtlich der Reichtumslagen also<br />
e<strong>in</strong>e Verschärfung der Geschlechterungleichheit unter den Altersgruppen, die dabei s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand überzugehen oder diesen Schritt <strong>in</strong> der jüngeren Vergangenheit gerade getan haben.<br />
159
4.5.4 Vermögen, Verschuldung, Sparen <strong>und</strong> Entsparen<br />
160<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Aktuelle <strong>und</strong> künftige Ruheständler kompensieren M<strong>in</strong>derungen der Leistungen der GRV möglicherweise<br />
<strong>in</strong> erheblichem Maße durch Zuflüsse aus Erbschaften <strong>und</strong> durch Kapitale<strong>in</strong>kommen.<br />
Erstens zeigt sich bereits heute, dass die Vermögensausstattung künftiger Ruhestandskohorten<br />
häufig günstiger ist als die heutiger Älterer (z.B. Braun, Burger, Miegel, Pfeiffer, & Schulte,<br />
2002; Kohli et al., 2000; Lauterbach & Lüscher, 1995; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000). Zweitens deuten<br />
alle verfügbaren Daten auf e<strong>in</strong>e Zunahme von Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit <strong>und</strong> Umfang von Erbschaften<br />
h<strong>in</strong> (Braun et al., 2002; Lauterbach, 1998; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel et al., 2004; Szydlik,<br />
1999). Vermögen <strong>und</strong> Zuflüsse von Erbschaften betreffen dabei vor allem Personen mit höheren<br />
E<strong>in</strong>kommen: „’Besserverdiener’ besitzen höhere Vermögen“, „’Besserverdiener’ erben häufiger“<br />
<strong>und</strong> „’Besserverdiener’ erben mehr“ (Braun et al., 2002; Künem<strong>und</strong> et al., 2004; Szydlik,<br />
1999). Erbschaften haben also e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf Verteilungen <strong>in</strong>nerhalb von Geburtskohorten,<br />
jedoch wird Ungleichheit allgeme<strong>in</strong> nicht durch Erbschaften erzeugt, sondern lediglich über die<br />
Zeit <strong>und</strong> Kohorten perpetuiert.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs wird die Gesamtentwicklung mittelfristig mit e<strong>in</strong>er erheblichen Zunahme der Ungleichverteilung<br />
von Alterse<strong>in</strong>kommen e<strong>in</strong>hergehen: Während sich die E<strong>in</strong>kommen unterer<br />
sozialer Schichten mit Blick auf diese Ursachen eher stabil entwickeln dürften, was sich je nach<br />
Berechnungsgr<strong>und</strong>lage <strong>in</strong> konstanten oder leicht ansteigenden Armutsquoten äußern dürfte,<br />
könnten <strong>in</strong>sbesondere hohe E<strong>in</strong>kommen weiter ansteigen, wie der <strong>in</strong>ternationale Vergleich nahe<br />
legt (G<strong>in</strong>n & Arber, 2000; Yamada, 2003), so dass die Annahme der sozialen Ausdifferenzierung<br />
mit weiter zunehmender Ausprägung e<strong>in</strong>er quantitativ bedeutsamen, besonders e<strong>in</strong>kommensstarken<br />
Gruppe Älterer plausibel ersche<strong>in</strong>t. Die <strong>Entwicklung</strong> von Vermögensbesitz <strong>und</strong><br />
Verschuldung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte sowie von Zu- <strong>und</strong> Abflüssen durch Erbschaften,<br />
Sparen <strong>und</strong> Entsparen s<strong>in</strong>d daher langfristig zu beobachten <strong>und</strong> <strong>in</strong> ihren Wirkungen zu untersuchen.<br />
Geldvermögen <strong>und</strong> Verb<strong>in</strong>dlichkeiten<br />
Trotz der <strong>in</strong> weiten Teilen der Bevölkerung durchaus beachtlichen Kapitalbestände (vgl. Hauser<br />
& Ste<strong>in</strong>, 2001) ist der Bevölkerungsanteil, der <strong>in</strong> nennenswerter Weise auf Kapitalerträge aus<br />
Geldvermögen zurückgreifen kann, vergleichsweise ger<strong>in</strong>g. Das mittlere, jährliche Vermögense<strong>in</strong>kommen<br />
beträgt gemäß den Angaben der E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Verbrauchsstichprobe (EVS)<br />
1998 r<strong>und</strong> 18.000 DM (etwa 9.000 €), wobei aber die Verteilung selbst unter den Beziehern<br />
(also unter Ausschluss derjenigen ohne Vermögense<strong>in</strong>kommen) mit e<strong>in</strong>em G<strong>in</strong>i-Koeffizienten<br />
von .40 deutlich ungleicher als im Falle der Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommen ist (vgl. Hauser & Becker,<br />
2003). 17 Die Nettovermögen s<strong>in</strong>d noch weitaus ungleicher verteilt. Der G<strong>in</strong>i-Koeffizient<br />
liegt hier lt. EVS im Jahr 1998 auf Haushaltsebene bei etwa 0.640 (West) bzw. 0,676 (Ost) <strong>und</strong><br />
auf Personenebene bei 0.624 (West) bzw. 0.635 (Ost) (vgl. Hauser & Becker, 2003, S. 124 <strong>und</strong><br />
133).<br />
17 Der Koeffizient liegt <strong>in</strong> der EVS 1998 dabei e<strong>in</strong>malig niedrig - <strong>in</strong> allen Jahren zuvor lassen sich Werte deutlich<br />
über .50 errechnen.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Tabelle 4.5:<br />
Vermögensbesitz privater Haushalte nach Alter <strong>und</strong> relativer E<strong>in</strong>kommensposition, 2002<br />
(E<strong>in</strong>kommen - äquivalenzgewichtet nach Citro & Michael, 1995)<br />
Bevölkerung. <strong>in</strong>sgesamt Ältere von 65 – 85 Jahren<br />
Vermögen Bestand Wert (> 0) Bestand Wert (> 0)<br />
E<strong>in</strong>kommensposition (<strong>in</strong> %) (<strong>in</strong> €) (<strong>in</strong> %) (<strong>in</strong> €)<br />
mehr als 200 % 93,6 % 296.640 € 97,7 % 360.315 €<br />
151 –200 % 89,7 % 136.630 € 99,4 % 220.296 €<br />
101 – 150 % 83,2 % 98.353 € 85,8 % 148.171 €<br />
51 – 100 % 69,8 % 74.457 € 76,8 % 86.799 €<br />
0 – 50% 43,0 % 61.135 € 57,5 % 106.522 €<br />
Gesamt 73,4 % 105.785 € 78,3 % 124.912 €<br />
Quelle: SOEP, Berechnungen nach Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel et al., 2004.<br />
Zwar ist gerade das Geldvermögen <strong>in</strong> den zurückliegenden Jahren überproportional angestiegen<br />
<strong>und</strong> die Analysen des Alterssurvey, des SOEP oder auch der EVS können zeigen, dass e<strong>in</strong>e<br />
deutliche Mehrheit der Gesamtbevölkerung Zugriff auf Vermögensbestände hat, doch ist zum<br />
e<strong>in</strong>em dieser Zugriff stets auch stark nach sozialen Gruppen differenziert – Bezieher niedriger<br />
E<strong>in</strong>kommen besitzen e<strong>in</strong>erseits generell seltener Vermögen, andererseits haben sie auch als<br />
Vermögensbesitzer im Mittel deutlich ger<strong>in</strong>gere Beträge zur Verfügung (Tabelle 4.5). Zum<br />
anderen bestehen die privaten Vermögensbestände <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> selbstgenutztem Wohneigentum<br />
(etwa zwei Drittel des privaten Vermögensbesitzes umfasst diese Vermögensform), das<br />
(sieht man e<strong>in</strong>mal von dem geldwerten Vorteil durch E<strong>in</strong>sparen der Mietzahlungen ab) nicht<br />
unmittelbar e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kommenserzielung zulässt <strong>und</strong> auch nicht ohne weiteres zur Erhöhung des<br />
E<strong>in</strong>kommens kapitalisiert werden kann.<br />
Die Daten des Alterssurvey belegen, dass die Verbreitung des Vermögensbesitzes zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 <strong>in</strong>sgesamt weitgehend stabil geblieben ist (Tabelle 4.6; vgl. auch Anhangstabelle<br />
A.4.3). E<strong>in</strong>bußen f<strong>in</strong>den sich allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>und</strong> hier vor allem bei den über 70-<br />
Jährigen. H<strong>in</strong>sichtlich der Verb<strong>in</strong>dlichkeiten sehen wir e<strong>in</strong> anderes Bild (Tabelle 4.7; vgl. auch<br />
Anhangstabelle A.4.4). Hier zeigen sich <strong>in</strong>sgesamt Rückgänge der Verbreitung der Verschuldung,<br />
die gleichermaßen aus <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> West- wie <strong>in</strong> Ostdeutschland resultieren. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
greift dieser Trend vor allem für die 40- bis 54-Jährigen, wo auf hohem Niveau Rückgänge<br />
zu verzeichnen s<strong>in</strong>d. Die Verbreitung der Verschuldung unter den 70- bis 85-Jährigen ist<br />
dagegen auf niedrigem Niveau weitgehend stabil.<br />
161
Tabelle 4.6:<br />
Geldvermögen (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
162<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 86,3 79,5 83,0 86,2 80,9 83,6 86,3 79,7 83,2<br />
55-69 Jahre 82,2 76,7 79,5 82,2 80,7 81,5 82,2 77,5 79,9<br />
70-85 Jahre 79,5 68,8 72,9 87,6 76,2 80,3 80,9 70,1 74,2<br />
Gesamt 83,8 76,2 79,9 84,8 79,9 82,3 84,0 76,9 80,4<br />
40-54 Jahre 80,2 80,9 80,6 76,4 75,0 75,7 79,5 79,7 79,6<br />
55-69 Jahre 85,2 77,5 81,3 76,8 71,9 74,3 83,6 76,4 79,9<br />
70-85 Jahre 79,6 73,0 75,6 71,7 59,7 64,1 78,2 70,5 73,5<br />
Gesamt 81,9 77,7 79,7 75,8 70,2 72,9 80,7 76,2 78,4<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.610/2.485), gewichtet.<br />
Tabelle 4.7:<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeiten (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 35,1 29,0 32,1 36,4 29,5 33,0 35,3 29,1 32,3<br />
55-69 Jahre 16,6 12,7 14,6 19,7 18,7 19,2 17,2 13,8 15,5<br />
70-85 Jahre 4,1 3,7 3,9 4,5 4,0 4,2 4,2 3,8 3,9<br />
Gesamt 23,7 17,6 20,5 26,2 20,7 23,3 24,2 18,2 21,1<br />
40-54 Jahre 29,0 23,7 26,4 30,4 24,2 27,3 29,3 23,8 26,6<br />
55-69 Jahre 13,5 9,6 11,5 13,5 12,6 13,0 13,5 10,2 11,8<br />
70-85 Jahre 5,2 2,2 3,3 5,1 2,9 3,7 5,2 2,3 3,4<br />
Gesamt 18,9 13,2 15,9 20,1 14,9 17,4 19,1 13,6 16,2<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.880/2.702), gewichtet.<br />
Immobilienvermögen<br />
Der Immobilienbesitz ist neben dem Geldvermögen e<strong>in</strong>e zweite wichtige Form des privaten<br />
Vermögensbesitzes. Zwar s<strong>in</strong>d Immobilien weniger verbreitet als der Besitz von Geldwerten<br />
(vgl. Tabelle 4.8). Doch h<strong>in</strong>sichtlich des Wertes des Besitzes übertrifft der Immobilienbesitz das<br />
private Geldvermögen deutlich (vgl. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel et al., 2004; Hauser & Becker, 2003).<br />
Immobilienvermögen ist also weitaus ungleicher verteilt als das Geldvermögen. Vor allem der<br />
Besitz selbstgenutzten Wohneigentums stellt im Alter, wenn das Wohneigentum der Ruheständler<br />
nicht mehr mit Hypotheken belastet ist, angesichts der hierdurch ersparten Ausgaben für<br />
Mieten e<strong>in</strong>e bedeutende Ressource dar.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Der Besitz von Immobilienvermögen ist weit verbreitet. Insgesamt knapp 64 Prozent der 40- bis<br />
85-Jährigen s<strong>in</strong>d im Besitz von Immobilien. Dies s<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>familienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften,<br />
Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen sowie auch Ferienhäuser <strong>und</strong> -<br />
wohnungen. Der Besitz „sonstiger Gr<strong>und</strong>stücke“ wurde <strong>in</strong> den vorliegenden Berechnungen<br />
nicht berücksichtigt. Die Quoten haben sich <strong>in</strong> Westdeutschland über den Beobachtungszeitraum<br />
<strong>in</strong>sgesamt kaum verändert, auch wenn sich die Verteilung über die Altersgruppen offenbar<br />
im <strong>Wandel</strong> bef<strong>in</strong>det. E<strong>in</strong> erheblicher Anstieg f<strong>in</strong>det sich bei den Älteren über 55 Jahren, während<br />
unter den 40- bis 54-Jährigen die Quoten sogar leicht rückläufig s<strong>in</strong>d. Offenbar gel<strong>in</strong>gt es<br />
den Älteren derzeit oftmals mit Immobilienbesitz zu altern, während die Mitglieder der <strong>in</strong> die<br />
zweite Lebenshälfte nachrückenden Kohorten seltener mit Immobilienbesitz ausgestattet s<strong>in</strong>d.<br />
Tabelle 4.8:<br />
Besitz von Immobilienvermögen (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 67,4 71,5 69,4 44,7 48,6 46,6 62,9 67,0 64,9<br />
55-69 Jahre 69,8 69,7 69,7 44,3 37,9 41,1 64,9 63,6 64,2<br />
70-85 Jahre 62,8 47,6 53,4 39,8 30,6 33,8 59,0 44,5 49,9<br />
Gesamt 67,7 65,7 66,7 44,0 41,2 42,5 63,1 61,0 62,0<br />
40-54 Jahre 64,0 66,6 65,3 51,8 54,6 53,2 61,5 64,1 62,8<br />
55-69 Jahre 73,3 76,1 74,7 56,6 45,9 51,1 69,9 69,8 69,8<br />
70-85 Jahre 67,0 56,0 60,2 33,6 26,1 28,8 61,1 50,3 54,4<br />
Gesamt 67,9 67,0 67,5 50,7 44,6 47,5 64,5 62,5 63,5<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.866/2.734), gewichtet.<br />
In Ostdeutschland h<strong>in</strong>gegen verschiebt sich auf niedrigerem Niveau (2002: knapp 48 Prozent)<br />
die Verteilung weiter zugunsten der jüngeren Geburtskohorten. Bei den unter 70-Jährigen überschreitet<br />
der Anteil die 50-Prozent-Marke, während er bei den Ältesten sogar leicht rückläufig<br />
zu se<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>t. Die stärksten Zunahmen f<strong>in</strong>den sich hier <strong>in</strong> der mittleren Gruppe der 55- bis 69-<br />
Jährigen.<br />
Sparen <strong>und</strong> Entsparen<br />
Der Alterssurvey bietet <strong>in</strong> beiden Erhebungswellen die Möglichkeit, die Entstehung <strong>und</strong> Auflösung<br />
von Vermögen zu beobachten. Dabei kommt von Spar- <strong>und</strong> Entsparvorgängen e<strong>in</strong>e bedeutende<br />
Rolle zu. Daneben s<strong>in</strong>d Übertragungen <strong>in</strong> der Form von Vererbung <strong>und</strong> von Transfervergaben<br />
relevant die später untersucht werden sollen.<br />
Sparen ist <strong>in</strong> allen Altersgruppen auch im Jahr 2002 weit verbreitet. R<strong>und</strong> 61 Prozent der 40- bis<br />
85-Jährigen geben an, regelmäßig oder auch unregelmäßig Geld zurückzulegen. Trotz der nach<br />
wie vor hohen Verbreitung des Sparens ist die Sparneigung zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 <strong>in</strong> allen<br />
Altersgruppen deutlich zurückgegangen. Hiervon besonders betroffen s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs die über<br />
163
164<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
70-Jährigen, bei denen bei Rückgängen von fast 10 Prozentpunkten (West) bzw. über 20 Prozentpunkten<br />
(Ost) von regelrechten E<strong>in</strong>brüchen im Sparverhalten gesprochen werden muss (vgl.<br />
Tabelle 4.9). Die <strong>in</strong> den oberen Altersgruppen ger<strong>in</strong>ge <strong>und</strong> gegenüber 1996 im Jahr 2002 auch<br />
überdurchschnittlich verr<strong>in</strong>gerte Sparneigung korrespondiert mit den vorangehenden Schilderungen<br />
der <strong>Entwicklung</strong> der E<strong>in</strong>kommen. Hier wurde deutlich, dass die E<strong>in</strong>kommen der über<br />
70-Jährigen nicht mit der allgeme<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>kommensentwicklung Schritt halten konnte. Gleiches<br />
gilt für die Verr<strong>in</strong>gerung der Sparneigung unter den 40- bis 55-Jährigen bzw. der 70- bis 85-<br />
Jährigen. Auch hier spiegelt sich die Veränderung der E<strong>in</strong>kommenslagen.<br />
Tabelle 4.9:<br />
Sparen (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 72,3 67,1 69,8 65,6 68,0 66,8 71,0 67,3 69,2<br />
55-69 Jahre 69,5 69,1 69,3 71,0 68,7 69,8 69,8 69,0 69,4<br />
70-85 Jahre 70,1 59,6 63,5 78,9 68,7 72,3 71,5 61,2 65,0<br />
Gesamt 70,9 66,1 68,5 69,3 68,4 68,8 70,6 66,6 68,5<br />
40-54 Jahre 60,1 62,6 61,3 61,5 55,6 58,6 60,4 61,2 60,8<br />
55-69 Jahre 70,2 61,7 65,8 62,4 62,3 62,4 68,6 61,8 65,1<br />
70-85 Jahre 58,3 51,4 54,1 60,6 46,4 51,6 58,7 50,5 53,7<br />
Gesamt 63,4 59,4 61,3 61,7 55,8 58,6 63,1 58,7 60,8<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.931/2.734), gewichtet.<br />
Bei den Zwecken, die von den 40- bis 85-Jährigen mit dem Sparen verfolgt werden, rangieren<br />
besondere Anschaffungen an erster Stelle (Tabelle 4.10). Allerd<strong>in</strong>gs ist diese Stellung <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
weniger ausgeprägt – hier liegt die Vorsorge für das eigene Alter nahezu gleichauf.<br />
Nur <strong>in</strong>sgesamt etwa e<strong>in</strong> Sechstel der 40- bis 85-Jährigen legt h<strong>in</strong>gegen Geld für Angehörige<br />
zurück. Alle<strong>in</strong> unter den 70- bis 85-Jährigen spielt dieses Ziel e<strong>in</strong>e besonders herausragende<br />
Bedeutung – r<strong>und</strong> 28 Prozent der Personen <strong>in</strong> diesem Alter gibt an, für die Unterstützung von<br />
Angehörigen zu sparen. Dies geschieht offenbar zu Lasten des Sparens für Anschaffungen, während<br />
das Sparmotiv der Altersvorsorge auch <strong>in</strong> dieser Altersgruppe ungebrochen sche<strong>in</strong>t. Sonstige<br />
Sparziele gibt ebenfalls etwa jeder Sechste an.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Tabelle 4.10:<br />
Sparzwecke (nur Sparer, <strong>in</strong> Prozent)<br />
Für bestimmte<br />
Anschaffungen<br />
Für das<br />
eigene Alter<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
59,4 59,4 59,4 54,6 48,3 51,4 58,5 57,3 57,9<br />
49,4 44,7 47,0 53,4 52,7 49,4 50,2 46,2 48,2<br />
Für Angehörige 17,7 17,9 17,8 13,2 16,7 15,0 16,8 17,7 17,2<br />
Für sonstige Zwecke 13,6 15,9 14,7 15,3 15,4 15,3 13,9 15,8 14,9<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 2.659), nur Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, gewichtet,<br />
Mehrfachnennungen s<strong>in</strong>d möglich.<br />
Auch das Entsparen geschieht im Jahr 2002 offenbar <strong>in</strong> deutlich gedämpfterem Umfang als dies<br />
noch 1996 der Fall war (Tabelle 4.11). Entnahmen 1996 noch r<strong>und</strong> 44 Prozent der 40- bis 85-<br />
Jährigen Vermögensressourcen für bestimmte Zwecke, so ist der Anteil bis 2002 auf etwa e<strong>in</strong><br />
Drittel abgesunken. Die Abnahmen s<strong>in</strong>d – wie schon beim Sparen – <strong>in</strong> Ostdeutschland besonders<br />
deutlich erkennbar: S<strong>in</strong>kt die Quote <strong>in</strong> Westdeutschland um etwa 10 Prozentpunkte von 43<br />
and 33 Prozent, so f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Ostdeutschland Abnahmen von 52 auf 34 Prozent – also um<br />
r<strong>und</strong> 18 Prozentpunkte.<br />
Tabelle 4.11:<br />
Entsparen (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 50,3 46,6 48,5 49,5 58,1 53,7 50,2 48,9 49,5<br />
55-69 Jahre 39,1 40,9 40,0 51,4 55,1 53,3 41,4 43,7 42,6<br />
70-85 Jahre 33,6 31,7 32,4 49,7 36,8 41,5 36,3 32,6 34,0<br />
Gesamt 43,7 41,3 42,5 50,3 52,9 51,6 45,0 43,5 44,2<br />
40-54 Jahre 33,1 39,2 36,1 32,7 31,8 32,3 33,0 37,7 35,4<br />
55-69 Jahre 35,2 33,2 34,2 38,7 37,8 38,2 35,9 34,2 35,0<br />
70-85 Jahre 26,7 22,9 24,4 31,6 27,4 29,0 27,5 23,7 25,2<br />
Gesamt 32,7 32,9 32,8 34,8 32,9 33,8 33,1 32,9 33,0<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.873/2.708), gewichtet.<br />
Die im Jahr 1996 noch vorzuf<strong>in</strong>denden West-Ost-Unterschiede haben sich dabei nivelliert. Die<br />
Unterschiede im Niveau bestehen nicht mehr, jedoch zeigen sich <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern<br />
andere Verteilungsmuster über die Altersgruppen als <strong>in</strong> den neuen Ländern: S<strong>in</strong>d hier die Altersgruppendifferenzen<br />
schwach, so zeigt sich <strong>in</strong> Westdeutschland, dass die Entsparhäufigkeit<br />
unter den 40- bis 54-Jährigen etwa 50 Prozent über jener unter den 70- bis 85-Jährigen liegt.<br />
165
166<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Unter den Zielen, die mit der Entnahme von Vermögensteilen verfolgt werden (Tabelle 4.12),<br />
rangieren <strong>in</strong>sgesamt Konsumziele ganz vorn. Besondere Anschaffungen, Investitionen <strong>in</strong> Haus<br />
oder Wohnung sowie Urlaubsreisen werden vorrangig genannt. Die Verwendung für den normalen<br />
Lebensunterhalt – e<strong>in</strong> Motiv, das auf f<strong>in</strong>anzielle Problemlagen h<strong>in</strong>deutet – f<strong>in</strong>det sich<br />
h<strong>in</strong>ter jeder siebten Entnahme. Für die Unterstützung von Angehörigen f<strong>in</strong>det jede sechste Entnahme<br />
statt. Es f<strong>in</strong>den sich bestimmte Unterschiede <strong>in</strong> den Entnahmezwecken zwischen West-<br />
<strong>und</strong> Ostdeutschland. Besondere Anschaffungen spielen <strong>in</strong> Westdeutschland e<strong>in</strong>e bedeutendere<br />
Rolle, während h<strong>in</strong>gegen die Entnahmen zur Unterstützung von Angehörigen <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
häufiger angegeben werden. Auch bei der Entnahme für Angehörige zeigen sich – wie schon<br />
beim entsprechenden Sparziel – deutliche Altersgruppeneffekte: 29 Prozent der West- <strong>und</strong> sogar<br />
41 Prozent der Ostdeutschen im Alter von 70 bis 86 Jahren geben an, dass das entnommene<br />
Geld zur Unterstützung von Angehörigen bestimmt gewesen sei. H<strong>in</strong>gegen gilt dies <strong>in</strong> beiden<br />
Regionen nur für etwa 9 Prozent der 40- bis 54-Jährigen. Entgegengesetzte Altersgruppendifferenzen<br />
gibt es h<strong>in</strong>gegen wieder bei dem Zweck der besonderen Anschaffung.<br />
Tabelle 4.12:<br />
Gründe für Entsparen (nur Entsparer, <strong>in</strong> Prozent)<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Für den Lebensunterhalt 17,0 13,5 15,2 18,2 8,9 13,4 17,2 12,6 14,8<br />
Für bes. Anschaffungen 41,6 42,2 41,9 25,5 29,2 27,4 38,2 39,6 38,9<br />
Für d. Wohnung/Haus 39,9 43,8 42,0 41,1 45,8 43,5 40,1 44,2 42,3<br />
Für Urlaubsreisen 31,1 28,9 29,9 31,9 28,5 30,1 31,3 28,8 30,0<br />
Für die Unterstützung<br />
von Angehörigen<br />
17,1 12,5 14,7 22,6 22,0 22,3 18,2 14,4 16,2<br />
Für sonstige Zwecke 9,1 9,6 9,4 12,7 8,6 10,6 9,9 9,4 9,6<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 2.698), nur Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, gewichtet,<br />
Mehrfachnennungen s<strong>in</strong>d möglich.<br />
4.5.5 Erbschaften <strong>und</strong> Transfers zu Lebzeiten<br />
Erbschaften<br />
Der Frage nach der Bedeutung <strong>in</strong>tergenerationaler Ressourcenflüsse durch Erbschaften für die<br />
künftige Vermögensverteilung spielt e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle <strong>in</strong> den Diskussionen um e<strong>in</strong>e<br />
gerechte Ressourcenverteilung zwischen Generationen <strong>und</strong> über die Möglichkeiten <strong>und</strong> Spielräume<br />
für e<strong>in</strong> Zurückführen öffentlichen Transferleistungen an die Älteren. Die prospektive<br />
Fortschreibungen der Erbschaftssituation 1996 auf der Basis der ersten Erhebungswelle des<br />
Alterssurveys (vgl. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel et al., 2004) deuten denn auch auf e<strong>in</strong>e künftig deutlich<br />
wachsende Verbreitung der Erbschaften h<strong>in</strong>. Die Kumulation von 1996 bereits erhaltenen <strong>und</strong><br />
künftig erwarteten Erbschaft der 60- bis 85-Jährigen steigt von etwa 49 Prozent <strong>in</strong> 1996 auf 60<br />
Prozent im Jahre 2015 (Abbildung 4.9), wo sie bis etwa 2030 entsprechend den Angaben des
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Alterssurveys 1996 verharrt. Möglicherweise handelt es sich bei e<strong>in</strong>em Teil der Abflachung der<br />
Kurve nach 2015 um e<strong>in</strong>en bloßen Erhebungs- <strong>und</strong> Stichprobeneffekt derart, dass die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
weit <strong>in</strong> der Zukunft möglicherweise e<strong>in</strong>treffender Ereignisse unterschätzt wird<br />
<strong>und</strong> die Fortschreibung des Alterssurveys nachwachsende Generationen von Ruheständlern<br />
nicht ausreichend repräsentiert. Wird daher die nahezu l<strong>in</strong>eare <strong>Entwicklung</strong> des ersten Teils des<br />
Betrachtungszeitraumes fortgeschrieben, um e<strong>in</strong>en oberen Wert für e<strong>in</strong>e Schätzung zu generieren,<br />
so lässt sich für die Ruheständler künftig e<strong>in</strong>e Erbschaftsquote von etwa 60 bis zu 70 Prozent<br />
erwarten (Abbildung 4.9).<br />
Abbildung 4.9:<br />
Erhaltene <strong>und</strong> erwartete Erbschaften heutiger <strong>und</strong> künftiger 65- bis 85-Jähriger <strong>in</strong> Deutschland<br />
(Basis 1996)<br />
Prozent<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 erhaltene <strong>und</strong> erwartete Erbschaften<br />
1996 erwartete Erbschaften<br />
1996 bereits erhaltene Erbschaften<br />
1996 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030<br />
Jahr<br />
Fortgeschriebene Zahlen des Jahres 1996. = l<strong>in</strong>eare Fortschreibung der <strong>Entwicklung</strong> über die<br />
ersten zwei Jahrzehnte des Betrachtungszeitraums. 2025: 69- bis 85-Jährige, 2030: 74- bis 85-Jährige.<br />
Quelle: Basisstichprobe des Alterssurveys (n= 3.833), nach Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel et al., 2004.<br />
Die Fortschreibung der Verbreitung von Erbschaften korrespondiert mit erwarteten <strong>Entwicklung</strong>en<br />
ihres tatsächlichen oder erwarteten Umfangs. Über den Untersuchungszeitraum bis 2030<br />
h<strong>in</strong>weg deutet sich e<strong>in</strong> Rückgang der relativen Bedeutung kle<strong>in</strong>erer Erbschaften an, während<br />
gemäß der Fortschreibung der 1996er Daten bis 2030 der Anteil größerer Erbschaften im Wert<br />
von 250.000 € <strong>und</strong> darüber (Werte von 1996) auf zehn Prozent ansteigen wird (Abbildung<br />
4.10). Auch hier ist freilich e<strong>in</strong> Effekt der besseren Vorhersehbarkeit größerer Erbschaften plausibel<br />
anzunehmen. Teilweise ist die Basis der Abschätzungen aber auch noch gänzlich unbekannt,<br />
da sich die später zu erbenden Vermögen noch im Aufbau bef<strong>in</strong>den oder selbst erst noch<br />
durch Erbschaft erworben werden müssen. In anderer Richtung besteht auch die Möglichkeit,<br />
dass Vermögen, deren Vererbung erwartet wird, vor dem Tod des Erblassers teilweise oder<br />
vollständig aufgezehrt werden. Dies ist letztlich für die Befragten langfristig nur schwer vorhersehbar.<br />
Man kann also davon ausgehen, dass die hier angedeuteten <strong>Entwicklung</strong>en nur sehr grob<br />
prospektiv abgeschätzt werden können.<br />
167
168<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Es ist im Folgenden zu fragen, ob sich die 1996 angedeuteten <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> den Daten des<br />
Jahres 2002 bereits faktisch nachzeichnen lassen – ob also die 1996 prognostizierten Anstiege <strong>in</strong><br />
Quoten <strong>und</strong> Werten als Trend durch die Zahlen 2002 bestätigt werden.<br />
Abbildung 4.10:<br />
Wert erhaltener <strong>und</strong> erwarteter Erbschaften heutiger <strong>und</strong> künftiger 65- bis 85-Jähriger <strong>in</strong><br />
Deutschland, 1996<br />
Prozent<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1996 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030<br />
Jahr<br />
1000000 <strong>und</strong> mehr<br />
500000 - 999999 DM<br />
100000 - 499999 DM<br />
25000 - 99999 DM<br />
5000 - 24999 DM<br />
Unter 5.000 DM<br />
Fortgeschriebene Zahlen des Jahres 1996. Geschätzter Wert der bisherigen <strong>und</strong> künftigen Erbschaften <strong>in</strong> Preisen von<br />
1996; graduelle Unterschätzung des Wertes bei Kumulation bisheriger <strong>und</strong> künftiger Erbschaften durch Kumulation<br />
kategorialer Werte. Der Anstieg der Erbschaftswerte über den Untersuchungszeitraum wird so <strong>in</strong> der Tendenz systematisch<br />
ger<strong>in</strong>gfügig unterschätzt. 2025: 69- bis 85-Jährige, 2030: 74- bis 85-Jährige.<br />
Quelle: Basisstichprobe des Alterssurveys (n= 3.762), nach Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel et al., 2004.<br />
Es zeigt sich, dass die allgeme<strong>in</strong>e Häufigkeit erhaltener Erbschaften zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
ger<strong>in</strong>gfügig von 47 auf 48 Prozent angestiegen ist. Dabei s<strong>in</strong>d erwartungsgemäß <strong>in</strong>sbesondere<br />
die Häufigkeiten unter den 55- bis 69-Jährigen angestiegen. Die Differenz zwischen West- <strong>und</strong><br />
Ostdeutschland ist <strong>in</strong> diesem Prozess eher leicht größer geworden, denn die Zunahmen gehen<br />
alle<strong>in</strong> auf Anstiege <strong>in</strong> Westdeutschland zurück, während <strong>in</strong> Ostdeutschland im Jahr 2002 sogar<br />
leicht niedrigere Quoten zu verzeichnen s<strong>in</strong>d. Dies ist e<strong>in</strong>erseits den 70- bis 85-Jährigen, vor<br />
allem aber auch den neu <strong>in</strong> die zweite Lebenshälfte gekommenen Gruppen der 40- bis 54-<br />
Jährigen zuzuschreiben. Hier erreichen die Quoten im Jahr 2002 nicht mehr das Niveau der<br />
ersten Erhebungswelle 1996. Dieser Effekt zeigt sich im Übrigen auch für die 40- bis 54-<br />
Jährigen Westdeutschen, während tatsächlich starke Anstiege unter den 55- bis 69-Jährigen<br />
stattf<strong>in</strong>den, wie <strong>in</strong> der Fortschreibung der 1996er Daten auch erwartet. Offenbar aber deutet sich<br />
unter den jüngeren Gruppen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte bereits jetzt schon e<strong>in</strong> Rückgang <strong>in</strong> der<br />
Verbreitung von Erbschaften an. Es ist also für die Zukunft nicht e<strong>in</strong>fach von stetige Zuwächsen<br />
auszugehen. Stattdessen haben wir es heute <strong>und</strong> <strong>in</strong> der nahen Zukunft mit e<strong>in</strong>em historisch neuen<br />
„Erbschaftsberg“ zu tun, dessen Effekte nicht e<strong>in</strong>fach für künftige Generationen Älterer fortgeschrieben<br />
werden können.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Tabelle 4.13:<br />
Erbschaften (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 47,0 47,1 47,0 39,5 38,3 38,9 45,6 45,3 45,4<br />
55-69 Jahre 52,2 54,4 53,3 42,4 45,5 43,9 50,3 52,7 51,5<br />
70-85 Jahre 50,3 40,9 44,4 48,3 38,3 41,9 49,9 40,4 44,0<br />
Gesamt 49,4 48,3 48,9 41,7 40,8 41,3 48,0 46,9 47,4<br />
40-54 Jahre 40,7 44,2 42,4 33,7 33,6 33,6 39,2 42,1 40,7<br />
55-69 Jahre 59,4 60,1 59,8 41,7 47,6 44,8 55,9 57,5 56,7<br />
70-85 Jahre 53,2 49,5 50,9 41,4 32,9 36,0 51,1 46,3 48,2<br />
Gesamt 49,8 51,0 50,5 37,9 38,5 38,2 47,4 48,5 48,0<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.949/2.741), gewichtet.<br />
Der Wert der Erbschaften sollte nicht überschätzt werden. Der Wert der Erbschaften liegt zu<br />
beiden Erhebungszeitpunkten unter DM 100.000 bzw. 51.000 € (vgl. Anhangstabelle A.4.11).<br />
Die gilt jeweils für etwa 70 Prozent der westdeutschen Nachlässe <strong>und</strong> 90 Prozent der Erbschaften<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland. H<strong>in</strong>zu kommt, dass große Erbschaften häufig <strong>in</strong>sbesondere an solche<br />
Personen(gruppen) fließen, die ohneh<strong>in</strong> über eigene Vermögensbestände verfügen, <strong>und</strong> Vermögenslose<br />
leer ausgehen oder nur ger<strong>in</strong>ge Beträge erben (Künem<strong>und</strong> et al., 2004) – Erbschaften<br />
verbessern also ggf. die Vermögensausstattung begründen, aber nur selten erheblichen Vermögensbesitz<br />
zu schaffen. Wie auch die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, überhaupt etwas zu erben, so s<strong>in</strong>d also<br />
auch die geerbten Werte zwischen West- <strong>und</strong> Ostdeutschen sehr ungleich verteilt: jede dritte<br />
Erbschaft <strong>in</strong> Ostdeutschland hat e<strong>in</strong>en Wert von weniger als 2.500 € während dies nur für etwa<br />
jede siebte Erbschaft im Westen gilt (vgl. Anhangstabelle A.4.11).<br />
Von Bedeutung für die Vermögensverteilung dürften lediglich die Erbschaften etwas größeren<br />
Umfangs se<strong>in</strong>. Im Folgenden werden Erbschaften im Wert von 2.500 € <strong>und</strong> mehr als größere<br />
Erbschaften bezeichnet (Tabelle 4.14). Hier zeigt sich auf niedrigerem Niveau von im Jahr 2002<br />
<strong>in</strong>sgesamt 41 Prozent e<strong>in</strong> ähnliches Bild: die Quoten <strong>in</strong> den beiden oberen Altersgruppen s<strong>in</strong>d<br />
signifikant angestiegen, während sich e<strong>in</strong> deutlicher Rückgang <strong>in</strong> der Gruppe der 40- bis 54-<br />
Jährigen belegen lässt. Dies ist e<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong>, die <strong>in</strong>sgesamt vor allem auf die Westdeutschen<br />
zurückgeht – <strong>in</strong> Ostdeutschland h<strong>in</strong>gegen s<strong>in</strong>d die Quoten <strong>in</strong> allen Altersgruppen weitgehend<br />
konstant. Möglicherweise überlagern sich hier <strong>in</strong> der empirischen Darstellung bestimmte<br />
Nachholeffekte <strong>und</strong> Kohortendifferenzen.<br />
169
Tabelle 4.14:<br />
Erbschaften im Umfang von 2.500 € <strong>und</strong> mehr (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
170<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 40,8 39,6 40,2 25,0 22,5 23,8 37,7 36,2 37,0<br />
55-69 Jahre 45,4 45,8 45,6 28,6 27,7 28,1 42,2 42,2 42,2<br />
70-85 Jahre 43,3 32,8 36,8 32,4 25,7 28,1 41,5 31,5 35,3<br />
Gesamt 42,9 40,3 41,5 27,3 25,0 26,1 39,9 37,3 38,6<br />
40-54 Jahre 34,5 35,0 34,7 23,8 22,6 23,2 32,3 32,6 32,4<br />
55-69 Jahre 56,2 52,9 54,5 26,3 34,7 30,7 50,2 49,1 49,7<br />
70-85 Jahre 47,8 45,5 46,4 30,7 26,6 28,1 44,8 41,9 43,0<br />
Gesamt 44,9 43,9 44,3 25,8 28,0 27,0 41,1 40,7 40,9<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.949/2.741), gewichtet.<br />
Neben den <strong>in</strong> der Vergangenheit erhaltenen Erbschaften erfragt der Alterssurvey auch die Erwartung<br />
künftiger Zuflüsse von Vermögen durch Erbschaft. Die Erwartung künftiger Nachlässe<br />
ist <strong>in</strong> den jüngeren Altersgruppen am weitesten verbreitet. Allerd<strong>in</strong>gs zeigt sich im Vergleich<br />
der Erhebungszeitpunkte e<strong>in</strong>e merkliche Dämpfung der Erwartungshaltung, welche vor allem <strong>in</strong><br />
der jüngsten der betrachteten Altersgruppen auftritt (Tabelle 4.15). Dieses Ergebnis bestätigt die<br />
Annahme e<strong>in</strong>er künftig, im Vergleich zu den angesprochenen, sehr optimistischen Fortschreibungen,<br />
deutlich gedämpften Erbschaftsentwicklung. Die Analysen legen nahe anzunehmen,<br />
dass der derzeitig sichtbaren Erbengeneration e<strong>in</strong>e Generation folgen wird, auf die e<strong>in</strong>e Fortschreibung<br />
der aktuell günstigen <strong>Entwicklung</strong> h<strong>in</strong>sichtlich der <strong>in</strong>tergenerationalen Weitergabe<br />
von Ressourcen nicht s<strong>in</strong>nvoll ersche<strong>in</strong>t.<br />
Tabelle 4.15:<br />
Künftig erwartete Erbschaften (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 38,2 28,7 33,6 22,9 16,5 19,8 35,2 26,3 30,8<br />
55-69 Jahre 16,1 8,5 12,3 10,9 6,5 8,6 15,1 8,1 11,6<br />
70-85 Jahre 1,9 2,1 2,0 1,1 1,2 1,2 1,8 1,9 1,9<br />
Gesamt 24,7 15,9 20,2 15,7 9,9 12,7 23,0 14,7 18,7<br />
40-54 Jahre 32,8 24,9 28,9 17,6 15,2 16,5 29,7 22,9 26,3<br />
55-69 Jahre 15,2 10,4 12,7 9,0 4,7 6,7 13,9 9,2 11,5<br />
70-85 Jahre 2,9 1,1 1,8 1,4 1,4 1,4 2,6 1,1 1,7<br />
Gesamt 20,9 13,7 17,1 11,9 8,1 9,9 19,1 12,6 15,6<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.845/2.736), gewichtet.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Die Kumulation erhaltener <strong>und</strong> erwarteter Erbschaften (Tabelle 4.16) legt die Annahme nahe,<br />
dass die Zuflüsse materieller Ressourcen durch Erbschaften an künftigen Altengenerationen<br />
wohl eher auf dem heutigen Niveau verharren dürfte. Demnach teilt sich die Gesellschaft recht<br />
konstant jeweils etwa hälftig <strong>in</strong> Erben <strong>und</strong> Nichterben – mit e<strong>in</strong>er erheblichen Spreizung unter<br />
den Erben h<strong>in</strong>sichtlich der geerbten Vermögenswerte.<br />
Tabelle 4.16:<br />
Kumulation erhaltener <strong>und</strong> erwarteter Erbschaften (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 63,9 57,8 60,9 49,8 46,8 48,3 61,2 55,6 58,4<br />
55-69 Jahre 57,3 55,9 56,6 45,9 49,0 47,5 55,1 54,5 54,8<br />
70-85 Jahre 50,5 42,0 45,3 48,9 39,3 42,8 50,3 41,6 44,8<br />
Gesamt 59,5 53,7 56,5 48,2 46,1 47,1 57,4 52,2 54,7<br />
40-54 Jahre 59,7 54,4 57,1 41,3 39,7 40,5 55,9 51,6 53,7<br />
55-69 Jahre 64,9 62,7 63,8 48,1 48,3 48,2 61,5 59,7 60,6<br />
70-85 Jahre 54,2 49,8 51,5 42,1 32,9 36,3 52,1 46,6 48,7<br />
Gesamt 60,5 56,1 58,2 43,9 41,2 42,5 57,2 53,1 55,1<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.950/2.742), gewichtet.<br />
Transfers zu Lebzeiten der Geber<br />
Transfers zu Lebzeiten der Geber stellen e<strong>in</strong>en weiteren, sehr bedeutenden Aspekt der privaten<br />
<strong>in</strong>tergenerationalen Weitergaben materieller Ressourcen dar. Aus der ersten Erhebung des Alterssurvey<br />
im Jahr 1996 <strong>und</strong> den darauf aufbauenden Publikationen (Motel & Szydlik, 1999;<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000; Kohli et al., 2000) ist bekannt, dass fast jeder Dritte der 40- bis 85-<br />
Jährigen <strong>in</strong>nerhalb von zwölf Monaten Geld- oder Sachtransfers an Dritte geleistet hat (Tabelle<br />
4.17). Der Erhalt solcher Leistungen ist h<strong>in</strong>gegen wesentlich seltener: weniger als jeder Zehnte<br />
gibt an, solche Leistungen auch erhalten zu haben. Auch mit Blick auf den Wert der Leistungen<br />
s<strong>in</strong>d die 40- bis 85-Jährigen im Mittel als Geber zu bezeichnen (vgl. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000).<br />
Wie gestaltet sich dieses aber nun sechs Jahre später? Trägt die veränderte Ressourcenausstattung<br />
zu abnehmenden Transferquoten bei oder schlägt sich der soziale <strong>Wandel</strong> über die Zeit von<br />
sechs Jahren nieder?<br />
Die im Jahr 1996 vorgef<strong>und</strong>ene Quote von 31 Prozent wird <strong>in</strong> der Erhebung von 2002 e<strong>in</strong>drucksvoll<br />
bestätigt: 31,3 Prozent der 40- bis 85-Jährigen geben an, anderen Personen Geld-<br />
oder Sachgeschenke gemacht oder diese f<strong>in</strong>anziell unterstützt zu haben (Tabelle 4.17).<br />
Während sich 1996 aber nahezu e<strong>in</strong>e Gleichverteilung der Transferhäufigkeiten über die Altersgruppen<br />
belegen ließ, zeigt sich 2002 e<strong>in</strong>e leichte Konzentration auf die Gruppe der 55- bis 69-<br />
Jährigen: leichte Abnahmen um r<strong>und</strong> zwei Prozentpunkte bei den Jüngeren <strong>und</strong> Älteren, steht<br />
hier e<strong>in</strong>e Zunahme der Transferwahrsche<strong>in</strong>lichkeit um r<strong>und</strong> vier Prozentpunkte gegenüber.<br />
171
172<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Diese strukturelle Verlagerung ist allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong> re<strong>in</strong>er Westeffekt. Er geht <strong>in</strong>sgesamt mit disparaten<br />
<strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland e<strong>in</strong>her. Während <strong>in</strong> Westdeutschland die<br />
Transferquoten zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 leicht angestiegen s<strong>in</strong>d (e<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong>, die <strong>in</strong> allen<br />
Altersgruppen, vor allem aber unter den 55- bis 69-Jährigen beobachtet werden kann), ist <strong>in</strong><br />
Ostdeutschland e<strong>in</strong> Rückgang im Transfergeschehen zu konstatieren, der alle Altersgruppen<br />
betrifft, vor allem aber auf die Ältesten zurückgeht. Es ist daran zu er<strong>in</strong>nern, dass es gerade<br />
diese Gruppe der 70- bis 85-Jährigen ist, für die <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>kommensanalysen relative Abstiege<br />
der mittleren E<strong>in</strong>kommenspositionen vermerkt werden müssen. Offenbar schlägt sich im Transfergeschehen<br />
die Verschiebung der Ressourcengr<strong>und</strong>lagen zwischen den Altersgruppen deutlich<br />
nieder.<br />
Tabelle 4.17:<br />
Transfervergabe (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 29,3 28,5 28,9 25,7 36,3 30,9 28,6 30,0 29,3<br />
55-69 Jahre 32,7 33,0 32,9 32,8 30,2 31,5 32,8 32,4 32,6<br />
70-85 Jahre 36,9 28,7 31,8 38,3 33,3 35,1 37,2 29,5 32,3<br />
Gesamt 31,7 30,1 30,9 29,9 33,5 31,8 31,4 30,8 31,0<br />
40-54 Jahre 27,6 26,7 27,1 27,3 26,6 27,0 27,5 26,7 27,1<br />
55-69 Jahre 40,2 36,5 38,3 30,8 29,8 30,3 38,3 35,1 36,7<br />
70-85 Jahre 35,0 30,5 32,2 33,5 20,1 25,0 34,8 28,5 30,9<br />
Gesamt 33,6 31,0 32,2 29,6 26,2 27,8 32,8 30,0 31,3<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.791/3.065), gewichtet.<br />
E<strong>in</strong> Blick auf die Transferflüsse an die 40- bis 85-Jährigen (Tabelle 4.18) stützt diese These auf<br />
den ersten Blick allerd<strong>in</strong>gs weniger. Bei <strong>in</strong>sgesamt leicht s<strong>in</strong>kenden Transferquoten, s<strong>in</strong>d es<br />
besonders die 70- bis 85-Jährigen <strong>in</strong> Ostdeutschland, die absolut wie relativ besonders starke<br />
Verr<strong>in</strong>gerungen zu verzeichnen haben. Offenbar ziehen sich ältere Ostdeutsche <strong>in</strong>sgesamt deutlich<br />
aus den privaten Austauschprozessen zurück – e<strong>in</strong> Effekt der angesichts der Ergebnisse der<br />
Transferliteratur durchaus ebenfalls mit gem<strong>in</strong>derten Ressourcenausstattungen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
gebracht werden kann. Denn häufig wird e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>geschränkte Möglichkeit zur Partizipation an<br />
Reziprozitätsketten <strong>in</strong> der Rolle des Gebers mit e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>derung der Bereitschaft zur Annahme<br />
von Gaben verb<strong>und</strong>en. E<strong>in</strong>e abschließende Interpretation der Ergebnisse muss mit weitergehenden<br />
Analysen verb<strong>und</strong>en werden <strong>und</strong> kann an dieser Stelle noch nicht geleistet werden.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Tabelle 4.18:<br />
Transfererhalt (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 11,3 14,2 12,7 12,5 13,0 12,7 11,5 13,9 12,7<br />
55-69 Jahre 4,7 5,3 5,0 6,5 8,1 7,3 5,0 5,8 5,4<br />
70-85 Jahre 2,0 3,9 3,2 3,4 5,1 4,5 2,2 4,1 3,4<br />
Gesamt 7,5 8,8 8,2 9,1 9,7 9,4 7,8 9,0 8,4<br />
40-54 Jahre 10,6 13,3 11,9 8,5 12,4 10,4 10,2 13,1 11,6<br />
55-69 Jahre 4,4 6,8 5,7 4,1 5,6 4,9 4,3 6,6 5,5<br />
70-85 Jahre 1,4 4,0 3,0 2,6 ,6 1,3 1,6 3,3 2,7<br />
Gesamt 6,6 8,7 7,7 5,9 7,1 6,6 6,5 8,4 7,5<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.804/3.070), gewichtet.<br />
Tabelle 4.19:<br />
Transfervergabe <strong>und</strong> -erhalt nach Empfängern <strong>und</strong> Gebern (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Vergabe 1996<br />
Vergabe 2002<br />
Erhalt 1996<br />
Erhalt 2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Gesamt 31,7 30,1 30,9 29,9 33,5 31,8 31,4 30,8 31,0<br />
Darunter:<br />
Elterngeneration* 2,8 2,4 2,6 2,3 1,7 2,0 2,7 2,3 2,5<br />
K<strong>in</strong>dergen.* 27,5 25,9 26,7 26,6 28,6 27,7 27,3 26,5 26,9<br />
Gesamt 33,6 31,0 32,2 29,6 26,2 27,8 32,8 30,0 31,3<br />
Darunter:<br />
Elterngeneration* 3,7 2,1 3,0 1,8 1,1 1,5 3,3 1,9 2,7<br />
K<strong>in</strong>dergen. * 26,1 24,9 25,5 26,1 22,7 24,2 26,1 24,4 25,2<br />
Gesamt 7,5 8,8 8,2 9,1 9,7 9,4 7,8 9,0 8,4<br />
Darunter:<br />
Elterngeneration* 5,7 5,6 5,6 6,1 5,8 5,9 5,8 5,6 5,7<br />
K<strong>in</strong>dergen.* 1,1 1,6 1,4 2,8 3,7 3,3 1,4 2,0 1,7<br />
Gesamt 6,6 8,7 7,7 5,9 7,1 6,6 6,5 8,4 7,5<br />
Darunter:<br />
Elterngeneration* 7,3 9,1 8,1 6,1 8,9 7,4 7,1 9,0 8,0<br />
K<strong>in</strong>dergen.* 1,0 1,9 1,4 1,4 2,2 1,8 1,0 1,9 1,4<br />
* sofern vorhanden. Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.791-4.804/3.065-3.070),<br />
gewichtet.<br />
173
174<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Tabelle 4.19 lässt e<strong>in</strong>en Blick auf die <strong>in</strong>tergenerationale <strong>und</strong> familiale Dimension der Transfervergabe<br />
zu. Inzwischen wissen wir gut, dass dieser Aspekt das Transfergeschehen dom<strong>in</strong>iert –<br />
der überwiegende Teil aller Transfers wird <strong>in</strong>nerhalb von Familien <strong>und</strong> dort entlang der direkten<br />
Verwandtschaftsl<strong>in</strong>ien geleistet. Insgesamt deuten die Resultate auf e<strong>in</strong>e Stabilität der Transfers<br />
zwischen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern. Allerd<strong>in</strong>gs zeigt sich e<strong>in</strong>e Hauptveränderung: leicht verr<strong>in</strong>gert hat<br />
sich die Häufigkeit von Leistungen an die K<strong>in</strong>dergeneration (1996: 26,9 Prozent; 2002: 25,2<br />
Prozent) <strong>und</strong> deutlich verstärkt zeigen sich der Erhalt von Leistungen von den alten Eltern<br />
(1996: 5,7 Prozent; 2002: 8,0 Prozent). Die 40- bis 85-Jährigen kommen also <strong>in</strong>nerhalb ihrer<br />
Familien eher von der Rolle e<strong>in</strong>er Gebergruppe ab <strong>und</strong> tendieren dazu „häufiger“ Leistungen zu<br />
beziehen.<br />
Tabelle 4.20:<br />
Transfervergabe an erwachsene K<strong>in</strong>der außerhalb des Haushalts (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 41,6 32,9 36,4 32,7 35,9 34,5 39,1 33,7 35,9<br />
55-69 Jahre 30,8 31,6 31,2 29,1 23,9 26,4 30,5 29,9 30,2<br />
70-85 Jahre 27,2 20,4 23,0 31,6 28,7 29,8 27,9 22,0 24,2<br />
Gesamt 32,5 28,8 30,4 30,7 29,2 29,9 32,1 28,8 30,3<br />
40-54 Jahre 37,9 30,1 33,5 28,8 27,9 28,2 35,2 29,4 31,9<br />
55-69 Jahre 31,8 27,8 29,7 24,3 23,2 23,7 30,2 26,7 28,4<br />
70-85 Jahre 23,8 19,9 21,5 21,7 14,9 17,5 23,5 18,9 20,7<br />
Gesamt 30,9 25,7 28,0 25,1 22,5 23,6 29,6 25,0 27,0<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.192/2.083), gewichtet.<br />
E<strong>in</strong>e etwas genauere Betrachtung der <strong>in</strong>tergenerationalen, familialen Transfers zwischen Eltern<br />
<strong>und</strong> ihren erwachsenen K<strong>in</strong>dern (Tabelle 4.20) zeigt, dass der angedeutete Rückgang <strong>in</strong> Westdeutschland<br />
schwächer ausgeprägt ist als <strong>in</strong> Ostdeutschland. In den ostdeutschen B<strong>und</strong>esländern<br />
weisen von allem die 70- bis 85-Jährigen deutliche E<strong>in</strong>bußen im Transfergeschehen auf. Hier<br />
s<strong>in</strong>kt die Transferquote zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 von 29,9 Prozent – e<strong>in</strong>em Wert, der dem gesamtdeutschen<br />
Mittelwert entspricht <strong>und</strong> deutlich über jenem der westdeutschen Altersgenossen<br />
liegt – auf nur noch 17,5 Prozent. Der Erhalt von Leistungen der eigenen K<strong>in</strong>der (Tabelle 4.21)<br />
spielt nach wie vor nur e<strong>in</strong>e untergeordnete Rolle.<br />
Im Vergleich beider Erhebungspunkte zeigt sich hier Stabilität im Westen <strong>und</strong> schwache Abnahmen<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland, die unter den über 70-Jährigen am stärksten ausgeprägt s<strong>in</strong>d. Dieser<br />
Trend entspricht jenem, der bereits weiter oben für das Gesamtgeschehen dokumentiert wurde.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Tabelle 4.21:<br />
Transfererhalt von erwachsenen K<strong>in</strong>dern außerhalb des Haushalts (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1996<br />
2002<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
40-54 Jahre 1,3 2,6 2,1 3,5 1,9 2,6 2,0 2,4 2,2<br />
55-69 Jahre 1,3 0,7 1,0 4,3 4,5 4,4 1,9 1,5 1,7<br />
70-85 Jahre 1,8 3,0 2,5 4,0 4,8 4,5 2,2 3,3 2,9<br />
Gesamt 1,4 1,9 1,7 4,0 3,7 3,8 2,0 2,3 2,1<br />
40-54 Jahre 0,0 2,3 1,3 0,0 2,9 1,7 0,0 2,5 1,4<br />
55-69 Jahre 2,2 1,1 1,6 2,7 2,6 2,7 2,3 1,4 1,8<br />
70-85 Jahre 1,0 3,7 2,6 2,1 0,7 1,3 1,2 3,1 2,4<br />
Gesamt 1,4 2,2 1,9 1,8 2,2 2,0 1,5 2,2 1,9<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.204/2.115), gewichtet.<br />
Der Umfang der Transfers zu Lebzeiten der Geber<br />
Die Analyse des Wertes der Geld- <strong>und</strong> Sachtransfers zeigt die quantitative Bedeutung der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Transferleistungen <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere der Transfers zwischen Eltern <strong>und</strong> ihren erwachsenen<br />
K<strong>in</strong>dern. Transfers von Geld- <strong>und</strong> Sachwerten werden ganz überwiegend im Bereich bis<br />
etwa 2.500 € pro Jahr vergeben (Tabelle 4.22). Lediglich 20 Prozent der Geber transferieren<br />
mehr – dies gilt gleichermaßen für West- <strong>und</strong> Ostdeutschland. Große Transfers im Wert von<br />
mehr als 10.000 € s<strong>in</strong>d eher selten <strong>und</strong> werden nur von etwa fünf Prozent der Geber geleistet.<br />
Bedeutend ist hierbei, dass die „Vielgeber“ im Westen e<strong>in</strong>e besonders bedeutende Rolle spielen,<br />
da hierbei hohe Summen oft an mehrere Personen vergeben werden, was sich dann auch <strong>in</strong> der<br />
Verteilung der Transferwerte niederschlägt. Die Wert aller von den 40- bis 85-Jährigen geleisteten<br />
Transfers beträgt <strong>in</strong>sgesamt etwa 2.600 € pro Transfergeber. Die Differenz zwischen West-<br />
<strong>und</strong> Ostdeutschland ist dabei zu beachten: Während <strong>in</strong> Westdeutschland im Mittel gut 2.700 €<br />
transferiert werden, s<strong>in</strong>d es im Osten lediglich knapp 2.300 €. Diese Differenz resultiert vor<br />
allem aus den bereits angesprochenen, besonders umfangreichen Vergaben. Werden diese <strong>in</strong> der<br />
Überprüfung ausgeschlossen, so liegt der Wert der Transfers <strong>in</strong> Ostdeutschland sogar leicht über<br />
Westniveau.<br />
Der Wert Leistungen an die erwachsenen K<strong>in</strong>der übersteigt jenen, der <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Betrachtung<br />
berechnet wurde. Kle<strong>in</strong>e Leistungen im Wert von weniger als etwa 250 € spielen hier<br />
nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Rolle. H<strong>in</strong>gegen bestimmen Transfers von bis zu r<strong>und</strong> 2.500 € das Geschehen.<br />
Auch besonders umfangreiche Leistungen s<strong>in</strong>d hier besonders häufig vorzuf<strong>in</strong>den.<br />
175
Tabelle 4.22:<br />
Wert der materiellen Transferleistungen <strong>in</strong> den vergangenen 12 Monaten, 2002<br />
176<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Westdeutschland Ostdeutschland B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Vergaben <strong>in</strong>sgesamt<br />
Bis zu 255 € 13,3 17,0 15,2 11,3 12,8 12,0 13,0 16,3 14,6<br />
256-510 € 17,4 19,9 18,7 14,5 17,1 15,8 16,9 19,4 18,2<br />
511-1.022 € 22,2 22,3 22,3 21,1 24,3 22,7 22,0 22,7 22,3<br />
1.023-2.555 € 22,3 19,4 20,9 29,4 21,4 25,5 23,6 19,7 21,7<br />
2.556-5.112 € 10,9 10,7 10,8 12,1 10,0 11,1 11,1 10,6 10,8<br />
5.113-10.225€ 7,4 6,6 7,0 8,4 10,7 9,5 7,6 7,3 7,5<br />
10.226+ € 6,4 4,0 5,2 3,2 3,6 3,4 5,9 3,9 4,9<br />
Mean 2.714 € 2.281 € 2.638 €<br />
Vergaben an erwachsene K<strong>in</strong>der außerhalb des Haushalts<br />
Bis zu 255 € 4,3 7,7 6,0 3,2 9,0 6,3 4,1 8,0 6,1<br />
256-510 € 14,1 19,9 17,0 20,5 16,8 18,5 15,3 19,2 17,3<br />
511-1.022 € 16,7 17,5 17,1 14,3 24,4 19,7 16,3 19,0 17,6<br />
1.023-2.555 € 22,6 19,2 20,9 31,8 15,6 23,2 24,4 18,4 21,4<br />
2.556-5.112 € 12,1 10,2 11,2 13,9 10,9 12,3 12,4 10,4 11,4<br />
5.113-10.225 € 8,6 8,4 8,5 5,8 8,8 7,4 8,1 8,5 8,3<br />
10.226+ € 21,5 17,1 19,3 10,5 14,6 12,7 19,4 16,6 18,0<br />
Mean 3.296 € 2.396 € 3.109 €<br />
Die arithmetischen Mittelwerte ergeben sich als Summe der Kategorienmittelwerte <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d damit vor allem als näherungsweise<br />
Schätzung der Transferbeträge zu verstehen, nicht aber als exakte Angaben. Die „krummen“ Zahlenangaben<br />
resultieren aus der Übertragung der 1996 <strong>in</strong> DM gewählten Kategoriengrenzen <strong>in</strong> €-Beträge.<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 779/455), gewichtet.<br />
Insgesamt bestätigen diese deskriptiven Bef<strong>und</strong>e die ausführlicheren Analysen der ersten Befragungswelle<br />
von 1996. Weitere Studien zur längsschnittlichen <strong>Entwicklung</strong> des Transfergeschehens<br />
vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> variierender Ressourcen- <strong>und</strong> Bedarfslagen müssen folgen, die die<br />
vorliegenden querschnittlichen Analysen (vgl. Motel & Szydlik, 1999; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000;<br />
Künem<strong>und</strong> et al., 2004) fortführen.<br />
4.5.6 Zusammenschau von Kennziffern der materiellen Lage<br />
Die folgende Zusammenschau von Kennziffern der ökonomischen Lage zeigt e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e<br />
erhebliche Stabilität der materiellen Lagen. So erweist sich <strong>in</strong> der Zusammenschau der Vermögensbesitze<br />
als stabil. Hier steht e<strong>in</strong>em marg<strong>in</strong>al abnehmenden Besitz von Geldvermögen e<strong>in</strong>e
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
leichte Zunahme des Immobilienbesitzes gegenüber. Daneben zeigen sich konstante Quoten<br />
h<strong>in</strong>sichtlich der Erbschaften <strong>und</strong> auch der Transfervergabe an Dritte, seien es nun K<strong>in</strong>der bzw.<br />
andere Familienangehörige oder auch weitere Personen. Andererseits kündigen sich moderate<br />
Veränderungen von Niveaus <strong>und</strong> Verteilungen an. Besorgnis könnten steigende Quoten der<br />
relativen E<strong>in</strong>kommensarmut erregen, denen stabile Quoten hoher E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte gegenüberstehen. Daneben ist e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>kende Sparneigung festzustellen, die auch<br />
mit e<strong>in</strong>er abnehmende Erbschaftserwartung e<strong>in</strong>hergeht – beide Aspekte der Vermögensbildung<br />
zusammen sche<strong>in</strong>en geschwächt zu se<strong>in</strong>. Insgesamt deutet sich auf der Basis der Ergebnisse des<br />
Alterssurveys somit an, dass e<strong>in</strong>e Fortschreibung der bisher stetigen Verbesserung materieller<br />
Lagen im Alter nicht geboten ersche<strong>in</strong>t. Vielmehr deutet sich e<strong>in</strong> ambivalentes Bild an, <strong>in</strong> dem<br />
vor allem weitere Differenzierung der Lagen die Situation bestimmen werden. Es wird im Folgenden<br />
zu prüfen se<strong>in</strong>, wie sich dies auf die subjektive Wahrnehmung des Lebensstandards <strong>in</strong><br />
der zweiten Lebenshälfte niederschlägt.<br />
Tabelle 4.23:<br />
Kennziffern der wirtschaftlichen Lage, 1996 <strong>und</strong> 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
E<strong>in</strong>kommensarmut<br />
E<strong>in</strong>kommensreichtum<br />
Geldvermögen<br />
Verschuldung<br />
Wohnen im Wohneigentum<br />
Besitz von Wohneigentum<br />
Sparen<br />
Entsparen<br />
Transfers an Dritte geleistet<br />
Transfers von Dritten erhalten<br />
Erbschaften gemacht<br />
Erbschaften erwartet<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre Gesamt<br />
1996 5,7 6,0 8,1 6,2<br />
2002 7,2 7,8 7,4 7,4<br />
1996 9,6 5,7 4,8 7,3<br />
2002 9,4 8,1 4,2 7,8<br />
1996 83,2 79,9 74,2 80,4<br />
2002 79,6 79,9 73,5 78,4<br />
1996 32,3 15,5 3,9 21,1<br />
2002 26,6 11,8 3,4 16,2<br />
1996 59,6 61,5 48,2 58,2<br />
2002 59,4 60,9 47,9 57,7<br />
1996 63,1 62,1 48,3 60,2<br />
2002 62,8 69,8 54,4 63,5<br />
1996 69,2 69,4 65,3 68,5<br />
2002 60,8 65,1 53,7 60,8<br />
1996 49,5 42,7 34,0 44,2<br />
2002 35,4 35,0 25,2 33,0<br />
1996 29,3 32,6 32,3 31,0<br />
2002 27,1 36,7 30,9 31,3<br />
1996 12,7 5,4 3,4 8,4<br />
2002 11,6 5,5 2,7 7,5<br />
1996 45,4 51,5 44,0 47,4<br />
2002 40,7 56,7 48,2 48,0<br />
1996 30,8 11,6 1,9 18,7<br />
2002 26,3 11,5 1,7 15,6<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4838/3084), gewichtet.<br />
177
4.6 Die subjektive Bewertung des Lebensstandards<br />
178<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Die subjektive Bewertung des Lebensstandards sowie se<strong>in</strong>er vergangenen <strong>und</strong> künftigen <strong>Entwicklung</strong><br />
ist e<strong>in</strong> zentraler Aspekt der allgeme<strong>in</strong>en Lebensqualität <strong>und</strong> dürfte besonders für die<br />
Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> Lebensplanung bedeutsam se<strong>in</strong>. Im Folgenden soll daher betrachtet<br />
werden, wie sich vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der objektiven Lagen die subjektiven Bewertungen im<br />
Lebensbereich „E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> materielle Sicherung“ verteilen. Es ist zu untersuchen, ob sich<br />
hier Muster zeigen lassen, die den Verteilungen von E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen entsprechen.<br />
Zum e<strong>in</strong>em soll geschildert werden, wie sich die Bewertungen im Jahr 2002 verteilen. Zum<br />
anderen wird analysiert, welche Veränderungen sich <strong>in</strong> den Verteilungen zwischen 1996 <strong>und</strong><br />
2002 ergeben haben.<br />
Abbildung 4.11:<br />
Subjektive Bewertungen des aktuellen Lebensstandards, 2002<br />
Bereichsbewertung (Range 1-5)<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85 Zeile 7 40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85<br />
Männer Frauen Männer Frauen<br />
Westdeutschland Ostdeutschland<br />
Der Range der Bewertungen reicht von 1 bis 5. Während <strong>in</strong> der Erhebung niedrige Werte e<strong>in</strong>e besonders positive Bewertung<br />
zum Ausdruck brachten, wurde hier zur besseren Darstellbarkeit die Skalierung umgekehrt.<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.805/3.074), gewichtet.<br />
1996<br />
2002<br />
4.6.1 Bewertung des aktuellen Lebensstandards<br />
Insgesamt entsprechen die Verteilungen der mittleren Bewertung des Lebensstandards nach<br />
Altersgruppe, Region <strong>und</strong> Geschlecht im Jahr 2002 jenen, die bereits sechs Jahre zuvor bekannt<br />
s<strong>in</strong>d. Das Niveau liegt im Westen leicht über jenem <strong>in</strong> Ostdeutschland. Dabei zeigen sich <strong>in</strong><br />
Westdeutschland kaum Unterschiede zwischen den Altersgruppen, während sich <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
die Jüngeren nach wie vor deutlich weniger positiv über ihren Lebensstandard äußern als<br />
die Älteren. In dieser H<strong>in</strong>sicht s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Ostdeutschland über die Zeit leichte Nivellierungstendenzen<br />
zu vermelden, die aus Gew<strong>in</strong>nen unter den jüngeren Altersgruppen <strong>und</strong> Abstiegen unter den<br />
über 70-Jährigen resultieren. Im Westen h<strong>in</strong>gegen verlieren vor allen die 40- bis 54-Jährigen,<br />
während die Zugew<strong>in</strong>ne unter den 70- bis 85-Jährigen moderat <strong>und</strong> unter den 55- bis 69-<br />
Jährigen stärker ausfallen. Alle geschilderten <strong>Entwicklung</strong>en gelten <strong>in</strong> ganz ähnlicher Weise für
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Männer wie für Frauen. Die <strong>Entwicklung</strong>en spiegeln die Verschiebungen vor allem der mittleren<br />
E<strong>in</strong>kommenslagen durchaus plausibel wieder. Allerd<strong>in</strong>gs korrespondieren die von den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Gruppen erreichten E<strong>in</strong>kommensniveaus unmittelbar mit den subjektiven Bewertungen<br />
des Lebensstandards. Möglicherweise erfolgen die Anpassungen der Bewertungen den objektiven<br />
Veränderungen zeitlich nachlaufend, so dass hier künftig weitere Verschiebungen aufgr<strong>und</strong><br />
der bereits stattgef<strong>und</strong>enen Modifikationen der Ressourcenverteilung zu erwarten se<strong>in</strong> dürften.<br />
Der Blick nicht nur auf gruppenspezifische Mittelwerte sondern auf die komplette Verteilung<br />
(Anhangstabelle A.4.6) zeigt auch, dass die Disparitäten <strong>in</strong>nerhalb der Regionen im Westen<br />
größer sche<strong>in</strong>en als im Osten.<br />
4.6.2 Bewertung vergangener <strong>Entwicklung</strong>en des Lebensstandards<br />
Auch die mittleren Bewertungen der vergangenen <strong>Entwicklung</strong>en des Lebensstandards spiegeln<br />
<strong>in</strong> den <strong>Wandel</strong> der mittleren relativen E<strong>in</strong>kommenspositionen (Abbildung 4.12). Besonders<br />
positiv äußern sich die Gew<strong>in</strong>nergruppen der letzten Jahre – <strong>in</strong>sgesamt f<strong>in</strong>det sich aber <strong>in</strong> Westdeutschland<br />
e<strong>in</strong>e Konstanz der Abschätzung der <strong>Entwicklung</strong>en <strong>und</strong> <strong>in</strong> Ostdeutschland im Mittel<br />
e<strong>in</strong> Abs<strong>in</strong>ken der Vergangenheitsbewertungen. Überdurchschnittlich positiv urteilen <strong>in</strong> beiden<br />
Landesteilen die 40- bis 54-Jährigen, die generell auch die Gew<strong>in</strong>ner der Verschiebungen <strong>in</strong><br />
der E<strong>in</strong>kommensstruktur darstellen. Die 55- bis 69-Jährigen Westdeutschen stellen allerd<strong>in</strong>gs<br />
e<strong>in</strong>e Ausnahme dar. Während sie objektiv zu den Gew<strong>in</strong>nern zu zählen se<strong>in</strong> sollten, geben sie<br />
im Mittel nur mäßige Bewertungen der Veränderungen an. Dieses wird <strong>in</strong> Zukunft gesondert zu<br />
untersuchen se<strong>in</strong>.<br />
Abbildung 4.12:<br />
Subjektive Bewertungen des der vergangenen <strong>Entwicklung</strong>en des Lebensstandards, 2002<br />
Bereichsbewertung (Range 1-5)<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1996<br />
2002<br />
40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85 Zeile 7 40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85<br />
Männer Frauen Männer Frauen<br />
Westdeutschland Ostdeutschland<br />
Der Range der Bewertungen reicht von 1 bis 5. Während <strong>in</strong> der Erhebung niedrige Werte e<strong>in</strong>e besonders positive Bewertung<br />
zum Ausdruck brachten, wurde hier zur besseren Darstellbarkeit die Skalierung umgekehrt. Quelle: Basis- <strong>und</strong><br />
Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 4.820/3.075), gewichtet.<br />
179
180<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Die Darstellung von Gruppenmittelwerten verdeckt aber den Blick auf die Verteilungen der<br />
Bewertungen. Die Anhangstabelle A.4.7 deutet besonders <strong>in</strong> Ostdeutschland auf abnehmende<br />
Polarisierungen h<strong>in</strong>. War noch 1996 zu konstatieren, dass die Bewertung der Vergangenheit –<br />
damals noch der Vere<strong>in</strong>igungszeit – als „viel besser geworden“ oder „viel schlechter geworden“<br />
häufiger vorgenommen wurde als <strong>in</strong> Westdeutschland, so hat sich dies 2002 relativiert. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
ist nach wie vor festzuhalten, dass die Bewertung „gleich geblieben“ <strong>in</strong> Westdeutschland<br />
häufiger vorkommt als im Osten, wo positive oder negative Nennungen üblicher s<strong>in</strong>d. Allgeme<strong>in</strong><br />
sche<strong>in</strong>t es aber zu e<strong>in</strong>er Stabilisierung der Bewertungen gekommen zu se<strong>in</strong>.<br />
4.6.3 Erwartungen künftiger <strong>Entwicklung</strong>en des Lebensstandards<br />
Künftige Verbesserungen des Lebensstandards zu erwarten, ist <strong>in</strong>zwischen <strong>in</strong> Westdeutschland<br />
unter den Jüngeren – den 40- bis 54-Jährigen – <strong>in</strong> ähnlicher Weise verbreitet wie <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
(nachfolgende Abbildung 4.13). Während sich <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 wenig getan hat, zeigen sich im Westen 2002 unter den Jüngeren deutlich<br />
optimistischere Aussagen, als dies noch 1996 der Fall war. Auch dieser Trend gilt für Männer<br />
<strong>und</strong> Frauen <strong>in</strong> ganz ähnlicher Weise. Die Anhangstabelle A.4.8 weist darüber h<strong>in</strong>aus aus, dass<br />
sich hier weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> Ostdeutschland e<strong>in</strong>e deutlichere Polarisierung zwischen Optimisten <strong>und</strong><br />
Pessimisten zeigt. Im Westen h<strong>in</strong>gegen ist die Konstanzerwartung weiter verbreitet – abgenommen<br />
haben hier vor allem auch die Abstiegsbefürchtungen. Die Erwartung, dass der künftige<br />
Lebensstandard deutlich s<strong>in</strong>ken wird, f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Westdeutschland im Jahr 2002 kaum<br />
mehr (0,7 Prozent).
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Abbildung 4.13:<br />
Subjektive Bewertungen künftiger <strong>Entwicklung</strong>en, 2002<br />
Bereichsbewertung (Range 1-5)<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85 Zeile 7 40-54 55-69 70-85 40-54 55-69 70-85<br />
Männer Frauen Männer Frauen<br />
Westdeutschland Ostdeutschland<br />
Der Range der Bewertungen reicht von 1 bis 5. Während <strong>in</strong> der Erhebung niedrige Werte e<strong>in</strong>e besonders positive Bewertung<br />
zum Ausdruck brachten, wurde hier zur besseren Darstellbarkeit die Skalierung umgekehrt.<br />
Quelle: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n= 3.062/4.809), gewichtet.<br />
4.6.4 Zur Korrespondenz erwarteter <strong>und</strong> tatsächlicher <strong>Entwicklung</strong>en des<br />
Lebensstandards<br />
Wenden wir uns e<strong>in</strong>er genaueren Betrachtung des Zusammenhangs erwarteter <strong>und</strong> tatsächlicher<br />
<strong>Entwicklung</strong>en zu, da sich die Frage nach der Relevanz der Zukunftserwartungen als Indikator<br />
tatsächlicher <strong>Entwicklung</strong>en stellen kann (zu e<strong>in</strong>er erweiterten Sicht auf die Bewertungen <strong>in</strong> den<br />
e<strong>in</strong>zelnen Lebensbereichen <strong>und</strong> die Lebensqualität im Alter vgl. Kapitel 9). Was sagt die subjektive<br />
Erwartung künftiger <strong>Entwicklung</strong>en über die tatsächliche <strong>Entwicklung</strong> künftiger Bewertungen<br />
voraus? Tabelle 4.24 beschreibt diese Zusammenhänge. Es ist deutlich zu erkennen, dass<br />
die Erwartung künftiger <strong>Entwicklung</strong>en nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Vorhersagekraft für tatsächliche Veränderungen<br />
der Bewertung <strong>in</strong> den folgenden Jahren hat. Die Bedeutung im H<strong>in</strong>blick auf die<br />
Veränderung objektiver Lagen muss an anderer Stelle analysiert <strong>und</strong> diskutiert werden. Es zeigt<br />
sich bestenfalls, dass e<strong>in</strong>e Extremerwartung („besser“ oder „schlechter“) positiv mit künftigen<br />
Verbesserungen zusammenhängt, während vormalige Konstanzerwartungen auch mit Konstanz<br />
der tatsächlichen Gegenwartsbewertungen korrespondieren.<br />
1996<br />
2002<br />
181
182<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Tabelle 4.24:<br />
Erwartete <strong>und</strong> tatsächliche <strong>Entwicklung</strong>en des subjektiven Lebensstandards (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Bewertung des Lebensstandards 1996<br />
gut<br />
Mittel<br />
Schlech<br />
Gesamt<br />
<strong>Entwicklung</strong> 1996-2002<br />
Erwartung 1996 verbessert Konstant verschlechtert Gesamt<br />
verbessert 1,3 6,9 3,0 11,2<br />
konstant 9,7 45,8 21,2 76,7<br />
verschlechtert 1,3 7,6 3,1 12,0<br />
verbessert 14,1 13,2 3,2 30,5<br />
konstant 25,5 24,3 2,7 52,5<br />
verschlechtert 8,4 7,5 1,1 17,0<br />
verbessert 28,6 4,3 1,4 34,3<br />
konstant 18,6 1,4 - 20,0<br />
verschlechtert 37,1 5,7 2,9 45,7<br />
verbessert 6,3 8,6 3,0 17,9<br />
konstant 14,7 37,4 14,8 67,0<br />
verschlechtert 5,1 7,5 2,5 15,1<br />
Quelle: Panelstichprobe des Alterssurveys (n= 1.509), gewichtet.<br />
Auch e<strong>in</strong>e Trennung der Analyse entsprechend der Ausgangsniveaus des Jahres 1996 erbr<strong>in</strong>gt<br />
ke<strong>in</strong>e nennenswerte Akzentuierung. Der lediglich schwache Zusammenhang zwischen Erwartungen<br />
<strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>en sche<strong>in</strong>t unabhängig vom Ausgangsniveau zu bestehen. Es bleibt<br />
festzuhalten, dass es zum<strong>in</strong>dest fraglich bleiben muss, <strong>in</strong>wieweit aus den Erwartungen künftiger<br />
<strong>Entwicklung</strong>en auf künftige subjektive Bewertungen des Lebensstandards geschlossen werden<br />
kann, <strong>und</strong> damit, wie relevant die Zukunftsbewertungen für Abschätzungen der Lebensplanungen<br />
se<strong>in</strong> können. Diese Überlegungen relativieren die Aussagekraft der Ergebnisse zu subjektiven<br />
Indikatoren im Rahmen der Ausarbeitung politikrelevanter Empfehlungen. Sie verweisen<br />
darüber h<strong>in</strong>aus auf die Relevanz der Dauerbeobachtung objektiver Indikatoren sozialer Lagen.<br />
Detailliertere Analysen hierzu werden allerd<strong>in</strong>gs notwendig se<strong>in</strong>.<br />
4.7 Zusammenfassung<br />
Der vorliegende Beitrag unternimmt es, die materielle Lage <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte zu Beg<strong>in</strong>n<br />
dieses Jahrzehnts anhand e<strong>in</strong>er für belastbare Aussagen h<strong>in</strong>reichend großen, repräsentativen<br />
Stichprobe zu beschreiben, <strong>und</strong> die <strong>Entwicklung</strong> materieller Lagen über die Zeit zu untersuchen.<br />
Dies geschieht erstens durch den Vergleich der Lage der Altersgruppen zu verschiedenen<br />
Erhebungszeitpunkten, also als Kohortensequenzanalyse <strong>und</strong> zweitens durch die Untersuchung<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Dynamiken über den Lebenslauf. Neben der aktuellen Bestandsaufnahme im S<strong>in</strong>ne<br />
der Alterssozialberichterstattung steht die Untersuchung der Veränderung der <strong>in</strong> kohortenvergleichender<br />
Perspektive im Zentrum das Beitrags. Die Veränderungen der materiellen Lagen im<br />
Alter sowie die damit verb<strong>und</strong>enen Potenziale <strong>und</strong> Problemlagen, wurden im vorliegenden Bei-
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
trag <strong>in</strong> dreierlei H<strong>in</strong>sicht untersucht. Für alle drei Aspekte soll nachfolgend e<strong>in</strong> kurzer Abriss<br />
versucht werden.<br />
Erstens wurde auf die zahlenmäßige <strong>Entwicklung</strong> der älteren Bevölkerung abgehoben. Hiermit<br />
verkoppelt variieren Kaufkraft aber auch die Bedeutung von Randlagen bereits bei konstanten<br />
relativen Parametern wie Prozentanteilen oder Mittelwerten alle<strong>in</strong> durch die demografischen<br />
Verschiebungen. Die wirtschaftliche wie sozialpolitische Bedeutung der Älteren <strong>und</strong> ihrer materiellen<br />
Ressourcen wird sich demnach alle<strong>in</strong> wegen des demografischen Umbruchs deutlich<br />
erhöhen. Prognostizierte Zunahmen der Anzahl z.B. der über 60-Jährigen um r<strong>und</strong> 40 Prozent<br />
bis zum Jahr 2030 lassen dieses Szenario als sehr wahrsche<strong>in</strong>lich sche<strong>in</strong>en. Aufgr<strong>und</strong> des im<br />
Alterssurvey vergleichsweise kle<strong>in</strong>en Zeitfensters können hierzu bisher aber noch ke<strong>in</strong>e über die<br />
Demografie h<strong>in</strong>ausgehenden empirischen Aussagen getroffen werden.<br />
Zweitens kann es – so die Vorannahme dieses Beitrags – zu absoluten oder auch relativen Verschiebungen<br />
<strong>in</strong> den materiellen Lagen älterer Menschen kommen. Dieses Argument zielt vor<br />
allem auf die Relationen zwischen den Altersgruppen. Die Analysen des Alterssurveys konnten<br />
hier letztlich zeigen, dass die Ältesten vor allem im Osten Deutschlands derzeit mit den aktuellen<br />
E<strong>in</strong>kommensentwicklungen im Mittel nicht Schritt halten können. Für die Ältesten im Westen<br />
gilt dies im e<strong>in</strong>geschränkten Ausmaß ebenfalls. Während die Relationen zwischen den Altersgruppen<br />
im Westen Deutschland im Wesentlichen durch die Alterung e<strong>in</strong>er möglicherweise<br />
materiell e<strong>in</strong>malig gut gestellten Kohorte der heute 55- bis 69-Jährigen gekennzeichnet, gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
aber stabil sche<strong>in</strong>t, erweist sich die im Zuge der Systemanpassung <strong>in</strong> den ersten Jahren<br />
nach der Vere<strong>in</strong>igung vergleichsweise sehr gute Position der Ältesten als zunehmend fragil.<br />
Dies war angesichts der <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong>stitutioneller Regelungen zu erwarten. Die <strong>Entwicklung</strong><br />
f<strong>in</strong>det ihren Ausdruck auch <strong>in</strong> steigenden Armutsquoten <strong>in</strong> dieser Gruppe, während <strong>in</strong>sbesondere<br />
der Anteil besonders wohlhabender Personen mit hohen E<strong>in</strong>kommen weiterh<strong>in</strong> marg<strong>in</strong>al<br />
bleibt. Auch der Vermögensbesitz ist hier weiterh<strong>in</strong> weniger stark verbreitet als <strong>in</strong> anderen<br />
Gruppen. Bemerkenswerterweise f<strong>in</strong>det dies bisher kaum Niederschlag <strong>in</strong> den subjektiven Bewertungen<br />
des gegenwärtigen Lebensstandards. Ganz im Gegenteil geben die 70- bis 85-<br />
Jährigen – <strong>in</strong>sbesondere die Männer – deutlich günstigere Bewertungen ab als die jüngeren Altersgruppen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Dieser Effekt war bereits 1996 deutlich erkennbar <strong>und</strong><br />
hat sich lediglich sehr ger<strong>in</strong>gfügig abgeschwächt. In Westdeutschland zeigen sich im Gegensatz<br />
dazu übrigens zu ke<strong>in</strong>em der beiden Erhebungszeitpunkte deutliche Altersgruppendifferenzen <strong>in</strong><br />
der Bewertung das aktuellen Lebensstandards. Im Gegensatz zur aktuellen Bewertung steht die<br />
Beurteilung der bisherigen <strong>Entwicklung</strong> des Lebensstandards. Diese wird von den 70- bis 85-<br />
Jährigen <strong>in</strong> Ostdeutschland im Gegensatz zu 1996 deutlich schlechter e<strong>in</strong>geschätzt als von den<br />
jüngeren Altersgruppen. Noch 1996 zeichneten sich die 70- bis 85-Jährigen <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
durch die b<strong>und</strong>esweit besten Bewertungen der bisherigen <strong>Entwicklung</strong>en aus – dies war angesichts<br />
der <strong>Entwicklung</strong> objektiver Indikatoren durchaus berechtigt.<br />
Drittens werden Verschiebungen <strong>in</strong>nerhalb der Gruppe der Älteren erwartet. Die Analysen zeigen<br />
<strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht allerd<strong>in</strong>gs recht konstante Niveauunterschiede zwischen West- <strong>und</strong> Ost.<br />
Dieser ausbleibenden Annäherung der E<strong>in</strong>kommensniveaus steht die Angleichung der Verteilung<br />
über die Altersgruppen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte gegenüber. Auch <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
bilden sich zunehmend aus Westdeutschland lang bekannte Muster heraus, nach dem die Jüngeren<br />
im noch erwerbsfähigen Alter über deutlich höhere E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Vermögenswerte<br />
183
184<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
verfügen als die über 70-Jährigen. Dies revidiert das noch Mitte der 90er-Jahre <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
vorgef<strong>und</strong>ene Muster, nachdem die materiellen Älteren jenen der mittleren Altersgruppen<br />
zum<strong>in</strong>dest ebenbürtig waren. Damit verb<strong>und</strong>en f<strong>in</strong>det sich auch e<strong>in</strong>e deutliche Ausdifferenzierung<br />
der Verteilungen <strong>in</strong>nerhalb der Altersgruppen <strong>in</strong> Ostdeutschland. Die Diagnose deutlich<br />
zunehmender Ungleichheit betrifft ganz besonders die Jüngeren der betrachteten Altersgruppen.<br />
Hier geht das späte Aufholen h<strong>in</strong>sichtlich der Niveaus (die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Angleichung der Altersverteilungen<br />
an die Westmuster münden) mit e<strong>in</strong>er deutlichen Vertiefung der E<strong>in</strong>kommensungleichheit<br />
e<strong>in</strong>her. Nachfolgend sollen e<strong>in</strong>ige E<strong>in</strong>zelergebnisse zusammengefasst werden:<br />
E<strong>in</strong>kommenslagen – Annahmen für künftige <strong>Entwicklung</strong>en der Ruhestandse<strong>in</strong>kommen lassen<br />
erwarten, dass diese nicht mit den Erwerbse<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> der Lebensmitte Schritt halten dürften.<br />
Zugleich s<strong>in</strong>d Ausdifferenzierungen der Verteilungen zu erwarten. Beide Tendenzen lassen sich<br />
mit gewissen E<strong>in</strong>schränkungen bereits heute ausmachen. Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 haben <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland die E<strong>in</strong>kommen der über 70-Jährigen nicht mit jenen der Jüngeren<br />
Schritt gehalten. In Ostdeutschland ist auch e<strong>in</strong>e Ausdifferenzierung der E<strong>in</strong>kommen aller Altersgruppen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte (mit Ausnahme der über 70-jährigen Männer) festzustellen.<br />
Dieser Bef<strong>und</strong> ist allerd<strong>in</strong>gs nicht auf Westdeutschland übertragbar, wo sich leichte<br />
Verstärkungen der Ungleichheit der E<strong>in</strong>kommenslagen nur unter den unter 70-jährigen Männern<br />
zeigen lassen. Allgeme<strong>in</strong> stellen sich die E<strong>in</strong>kommensverteilungen im Westen im Jahr 2002<br />
allerd<strong>in</strong>gs sogar leicht homogener dar, als noch sechs Jahre zuvor.<br />
E<strong>in</strong>kommensdynamik – Entgegen der landläufigen Erwartung sehr stabiler Alterse<strong>in</strong>kommen,<br />
zeigt sich <strong>in</strong> allen E<strong>in</strong>kommensgruppen, dass Auf- oder Abstiege <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>kommensverteilung<br />
sehr häufig s<strong>in</strong>d. Dennoch ist der Anteil stabiler E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> den oberen Altersgruppen deutlich<br />
höher. Aufstiege f<strong>in</strong>den sich besonders häufig unter den zwischen 1942 <strong>und</strong> 1956 geborenen<br />
– also den 40- bis 54-Jährigen des Jahres 1996. Dieses repräsentiert sich auch <strong>in</strong> den mittleren<br />
Veränderungen. Demnach gehören die Altersgruppen im erwerbsfähigen Alter im Mittel<br />
verglichen mit der allgeme<strong>in</strong>ern E<strong>in</strong>kommensentwicklung zu den Aufsteigern, da sie überproportionale<br />
Gew<strong>in</strong>ne realisieren konnten, während die Personen im Ruhestandsalter im Mittel<br />
absteigen. Dass besonders starke E<strong>in</strong>bußen bei jenen Geburtsjahrgängen zu verzeichnen s<strong>in</strong>d,<br />
die zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 <strong>in</strong> den Ruhestand übergegangen s<strong>in</strong>d, entspricht den Erwartungen.<br />
Besonders häufig s<strong>in</strong>d Abstiege unter den Ostdeutschen der Geburtsjahrgänge 1911 bis 1926,<br />
die bereits 1996 70 Jahre <strong>und</strong> älter waren. Bei ihnen f<strong>in</strong>den sich auch überproportional selten<br />
Aufstiege <strong>in</strong> der relativen E<strong>in</strong>kommensposition.<br />
Armut <strong>und</strong> Wohlstand – Die Ergebnisse h<strong>in</strong>sichtlich der Randlagen der E<strong>in</strong>kommensverteilung,<br />
wie sie <strong>in</strong> Armut <strong>und</strong> Wohlstand zum Ausdruck kommen, entsprechen teilweise den Tendenzen,<br />
die h<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>kommen beschrieben wurden. Moderate allgeme<strong>in</strong>e Anstiege der Armutsquoten<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> Deutschland verdecken e<strong>in</strong>e zweigeteilte <strong>Entwicklung</strong><br />
zwischen West <strong>und</strong> Ost. Während die Quote <strong>in</strong> Westdeutschland nahezu konstant bleibt,<br />
steigt sie <strong>in</strong> Ostdeutschland deutlich an. Diese Disparität tritt unter den über 70-Jährigen am<br />
deutlichsten zu Tage. Es f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Westdeutschland sogar Absenkungen der Armutsbetroffenheit<br />
unter den Ältesten während sich h<strong>in</strong>gegen die <strong>in</strong> den untersuchten Altersgruppen stärksten<br />
Anstiege unter den Altersgenossen <strong>in</strong> Ostdeutschland f<strong>in</strong>den. Daneben steigen die Armutsquoten<br />
– b<strong>und</strong>esweit – deutlich unter den 40- bis 54-jährigen Männern an. Der Trend zu immer<br />
weniger Armut <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte sche<strong>in</strong>t bereits über die Jahrtausendwende mittel-
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
fristig gebrochen zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> setzt sich nur noch im höchsten Alter im Westen fort. H<strong>in</strong>sichtlich<br />
des Wohlstands zeigt sich, das auch hier die Ältesten <strong>in</strong> Ostdeutschland kaum an hohen E<strong>in</strong>kommen<br />
partizipieren während die Jüngeren hier aufholen konnten. Gew<strong>in</strong>ner sche<strong>in</strong>en hier die<br />
55- bis 69-jährigen Männer <strong>in</strong> Westdeutschland zu se<strong>in</strong>.<br />
Vermögen <strong>und</strong> Verschuldung – H<strong>in</strong>sichtlich Vermögen <strong>und</strong> Verschuldung zeigen sich <strong>in</strong> den<br />
Niveaus kaum Veränderungen über die Zeit <strong>und</strong> die Differenzen zwischen West <strong>und</strong> Ost bleiben<br />
bestehen. Allerd<strong>in</strong>gs ist auch hier nach Altersgruppen zu differenzieren, denn die unter 70-<br />
Jährigen <strong>in</strong> Ostdeutschland zeigen die größten Gew<strong>in</strong>ne, während die Verbreitung des Vermögensbesitzes<br />
unter den über 70-Jährigen <strong>in</strong> Ostdeutschland deutlich zurückgeht. Auch hier deutet<br />
sich wiederum die besondere Problemlage der Ältesten <strong>in</strong> Ostdeutschland: zwischen 1996<br />
<strong>und</strong> 2002 nur noch schwach steigenden E<strong>in</strong>kommen stehen ger<strong>in</strong>ge Vermögen gegenüber.<br />
Sparen <strong>und</strong> Entsparen – Sparen <strong>und</strong> Entsparen bef<strong>in</strong>den sich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 auf dem<br />
Rückzug. Insbesondere hat die Spartätigkeit der über 70-Jährigen deutlich abgenommen, wobei<br />
auch hier die Rückgänge im Osten noch über denen <strong>in</strong> Westdeutschland liegen.<br />
Erbschaften – Die Verbreitung der Erbschaften entspricht 2002 <strong>in</strong> etwa jener von 1996 <strong>und</strong> liegt<br />
bei knapp 50 Prozent. Während allerd<strong>in</strong>gs die Erbschaftsquote unter den 55- bis 69-Jährigen<br />
allgeme<strong>in</strong> weiter angestiegen ist, können die 40- bis 54-Jährigen im Jahr 2002 nicht mehr das<br />
Niveau von 1996 erreichen. Offenbar wurde hier <strong>in</strong> der Vergangenheit e<strong>in</strong>e Höchstmarke überschritten,<br />
die entgegen weit verbreiteterer Hoffnungen künftig nicht mehr fortzuschreiben se<strong>in</strong><br />
wird. Diese Annahme wird bestätigt, wenn die Erbschaftserwartung betrachtet wird, denn auch<br />
künftig ist nicht damit zu rechnen, dass die bisher ger<strong>in</strong>ge Quote unter den 40- bis 54-Jährigen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Maße angehoben werden wird, dass <strong>in</strong> der Kumulation die Niveaus der Vorgängerjahrgänge<br />
erreicht werden<br />
Transfers zu Lebzeiten – Die Ergebnisse zur privaten Weitergabe von Geld- <strong>und</strong> Sachwerten<br />
jenseits der Erbschaft bestätigen weitgehend die Resultate der umfangreichen Analysen anhand<br />
der ersten Welle. Die Verbreitung solcher Leistungen ist unverändert hoch. Doch konzentriert<br />
sich e<strong>in</strong>erseits das Vergabegeschehen 2002 zunehmend auf die 55- bis 69-Jährigen. Andererseits<br />
zeigen sich disparate <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> West <strong>und</strong> Ost. Während die Quoten <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
allgeme<strong>in</strong> s<strong>in</strong>ken, f<strong>in</strong>den sich ger<strong>in</strong>gfügige Verr<strong>in</strong>gerungen im Westen nur unter den 40- bis 54-<br />
Jährigen. In den anderen Altersgruppen f<strong>in</strong>den sich eher leichte bist starke Zunahmen. Es zeigt<br />
sich, dass <strong>in</strong>sbesondere die Vergabe von Leistungen an die K<strong>in</strong>der bei den alten Ostdeutschen<br />
seltener wird. Hier dürften sich die oben geschilderten Ressourcenverschiebungen bemerkbar<br />
machen, die die relative Bedürftigkeit <strong>in</strong> der K<strong>in</strong>dergeneration tendenziell m<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> die für<br />
Transfers bereitstehenden Ressourcen der Älteren schmälern sollte. Der Wert der vergebenen<br />
Leistungen entspricht 2002 <strong>in</strong> etwa jenen Größenordnungen die aus dem Jahr 1996 bekannt<br />
s<strong>in</strong>d. Der Erhalt von Leistungen ist allgeme<strong>in</strong> stabil, doch zeigt sich auch, dass sich die Ältesten<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland trotz oder gerade wegen ihrer relativ s<strong>in</strong>kenden Ressourcen aus den Vergabeprozessen<br />
auch als Empfänger zurückziehen. Es bleibt aber <strong>in</strong>sgesamt festzuhalten, dass weiterh<strong>in</strong><br />
dem öffentlichen Transferfluss an die Ruheständler e<strong>in</strong> stabiles, zumeist familiales Transfersystem<br />
gegenüber steht, dass umfangreiche Leistungen <strong>in</strong> der Gegenrichtung vergibt.<br />
185
186<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Subjektive Bewertungen des Lebensstandards <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er <strong>Entwicklung</strong>en – Die Niveaus der subjektiven<br />
Bewertungen des Lebensstandards haben sich nur ger<strong>in</strong>gfügig verändert. Die bei den<br />
objektiven Lagen geschilderten Verschiebungen f<strong>in</strong>den sich hier nicht wieder. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d<br />
die Bewertungen vergangener <strong>Entwicklung</strong>en nun auch im Osten weniger von den Vere<strong>in</strong>igungsprozessen<br />
<strong>und</strong> damit positiv bee<strong>in</strong>flusst. Auch hier f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Niveau <strong>und</strong> Verteilung<br />
e<strong>in</strong>e Annäherung an Westniveaus. Zukunftserwartungen s<strong>in</strong>d allgeme<strong>in</strong> weiterh<strong>in</strong> auf Konstanz<br />
gerichtet <strong>und</strong> unter den Jüngeren im Mittel besser <strong>und</strong> ungleicher als unter den Älteren. Diese<br />
Differenz zwischen den Altersgruppen hat sich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 verstärkt.<br />
Implikationen – Da die Ältesten ganz besonders <strong>in</strong> Ostdeutschland zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nur<br />
unterdurchschnittlich an der Wohlfahrtsentwicklung partizipieren konnten, deuten sich hier<br />
aktuelle Problemlagen an. Weitere Absenkungen der relativen E<strong>in</strong>kommenslagen durch Dämpfungen<br />
der Rentenanpassungen sche<strong>in</strong>en damit problematisch zu se<strong>in</strong>, wenn hierdurch ke<strong>in</strong>e<br />
massive Ausweitung von Armutslagen verb<strong>und</strong>en se<strong>in</strong> soll. Mit Blick auf die künftigen Alten<br />
deutet sich e<strong>in</strong>e Bestätigung der Erwartung an, dass die aktuell sehr positive ausfallende Beschreibung<br />
der materiellen Lagen der jüngsten Ruhestandskohorten nicht e<strong>in</strong>fach fortgeschrieben<br />
werden kann. Die Hoffnung, dass verm<strong>in</strong>derte E<strong>in</strong>kommen aus öffentlichen Alterssicherungssystemen<br />
auch durch private Vermögensübertragungen kompensiert werden können, s<strong>in</strong>d<br />
durch die Ergebnisse das Alterssurvey kaum zu nähren. Es ist nicht nur der Fall, dass solche<br />
Übertragungen häufig jenen zugute kommen, die ohneh<strong>in</strong> bereits über h<strong>in</strong>reichende E<strong>in</strong>kommen<br />
<strong>und</strong> Vermögen verfügen. Vielmehr s<strong>in</strong>kt ganz allgeme<strong>in</strong> die Verbreitung von Erbschaften unter<br />
den Altersgruppen, die sich noch <strong>in</strong> der Erwerbsphase bef<strong>in</strong>den.<br />
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Analysen e<strong>in</strong> <strong>in</strong>sgesamt eher positives <strong>und</strong> über<br />
die Zeit recht stabiles Bild der materiellen Lagen im Alter beschreiben. So s<strong>in</strong>d beispielsweise<br />
der Anteil besonders hoher E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> der Vermögensbesitz recht stabil, was verb<strong>und</strong>en<br />
mit dem starken Wachstum der Zahl älterer Menschen erhebliche Markpotenziale aufzeigt.<br />
Problemlagen zeigen sich aktuell vor allem bei den ältesten Ostdeutschen. Befürchtungen über<br />
künftig verschlechterte Lagen nähren sich langfristig vor allem aus den Ergebnissen zur Lage<br />
der 40- bis 54-Jährigen. Die oftmals vermuteten Spielräume für Rückführungen der wohlfahrtsstaatlichen<br />
Alterssicherung sche<strong>in</strong>en hier ger<strong>in</strong>ger zu se<strong>in</strong>, als es oftmals vermutet wird.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
4.8 Literatur<br />
Aaberge, R., & Melby I. (1998). The sensivity of <strong>in</strong>come <strong>in</strong>equality to choice of equivalence<br />
scales. Review of Income and Wealth, 44, 565-569.<br />
Albrecht, G., & Polster, A. (1999). Studie bestätigt: Rentenversicherung auch <strong>in</strong> Zukunft tragende<br />
Säule der Alterssicherung. VDR aktuell, 19. Mai 1999.<br />
Allmend<strong>in</strong>ger, J. (1994). Lebensverlauf <strong>und</strong> Sozialpolitik. Die Ungleichheit von Mann <strong>und</strong> Frau<br />
<strong>und</strong> ihr gesellschaftlicher Ertrag. Frankfurt/M., New York: Campus.<br />
Andreß, H.-J., Burkatzki, E., Lipsmeier, G., Salent<strong>in</strong>, K., Schulte, K., & Strengmann-Kuhn, W.<br />
(1996). Leben <strong>in</strong> Armut. Analysen der Verhaltensweisen armer Haushalte mit Umfragedaten.<br />
Endbericht des DFG-Projektes "Versorgungsstrategien privater Haushalte im<br />
unteren E<strong>in</strong>kommensbereich". Bielefeld: Universität Bielefeld.<br />
Atk<strong>in</strong>son, A. B. (1983). The economics of <strong>in</strong>equality (2 ed.). Oxford: Clarendon.<br />
Attias-Donfut, C. (Ed.). (1995). Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles, état.<br />
Paris: Editions Nathan.<br />
Attias-Donfut, C., & Wolff, F.-C. (2000a). Complementarity between private and public transfers.<br />
In S. Arber & C. Attias-Donfut (Eds.), The myth of generational conflict (pp. 47-<br />
68). London: Routledge.<br />
Attias-Donfut, C., & Wolff, F.-C. (2000b). The redistributive effects of generational transfer. In<br />
S. Arber & C. Attias-Donfut (Eds.), The myth of generational conflict (pp. 22-46). London:<br />
Routledge.<br />
Bäcker, G. (1995). Altersarmut - Frauenarmut: Dimensionen e<strong>in</strong>es sozialen Problems <strong>und</strong> sozialpolitische<br />
Reformoptionen. In W. Hanesch (Ed.), Sozialpolitische Strategien gegen<br />
Armut (pp. 375-403). Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Bäcker, G. (2003). Müssen die Jüngeren vor den Alten geschützt werden? Über Generationengerechtigkeit<br />
im Sozialstaat. Theorie <strong>und</strong> Praxis der sozialen Arbeit (5), 4-12.<br />
Bäcker, G., Bisp<strong>in</strong>ck, R., Hofemann, K., & Naegele, G. (2000). Sozialpolitik <strong>und</strong> soziale Lage<br />
<strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. 3., gr<strong>und</strong>legend überarbeitete <strong>und</strong> erweiterte Auflage.<br />
Köln: B<strong>und</strong>.<br />
Bäcker, G., & Koch, A. (2003). Die Jungen als Verlierer? Alterssicherung <strong>und</strong> Generationengerechtigkeit.<br />
WSI-Mitteilungen, (2), 111-117.<br />
Backes, G. M. (1993). Frauen zwischen „alten“ <strong>und</strong> „neuen“ Alter(n)srisiken. In G. Naegele &<br />
H. P. Tews (Eds.), Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft -<br />
Folgen für die Politik (pp. 170-189). Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Backes, G. M., & Clemens, W. (1998). Lebensphase Alter. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die sozialwissenschaftliche<br />
Alternsforschung. We<strong>in</strong>heim, München: Juventa.<br />
Barr, N. (1993). The economics of the welfare state (2 ed.). London: Weidenfeld and Nicholson.<br />
187
188<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Barr, N. (2002). Rentenreformen: Mythen, Wahrheiten <strong>und</strong> politische Entscheidungen. Internationale<br />
Revue für Soziale Sicherheit, 55(2), 3-46.<br />
Berger, P. A. (1994). Individualisierung <strong>und</strong> Armut. In M. Zwick (Ed.), E<strong>in</strong>mal arm, immer<br />
arm? Neue Bef<strong>und</strong>e zur Armut <strong>in</strong> Deutschland (pp. 21-46). Frankfurt/M., New York:<br />
Campus.<br />
Berkel, B., & Börsch-Supan, A. (2003). Pension reform <strong>in</strong> Germany: The impact on retirement<br />
decisions (NBER work<strong>in</strong>g paper No. 9913). Cambridge, MA: National Bureau of Economic<br />
Research.<br />
Berntsen, R. (1992). Dynamik <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>kommensverteilung privater Haushalte. Frankfurt/M.,<br />
New York: Campus.<br />
Bertelsmann Stiftung. (2003a). Altersvorsorge 2003: Wer hat sie, wer will sie? Private <strong>und</strong><br />
betriebliche Altersvorsorge der 30- bis 50-Jährigen <strong>in</strong> Deutschland (Bertelsmann Stiftung<br />
Vorsorgestudien 18). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.<br />
Bertelsmann Stiftung (Ed.). (2003b). Vorsorgereport. Private Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.<br />
Braun, R., Burger, F., Miegel, M., Pfeiffer, U., & Schulte, K. (2002). Erben <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Volumen, Psychologie <strong>und</strong> gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Köln: Deutsches Institut<br />
für Altersvorsorge.<br />
Brown, M. (2003). Social security reform and the exchange of bequests for elder care (Work<strong>in</strong>g<br />
Paper 2003-12). Boston: Center for Retirement Research at Boston College.<br />
Buhmann, B., Ra<strong>in</strong>water, L., Schmaus, G., & Smeed<strong>in</strong>g, T. M. (1988). Equivalence scales,<br />
well-be<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>equality and poverty - Sensitivity estimates across ten countries us<strong>in</strong>g the<br />
Luxembourg Income Study (LIS) Database. Review of Income and Wealth, 34, 115-142.<br />
Buhr, P. (1995). Dynamik von Armut. Dauer <strong>und</strong> biographische Bedeutung von Sozialhilfebezug.<br />
Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Bulmahn, T. (2003). Zur <strong>Entwicklung</strong> der privaten Altersvorsorge <strong>in</strong> Deutschland. Vorsorgebereitschaft,<br />
Vorsorgeniveau <strong>und</strong> erwartete Absicherung im Alter. Kölner Zeitschrift für<br />
Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie, 55(3), 29-54.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung (Ed.). (1999). Konzept- <strong>und</strong> Umsetzungsstudie<br />
zur Vorbereitung des Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsberichtes der B<strong>und</strong>esregierung (Vol.<br />
Sozialforschung Band 278). Bonn: Stollfuss.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung. (2001). Lebenslagen <strong>in</strong> Deutschland. Der<br />
erste Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsbericht der B<strong>und</strong>esregierung. Berl<strong>in</strong>: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung (Ed.). (2001). Alterssicherungsbericht<br />
2001. Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung (Ed.). (2003). Nachhaltigkeit <strong>in</strong> der<br />
F<strong>in</strong>anzierung der sozialen Sicherungssysteme. Bericht der Kommission. Berl<strong>in</strong>: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung.<br />
Butrica, B. A., Smith, K., & Toder, E. (2002). Project<strong>in</strong>g poverty rates <strong>in</strong> 2020 for the 62 and<br />
older population: What changes can we expect and why? (Work<strong>in</strong>g Paper 2002-03).<br />
Boston: Center for Retirement Research at Boston College.<br />
Casey, B., & Yamada, A. (2003). Gett<strong>in</strong>g older, gett<strong>in</strong>g poorer? A study of the earn<strong>in</strong>gs, pensions,<br />
assets and liv<strong>in</strong>g arrangements of older people <strong>in</strong> n<strong>in</strong>e countries (Labour Market<br />
and Social Policy - Occasional Papers No. 60). Paris: Organisation for Economic Co-<br />
Operation and Development (OECD).<br />
Citro, C. F., & Michael, R. T. (Eds.). (1995). Measur<strong>in</strong>g poverty. A new approach. Wash<strong>in</strong>gton<br />
D.C.: National Academy Press.<br />
Coulter, F. A. E., Cowell, F. A., & Jenk<strong>in</strong>s, S. P. (1992). Equivalence scale relativities and the<br />
extent of <strong>in</strong>equality and poverty. The Economic Journal, 102, 1067-1082.<br />
Croda, E. (1998). Shar<strong>in</strong>g the wealth - Income shocks and <strong>in</strong>tra-family transfers <strong>in</strong> Germany.<br />
Los Angeles: Department of Economics, University of California.<br />
Dannefer, D. (2003). Cumulative advantage/disadvantage and the life course. Cross-fertiliz<strong>in</strong>g<br />
age and social science theory. Journals of Gerontology. Social Sciences, 58B, S327-<br />
337.<br />
Danziger, S., & Taussig, M. K. (1979). The <strong>in</strong>come unit and the anatomy of <strong>in</strong>come distribution.<br />
Review of Income and Wealth, 25, 365-375.<br />
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. (1990). Das E<strong>in</strong>kommen sozialer Haushaltsgruppen<br />
<strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,<br />
Wochenbericht, 57/90, 304-313.<br />
Easterl<strong>in</strong>, R. A., & Schaeffer, C. M. (1999). Income and subjective well-be<strong>in</strong>g over the life cycle.<br />
In C. D. Ryff & V. W. Marshall (Eds.), The self and society <strong>in</strong> ag<strong>in</strong>g processes (pp.<br />
279-302). New York.<br />
Ebert, E. (1995). E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Konsum <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern. Ergebnisse der Mehrthemenbefragung<br />
der KSPW 1993. In H. Bertram (Ed.), Ostdeutschland im <strong>Wandel</strong>:<br />
Lebensverhältnisse - politische E<strong>in</strong>stellungen (pp. 31-67). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Faik, J. (1995). Äquivalenzskalen. Theoretische Erörterung, empirische Ermittlung <strong>und</strong> verteilungsbezogene<br />
Anwendung für die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Berl<strong>in</strong>: Duncker &<br />
Humblot.<br />
Faik, J. (1997). Institutionelle Äquivalenzskalen als Basis von Verteilungsanalysen - E<strong>in</strong>e Modifizierung<br />
der Sozialhilfeskala. In I. Becker & R. Hauser (Eds.), E<strong>in</strong>kommensverteilung<br />
<strong>und</strong> Armut. Deutschland auf dem Weg zur Vierfünftel-Gesellschaft? (pp. 13-42).<br />
Frankfurt/M., New York: Campus.<br />
189
190<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Fig<strong>in</strong>i, P. (1998). Inequality measures, equivalence scales and adjustment for household size<br />
and composition (Luxembourg Income Study, Work<strong>in</strong>g Paper No. 185). Luxembourg:<br />
Luxembourg Income Study.<br />
G<strong>in</strong>n, J., & Arber, S. (2000). Gender, the generational contract and pension privatisation. In S.<br />
Arber & C. Attias-Donfut (Eds.), The myth of generational conflict (pp. 133-153). London:<br />
Routledge.<br />
Glatzer, W. (1992). Die Lebensqualität älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland. Zeitschrift für Gerontologie,<br />
25, 137-144.<br />
Grabka, M. M. (2000). E<strong>in</strong>kommensverteilung <strong>in</strong> Deutschland. Stärkere Umverteilungseffekte<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,Wochenbericht 19/00<br />
(19), 291-297.<br />
Gustafsson, B., & Johansson, M. (1997). In search for a smok<strong>in</strong>g gun: What makes <strong>in</strong>come <strong>in</strong>equality<br />
vary over time <strong>in</strong> different countries (Luxembourg Income Study, Work<strong>in</strong>g Paper<br />
No. 172). Luxembourg: Luxembourg Income Study.<br />
Habich, R., & Krause, P. (1997). Armut. In Statistisches B<strong>und</strong>esamt (Ed.), Datenreport 1997<br />
(pp. 515-525). Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung.<br />
Hanesch, W., Adamy, W., Martens, R., Rentzsch, D., Schneider, U., Schubert, U., & Wisskirchen,<br />
M. (Eds.). (1994). Armut <strong>in</strong> Deutschland - Der Armutsbericht des DGB <strong>und</strong> des<br />
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Re<strong>in</strong>bek bei Hamburg: Rowohlt.<br />
Hanesch, W., Krause, P., Bäcker, Maschke, G. & Otto, B.. (2000). Armut <strong>und</strong> Ungleichheit <strong>in</strong><br />
Deutschland. Der neue Armutsbericht der Hans-Böckler-Stiftung, des DGB <strong>und</strong> des Paritätischen<br />
Wohlfahrtsverbandes. Hamburg: Rowohlt.<br />
Hauser, R. (1999). Lebensstandardsicherung <strong>und</strong> Armut unter der älteren Bevölkerung. Interntaionale<br />
Revue für Soziale Sicherheit, 52(3), 129-149.<br />
Hauser, R., & Becker, I. (2003). Anatomie der E<strong>in</strong>kommensverteilung. Ergebnisse der E<strong>in</strong>kommens-<br />
<strong>und</strong> Verbrauchsstichproben 1969-1998. Berl<strong>in</strong>: edition sigma.<br />
Hauser, R., & Ste<strong>in</strong>, H. (2001). Die Vermögensverteilung im vere<strong>in</strong>igten Deutschland. Frankfurt<br />
am Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Hauser, R., & Wagner, G. (1992). Altern <strong>und</strong> soziale Sicherung. In P. B. Baltes & J. Mittelstrass<br />
(Eds.), Zukunft des Alterns <strong>und</strong> gesellschaftliche <strong>Entwicklung</strong> (pp. 581-613). Berl<strong>in</strong>,<br />
New York: de Gruyter.<br />
Himmelreicher, R. K., & Viebrok, H. (2003). Die „Riester-Rente“ <strong>und</strong> e<strong>in</strong>ige Folgen für Alterse<strong>in</strong>künfte<br />
(ZeS-Arbeitspapier 4/2003). Bremen: Zentrum für Sozialpolitik.<br />
Hungerford, T. L. (2001). The economic consequences of widowhood on elderly women <strong>in</strong> the<br />
United States and Germany. The Gerontologist, 41(1), 103-110.<br />
Huster, E.-U., & Eissel, D. (2001). Forschungsprojekt "Reichtumsgrenzen für empirische Analysen<br />
der Vermögensverteilung, Instrumente für den staatlichen Umgang mit großen<br />
Vermögen, ökonömische, soziologische <strong>und</strong> ethische Beurteilungen großer Vermögen".
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Beitrag zum Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsbericht 2001 der B<strong>und</strong>esregierung. Berl<strong>in</strong>: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung.<br />
Jürges, H. (1998). Parent-child-transfers <strong>in</strong> Germany: Evidence from Panel-Data. Dortm<strong>und</strong>:<br />
University of Dortm<strong>und</strong>.<br />
Kaufmann, F.-X. (1997). Herausforderungen des Sozialstaates. Frankfurt/M.: Suhrkamp.<br />
Keenay, G., & Whitehouse, E. (2003). F<strong>in</strong>ancial resources and retirement <strong>in</strong> n<strong>in</strong>e OECD countries:<br />
The role of the tax systeme (OECD Social, Employment and Migration Work<strong>in</strong>g<br />
Papers No. 8). Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development<br />
(OECD).<br />
Kohli, M. (1985). Die Institutionalisierung des Lebenslaufs - Historische Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> theoretische<br />
Argumente. Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie, 37, 1-29.<br />
Kohli, M. (1989). Moralökonomie <strong>und</strong> "Generationenvertrag". In M. Haller & H.-J. Hoffman-<br />
Nowottny & W. Zapf (Eds.), Kultur <strong>und</strong> Gesellschaft. Verhandlungen des 24. Deutschen<br />
Soziologentags, des 11. Österreichischen Soziologentags <strong>und</strong> des 8. Kongresses<br />
der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie <strong>in</strong> Zürich 1988 (pp. 532-555). Frankfurt/M.,<br />
New York: Campus.<br />
Kohli, M. (1999a). Ausgrenzung im Lebenslauf. In S. Herkommer (Ed.), Soziale Ausgrenzungen.<br />
Gesichter des neuen Kapitalismus (pp. 111-129). Hamburg: VSA.<br />
Kohli, M. (1999b). Private and public transfers between generations: L<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g the family and the<br />
state. European Societies, 1, 81-104.<br />
Kohli, M. (2003). Generationen <strong>in</strong> der Gesellschaft (Forschungsbericht Forschungsgruppe Altern<br />
<strong>und</strong> Lebenslauf (FALL), Forschungsbericht 73). Berl<strong>in</strong>: Freie Universität.<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A., & Szydlik, M. (2000). Generationenbeziehungen. In M.<br />
Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong><br />
Partizipation im Spiegel des Alterssurveys (pp. 176-211). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2000). Datengr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> Methoden. In M. Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die<br />
zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alterssurveys<br />
(pp. 33-40). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Künem<strong>und</strong>, H., & Motel, A. (1999). Ältere Menschen <strong>und</strong> ihre erwachsenen K<strong>in</strong>der – Bilanz<br />
<strong>und</strong> Perspektiven familialer Hilfe- <strong>und</strong> Transferbeziehungen. In H. Schwengel (Ed.),<br />
Grenzenlose Gesellschaft (pp. 240-243). Pfaffenweiler: Centaurus.<br />
Künem<strong>und</strong>, H., & Motel, A. (2000). Verbreitung, Motivation <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>sperspektiven<br />
privater <strong>in</strong>tergenerationaler Hilfeleistungen <strong>und</strong> Transfers. In M. Kohli & M. Szydlik<br />
(Eds.), Generationen <strong>in</strong> Familie <strong>und</strong> Gesellschaft (pp. 122-137). Opladen: Leske +<br />
Budrich.<br />
Künem<strong>und</strong>, H., Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., & Kohli, M. (2003). Do private <strong>in</strong>tergenerational transfers<br />
<strong>in</strong>crease social <strong>in</strong>equality <strong>in</strong> middle adulthood? Evidence from the German Age<strong>in</strong>g<br />
Survey (Forschungsbericht Forschungsgruppe Altern <strong>und</strong> Lebenslauf (FALL), Forschungsbericht<br />
72). Berl<strong>in</strong>: Freie Universität.<br />
191
192<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Künem<strong>und</strong>, H., Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., & Kohli, M. (2004). Do private <strong>in</strong>tergenerational transfers<br />
<strong>in</strong>crease social <strong>in</strong>equality <strong>in</strong> middle adulthood? Evidence from the German Age<strong>in</strong>g<br />
Survey. Journal of Gerontology: Social Sciences, <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>t.<br />
Künem<strong>und</strong>, H., & Re<strong>in</strong>, M. (1999). There is more to receiv<strong>in</strong>g than need<strong>in</strong>g: Theoretical arguments<br />
and empirical explorations of crowd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> and crowd<strong>in</strong>g out. Age<strong>in</strong>g and Society,<br />
19, 93-121.<br />
Lauterbach, W. (1998). Familiensystem <strong>und</strong> Vermögensübertragung - Zur Bedeutung e<strong>in</strong>er<br />
Erbschaft für Erben <strong>und</strong> Erblasser. In M. Wagner & Y. Schütze (Eds.), Verwandschaft.<br />
Sozialwissenschaftliche Beiträge zu e<strong>in</strong>em vernachlässigten Thema (pp. 237-261).<br />
Stuttgart: Enke.<br />
Lauterbach, W., & Lüscher, K. (1995). Neue <strong>und</strong> alte Muster des Erbens gegen Ende des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts (Arbeitspapier Nr. 18). Konstanz: Sozialwissenschaftliche Fakultät der<br />
Universität Konstanz, Forschungsschwerpunkt "Gesellschaft <strong>und</strong> Familie".<br />
Leibfried, S., Leiser<strong>in</strong>g, L., Buhr, P., Ludwig, M., Maedje, E., Olk, T., Voges, W., & Zwick, M.<br />
(1995). Zeit der Armut. Lebensläufe im Sozialstaat. Frankfurt/M.: Suhrkamp.<br />
Leiser<strong>in</strong>g, L. (1996). Alternde Bevölkerung - veraltender Sozialstaat? Demographischer <strong>Wandel</strong><br />
als Politik. Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte, B35/96, 13-22.<br />
Leiser<strong>in</strong>g, L. (2002). Entgrenzung <strong>und</strong> Remoralisierung. Alterssicherung <strong>und</strong> Generationenbeziehungen<br />
im globalisierten Wohlfahrtskapitalismus. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong><br />
Geriatrie, 35, 343-354.<br />
Leiser<strong>in</strong>g, L., & Motel, A. (1997). Voraussetzungen e<strong>in</strong>es neuen Generationenvertrags. Blätter<br />
für deutsche <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationale Politik, 42, 1213-1224.<br />
Lerman, R. I., & Sorensen, E. (2001). Child support: Interactions between private and public<br />
transfers (NBER work<strong>in</strong>g paper No. 8199). Cambridge, MA: National Bureau of Economic<br />
Research.<br />
L<strong>in</strong>denberger, U., Gilberg, R., Pötter, U., Little, T. D., & Baltes, P. B. (1996). Stichprobenselektivität<br />
<strong>und</strong> Generalisierbarkeit der Ergebnisse <strong>in</strong> der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie. In K. U.<br />
Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 85-108). Berl<strong>in</strong>: Akademie<br />
Verlag.<br />
Mayer, K. U. (1995). Gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong>, Kohortenungleichheit <strong>und</strong> Lebensverläufe. In<br />
P. Berger & P. Sopp (Eds.), Sozialstruktur <strong>und</strong> Lebenslauf (pp. 27-47). Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
Mayer, K. U., & Blossfeld, H.-P. (1990). Die gesellschaftliche Konstruktion sozialer Ungleichheit<br />
im Lebensverlauf. In P. A. Berger & S. Hradil (Eds.), Lebenslage, Lebensläufe, Lebensstile.<br />
Soziale Welt, Sonderband 7 (pp. 297-318). Gött<strong>in</strong>gen: Schwartz.<br />
Merz, J. (2001). Forschungsprojekt "Hohe E<strong>in</strong>kommen, ihre Struktur <strong>und</strong> Verteilung". Beitrag<br />
zum Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsbericht 2001 der B<strong>und</strong>esregierung. Berl<strong>in</strong>: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Miegel, M., Wahl, S., & Hefele, P. (Eds.). (2002). Lebensstandard im Alter. Warum Senioren <strong>in</strong><br />
Zukunft mehr Geld brauchen. Köln: Deutsches Institut für Altersvorsorge.<br />
Motel, A. (1997). Leistungen <strong>und</strong> Leistungspotentiale älterer Menschen. F<strong>in</strong>anzielle Leistungen<br />
der Älteren an ihre K<strong>in</strong>der. In D. Grunow & S. Herkel & H. J. Hummell (Eds.), Leistungen<br />
<strong>und</strong> Leistungspotentiale älterer Menschen. Bilanz <strong>und</strong> Perspektiven des <strong>in</strong>tergenerationalen<br />
Lastenausgleichs <strong>in</strong> Familie <strong>und</strong> sozialem Netz. Duisburger Beiträge zur<br />
soziologischen Forschung Nr. 2/1997 (pp. 16-30). Duisburg: Gerhard-Mercator-<br />
Universität.<br />
Motel, A. (2000). E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen. In M. Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite<br />
Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alterssurveys<br />
(pp. 41-101). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Motel, A., & Künem<strong>und</strong>, H. (1996). E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> materielle Absicherung alter Menschen.<br />
Forschungsstand, Fragestellungen <strong>und</strong> das Erhebungsdesign des Deutschen Alterssurveys<br />
(Manuskript Forschungsgruppe Altern <strong>und</strong> Lebenslauf (FALL), Forschungsbericht<br />
53). Berl<strong>in</strong>: Freie Universität.<br />
Motel, A., & Spieß, K. (1995). F<strong>in</strong>anzielle Unterstützungsleistungen alter Menschen an ihre<br />
K<strong>in</strong>der. Ergebnisse der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (BASE). Forum - Demographie <strong>und</strong> Politik<br />
(7), 133-154.<br />
Motel, A., & Szydlik, M. (1999). Private Transfers zwischen den Generationen. Zeitschrift für<br />
Soziologie, 28, 3-22.<br />
Motel, A., & Wagner, M. (1993). Armut im Alter? Ergebnisse der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie zur<br />
E<strong>in</strong>kommenslage alter <strong>und</strong> sehr alter Menschen. Zeitschrift für Soziologie, 22, 433-448.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. (2000). Alter <strong>und</strong> Generationenvertrag im <strong>Wandel</strong> des Sozialstaats. Alterssicherung<br />
<strong>und</strong> private Generationenbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Berl<strong>in</strong>:<br />
Weißensee Verlag.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. (2004). Quality of life and social <strong>in</strong>equality <strong>in</strong> old age. In S. O. Daatland<br />
& S. Biggs (Eds.), Age<strong>in</strong>g and diversity. Multiple pathways <strong>in</strong> later life (pp. <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>t).<br />
Bristol: The Policy Press.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., & Backes, G. (2004). Wohlfahrtsstaat, Generationendiskurs <strong>und</strong> Ungleichheit<br />
– e<strong>in</strong>e alternswissenschaftlich vergleichende Perspektive. Berl<strong>in</strong>: Deutsches<br />
Zentrum für Altersfragen.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., Krause, P., & Künem<strong>und</strong>, H. (2004). Alterse<strong>in</strong>kommen der Zukunft (Diskussionspapier<br />
Nr. 43). Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., & Tesch-Roemer, C. (2004). Generationengerechtigkeit <strong>in</strong> der sozialen<br />
Sicherung. Anmerkungen sowie ausgewählte Literatur aus Sicht der angewandten Altersforschung<br />
(Diskussionspapiere Nr. 42). Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., Tesch-Roemer, C., & von Kondratowitz, H.-J. (2003). The quantitative<br />
survey. In A. Lowenste<strong>in</strong> & J. Ogg (Eds.), OASIS - Old age and autonomy: The role of<br />
193
194<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
service systems and <strong>in</strong>tergenerational family solidarity. F<strong>in</strong>al Report (pp. 63-101). Haifa:<br />
Haifa University.<br />
Müller, K., Hauser, R., Frick, J., & Wagner, G. (1995). Zur <strong>Entwicklung</strong> der E<strong>in</strong>kommensverteilung<br />
<strong>und</strong> der E<strong>in</strong>kommenszufriedenheit <strong>in</strong> den neuen <strong>und</strong> alten B<strong>und</strong>esländern 1990<br />
bis 1993. In W. Glatzer & H.-H. Noll (Eds.), Lebensverhältnisse <strong>in</strong> Deutschland seit der<br />
Wiedervere<strong>in</strong>igung (pp. 73-108). Frankfurt/M., New York: Campus.<br />
Münke, S. (1956). Die Armut <strong>in</strong> der heutigen Gesellschaft. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Untersuchung <strong>in</strong><br />
Westberl<strong>in</strong>. Berl<strong>in</strong>: Duncker & Humblot.<br />
Nollmann, G., & Strasser, H. (2002). Armut <strong>und</strong> Reichtum <strong>in</strong> Deutschland. Aus Politik <strong>und</strong><br />
Zeitgeschichte (B29/30), 20-28.<br />
Piachaud, D. (1992). Wie mißt man Armut? In S. Leibfried & W. Voges (Eds.), Armut im modernen<br />
Wohlfahrtsstaat. Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie, Sonderheft<br />
32 (pp. 63-87). Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Pris, S. G. (2000). Income <strong>in</strong>equality as a Canadian cohort ages. An analysis of the later life<br />
course. Research on Ag<strong>in</strong>g, 22(3), 211-237.<br />
Reil-Held, A. (2002). Die Rolle <strong>in</strong>tergenerationaler Transfers <strong>in</strong> E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen der<br />
älteren Menschen <strong>in</strong> Deutschland (MATEO Monographien ed. Vol. 26). Mannheim.<br />
Rendtel, U., Langehe<strong>in</strong>e, R., & Berntsen, R. (1992). Mobilitätsprozesse <strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommensarmut<br />
- Erfragtes <strong>und</strong> errechnetes Haushaltse<strong>in</strong>kommen im Vergleich (Arbeitspapier Deutsches<br />
Institut für Wirtschaftsforschung - Diskussionspapier Nr. 56). Berl<strong>in</strong>: Deutsches<br />
Institut für Wirtschaftsforschung.<br />
Roth, M. (2000). Zentrale Ergebnisse zur Altersvorsorge der Rentenversicherten der Geburtsjahrgänge<br />
1936-1955. In Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Ed.), Soziale<br />
Sicherung der Frau. DRV-Schriften - Band 23 (pp. 12-37). Frankfurt/M.: Verband<br />
Deutscher Rentenversicherungsträger.<br />
Schmähl, W. (2004). "Generationengerechtigkeit" als Begründung für e<strong>in</strong>e Strategie "nachhaltiger"<br />
Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland. Unpublished manuscript, Bremen.<br />
Schmähl, W., & Fach<strong>in</strong>ger, U. (1998). Armut <strong>und</strong> Reichtum: E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommensverwendung<br />
älterer Menschen (ZeS-Arbeitspapier Nr. 9/98). Bremen: Zentrum für Sozialpolitk.<br />
Schmähl, W., Himmelreicher, R. K., & Viebrok, H. (2003). Private Altersvorsorge statt gesetzlicher<br />
Rente: Wer gew<strong>in</strong>nt, wer verliert? Forschungsprojekt "Die sozial- <strong>und</strong> verteilungspolitische<br />
Bedeutung der Rahmenbed<strong>in</strong>gungen privater Altersvorsorge" (PrAVo-<br />
Projekt). Bremen: Zentrum für Sozialpolitik.<br />
Schupp, J., & Wagner, G. G. (2003). Forschungsprojekt "Repräsentative Analyse der Lebenslage<br />
e<strong>in</strong>kommensstarker Haushalte". Beitrag zum Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsbericht 2001<br />
der B<strong>und</strong>esregierung. Berl<strong>in</strong>: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung.
Kapitel 4: Materielle Lagen alter Menschen<br />
Schwarze, J. (2000). Us<strong>in</strong>g Panel Data on <strong>in</strong>come satisfaction to estimate the equivalence scale<br />
elasticity (Discussion Paper No. 227). Berl<strong>in</strong>: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.<br />
Schwenk, O. (1995). Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Bauste<strong>in</strong>e für die Konstruktion sozialer Lagen <strong>in</strong><br />
Ostdeutschland. In H. Bertram (Ed.), Ostdeutschland im <strong>Wandel</strong>: Lebensverhältnisse -<br />
politische E<strong>in</strong>stellungen (pp. 3-29). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Schwitzer, K.-P. (1995). Ungleichheit <strong>und</strong> Angleichung von Lebensverhältnissen im vere<strong>in</strong>ten<br />
Deutschland am Beispiel älterer Menschen. In W. Glatzer & H.-H. Noll (Eds.), Lebensverhältnisse<br />
<strong>in</strong> Deutschland seit der Wiedervere<strong>in</strong>igung (pp. 133-164). Frankfurt/M.,<br />
New York: Campus.<br />
Sen, A. (1983). Poor, relatively speak<strong>in</strong>g. Oxford Economic Papers, 35, 380-403.<br />
Sen, A. (1987). The standard of liv<strong>in</strong>g. The Tanner Lectures. Cambridge: University Press.<br />
Shuey, K., & Hardy, M. A. (2003). Assistance to ag<strong>in</strong>g parents and parents-<strong>in</strong>-law: Does l<strong>in</strong>eage<br />
affect family allocation decisions? Journal of Marriage and Family, 65, 418-431.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (1993). Demographische Standards. E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Empfehlung<br />
des Arbeitskreises Deutscher Marktforschungs<strong>in</strong>stitute e.V. (ADM), der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI) <strong>und</strong> des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes.<br />
Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (1999). Demographische Standards. E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Empfehlung<br />
des Arbeitskreises Deutscher Marktforschungs<strong>in</strong>stitute e.V. (ADM), der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI) <strong>und</strong> des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes.<br />
Ausgabe 1999. Methoden - Verfahren - <strong>Entwicklung</strong>en. Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (Ed.). (2002). Datenreport 2002. Zahlen <strong>und</strong> Fakten über die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (2003). Bevölkerung Deutschlands bis 2050. 10. koord<strong>in</strong>ierte Bevölkerungsvorausberechnung.<br />
Wiesbaden: Statistisches B<strong>und</strong>esamt.<br />
Szydlik, M. (1999). Erben <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Zum Verhältnis von familialer<br />
Solidarität <strong>und</strong> sozialer Ungleichheit. Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie,<br />
51, 80-104.<br />
Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A., & Engstler, H. (2002). Die zweite Welle des Alterssurveys<br />
- Erhebungsdesign <strong>und</strong> Instrumente (Diskussionspapier Nr. 35). Berl<strong>in</strong>: Deutsches<br />
Zentrum für Altersfragen.<br />
Vartanian, T. P., & McNamara, J. M. (2002). Older women <strong>in</strong> poverty: The impact of midlife<br />
factors. Journal of Marriage and Family, 64, 532–548.<br />
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Ed.). (1999). Altersvorsorge <strong>in</strong> Deutschland<br />
(AVID '96). Lebensverläufe <strong>und</strong> künftige E<strong>in</strong>kommen im Alter (Vol. Band 19). Frankfurt/M.:<br />
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger.<br />
195
196<br />
Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Wagner, G., Motel, A., Spieß, K., & Wagner, M. (1996). Wirtschaftliche Lage <strong>und</strong> wirtschaftliches<br />
Handeln alter Menschen. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
(pp. 277-299). Berl<strong>in</strong>: Akademie Verlag.<br />
Wagner, M., & Motel, A. (1996). Die Qualität der E<strong>in</strong>kommensmessung bei alten Menschen.<br />
Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie, 48, 493-512.<br />
Wagner, M., & Motel, A. (1998). Income dynamics <strong>in</strong> old age <strong>in</strong> Germany. In L. Leiser<strong>in</strong>g & R.<br />
Walker (Eds.), The dynamics of modern society. Poverty, policy and welfare (pp. 125-<br />
142). Bristol: The Policy Press.<br />
Yamada, A. (2003). The evolv<strong>in</strong>g retirement <strong>in</strong>come package: Trends <strong>in</strong> adequacy and equality<br />
(Labour Market and Social Policy - Occasional Papers No. 63). Paris: Organisation for<br />
Economic Co-Operation and Development (OECD).<br />
Zacher, H. F. (1992). Sozialrecht. In P. B. Baltes & J. Mittelstrass (Eds.), Zukunft des Alterns<br />
<strong>und</strong> gesellschaftliche <strong>Entwicklung</strong> (pp. 305-329). Berl<strong>in</strong>, New York: de Gruyter.
Tabelle A4.1: Äquivalenze<strong>in</strong>kommen (OECD neu; Angaben <strong>in</strong> Euro)<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Alte Länder x 1531 1430 1483 1347 1304 1326 1297 1124 1191 1429 1319 1373<br />
s 894 766 836 971 816 900 1022 595 793 947 758 859<br />
Neue Länder x 1079 1060 1069 1006 961 983 1031 925 964 1045 996 1020<br />
s 449 446 447 381 321 352 293 306 305 407 381 394<br />
Gesamt x 1441 1354 1399 1279 1227 1254 1249 1086 1149 1353 1252 1302<br />
s 844 727 791 895 749 827 940 557 732 881 709 800<br />
Relation West/Ost 1,42 1,35 1,39 1,34 1,36 1,35 1,26 1,22 1,24 1,37 1,32 1,35<br />
Ost/West 0,70 0,74 0,72 0,75 0,74 0,74 0,79 0,82 0,81 0,73 0,76 0,74<br />
2002<br />
Alte Länder x 1703 1684 1694 1752 1507 1625 1507 1346 1411 1684 1535 1606<br />
s 1050 954 1005 1151 743 967 718 607 658 1039 813 931<br />
Neue Länder x 1297 1337 1317 1284 1134 1206 1158 1013 1067 1270 1186 1226<br />
s 687 811 749 774 423 621 310 454 411 679 625 652<br />
Gesamt x 1620 1610 1615 1653 1429 1536 1444 1281 1346 1600 1462 1528<br />
s 999 936 969 1098 705 921 677 595 633 990 790 894<br />
Relation West/Ost 1,31 1,26 1,29 1,36 1,33 1,35 1,30 1,33 1,32 1,33 1,29 1,31<br />
Ost/West 0,76 0,79 0,78 0,73 0,75 0,74 0,77 0,75 0,76 0,75 0,77 0,76<br />
Äquivalenze<strong>in</strong>kommen: gemäß der sog. neuen OECD-Skala bedarfsgewichtetes Haushaltse<strong>in</strong>kommen pro Kopf.<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=4.275/2.686), gewichtet.<br />
197
Tabelle A4.2: Relative E<strong>in</strong>kommensarmut <strong>und</strong> relativer Wohlstand (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
198<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Alte Länder 2,1 7,1 4,5 4,4 6,9 5,6 8,1 8,8 8,6 3,8 7,4 5,6<br />
Neue Länder 9,4 11,2 10,3 8,7 6,6 7,6 2,5 8,4 6,2 8,3 8,9 8,6<br />
Gesamt 3,6 8,0 5,7 5,3 6,8 6,0 7,1 8,7 8,1 4,7 7,7 6,2<br />
Armut<br />
Alte Länder 0,2 2,0 1,0 1,3 1,9 1,6 4,4 3,9 4,1 1,2 2,4 1,8<br />
Neue Länder 2,5 1,7 2,1 3,2 1,0 2,1 0,0 3,4 2,2 2,4 1,8 2,1<br />
Gesamt 0,6 1,9 1,3 1,7 1,7 1,7 3,6 3,8 3,7 1,5 2,3 1,9<br />
Strenge Armut<br />
Alte Länder 6,9 11,5 9,1 12,4 15,2 13,7 16,5 22,6 20,2 10,3 15,2 12,8<br />
Neue Länder 20,1 22,9 21,5 19,0 19,7 19,4 6,6 21,2 15,8 18,0 21,4 19,7<br />
Gesamt 9,5 13,8 11,6 13,7 16,2 14,9 14,7 22,3 19,4 11,8 16,5 14,2<br />
Gemäß. Armut<br />
Alte Länder 12,8 10,3 11,6 7,8 6,2 7,0 7,6 4,7 5,8 10,2 7,6 8,9<br />
Neue Länder 1,6 1,7 1,7 1,0 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 1,2 1,1 1,2<br />
Gesamt 10,6 8,5 9,6 6,5 4,9 5,7 6,4 3,9 4,8 8,4 6,3 7,3<br />
Wohlstand<br />
2002<br />
Alte Länder 6,4 4,5 5,5 5,8 8,6 7,3 4,4 7,7 6,4 5,8 6,8 6,3<br />
Neue Länder 14,9 12,2 13,6 9,0 10,3 9,7 6,3 14,4 11,4 11,3 12,0 11,7<br />
Gesamt 8,2 6,1 7,2 6,5 9,0 7,8 4,8 9,1 7,4 6,9 7,9 7,4<br />
Armut<br />
Alte Länder 2,7 2,6 2,6 1,7 4,7 3,2 1,9 2,6 2,3 2,2 3,3 2,8<br />
Neue Länder 7,1 8,1 7,6 3,9 5,5 4,7 3,5 11,5 8,5 5,3 8,0 6,7<br />
Gesamt 3,6 3,7 3,7 2,2 4,8 3,5 2,2 4,3 3,5 2,8 4,3 3,6<br />
Strenge Armut<br />
Alte Länder 11,9 9,3 10,7 11,9 14,0 13,0 8,6 16,2 13,2 11,3 12,7 12,0<br />
Neue Länder 20,2 26,4 23,2 18,1 20,5 19,4 10,5 30,9 23,3 17,9 25,3 21,8<br />
Gesamt 13,6 12,9 13,3 13,2 15,3 14,3 8,9 19,1 15,1 12,6 15,4 14,0<br />
Gemäß. Armut<br />
Alte Länder 11,2 10,3 10,8 12,9 6,6 9,7 6,7 4,1 5,1 11,0 7,4 9,1<br />
Neue Länder 3,6 4,7 4,1 4,5 0,7 2,5 0,0 0,7 0,4 3,4 2,3 2,8<br />
Gesamt 9,6 9,1 9,4 11,1 5,4 8,1 5,5 3,4 4,2 9,4 6,3 7,8<br />
Wohlstand<br />
Armut (strenge A./gemäßigte A.): bis zu 50 Prozent (40 Prozent/60 Prozent) des arithmet. Mittels der Gesamtbevölkerung; Wohlstand: m<strong>in</strong>d. 200 Prozent des arithmet. Mittels der Gesamtbevölkerung.<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=4.275/2.686), gewichtet.
Tabelle A4.3: Geldvermögen brutto (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
ke<strong>in</strong> Guthaben Alte Länder 13,7 20,5 17,0 17,8 23,3 20,5 20,5 31,3 26,9 16,2 23,7 20,0<br />
Neue Länder 13,8 19,1 16,4 17,8 19,3 18,5 12,4 23,8 19,6 15,2 20,1 17,7<br />
Gesamt 13,7 20,3 16,9 17,8 22,5 20,1 19,1 29,8 25,5 16,0 23,0 19,5<br />
unter 2556 € Alte Länder 8,2 7,0 7,6 6,2 8,0 7,1 5,3 9,9 8,1 7,1 8,0 7,5<br />
Neue Länder 14,8 11,3 13,1 10,6 16,2 13,4 3,1 14,9 10,6 11,8 13,8 12,8<br />
Gesamt 9,5 7,9 8,7 7,1 9,7 8,4 4,9 10,9 8,5 8,0 9,1 8,6<br />
2556-12.781 € Alte Länder 21,2 23,0 22,1 23,4 24,9 24,2 22,0 31,3 27,5 22,1 25,4 23,8<br />
Neue Länder 36,7 40,7 38,6 37,9 41,7 39,7 57,8 44,0 49,1 39,7 41,7 40,7<br />
Gesamt 24,3 26,6 25,4 26,4 28,3 27,3 28,2 33,8 31,6 25,6 28,7 27,1<br />
12.782-51.128 € Alte Länder 32,2 32,7 32,5 35,9 30,8 33,4 35,9 19,1 25,8 34,1 29,3 31,7<br />
Neue Länder 30,0 24,5 27,3 29,9 21,5 25,8 24,8 16,1 19,3 29,3 21,7 25,5<br />
Gesamt 31,8 31,1 31,4 34,7 28,9 31,9 34,0 18,5 24,6 33,2 27,8 30,4<br />
51.129 € u. mehr Alte Länder 24,7 16,7 20,9 16,6 12,9 14,8 16,3 8,6 11,7 20,5 13,7 17,1<br />
Neue Länder 4,8 4,4 4,6 3,8 1,3 2,6 1,9 1,2 1,4 4,0 2,7 3,3<br />
Gesamt 20,8 14,2 17,6 14,0 10,5 12,3 13,8 7,1 9,7 17,3 11,5 14,3<br />
2002<br />
ke<strong>in</strong> Guthaben Alte Länder 19,8 19,1 19,4 14,8 22,5 18,7 20,4 27,0 24,4 18,1 22,3 20,2<br />
Neue Länder 23,6 25,0 24,3 23,2 28,1 25,6 28,3 40,3 36,0 24,2 29,8 27,1<br />
Gesamt 20,6 20,3 20,4 16,5 23,6 20,1 21,8 29,6 26,5 19,3 23,8 21,6<br />
unter 2556 € Alte Länder 8,4 11,0 9,7 4,2 4,0 4,1 7,3 10,3 9,1 6,7 8,4 7,6<br />
Neue Länder 9,6 16,4 12,9 8,7 8,3 8,5 6,3 14,7 11,7 8,7 13,3 11,1<br />
Gesamt 8,7 12,2 10,4 5,1 4,8 5,0 7,1 11,2 9,6 7,1 9,4 8,3<br />
2556-12.781 € Alte Länder 19,0 20,1 19,5 21,8 25,4 23,6 22,5 25,8 24,5 20,7 23,4 22,1<br />
Neue Länder 33,1 22,9 28,1 34,1 33,1 33,6 31,5 27,1 28,7 33,2 27,4 30,1<br />
Gesamt 22,0 20,7 21,3 24,3 26,9 25,6 24,1 26,1 25,3 23,2 24,2 23,7<br />
12.782-51.128 € Alte Länder 29,7 31,4 30,5 36,3 34,1 35,1 33,2 29,0 30,7 32,7 31,7 32,2<br />
Neue Länder 22,9 27,1 25,0 23,9 24,8 24,4 29,9 13,2 19,3 24,4 22,9 23,6<br />
Gesamt 28,3 30,5 29,4 33,8 32,3 33,0 32,6 25,9 28,5 31,1 30,0 30,5<br />
51.129 € u. mehr Alte Länder 23,1 18,4 20,8 22,9 14,1 18,4 16,6 7,9 11,4 21,8 14,3 17,9<br />
Neue Länder 10,8 8,6 9,7 10,1 5,8 8,0 3,9 4,7 4,4 9,5 6,7 8,0<br />
Gesamt 20,5 16,3 18,5 20,3 12,5 16,4 14,4 7,3 10,1 19,4 12,7 15,9<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=3.611/2.492), gewichtet.<br />
199
Tabelle A4.4: Verschuldung brutto (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
200<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Ke<strong>in</strong>e Schulden Alte Länder 66,2 71,8 68,9 83,9 87,6 85,7 95,9 97,4 96,8 77,1 82,8 80,0<br />
Neue Länder 63,6 71,2 67,3 80,6 81,3 80,9 95,5 96,0 95,8 74,2 79,7 77,0<br />
Gesamt 65,7 71,6 68,6 83,2 86,3 84,8 95,8 97,1 96,6 76,5 82,2 79,4<br />
unter 2556 € Alte Länder 6,6 5,1 5,9 2,1 2,4 2,3 0,8 0,6 0,7 4,1 3,2 3,6<br />
Neue Länder 8,3 4,7 6,5 3,6 4,4 4,0 1,7 1,1 1,4 5,6 3,9 4,7<br />
Gesamt 7,0 5,0 6,0 2,4 2,8 2,6 1,0 0,7 0,8 4,4 3,3 3,8<br />
2556-12.781 € Alte Länder 13,1 9,1 11,1 8,0 5,4 6,7 1,9 1,7 1,8 9,6 6,2 7,9<br />
Neue Länder 17,1 15,3 16,2 10,8 11,2 11,0 1,7 2,3 2,1 12,7 11,3 11,9<br />
Gesamt 13,9 10,4 12,2 8,6 6,5 7,6 1,9 1,8 1,9 10,2 7,2 8,7<br />
12.782-51.128 € Alte Länder 9,0 7,2 8,1 3,1 3,9 3,5 1,1 0,0 0,4 5,7 4,5 5,1<br />
Neue Länder 9,7 6,0 7,9 3,6 2,0 2,8 0,6 0,6 0,6 6,2 3,5 4,8<br />
Gesamt 9,1 7,0 8,1 3,2 3,5 3,4 1,0 0,1 0,5 5,8 4,3 5,0<br />
51.129 € u. mehr Alte Länder 5,1 6,8 5,9 2,9 0,7 1,8 0,3 0,3 0,3 3,6 3,3 3,4<br />
Neue Länder 1,4 2,8 2,1 1,4 1,2 1,3 0,6 0,0 0,2 1,3 1,7 1,5<br />
Gesamt 4,4 6,0 5,2 2,6 0,8 1,7 0,3 0,2 0,3 3,1 3,0 3,0<br />
2002<br />
Ke<strong>in</strong>e Schulden Alte Länder 71,3 77,2 74,3 86,8 90,4 88,6 94,8 97,8 96,6 81,5 87,1 84,4<br />
Neue Länder 70,1 76,9 73,4 87,1 89,3 88,2 94,9 97,1 96,3 80,4 86,2 83,5<br />
Gesamt 71,0 77,2 74,1 86,8 90,2 88,5 94,8 97,7 96,6 81,3 86,9 84,2<br />
unter 2556 € Alte Länder 6,0 5,5 5,8 2,6 3,0 2,8 2,3 0,7 1,3 4,0 3,4 3,7<br />
Neue Länder 3,6 10,2 6,8 2,6 4,3 3,4 1,5 0,7 1,0 2,9 5,8 4,4<br />
Gesamt 5,5 6,5 6,0 2,6 3,2 2,9 2,1 0,7 1,3 3,8 3,9 3,8<br />
2556-12.781 € Alte Länder 10,6 7,7 9,2 6,8 4,3 5,5 1,3 1,4 1,4 7,5 4,9 6,1<br />
Neue Länder 18,0 6,8 12,5 4,5 5,0 4,8 2,2 2,2 2,2 10,4 5,0 7,6<br />
Gesamt 12,2 7,5 9,9 6,3 4,4 5,4 1,5 1,6 1,5 8,1 4,9 6,4<br />
12.782-51.128 € Alte Länder 8,5 5,5 7,0 2,3 2,0 2,1 1,3 0,0 0,5 4,8 2,9 3,8<br />
Neue Länder 6,0 2,7 4,4 3,9 1,4 2,6 0,7 0,0 0,3 4,4 1,6 2,9<br />
Gesamt 8,0 5,0 6,5 2,6 1,9 2,2 1,2 0,0 0,5 4,7 2,6 3,6<br />
51.129 € u. mehr Alte Länder 3,5 4,0 3,8 1,6 0,3 1,0 0,3 0,0 0,1 2,2 1,7 1,9<br />
Neue Länder 2,4 3,4 2,9 1,9 0,0 1,0 0,7 0,0 0,3 2,0 1,4 1,6<br />
Gesamt 3,3 3,9 3,6 1,7 0,3 1,0 0,4 0,0 0,2 2,2 1,6 1,9<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=3.879/2.704), gewichtet.
Tabelle A4.5: Geldvermögen netto (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Negative Misch. Alte Länder 8,8 8,7 8,8 4,3 4,3 4,3 0,6 0,7 0,6 6,0 5,5 5,8<br />
Neue Länder 7,8 8,1 7,9 7,0 6,6 6,8 1,9 1,3 1,5 6,8 6,2 6,5<br />
Gesamt 8,6 8,6 8,6 4,9 4,8 4,8 0,8 0,8 0,8 6,1 5,7 5,9<br />
Nur Schulden Alte Länder 5,2 4,4 4,8 3,0 2,7 2,9 0,9 1,0 1,0 3,8 3,1 3,4<br />
Neue Länder 5,4 7,1 6,2 3,1 4,8 4,0 0,0 1,3 0,8 3,8 5,1 4,5<br />
Gesamt 5,2 4,9 5,1 3,0 3,1 3,1 0,7 1,1 0,9 3,8 3,5 3,6<br />
Null o. ausgegl. Alte Länder 13,1 20,2 16,5 16,5 22,2 19,3 20,4 29,9 26,1 15,4 22,9 19,2<br />
Neue Länder 15,6 16,7 16,1 16,3 16,3 16,3 13,1 20,8 17,9 15,6 17,3 16,5<br />
Gesamt 13,6 19,5 16,4 16,4 21,0 18,7 19,1 28,1 24,5 15,4 21,8 18,6<br />
Nur Positivverm. Alte Länder 57,7 55,6 56,7 69,6 66,8 68,2 76,3 68,1 71,4 64,7 62,1 63,4<br />
Neue Länder 55,1 59,1 57,0 65,1 67,0 66,0 83,1 76,7 79,1 62,4 65,4 63,9<br />
Gesamt 57,2 56,3 56,8 68,7 66,8 67,8 77,5 69,8 72,8 64,3 62,8 63,5<br />
Positive Misch. Alte Länder 15,3 11,0 13,3 6,5 4,1 5,3 1,8 0,3 0,9 10,1 6,4 8,2<br />
Neue Länder 16,1 9,1 12,7 8,5 5,3 6,9 1,9 0,0 0,7 11,4 5,9 8,6<br />
Gesamt 15,5 10,6 13,1 6,9 4,3 5,6 1,8 0,3 0,9 10,4 6,3 8,3<br />
2002<br />
Negative Misch. Alte Länder 5,9 6,8 6,3 3,2 1,8 2,5 0,3 1,2 0,9 3,9 3,6 3,8<br />
Neue Länder 7,9 7,3 7,6 6,5 0,8 3,7 1,6 0,0 0,6 6,4 3,3 4,8<br />
Gesamt 6,3 6,9 6,6 3,8 1,6 2,7 0,6 1,0 0,8 4,4 3,6 4,0<br />
Nur Schulden Alte Länder 5,2 6,1 5,6 2,5 2,9 2,7 1,0 1,2 1,1 3,4 3,7 3,6<br />
Neue Länder 3,9 5,1 4,5 ,7 5,0 2,9 0,0 1,6 1,0 2,1 4,2 3,2<br />
Gesamt 4,9 5,9 5,4 2,1 3,3 2,7 0,9 1,3 1,1 3,2 3,8 3,5<br />
Null o. ausgegl. Alte Länder 18,1 16,2 17,2 14,1 20,9 17,5 21,7 25,2 23,8 17,3 20,1 18,8<br />
Neue Länder 21,7 22,6 22,2 23,9 22,7 23,3 29,4 38,6 35,2 23,7 26,6 25,2<br />
Gesamt 18,8 17,5 18,2 16,1 21,2 18,7 23,0 27,8 25,9 18,5 21,4 20,0<br />
Nur Positivverm. Alte Länder 56,5 63,2 59,7 73,9 70,7 72,3 74,8 72,4 73,4 66,2 68,2 67,2<br />
Neue Länder 52,6 58,4 55,5 63,0 65,5 64,3 65,9 59,1 61,6 58,6 61,0 59,9<br />
Gesamt 55,7 62,2 58,9 71,7 69,7 70,7 73,3 69,8 71,2 64,7 66,7 65,8<br />
Positive Misch. Alte Länder 14,4 7,8 11,2 6,4 3,7 5,0 2,1 0,0 0,8 9,2 4,4 6,7<br />
Neue Länder 13,8 6,6 10,2 5,8 5,9 5,8 3,2 0,8 1,7 9,1 4,9 6,9<br />
Gesamt 14,3 7,5 11,0 6,2 4,1 5,2 2,3 0,2 1,0 9,2 4,5 6,7<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=3.552/2.467), gewichtet.<br />
201
Tabelle A4.6: Subjektiver Lebensstandard (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
202<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Sehr gut Alte Länder 12,2 14,9 13,5 8,8 8,8 8,8 8,6 9,6 9,2 10,4 11,6 11,0<br />
Neue Länder 4,9 6,3 5,6 4,9 4,6 4,7 9,4 5,6 6,9 5,5 5,5 5,5<br />
Gesamt 10,8 13,2 12,0 8,1 7,9 8,0 8,8 8,9 8,8 9,5 10,4 10,0<br />
Gut Alte Länder 57,6 54,1 55,8 56,6 54,1 55,3 60,3 58,8 59,4 57,6 55,1 56,3<br />
Neue Länder 43,7 44,6 44,2 53,4 53,8 53,6 63,9 63,0 63,3 49,9 51,5 50,7<br />
Gesamt 54,9 52,2 53,5 56,0 54,0 55,0 60,9 59,5 60,0 56,1 54,4 55,2<br />
Mittel Alte Länder 26,3 27,4 26,8 29,5 32,5 31,0 28,2 26,8 27,3 27,8 29,0 28,4<br />
Neue Länder 43,0 39,8 41,4 37,2 35,7 36,5 23,8 29,2 27,2 38,4 36,2 37,3<br />
Gesamt 29,5 29,8 29,7 30,9 33,1 32,0 27,4 27,2 27,3 29,8 30,4 30,1<br />
Schlecht Alte Länder 3,8 3,2 3,5 4,2 3,1 3,6 2,4 4,1 3,5 3,7 3,4 3,6<br />
Neue Länder 6,1 7,1 6,6 3,0 4,6 3,8 2,5 2,3 2,4 4,5 5,2 4,9<br />
Gesamt 4,2 4,0 4,1 4,0 3,4 3,7 2,4 3,8 3,3 3,9 3,7 3,8<br />
Sehr schlecht Alte Länder 0,2 0,5 0,3 1,0 1,6 1,3 0,4 0,7 0,6 0,5 0,9 0,7<br />
Neue Länder 2,3 2,2 2,3 1,5 1,3 1,4 0,5 0,0 0,2 1,8 1,5 1,6<br />
Gesamt 0,6 0,8 0,7 1,1 1,5 1,3 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,9<br />
2002<br />
Sehr gut Alte Länder 8,2 13,4 10,7 13,2 10,9 12,0 11,9 12,9 12,5 10,7 12,4 11,6<br />
Neue Länder 4,8 11,8 8,3 8,2 5,0 6,5 5,7 4,9 5,2 6,2 7,7 7,0<br />
Gesamt 7,5 13,1 10,2 12,2 9,7 10,9 10,8 11,4 11,2 9,8 11,4 10,7<br />
Gut Alte Länder 59,8 55,6 57,7 63,6 65,0 64,3 61,3 56,0 58,1 61,5 59,0 60,2<br />
Neue Länder 47,3 45,0 46,2 54,7 60,9 57,9 66,7 56,2 60,0 53,2 53,4 53,3<br />
Gesamt 57,3 53,4 55,4 61,8 64,1 63,0 62,2 56,0 58,4 59,8 57,8 58,8<br />
Mittel Alte Länder 24,8 26,2 25,5 20,2 21,5 20,9 24,9 27,4 26,4 23,1 24,9 24,1<br />
Neue Länder 38,8 32,5 35,7 30,6 28,6 29,5 27,0 33,3 31,0 33,9 31,3 32,5<br />
Gesamt 27,6 27,5 27,6 22,3 22,9 22,6 25,2 28,5 27,3 25,3 26,2 25,7<br />
Schlecht Alte Länder 6,6 3,5 5,1 2,3 2,4 2,3 1,7 3,1 2,5 4,2 3,0 3,5<br />
Neue Länder 6,4 9,5 7,9 4,7 5,6 5,2 0,6 5,6 3,8 4,8 7,1 6,1<br />
Gesamt 6,6 4,7 5,7 2,8 3,0 2,9 1,5 3,6 2,8 4,3 3,8 4,0<br />
Sehr schlecht Alte Länder 0,6 1,3 1,0 0,6 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,8 0,7<br />
Neue Länder 2,7 1,2 1,9 1,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 1,1<br />
Gesamt 1,0 1,3 1,2 0,8 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,8 0,7 0,8<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=4.805/3.074), gewichtet.
Tabelle A4.7: Bewertung der <strong>Entwicklung</strong>en des Lebensstandards <strong>in</strong> den letzten 10 Jahren (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
viel besser<br />
Alte Länder 9,9 8,9 9,4 4,2 4,1 4,1 1,5 1,7 1,7 6,6 5,6 6,1<br />
geworden Neue Länder 11,7 13,0 12,3 9,1 8,8 9,0 15,8 12,4 13,6 11,2 11,4 11,3<br />
Gesamt 10,3 9,7 10,0 5,1 5,0 5,1 3,9 3,6 3,7 7,4 6,7 7,1<br />
etwas besser gewor- Alte Länder 34,9 35,7 35,3 21,6 19,8 20,7 10,4 10,6 10,5 26,4 24,6 25,5<br />
den Neue Länder 42,6 41,9 42,2 41,5 41,5 41,5 44,8 43,6 44,0 42,5 42,1 42,3<br />
Gesamt 36,4 36,9 36,7 25,4 24,2 24,8 16,1 16,4 16,3 29,4 28,0 28,7<br />
Gleich<br />
Alte Länder 40,1 42,3 41,1 53,6 58,4 56,0 77,7 71,4 73,7 50,5 54,4 52,5<br />
geblieben Neue Länder 24,2 22,6 23,4 32,3 31,7 32,0 33,0 35,3 34,5 28,3 28,4 28,4<br />
Gesamt 37,0 38,3 37,6 49,6 53,1 51,3 70,2 65,1 67,0 46,4 49,3 47,9<br />
etwas schlechter Alte Länder 12,0 10,8 11,4 16,3 14,4 15,4 9,5 13,9 12,3 13,3 12,7 13,0<br />
geworden Neue Länder 13,2 12,2 12,7 13,1 12,7 12,9 4,4 7,3 6,3 12,1 11,4 11,8<br />
Gesamt 12,2 11,1 11,7 15,7 14,1 14,9 8,7 12,7 11,2 13,1 12,5 12,8<br />
viel schlechter Alte Länder 3,1 2,4 2,7 4,3 3,3 3,8 0,9 2,4 1,8 3,2 2,7 3,0<br />
geworden Neue Länder 8,3 10,4 9,3 4,0 5,2 4,6 2,0 1,4 1,6 5,9 6,8 6,3<br />
Gesamt 4,1 3,9 4,0 4,3 3,7 4,0 1,1 2,2 1,8 3,7 3,5 3,6<br />
2002<br />
viel besser<br />
Alte Länder 10,2 9,4 9,8 4,7 1,5 3,0 0,6 2,8 1,9 6,4 4,9 5,6<br />
geworden Neue Länder 9,0 17,2 13,1 5,3 7,5 6,4 5,1 0,6 2,2 7,0 9,7 8,4<br />
Gesamt 10,0 10,9 10,5 4,8 2,7 3,7 1,4 2,3 2,0 6,6 5,9 6,2<br />
etwas besser gewor- Alte Länder 33,4 37,4 35,4 18,2 17,1 17,6 7,9 8,6 8,3 23,2 22,9 23,0<br />
den Neue Länder 37,2 29,6 33,5 24,7 26,1 25,4 24,1 20,5 21,8 30,5 26,1 28,1<br />
Gesamt 34,2 35,8 35,0 19,5 18,9 19,2 10,7 10,8 10,8 24,6 23,5 24,0<br />
gleich<br />
Alte Länder 39,8 38,8 39,3 56,9 59,4 58,2 76,3 70,0 72,4 52,7 54,0 53,4<br />
geblieben Neue Länder 27,1 28,4 27,8 51,2 50,9 51,0 55,7 64,0 61,0 40,7 45,1 43,0<br />
Gesamt 37,2 36,7 36,9 55,7 57,7 56,7 72,7 68,9 70,3 50,3 52,2 51,3<br />
etwas schlechter Alte Länder 12,3 10,7 11,5 17,3 19,1 18,2 14,4 17,1 16,1 14,5 15,3 14,9<br />
geworden Neue Länder 19,1 17,2 18,2 14,7 13,7 14,2 12,0 13,0 12,7 16,4 14,9 15,6<br />
Gesamt 13,7 12,0 12,9 16,8 18,0 17,4 14,0 16,4 15,4 14,9 15,2 15,1<br />
viel schlechter Alte Länder 4,2 3,7 4,0 2,9 2,9 2,9 0,8 1,5 1,3 3,1 2,9 3,0<br />
geworden Neue Länder 7,4 7,7 7,6 4,1 1,9 2,9 3,2 1,9 2,3 5,5 4,2 4,8<br />
Gesamt 4,9 4,5 4,7 3,2 2,7 2,9 1,3 1,6 1,5 3,6 3,2 3,4<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=4.820/3.075), gewichtet.<br />
203
Tabelle A4.8: Erwartungen künftiger Veränderungen des Lebensstandards (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
204<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
wird viel besser Alte Länder 4,1 2,4 3,3 1,1 0,6 0,9 0,4 0,0 0,2 2,5 1,2 1,8<br />
werden Neue Länder ,8 1,9 1,3 1,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 0,9<br />
Gesamt 3,5 2,3 2,9 1,3 0,5 0,9 0,4 0,0 0,1 2,2 1,1 1,6<br />
wird etwas besser Alte Länder 17,7 18,4 18,1 6,9 5,9 6,4 2,7 1,7 2,1 11,5 10,3 10,9<br />
werden Neue Länder 26,4 23,3 24,9 11,0 13,4 12,2 8,9 7,4 7,9 18,4 16,6 17,5<br />
Gesamt 19,4 19,4 19,4 7,7 7,4 7,5 3,7 2,7 3,1 12,8 11,6 12,1<br />
wird gleich bleiben Alte Länder 59,8 65,7 62,7 70,6 71,9 71,2 80,7 83,9 82,7 66,9 71,9 69,5<br />
Neue Länder 58,5 54,1 56,3 64,3 61,3 62,8 83,7 83,4 83,5 63,8 62,4 63,1<br />
Gesamt 59,5 63,3 61,4 69,4 69,8 69,6 81,2 83,8 82,9 66,3 70,1 68,2<br />
wird etwas schlech- Alte Länder 15,5 11,8 13,7 18,6 18,9 18,8 15,3 12,4 13,5 16,6 14,4 15,5<br />
ter werden<br />
Neue Länder 11,7 16,7 14,2 19,5 21,0 20,3 6,4 8,8 7,9 14,0 16,7 15,4<br />
Gesamt 14,7 12,8 13,8 18,7 19,4 19,0 13,8 11,8 12,5 16,1 14,9 15,5<br />
wird viel schlechter Alte Länder 2,9 1,7 2,3 2,9 2,7 2,8 0,9 2,0 1,6 2,6 2,1 2,4<br />
werden<br />
Neue Länder 2,6 4,1 3,4 3,4 4,3 3,8 1,0 0,5 0,6 2,7 3,4 3,1<br />
Gesamt 2,9 2,2 2,5 3,0 3,0 3,0 0,9 1,7 1,4 2,6 2,4 2,5<br />
2002<br />
wird viel besser Alte Länder 2,4 2,4 2,4 1,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0 1,3<br />
werden Neue Länder 2,1 1,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 1,1 0,5 0,8<br />
Gesamt 2,4 2,2 2,3 1,2 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 1,5 0,9 1,2<br />
wird etwas besser Alte Länder 23,6 19,0 21,3 9,7 5,9 7,8 1,1 2,2 1,8 14,4 10,1 12,1<br />
werden<br />
Neue Länder 26,7 19,5 23,2 8,2 7,5 7,8 4,5 1,9 2,8 16,3 11,0 13,4<br />
Gesamt 24,3 19,1 21,7 9,4 6,2 7,8 1,7 2,1 2,0 14,8 10,3 12,4<br />
wird gleich bleiben Alte Länder 63,3 68,4 65,9 75,5 79,4 77,5 85,3 82,8 83,7 71,8 75,9 74,0<br />
Neue Länder 55,1 62,7 58,9 72,4 79,5 76,1 82,8 87,3 85,7 66,0 74,6 70,6<br />
Gesamt 61,6 67,3 64,4 74,9 79,4 77,2 84,8 83,6 84,1 70,6 75,7 73,3<br />
wird etwas schlech- Alte Länder 9,7 9,6 9,7 12,7 14,5 13,6 12,7 14,2 13,6 11,3 12,5 11,9<br />
ter werden<br />
Neue Länder 10,2 12,4 11,3 16,5 11,8 14,0 11,5 8,9 9,8 12,7 11,3 12,0<br />
Gesamt 9,8 10,2 10,0 13,5 13,9 13,7 12,5 13,2 12,9 11,6 12,2 12,0<br />
wird viel schlechter Alte Länder 0,9 0,5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7<br />
werden<br />
Neue Länder 5,9 4,1 5,0 2,9 1,2 2,1 0,6 1,9 1,4 3,9 2,6 3,2<br />
Gesamt 1,9 1,3 1,6 1,1 0,5 0,8 0,8 1,1 1,0 1,4 1,0 1,2<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=4.809/3.062), gewichtet.
Tabelle A4.9: Materielle Transfers <strong>in</strong>sgesamt – Erhalt <strong>und</strong> Vergabe (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Erhalt Alte Länder 11,3 14,2 12,7 4,7 5,3 5,0 2,0 3,9 3,2 7,5 8,8 8,2<br />
Neue Länder 12,5 13,0 12,7 6,5 8,1 7,3 3,4 5,1 4,5 9,1 9,7 9,4<br />
Gesamt 11,5 13,9 12,7 5,0 5,8 5,4 2,2 4,1 3,4 7,8 9,0 8,4<br />
Vergabe Alte Länder 29,3 28,5 28,9 32,7 33,0 32,9 36,9 28,7 31,8 31,7 30,1 30,9<br />
Neue Länder 25,7 36,3 30,9 32,8 30,2 31,5 38,3 33,3 35,1 29,9 33,5 31,8<br />
Gesamt 28,6 30,0 29,3 32,8 32,4 32,6 37,2 29,5 32,3 31,4 30,8 31,0<br />
2002<br />
Erhalt Alte Länder 10,6 13,3 11,9 4,4 6,8 5,6 1,4 4,0 3,0 6,6 8,7 7,7<br />
Neue Länder 8,5 12,4 10,4 4,1 5,6 4,9 2,6 0,6 1,3 5,9 7,1 6,6<br />
Gesamt 10,2 13,1 11,6 4,3 6,6 5,5 1,6 3,3 2,7 6,5 8,4 7,5<br />
Vergabe Alte Länder 27,6 26,7 27,1 40,1 36,5 38,3 35,0 30,5 32,2 33,5 31,0 32,2<br />
Neue Länder 27,3 26,6 27,0 30,6 29,8 30,2 33,5 20,6 25,3 29,5 26,3 27,8<br />
Gesamt 27,5 26,7 27,1 38,1 35,1 36,6 34,8 28,6 31,0 32,7 30,1 31,3<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (nErhalt=4.804/3.070, nVergabe=4.791/3.065), gewichtet<br />
205
Tabelle A4.10: Materielle Transfers an erwachsene K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> von erwachsenen K<strong>in</strong>dern (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
206<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Erhalt Alte Länder 1,3 2,6 2,1 1,3 0,7 1,0 1,8 3,0 2,5 1,4 1,9 1,7<br />
Neue Länder 3,5 1,9 2,6 4,3 4,5 4,4 4,0 4,8 4,5 4,0 3,7 3,8<br />
Gesamt 2,0 2,4 2,2 1,9 1,5 1,7 2,2 3,3 2,9 2,0 2,3 2,1<br />
Vergabe Alte Länder 41,6 32,9 36,4 30,8 31,6 31,2 27,2 20,4 23,0 32,5 28,8 30,4<br />
Neue Länder 32,7 35,9 34,5 29,1 23,9 26,4 31,6 28,7 29,8 30,7 29,2 29,9<br />
Gesamt 39,1 33,7 35,9 30,5 29,9 30,2 27,9 22,0 24,2 32,1 28,8 30,3<br />
2002<br />
Erhalt Alte Länder 0,0 2,3 1,3 2,2 1,1 1,6 1,0 3,7 2,6 1,4 2,2 1,9<br />
Neue Länder 0,0 2,9 1,7 2,7 2,6 2,7 2,1 0,7 1,3 1,8 2,2 2,0<br />
Gesamt 0,0 2,5 1,4 2,3 1,4 1,8 1,2 3,1 2,4 1,5 2,2 1,9<br />
Vergabe Alte Länder 37,9 30,1 33,5 31,6 27,8 29,7 23,8 19,9 21,5 30,8 25,7 28,0<br />
Neue Länder 28,8 27,9 28,2 24,1 23,2 23,6 21,7 15,6 17,9 25,0 22,7 23,7<br />
Gesamt 35,2 29,4 31,9 30,0 26,7 28,3 23,5 19,0 20,8 29,5 25,0 27,0<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (nErhalt=3.204/2.115, nVergabe=3.192/2.083), gewichtet.
Tabelle A4.11: Wert erhaltener Erbschaften (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
1996<br />
Unter<br />
Alte Länder 13,5 16,5 14,9 13,6 16,3 15,0 15,0 21,4 18,7 13,7 17,3 15,5<br />
5.000 DM Neue Länder 37,2 42,2 39,6 33,6 40,2 37,1 33,3 33,8 33,6 35,3 39,8 37,6<br />
Gesamt 17,5 20,9 19,1 16,8 20,3 18,6 18,2 23,6 21,3 17,3 21,1 19,3<br />
5.000-<br />
Alte Länder 26,5 26,3 26,4 30,0 24,9 27,4 30,1 29,8 29,9 28,4 26,4 27,4<br />
24.999 DM Neue Länder 37,2 26,5 32,0 35,3 31,3 33,2 34,5 38,2 36,7 36,1 30,6 33,3<br />
Gesamt 28,3 26,4 27,4 30,9 26,0 28,4 30,8 31,3 31,1 29,7 27,1 28,3<br />
25.000-<br />
Alte Länder 28,3 27,7 28,0 29,2 29,9 29,5 32,4 21,4 26,1 29,2 27,4 28,3<br />
99.999 DM Neue Länder 15,1 21,7 18,3 18,1 21,4 19,9 19,0 16,2 17,4 16,8 20,6 18,7<br />
Gesamt 26,0 26,7 26,3 27,4 28,4 27,9 30,1 20,5 24,6 27,1 26,3 26,7<br />
100.000-<br />
Alte Länder 24,2 24,6 24,4 22,8 24,4 23,6 17,9 20,6 19,5 22,8 23,8 23,3<br />
499.999 DM Neue Länder 8,1 8,4 8,3 12,1 7,1 9,5 13,1 11,8 12,3 10,3 8,5 9,4<br />
Gesamt 21,5 21,8 21,6 21,1 21,5 21,3 17,1 19,1 18,2 20,7 21,2 21,0<br />
500.000-<br />
Alte Länder 4,5 4,0 4,3 2,4 2,7 2,6 3,5 3,8 3,7 3,5 3,5 3,5<br />
999.999 DM Neue Länder 1,2 1,2 1,2 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 0,7<br />
Gesamt 3,9 3,5 3,7 2,2 2,3 2,2 2,9 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0<br />
1.000.000 DM Alte Länder 3,1 0,9 2,0 2,0 1,8 1,9 1,2 3,1 2,2 2,4 1,6 2,0<br />
<strong>und</strong> mehr Neue Länder 1,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3<br />
Gesamt 2,8 0,7 1,8 1,7 1,5 1,6 1,0 2,5 1,9 2,1 1,4 1,7<br />
2002<br />
Unter<br />
Alte Länder 15,9 22,5 19,3 5,6 13,1 9,4 11,0 8,7 9,6 10,5 15,2 13,0<br />
2.556 € Neue Länder 31,5 36,4 33,8 38,7 28,8 33,2 30,0 22,0 25,3 34,3 30,0 32,0<br />
Gesamt 18,6 24,6 21,6 10,6 15,9 13,3 13,6 10,4 11,7 14,2 17,5 15,9<br />
2.556-<br />
Alte Länder 22,1 28,3 25,2 28,1 22,0 25,0 22,1 22,8 22,5 24,7 24,4 24,6<br />
12.781 € Neue Länder 40,7 34,1 37,6 32,3 37,9 35,4 34,0 24,4 28,4 36,1 33,9 35,0<br />
Gesamt 25,4 29,1 27,3 28,7 24,8 26,7 23,7 23,0 23,3 26,5 25,9 26,2<br />
12.782-<br />
Alte Länder 32,7 27,5 30,1 29,8 32,7 31,3 26,6 33,1 30,5 30,3 31,0 30,7<br />
51.128 € Neue Länder 25,9 20,5 23,4 16,1 22,7 19,8 26,0 36,6 32,1 21,9 24,7 23,4<br />
Gesamt 31,6 26,5 29,0 27,7 31,0 29,4 26,5 33,5 30,7 29,0 30,0 29,5<br />
51.129-<br />
Alte Länder 23,0 15,2 19,0 30,3 26,8 28,6 31,2 27,6 29,0 27,8 23,0 25,3<br />
255.645 € Neue Länder 0,0 9,1 4,3 12,9 9,1 10,8 8,0 14,6 11,9 6,7 10,2 8,5<br />
Gesamt 19,0 14,3 16,6 27,7 23,6 25,6 28,1 25,9 26,8 24,5 21,0 22,6<br />
255.646-<br />
Alte Länder 4,4 5,8 5,1 3,9 4,2 4,1 7,1 6,3 6,6 4,7 5,3 5,0<br />
511.291€ Neue Länder 1,9 0,0 1,0 0,0 1,5 0,8 2,0 2,4 2,3 1,1 1,2 1,2<br />
Gesamt 4,0 4,9 4,5 3,3 3,7 3,5 6,5 5,8 6,1 4,2 4,6 4,4<br />
511.292 €<br />
Alte Länder 1,8 0,7 1,2 2,2 1,2 1,7 1,9 1,6 1,7 2,0 1,1 1,5<br />
<strong>und</strong> mehr Neue Länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamt 1,5 0,6 1,0 1,9 1,0 1,4 1,7 1,4 1,5 1,7 1,0 1,3<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Alterssurveys (n=1.771/1.195), gewichtet<br />
207
208
5. Intergenerationale Familienbeziehungen<br />
im <strong>Wandel</strong><br />
Andreas Hoff<br />
5.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Familien gehören zu den ältesten Institutionen der Menschheit. Be<strong>in</strong>ahe jeder Mensch wird <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Familie h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>geboren. Soziale Beziehungen zu anderen Familienangehörigen s<strong>in</strong>d dementsprechend<br />
die ältesten <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Regel auch die stabilsten Beziehungen, die uns e<strong>in</strong> Leben<br />
lang begleiten. E<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong> e<strong>in</strong> familiales Netzwerk werden wir sozialisiert <strong>und</strong> verbr<strong>in</strong>gen<br />
e<strong>in</strong>en großen Teil unserer Freizeit mit unseren Familienangehörigen. Es bleiben e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
geme<strong>in</strong>samer Er<strong>in</strong>nerungen <strong>und</strong> Erfahrungen, auf denen sich das besondere Zusammengehörigkeitsgefühl<br />
von Familien gründet. Dazu gehören auch erlebte Unterstützung <strong>und</strong> Solidarität.<br />
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird durch fortgesetzte wechselseitige Interaktion <strong>und</strong><br />
Kommunikation ständig erneuert <strong>und</strong> zum Teil auch neu begründet. Im Endeffekt ist es also<br />
notwendig, die sich im Lebensverlauf entwickelnden Familienbeziehungen zu untersuchen,<br />
wenn man verstehen will, was es heißt, alt zu werden.<br />
Diese auf die <strong>Entwicklung</strong> von Familienbeziehungen im gesamten Lebensverlauf gerichtete<br />
Perspektive bildet neben der Perspektive des gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s die zentrale theoretisch-konzeptuelle<br />
Gr<strong>und</strong>lage dieses Kapitels, das Generationenbeziehungen im Kontext der<br />
erweiterten Familie untersucht. Auf der Basis der nun vorliegenden zwei Erhebungszeitpunkte<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 ist es mit den Alterssurvey-Daten erstmals möglich, <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Kont<strong>in</strong>uität<br />
sozialer Beziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte über e<strong>in</strong>en Zeitraum von mehreren Jahren zu<br />
verfolgen. Es ersche<strong>in</strong>t jedoch e<strong>in</strong>e Warnung vor übertriebenen Erwartungen angebracht. Sechs<br />
Jahre (zwischen der Ersterhebung 1996 <strong>und</strong> der zweiten Welle im Jahre 2002) s<strong>in</strong>d, aus e<strong>in</strong>er<br />
Lebenslaufperspektive betrachtet, e<strong>in</strong> relativ kurzer Zeitraum. Tiefgreifende E<strong>in</strong>schnitte oder<br />
Veränderungen sozialer Beziehungen <strong>in</strong> Familien s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>nerhalb weniger Jahre kaum zu erwarten.<br />
Von Interesse dürfte jedoch se<strong>in</strong>, ob erkennbare Unterschiede im Vergleich zum vorigen<br />
Untersuchungszeitpunkt als Vorboten e<strong>in</strong>er zukünftigen Veränderung von Familienbeziehungen<br />
<strong>in</strong>terpretiert werden können.<br />
Das vorliegende Kapitel ist explizit deskriptiv angelegt. Die hauptsächliche Zielstellung ist es,<br />
auf Basis der Alterssurvey-Daten e<strong>in</strong>erseits <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sverläufe <strong>in</strong> bestimmten<br />
Phasen der zweiten Lebenshälfte nachzuvollziehen <strong>und</strong> andererseits nach Anzeichen e<strong>in</strong>es familialen<br />
<strong>Wandel</strong>s <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte zu suchen. Dementsprechend wird der <strong>Wandel</strong> von<br />
Generationenbeziehungen durch den Vergleich von Basisstichprobe 1996 <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
2002 nachgezeichnet. Die Darstellung <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong>en erfolgt h<strong>in</strong>gegen<br />
entsprechend der dazu notwendigen Längsschnittperspektive ausschließlich auf Basis der<br />
Panelstichprobe. Gegenstand dieses Kapitels ist also e<strong>in</strong>e umfassende Deskription von Generationenbeziehungen<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Familie, e<strong>in</strong>schließlich der Dimension sozialer Unterstützung.<br />
209
210<br />
Andreas Hoff<br />
Damit wird den Anforderungen an e<strong>in</strong>e empirische Sozialberichterstattung entsprochen (Noll,<br />
1999; Tesch-Römer, Wurm, Hoff, & Engstler, 2002). Abschließend werden die zentralen Ergebnisse<br />
dieses Reports noch e<strong>in</strong>mal gebündelt <strong>und</strong> <strong>in</strong> konkrete sozialpolitische Handlungsempfehlungen<br />
umgesetzt.<br />
Das Kapitel ist folgendermaßen gegliedert: Zu Beg<strong>in</strong>n wird der Zusammenhang zwischen den<br />
beiden zentralen Betrachtungsweisen dieses Kapitels – <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong> <strong>Wandel</strong><br />
von Familienbeziehungen – argumentativ untermauert, gefolgt von der Formulierung der zentralen<br />
Fragestellungen dieses Kapitels. Im Anschluss daran erfolgt die Präsentation empirischer<br />
Ergebnisse. In e<strong>in</strong>em ersten Schritt wird e<strong>in</strong> Überblick über die gelebten Generationenbeziehungen<br />
<strong>in</strong> der Familie gegeben. Dazu gehört auch die Darstellung spezifischer Generationenkonstellationen<br />
<strong>in</strong> der erweiterten Familie. Das vierte Unterkapitel ist der Frage gewidmet, mit wem<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte unmittelbar zusammenleben. Ausgangspunkt ist die Analyse<br />
der Wohnentfernung zwischen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern, gefolgt von der Untersuchung <strong>in</strong>tergenerationaler<br />
Beziehungskonstellationen auf Haushaltsebene. E<strong>in</strong> dritter Abschnitt ist der Bedeutung<br />
familialer Generationenbeziehungen gewidmet. Dabei wird zunächst die subjektive Wahrnehmung<br />
der Befragten untersucht, bevor der Blick auf andere, „objektive“ Indikatoren, wie die<br />
Kontakthäufigkeit zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern gelenkt wird. Dem folgt e<strong>in</strong>e umfassende Analyse<br />
<strong>in</strong>tergenerationaler Unterstützungsbeziehungen <strong>in</strong> der Familie. Den Abschluss bildet die<br />
Diskussion der sozial- <strong>und</strong> familienpolitischen Implikationen der vorgestellten Ergebnisse.<br />
5.2 Familienbeziehungen <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong><br />
In diesem Unterkapitel wird das Konzept des <strong>Wandel</strong>s von Familienbeziehungen e<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong><br />
den breiteren Rahmen des familialen <strong>und</strong> demografischen <strong>Wandel</strong>s, welche wiederum Bestandteile<br />
des gesamtgesellschaftlichen oder sozialen <strong>Wandel</strong>s s<strong>in</strong>d. Dabei wird angeknüpft an die<br />
theoretisch-konzeptuellen Überlegungen aus dem E<strong>in</strong>führungskapitel (vgl. Kapitel 1 dieses<br />
Bandes) – <strong>in</strong>sbesondere jenen zum Paradigma der Lebensverlaufsperspektive <strong>und</strong> dem Konzept<br />
des sozialen <strong>Wandel</strong>s. Auf dieser Gr<strong>und</strong>lage werden im Folgenden <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Akteure, Familie<br />
<strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong> zue<strong>in</strong>ander <strong>in</strong> Beziehung gesetzt. Dem schließt sich die Herleitung der<br />
zentralen Fragestellungen dieses Kapitels an.<br />
5.2.1 Individuum, Familie <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong><br />
Individuum, Familie <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong> stehen für die drei klassischen Ebenen soziologischer<br />
Analyse – Mikro, Meso- <strong>und</strong> Makroebene. Die Mikroebene entspricht der Ebene des <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Handelns. Im Gegensatz dazu stellt die Makroebene die Ebene gesamtgesellschaftlicher<br />
Wirkungszusammenhänge dar. Soziale Strukturen werden dabei als Ergebnisse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Handelns betrachtet, wobei es sich dabei <strong>in</strong> der Regel um un<strong>in</strong>tendierte Konsequenzen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Handelns handelt (Coleman, 1990; Esser, 1993, 1999). Menschengruppen wie beispielsweise<br />
die Familie oder auch soziale Netzwerke s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne <strong>in</strong>termediäre Strukturen,<br />
welche der zwischen Mikro- <strong>und</strong> Makroebene liegenden sogenannten Mesoebene zuzuordnen<br />
s<strong>in</strong>d. Die Manifestation der Ergebnisse <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Handelns <strong>in</strong> soziale Strukturen wird durch
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
solche <strong>in</strong>termediären Strukturen vermittelt (Galaskiewicz & Wasserman, 1994). Individuen<br />
werden dabei als <strong>in</strong>teragierende Mitglieder der Gesellschaft betrachtet – <strong>und</strong> nicht als Elemente<br />
e<strong>in</strong>es abstrakten sozialen Systems.<br />
Mit dem Begriff des sozialen <strong>Wandel</strong>s wird die Veränderung der Gesellschaft <strong>und</strong> dabei <strong>in</strong>sbesondere<br />
die Veränderung sozialer Strukturen <strong>und</strong>/oder sozialen Verhaltens bezeichnet (Wiswede,<br />
2000). Der sehr allgeme<strong>in</strong>e Begriff des sozialen <strong>Wandel</strong>s bezieht sich auf die gesamtgesellschaftliche<br />
Ebene. Der Charme dieses Konzepts besteht im Wesentlichen dar<strong>in</strong>, dass es den<br />
dynamischen Charakter gesellschaftlicher Veränderungen betont <strong>und</strong> sich so von konventionellen<br />
statischen Vergleichen abgrenzt (für e<strong>in</strong>en Überblick über das Konzept sozialen <strong>Wandel</strong>s<br />
vgl. Hradil, 2001). E<strong>in</strong>en nach wie vor lesenswerten Überblick über Theorien des sozialen<br />
<strong>Wandel</strong>s bietet Zapf (1971). Der Nachteil des Konzepts besteht jedoch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em hohen Abstraktionsgrad<br />
aufgr<strong>und</strong> der gesamtgesellschaftlichen Bezugsebene. Konkrete, operationalisierbare<br />
Indikatoren sozialen <strong>Wandel</strong>s s<strong>in</strong>d nur sehr schwer zu identifizieren.<br />
Gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die mit dem Begriff „sozialer <strong>Wandel</strong>“ bezeichnet<br />
werden, vollziehen sich jedoch nicht nur auf Gesellschaftsebene – sie treten auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vielzahl<br />
von Teilbereichen der Gesellschaft auf. Ihre jeweilige Bezeichnung richtet sich nach diesen<br />
Teilbereichen – Begriffe wie familialer <strong>Wandel</strong>, demografischer <strong>Wandel</strong>, Altersstrukturwandel,<br />
etc. geben H<strong>in</strong>weise auf ihre Bezugspunkte. So beschäftigt sich der familiale <strong>Wandel</strong> mit Veränderungen<br />
der Familienstruktur oder der demografische <strong>Wandel</strong> mit Veränderungen der Bevölkerungsstruktur.<br />
Diese Unterkonzepte s<strong>in</strong>d konkret zu erfassen <strong>und</strong> mit Hilfe konkreter Indikatoren<br />
messbar. Die für die zweite Lebenshälfte relevanten Indikatoren demografischen <strong>und</strong><br />
familialen <strong>Wandel</strong>s werden im Anschluss benannt. Erklärtes Ziel des Kapitels ist es festzustellen,<br />
<strong>in</strong> welchem Maße sich die Familienbeziehungen der befragten 40- bis 85-Jährigen (im<br />
Längsschnitt: 46- bis 91-Jährigen) <strong>in</strong> den letzten sechs Jahren verändert haben. In e<strong>in</strong>em zweiten<br />
Schritt soll dann untersucht werden, <strong>in</strong>wieweit Veränderungen demografische <strong>und</strong> familienstrukturelle<br />
Wandlungsprozesse die Gestaltung von Familienbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
bee<strong>in</strong>flussen. Im Folgenden wird zunächst e<strong>in</strong> kurzer Überblick über die wesentlichen<br />
Trends des demografischen <strong>und</strong> des familialen <strong>Wandel</strong>s gegeben.<br />
Im Zuge des demografischen <strong>Wandel</strong>s hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung <strong>in</strong>nerhalb<br />
des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts auf 75,4 bzw. 81,2 Jahre für 2000/2002 geborene Männer bzw. Frauen<br />
mehr als verdoppelt (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2004). E<strong>in</strong>e deutlich gestiegene Lebenserwartung<br />
war <strong>und</strong> ist e<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Menschen <strong>in</strong> Deutschland heutzutage<br />
mit e<strong>in</strong>iger Sicherheit erwarten können, e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong> oder sogar zwei Jahrzehnte umfassenden<br />
Lebensabend <strong>in</strong> relativ guter Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Paarbeziehung zu erleben. So haben<br />
2000/2002 65-jährige Männer noch e<strong>in</strong>e durchschnittliche fernere Lebenserwartung von 16<br />
Jahren, Frauen sogar von fast 20 Jahren (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2004).<br />
Erst die gestiegene Lebenserwartung ermöglicht die Existenz von drei, vier oder mehr Generationen<br />
<strong>in</strong>nerhalb desselben Familiennetzwerks (Lauterbach & Kle<strong>in</strong>, 1997). Das vielfach beschworene<br />
harmonische Zusammenleben mehrerer Generationen <strong>in</strong> der vormodernen Großfamilie<br />
muss schon alle<strong>in</strong> deshalb als Mythos der Familienforschung e<strong>in</strong>gestuft werden (Nave-Herz,<br />
2004; Rosenbaum, 1982). Die deutlich gestiegene Lebenserwartung ist im übrigen auch Voraussetzung<br />
dafür, dass e<strong>in</strong>e Mehrheit der Bevölkerung heute erfüllte Großeltern-Enkel-<br />
211
212<br />
Andreas Hoff<br />
Beziehungen erleben kann (Lange & Lauterbach, 1997; Lauterbach, 2002; Uhlenberg & Kirby,<br />
1998).<br />
Aber es gibt auch gegenläufige demografische Trends. Der Rückgang der Geburtenrate <strong>und</strong> das<br />
steigende Lebensalter von Frauen bei der Geburt ihres ersten K<strong>in</strong>des verr<strong>in</strong>gern die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
der parallelen Existenz vieler Generationen, da die Abstände zwischen den Generationen<br />
immer größer werden. E<strong>in</strong>e weitere Konsequenz dieser <strong>Entwicklung</strong> ist es, dass es <strong>in</strong> den<br />
nachrückenden Generationen immer weniger K<strong>in</strong>der (<strong>und</strong> dementsprechend Enkel <strong>und</strong> Urenkel)<br />
gibt. Dementsprechend haben Anzahl <strong>und</strong> Anteil k<strong>in</strong>derloser Haushalte zugenommen – <strong>und</strong><br />
zwar nicht nur <strong>in</strong> den Altersgruppen, die nach dem Auszug ihrer K<strong>in</strong>der aus dem elterlichen<br />
Haushalt alle<strong>in</strong> leben (Engstler & Menn<strong>in</strong>g, 2003).<br />
E<strong>in</strong> weiterer, von Familienpolitikern mit Sorge betrachteter Trend ist die Zunahme von Haushalten<br />
alle<strong>in</strong>lebender Menschen. Dies betrifft vor allem höheraltrige <strong>und</strong> hochaltrige Frauen,<br />
deren männliche Lebenspartner vor ihnen gestorben s<strong>in</strong>d. Diese Frauen s<strong>in</strong>d oft hilfebedürftig,<br />
während die Anzahl verwandter Personen, die als Hilfepotenzial <strong>in</strong> Frage kommen, auch aus<br />
natürlichen Gründen immer ger<strong>in</strong>ger wird (B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, 2002).<br />
Seit den 70er Jahren ist die Zahl der Ehescheidungen sprunghaft angestiegen: wurde damals nur<br />
jede sechste Ehe geschieden, so waren es im Jahre 2000 mehr als 38 Prozent aller Ehen<br />
(Engstler & Menn<strong>in</strong>g, 2003, S. 81). Parallel dazu nahm die Zahl der Eheschließungen deutlich<br />
ab (Engstler & Menn<strong>in</strong>g, 2003, S. 65). So haben sich die Formen des Zusammenlebens, zum<strong>in</strong>dest<br />
<strong>in</strong> den jüngeren Generationen, erheblich verändert. Das gilt auch für die Lebensform Familie.<br />
Seit den 70er Jahren s<strong>in</strong>d Anzahl <strong>und</strong> Anteil sogenannter „neuer“ Familienformen an allen<br />
Familienhaushalten um e<strong>in</strong> Vielfaches gestiegen. Der Anteil von familialen Haushalten mit<br />
K<strong>in</strong>dern ist seitdem rückläufig – zwischen 1972 <strong>und</strong> 2000 verr<strong>in</strong>gerte sich ihr Anteil von 69 auf<br />
55 Prozent (Engstler & Menn<strong>in</strong>g, 2003). Vor dreißig Jahren war das Monopol der ehelichen<br />
Familie mit K<strong>in</strong>dern noch ungebrochen. Obwohl sie noch immer die mit Abstand am weitesten<br />
verbreitete Familienform (mit K<strong>in</strong>dern) ist (2000: 77 Prozent), so haben sich doch <strong>in</strong>zwischen<br />
auch andere Familienformen etabliert, <strong>in</strong>sbesondere Alle<strong>in</strong>erziehende (2000: 18 Prozent) <strong>und</strong><br />
nichteheliche Lebensgeme<strong>in</strong>schaften mit K<strong>in</strong>dern (2000: 5 Prozent) (Engstler & Menn<strong>in</strong>g,<br />
2003). Die Mehrzahl Alle<strong>in</strong>erziehender geht früher oder später e<strong>in</strong>e neue Paarbeziehung e<strong>in</strong>, mit<br />
der Konsequenz der Bildung von Stieffamilien (Klar, 1996). In den letzten Jahren haben sich für<br />
solche aus mehreren „alten“ <strong>und</strong> „neuen“ Familienmitgliedern zusammengesetzte Familiennetzwerke<br />
der Begriff „Patchwork-Familie“ e<strong>in</strong>gebürgert. Es stellt sich nun die Frage, welche<br />
Konsequenzen diese <strong>Entwicklung</strong> für Familienbeziehungen im Alter hat bzw. haben wird.<br />
Obwohl die Lebensform Familie historisch betrachtet selten Konstanz erlebt hat (Nave-Herz,<br />
2004; Rosenbaum, 1982), s<strong>in</strong>d die dramatischen demografischen Veränderungen <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick<br />
auf Lebenserwartung, Fertilität, Haushaltsstrukturen, Heirats- vs. Scheidungshäufigkeit <strong>und</strong> die<br />
zunehmende Pluralisierung von Familienformen (Alle<strong>in</strong>erziehende, nicht-eheliche Lebensgeme<strong>in</strong>schaften),<br />
die wir seit Beg<strong>in</strong>n der 70er-Jahre des zwanzigsten Jahrh<strong>und</strong>erts erleben, <strong>in</strong> ihrer<br />
Häufung außergewöhnlich. Angesichts dieser Ballung verschiedener demografischer Trends<br />
muss von e<strong>in</strong>em gravierenden Strukturwandel der Familie gesprochen werden (Hill & Kopp,<br />
1995). Dieses Urteil hat auch dann Bestand, wenn man die vormalige „Monopolstellung“ der<br />
„bürgerlichen Kle<strong>in</strong>- oder Kernfamilie“ während der 50er- <strong>und</strong> 60er-Jahre als historische Aus-
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
nahmesituation <strong>und</strong> die seitdem entstehende Vielfalt von Familienformen als Prozess der historischen<br />
Normalisierung (Meyer, 1992) betrachtet.<br />
E<strong>in</strong>e der brennendsten Fragen der Alter(n)sforschung ist es, welche Konsequenzen der oben <strong>in</strong><br />
groben Zügen beschriebene demografische <strong>und</strong> familiale <strong>Wandel</strong> auf die Ausprägung von Familienbeziehungen<br />
im Alter hat bzw. haben wird. Im Vordergr<strong>und</strong> steht dabei zum e<strong>in</strong>en der Erhalt<br />
der Funktionalität der Institution Familie <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte (z.B. Unterstützung<br />
<strong>und</strong> Pflege bedürftiger Angehöriger, Reproduktion <strong>und</strong> Sozialisation nachfolgender Generationen),<br />
zum anderen die soziale Integration von Familienmitgliedern.<br />
5.2.2 Fragestellungen<br />
In diesem Abschnitt werden die Fragestellungen, die <strong>in</strong> diesem Kapitel untersucht werden sollen,<br />
hergeleitet. Ausgangspunkt s<strong>in</strong>d die beiden zentralen Betrachtungsweisen des vorliegenden<br />
Berichts, die Lebensverlaufsperspektive sowie der <strong>Wandel</strong> von Familienbeziehungen.<br />
Zwischen den Konzepten der Familie <strong>und</strong> des Lebensverlaufs besteht e<strong>in</strong> enger Zusammenhang.<br />
Dabei ist „...der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Lebensverlauf als Abfolge von Aktivitäten <strong>und</strong> Ereignissen <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Lebensbereichen <strong>und</strong> verschiedenen <strong>in</strong>stitutionalisierten Handlungsfeldern...“ (Mayer,<br />
1990, Seite 9) zu verstehen. Fast jeder Mensch bleibt im Verlauf se<strong>in</strong>es/ihres gesamten Lebens<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> bestimmtes Familiennetzwerk e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en.Vergangene Interaktionen mit Familienmitgliedern<br />
bee<strong>in</strong>flussen gegenwärtige <strong>und</strong> zukünftige Interaktionen ebenso, wie die lebenslange<br />
<strong>Entwicklung</strong> des fraglichen Individuums. Die Lebensverlaufsperspektive versetzt uns <strong>in</strong><br />
die Lage, die Variabilität von Unterstützungsmustern <strong>und</strong> die Erwartungen zukünftiger Unterstützungsleistung<br />
aus der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Historie gelebter Familien- <strong>und</strong> Unterstützungsbeziehungen<br />
abzuleiten (Fry & Keith, 1982; Jackson, Antonucci, & Gibson, 1990; Kohli, 1986). Unterschiedliche<br />
Erfahrungen zu Beg<strong>in</strong>n des Lebensverlaufs bee<strong>in</strong>flussen zudem die Ausstattung<br />
mit Bildungs- <strong>und</strong> sozio-ökonomischen Ressourcen im weiteren Lebensverlauf (Elder, 1974;<br />
Hareven & Adams, 1996). E<strong>in</strong>e Erweiterung der Lebensverlaufsperspektive, vor allem <strong>in</strong> Bezug<br />
auf die Untersuchung des Austauschs sozialer Unterstützung, stellt das sogenannte ‚Konvoi-<br />
Modell’ dar (Antonucci, 1985; Antonucci & Akiyama, 1995; Kahn & Antonucci, 1980). Das<br />
Modell des sozialen Konvois betont den kumulativen Charakter sozialer Beziehungen, die sich<br />
im Verlauf e<strong>in</strong>es Lebens im Ergebnis wiederholter Austauschbeziehungen <strong>und</strong> daraus resultierender<br />
Erfahrungen herausbilden. Soziale Beziehungen müssen <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne im Längsschnitt<br />
betrachtet werden, um ihre Natur auf der Gr<strong>und</strong>lage ihrer Entstehungsgeschichte verstehen zu<br />
können.<br />
Mit dem Vorliegen der zweiten Welle des Alterssurveys gibt es erstmals die Möglichkeit, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte im Längsschnitt zu untersuchen. Für den<br />
sechs Jahre langen Lebensabschnitt zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 können <strong>Entwicklung</strong>sverläufe<br />
nachvollzogen werden. Außerdem erleichtert die Längsschnittperspektive die Isolierung von<br />
Alterseffekten. Diese Veränderungen werden beim Vergleich von Unterschieden zwischen jüngeren<br />
<strong>und</strong> älteren Menschen identifiziert (Alw<strong>in</strong> & McCammon, 2003). Auslöser dieser Veränderung<br />
s<strong>in</strong>d vor allem biologische <strong>und</strong> psychologische, aber auch soziale Faktoren. Ziel dieser<br />
213
214<br />
Andreas Hoff<br />
Betrachtungsweise ist schlussendlich die Identifikation <strong>in</strong>tra-<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen mit<br />
zunehmendem Alter (Hoff, Tesch-Römer, Wurm, & Engstler, 2003).<br />
Trotz des im E<strong>in</strong>leitungskapitel beschriebenen gr<strong>und</strong>sätzlichen Problems, dass es bis dato ke<strong>in</strong>e<br />
perfekte Analysemethode zur Trennung von Alters-, Perioden- <strong>und</strong> Kohorteneffekten gibt (Donaldson<br />
& Horn, 1992; Glenn, 2003; Haagenaars, 1990), s<strong>in</strong>d verschiedene methodische Designs<br />
unterschiedlich gut geeignet, diese Aspekte zu erfassen. Zur Untersuchung von Alterseffekten<br />
eignet sich e<strong>in</strong> Paneldesign, also die wiederholte Befragung derselben Personen, am besten.<br />
Im Gegensatz dazu erleichtert die Untersuchung derselben Merkmale gleichaltriger, aber unterschiedlicher<br />
Personen die Isolation äußerer E<strong>in</strong>flussfaktoren. Wenn sich also die Merkmale von<br />
zwei zu unterschiedlichen Zeitpunkten befragten, gleichaltrigen Menschen unterscheiden, dann<br />
handelt es sich dabei sicherlich nicht um e<strong>in</strong>en Alterseffekt, sondern um e<strong>in</strong>en Effekt, dessen<br />
Ursache entweder <strong>in</strong> spezifischen gesellschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zum Interviewzeitpunkt<br />
(Periodeneffekt) zu suchen ist oder aber <strong>in</strong> spezifischen biografischen Bed<strong>in</strong>gungen, die<br />
sich aus der Term<strong>in</strong>ierung bestimmter Lebensereignisse oder Statuspassagen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em konkreten<br />
historischen Kontext ergeben (Kohorteneffekt).<br />
Die Zugehörigkeit von Menschen zu e<strong>in</strong>er Kohorte wird durch den Zeitbezug zu e<strong>in</strong>em bestimmten<br />
Ausgangsereignis def<strong>in</strong>iert (z.B. Geburtskohorten über das Geburtsjahr, Heiratskohorten<br />
über das Heiratsdatum). Bezogen auf e<strong>in</strong>en historischen Kontext s<strong>in</strong>d Kohorten also Menschengruppen,<br />
die <strong>in</strong>nerhalb desselben Zeitabschnitts bestimmte historische Ereignisse erlebt<br />
haben bzw. deren Leben von <strong>in</strong> demselben Zeitabschnitt erlebten historischen Ereignissen entscheidend<br />
geprägt wurde. Die Untersuchung von Kohorteneffekten zielt also auf die zeitliche<br />
Passung zwischen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Übergängen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Ereignissen (Hu<strong>in</strong><strong>in</strong>k,<br />
1995). Die E<strong>in</strong>ordnung von Individuen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e bestimmte Geburtskohorte erweist sich dabei als<br />
sehr präzise Methode der Verb<strong>in</strong>dung von <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>m Alter <strong>und</strong> historischer Zeit. Indem<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong> historischer <strong>Wandel</strong> <strong>in</strong> Beziehung zue<strong>in</strong>ander gesetzt werden,<br />
werden E<strong>in</strong>zelschicksale mit dem sozialen <strong>Wandel</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten historischen Epoche verknüpft.<br />
Die Analyse sozialen <strong>Wandel</strong>s wird am besten auf der Gr<strong>und</strong>lage wiederholter Querschnitte<br />
vorgenommen (Alw<strong>in</strong> & McCammon, 2003). Innerhalb des Alterssurveys werden dazu<br />
die beiden Querschnittsdatensätze der Basisstichprobe 1996 <strong>und</strong> der Replikationsstichprobe<br />
2002 e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Die familiensoziologische Zielstellung des Kapitels besteht dar<strong>in</strong>, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong><br />
sozialen <strong>Wandel</strong> im H<strong>in</strong>blick auf ausgewählte, zentrale Aspekte der Generationenbeziehungen<br />
im erweiterten Familiennetzwerks zu untersuchen. Im Kern geht es darum zu analysieren, welche<br />
Konsequenzen der <strong>in</strong> der Familienforschung <strong>und</strong> <strong>in</strong> der amtlichen Statistik bereits vielfach<br />
konstatierte demografische <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong>Wandel</strong> der Familienstrukturen für die Funktionalität<br />
der Familie <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte hat. Konkret werden daraus folgende vier Fragenkomplexe<br />
abgeleitet, deren Beantwortung dieses Kapitel zum Ziel hat <strong>und</strong> die sich dementsprechend<br />
<strong>in</strong> der Gliederung des Kapitels <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Unterkapiteln widerspiegeln.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Wie verbreitet s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>tergenerationale Beziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte?<br />
Gegenstand dieses Fragenkomplexes ist die Deskription <strong>in</strong>tergenerationaler Familienbeziehungen.<br />
Dabei geht es zum e<strong>in</strong>en um die Erfassung der Anzahl tatsächlich im Familienkontext<br />
nachweisbarer Generationen <strong>und</strong> zum anderen um die Verteilung e<strong>in</strong>zelner, die jeweiligen Generationen<br />
repräsentierenden Personengruppen. Auf e<strong>in</strong>em etwas höheren Abstraktionsniveau<br />
soll zudem untersucht werden, wie sich spezifische Generationenkonstellationen (zum Begriff<br />
der Generationenkonstellationen vgl. (Kohli, Künem<strong>und</strong>, Motel, & Szydlik, 2000) e<strong>in</strong>erseits mit<br />
zunehmendem Alter entwickeln <strong>und</strong> andererseits, ob nachfolgende Kohorten hier andere Muster<br />
aufweisen als die 1996 erstmals befragten Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Teilnehmer am Alterssurvey.<br />
Das konkrete Forschungs<strong>in</strong>teresse an diesen Fragen ergibt sich aus e<strong>in</strong>er kontrovers geführten<br />
Diskussion <strong>in</strong> der Familiensoziologie. Auf der e<strong>in</strong>en Seite werden dramatische Veränderungen<br />
der Generationenstruktur von Familien als Folge des demografischen <strong>Wandel</strong>s vorhergesagt.<br />
E<strong>in</strong> besonders anschauliches Beispiel ist die Prognose der sogenannten „Bohnenstangenfamilie“<br />
(Bengtson, Rosenthal, & Burton, 1990). Die Metapher der Bohnenstange wird zur Veranschaulichung<br />
des <strong>Wandel</strong>s von Familienstrukturen verwendet: die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit des Auftretens<br />
von Vier-, Fünf- oder sogar Sechsgenerationen-Familien hat gegenüber früheren Epochen zugenommen,<br />
während gleichzeitig e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tragenerationale „Verschmälerung“ (Hörl & Kytir, 1998)<br />
aufgr<strong>und</strong> von ger<strong>in</strong>geren K<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Geschwisterzahlen stattf<strong>in</strong>det. Auf der anderen Seite gehen<br />
andere davon aus, dass diese Mehrgenerationenkonstellationen nur äußerst selten <strong>und</strong> wenn,<br />
dann nur sehr kurzfristig auftreten (zum Beispiel Uhlenberg, 1995).<br />
Die Datenlage zur Verbreitung von Mehrgenerationenfamilien <strong>in</strong> Deutschland muss als unbefriedigend<br />
e<strong>in</strong>geschätzt werden. Den bahnbrechenden, allerd<strong>in</strong>gs nicht auf Repräsentativerhebungen<br />
basierenden Studien von Kruse (1983) sowie Lehr & Schneider (1983) (vgl. Kruse,<br />
1983; Lehr & Schneider, 1983) folgten die umfassenden Erhebungen des Familiensurveys, <strong>in</strong><br />
deren Fokus sich jedoch explizit die jüngeren Generationen befanden <strong>und</strong> die zudem maximal<br />
Drei-Generationen-Konstellationen erfasst haben (vgl. die Beiträge der Autoren <strong>in</strong> Bien, 1994).<br />
Auch die viel beachtete Studie von Lauterbach & Kle<strong>in</strong> (1997) ist <strong>in</strong>sofern e<strong>in</strong>geschränkt als<br />
dass sie ke<strong>in</strong>e Aussagen über Urgroßeltern treffen kann. Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (BASE)<br />
schließlich bietet zwar umfassende Daten zu Mehrgenerationenbeziehungen, allerd<strong>in</strong>gs ausschließlich<br />
aus der Sicht über 70-Jähriger <strong>und</strong> regional (auf Berl<strong>in</strong>) beschränkt (Mayer & Baltes,<br />
1999; Wagner, Schütze, & Lang, 1999). Die erste umfassende <strong>und</strong> auf b<strong>und</strong>esweit repräsentativen<br />
Daten basierende Erhebung von Generationenbeziehungen <strong>und</strong> Generationenkonstellationen<br />
im mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter war die 1996 durchgeführte erste Welle des<br />
Alterssurveys (vgl. Kohli et al., 2000; Szydlik, 2000).<br />
Die Untersuchung der Generationenbeziehungen <strong>und</strong> -konstellationen <strong>in</strong> der zweiten Welle des<br />
Alterssurveys richtet sich also zum e<strong>in</strong>en auf die Frage, ob die Ergebnisse der ersten Welle bestätigt<br />
werden können. Sollte dies nicht der Fall se<strong>in</strong>, stellt sich (im Querschnittsvergleich der<br />
beiden Wellen) die Frage, ob es sich bei solchen Divergenzen um H<strong>in</strong>weise auf e<strong>in</strong>en sich vollziehenden<br />
<strong>Wandel</strong> der Familienstrukturen handelt. Maßgeblichen E<strong>in</strong>fluss darauf haben zwei<br />
gegensätzliche demografische Trends: E<strong>in</strong>erseits nimmt mit weiterh<strong>in</strong> steigender Lebenserwartung<br />
auch die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Existenz von mehr als drei Generationen im erweiterten<br />
Familiennetzwerk zu. Urgroßeltern <strong>und</strong> Urenkel s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Seltenheit mehr. Andererseits führt<br />
215
216<br />
Andreas Hoff<br />
das steigende Alter deutscher Frauen bei der Geburt ihres ersten K<strong>in</strong>des zu e<strong>in</strong>er Vergrößerung<br />
des Abstandes zwischen den Generationen. Es ist noch unklar, welcher der beiden Trends den<br />
stärkeren Effekt auf Generationenbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte haben wird, das<br />
heißt, ob <strong>in</strong>nerhalb der erweiterten Familie e<strong>in</strong>e Zunahme oder e<strong>in</strong>e Abnahme der Prävalenz von<br />
Mehrgenerationenkonstellationen erwartet werden kann.<br />
Schließlich liegen mit der Panelstichprobe erstmals Längsschnittdaten zur Untersuchung der<br />
<strong>Entwicklung</strong> von Generationenbeziehungen über e<strong>in</strong>en Abschnitt von sechs Jahren vor. Für<br />
diesen Zeitraum können altersspezifische Veränderungen identifiziert <strong>und</strong> analysiert werden. Es<br />
wird erwartet, dass mit zunehmendem Alter der Anteil von Mehrgenerationenkonstellationen<br />
zunimmt.<br />
Wie gestaltet sich das Zusammenleben von Generationen?<br />
Im Gegensatz zum ersten Fragenkomplex liegt hier der Fokus auf Generationenkonstellationen<br />
im Zusammenleben von Menschen – also primär auf der Haushaltsebene. Hier kommen dieselben<br />
demografischen Trends zur Wirkung wie <strong>in</strong> der erweiterten Familie – aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
wird hier auf e<strong>in</strong>e nochmalige ausführliche Darstellung verzichtet. Im Gegensatz zur „multilokalen<br />
Mehrgenerationenfamilie“ (Bertram, 2000) wird für die <strong>Entwicklung</strong> von Haushaltsstrukturen<br />
jedoch erwartet, dass sich Familienhaushalte im Querschnitt durch e<strong>in</strong>e Abnahme der<br />
Generationenvielfalt auszeichnen. Dies liegt vor allem <strong>in</strong> der zunehmenden Anzahl von k<strong>in</strong>derlosen<br />
Paaren <strong>und</strong> S<strong>in</strong>gles (Enquête-Kommission, 2002) <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Pluralisierung von Lebensformen<br />
(Hu<strong>in</strong><strong>in</strong>k & Wagner, 1998) begründet. Nach dem Auszug der K<strong>in</strong>der aus dem elterlichen<br />
Haushalt dom<strong>in</strong>ieren E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalte, die sich aus den beiden Ehe- bzw. Lebenspartnern<br />
zusammensetzen. Dies gilt vor allem für Männer. Frauen h<strong>in</strong>gegen leben ab dem<br />
75. Lebensjahr häufig als Alle<strong>in</strong>stehende (Engstler & Menn<strong>in</strong>g, 2003). Dementsprechend wird<br />
das höhere Lebensalter, das aufgr<strong>und</strong> der durchschnittlich höheren Lebenserwartung von Frauen<br />
vor allem diese trifft, oft als strukturell isolierte Lebenssituation angesehen (Wagner & Wolf,<br />
2001).<br />
Im Gegensatz dazu stellt sich die Frage, ob im hohen Lebensalter der Anteil von Mehrgenerationenhaushalten<br />
wieder zunimmt, dann nämlich, wenn Hochaltrige pflegebedürftig werden <strong>und</strong><br />
von Angehörigen <strong>in</strong> häuslicher Pflege gepflegt werden müssen. In solchen Fällen ist die Koresidenz<br />
von hochaltrigen Eltern mit ihren K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> gegebenenfalls deren K<strong>in</strong>dern vorgezeichnet.<br />
In der ersten Welle des Alterssurveys wurde e<strong>in</strong>e leichte Zunahme des Anteils von Haushalten,<br />
<strong>in</strong> denen Höheraltrige mit ihren erwachsenen K<strong>in</strong>dern zusammenleben, festgestellt (Kohli et<br />
al., 2000). Pflegebedürftigkeit tritt jedoch erst ab e<strong>in</strong>em Lebensalter von 80-85 Jahren verstärkt<br />
auf. Auf der Basis der mit der zweiten Welle des Alterssurveys vorliegende Panelstichprobe<br />
kann nun untersucht werden, ob es mit zunehmendem Alter tatsächlich zu e<strong>in</strong>er Zunahme von<br />
Mehrgenerationenhaushalten kommt.<br />
Daneben kommt der Untersuchung der über den unmittelbaren Haushalt h<strong>in</strong>ausgehenden<br />
Wohnentfernung große Bedeutung zu, da diese e<strong>in</strong> entscheidender Prädiktor wechselseitiger<br />
Unterstützung ist (Lauterbach & Pillemer, 2001). Es wird erwartet, dass sich diese altersgruppenspezifisch<br />
unterschiedlich entwickelt: Für die 40- bis 60-Jährigen, die <strong>in</strong> dieser Lebensphase<br />
den Auszug ihrer K<strong>in</strong>der aus dem elterlichen Haushalt erleben, ist von e<strong>in</strong>er Vergrößerung der
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Wohnentfernung auszugehen. Im Gegensatz dazu wird für die Höher- <strong>und</strong> Hochaltrigen e<strong>in</strong>e<br />
Verr<strong>in</strong>gerung der Wohnentfernung zu ihren K<strong>in</strong>dern erwartet, da e<strong>in</strong>e stärkere Angewiesenheit<br />
der hilfebedürftigen Eltern auf die soziale Unterstützung ihrer K<strong>in</strong>der die räumliche Nähe zum<strong>in</strong>dest<br />
e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des erforderlich macht.<br />
Welchen Bedeutung haben <strong>in</strong>tergenerationale Familienbeziehungen?<br />
Familienbeziehungen gehören zu den wichtigsten sozialen Beziehungen überhaupt. Dies äußert<br />
sich sowohl <strong>in</strong> der subjektiven Bewertung der Bedeutung von Familienbeziehungen <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Gefühl enger Verb<strong>und</strong>enheit mit der eigenen Familie als auch <strong>in</strong> „objektiven“ Indikatoren<br />
der Kontakthäufigkeit oder des Anteils von Familienangehörigen am gesamten sozialen Netzwerk.<br />
Der rapide <strong>Wandel</strong> von Formen familialen Zusammenlebens könnte die wahrgenommene<br />
Bedeutung von Familie nachhaltig unterm<strong>in</strong>iert haben, entsprechend der von e<strong>in</strong>igen Familienforschern<br />
zu Beg<strong>in</strong>n der 80er-Jahre geäußerten Befürchtungen (vgl. beispielsweise Berger &<br />
Berger, 1984). E<strong>in</strong>e Vielzahl empirischer Erhebungen hat jedoch den nach wie vor äußerst hohen<br />
Stellenwert von Familie <strong>in</strong> allen Altersgruppen der deutschen Bevölkerung nachgewiesen,<br />
der demzufolge <strong>in</strong> den letzten 20 Jahren sogar noch gestiegen ist (Nave-Herz, 2004; Weick,<br />
1999). Angesichts dieser gegensätzlichen Tendenzen stellt sich die Frage nach den Konsequenzen<br />
sozialen <strong>Wandel</strong>s bei der Bewertung familialer Beziehungen durch Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte. Auf der Basis der Alterssurvey-Daten wird dieser Frage für die Menschen <strong>in</strong><br />
der zweiten Lebenshälfte nachgegangen. Dabei ist sowohl die Frage nach der <strong>Entwicklung</strong> der<br />
subjektiven E<strong>in</strong>schätzung mit zunehmendem Alter auf der Basis der Panelstichprobe, als auch<br />
die Überprüfung auf etwaige Veränderungen im Kohortenvergleich von Interesse.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Literatur verschiedene Merkmale der Beziehungsqualität diskutiert<br />
worden. Dabei handelt es sich vor allem um die subjektiv wahrgenommene Verb<strong>und</strong>enheit zwischen<br />
K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> das objektive Maß der Kontakthäufigkeit zwischen<br />
beiden Seiten andererseits. Die Ergebnisse bisheriger Studien zeigen, dass Eltern e<strong>in</strong>e größere<br />
Verb<strong>und</strong>enheit zu ihren K<strong>in</strong>dern angeben als umgekehrt (Bengtson & Kuypers, 1971; Giarusso,<br />
Stall<strong>in</strong>gs, & Bengtson, 1995; Kohli et al., 2000). Szydlik (1995, 1997) betont zudem die Wichtigkeit<br />
dieses subjektiven Indikators für das Verstehen von Generationenbeziehungen – neben<br />
den „härteren“ Indikatoren Kontakthäufigkeit <strong>und</strong> Wohnentfernung. Auf der Basis von Familiensurvey-Daten<br />
wurden für 40-70 Prozent der befragten erwachsenen K<strong>in</strong>der tägliche Kontakte<br />
zu den Eltern ermittelt (Bertram, 1995b). Die erste Welle des Alterssurveys kam zu etwas weniger<br />
optimistischen Ergebnissen – dennoch gaben mehr als drei Viertel der befragten K<strong>in</strong>der <strong>und</strong><br />
Eltern an, m<strong>in</strong>destens wöchentlich mit dem jeweiligen Gegenüber <strong>in</strong> Kontakt zu se<strong>in</strong> (Kohli et<br />
al., 2000).<br />
Diese Ergebnisse werden <strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys um die Resultate der Zweiterhebung<br />
ergänzt. Der Vergleich beider Wellen kann gegebenenfalls Aufschluss über e<strong>in</strong>en <strong>Wandel</strong><br />
der Familienbeziehungen im gesamtgesellschaftlichen Kontext geben. Darüber h<strong>in</strong>aus gilt<br />
auch hier der erstmals möglichen Beobachtung der <strong>Entwicklung</strong> von Kontakthäufigkeit <strong>und</strong> der<br />
subjektiv wahrgenommenen Verb<strong>und</strong>enheit mit zunehmendem Alter besondere Aufmerksamkeit.<br />
Es wird erwartet, dass Verb<strong>und</strong>enheit <strong>und</strong> Kontakthäufigkeit zwischen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> ihren<br />
Eltern stabil bleiben <strong>und</strong> zwar sowohl im Querschnitt als auch mit zunehmendem Alter.<br />
217
Wie unterstützen sich die Generationen <strong>in</strong>nerhalb der Familie?<br />
218<br />
Andreas Hoff<br />
E<strong>in</strong>e der zentralen Funktionen von Familien <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte besteht <strong>in</strong> der wechselseitigen<br />
Unterstützung von Familienangehörigen. E<strong>in</strong> gängiges Altersbild ist das der hilfebedürftigen<br />
Alten, die auf <strong>in</strong>formelle Unterstützung ihrer K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> anderer Familienangehöriger<br />
zur Bewältigung ihres Haushalts angewiesen s<strong>in</strong>d. Dieses Image weist älteren Menschen e<strong>in</strong>e<br />
passive Rolle als Empfänger von Unterstützung zu. Nachdem sie im Verlauf des Großteils ihres<br />
Lebens Unterstützung gegeben haben, s<strong>in</strong>d sie nun <strong>in</strong> der Rolle des Unterstützungsempfängers<br />
angelangt. Im Gegensatz zu dieser pauschalen Annahme mehren sich die H<strong>in</strong>weise aus der Forschung,<br />
dass gerade die Älteren ganz entscheidende <strong>in</strong>strumentelle Hilfen für die Jüngeren bereitstellen,<br />
etwa durch Betreuung ihrer Enkel (Lauterbach, 2002; Uhlenberg & Kirby, 1998) –<br />
<strong>und</strong> nicht zuletzt durch die Gewährung f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung helfen, deren Lebensstandard<br />
zu verbessern bzw. aufrechtzuerhalten (Motel & Szydlik, 1999). Ältere Menschen s<strong>in</strong>d also<br />
demnach noch lange <strong>in</strong> der Lage, erhaltene Unterstützung zu erwidern. Allerd<strong>in</strong>gs wird <strong>in</strong> der<br />
Forschung bis heute kontrovers diskutiert, ob auch familiale Austauschbeziehungen der – laut<br />
Gouldner (1960) universell gültigen – Reziprozitätsnorm unterliegen. E<strong>in</strong>ige Autoren sehen<br />
gerade <strong>in</strong> der fehlenden Erwartung von Reziprozität <strong>in</strong> Familienbeziehungen den entscheidenden<br />
Unterschied zu Austausch <strong>in</strong> persönlichen, nicht auf Verwandtschaft beruhenden Beziehungen<br />
(Bengtson et al., 1990; Motel & Szydlik, 1999). Andere Autoren verweisen darauf, dass<br />
familiale Austauschbeziehungen durchaus von Reziprozität gekennzeichnet s<strong>in</strong>d (beispielsweise<br />
Alt, 1994; Rossi & Rossi, 1990). Im Gegensatz zu anderen Austauschbeziehungen beruhen diese<br />
jedoch auf der Basis sehr langfristiger (teilweise lebenslanger) Verpflichtungen, so dass sie <strong>in</strong><br />
der Regel <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er nachgelagerten Reziprozität auftritt (Antonucci, 1985; Antonucci,<br />
Sherman, & Akiyama, 1996; Antonucci, 2001), die zum Teil auch über andere Familienmitglieder<br />
vermittelt wird, etwa im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Kaskadenmodells (Nye, 1979) oder der sogenannten<br />
„<strong>in</strong>tergenerational stake hypothesis“ (Giarusso et al., 1995).<br />
Der Alterssurvey bietet e<strong>in</strong>e umfassende Datenbasis zur Beschreibung von Familienbeziehungen<br />
<strong>und</strong> von Unterstützungsleistungen. Wie nicht zuletzt die Ergebnisse der ersten Welle des<br />
Alters-Survey 1996 nachdrücklich unter Beweis gestellt haben (Kohli et al., 2000), erfolgt<br />
wechselseitige Unterstützung <strong>in</strong>nerhalb der Familie vor allem <strong>in</strong>tergenerational, also zwischen<br />
den Generationen – <strong>und</strong> hierbei <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern. E<strong>in</strong> Großteil der<br />
Teilnehmer/Teilnehmer<strong>in</strong>nen des Alterssurveys nimmt ihre Unterstützungsfunktion aus e<strong>in</strong>er<br />
Doppelrolle heraus wahr: e<strong>in</strong>mal als erwachsenes K<strong>in</strong>d, zum anderen selbst als Eltern von K<strong>in</strong>dern.<br />
Der Alterssurvey stellt diesbezüglich Daten sowohl aus Eltern- als auch aus K<strong>in</strong>derperspektive<br />
zur Verfügung. E<strong>in</strong> wesentliches Ergebnis der ersten Welle des Alterssurveys war der<br />
Nachweis der aktiven Rolle der älteren Generationen bei der Unterstützung der Jüngeren (Kohli<br />
et al., 2000).<br />
In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
bereits zu e<strong>in</strong>er Veränderung der sozialen Unterstützungsfunktion der Familie<br />
geführt haben. Stärkere Belastungen von Familien aufgr<strong>und</strong> höherer Anforderungen an die Flexibilität<br />
von Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmern ohne Rücksichtnahme auf ihre Familiensituation<br />
e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> zunehmende Arbeitslosigkeit andererseits, im Kontext von Sozialstaatsreform<br />
<strong>und</strong> daraus resultierenden zusätzlichen f<strong>in</strong>anziellen Verpflichtungen, erhöhen die Notwen-
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
digkeit der Nutzung familialer Ressourcen. Leisten bzw. erhalten Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
heute weniger Unterstützung als vor sechs Jahren? Gibt es Veränderungen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der personellen Zusammensetzung des Unterstützungsnetzwerks? Erste Reduktionen bzw.<br />
Veränderungen der personellen Struktur an dieser Stelle könnten darauf h<strong>in</strong>deuten, dass die<br />
Familie künftig nicht oder nur noch e<strong>in</strong>geschränkt <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong> wird, ihre Unterstützungsfunktion<br />
zu erfüllen. Daneben soll auf der Gr<strong>und</strong>lage der Panelstichprobe untersucht werden,<br />
wie sich Leistung <strong>und</strong> Erhalt von sozialer Unterstützung mit zunehmendem Alter entwickeln. Es<br />
wird erwartet, dass Menschen <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe des Alterssurveys, also die 2002 76-<br />
bis 91-Jährigen, mehr Hilfe <strong>in</strong> Anspruch nehmen als sechs Jahre zuvor. Außerdem wird erwartet,<br />
dass die Verkle<strong>in</strong>erung der sozialen Netzwerke <strong>in</strong> dieser Altersgruppe zu e<strong>in</strong>er abnehmenden<br />
Zahl von Unterstützungspersonen geführt hat.<br />
Abschließend noch e<strong>in</strong>e Vorbemerkung zu Umfang <strong>und</strong> „Tiefe“ der Darstellungen <strong>in</strong> diesem<br />
Kapitel. Ziel dieses Kapitels war es, e<strong>in</strong>en möglichst breiten Überblick über den <strong>Wandel</strong> von<br />
Familienbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte zu geben. Daher wurde jenen Fragen der<br />
Vorzug gegeben, die <strong>in</strong> beiden Erhebungswellen umfassend erhoben wurden. Obwohl die zweite<br />
Welle des Alterssurveys die Instrumente aus Welle 1 nahezu 1 : 1 übernommen <strong>und</strong> nur an<br />
wenigen Stellen noch verfe<strong>in</strong>ert hat, gibt es punktuell auch Neuerungen, die e<strong>in</strong>e vertiefende<br />
Analyse bestimmter theoretischer Perspektiven ermöglichen. Dies gilt <strong>in</strong>sbesondere für das von<br />
Lüscher & Pillemer (1996) e<strong>in</strong>geführte Konzept der Ambivalenz von Generationenbeziehungen<br />
(Lüscher & Pillemer, 1996; Lüscher, 1999; 2000), das im Rahmen dieses Kapitels jedoch nicht<br />
berücksichtigt wurde. Es steht außer Frage, dass auf dieser Basis noch e<strong>in</strong>e ganze Reihe von<br />
vertiefenden Analysen möglich <strong>und</strong> s<strong>in</strong>nvoll s<strong>in</strong>d.<br />
Der Aufbau des vorliegenden Kapitels orientiert sich an diesen vier zentralen Fragestellungen,<br />
die im Folgenden <strong>in</strong> dieser Reihenfolge abgehandelt werden. Dabei entspricht der erste Fragenkomplex<br />
„Verbreitung <strong>in</strong>tergenerationaler Beziehungen“ dem unmittelbar folgenden Unterkapitel<br />
3, die zweite Fragestellung „Zusammenleben von Generationen“ Unterkapitel 4, die dritte<br />
„Bedeutung <strong>in</strong>tergenerationaler Familienbeziehungen“ Unterkapitel 5 <strong>und</strong> schließlich das sechste<br />
Unterkapitel der vierten zentralen Fragestellung „<strong>in</strong>tergenerationale Unterstützung“.<br />
5.3 Generationenkonstellationen im multilokalen Familienverb<strong>und</strong><br />
Generationenbeziehungen werden vor allem im familiären Kontext gelebt. In westlichen Industrienationen<br />
der Gegenwart ist die sogenannte „multilokale Mehrgenerationenfamilie“ (Bertram,<br />
1995a) der Normalfall, d.h. die Angehörigen e<strong>in</strong> <strong>und</strong> derselben Familie, leben <strong>und</strong> wirtschaften<br />
<strong>in</strong> mehreren Haushalten, oftmals durch größere räumliche Entfernungen vone<strong>in</strong>ander getrennt.<br />
Das Konzept e<strong>in</strong>es familialen „Netzwerks“ wird dementsprechend der Lebenswirklichkeit der<br />
erweiterten Familie am besten gerecht. Dementsprechend wird im folgenden Abschnitt das<br />
Konzept der Generationenkonstellationen auf das gesamte Netzwerk der an mehreren Orten<br />
lebenden Familienmitglieder angewandt. Das Unterkapitel beg<strong>in</strong>nt mit e<strong>in</strong>er Bestandsaufnahme<br />
der gelebten Generationenbeziehungen <strong>in</strong> der erweiterten Familie. Im Anschluss daran werden<br />
die im Familienverb<strong>und</strong> prävalenten Generationenkonstellationen untersucht.<br />
219
5.3.1 Generationen <strong>in</strong> der erweiterten Familie<br />
220<br />
Andreas Hoff<br />
Mit Hilfe des Alterssurveys können sechs Generationen identifiziert <strong>und</strong> Transferleistungen<br />
zwischen fünf dieser Generationen beschrieben werden 1 . Die <strong>in</strong> diesem Abschnitt dargestellten<br />
familialen Generationenkonstellationen schließen folgende Generationen e<strong>in</strong>: (1) Großeltern, (2)<br />
Eltern (e<strong>in</strong>schließlich Schwiegereltern, Onkel/Tanten), (3) Interviewteilnehmer/Interviewteilnehmer<strong>in</strong>nen<br />
(e<strong>in</strong>schließlich Lebenspartner/Lebenspartner<strong>in</strong>nen, Geschwister, Schwäger<strong>in</strong>nen/Schwager,<br />
Cous<strong>in</strong>s/Cous<strong>in</strong>en), (4) K<strong>in</strong>der (e<strong>in</strong>schließlich Nichten/Neffen), (5) Enkel <strong>und</strong><br />
(6) Urenkel. Abbildung 5.1 auf dieser Seite veranschaulicht die prozentuale Verteilung der für<br />
die jeweiligen Generationen namensgebenden Gruppen Familienangehöriger 2 , die zugleich jeweils<br />
die wesentlichen Interaktionspartner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -partner <strong>in</strong> der <strong>in</strong>tergenerationalen Interaktion<br />
<strong>und</strong> Kommunikation s<strong>in</strong>d.<br />
Der Vergleich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 (vgl. Abbildung 5.1 unten) bestätigt, dass sich die erweiterte<br />
Familie <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte im H<strong>in</strong>blick auf ihre personelle Zusammensetzung<br />
vor allem durch Stabilität auszeichnet. Der Kohortenvergleich ergibt ke<strong>in</strong>e größeren Veränderungen.<br />
Lediglich für Väter e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> Enkel andererseits kann im Vergleich zu 1996 e<strong>in</strong><br />
leichter Anstieg von drei Prozent konstatiert werden. Zahlenmäßig dom<strong>in</strong>ierend s<strong>in</strong>d erwartungsgemäß<br />
zum e<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> zum anderen Ehe- bzw. Lebenspartner.<br />
Abbildung 5.1:<br />
Existenz ausgewählter Familienmitglieder, 1996 <strong>und</strong> 2002 (<strong>in</strong> Prozent) 3<br />
Familienmitglieder<br />
(1) Großeltern<br />
(2) Vater<br />
(2) Mutter<br />
(3) Partner<br />
(4) K<strong>in</strong>der<br />
(5) Enkel<br />
(6) Urenkel<br />
4,9<br />
5<br />
5,2<br />
6<br />
16,6<br />
19,6<br />
21,3<br />
24,3<br />
36,5<br />
36,2<br />
79,8<br />
78,1<br />
85,6<br />
84,2<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Prozent<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.838) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 3.084), gewichtete Daten<br />
1996<br />
2002<br />
1 Von der jüngsten erfassten Generation – Urenkel – wurde lediglich deren Vorhandense<strong>in</strong> erfasst.<br />
2 Eltern wurden separat nach Vater <strong>und</strong> Mutter aufgeführt, wobei <strong>in</strong> diesen Kategorien neben den biologischen auch<br />
Adoptiv-, Pflege- <strong>und</strong> Stiefeltern berücksichtigt wurden.<br />
3 Mehrfachnennungen möglich
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Nahezu 85 Prozent der Befragten gaben an, noch lebende K<strong>in</strong>der zu haben. Knapp 80 Prozent<br />
der Befragten lebten mit ihrem Partner zusammen. Mehr als e<strong>in</strong> Drittel der Teilnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Teilnehmer am Alterssurvey berichtete zudem, dass zum<strong>in</strong>dest ihre Mutter noch am Leben<br />
ist, während der Anteil derer, die gleiches über ihre Väter sagen können, um die Hälfte ger<strong>in</strong>ger<br />
ist. Die beiden <strong>in</strong> der Zeit „am weitesten von der Zielperson entfernten“ Generationen – die der<br />
Großeltern e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> der Urenkel andererseits – treten naturgemäß am wenigsten <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung.<br />
Es versteht sich von selbst, dass mit zunehmendem Alter <strong>in</strong>nerhalb des Familienverb<strong>und</strong>s e<strong>in</strong>e<br />
Verschiebung zugunsten jüngerer Familienangehöriger erfolgt. Während beispielsweise bei<br />
mehr als drei Viertel der befragten 40- bis 54-Jährigen die Eltern noch lebten, so waren das bei<br />
den 55- bis 69-Jährigen nur noch 20 Prozent. Bemerkenswert ist, dass es 2002 auch unter den<br />
70- bis 85-Jährigen noch sieben Personen gab, deren Mutter noch am Leben ist.<br />
Beim Vergleich der e<strong>in</strong>zelnen Altersgruppen spiegeln sich die im Verlauf des demografischen<br />
<strong>Wandel</strong>s abnehmenden Geburtenraten wider: die älteren Geburtskohorten haben durchschnittlich<br />
mehr K<strong>in</strong>der als die jüngeren 4 . Dieses Ergebnis wird durch die Betrachtung nach Altersgruppen<br />
bestätigt: Betrug die durchschnittliche K<strong>in</strong>derzahl <strong>in</strong> der ältesten Alterskategorie noch<br />
2,08 (SD: 1,5), so hat sich diese auf 1,98 (SD: 1,21) <strong>in</strong> der mittleren bzw. 1,63 (SD: 1,12) <strong>in</strong> der<br />
jüngsten Altersklasse reduziert. Den größten Anteil unter den Familien mit K<strong>in</strong>dern im Alterssurvey<br />
2002 nehmen mit mehr als 38 Prozent Zweik<strong>in</strong>dfamilien e<strong>in</strong>, gefolgt von E<strong>in</strong>k<strong>in</strong>dfamilien<br />
(22,8 Prozent) <strong>und</strong> Dreik<strong>in</strong>dfamilien (16,7 Prozent). Mehr als drei K<strong>in</strong>der haben weniger als<br />
acht Prozent der Deutschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte, mehr als vier K<strong>in</strong>der haben nur drei<br />
Prozent der Befragten. Die maximale K<strong>in</strong>derzahl lag bei 14 K<strong>in</strong>dern.<br />
Angesichts der aus der amtlichen Statistik bekannten Geburtenentwicklung <strong>in</strong> den jüngeren<br />
Geburtskohorten kann davon ausgegangen werden, dass Menschen, die heute zwischen 40 <strong>und</strong><br />
85 Jahre alt s<strong>in</strong>d, über potentiell größere familiale Netzwerke verfügen als die folgenden Generationen.<br />
Darauf deutet bereits heute die Abnahme der K<strong>in</strong>derzahl im Altersgruppenvergleich<br />
des Alterssurveys 2002 h<strong>in</strong>.<br />
5.3.2 Generationenkonstellationen im multilokalen Familienverb<strong>und</strong><br />
Diesem allgeme<strong>in</strong>en Überblick über prozentuelle Verteilungen ausgewählter Familienmitglieder<br />
folgt nun die differenzierte Darstellung der Generationenkonstellationen im Familienverb<strong>und</strong>,<br />
zunächst wiederum differenziert nach Altersgruppen (vgl. Tabelle 5.1 unten). In der Regel leben<br />
die Deutschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> Familien mit drei Generationen. Dies betrifft <strong>in</strong>sgesamt<br />
mehr als 60 Prozent der Befragten. Auch e<strong>in</strong>e altersgruppendifferenzierte Betrachtung<br />
kommt zu demselben Ergebnis – Drei-Generationen-Konstellationen dom<strong>in</strong>ieren <strong>in</strong> allen Altersgruppen.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs nimmt diese Dom<strong>in</strong>anz mit steigendem Alter ab: entsprechen noch<br />
4 Die e<strong>in</strong>zige Ausnahme von dieser Regel bildet die Kohorte der 1921-26 Geborenen, deren Familiengründungspläne<br />
durch den Zweiten Weltkrieg negativ bee<strong>in</strong>flusst wurden. Angehörige dieser Kohorte haben ebenfalls deutlich weniger<br />
K<strong>in</strong>der.<br />
221
222<br />
Andreas Hoff<br />
mehr als drei Viertel der Familien 40- bis 54-Jähriger diesem Modell, so reduziert sich ihr Anteil<br />
auf 55 Prozent bei den 55- bis 69-Jährigen <strong>und</strong> schließlich nur noch 38 Prozent bei den 70-<br />
bis 85-Jährigen (vgl. nachstehende Tabelle 5.1).<br />
Tabelle 5.1:<br />
Generationenkonstellationen im Familienverb<strong>und</strong> nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
40-54 55-69 70-85 40-85<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
1-Generationen-Konstellation 0,6 0,5 3,5 2,1 3,9 5,7 2,3 2,2<br />
2-Generationen-Konstellation 6,9 8,3 21,5 23,2 33,4 34,4 17,0 19,2<br />
3-Generationen-Konstellation 80,2 78,2 54,2 54,5 40,0 38,0 63,5 61,2<br />
4-Generationen-Konstellation 12,1 13,0 19,3 19,4 20,8 20,7 16,3 16,9<br />
5-Generationen-Konstellation 0,2 - 1,4 0,7 1,9 1,2 1,0 0,5<br />
N 1.719 1.096 1.779 1.004 1.340 984 4.838 3.084<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.838) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 3.084), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede p < .05.<br />
In Abhängigkeit vom Alter variiert auch die Zusammensetzung dieser Drei-Generationen-<br />
Familien: In der jüngsten Altersgruppe gehören neben Angehörigen der eigenen Generation die<br />
Generationen der K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> der Eltern zur Familie. In der mittleren Altersgruppe hat deren<br />
Anteil rapide abgenommen, gleichzeitig ist der Anteil e<strong>in</strong>er Generationenkonstellation mit K<strong>in</strong>dern<br />
<strong>und</strong> Enkeln gestiegen, welcher <strong>in</strong> der Gruppe der 70- bis 85-Jährigen klar dom<strong>in</strong>iert.<br />
Daneben gibt es e<strong>in</strong>e Reihe von Menschen, <strong>in</strong> deren Familiennetzwerken noch mehr Generationen<br />
leben. Knapp 17 Prozent der Teilnehmer/Teilnehmer<strong>in</strong>nen am Alterssurvey 2002 geben an,<br />
<strong>in</strong> Familien mit vier Generationen zu leben – e<strong>in</strong>ige wenige (n= 15) leben sogar <strong>in</strong> Fünf-<br />
Generationen-Familien. Im Gegensatz zu Drei-Generationen-Konstellationen nimmt der Anteil<br />
von Vier- <strong>und</strong> Fünf-Generationen-Konstellationen mit steigendem Alter zu. Mehr als e<strong>in</strong> Fünftel<br />
der 70- bis 85-Jährigen leben <strong>in</strong> Vier-Generationen-Familien.<br />
Doch auch der Anteil generationenhomogener Familiennetzwerke wächst mit steigendem Alter.<br />
E<strong>in</strong> Fünftel der Befragten gibt an, lediglich e<strong>in</strong>e andere als die eigene Generation <strong>in</strong>nerhalb des<br />
erweiterten Familienkreises zu haben. Dabei handelt es sich vorwiegend um K<strong>in</strong>der. Während<br />
e<strong>in</strong>e Zwei-Generationen-Konstellation nur e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>derheit der 40- bis 54-Jährigen betrifft<br />
(weniger als 10 Prozent), steigt der Anteil von Zwei-Generationen-Konstellationen bei den<br />
70- bis 85-Jährigen auf mehr als e<strong>in</strong> Drittel. Nur Angehörige der eigenen Generation zu haben<br />
gaben 2,4 Prozent der Teilnehmer/<strong>in</strong>nen am Alterssurvey 2002 an, wobei auch hier deren Anteil<br />
<strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe mit 5,7 Prozent am höchsten ist.<br />
Vergleicht man die beiden Erhebungszeitpunkte 1996 <strong>und</strong> 2002, so ist festzuhalten, dass sich<br />
die Generationenkonstellationen <strong>in</strong>nerhalb des Beobachtungszeitraums durch große Stabilität<br />
auszeichnen. Im Detail zeichnet sich jedoch e<strong>in</strong>e leichte Verschiebung von Drei-Generationen-<br />
Konstellationen h<strong>in</strong> zu Zwei-Generationen-Konstellationen ab. So hat sich <strong>in</strong>nerhalb des kurzen
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Zeitraums von nur sechs Jahren seit der Ersterhebung der Anteil von Drei-Generationen-<br />
Familien von 63,5 auf 61,2 Prozent verr<strong>in</strong>gert, während gleichzeitig der Anteil von Zwei-<br />
Generationen-Familien von 17 auf 19,2 Prozent angestiegen ist. Diese Veränderung ist vor allem<br />
der Tatsache geschuldet, dass der Anteil von Drei-Generationen-Konstellationen mit K<strong>in</strong>dern<br />
<strong>und</strong> Eltern deutlich abgenommen hat.<br />
Im Folgenden erfolgt e<strong>in</strong>e nach Geburtskohorten differenzierte Analyse mit dem Ziel, diese im<br />
Altersgruppenvergleich identifizierte leichte Verschiebung h<strong>in</strong> zu Zwei-Generationen-<br />
Konstellationen genauer lokalisieren zu können. Wegen des Sechsjahres-Abstands der beiden<br />
Erhebungszeitpunkte 1996 <strong>und</strong> 2002 s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>en trennscharfen Kohortenvergleich die Befragten<br />
jeweils <strong>in</strong> sechs Jahre umfassende Alters- bzw. Geburtsjahrgangsgruppen unterteilt worden.<br />
Mit dieser Gruppenbildung wird verh<strong>in</strong>dert, dass e<strong>in</strong>zelne Geburtsjahrgänge zu beiden Messzeitpunkten<br />
der gleichen Altersgruppe angehören (vgl. die Ausführungen im Methodenkapitel 2<br />
<strong>in</strong> diesem Band, S. 7-8). Die detaillierten Ergebnisse des Kohortenvergleichs der Generationenkonstellationen<br />
<strong>in</strong> der erweiterten Familie können der Tabelle 5.2 entnommen werden.<br />
Die Darstellung <strong>in</strong> Tabelle 5.2 ersche<strong>in</strong>t auf den ersten Blick sehr komplex. Beim genaueren<br />
H<strong>in</strong>sehen zeichnen sich jedoch e<strong>in</strong>ige Unterschiede zwischen Welle 1 <strong>und</strong> Welle 2 ab. Auch<br />
hier lässt sich die herausragende Bedeutung von Drei-Generationen-Konstellationen <strong>in</strong> den Familien<br />
der zweiten Lebenshälfte nachweisen. Wie schon beim Altersgruppenvergleich <strong>in</strong> Tabelle<br />
5.1 beobachtet, nimmt diese zu beiden Erhebungszeitpunkten mit zunehmendem Alter kont<strong>in</strong>uierlich<br />
ab. Im Folgenden steht die Identifikation des mit dem Alterseffekt konf<strong>und</strong>ierten Kohorteneffekts<br />
im Mittelpunkt des Interesses.<br />
Tabelle 5.2<br />
Altersspezifische Generationenkonstellationen <strong>in</strong> der erweiterten Familie nach<br />
Geburtskohorten, 1996 <strong>und</strong> 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
1-Generation-<br />
Konstellation<br />
2-Generation-<br />
Konstellation<br />
3-Generation-<br />
Konstellation<br />
4-Generation-<br />
Konstellation<br />
5-Generation-<br />
Konstellation<br />
Alter 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
40-45 0,5 0,6 4,0 6,4 78,8 74,3 15,6 18,7 0,1 -<br />
46-51 0,4 0,4 6,3 7,2 84,6 83,7 8,4 8,7 0,4 -<br />
52-57 1,3 0,7 14,2 13,8 69,8 73,8 14,5 11,6 0,2 -<br />
58-63 3,2 1,4 22,0 20,7 54,7 57,1 18,8 20,1 1,2 (0,8)<br />
64-69 5,4 3,3 26,8 29,1 43,5 46,9 21,8 20,0 2,5 (0,7)<br />
70-75 4,2 4,8 32,4 39,6 41,3 39,3 19,7 15,0 2,3 (1,2)<br />
76-81 3,3 7,7 36,3 29,8 38,1 38,2 20,5 23,5 1,8 (0,7)<br />
N 107 81 852 609 2.800 1.747 822 525 63 20<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.644) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 2.982), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede p < .05 außer Fünf-Generationen-Konstellationen (nicht signifikant).<br />
223
224<br />
Andreas Hoff<br />
Zwei Veränderungen fallen <strong>in</strong>s Auge: 1.) Die Dom<strong>in</strong>anz von Drei-Generationen-<br />
Konstellationen <strong>in</strong> den familialen Netzen hat sich seit 1996 <strong>in</strong> den mittleren Geburtskohorten<br />
des Alterssurveys, also bei den 52- bis 69-Jährigen, noch verstärkt. Am stärksten ausgeprägt ist<br />
dieser Kohorteneffekt <strong>in</strong> der Altersgruppe der 52- bis 57-Jährigen im Jahre 2002. Wie <strong>in</strong> Tabelle<br />
5.2 <strong>in</strong> der Spalte „Drei-Generationen-Konstellation“ zu erkennen ist, verzeichnen diese Generationen-Konstellationen<br />
<strong>in</strong> den genannten Geburtskohorten e<strong>in</strong>en deutlichen Zuwachs gegenüber<br />
den sechs Jahre zuvor Geborenen. In diesem Anstieg spiegelt sich vor allem die bessere Ges<strong>und</strong>heit<br />
der Eltern der Befragten wider. Allerd<strong>in</strong>gs zeichnet sich bereits für die nachrückenden<br />
Geburtskohorten, die 2002 40- bis 45-Jährigen, e<strong>in</strong> Rückgang des Anteils von Drei-<br />
Generationen-Konstellationen ab. Aufgr<strong>und</strong> der weiter steigenden Lebenserwartung ist von<br />
e<strong>in</strong>er zunehmenden Verbreitung von Vier-Generationen-Konstellationen auszugehen. 2.) Zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 kam es zu e<strong>in</strong>em deutlichen Anstieg von Zwei-Generationen-<br />
Konstellationen <strong>in</strong> den ältesten Kohorten. So hat ihr Anteil bei den im Jahre 2002 70- bis 75-<br />
Jährigen gegenüber von 1996 um mehr als 7 Prozent auf nunmehr knapp 40 Prozent stark zugenommen.<br />
Im Ergebnis dieses starken Anstiegs erreichen Zwei-Generationen-Konstellationen bei<br />
dieser Kohorte den gleichen Verbreitungsgrad wie Drei-Generationen-Konstellationen. Umgekehrt<br />
hat sich der Anteil von Zwei-Generationen-Konstallationen <strong>in</strong> der ältesten Kohorte der 76-<br />
bis 81-Jährigen um 6,5 Prozent verr<strong>in</strong>gert. Diese Veränderungen werden durch zwei unterschiedliche<br />
Geburtskohorten verursacht: der deutliche Anstieg bei den 70- bis 75-Jährigen durch<br />
die Kohorte der 1927-32 Geborenen <strong>und</strong> die der 1921-26 Geborenen, bei denen der Anteil von<br />
Zwei-Generationen-Konstellationen <strong>in</strong>nerhalb der letzten sechs Jahre erstaunlich stabil geblieben<br />
ist.<br />
In e<strong>in</strong>em Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass sich die Generationen-Konstellationen <strong>in</strong> der<br />
zweiten Lebenshälfte durch e<strong>in</strong> hohes Maß an Kont<strong>in</strong>uität auszeichnen. Weder die gestiegene<br />
Lebenserwartung noch der Trend zunehmender Abstände zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Generationen<br />
aufgr<strong>und</strong> des zunehmenden Alters von Frauen bei der Geburt ihres ersten K<strong>in</strong>des schlägt sich <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Veränderung der Generationen-Konstellationen der 40- bis 85-Jährigen nieder. In ger<strong>in</strong>gfügigem<br />
Umfang konnte e<strong>in</strong>e Verschiebung des Anteils von Drei-Generationen-Konstellationen<br />
h<strong>in</strong> zu Zwei-Generationen-Konstellationen beobachtet werden (p < .01). Ob es sich dabei um<br />
e<strong>in</strong>en ersten H<strong>in</strong>weis auf familienstrukturelle Wandlungsprozesse oder aber um e<strong>in</strong>e zufällige<br />
Abweichung handelt, kann erst nach dem Vorliegen e<strong>in</strong>es weiteren Messzeitpunkts entschieden<br />
werden.<br />
Nachdem wir e<strong>in</strong>en Überblick über die Verteilung von E<strong>in</strong>-, Zwei, Drei- <strong>und</strong> Mehr-<br />
Generationenhaushalten <strong>in</strong> den Familien von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte gewonnen<br />
haben, gilt unsere Aufmerksamkeit den <strong>Entwicklung</strong>strends auf der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ebene. Abbildung<br />
5.2 unten gibt auf Basis der Panelstichprobe e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die <strong>Entwicklung</strong>sverläufe<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002, jeweils differenziert nach Altersgruppen. Die l<strong>in</strong>ke Grafik enthält die<br />
<strong>Entwicklung</strong>sverläufe für die jüngste Altersgruppe im Alterssurvey, also die 1996 40- bis 54-<br />
Jährigen <strong>und</strong> dementsprechend 2002 46- bis 60-Jährigen, gefolgt von der mittleren (55-69 bzw.<br />
61-75 Jahre) <strong>und</strong> der ältesten Altersgruppe (70-85 bzw. 76-91 Jahre). Noch e<strong>in</strong>mal zur Er<strong>in</strong>nerung:<br />
Es wird erwartet, dass mit zunehmendem Alter der Anteil von Mehr-Generationen-<br />
Konstellationen zunimmt.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Abbildung 5.2:<br />
<strong>Entwicklung</strong> von Generationen-Konstellationen im familialen Netz nach Altersgruppen,<br />
1996-2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Jüngste Altersgr. 46-60 (2002)<br />
1996 2002<br />
1 Generation 2 Generation 3 Generation<br />
4 Generation 5 Generation<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Mittlere Altersgr. 61-75 (2002)<br />
1996 2002<br />
1 Generation 2 Generation 3 Generation<br />
4 Generation 5 Generation<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996 <strong>und</strong> 2002 (n= 1.515), gewichtete Daten<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Älteste Altersgr. 76-91 (2002)<br />
1996 2002<br />
1 Generation 2 Generation 3 Generation<br />
4 Generation 5 Generation<br />
Beg<strong>in</strong>nen wir die Betrachtung mit der l<strong>in</strong>ken Grafik, also der jüngsten Altersgruppe im Alterssurvey.<br />
Bei e<strong>in</strong>em Blick auf diese Abbildung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em ersten Vergleich mit den <strong>Entwicklung</strong>sverläufen<br />
<strong>in</strong> den beiden älteren Altersgruppen fällt auf, dass sich die jüngste Altersgruppe<br />
durch e<strong>in</strong> hohes Maß an Stabilität auszeichnet – seit 1996 hat es nur moderate Veränderungen<br />
gegeben, was sich im vergleichsweise flachen Kurvenverlauf widerspiegelt. In dieser Lebensphase<br />
dom<strong>in</strong>ieren Drei-Generationen-Konstellationen klar – daran hat sich auch sechs Jahre<br />
später nichts geändert. Obwohl Drei-Generationen-Konstellationen auch 2002 e<strong>in</strong>deutig vorherrschen,<br />
zeichnet sich dennoch seit 1996 e<strong>in</strong> Alterseffekt ab: Der Anteil von Drei- <strong>und</strong> von<br />
Vier-Generationen-Konstellationen ist seit 1996 leicht zurückgegangen, gleichzeitig ist der Anteil<br />
von Zwei-Generationen-Konstellationen etwas gestiegen. Damit haben Vier-Generationen-<br />
Konstellationen ihren Stellenwert als die am zweithäufigsten verbreitete Generationen-<br />
Konstellation an Zwei-Generationen-Konstellationen verloren.<br />
In der mittleren Altersgruppe (mittlere Grafik) lassen sich h<strong>in</strong>gegen steilere <strong>Entwicklung</strong>sverläufe<br />
beobachten. Der bereits <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe beobachtete Alterseffekt e<strong>in</strong>er Zunahme<br />
des Anteils von Zwei-Generationen-Konstellationen bei paralleler Abnahme von Drei-<br />
<strong>und</strong> Vier-Generationen-Konstellationen kann <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe e<strong>in</strong>deutig identifiziert<br />
werden. Das äußert sich vor allem <strong>in</strong> dem steilen Anstieg des Anteils von Zwei-<br />
Generationen-Familien. Ursache für diese <strong>Entwicklung</strong> ist <strong>in</strong> den meisten Fällen der Tod der<br />
Eltern. In der Konsequenz hat sich der Anteil von Drei- <strong>und</strong> Vier-Generationen-Konstellationen<br />
spürbar verr<strong>in</strong>gert. Drei-Generationen-Konstellationen s<strong>in</strong>d zwar nach wie vor am weitesten<br />
verbreitet, ihr Anteil hat sich jedoch seit 1996 deutlich verr<strong>in</strong>gert.<br />
Erst bei den 2002 76- bis 91-Jährigen (rechte Grafik) zeichnet sich e<strong>in</strong>e gegenläufige <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> Gestalt e<strong>in</strong>er deutlichen Zunahme von Vier-Generationen-Konstellationen ab. Bemerkenswert<br />
ist zudem die Verdoppelung des Anteils von E<strong>in</strong>-Generationen-Konstellationen, wenn<br />
auch auf niedrigem absoluten Niveau. Hier zeichnet sich e<strong>in</strong>e Zweiteilung der weiteren Ent-<br />
225
226<br />
Andreas Hoff<br />
wicklung ab – je nachdem, ob es <strong>in</strong> der Familie K<strong>in</strong>der gibt oder nicht. Während sich <strong>in</strong> Familien<br />
mit K<strong>in</strong>dern (<strong>und</strong> Enkeln, ggf. Urenkeln) Mehr-Generationen-Konstellationen entwickeln,<br />
wachsen <strong>in</strong> Familien K<strong>in</strong>derloser ke<strong>in</strong>e neuen Generationen nach 5 .<br />
Die Ergebnisse aus der Längsschnittperspektive zusammenfassend kann also festgestellt werden,<br />
dass sich Generationen-Konstellationen <strong>in</strong> der erweiterten Familie mit zunehmendem Alter<br />
den zuvor formulierten Erwartungen entsprechend entwickelt haben. Der Anteil von Mehr-<br />
Generationen-Konstellationen nimmt mit zunehmendem Alter zu. Dieser Effekt kommt allerd<strong>in</strong>gs<br />
erst bei hochaltrigen Menschen zum Tragen.<br />
5.4 Zusammenleben der Generationen<br />
Wie im vorangegangenen Kapitel diskutiert, hat sich <strong>in</strong> den 90er-Jahren das Konzept der multilokalen<br />
Familie (Bertram, 1995a) durchgesetzt, welches bewusst den Blick auf den erweiterten<br />
Familienverb<strong>und</strong> richtet. Dieser besteht aus mehreren, geographisch vone<strong>in</strong>ander getrennten<br />
Haushalten. In diesem Unterkapitel ist der Fokus auf das unmittelbare Zusammenleben <strong>und</strong><br />
Zusammenwirtschaften von Generationen gerichtet. Untersuchungsgegenstände s<strong>in</strong>d also die<br />
Haushalte von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf den<br />
Kern <strong>in</strong>tergenerationaler Beziehungen gerichtet, nämlich auf Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen. Der<br />
detaillierten Betrachtung von Haushaltsbeziehungen logisch vorgelagert ist jedoch die Frage<br />
nach der Wohnentfernung zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern. Geographische Nähe bzw. Ferne hat<br />
e<strong>in</strong>en entscheidenden E<strong>in</strong>fluss auf qualitative <strong>und</strong> quantitative Merkmale von Generationenbeziehungen<br />
(Szydlik, 1995) <strong>und</strong> auf die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit wechselseitiger Unterstützung (Lauterbach<br />
& Pillemer, 2001). Befragte mit K<strong>in</strong>dern erleben diese besondere Beziehung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Doppelrolle – zum e<strong>in</strong>en als K<strong>in</strong>d alternder Eltern <strong>und</strong> zum anderen als Vater oder Mutter eigener<br />
K<strong>in</strong>der. Beiden Perspektiven wird <strong>in</strong> diesem Unterkapitel Rechnung getragen.<br />
<strong>Sozialer</strong> <strong>Wandel</strong> im gesamten Familiennetzwerk muss sich auch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Elementen, den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Haushalten, <strong>in</strong> Form veränderter Haushaltsstrukturen niederschlagen. Dementsprechend<br />
bezieht sich die Untersuchung sozialen <strong>Wandel</strong>s von Familienstrukturen <strong>und</strong> Familienfunktionen<br />
<strong>in</strong> diesem Kapitel auf die Haushaltsebene. Zunächst werden Veränderungen der Haushaltsgröße<br />
betrachtet, bevor die Aufmerksamkeit auf Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> <strong>Wandel</strong> von Konstellationen<br />
<strong>in</strong>nerhalb von Haushalten gerichtet wird.<br />
5.4.1 Wohnentfernung zwischen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern<br />
Die <strong>in</strong> diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse betreffen nur die Befragten des Alterssurveys,<br />
die K<strong>in</strong>der haben. Das ist die große Mehrheit der Befragten von immerh<strong>in</strong> 86 Prozent (2002).<br />
Damit hat sich der Anteil von K<strong>in</strong>derlosen gegenüber der Ersterhebung im Jahre 1996, als 87<br />
Prozent der Befragten K<strong>in</strong>der hatten, nicht merklich erhöht.<br />
5 Das trifft natürlich nur auf solche Familien zu, <strong>in</strong> denen es überhaupt ke<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>der gibt.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Die Beziehung zu den eigenen Eltern ist, neben der zu den eigenen K<strong>in</strong>dern, die stärkste <strong>und</strong><br />
dauerhafteste B<strong>in</strong>dung, die e<strong>in</strong> Mensch im Verlauf se<strong>in</strong>es Lebens e<strong>in</strong>geht. Sie ist aus e<strong>in</strong>er Vielzahl<br />
von Gründen e<strong>in</strong>zigartig <strong>und</strong> für das eigene Leben außerordentlich wichtig. Das schließt<br />
emotionale, biografisch-identitätsbildende Beziehungsaspekte ebenso e<strong>in</strong> wie normative <strong>und</strong><br />
funktionale. Die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit der Leistung bzw. des Erhalts von <strong>in</strong>formeller Unterstützung<br />
nimmt mit abnehmender Wohnentfernung zu (Marbach, 1994). Natürlich leben Eltern <strong>und</strong><br />
K<strong>in</strong>der oft nicht am selben Ort – was von Rosenmayr <strong>und</strong> Köckeis (1965) bereits vor 40 Jahren<br />
so treffend mit dem Konzept der „Intimität aus der Ferne“ (Rosenmayr & Köckeis, 1965) bezeichnet<br />
wurde. Moderne Telekommunikation hat auch zu e<strong>in</strong>er Aufweichung des l<strong>in</strong>earen Zusammenhangs<br />
zwischen Wohnentfernung <strong>und</strong> Kontakthäufigkeit geführt. Nichtsdestotrotz erhöht<br />
e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Wohnentfernung nach wie vor die Möglichkeit wechselseitiger Interaktion<br />
<strong>und</strong> Kommunikation <strong>und</strong> eröffnet die Möglichkeit spontaner oder anderweitig kurzfristiger<br />
Kontakte. So ist e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Wohnentfernung e<strong>in</strong>e wichtige, aber nicht unabd<strong>in</strong>gbare Bed<strong>in</strong>gung<br />
für die emotionale Enge der Beziehung (Szydlik, 1995).<br />
Wohnentfernung zu den K<strong>in</strong>dern<br />
Die Wohnentfernung zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern ist im Lebensverlauf beträchtlichen Veränderungen<br />
unterworfen: dem Leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Haushalt folgt der Aus- <strong>und</strong> Wegzug<br />
der K<strong>in</strong>der. Der Alterssurvey vere<strong>in</strong>t Menschen <strong>in</strong> unterschiedlichen Lebensphasen: viele Untersuchungsteilnehmer/Untersuchungsteilnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe haben gerade<br />
erst den Auszug ihrer K<strong>in</strong>der erlebt, während dies bei der mittleren Altersgruppe schon länger<br />
zurück liegt. Wenn Eltern alt <strong>und</strong> hilfebedürftig werden, kann die Notwendigkeit entstehen,<br />
dass sich zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d <strong>in</strong> relativer räumlicher Nähe zu den Eltern aufhält, um Unterstützung<br />
zu leisten. Nicht selten ziehen auch hochbetagte Eltern <strong>in</strong> den Haushalt e<strong>in</strong>es erwachsenen<br />
K<strong>in</strong>des. Möglicherweise gibt es e<strong>in</strong>ige Menschen <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe, die <strong>in</strong> der jüngeren<br />
Vergangenheit <strong>in</strong> größere räumliche Nähe zu ihren erwachsenen K<strong>in</strong>dern gezogen s<strong>in</strong>d. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong>e konzentriert sich die folgende Darstellung der Wohnentfernung auf das räumlich<br />
am nächsten wohnende K<strong>in</strong>d. Ergebnisse für beide Erhebungszeitpunkte wurden auf der Basis<br />
dieses Konzepts berechnet, so dass es zu Abweichungen von bereits publizierten Ergebnissen<br />
aus der ersten Welle des Alterssurveys (vgl. zum Beispiel Kohli et al., 2000), die Durchschnittswerte<br />
für die ersten vier K<strong>in</strong>der berechnet hatten, kommen kann 6 . Die nachfolgende Tabelle<br />
5.3 gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die Veränderung der Wohnentfernung zwischen Eltern <strong>und</strong><br />
ihren jeweils am nächsten lebenden K<strong>in</strong>dern zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten 1996<br />
<strong>und</strong> 2002.<br />
Wie schon 1996 berichtete die übergroße Mehrheit der Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte,<br />
dass zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>es ihrer K<strong>in</strong>der <strong>in</strong>nerhalb von zwei St<strong>und</strong>en erreichbar ist. Fast drei Viertel<br />
gaben sogar an, dass e<strong>in</strong>es ihrer K<strong>in</strong>der im gleichen Ort lebt. Insgesamt konnte damit der Bef<strong>und</strong><br />
aus der ersten Welle bestätigt werden (Kohli et al., 2000).<br />
6 Daten zur Wohnentfernung werden im Alterssurvey nur für das 1. bis 4. K<strong>in</strong>d erfasst.<br />
227
Tabelle 5.3:<br />
Wohnentfernung zum nächstwohnenden K<strong>in</strong>d nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
228<br />
Andreas Hoff<br />
40-54 55-69 70-85 40-85<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
Im selben Haus 70,0 67,5 34,3 27,3 25,9 22,2 47,0 39,7<br />
In der Nachbarschaft 6,2 4,9 14,7 14,3 17,6 18,9 11,8 12,2<br />
Im gleichen Ort 8,9 9,4 24,4 23,8 23,9 28,7 18,0 20,1<br />
Innerhalb v. 2 h erreichbar 11,3 13,2 19,6 26,1 23,4 22,4 17,0 20,8<br />
Weiter entfernt 3,7 5,1 7,1 8,5 9,2 7,7 6,1 7,2<br />
N 1.219 691 1.532 903 1.137 870 3.888 2.464<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 3.888) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 2.464), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede p < .01.<br />
Der Anteil von Befragten, die angaben, dass e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d im selben Haus oder Haushalt lebt, ist seit<br />
1996 jedoch beträchtlich gesunken – von 47 auf knapp 40 Prozent (vgl. rechte Spalte von Tabelle<br />
5.3). Interessanterweise wird dieser Rückgang überwiegend durch die deutliche Abnahme<br />
ihres Anteils <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern erklärt (1996: 48 – 2002: 39 Prozent). Leichte Anstiege<br />
s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen <strong>in</strong> den Kategorien der am selben Ort wohnenden <strong>und</strong> der <strong>in</strong>nerhalb von zwei<br />
St<strong>und</strong>en Reiseentfernung lebenden K<strong>in</strong>der zu verzeichnen. Anders ausgedrückt, haben im Jahr<br />
2002 28 Prozent der Befragten ke<strong>in</strong>e am selben Ort lebenden K<strong>in</strong>der. Das bedeutet e<strong>in</strong>en Anstieg<br />
um 5 Prozentpunkte seit 1996. Für diese Menschen gibt es also e<strong>in</strong>e deutlich verr<strong>in</strong>gerte<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, dass ihnen ihre erwachsenen K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> Notfällen oder auch im Alltag<br />
schnell zur Hilfe kommen können.<br />
Die Zunahme der Wohnentfernung zu dem am nächsten lebenden K<strong>in</strong>d ist <strong>in</strong> der Gruppe der 55-<br />
bis 69-Jährigen am stärksten. In dieser Altersgruppe hat sich der Anteil der im selben Haus oder<br />
Haushalt lebenden K<strong>in</strong>der von mehr als e<strong>in</strong>em Drittel auf e<strong>in</strong> gutes Viertel verr<strong>in</strong>gert. Parallel<br />
dazu ist der Anteil der nächstlebenden K<strong>in</strong>der, die nicht im gleichen Ort leben, von 27 auf 35<br />
Prozent gestiegen (= Summe der Kategorien „anderer Ort, weniger als 2 St<strong>und</strong>en“ + „weiter<br />
entfernt“). Diese Menschen verfügen also über weitaus weniger unmittelbare Unterstützungsmöglichkeiten<br />
durch ihre K<strong>in</strong>der.<br />
In der ältesten Altersgruppe ist ebenfalls e<strong>in</strong> Rückgang der Koresidenz von Eltern <strong>und</strong> erwachsenen<br />
K<strong>in</strong>dern festzustellen, wobei dieser aber durch die prozentuale Zunahme von <strong>in</strong> der<br />
Nachbarschaft <strong>und</strong> vor allem am gleichen Ort lebenden K<strong>in</strong>dern kompensiert wird. Nahezu<br />
konstant geblieben ist h<strong>in</strong>gegen die Wohnentfernung zum nächstlebenden K<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Altersgruppe<br />
der 40- bis 54-Jährigen.<br />
Im Kohortenvergleich fallen drei Geburtskohorten auf, die im Wesentlichen für die oben beschriebene<br />
<strong>Entwicklung</strong> verantwortlich s<strong>in</strong>d. Bezogen auf Koresidenz mit erwachsenen K<strong>in</strong>dern<br />
im selben Haus f<strong>in</strong>den sich die stärksten Effekte bei den jeweils 52- bis 63-Jährigen.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Als nächstes wenden wir uns der Frage zu, wie sich die Wohnentfernung mit zunehmendem<br />
Alter entwickelt. Zur Beantwortung dieser Frage ist e<strong>in</strong>e Längsschnittbetrachtung die am besten<br />
geeignete Methode – die Panelstichprobe des Alterssurveys bildet die Datenbasis (vgl. Abbildung<br />
5.3).<br />
Abbildung 5.3:<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Wohnentfernung zum nächstwohnenden K<strong>in</strong>d, 1996 – 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Prozent<br />
jüngste Altersgruppe<br />
(2002: 46-60 Jahre)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
selb. Haus Nachbarsch<br />
gleicher Ort <strong>in</strong> 2 h<br />
mehr als 2 h<br />
Prozent<br />
Mittlere Altersgruppe<br />
(2002: 61-75 Jahre)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
selb. Haus Nachbarsch<br />
gleicher Ort <strong>in</strong> 2 h<br />
mehr als 2 h<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996 <strong>und</strong> 2002 (n= 1.176), gewichtete Daten<br />
Prozent<br />
Älteste Altersgruppe<br />
(2002:76-91 Jahre)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
selb. Haus Nachbarsch<br />
gleicher Ort <strong>in</strong> 2 h<br />
mehr als 2 h<br />
Hier werden also <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sverläufe dargestellt. In der l<strong>in</strong>ken Grafik s<strong>in</strong>d die<br />
Verläufe für die 1996 40- bis 54-Jährigen abgebildet. Bei der Zweiterhebung im Jahre 2002 s<strong>in</strong>d<br />
sie nicht nur sechs Jahre älter geworden, sondern viele K<strong>in</strong>der haben <strong>in</strong>zwischen den elterlichen<br />
Haushalt verlassen. Dies lässt sich an der steil abfallenden oberen L<strong>in</strong>ie ablesen. Parallel dazu<br />
s<strong>in</strong>d für alle anderen Kategorien leichte Anstiege zu verzeichnen.<br />
E<strong>in</strong>e bemerkenswerte <strong>Entwicklung</strong> erlebten h<strong>in</strong>gegen Angehörige der mittleren Altersgruppe,<br />
die 2002 61 bis 75 Jahre alt waren (mittlere Grafik). Die Wohnentfernung zu den nächstlebenden<br />
K<strong>in</strong>dern hat sich <strong>in</strong> dieser Altersgruppe zu mehr Heterogenität h<strong>in</strong> entwickelt, was <strong>in</strong> der<br />
annähernden Gleichverteilung der Anteile aller Entfernungskategorien zum Ausdruck kommt.<br />
Die Wohnentfernungen zu den am nächsten wohnenden K<strong>in</strong>dern <strong>in</strong> der älteste Altersgruppe der<br />
nun 76- bis 91-Jährigen h<strong>in</strong>gegen zeichnen sich durch e<strong>in</strong> hohes Maß an Stabilität aus (vgl.<br />
rechte Grafik). Lediglich zwischen den Kategorien „wohnt <strong>in</strong> der Nachbarschaft“ <strong>und</strong> „wohnt<br />
im selben Ort“ kam es zu ger<strong>in</strong>gfügigen Verschiebungen.<br />
Es bleibt also festzuhalten, dass nach wie vor fast drei Viertel wenigstens e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d vor Ort haben,<br />
das ihnen im Bedarfsfall helfen kann. Insgesamt nimmt die Wohnentfernung zu nächstlebenden<br />
K<strong>in</strong>dern jedoch mit zunehmendem Alter leicht zu. Bemerkenswert ist vor allem die<br />
gestiegene Anzahl derjenigen, deren K<strong>in</strong>der nicht am selben Ort leben. Dies könnte gerade im<br />
hohen Alter, <strong>in</strong>sbesondere bei Pflegebedürftigkeit der Eltern, zu Problemen bei der Bereitstellung<br />
von Unterstützungsleistungen durch die K<strong>in</strong>der führen.<br />
229
Wohnentfernung zu den Eltern<br />
230<br />
Andreas Hoff<br />
Wie e<strong>in</strong>gangs erwähnt, bef<strong>in</strong>den sich viele Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Doppelrolle<br />
als Eltern heranwachsender K<strong>in</strong>der e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> als erwachsene K<strong>in</strong>der alternder Eltern<br />
andererseits. Dementsprechend stellt die nachfolgende Tabelle 5.4 die Veränderung der<br />
Wohnentfernung zu den eigenen Eltern dar. In der Gruppe der 70- bis 85-Jährigen waren allerd<strong>in</strong>gs<br />
nur noch 13 (1996) bzw. 10 (2002) Eltern am Leben. Da auf dieser Basis ke<strong>in</strong>e zuverlässigen<br />
Schlussfolgerungen gezogen werden können, wurde <strong>in</strong> dieser Altersgruppe auf e<strong>in</strong>e Darstellung<br />
<strong>und</strong> Interpretation der Ergebnisse verzichtet.<br />
Tabelle 5.4:<br />
Wohnentfernung zum nächstwohnenden Elternteil nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
40-54 55-69 70-85 40-85<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
Im selben Haus 13,0 10,4 17,3 12,9 / / 13,9 10,8<br />
In der Nachbarschaft 11,7 12,7 13,6 14,8 / / 12,1 13,0<br />
Im gleichen Ort 25,2 25,7 22,9 27,6 / / 24,7 26,1<br />
Innerhalb v. 2 h erreichbar 34,8 35,8 28,5 31,0 / / 33,5 35,0<br />
Weiter entfernt 15,3 15,4 17,8 13,8 / / 15,8 14,1<br />
N 1.156 787 381 192 13 10 1.549 1.190<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 1.549) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 1.190), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede: p < .05.<br />
Wie die Ergebnisse <strong>in</strong> Tabelle 5.4 zeigen, ist die Wohnentfernung zu den eigenen Eltern durch<br />
e<strong>in</strong> hohes Maß an Stabilität gekennzeichnet. Betrachtet man alle<strong>in</strong> die <strong>in</strong> der rechten Spalte abgetragenen<br />
Gesamtverteilungen, so ist ke<strong>in</strong> wesentlicher Unterschied zwischen beiden Erhebungszeitpunkten<br />
zu erkennen. Die Häufigkeitsverteilungen s<strong>in</strong>d nahezu konstant geblieben.<br />
Die e<strong>in</strong>zige Abweichung stellt die auch hier erkennbare Reduktion des Anteils von Koresidenz<br />
mit den Eltern dar – hier hat sich der Gesamtanteil von knapp 14 auf 11 Prozent verr<strong>in</strong>gert. Die<br />
altersgruppenspezifische Betrachtung bestätigt dieses Ergebnis, wobei diese Abnahme <strong>in</strong> der<br />
mittleren Altersgruppe am stärksten ausgeprägt ist. Davon abgesehen, ist der <strong>in</strong> Bezug auf K<strong>in</strong>der<br />
identifizierte Trend sich vergrößernder Wohnentfernungen <strong>in</strong> der Beziehung zu den Eltern<br />
nicht erkennbar.<br />
Abschließend werden die <strong>Entwicklung</strong>strends bei den zweimal befragten Personen <strong>in</strong> Bezug auf<br />
den Wohnort der Eltern dargestellt (vgl. Abbildung 5.4 unten). Es kann nicht überraschen, dass<br />
es 2002 ke<strong>in</strong>e 76- bis 91-Jährigen gab, deren Eltern noch am Leben waren. Dementsprechend<br />
muss sich die Darstellung auf die beiden jüngeren Altersgruppen beschränken. Hält man sich<br />
das Alter der Befragten <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe (2002: 61 bis 75 Jahre) vor Augen, so<br />
wird klar, dass es sich bei diesen Eltern nur um sehr wenige, hochaltrige Menschen handeln<br />
kann, die vergleichsweise oft soziale Unterstützung benötigen. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e wurde die<br />
Darstellung <strong>in</strong> Abbildung 5.4 auf zwei Dimensionen der Wohnentfernung zugespitzt: Wohnen<br />
am selben Ort vs. weiter entferntes Wohnen.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Abbildung 5.4:<br />
Veränderung der Wohnentfernung zum nächstwohnenden Elternteil, 1996 – 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Prozent<br />
jüngste Altersgruppe (2002: 46-60 Jahre)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
gleicher Ort w eiter entfernt<br />
Prozent<br />
mittlere Altersgruppe (2002: 61-75 Jahre)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
gleicher Ort w eiter entfernt<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996 (n= 592) <strong>und</strong> 2002 (n= 403), gewichtete Daten<br />
Wie Abbildung 5.4 zu entnehmen ist, unterscheiden sich die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Veränderungen gravierend<br />
von jenen für die Wohnentfernung zu den K<strong>in</strong>dern. In der jüngsten Altersgruppe des<br />
Alterssurveys herrscht be<strong>in</strong>ahe absolute Stabilität <strong>in</strong> den Wohnverhältnissen vor – die Wohnentfernung<br />
zwischen den Befragten <strong>und</strong> ihren Eltern hat sich nicht verändert. E<strong>in</strong> angesichts dessen<br />
unerwartetes Ergebnis erwartet den Betrachter <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe: mehr als die Hälfte<br />
der hochaltrigen Eltern leben nicht mehr am gleichen Ort wie ihre K<strong>in</strong>der (siehe rechte Grafik),<br />
wobei sich dieser Anteil <strong>in</strong> den letzten sechs Jahren auf nunmehr knapp 60 Prozent erhöht hat.<br />
Nachfolgend erfolgt e<strong>in</strong>e Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse im H<strong>in</strong>blick auf die<br />
Wohnentfernung zwischen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte: Die überwiegende<br />
Mehrheit der Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte lebt <strong>in</strong> räumlicher Nähe zu ihren K<strong>in</strong>dern<br />
bzw. Eltern. Im Jahre 2002 gab es bei mehr als 70 Prozent der Befragten zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d,<br />
das im selben Ort wie die Eltern wohnte. Im Vergleich zu 1996 hat der Anteil der vor Ort lebenden<br />
K<strong>in</strong>der jedoch deutlich abgenommen. Dabei handelt es sich sowohl um e<strong>in</strong>en Alterseffekt,<br />
als auch um Auswirkungen sozialen <strong>Wandel</strong>s, die im Vergleich von Gleichaltrigen zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 identifiziert wurden. Auch Koresidenz von Eltern <strong>und</strong> erwachsenen K<strong>in</strong>dern<br />
ist immer weniger die Norm. Gleiches gilt auch für Koresidenz mit hochaltrigen Eltern.<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte legen offenbar bis <strong>in</strong>s hohe Lebensalter Wert auf Unabhängigkeit,<br />
was im Wohnen im eigenen Haushalt se<strong>in</strong>en Niederschlag f<strong>in</strong>det. Aufgelöst wird<br />
dieser immer öfter erst durch den Tod oder den ‚Umzug’ <strong>in</strong>s Pflegeheim. Der <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahrzehnten beobachtete Individualisierungstrend <strong>in</strong> der Gesellschaft setzt sich also mehr <strong>und</strong><br />
mehr auch <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte durch.<br />
5.4.2 Generationen-Konstellationen im Haushalt<br />
Nachdem im vorigen Abschnitt die Wohnentfernung zwischen den Haushalten von Eltern <strong>und</strong><br />
K<strong>in</strong>dern betrachtet wurde, stehen nun die Generationenbeziehungen <strong>in</strong>nerhalb dieser Haushalte<br />
231
232<br />
Andreas Hoff<br />
im Mittelpunkt. Anhand der Veränderung der durchschnittlichen Haushaltsgröße <strong>in</strong> Deutschland<br />
seit Beg<strong>in</strong>n des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts lässt sich der phänomenale <strong>Wandel</strong>, den deutsche Haushalte im<br />
letzten Jahrh<strong>und</strong>ert durchlaufen haben, erahnen. Lebten 1900 noch durchschnittlich 4,5 Personen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushalt, so hatte sich deren Anzahl bis zum Jahr 2000 auf 2,2 Personen halbiert<br />
(Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2002). Natürlich s<strong>in</strong>d Veränderungen dieser Größenordnung bei e<strong>in</strong>em<br />
Beobachtungszeitraum von sechs Jahren nicht zu erwarten, zumal der Alterssurvey nur<br />
e<strong>in</strong>en Teil der Bevölkerung, die 40- bis 85-Jährigen, untersucht. Dennoch ergeben sich beim<br />
Vergleich der Haushaltszusammensetzung im Jahre 2002 (Replikationsstichprobe) mit jener der<br />
Basisstichprobe 1996 Anzeichen für e<strong>in</strong>e Fortsetzung dieses allgeme<strong>in</strong>en demografischen<br />
Trends. Selbst für diesen vergleichsweise kurzen Untersuchungszeitraum von sechs Jahren lässt<br />
sich e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der Haushaltsgröße feststellen. Betrug die durchschnittliche Haushaltsgröße<br />
der 40- bis 85-jährigen Deutschen 1996 noch 2,52 Personen (SD 1,19), so hatte sich diese<br />
im Jahre 2002 auf 2,35 verr<strong>in</strong>gert (SD 1,13) 7 . Dieses Resultat bestätigt den aus der amtlichen<br />
Statistik bekannten allgeme<strong>in</strong>en Trend der Verkle<strong>in</strong>erung von Haushaltsgrößen seit Mitte der<br />
1950er Jahre. Im Vergleich mit den Daten des Mikrozensus aus dem Jahr 2000 liegt die durchschnittliche<br />
Haushaltsgröße <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte jedoch noch ger<strong>in</strong>gfügig höher als im<br />
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung (Engstler & Menn<strong>in</strong>g, 2003).<br />
Die überwiegende Mehrheit der 40- bis 85-jährigen Deutschen lebt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Haushaltsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
mit anderen. Der Anteil von alle<strong>in</strong>lebenden Personen ist allerd<strong>in</strong>gs zwischen 1996 <strong>und</strong><br />
2002 von 16,2 Prozent auf 20,5 Prozent deutlich angestiegen. Bezieht man darüber h<strong>in</strong>aus auch<br />
Zweipersonenhaushalte <strong>in</strong> die Betrachtung e<strong>in</strong>, deren Anteil ebenfalls leicht zugenommen hat,<br />
so verstärkt sich der E<strong>in</strong>druck tendenziell abnehmender Haushaltsgrößen – zwei Drittel der Befragten<br />
<strong>in</strong> Welle 2 lebten <strong>in</strong> E<strong>in</strong>- oder Zweipersonenhaushalten verglichen mit lediglich 60 Prozent<br />
im Jahre 1996. Der Anteil von Haushalten mit mehr als zwei Personen ist h<strong>in</strong>gegen spürbar<br />
zurückgegangen (vgl. nachfolgende Abbildung 5.5).<br />
7 Die Mittelwertdifferenz zwischen beiden Erhebungszeitpunkten ist hoch signifikant: p < 0.001.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Abbildung 5.5:<br />
Anzahl im Haushalt lebender Personen (<strong>in</strong> Prozent)<br />
19,1<br />
14,3<br />
4,4<br />
1,7<br />
1996<br />
16,2<br />
44,3<br />
1 Person 2 Personen 3 Personen<br />
4 Personen 5 Personen 6 u. mehr P.<br />
16,1<br />
11,9<br />
3,4<br />
1,2<br />
2002<br />
46,9<br />
20,5<br />
1 Person 2 Personen 3 Personen<br />
4 Personen 5 Personen 6 u. mehr P.<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 (n= 4.834) <strong>und</strong> 2002 (n= 3.082), jeweils gewichtete Daten<br />
In e<strong>in</strong>em nächsten Schritt erfolgt e<strong>in</strong>e nach Altersgruppen, Geschlecht <strong>und</strong> Region differenzierte<br />
Betrachtungsweise. Dabei bilden wiederum die beiden Querschnitte der Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 die Datengr<strong>und</strong>lage. Auch hier zeigen sich zum Teil erhebliche<br />
Unterschiede:<br />
Haushaltsgröße nach Altersgruppen<br />
Die durchschnittliche Haushaltsgröße verr<strong>in</strong>gert sich mit zunehmendem Alter. Ergab sich für<br />
die jüngste im Alterssurvey 2002 befragte Altersgruppe der 40- bis 54-Jährigen e<strong>in</strong>e durchschnittliche<br />
Haushaltsgröße von 2,94 Personen (SD 1,27), so verr<strong>in</strong>gert sich diese auf 2,07 (SD<br />
0,80) <strong>in</strong> der mittleren (55-69 Jahre) bzw. 1,67 (SD 0,67) <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe (70-85<br />
Jahre). Diese Veränderung markiert den typischen Familienzyklus <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte:<br />
<strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe des Alterssurveys (40 bis 54 Jahre) leben <strong>in</strong> der Mehrzahl der<br />
Haushalte noch K<strong>in</strong>der. Spätestens <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe der 55- bis 69-Jährigen haben<br />
die K<strong>in</strong>der den elterlichen Haushalt verlassen – das (noch immer typischerweise) verheiratete<br />
Paar lebt im sogenannten „empty nest“. Die älteste Altersgruppe des Alterssurvey (70 bis 85<br />
Jahre) erlebt nun vielfach e<strong>in</strong>e weitere deutliche Verkle<strong>in</strong>erung des Haushalts durch den Tod<br />
e<strong>in</strong>es (<strong>in</strong> der Regel des männlichen) Ehepartners. Jedoch nicht nur im Vergleich zwischen e<strong>in</strong>zelnen<br />
Lebensphasen, sondern auch im Vergleich zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 hat sich die durchschnittliche Haushaltsgröße der jüngeren Altersgruppen signifikant<br />
verr<strong>in</strong>gert. 1996 lebten mit durchschnittlich 3,14 Personen (SD 1,25) noch signifikant<br />
mehr Personen im Haushalt 40- bis 54-jähriger Befragter. In ger<strong>in</strong>gerem Umfang, aber ebenfalls<br />
signifikant, hat sich das arithmetische Mittel der Haushaltsgröße <strong>in</strong> der Altersgruppe der 55- bis<br />
69-Jährigen von 2,16 (SD 0,82) auf 2,07 Personen (SD 0,8) reduziert. Lediglich <strong>in</strong> der ältesten<br />
Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen blieb die durchschnittliche Haushaltsgröße konstant (1996:<br />
1,69 (SD 0,78) – 2002: 1,67 (SD 0,67).<br />
233
Haushaltsgröße nach Geschlecht<br />
234<br />
Andreas Hoff<br />
Neben dem Alters- gibt es auch e<strong>in</strong>en erkennbaren Geschlechtseffekt: Männer leben im Durchschnitt<br />
<strong>in</strong> größeren Haushalten als Frauen im selben Lebensabschnitt (2002: 2,47 vs. 2,24 Personen).<br />
Dieses Ergebnis ist der höheren Lebenserwartung von Frauen geschuldet, die ihre<br />
männlichen Lebenspartner <strong>in</strong> der Regel überleben <strong>und</strong> dann alle<strong>in</strong> im vormals ehelichen Haushalt<br />
zurückbleiben. Zwischen Welle 1 <strong>und</strong> 2 hat sich die durchschnittliche Haushaltsgröße für<br />
beide signifikant verr<strong>in</strong>gert (Männer: von 2,66 (SD 1,14) auf 2,47 (SD 1,1); Frauen: von 2,40<br />
(SD 1,22) auf 2,24 (SD 1,14)). Auch hier zeigen sich also die erwartbaren Anzeichen des demografischen<br />
<strong>Wandel</strong>s.<br />
Haushaltsgröße <strong>in</strong> Ost/West<br />
Hatte sich die durchschnittliche Haushaltsgröße von 40- bis 85-jährigen Menschen <strong>in</strong> West- <strong>und</strong><br />
Ostdeutschland 1996 noch signifikant vone<strong>in</strong>ander unterschieden, so ist dies 2002 nicht mehr<br />
der Fall. Bed<strong>in</strong>gt durch den deutlichen Rückgang <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>sländern (1996: 2,55 (SD<br />
1,21) – 2002: 2,35 Personen (SD 1,16) hat sich die durchschnittliche Haushaltsgröße <strong>in</strong> beiden<br />
Landesteilen auf nahezu identischem Niveau von 2,35 (West) bzw. 2,33 (Ost) Personen im<br />
Haushalt e<strong>in</strong>gependelt. Klare Unterschiede ergeben sich h<strong>in</strong>gegen beim Vergleich von Haushalten<br />
<strong>in</strong> ländlichen <strong>und</strong> städtischen Geme<strong>in</strong>den. Als Faustregel gilt: Je größer die Geme<strong>in</strong>de, desto<br />
kle<strong>in</strong>er s<strong>in</strong>d die Haushalte älterer Menschen.<br />
In e<strong>in</strong>em kurzen Zwischenfazit bleibt also festzuhalten, dass sich die Haushaltsgrößen <strong>in</strong> der<br />
zweiten Lebenshälfte seit 1996 spürbar verr<strong>in</strong>gert haben. Männer leben nach wie vor <strong>in</strong> größeren<br />
Haushalten als Frauen. Die zwischen West <strong>und</strong> Ost vor sechs Jahren noch existierenden<br />
Unterschiede <strong>in</strong> der Haushaltsgröße bestehen nicht mehr.<br />
Die Haushaltsgröße alle<strong>in</strong> sagt jedoch wenig aus über die gelebten Beziehungen von Menschen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Wie im vorigen Abschnitt auf der Basis von Daten aus der Replikationsstichprobe<br />
2002 gezeigt wurde, lebt die überwiegende Mehrheit von Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte mit anderen Menschen zusammen. Von herausragender Bedeutung s<strong>in</strong>d dabei<br />
Ehe- bzw. Lebenspartner <strong>und</strong> Lebenspartner<strong>in</strong>nen – drei Viertel aller Befragten teilten im Jahre<br />
2002 ihren Haushalt mit e<strong>in</strong>em Partner bzw. e<strong>in</strong>er Partner<strong>in</strong>. Dabei ist zu bedenken, dass ihr<br />
Anteil ohne Berücksichtigung der 70- bis 85-Jährigen noch deutlich höher ausfallen würde. In<br />
der ältesten Altersgruppe lebten 2002 nur noch wenig mehr als die Hälfte (52,5 Prozent) geme<strong>in</strong>sam<br />
mit ihrem Partner. Hier zeigt sich auch der durch die unterschiedliche Lebenserwartung<br />
bed<strong>in</strong>gte Geschlechtsunterschied – ältere Männer leben häufiger <strong>in</strong> Paarhaushalten als<br />
Frauen.<br />
E<strong>in</strong> Drittel der Befragten gab an, dass <strong>in</strong> ihrem Haushalt K<strong>in</strong>der lebten. Dies betraf jedoch vorwiegend<br />
die Jüngeren, die noch die Erziehungsverantwortung für m<strong>in</strong>derjährige K<strong>in</strong>der hatten.<br />
Dementsprechend lebten mehr als drei Viertel der angegebenen K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> den Haushalten 40-<br />
bis 54-jähriger Befragter, lediglich 5 Prozent <strong>in</strong> jenen der ältesten Altersgruppe (70 bis 85<br />
Jahre). Auch e<strong>in</strong>e Betrachtung nach Alterskohorten kommt zu dem Ergebnis, dass mit zunehmendem<br />
Alter e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Abnahme des Anteils von Haushalten mit K<strong>in</strong>dern zu beobachten<br />
ist. Andere Personengruppen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Haushalten älterer Menschen kaum anzutref-
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
fen, wobei darunter die eigenen Eltern mit 1,8 Prozent (n= 55) noch am häufigsten <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung<br />
treten.<br />
E<strong>in</strong> Ergebnis der Ersterhebung des Alterssurveys im Jahre 1996 war es, dass <strong>in</strong> Deutschland<br />
Haushalte mit drei oder mehr Generationen die absolute Ausnahme bilden <strong>und</strong> dass der Anteil<br />
von Personen ohne Angehörige anderer Generationen im selben Haushalt mit zunehmendem<br />
Alter stark zunimmt (Kohli et al., 2000). Wenn man die Vorgehensweise aus Welle 1 unter<br />
Verwendung des von Kohli et al. (2000) e<strong>in</strong>geführten Konzepts der Generationen-<br />
Konstellationen repliziert <strong>und</strong> diese lediglich um die Ergebnisse aus der Replikationsstichprobe<br />
des Alterssurveys 2002 ergänzt, so bestätigen diese die Ergebnisse von 1996 (vgl. Tabelle 5.5<br />
unten).<br />
Tabelle 5.5:<br />
Haushaltsbezogene Generationen-Konstellationen nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002 (<strong>in</strong><br />
Prozent)<br />
40-54 55-69 70-85 40-85<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
1 Generationen 31,5 38,8 74,8 82,9 91,5 92,2 58,1 65,8<br />
- E<strong>in</strong>personen 6,8 12,7 15,5 17,2 41,3 41,6 16,2 20,5<br />
2 Generationen 65,5 58,8 23,4 15,9 6,7 6,9 39,6 32,5<br />
- mit Eltern 2,4 1,6 2,8 1,9 0,3 0,2 2,2 1,4<br />
- mit K<strong>in</strong>dern 63,0 57,2 19,8 14,1 6,0 6,3 36,9 31,1<br />
3 Generationen 3,0 2,4 1,8 1,2 1,8 0,9 2,4 1,7<br />
- Eltern/K<strong>in</strong>der 2,9 2,3 1,1 0,3 - - 1,7 1,1<br />
- K<strong>in</strong>der/Enkel 0,1 0,2 0,8 0,9 1,8 0,9 0,7 0,6<br />
N 1.715 1.091 1.776 1.004 1.339 983 4.830 3.078<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.830) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 3.078), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede: p < .01; außer „Zwei-Generationen-HH mit Eltern“ u. „Drei-Generationen-HH mit Eltern/<br />
K<strong>in</strong>dern“ (jeweils p < .05), sowie „Drei-Generationen-HH mit K<strong>in</strong>dern/Enkeln“ (p nicht signifikant)<br />
Während <strong>in</strong> der Gruppe der 40- bis 54-Jährigen Zwei-Generationen-Haushalte mit K<strong>in</strong>dern dom<strong>in</strong>ieren,<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den beiden älteren Altersgruppen E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalte mit Abstand am<br />
weitesten verbreitet.<br />
Tabelle 5.5 enthält jedoch auch H<strong>in</strong>weise auf e<strong>in</strong>e im Vergleich zu Welle 1 bemerkenswerte<br />
Veränderung: <strong>in</strong> den beiden jüngeren Altersgruppen (also bei den 40- bis 69-Jährigen) ist e<strong>in</strong>e<br />
deutliche Verschiebung des Anteils von Zwei-Generationen-Haushalten h<strong>in</strong> zu E<strong>in</strong>-<br />
Generationen-Haushalten festzustellen. In der Gruppe der 40- bis 54-Jährigen nahm der Anteil<br />
der E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalte zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 um 7,3 Prozentpunkte zu, bei den 55-<br />
bis 69-Jährigen betrug der Zuwachs 8,1 Prozentpunkte, <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe (70 bis 85<br />
Jahre) h<strong>in</strong>gegen ist der Anteil nahezu konstant geblieben. Besonders stark fällt der Anstieg <strong>in</strong><br />
der jüngsten Altersgruppe der 40- bis 54-Jährigen aus, <strong>in</strong> der sich der Anteil von E<strong>in</strong>personenhaushalten<br />
im Vergleich zu 1996 be<strong>in</strong>ahe verdoppelt hat.<br />
235
236<br />
Andreas Hoff<br />
Diese Veränderungen korrespondieren mit e<strong>in</strong>em starken Rückgang des Anteils von Haushalten<br />
mit K<strong>in</strong>dern <strong>in</strong> den beiden jüngeren Altersgruppen (40- bis 54-Jährige: m<strong>in</strong>us 5,8 Prozentpunkte;<br />
55- bis 69-Jährige: m<strong>in</strong>us 5,7 Prozentpunkte). Weniger als zwei Prozent der 40- bis 85jährigen<br />
deutschen Bevölkerung lebte 2002 <strong>in</strong> häuslicher Geme<strong>in</strong>schaft mit zwei anderen, also<br />
<strong>in</strong>sgesamt drei Generationen. Haushalte, <strong>in</strong> denen vier Generationen zusammen lebten, konnten<br />
<strong>in</strong> der zweiten Welle des Alterssurveys überhaupt nicht nachgewiesen werden.<br />
Zurückkehrend zur Ausgangsfrage dieses Kapitels nach der Identifikation von sozialem <strong>Wandel</strong><br />
stellt sich nun die Frage, ob neben den benannten Alterseffekten auch Kohorteneffekte identifiziert<br />
werden können. Tabelle 5.6 auf der folgenden Seite enthält die nach Geburtskohorten aufgeschlüsselten<br />
Ergebnisse der Querschnitte (Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe) beider Erhebungswellen.<br />
Tabelle 5.6:<br />
Haushaltsbezogene Generationen-Konstellationen nach Geburtskohorten, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Geburtskohorten 1 Generation<br />
im HH<br />
2 Generationen<br />
im HH<br />
3 Generationen<br />
im HH<br />
Alter 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
40-45 1951-56 1957-62 20,3 31,9 76,5 66,9 3,2 1,3<br />
46-51 1945-50 1951-56 31,7 35,9 65,4 60,4 2,9 3,7<br />
52-57 1939-44 1945-50 59,0 60,8 38,4 37,7 2,5 1,5<br />
58-63 1933-38 1939-44 73,4 82,1 24,6 16,8 2,0 1,2<br />
64-69 1927-32 1933-38 86,3 88,5 12,6 10,4 1,1 1,2<br />
70-75 1921-26 1927-32 91,3 92,2 7,4 7,2 1,3 0,6<br />
76-81 1915-20 1921-26 93,4 94,1 4,7 5,9 1,8 -<br />
N 4.637 2.977 2.948 2.068 1.593 863 96 46<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.828) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 2.977), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede p < 0.01.<br />
Die Altersspannen von jeweils sechs Jahren, auf denen der Kohortenvergleich beruht, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
der ersten Spalte abgetragen, <strong>in</strong> den Spalten 2 <strong>und</strong> 3 folgt die Zuweisung der entsprechenden<br />
Geburtskohorten zum Erhebungszeitpunkt der Welle 1 (Spalte 2) <strong>und</strong> der Welle 2 (Spalte 3).<br />
Die Angaben zu E<strong>in</strong>-, Zwei- <strong>und</strong> Drei-Generationen-Haushalten folgen derselben Logik. Das<br />
heißt, die Erhebungszeitpunkte 1996 <strong>und</strong> 2002 beziehen sich auf zwei unterschiedliche Geburtskohorten,<br />
die zum Interviewzeitpunkt gleich alt waren. Der Unterschied im Vergleich der<br />
beiden Erhebungszeitpunkte (z.B. 20,3 Prozent (1996) vs. 31,9 Prozent (2002) für E<strong>in</strong>-<br />
Generationen-Haushalte) kann also als Kohorteneffekt <strong>in</strong>terpretiert werden.<br />
Wie aus den Daten <strong>in</strong> Tabelle 5.6 ersichtlich wird, ist die Tendenz e<strong>in</strong>er Zunahme des Anteils<br />
von E<strong>in</strong>-Generationen- auf Kosten e<strong>in</strong>er Abnahme des Anteils von Zwei-Generationen-<br />
Haushalten auch im Kohortenvergleich festzustellen. Dabei dürfte es sich allerd<strong>in</strong>gs vorwiegend
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
um die Auswirkungen des mit dem Kohorteneffekt konf<strong>und</strong>ierten Alterseffekts handeln, nämlich<br />
die auf Folgen des Auszugs der erwachsenen K<strong>in</strong>der aus dem elterlichen Haushalt. Das<br />
betrifft vor allem die beiden jüngsten Kohorten, also die 40- bis 51-Jährigen. Neben dieser aus<br />
dem normalen Familienzyklus erklärbaren Veränderung fällt jedoch e<strong>in</strong>e weitere, deutlich ältere<br />
Geburtskohorte auf, für die e<strong>in</strong>e deutliche Veränderung konstatiert werden kann – die 58- bis<br />
63-Jährigen. Bei diesen Geburtsjahrgängen, die heute den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand vollziehen,<br />
handelt es sich um die <strong>in</strong> der Zeit des Nationalsozialismus (1996: Geburtsjahrgänge 1933-<br />
38) bzw. während des Zweiten Weltkriegs (2002: Geburtsjahrgänge 1939-44) Geborenen.<br />
Im Ergebnis der Betrachtung der beiden Querschnitte aus Erst- <strong>und</strong> Zweiterhebung des Alterssurveys<br />
kann also festgehalten werden, dass sich die generationenbezogene Haushaltsstruktur<br />
seit 1996 deutlich verändert hat. Der zu Beg<strong>in</strong>n dieses Kapitels <strong>in</strong> Ansätzen beschriebene demografische<br />
<strong>und</strong> familiale <strong>Wandel</strong> hat hier deutliche Spuren h<strong>in</strong>terlassen.<br />
Dementsprechend wird dieser Frage im Folgenden mit Daten aus der Panelstichprobe des Alterssurveys<br />
nachgegangen. Abbildung 5.6 enthält die drei <strong>Entwicklung</strong>sverläufe für die drei<br />
Altersgruppen, jeweils für den Untersuchungszeitraum 1996-2002.<br />
Vergleicht man die drei großen Altersgruppen <strong>in</strong> Abbildung 5.6 mite<strong>in</strong>ander, so ergibt sich e<strong>in</strong><br />
völlig unterschiedliches Bild. Auf den ersten Blick haben diese wenig geme<strong>in</strong>. Sieht man jedoch<br />
genauer h<strong>in</strong>, offenbaren sie die Kont<strong>in</strong>uität bestimmter <strong>Entwicklung</strong>strends, namentlich der<br />
Verr<strong>in</strong>gerung des Anteils von Zwei-Generationen-Haushalten bei gleichzeitigem Anstieg des<br />
Anteils von E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten mit zunehmendem Alter. In der jüngsten Altersgruppe<br />
der 1996 40- bis 54-Jährigen (l<strong>in</strong>ke Grafik <strong>in</strong> Abbildung 5.6) fällt dieser Alterseffekt besonders<br />
auf: während 1996 lediglich e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>derheit <strong>in</strong> E<strong>in</strong>-Generationen- <strong>und</strong> die große Mehrheit<br />
<strong>in</strong> Zwei-Generationen-Konstellationen lebte, hat sich dieses Verhältnis <strong>in</strong>nerhalb der vergangenen<br />
sechs Jahre umgekehrt – nun lebt die knappe Mehrheit <strong>in</strong> E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten.<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> dieser <strong>Entwicklung</strong> ist der verstärkte Auszug erwachsener K<strong>in</strong>der aus dem Elternhaus<br />
gerade <strong>in</strong> diesem Zeitraum.<br />
Abbildung 5.6:<br />
<strong>Entwicklung</strong> haushaltsbezogener Generationen-Konstellationen, 1996-2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Jüngste Altersgr. 46-60 (2002)<br />
1996 2002<br />
1 Generation 2 Generationen<br />
3 Generationen<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Mittlere Altersgr. 61-75 (2002)<br />
1996 2002<br />
1 Generation 2 Generationen<br />
3 Generationen<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996 <strong>und</strong> 2002 (n= 1.515), gewichtete Daten<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Älteste Altersgr. 76-91 (2002)<br />
1996 2002<br />
1 Generation 2 Generationen<br />
3 Generationen<br />
237
238<br />
Andreas Hoff<br />
Es stellt sich die Frage, ob auch im Lebensverlauf, nachdem die Befragten um sechs Jahre gealtert<br />
s<strong>in</strong>d, deutliche Veränderungen feststellbar s<strong>in</strong>d. Diese Fragestellung erfordert e<strong>in</strong> Längsschnittdesign.<br />
Auch <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe der 2002 61- bis 75-Jährigen (mittlere Grafik) geht die <strong>Entwicklung</strong><br />
e<strong>in</strong>deutig <strong>in</strong> Richtung E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalte. Fast alle 61- bis 75-Jährigen leben<br />
<strong>in</strong> E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten. In der ältesten Altersgruppe (2002: 76 bis 91 Jahre) hat sich<br />
der Anteil von E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten auf diesem hohem Niveau stabilisiert. Mit dem<br />
E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Hochaltrigkeit erhöht sich jedoch auch das Angewiesense<strong>in</strong> auf Hilfe durch Familienangehörige.<br />
In e<strong>in</strong>igen Fällen führte dies zum Zusammenzug <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Haushalt<br />
mit den erwachsenen K<strong>in</strong>dern, was sich <strong>in</strong> der – wenngleich auf niedrigem absoluten Niveau<br />
– Vervielfachung des Anteils von Drei-Generationen-Haushalten widerspiegelt. Drei-<br />
Generationen-Haushalte s<strong>in</strong>d somit unter den 76- bis 91-Jährigen zum<strong>in</strong>dest häufiger anzutreffen<br />
als Zwei-Generationen-Haushalte.<br />
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die große Mehrheit der Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Haushaltsgeme<strong>in</strong>schaft mit anderen lebt. Der demografische <strong>Wandel</strong><br />
macht sich jedoch <strong>in</strong> der Haushaltszusammensetzung bemerkbar – im Vergleich zu 1996 hat<br />
sich sowohl der Anteil von Alle<strong>in</strong>lebenden als auch der von Zweipersonenhaushalten deutlich<br />
erhöht. Mit zunehmendem Alter verr<strong>in</strong>gert sich der Anteil von Menschen, die <strong>in</strong> Zwei-<br />
Generationen-Haushalten leben zugunsten e<strong>in</strong>es ebenso deutlichen Anstiegs des Anteils von<br />
E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten. Neben dieser <strong>Entwicklung</strong> im Lebensverlauf zeichnet sich jedoch<br />
auch e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legender <strong>Wandel</strong> der generationenbezogenen Haushaltszusammensetzung<br />
ab – künftig werden <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalte dom<strong>in</strong>ieren, der<br />
Anteil von Mehr-Generationen-Haushalten wird weiter abnehmen. Dies geht e<strong>in</strong>her mit dem<br />
Streben nach unabhängiger Lebensgestaltung bis <strong>in</strong>s hohe Lebensalter. Das deutet darauf h<strong>in</strong>,<br />
dass <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong>tergenerationale Beziehungen <strong>in</strong> Zukunft noch weniger im<br />
unmittelbaren Zusammenleben <strong>und</strong> geme<strong>in</strong>samen Wirtschaften <strong>in</strong>nerhalb desselben Haushalts<br />
stattf<strong>in</strong>den werden. Daraus ergibt sich die Frage, wie es angesichts dieses <strong>Wandel</strong>s der Formen<br />
des Zusammenlebens um die Bedeutung von <strong>in</strong>tergenerationalen Beziehungen im erweiterten<br />
Familiennetzwerk bestellt ist. Das ist Gegenstand des folgenden Unterkapitels.<br />
5.5 Die Bedeutung familialer Generationenbeziehungen<br />
Nachdem <strong>in</strong> den beiden vorangegangenen Unterkapiteln die Verbreitung von Generationen-<br />
Konstellationen e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> sich daraus ergebende Strukturen im Zusammenleben der Generationen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der erweiterten Familie andererseits betrachtet wurden, widmet sich das nun<br />
folgende Unterkapitel der Bedeutung von Generationenbeziehungen. In e<strong>in</strong>em ersten Abschnitt<br />
wird die subjektive E<strong>in</strong>schätzung der Familienbeziehungen durch die Befragten wiedergegeben<br />
sowie die Verbreitung des für den Zusammenhalt der Familie essentiellen Gefühls der Verb<strong>und</strong>enheit<br />
untersucht. Im weiteren Verlauf des fünften Unterkapitels wird die Kontakthäufigkeit<br />
zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern analysiert.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
5.5.1 Subjektive Bewertung von Familienbeziehungen<br />
Familienbeziehungen spielen e<strong>in</strong>e zentrale Rolle im Leben von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte.<br />
Dementsprechend gaben mehr als drei Viertel der Befragten des Alterssurveys bei<br />
der Erstbefragung im Jahre 1996 an, dass sie ihre Beziehung zu ihrer Familie als gut oder sehr<br />
gut e<strong>in</strong>schätzen. Unter den Bed<strong>in</strong>gungen gesellschaftspolitischer <strong>und</strong> ökonomischer Krisenersche<strong>in</strong>ungen<br />
hat die Familie <strong>in</strong> den letzten Jahren offenbar noch an Bedeutung gewonnen. So ist<br />
die Wertschätzung der Familie im Urteil der Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Teilnehmer am Alterssurvey<br />
seit 1996 gestiegen: nahezu 80 Prozent der 40- bis 69-Jährigen <strong>und</strong> sogar etwas mehr als 80<br />
Prozent der 70- bis 85-Jährigen schätzten im Jahre 2002 ihre Familienbeziehungen als sehr gut<br />
oder gut e<strong>in</strong> (vgl. Abbildung 5.7 unten) 8 . Dabei hat die positive Bewertung <strong>in</strong> allen Altersgruppen<br />
signifikant zugenommen. Die größte Wertschätzung erfahren Familienbeziehungen <strong>in</strong> der<br />
ältesten Altersgruppe des Alterssurveys. Darüber h<strong>in</strong>aus berichteten Frauen generell positiver<br />
über Familienbeziehungen – im Jahre 2002 gab es 82,1 Prozent, die sehr gute oder gute Beziehungen<br />
zur Familie angaben - gegenüber 78,4 Prozent der Männer. Dies bedeutete jedoch<br />
gleichzeitig für beide e<strong>in</strong>e Steigerung um mehr als 3 Prozent gegenüber von 1996.<br />
Abbildung 5.7:<br />
Subjektive Bewertung der Beziehung zur Familie, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
Prozent<br />
Bewertung der Beziehung zur Familie, 1996 <strong>und</strong><br />
2002<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
76,1<br />
79,4<br />
76,9<br />
79,4<br />
82,4<br />
84,3<br />
20,7 17,1 18,6 17,2 14 12,8<br />
3,2 3,6 4,5 3,4 3,6 2,8<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
jüngste Altersgruppe mittlere Altersgruppe älteste Altersgruppe<br />
sehr gut + gut mittel sehr schlecht + schlecht<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.660) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 2.999), gewichtete Daten<br />
Die Analyse der hier nicht graphisch dargestellten Panelstichprobe weist im Längsschnitt e<strong>in</strong>en<br />
klaren Alterseffekt nach. Der Anteil derjenigen, die ihre familialen Beziehungen als sehr gut<br />
oder gut e<strong>in</strong>schätzen, ist bei den nun sechs Jahre Älteren noch e<strong>in</strong>mal deutlich angestiegen. Diese<br />
<strong>Entwicklung</strong> lässt sich für jede e<strong>in</strong>zelne Altersgruppe nachvollziehen.<br />
8 Der Wortlaut der Frage war: „E<strong>in</strong>mal <strong>in</strong>sgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige Beziehung zu Ihrer<br />
Familie?“ (Frage 319)<br />
239
240<br />
Andreas Hoff<br />
Diese überaus positive subjektive Bewertung der Familienbeziehungen ist auch über e<strong>in</strong>en längeren<br />
Zeitraum stabil. So berichtete die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Teilnehmer am Alterssurvey 2002, dass ihre Beziehung zur Familie <strong>in</strong> den letzten sechs Jahren<br />
– also seit der Ersterhebung – „gleich geblieben“ ist. Auch hier s<strong>in</strong>d die Zustimmungsraten bei<br />
den Älteren signifikant höher (40- bis 54-Jährige: 75 Prozent, 55- bis 69-Jährige: 80,6 Prozent;<br />
70- bis 85-Jährige: 85,9 Prozent; jeweils gewichtete Daten). Mehr als 90 Prozent der Menschen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte erwarten zudem, dass sich ihre Familienbeziehungen auch <strong>in</strong> Zukunft<br />
nicht verändern werden. Wenn man die zuvor diskutierte, überaus positive Bewertung der<br />
gegenwärtigen Familienbeziehungen zugr<strong>und</strong>e legt, dann ist das e<strong>in</strong>e sehr erfreuliche Perspektive.<br />
Mehr Bedeutung noch als der allgeme<strong>in</strong>en Bewertung der Beziehungen zur Familie wird dem<br />
Gefühl der Verb<strong>und</strong>enheit mit den am nächsten stehenden Familienangehörigen e<strong>in</strong>geräumt.<br />
Dieses Maß wurde <strong>in</strong> den wechselseitigen Beziehungen zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern zu beiden<br />
Untersuchungszeitpunkten erhoben. Der Tatbestand, dass die Wahrnehmung großer Verb<strong>und</strong>enheit<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Familie für Erhalt bzw. Leistung von sozialer Unterstützung förderlich ist,<br />
wurde <strong>in</strong> der Vergangenheit vielfach empirisch nachgewiesen. Dabei sehen Eltern ihre Beziehung<br />
zu ihren K<strong>in</strong>dern oft als enger an als diese im umgekehrten Verhältnis (Bengtson & Kuypers,<br />
1971; Giarusso et al., 1995; Kohli et al., 2000). Im Alterssurvey wurden die Befragten<br />
gebeten, ihre derzeitige Beziehung zu ihren K<strong>in</strong>dern e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> zu ihren Eltern andererseits<br />
zu bewerten. Dazu wurde ihnen als Antwortmöglichkeiten e<strong>in</strong>e 5er-Skala mit den Ausprägungen<br />
„Sehr eng“, „Eng“, „Mittel“, „Weniger eng“ <strong>und</strong> „Überhaupt nicht eng“ vorgelegt.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage dieser Alterssurvey-Daten ist von e<strong>in</strong>er Krise der Familienbeziehungen<br />
nichts zu spüren: knapp 95 Prozent der Befragten berichten e<strong>in</strong> „sehr enges“ oder „enges“ Verhältnis<br />
zu ihren K<strong>in</strong>dern, mehr als zwei Drittel sogar e<strong>in</strong> „sehr enges“. Das gilt für alle Altersgruppen<br />
<strong>und</strong> Geburtskohorten ebenso wie für alte <strong>und</strong> neue B<strong>und</strong>esländer. Im Kohortenvergleich<br />
hat sich daran ebenso wenig geändert wie <strong>in</strong> der Längsschnittbetrachtung. Frauen berichteten<br />
e<strong>in</strong> noch größeres Gefühl der Verb<strong>und</strong>enheit als Männer – wenngleich auch mehr als 90<br />
Prozent der Männer angaben, sich „sehr eng“ oder „eng“ mit ihren K<strong>in</strong>dern verb<strong>und</strong>en zu fühlen.<br />
Umgekehrt zeichnen sich auch die Beziehungen der Befragten zu ihren Eltern durch hohe<br />
Verb<strong>und</strong>enheitswerte aus, wenngleich nicht auf ganz so hohem Niveau wie zu den K<strong>in</strong>dern.<br />
„Sehr enge“ oder „enge“ Beziehungen zu ihren Eltern berichteten etwa drei Viertel der Befragten.<br />
In e<strong>in</strong>em ersten Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass die übergroße Mehrheit der Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte durch e<strong>in</strong> Gefühl enger oder sogar sehr<br />
enger Verb<strong>und</strong>enheit charakterisiert werden. Daran hat sich auch <strong>in</strong> den vergangenen sechs<br />
Jahren nichts geändert. Der von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte wahrgenommene Zusammenhalt<br />
<strong>in</strong>nerhalb von Familien wird also durch e<strong>in</strong> hohes Maß an Stabilität <strong>und</strong> Kont<strong>in</strong>uität<br />
gekennzeichnet.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
5.5.2 Kontakthäufigkeit<br />
E<strong>in</strong> weiteres Maß für die Bedeutung von Familie ist die Kontakthäufigkeit zwischen ihren Mitgliedern.<br />
Es ist sicherlich unbestritten, dass es e<strong>in</strong>en Zusammenhang zwischen Wohnentfernung<br />
<strong>und</strong> Kontakthäufigkeit gibt. Allerd<strong>in</strong>gs haben moderne Kommunikationsmedien dazu beigetragen,<br />
dass wechselseitige Kommunikation nicht länger an die physische Präsenz beider Interaktionspartner/Interaktionspartner<strong>in</strong>nen<br />
geknüpft ist. Anders sieht es h<strong>in</strong>gegen bei der Leistung<br />
von sozialer Unterstützung aus. Während kognitive, emotionale <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung<br />
bis zu e<strong>in</strong>em gewissen Grad auch ohne physische Präsenz des Hilfeleistenden erfolgen kann,<br />
trifft dies für <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung nicht zu. Im Folgenden wird die Kontakthäufigkeit<br />
der befragten Eltern zu ihren K<strong>in</strong>dern e<strong>in</strong>erseits bzw. zu ihren Eltern andererseits untersucht.<br />
Nachstehende Tabelle 5.7 gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die Kontakthäufigkeit der Befragten zu<br />
demjenigen ihrer K<strong>in</strong>der, mit dem sie am häufigsten kommunizieren.<br />
Tabelle 5.7:<br />
Kontakthäufigkeit zu K<strong>in</strong>dern nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
40-54 55-69 70-85 40-85<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
Täglich 74,3 72,8 50,6 41,8 47,7 42,3 59,5 52,4<br />
M<strong>in</strong>destens wöchentlich 19,6 20,3 37,4 48,2 40,5 46,1 30,9 38,2<br />
Weniger häufig 5,5 5,5 11,3 8,7 10,8 11,1 9,6 6,3<br />
Nie 0,7 1,5 0,8 1,2 1,1 0,3 0,8 1,1<br />
N 1.215 694 1.539 913 1.144 873 3.898 2.480<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 3.898) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 2.480), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede: p < .05.<br />
Insgesamt betrachtet, hat mehr als die Hälfte der Teilnehmer/Teilnehmer<strong>in</strong>nen am Alterssurvey<br />
täglich Kontakt zu m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ihrer K<strong>in</strong>der (vgl. rechte Spalte <strong>in</strong> Tabelle 5.7). Etwa 90<br />
Prozent stehen m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal pro Woche mit e<strong>in</strong>em ihrer K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung. Zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 gab es jedoch e<strong>in</strong>en deutlichen Rückgang der maximalen Kontakthäufigkeit –<br />
der Anteil von m<strong>in</strong>destens täglichen Interaktionen hat sich von knapp 60 auf wenig mehr als 50<br />
Prozent reduziert, zugleich nahm der Anteil der zweithäufigsten Kategorie („mehrmals wöchentlich“)<br />
ebenso deutlich zu. Es sei an dieser Stelle noch e<strong>in</strong>mal das Ergebnis tendenziell<br />
zunehmender Wohnentfernungen (vgl. Unterkapitel 5.4.1.) <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung gerufen. Im Vergleich<br />
zu 1996 hat sich die Wohnentfernung zum nächstwohnenden K<strong>in</strong>d erhöht – dementsprechend<br />
hat auch die Kontakthäufigkeit abgenommen. E<strong>in</strong>e nach Altersgruppen differenzierte Betrachtung<br />
offenbart, dass diese <strong>in</strong> Anbetracht des kurzen Zeitraums von sechs Jahren erstaunlich klare<br />
Veränderung ihren Ausgangspunkt <strong>in</strong> der mittleren <strong>und</strong> älteren Altersgruppe, also bei den 55-<br />
bis 85-Jährigen, hat. In diesen Familien leben die K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> der Regel nicht mehr im elterlichen<br />
Haushalt.<br />
Mit Hilfe e<strong>in</strong>es Kohortenvergleichs lässt sich diese Gruppe genauer e<strong>in</strong>grenzen: Demzufolge<br />
s<strong>in</strong>d von dieser <strong>Entwicklung</strong> vor allem die 52- bis 63-Jährigen betroffen, also die Menschen, die<br />
241
242<br />
Andreas Hoff<br />
sich kurz vor dem oder bereits im Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand bef<strong>in</strong>den. Während <strong>in</strong> der Geburtskohorte<br />
1945-50 54 Prozent täglich Kontakt zu ihren K<strong>in</strong>dern haben, s<strong>in</strong>d das bei den<br />
1939-44 Geborenen sogar nur 38 Prozent. Danach – bei den noch früher geborenen Jahrgängen<br />
– steigt der Anteil täglicher Kontakte wieder leicht auf über 40 Prozent an. Bisher ist die Familienforschung<br />
davon ausgegangen, dass am Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand e<strong>in</strong>e Rückbes<strong>in</strong>nung auf<br />
die Familie <strong>und</strong> auf andere Netzwerkaktivitäten stattf<strong>in</strong>det. Stellt dieser Bef<strong>und</strong> die Rückbes<strong>in</strong>nungsthese<br />
<strong>in</strong> Frage? Könnte es sich hier um die Vorboten langfristigen sozialen <strong>Wandel</strong>s handeln?<br />
Es wäre denkbar, dass gerade die Angehörigen der sogenannten „Sandwich-Generation“<br />
(Hörl & Kytir, 1998) angesichts der wachsenden Belastungen bei der Vere<strong>in</strong>barung von Familie<br />
<strong>und</strong> Beruf weniger Zeit für ihre Eltern haben. Auch die zunehmende Wohnentfernung könnte<br />
ihre Ursache dar<strong>in</strong> haben. Umgekehrt wäre jedoch genauso gut denkbar, dass die „aktiven Alten“<br />
weniger Zeit für ihre K<strong>in</strong>der haben. Dies sollte <strong>in</strong> zukünftigen vertiefenden Analysen genauer<br />
untersucht werden.<br />
Angesichts dieser deutlichen Veränderungen kommt der Längsschnittperspektive <strong>in</strong> dieser Frage<br />
besondere Bedeutung zu. Gibt es auch auf der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ebene mit zunehmendem Alter<br />
starke Veränderungen? Besonderes Augenmerk gilt angesichts des obigen Ergebnisses der mittleren<br />
Altersgruppe – <strong>und</strong> hierbei <strong>in</strong>sbesondere den Kohorten, die seit 1996 den Übergang <strong>in</strong> den<br />
Ruhestand vollzogen haben. Die nachstehende Abbildung 5.8 fasst die diesbezüglichen <strong>Entwicklung</strong>sverläufe<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 zusammen.<br />
Abbildung 5.8:<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Kontakthäufigkeit zu den K<strong>in</strong>dern nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Prozent<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
jüngste Altersgruppe<br />
(2002: 46-60)<br />
1996 2002<br />
täglich<br />
m<strong>in</strong>destens w öchentlich<br />
w eniger häufig<br />
nie<br />
Prozent<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
mittlere Altersgruppe<br />
(2002: 61-75)<br />
1996 2002<br />
täglich<br />
m<strong>in</strong>destens w öchentlich<br />
w eniger häufig<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996 <strong>und</strong> 2002 (n= 1.180), gewichtete Daten<br />
nie<br />
Prozent<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
älteste Altersgruppe<br />
(2002: 76-91)<br />
1996 2002<br />
täglich<br />
m<strong>in</strong>destens w öchentlich<br />
w eniger häufig<br />
Diese Abbildung 5.8 erbr<strong>in</strong>gt den Nachweis e<strong>in</strong>er klaren Abnahme der Kontakthäufigkeit zwischen<br />
Eltern <strong>und</strong> ihren erwachsenen K<strong>in</strong>dern. Ob es sich hierbei auch um e<strong>in</strong>en Alterseffekt<br />
handelt, kann nicht e<strong>in</strong>deutig beantwortet werden. Möglich wäre auch e<strong>in</strong> Periodeneffekt, der<br />
alle gleichermaßen betrifft. Für alle drei Altersgruppen kann im Verlauf der letzten sechs Jahre<br />
e<strong>in</strong> deutlicher Rückgang täglicher Kontakte bei paralleler Zunahme e<strong>in</strong>- bis mehrmaliger Inter-<br />
nie
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
aktionen pro Woche konstatiert werden. Dasselbe gilt auch im Vergleich zwischen der jüngsten<br />
<strong>und</strong> den beiden älteren Altersgruppen. Überraschenderweise gibt es jedoch e<strong>in</strong>e sehr große Ähnlichkeit<br />
der Verläufe <strong>in</strong> den beiden älteren Altersgruppen.<br />
Im Folgenden wenden wir uns nun der umgekehrten Seite der Beziehungsrolle der Befragten zu:<br />
der Häufigkeit ihrer Kontakte zu den eigenen Eltern. Tabelle 5.8 enthält den Altersgruppenvergleich<br />
der Kontakthäufigkeit zu den Eltern. Hat es hier ähnlich starke Veränderungen seit 1996<br />
gegeben wie <strong>in</strong> der Beziehung zu den erwachsenen K<strong>in</strong>dern?<br />
Zunächst fällt auf, dass Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte gr<strong>und</strong>sätzlich weniger häufig<br />
Kontakt zu ihren Eltern als zu ihren K<strong>in</strong>dern haben. Waren <strong>in</strong> der Interaktion mit K<strong>in</strong>dern tägliche<br />
Kontakte mit zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>em K<strong>in</strong>d die Regel, so dom<strong>in</strong>ieren im Verhältnis zu den Eltern<br />
e<strong>in</strong>- oder mehrmalige Kontakte pro Woche. Verglichen mit der Kontakthäufigkeit zu K<strong>in</strong>dern<br />
fällt auch der Anteil von e<strong>in</strong>em knappen Fünftel, der zu se<strong>in</strong>en Eltern weniger häufig als wöchentlich<br />
Kontakt hat, auf.<br />
Der Querschnittsvergleich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 zeigt <strong>in</strong> der Beziehung zu den Eltern mehr<br />
Stabilität als <strong>in</strong> dem zu K<strong>in</strong>dern. Allerd<strong>in</strong>gs gab es auch hier spürbare Veränderungen, vor allem<br />
<strong>in</strong> der Gruppe der 40- bis 54-jährigen Befragten: so ist <strong>in</strong> dieser Gruppe der Anteil täglicher<br />
Kontakte seit 1996 weiter zugunsten wöchentlicher Interaktionen zurückgegangen. In der mittleren<br />
Altersgruppe der 55- bis 69-Jährigen h<strong>in</strong>gegen nahm die Kontakthäufigkeit zu. In dieser<br />
Altersgruppe machen Gebrechlichkeit oder gar Pflegebedürftigkeit e<strong>in</strong> höheres Maß an Aufmerksamkeit<br />
erforderlich. Auch 2002 gab es <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen<br />
immerh<strong>in</strong> noch 10 Personen, die angaben, dass wenigstens e<strong>in</strong> Elternteil noch am Leben sei.<br />
Angesichts der ger<strong>in</strong>gen Fallzahl wurde jedoch auf e<strong>in</strong>e Auszählung <strong>und</strong> Interpretation der Ergebnisse<br />
verzichtet.<br />
Tabelle 5.8:<br />
Kontakthäufigkeit zu den Eltern nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
40-54 55-69 70-85 40-85<br />
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002<br />
Täglich 26,9 21,8 34,6 34,5 / / 28,5 24,4<br />
M<strong>in</strong>destens wöchentlich 49,3 56,8 44,3 48,2 / / 48,2 55,0<br />
Weniger häufig 21,9 19,4 20,4 15,9 / / 21,6 18,7<br />
Nie 1,9 1,9 0,8 1,4 / / 1,6 1,8<br />
N 1.173 804 385 200 14 10 1.572 1.014<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 1.572) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 1.014), gewichtete Daten<br />
Signifikanz der Unterschiede: p < .05.<br />
Abschließend erfolgt e<strong>in</strong> Blick auf die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>Entwicklung</strong>sverläufe für die beiden jüngeren<br />
Altersgruppen auf Basis der Panelstichprobe. Diese s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der nachfolgenden Abbildung<br />
5.9 dargestellt.<br />
243
Abbildung 5.9:<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Kontakthäufigkeit zu den Eltern nach Altersgruppen, 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Prozent<br />
244<br />
Jüngste Altersgruppe (2002: 46-60)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
täglich m<strong>in</strong>d estens wö chentlich<br />
wenig er häuf ig nie<br />
Prozent<br />
Mittlere Altersgruppe (2002: 61-75)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
täglich m<strong>in</strong>d estens wö chentlich<br />
wenig er häuf ig nie<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996 <strong>und</strong> 2002 (n= 417), gewichtete Daten<br />
Andreas Hoff<br />
Dabei unterscheiden sich die <strong>Entwicklung</strong>sverläufe zwischen beiden Altersgruppen wiederum<br />
gr<strong>und</strong>legend. Für Angehörige der jüngeren Altersgruppe des Alterssurveys kann relative Stabilität<br />
festgestellt werden. Während der Anteil täglicher Kontakte unverändert bei mehr als e<strong>in</strong>em<br />
Viertel lag, ist der Anteil seltenerer Interaktionen zugunsten wöchentlicher Kontakte zurückgegangen.<br />
Für die 2002 46- bis 60-Jährigen kann also <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e eher zunehmende Kontakthäufigkeit<br />
zu den Eltern festgestellt werden (vgl. die l<strong>in</strong>ke Grafik <strong>in</strong> Abbildung 5.9). Im Gegensatz<br />
dazu geht der für die 2002 61- bis 75-Jährigen ebenfalls konstatierte Anstieg wöchentlicher<br />
Interaktionen primär zu Lasten täglicher Kontakte (rechte Abbildung).<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Kontakthäufigkeit seit 1996 <strong>in</strong>sgesamt<br />
leicht verr<strong>in</strong>gert hat. Dies gilt sowohl im Kohorten- als auch im Längsschnittvergleich. Der<br />
Anteil täglicher Interaktionen hat sich verr<strong>in</strong>gert, während der Anteil e<strong>in</strong>- oder mehrmaliger<br />
Kontakte pro Woche zugenommen hat. Bei diesem Bef<strong>und</strong> könnte es sich zum e<strong>in</strong>en um e<strong>in</strong><br />
Indiz für größere wechselseitige Unabhängigkeit als Konsequenz fortgesetzter Individualisierungstendenzen<br />
<strong>in</strong> unserer Gesellschaft handeln. Es könnte sich jedoch auch um erste Anzeichen<br />
e<strong>in</strong>er beg<strong>in</strong>nenden Überlastung <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Akteure, die sich im Alltag zwischen Familie<br />
<strong>und</strong> Beruf aufreiben, handeln. Es sollte die Aufgabe vertiefender Analysen se<strong>in</strong>, dies näher zu<br />
ergründen.<br />
Zum Abschluss dieses Unterkapitels kann festgehalten werden, dass die Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte ihren Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern große Bedeutung beimessen.<br />
Das kommt sowohl <strong>in</strong> dem ausgeprägten Gefühl der Verb<strong>und</strong>enheit zwischen Eltern <strong>und</strong><br />
K<strong>in</strong>dern als auch <strong>in</strong> der subjektiven E<strong>in</strong>schätzung der vergangenen, gegenwärtigen <strong>und</strong> zukünftigen<br />
Familienbeziehungen zum Ausdruck. Im Widerspruch dazu stehen allerd<strong>in</strong>gs die tendenziell<br />
zunehmende Wohnentfernung <strong>und</strong> die tendenziell abnehmende Kontakthäufigkeit.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
5.6 Intergenerationale Unterstützung<br />
Im Zuge der öffentlichen Diskussion um den demografischen <strong>Wandel</strong> wird immer wieder die<br />
Sorge geäußert, dass die abnehmende K<strong>in</strong>derzahl <strong>in</strong> deutschen Familien bei gleichzeitiger Zunahme<br />
der Anzahl hochaltriger Personen <strong>in</strong> Zukunft zu e<strong>in</strong>er Überlastung familialer Unterstützungsnetzwerke<br />
führen wird. Das gängige Altersbild, welches dar<strong>in</strong> implizit zum Ausdruck<br />
kommt, ist das der hilfebedürftigen Alten, die auf Unterstützung ihrer K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> anderer Familienangehöriger<br />
angewiesen s<strong>in</strong>d. Dieses Image weist älteren Menschen e<strong>in</strong>e passive Rolle als<br />
Empfänger von Unterstützung zu. Nachdem sie im Verlauf ihres Lebens Unterstützung gegeben<br />
haben, s<strong>in</strong>d sie nun <strong>in</strong> der Rolle des Unterstützungsempfängers angelangt. Im Gegensatz zu<br />
dieser pauschalen Annahme mehren sich die H<strong>in</strong>weise aus der Forschung, dass gerade die Älteren<br />
ganz entscheidende Hilfen für die Jüngeren bereitstellen, etwa durch Betreuung ihrer Enkel<br />
– <strong>und</strong> nicht zuletzt durch die Gewährung f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung helfen, deren Lebensstandard<br />
zu verbessern bzw. aufrechtzuerhalten. Die Untersuchung dieser <strong>in</strong>tergenerationalen Transferströme<br />
hatte <strong>in</strong> den Auswertungen der ersten Welle des Alterssurveys e<strong>in</strong>en prom<strong>in</strong>enten<br />
Stellenwert. Die Ergebnisse s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>zwischen <strong>in</strong> zahlreichen Publikationen veröffentlicht worden<br />
(z. B. Kohli et al., 2000; Künem<strong>und</strong> & Hollste<strong>in</strong>, 2000; Motel & Szydlik, 1999; Motel-<br />
Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000). Wie gezeigt werden konnte, leisten ältere Menschen noch bis <strong>in</strong>s hohe Alter<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> soziale Unterstützung. Die Ausweitung der Datenbasis um e<strong>in</strong>e zweite Welle bietet erweiterte<br />
Möglichkeiten zur Beschreibung des Austauschs von sozialer Unterstützung.<br />
Gegenstand dieses Unterkapitels ist zunächst e<strong>in</strong>e umfassende Bestandsaufnahme von Leistung<br />
<strong>und</strong> Erhalt sozialer Unterstützung 9 . Während im Mittelpunkt des ersten Abschnitts die Erfassung<br />
tatsächlich geleisteter bzw. empfangener <strong>in</strong>formeller Hilfen steht, konzentriert sich der nachfolgende<br />
zweite Abschnitt auf das verfügbare personelle Unterstützungspotenzial. Zentral ist <strong>in</strong><br />
beiden Abschnitten wiederum die Identifikation von Alterseffekten <strong>und</strong> die Frage, <strong>in</strong>wieweit<br />
Veränderungen <strong>in</strong> diesem Bereich als Indikatoren sozialen <strong>Wandel</strong>s <strong>in</strong>terpretiert werden können.<br />
5.6.1 Leistung <strong>und</strong> Erhalt von sozialer Unterstützung<br />
Wie bereits gezeigt wurde, gibt es e<strong>in</strong>en Trend der Abnahme der Anzahl sozialer Kontakte mit<br />
zunehmendem Alter. Daraus auch e<strong>in</strong>e l<strong>in</strong>eare Abnahme des Empfangs <strong>und</strong> der Bereitstellung<br />
<strong>in</strong>formeller Unterstützung zu schlussfolgern, wäre allerd<strong>in</strong>gs voreilig. Künem<strong>und</strong> & Hollste<strong>in</strong><br />
(2000: 242ff.) konstatieren unterschiedliche Verläufe nach Unterstützungstyp <strong>und</strong> Geschlecht.<br />
Es gibt e<strong>in</strong>e Reihe e<strong>in</strong>flussreicher Typologien von Unterstützungsarten (beispielsweise Pearson,<br />
1990; Cutrona & Suhr, 1994). Diewald (1991) unterscheidet 16 Formen sozialer Unterstützung,<br />
differenziert nach den drei Dimensionen „konkrete Interaktion“, „Anerkennung“ <strong>und</strong> „emotionaler<br />
Unterstützung“ (Diewald, 1991).<br />
9 Im Verlauf dieses Kapitels werden die Begriffe „soziale Unterstützung“ <strong>und</strong> „<strong>in</strong>formelle Unterstützung“ synonym<br />
gebraucht.<br />
245
246<br />
Andreas Hoff<br />
Die folgende Analyse <strong>in</strong>strumenteller Unterstützungsformen berücksichtigt alle<strong>in</strong> konkrete Interaktionsformen:<br />
(a) kognitive, (b) emotionale, (c) <strong>in</strong>strumentelle <strong>und</strong> (d) f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung<br />
(Künem<strong>und</strong> & Hollste<strong>in</strong>, 2000; Kohli et al., 2000).<br />
Unterstützungsleistung <strong>und</strong> Unterstützungserhalt wurden im Alterssurvey folgendermaßen operationalisiert.<br />
Für jeden e<strong>in</strong>zelnen Unterstützungstyp (kognitiv, emotional, <strong>in</strong>strumentell, f<strong>in</strong>anziell)<br />
wurde zunächst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ersten Schritt die erwartete Verfügbarkeit, also das Unterstützungspotential,<br />
erfragt. Dies geschah aufgr<strong>und</strong> der folgenden Frage (Beispiel für Erfassung<br />
kognitiver Unterstützung, Frage 700): „Wenn Sie wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen<br />
haben: Hätten Sie da jemanden, den Sie um Rat fragen können?“ E<strong>in</strong>e analoge Filterfrage<br />
gab es auch für alle anderen Unterstützungstypen. Emotionale Unterstützung wurde durch folgende<br />
Frage erfasst: „An wen könnten Sie sich wenden, wenn Sie e<strong>in</strong>mal Trost oder Aufmunterung<br />
brauchen, z.B. wenn Sie traurig s<strong>in</strong>d.“ E<strong>in</strong>e Besonderheit betrifft die Abfrage <strong>in</strong>strumenteller<br />
Unterstützung, die mittels „Arbeiten im Haushalt, z.B. beim Saubermachen, bei kle<strong>in</strong>en Reparaturen<br />
oder beim E<strong>in</strong>kaufen“ operationalisiert wurde: Hier wurden nur Personen berücksichtigt,<br />
die nicht im selben Haushalt leben. F<strong>in</strong>anzielle Unterstützung wurde mit Hilfe der Frage<br />
nach „Geldgeschenken, größeren Sachgeschenken oder regelmäßiger f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung“<br />
abgefragt. Tatsächliche Inanspruchnahme oder Leistung von Hilfen wurde mit Hilfe der<br />
Frage nach der Unterstützungshäufigkeit <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten gemessen (für e<strong>in</strong>e<br />
detaillierte Darstellung für die Auswahl dieser Erhebungs<strong>in</strong>strumente vgl. Künem<strong>und</strong> &<br />
Hollste<strong>in</strong>, 2000).<br />
In der folgenden Darstellung geht es nicht um die erwartete Verfügbarkeit <strong>in</strong>formeller Unterstützung,<br />
sondern um das härtere Kriterium der tatsächlichen Inanspruchnahme <strong>in</strong>nerhalb der<br />
vergangenen 12 Monate. Diese wird <strong>in</strong> Abbildung 5.10 auf der nächsten Seite der im gleichen<br />
Zeitraum geleisteten sozialen Unterstützung gegenübergestellt, um die Doppelrolle von Menschen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte als Empfänger/Empfänger<strong>in</strong> von Unterstützung <strong>und</strong> als Unterstützungsleistende/Unterstützungsleistender<br />
von Anfang an im Zusammenhang betrachten zu<br />
können. Die Betrachtung beider Seiten ist wichtig, um der realen Lebenssituation älterer Menschen<br />
<strong>und</strong> ihrer E<strong>in</strong>bettung <strong>in</strong> soziale Netzwerke gerecht zu werden. Obwohl <strong>in</strong> familialen Netzen<br />
Unterstützung primär aufgr<strong>und</strong> des Bedürftigkeitspr<strong>in</strong>zips <strong>und</strong> nicht <strong>in</strong> Erwartung von Gegenleistungen<br />
(Reziprozitätspr<strong>in</strong>zip) bereitgestellt wird, so ist dennoch unbestritten, dass die<br />
Fähigkeit zur Reziprozität e<strong>in</strong>e wichtige Quelle von Selbstwertgefühl für die Empfänger sozialer<br />
Unterstützung <strong>und</strong> damit nicht zuletzt Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Unterstützung<br />
ist.<br />
In Abbildung 5.10 wurden Angaben von all jenen berücksichtigt, die angaben, überhaupt Zugang<br />
zu den genannten Unterstützungstypen zu haben. Dies ist ke<strong>in</strong>eswegs selbstverständlich.<br />
So verfügte zu beiden Erhebungszeitpunkten ca. e<strong>in</strong> Zehntel der Befragten über ke<strong>in</strong>e Personen,<br />
die ihnen kognitive Unterstützung im S<strong>in</strong>ne von Rat <strong>und</strong> Entscheidungshilfe oder emotionale<br />
Unterstützung im S<strong>in</strong>ne von Trost <strong>und</strong> Zuwendung leisten könnten. Dabei handelt es sich nicht<br />
um Personen, die <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten ke<strong>in</strong>e solche Hilfen benötigt haben, sondern um<br />
Menschen, denen diese Unterstützungsformen nach eigener E<strong>in</strong>schätzung auch im Bedarfsfall<br />
nicht zur Verfügung stehen. Jeder zehnte Mensch <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte muss also <strong>in</strong> Krisensituationen<br />
ohne kognitive <strong>und</strong> emotionale Unterstützung auskommen. Im Folgenden liegt
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
der Schwerpunkt der Darstellung jedoch zunächst auf Leistung <strong>und</strong> Erhalt von <strong>in</strong>formeller Unterstützung.<br />
Abbildung 5.10 gibt diesbezüglich e<strong>in</strong>en ersten Überblick.<br />
Von denjenigen Personen, die überhaupt von Zugang zu emotionaler <strong>und</strong> kognitiver Unterstützung<br />
berichtet hatten, hatten mehr als drei Viertel <strong>in</strong> den vorangegangenen 12 Monaten beide<br />
Unterstützungstypen sowohl empfangen als auch selbst geleistet. Beim Vergleich von geleisteter<br />
(l<strong>in</strong>ke Grafik) <strong>und</strong> erhaltener (rechte Grafik) Unterstützung fällt auf, dass Menschen <strong>in</strong> der<br />
zweiten Lebenshälfte bei allen Unterstützungstypen mehr Unterstützung an andere leisten als sie<br />
selbst <strong>in</strong> Anspruch nehmen. Dies gilt für kognitive, emotionale, <strong>in</strong>strumentelle <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzielle<br />
Unterstützung. Besonders groß ist diese Diskrepanz h<strong>in</strong>sichtlich f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung –<br />
hier greifen ältere Menschen anderen mehr als viermal so häufig unter die Arme als sie selbst<br />
f<strong>in</strong>anzielle Hilfe <strong>in</strong> Anspruch nehmen. So gaben im Jahre 2002 31,3 Prozent der Befragten an,<br />
andere f<strong>in</strong>anziell unterstützt zu haben während gerade e<strong>in</strong>mal 7,5 Prozent selbst <strong>in</strong>formelle<br />
Geldleistungen <strong>in</strong> Empfang genommen hatten. Aber auch der Anteil derer, die <strong>in</strong> den letzten 12<br />
Monaten emotionale Unterstützung geleistet haben, ist mit 83,9 Prozent (2002) um mehr als 10<br />
Prozent höher als der derjenigen, die im selben Zeitraum selbst getröstet werden mussten.<br />
Abbildung 5.10:<br />
Geleistete vs. erhaltene <strong>in</strong>formelle Unterstützung <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten, 1996 u. 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
kognitiv<br />
emotional<br />
<strong>in</strong>strumentell<br />
f<strong>in</strong>anziell<br />
Geleistete soziale Unterstützung<br />
29,6<br />
31<br />
34,3<br />
31,3<br />
87,7<br />
84,7<br />
84,2<br />
83,9<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
100<br />
84,7<br />
81,9<br />
75,2<br />
73,4<br />
80<br />
Erhaltene soziale Unterstützung<br />
60<br />
30,6<br />
40<br />
2002 1996<br />
25<br />
20<br />
8,4<br />
7,5<br />
0<br />
kognitiv<br />
emotional<br />
<strong>in</strong>strumentell<br />
f<strong>in</strong>anziell<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.838) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 3.084), gewichtete Daten<br />
Bei <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung fällt der positive Saldo von geleisteter vs. erhaltener Unterstützung<br />
mit 4,6 Prozent etwas ger<strong>in</strong>ger, aber immer noch deutlich aus. Am ausgeglichensten ist<br />
das Verhältnis bei kognitiver Unterstützung – hier beträgt der Unterschied nur knapp 3 Prozent.<br />
Auch im Vergleich der beiden Untersuchungszeitpunkte 1996 <strong>und</strong> 2002 unterscheiden sich Unterstützungsleistung<br />
<strong>und</strong> Unterstützungserhalt signifikant vone<strong>in</strong>ander. Dabei fällt auf, dass sich<br />
der Umfang geleisteter Unterstützung kaum verändert hat. Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
leisteten 2002 genauso viel Unterstützung wie sechs Jahre zuvor, mit Ausnahme von <strong>in</strong>strumenteller<br />
Unterstützung. Im Gegensatz dazu hat sich das schon 1996 bestehende Ungleichgewicht<br />
zwischen Leistung <strong>und</strong> Erhalt von sozialer Unterstützung (vgl. auch Kohli et al., 2000)<br />
247
248<br />
Andreas Hoff<br />
seitdem sogar noch verschärft: Menschen im Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren erhielten 2002 <strong>in</strong><br />
allen Unterstützungsarten weniger Hilfe als noch Mitte der 1990er Jahre.<br />
Am deutlichsten fällt dieser Rückgang bei <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung (m<strong>in</strong>us 5,6 Prozent)<br />
aus. Nur ger<strong>in</strong>gfügig verändert hat sich der Umfang <strong>in</strong>formeller f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung, wobei<br />
hier allerd<strong>in</strong>gs auch schon 1996 gerade e<strong>in</strong>mal 8,4 Prozent der Befragten angaben, überhaupt<br />
f<strong>in</strong>anzielle Hilfen erhalten zu haben.<br />
E<strong>in</strong>e differenziertere Analyse versucht, diesen Indikatoren e<strong>in</strong>es möglicherweise bereits jetzt<br />
erkennbaren sozialen <strong>Wandel</strong>s aufzuspüren. Den Anfang macht dabei wiederum e<strong>in</strong>e nach Altersgruppen<br />
differenzierte Betrachtung der e<strong>in</strong>zelnen Unterstützungstypen auf Gr<strong>und</strong>lage der<br />
Querschnittsdaten von Basisstichprobe 1996 <strong>und</strong> Replikationsstichprobe 2002. E<strong>in</strong> zentraler<br />
Aspekt der gewählten Darstellungsform ist die Gegenüberstellung von Unterstützungsleistung<br />
<strong>und</strong> Unterstützungserhalt, also von „Geben <strong>und</strong> Nehmen“.<br />
Abbildung 5.11:<br />
Geleistete vs. erhaltene <strong>in</strong>formelle Unterstützung <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten nach<br />
Altersgruppen, 1996 u. 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85<br />
Geleistet<br />
(1) Kognitiv (2) Emotional<br />
83,3<br />
80,2<br />
74,6<br />
91,5<br />
91<br />
86,8<br />
0 20 40 60 80 100<br />
18,1<br />
15,6<br />
2002 1996<br />
Geleistet<br />
41,8<br />
37,3<br />
32,8<br />
29,1<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
100<br />
88<br />
84,9<br />
82,5<br />
80,2<br />
80,2<br />
78,5<br />
80<br />
60<br />
Erhalten<br />
40<br />
2002 1996<br />
20<br />
0<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85<br />
Geleistet<br />
79<br />
82,2<br />
74,2<br />
87,8<br />
83,4<br />
89,3<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
(3) Instrumentell (4) F<strong>in</strong>anziell<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Erhalten<br />
41,3<br />
36,2<br />
40<br />
2002 1996<br />
29,8<br />
22,7<br />
26,4<br />
20,7<br />
20<br />
0<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85<br />
Geleistet<br />
29,3<br />
27,1<br />
32,4<br />
31<br />
32,6<br />
36,6<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
100<br />
100<br />
77,5<br />
78,2<br />
73,2<br />
72,8<br />
68,3<br />
73<br />
80<br />
80<br />
60<br />
Erhalten<br />
40<br />
2002 1996<br />
60<br />
Erhalten<br />
40<br />
2002 1996<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.838) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 3.084), gewichtet<br />
12,7<br />
11,6<br />
20<br />
20<br />
5,4<br />
5,5<br />
2,7<br />
3,5<br />
0<br />
0<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85<br />
40 - 54<br />
55 - 69<br />
70 - 85
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Abgesehen von wenigen Ausnahmen erbr<strong>in</strong>gen Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
mehr soziale Unterstützung als sie von anderen erhalten. Insgesamt ist festzuhalten,<br />
dass die 40- bis 54-Jährigen (entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit) bei allen immateriellen<br />
Unterstützungsarten den größten Anteil der Hilfeleistungen erbr<strong>in</strong>gen. Im Gegensatz dazu leisten<br />
die 55- bis 85-Jährigen den größten Teil der f<strong>in</strong>anziellen Unterstützung. Nach Unterstützungstypen<br />
differenziert ergibt sich folgendes Bild:<br />
Kognitive Unterstützung: Rat <strong>und</strong> Entscheidungshilfen werden am häufigsten von den 40- bis<br />
54-Jährigen erbracht – allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d sie auch diejenigen, die umgekehrt am häufigsten kognitive<br />
Unterstützung <strong>in</strong> Anspruch nehmen. Während die Ausgangssituation aus dem Jahr 1996<br />
nahezu e<strong>in</strong> Gleichgewicht von Leistung <strong>und</strong> Erhalt kognitiver Unterstützung ergab, hat es seither<br />
e<strong>in</strong>en leichten Rückgang sowohl von Leistung als auch des Erhalts von Rat <strong>und</strong> Entscheidungshilfen<br />
gegeben 10 . Auffällig ist dabei vor allem der reduzierte Anteil geleisteter Unterstützung<br />
<strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe, die im Ergebnis dieses Rückgangs nun mehr kognitive Unterstützung<br />
empfängt, als sie selbst leistet.<br />
Emotionale Unterstützung: Hier ergibt sich e<strong>in</strong> ähnliches Bild wie bei kognitiver Unterstützung<br />
– <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe der 40- bis 54-Jährigen wird sowohl am häufigsten Trost <strong>und</strong><br />
Aufmunterung an andere geleistet, als auch selbst <strong>in</strong> Anspruch genommen. Verglichen mit 1996<br />
dom<strong>in</strong>iert Kont<strong>in</strong>uität der Verhältnisse. Gestört wird dieser allgeme<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>druck der Stabilität<br />
jedoch durch deutliche Veränderungen <strong>in</strong> zwei Altersgruppen: (a) Die 55- bis 69-Jährigen erhielten<br />
2002 deutlich weniger emotionale Unterstützung als noch sechs Jahre zuvor; (b) Ähnlich<br />
wie bei der kognitiven Unterstützung leisteten die 70- bis 85-Jährigen 2002 erkennbar weniger<br />
emotionale Unterstützung.<br />
Instrumentelle Unterstützung: Das für beide Erhebungszeitpunkte beobachtete typische Muster<br />
ist entsprechend der jeweiligen körperlichen Voraussetzungen e<strong>in</strong> Plus geleisteter <strong>in</strong>strumenteller<br />
Hilfen <strong>in</strong> der jüngeren <strong>und</strong> der mittleren Altersgruppe, während die 70- bis 85-Jährigen mehr<br />
<strong>in</strong>strumentelle Unterstützung <strong>in</strong> Anspruch nehmen, als sie selbst leisten. Dem Gr<strong>und</strong>satz nach<br />
hat sich daran <strong>in</strong> den letzten sechs Jahren nichts geändert. Der auf der vorigen Seite konstatierte<br />
allgeme<strong>in</strong>e, erhebliche Rückgang von Leistung <strong>und</strong> Erhalt <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung ist<br />
Abbildung 5.11 zufolge e<strong>in</strong> universelles Phänomen, das alle Altersgruppen gleichermaßen betrifft.<br />
Die Reduktionsraten s<strong>in</strong>d jedoch sowohl auf der Leistungs- als auch auf der Empfangsseite<br />
<strong>in</strong> der jüngeren Altersgruppe am höchsten.<br />
F<strong>in</strong>anzielle Unterstützung: Im H<strong>in</strong>blick auf f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung fällt das bereits aus der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Darstellung <strong>in</strong> Abbildung 5.10 bekannte deutliche Missverhältnis zwischen Unterstützungsleistung<br />
<strong>und</strong> den <strong>in</strong> weitaus ger<strong>in</strong>gerem Umfang erhaltenen f<strong>in</strong>anziellen Hilfen <strong>in</strong>s<br />
Auge. Der ger<strong>in</strong>ge Umfang des Erhalts <strong>in</strong>formeller f<strong>in</strong>anzieller Hilfen durch Menschen <strong>in</strong> der<br />
zweiten Lebenshälfte betrifft alle Altersgruppen, wobei die Divergenz zwischen Leistung <strong>und</strong><br />
eigener Inanspruchnahme f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe e<strong>in</strong>deutig am<br />
stärksten ausgeprägt ist. Während 40- bis 54-Jährige mehr als doppelt so häufig f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung<br />
leisten wie sie selbst empfangen, tun dies 55- bis 69-Jährige sogar mehr als sechs-<br />
10 Die e<strong>in</strong>zige Ausnahme davon ist <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe zu f<strong>in</strong>den, bei der die Häufigkeit von Hilfeleistungen<br />
konstant geblieben ist.<br />
249
250<br />
Andreas Hoff<br />
mal <strong>und</strong> 70- bis 85-Jährige mehr als elfmal so oft. Der schon aus Welle 1 bekannte ger<strong>in</strong>ge Umfang<br />
des Erhalts f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung (Kohli et al., 2000) hat sich praktisch nicht verändert.<br />
Bei der Leistung f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung s<strong>in</strong>d für die jüngere <strong>und</strong> die ältere Altersgruppe<br />
ger<strong>in</strong>gfügige Verr<strong>in</strong>gerungen festzustellen. Auffallend ist zudem e<strong>in</strong> deutlicher Anstieg der<br />
Unterstützungshäufigkeit durch die 55- bis 69-Jährigen.<br />
Wie <strong>in</strong> den Abbildungen 5.10 <strong>und</strong> 5.11 gezeigt wurde, waren Leistung <strong>und</strong> Erhalt sozialer Unterstützung<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 <strong>in</strong> Anbetracht des vergleichsweise kurzen Beobachtungszeitraums<br />
zum Teil erheblichen Veränderungen ausgesetzt. Bei diesen Veränderungen handelte<br />
es sich überwiegend um leichte Rückgänge des Erhalts bzw. der Inanspruchnahme <strong>in</strong>formeller<br />
Unterstützung. Offenbar handelt es sich hier um Anzeichen e<strong>in</strong>es sich vollziehenden sozialen<br />
<strong>Wandel</strong>s. Weniger klar ist die Interpretation dieser Veränderungen. Wenn die Menschen <strong>in</strong> der<br />
zweiten Lebenshälfte weniger soziale Unterstützung erhalten, so könnte dies auf e<strong>in</strong>en Mangel<br />
an Unterstützungsressourcen <strong>in</strong> ihrem familialen Umfeld h<strong>in</strong>deuten. Genauso gut könnte e<strong>in</strong>e<br />
zurückgehende Inanspruchnahme <strong>in</strong>formeller Unterstützungsleistungen aber auch e<strong>in</strong>e Verbesserung<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Lebensbed<strong>in</strong>gungen dieser Menschen bedeuten, die e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme<br />
<strong>in</strong>formeller Unterstützung nicht mehr benötigt.<br />
Im Folgenden wird untersucht, wie sich Leistung <strong>und</strong> Erhalt von sozialer Unterstützung mit<br />
zunehmendem Alter entwickeln. Die Datenbasis für diese Längsschnittanalysen bildet dabei die<br />
Panelstichprobe. Zunächst erfolgt die Darstellung der <strong>Entwicklung</strong> der Unterstützungsleistung.<br />
In Abbildung 5.12 werden die entsprechenden <strong>Entwicklung</strong>sverläufe für jede Altersgruppe jeweils<br />
nach Unterstützungstyp separat abgebildet.<br />
Abbildung 5.12:<br />
<strong>Entwicklung</strong> geleisteter Unterstützung mit zunehmendem Alter, 1996 u. 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Kognitive<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
älteste<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Emotionale<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
älteste<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Instrumentelle<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
älteste<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 <strong>und</strong> 2002 Panelstichprobe (n= 1.524), gewichtet<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
F<strong>in</strong>anzielle<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
Abbildung 5.12 offenbart klare Alterseffekte <strong>in</strong> Bezug auf zwei Unterstützungstypen: Mit zunehmendem<br />
Alter nimmt die Leistung kognitiver <strong>und</strong> <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung ab. Im Altersgruppenvergleich<br />
ist zudem e<strong>in</strong>e beschleunigte Abnahme von jüngerer zu mittlerer <strong>und</strong> noch<br />
stärker von mittlerer zu älterer Altersgruppe zu beobachten, was an dem steileren Kurvenverlauf<br />
erkennbar ist.<br />
älteste
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Weniger e<strong>in</strong>deutig stellt sich die <strong>Entwicklung</strong> der Leistung emotionaler <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung<br />
dar. Während sich die emotionale Unterstützungsleistung durch Angehörige der jüngeren<br />
<strong>und</strong> der älteren Altersgruppe durch Konstanz auf hohem Niveau auszeichnen, ist es <strong>in</strong> der<br />
mittleren Altersgruppe zu e<strong>in</strong>em spürbaren Rückgang der Unterstützungsleistung gekommen.<br />
Ganz anders stellt sich das Bild im H<strong>in</strong>blick auf f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung dar. Hier ist der Leistungsumfang<br />
<strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe nahezu konstant geblieben, während er <strong>in</strong> den beiden<br />
anderen Gruppen durch gegenläufige Trends charakterisiert wird: E<strong>in</strong>er deutlichen Zunahme <strong>in</strong><br />
der Gruppe der 2002 46- bis 60-Jährigen steht e<strong>in</strong> ebenso deutlicher Rückgang f<strong>in</strong>anzieller Unterstützungsleistung<br />
durch die 2002 76- bis 91-Jährigen gegenüber.<br />
In e<strong>in</strong>em nächsten Schritt erfolgt die Darstellung der Ergebnisse für die Gegenseite, also die<br />
<strong>Entwicklung</strong> des Erhalts sozialer Unterstützung durch Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
mit zunehmendem Alter (vgl. Abbildung 5.13 unten).<br />
Abbildung 5.13:<br />
<strong>Entwicklung</strong> erhaltener Unterstützung mit zunehmendem Alter, 1996 u. 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Kognitive<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
älteste<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Emotionale<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
älteste<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Instrumentelle<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
älteste<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 <strong>und</strong> 2002 Panelstichprobe (n= 1.524), gewichtet<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
F<strong>in</strong>anzielle<br />
Unterstützung<br />
1996 2002<br />
jüngste mittlere<br />
Wie schon im H<strong>in</strong>blick auf Unterstützungsleistung gibt es auch bei der Inanspruchnahme kognitiver<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung klare Alterseffekte. Die <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Bezug auf den<br />
Erhalt kognitiver Unterstützung verläuft analog zu dem für die Leistung kognitiver Hilfe: Mit<br />
zunehmendem Alter nimmt der Empfang bzw. die Inanspruchnahme dieser Unterstützungsform<br />
<strong>in</strong> allen Altersgruppen ab. Dabei nehmen Menschen <strong>in</strong> der älteren Altersgruppe weniger häufig<br />
kognitive Hilfen <strong>in</strong> Anspruch als Jüngere. Umgekehrt nehmen Angehörige der jüngeren Altersgruppe<br />
öfter als Ältere diese Form der Unterstützung <strong>in</strong> Anspruch.<br />
Im Gegensatz zur Leistung verläuft beim Erhalt <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung die <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> den Altersgruppen nicht synchron. Während die 2002 46- bis 60-Jährigen e<strong>in</strong>e spürbare Verr<strong>in</strong>gerung<br />
des Erhalts <strong>in</strong>strumenteller Hilfen berichteten, nahmen die 76- bis 91-Jährigen 2002<br />
erheblich mehr <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung <strong>in</strong> Anspruch als noch sechs Jahre zuvor. Ursache<br />
ist der mit dem E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Hochaltrigkeit e<strong>in</strong>hergehende klare Anstieg der Bedürftigkeit.<br />
Wenig verändert hat sich h<strong>in</strong>gegen für die 61- bis 75-Jährigen (2002).<br />
älteste<br />
251
252<br />
Andreas Hoff<br />
Weniger ausgeprägt s<strong>in</strong>d die Alterseffekte <strong>in</strong> Bezug auf f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung. Während die<br />
2002 61- bis 91-Jährigen gleichbleibend wenig f<strong>in</strong>anzielle Hilfen erhalten, gaben die Angehörigen<br />
der jüngeren Altersgruppe e<strong>in</strong>en deutlichen Rückgang der Inanspruchnahme <strong>in</strong>formeller<br />
f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung an.<br />
Am wenigsten e<strong>in</strong>deutig s<strong>in</strong>d die <strong>Entwicklung</strong>srichtungen für den Erhalt emotionaler Unterstützung.<br />
Die älteste Altersgruppe berichtete e<strong>in</strong>en massiven Anstieg (um fast 16 Prozent) der Inanspruchnahme<br />
von Trost <strong>und</strong> Aufmunterung. E<strong>in</strong>e Veränderung <strong>in</strong> dieser Größenordnung ist<br />
<strong>in</strong>nerhalb des kurzen Betrachtungszeitraums von nur sechs Jahren äußerst bemerkenswert, auch<br />
wenn der E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Hochaltrigkeit <strong>und</strong> die damit e<strong>in</strong>hergehenden ges<strong>und</strong>heitlichen Probleme<br />
die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er verstärkten Nachfrage nach emotionaler Unterstützung nur zu verständlich<br />
ersche<strong>in</strong>en lässt. E<strong>in</strong> gegenläufiger Trend lässt sich für die mittlere Altersgruppe ausmachen,<br />
die 2002 deutlich weniger Trost <strong>und</strong> Aufmunterung erhalten hat. Relativ konstant<br />
geblieben ist h<strong>in</strong>gegen das Unterstützungsniveau für die Jüngeren.<br />
Wie dieser Abschnitt zu Leistung <strong>und</strong> Erhalt von sozialer Unterstützung nachdrücklich belegt,<br />
s<strong>in</strong>d die Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ke<strong>in</strong>eswegs die Kostgänger der jüngeren Generationen<br />
– im Gegenteil, sie leisten mehr Unterstützung als sie selbst erhalten. Während die<br />
ältere Generation auch 2002 genauso viel Unterstützung leistete wie vor sechs Jahren, erhielt sie<br />
im Gegenzug sogar noch weniger Unterstützung von anderen.<br />
5.6.2 Unterstützungspersonen<br />
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt der Umfang der Leistung <strong>und</strong> des Erhalts sozialer<br />
Unterstützung umfassend beleuchtet wurde, wenden wir uns jetzt der Frage zu, wer die wesentlichen<br />
Unterstützer von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> wen diese im Gegenzug<br />
vorwiegend unterstützen. Auch hier gibt es e<strong>in</strong> zweigeteiltes Forschungs<strong>in</strong>teresse: 1.) Mit zunehmendem<br />
Alter verändert sich die Zusammensetzung familialer Netze aufgr<strong>und</strong> des Ablebens<br />
der älteren <strong>und</strong> des „Nachrückens“ jüngerer Generationen. Aus der Längsschnittperspektive ist<br />
also <strong>in</strong>sbesondere von Interesse, ob Befragte, die nun sechs Jahre älter s<strong>in</strong>d, spürbare personelle<br />
Veränderungen ihres Unterstützungspotentials berichten. Das gilt <strong>in</strong> besonderem Maße für die<br />
ältesten Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Teilnehmer am Alterssurvey. 2.) Wenngleich gr<strong>und</strong>legende Veränderungen<br />
im Querschnitt weniger wahrsche<strong>in</strong>lich s<strong>in</strong>d, so ist doch e<strong>in</strong>e kontrollierende Überprüfung<br />
etwaiger Kohorteneffekte ebenfalls s<strong>in</strong>nvoll.<br />
Insgesamt zeichnet sich der personelle Umfang sozialer Unterstützungsnetze durch e<strong>in</strong> hohes<br />
Maß an Stabilität aus. Da im Kohortenvergleich ke<strong>in</strong>e bedeutsamen Unterschiede festgestellt<br />
werden konnten, wird hier auf e<strong>in</strong>e Darstellung verzichtet. Die folgenden Ausführungen konzentrieren<br />
sich dementsprechend alle<strong>in</strong> auf die Panelstichprobe zur Analyse der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> im Längsschnitt. Dabei wird zunächst die Anzahl der genannten potentiellen Unterstützer<br />
<strong>in</strong>s Auge genommen. Abbildung 5.14 gibt den <strong>Entwicklung</strong>sverlauf der durchschnittlich<br />
verfügbaren Anzahl von kognitiven, emotionalen, <strong>in</strong>strumentellen <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anziellen Helfern,<br />
differenziert nach Altersgruppen, zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 wieder.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Abbildung 5.14:<br />
<strong>Entwicklung</strong> der durchschnittlich verfügbaren Anzahl von Unterstützungspersonen<br />
nach Altersgruppen, 1996 u. 2002 (arithmetisches Mittel)<br />
Anzahl Potentielle Helfer<br />
Jüngere Altersgr. (2002: 46-60)<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
1996 2002<br />
(1) kognitiv<br />
(2) emotional<br />
(3) <strong>in</strong>strumentell<br />
(4) f<strong>in</strong>anziell<br />
Anzahl Potentielle Helfer<br />
Mittlere Altersgr. (2002: 61-75)<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
1996 2002<br />
(1) kognitiv<br />
(2) emotional<br />
(3) <strong>in</strong>strumentell<br />
(4) f<strong>in</strong>anziell<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 <strong>und</strong> 2002 Panelstichprobe (n= 1.524), gewichtet<br />
Anzahl Potentielle Helfer<br />
Ältere Altersgr. (2002: 76-91)<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
1996 2002<br />
(1) kognitiv<br />
(2) emotional<br />
(3) <strong>in</strong>strumentell<br />
(4) f<strong>in</strong>anziell<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte verfügen im Durchschnitt über zwei Personen, die ihnen<br />
bei Bedarf mit Rat <strong>und</strong> Entscheidungshilfe zur Seite stehen können. Fast genauso viele Personen<br />
leisten emotionale Unterstützung. Deutlich weniger Personen helfen im Haushalt mit oder<br />
stellen f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung bereit. Der personelle Umfang sozialer Unterstützungsnetze<br />
zeichnet sich im Längsschnitt durch e<strong>in</strong> hohes Maß an Konstanz aus. Für die im Jahre 2002 46-<br />
bis 75-Jährigen hat sich diesbezüglich <strong>in</strong> ihren vergangenen sechs Lebensjahren nur sehr wenig<br />
verändert. Etwas anders stellt sich die Situation für die 76- bis 91-Jährigen dar. Der Übergang <strong>in</strong><br />
die Hochaltrigkeit ist für viele von ihnen mit e<strong>in</strong>er deutlichen Abnahme der Zahl potentieller<br />
kognitiver <strong>und</strong> emotionaler Helfer <strong>und</strong> Helfer<strong>in</strong>nen verb<strong>und</strong>en (vgl. rechte Grafik). Zugenommen<br />
hat h<strong>in</strong>gegen die Zahl von Personen, die Hilfe im Haushalt verrichteten. Erst <strong>in</strong> diesem<br />
Alter kommt die Notwendigkeit dazu voll zum Tragen. Es ist auf der anderen Seite e<strong>in</strong> schönes<br />
Ergebnis, dass die <strong>in</strong>formellen Unterstützungsnetzwerke nach wie vor <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, dieses<br />
im höheren Lebensalter erwachsende Bedürfnis zu erfüllen.<br />
Bemerkenswert ist zudem, dass Frauen gr<strong>und</strong>sätzlich über mehr kognitive <strong>und</strong> emotionale Unterstützer<br />
<strong>und</strong> Unterstützer<strong>in</strong>nen verfügen als Männer, wobei dieser Unterschied mit dem um<br />
sechs Jahre höheren Alter im Jahre 2002 noch zugenommen hat. Ke<strong>in</strong>e signifikanten geschlechtsspezifischen<br />
Unterschiede gibt es h<strong>in</strong>gegen bei <strong>in</strong>strumenteller <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung.<br />
Wurden noch 1996 <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern deutlich mehr potentielle <strong>in</strong>strumentelle Helfer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Helfer angegeben, so gibt es hier heute ke<strong>in</strong>e signifikanten Unterschiede zwischen<br />
beiden Landesteilen mehr. Der Osten hat sich dem niedrigeren westdeutschen Niveau angeglichen.<br />
Umgekehrt stehen den Menschen <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern nun deutlich mehr emotionale<br />
Unterstützer zur Verfügung als jenen <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern – <strong>und</strong> das obwohl noch<br />
vor sechs Jahren ke<strong>in</strong>e bedeutsamen Unterschiede feststellbar waren.<br />
253
254<br />
Andreas Hoff<br />
Während es sich bei den eben beschriebenen <strong>Entwicklung</strong>strends vorwiegend um Alterseffekte<br />
gehandelt haben dürfte, folgen nun Querschnittsanalysen mit dem Ziel der Identifikation sozialer<br />
Trends, die auf e<strong>in</strong>en nachhaltigen sozialen <strong>Wandel</strong> der Unterstützungsbeziehungen <strong>in</strong> der<br />
Familie h<strong>in</strong>deuten könnten. Datenbasis s<strong>in</strong>d dementsprechend Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
– <strong>und</strong> nicht die Panelstichprobe. Der Fokus der Analysen richtet sich jedoch auf dieselben<br />
Personengruppen, die bei der Vorstellung der Längsschnittanalysen im Mittelpunkt standen.<br />
Bezogen auf den Anteil von Familienmitgliedern am gesamten <strong>in</strong>formellen Unterstützungspotential<br />
dom<strong>in</strong>ieren Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Stabilität auf hohem Niveau. Die Familie stellt bei allen Unterstützungstypen<br />
den mit weitem Abstand größten Anteil potentieller Helfer, mit der aus der<br />
Längsschnittanalyse bereits bekannten E<strong>in</strong>schränkung h<strong>in</strong>sichtlich <strong>in</strong>strumenteller Hilfen im<br />
Haushalt, wobei sie auch hier immerh<strong>in</strong> knapp 60 Prozent stellt. Dieser Bef<strong>und</strong> für die 40- bis<br />
85-Jährigen wurde durch die Ergebnisse der Replikationsstichprobe 2002 bestätigt.<br />
Abbildung 5.15:<br />
Personelle Struktur <strong>in</strong>formeller Unterstützungsnetzwerke, 1996 u. 2002 (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Familie <strong>in</strong>sges.<br />
Ehepartner<br />
K<strong>in</strong>der<br />
Eltern<br />
Geschw ister<br />
Fre<strong>und</strong>e<br />
Familie <strong>in</strong>sges.<br />
K<strong>in</strong>der<br />
Eltern<br />
Geschw ister<br />
Fre<strong>und</strong>e<br />
and. Personen<br />
Kognitive Helfer<br />
31,6<br />
33,1<br />
29<br />
24,3<br />
4,9<br />
6,4<br />
6,6<br />
9,1<br />
15,8<br />
17,9<br />
78,8<br />
78,2<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
Instrumentelle Helfer<br />
6<br />
4,7<br />
4,5<br />
5,1<br />
17, 5<br />
17, 4<br />
25,2<br />
23,9<br />
27,2<br />
29,4<br />
57,3<br />
58 ,7<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
Familie <strong>in</strong>sges.<br />
Ehepartner<br />
K<strong>in</strong>der<br />
Eltern<br />
Geschw ister<br />
Fre<strong>und</strong>e<br />
Familie <strong>in</strong>sges.<br />
Ehepartner<br />
K<strong>in</strong>der<br />
Eltern<br />
Schw iegerfam.<br />
Geschw ister<br />
Fre<strong>und</strong>e<br />
Emotionale Helfer<br />
4,7<br />
5,4<br />
5,4<br />
7,5<br />
30,1<br />
24,3<br />
16,4<br />
19,5<br />
33,3<br />
35<br />
79,3<br />
76,8<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
F<strong>in</strong>anzielle Helfe r<br />
8<br />
7,5<br />
3,8<br />
5,3<br />
2,3<br />
6,5<br />
21<br />
19,5<br />
15<br />
15<br />
42,4<br />
35,7<br />
95,4<br />
89,3<br />
0 20 40 60 80 100<br />
2002 1996<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 Basisstichprobe (n= 4.838) <strong>und</strong> 2002 Replikationsstichprobe (n= 3.084), gewichtet
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Auf den Anteil der Familie an den verfügbaren Unterstützungsleistenden bezogen fällt nur e<strong>in</strong><br />
Ergebnis aus dem Rahmen, welches jedoch gerade deshalb besondere Aufmerksamkeit verdient<br />
– verglichen mit 1996 ist der Anteil Familienangehöriger an der Bereitstellung f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung<br />
deutlich – von 95 auf 89 Prozent – zurückgegangen. Noch e<strong>in</strong>mal zur Er<strong>in</strong>nerung, es<br />
handelt sich hierbei nicht um e<strong>in</strong>en Alterseffekt. Zielgruppe der Untersuchung waren <strong>in</strong> beiden<br />
Fällen die 40- bis 85-Jährigen (die detaillierten Ergebnisse können Abbildung 5.16 entnommen<br />
werden).<br />
Ähnlich wie schon bei der Längsschnittanalyse diskutiert, ragen Ehepartner e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> K<strong>in</strong>der<br />
andererseits als am häufigsten genannte potentielle Ratgeber <strong>und</strong> Trostspender <strong>und</strong> -<br />
spender<strong>in</strong>nen heraus. Auffällig ist jedoch sowohl bei der Analyse der kognitiven, als auch der<br />
emotionalen Unterstützung der deutliche Rückgang des Anteils von K<strong>in</strong>dern am <strong>in</strong>formellen<br />
Unterstützungspotential (von 29 bzw. 30 Prozent auf nunmehr 24 Prozent). Möglicherweise<br />
spiegeln sich hier bereits die <strong>in</strong> jüngeren Geburtskohorten abnehmenden K<strong>in</strong>derzahlen wieder.<br />
Leicht zugenommen hat h<strong>in</strong>gegen die Bedeutung von Geschwistern e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> von Fre<strong>und</strong>en<br />
andererseits (vgl. obige Abbildung 5.15).<br />
Dieser e<strong>in</strong>führenden Erläuterung folgt nun die detaillierte Analyse der personellen Zusammensetzung<br />
der <strong>in</strong>formellen Unterstützungsnetzwerke von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> der personellen Struktur <strong>in</strong>formeller Unterstützungsnetzwerke <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte wird gleichermaßen durch Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Dynamik gekennzeichnet. Kont<strong>in</strong>uität<br />
ist dabei das Wesensmerkmal der auf kognitive <strong>und</strong> emotionale Unterstützung gerichteten<br />
Netzwerke – hier ist es im Längsschnitt kaum zu Veränderungen gekommen. In beiden Fällen<br />
waren <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d fast 80 Prozent der genannten Unterstützungspersonen Familienangehörige.<br />
Herausragend ist dabei die Bedeutung von Ehe- bzw. Lebenspartner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -partnern e<strong>in</strong>erseits<br />
<strong>und</strong> von K<strong>in</strong>dern andererseits (vgl. Abbildung 5.16 unten), die etwa e<strong>in</strong> Drittel (Partner/<strong>in</strong>nen)<br />
bzw. knapp 30 Prozent (K<strong>in</strong>der) der potentiellen Hilfeleistenden stellen. Die drittgrößte<br />
Gruppe stellen Fre<strong>und</strong>e mit ca. e<strong>in</strong>em Sechstel.<br />
Abbildung 5.16:<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Personalstruktur <strong>in</strong>formeller Unterstützungsnetzwerke, 1996 u. 2002<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Prozent<br />
Anteil kognitiver<br />
Helfer<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
Fre<strong>und</strong>e Geschw.<br />
Eltern K <strong>in</strong>der<br />
Ehepart . Familie<br />
Prozent<br />
Anteil em otionaler<br />
Helfer<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
Fre<strong>und</strong>e Geschw.<br />
Elt ern K<strong>in</strong>d er<br />
Ehep art . Familie<br />
Prozent<br />
Anteil <strong>in</strong>strum ent.<br />
Helfer<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
Fre<strong>und</strong>e Geschw .<br />
Eltern K<strong>in</strong>d er<br />
and. Pers. Familie<br />
Quelle: Alterssurvey 1996 <strong>und</strong> 2002 Panelstichprobe (n= 1.524), gewichtet<br />
Prozent<br />
Anteil f<strong>in</strong>anzieller<br />
Helfer<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1996 2002<br />
Fre<strong>und</strong>e Geschw .<br />
Elt ern K<strong>in</strong>d er<br />
Ehep art . Familie<br />
255
256<br />
Andreas Hoff<br />
Erwartungsgemäß <strong>und</strong> altersbed<strong>in</strong>gt ist der Anteil der eigenen Eltern am Hilfepotential weiter<br />
zurückgegangen, was durch e<strong>in</strong>en Anstieg des Anteils von Geschwistern kompensiert wurde.<br />
Das bestätigt das aus der <strong>in</strong>ternationalen Familien- <strong>und</strong> Alternssoziologie bekannte Ergebnis der<br />
zunehmenden Bedeutung von Geschwistern im höheren <strong>und</strong> hohen Lebensalter (vgl. Connidis,<br />
2001).<br />
Im Gegensatz zum kognitiven <strong>und</strong> emotionalen Hilfepotential wird die <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong>strumenteller<br />
<strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung durch dynamische Verläufe charakterisiert, wie e<strong>in</strong> Blick<br />
auf die beiden rechten Grafiken <strong>in</strong> Abbildung 5.16 verrät. Instrumentelle Hilfe ist diejenige der<br />
vier Unterstützungstypen, bei dem Familienangehörige den ger<strong>in</strong>gsten Anteil des Unterstützungspotentials<br />
stellen – nur wenig mehr als die Hälfte der <strong>in</strong>strumentelle Hilfe erbr<strong>in</strong>genden<br />
Personen s<strong>in</strong>d Familienangehörige. Haushaltshilfen durch Personen, die nicht im Haushalt der<br />
Befragungsteilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -teilnehmer leben, werden vorwiegend von zwei Personengruppen<br />
erbracht: nicht-verwandte Personen, zum großen Teil bezahlte Helfer, bildeten schon<br />
1996 die größte E<strong>in</strong>zelgruppe. Ihr Anteil hat seitdem weiter zugenommen <strong>und</strong> macht 2002 fast<br />
30 Prozent der <strong>in</strong>strumentellen Hilfeleistenden aus. Mit zunehmendem Alter der Befragten ist<br />
zugleich der Anteil der zweitgrößten Gruppe – nämlich der eigenen K<strong>in</strong>der – weiter gestiegen.<br />
Diese machen nun deutlich mehr als e<strong>in</strong> Viertel des Unterstützungspotentials aus. Trotz des<br />
hohen Anteils nicht-verwandter Hilfepersonen bleibt festzuhalten, dass deren Anteil mit zunehmendem<br />
Alter zugunsten e<strong>in</strong>es größeren Anteils von Familienangehörigen abnimmt. Das wird<br />
vor allem durch den deutlichen Rückgang <strong>in</strong>strumenteller Hilfeleistung durch Fre<strong>und</strong>e erklärt.<br />
Viele befre<strong>und</strong>ete Menschen von Hochaltrigen haben <strong>in</strong>zwischen selbst e<strong>in</strong> hohes Alter erreicht<br />
oder s<strong>in</strong>d verstorben, so dass sie als Unterstützer nicht mehr zur Verfügung stehen.<br />
Die dramatischsten Veränderungen <strong>in</strong> der personellen Zusammensetzung des Unterstützungspotentials<br />
hat es bei der f<strong>in</strong>anziellen Unterstützung gegeben. Wenngleich hier der Anteil familialer<br />
Unterstützung mit mehr als 90 Prozent mit Abstand am höchsten ist <strong>und</strong> sich zudem durch e<strong>in</strong><br />
hohes Maß an Kont<strong>in</strong>uität auszeichnet, ist es doch <strong>in</strong> den letzten sechs Jahren zu erheblichen<br />
Verschiebungen zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Generationen <strong>in</strong>nerhalb der Familie gekommen. Der<br />
Anteil der Elterngeneration an den f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung bereitstellenden Personen ist von<br />
44 Prozent 1996 auf knapp 29 Prozent im Jahre 2002 drastisch zurückgegangen, während sich<br />
gleichzeitig der Anteil der K<strong>in</strong>dergeneration von 16 auf 35 Prozent mehr als verdoppelt hat.<br />
Diese deutliche Verschiebung der personellen Verantwortung für f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Familie mit zunehmendem Alter hat weitreichende Konsequenzen. Bei der Interpretation<br />
dieses Ergebnisses ist jedoch Vorsicht angebracht: e<strong>in</strong> abnehmender Anteil von Unterstützungspersonen<br />
bedeutet nicht automatisch e<strong>in</strong>en (gleich großen) Rückgang der f<strong>in</strong>anziellen<br />
Unterstützungsleistung.<br />
Kaum verändert hat sich das Bild im H<strong>in</strong>blick auf <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung. Hier unterscheidet<br />
sich die personelle Struktur des Unterstützungsnetzwerks im Jahre 2002 kaum von der<br />
1996. E<strong>in</strong>e Überraschung hält jedoch der Blick auf die äußerst rechts stehende Grafik <strong>in</strong> Abbildung<br />
5.16 zu dem f<strong>in</strong>anziellen Hilfepotential bereit. Konnte der dramatische Rückgang des Anteils<br />
von Eltern <strong>in</strong> der Längsschnittanalyse noch plausibel als Alterseffekt erklärt werden, so ist<br />
die ebenfalls sehr deutliche Abnahme des Anteils von Eltern im Querschnittsvergleich (von 42<br />
auf knapp 36 Prozent) nicht ohne weiteres zu erklären. Von dieser Veränderung abgesehen<br />
bleibt das aus der ersten Welle bekannte Muster ziemlich stabil, lediglich der Anteil von Freun-
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
den als f<strong>in</strong>anzielle Unterstützer <strong>und</strong> Unterstützer<strong>in</strong>nen hat sich, wenngleich auf niedrigem Niveau,<br />
spürbar erhöht.<br />
Das Unterkapitel zu sozialer Unterstützung zusammenfassend, bleibt folgendes festzuhalten:<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte leisten mehr Unterstützung als sie von anderen bekommen.<br />
Dies gilt <strong>in</strong> besonderem Maße für f<strong>in</strong>anzielle Hilfen. Dieses bereits aus der ersten Welle<br />
1996 bekannte Ergebnis konnte bestätigt werden. Allerd<strong>in</strong>gs erhalten die 40- bis 85-Jährigen<br />
2002 noch weniger Unterstützung als dies vor sechs Jahren der Fall war. Im Lebensverlauf<br />
nimmt jedoch die Fähigkeit zur Unterstützungsleistung mit zunehmendem Alter ab. Das Unterstützungsnetzwerk<br />
von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte zeichnet sich durch Kont<strong>in</strong>uität<br />
aus. Die Anzahl von Hilfspersonen bleibt bis <strong>in</strong>s hohe Alter weitestgehend konstant. Soziale<br />
Unterstützung wird überwiegend von Familienangehörigen geleistet.<br />
5.7 Zusammenfassung <strong>und</strong> sozialpolitische Implikationen<br />
Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse des vorliegenden Kapitels zusammengefasst.<br />
Auf dieser Gr<strong>und</strong>lage werden im Anschluss daran sozialpolitische Handlungsempfehlungen<br />
formuliert. Ziel dieses Kapitels war es, den <strong>Wandel</strong> von Familiengenerationen zu untersuchen.<br />
Vier zentrale Fragestellungen standen im Mittelpunkt.<br />
Wie verbreitet s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>tergenerationale Beziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte?<br />
Generationenbeziehungen werden heute vor allem im „multilokalen Familienverb<strong>und</strong>“ gelebt.<br />
Das Konzept der Generationen-Konstellationen gibt Auskunft über die Anzahl der Generationen<br />
<strong>und</strong> der Generationenstruktur <strong>in</strong> der erweiterten Familie. Die meisten Deutschen leben heute <strong>in</strong><br />
Drei-Generationen-Konstellationen. In der zweiten Lebenshälfte zeichnen sich Generationen-<br />
Konstellationen durch e<strong>in</strong> hohes Maß an Kont<strong>in</strong>uität aus. Erste Anzeichen für die Auswirkungen<br />
des demografischen <strong>Wandel</strong>s machen sich jedoch bei den 40- bis 54-Jährigen bemerkbar.<br />
Es konnte e<strong>in</strong>e Verschiebung des Anteils von Drei-Generationen-Konstellationen h<strong>in</strong> zu Zwei-<br />
Generationen-Konstellationen beobachtet werden. Im Gegensatz dazu haben sich die Ergebnisse<br />
im Längsschnitt entsprechend den Erwartungen entwickelt. Mit zunehmendem Alter nimmt der<br />
Anteil von Mehr-Generationen-Konstellationen <strong>in</strong> der erweiterten Familie zu.<br />
Wie gestaltet sich das Zusammenleben von Generationen?<br />
Die große Mehrheit der Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte lebt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Haushaltsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
mit anderen. Der demografische <strong>Wandel</strong> macht sich jedoch <strong>in</strong> der Haushaltszusammensetzung<br />
bemerkbar – im Vergleich zu 1996 hat sich sowohl der Anteil von Alle<strong>in</strong>lebenden, als<br />
auch der von Paaren ohne K<strong>in</strong>der deutlich erhöht. Mit zunehmendem Alter verr<strong>in</strong>gert sich der<br />
Anteil von Menschen, die <strong>in</strong> Zwei-Generationen-Haushalten leben zugunsten e<strong>in</strong>es ebenso deutlichen<br />
Anstiegs des Anteils von E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten. Neben dieser <strong>Entwicklung</strong> im<br />
Lebensverlauf zeichnet sich auch e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legender <strong>Wandel</strong> der generationenbezogenen Haushaltszusammensetzung<br />
ab – mit dem weiteren Anstieg k<strong>in</strong>derloser Haushalte <strong>in</strong> den nächsten<br />
Jahren wird sich der Anteil von E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten weiter erhöhen. Obwohl die<br />
257
258<br />
Andreas Hoff<br />
überwiegende Mehrheit der Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> räumlicher Nähe zu ihren<br />
K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern lebt, ist die Wohnentfernung zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern 2002 größer als<br />
vor sechs Jahren. Vor allem der Anteil von am selben Ort lebenden K<strong>in</strong>dern hat im Vergleich zu<br />
1996 abgenommen. Koresidenz von Eltern <strong>und</strong> erwachsenen K<strong>in</strong>dern ist 2002 noch weniger die<br />
Norm als vor sechs Jahren.<br />
Welche Bedeutung haben <strong>in</strong>tergenerationale Familienbeziehungen?<br />
Die Beziehungen zu ihrer Familie werden von fast allen Befragten als positiv e<strong>in</strong>geschätzt. Sie<br />
haben sich gegenüber von 1996 sogar noch verbessert. In E<strong>in</strong>klang damit werden Eltern-K<strong>in</strong>d-<br />
Beziehungen durch e<strong>in</strong> Gefühl großer Verb<strong>und</strong>enheit charakterisiert. Die wichtigsten Kontaktpersonen<br />
s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> bleiben Familienangehörige. Im Gegensatz dazu hat sich allerd<strong>in</strong>gs die Kontakthäufigkeit<br />
zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern etwas verr<strong>in</strong>gert.<br />
Wie unterstützen sich die Generationen <strong>in</strong>nerhalb der Familie?<br />
Das Bild der „hilfebedürftigen Alten“ entspricht nicht der Realität. Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>eswegs die Kostgänger der jüngeren Generationen – im Gegenteil, sie<br />
leisten mehr Unterstützung als sie umgekehrt erhalten. Im Jahre 2002 hat sich dieses Missverhältnis<br />
noch verschärft – die Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte erhalten jetzt noch weniger<br />
Unterstützung als vor sechs Jahren. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt aber die Unterstützungsleistung<br />
ab. Parallel dazu steigt die Inanspruchnahme von emotionaler Unterstützung <strong>und</strong><br />
von <strong>in</strong>strumentellen Hilfen, nicht jedoch von kognitiver <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung. Soziale<br />
Unterstützung wird überwiegend von Familienangehörigen geleistet. Die Anzahl von Hilfepersonen<br />
bleibt bis <strong>in</strong>s hohe Alter weitestgehend konstant.<br />
Es stellt sich nun die Frage, was staatliche Sozialpolitik zur Stärkung <strong>in</strong>tergenerationaler Familienbeziehungen<br />
beitragen kann. Die Institution Familie hat nach wie vor e<strong>in</strong>e zentrale gesellschaftliche<br />
Bedeutung. Gerade <strong>in</strong> Zeiten e<strong>in</strong>es tiefgreifenden <strong>Wandel</strong>s der Gesellschaft gibt die<br />
Familie Halt. Durch die Pluralisierung von Lebensformen hat sich jedoch die Familie <strong>in</strong> ihrem<br />
äußeren Ersche<strong>in</strong>ungsbild gewandelt. Der demografische <strong>Wandel</strong> führt zu veränderten Familienstrukturen.<br />
Deutschland zeichnet sich schon jetzt durch e<strong>in</strong>en im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich<br />
außergewöhnlich hohen Anteil von E<strong>in</strong>personenhaushalten aus. Generationenbeziehungen werden<br />
daher überwiegend jenseits der Haushaltsebene, <strong>in</strong> der „multilokalen Generationenfamilie“<br />
(Bertram, 2000) gelebt. Dieser Trend wird sich mit dem weiter steigenden Anteil von älteren<br />
<strong>und</strong> alten Menschen bei gleichzeitig s<strong>in</strong>kenden Geburtenraten noch verschärfen.<br />
Die Mehrzahl der heute 60-Jährigen kann damit rechnen, e<strong>in</strong> bis zwei weitere Lebensjahrzehnte<br />
<strong>in</strong> guter Ges<strong>und</strong>heit zu verbr<strong>in</strong>gen. Viele von ihnen werden aktiv an der Betreuung ihrer Enkelk<strong>in</strong>der<br />
teilnehmen <strong>und</strong> die Geburt von Urenkeln erleben. Mehr-Generationen-Konstellationen <strong>in</strong><br />
der erweiterten Familie s<strong>in</strong>d die Regel. Mit dem Nachrücken der geburtenschwächeren Jahrgänge<br />
<strong>in</strong> die Elterngeneration wird sich die Zahl von K<strong>in</strong>dern, Enkeln <strong>und</strong> Urenkeln jedoch sukzessive<br />
verr<strong>in</strong>gern. Was die nach dem Umlageverfahren f<strong>in</strong>anzierten Sozialversicherungssysteme<br />
vor enorme Probleme stellt, kann sich für die wenigen K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> Enkelk<strong>in</strong>der zunächst positiv
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
auswirken, wenn sie zum Empfänger der gebündelten Aufmerksamkeit <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzieller Transfers<br />
von mehreren Großeltern werden, die sich wenige Enkel „teilen“ müssen.<br />
Das Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip, auf dem der deutsche Sozialstaat beruht, hat <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
dazu geführt, dass Familien <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e Vielzahl von Aufgaben übernommen haben,<br />
die <strong>in</strong> anderen Gesellschaftssystemen von anderen Institutionen getragen werden. Indem Menschen<br />
<strong>in</strong>formelle Unterstützung leisten, entlasten sie den Sozialstaat um Milliardenbeträge, die<br />
andernfalls <strong>in</strong> die Bereitstellung formeller Hilfestrukturen <strong>in</strong>vestiert werden müssten. Zudem hat<br />
soziale Unterstützung e<strong>in</strong>en positiven Effekt auf die Lebensqualität. Im Zuge der sich verlängernden<br />
Lebenszeit übernehmen Familien neue Aufgaben bei der Pflege <strong>und</strong> Betreuung alter<br />
Familienangehöriger. Neben der Reproduktions-, Sozialisations-, <strong>und</strong> der Regenerationsfunktion<br />
ist die Funktion der sozialen Unterstützung e<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil familialer Beziehungen<br />
geworden.<br />
Soziale Unterstützungsbeziehungen <strong>und</strong> <strong>in</strong>tergenerationale Solidarität werden <strong>in</strong> der K<strong>in</strong>dheit<br />
geprägt. Voraussetzung für verlässliche <strong>und</strong> belastbare soziale Unterstützung im Alter s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
erster L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong>takte Familien. Daher ist es empfehlenswert, noch mehr <strong>in</strong> Hilfen zu Erziehung<br />
<strong>und</strong> Familienbildung zu <strong>in</strong>vestieren, um Familien zu helfen, <strong>in</strong> denen diese Werte nicht im<br />
Rahmen der k<strong>in</strong>dlichen Sozialisation vermittelt werden. Geld, das so frühzeitig <strong>in</strong> die Förderung<br />
sozialer Unterstützungsbeziehungen <strong>in</strong>vestiert wird, ist e<strong>in</strong>e gute Geldanlage mit lebenslangem<br />
Nutzen sowohl für Familie als auch für den Sozialstaat.<br />
Wie <strong>in</strong> diesem Kapitel gezeigt wurde, erfolgt der wechselseitige Austausch von Unterstützung<br />
primär zwischen den Generationen, vor allem zwischen erwachsenen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> ihren Eltern.<br />
Gerade die relativ wenigen Angehörigen der geburtenschwachen Jahrgänge werden für die<br />
Pflege der Angehörigen der „Babyboom“-Generation aufkommen müssen. E<strong>in</strong> Szenario, <strong>in</strong> dem<br />
sich e<strong>in</strong>e Person um die Pflege mehrerer Familienangehöriger kümmern muss, wird <strong>in</strong> Zukunft<br />
immer wahrsche<strong>in</strong>licher. Die übergroße Mehrheit der Deutschen räumt der häuslichen Pflege<br />
nach wie vor e<strong>in</strong>deutig Vorrang gegenüber der stationären Pflege e<strong>in</strong> (Berger-Schmidt, 2003).<br />
Da es noch immer vorwiegend Frauen s<strong>in</strong>d, die sich um pflegebedürftige Familienangehörige<br />
kümmern, werden gerade sie Unterstützung benötigen. War bisher die Forderung nach e<strong>in</strong>er<br />
besseren „Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie <strong>und</strong> Beruf“ ausschließlich auf Eltern mit kle<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dern<br />
gerichtet, sollte sie künftig auch Anwendung f<strong>in</strong>den auf die Förderung von Frauen (<strong>und</strong> Männern),<br />
die pflegebedürftige Familienangehörige betreuen. Die Tatsache, dass es mehrere Jahrzehnte<br />
gedauert hat bis auch Männer bereit waren, sich stärker an der K<strong>in</strong>dererziehung zu beteiligen,<br />
unterstreicht zudem die Dr<strong>in</strong>glichkeit e<strong>in</strong>es gesellschaftlichen Umdenkens, das Männern<br />
e<strong>in</strong>e stärkere Verantwortungsübernahme <strong>in</strong> der häuslichen Pflege erleichtert.<br />
Verschärft wird sich diese Situation für k<strong>in</strong>derlose Menschen darstellen. K<strong>in</strong>derlose werden ihre<br />
Eltern genauso pflegen wie andere auch – doch wer pflegt sie im Alter? K<strong>in</strong>derlose Menschen<br />
verfügen im Alter <strong>in</strong> weitaus ger<strong>in</strong>gerem Maße über soziales Unterstützungspotential <strong>in</strong> ihrem<br />
familiären Umfeld. K<strong>in</strong>derlose werden die fehlende Unterstützung im Fre<strong>und</strong>eskreis, vor allem<br />
aber durch die Bezahlung entsprechender Dienstleistungen kompensieren müssen. Es ist jedoch<br />
abzusehen, dass nicht alle k<strong>in</strong>derlosen Menschen wohlhabend genug se<strong>in</strong> werden, um dieses<br />
Defizit auszugleichen. Hier entsteht e<strong>in</strong>e neue Zielgruppe staatlicher Sozialpolitik. Der Sozial-<br />
259
260<br />
Andreas Hoff<br />
staat wird zur Unterstützung dieser Menschen <strong>in</strong> Zukunft mehr ambulante Pflegestrukturen aufbauen<br />
bzw. f<strong>in</strong>anzieren müssen.<br />
Schließlich trägt noch e<strong>in</strong> dritter Trend zur Notwendigkeit des Ausbaus ambulanter Pflegestrukturen<br />
bei: Wie im vorliegenden Kapitel gezeigt wurde, nimmt die Wohnentfernung zwischen<br />
Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern zu. Solange <strong>in</strong> der deutschen Gesellschaft die Erfordernisse des Arbeitsmarktes<br />
Priorität haben gegenüber den Bedürfnissen von Familien, wird vielen Angehörigen der<br />
Elterngeneration im hohen Lebensalter die unmittelbare Unterstützung durch ihre K<strong>in</strong>der vor<br />
Ort fehlen. Der schon heute feststellbare Rückgang an <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung unterstreicht<br />
diese Notwendigkeit zusätzlich.<br />
Auch hochaltrige Menschen legen großen Wert auf e<strong>in</strong>e unabhängige Lebensführung. Da die<br />
nachrückenden Generationen <strong>in</strong> noch viel stärkerem Maße durch die Individualisierung der<br />
Gesellschaft geprägt wurden, wird sich dieser Wunsch nach Unabhängigkeit noch verstärken.<br />
Hochaltrige Menschen benötigen Unterstützung zur Führung ihres Haushalts. Wenn diese durch<br />
Familienangehörige wegen zu großer Wohnentfernung nicht geleistet werden kann, müssen<br />
diese Hilfen entweder privat bezahlt oder durch den Sozialstaat bereitgestellt werden.<br />
Sozialpolitik besteht jedoch nicht nur <strong>in</strong> der Bereitstellung von Leistungen – zu Sozialpolitik<br />
gehört auch die Schaffung von geeigneten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Hilfe zur Selbsthilfe.<br />
Der demografische <strong>Wandel</strong> wird <strong>in</strong> den nächsten Jahren zu e<strong>in</strong>schneidenden Veränderungen auf<br />
dem Arbeitsmarkt führen. So wird es künftig zu wenige Pflegekräfte für die wachsende Zahl<br />
hochaltriger Menschen geben. Zur Lösung dieses Problems könnte die Beschäftigung von ausländischen<br />
Pflegekräften sowohl <strong>in</strong> der stationären <strong>und</strong> ambulanten Pflege als auch <strong>in</strong> den<br />
Haushalten hochaltriger Menschen beitragen. Deutschland wird jedoch um diese begehrten Arbeitskräfte<br />
aus dem Ausland mit anderen europäischen Ländern konkurrieren müssen.<br />
Der demografische <strong>Wandel</strong> wird <strong>in</strong> den kommenden Jahrzehnten zu e<strong>in</strong>em gewaltigen Anstieg<br />
der Anzahl Hochaltriger führen. Soziale Unterstützung hat jedoch ihre Grenzen – sie wird nie<br />
e<strong>in</strong>e adäquate stationäre Pflege schwer <strong>und</strong> schwerst Pflegebedürftiger leisten können. Schon<br />
alle<strong>in</strong> deshalb stehen ambulante <strong>und</strong> stationäre Pflegee<strong>in</strong>richtungen vor völlig neuen Herausforderungen,<br />
die sich nur durch den umfassenden Ausbau der vorhandenen Strukturen lösen lassen.<br />
Obwohl Deutschland mit der E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung gegenüber vielen anderen<br />
Ländern im Vorteil ist, bedarf auch diese fünfte Säule der deutschen Sozialversicherung e<strong>in</strong>er<br />
umfassenden Reform.<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n dieses Abschnitts ist die aktive Förderung des Erlernens sozialer Unterstützungsbeziehungen<br />
von K<strong>in</strong>dheit an empfohlen worden. Außerdem s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Reihe von Maßnahmen zur<br />
Unterstützung häuslicher Pflege benannt worden. Neben diesen konkreten, sozialpolitischen<br />
Empfehlungen wird abschließend <strong>in</strong> Anlehnung an e<strong>in</strong>e Idee von Lüscher & Liegle (2003) die<br />
Zusammenführung der bisher separat geführten politischen Handlungsfelder von Familien-,<br />
K<strong>in</strong>der-, Senioren- <strong>und</strong> Bildungspolitik zu e<strong>in</strong>er „Generationenpolitik“ (Lüscher & Liegle,<br />
2003) angeregt. Dabei handelt es sich um e<strong>in</strong> gesellschaftspolitisches Programm zur Förderung<br />
des künftigen Zusammenlebens von Generationen. Generationenpolitik setzt die Kooperation<br />
verschiedener gesellschaftlicher Akteure (Staat, Kirchen, Verbände, Unternehmen, etc.) voraus.<br />
E<strong>in</strong>e koord<strong>in</strong>ierte Generationenpolitik hat die Interessen aller Generationen im Blick <strong>und</strong> geht<br />
von den Leitideen der Generationengerechtigkeit, wechselseitiger Verantwortung <strong>und</strong> der Ver-
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
antwortung für die Zukunft im S<strong>in</strong>ne von Nachhaltigkeit aus. Wenn beispielsweise K<strong>in</strong>der zu<br />
Generationensolidarität <strong>und</strong> <strong>in</strong>tergenerationaler Unterstützung erzogen werden, dann werden<br />
damit zugleich die Interessen der älteren Generation vertreten. So werden K<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Seniorenpolitik<br />
zu zwei Seiten derselben Medaille.<br />
261
5.8 Literatur<br />
262<br />
Andreas Hoff<br />
Alt, C. (1994). Reziprozität von Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen <strong>in</strong> Mehrgenerationennetzwerken. In<br />
W. Bien (Ed.), Eigen<strong>in</strong>teresse oder Solidarität. Beziehungen <strong>in</strong> modernen Mehrgenerationenfamilien<br />
(pp. 197 - 222). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Alw<strong>in</strong>, D. F., & McCammon, R. J. (2003). Generations, cohorts, and social change. In J. T.<br />
Mortimer & M. S. Shanahan (Eds.), Handbook of the Life Course (pp. 3-22). New<br />
York: Kluwer Academic.<br />
Antonucci, T. C. (1985). Social support: Theoretical advances, research f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs and press<strong>in</strong>g<br />
issues. In I. G. Sarason & B. R. Sarason (Eds.), Social support: theory, research and<br />
applications (pp. 21-37). The Hague: Mar<strong>in</strong>us Nijhof.<br />
Antonucci, T. C. (2001). Social relations: An exam<strong>in</strong>ation of social networks, social support ,<br />
and sense of control. In J. E. Birren & K. W. Schaie (Eds.), Handbook of the psychology<br />
of ag<strong>in</strong>g (pp. 427-453). San Diego, CA: Academic Press.<br />
Antonucci, T. C., & Akiyama, H. (1995). Convoys of social relations: Family and friendships<br />
with<strong>in</strong> the life span context. In R. Blieszner & V. H. Bedford (Eds.), Handbook of ag<strong>in</strong>g<br />
and the family (pp. 355-371). Westport: CT: Greenwood Press.<br />
Antonucci, T. C., Sherman, A. M., & Akiyama, H. (1996). Social networks, support, and <strong>in</strong>tegration.<br />
In J. Birren (Ed.), Encyclopedia of gerontology (Vol. 2, pp. 505-515). San Diego,<br />
CA: Academic Press.<br />
Bengtson, V. L., & Kuypers, J. A. (1971). Generational difference and the developmental stake.<br />
Ag<strong>in</strong>g and Human Development, 2, 249-260.<br />
Bengtson, V. L., Rosenthal, C., & Burton, L. (1990). Families and ag<strong>in</strong>g: Diversity and heterogeneity.<br />
In R. H. B<strong>in</strong>stock & L. George (Eds.), Handbook of age<strong>in</strong>g and the social sciences<br />
(pp. 263-287). San Diego, CA: Academic Press.<br />
Berger, P. L., & Berger, B. (1984). In Verteidigung der bürgerlichen Familie. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>:<br />
Fischer.<br />
Berger-Schmidt, R. (2003). Ger<strong>in</strong>gere familiale Pflegebereitschaft bei jüngeren Generationen.<br />
Analysen zur Betreuung <strong>und</strong> Pflege alter Menschen <strong>in</strong> den Ländern der Europäischen<br />
Union. ISI Informationsdienst Soziale Indikatoren, 29, 12-15.<br />
Bertram, H. (1995a). Individuen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividualisierten Gesellschaft. In H. Bertram (Ed.),<br />
Das Individuum <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Familie (pp. 9-34). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Bertram, H. (1995b). Regionale Vielfalt <strong>und</strong> Lebensform. In H. Bertram (Ed.), Das Individuum<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Familie (pp. 157-195). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Bertram, H. (2000). Die verborgenen familiären Beziehungen <strong>in</strong> Deutschland: Die multilokale<br />
Mehrgenerationenfamilie. In M. Kohli & M. Szydlik (Eds.), Generationen <strong>in</strong> Familie<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft (pp. 97-121). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Bien, W. (1994). Eigen<strong>in</strong>teresse oder Solidarität. Beziehungen <strong>in</strong> modernen Mehrgenerationenfamilien.<br />
Opladen: Leske + Budrich.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, S., Frauen <strong>und</strong> Jugend. (2002). Vierter Bericht zur Lage der<br />
älteren Generation. Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend.<br />
Coleman, J. S. (1990). The fo<strong>und</strong>ations of social theory. Cambridge, MA: Belknap Press.<br />
Connidis, I. A. (2001). Family ties & age<strong>in</strong>g. Thousand Oaks: Sage.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Cutrona, C. E., & Suhr, J. A. (1994). Social support communication <strong>in</strong> the context of marriage.<br />
An analysis of couples' supportive <strong>in</strong>teractions. In B. R. Burleson & T. L. Albrecht & I.<br />
G. Sarason (Eds), Communication of social support. Thousand Oaks: Sage.<br />
Diewald, M. (1991). Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung<br />
<strong>in</strong> <strong>in</strong>formellen Netzwerken. Berl<strong>in</strong>: Edition Sigma.<br />
Donaldson, G., & Horn, J. L. (1992). Age, cohort, and time developmental muddles: Easy <strong>in</strong><br />
Practice, hard <strong>in</strong> theory. Experimental Ag<strong>in</strong>g Research, 18(4), 213-222.<br />
Elder, G. H. J. (1974). Children of the great depression: Social change <strong>in</strong> life experience. Chicago:<br />
University of Chicago Press.<br />
Engstler, H., & Menn<strong>in</strong>g, S. (2003). Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik. Berl<strong>in</strong>:<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend.<br />
Enquête-Kommission. (2002). Enquête-Kommission Demographischer <strong>Wandel</strong>. Herausforderungen<br />
unserer älter werdenden Gesellschaft an den E<strong>in</strong>zelnen <strong>und</strong> die Politik. Berl<strong>in</strong>:<br />
Deutscher B<strong>und</strong>estag.<br />
Esser, H. (1993). Soziologie. Allgeme<strong>in</strong>e Gr<strong>und</strong>lagen. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Esser, H. (1999). Soziologie. Spezielle Gr<strong>und</strong>lagen. Band 1: Situationslogik <strong>und</strong> Handeln.<br />
Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Fry, C. L., & Keith, J. (1982). The life course as a cultural unit. In M. W. Riley & R. P. Abeles<br />
& M. S. Teitelbaum (Eds), Age<strong>in</strong>g from birth to death (pp. 51-70). Boulder: Westview<br />
Press.<br />
Galaskiewicz, J., & Wasserman, S. (1994). Introduction. Advances <strong>in</strong> the social and behavioral<br />
sciences from social network analysis. In S. Wasserman & J. Galaskiewicz (Eds), Advances<br />
<strong>in</strong> social network analysis. Research <strong>in</strong> the social and behavioral sciences.<br />
Thousand Oaks: Sage.<br />
Giarusso, R., Stall<strong>in</strong>gs, M., & Bengtson, V. L. (1995). The "<strong>in</strong>tergenerational stake" hypothesis<br />
revisited: parent-child differences <strong>in</strong> perceptions of relationships 20 years later. In V. L.<br />
Bengtson & K. Warner Schaie & L. M. Burton (Eds), Adult <strong>in</strong>tergenerational relations:<br />
Effects of societal change (pp. 227-263). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Glenn, N. D. (2003). Dist<strong>in</strong>guish<strong>in</strong>g age, period, and cohort effects. In J. T. Mortimer & M. S.<br />
Shanahan (Eds), Handbook of the life course (pp. 465-476). New York: Kluwer Academic.<br />
Haagenaars, J. A. (1990). Categorical Longitud<strong>in</strong>al Data. Log-l<strong>in</strong>ear panel, trend, and cohort<br />
analysis. Newbury Park: Sage.<br />
Hareven, T. K., & Adams, K. (1996). The generation <strong>in</strong> the middle: Cohort comparisons <strong>in</strong> assistance<br />
to ag<strong>in</strong>g parents <strong>in</strong> an American community. In T. K. Hareven (Ed.), Ag<strong>in</strong>g and<br />
generational relations over the life course: A historical and cross-cultural perspective<br />
(pp. 272-293). Berl<strong>in</strong>: Walter de Gruyter.<br />
Hill, P. B., & Kopp, J. (1995). Familiensoziologie. Stuttgart: Teubner.<br />
Hoff, A., Tesch-Römer, C., Wurm, S., & Engstler, H. (2003). "Die zweite Lebenshälfte" - der<br />
Alterssurvey zwischen gerontologischer Längsschnittanalyse <strong>und</strong> Alterssozialberichterstattung<br />
im Längsschnitt. In F. Karl (Ed.), Sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftliche Gerontologie.<br />
We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Hörl, J., & Kytir, J. (1998). Die "Sandwich-Generation": Soziale Realität oder gerontologischer<br />
Mythos? Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie, 50(4), 730-741.<br />
263
264<br />
Andreas Hoff<br />
Hradil, S. (2001). <strong>Sozialer</strong> <strong>Wandel</strong>. Gesellschaftliche <strong>Entwicklung</strong>strends. In B. Schäfers & W.<br />
Zapf (Eds), Handwörterbuch der Gesellschaft Deutschlands (pp. 642-652). Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale<br />
für politische Bildung.<br />
Hu<strong>in</strong><strong>in</strong>k, J. (1995). Warum noch Familie? Zur Attraktivität von Partnerschaft <strong>und</strong> Elternschaft<br />
<strong>in</strong> unserer Gesellschaft. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Hu<strong>in</strong><strong>in</strong>k, J., & Wagner, M. (1998). Individualisierung <strong>und</strong> die Pluralisierung von Lebensformen.<br />
In J. Friedrichs (Ed.), Die Individualisierungs-These (pp. 85-106). Opladen: Leske +<br />
Budrich.<br />
Jackson, J. S., Antonucci, T. C., & Gibson, R. C. (1990). Cultural, racial and ethnic <strong>in</strong>fluences<br />
on ag<strong>in</strong>g. In J. Birren & K. W. Schaie (Eds), Handbook of psychology of ag<strong>in</strong>g (pp.<br />
103-123). San Diego: Academic Press.<br />
Kahn, R. L., & Antonucci, T. C. (1980). Convoys over the life course: Attachment, roles, and<br />
social support. Life span development, 3, 253-286.<br />
Klar, C. u. S. S.-B. (1996). Lebensbed<strong>in</strong>gungen Alle<strong>in</strong>erziehender. In W. Bien (Ed.), Familie an<br />
der Schwelle zum neuen Jahrtausend. <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong> familialer Lebensformen<br />
(pp. 140 - 149). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M. (1986). Social organization and subjective construction of the life course. In A. B.<br />
Sorenson & F. E. We<strong>in</strong>ert & L. R. Sherrod (Eds), Human development and the life<br />
course: Multidiscipl<strong>in</strong>ary perspectives (pp. 271-292). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A., & Szydlik, M. (2000). Generationenbeziehungen. In M.<br />
Kohli u. H. Künem<strong>und</strong> (Ed.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation<br />
im Spiegel des Alters-Survey (pp. 176-211). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kruse, A. (1983). Fünf-Generationen-Familien: Interaktion, Kooperation <strong>und</strong> Konflikt. Zeitschrift<br />
für Gerontologie, 16, 205-209.<br />
Künem<strong>und</strong>, H., & Hollste<strong>in</strong>, B. (2000). Soziale Beziehungen <strong>und</strong> Unterstützungsnetzwerke. In<br />
M. Kohli u. H. Künem<strong>und</strong> (Ed.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong><br />
Partizipation im Spiegel des Alters-Survey (pp. 212-276). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Lange, A., & Lauterbach, W. (1997). Wie nahe wohnen Enkel bei ihren Großeltern? Aspekte<br />
der Mehrgenerationenfamilie heute (Arbeitspapier Nr. 24). Konstanz: Sozialwissenschaftliche<br />
Fakultät.<br />
Lauterbach, W. (2002). Großelternschaft <strong>und</strong> Mehrgenerationenfamilien - soziale Realität oder<br />
demographischer Mythos? Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35(6), 540-555.<br />
Lauterbach, W., & Kle<strong>in</strong>, T. (1997). Altern im Generationenzusammenhang. In J. Mansel & G.<br />
Rosenthal & A. Tölke (Eds), Generationen-Beziehungen, Austausch <strong>und</strong> Tradierung<br />
(pp. 109-120). Opladen.<br />
Lauterbach, W., & Pillemer, K. (2001). Social structure and the family: A United States - Germany<br />
comparison of residential proximity between parents and adult children. Zeitschrift<br />
für Familienforschung, 13(1), 68-88.<br />
Lehr, U., & Schneider, W.-F. (1983). Fünf-Generationen-Familien: e<strong>in</strong>ige Daten über Ururgroßeltern<br />
<strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Zeitschrift für Gerontologie, 16, 200-204.<br />
Lüscher, K. (1999). Die Ambivalenz von Generationenbeziehungen. In H. Schwengel & B.<br />
Höpken (Eds), Grenzenlose Gesellschaft?Bd.II.T. 2. (pp. 243-246). Pfaffenweiler.<br />
Lüscher, K. (2000). Die Ambivalenz von Generationenbeziehungen - e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e heuristische<br />
Hypothese. In M. Kohli (Ed.), Generationen im Familie <strong>und</strong> Gesellschaft (pp. 138-<br />
161). Opladen.
Kapitel 5: Intergenerationale Familienbeziehungen im <strong>Wandel</strong><br />
Lüscher, K., & Liegle, L. (2003). Generationenbeziehungen <strong>in</strong> Familie <strong>und</strong> Gesellschaft. Konstanz:<br />
UVK Verlagsgesellschaft.<br />
Lüscher, K., & Pillemer, K. (1996). Die Ambivalenz familialer Generationenbeziehungen. Konzeptuelle<br />
Überlegungen zu e<strong>in</strong>em aktuellen Thema der familienwissenschaftlichen Forschung.<br />
Konstanz.<br />
Marbach, J. H. (1994). Der E<strong>in</strong>fluß von K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Wohnentfernung auf die Beziehungen<br />
zwischen Eltern <strong>und</strong> Großeltern: E<strong>in</strong>e Prüfung des quasi-experimentellen Designs der<br />
Mehrgenerationenstudie. In W. Bien (Ed.), Eigen<strong>in</strong>teresse oder Solidarität. Beziehungen<br />
<strong>in</strong> modernen Mehrgenerationenfamilien (pp. 77-112). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Mayer, K. U. (1990). Lebensverläufe <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong>. Anmerkungen zu e<strong>in</strong>em Forschungsprogramm.<br />
In K. U. Mayer (Ed.), Lebensverläufe <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong> (pp. 7-<br />
21). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Mayer, K. U., & Baltes, P. B. (Eds.). (1999). Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (2. Aufl. ed.). Berl<strong>in</strong>:<br />
Akademie Verlag.<br />
Meyer, T. (1992). Modernisierung der Privatheit. Differenzierungs- <strong>und</strong> Individualisierungsprozesse<br />
des familialen Zusammenlebens. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Motel, A., & Szydlik, M. (1999). Private Transfers zwischen den Generationen. Zeitschrift für<br />
Soziologie, 28, 3-22.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. (2000). Alter <strong>und</strong> Generationenvertrag im <strong>Wandel</strong> des Sozialstaats. Alterssicherung<br />
<strong>und</strong> private Generationenbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Berl<strong>in</strong>:<br />
Weißensee.<br />
Nave-Herz, R. (2004). Ehe- <strong>und</strong> Familiensoziologie. München: Juventa.<br />
Noll, H.-H. (1999). Die Perspektive der Sozialberichtserstattung. In P. Flora & H.-H. Noll<br />
(Eds), Sozialberichterstattung <strong>und</strong> Sozialstaatsbeobachtung (pp. 13-28). Frankfurt/Ma<strong>in</strong>:<br />
Campus.<br />
Nye, F. I. (1979). Choice, exchange, and the family. In W. R. Burr, Hill, R., Nye, F. I., and<br />
Rice, I. L. (Ed.), Contemporary theories about the family (Vol. II, pp. 1-41). New York.<br />
Pearson, R. E. (1990). Counsell<strong>in</strong>g and social support. Perspectives and practice. Newbury<br />
Park: Sage.<br />
Rosenbaum, H. (1982). Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen,<br />
Sozialstruktur <strong>und</strong> sozialem <strong>Wandel</strong> <strong>in</strong> der deutschen Gesellschaft des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Suhrkamp.<br />
Rosenmayr, L., & Köckeis, E. (1965). Umwelt <strong>und</strong> Familie alter Menschen. Neuwied: Luchterhand.<br />
Rossi, A. S., & Rossi, P. H. (1990). On human bond<strong>in</strong>g: Parent-child relations across the life<br />
course. Hawthorne: de Gruyter.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (2002). Datenreport 2002. Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (2004). Durchschnittliche weitere Lebenserwartung. Retrieved<br />
28.07.2004, http://www.destatis.de/basis/d/bevoe/bevoetab3.php<br />
Szydlik, M. (1995). Die Enge der Beziehung zwischen erwachsenen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> ihren Eltern -<br />
<strong>und</strong> umgekehrt. Zeitschrift für Soziologie, 27, 297-315.<br />
Szydlik, M. (2000). Lebenslange Solidarität? Generationenbeziehungen zwischen erwachsenen<br />
K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern. Opladen: Leske + Budrich.<br />
265
266<br />
Andreas Hoff<br />
Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A., & Engstler, H. (2002). Alterssozialberichterstattung im<br />
Längsschnitt: Die zweite Welle des Alterssurveys. In A. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel & U. Kelle<br />
(Eds), Perspektiven der empirischen Alter(n)ssoziologie (pp. 155-190). Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
Uhlenberg, P. (1995). Demographic <strong>in</strong>fluences on <strong>in</strong>tergenerational relationships. In V. L.<br />
Bengtson & K. W. Schaie & L. Burton (Eds), Adult <strong>in</strong>tergenerational relations: Effects<br />
of societal change (pp. 19-25). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Uhlenberg, P., & Kirby, J. B. (1998). Grandparenthood over time: Historical and demographic<br />
trends. In M. E. Sz<strong>in</strong>ovcz (Ed.), Handbook on grandparenthood (pp. 23-39). Westport,<br />
CN: Greenwood.<br />
Wagner, M., Schütze, Y., & Lang, F. R. (1999). Soziale Beziehungen alter Menschen. In K. U.<br />
Mayer & P. B. Baltes (Eds), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (2. Aufl. ed., pp. 301-320). Berl<strong>in</strong>:<br />
Akademie Verlag.<br />
Wagner, M., & Wolf, C. (2001). Altern, Familie <strong>und</strong> soziales Netzwerk. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,<br />
4(4), 529-554.<br />
Weick, S. (1999). Steigende Bedeutung der Familie nicht nur <strong>in</strong> der Politik. Untersuchungen zur<br />
Familie mit objektiven <strong>und</strong> subjektiven Indikatoren. ISI Informationsdienst Soziale Indikatoren,<br />
22, 12-15.<br />
Wiswede, G. (2000). <strong>Sozialer</strong> <strong>Wandel</strong>. In G. Re<strong>in</strong>hold (Ed.), Soziologie-Lexikon (4. ed., pp.<br />
596-598). München: Oldenbourg.
6. Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
6.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Dass es auch <strong>in</strong> der Lebensphase nach dem Beruf noch systematisch strukturierte Tätigkeiten jenseits<br />
der re<strong>in</strong>en Reproduktionsarbeit gibt, ist – über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum betrachtet – nicht<br />
sonderlich neu. Die Bedeutung, die diesen zukommt, hat jedoch deutlich zugenommen, <strong>und</strong> sie<br />
wird <strong>in</strong> der näheren Zukunft noch weiter zunehmen. Verständlich wird diese <strong>Entwicklung</strong>, wenn<br />
man <strong>in</strong> historischer Perspektive die sozialpolitischen <strong>und</strong> demographischen Veränderungen <strong>in</strong> den<br />
Blick nimmt. Zum Zeitpunkt der E<strong>in</strong>führung der Alters- <strong>und</strong> Invalidenversicherung im Jahre 1891<br />
erreichten z.B. nur knapp 40 Prozent der Frauen <strong>und</strong> r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Drittel der Männer überhaupt das 60.<br />
Lebensjahr. Heute s<strong>in</strong>d es mehr als vier Fünftel der Frauen <strong>und</strong> mehr als neun Zehntel der Männer,<br />
die dieses Lebensalter erreichen, welches ungefähr dem derzeitigen durchschnittlichen Rentenzugangsalter<br />
entspricht. Und die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt dann noch weitere knapp<br />
18 Jahre für die Männer <strong>und</strong> gut 22 Jahre für die Frauen (vgl. Kohli, 1998, S.3). Nur noch e<strong>in</strong> Achtel<br />
der über 60-jährigen Männer s<strong>in</strong>d erwerbstätig, bei den Frauen sogar nur 12 Prozent, obwohl<br />
ihre Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong>sgesamt stark zugenommen hat. Über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum betrachtet<br />
lässt sich also feststellen: E<strong>in</strong> zunehmender Teil der Menschen erreicht das Rentenalter, <strong>und</strong> der<br />
ganz überwiegende Teil derjenigen, die das Rentenalter erreichen, geht dann auch tatsächlich <strong>in</strong><br />
den Ruhestand, ohne noch h<strong>in</strong>zuzuverdienen. Wir haben es daher heute mit e<strong>in</strong>er strukturell klar<br />
abgrenzbaren Lebensphase von erheblicher Länge für den überwiegenden Teil der Bevölkerung zu<br />
tun – also mit Alter als e<strong>in</strong>em selbstverständlichen <strong>und</strong> eigenständigen Teil der Normalbiographie<br />
(Kohli, 1985). Wenn die Soziologie also die Frage nach der Produktivität <strong>in</strong> der nachberuflichen<br />
Lebensphase aufgreift, ist dies ke<strong>in</strong> randständiges Thema, sondern es betrifft aktuell die Lebenssituation<br />
von fast e<strong>in</strong>em Viertel der Bevölkerung. Schon bald werden die über 60-Jährigen sogar<br />
mehr als e<strong>in</strong> Drittel der Bevölkerung stellen.<br />
Die gegenwärtige Aktualität der Frage nach produktiven Tätigkeiten im Ruhestand nährt sich aber<br />
auch aus weiteren Quellen. Neben der gestiegenen durchschnittlichen Lebenserwartung, des im<br />
Schnitt ger<strong>in</strong>geren Alters bei Beendigung der Erwerbsphase <strong>und</strong> der dadurch zunehmenden „Entberuflichung“<br />
des Alters (Tews, 1989) s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere zwei weitere Aspekte zentral: Zum e<strong>in</strong>en<br />
die mit dem steigenden Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung e<strong>in</strong>hergehende „Alterslast“<br />
für die Sozialversicherungssysteme, zum anderen die zunehmend günstigere Ressourcenausstattung<br />
der Älteren: e<strong>in</strong>em zunehmend brachliegenden „Humankapital“.<br />
Der erste Aspekt steht zumeist im Vordergr<strong>und</strong>, wenn das Thema „Alter“ <strong>in</strong> der öffentlichen Diskussion<br />
auftaucht. Besonders auffällig s<strong>in</strong>d die wiederkehrenden Versuche, e<strong>in</strong>en Generationenkonflikt<br />
zu schüren. Jörg Tremmel – Mitbegründer der „Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen“<br />
– sieht z.B. e<strong>in</strong>e Altenlobby am Werk, die die Zukunftschancen der Jüngeren ru<strong>in</strong>iert,<br />
<strong>und</strong> malt das Schreckensbild e<strong>in</strong>er „Diktatur der Senioren <strong>und</strong> Senilen“ (Tremmel, 1996, S. 60) an<br />
267
268<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
die Wand. Zugespitzt wird formuliert, die Älteren hätten sich auf Kosten der nachfolgenden Generationen<br />
unrechtmäßig bereichert <strong>und</strong> würden heute vom Wohlfahrtsstaat unverhältnismäßig begünstigt:<br />
Der Wohlstand der heutigen Rentner <strong>und</strong> Pensionäre gehe zulasten enormer ökonomischer<br />
Folgekosten (Arbeitslosigkeit durch zu hohe Lohnnebenkosten, K<strong>in</strong>derarmut, Verschuldung)<br />
<strong>und</strong> ökologischer Schäden (hemmungslose Ausbeutung der Ressourcen, Umweltzerstörung) für die<br />
jüngeren Generationen, während sich die Älteren derweil geruhsam <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e sozial abgefederte<br />
Konsumentenrolle zurückziehen <strong>und</strong> „<strong>in</strong> schmucken Ferienhäusern am Mittelmeer“ überw<strong>in</strong>tern<br />
(Schreiber, 1996, S. 93). Es wird e<strong>in</strong>e „gierige Generation“ (Klöckner, 2003) beklagt, <strong>und</strong> dabei<br />
zumeist geflissentlich übersehen, dass nicht alle Älteren im sonnigen Süden überw<strong>in</strong>tern, nicht alle<br />
die Umwelt gleichermaßen vernachlässigt haben, <strong>und</strong> ke<strong>in</strong>esfalls nur Rentner Zweitwohnungen im<br />
südlichen Ausland besitzen. Die Relevanz sozialer Ungleichheit wird <strong>in</strong> dieser Diskussion zumeist<br />
ignoriert, e<strong>in</strong> <strong>in</strong> weiten Teilen altersunabhängiges Verteilungsproblem zum „Altersklassenkampf“<br />
(Schreiber, 1996) stilisiert. 1 Dabei wird die Leistungsbilanz zwischen den Generationen <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang meist e<strong>in</strong>seitig – nämlich mit alle<strong>in</strong>igem Blick auf die öffentlichen Transferleistungen<br />
an die Älteren – dargestellt. Allenfalls die früheren Leistungen der Älteren – etwa <strong>in</strong> der<br />
Aufbauphase der B<strong>und</strong>esrepublik oder ihre geleisteten Beiträge zum System sozialer Sicherung –<br />
f<strong>in</strong>den vere<strong>in</strong>zelt anerkennende Erwähnung. Weitgehend unberücksichtigt aber bleiben die aktuellen<br />
Leistungen der Älteren selbst: Die wohlfahrtsstaatliche Umverteilung von den Erwerbstätigen<br />
zu den Rentnern <strong>und</strong> Pensionären schafft Freiräume <strong>und</strong> stellt Ressourcen bereit, die u.a. durch<br />
ehrenamtliche Tätigkeiten, Pflege, (Enkel-)K<strong>in</strong>derbetreuung, <strong>in</strong>formelle Unterstützungsleistungen<br />
<strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzielle Transfers <strong>in</strong> der Familie auch den Jüngeren wieder zugute kommen (vgl. Künem<strong>und</strong>,<br />
1999; Kohli et al., 2000). Ohneh<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d die hohen Rentenversicherungsbeiträge derzeit noch<br />
weniger den demographischen Veränderungen als jenen am Arbeitsmarkt geschuldet – dieses<br />
Problem steht erst noch an. 2<br />
H<strong>in</strong>sichtlich des zweiten Aspektes ist festzuhalten, dass die Älteren zunehmend e<strong>in</strong>en Personenkreis<br />
darstellen, der mit den bisherigen Kategorien <strong>und</strong> Wahrnehmungsformen von „Rentnern“<br />
nicht mehr angemessen zu erfassen ist: Sie werden nicht nur zahlenmäßig mehr, sondern sie<br />
verbr<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>e deutlich gestiegene Lebenszeit im Ruhestand, sie s<strong>in</strong>d „jünger“ <strong>und</strong> leben zugleich<br />
länger. Vor allem aber weist bislang jede jüngere Ruhestandskohorte e<strong>in</strong>e im Schnitt bessere Bildung,<br />
e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> auch e<strong>in</strong>e bessere f<strong>in</strong>anzielle Absicherung auf. Die Älteren<br />
br<strong>in</strong>gen also zunehmend bessere Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e aktive <strong>und</strong> produktive Gestaltung mit <strong>in</strong><br />
die nachberufliche Lebensphase. Insofern wäre es nicht überraschend, neue Partizipations- <strong>und</strong><br />
Tätigkeitsformen im Alter vorzuf<strong>in</strong>den, die sich von der „Altersfreizeit“ z.B. der 70er Jahre deut-<br />
1 Zu e<strong>in</strong>em wirklichen Altersklassenkampf fehlt <strong>in</strong> gewisser H<strong>in</strong>sicht noch der Gegner auf gleicher Augenhöhe – zum<strong>in</strong>dest<br />
bislang treten noch kaum öffentlichkeitswirksame <strong>und</strong> schlagkräftige Organisationen Älterer auf, die ähnlich<br />
plakativ den Jüngeren e<strong>in</strong>en kollektiven Egoismus vorwerfen – die rücksichtlose Maximierung ihrer „Wohlfahrtsbilanz“<br />
als k<strong>in</strong>derlose Doppelverdiener, denen die Alten als „Renditekiller“ nur im Weg stehen.<br />
2 Die absehbaren Probleme z.B. der Staatsverschuldung <strong>und</strong> abnehmender Kohortengrößen sollen an dieser Stelle nicht<br />
<strong>in</strong> Abrede gestellt werden – im Gegenteil. Nur deren Rahmung als Generationenkonflikt ist nicht h<strong>in</strong>reichend differenziert<br />
<strong>und</strong> legt „Lösungen“ nahe, die ihrerseits sozial differenzierend wirken. Dies wird – beabsichtigt oder nicht – zu<br />
selten ausführlich erörtert.
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
lich unterscheiden. Tatsächlich wird – seit die genannten Trends <strong>in</strong> das Blickfeld geraten s<strong>in</strong>d – das<br />
Entstehen e<strong>in</strong>er neuen Generation „zwischen Lebensmitte <strong>und</strong> Lebensabend“ (Opaschowski &<br />
Neubauer, 1984, S. 36), e<strong>in</strong>es „gewandelten Ruhestandsbewußtse<strong>in</strong>s“ (Naegele 1984: 64), e<strong>in</strong>er<br />
„neuen Muße-Klasse“ (Tokarski, 1985), von „neuen Freizeitgenerationen“ (Attias-Donfut, 1988)<br />
oder zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>e Ausdifferenzierung von Lebensstilen auch im Alter erwartet (Tokarski, 1989).<br />
Die empirische Bef<strong>und</strong>lage hierzu ist bislang allerd<strong>in</strong>gs äußerst dünn. Die wenigen Studien, die<br />
„junge“ oder „neue“ Alte auf repräsentativer Basis empirisch identifizieren konnten, s<strong>in</strong>d widersprüchlich<br />
<strong>und</strong> z.T. auch methodisch fragwürdig: zwischen zwei <strong>und</strong> 25 Prozent variieren die Ergebnisse<br />
alle<strong>in</strong> für den Anteil „neuer“ Alter (Künem<strong>und</strong>, 2001). Gelegentlich wird die Existenz<br />
neuer Lebens- <strong>und</strong> Freizeitstile im Alter schlicht unterstellt (z.B. Tokarski 1998, S. 111), doch<br />
überzeugende empirische Belege fehlen bislang. Dass sich die gesellschaftliche Partizipation im<br />
Alter weniger schnell <strong>und</strong> drastisch verändert, als dies <strong>in</strong> Anbetracht der veränderten Ressourcen<br />
zu erwarten wäre, liegt teilweise auch an den gesellschaftlichen Strukturen, die sich an das Altern<br />
der Gesellschaft noch kaum angepasst haben (Riley et al. 1994). Gemessen an der historischen<br />
Zunahme der Lebenszeit außerhalb des Bereichs der Erwerbsarbeit <strong>und</strong> der zunehmend besseren<br />
Ressourcenausstattung der Älteren ersche<strong>in</strong>t die „gesellschaftliche Produktivität des Alters unterentwickelt“<br />
(Tews 1996, S. 193), weil auch die Opportunitätsstrukturen e<strong>in</strong> produktives Engagement<br />
der Älteren unterentwickelt s<strong>in</strong>d.<br />
Für die beiden genannten Aspekte ist somit die Frage nach der Produktivität des Alters zentral.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist umstritten, was unter „Produktivität “ zu verstehen ist, <strong>und</strong> ob man diesen Begriff<br />
überhaupt verwenden sollte (vgl. als Übersicht zu verschiedenen Def<strong>in</strong>itionen O´Reilly/Caro<br />
1994). Während <strong>in</strong> soziologischer <strong>und</strong> ökonomischer Perspektive neben der Erwerbsarbeit primär<br />
Haushaltsproduktion, Eigenarbeit, Ehrenamt <strong>und</strong> Netzwerkhilfen <strong>in</strong> das Blickfeld geraten (z.B.<br />
Glatzer, 1986), kann <strong>in</strong> psychologischer Perspektive bereits die erfolgreiche Anpassung an spezifische<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen, also z.B. an alterspezifische Verluste, als „produktiv“ bezeichnet werden<br />
(z.B. Baltes, 1996). Wird der Begriff dabei zu eng gefasst, besteht die Gefahr e<strong>in</strong>er Privilegierung<br />
e<strong>in</strong>zelner Tätigkeiten bei der gesellschaftlichen Bewertung e<strong>in</strong>es erfolgreichen Alterns, bzw. umgekehrt:<br />
e<strong>in</strong>er Stigmatisierung anderer Tätigkeiten sowie großer Teile der Bevölkerung als „unproduktiv“.<br />
Dies ist an dieser Stelle selbstverständlich nicht beabsichtigt. Wird der Begriff aber zu<br />
weit gefasst, so verbleibt nur e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>er Prozentsatz „unproduktiver“ Menschen, deren „Unproduktivität“<br />
oftmals nicht freiwillig gewählt se<strong>in</strong> dürfte <strong>und</strong> für die dieses Konzept daher besonders<br />
unpassend ersche<strong>in</strong>t. Soll die Perspektive der Produktivität empirisch Trennschärfe besitzen, muss<br />
daher irgendwo zwischen solchen Extremen e<strong>in</strong>e Trennl<strong>in</strong>ie gezogen werden – e<strong>in</strong>e Engführung<br />
des Begriffs ist unerlässlich. Es geht dabei dann darum, die Produktivität gemäß dieser Def<strong>in</strong>ition<br />
<strong>in</strong> groben Zügen zu vermessen, wohl wissend, dass andere Aspekte von Produktivität dabei ausgeklammert<br />
bleiben <strong>und</strong> andere Def<strong>in</strong>itionen auch zu anderen Ergebnisse führen können.<br />
Es wurde bereits an früherer Stelle skizziert, welche Tätigkeitsfelder <strong>in</strong> der Lebensphase „Alter“<br />
gesellschaftlich als relevant herausgehoben werden können, aber zumeist noch zu selten angemessen<br />
zur Kenntnis genommen wurden (Kohli & Künem<strong>und</strong>, 1996; Künem<strong>und</strong>, 2000). An dieser<br />
Stelle soll diese Bestandsaufnahme auf der Basis der zweiten Welle des Alterssurveys aktualisiert<br />
werden, wobei sich die Darstellung auf e<strong>in</strong>e sehr knappe Skizze „produktiver“ Tätigkeiten <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>formeller Unterstützungsleistungen beschränkt. Deutlich gemacht werden soll damit, dass sich<br />
die Älteren ke<strong>in</strong>eswegs kollektiv <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e sozial abgefederte Konsumentenrolle zurückziehen <strong>und</strong><br />
269
270<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
daher empirisch stichhaltig pauschal als egoistische, gierige Generation bezeichnet werden können,<br />
sondern sie <strong>in</strong> beträchtlichem Ausmaß produktiv etwas für die Gesellschaft leisten. Diese Leistung<br />
würde bei e<strong>in</strong>er weiter gefassten Perspektive noch höher liegen, etwa bei Berücksichtigung psychologischer<br />
Aspekte wie z.B. der S<strong>in</strong>nerfüllung im Alter, die wiederum – auch <strong>in</strong> ihrer „Summe“<br />
– e<strong>in</strong>e erhebliche gesellschaftliche Bedeutung haben. Zwar zeigt sich im Vergleich der Altersgruppen<br />
zumeist e<strong>in</strong> deutlicher Rückgang der Partizipationsquoten im höheren Alter, aber die Ursachen<br />
hierfür s<strong>in</strong>d nicht zw<strong>in</strong>gend <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Egoismus der älteren Generation zu suchen – Opportunitätsstrukturen<br />
<strong>und</strong> Ressourcen wie Ges<strong>und</strong>heit, Bildung <strong>und</strong> e<strong>in</strong> h<strong>in</strong>reichendes <strong>und</strong> verlässliches E<strong>in</strong>kommen<br />
dürften neben e<strong>in</strong>geschliffenen Rout<strong>in</strong>en der Lebensführung <strong>und</strong> Altersbildern weit entscheidender<br />
se<strong>in</strong>. Dass die Verfügbarkeit <strong>und</strong> Verlässlichkeit dieser Ressourcen <strong>in</strong> der gegenwärtigen<br />
Diskussion um die Zukunft des Sozialstaats dennoch <strong>in</strong>frage gestellt werden, ist so betrachtet<br />
sogar widers<strong>in</strong>nig: Die Gr<strong>und</strong>lagen für e<strong>in</strong>e „produktive“ Partizipation stehen damit für Teile der<br />
Älteren ebenfalls <strong>in</strong>frage.<br />
Im Folgenden wird die gegenwärtige Verbreitung der wichtigsten Tätigkeiten dokumentiert, wie<br />
sie mit dem Alterssurvey 2002 erfasst wurden. Auch wenn sich das Interesse an dieser Stelle<br />
hauptsächlich auf die gegenwärtigen Tätigkeiten im Ruhestand richtet, ist der E<strong>in</strong>bezug jüngerer<br />
Personen wichtig: Die Besonderheiten dieser Lebensphase treten erst im Vergleich hervor. In den<br />
Abbildungen werden daher Altersunterschiede über die Spanne von 40 bis 85 Jahren <strong>in</strong> Fünfjahresgruppen<br />
ausgewiesen, jeweils getrennt für Männer <strong>und</strong> Frauen <strong>in</strong> Ost <strong>und</strong> West. Trotz der <strong>in</strong>sgesamt<br />
hohen Fallzahl ist damit fast die Grenze der Aussagefähigkeit erreicht. Dies gilt <strong>in</strong>sbesondere<br />
für die Altersgruppen 75-79 Jahre <strong>und</strong> 80-85 Jahre <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern, da die Ausschöpfung<br />
bei den Ältesten etwas weniger gut ausfiel. Konkret basieren die Daten für die neuen B<strong>und</strong>esländer<br />
im Jahre 1996 auf 52 Männern <strong>und</strong> 69 Frauen der Altersgruppe 75-79 Jahre sowie 49 Männern<br />
<strong>und</strong> 53 Frauen der Altersgruppe 80-85 Jahre (jeweils ungewichtete Fallzahlen). Im Jahr 2002<br />
s<strong>in</strong>d es <strong>in</strong> der Altersgruppe 75-79 Jahre mit 54 <strong>und</strong> 67 Fällen ähnlich viele Befragte, <strong>und</strong> auch <strong>in</strong><br />
den jüngeren Altersgruppen s<strong>in</strong>d es nur je um die 50 Fälle. Bei den 80- bis 85-Jährigen s<strong>in</strong>d es<br />
sogar nur 28 Männer <strong>und</strong> 39 Frauen. In E<strong>in</strong>zelfällen kann es bei dieser fe<strong>in</strong>en Untergliederung <strong>in</strong><br />
diesen Gruppen somit zu „ungewöhnlichen“ Quoten kommen, die nicht über<strong>in</strong>terpretiert werden<br />
sollten. Die Tabellen im Anhang geben zusätzlich e<strong>in</strong>e Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen,<br />
gegliedert nach den Schichtungskriterien der Stichprobe.<br />
6.2 Erwerbstätigkeit<br />
Mit dem Altern der Gesellschaft geht e<strong>in</strong>e Verknappung des Arbeitskräfteangebots e<strong>in</strong>her: Dem<br />
Arbeitsmarkt werden – auch bei fortgesetzter Zuwanderung – <strong>in</strong> Zukunft deutlich weniger junge<br />
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen als bisher. Dem „Altern der Gesellschaft“ korrespondiert daher<br />
e<strong>in</strong> „Altern der Belegschaften“, was für die Leistungs- <strong>und</strong> Konkurrenzfähigkeit der Betriebe wie<br />
auch der Volkswirtschaft <strong>in</strong>sgesamt gänzlich neue Herausforderungen stellt, die bislang noch kaum<br />
h<strong>in</strong>reichend erkannt worden s<strong>in</strong>d (vgl. z.B. Frerichs, 1998; Bull<strong>in</strong>ger, 2001; Herfurth et al., 2003).<br />
Die bisherige Praxis der beruflichen Frühausgliederung muss vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> ebenso <strong>in</strong>frage<br />
gestellt werden wie das gängige Bild älterer Arbeitnehmer mit ger<strong>in</strong>gerer Leistungsfähigkeit,<br />
höheren krankheitsbed<strong>in</strong>gten Ausfallzeiten, ger<strong>in</strong>gerer Qualifikation vor allem im Umgang mit<br />
neuen Technologien usw., im Gegenteil s<strong>in</strong>d Diskussionen notwendig zu Stichworten wie dem
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
„Lebenslangen Lernen im Beruf“, der Gestaltung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen für ältere Arbeitnehmer<br />
sowie nicht zuletzt der Veränderung der Altersgrenzen beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben<br />
<strong>und</strong> dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand, soll das Altern der Gesellschaft nicht zu e<strong>in</strong>em zusätzlichen<br />
„Standortnachteil“ werden.<br />
Der Blick auf die gegenwärtige Erwerbsbeteiligung Älterer ist vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>in</strong>struktiv,<br />
<strong>in</strong>sofern er die Beschäftigungsfelder, Kompetenzen <strong>und</strong> Ressourcen <strong>in</strong> den Blick nehmen kann,<br />
auch wenn es sich derzeit nicht um e<strong>in</strong>e besonders verbreitete Form nachberuflicher Tätigkeit handelt.<br />
Der Blick auf die Erwerbsbeteiligung steht aber hier auch deshalb an erster Stelle, weil der<br />
Rückgang der Erwerbsbeteiligung im Alter den H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> für die Frage nach den nachberuflichen<br />
Tätigkeitsfeldern erhellt.<br />
Die Ergebnisse des Alterssurvey zeigen e<strong>in</strong>e relativ hohe Arbeitsmarktbeteiligung der 40- bis 44jährigen<br />
Männer <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern (89 Prozent, e<strong>in</strong>schließlich unregelmäßiger, ger<strong>in</strong>gfügiger<br />
<strong>und</strong> Nebenerwerbstätigkeiten sowie der Erwerbstätigkeit von Rentnern <strong>und</strong> Pensionären; vgl.<br />
Abbildung 6.1), während <strong>in</strong> der Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen dieser Anteil nur bei 31 Prozent<br />
liegt. Im Vergleich zu 1996 s<strong>in</strong>d diese Anteile etwas gesunken, aber <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
liegen diese Anteile längst nicht mehr so deutlich unter jenen im Westen, wie dies noch 1996<br />
der Fall war (vgl. Künem<strong>und</strong>, 2000). Dies dürfte daran liegen, dass die Vorruhestands- <strong>und</strong> Altersübergangsgeldregelungen<br />
im Osten Deutschlands nicht mehr greifen bzw. ausgelaufen s<strong>in</strong>d; die<br />
Wirkungen der massiven Ausgliederung älterer Arbeitnehmer nach der Wende – 1996 noch deutlich<br />
erkennbar – s<strong>in</strong>d kaum noch auszumachen.<br />
Abbildung 6.1:<br />
Alle Erwerbstätigkeiten<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
40-44<br />
45-49<br />
50-54<br />
55-59<br />
60-64<br />
65-69<br />
70-74<br />
75-79<br />
80-85<br />
Altersgruppen<br />
Männer (West)<br />
Männer (Ost)<br />
Frauen (West)<br />
Frauen (Ost)<br />
Die Quoten bei den 60- bis 64-Jährigen lägen noch etwas niedriger, wenn nur hauptberufliche Tätigkeiten<br />
betrachtet werden würden – die hier e<strong>in</strong>bezogenen Erwerbstätigkeiten der Altersrentner<br />
271
272<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
führen zu e<strong>in</strong>er leichten Überschätzung des Anteils der Personen, die noch voll im Erwerbsleben<br />
stehen. E<strong>in</strong>e solche Erwerbstätigkeit nach dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand ist noch immer e<strong>in</strong>e<br />
seltene Ausnahme, aber etwas häufiger als noch 1996: Es s<strong>in</strong>d 6,3 Prozent derjenigen unter 86<br />
Jahren erwerbstätig, die bereits e<strong>in</strong>e Altersrente aus eigener Erwerbstätigkeit beziehen (1996: 5,1<br />
Prozent); bei den 70- bis 85-Jährigen s<strong>in</strong>d es 4,7 Prozent (vgl. Tabelle A6.1). 3 Die Männer s<strong>in</strong>d<br />
dabei mit 7,2 Prozent etwa aktiver als die Frauen (5,5 Prozent). Und im Osten Deutschlands ist<br />
e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit von Altersrentnern <strong>und</strong> Pensionären mit 4,9 Prozent etwas seltener als im<br />
Westen (6,7 Prozent). Insgesamt aber kann man festhalten, dass die „Entberuflichung“ des Alters<br />
heute be<strong>in</strong>ahe vollständig erfolgt ist. Welche Tätigkeiten treten an diese Stelle? Welche werden<br />
neu aufgenommen, welche <strong>in</strong>tensiviert?<br />
6.3 Ehrenamtliches Engagement<br />
Das Interesse am Feld der ehrenamtlichen Tätigkeiten hat <strong>in</strong> den letzten Jahren enorm zugenommen,<br />
<strong>und</strong> zwar auch h<strong>in</strong>sichtlich der Älteren. Die Datenlage hierzu hat sich ebenfalls deutlich verbessert,<br />
allerd<strong>in</strong>gs ist sie nicht immer leicht <strong>in</strong>terpretierbar. Unter ehrenamtlicher Tätigkeit wurde<br />
lange Zeit freiwillige, nicht auf Entgelt ausgerichtete Tätigkeit im Rahmen von Institutionen <strong>und</strong><br />
Vere<strong>in</strong>igungen verstanden, also e<strong>in</strong>e an die Mitgliedschaft <strong>in</strong> Organisationen, Vere<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Verbänden<br />
geb<strong>und</strong>ene Funktion. Dieses „traditionelle“ Bild des Ehrenamts gerät seit längerem <strong>in</strong> Bedrängnis<br />
– es wird e<strong>in</strong>e „neue Ehrenamtlichkeit“ außerhalb oder am Rande der traditionellen Institutionen<br />
– <strong>in</strong>sbesondere der großen Wohlfahrtsverbände – konstatiert, nämlich <strong>in</strong> selbstorganisierten<br />
Gruppen, Initiativen <strong>und</strong> Projekten (Olk, 1987). Was das qualitativ Neue an der neuen Ehrenamtlichkeit<br />
ist, bleibt dennoch etwas unklar. Schmitz-Scherzer et al. (1994, S. 70) heben z.B. den<br />
Aspekt der Professionalisierung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Abkehr vom Pr<strong>in</strong>zip der Unentgeltlichkeit hervor. In<br />
dieser Perspektive handelt es sich also tendenziell um e<strong>in</strong>e „schlecht bezahlte Erwerbsarbeit“, deren<br />
verstärkte Inanspruchnahme letztlich helfen soll, den Sozialstaat zu entlasten (vgl. auch die<br />
Diskussion im Band von Müller & Rauschenbach, 1988). Braun et al. (1997, S. 98f.) stellen als<br />
Unterschied heraus, dass „traditionelles“ Ehrenamt primär „Tätigkeit für andere“ sei, das „neue“<br />
Ehrenamt eher „Tätigkeit für sich <strong>und</strong> für andere“. In dieser Perspektive wird das gesellschaftliche<br />
bzw. sozialpolitische Interesse an e<strong>in</strong>er verstärkten Nutzung unausgeschöpfter Potentiale ehrenamtlichen<br />
Engagements neben e<strong>in</strong>en expliziten H<strong>in</strong>weis auf die „process benefits“ für die beteiligten<br />
Individuen gestellt. Empirisch allerd<strong>in</strong>gs dürften sowohl diese Differenzierung zwischen altruistischen<br />
bzw. Verpflichtungsmotiven <strong>und</strong> egoistischen bzw. Selbstentfaltungsmotiven als auch deren<br />
konkrete Mischungsverhältnisse kaum bestimmbar se<strong>in</strong>, 4 so dass auch dieser <strong>Wandel</strong> nur schwer<br />
3 Nicht erhoben wurden Erwerbstätigkeiten von Vorruheständlern, Arbeitslosen <strong>und</strong> Beziehern von Erwerbs- <strong>und</strong> Berufsunfähigkeitsrenten.<br />
4 E<strong>in</strong>e Mischung dieser Motive ist ohneh<strong>in</strong> auch beim „traditionellen“ Ehrenamt wahrsche<strong>in</strong>lich: Das Erlangen der<br />
„Ehre“, welche mit dem traditionellen politischen Ehrenamt e<strong>in</strong>hergeht, kann selbst e<strong>in</strong> wesentliches Motiv zur Ausübung<br />
dieser Tätigkeiten darstellen. Und auch beim sozialen Ehrenamt spielen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Interessen <strong>und</strong> Präferenzen<br />
(e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle Aufgabe zu haben, Kontakte zu Anderen usw.) sicher schon länger e<strong>in</strong>e erhebliche Rolle.
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
empirisch belegt werden kann. E<strong>in</strong>deutig sche<strong>in</strong>t lediglich der Bef<strong>und</strong>, dass sich die Felder ehrenamtlichen<br />
Engagements ausdifferenzieren <strong>und</strong> nicht mehr auf die traditionellen Vere<strong>in</strong>e <strong>und</strong> Verbände<br />
beschränken.<br />
Daneben kamen <strong>in</strong> den letzten Jahren zunehmend neuere Konzepte wie bürgerschaftliches Engagement<br />
oder freiwillige soziale Tätigkeiten <strong>in</strong> die Diskussion, die empirisch unterschiedlich erfasst<br />
werden <strong>und</strong> daher zu gänzlich anderen Ergebnissen führen. In die Erhebung bürgerschaftlichen<br />
Engagements etwa geht bereits die aktive Beteiligung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Selbsthilfegruppe oder der Kirchengeme<strong>in</strong>de<br />
e<strong>in</strong>, auch wenn damit ke<strong>in</strong> „Amt“ oder e<strong>in</strong>e spezifische „Funktion“ verb<strong>und</strong>en ist (Klages<br />
1998). Es stehen also weniger Funktionen oder Ämter als vielmehr das Engagement an sich im<br />
Vordergr<strong>und</strong>, d.h. auch jemand, der sich aktiv z.B. für Dorf- <strong>und</strong> Stadtteilverschönerung e<strong>in</strong>setzt,<br />
soll explizit e<strong>in</strong>gerechnet werden, <strong>und</strong> zwar auch dann, wenn diese Person <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
ke<strong>in</strong> Amt bekleidet, sondern sich eben nur aktiv beteiligt. Diese Breite ist bei der allgeme<strong>in</strong>eren<br />
Frage nach dem bürgerschaftlichen Engagement auch durchaus s<strong>in</strong>nvoll, jedoch s<strong>in</strong>d die Ergebnisse<br />
dann nur sehr e<strong>in</strong>geschränkt mit den bisherigen Ergebnissen zum ehrenamtlichen Engagement<br />
vergleichbar: die so ermittelten Beteiligungsquoten liegen zwangsläufig deutlich höher.<br />
Damit werden nicht nur die Ergebnisse empirischer Forschung vielfältiger; auch e<strong>in</strong> Querschnittsvergleich<br />
zur Abschätzung gesellschaftlicher Veränderungen <strong>in</strong> diesem Bereich wird erschwert. Im<br />
Alterssurvey wurde h<strong>in</strong>gegen versucht, das traditionelle Ehrenamt <strong>in</strong> den Mittelpunkt zu stellen,<br />
um mit früheren Studien vergleichbar zu bleiben, zugleich aber neuere Formen des Engagements<br />
<strong>in</strong>sbesondere im alterspezifischen Bereich sowie weitere ehrenamtliche Tätigkeiten ohne Anb<strong>in</strong>dung<br />
an Vere<strong>in</strong>e oder Verbände zusätzlich e<strong>in</strong>zubeziehen. 5<br />
Im Bereich des so gemessenen ehrenamtlichen Engagements fällt der Rückgang der Partizipation<br />
im höheren Alter weit weniger dramatisch als etwa die Erwerbstätigkeit, aber immer noch erheblich<br />
aus (vgl. Abbildung 6.2 sowie Tabelle A6.1). Die Beteiligung geht von 23 Prozent bei den 40-<br />
bis 54-Jährigen auf neun Prozent bei den 70- bis 85-Jährigen zurück. Im Osten ist e<strong>in</strong> ehrenamtliches<br />
Engagement <strong>in</strong> allen Altersgruppen deutlich seltener als im Westen. Männer s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> allen<br />
Altersgruppen – <strong>in</strong> Ost <strong>und</strong> West – häufiger ehrenamtlich tätig als Frauen, <strong>und</strong> diese Differenz<br />
nimmt über die Altersgruppen zu, stärker noch, als dies bereits 1996 der Fall war.<br />
5 Die verwendete Liste zu den Vere<strong>in</strong>en, Gruppen <strong>und</strong> Verbänden schließt u.a. Selbsthilfegruppen, Bürger<strong>in</strong>itiativen,<br />
Seniorengenossenschaften, Gruppen für freiwillige Tätigkeiten <strong>und</strong> Hilfen e<strong>in</strong>; es lassen sich also mit dem Alterssurvey<br />
– zumal auch <strong>in</strong>formelle Hilfen <strong>und</strong> Pflegetätigkeiten erhoben wurden – verschiedene Konzepte messen <strong>und</strong> analysieren.<br />
Im Folgenden wird e<strong>in</strong>e eher restriktive Def<strong>in</strong>ition des Ehrenamts verwendet, die nur konkrete Funktionen<br />
bzw. Ämter <strong>in</strong> diesen Gruppen berücksichtigt, nicht aber bereits die Mitgliedschaft z.B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Selbsthilfegruppe oder<br />
Bürger<strong>in</strong>itiative.<br />
273
Abbildung 6.2:<br />
Ehrenamtliches Engagement<br />
274<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
40-44<br />
45-49<br />
50-54<br />
55-59<br />
60-64<br />
65-69<br />
70-74<br />
75-79<br />
80-85<br />
Altersgruppen<br />
Männer (West)<br />
Männer (Ost)<br />
Frauen (West)<br />
Frauen (Ost)<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
Die höchsten Quoten von ehrenamtlich Tätigen unter den 40- bis 85-Jährigen f<strong>in</strong>den sich bei den<br />
Sportvere<strong>in</strong>en, geselligen Vere<strong>in</strong>igungen, kirchlichen bzw. religiösen Gruppen <strong>und</strong> den wohltätigen<br />
Organisationen, d.h. solchen Vere<strong>in</strong>en, Gruppen <strong>und</strong> Verbänden, die man als „altersunspezifisch“<br />
bezeichnen kann. Im Kontrast zu der wissenschaftlichen <strong>und</strong> sozialpolitischen Aufmerksamkeit,<br />
die dem „altersspezifischen“ Bereich der Seniorengenossenschaften, Vorruhestands- <strong>und</strong><br />
Seniorenselbsthilfegruppen, politischen Interessenvertretungen Älterer oder dem Bereich der Bildung<br />
im Alter zuteil wird, ist e<strong>in</strong>e faktische Teilnahme <strong>in</strong> diesen Bereichen eher selten. Und bei<br />
diesen altersspezifischen Gruppen <strong>und</strong> Vere<strong>in</strong>en ist die Beteiligung im „traditionellen“ Bereich am<br />
stärksten, also <strong>in</strong> den Seniorenfreizeitstätten oder z.B. <strong>in</strong> Seniorentanzgruppen. Die „neuen“ Formen<br />
altersspezifischer Partizipation stoßen auf wesentlich ger<strong>in</strong>geren Zuspruch. Vergleichsweise<br />
hoch liegt dagegen mit gut sechs Prozent der Anteil der Ehrenämter <strong>und</strong> Funktionen, die nicht an<br />
e<strong>in</strong>e Mitgliedschaft <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vere<strong>in</strong> oder Verband geb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d.<br />
Die ehrenamtlich Tätigen <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en oder Verbänden s<strong>in</strong>d meist wöchentlich (48 Prozent) oder<br />
monatlich (36 Prozent) <strong>in</strong> dieser Funktion tätig; drei Prozent s<strong>in</strong>d sogar täglich, weitere 13 Prozent<br />
aber auch seltener als monatlich engagiert. Frauen <strong>und</strong> Männer unterscheiden sich <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht<br />
nicht – es gibt also <strong>in</strong> allen Altersgruppen bei Männern <strong>und</strong> Frauen etwa gleich hohe Anteile<br />
von mehr <strong>und</strong> weniger aktiven Ehrenamtlichen. Im Schnitt werden knapp 18 St<strong>und</strong>en pro Monat <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e ehrenamtliche Tätigkeit <strong>in</strong>vestiert – 19 St<strong>und</strong>en von den 40- bis 54-Jährigen <strong>und</strong> 17 St<strong>und</strong>en<br />
von den 70- bis 85-Jährigen. Dem deutlichen Rückgang im Beteiligungsgrad entspricht also ke<strong>in</strong><br />
ebenso deutlicher Rückgang der Intensität des Ehrenamtes. Es handelt sich oftmals um e<strong>in</strong> erhebliches<br />
Engagement, welches die Älteren weitgehend unentgeltlich e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen.
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
6.4 Pflegetätigkeiten<br />
Nach den jüngsten Ergebnissen e<strong>in</strong>er Repräsentativerhebung im Auftrag des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums<br />
für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (BMFSFJ) liegt die Zahl der Hilfs- <strong>und</strong> Pflegebedürftigen<br />
<strong>in</strong> Privathaushalten – gemessen an den Leistungsbeziehern der sozialen oder privaten Pflegeversicherung<br />
– bei r<strong>und</strong> 1,4 Millionen (Schneekloth & Leven, 2003). H<strong>in</strong>zu kommen zusätzlich<br />
knapp 3 Millionen so genannte hauswirtschaftlich Hilfebedürftige, die bei ihren alltäglichen Verrichtungen<br />
e<strong>in</strong>geschränkt s<strong>in</strong>d; knapp die Hälfte davon ist auf tägliche Hilfe angewiesen. Die Studie<br />
zeigt auch, dass <strong>in</strong> ganz überwiegendem Maße die näheren Angehörigen für die Betreuung<br />
Pflege- <strong>und</strong> Hilfsbedürftiger <strong>in</strong> Privathaushalten – meist unbezahlt – die Hauptverantwortung tragen.<br />
Bei den ersten Auswertungen des Alterssurvey hatte sich gezeigt, dass die bisherigen Studien (<strong>und</strong><br />
auch neuere wie z.B. Schneekloth & Leven, 2003) durch die Konzentration auf die jeweiligen<br />
Hauptpflegepersonen auf der Ebene pflegenden Personen ke<strong>in</strong>e Repräsentativität beanspruchen<br />
können <strong>und</strong> hier eher zu Fehlschlüssen verleiten. Dies wurde u.a. daran deutlich, dass sich im Alterssurvey<br />
e<strong>in</strong> höherer Anteil von pflegenden Männern ergab, als dies üblicherweise angenommen<br />
wurde (vgl. ausführlich hierzu: Künem<strong>und</strong>, 2000). Inzwischen konnte diese Perspektive auch mit<br />
Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) repliziert werden, wobei die Ergebnisse jenen des<br />
Alterssurvey weitgehend entsprechen (vgl. Schupp & Künem<strong>und</strong>, 2004).<br />
Auch die Ergebnisse der zweiten Welle weisen <strong>in</strong> diese Richtung. Insgesamt betreuen gut elf Prozent<br />
der 40- bis 85-jährigen hilfe- oder pflegebedürftige Personen, <strong>und</strong> zwar überwiegend die<br />
(Schwieger-)Eltern: 51 Prozent der Pflegenden betreuen e<strong>in</strong>en Angehörigen der Elterngeneration.<br />
Nur e<strong>in</strong> Prozent der Pflegenden betreut e<strong>in</strong>en Angehörigen der Großelterngeneration, 18 Prozent<br />
betreuen e<strong>in</strong>en (Ehe-)Partner, 19 Prozent e<strong>in</strong>en anderen Verwandten <strong>und</strong> 17 Prozent e<strong>in</strong>e nichtverwandte<br />
Person. Der Anteil derjenigen Pflegenden, die e<strong>in</strong>en Angehörigen der Elterngeneration<br />
betreuen, ist bei den 40- bis 54-Jährigen am höchsten (72 Prozent), da <strong>in</strong> den höheren Altersgruppen<br />
die Existenz e<strong>in</strong>es Angehörigen der Elterngeneration zunehmend unwahrsche<strong>in</strong>licher wird. Bei<br />
den 70- bis 85-Jährigen s<strong>in</strong>d es h<strong>in</strong>gegen überwiegend die (Ehe-)Partner, die gepflegt werden (45<br />
Prozent). Aber auch der Prozentsatz derjenigen, die e<strong>in</strong>e nicht-verwandte Person betreuen, nimmt<br />
über die Altersgruppen zu: Von den Pflegenden betreuen 15 Prozent der 40- bis 54-Jährigen, 22<br />
Prozent der 55- bis 69-Jährigen <strong>und</strong> 32 Prozent der 70- bis 85-Jährigen e<strong>in</strong>e Person, mit der sie<br />
nicht verwandt s<strong>in</strong>d. Gleichzeitig geht die Quote der Pflegenden im Altersgruppenvergleich kaum<br />
zurück (vgl. Abbildung 6.3).<br />
275
Abbildung 6.3:<br />
Pflegetätigkeiten<br />
276<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
40-44<br />
45-49<br />
50-54<br />
55-59<br />
60-64<br />
65-69<br />
70-74<br />
75-79<br />
80-85<br />
Altersgruppen<br />
Männer (West)<br />
Männer (Ost)<br />
Frauen (West)<br />
Frauen (Ost)<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen fallen also weniger deutlich aus als z.B. beim Ehrenamt.<br />
Deutlich erkennbar ist die höhere Quote der pflegenden Frauen: Sie pflegen mit knapp 15<br />
Prozent deutlich häufiger als Männer (acht Prozent). Dieser Unterschied zwischen Frauen <strong>und</strong><br />
Männern ist am höchsten <strong>in</strong> der Gruppe der 40- bis 54-Jährigen, <strong>in</strong> der es hauptsächlich um die<br />
Pflege der (Schwieger-)Eltern geht, <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>ger <strong>in</strong> der mittleren <strong>und</strong> höchsten der drei Altersgruppen,<br />
<strong>in</strong> der die Pflege des (Ehe-)Partners <strong>in</strong> den Vordergr<strong>und</strong> tritt. Und wo (Ehe-)Partner gepflegt<br />
werden, handelt es sich oftmals um e<strong>in</strong>e Betreuung „r<strong>und</strong> um die Uhr“, weshalb der durchschnittliche<br />
Zeitaufwand bei den 70- bis 85-Jährigen auch fast doppelt so hoch ausfällt wie bei den<br />
40- bis 54-Jährigen. Dem leichten Rückgang des Anteils der Pflegenden <strong>in</strong> den höheren Altersgruppen<br />
steht also e<strong>in</strong>e erhebliche zeitliche Intensivierung gegenüber, zugleich aber auch e<strong>in</strong> häufigeres<br />
Engagement für entferntere Verwandte, Fre<strong>und</strong>e, Bekannte <strong>und</strong> Nachbarn, als dies bei den<br />
jüngeren zu beobachten ist.<br />
6.5 (Enkel-)K<strong>in</strong>derbetreuung<br />
Die Betreuung von Enkelk<strong>in</strong>dern wurde <strong>in</strong> der Literatur zu Tätigkeitsformen im Alter bislang eher<br />
selten zum Thema gemacht. Sie ist dennoch <strong>in</strong> vielerlei H<strong>in</strong>sicht von Bedeutung: für die Vergesellschaftung<br />
<strong>und</strong> familiale Integration der Älteren, aber auch für die mittlere Generation (z.B. h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Entlastung erwerbstätiger Personen) <strong>und</strong> die Sozialisation der Enkelk<strong>in</strong>der. Die strukturellen<br />
Möglichkeiten für solche Tätigkeiten haben historisch betrachtet deutlich zugenommen –<br />
die angestiegene Lebenserwartung hat die geme<strong>in</strong>same Lebenszeit unterschiedlicher Generationen<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Familie stark erhöht (Uhlenberg, 1980, 1996).
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
E<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>derbetreuung ist als Tätigkeit bei den 55- bis 69-Jährigen am häufigsten vorf<strong>in</strong>dbar (vgl.<br />
Abbildung 6.4 sowie Tabelle A6.1). Der ger<strong>in</strong>gere Anteil bei den Ältesten hängt wahrsche<strong>in</strong>lich<br />
damit zusammen, dass die Enkelk<strong>in</strong>der hier oftmals e<strong>in</strong> Alter erreicht haben, <strong>in</strong> dem die Betreuung<br />
zunehmend überflüssig wird. Wie bei den Pflegetätigkeiten s<strong>in</strong>d es eher die Frauen, die <strong>in</strong> diesem<br />
Bereich tätig s<strong>in</strong>d. Die Unterschiede zwischen den alten <strong>und</strong> neuen B<strong>und</strong>esländern s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sofern<br />
überraschend, also 1996 noch e<strong>in</strong>e sehr deutlich höhere Beteiligung im Osten festgestellt wurde:<br />
Von beiden Geschlechtern <strong>und</strong> <strong>in</strong> allen Altersgruppen wurde diese Tätigkeit <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
häufiger ausgeübt. Dies dürfte z.T. auf die etwas höhere Fertilität <strong>und</strong> das niedrigere Alter<br />
der Eltern bei der Geburt der K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern zurückgegangen se<strong>in</strong>. H<strong>in</strong>gegen<br />
dürfte sich heute der drastische Geburtenrückgang nach der Wende stärker auswirken – die Gelegenheitsstrukturen<br />
für solche Tätigkeiten haben sich <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern verschlechtert.<br />
Abbildung 6.4:<br />
(Enkel-)K<strong>in</strong>derbetreuung<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
40-44<br />
45-49<br />
50-54<br />
55-59<br />
60-64<br />
65-69<br />
70-74<br />
75-79<br />
80-85<br />
Altersgruppen<br />
Männer (West)<br />
Männer (Ost)<br />
Frauen (West)<br />
Frauen (Ost)<br />
Der Zeitaufwand für diese Tätigkeit liegt im Durchschnitt bei ca. 35 St<strong>und</strong>en pro Monat. Die Varianz<br />
ist aber erheblich, da <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen wenigen Fällen e<strong>in</strong>e Betreuung „r<strong>und</strong> um die Uhr“ angegeben<br />
wurde, <strong>in</strong> anderen Fällen nur e<strong>in</strong>e St<strong>und</strong>e pro Monat. Die betreuten Personen s<strong>in</strong>d überwiegend die<br />
Enkelk<strong>in</strong>der (73 Prozent), allerd<strong>in</strong>gs bei erheblichen Altersunterschieden: Bei den Jüngeren s<strong>in</strong>d es<br />
überwiegen K<strong>in</strong>der von Fre<strong>und</strong>en oder Bekannten (35 Prozent); Enkelk<strong>in</strong>der s<strong>in</strong>d hier noch vergleichsweise<br />
selten vorhanden. Bei den 70- bis 85-Jährigen aber s<strong>in</strong>d es zu 90 Prozent Enkelk<strong>in</strong>der.<br />
Das Engagement der Älteren <strong>in</strong> diesem Bereich kommt also fast ausschließlich der Familie zugute.<br />
277
6.6 Informelle Hilfen <strong>und</strong> Transfers<br />
278<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, <strong>in</strong>formelle Hilfe <strong>und</strong> Unterstützung zu benötigen.<br />
Es ist aber auch h<strong>in</strong>sichtlich solcher Unterstützungsleistungen im Alltag zu e<strong>in</strong>seitig, die<br />
Älteren nur als potentielle oder faktische Empfänger von Hilfen darzustellen – e<strong>in</strong> erheblicher Anteil<br />
auch der Ältesten ist h<strong>in</strong>sichtlich solcher Unterstützungsleistungen im Alltag nicht Hilfebedürftig<br />
(vgl. Künem<strong>und</strong> & Hollste<strong>in</strong>, 2000). Im Gegenteil hat sogar von den 70- bis 85-Jährigen jeder<br />
Siebente e<strong>in</strong>er anderen Person, die nicht im gleichen Haushalt lebt, bei Arbeiten im Haushalt, z.B.<br />
beim Saubermachen, bei kle<strong>in</strong>eren Reparaturen oder beim E<strong>in</strong>kaufen geholfen. Bei den 40- bis 54-<br />
Jährigen liegt dieser Anteil allerd<strong>in</strong>gs bei 47 Prozent, d.h. auch solche Tätigkeiten werden über die<br />
Altersgruppen h<strong>in</strong>weg betrachtet deutlich seltener (Abbildung 6.5).<br />
Abbildung 6.5:<br />
Informelle Unterstützungsleistungen<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
40-44<br />
45-49<br />
50-54<br />
55-59<br />
60-64<br />
65-69<br />
70-74<br />
75-79<br />
80-85<br />
Altersgruppen<br />
Männer (West)<br />
Männer (Ost)<br />
Frauen (West)<br />
Frauen (Ost)<br />
In den neuen B<strong>und</strong>esländern s<strong>in</strong>d solche Unterstützungsleistungen <strong>in</strong> allen Altersgruppen etwas<br />
seltener, <strong>und</strong> zwar <strong>in</strong>sbesondere bei den Frauen. Bei den Jüngeren könnte dabei die stärkere Arbeitsmarktbeteiligung<br />
e<strong>in</strong>e Rolle spielen, aber <strong>in</strong>sgesamt ist dieser Trend überraschend, denn 1996<br />
war es noch umgekehrt: In den neuen B<strong>und</strong>esländern waren solche Unterstützungsleistungen <strong>in</strong><br />
allen Altersgruppen häufiger, <strong>und</strong> dies lag <strong>in</strong>sbesondere an den Männern, die hier stärker engagiert<br />
waren als die Frauen. Möglicherweise f<strong>in</strong>det aber auch bei den Männern hier die veränderte Arbeitsmarktsituation<br />
ihren Niederschlag, denn 1996 hatten Vorruhestand, Altersübergang, Kurzarbeit<br />
usw. noch e<strong>in</strong> anderes Ausmaß. Auch hat sich die ökonomische Lage offenbar verschlechtert<br />
(vgl. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel <strong>in</strong> diesem Bericht), d.h. die Ressourcen, Zeit <strong>und</strong> Geld s<strong>in</strong>d knapper geworden.<br />
Sollte dieser Zusammenhang für diesen Rückgang erklärungskräftig se<strong>in</strong>, müsste man h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der weiteren <strong>Entwicklung</strong> – <strong>in</strong> Anbetracht der im Schnitt eher knapperen Renten <strong>und</strong> der<br />
längeren Lebensarbeitszeit – skeptisch se<strong>in</strong>.
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
Betrachten wir die Personengruppen, die <strong>in</strong>strumentell unterstützt werden, wird deutlich, dass die<br />
40- bis 54-Jährigen häufig ihre (Schwieger-)Eltern unterstützen. Da die Existenz von Eltern mit<br />
steigendem Alter zunehmend unwahrsche<strong>in</strong>licher wird, geht dieser Anteil über die Altersgruppen<br />
stark zurück (von 21 auf e<strong>in</strong> Prozent). Abgesehen von den K<strong>in</strong>dern werden aber auch alle anderen<br />
Personengruppen von den 70- bis 85-Jährigen seltener unterstützt als von den 40-bis 54-Jährigen,<br />
auch Nachbarn <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e. Und die 70- bis 85-Jährigen unterstützen ihre K<strong>in</strong>der seltener <strong>in</strong>strumentell<br />
als z.B. die 40- bis 54-Jährigen ihre Eltern. Dies weist aber nicht zwangsläufig auf e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>seitigkeit der familialen <strong>in</strong>tergenerationellen Hilfebeziehungen h<strong>in</strong>. Den <strong>in</strong>strumentellen Hilfen<br />
stehen private materielle Transfers zwischen den Generationen gegenüber, die überwiegend <strong>in</strong><br />
entgegengesetzter Richtung fließen. Und zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> diesem Punkt lässt sich ke<strong>in</strong>e dramatische<br />
Altersabnahme feststellen (vgl. Abbildung 6.6): knapp e<strong>in</strong> Drittel der 40- bis 85-Jährigen unterstützt<br />
andere Personen f<strong>in</strong>anziell, <strong>und</strong> zwar ganz überwiegend K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> Enkel. Transferströme <strong>in</strong><br />
umgekehrter Richtung s<strong>in</strong>d kaum zu sehen (vgl. Tabelle A6.2).<br />
Abbildung 6.6:<br />
Geleistete private Transfers<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
40-44<br />
45-49<br />
50-54<br />
55-59<br />
60-64<br />
65-69<br />
70-74<br />
75-79<br />
80-85<br />
Altersgruppen<br />
Männer (West)<br />
Männer (Ost)<br />
Frauen (West)<br />
Frauen (Ost)<br />
Der Anteil der Unterstützenden ist mit 37 Prozent <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe am höchsten;<br />
höchstwahrsche<strong>in</strong>lich spielen dabei sowohl die verfügbaren Ressourcen als auch die spezifischen<br />
Bedarfslagen der jeweiligen K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> Enkel e<strong>in</strong>e größere Rolle. In dieser Altersgruppe werden<br />
die K<strong>in</strong>der mit 71 Prozent am Häufigsten genannt, die Enkelk<strong>in</strong>der von 24 Prozent. Bei den 70- bis<br />
85-Jährigen liegt der Anteil der K<strong>in</strong>der nur noch bei 59 Prozent, dafür steigt der Anteil derjenigen,<br />
die monetäre Transfers (auch) an die Enkelk<strong>in</strong>der leisten (48 Prozent). Insgesamt gesehen ist dies<br />
e<strong>in</strong>er der wenigen Bereiche, <strong>in</strong> denen sich ke<strong>in</strong>e signifikante Abnahme <strong>in</strong> den höheren Altergruppen<br />
zeigt. Dies ist lediglich bei den älteren Frauen der Fall, was wiederum auf die verfügbaren<br />
Ressourcen verweisen dürfte. Solche Transfers können aber gerade für die Ältesten <strong>und</strong> Hilfsbe-<br />
279
280<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
dürftigen von zentraler Bedeutung se<strong>in</strong>, da sie nicht e<strong>in</strong>fach nur passive Empfänger von Hilfen<br />
bleiben müssen, sonder etwas „zurückgeben“ (<strong>und</strong> vielfach deshalb auch erst annehmen) können.<br />
6.7 Partizipation an Bildungsangeboten<br />
Die Frage nach der Partizipation an Bildung ist nicht nur für die späten Phasen des Erwerbslebens<br />
kritisch, wenn es um die Frage der Verlängerung der Lebensarbeitszeit <strong>und</strong> die Beschäftigungschancen<br />
älterer Arbeitnehmer geht. Sie hat auch <strong>in</strong> mehrerlei H<strong>in</strong>sicht e<strong>in</strong>e herausragende Bedeutung<br />
<strong>in</strong> der nachberuflichen Lebensphase. Beispielsweise hat die Technisierung der Umwelt – <strong>in</strong>sbesondere<br />
auch im Haushalt – die Handlungsspielräume auch im höheren Alter erweitert <strong>und</strong> die<br />
Alltagsarbeit erheblich erleichtert. Wird der Umgang mit moderner Technik jedoch nicht erlernt<br />
bzw. geübt, bleibt es <strong>in</strong> vielen Bereichen der alltäglichen Lebensführung nicht nur bei e<strong>in</strong>em relativen<br />
Verlust an Lebensqualität im Vergleich zu jenen, die den Umgang mit dieser Technik beherrschen,<br />
sondern diese Technik kann dann sogar zu e<strong>in</strong>em H<strong>in</strong>dernis werden <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>em Verlust<br />
an Lebensqualität führen, etwa wenn der Bankautomat nicht bedient werden kann (vgl. z.B. Mollenkopf<br />
& Kaspar 2004). Handlungsspielräume werden e<strong>in</strong>geschränkt <strong>und</strong> die Lebensführung <strong>in</strong>sgesamt<br />
erschwert. E<strong>in</strong>e Teilnahme an Bildungsangeboten kann demgegenüber Produktivität freisetzen<br />
<strong>und</strong> zu selbstorganisierter produktiver Tätigkeit anregen (Schäffter 1989, S. 22). Dafür<br />
spricht der wiederholt belegte Zusammenhang zwischen Bildung <strong>und</strong> anderen produktiven Tätigkeiten,<br />
z.B. dem Ehrenamt: Bildung ist e<strong>in</strong>er der stärksten Prädiktoren für e<strong>in</strong> solches Engagement<br />
(Künem<strong>und</strong>, 2000).<br />
Für die Individuen kann die Partizipation an Bildung im Alter zudem Selbstsicherheit <strong>und</strong> Unabhängigkeit<br />
steigern, sie kann praktische <strong>und</strong> psychologische Probleme besser lösen helfen, neue<br />
Aufgabenfelder erschließen, Selbsterfahrung <strong>und</strong> Selbst<strong>in</strong>terpretation stärken <strong>und</strong> auch zur Strukturierung<br />
von Zeit, zur E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> soziale Interaktion oder zur Erfahrung gesellschaftlicher Veränderungen<br />
beitragen. Auch können alterstypische Reduktionen der Leistungsfähigkeit im H<strong>in</strong>blick<br />
auf Gedächtnis <strong>und</strong> psychomotorische Funktionen abgemildert werden (vgl. Baltes, 1987;<br />
Kruse & Rud<strong>in</strong>ger, 1997). Bildung im Alter kann also die allgeme<strong>in</strong>e Lebensqualität <strong>und</strong> Unabhängigkeit<br />
steigern <strong>und</strong> daher als sozialpolitische Prävention betrachtet werden (Naegele, 1991).<br />
Daneben können z.B. bereits ehrenamtlich Tätige ihre Kompetenzen durch gezielte Weiterbildung<br />
erweitern. Auch im Alter ist Bildung somit nicht nur „Konsum”, sondern bleibt Investition: sie<br />
erhält <strong>und</strong> erweitert das Humanpotential im weitesten S<strong>in</strong>ne. Sie dient nicht e<strong>in</strong>fach <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
„Freizeit“-Interessen, sondern kann konkrete psychologische, soziale <strong>und</strong> ökonomische Effekte<br />
positiver Art haben (vgl. Sommer et al., 2004).<br />
Entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit, die der Bildung im Alter zuteil wird. Dennoch ist dies<br />
e<strong>in</strong> Bereich, <strong>in</strong> dem die Partizipation im höheren Alter eher ger<strong>in</strong>g ausfällt – von den 70- bis 85-<br />
Jährigen besuchen nur 13 Prozent wenigstens e<strong>in</strong>mal im Jahr e<strong>in</strong>en Kurs oder Vortrag – <strong>und</strong> im<br />
Altersgruppenvergleich extrem stark zurückgeht (vgl. Abbildung 6.7).
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
Abbildung 6.7:<br />
Besuch von Kursen <strong>und</strong> Vorträgen<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
40-44<br />
45-49<br />
50-54<br />
55-59<br />
60-64<br />
65-69<br />
70-74<br />
75-79<br />
80-85<br />
Altersgruppen<br />
Männer (West)<br />
Männer (Ost)<br />
Frauen (West)<br />
Frauen (Ost)<br />
Von den 40- bis 54-Jährigen haben mehr als die Hälfte m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e solche Bildungsveranstaltung<br />
besucht (vgl. Tabelle A6.3). Zwischen Männern <strong>und</strong> Frauen zeigen sich dabei ke<strong>in</strong>e nennenswerten<br />
Unterschiede, im Osten Deutschlands fällt die Beteiligung <strong>in</strong> diesem Bereich <strong>in</strong> allen hier<br />
betrachteten Altersgruppen etwas ger<strong>in</strong>ger aus. Altersbildung erreicht also offenbar ke<strong>in</strong>e breite<br />
Schicht der Älteren, sondern nur e<strong>in</strong>en relativ kle<strong>in</strong>en <strong>und</strong> h<strong>in</strong>sichtlich der sozialen Schichtung<br />
höchstwahrsche<strong>in</strong>lich sehr selektiven Teil der Altenpopulation (vgl. ausführlich hierzu Sommer et<br />
al., 2004).<br />
6.8 Weitere Tätigkeiten<br />
Die weiteren Tätigkeitsfelder <strong>und</strong> -bereiche, die mit dem Alterssurvey erhoben wurden, sollen<br />
abschließend überblicksartig zusammengefasst werden, wobei der Schwerpunkt der Darstellung<br />
auf die Unterschiede zwischen den Altersgruppen gelegt wird.<br />
Was zunächst die Hand-, Bastel- <strong>und</strong> Heimwerkerarbeiten betrifft, ist e<strong>in</strong> nur leichter Rückgang<br />
der Anteile über die Altersgruppen zu beobachten – r<strong>und</strong> drei Viertel der 40- bis 69-Jährigen <strong>und</strong><br />
zwei Drittel der 70- bis 85-Jährigen geben e<strong>in</strong>e solche Tätigkeit an. Die Abnahme im Altersgruppenvergleich<br />
ist dabei alle<strong>in</strong> bei den eher selteneren Engagements feststellbar, „tägliche“ Hand-,<br />
Bastel- <strong>und</strong> Heimwerkerarbeiten s<strong>in</strong>d davon nicht betroffen. Das etwas ger<strong>in</strong>gere Ausmaß der Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich <strong>in</strong> der höchsten Altersgruppe verweist wahrsche<strong>in</strong>lich auf das Zunehmen<br />
ges<strong>und</strong>heitlicher Bee<strong>in</strong>trächtigungen, welche zu e<strong>in</strong>er gewissen Polarisierung <strong>in</strong> Aktivität<br />
<strong>und</strong> Inaktivität bezüglich physisch anforderungsreicher Tätigkeiten führt. In diese Richtung weist<br />
auch die ähnlich gelagerte Verteilung bei Gartenarbeit. Sie ist <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe am<br />
weitesten verbreitet, im höheren Alter kommt es <strong>in</strong> diesem Bereich zu e<strong>in</strong>er stärkeren Polarisierung<br />
281
282<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
<strong>in</strong> täglich bzw. mehrmals wöchentlich Aktive <strong>und</strong> gänzlich Inaktive. Der Anteil derjenigen, die <strong>in</strong><br />
den letzten zwölf Monaten ke<strong>in</strong>e Gartenarbeit verrichtet haben, liegt <strong>in</strong> der höchsten Altersgruppe<br />
mit 39 Prozent sehr deutlich über jenem der unteren <strong>und</strong> mittleren Altersgruppen (26 respektive 23<br />
Prozent); diese Differenz ist damit jener bei den Hand-, Bastel- <strong>und</strong> Heimwerkerarbeiten sehr ähnlich.<br />
Insgesamt handelt es sich bei Hand-, Bastel- <strong>und</strong> Heimwerkerarbeiten sowie Gartenarbeit <strong>in</strong><br />
den Sommermonaten aber für e<strong>in</strong>en erheblichen Teil der Älteren – Männer wie Frauen <strong>in</strong> Ost <strong>und</strong><br />
West – um e<strong>in</strong> relativ häufiges <strong>und</strong> bedeutsames Tätigkeitsfeld.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der sportlichen Aktivität ist der Zusammenhang mit dem Alter erwartungsgemäß deutlich<br />
stärker. Immerh<strong>in</strong> r<strong>und</strong> 40 Prozent der 70- bis 85-Jährigen geben aber an, sich <strong>in</strong> den letzten<br />
zwölf Monaten sportlich betätigt zu haben. Auch hier bleibt der Anteil derer, die sich täglich engagieren,<br />
über die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg betrachtet eher konstant. R<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Viertel der 70- bis 85jährigen<br />
Männer besucht zudem m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal im Jahr e<strong>in</strong>e Sportveranstaltung, von den Frauen<br />
etwa jede Zehnte. Bei den 40- bis 54-Jährigen liegen diese Anteile bei 57 <strong>und</strong> 33 Prozent, <strong>in</strong> der<br />
mittleren Altersgruppe bei 43 <strong>und</strong> 24 Prozent; d.h. der im Altersgruppenvergleich feststellbare<br />
Rückgang verläuft bei beiden Geschlechtern etwa parallel. Das Spazierengehen zählt zu den wenigen<br />
Tätigkeiten, die von den Älteren genauso häufig angegeben werden wie von den Jüngeren: 88<br />
Prozent der 70- bis 85-Jährigen, 92 Prozent der 55- bis 69-Jährigen <strong>und</strong> 91 Prozent der 40- bis 54-<br />
Jährigen gehen überhaupt je spazieren. Die Häufigkeit nimmt sogar deutlich zu.<br />
E<strong>in</strong> ganz ähnliches Bild ergibt sich h<strong>in</strong>sichtlich der Beschäftigung mit Kreuzworträtseln oder<br />
Denksportaufgaben – hier gibt es ke<strong>in</strong>e Abnahme <strong>in</strong> den höheren Altersgruppen, wohl aber e<strong>in</strong>e<br />
deutlich häufigere Nennung von „täglich“. Abgesehen vom Fernsehen s<strong>in</strong>d dies die e<strong>in</strong>zigen Tätigkeiten,<br />
die von den Älteren <strong>in</strong>tensiver ausgeübt werden als von den Jüngeren. Auch bei der<br />
künstlerischen Betätigung s<strong>in</strong>d die Unterschiede zwischen den Altersgruppen eher ger<strong>in</strong>g. Dagegen<br />
werden Konzert , Theater- oder Museumsbesuche <strong>in</strong> den höheren Altersgruppen zunehmend seltener,<br />
was im Vergleich zur eigenen künstlerischen Betätigung eher auf ges<strong>und</strong>heitliche <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzielle<br />
Ressourcen denn als auf e<strong>in</strong>en Rückgang des Interesses im Prozess des Alterns h<strong>in</strong>weisen<br />
dürfte. E<strong>in</strong> Teil dieser Altersunterschiede könnte aber auch im S<strong>in</strong>ne von Kohorteneffekten <strong>in</strong>terpretiert<br />
werden – anders gelagerte Interessen der verschiedenen Geburtsjahrgänge aufgr<strong>und</strong> ja spezifischer<br />
Sozialisationserfahrungen, Ressourcen <strong>und</strong> Lebensstile.<br />
E<strong>in</strong> Besuch von oder bei Fre<strong>und</strong>en oder Bekannten wird <strong>in</strong> allen drei Altersgruppen am Häufigsten<br />
„e<strong>in</strong>- bis dreimal im Monat“ angegeben. Der Anteil derjenigen, die <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
ke<strong>in</strong>e solchen Besuche bekamen oder selbst unternahmen, steigt über die Altersgruppe h<strong>in</strong>weg<br />
betrachtet von zwei auf elf Prozent an, <strong>und</strong> auch „seltene“ Besuche werden von den Ältesten häufiger<br />
genannt als von den Jüngeren. Karten- <strong>und</strong> Gesellschaftsspiele werden ebenfalls im höheren<br />
Alter seltener angegeben – der Anteil derer, die dies nie tun, steigt von 29 auf 53 Prozent. Die soziale<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung nimmt <strong>in</strong>sofern offenbar stetig ab. Es gibt hier aber dennoch zugleich e<strong>in</strong>e gewisse<br />
Zunahme <strong>in</strong> der Kategorie „täglich“.<br />
Auch politische Veranstaltungen werden von den Älteren zunehmend weniger besucht. Insbesondere<br />
bei den 70- bis 85-jährigen Frauen kommt dies praktisch gar nicht vor (knapp 94 Prozent beantworteten<br />
diese Frage mit „nie“), während von den 70- bis 85-jährigen Männern im Westen immerh<strong>in</strong><br />
noch jeder Vierte, im Osten knapp jeder Fünfte m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e solche Veranstaltung <strong>in</strong><br />
den letzten zwölf Monaten vor der Befragung besucht hat. In den jüngeren hier betrachteten Al-
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
tersgruppen liegen diese Anteile jeweils r<strong>und</strong> zehn Prozent höher, wobei dieser Rückgang bei den<br />
Frauen deutlich stärker ausfällt als bei den Männern. Entsprechend ist der Unterschied zwischen<br />
Männern <strong>und</strong> Frauen bei den 40- bis 54-Jährigen weniger groß als im Alter. Dass es sich hier um<br />
e<strong>in</strong>en Kohorteneffekt handelt, so dass der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei den zukünftigen<br />
Älteren ger<strong>in</strong>ger se<strong>in</strong> wird als bei den heutigen Älteren, sche<strong>in</strong>t recht wahrsche<strong>in</strong>lich.<br />
Fast 40 Prozent der 40- bis 85-Jährigen nutzen privat e<strong>in</strong>en Computer. E<strong>in</strong>en steileren Abfall der<br />
Anteile über die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg – <strong>und</strong> somit e<strong>in</strong>e stärkere Ungleichheit zwischen ihnen –<br />
kann man allerd<strong>in</strong>gs lediglich bei der Erwerbstätigkeit feststellen: 63 Prozent der 40- bis 54-<br />
Jährigen, aber nur acht Prozent der 70- bis 85-Jährigen verwendete <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten m<strong>in</strong>destens<br />
e<strong>in</strong>mal privat e<strong>in</strong>en Computer. Diese Tendenz ist noch ausgeprägter, wenn man auch die<br />
berufliche Nutzung von Computern e<strong>in</strong>bezieht. Der sog. „digital divide“ konturiert sich sehr deutlich<br />
entlang der Altersachse, wesentlich stärker als etwa zwischen den Geschlechtern. Dies ist –<br />
wie bereits <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>leitung angesprochen – <strong>in</strong>sofern bedenklich, als dass gerade die Älteren mit<br />
der Technisierung <strong>und</strong> Computerisierung des Alltags Probleme haben können, obwohl gerade sie<br />
erheblich von den neuen Technologien profitieren könnten.<br />
Was schließlich die Hausarbeit betrifft, zeigt sich e<strong>in</strong>e höhere Beteiligung der Männer mit zunehmendem<br />
Alter – was das „tägliche“ Engagement betrifft – ebenso wie e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere – nämlich mit<br />
Blick auf jenen Anteil der Männer, die nie Hausarbeit machen. Während für Letzteres wahrsche<strong>in</strong>lich<br />
traditionelle, kohortenspezifische Rollenerwartungen verantwortlich s<strong>in</strong>d, deutet ersteres auf<br />
e<strong>in</strong>en Ruhestandseffekt. Allerd<strong>in</strong>gs bleibt offen, welcher Art die Beteiligung an der Hausarbeit ist<br />
<strong>und</strong> ob die (Ehe-)Frauen dadurch entlastet werden. Sie s<strong>in</strong>d jedenfalls <strong>in</strong> allen Altersgruppen zu<br />
über 80 Prozent täglich mit Arbeiten im Haushalt befasst. Das Lesen von Tageszeitungen wird von<br />
der mittleren der hier betrachteten Altersgruppe am Häufigsten angegeben: Hier lesen drei Viertel<br />
täglich e<strong>in</strong>e Tageszeitung. Überraschend hoch – jedenfalls im Vergleich zu den Männern – s<strong>in</strong>d die<br />
Anteile der 70- bis 85-jährigen Frauen, die „nie“ e<strong>in</strong>e Tageszeitung lesen: In Ost <strong>und</strong> West jeweils<br />
jede siebente Frau. Beim Fernsehen gibt es e<strong>in</strong>e solche Auffälligkeit nicht. Dies ist zugleich auch<br />
jene Tätigkeit, die als E<strong>in</strong>zige e<strong>in</strong>en deutlichen Zuwachs sowohl h<strong>in</strong>sichtlich der Partizipationsquote<br />
als auch der zeitlichen Intensität im Vergleich der Altersgruppen offenbart.<br />
6.9 Schlussfolgerungen<br />
Für die meisten dieser Tätigkeiten gilt also, dass sie – wenn auch <strong>in</strong> ganz unterschiedlichem Ausmaß<br />
– mit zunehmendem Alter seltener ausgeübt werden. Ausnahmen mit e<strong>in</strong>er deutlichen Zunahme<br />
oder Intensivierung s<strong>in</strong>d das Fernsehen <strong>und</strong> die Beschäftigung mit Kreuzworträtseln oder<br />
Denksportaufgaben. Eher stabil bleiben im Altersgruppenvergleich Spazierengehen sowie f<strong>in</strong>anzielle<br />
Transfers, ansonsten zeigt sich fast überall e<strong>in</strong> mehr oder weniger deutlicher Rückgang der<br />
Partizipationsquoten. Es entsteht nicht der E<strong>in</strong>druck, als würden neue Lebensstile <strong>und</strong> Partizipationsformen<br />
an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen. Eher sche<strong>in</strong>t es, als würde im Ruhestand eher wenig „Neues“<br />
entdeckt, <strong>und</strong> das Freizeitverhalten folge dem Muster e<strong>in</strong>er zeitlichen Dehnung <strong>und</strong> Streckung<br />
solcher Tätigkeiten, die schon zuvor ausgeübt wurden. Dennoch s<strong>in</strong>d auch die 70- bis 85-Jährigen<br />
ke<strong>in</strong>esfalls nur „passive“ Empfänger von familialen oder sozialstaatlichen Hilfen <strong>und</strong> Transfers,<br />
sondern sie tragen selbst <strong>in</strong> beträchtlichem Maße produktiv etwas zur Gesellschaft bei – es handelt<br />
283
284<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
sich zum Teil um Tätigkeiten, mit denen sie erhebliche wirtschaftliche Leistungen erbr<strong>in</strong>gen (vgl.<br />
Künem<strong>und</strong>, 1999).<br />
E<strong>in</strong>schränkend muss konstatiert werden, dass diejenigen, die sich <strong>in</strong> m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em dieser Bereiche<br />
engagieren, <strong>in</strong> der M<strong>in</strong>derheit s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> ihr Anteil über die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg stark abnimmt.<br />
In Zukunft dürfte sich im Zuge der Verbesserung der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ressourcen dieser Personenkreis<br />
erweitern: Jede jüngere Ruhestandskohorte weist e<strong>in</strong> höheres Ausbildungsniveau, e<strong>in</strong>e<br />
bessere Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> – zum<strong>in</strong>dest bislang – e<strong>in</strong>e bessere materielle Absicherung auf, verfügt<br />
also über mehr Ressourcen für Aktivität als jede ältere Kohorte. Da Ges<strong>und</strong>heit, materielle Absicherung<br />
<strong>und</strong> vor allem Bildungsniveau starke Prädiktoren der Partizipation der Älteren im Bereich<br />
z.B. des ehrenamtlichen Engagements oder der Bildung s<strong>in</strong>d, kann mit e<strong>in</strong>er stärkeren Beteiligung<br />
<strong>in</strong> diesen Bereichen gerechnet werden. Zugleich dürfte sich der Anspruch auf s<strong>in</strong>nvolle Aktivität<br />
als Folge der gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse erhöhen.<br />
Auf der anderen Seite werden die Voraussetzungen für die gesellschaftliche Partizipation <strong>und</strong> das<br />
Engagement der Älteren aber <strong>in</strong> mancher H<strong>in</strong>sicht auch schlechter. Vor allem die im Zusammenhang<br />
mit dem Altern der Bevölkerung anstehenden f<strong>in</strong>anziellen Belastungen des Sozialstaats führen<br />
zu Überlegungen, die primär auf die Kürzung von Sozialleistungen abzielen. Rentenkürzungen<br />
könnten sich hier negativ bemerkbar machen, <strong>und</strong> zwar <strong>in</strong>sbesondere bei den schlechter gestellten<br />
Älteren. Ohneh<strong>in</strong> schient e<strong>in</strong>e Zunahme der sozialen Ungleichheiten im Alter wahrsche<strong>in</strong>lich, <strong>in</strong>sbesondere<br />
bei den geburtenstarken 60er Jahrgängen. Wie sich bereits bei der ger<strong>in</strong>gen Inanspruchnahme<br />
der Riester-Rente abzeichnet, könnten die später ger<strong>in</strong>geren gesetzlichen Renten ohne zusätzlich<br />
private Absicherung zu e<strong>in</strong>er neuerlichen Altersarmut führen, <strong>und</strong> zwar bevorzugt <strong>in</strong> bestimmten<br />
sozialen Schichten mit heute eher ger<strong>in</strong>gen E<strong>in</strong>kommen (Bertelsmann-Stiftung 2003;<br />
Schwarze et al., 2004). Oder zum<strong>in</strong>dest zu e<strong>in</strong>er stärkeren Zunahme bei der bedarfsorientierten<br />
Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter. Zugleich lässt die Verteilung von Vermögen (<strong>und</strong> Erbschaften) wie auch<br />
die gegenwärtige Inanspruchnahme privater Vorsorge <strong>und</strong> der Riester-Rente erwarten, dass die<br />
Erträge aus privater Altersvorsorge vor allem Haushalten mit höherem <strong>und</strong> hohem E<strong>in</strong>kommen<br />
zufließen (Schmähl & Fach<strong>in</strong>ger, 1999; Bäcker, 2002). Dass sich dies <strong>in</strong> der Summe positiv auf<br />
Partizipation <strong>und</strong> Engagement auswirkt, sche<strong>in</strong>t eher unwahrsche<strong>in</strong>lich.
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
6.10 Literatur<br />
Attias-Donfut, Claud<strong>in</strong>e (1988): Die neuen Freizeitgenerationen. In:Leopold Rosenmayr & Franz<br />
Kolland (Hrsg.): Arbeit - Freizeit -Lebenszeit. Gr<strong>und</strong>lagenforschungen zu Übergängen im<br />
Lebenszyklus. Opladen: Westdeutscher Verlag, 57-73.<br />
Bäcker, G. (2002). Alterssicherung <strong>und</strong> Generationengerechtigkeit nach der Rentenreform. In:<br />
Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35, 282-291.<br />
Baltes, M. M. (1987). Erfolgreiches Altern als Ausdruck von Verhaltenskompetenz <strong>und</strong> Umweltqualität.<br />
In: Niemitz, C. (Ed.): Erbe <strong>und</strong> Umwelt. Zur Natur von Anlage <strong>und</strong> Selbstbestimmung<br />
des Menschen. Frankfurt: Suhrkamp, 353-376.<br />
Baltes, M. M. (1996). Produktives Leben im Alter: Die vielen Gesichter des Alterns – Resumee<br />
<strong>und</strong> Perspektiven für die Zukunft. In: Baltes, M. M. & L. Montada (Ed.): Produktives Leben<br />
im Alter. Frankfurt: Campus, 393-408.<br />
Bertelsmann Stiftung (2003). Die Riester-Rente: Wer hat sie, wer will sie? Vorabauswertung e<strong>in</strong>er<br />
repräsentativen Umfrage zum Vorsorgeverhalten der 30- bis 50-Jährigen, erstellt von Johannes<br />
Le<strong>in</strong>ert, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh (Bertelsmann Stiftung Vorsorgestudien<br />
14). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.<br />
Braun, J. & F. Claussen, unter Mitarbeit von S. Bischoff, L. Sommer & F. Thomas (1997). Freiwilliges<br />
Engagement im Alter. Nutzer <strong>und</strong> Leistungen von Seniorenbüros. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Bull<strong>in</strong>ger, H.-J. (Ed.) (2001). Zukunft der Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft. Stuttgart: IRB-<br />
Verlag.<br />
Frerichs, F. (1998). Älterwerden im Betrieb. Beschäftigungschancen <strong>und</strong> -risiken im demographischen<br />
<strong>Wandel</strong>. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Glatzer, W. (1986). Haushaltsproduktion, wirtschaftliche Stagnation <strong>und</strong> sozialer <strong>Wandel</strong>. In:<br />
Glatzer, W. & R. Becker-Schmitt (Ed.): Haushaltsproduktion <strong>und</strong> Netzwerkhilfe. Die alltäglichen<br />
Leistungen der Haushalte <strong>und</strong> Familien. Frankfurt: Campus, 9-50.<br />
Herfurth, M., M. Kohli & K. F. Zimmermann (Ed.) (2003). Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft.<br />
Problembereiche <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>stendenzen der Erwerbssituation Älterer. Opladen:<br />
Leske + Budrich.<br />
Klages, H. (1998). Engagement <strong>und</strong> Engagementpotential <strong>in</strong> Deutschland. Ergebnisse der empirischen<br />
Forschung. In: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte, B38/98, 29-38.<br />
Klöckner, B. W. (2003). Die gierige Generation. Wie die Alten auf Kosten der Jungen abkassieren.<br />
Frankfurt: Eichborn.<br />
Kohli, M. (1985). Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie<br />
<strong>und</strong> Sozialpsychologie, 37, 1-29.<br />
Kohli, M. (1998). Alter <strong>und</strong> Altern der Gesellschaft. In: Schäfers, B. & W. Zapf (Eds): Handwörterbuch<br />
zur Gesellschaft Deutschlands.(pp. 1-11) Opladen: Leske + Budrich,.<br />
285
286<br />
Harald Künem<strong>und</strong><br />
Kohli, M. & H. Künem<strong>und</strong> (1996). Nachberufliche Tätigkeitsfelder – Konzepte, Forschungslage,<br />
Empirie. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Kohli, M., H. Künem<strong>und</strong>, A. Motel & M. Szydlik (2000). Generationenbeziehungen. In: Kohli, M.<br />
& H. Künem<strong>und</strong> (Eds): Die zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation<br />
im Spiegel des Alters-Survey (pp. 176-211) Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kruse, A. & G. Rud<strong>in</strong>ger (1997). Lernen <strong>und</strong> Leistung im Erwachsenenalter. In: We<strong>in</strong>ert, F. E. &<br />
H. Mandl (Eds): Psychologie der Erwachsenbildung. (pp. 45-85) Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (1999). Entpflichtung <strong>und</strong> Produktivität des Alters. WSI-Mitteilungen, 52, 26-31.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2000). „Produktive“ Tätigkeiten. In: Kohli, M. & H. Künem<strong>und</strong> (Eds): Die zweite<br />
Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-Survey.<br />
Opladen: Leske + Budrich, 277-317.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2001). Gesellschaftliche Partizipation <strong>und</strong> Engagement <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte.<br />
Empirische Bef<strong>und</strong>e zu Tätigkeitsformen im Alter <strong>und</strong> Prognosen ihrer zukünftigen<br />
<strong>Entwicklung</strong>. Berl<strong>in</strong>: Weißensee-Verlag.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. & B. Hollste<strong>in</strong> (2000). Soziale Beziehungen <strong>und</strong> Unterstützungsnetzwerke. In:<br />
Kohli, Mart<strong>in</strong> & H. Künem<strong>und</strong> (Eds): Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong><br />
Partizipation im Spiegel des Alters-Survey. Opladen: Leske + Budrich, 212-276.<br />
Mollenkopf, H. & R. Kaspar (2004): Technisierte Umwelten als Handlungs- <strong>und</strong> Erlebensräume<br />
älterer Menschen. Ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong>: Backes, G. M., W. Clemens & H. Künem<strong>und</strong> (Eds): Lebensformen<br />
<strong>und</strong> Lebensführung im Alter. Wiesbaden: WS-Verlag für Sozialwissenschaften<br />
(im Druck).<br />
Müller, S. & T. Rauschenbach (Ed.) (1988). Das soziale Ehrenamt. Nützliche Arbeit zum Nulltarif.<br />
We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Naegele, G. (1984). Ältere Arbeitnehmer <strong>in</strong> der Spätphase ihrer Erwerbstätigkeit. Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung.<br />
Naegele, G. (1991). Zum Stand der gerontologischen Forschung <strong>und</strong> Altenpolitik <strong>in</strong> NRW <strong>und</strong> zu<br />
e<strong>in</strong>igen Implikationen für e<strong>in</strong>e auf Älterwerden <strong>und</strong> Alter bezogene Bildungsarbeit. In:<br />
Landes<strong>in</strong>stitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung (Ed.): S<strong>in</strong>nerfülltes Leben im Alter. Beiträge<br />
der Erwachsenenbildung. Soest: Soester Verlagskontor, 36-63.<br />
Olk, T. (1987). Das soziale Ehrenamt. Sozialwissenschaftliche Literaturr<strong>und</strong>schau 10, 84-101.<br />
Opaschowski, H. W & U. Neubauer (1984). Freizeit im Ruhestand. Erwartungen <strong>und</strong> Wirklichkeit<br />
von Pensionären. Hamburg: BAT Freizeit-Forschungs<strong>in</strong>stitut.<br />
O´Reilly, P. & F. G. Caro (1994). Productive ag<strong>in</strong>g: An overview of the literature. Journal of Ag<strong>in</strong>g<br />
and Social Policy 3, 6, 39-71.<br />
Riley, M. W., R. L. Kahn & A. Foner (Eds) (1994). Age and structural lag. Society´s failure to<br />
provide mean<strong>in</strong>gful opportunities <strong>in</strong> work, family, and leisure. New York: Wiley.
Kapitel 6: Tätigkeiten <strong>und</strong> Engagement im Ruhestand<br />
Schäffter, O. (1989): Produktivität des Alters – Perspektiven <strong>und</strong> Leitfragen. In: Knopf, D., O.<br />
Schäffter & R. Schmidt (Eds): Produktivität des Alters. Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen,<br />
20-25.<br />
Schmähl, W. & U. Fach<strong>in</strong>ger (1999). Armut <strong>und</strong> Reichtum: E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Konsumverhalten<br />
älterer Menschen. In: Niederfranke, A., G. Naegele & E. Frahm (Eds): Funkkolleg Altern<br />
2. Lebenslagen <strong>und</strong> Lebenswelten, soziale Sicherung <strong>und</strong> Altenpolitik. Opladen: Westdeutscher<br />
Verlag, 159-208.<br />
Schmitz-Scherzer, R., G. M. Backes, I. Friedrich, F. Karl & A. Kruse (1994). Ressourcen älterer<br />
<strong>und</strong> alter Menschen. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Schneekloth, U. & I. Leven (2003). Hilfe- <strong>und</strong> Pflegebedürftige <strong>in</strong> Privathaushalten <strong>in</strong> Deutschland<br />
2002. Schnellbericht. München: Infratest.<br />
Schreiber, H. (1996). Das gute Ende. Wider die Abschaffung des Todes. Re<strong>in</strong>bek: Rowohlt.<br />
Schupp, J. & H. Künem<strong>und</strong> (2004). Private Versorgung <strong>und</strong> Betreuung von Pflegebedürftigen <strong>in</strong><br />
Deutschland. DIW Wochenbericht, 71, 289-294.<br />
Schwarze, J., G. G. Wagner & C. W<strong>und</strong>er (2004). Alterssicherung: Gesunkene Zufriedenheit <strong>und</strong><br />
Skepsis gegenüber privater Vorsorge. DIW Wochenbericht, 71, 315-322.<br />
Sommer, C., H. Künem<strong>und</strong> & M. Kohli (2004). Zwischen Selbstorganisation <strong>und</strong> Seniorenakademie.<br />
Die Vielfalt der Altersbildung <strong>in</strong> Deutschland. Berl<strong>in</strong>: Weißensee Verlag.<br />
Tews, H. P. (1989). Die „neuen“ Alten – Ergebnis des Strukturwandels des Alters. In: Karl, F. &<br />
W. Tokarski (Eds): Die „neuen“ Alten. Beiträge der XVII. Jahrestagung der deutschen<br />
Gesellschaft für Gerontologie. Kassel: Gesamthochschulbibliothek, 126-143.<br />
Tews, Hans Peter (1996). Produktivität des Alters. In Margret Baltes & Leo Montada (Eds.), Produktives<br />
Leben im Alter. Frankfurt/M.: Campus, 184-210.<br />
Tokarski, W. (1985). „Freigesetzte“ Arbeitnehmer im 6. Lebensjahrzehnt <strong>in</strong> der Freizeit: „Abgeschobene“<br />
oder e<strong>in</strong>e neue „Muße-Klasse“? In: Dieck, M., G. Naegele & R. Schmidt (Eds):<br />
„Freigesetzte“ Arbeitnehmer im 6. Lebensjahrzehnt – e<strong>in</strong>e neue Ruhestandsgeneration?<br />
Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen, 365-373.<br />
Tokarski, W. (1989). Freizeit- <strong>und</strong> Lebensstile älterer Menschen. Kassel: Gesamthochschulbibliothek.<br />
Tokarski, W. (1998). Alterswandel <strong>und</strong> veränderte Lebensstile. In: Clemens, W. & G. M. Backes<br />
(Eds): Altern <strong>und</strong> Gesellschaft. Gesellschaftliche Modernisierung durch Strukturwandel.<br />
Opladen: Leske + Budrich, 109-119.<br />
Tremmel, J. (1996). Der Generationsbetrug. Plädoyer für das Recht der Jugend auf Zukunft.<br />
Frankfurt: Eichborn.<br />
Uhlenberg, P. (1980). Death and the family. Journal of Family History, 5, 313-320.<br />
Uhlenberg, P. (1996): Mortality decl<strong>in</strong>e <strong>in</strong> the twentieth century and supply of k<strong>in</strong> over the life<br />
course. The Gerontologist, 36, 681-685<br />
287
Tabelle A6.1: „Produktive“ Tätigkeiten<br />
288<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre 40-85 Jahre<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Erwerbstätigkeiten parallel zu e<strong>in</strong>em Altersrentenbezug (mündl. Interview, Frage 102; Basis: Altersrente aus eigener Erwerbstätigkeit lt. Frage 100)<br />
Gesamt – – – 8,4 % 7,9 % 8,2 % 6,0 % 3,7 % 4,7 % 7,2 % 5,5 % 6,3 %<br />
Alte Länder – – – 8,7 % 8,4 % 8,6 % 6,5 % 4,0 % 5,1 % 7,6 % 5,9 % 6,7 %<br />
Neue Länder – – – 7,3 % 6,5 % 6,9 % 3,8 % 2,6 % 3,1 % 5,7 % 4,4 % 4,9 %<br />
Ehrenamtliche Tätigkeiten <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Verbänden (mündl. Interview, Fragen 408 <strong>und</strong> 414)<br />
Ja 18,4 % 12,8 % 15,6 % 19,1 % 13,3 % 16,1 % 12,2 % 3,2 % 6,6 % 17,5 % 10,5 % 13,8 %<br />
Alte Länder 20,1 % 14,5 % 17,3 % 20,1 % 14,5 % 17,3 % 12,8 % 3,5 % 7,1 % 18,7 % 11,6 % 15,0 %<br />
Neue Länder 12,1 % 6,0 % 9,1 % 15,1 % 8,8 % 11,8 % 9,5 % 1,9 % 4,5 % 12,8 % 6,0 % 9,2 %<br />
Ehrenämter <strong>in</strong>sgesamt (mündl. Interview; Fragen 408, 414 <strong>und</strong> 416)<br />
Ja 22,0 % 23,2 % 22,6 % 23,4 % 17,9 % 20,6 % 15,1 % 5,3 % 9,0 % 21,3 % 16,8 % 18,9 %<br />
Alte Länder 23,8 % 25,5 % 24,6 % 25,0 % 19,2 % 22,1 % 15,4 % 6,1 % 9,7 % 22,7 % 18,3 % 20,4 %<br />
Neue Länder 14,9 % 14,5 % 14,7 % 17,5 % 13,3 % 15,3 % 13,5 % 1,9 % 6,0 % 15,7 % 11,0 % 13,2 %<br />
„Gibt es Personen, die auf Gr<strong>und</strong> ihres schlechten Ges<strong>und</strong>heitszustandes von Ihnen privat oder ehrenamtlich betreut bzw. gepflegt werden oder denen Sie regelmäßig<br />
Hilfe leisten?“ (mündl. Interview, Frage 539)<br />
Ja 7,8 % 16,0 % 11,9 % 9,3 % 14,6 % 12,0 % 7,4 % 10,4 % 9,3 % 8,3 % 14,1 % 11,4 %<br />
Alte Länder 7,3 % 17,1 % 12,2 % 9,4 % 13,9 % 11,7 % 6,9 % 11,3 % 9,6 % 8,0 % 14,6 % 11,5 %<br />
Neue Länder 9,5 % 11,8 % 10,7 % 8,9 % 17,0 % 13,1 % 10,0 % 6,8 % 8,0 % 9,4 % 12,5 % 11,0 %<br />
„Betreuen oder beaufsichtigen Sie privat K<strong>in</strong>der, die nicht Ihre eigenen s<strong>in</strong>d, z.B. auch Ihre Enkel oder K<strong>in</strong>der von Nachbarn, Fre<strong>und</strong>en oder Bekannten?“ (mündl.<br />
Interview, Frage 423)<br />
Ja 9,2 % 16,8 % 13,0 % 20,6 % 27,3 % 24,1 % 15,0 % 16,9 % 16,1 % 14,5 % 20,5 % 17,6 %<br />
Alte Länder 10,3 % 16,0 % 13,1 % 22,2 % 27,6 % 24,9 % 16,3 % 19,0 % 17,9 % 15,7 % 20,8 % 18,4 %<br />
Neue Länder 5,3 % 20,1 % 12,6 % 14,7 % 26,2 % 20,7 % 8,8 % 8,0 % 8,3 % 9,4 % 19,3 % 14,7 %<br />
Alterssurvey 2002, gewichtet.
Tabelle A6.2: Unterstützungsleistungen<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre 40-85 Jahre<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
„Haben Sie während der letzten 12 Monate jemandem, der nicht hier im Haushalt lebt, bei Arbeiten im Haushalt, z.B. beim Saubermachen, bei kle<strong>in</strong>eren Reparaturen oder beim E<strong>in</strong>kaufen<br />
geholfen?“ Falls ja: „Welche Person oder welche Personen s<strong>in</strong>d das?“ (mündl. Interview, Fragen 708 <strong>und</strong> 709)<br />
Ne<strong>in</strong> 61,9 % 64,4 % 63,1 % 66,0 % 75,8 % 71,1 % 83,1 % 85,3 % 84,5 % 67,2 % 73,7 % 70,7 %<br />
Alte Länder 62,3 % 63,3 % 62,8 % 64,4 % 75,1 % 69,9 % 83,0 % 84,0 % 83,6 % 66,9 % 72,8 % 70,0 %<br />
Neue Länder 60,3 % 68,6 % 64,5 % 72,4 % 78,5 % 75,5 % 83,6 % 90,7 % 88,2 % 68,6 % 77,5 % 73,4 %<br />
E<strong>in</strong>e Person genannt 19,6 % 24,3 % 21,9 % 21,8 % 18,4 % 20,0 % 11,8 % 11,1 % 11,4 % 19,0 % 18,9 % 18,9 %<br />
Alte Länder 19,1 % 25,7 % 22,4 % 22,4 % 19,1 % 20,7 % 11,6 % 12,0 % 11,8 % 18,9 % 19,8 % 19,4 %<br />
Neue Länder 21,2 % 18,9 % 20,1 % 19,4 % 15,8 % 17,6 % 12,6 % 7,4 % 9,3 % 19,1 % 15,0 % 16,9 %<br />
Zwei Personen genannt 11,5 % 7,6 % 9,5 % 8,7 % 5,2 % 6,9 % 3,5 % 2,5 % 2,8 % 9,0 % 5,5 % 7,1 %<br />
Alte Länder 12,2 % 7,0 % 9,6 % 9,7 % 5,3 % 7,4 % 3,4 % 2,8 % 3,0 % 9,6 % 5,3 % 7,3 %<br />
Neue Länder 8,7 % 10,1 % 9,4 % 4,7 % 5,1 % 4,9 % 3,8 % 1,2 % 2,2 % 6,4 % 6,1 % 6,3 %<br />
Drei oder mehr Personen genannt 7,1 % 3,7 % 5,4 % 3,5 % 0,6 % 2,0 % 1,6 % 1,1 % 1,3 % 4,8 % 1,9 % 3,3 %<br />
Alte Länder 6,4 % 4,0 % 5,2 % 3,5 % 0,6 % 2,0 % 2,0 % 1,2 % 1,5 % 4,5 % 2,1 % 3,2 %<br />
Neue Länder 9,8 % 2,4 % 6,1 % 3,5 % 0,6 % 2,0 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 5,8 % 1,3 % 3,4 %<br />
„Viele Menschen machen anderen Geld- oder Sachgeschenke oder unterstützen diese f<strong>in</strong>anziell. Dabei kann es sich z.B. um Eltern, K<strong>in</strong>der, Enkel oder andere Verwandte, aber auch um<br />
Fre<strong>und</strong>e oder Bekannte handeln. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten jemandem Geld geschenkt, größere Sachgeschenke gemacht oder jemanden regelmäßig<br />
f<strong>in</strong>anziell unterstützt?“ (mündl. Interview, Frage 800)<br />
Ja 27,5 % 26,7 % 27,1 % 38,1 % 35,1 % 36,6 % 34,8 % 28,6 % 31,0 % 32,7 % 30,1 % 31,3 %<br />
Alte Länder 27,6 % 26,7 % 27,1 % 40,1 % 36,5 % 38,3 % 35,0 % 30,5 % 32,2 % 33,5 % 31,0 % 32,2 %<br />
Neue Länder 27,3 % 26,6 % 27,0 % 30,6 % 29,8 % 30,2 % 33,5 % 20,6 % 25,3 % 29,5 % 26,3 % 27,8 %<br />
Von diesen nennen (Mehrfachantwortmöglichkeit):<br />
(Schwieger-)Eltern 11,3 % 7,3 % 9,3 % 3,1 % 0,7 % 1,9 % 0,0 % 0,9 % 0,5 % 5,6 % 3,1 % 4,3 %<br />
K<strong>in</strong>der 63,0 % 72,9 % 67,9 % 72,1 % 70,7 % 71,4 % 60,1 % 57,5 % 58,6 % 66,4 % 68,3 % 67,3 %<br />
Enkel 1,3 % 4,9 % 3,0 % 22,7 % 25,3 % 24,0 % 49,8 % 47,2 % 48,3 % 19,7 % 23,5 % 21,6 %<br />
Andere Verwandte 27,6 % 20,9 % 24,4 % 12,3 % 10,2 % 11,3 % 19,3 % 17,8 % 18,5 % 19,5 % 15,9 % 17,6 %<br />
Andere Personen 13,8 % 19,1 % 16,4 % 13,5 % 8,8 % 11,2 % 5,6 % 6,1 % 5,9 % 12,1 % 11,8 % 11,9 %<br />
Alterssurvey 2002, gewichtet.<br />
289
Tabelle A6.3: Besuch von Kursen oder Vorträgen<br />
290<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre 40-85 Jahre<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
„Wie oft besuchen Sie Kurse oder Vorträge, z.B. zur Fort- oder Weiterbildung?“ (mündl. Interview, Frage 432)<br />
Täglich 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %<br />
Alte Länder 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %<br />
Neue Länder 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %<br />
Mehrmals <strong>in</strong> der Woche 1,1 % 0,5 % 0,8 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0,7 %<br />
Alte Länder 1,2 % 0,3 % 0,7 % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 1,1 % 0,6 % 0,8 %<br />
Neue Länder 0,5 % 1,2 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,4 %<br />
E<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> der Woche 1,3 % 3,6 % 2,5 % 1,8 % 3,0 % 2,4 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 1,4 % 2,7 % 2,1 %<br />
Alte Länder 1,5 % 4,3 % 2,9 % 2,0 % 2,9 % 2,5 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 1,6 % 2,9 % 2,3 %<br />
Neue Länder 0,5 % 1,2 % 0,9 % 0,6 % 3,1 % 1,9 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 0,7 % 1,9 % 1,3 %<br />
E<strong>in</strong> bis dreimal im Monat 6,6 % 7,4 % 7,0 % 4,8 % 4,7 % 4,7 % 2,2 % 3,3 % 2,9 % 5,1 % 5,4 % 5,3 %<br />
Alte Länder 6,9 % 7,5 % 7,2 % 5,0 % 4,1 % 4,5 % 2,0 % 4,0 % 3,2 % 5,3 % 5,4 % 5,4 %<br />
Neue Länder 5,3 % 7,1 % 6,2 % 4,1 % 6,9 % 5,5 % 3,2 % 0,6 % 1,5 % 4,5 % 5,4 % 5,0 %<br />
Seltener 42,6 % 41,5 % 42,1 % 23,4 % 20,1 % 21,7 % 13,7 % 5,8 % 8,8 % 30,4 % 24,9 % 27,5 %<br />
Alte Länder 45,8 % 43,2 % 44,5 % 25,7 % 23,2 % 24,4 % 14,7 % 6,4 % 9,6 % 32,8 % 26,8 % 29,6 %<br />
Neue Länder 30,2 % 34,9 % 32,5 % 14,1 % 8,1 % 11,0 % 8,9 % 3,1 % 5,2 % 20,8 % 17,6 % 19,1 %<br />
Nie 48,1 % 46,7 % 47,4 % 68,9 % 71,3 % 70,1 % 83,2 % 89,9 % 87,3 % 62,0 % 66,3 % 64,3 %<br />
Alte Länder 44,3 % 44,5 % 44,4 % 65,8 % 68,5 % 67,2 % 82,5 % 88,7 % 86,3 % 59,1 % 64,3 % 61,9 %<br />
Neue Länder 63,0 % 55,0 % 59,1 % 81,2 % 81,9 % 81,5 % 86,7 % 95,1 % 92,1 % 73,5 % 74,4 % 74,0 %<br />
Alterssurvey 2002, gewichtet.
7. Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Susanne Wurm <strong>und</strong> Clemens Tesch-Römer<br />
7.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Der sich derzeit vollziehende demografische <strong>Wandel</strong> führt auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Ebene zu e<strong>in</strong>er höheren<br />
Lebenserwartung <strong>und</strong> auf gesellschaftlicher Ebene zu e<strong>in</strong>em Zuwachs des Anteils alter<br />
<strong>und</strong> sehr alter Menschen. Aktuelle Modellrechnungen gehen von e<strong>in</strong>er <strong>Entwicklung</strong> der durchschnittlichen<br />
Lebenserwartung bis zum Jahr 2050 für Männer von 79 bis 83 Jahren aus, für<br />
Frauen von e<strong>in</strong>em Anstieg auf 86 bis 88 Jahre (Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2003). Derzeit liegt die<br />
Lebenserwartung bei Geburt für Männer bei 75,4, für Frauen bei 81,2 Jahren 1 . Zugleich wird der<br />
Anteil alter <strong>und</strong> sehr alter Menschen an der Gesamtbevölkerung <strong>in</strong> Zukunft deutlich zunehmen:<br />
Im Jahr 2002 waren 17,5 Prozent der Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland im Alter von 65 Jahren <strong>und</strong><br />
älter. Der Anteil dieser Altersgruppe wird sich, Bevölkerungsvorausberechnungen zufolge, <strong>in</strong>nerhalb<br />
der ersten Hälfte dieses Jahrh<strong>und</strong>erts fast verdoppelt haben – für das Jahr 2050 ist e<strong>in</strong><br />
Anteil von 29,6 Prozent prognostiziert. E<strong>in</strong> besonders hoher Anstieg wird für den Anteil der<br />
Hochbetagten, d.h. der 80-Jährigen <strong>und</strong> Älteren, an der Bevölkerung erwartet. Dieser betrug im<br />
Jahr 2002 4,0 Prozent <strong>und</strong> wird Vorausberechnungen zufolge bis zum Jahr 2050 mit 12,1 Prozent<br />
dreimal so hoch liegen 2 . Dieser prognostizierte demografische <strong>Wandel</strong> ist von hoher <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r<br />
Bedeutung, denn er impliziert für viele Menschen e<strong>in</strong>e lange Lebensphase des Alterns<br />
<strong>und</strong> Altse<strong>in</strong>s. Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Alltagskompetenz entscheiden dabei maßgeblich über die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Lebensqualität (vgl. auch Kapitel 9) sowie über die Möglichkeit, e<strong>in</strong>e selbstständige Lebensführung<br />
aufrechterhalten zu können.<br />
Zugleich hat der starke Anstieg des Anteils älterer <strong>und</strong> alter Menschen an der Bevölkerung hohe<br />
gesellschaftliche Bedeutung. In H<strong>in</strong>blick auf Ges<strong>und</strong>heit lässt sich diese beispielhaft anhand<br />
zweier Themenkomplexe skizzieren. Angesichts der Verr<strong>in</strong>gerung des Erwerbspersonenpotenzials<br />
kann es sich <strong>in</strong> Zukunft als notwendig erweisen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern. E<strong>in</strong>e<br />
zentrale Voraussetzung für die Partizipation am Erwerbsleben ist jedoch e<strong>in</strong>e gute Ges<strong>und</strong>heit<br />
im mittleren Erwachsenenalter. Für alte <strong>und</strong> sehr alte Menschen entscheidet die Ges<strong>und</strong>heit<br />
h<strong>in</strong>gegen oftmals über e<strong>in</strong> selbstständiges <strong>und</strong> selbstverantwortliches Leben im eigenen Haushalt.<br />
Die Erhaltung guter Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Selbstständigkeit hat damit erhebliche Konsequenzen<br />
für die Kosten im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen: Je besser die Ges<strong>und</strong>heit älter werdender<br />
Menschen, um so ger<strong>in</strong>ger wird die Inanspruchnahme von kostenträchtigen Krankenbehandlungen<br />
sowie die Notwendigkeit ambulanter wie stationärer pflegerischer Versorgung se<strong>in</strong>. Zur<br />
Def<strong>in</strong>ition dessen, was unter Ges<strong>und</strong>heit zu verstehen ist, wurden lange Zeit ausschließlich mediz<strong>in</strong>ische<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmodelle herangezogen. Im Mittelpunkt dieser Modelle stehen Krankhei-<br />
1 Vgl. Sterbetafel 2000/2002. Statistisches B<strong>und</strong>esamt, www.destatis.de.<br />
2 Variante 5 der 10. Koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung; vgl. Hoffmann & Menn<strong>in</strong>g, 2004.<br />
291
292<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
ten. Entsprechend werden als Indikatoren Maße der Morbidität, funktioneller E<strong>in</strong>schränkungen<br />
<strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derungen herangezogen sowie Lebenserwartung <strong>und</strong> Mortalität berücksichtigt. Diese<br />
klassische, mediz<strong>in</strong>ische Sichtweise wurde von der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation durch e<strong>in</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äres,<br />
die Sozialwissenschaften <strong>in</strong>tegrierendes Ges<strong>und</strong>heitskonzept ergänzt (WHO,<br />
1986). Dieses enthält Indikatoren subjektiver Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Lebenszufriedenheit sowie Lebensstil<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsverhalten als weitere bedeutsame Kriterien für e<strong>in</strong>e gute Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Die nachfolgenden Ausführungen zur Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte greifen Aspekte<br />
des klassischen <strong>und</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Ges<strong>und</strong>heitskonzeptes auf <strong>und</strong> ergänzen diese durch die<br />
Betrachtung e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme von Leistungen der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung.<br />
Über die Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsversorgung von Personen im höheren <strong>und</strong> hohen Alter<br />
liegen gegenwärtig nur wenige bevölkerungsrepräsentative Datensätze vor. Zu umfangreichen<br />
deutschen Ges<strong>und</strong>heitssurveys zählten <strong>in</strong> den 80er- <strong>und</strong> 90er-Jahren die MONICA-Studie der<br />
Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO, 1988) sowie die Nationalen Ges<strong>und</strong>heitssurveys der Deutschen<br />
Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP-Studie). Diese Studien konzentrierten sich allerd<strong>in</strong>gs<br />
nur auf die Bevölkerung im Alter zwischen 25 <strong>und</strong> 65 Jahren (MONICA) bzw. 25 <strong>und</strong> 69<br />
Jahren (Nationale Ges<strong>und</strong>heitssurveys), während ältere Personen von diesen Studien ausgeschlossen<br />
blieben. Im H<strong>in</strong>blick auf die Altersspanne komplementär hierzu ist die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
(Mayer & Baltes, 1996). In ihrem Rahmen wurden alte <strong>und</strong> hochaltrige Personen im<br />
Alter zwischen 70 <strong>und</strong> über 100 Jahren untersucht. Die Haupterhebung der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
fand (wie der dritte Nationale Ges<strong>und</strong>heitssurvey) zu Beg<strong>in</strong>n der 90er-Jahre statt <strong>und</strong> bezog sich<br />
auf alte <strong>und</strong> hochaltrige Personen aus West-Berl<strong>in</strong>. Bis heute kommt der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
e<strong>in</strong>e zentrale Stellung <strong>in</strong> der gerontologischen Forschung zu. Trotz ihrer e<strong>in</strong>geschränkten Repräsentativität<br />
ist sie – unter anderem – e<strong>in</strong>e weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zigartige Datenquelle bezüglich der Art<br />
<strong>und</strong> Verbreitung von chronischen Krankheiten im höheren <strong>und</strong> hohen Alter. Andere Daten hierzu<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel fallbezogen (z.B. Krankenhausdiagnosestatistik) <strong>und</strong> nicht bevölkerungsbezogen<br />
oder berücksichtigen ältere, <strong>in</strong>sbesondere hochbetagte Personen nicht. Aktuelle <strong>und</strong><br />
umfangreiche Daten zur Ges<strong>und</strong>heit liefert schließlich der B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitssurvey, dessen<br />
Haupterhebung zwischen 1997 <strong>und</strong> 1999 stattfand. Im Gegensatz zu den Nationalen Surveys<br />
wurde hierbei e<strong>in</strong>e breitere Altersspanne von Personen zwischen 18 <strong>und</strong> 79 Jahren aus Ost- wie<br />
Westdeutschland e<strong>in</strong>bezogen (Thefeld, Stolzenberg, & Bellach, 1999) 3 . Neben diesen Studien<br />
mit e<strong>in</strong>em ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Schwerpunkt enthalten auch allgeme<strong>in</strong>e Bevölkerungsbefragungen<br />
wie der Mikrozensus, das Sozioökonomische Panel <strong>und</strong> der Wohlfahrtssurvey Fragen<br />
zur Ges<strong>und</strong>heit, jedoch <strong>in</strong> deutlich ger<strong>in</strong>gerem Umfang.<br />
Ziel des Alterssurveys ist e<strong>in</strong>e umfassende Beobachtung des Alterungsprozesses der deutschen<br />
Bevölkerung. Mit e<strong>in</strong>er breiten Altersspanne von mehr als 45 Jahren 4 werden langfristige Prozesse<br />
der Alterung untersucht – beg<strong>in</strong>nend vom mittleren Erwachsenenalter bis h<strong>in</strong> zur Anfangsphase<br />
der Hochaltrigkeit. Die allgeme<strong>in</strong>e, bevölkerungsbezogene Perspektive der Ges<strong>und</strong>-<br />
3 Im Gegensatz zum B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitssurvey umfassten die Nationalen Ges<strong>und</strong>heitssurveys nur westdeutsche<br />
Personen. Als Ergänzung der westdeutschen DHP-Studie wurde <strong>in</strong> den Jahren 1991/92 der ‚Ges<strong>und</strong>heitssurvey<br />
Ost’ durchgeführt.<br />
4 Je nach Stichprobe des Alterssurveys handelt es sich um Personen im Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85 bzw. 46 <strong>und</strong> 91<br />
Jahren, vgl. Kapitel 2.
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
heitssurveys sowie die besonders auf Fragen zum hohen Alter konzentrierte Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
können damit durch e<strong>in</strong>e bedeutsame Perspektive erweitert werden, da im Alterssurvey die<br />
Ges<strong>und</strong>heit von Personen des mittleren Erwachsenenalters <strong>und</strong> jungen Alters im Mittelpunkt<br />
steht. Fragen zu <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Alterungsprozessen <strong>und</strong> der Alterung e<strong>in</strong>er ganzen Gesellschaft<br />
s<strong>in</strong>d stets eng verknüpft mit Fragen zur Ges<strong>und</strong>heit. Die ges<strong>und</strong>heitlichen Folgen des Alterns<br />
werden oftmals schon <strong>in</strong> den Anfängen der zweiten Lebenshälfte deutlich spürbar. Zugleich<br />
bestehen besonders <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf das mittlere Erwachsenenalter noch immer erhebliche Forschungsdefizite<br />
(Staud<strong>in</strong>ger & Bluck, 2001). Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> des demografischen <strong>Wandel</strong>s<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Implikationen für die Arbeitswelt <strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heitsversorgung Älterer von<br />
heute <strong>und</strong> vor allem auch <strong>in</strong> naher Zukunft ist es wichtig, bei Fragen zum Altern <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
die gesamte zweite Lebenshälfte <strong>in</strong> den Blickpunkt zu rücken. Das Aufdecken von Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schränkungen<br />
<strong>und</strong> Versorgungsdefiziten kann dabei behilflich se<strong>in</strong>, auf gesellschaftspolitischer<br />
wie <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Ebene Maßnahmen zu ergreifen, die e<strong>in</strong> Altern <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heit, Lebensqualität<br />
<strong>und</strong> Würde unterstützen. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e stellen die Daten des Alterssurveys<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Ergänzung vorliegender Studien dar.<br />
Der Alterssurvey zeichnet sich hierbei durch besondere Stärken aus, ohne zugleich frei von<br />
E<strong>in</strong>schränkungen zu se<strong>in</strong>. In H<strong>in</strong>blick auf Ges<strong>und</strong>heit, aber auch bezüglich vielfältiger anderer<br />
Themenbereiche, liegt e<strong>in</strong>e besondere Stärke des Alterssurveys <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Komb<strong>in</strong>ation aus<br />
Längsschnitt- <strong>und</strong> Kohortendesign (vgl. Kapitel 2). Dadurch lassen sich <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Ges<strong>und</strong>heitsentwicklungen<br />
betrachten (vgl. Kapitel 8), während die wiederholt durchgeführten Querschnittuntersuchungen<br />
Kohortenvergleiche ermöglichen. Letztere s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e zentrale Gr<strong>und</strong>lage<br />
für die Frage, ob die nachfolgenden Kohorten Älterer <strong>in</strong> besserer Ges<strong>und</strong>heit alt werden als<br />
früher geborene Kohorten (D<strong>in</strong>kel, 1999; vgl. Abschnitt 7.6). Aus methodischer Sicht s<strong>in</strong>d im<br />
Alterssurvey damit die Stärken des Längsschnittes, wie sie <strong>in</strong> der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie deutlich<br />
werden, sowie die Stärken des Kohortenvergleichs, wie sie durch die Nationalen Ges<strong>und</strong>heitssurveys<br />
bekannt s<strong>in</strong>d, komb<strong>in</strong>iert. Im Rahmen des Alterssurveys wurde zudem neben Fragen<br />
zur Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>e Vielfalt anderer Lebensbereiche (z.B. Familie, E<strong>in</strong>kommen) sowie persönliche<br />
E<strong>in</strong>stellungen (z.B. E<strong>in</strong>stellungen gegenüber dem Älterwerden) <strong>und</strong> Bef<strong>in</strong>dlichkeiten (z.B.<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den, Lebenszufriedenheit) erfasst. E<strong>in</strong>e komb<strong>in</strong>ierte Erhebung umfangreicher sozialer<br />
wie psychischer Faktoren erfolgt <strong>in</strong> Bevölkerungsumfragen nur sehr selten. Diese Komb<strong>in</strong>ation<br />
ermöglicht, neben den äußeren Lebenszusammenhängen, auch die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n psychischen<br />
Risiken <strong>und</strong> Ressourcen zu berücksichtigen <strong>und</strong> diese <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Ges<strong>und</strong>heitsvorhersage e<strong>in</strong>zubeziehen<br />
(vgl. Kapitel 8).<br />
E<strong>in</strong>schränkungen müssen jedoch <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Art der Ges<strong>und</strong>heitserhebung gemacht<br />
werden. Der Alterssurvey basiert, vergleichbar mit anderen Bevölkerungsumfragen wie dem<br />
Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), Mikrozensus oder Wohlfahrtssurvey, ausschließlich auf<br />
Selbstaussagen der Befragungspersonen. Die nachfolgenden Darstellungen zum Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
alternder <strong>und</strong> alter Personen s<strong>in</strong>d folglich nicht als Ergebnisse mediz<strong>in</strong>ischer Untersuchungen<br />
zu <strong>in</strong>terpretieren. Zudem besteht im Alterssurvey wie <strong>in</strong> anderen Bevölkerungsumfragen<br />
das Problem, dass die Befragten zugunsten Gesünderer selektiert s<strong>in</strong>d. Personen mit e<strong>in</strong>em<br />
schlechten Ges<strong>und</strong>heitszustand lehnen häufiger die Teilnahme an e<strong>in</strong>er Befragung ab als Personen<br />
mit e<strong>in</strong>er guten Ges<strong>und</strong>heit (vgl. Kapitel 2). Ebenfalls wie <strong>in</strong> den meisten anderen Surveys,<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den nachfolgenden Darstellungen ke<strong>in</strong>e Heimbewohner e<strong>in</strong>bezogen. Dies führt dazu,<br />
293
294<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
dass die Daten e<strong>in</strong> <strong>in</strong>sgesamt positiveres Bild vom Ges<strong>und</strong>heitszustand Älterer geben, als es für<br />
die Gesamtbevölkerung angenommen werden kann. Repräsentative Daten zu Hilfe- <strong>und</strong> Pflegebedürftigen<br />
<strong>in</strong> Heime<strong>in</strong>richtungen liefert jedoch e<strong>in</strong>e eigens hierauf ausgerichtete Studie<br />
(Schneekloth & Müller, 1997).<br />
7.2 Fragestellungen im Kapitelüberblick<br />
Im umfassendsten Teil des vorliegenden Kapitels wird zunächst die Frage verfolgt, wie sich der<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand aus Sicht der Personen darstellt, die sich <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte bef<strong>in</strong>den<br />
(Abschnitt 7.4). Berücksichtigt werden hierbei der altersabhängige Anstieg körperlicher<br />
Erkrankungen, die damit verb<strong>und</strong>enen Beschwerden sowie das berichtete Ausmaß an Multimorbidität<br />
(Abschnitt 7.4.1). E<strong>in</strong>e Folge von körperlichen Beschwerden s<strong>in</strong>d oftmals funktionelle<br />
E<strong>in</strong>schränkungen. Hierzu zählen <strong>in</strong>sbesondere E<strong>in</strong>schränkungen der Mobilität. Diese gefährden<br />
e<strong>in</strong>e selbstständige Lebensführung im Alter, können aber bereits <strong>in</strong> früheren Lebensphasen<br />
die Möglichkeiten e<strong>in</strong>er gesellschaftlichen Teilhabe e<strong>in</strong>schränken. Auf die Fragen, <strong>in</strong> welcher<br />
Weise Mobilitätsbee<strong>in</strong>trächtigungen mit dem Alter ansteigen <strong>und</strong> wie viele Personen schließlich<br />
auf Hilfeleistungen angewiesen s<strong>in</strong>d, geht der zweite Abschnitt (7.4.2) e<strong>in</strong>. Während die Aspekte<br />
von Morbidität, Funktionse<strong>in</strong>bußen <strong>und</strong> Hilfebedürftigkeit eher dem mediz<strong>in</strong>ischen Ges<strong>und</strong>heitskonzept<br />
zuzuordnen s<strong>in</strong>d, wird – dem <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Ges<strong>und</strong>heitskonzept folgend –<br />
auch die subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung berücksichtigt. Dabei wird aufgezeigt, ob <strong>und</strong> wie<br />
sich die subjektive Ges<strong>und</strong>heit im Verlaufe der zweiten Lebenshälfte verändert (Abschnitt<br />
7.4.3). Auf die ergänzende Darstellung der psychischen Bef<strong>in</strong>dlichkeit <strong>und</strong> Depressivitätsneigung<br />
Älterer wurde an dieser Stelle verzichtet. Ergebnisse zur subjektiven Bef<strong>in</strong>dlichkeit können<br />
jedoch Kapitel 9 entnommen werden.<br />
Der zweite Teil des vorliegenden Kapitels (Abschnitt 7.5) beschäftigt sich damit, <strong>in</strong> welchem<br />
Ausmaß mediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> andere Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen <strong>in</strong> Anspruch genommen werden.<br />
Betrachtet werden hierbei Arztbesuche sowie Fragen danach, wie viele Personen (vor E<strong>in</strong>führung<br />
der Ges<strong>und</strong>heitsreform) e<strong>in</strong>e Hausärzt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>en Hausarzt hatten <strong>und</strong> wie viele Personen<br />
Zahnarztbesuche vermeiden. Daran schließt sich e<strong>in</strong>e Darstellung über die Nutzung weiterer<br />
mediz<strong>in</strong>naher Dienstleistungen an, unter anderem die Nutzung von Heilhilfsbehandlungen.<br />
Im dritten <strong>und</strong> abschließenden Teil des Kapitels (Abschnitt 7.6) steht die Frage im Zentrum,<br />
<strong>in</strong>wieweit sich abzeichnet, dass nachfolgende Geburtskohorten gesünder s<strong>in</strong>d als früher geborene<br />
Kohorten gleichen Alters. Sollte dies der Fall se<strong>in</strong>, wäre es e<strong>in</strong> H<strong>in</strong>weis darauf, dass die <strong>in</strong>folge<br />
steigender Lebenserwartung „gewonnenen“ Lebensjahre nicht e<strong>in</strong>e bloße Verlängerung<br />
von Lebensjahren <strong>in</strong> Krankheit <strong>und</strong> Pflegebedürftigkeit be<strong>in</strong>halten, sondern e<strong>in</strong>en Gew<strong>in</strong>n aktiver<br />
Lebensjahre bedeuten könnten.
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
7.3 Datengr<strong>und</strong>lage<br />
Gr<strong>und</strong>lage der nachfolgenden Ergebnisdarstellungen bildet vor allem die Replikationsstichprobe<br />
des Alterssurveys (vgl. Kapitel 2). Es handelt sich hierbei um mehr als 3000 Personen der deutschen<br />
Wohnbevölkerung <strong>in</strong> Privathaushalten. Im Befragungsjahr 2002 waren diese Personen im<br />
Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren. Die Replikationsstichprobe wurde bei der Stichprobenziehung<br />
nach Altersgruppe, Geschlecht <strong>und</strong> regionaler Herkunft geschichtet. Dadurch ist auch für die<br />
höchste der drei Altersgruppen (70-85 Jahre) e<strong>in</strong>e ausreichend hohe Fallzahl (n=1.008) gewährleistet,<br />
um Ergebnisse nach Geschlecht <strong>und</strong> regionaler Herkunft (Ost-/ Westdeutschland) differenzieren<br />
<strong>und</strong> vergleichen zu können.<br />
In der Basisstichprobe des Alterssurveys von 1996 zählte der Themenbereich Ges<strong>und</strong>heit nicht<br />
zu den zentralen Befragungsschwerpunkten, weshalb nur e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>ere Zahl von Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikatoren<br />
erhoben wurde (Künem<strong>und</strong>, 2000). Für die zweite Welle des Alterssurveys wurde der<br />
Themenbereich modifiziert <strong>und</strong> deutlich erweitert. Aus diesem Gr<strong>und</strong> bezieht sich e<strong>in</strong> Großteil<br />
der nachfolgenden Darstellungen ausschließlich auf die Querschnittsdaten der Replikationsstichprobe.<br />
Zur Frage, ob nachfolgende Kohorten gesünder s<strong>in</strong>d, als früher Geborene gleichen<br />
Alters (Abschnitt 7.6), werden h<strong>in</strong>gegen Vergleiche zwischen den Angaben der Basisstichprobe<br />
<strong>und</strong> der Replikationsstichprobe vorgenommen.<br />
Die nachfolgenden Darstellungen konzentrieren sich auf e<strong>in</strong>e Deskription des Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
<strong>und</strong> Inanspruchnahmeverhaltens. In Kapitel 8 wird ergänzend hierzu der Frage nachgegangen,<br />
welchen E<strong>in</strong>fluss verschiedene soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren sowie das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten<br />
auf die Ges<strong>und</strong>heit haben. Gr<strong>und</strong>lage für die Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
ges<strong>und</strong>heitlichen Veränderungen bildet hierbei – im Gegensatz zum vorliegenden Kapitel – die<br />
Panelstichprobe des Alterssurveys.<br />
7.4 Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
Der nachfolgende Abschnitt geht auf den selbstberichteten Ges<strong>und</strong>heitszustand älter werdender<br />
<strong>und</strong> alter Personen e<strong>in</strong>. Im Blickpunkt steht dabei die Frage, h<strong>in</strong>sichtlich welcher Ges<strong>und</strong>heitsaspekte<br />
deutliche Altersgruppenunterschiede bestehen. Betrachtet wird auch, <strong>in</strong>wieweit Frauen<br />
sich aufgr<strong>und</strong> ihrer höheren Lebenserwartung <strong>in</strong> ihrer Ges<strong>und</strong>heit von Männern unterscheiden.<br />
Der Kontrast zwischen der erhöhten Mortalität von Männern <strong>und</strong> der erhöhten Morbidität von<br />
Frauen ist seit vielen Jahrzehnten bekannt <strong>und</strong> lässt sich verkürzt auf die Aussage „women get<br />
sick and men die“ (Sen, 1996, S.211) zuspitzen. Schließlich f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> den folgenden Darstellungen<br />
Berücksichtigung, <strong>in</strong>wieweit sich zwölf Jahre nach der Wiedervere<strong>in</strong>igung der beiden deutschen<br />
Staaten noch Ges<strong>und</strong>heitsdifferenzen zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschen zeigen. Ges<strong>und</strong>heitsprobleme,<br />
die sich <strong>in</strong> Abhängigkeit von der betrachteten Altersgruppe, Geschlechtszugehörigkeit<br />
oder regionaler Herkunft zeigen, können H<strong>in</strong>weise geben für spezifische Bedarfe an<br />
Präventions- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderungsprogrammen.<br />
295
7.4.1 Körperliche Erkrankungen <strong>und</strong> Multimorbidität<br />
296<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Die körperliche Ges<strong>und</strong>heit unterliegt lebenslangen <strong>Entwicklung</strong>en <strong>und</strong> Veränderungen. Ab<br />
dem mittleren Erwachsenenalter nimmt jedoch die Anzahl von Personen deutlich zu, deren körperliche<br />
Ges<strong>und</strong>heit sich verschlechtert. Hierbei handelt es sich vor allem um chronische Erkrankungen,<br />
Funktionsverluste (z.B. E<strong>in</strong>bußen der Sehfähigkeit) <strong>und</strong> Veränderungen der kognitiven<br />
Leistungsfähigkeit (vor allem demenzielle Erkrankungen, vgl. Förstl, Lauter, & Bickel,<br />
2001). Dabei liegen die Gründe für e<strong>in</strong>en altersabhängigen Anstieg von Erkrankungen <strong>und</strong><br />
Funktionsverlusten nicht alle<strong>in</strong> an altersphysiologischen Veränderungen von Organen <strong>und</strong> Organsystemen<br />
(Walter & Schwartz, 2001). Auch die lange Latenzzeit mancher Krankheiten führt<br />
dazu, dass diese erst im mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter gehäuft auftreten. Hierzu zählen<br />
beispielsweise verschiedene Formen von Krebserkrankungen, bei denen zugleich die mit<br />
dem Alter abnehmende Immunresponsivität e<strong>in</strong>e Rolle spielt. E<strong>in</strong> weiterer Faktor für den altersabhängigen<br />
Anstieg von Erkrankungen ist oftmals auch die jahre- oder jahrzehntelange Exposition<br />
verschiedener Risikofaktoren (Umfeldfaktoren, z.B. Lärm, Gifte; Ges<strong>und</strong>heitsverhalten,<br />
z.B. Rauchen). Diese führt zur sukzessiven Schädigung von Organen bis h<strong>in</strong> zu chronischen<br />
Erkrankungen (z.B. chronische Bronchitis) oder dauerhaften Funktionsverlusten (z.B. Verluste<br />
der Hörfähigkeit). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Krankheiten erst im mittleren<br />
<strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter auftreten, sondern lediglich „mitaltern“, d.h. seit dem Auftreten<br />
<strong>in</strong> jüngeren Lebensjahren fortbestehen (Schwartz & Walter, 1998). E<strong>in</strong>ige dieser Erkrankungen<br />
können durch die lange Dauer ihres Bestehens zu Folgekrankheiten führen. Dies ist<br />
beispielweise für Diabetes bekannt ist, die Arteriosklerose begünstigt <strong>und</strong> dadurch die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
(unter anderem) für Herz<strong>in</strong>farkt, Nierenversagen <strong>und</strong> Erbl<strong>in</strong>dung erhöht.<br />
Nach dem Vorhandense<strong>in</strong> körperlicher Erkrankungen wurde im Rahmen des Alterssurveys anhand<br />
e<strong>in</strong>er Liste von <strong>in</strong>sgesamt 11 Krankheiten <strong>und</strong> Krankheitsgruppen gefragt. Die Befragungspersonen<br />
konnten zunächst angeben, ob sie diese haben oder nicht. Sofern e<strong>in</strong>e Person<br />
angab, die entsprechende Krankheit zu haben, wurde sie zusätzlich danach gefragt, wie viele<br />
Beschwerden die Krankheit bereitet. Als Antwortmöglichkeiten standen die Angaben „ke<strong>in</strong>e“,<br />
„leichte“, „mittlere“ oder „große“ Beschwerden zur Auswahl. In der nachfolgenden Tabelle s<strong>in</strong>d<br />
die Angaben der Befragten zu entnehmen. Für jede der aufgeführten Krankheiten enthält die<br />
jeweils erste Zeile e<strong>in</strong>e Information über das Vorhandense<strong>in</strong> der Krankheit. Der jeweils zweiten<br />
Zeile kann entnommen werden, wie viele der Personen, die von der entsprechenden Krankheit<br />
betroffen s<strong>in</strong>d, über mittlere bis große Beschwerden berichten.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, dass die Angaben auf Selbstaussagen der Befragungspersonen beruhen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>ige der erfragten Krankheitsgruppen unterschiedliche Krankheiten subsumieren, verfolgt<br />
der Alterssurvey nicht den Anspruch, genaue Prävalenzdaten zu liefern. Zudem ist zu erwarten<br />
– <strong>und</strong> dies gilt für alle bevölkerungsbezogenen Untersuchungen – dass die Häufigkeit des Vorkommens<br />
von Krankheiten alle<strong>in</strong> durch die ger<strong>in</strong>gere Teilnahmebereitschaft von Personen mit<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbee<strong>in</strong>trächtigungen unterschätzt wird. E<strong>in</strong>e wichtige <strong>und</strong> die Angaben anderer Studien<br />
ergänzende Information liefern im Rahmen des Alterssurveys vor allem die Aussagen über<br />
das krankheitsabhängige Ausmaß an Beschwerden.
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Tabelle 7.1:<br />
Selbstaussagen zu Krankheiten <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Beschwerden, differenziert nach<br />
Altersgruppe <strong>und</strong> Geschlecht (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Gelenk-, Knochen-, Krankh 1<br />
Bandscheiben- od.<br />
Beschw<br />
Rückenleiden<br />
2<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre<br />
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen<br />
49,1 48,6<br />
38,8 43,7<br />
61,9 64,3<br />
53,7 51,4<br />
60,7 75,0<br />
52,1 69,7<br />
Herz-/ Kreislauf- Krankh 16,2 17,0 38,7 33,9 52,5 50,5<br />
erkrankung Beschw 23,1 25,5 26,3 27,2 39,9 37,2<br />
Durchblutungs- Krankh 10,4 9,9 26,8 27,3 45,8 44,7<br />
störungen Beschw 20,5 32,9 33,0 26,4 36,5 39,3<br />
Augenleiden, Krankh 28,6 26,5 31,4 34,0 44,7 47,3<br />
Sehstörungen Beschw 24,5 29,8 25,1 27,2 37,8 43,9<br />
Ohrenleiden, Krankh 9,1 6,8 22,3 10,3 33,7 24,2<br />
Schwerhörigkeit Beschw 21,2 (16,4) 3 32,0 36,0 41,3 47,2<br />
Zucker / Diabetes Krankh 4,5 2,2 11,8 9,1 18,1 17,3<br />
Beschw (35,2) (27,8) 38,9 36,8 50,7 44,5<br />
Blasenleiden Krankh 3,3 6,5 9,8 12,4 16,6 17,4<br />
Beschw (28,0) (22,2) 28,0 16,3 46,8 32,8<br />
Atemwegserkrankg. Krankh 7,9 11,6 11,7 14,6 19,6 11,6<br />
Asthma, Atemnot Beschw (23,7) 31,3 41,1 37,6 44,2 39,0<br />
Magen- oder Krankh 10,3 10,1 11,6 12,1 12,3 13,9<br />
Darmerkrankung Beschw 16,0 36,1 41,5 35,5 34,4 37,5<br />
Gallen-, Leber- Krankh 4,3 5,1 6,9 10,6 8,0 12,5<br />
oder Nierenleiden Beschw (21,9) (14,3) (30,7) 24,0 25,9 25,3<br />
Krebserkrankung Krankh 2,3 1,8 3,8 5,2 8,3 4,9<br />
Beschw / 4<br />
/ (32,1) (28,2) (45,1) (37,5)<br />
1 Anzahl der Personen (<strong>in</strong> Prozent), welche angeben, die entsprechende Erkrankung zu haben<br />
2 Anteil der erkrankten Personen (<strong>in</strong> Prozent) mit mittleren oder hohen Beschwerden<br />
3 Angaben <strong>in</strong> Klammern: Angaben auf der Gr<strong>und</strong>lage von ungewichteten Fallzahlen 10 < n ≤ 35<br />
4<br />
Ohne Angaben (Schrägstrich): ungewichtete Fallzahl n ≤ 10<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 2.706-2.754, gewichtet<br />
297
298<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
E<strong>in</strong>e nähere Betrachtung der Krankheitsnennungen (jeweils erste Zeile <strong>in</strong> Tabelle 7.1) macht<br />
deutlich, dass e<strong>in</strong>ige Krankheiten mit steigendem Alter deutlich häufiger genannt werden als zu<br />
Beg<strong>in</strong>n der zweiten Lebenshälfte. Über die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg kommt es zu e<strong>in</strong>em bedeutsamen<br />
Anstieg von Herz-Kreislauferkrankungen sowie von Durchblutungsstörungen, Ohrenleiden,<br />
Atemwegserkrankungen <strong>und</strong> Blasenleiden (p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
oder hohes Beschwerdemaß bei Magen- oder Darmerkrankungen als Ostdeutsche (p
300<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Für die höchste Altersgruppe ist der Abbildung schließlich zu entnehmen, dass r<strong>und</strong> jede vierte<br />
Person von e<strong>in</strong>er hohen Multimorbidität (5 <strong>und</strong> mehr Erkrankungen) betroffen ist, während e<strong>in</strong><br />
Großteil der Personen über m<strong>in</strong>destens zwei Erkrankungen berichtet. Allerd<strong>in</strong>gs gibt es auch <strong>in</strong><br />
dieser Altersgruppe, die bis <strong>in</strong> die Anfänge des hohen Alters 5 h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>reicht, noch immer e<strong>in</strong>e<br />
nennenswerte Anzahl von Personen, die über ke<strong>in</strong>e oder nur e<strong>in</strong>e Erkrankung berichten: hierbei<br />
handelt es sich um r<strong>und</strong> jede fünfte Person im Alter zwischen 70 <strong>und</strong> 85 Jahren. Vergleiche<br />
zwischen den Altersgruppen, Geschlechtern <strong>und</strong> Regionen machen deutlich, dass es von der<br />
jüngsten zur höchsten dargestellten Altersgruppe zwar zu e<strong>in</strong>em bedeutsamen Anstieg der Multimorbidität<br />
kommt, hiervon jedoch Frauen wie Männer <strong>und</strong> Ost- wie Westdeutsche etwa gleichermaßen<br />
betroffen s<strong>in</strong>d (Haupteffekt Altersgruppe; p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Selbst <strong>in</strong> der höchsten Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen haben noch über die Hälfte der Befragten<br />
h<strong>in</strong>sichtlich ke<strong>in</strong>er oder nur e<strong>in</strong>er Erkrankung größere Beschwerden. Der Anteil jener<br />
Personen mit multiplen Beschwerden steigt jedoch über die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg an (p
302<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Die Darstellung macht deutlich, dass es über die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg zu e<strong>in</strong>em Anstieg von<br />
schweren Erkrankungen bzw. Unfällen kommt. Erneut erweisen sich die Altersgruppen-<br />
Unterschiede als statistisch bedeutsam (p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
sche<strong>in</strong>t, dass der Anstieg der Multimorbidität nicht mit hohen Beschwerden gleichzusetzen ist.<br />
Zwar steigt neben der Multimorbidität auch die Häufigkeit multipler Beschwerden, dennoch<br />
berichtet bis <strong>in</strong> die Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen e<strong>in</strong> großer Teil der Befragten, höchstens<br />
h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>er Erkrankung unter mittleren bis großen Beschwerden zu leiden. Dieser<br />
Bef<strong>und</strong> kann möglicherweise als Ausdruck <strong>und</strong> Bestandteil e<strong>in</strong>er, bis <strong>in</strong>s hohe Alter fortdauernden<br />
Lebensqualität gewertet werden. Zugleich sollte Aufgabe weiterführender Forschung se<strong>in</strong>,<br />
der Frage nachzugehen, <strong>in</strong>wieweit dieser Bef<strong>und</strong> auch als Ausdruck e<strong>in</strong>er Anpassung an vorhandene<br />
Beschwerden zu verstehen ist. In diesem Fall würde es sich vermutlich e<strong>in</strong>erseits um<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Bewältigungsstrategie handeln. Andererseits birgt diese Form der Bewältigung<br />
von Beschwerden zugleich die Gefahr, dass dadurch entscheidende Rehabilitationspotenziale<br />
nicht ausreichend ausgeschöpft werden.<br />
Eng mit Fragen zur Multimorbidität <strong>und</strong> Beschwerden verknüpft ist die Frage, <strong>in</strong> welchem<br />
Ausmaß das Älterwerden mit Funktionse<strong>in</strong>bußen verb<strong>und</strong>en ist. Bereits im vorliegenden Abschnitt<br />
wurde gezeigt, dass das Altern <strong>in</strong>folge altersphysiologischer Prozesse sowie <strong>in</strong>folge von<br />
Krankheiten mit vermehrten E<strong>in</strong>bußen der Seh- <strong>und</strong> Hörfähigkeit e<strong>in</strong>hergeht. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
fiel jedoch besonders der hohe Anteil jener Personen auf, die über Gelenk- Knochen-, Bandscheiben-<br />
oder Rückenleiden berichteten (vgl. Tabelle 7.1). Bemerkenswert waren hierbei die<br />
deutlichen Geschlechtsunterschiede zu Ungunsten der Frauen. Der nachfolgende Abschnitt zu<br />
funktionellen E<strong>in</strong>schränkungen beschäftigt sich mit der Frage, <strong>in</strong> welchem Ausmaß Personen <strong>in</strong><br />
ihrer zweiten Lebenshälfte über E<strong>in</strong>schränkungen ihrer Mobilität berichten <strong>und</strong> wie viele Personen<br />
angeben, <strong>in</strong> ihrem Alltag auf fremde Hilfe oder Pflegeleistungen angewiesen zu se<strong>in</strong>. Dabei<br />
wird zu verfolgen se<strong>in</strong>, ob sich die größere Verbreitung von Gelenk- <strong>und</strong> Knochenerkrankungen<br />
bei Frauen gegenüber Männern entsprechend auch <strong>in</strong> stärkeren Mobilitätse<strong>in</strong>bußen wiederf<strong>in</strong>det.<br />
7.4.2 Funktionelle E<strong>in</strong>schränkungen<br />
Erkrankungen <strong>und</strong> Unfälle stellen mit steigendem Alter <strong>in</strong> zunehmendem Maße e<strong>in</strong>en Risikofaktor<br />
für die selbstständige Alltagsgestaltung dar. Art <strong>und</strong> Ausmaß körperlicher oder psychischer<br />
(<strong>in</strong>sbesondere demenzieller) Erkrankungen sowie e<strong>in</strong>e häufiger vorliegende Multimorbidität<br />
erschweren die Möglichkeit, ges<strong>und</strong>heitliche E<strong>in</strong>schränkungen zu kompensieren. Dies führt<br />
dazu, dass mit steigendem Alter Hilfs- <strong>und</strong> Pflegebedürftigkeit zunehmen.<br />
Neben Erkrankungen führen altersphysiologische (<strong>und</strong> alterskorrelierte) Veränderungen zusätzlich<br />
zu Funktionse<strong>in</strong>bußen, die direkt die Aufrechterhaltung von Selbstständigkeit im Alter gefährden.<br />
Hierzu zählen sensorische Verluste, <strong>in</strong>sbesondere visuelle E<strong>in</strong>schränkungen aufgr<strong>und</strong><br />
von Alterssichtigkeit <strong>und</strong> L<strong>in</strong>sentrübungen sowie auditive E<strong>in</strong>bußen durch Hochtonverluste <strong>und</strong><br />
Schwerhörigkeit. Ebenso können Veränderungen des Bewegungsapparates <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er Abnahme<br />
der Muskulatur, der Dehnbarkeit der Sehnen <strong>und</strong> der Gelenkbeweglichkeit zu funktionellen<br />
E<strong>in</strong>schränkungen führen, <strong>in</strong>dem die Mobilität bee<strong>in</strong>trächtigt wird. Sensomotorische Funktionse<strong>in</strong>bußen<br />
können zugleich zu Krankheiten beitragen, <strong>in</strong>sbesondere zu Verletzungen aufgr<strong>und</strong><br />
von Stürzen. Vor allem aber bee<strong>in</strong>flussen sie, ebenso wie Krankheiten, die <strong>in</strong>strumentellen <strong>und</strong><br />
303
304<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
basalen Aktivitäten des täglichen Lebens <strong>und</strong> die Möglichkeiten e<strong>in</strong>er Teilhabe am sozialen<br />
Leben.<br />
Die nachfolgenden Darstellungen zeigen für die körperliche Mobilität auf, welche Funktionse<strong>in</strong>bußen<br />
bereits im mittleren Erwachsenenalter <strong>und</strong> der Phase des jungen Alters festzustellen<br />
s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> damit bereits hier zu <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n E<strong>in</strong>schränkungen führen. Zu Beg<strong>in</strong>n der zweiten<br />
Lebenshälfte s<strong>in</strong>d diese E<strong>in</strong>schränkungen zumeist jedoch noch nicht mit Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit<br />
verb<strong>und</strong>en, wie im Folgenden deutlich wird.<br />
Abbildung 7.5 beruht auf Angaben, die mit Hilfe der Subskala „Körperliche Funktionsfähigkeit<br />
(Mobilität/Aktivitäten des täglichen Lebens; kurz: KÖFU)“ des SF-36-Fragebogens erhoben<br />
wurden. Es handelt sich beim SF-36-Fragebogen um e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternational anerkanntes Instrument<br />
zur Messung der ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Lebensqualität (Kirchberger, 2000; Radoschewski &<br />
Bellach, 1999). Das Instrument enthält <strong>in</strong>sgesamt neun Subskalen (unter anderem auch zu psychischem<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den, zu Vitalität <strong>und</strong> sozialer Funktionsfähigkeit) von denen jedoch ausschließlich<br />
die Subskala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ für den E<strong>in</strong>satz im Alterssurvey ausgewählt<br />
wurde. Die körperliche Funktionsfähigkeit wird hierbei anhand von 10 E<strong>in</strong>zelaspekten<br />
der Mobilität erhoben. Für jeden kann angegeben werden, ob diesbezüglich die Mobilität überhaupt<br />
nicht, etwas oder stark e<strong>in</strong>geschränkt ist. In der Abbildung ist e<strong>in</strong>e Auswahl dieser 10<br />
Mobilitätsaspekte enthalten. Diese s<strong>in</strong>d abgestuft von anstrengenden Tätigkeiten (schnell laufen,<br />
schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben) bis h<strong>in</strong> zu basalen Aktivitäten des<br />
täglichen Lebens (sich baden oder anziehen).<br />
Abbildung 7.5:<br />
Körperliche Funktionsfähigkeit - Ausgewählte Items aus dem SF-36 Fragebogen, differenziert<br />
nach Altersgruppen (Angaben <strong>in</strong> Prozent) 1<br />
Anstrengende Tätigkeit<br />
Sich beugen, knien, bücken<br />
E<strong>in</strong>kaufstaschen heben/tragen<br />
Mehrere Straßenkreuzungen zu Fuß<br />
E<strong>in</strong>en Treppenabsatz steigen<br />
Sich baden oder anziehen<br />
27 9,8<br />
39 24,6<br />
38 50,0<br />
11 4,1 40-54J.<br />
23 10,2 55-69J.<br />
38 20,5<br />
7 2,6 40-54J.<br />
17 7,4 55-69J.<br />
32 18,2<br />
3 1,9 40-54J.<br />
7 5,1 55-69J.<br />
16 17,7<br />
3 1,2<br />
9 2,5<br />
19 10,7<br />
20,9<br />
4 1,8<br />
14 6,5<br />
70-85J.<br />
70-85J.<br />
70-85J.<br />
etwas e<strong>in</strong>geschränkt<br />
stark e<strong>in</strong>geschränkt<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
1<br />
Die ersten Balken beziehen sich jeweils auf die jüngste Altersgruppe der 40- bis 54-Jährigen, mittlere Balken auf die<br />
Gruppe der 55- bis 69-Jährigen, äußerste Balken auf 70- bis 85-Jährige, wie dies auch für drei Balkengruppen exemplarisch<br />
e<strong>in</strong>gezeichnet ist<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 3.065-3.072, gewichtet
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Die Abbildung macht zunächst deutlich, dass es h<strong>in</strong>sichtlich aller dargestellten Mobilitätsaspekte<br />
über die drei Altersgruppen zu e<strong>in</strong>em bedeutsamen Anstieg von E<strong>in</strong>schränkungen kommt.<br />
Von E<strong>in</strong>schränkungen bezüglich anstrengender körperlicher Tätigkeiten ist bereits mehr als jede<br />
dritte Person zwischen 40 <strong>und</strong> 54 Jahren betroffen. Relativ früh im Lebensverlauf hat auch bereits<br />
r<strong>und</strong> jede siebte Person Probleme mit basalen Bewegungen wie dem sich Beugen, Knien<br />
oder Bücken. H<strong>in</strong>sichtlich dieser beiden Mobilitätsaspekte steigt der Anteil von Personen, der<br />
e<strong>in</strong>geschränkt ist, bereits zwischen der jüngsten <strong>und</strong> mittleren der drei Altersgruppen deutlich<br />
an. Die Zahl stark e<strong>in</strong>geschränkter Personen erhöht sich hierbei jeweils um den Faktor 2,5. Für<br />
alle anderen der dargestellten Aspekte körperlicher Mobilität kommt es h<strong>in</strong>gegen vor allem<br />
zwischen der mittleren <strong>und</strong> ältesten Altersgruppe zu e<strong>in</strong>em Anstieg starker E<strong>in</strong>schränkungen.<br />
Dabei verdreifacht sich jeweils etwa der Anteil von Personen mit starken Mobilitätsbee<strong>in</strong>trächtigungen.<br />
Über die drei Altersgruppen betrachtet veranschaulicht die Darstellung somit den Anstieg von<br />
Funktionse<strong>in</strong>bußen. Zugleich sollte nicht übersehen werden, dass auch <strong>in</strong> der Altersgruppe der<br />
70- bis 85-Jährigen e<strong>in</strong> hoher Anteil der Personen ohne jeweilige Mobilitätse<strong>in</strong>schränkung ist:<br />
Die Hälfte der Befragten dieser Altersgruppe gibt an, ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schränkungen beim Heben bzw.<br />
Tragen von E<strong>in</strong>kaufstaschen zu haben, r<strong>und</strong> zwei Drittel können ohne E<strong>in</strong>schränkungen mehrere<br />
Straßenkreuzungen zu Fuß gehen <strong>und</strong> über drei Viertel der Befragten nennt, beim Baden oder<br />
Anziehen ke<strong>in</strong>e Probleme zu haben. E<strong>in</strong>schränkend ist zu berücksichtigen, dass Bevölkerungsumfragen<br />
wie der Alterssurvey <strong>in</strong>folge der ger<strong>in</strong>geren Teilnahmebereitschaft von ges<strong>und</strong>heitlich<br />
bee<strong>in</strong>trächtigten Personen sowie aufgr<strong>und</strong> der auf Selbstaussagen basierenden Ergebnisse <strong>in</strong> der<br />
Regel zu optimistischeren Schlüssen kommen, als dies der tatsächlichen Situation Älterer entspricht.<br />
Doch auch unter Berücksichtigung dieser methodischen E<strong>in</strong>schränkung lassen die Ergebnisse<br />
<strong>in</strong>sgesamt auf eher gute Mobilitätsmöglichkeiten schließen. Auch im Rahmen der Berl<strong>in</strong>er<br />
Altersstudie konnte die hohe Mobilität <strong>und</strong> Selbstständigkeit 70- bis 84-Jähriger<br />
festgestellt werden. Durch letztere Studie ist allerd<strong>in</strong>gs bekannt, dass es ab dem 85. Lebensjahr<br />
zu e<strong>in</strong>em deutlichen Anstieg von Funktionse<strong>in</strong>bußen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er damit verb<strong>und</strong>enen Hilfebedürftigkeit<br />
kommt (Ste<strong>in</strong>hagen-Thiessen & Borchelt, 1996).<br />
Der Abbildung 7.5 waren Altersgruppenvergleiche, jedoch ke<strong>in</strong>e Vergleiche zwischen den Geschlechtern<br />
oder Regionen (Ost-/West) zu entnehmen. Hierzu erfolgten ergänzende statistische<br />
Überprüfungen, die aufzeigten, dass ke<strong>in</strong>e regionalspezifischen Mobilitätsunterschiede, h<strong>in</strong>gegen<br />
deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen. Geschlechtsunterschiede<br />
werden aus diesem Gr<strong>und</strong> nachfolgend näher betrachtet.<br />
Um e<strong>in</strong> zusammenfassendes Maß über die Mobilität zu erhalten, wurden, ergänzend zu den<br />
E<strong>in</strong>zelangaben, über alle 10 erhobenen Mobilitätsaspekte Summenwerte gebildet. Bei der<br />
Summenbildung wird der Wert 3 vergeben, wenn e<strong>in</strong> Mobilitätsaspekt ohne E<strong>in</strong>schränkungen<br />
ausgeführt werden kann, der Wert 2 für die Angabe, hierbei „etwas“ e<strong>in</strong>geschränkt zu se<strong>in</strong>, der<br />
Wert 1 für die Angabe, „sehr“ e<strong>in</strong>geschränkt zu se<strong>in</strong>. Pro Person werden rohe Punktsummen<br />
(Wertebereich 10-30) berechnet <strong>und</strong> anschließend <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Skalenspanne von 0 bis 100 transformiert.<br />
Dabei bedeutet der Wert 0, dass e<strong>in</strong>e Person h<strong>in</strong>sichtlich aller Aspekte erhobener Mobilität<br />
sehr e<strong>in</strong>geschränkt ist, der Wert 100 h<strong>in</strong>gegen gibt an, dass e<strong>in</strong>e Person über ke<strong>in</strong>erlei E<strong>in</strong>schränkungen<br />
berichtet. Die Transformation <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Skalenspanne von 0 bis 100 entspricht dem<br />
Standardvorgehen für Skalen des SF-36. Die nachfolgende Abbildung 7.6 veranschaulicht an-<br />
305
306<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
hand dieses Summenmaßes körperlicher Funktionsfähigkeit, wie sich über die zweite Lebenshälfte<br />
h<strong>in</strong>weg die Mobilität von Frauen <strong>und</strong> Männern entwickelt.<br />
Wie der Abbildung zu entnehmen ist, zeigen sich zu Beg<strong>in</strong>n der zweiten Lebenshälfte noch<br />
ke<strong>in</strong>e bedeutsamen Geschlechtsunterschiede. Mit steigendem Alter jedoch wächst die Diskrepanz<br />
zwischen Frauen <strong>und</strong> Männern. Es ist ersichtlich, dass ältere Frauen von höheren Mobilitätse<strong>in</strong>schränkungen<br />
betroffen s<strong>in</strong>d als Männer. Dies wird besonders anhand des polynomialen<br />
Kurvenverlaufs deutlich, der die <strong>in</strong> der Abbildung 7.6 enthaltenen Mittelwertsangaben ergänzt 6 .<br />
Abbildung 7.6:<br />
Körperliche Funktionsfähigkeit – Summenscore der Subskala KÖFÜ des SF-36-Fragebogens,<br />
differenziert nach Alter <strong>und</strong> Geschlecht (Mittelwertsangaben)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Männer<br />
10<br />
0<br />
Frauen<br />
40 45 50 55 60 65<br />
Alter<br />
70 75 80 85<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 3.084, gewichtet<br />
An diesen geschlechtsdifferenzierten Verläufen bestätigt sich der, auch aus anderen Studien<br />
bekannte Bef<strong>und</strong>, dass Frauen im höheren Alter stärker von Beh<strong>in</strong>derungen betroffen s<strong>in</strong>d als<br />
Männer. Zugleich wird deutlich, dass der aufgezeigte Bef<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er unter Frauen größeren<br />
Verbreitung von Gelenk- <strong>und</strong> Knochenerkrankungen sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schlechteren Mobilität wiederf<strong>in</strong>den<br />
lässt. E<strong>in</strong> wesentlicher Gr<strong>und</strong> für den Geschlechtsunterschied liegt <strong>in</strong> der höheren<br />
Frühsterblichkeit von Männern. Während Männer mit schlechtem Ges<strong>und</strong>heitszustand früher<br />
sterben, überleben Frauen mit schlechter Ges<strong>und</strong>heit häufiger bis <strong>in</strong>s hohe Alter <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>folgedessen<br />
häufiger bee<strong>in</strong>trächtigt. Der Gr<strong>und</strong> für diese Geschlechtsunterschiede ist bis heute im<br />
Wesentlichen noch unbekannt (Baltes, 1997).<br />
Die mit dem Alter zunehmende Bee<strong>in</strong>trächtigung körperlicher Funktionsfähigkeit führt zwar zu<br />
Beh<strong>in</strong>derungen <strong>in</strong> der Alltagsgestaltung, doch nicht unbed<strong>in</strong>gt tritt e<strong>in</strong> regelmäßiger Hilfe- oder<br />
Pflegebedarf e<strong>in</strong>. Bis <strong>in</strong>s höhere Alter von 70- bis 85-Jahren gibt nur e<strong>in</strong> eher kle<strong>in</strong>er Teil von<br />
6 Zur Ergänzung: Der l<strong>in</strong>eare Zusammenhang zwischen körperlicher Funktionsfähigkeit <strong>und</strong> Alter liegt bei r=-.39 für<br />
Männer <strong>und</strong> r=-.52 bei Frauen.
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Personen an, so stark ges<strong>und</strong>heitlich e<strong>in</strong>geschränkt zu se<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong>e regelmäßige Hilfe, Unterstützung<br />
oder Pflege benötigt wird. Dies veranschaulicht nachfolgende Abbildung 7.7. In der<br />
jüngsten Altersgruppe der 40- bis 54-Jährigen geben lediglich 17 Personen (1,6%) an, Hilfe<br />
oder Pflege zu benötigen. In der mittleren Altersgruppe der 55- bis 69-Jährigen s<strong>in</strong>d mit 4 Prozent<br />
mehr als doppelt so viele Personen von Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit betroffen wie <strong>in</strong> der<br />
jüngsten Altersgruppe. Diese Zahl verdreifacht sich auf 13 Prozent <strong>in</strong> der Gruppe der 70- bis<br />
85-Jährigen 7 . In dieser Altersgruppe f<strong>in</strong>den sich leichte Geschlechtsunterschiede, d.h. Frauen<br />
geben e<strong>in</strong> höheres Maß an Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit an als Männer. Ansonsten bestehen<br />
nur Unterschiede zwischen den Altersgruppen (p
308<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen gibt nur etwa jede achte Person an, Hilfe, Pflege oder andere<br />
Unterstützung zu benötigen.<br />
7.4.3 Subjektive Ges<strong>und</strong>heit<br />
Im Gegensatz zu klassischen, mediz<strong>in</strong>ischen Ges<strong>und</strong>heitsmodellen ist <strong>in</strong> neueren Modellen die<br />
subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung e<strong>in</strong> zentrales Kriterium für Ges<strong>und</strong>heit. Warum subjektive<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> Abgrenzung zu körperlicher Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>e spezifische, eigenständige Bedeutung<br />
hat, soll im Folgenden e<strong>in</strong>leitend näher erläutert werden.<br />
In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass zwischen dem mediz<strong>in</strong>isch messbaren<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er subjektiven Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung lediglich e<strong>in</strong> moderater<br />
Zusammenhang besteht. Dies verdeutlicht, dass die subjektive Wahrnehmung von Ges<strong>und</strong>heit<br />
nicht e<strong>in</strong>fach die mediz<strong>in</strong>isch messbare Ges<strong>und</strong>heit widerspiegelt, sondern Ausdruck verschiedener<br />
Personen- <strong>und</strong> Umweltmerkmale ist. Hierzu zählen Lebenszufriedenheit, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Kontrollüberzeugungen <strong>und</strong> Bewältigungskompetenzen sowie soziale Unterstützung <strong>und</strong> soziale<br />
Vergleichsprozesse.<br />
Die Bedeutung subjektiver Ges<strong>und</strong>heit ist trotz des verhältnismäßig ger<strong>in</strong>gen Zusammenhangs<br />
mit objektiver Ges<strong>und</strong>heit nicht zu unterschätzen. Subjektive Ges<strong>und</strong>heit ist nicht nur e<strong>in</strong> zentraler<br />
Indikator für subjektive Lebensqualität (Filipp, 2002), sondern wird besonders im höheren<br />
Lebensalter als besonders bedeutsame Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>formation angesehen (Ebrahim, 1996).<br />
Gr<strong>und</strong> hierfür ist, dass sich die globale subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung im Vergleich zu<br />
mediz<strong>in</strong>ischen Ges<strong>und</strong>heitsmaßen als sensitiverer Indikator für das Mortalitätsrisiko erwiesen<br />
hat. Dieser Bef<strong>und</strong> konnte <strong>in</strong> verschiedenen Längsschnittstudien gezeigt werden <strong>und</strong> zwar auch<br />
dann, wenn objektiver Ges<strong>und</strong>heitsstatus, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten sowie Alter, Geschlecht <strong>und</strong><br />
andere soziodemografische Variablen kontrolliert wurden (Idler & Kasl, 1991; Menec, Chipperfield,<br />
& Raymond, 1999; Mossey & Shapiro, 1982).<br />
Hierfür gibt es mehrere mögliche Erklärungen: (1) Es ist denkbar, dass subtile biologische <strong>und</strong><br />
physiologische Veränderungen mittels objektiver, mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsmessungen nicht<br />
ausreichend erfasst werden, während diese Veränderungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er subjektiven E<strong>in</strong>schätzung<br />
enthalten s<strong>in</strong>d. Zudem können bei Selbste<strong>in</strong>schätzungen auch <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Ges<strong>und</strong>heitsgewohnheiten<br />
<strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitsverlauf über die Lebensspanne e<strong>in</strong>bezogen werden, das heißt, Personen<br />
berücksichtigen möglicherweise ihr biografisches Wissen bezüglich zurückliegender Erkrankungen<br />
sowie verschiedener Aspekte ihres Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens (Mossey & Shapiro,<br />
1982). Diese These, die auf die Grenzen mediz<strong>in</strong>ischer Messungen h<strong>in</strong>weist, wird bestärkt<br />
durch die Feststellung, dass gerade im höheren Alter Erkrankungen <strong>und</strong> Risikofaktoren wie<br />
Diabetes <strong>und</strong> Bluthochdruck häufig mediz<strong>in</strong>isch <strong>und</strong>iagnostiziert bleiben (Ebrahim, 1996).<br />
(2) E<strong>in</strong>e weitere Erklärung ist, dass die subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung den zeitlich nachfolgenden<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand bee<strong>in</strong>flusst <strong>und</strong> auf diese <strong>in</strong>direkte Weise e<strong>in</strong>e Mortalitätsvorhersage<br />
leisten kann. Diese Annahme wurde empirisch untersucht, ergab bisher jedoch heterogene<br />
Bef<strong>und</strong>e: Es konnte gezeigt werden, dass subjektive Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zeitraum von e<strong>in</strong> bis<br />
sechs Jahren die Veränderung von funktionellen Fähigkeiten vorhersagen kann (Idler & Kasl,<br />
1995), Zusammenhänge zu Morbidität wurden bisher jedoch nicht festgestellt (Menec et al.,
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
1999). (3) Schließlich ist es auch möglich, dass die subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung e<strong>in</strong>en<br />
direkten Vorhersagewert für die Mortalität hat. Im Falle positiver E<strong>in</strong>schätzungen könnten die<br />
optimistischen Gefühle als solche bereits e<strong>in</strong>e protektive Wirkung haben, während im Fall von<br />
negativen E<strong>in</strong>schätzungen möglicherweise Depressionen oder anderen emotionalen Problemen<br />
e<strong>in</strong>e Bedeutung für Mortalität zukommt.<br />
Wenngleich die verschiedenen Wirkmechanismen subjektiver Ges<strong>und</strong>heit derzeit noch diskutiert<br />
werden, weisen die verschiedenen Bef<strong>und</strong>e konsistent auf die Bedeutung h<strong>in</strong>, gerade bei<br />
älteren Personen die subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung mit zu berücksichtigen, da sie e<strong>in</strong>e<br />
wichtige ergänzende Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>formation darstellt.<br />
Der nachfolgenden Abbildung 7.8 kann für die Daten des Alterssurveys entnommen werden,<br />
wie viele Personen subjektiv ihre Ges<strong>und</strong>heit als gut bis sehr gut e<strong>in</strong>schätzen.<br />
Abbildung 7.8:<br />
Anzahl von Personen mit subjektiv guter bis sehr guter Ges<strong>und</strong>heit, differenziert nach Altersgruppe,<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Region (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Frauen<br />
Ost<br />
72,5<br />
West<br />
68,6<br />
57,2<br />
50,3<br />
38,5<br />
30,1<br />
80 70 60 50 40 30 20 10 0<br />
70-85 J.<br />
55-69 J.<br />
40-54 J.<br />
32,7<br />
38,6<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 3.080<br />
54,7<br />
55,4<br />
Männer<br />
65,6<br />
Ost<br />
West<br />
72,6<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
An dieser nach Altersgruppen, Geschlecht <strong>und</strong> Region differenzierten Darstellung wird deutlich,<br />
dass die Zahl jener, die ihre subjektive Ges<strong>und</strong>heit als (sehr) gut e<strong>in</strong>schätzen, von der jüngsten<br />
zur ältesten Altersgruppe deutlich abnimmt (p
310<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Abbildung 7.9:<br />
Subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung differenziert nach Alter (Mittelwertsangaben <strong>und</strong> Variationskoeffizienten,<br />
Skala: 1=sehr schlecht bis 5=sehr gut)<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
•<br />
• • • • •<br />
• •<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
• • •<br />
•<br />
• •<br />
• •<br />
• •<br />
• •<br />
• •<br />
•<br />
•<br />
• • • • •<br />
•<br />
• • •<br />
• • • •<br />
• •<br />
•<br />
•<br />
1,0<br />
40 45 50 55 60 65<br />
Alter<br />
70 75 80 85<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 3.080, gewichtet<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der hohen Bedeutung subjektiver Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung für die Lebensqualität,<br />
aber auch für die Mortalitätsprognose, weisen die vorliegenden Daten besonders <strong>in</strong><br />
der höchsten der untersuchten Alterungsgruppen auf Risiken h<strong>in</strong>. In deutlicherem Maße, als sich<br />
dies anhand der Betrachtung von Beschwerden zeigte, ist zu erkennen, dass sich e<strong>in</strong>e verschlechternde<br />
körperliche Ges<strong>und</strong>heit zugleich auf e<strong>in</strong>e schlechtere subjektive Ges<strong>und</strong>heit auswirkt.<br />
In welchem Maß dies mit e<strong>in</strong>er Abnahme des Wohlbef<strong>in</strong>dens e<strong>in</strong>hergeht, lässt sich anhand<br />
der Darstellungen des Kapitels 8 nachvollziehen. Vertiefende Untersuchungen geben nähere<br />
Aufschlüsse darüber, <strong>in</strong> welchem Ausmaß soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren sowie das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten<br />
zur subjektiven Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung beitragen (Kapitel 8).<br />
7.5 Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Anhand der vorangegangenen Darstellungen zum Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
wurde deutlich, dass über diese Lebensphase h<strong>in</strong>weg körperliche Erkrankungen <strong>und</strong> funktionelle<br />
E<strong>in</strong>schränkungen zunehmen. Dabei zeichnen sich Erkrankungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
gegenüber solchen der ersten Lebenshälfte durch die Besonderheit aus, dass sie oftmals<br />
chronisch <strong>und</strong> irreversibel s<strong>in</strong>d, mit steigendem Alter <strong>in</strong> zunehmendem Maße mit Multimorbidität<br />
verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> zu dauerhaften Funktionse<strong>in</strong>schränkungen führen. Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
ist e<strong>in</strong>e angemessene Ges<strong>und</strong>heitsversorgung e<strong>in</strong>e komplexe Aufgabe von hoher Wichtigkeit.<br />
Zur Ges<strong>und</strong>heitsversorgung zählt dabei sowohl die mediz<strong>in</strong>ische Behandlung, wie sie<br />
über ambulante Arztpraxen <strong>und</strong> stationäre E<strong>in</strong>richtungen erfolgt, als auch die Behandlung durch<br />
weitere Formen von Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen. Ziel dieser Versorgung kann gerade bei chronischen<br />
Erkrankungen nicht immer e<strong>in</strong>e Heilung „ad <strong>in</strong>tegrum“ se<strong>in</strong> (Sachverständigenrat,<br />
2001a). Anzustreben ist jedoch, e<strong>in</strong>en unter Berücksichtigung der Erkrankungen möglichst op-
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
timalen Ges<strong>und</strong>heitszustand herzustellen (B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong><br />
Jugend, 2002). Um dieses Ziel zu erreichen, s<strong>in</strong>d neben mediz<strong>in</strong>isch-kurativen Behandlungen<br />
auch ges<strong>und</strong>heitsfördernde, präventive <strong>und</strong> rehabilitative Maßnahmen notwendig. In welchem<br />
Maß diese verschiedenen Formen von Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen tatsächlich genutzt werden,<br />
wird anhand nachfolgender Ergebnisse deutlich. Gr<strong>und</strong>lage bilden erneut Selbstaussagen 40- bis<br />
85-jähriger Personen aus der Replikationsstichprobe des Alterssurveys.<br />
7.5.1 Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen<br />
In der zweiten Lebenshälfte nehmen die Ges<strong>und</strong>heitsbee<strong>in</strong>trächtigungen zu. Zugleich wird aus<br />
den Angaben zur Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen deutlich, dass<br />
der überwiegende Teil der Älteren m<strong>in</strong>destens jährlich mediz<strong>in</strong>ische Versorgung erhält. Mit<br />
97,6 Prozent gibt der größte Teil der Befragten an, <strong>in</strong>nerhalb der vergangenen 12 Monate vor<br />
Befragung (m<strong>in</strong>destens) e<strong>in</strong>e Arztpraxis aufgesucht zu haben. Ohne E<strong>in</strong>berechnung der Zahnarztbesuche<br />
verbleiben 95,4 Prozent der Befragten, die e<strong>in</strong>en Arztbesuch angeben. Für die Altersspanne<br />
der 18- bis 79-Jährigen liegt hierzu e<strong>in</strong>e vergleichbare Zahl aus dem B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitssurvey<br />
vor. Demnach waren r<strong>und</strong> 90 Prozent der 18- bis 79-Jährigen Selbstaussagen zufolge<br />
<strong>in</strong> den letzten 12 Monaten vor der Befragung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Arztpraxis (Bergmann & Kamtsiuris,<br />
1999). Aus e<strong>in</strong>em Vergleich dieser Angaben lässt sich ableiten, dass der Anteil der Personen<br />
mit Arztbesuchen bei älterwerdenden <strong>und</strong> alten Personen deutlich höher liegt als bei jüngeren<br />
Personen. Innerhalb der zweiten Lebenshälfte steigt der Anteil von 93,3 Prozent (40- bis 54-<br />
Jährige) auf 95,8 (55- bis 69-Jährige) <strong>und</strong> schließlich <strong>in</strong> der höchsten Altersgruppe (70- bis 85-<br />
Jährige) auf 97,1 Prozent an.<br />
Neben dem Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es m<strong>in</strong>destens jährlichen Arztkontaktes liefert auch die Häufigkeit<br />
von Arztbesuchen wesentliche Informationen über die Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer<br />
Hilfe. E<strong>in</strong>e Betrachtung ausgewählter Allgeme<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Fachärzte macht nachfolgend deutlich,<br />
dass es mit zunehmendem Alter nicht gr<strong>und</strong>sätzlich zu e<strong>in</strong>er häufigeren Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer<br />
Leistungen kommt. Über die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg bleiben die Nutzungshäufigkeiten<br />
für e<strong>in</strong>zelne Facharztgruppen teilweise auch konstant oder nehmen sogar ab. Dabei verlaufen<br />
die <strong>Entwicklung</strong>en für Männer <strong>und</strong> Frauen zum Teil unterschiedlich. Dies ist nachfolgender<br />
Tabelle 7.2 zu entnehmen.<br />
Anhand der Angaben der nachfolgenden Tabelle 7.2 wird deutlich, dass es für Männer wie<br />
Frauen zu e<strong>in</strong>er über die Altersgruppen ansteigenden Nutzungshäufigkeit von<br />
allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>ischen, augenärztlichen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternistischen Arztpraxen kommt (p
312<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Tabelle 7.2:<br />
Häufigkeit der Arztbesuche <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten vor Befragung, differenziert<br />
nach Altersgruppe <strong>und</strong> Geschlecht (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Frauen Fachbereich Männer<br />
nie 1mal 2-6mal öfter nie 1mal 2-6mal öfter<br />
Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong><br />
15,7 24,8 48,4 11,1 40-54 Jahre 19,5 23,1 49,8 7,7<br />
12,7 15,7 52,3 19,3 55-69 Jahre 14,2 16,5 45,3 23,9<br />
6,6 7,3 49,9 36,1 70-85 Jahre 10,0 7,8 48,0 34,2<br />
Zahnmediz<strong>in</strong><br />
10,7 35,2 50,4 3,7 40-54 Jahre 17,6 40,2 40,9 1,3<br />
12,5 38,5 45,2 3,8 55-69 Jahre 20,3 35,4 41,3 3,0<br />
33,5 41,4 24,5 0,6 70-85 Jahre 28,0 40,8 30,3 0,9<br />
Augenheilk<strong>und</strong>e<br />
57,5 35,0 6,3 1,2 40-54 Jahre 64,8 26,9 7,9 0,4<br />
44,1 42,3 12,1 1,4 55-69 Jahre 49,6 37,5 12,0 0,9<br />
34,0 33,1 31,6 1,2 70-85 Jahre 37,6 34,6 25,6 2,2<br />
Hals-Nasen-Ohren<br />
80,4 12,3 6,9 0,4 40-54 Jahre 83,7 11,6 4,3 0,5<br />
79,4 13,5 6,5 0,6 55-69 Jahre 76,4 15,4 6,9 1,3<br />
76,5 13,7 8,9 0,9 70-85 Jahre 72,9 19,5 7,3 0,3<br />
Orthopädie<br />
73,8 10,4 11,2 4,6 40-54 Jahre 75,1 12,6 10,1 2,1<br />
62,7 14,0 18,9 4,4 55-69 Jahre 70,0 14,5 12,2 3,3<br />
65,5 11,9 18,3 4,3 70-85 Jahre 71,8 12,1 13,2 2,9<br />
Innere Mediz<strong>in</strong><br />
71,0 18,4 8,0 2,6 40-54 Jahre 75,4 13,9 9,1 1,6<br />
61,8 16,3 18,0 3,9 55-69 Jahre 65,4 15,6 14,2 4,8<br />
60,9 13,8 18,0 7,3 70-85 Jahre 53,8 16,2 19,7 10,3<br />
Gynäkologie – Urologie<br />
13,8 50,4 34,2 1,7 40-54 Jahre 89,3 7,8 2,5 0,5<br />
25,7 48,7 25,0 0,6 55-69 Jahre 71,6 16,0 11,4 1,1<br />
57,5 30,7 11,2 0,6 70-85 Jahre 62,5 18,3 18,1 1,0<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 2.706-2.754, gewichtet<br />
Schließlich ist für Männer auch e<strong>in</strong>e mit steigendem Alter erhöhte Inanspruchnahme von<br />
urologischen Arztpraxen festzustellen, während bei Frauen der Besuch von gynäkologischen<br />
Arztpraxen deutlich abnimmt. H<strong>in</strong>gegen kommt es für beide Geschlechter zu e<strong>in</strong>er altersabhängigen<br />
Abnahme bezüglich der zahnärztlichen Versorgung. Insbesondere Personen der höchsten<br />
Altersgruppe geben deutlich seltener an, während der letzten 12 Monate e<strong>in</strong>e zahnmediz<strong>in</strong>ische<br />
Arztpraxis aufgesucht zu haben, als Jüngere. Dieser Bef<strong>und</strong> weist auf deutliche Defizite <strong>in</strong> der<br />
zahnärztlichen Versorgung alter Menschen h<strong>in</strong> <strong>und</strong> bestätigt damit Erkenntnisse, die hierzu im<br />
Rahmen der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie gewonnen werden konnten (Nitschke & Hopfenmüller, 1996).<br />
E<strong>in</strong>e Erklärung für die ger<strong>in</strong>gere Inanspruchnahme von Zahnärzten liegt <strong>in</strong> der mit höherem<br />
Alter häufiger bestehenden Zahnlosigkeit. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d regelmäßige Untersuchungen auch
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
bei Personen mit Zahnprothesen erforderlich. Zudem weisen Nitschke <strong>und</strong> Hopfenmüller darauf<br />
h<strong>in</strong>, dass unbezahnte Personen halbjährliche Kontrolluntersuchungen aufsuchen sollten, um<br />
eventuelle M<strong>und</strong>erkrankungen wie Pilzerkrankungen oder Tumore frühzeitig zu erkennen<br />
(Nitschke & Hopfenmüller, 1996).<br />
Abbildung 7.10:<br />
Anzahl der Personen, die m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Arztpraxis aufgesucht haben. Darstellung differenziert nach Altersgruppe <strong>und</strong> Geschlecht<br />
(Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Frauen<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre<br />
P<br />
Z<br />
G<br />
I<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Männer<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre<br />
Praktischer Arzt (P) Zahnarzt (Z) Internist (I) Gynäkologe (G) / Urologe (U)<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 3.005-3.076, gewichtet<br />
Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen <strong>und</strong> Geschlechtern s<strong>in</strong>d für vier der <strong>in</strong>sgesamt<br />
acht <strong>in</strong> der Tabelle enthaltenen Fachärzte anhand von Abbildung 7.10 veranschaulicht. Die Abbildung<br />
enthält e<strong>in</strong>e gegenüber der Tabelle zusammengefasste Information. In diesem Fall ist<br />
die Anzahl aller Personen dargestellt, welche m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal pro Jahr die entsprechenden<br />
Arztpraxen aufgesucht haben. Die Auswahl dieser vier Facharztbereiche sowie die Darstellungsform<br />
erfolgte hierbei analog zum B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitssurvey (Bergmann & Kamtsiuris,<br />
1999), um Vergleiche zu ermöglichen. Dabei zeigen sich <strong>in</strong> beiden Surveys sehr ähnliche, altersgruppenabhängige<br />
Verläufe <strong>in</strong> der Nutzung der Ärzte, vergleicht man <strong>in</strong> beiden Fällen nur<br />
die Angaben der über 40-Jährigen. Allerd<strong>in</strong>gs liegt der prozentuale Anteil der Personen, die<br />
angeben, die entsprechende Arztpraxis aufgesucht zu haben, im Alterssurvey <strong>in</strong>sgesamt etwas<br />
höher als im B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitssurvey.<br />
Die vier ausgewählten Facharztgruppen <strong>in</strong> Abbildung 7.10 machen deutlich, was auch h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der anderen Fachärzte (Tabelle 7.2) gef<strong>und</strong>en wurde: Bis auf deutliche Unterschiede <strong>in</strong> der<br />
Nutzungshäufigkeit von gynäkologischen <strong>und</strong> urologischen Arztpraxen gibt es nur ger<strong>in</strong>ge Geschlechtsunterschiede.<br />
Diese zeigen sich für Zahnärzte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er etwas ger<strong>in</strong>geren Nutzung durch<br />
Frauen besonders der höchsten Altersgruppe, für Augenärzte mit e<strong>in</strong>er etwas ger<strong>in</strong>geren Nutzung<br />
durch Männer (p
314<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Ärzte zeigen. Entsprechende Analysen ergaben, dass Ostdeutsche häufiger als Westdeutsche<br />
angeben, <strong>in</strong> den vergangenen 12 Monaten praktische Ärzte, Zahnärzte sowie Urologen aufgesucht<br />
zu haben (p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
In der ältesten Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen h<strong>in</strong>gegen sche<strong>in</strong>en – stellt man die häufige<br />
Nicht-Inanspruchnahme von 30,5 Prozent <strong>und</strong> die vergleichsweise seltene Angabe e<strong>in</strong>er Behandlungsvermeidung<br />
von durchschnittlich 5,4 Prozent gegenüber – Ängste <strong>und</strong> Befürchtungen<br />
möglicherweise weniger e<strong>in</strong>e Ursache für die ger<strong>in</strong>gen Zahnarztbesuche zu se<strong>in</strong>. Vielmehr entsteht<br />
der E<strong>in</strong>druck, dass bei e<strong>in</strong>er beträchtlichen Zahl Älterer die E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> die Notwendigkeit<br />
fehlt, regelmäßig e<strong>in</strong>en Zahnarzt aufzusuchen. Zu e<strong>in</strong>em entsprechenden Bef<strong>und</strong> kommt auch<br />
die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie. In dieser wurde von e<strong>in</strong>em großen Teil der 70-Jährigen <strong>und</strong> älteren<br />
Befragten als e<strong>in</strong>e wesentliche Erklärung für e<strong>in</strong>en längeren Zeitabstand seit dem letzten Zahnarztbesuch<br />
angegeben, dass es ke<strong>in</strong>en Gr<strong>und</strong> gegeben hätte, e<strong>in</strong>en Zahnarzt aufzusuchen<br />
(Nitschke & Hopfenmüller, 1996). Die Daten des Alterssurveys machen deutlich, dass r<strong>und</strong> 10<br />
Jahre nach den Erhebungen der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie erneut zu f<strong>in</strong>den ist, dass Ältere offensichtlich<br />
h<strong>in</strong>sichtlich zahnmediz<strong>in</strong>ischer Behandlungen unterversorgt s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> potentielle Präventionspotenziale<br />
ungenutzt bleiben. Gründe hierfür s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>stellungen der Älteren, möglicherweise<br />
aber zudem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er zu ger<strong>in</strong>gen Informationsvermittlung durch die Zahnmediz<strong>in</strong>er<br />
selbst zu suchen. Deren Aufgabe <strong>und</strong> auch die Aufgabe von Hausarztpraxen könnte dar<strong>in</strong> liegen,<br />
die Patienten selbst <strong>und</strong> gegebenenfalls auch die Angehörigen (<strong>in</strong>sbesondere bei kognitiv<br />
bee<strong>in</strong>trächtigten Älteren) stärker auf die Notwendigkeit regelmäßiger Zahnarztbesuche, auch bei<br />
unbezahnten Menschen, h<strong>in</strong>zuweisen.<br />
Im Vergleich zu Fachärzten kommt Hausärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Hausärzten e<strong>in</strong>e wichtige Zusatzaufgabe<br />
<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er „Lotsenfunktion“ zu. Seit der E<strong>in</strong>führung der aktuellen Ges<strong>und</strong>heitsreform zu<br />
Beg<strong>in</strong>n des Jahres 2004 erfolgt deshalb e<strong>in</strong>e gezielte Stärkung von Hausarztmodellen. Die Lotsenfunktion<br />
von Hausarztpraxen be<strong>in</strong>haltet, Patienten über die Angebote des Ges<strong>und</strong>heitswesens<br />
zu beraten, sie zu behandeln <strong>und</strong> Leistungen von Fachärzten zu koord<strong>in</strong>ieren. Diese Aufgaben<br />
s<strong>in</strong>d besonders <strong>in</strong> der Versorgung älterer <strong>und</strong> alter Menschen von hoher Bedeutung.<br />
Gr<strong>und</strong> hierfür ist die mit höherem Alter zunehmende Zahl von Personen, die von multiplen,<br />
chronischen <strong>und</strong> oftmals über Jahre bis Jahrzehnte bestehenden Erkrankungen betroffen s<strong>in</strong>d.<br />
Hausärztliche Versorgung ist im Gegensatz zu fachärztlicher Versorgung zumeist durch e<strong>in</strong>e<br />
vergleichsweise hohe Behandlungskont<strong>in</strong>uität gekennzeichnet. Diese ist wichtig, um die vielfach<br />
komplexen <strong>und</strong> langjährigen Krankengeschichten Älterer erfassen <strong>und</strong> begleiten zu können.<br />
E<strong>in</strong>e hohe Behandlungskont<strong>in</strong>uität unterstützt zugleich den Aufbau e<strong>in</strong>es Vertrauensverhältnisses<br />
<strong>in</strong> der Arzt-Patienten-Beziehung <strong>und</strong> eröffnet oftmals E<strong>in</strong>sichten <strong>in</strong> die sozialen<br />
Strukturen sowie psychischen Ressourcen <strong>und</strong> Risiken von Patienten. Durch dieses umfangreiche<br />
Wissen haben Hausärzte die Möglichkeit, die ges<strong>und</strong>heitliche Gesamtsituation zu überblicken<br />
<strong>und</strong> diese bei der Beratung <strong>und</strong> Behandlung ihrer Patienten angemessen zu berücksichtigen.<br />
Dies ist gerade bei Älteren von besonderer Bedeutung, da es <strong>in</strong> zunehmendem Maße nicht<br />
nur um die Kuration von Akuterkrankungen geht, sondern um die kont<strong>in</strong>uierliche Behandlung<br />
<strong>und</strong> Begleitung nicht-heilbarer körperlicher wie kognitiver Erkrankungen sowie gegebenenfalls<br />
auch um die Ause<strong>in</strong>andersetzung mit pflegerischer Versorgung, Sterben <strong>und</strong> Tod. Vor diesem<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> ist e<strong>in</strong> wichtiger Bef<strong>und</strong>, dass bereits im Jahr 2002, also noch vor E<strong>in</strong>führung der<br />
aktuellen Ges<strong>und</strong>heitsreform, mit 93,6 Prozent e<strong>in</strong> Großteil der älterwerdenden <strong>und</strong> alten Menschen<br />
angeben e<strong>in</strong>en Hausarzt zu haben, den sie im Regelfall bei ges<strong>und</strong>heitlichen Problemen<br />
zuerst aufsuchen. Dabei steigt der Anteil von 90,6 Prozent <strong>in</strong> der Altersgruppe der 40- bis 54-<br />
Jährigen auf 95,7 Prozent <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen an. Im Vergleich<br />
315
316<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
zu Ergebnissen der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie, <strong>in</strong> der 93 Prozent aller 70-Jährigen <strong>und</strong> Älteren über<br />
e<strong>in</strong>e regelmäßige hausärztliche Betreuung berichteten (L<strong>in</strong>den, Gilberg, Horgas, & Ste<strong>in</strong>hagen-<br />
Thiessen, 1996), liegt demnach den Daten des Alterssurveys zufolge die hausärztliche Versorgung<br />
im b<strong>und</strong>esweiten Durchschnitt sogar eher etwas höher oder ist möglicherweise seit Anfang<br />
der 90er Jahre leicht angestiegen. Nähere Angaben zur hausärztlichen Versorgung können nachfolgender<br />
Abbildung 7.12 entnommen werden. Diese zeigt e<strong>in</strong>e nach Altersgruppen, Geschlechtern<br />
<strong>und</strong> Regionen (Ost/West) differenzierte Darstellung.<br />
Abbildung 7.12:<br />
Anzahl der Personen <strong>in</strong> Prozent, die angeben, dass sie e<strong>in</strong>e Hausärzt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>en Hausarzt<br />
haben, welche/n sie im Regelfall zuerst bei ges<strong>und</strong>heitlichen Problemen aufsuchen. Darstellung<br />
differenziert nach Altersgruppe, Geschlecht <strong>und</strong> Region<br />
Frauen<br />
93,9<br />
96,9<br />
96,9<br />
94,1<br />
91,3<br />
90,4<br />
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0<br />
Ost<br />
West<br />
70-85 J.<br />
55-69 J.<br />
40-54 J.<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 3.080<br />
93,6<br />
91,4<br />
89,9<br />
93,8<br />
96,4<br />
98,1<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Ost<br />
West<br />
Männer<br />
Anhand von Gruppenvergleichen wird deutlich, dass Männer wie Frauen gleichermaßen häufig<br />
angeben, e<strong>in</strong>e Hausärzt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>en Hausarzt zu haben. Leichte regionale Unterschiede s<strong>in</strong>d an<br />
e<strong>in</strong>er im Vergleich zu Westdeutschen etwas höheren Hausarztrate ostdeutscher 55- bis 69-<br />
Jähriger <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>geren Hausarztrate ostdeutscher 70- bis 85-Jähriger zu erkennen<br />
(p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
7.5.2 Inanspruchnahme weiterer Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen<br />
Zu e<strong>in</strong>er ganzheitlichen Versorgung von Älteren, <strong>in</strong>sbesondere von jenen mit dauerhaften Erkrankungen<br />
<strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen, zählen neben ärztlichen Behandlungen weitere Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen.<br />
Diese umfassen neben dem Ziel e<strong>in</strong>er möglichst weitgehenden Wiederherstellung<br />
von Ges<strong>und</strong>heit unter anderem auch präventive Maßnahmen, die L<strong>in</strong>derung von<br />
Beschwerden <strong>und</strong> die mediz<strong>in</strong>isch-pflegerische Versorgung. E<strong>in</strong> Teil dieser Dienstleistungen<br />
fällt unter die Heilmittelverordnung der Krankenkassen, e<strong>in</strong> anderer Teil jedoch wird von den<br />
Betroffenen selbst f<strong>in</strong>anziert. Die nachfolgenden Darstellungen machen für <strong>in</strong>sgesamt 15 solcher<br />
Dienstleistungen deutlich, <strong>in</strong> welchem Maß diese von Personen im Alter zwischen 40- <strong>und</strong><br />
85-Jahren genutzt werden.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der 15 ausgewählten Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen handelt es sich bei sechs Dienstleistungen<br />
um Heilbehandlungen im weiteren S<strong>in</strong>ne: hierzu zählen passive Formen der Physiotherapie,<br />
wie Massagen, Fango, Bäder sowie aktivierende Formen der Physiotherapie im S<strong>in</strong>ne<br />
von Krankengymnastik. Als weitere physische Heilbehandlungen wurde die Rehabilitation,<br />
heilpraktische Behandlung <strong>und</strong> Fußpflege berücksichtigt (wobei letztere auch aus re<strong>in</strong> kosmetischen<br />
Gründen genutzt werden kann). E<strong>in</strong>e zweite Gruppe von Heilbehandlungen bezieht sich<br />
stärker auf psychische oder hirnorganische Erkrankungen. In diesem Zusammenhang wurde die<br />
Inanspruchnahme von psychotherapeutischen <strong>und</strong> ergotherapeutischen Behandlungen, (Sozial-)<br />
Beratungsstellen, logopädischen Behandlungen <strong>und</strong> Gedächtnissprechst<strong>und</strong>en erhoben. E<strong>in</strong>e<br />
dritte Gruppe von Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen erfasst schließlich die über Heilbehandlungen<br />
h<strong>in</strong>ausgehende Versorgung. Hierzu zählt die Nutzung von Haushaltshilfe, mobilem Mittagstisch,<br />
häuslicher Krankenpflege, aber auch die Inanspruchnahme von Transportdiensten, Notrufmeldungen<br />
<strong>und</strong> schließlich Apotheken. Für die genannten Dienstleistungen wurden die Personen<br />
gefragt, wie häufig sie diese <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten für sich selbst <strong>in</strong> Anspruch genommen<br />
haben. Der nachfolgenden Tabelle 7.3 kann entnommen werden, wie viele Personen<br />
diese Dienstleistungen zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>mal im Laufe der 12 Monate vor der Befragung (im Jahr<br />
2002) <strong>in</strong> Anspruch genommen haben. Die Reihenfolge der Dienstleistungen entspricht der Häufigkeit<br />
der genannten Inanspruchnahme.<br />
317
318<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Tabelle 7.3:<br />
M<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>malige Inanspruchnahme ausgewählter Dienstleistungen während der 12 Monate<br />
vor dem Befragungszeitpunkt, 40- bis 85-Jährige; Gesamt <strong>und</strong> Ost-West-differenziert<br />
(Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Inanspruchnahme m<strong>in</strong>d. e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong><br />
12 Monaten vor Befragung<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistung Gesamt West Ost<br />
Apotheke 88,5 89,1 86,4<br />
Massagen, Fango, Bäder 20,9 20,0 24,5<br />
Fußpflege 18,8 18,5 20,2<br />
Krankengymnastik 14,4 15,3 11,0<br />
Haushaltshilfe 9,3 10,6 4,0<br />
Heilpraktikerbehandlung 5,8 6,3 3,7<br />
Rehabilitation 5,5 5,5 5,3<br />
Psychotherapeut 4,6 3,9 7,5<br />
Notrufdienst, Rettungsdienst 2,7 2,4 4,2<br />
Transportdienste 2,5 2,5 2,7<br />
Beratungsstelle, Sozialberatung 2,3 2,3 2,3<br />
Häusliche Krankenpflege 1,5 1,6 1,1<br />
Essen auf Rädern 1,1 0,9 1,6<br />
Arbeits-, Beschäftigungstherapie 0,6 0,5 0,7<br />
Logopädie, Sprachschulung 0,3 0,2 0,6<br />
Gedächtnissprechst<strong>und</strong>e 0,2 0,2 0,4<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 2.731-3.070, gewichtet<br />
Anhand von Tabelle 7.3 wird deutlich, dass e<strong>in</strong> Großteil der Befragten m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal im<br />
Jahr wegen e<strong>in</strong>es eigenen Medikamentenbedarfs e<strong>in</strong>e Apotheke aufsucht. Jede fünfte Person<br />
gibt an, physiotherapeutische Behandlungen <strong>in</strong> Form von Massagen, Fango oder Bäder erhalten<br />
zu haben. E<strong>in</strong>e häufigere Nutzung bezieht sich außerdem auf Fußpflege <strong>und</strong> Krankengymnastik.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Nutzung von physiotherapeutischen Behandlungen zeigen sich Ost-West-<br />
Unterschiede: während Ostdeutsche häufiger über passive Heilbehandlungen (Massagen, Fango,<br />
Bäder) berichten, geben Westdeutsche häufiger an, aktivierende Heilbehandlungen (Krankengymnastik)<br />
erhalten zu haben (p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Tabelle 7.4:<br />
Häufigkeit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten<br />
vor Befragung, differenziert nach Altersgruppe <strong>und</strong> Geschlecht (gewichtet: Ost/West),<br />
Angaben <strong>in</strong> Prozent<br />
Frauen Männer<br />
nie 1mal 2-6mal öfter nie 1mal 2-6mal öfter<br />
Apotheke<br />
7,8 6,9 61,5 23,8 40-54 Jahre 21,8 11,4 53,5 13,3<br />
8,0 4,8 55,3 32,0 55-69 Jahre 10,9 7,7 52,3 29,1<br />
7,5 2,9 49,2 40,5 70-85 Jahre 9,5 4,0 46,6 39,9<br />
Massagen, Fango, Bäder<br />
74,9 5,4 11,5 8,2 40-54 Jahre 85,9 2,5 6,2 5,3<br />
73,4 5,2 11,9 9,5 55-69 Jahre 82,3 2,2 8,1 7,4<br />
77,3 4,7 10,5 7,5 70-85 Jahre 81,2 3,2 7,9 7,7<br />
79,9 4,8 11,6 3,7<br />
Fußpflege<br />
40-54 Jahre 94,4 1,6 2,3 1,7<br />
69,9 5,4 15,1 9,6 55-69 Jahre 90,7 2,2 4,2 2,9<br />
63,6 4,5 20,9 10,9 70-85 Jahre 84,3 2,7 9,2 3,9<br />
Krankengymnastik<br />
85,7 2,8 4,7 6,9 40-54 Jahre 88,9 2,8 4,0 4,3<br />
81,6 2,3 6,2 9,9 55-69 Jahre 86,0 1,8 5,0 7,2<br />
82,3 2,7 7,1 7,9 70-85 Jahre 89,9 2,1 3,9 4,1<br />
Haushaltshilfe<br />
93,2 0,8 0,6 5,4 40-54 Jahre 95,6 0,8 3,6<br />
90,7 0,4 2,1 6,8 55-69 Jahre 92,8 0,3 1,8 5,2<br />
78,0 1,6 3,7 16,7 70-85 Jahre 88,7 0,7 1,2 9,5<br />
Heilpraktikerbehandlung<br />
93,4 1,1 4,0 1,6 40-54 Jahre 94,6 1,3 2,9 1,2<br />
93,1 1,7 3,0 2,1 55-69 Jahre 95,3 2,2 2,4 0,1<br />
93,0 1,3 3,9 1,9 70-85 Jahre 97,6 0,5 1,3 0,5<br />
Rehabilitation, Kur<br />
96,9 2,5 0,6 40-54 Jahre 95,9 3,2 0,9<br />
93,1 6,7 0,1 55-69 Jahre 93,7 5,8 0,4 0,1<br />
93,3 6,1 0,6 70-85 Jahre 92,1 6,0 1,3 0,5<br />
Quelle: Replikationsstichprobe des Alterssurveys, 2002; n= 2.738-2.750, gewichtet<br />
Deutliche Ost-West-Unterschiede zeigen sich hierbei <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf Haushaltshilfen, die von<br />
deutlich mehr West- als Ostdeutschen genutzt werden sowie h<strong>in</strong>sichtlich psychotherapeutischer<br />
Behandlungen (p
320<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
erkennen, dass Frauen wie Männer mit steigendem Alter häufiger zur Apotheke gehen, was sich<br />
vor allem mit der altersabhängig zunehmenden Medikation begründen lässt. Ebenso steigt über<br />
die Altersgruppen die Nutzung von Fußpflege <strong>und</strong> Haushaltshilfe (p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Inanspruchnahmeverhaltens zeigen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Demnach muss angenommen<br />
werden, dass <strong>in</strong>sbesondere im höheren Alter entscheidende Präventionspotenziale unausgeschöpft<br />
bleiben. Auf dieses Präventionsdefizit hat auch der Sachverständigenrat der Konzertierten<br />
Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen h<strong>in</strong>gewiesen (Sachverständigenrat, 2001b).<br />
E<strong>in</strong>e wesentliche Erklärung für diese ungenutzten Präventionspotenziale liegt vermutlich <strong>in</strong> den<br />
gesellschaftlichen wie <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n, negativen Vorstellungen über das Altern (Walter &<br />
Schwartz, 2001). Ältere Personen selbst, ihre behandelnden Ärzte sowie das darüber h<strong>in</strong>ausgehende<br />
soziale Umfeld haben die schwierige Aufgabe, zwischen Altern <strong>und</strong> Krankheit sowie<br />
zwischen zu akzeptierenden, irreversiblen Alterungsprozessen <strong>und</strong> verbesserungsfähigen Ges<strong>und</strong>heitszuständen<br />
zu differenzieren. Diese Differenzierung bereitet den Beteiligten oftmals<br />
Probleme. Infolge negativer Vorstellungen über das Alter werden dadurch Präventionspotenziale<br />
wiederholt übersehen. Um dem Wunsch näher zu kommen, viele beh<strong>in</strong>derungsfreie Jahre <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>e Kompression der Morbidität zu erreichen, ist es entscheidend, die bestehenden Präventionspotenziale<br />
Älterer stärker zu nutzen. Dabei gilt es, die vorhandenen Barrieren zu berücksichtigen<br />
<strong>und</strong> sukzessive abzubauen, welche vermutlich besonders aufgr<strong>und</strong> der vorherrschenden,<br />
negativen Altersstereotype bestehen.<br />
7.6 Kohortenvergleiche<br />
Die im vorliegenden Kapitel e<strong>in</strong>gangs beschriebene steigende Lebenserwartung wirft die Frage<br />
auf, was dieses „mehr“ an Lebensjahren <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er ges<strong>und</strong>heitlichen Ausgestaltung bedeutet.<br />
Impliziert das längere Leben zugleich e<strong>in</strong>e längere Phase des Leidens an chronischen Erkrankungen<br />
<strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e zeitliche Ausweitung von Hilfe- <strong>und</strong> Pflegebedürftigkeit?<br />
Oder haben die zukünftigen Alten e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit als Generationen von Älteren<br />
vor ihnen, so dass sie erst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em späteren Lebensalter von ges<strong>und</strong>heitlichen E<strong>in</strong>schränkungen<br />
betroffen s<strong>in</strong>d? Dies könnte bedeuten, dass sich trotz längerer Lebenszeit e<strong>in</strong>e von Krankheiten<br />
<strong>und</strong> Bee<strong>in</strong>trächtigungen begleitete Lebensphase nicht verlängert, sondern gleich bleibt oder<br />
womöglich sogar verkürzt. Diese Frage nach der Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung im Alter ist dabei<br />
nicht nur von hohem <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Interesse. Vor dem demografischen H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er starken<br />
Zunahme des Anteils Älterer an der Gesamtbevölkerung ist sie auch von hoher ges<strong>und</strong>heitsökonomischer<br />
Bedeutung.<br />
Mit der Frage, wie die beh<strong>in</strong>derungsfreie Lebenserwartung („Disability Free Life Expectancy“,<br />
auch als „Active Life Expectancy“ bekannt) derzeit ist, wie diese sich seit der Vergangenheit<br />
entwickelt hat <strong>und</strong> wie sie prognostisch betrachtet <strong>in</strong> Zukunft se<strong>in</strong> wird, beschäftigen sich verschiedene<br />
Theorien. Dabei lassen sich im wesentlichen drei Annahmen unterscheiden: Die pessimistische<br />
Theorie geht von e<strong>in</strong>er Morbiditätsexpansion im Alter aus (mit zunehmender durchschnittlicher<br />
Lebensdauer wächst die Zahl der Jahre <strong>in</strong> Krankheit). Diese Expansion wird damit<br />
begründet, dass es durch mediz<strong>in</strong>ische Erfolge immer besser gel<strong>in</strong>gt, das frühzeitige Sterben<br />
<strong>in</strong>folge lebensbedrohlicher Erkrankungen <strong>und</strong> Unfälle zu verh<strong>in</strong>dern. Haben früher zumeist nur<br />
die besonders Ges<strong>und</strong>en e<strong>in</strong> höheres oder gar hohes Alter erreicht, ermöglichen die mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Erfolge heute, dass viele Personen trotz schlechter Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> e<strong>in</strong> hohes Alter kommen.<br />
Infolgedessen sei zu erwarten, dass zunehmend mehr Menschen e<strong>in</strong>e längere Phase ihres<br />
321
322<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Lebens <strong>in</strong> Krankheit <strong>und</strong> Pflegebedürftigkeit verbr<strong>in</strong>gen werden. Der Theorie zufolge ist jedes<br />
Jahr gewonnener Lebenserwartung nur e<strong>in</strong> zusätzliches Jahr <strong>in</strong> Beh<strong>in</strong>derung (Kramer, 1980).<br />
E<strong>in</strong>e zweite Theorie geht h<strong>in</strong>gegen davon aus, dass die beh<strong>in</strong>derungsfreie Lebenserwartung<br />
gleich bleibe, da sich zwar die allgeme<strong>in</strong>e Lebenserwartung erhöhe, aber Personen erst <strong>in</strong> entsprechend<br />
späterem Lebensalter mit steigenden Beh<strong>in</strong>derungen zu rechnen hätten. E<strong>in</strong>e dritte,<br />
optimistische These geht schließlich von e<strong>in</strong>er „Kompression der Morbidität“ im Alter aus (mit<br />
zunehmender durchschnittlicher Lebensdauer wächst die Zahl der Jahre <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heit). Diese<br />
Kompression sei dadurch bed<strong>in</strong>gt, dass e<strong>in</strong> weiterer Anstieg der Lebenserwartung an se<strong>in</strong>e biologischen<br />
Grenzen stoße, während Erkrankungen <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derungen weiter abnehmen würden.<br />
Durch Maßnahmen zur Ges<strong>und</strong>heitserhaltung <strong>und</strong> Krankheitsprävention würde das Auftreten<br />
von Krankheiten <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e sehr kurze Zeit vor dem biologisch notwendigen<br />
Tod „komprimiert“ (Fries, 1980).<br />
Zur Beantwortung der Frage nach der <strong>Entwicklung</strong> der beh<strong>in</strong>derungsfreien Lebenserwartung<br />
bzw. der Lebenserwartung <strong>in</strong> guter Ges<strong>und</strong>heit („Healthy Life Expectancy“) werden zumeist<br />
Morbiditäts- <strong>und</strong> Mortalitäts<strong>in</strong>formationen aus der Bevölkerung mite<strong>in</strong>ander komb<strong>in</strong>iert. Anhand<br />
dieser komb<strong>in</strong>ierten Betrachtung können Dauer <strong>und</strong> Ausmaß der Morbidität vor dem Lebensende<br />
ermittelt werden. E<strong>in</strong> anderes Vorgehen ist, anhand von wiederholt durchgeführten<br />
Bevölkerungsumfragen Geburtskohorten mite<strong>in</strong>ander zu vergleichen. Auf diese Weise kann<br />
untersucht werden, <strong>in</strong>wieweit sich später geborene Kohorten von vor ihnen geborenen <strong>in</strong> ihrer<br />
Ges<strong>und</strong>heit unterscheiden, wenn sie <strong>in</strong>s gleiche Alter kommen. Auch dieses Vorgehen liefert<br />
wichtige H<strong>in</strong>weise im H<strong>in</strong>blick auf die drei formulierten Theorien, die sich verkürzt als pessimistische<br />
(Morbiditätsexpansion), optimistische (Morbiditätskompression) oder „neutrale“ Theorie<br />
(Morbiditätskonstanz) charakterisieren lassen. Solchermaßen kohortenvergleichende Auswertungen<br />
wurden <strong>in</strong> Deutschland unter anderem anhand der Daten des Mikrozensus vorgenommen<br />
(D<strong>in</strong>kel, 1999). Hier, wie auch <strong>in</strong> den meisten anderen kohortenvergleichenden Untersuchungen,<br />
wird dabei auf Selbstaussagen zu Krankheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit zurückgegriffen. Gr<strong>und</strong><br />
hierfür ist, dass es kaum bevölkerungsrepräsentative Studien gibt, die auf mediz<strong>in</strong>ische Daten<br />
zurückgreifen können, ohne zugleich erhebliche E<strong>in</strong>schränkungen <strong>in</strong> der Bevölkerungsrepräsentativität<br />
der Stichprobe bzw. den Möglichkeiten von Kohortenvergleichen aufzuweisen. Die<br />
Auswertungen der hochrepräsentativen Daten des Mikrozensus (1%-Stichprobe der deutschen<br />
Bevölkerung) ergaben, dass sich für nachfolgende Geburtskohorten e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere, selbste<strong>in</strong>geschätzte<br />
Krankheitsprävalenz <strong>und</strong> somit e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit zeigte, als für früher geborene<br />
Kohorten. Zu entsprechenden Ergebnissen kommen auch neuere Studien anderer Länder (z.B.<br />
Manton, Stallard, & Corder, 1997). Die Bef<strong>und</strong>e weisen darauf h<strong>in</strong>, dass sich eher die „neutrale“<br />
Theorie e<strong>in</strong>er Morbiditätskonstanz, möglicherweise sogar die „optimistische“ e<strong>in</strong>er Morbiditätskompression<br />
<strong>in</strong> Zukunft bestätigen könnte.<br />
Dieser Frage zur Morbiditätsentwicklung, soll im Folgenden anhand der Daten des Alterssurveys<br />
nachgegangen werden. Gr<strong>und</strong>lage der kohortenvergleichenden Untersuchung s<strong>in</strong>d hierbei<br />
die Daten der Basisstichprobe des Alterssurveys aus dem Jahr 1996 mit den Geburtsjahrgängen<br />
von 1911 bis 1956 sowie die Daten der Replikationsstichprobe des Jahres 2002, <strong>in</strong> welche die<br />
Jahrgänge 1917 bis 1962 e<strong>in</strong>bezogen wurden. Es handelt sich demzufolge hierbei um e<strong>in</strong>e Kohortendifferenz<br />
von sechs Jahren (vgl. Kapitel 2). Dies entspricht der Kohortendifferenz, wie sie<br />
auch im Rahmen der Auswertungen des Mikrozensus gebildet wurde (D<strong>in</strong>kel, 1999). Im Gegen-
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
satz zum Mikrozensus können im Rahmen des Alterssurveys nur die Angaben von zwei Befragungszeitpunkten<br />
(1996, 2002) mite<strong>in</strong>ander verglichen werden, allerd<strong>in</strong>gs für <strong>in</strong>sgesamt sieben<br />
Geburtsjahrgangsgruppen. Es kann beispielsweise betrachtet werden, <strong>in</strong>wieweit sich Personen,<br />
die im Jahr 2002 im Alter zwischen 76 <strong>und</strong> 81 Jahren waren (Geburtskohorten 1921-1926) h<strong>in</strong>sichtlich<br />
ihrer selbstberichteten Ges<strong>und</strong>heit von Personen unterscheiden, die im Jahr 1996 zwischen<br />
76 <strong>und</strong> 81 Jahren alt waren (Geburtskohorten 1915-1920).<br />
E<strong>in</strong>e Betrachtung verschiedener Geburtskohorten gleichen Alters wird nachfolgend für drei<br />
Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikatoren des Alterssurveys vorgenommen. Es handelt sich hierbei um Selbstaussagen<br />
zur Anzahl körperlicher Erkrankungen („Multimorbidität“), zur Anzahl größerer Beschwerden<br />
(„Multiple Beschwerden“) sowie um e<strong>in</strong>e subjektive Bewertung des eigenen Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
(„subjektive Ges<strong>und</strong>heit“). Alle drei Ges<strong>und</strong>heitsmaße wurden bereits <strong>in</strong><br />
vorangegangenen Abschnitten e<strong>in</strong>geführt (vgl. Abschnitt 7.4.1 bzw. 0).<br />
Anhand von Abbildung 7.14 werden zunächst die Ergebnisse e<strong>in</strong>er kohortenvergleichenden<br />
Betrachtung von Multimorbidität deutlich. In der Darstellung ist jeweils die durchschnittliche<br />
Anzahl körperlicher Erkrankungen pro Altersgruppe angeben. Verglichen werden hierbei Personen<br />
der Basisstichprobe, die 1996 <strong>in</strong> der jeweils angegebenen Altersgruppe waren mit jenen<br />
der Replikationsstichprobe, die sich 2002 im gleichen Alter befanden.<br />
Die kohortenvergleichende Betrachtung von Multimorbidität macht deutlich, dass nachfolgende<br />
Geburtskohorten von e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>sgesamt ger<strong>in</strong>geren Multimorbidität betroffen s<strong>in</strong>d als früher geborene<br />
Kohorten. Dies ist für die jüngeren Altersgruppen, die eher am Anfang der zweiten Lebenshälfte<br />
stehen, noch nicht konsistent festzustellen. Hier zeigen sich vor allem für die Gruppen<br />
der 40- bis 45-Jährigen <strong>und</strong> 52- bis 57-Jährigen ke<strong>in</strong>e bzw. nur marg<strong>in</strong>ale Unterschiede.<br />
H<strong>in</strong>gegen wird deutlich, dass nachfolgende Kohorten, besonders <strong>in</strong> der Lebensphase des „dritten<br />
Alters“, <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maße von Multimorbidität betroffen s<strong>in</strong>d als noch Personen, die<br />
sechs Jahre vor ihnen geboren s<strong>in</strong>d. Ab der Altersgruppe der 58- bis 63-Jährigen zeigt sich dieser<br />
bedeutsame Kohortenunterschied bis <strong>in</strong> die höchste Altersgruppe der 76- bis 81-Jährigen.<br />
Unterschiede zwischen Männern <strong>und</strong> Frauen sowie Ost- <strong>und</strong> Westdeutschen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt<br />
nicht festzustellen.<br />
Neben der Anzahl der Erkrankungen kann auch hier ergänzend die Anzahl der genannten Beschwerden<br />
betrachtet werden (vgl. Abschnitt 7.4.1). Es ist gr<strong>und</strong>sätzlich möglich, dass sich zwischen<br />
den Kohorten zwar die Anzahl der Erkrankungen im Durchschnitt verr<strong>in</strong>gert hat, nicht<br />
aber die Anzahl von Beschwerden mittleren oder größeren Ausmaßes. Sollte dies der Fall se<strong>in</strong>,<br />
wäre es e<strong>in</strong> wichtiger H<strong>in</strong>weis darauf, den vorliegenden Bef<strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gerer Multimorbidität von<br />
später geborenen Kohorten, nur e<strong>in</strong>geschränkt als tatsächlichen Gew<strong>in</strong>n beh<strong>in</strong>derungsfreier<br />
Lebensjahre <strong>in</strong>terpretieren zu können.<br />
323
324<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Abbildung 7.14:<br />
Multimorbidität im Kohortenvergleich, differenziert nach Altersgruppe (Mittelwerte <strong>und</strong> Variationskoeffizienten)<br />
5<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
*<br />
1996, Basisstichprobe 2002, Replikationsstichprobe<br />
**<br />
***<br />
40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 70-75 76-81<br />
Alter <strong>in</strong> Jahren<br />
Quelle: Basisstichprobe 1996 (n= 4.003) <strong>und</strong> Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.775) des Alterssurveys, gewichtet.<br />
*p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Abbildung 7.15:<br />
Multiple Beschwerden (Anzahl mittlerer bis großer Beschwerden) im Kohortenvergleich, differenziert<br />
nach Altersgruppe (Mittelwerte <strong>und</strong> Variationskoeffizienten)<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
1996, Basisstichprobe 2002, Replikationsstichprobe<br />
*<br />
*** **<br />
40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 70-75 76-81<br />
Alter <strong>in</strong> Jahren<br />
Quelle: Basisstichprobe 1996 (n= 3.447) <strong>und</strong> Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.267) des Alterssurveys, gewichtet;<br />
*p
326<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
weils zugunsten der später Geborenen. H<strong>in</strong>sichtlich der im Alterssurvey zusätzlich betrachteten<br />
Gruppen 40- bis 57-Jähriger s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Vergleiche möglich, da diese Altersgruppen <strong>in</strong> die Analysen<br />
des Mikrozensus nicht e<strong>in</strong>bezogen wurden.<br />
Ergänzend zur Betrachtung des selbstberichteten Ges<strong>und</strong>heitszustandes erfolgt abschließend<br />
e<strong>in</strong>e Darstellung von Kohortenvergleichen zur subjektiven Ges<strong>und</strong>heit. Dabei ist die allgeme<strong>in</strong>e<br />
subjektive Ges<strong>und</strong>heitsbewertung nicht gleichzusetzen mit Selbstberichten über Krankheiten<br />
<strong>und</strong> Beschwerden. Die Bewertung der Ges<strong>und</strong>heit aus subjektiver Sicht ist nicht nur Ausdruck<br />
von körperlicher Ges<strong>und</strong>heit, sondern auch Ausdruck von Personenmerkmalen (z.B. Kontrollüberzeugungen),<br />
Umweltmerkmalen (z.B. soziale Unterstützung) <strong>und</strong> Lebenszufriedenheit (vgl.<br />
Abschnitt 7.4.3). Es ist deshalb zu vermuten, dass sich der oben gezeigte, bessere Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
nachfolgender Kohorten nicht <strong>in</strong> gleichem Maße <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er besseren subjektiven Ges<strong>und</strong>heit<br />
widerspiegelt. Dies wäre vermutlich vor allem dann der Fall, wenn nachfolgende Kohorten<br />
sich nicht nur durch bessere Ges<strong>und</strong>heit, sondern auch durch erhöhte personale <strong>und</strong> soziale Ressourcen<br />
auszeichnen würden. Abbildung 7.16 s<strong>in</strong>d die Ergebnisse zu Kohortenvergleichen subjektiver<br />
Ges<strong>und</strong>heit zu entnehmen.<br />
Abbildung 7.16:<br />
Bewertung subjektiver Ges<strong>und</strong>heit im Kohortenvergleich, differenziert nach Altersgruppe<br />
(Mittelwerte <strong>und</strong> Variationskoeffizienten; Skala von 1=sehr schlecht bis 5=sehr gut)<br />
5<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
1996, Basisstichprobe 2002, Replikationsstichprobe<br />
*<br />
**<br />
40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 70-75 76-81<br />
Alter <strong>in</strong> Jahren<br />
Quelle: Basisstichprobe 1996 (n= 4.833) <strong>und</strong> Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.081) des Alterssurveys, gewichtet;<br />
*p
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
gruppe der 58- bis 63-Jährigen. Für diese zeigt sich nicht nur e<strong>in</strong>e Verbesserung körperlicher<br />
Ges<strong>und</strong>heit, sondern auch der subjektiven Ges<strong>und</strong>heitsbewertung. Dieses Ergebnis, dass sich<br />
<strong>in</strong>sgesamt durch die Verbesserung körperlicher Ges<strong>und</strong>heit aber nicht zugleich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er besseren<br />
subjektiven Ges<strong>und</strong>heit äußert, entspricht hierbei den Erwartungen. Demnach hat sich zwischen<br />
den Kohorten zwar die körperliche Ges<strong>und</strong>heit verbessert, nicht jedoch <strong>in</strong> gleichem Maße jene<br />
psychischen <strong>und</strong> sozialen Ressourcen, die darüber h<strong>in</strong>aus für e<strong>in</strong>e gute subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung<br />
relevant s<strong>in</strong>d. Dabei ist nicht auszuschließen, dass e<strong>in</strong> solcher Effekt bei größeren<br />
Kohortendifferenzen (als sechs Jahren), zu f<strong>in</strong>den se<strong>in</strong> könnte.<br />
Im vorliegenden Kapitel bilden die kohortenvergleichenden Analysen den letzten Teil deskriptiver<br />
Betrachtungen zur Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Dabei verweisen die Ergebnisse<br />
darauf, dass nachfolgende Geburtskohorten e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit, d.h. e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Multimorbidität<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Zahl von nennenswerten Beschwerden haben als früher Geborene.<br />
Dieser Kohorteneffekt ist deutlich festzustellen, obwohl die jeweiligen Geburtskohorten nur<br />
sechs Jahre ause<strong>in</strong>anderliegen, e<strong>in</strong> Bef<strong>und</strong>, der sich auch <strong>in</strong> den Analysen von D<strong>in</strong>kel zeigte<br />
(D<strong>in</strong>kel, 1999). Die durch e<strong>in</strong>e höhere Lebenserwartung „gewonnenen“ Lebensjahre zeichnen<br />
sich dadurch – bereits bei der Betrachtung e<strong>in</strong>er eher kurzen Kohortendifferenz von sechs Jahren<br />
– als Lebenszeit ab, die nicht e<strong>in</strong>fach e<strong>in</strong> Mehr an Jahren <strong>in</strong> schlechter, sondern auch e<strong>in</strong><br />
Mehr an Jahren <strong>in</strong> guter Ges<strong>und</strong>heit bedeuten. Ob sich darüber h<strong>in</strong>ausgehend zudem die Morbidität<br />
komprimiert, lässt sich anhand vorliegender Analysen allerd<strong>in</strong>gs nicht e<strong>in</strong>deutig beantworten.<br />
Die abschließende Betrachtung der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit weist darauf h<strong>in</strong>, dass sich e<strong>in</strong>e<br />
Verbesserung der körperlichen Ges<strong>und</strong>heit wie erwartet nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er zugleich besseren subjektiven<br />
Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung wiederf<strong>in</strong>den lässt. Dies verdeutlicht zum e<strong>in</strong>en erneut, dass<br />
subjektive Ges<strong>und</strong>heit nicht mit selbstberichteter Ges<strong>und</strong>heit gleichgesetzt werden kann. Damit<br />
stellen Angaben zur subjektiven Ges<strong>und</strong>heit auch ke<strong>in</strong>e guten Informationen dar, um der Frage<br />
nachzugehen, wie sich die Morbidität nachfolgender Kohorten im Vergleich zu früher Geborenen<br />
entwickelt hat. Zum anderen weisen die Ergebnisse darauf h<strong>in</strong>, dass sich im Gegensatz zu<br />
e<strong>in</strong>er über die Kohorten verbesserten körperlichen Ges<strong>und</strong>heit nicht <strong>in</strong> gleichem Ausmaß auch<br />
die persönlichen Ressourcen verbessert haben, die zur Bewertung der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit<br />
e<strong>in</strong>en wesentlichen Beitrag leisten.<br />
7.7 Zusammenfassung<br />
Im Zentrum des vorliegenden Kapitels stand die Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsversorgung von<br />
Personen im Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren. Gr<strong>und</strong>lage der Darstellungen bildeten die Daten<br />
der Replikationsstichprobe des Alterssurveys von 2002, für Kohortenvergleiche (Abschnitt 7.6)<br />
wurden zusätzlich die Daten der Basisstichprobe des Alterssurveys von 1996 herangezogen. Mit<br />
se<strong>in</strong>em Fokus auf die zweite Lebenshälfte <strong>und</strong> dem Vergleich verschiedener Altersgruppen<br />
<strong>in</strong>nerhalb dieser Lebensphase bilden die Ges<strong>und</strong>heitsdaten des Alterssurveys e<strong>in</strong>e wichtige Ergänzung<br />
anderer Surveybefragungen <strong>und</strong> Studien. Hierzu zählen <strong>in</strong>sbesondere die Ges<strong>und</strong>heitssurveys,<br />
welche die gesamte Bevölkerung im Erwachsenenalter umfassen 8 <strong>und</strong> entsprechend <strong>in</strong><br />
8 E<strong>in</strong> ergänzender K<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Jugendsurvey („KIGGS“) erfolgt seit 2003.<br />
327
328<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
der Studienkonzeption <strong>und</strong> Auswertung ke<strong>in</strong>en Schwerpunkt zu Fragen des Alterns <strong>und</strong> Alters<br />
haben sowie die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie, deren Forschungsschwerpunkt sich besonders auf die<br />
Lebensphase der Hochaltrigkeit richtete. In methodischer H<strong>in</strong>sicht s<strong>in</strong>d im Alterssurvey Kohortendesign<br />
<strong>und</strong> Längsschnittdesign komb<strong>in</strong>iert, so dass Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen von Gruppen<br />
(Geburtskohorten) sowie <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungen gleichermaßen untersucht werden können.<br />
Anhand des vorliegenden Kapitels wurden drei Fragen verfolgt: (1) Im ersten Abschnitt (Kapitel<br />
7.4) wurde der Frage nachgegangen, wie der selbstberichtete Ges<strong>und</strong>heitszustand älter werdender<br />
<strong>und</strong> alter Personen ist <strong>und</strong> welche spezifischen Ges<strong>und</strong>heitsprobleme <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Altersgruppen anzutreffen s<strong>in</strong>d. Dabei wurden die Altersgruppen 40- bis 54-Jähriger, 55- bis<br />
69-Jähriger sowie 70- bis 85-Jähriger unterschieden. Neben Vergleichen dieser Altersgruppen<br />
wurden bestehende Differenzen zwischen Frauen <strong>und</strong> Männern aufgezeigt <strong>und</strong> zudem untersucht,<br />
<strong>in</strong> welchem Ausmaß noch Ges<strong>und</strong>heitsunterschiede zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschen zu<br />
f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d. (2) Der zweite Abschnitt (Kapitel 7.5) beschäftigte sich mit der Frage, <strong>in</strong> welchem<br />
Ausmaß ältere Personen mediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> sonstige Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen <strong>in</strong> Anspruch<br />
nehmen <strong>und</strong> <strong>in</strong>wieweit sich hierbei Defizite h<strong>in</strong>sichtlich des Inanspruchnahmeverhaltens feststellen<br />
lassen. (3) Abschließend wurde im dritten Abschnitt (Kapitel 7.6) die Frage verfolgt, ob<br />
kohortenvergleichende Untersuchungen H<strong>in</strong>weise darauf geben, dass nachfolgende Geburtskohorten<br />
<strong>in</strong> besserer Ges<strong>und</strong>heit alt werden als früher Geborene. Ausgangspunkt dieser Betrachtung<br />
ist der Anstieg der Lebenserwartung, der die Frage aufwirft, <strong>in</strong> welcher Ges<strong>und</strong>heit die so<br />
„gewonnenen“ Lebensjahre verbracht werden.<br />
7.7.1 Ergebnisse zum Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Körperliche Erkrankungen <strong>und</strong> Beschwerden<br />
Die dargestellten Ergebnisse zum selbstberichteten Ges<strong>und</strong>heitszustand 40- bis 85-Jähriger machen<br />
deutlich, dass es über die untersuchten Altersgruppen h<strong>in</strong>weg zu e<strong>in</strong>em Anstieg der Erkrankungen<br />
<strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ener (mittlerer oder großer) Beschwerden kommt. E<strong>in</strong> altersabhängiger<br />
Anstieg sowohl der Erkrankungsrate als auch gleichzeitig der Beschwerderate betrifft<br />
besonders die Gelenk-, Bandscheiben-, Knochen- oder Rückenleiden, Herz-<br />
Kreislauferkrankungen, Durchblutungsstörungen <strong>und</strong> Atemwegserkrankungen. Dabei s<strong>in</strong>d<br />
Frauen häufiger von Erkrankungen des Bewegungsapparates (Gelenk-, Bandscheiben-, Knochen-<br />
oder Rückenleiden) betroffen als Männer <strong>und</strong> berichten diesbezüglich auch über e<strong>in</strong> höheres<br />
Beschwerdemaß. Männer h<strong>in</strong>gegen berichten häufiger von Ohrenerkrankungen; <strong>in</strong> der<br />
Gruppe der von Ohrenleiden betroffenen Personen f<strong>in</strong>den sich jedoch ke<strong>in</strong>e Unterschiede im<br />
Beschwerdemaß zwischen den Geschlechtern. H<strong>in</strong>gegen bereiten Männern Blasenleiden größere<br />
Beschwerden als Frauen. Im Gegensatz zu Geschlechtsunterschieden s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e wesentlichen<br />
Unterschiede zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschen festzustellen.<br />
E<strong>in</strong>e Betrachtung der Verbreitung von Mehrfacherkrankungen („Multimorbidität“) macht deutlich,<br />
dass bereits 40 Prozent der Befragten 40- bis 54-Jährigen über e<strong>in</strong> gleichzeitiges Vorhandense<strong>in</strong><br />
von m<strong>in</strong>destens zwei Erkrankungen oder Funktionse<strong>in</strong>bußen berichtet. Bei den 70- bis<br />
85-Jährigen liegt dieser Anteil etwa doppelt so hoch (79 Prozent), wobei alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Viertel der
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
70- bis 85-Jährigen über fünf <strong>und</strong> mehr Erkrankungen berichtet. Während e<strong>in</strong> deutlicher Anstieg<br />
e<strong>in</strong>zelner Beschwerden über die Altersgruppen festzustellen ist, zeigt sich ke<strong>in</strong> ähnlicher Anstieg<br />
multipler (mittlerer bis großer) Beschwerden. Der altersabhängige Anstieg multipler Beschwerden<br />
fällt im Vergleich zur Multimorbidität deutlich ger<strong>in</strong>ger aus. Hierfür gibt es mehrere<br />
Gründe: Zum e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d nicht alle Erkrankungen gleichermaßen mit hohen Beschwerden verb<strong>und</strong>en,<br />
selbst manche schweren Erkrankungen (z.B. e<strong>in</strong>ige Herz-Kreislauferkrankungen) gehen<br />
mit eher milden Beschwerden e<strong>in</strong>her. Zum anderen spielen vermutlich verschiedene Anpassungsprozesse<br />
e<strong>in</strong>e Rolle: hierzu zählt das Vermeiden von Beschwerden verursachenden Aktivitäten,<br />
e<strong>in</strong> Vergleich zwischen verschiedenen eigenen Beschwerden sowie schließlich der Vergleich<br />
eigener Beschwerden mit den (stärkeren) Beschwerden von Personen im sozialen Umfeld.<br />
Im Gegensatz zur Betrachtung der E<strong>in</strong>zelerkrankungen <strong>und</strong> Beschwerden f<strong>in</strong>den sich h<strong>in</strong>sichtlich<br />
Multimorbidität <strong>und</strong> multiplen Beschwerden ke<strong>in</strong>e Geschlechtsunterschiede <strong>und</strong> erneut<br />
auch ke<strong>in</strong>e regionalen Unterschiede (Ost-/Westdeutsche).<br />
Ergänzend wurde untersucht, wie viele Personen <strong>in</strong> den vergangenen 10 Jahren vor dem Befragungszeitpunkt<br />
(m<strong>in</strong>destens) e<strong>in</strong>en schweren Unfall oder e<strong>in</strong>e schwere Krankheit hatten. Dabei<br />
zeigte e<strong>in</strong> Vergleich der Altersgruppen, dass es von der jüngsten (40-54 Jahre) zur ältesten Altersgruppe<br />
(70- bis 85 Jahre) nahezu zu e<strong>in</strong>er Verdoppelung des Auftretens von schweren<br />
Krankheiten oder Unfällen kommt. Es wurde angenommen, dass Ältere möglicherweise weniger<br />
von solchen Ereignissen belastet s<strong>in</strong>d, da sie sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Alter bef<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>dem Krankheiten<br />
stärker verbreitet s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> zudem Folgen von Unfällen oder Krankheiten nur noch e<strong>in</strong>e (im<br />
Vergleich zum zurückliegenden Leben) vergleichsweise kurze Zeit ertragen werden müssen.<br />
Diese Annahme musste anhand der Ergebnisse jedoch verworfen werden: Ältere wie Jüngere<br />
fühlen sich durch solche Lebensereignisse gleichermaßen belastet. Dabei zeigen sich sowohl <strong>in</strong><br />
der Häufigkeit des Auftretens schwerer Krankheiten oder Unfälle, als auch im Belastungsgrad<br />
weder Geschlechts- noch Ost-West-Unterschiede.<br />
Funktionelle E<strong>in</strong>schränkungen<br />
E<strong>in</strong>e Betrachtung von Mobilität <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte machte deutlich, dass bereits <strong>in</strong> der<br />
jüngsten Altersgruppe (40-54 Jahre) über e<strong>in</strong> Drittel der Befragten angibt, bezüglich anstrengender<br />
Tätigkeiten (schnell laufen, schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben)<br />
e<strong>in</strong>geschränkt zu se<strong>in</strong>. In dieser Altersgruppe berichtet zudem etwa jede siebte Person über Mobilitätse<strong>in</strong>schränkungen<br />
h<strong>in</strong>sichtlich des sich Beugens, Kniens, Bückens. E<strong>in</strong>schränkungen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
anderer Aspekte der Mobilität (u.a. mehrere Straßenkreuzungen zu Fuß gehen, e<strong>in</strong>en<br />
Treppenabsatz steigen, sich baden oder anziehen) steigen erst zwischen der mittleren (55-69<br />
Jahre) <strong>und</strong> höchsten Altersgruppe (70-85 Jahre) an. Während sich erneut ke<strong>in</strong>e regionalen Unterschiede<br />
zeigen, machen die Ergebnisse deutlich, dass besonders Frauen im höheren Alter von<br />
e<strong>in</strong>er schlechteren Mobilität betroffen s<strong>in</strong>d als Männer. E<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> hierfür liegt vermutlich <strong>in</strong> der<br />
höheren Frühsterblichkeit von Männern, während Frauen trotz schlechten Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
oftmals e<strong>in</strong> hohes Alter erreichen. Dementsprechend s<strong>in</strong>d Frauen im Alter auch etwas häufiger<br />
auf Hilfe, Pflege oder andere Unterstützung angewiesen, während sich diesbezüglich erneut<br />
ke<strong>in</strong>e Ost-West-Unterschiede zeigten.<br />
329
Subjektive Ges<strong>und</strong>heit<br />
330<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Neben der körperlichen <strong>und</strong> funktionellen Ges<strong>und</strong>heit wurde auch die subjektive Ges<strong>und</strong>heit<br />
betrachtet. Diese ist bedeutsam, da sie als e<strong>in</strong> wesentlicher Ausdruck von Lebensqualität angesehen<br />
werden kann <strong>und</strong> sich zudem im Vergleich zur objektiven, körperlichen Ges<strong>und</strong>heit als<br />
sensiblerer Mortalitäts<strong>in</strong>dikator erwiesen hat. Die Ergebnisse machen deutlich, dass es über die<br />
Altersgruppen h<strong>in</strong>weg zu e<strong>in</strong>er Abnahme der subjektiven Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung kommt, sich<br />
hierbei jedoch ke<strong>in</strong>e geschlechts- oder regionalspezifischen (Ost/West) Unterschiede zeigen.<br />
7.7.2 Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich ist die Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer Dienstleistungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
hoch. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Reihe von differenzierenden Aussagen zu machen. Über 90<br />
Prozent aller über 40-Jährigen haben m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> den vorangegangenen zwölf Monaten<br />
e<strong>in</strong>e Arztpraxis aufgesucht. Mit dem Alter steigt dieser Prozentsatz leicht an. Betrachtet man<br />
die Fachdiszipl<strong>in</strong> der kontaktierten Arztpraxen, so steigt mit dem Alter <strong>in</strong>sbesondere die Inanspruchnahme<br />
von Arztpraxen der Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>, Augenheilk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> <strong>in</strong>neren Mediz<strong>in</strong>, im<br />
H<strong>in</strong>blick auf Zahnarztpraxen ist h<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong>e abnehmende Nutzungshäufigkeit zu beobachten.<br />
Bei der ältesten Altersgruppe sche<strong>in</strong>en Ängste <strong>und</strong> Befürchtungen h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>er Zahnarztbehandlung<br />
ke<strong>in</strong>e bedeutsamen Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme zahnärztlicher Behandlung<br />
zu se<strong>in</strong>. Vielmehr ist anzunehmen, dass vor allem die E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> die Notwendigkeit zahnärztlicher<br />
Kontrolle fehlt, die auch bei zahnlosen Menschen bzw. Personen mit Zahnprothesen<br />
notwendig ist. Zahnmediz<strong>in</strong>ische Präventionspotenziale werden somit gerade von alten Menschen<br />
nicht ausreichend wahrgenommen.<br />
Geschlechtsunterschiede <strong>in</strong> der Inanspruchnahme f<strong>in</strong>den sich h<strong>in</strong>sichtlich der häufigeren Inanspruchnahme<br />
von orthopädischen Arztpraxen durch Frauen, während Männer häufiger als Frauen<br />
Kontakt zu HNO-Arztpraxen haben. Diese Geschlechtsunterschiede entsprechen den von<br />
Frauen häufiger berichteten Erkrankungen des Bewegungsapparates <strong>und</strong> den von Männern häufiger<br />
genannten Ohrenerkrankungen. Während bei Frauen die Inanspruchnahme von<br />
gynäkologischen Arztpraxen mit dem Alter s<strong>in</strong>kt, steigt die Nutzungshäufigkeit von<br />
urologischen Arztpraxen bei Männern mit dem Alter. Regionale Unterschiede <strong>in</strong> der Nutzung<br />
fachärztlicher Expertise entspricht den regional unterschiedlichen Prävalenzraten: In Ostdeutschland<br />
geben Befragte im Vergleich mit Westdeutschland häufiger an, allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>ische<br />
Praxen <strong>und</strong> Zahnarztpraxen aufgesucht zu haben, <strong>und</strong> (für Männer) häufiger urologische<br />
Praxen besucht zu haben.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der gegenwärtig diskutierten Hausarztmodelle ist es von Interesse, dass die überwiegende<br />
Mehrzahl der Personen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte über e<strong>in</strong>e Hausärzt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>en<br />
Hausarzt verfügt. Insgesamt geben im Jahr 2002 94 Prozent aller Personen im Alter zwischen<br />
40 <strong>und</strong> 85 Jahren an, e<strong>in</strong>e Hausärzt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>en Hausarzt zu haben, den sie bei mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Fragen im Regelfall zuerst aufsuchen. Dabei steigt der Anteil von Personen mit Hausärzt<strong>in</strong> oder
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Hausarzt von 91 Prozent <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe auf 96 Prozent <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe.<br />
Große Unterschiede zwischen den Geschlechtern <strong>und</strong> Regionen f<strong>in</strong>den sich h<strong>in</strong>gegen nicht.<br />
Inanspruchnahme weiterer Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen<br />
Unter den nicht-mediz<strong>in</strong>ischen Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen werden mit Abstand am häufigsten<br />
Apotheken aufgesucht. Daneben nimmt e<strong>in</strong> erheblicher Teil der Bevölkerung <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte (mehr als 10 Prozent) m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal im Jahr Massagen/Fango/Bäder, Fußpflege<br />
oder Krankengymnastik <strong>in</strong> Anspruch. Dabei werden <strong>in</strong> Ostdeutschland häufiger passive<br />
Heilhilfsbehandlungen (wie etwa Massagen), <strong>in</strong> Westdeutschland häufiger aktivierende Heilhilfsbehandlungen<br />
(wie etwa Krankengymnastik oder Physiotherapie) genutzt. Frauen nehmen<br />
nicht-mediz<strong>in</strong>ische Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen deutlich häufiger <strong>in</strong> Anspruch als Männer. Die<br />
Rate der Personen, die logopädische Behandlungen, Gedächtnissprechst<strong>und</strong>en, Arbeits- oder<br />
Beschäftigungstherapie <strong>in</strong> Anspruch nehmen, ist sehr ger<strong>in</strong>g. Allerd<strong>in</strong>gs ist hierbei zu berücksichtigen,<br />
dass <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Bevölkerungsumfragen gerade jene Personengruppen, die derartiger<br />
Interventionen bedürfen, e<strong>in</strong>er Befragung oftmals nicht zur Verfügung stehen.<br />
Obwohl mit dem Alter die Zahl der Personen zunimmt, die unter chronischen Krankheiten <strong>und</strong><br />
Multimorbidität leiden, gibt es ke<strong>in</strong>en Anstieg <strong>in</strong> der Inanspruchnahme nicht-mediz<strong>in</strong>ischer<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen. Angesichts des besonderen Bedarfs älterer Menschen, bei denen<br />
Heilhilfsbehandlungen für den Umgang mit chronischen Leiden (Disease Management) s<strong>in</strong>nvoll<br />
wäre, bedeutet dies, dass Präventions- <strong>und</strong> Rehabilitationspotenziale im Alter nicht ausreichend<br />
genutzt werden.<br />
7.7.3 Kohortenvergleiche<br />
Die Ergebnisse der Kohortenvergleiche zwischen den 40- bis 85-Jährigen der Jahre 1996 <strong>und</strong><br />
2002 verweisen darauf, dass nachfolgende Geburtskohorten e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit, d.h. e<strong>in</strong>e<br />
ger<strong>in</strong>gere Multimorbidität <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Zahl von bedeutsamen Beschwerden haben als<br />
früher Geborene. Dies zeigte sich vor allem für Personen ab e<strong>in</strong>em Alter von 58 Jahren, e<strong>in</strong><br />
Großteil dieser Personen (im Alter zwischen 58 <strong>und</strong> 85 Jahren) bef<strong>in</strong>det sich dabei <strong>in</strong> der Phase<br />
des dritten Lebensalters. Im Gegensatz zur körperlichen Ges<strong>und</strong>heit lässt sich ke<strong>in</strong>e bessere<br />
subjektive Ges<strong>und</strong>heit nachfolgender Geburtskohorten feststellen. Dies entspricht den e<strong>in</strong>gangs<br />
formulierten Erwartungen, da subjektive Ges<strong>und</strong>heit ke<strong>in</strong> bloßes Abbild körperlicher Ges<strong>und</strong>heit<br />
darstellt, sondern zugleich als Ausdruck verschiedener personaler Ressourcen sowie Lebensqualität<br />
angesehen wird.<br />
Den Ergebnissen zur körperlichen Ges<strong>und</strong>heit zufolge s<strong>in</strong>d die durch e<strong>in</strong>e höhere Lebenserwartung<br />
„gewonnenen“ Lebensjahre also nicht e<strong>in</strong>fach im S<strong>in</strong>ne der Theorie e<strong>in</strong>er Morbiditätsexpansion<br />
zusätzliche Jahre <strong>in</strong> schlechter Ges<strong>und</strong>heit, sondern es handelt sich dabei auch um gewonnene<br />
Lebenszeit <strong>in</strong> guter Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Die Ergebnisse stützen somit (zum<strong>in</strong>dest) die Theorie e<strong>in</strong>er Morbiditätskonstanz, s<strong>in</strong>d aber auch<br />
mit der Theorie der Morbiditätskompression vere<strong>in</strong>bar. Denkbar ist allerd<strong>in</strong>gs, dass die gef<strong>und</strong>enen<br />
Kohortenunterschiede nicht mehr für die Phase der Hochaltrigkeit bestehen. Denn es ist<br />
331
332<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
möglich, dass zwar die nachfolgenden Kohorten mit e<strong>in</strong>em besseren ges<strong>und</strong>heitlichen Ausgangsniveau<br />
die Phase der Hochaltrigkeit beg<strong>in</strong>nen, dieser Vorteil jedoch nicht vor großen Verlusten<br />
schützt (Baltes, 1997). Aus heutiger Sicht ist bekannt, dass <strong>in</strong> der Lebensphase der Hochaltrigkeit<br />
unter anderem die Prävalenz von Demenzen stark zunimmt. Etwa jede vierte Person<br />
zwischen 85 <strong>und</strong> 89 Jahren <strong>und</strong> jede dritte ab 90 Jahren ist gegenwärtig hiervon betroffen<br />
(B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend, 2002).<br />
7.7.4 Empfehlungen<br />
Die Ergebnisse zum Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte geben H<strong>in</strong>weise auf verschiedene<br />
Präventionspotenziale: Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, dass chronische Erkrankungen „mitaltern“,<br />
d.h. bis <strong>in</strong>s hohe Alter fortbestehen <strong>und</strong> Folgeerkrankungen sowie Funktionse<strong>in</strong>bußen<br />
verursachen können, ersche<strong>in</strong>t es wichtig, möglichst früh im Lebensverlauf die Chronifizierung<br />
von Erkrankungen <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen zu vermeiden. Die hohe Zahl von r<strong>und</strong> 40 Prozent<br />
der 40- bis 54-Jährigen, die angeben, zwei oder mehr Erkrankungen bzw. Funktionse<strong>in</strong>bußen<br />
zu haben <strong>und</strong> der Bef<strong>und</strong>, dass über e<strong>in</strong> Drittel der Personen dieser Altersgruppe E<strong>in</strong>schränkungen<br />
h<strong>in</strong>sichtlich anstrengender Tätigkeiten nennen, weisen auf entsprechenden Präventions- <strong>und</strong><br />
Rehabilitationsbedarf h<strong>in</strong>. Die Möglichkeiten, dauerhafte Multimorbidität <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen<br />
zu vermeiden, s<strong>in</strong>d im mittleren Erwachsenenalter zumeist am größten. Aber auch h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der älteren Altersgruppen (55-69 Jahre; 70-85 Jahre) sollten die hohen präventiven Potenziale<br />
nicht unterschätzt werden. Für e<strong>in</strong>e Vielzahl von Erkrankungen, unter anderem Herz-<br />
Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen <strong>und</strong> Diabetes mellitus (Typ II), gibt es deutliche<br />
Präventionspotenziale, die noch nicht ausreichend genutzt werden. Dabei nimmt mit steigendem<br />
Alter besonders die Bedeutung von Tertiärprävention zu, d.h. die Vermeidung oder<br />
Verzögerung der Verschlimmerung e<strong>in</strong>er Erkrankung sowie die Verh<strong>in</strong>derung oder Milderung<br />
bleibender Funktionse<strong>in</strong>bußen.<br />
Im Altersgruppenvergleich wurde deutlich, dass mehrere der dargestellten Ergebnisse auf mit<br />
dem Alter steigenden Versorgungsbedarf sowie Versorgungsdefizite h<strong>in</strong>weisen:<br />
Die Feststellung, dass im höheren Alter das verbreitete Vorkommen von Multimorbidität nicht<br />
im entsprechenden Maße mit hohen Beschwerden korrespondiert, stellt <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Lebensqualität<br />
Älterer e<strong>in</strong>en eher beruhigenden Bef<strong>und</strong> dar. Dabei sollte allerd<strong>in</strong>gs neben den<br />
Vorteilen von Anpassungs- <strong>und</strong> Bewältigungsprozessen nicht übersehen werden, dass Ältere<br />
möglicherweise auch solche Erkrankungen <strong>und</strong> Beschwerden als „altersgemäße Abbauprozesse“<br />
akzeptieren, die gut mediz<strong>in</strong>isch behandelbar s<strong>in</strong>d. Es ersche<strong>in</strong>t deshalb von hoher Wichtigkeit,<br />
dass ältere Menschen selbst wie auch ihr soziales Umfeld <strong>und</strong> professionelle Ges<strong>und</strong>heitsdienstleister<br />
lernen, besser zwischen Altern <strong>und</strong> Krankheit zu unterscheiden.<br />
Geschlechtsdifferenzierte Ergebnisse zu Erkrankungen <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen machten deutlich,<br />
dass mit steigendem Alter Frauen <strong>in</strong> höherem Maße von Erkrankungen <strong>und</strong> Beschwerden<br />
des Bewegungsapparates (Gelenk-, Bandscheiben-, Knochen- oder Rückenleiden) betroffen s<strong>in</strong>d<br />
als Männer. Zugleich f<strong>in</strong>den sich bei Frauen im Alter zwischen 70 <strong>und</strong> 85 Jahren stärkere Mobilitätse<strong>in</strong>bußen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e höhere Hilfs- bzw. Pflegebedürftigkeit als bei gleichaltrigen Männern.<br />
Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Prävention sollten frühzeitig im Lebenslauf anset-
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
zen, um Risiken von Knochenerkrankungen wie beispielsweise Osteoporose zu reduzieren, von<br />
der Frauen etwa dreimal so häufig betroffen s<strong>in</strong>d wie Männer. Mit steigendem Alter steigt jedoch<br />
die Bedeutung tertiärpräventiver Maßnahmen (u.a. Verh<strong>in</strong>derung von Funktionse<strong>in</strong>bußen,<br />
Sturzprävention), damit ältere Frauen <strong>und</strong> Männer trotz Mobilitätse<strong>in</strong>bußen e<strong>in</strong>e selbstständige<br />
Lebensführung aufrechterhalten oder wiedererlangen können.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, dass nicht alle Formen der Krankheitsbewältigung gleichermaßen adaptiv<br />
s<strong>in</strong>d, ist es wichtig, Ältere <strong>in</strong> ihrer psychischen Bewältigung von Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>bußen zu unterstützen.<br />
Ältere s<strong>in</strong>d deutlich häufiger von Erkrankungen <strong>und</strong> Unfällen betroffen als Jüngere. Sie<br />
s<strong>in</strong>d dadurch gleichermaßen stark belastet wie Jüngere <strong>und</strong> haben oftmals ger<strong>in</strong>gere soziale<br />
Ressourcen zur potentiellen Unterstützung, da nicht selten enge Angehörige bereits verstorben<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen war festzustellen,<br />
dass Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> der Regel über e<strong>in</strong>e Hausärzt<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>en Hausarzt<br />
verfügen. Es ist jedoch auch zu erkennen, dass die mediz<strong>in</strong>ische Versorgung alter<br />
Menschen nicht <strong>in</strong> allen Bereichen ideal ist. Hier ist <strong>in</strong>sbesondere auf die zahnmediz<strong>in</strong>ische<br />
Versorgung h<strong>in</strong>zuweisen. Es ist für die Vorsorge <strong>und</strong> Versorgung notwendig, dass auch alte<br />
Menschen regelmäßig e<strong>in</strong>e zahnärztliche Untersuchung erhalten <strong>und</strong> zwar auch dann, wenn sie<br />
nicht mehr über (alle) Zähne verfügen.<br />
Schließlich zeigt sich, dass besonders im Bereich nicht-mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen<br />
Möglichkeiten für Präventionsmaßnahmen bestehen, die zur Zeit nicht vollständig genutzt<br />
werden. Obwohl Erkrankungen <strong>und</strong> Beschwerden sowie Funktionse<strong>in</strong>bußen mit dem Alter zunehmen,<br />
kommt es zu ke<strong>in</strong>em altersabhängigen Anstieg der Nutzung von Heilhilfsbehandlungen.<br />
Dies macht deutlich, dass wesentliche Präventionspotenziale im Alter ungenutzt bleiben.<br />
Ärzte <strong>und</strong> Pflegekräfte sollten dar<strong>in</strong> unterstützt <strong>und</strong> geschult werden, bestehende Rehabilitationspotenziale<br />
Älterer zu erkennen. Aber auch ältere Personen selbst sollten über ihre Präventionspotenziale<br />
besser <strong>in</strong>formiert werden, damit sie die Möglichkeit haben, e<strong>in</strong>e stärkere Selbst-<br />
<strong>und</strong> Mitverantwortung für ihre Ges<strong>und</strong>heit zu übernehmen.<br />
333
7.8 Literatur<br />
334<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Baltes, P. B. (1997). On the <strong>in</strong>complete architecture of human ontogeny: selection, optimization,<br />
and compensation as fo<strong>und</strong>ation of developmental theory. American Psychologist,<br />
52(4), 366-380.<br />
Baltes, P. B., & Smith, J. (2003). New frontiers <strong>in</strong> the future of ag<strong>in</strong>g: from successful ag<strong>in</strong>g of<br />
the young old to the dilemmas of the fourth Age. Gerontology, 49, 123-135.<br />
Bergmann, E., & Kamtsiuris, P. (1999). Inanspruchnahme mediz<strong>in</strong>ischer Leistungen. Ges<strong>und</strong>heitswesen,<br />
61(2), 138-144.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Ed.). (2002). Vierter Bericht zur<br />
Lage der älteren Generation <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland: Risiken, Lebensqualität<br />
<strong>und</strong> Versorgung Hochaltriger unter besonderer Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen.<br />
Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend.<br />
D<strong>in</strong>kel, R. (1999). Demografische <strong>Entwicklung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszustand. E<strong>in</strong>e empirische Kalkulation<br />
der Healthy Life Expectancy für die B<strong>und</strong>esrepublik auf der Basis von Kohortendaten.<br />
In H. Häfner (Ed.), Ges<strong>und</strong>heit - unser höchstes Gut? (pp. 61-82). Berl<strong>in</strong>:<br />
Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Ebrahim, S. (1996). Pr<strong>in</strong>ciples of epidemiology <strong>in</strong> old age. In S. Ebrahim & A. Kalache (Eds.),<br />
Epidemiology <strong>in</strong> old age (pp. 12-21). London: BMJ.<br />
Filipp, S.-H. (2002). Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Lebensqualität hochbetagter Frauen <strong>und</strong> Männer. In<br />
Deutsches Zentrum für Altersfragen (Ed.), Expertisen zum vierten Altenbericht der<br />
B<strong>und</strong>esregierung, Band I: Das hohe Alter - Konzepte, Forschungsfelder, Lebensqualität.<br />
Hannover: V<strong>in</strong>centz.<br />
Förstl, H., Lauter, H., & Bickel, H. (2001). Ursachen <strong>und</strong> Behandlungskonzepte der Demenz. In<br />
Deutsches Zentrum für Altersfragen (Ed.), Gerontopsychiatrie <strong>und</strong> Alterspsychotherapie<br />
<strong>in</strong> Deutschland (pp. 113-199). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Fries, J. F. (1980). Ag<strong>in</strong>g, natural death, and the compression of morbidity. The New England<br />
Journal of Medic<strong>in</strong>e, 329, 110-116.<br />
Hoffmann, E., & Menn<strong>in</strong>g, S. (2004). Wie alt ist Deutschland? E<strong>in</strong> Blick auf 100 Jahre Bevölkerungsentwicklung.<br />
Informationsdienst Altersfragen, Deutsches Zentrum für Alterfragen,<br />
1, 2-9.<br />
Idler, E. L., & Kasl, S. V. (1991). Health perceptions and survival: Do global evaluations of<br />
health status really predict mortality? Journal of Gerontology, 46, 55-65.<br />
Idler, E. L., & Kasl, S. V. (1995). Self-rat<strong>in</strong>gs of health: do they also predict change <strong>in</strong> functional<br />
ability? Journal of Gerontology, 50B(6), 344.<br />
Kirchberger, I. (2000). Der SF-36-Fragebogen zum Ges<strong>und</strong>heitszustand: Anwendung, Auswertung<br />
<strong>und</strong> Interpretation. In U. Ravens-Sieberer & A. Cieza (Eds.), Lebensqualität <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsökonomie <strong>in</strong> der Mediz<strong>in</strong> (pp. 73-85). Landsberg: ecomed.
Kapitel 7: Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung<br />
Kramer, M. (1980). The ris<strong>in</strong>g pandemic of mental disorders and associated chronic diseases<br />
and disabilities. Acta Psychiatrica Scand<strong>in</strong>avica, 62, 397-419.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2000). Ges<strong>und</strong>heit. In M. Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite Lebenshälfte<br />
- Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-Surveys (pp. 102-<br />
123). Opladen: Leske + Budrich.<br />
L<strong>in</strong>den, M., Gilberg, R., Horgas, A. L., & Ste<strong>in</strong>hagen-Thiessen, E. (1996). Die Inanspruchnahme<br />
mediz<strong>in</strong>ischer <strong>und</strong> pflegerischer Hilfe im hohen Alter. In K. U. Mayer & P. B. Baltes<br />
(Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 475-495). Berl<strong>in</strong>: Akademie-Verlag.<br />
Manton, K. G., Stallard, E., & Corder, L. S. (1997). Changes <strong>in</strong> the age dependence of mortality<br />
and disability: cohort and other determ<strong>in</strong>ants. Demography, 34, 135-157.<br />
Mayer, K. U., & Baltes, P. B. (Eds.). (1996). Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie. Berl<strong>in</strong>: Akademie-<br />
Verlag.<br />
Menec, V. H., Chipperfield, J. G., & Raymond, P. P. (1999). Self-perceptions of health: a<br />
prospective analysis of mortality, control, and health. Journal of Gerontology: Psychological<br />
Sciences, 54B(2), P85-P93.<br />
Mielck, A. (2000). Soziale Ungleichheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Bern: Hans Huber.<br />
Mossey, J. M., & Shapiro, E. (1982). Self-rated health: a predictor of mortality among the elderly.<br />
American Journal of Public Health, 72(8), 800-808.<br />
Nitschke, I., & Hopfenmüller, W. (1996). Die zahnmediz<strong>in</strong>ische Versorgung älterer Menschen.<br />
In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 429-448). Berl<strong>in</strong>:<br />
Akademie-Verlag.<br />
Noll, H.-H., & Schöb, A. (2002). Lebensqualität im Alter. In Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
(Ed.), Expertisen zum vierten Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung. Band I: Das hohe<br />
Alter - Konzepte, Forschungsfelder, Lebensqualität. Hannover: V<strong>in</strong>centz.<br />
Radoschewski, M., & Bellach, B.-M. (1999). Der SF-36 im B<strong>und</strong>es- Ges<strong>und</strong>heits-Survey -<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> Anforderungen der Nutzung auf der Bevölkerungsebene. Ges<strong>und</strong>heitswesen,<br />
61(2), 191-199.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen (2001a). Bedarfsgerechtigkeit<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit, Band III.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen (2001b). Bedarfsgerechtigkeit<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit. Band I: Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierung <strong>und</strong><br />
Partizipation.<br />
Schneekloth, Z., & Müller, U. (1997). Hilfe- <strong>und</strong> Pflegebedürftige <strong>in</strong> Heimen. Endbericht zur<br />
Repräsentativerhebung "Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen selbstständiger Lebensführung <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>richtungen". Schriftenreihe. Bd. 147.2.<br />
Schwartz, F. W., & Walter, U. (1998). Altse<strong>in</strong> - Krankse<strong>in</strong>? In F. W. Schwartz (Ed.), Das Public-Health-Buch:<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen (pp. 124-140). München: Urban &<br />
Schwarzenberg.<br />
335
336<br />
Susanne Wurm, Clemens Tesch-Römer<br />
Sen, K. (1996). Gender. In S. Ebrahim & A. Kalache (Eds.), Epidemiology <strong>in</strong> old age (pp. 210-<br />
220). London: BMJ.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt. (2003). 10. Koord<strong>in</strong>ierte Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden.<br />
Staud<strong>in</strong>ger, U. M., & Bluck, S. (2001). A view on midlife development from life-span theory. In<br />
M. E. Lachman (Ed.), Handbook of midlife development (pp. 3-39). New York: John<br />
Wiley & Sons, Inc.<br />
Ste<strong>in</strong>hagen-Thiessen, E., & Borchelt, M. (1996). Morbidität, Medikation <strong>und</strong> Funktionalität im<br />
Alter. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 151-184).<br />
Berl<strong>in</strong>: Akademie-Verlag.<br />
Thefeld, W., Stolzenberg, H., & Bellach, B.-M. (1999). B<strong>und</strong>es-Ges<strong>und</strong>heitssurvey: Response,<br />
Zusammensetzung der Teilnehmer <strong>und</strong> Non-Responder-Analyse. Ges<strong>und</strong>heitswesen,<br />
61, Sonderheft 2, 57-61.<br />
Walter, U., & Schwartz, F. W. (2001). Ges<strong>und</strong>heit der Älteren <strong>und</strong> Potenziale der Prävention<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung. In Deutsches Zentrum für Altersfragen (Ed.), Expertisen<br />
zum Dritten Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung, Band 1 (pp. 145-252). Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
WHO (1986). Charta der Ersten Internationalen Konferenz zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>in</strong> Ottawa.<br />
Genf: WHO.<br />
WHO (1988). WHO MONICA project pr<strong>in</strong>cipal <strong>in</strong>vestigators: The World Health Organization<br />
MONICA Project (monitor<strong>in</strong>g trends and determ<strong>in</strong>ants of cardiovascular disease): a major<br />
<strong>in</strong>ternational collaboration. Journal of Cl<strong>in</strong>ical Epidemiology, 41, 105-114.
Tabelle A7.1: Körperliche Funktionsfähigkeit: Anstrengende Tätigkeit, z.B. schnell laufen, schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Stark Alte Länder 8,8% 10,8% 9,8% 23,6% 24,7% 24,2% 43,8% 57,1% 51,9% 20,6% 27,6% 24,3%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 9,0% 9,6% 9,3% 25,4% 26,9% 26,2% 41,1% 53,7% 49,2% 20,2% 26,6% 23,6%<br />
Gesamt 8,8% 10,5% 9,7% 24,0% 25,2% 24,6% 43,3% 56,4% 51,4% 20,5% 27,4% 24,2%<br />
Etwas Alte Länder 23,0% 29,3% 26,1% 35,6% 44,7% 40,3% 39,5% 37,0% 38,0% 30,6% 36,6% 33,8%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 25,4% 31,7% 28,5% 33,7% 36,9% 35,4% 39,9% 36,4% 37,7% 30,8% 34,7% 32,9%<br />
Gesamt 23,5% 29,8% 26,6% 35,2% 43,1% 39,3% 39,6% 36,9% 37,9% 30,7% 36,3% 33,6%<br />
Überhaupt nicht Alte Länder 68,2% 59,9% 64,1% 40,8% 30,6% 35,6% 16,8% 5,9% 10,1% 48,7% 35,7% 41,9%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 65,6% 58,7% 62,2% 40,8% 36,2% 38,4% 19,0% 9,9% 13,2% 49,0% 38,7% 43,5%<br />
Gesamt 67,7% 59,7% 63,7% 40,8% 31,8% 36,2% 17,2% 6,6% 10,7% 48,8% 36,3% 42,2%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.066, gewichtet)<br />
337
Tabelle A7.2: Körperliche Funktionsfähigkeit: Sich beugen, knien oder bücken<br />
338<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Stark e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 4,5% 4,0% 4,3% 10,2% 9,1% 9,6% 13,4% 24,5% 20,2% 8,2% 11,1% 9,7%<br />
Neue Länder 2,1% 4,8% 3,4% 10,7% 14,3% 12,5% 18,4% 34,0% 28,3% 7,9% 15,3% 11,8%<br />
Gesamt 4,0% 4,2% 4,1% 10,3% 10,2% 10,2% 14,2% 26,4% 21,7% 8,2% 11,9% 10,2%<br />
Etwas e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 7,9% 11,8% 9,8% 20,8% 24,3% 22,6% 36,6% 39,8% 38,5% 17,9% 23,3% 20,8%<br />
Neue Länder 13,2% 14,3% 13,7% 22,5% 27,3% 25,0% 34,8% 36,4% 35,8% 20,1% 24,4% 22,4%<br />
Gesamt 9,0% 12,3% 10,6% 21,1% 25,0% 23,1% 36,3% 39,1% 38,0% 18,3% 23,5% 21,1%<br />
Überhaupt nicht Alte Länder 87,6% 84,2% 85,9% 69,0% 66,6% 67,8% 50,0% 35,7% 41,3% 73,9% 65,6% 69,5%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 84,7% 81,0% 82,8% 66,9% 58,4% 62,4% 46,8% 29,6% 35,9% 72,0% 60,3% 65,8%<br />
Gesamt 87,0% 83,6% 85,3% 68,6% 64,9% 66,7% 49,4% 34,5% 40,2% 73,5% 64,5% 68,8%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.068, gewichtet)
Tabelle A7.3: Körperliche Funktionsfähigkeit: E<strong>in</strong>kaufstaschen heben, tragen<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Stark e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 3,3% 2,7% 3,0% 4,4% 9,7% 7,1% 11,0% 23,8% 18,9% 5,1% 10,6% 8,0%<br />
Neue Länder 0,5% 1,8% 1,1% 5,3% 10,6% 8,1% 11,3% 29,0% 22,6% 4,0% 11,6% 8,1%<br />
Gesamt 2,8% 2,5% 2,6% 4,6% 9,9% 7,3% 11,1% 24,8% 19,6% 4,9% 10,8% 8,0%<br />
Etwas e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 3,6% 8,3% 6,0% 12,3% 20,5% 16,5% 21,2% 40,6% 33,1% 10,0% 20,9% 15,8%<br />
Neue Länder 4,8% 10,7% 7,7% 10,1% 28,0% 19,4% 25,8% 42,6% 36,5% 10,1% 24,7% 17,9%<br />
Gesamt 3,9% 8,8% 6,3% 11,8% 22,1% 17,1% 22,1% 40,9% 33,7% 10,0% 21,7% 16,2%<br />
Überhaupt nicht Alte Länder 93,0% 89,0% 91,0% 83,3% 69,8% 76,4% 67,7% 35,6% 48,1% 84,8% 68,5% 76,2%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 94,7% 87,5% 91,1% 84,6% 61,5% 72,6% 62,9% 28,4% 40,9% 85,9% 63,8% 74,1%<br />
Gesamt 93,4% 88,7% 91,1% 83,6% 68,1% 75,6% 66,9% 34,2% 46,7% 85,0% 67,6% 75,8%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.069, gewichtet)<br />
339
Tabelle A7.4: Körperliche Funktionsfähigkeit: Mehrere Straßenkreuzungen weit zu Fuß gehen<br />
340<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Stark e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 3,3% 1,1% 2,2% 4,7% 4,7% 4,7% 13,4% 19,8% 17,3% 5,7% 7,2% 6,5%<br />
Neue Länder 1,1% 1,8% 1,4% 7,7% 5,6% 6,6% 12,1% 30,2% 23,7% 5,3% 10,1% 7,9%<br />
Gesamt 2,9% 1,2% 2,0% 5,3% 4,9% 5,1% 13,1% 21,8% 18,5% 5,6% 7,8% 6,7%<br />
Etwas e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 2,4% 3,2% 2,8% 6,5% 6,7% 6,6% 12,8% 18,9% 16,5% 5,8% 8,5% 7,2%<br />
Neue Länder 1,1% 4,8% 2,9% 8,9% 12,4% 10,7% 17,2% 19,1% 18,4% 6,5% 11,0% 8,9%<br />
Gesamt 2,1% 3,5% 2,8% 6,9% 7,9% 7,4% 13,6% 18,9% 16,9% 5,9% 9,0% 7,6%<br />
Überhaupt nicht Alte Länder 94,2% 95,7% 95,0% 88,9% 88,6% 88,7% 73,9% 61,3% 66,2% 88,5% 84,3% 86,3%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 97,9% 93,5% 95,7% 83,4% 82,0% 82,7% 70,7% 50,6% 57,9% 88,2% 78,9% 83,2%<br />
Gesamt 95,0% 95,3% 95,1% 87,8% 87,2% 87,5% 73,3% 59,2% 64,6% 88,5% 83,2% 85,7%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.066, gewichtet)
Tabelle A7.5: Körperliche Funktionsfähigkeit: E<strong>in</strong>en Treppenabsatz steigen<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Stark e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 2,4% 0,3% 1,4% 2,6% 2,3% 2,5% 7,1% 13,4% 10,9% 3,4% 4,4% 3,9%<br />
Neue Länder 0,0% 1,8% 0,9% 3,0% 2,5% 2,7% 8,2% 16,0% 13,2% 2,4% 5,5% 4,1%<br />
Gesamt 1,9% ,6% 1,3% 2,7% 2,4% 2,5% 7,3% 13,9% 11,4% 3,2% 4,6% 3,9%<br />
Etwas e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 2,1% 4,5% 3,3% 6,1% 9,4% 7,8% 12,8% 23,0% 19,0% 5,5% 11,0% 8,4%<br />
Neue Länder 2,7% 1,2% 1,9% 10,7% 12,4% 11,6% 18,4% 26,5% 23,6% 8,1% 11,4% 9,9%<br />
Gesamt 2,2% 3,9% 3,0% 7,1% 10,0% 8,6% 13,8% 23,7% 19,9% 6,1% 11,1% 8,7%<br />
Überhaupt nicht Alte Länder 95,5% 95,2% 95,3% 91,2% 88,3% 89,7% 80,1% 63,7% 70,0% 91,1% 84,7% 87,7%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 97,3% 97,0% 97,2% 86,4% 85,1% 85,7% 73,4% 57,4% 63,2% 89,5% 83,1% 86,1%<br />
Gesamt 95,8% 95,6% 95,7% 90,3% 87,6% 88,9% 78,9% 62,5% 68,8% 90,8% 84,3% 87,4%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.067, gewichtet)<br />
341
Tabelle A7.6: Körperliche Funktionsfähigkeit: Sich baden oder anziehen<br />
342<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Stark e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 1,5% 0,5% 1,0% 1,8% 2,1% 1,9% 4,2% 7,1% 6,0% 2,1% 2,8% 2,5%<br />
Neue Länder 0,0% 1,2% 0,6% 1,8% 1,2% 1,5% 5,0% 13,6% 10,5% 1,5% 4,2% 2,9%<br />
Gesamt 1,2% 0,7% 0,9% 1,8% 1,9% 1,8% 4,4% 8,3% 6,8% 2,0% 3,1% 2,5%<br />
Etwas e<strong>in</strong>geschränkt Alte Länder 1,5% 1,9% 1,7% 4,7% 2,6% 3,6% 11,3% 15,1% 13,6% 4,5% 5,6% 5,1%<br />
Neue Länder 0,5% 3,0% 1,7% 5,3% 4,4% 4,8% 14,5% 19,8% 17,8% 4,5% 7,6% 6,2%<br />
Gesamt 1,3% 2,1% 1,7% 4,8% 3,0% 3,9% 11,9% 16,0% 14,4% 4,5% 6,0% 5,3%<br />
Überhaupt nicht Alte Länder 97,0% 97,6% 97,3% 93,6% 95,3% 94,5% 84,5% 77,8% 80,4% 93,4% 91,7% 92,5%<br />
e<strong>in</strong>geschränkt Neue Länder 99,5% 95,8% 97,7% 92,9% 94,4% 93,7% 80,5% 66,7% 71,7% 94,0% 88,2% 90,9%<br />
Gesamt 97,5% 97,2% 97,4% 93,4% 95,1% 94,3% 83,8% 75,6% 78,8% 93,5% 91,0% 92,2%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.072, gewichtet)
Tabelle A7.7: Häufigkeit der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>er<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>ers <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 20,9% 15,7% 18,3% 14,4% 13,8% 14,1% 10,2% 7,4% 8,5% 16,5% 12,9% 14,6%<br />
Neue Länder 14,4% 15,4% 14,9% 13,5% 8,1% 10,7% 8,9% 3,7% 5,5% 13,2% 9,9% 11,4%<br />
Gesamt 19,6% 15,7% 17,6% 14,2% 12,6% 13,4% 10,0% 6,7% 7,9% 15,9% 12,3% 14,0%<br />
1 mal Alte Länder 23,3% 26,1% 24,7% 15,5% 15,6% 15,6% 8,2% 8,0% 8,1% 17,7% 17,8% 17,7%<br />
Neue Länder 22,3% 18,9% 20,7% 20,6% 16,1% 18,3% 5,7% 4,9% 5,2% 19,1% 14,5% 16,6%<br />
Gesamt 23,1% 24,7% 23,9% 16,6% 15,7% 16,1% 7,8% 7,4% 7,5% 18,0% 17,1% 17,5%<br />
2-6 mal Alte Länder 48,5% 47,5% 48,0% 46,9% 52,6% 49,9% 48,4% 51,2% 50,2% 47,9% 50,2% 49,1%<br />
Neue Länder 54,3% 52,7% 53,5% 38,8% 50,9% 45,1% 46,2% 44,8% 45,3% 47,2% 50,1% 48,8%<br />
Gesamt 49,7% 48,5% 49,1% 45,3% 52,3% 48,9% 48,0% 50,0% 49,2% 47,8% 50,2% 49,1%<br />
öfter Alte Länder 7,3% 10,7% 9,0% 23,2% 17,9% 20,5% 33,1% 33,4% 33,3% 17,8% 19,1% 18,5%<br />
Neue Länder 9,0% 13,0% 11,0% 27,1% 24,8% 25,9% 39,2% 46,6% 44,0% 20,6% 25,5% 23,2%<br />
Gesamt 7,6% 11,1% 9,4% 24,0% 19,4% 21,6% 34,2% 36,0% 35,3% 18,4% 20,4% 19,4%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.074, gewichtet)<br />
343
Tabelle A7.8: Häufigkeit der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Zahnärzt<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Zahnarztes <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
344<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 19,9% 11,7% 15,8% 21,9% 13,8% 17,8% 29,0% 34,0% 32,1% 22,3% 18,3% 20,2%<br />
Neue Länder 9,5% 6,0% 7,8% 13,5% 6,8% 10,0% 23,4% 31,3% 28,4% 13,2% 12,5% 12,8%<br />
Gesamt 17,8% 10,6% 14,2% 20,2% 12,4% 16,2% 28,0% 33,5% 31,4% 20,5% 17,1% 18,7%<br />
1 mal Alte Länder 40,4% 34,4% 37,4% 36,0% 38,8% 37,4% 41,5% 40,8% 41,1% 39,0% 37,6% 38,2%<br />
Neue Länder 39,7% 38,7% 39,2% 32,9% 37,3% 35,2% 38,0% 43,6% 41,5% 36,9% 39,4% 38,2%<br />
Gesamt 40,2% 35,3% 37,8% 35,4% 38,5% 37,0% 40,9% 41,3% 41,1% 38,5% 37,9% 38,2%<br />
2-6 mal Alte Länder 38,6% 50,1% 44,3% 38,9% 43,8% 41,4% 28,4% 24,5% 26,0% 36,8% 41,3% 39,2%<br />
Neue Länder 49,2% 51,8% 50,5% 51,2% 50,9% 51,0% 38,6% 24,5% 29,6% 48,3% 44,8% 46,4%<br />
Gesamt 40,7% 50,5% 45,5% 41,4% 45,3% 43,4% 30,2% 24,5% 26,7% 39,1% 42,0% 40,6%<br />
öfter Alte Länder 1,2% 3,7% 2,5% 3,2% 3,5% 3,4% 1,1% 0,6% 0,8% 1,9% 2,9% 2,4%<br />
Neue Länder 1,6% 3,6% 2,6% 2,4% 5,0% 3,7% 0,0% 0,6% 0,4% 1,6% 3,3% 2,5%<br />
Gesamt 1,3% 3,7% 2,5% 3,0% 3,8% 3,4% 0,9% 0,6% 0,7% 1,9% 3,0% 2,4%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.076, gewichtet)
Tabelle A7.9: Häufigkeit der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Augenärzt<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Augenarztes <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 66,2% 58,4% 62,3% 49,6% 44,7% 47,1% 38,7% 35,8% 36,9% 55,1% 47,8% 51,2%<br />
Neue Länder 60,1% 53,8% 57,0% 49,7% 41,6% 45,5% 32,5% 27,2% 29,1% 51,9% 43,0% 47,1%<br />
Gesamt 64,9% 57,5% 61,2% 49,6% 44,1% 46,7% 37,6% 34,1% 35,5% 54,4% 46,8% 50,4%<br />
1 mal Alte Länder 26,0% 33,9% 29,9% 39,0% 41,8% 40,4% 34,8% 32,7% 33,5% 32,3% 36,3% 34,4%<br />
Neue Länder 30,3% 39,6% 34,9% 31,4% 44,7% 38,3% 33,8% 34,6% 34,3% 31,3% 40,2% 36,0%<br />
Gesamt 26,9% 35,0% 30,9% 37,5% 42,4% 40,0% 34,6% 33,1% 33,6% 32,1% 37,1% 34,8%<br />
2-6 mal Alte Länder 7,6% 6,4% 7,0% 10,6% 12,1% 11,3% 24,2% 30,6% 28,1% 11,7% 14,7% 13,3%<br />
Neue Länder 9,0% 5,9% 7,5% 17,8% 12,4% 15,0% 31,8% 35,8% 34,4% 15,9% 15,5% 15,7%<br />
Gesamt 7,9% 6,3% 7,1% 12,0% 12,1% 12,1% 25,6% 31,6% 29,3% 12,5% 14,8% 13,7%<br />
öfter Alte Länder 0,3% 1,3% 0,8% 0,9% 1,5% 1,2% 2,3% 0,9% 1,4% 0,9% 1,3% 1,1%<br />
Neue Länder 0,5% 0,6% 0,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,9% 2,5% 2,3% 1,0% 1,3% 1,1%<br />
Gesamt 0,3% 1,2% 0,8% 0,9% 1,4% 1,2% 2,2% 1,2% 1,6% 0,9% 1,3% 1,1%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.071, gewichtet)<br />
345
Tabelle A7.10: Häufigkeit der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Hals-Nasen-Ohrenärzt<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Hals-Nasen-Ohrenarztes <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
346<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 84,2% 80,3% 82,3% 75,4% 80,3% 77,9% 73,3% 78,0% 76,2% 79,0% 79,7% 79,4%<br />
Neue Länder 81,8% 81,1% 81,4% 80,5% 75,8% 78,0% 70,9% 70,6% 70,7% 79,6% 76,6% 78,0%<br />
Gesamt 83,7% 80,4% 82,1% 76,5% 79,4% 78,0% 72,9% 76,6% 75,2% 79,1% 79,1% 79,1%<br />
1 mal Alte Länder 11,2% 12,8% 12,0% 16,4% 12,6% 14,5% 19,6% 12,5% 15,3% 14,6% 12,7% 13,6%<br />
Neue Länder 12,8% 10,1% 11,5% 11,2% 16,8% 14,1% 19,0% 18,4% 18,6% 13,2% 14,5% 13,9%<br />
Gesamt 11,5% 12,2% 11,9% 15,3% 13,5% 14,4% 19,5% 13,7% 15,9% 14,4% 13,0% 13,7%<br />
2-6 mal Alte Länder 4,2% 6,4% 5,3% 6,7% 6,5% 6,6% 6,8% 8,6% 7,9% 5,6% 7,0% 6,3%<br />
Neue Länder 4,3% 8,9% 6,6% 7,7% 6,8% 7,2% 9,5% 10,4% 10,1% 6,4% 8,5% 7,5%<br />
Gesamt 4,2% 6,9% 5,6% 6,9% 6,5% 6,7% 7,3% 8,9% 8,3% 5,8% 7,3% 6,6%<br />
öfter Alte Länder 0,3% 0,5% 0,4% 1,5% 0,6% 1,0% 0,3% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%<br />
Neue Länder 1,1% 0,0% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,4% 0,6%<br />
Gesamt 0,5% 0,4% 0,4% 1,3% 0,6% 0,9% 0,3% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.073, gewichtet)
Tabelle A7.11: Häufigkeit der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Orthopäd<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Orthopäden <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 75,2% 73,0% 74,1% 68,2% 61,8% 64,9% 71,9% 65,3% 67,9% 72,0% 67,1% 69,4%<br />
Neue Länder 75,0% 77,2% 76,1% 77,1% 66,5% 71,5% 71,3% 66,0% 68,0% 75,2% 70,6% 72,8%<br />
Gesamt 75,1% 73,9% 74,5% 70,1% 62,7% 66,3% 71,8% 65,5% 67,9% 72,7% 67,8% 70,1%<br />
1 mal Alte Länder 12,4% 9,9% 11,2% 15,4% 14,7% 15,1% 11,4% 11,0% 11,2% 13,3% 11,9% 12,5%<br />
Neue Länder 13,3% 12,6% 12,9% 10,6% 11,2% 10,9% 15,3% 15,4% 15,4% 12,6% 12,8% 12,7%<br />
Gesamt 12,6% 10,4% 11,5% 14,4% 14,0% 14,2% 12,1% 11,9% 11,9% 13,2% 12,0% 12,6%<br />
2-6 mal Alte Länder 10,3% 12,3% 11,3% 13,1% 19,4% 16,3% 13,9% 19,3% 17,2% 12,0% 16,6% 14,4%<br />
Neue Länder 9,6% 6,6% 8,1% 8,8% 16,8% 13,0% 10,2% 14,2% 12,8% 9,4% 12,1% 10,8%<br />
Gesamt 10,2% 11,1% 10,6% 12,2% 18,9% 15,6% 13,3% 18,3% 16,4% 11,5% 15,7% 13,7%<br />
öfter Alte Länder 2,1% 4,8% 3,5% 3,3% 4,1% 3,7% 2,8% 4,3% 3,7% 2,7% 4,4% 3,6%<br />
Neue Länder 2,1% 3,6% 2,8% 3,5% 5,6% 4,6% 3,2% 4,3% 3,9% 2,8% 4,5% 3,7%<br />
Gesamt 2,1% 4,6% 3,3% 3,3% 4,4% 3,9% 2,9% 4,3% 3,8% 2,7% 4,4% 3,6%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.056, gewichtet)<br />
347
Tabelle A7.12: Häufigkeit der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Internist<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Internisten <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
348<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 73,4% 69,4% 71,4% 64,3% 60,9% 62,6% 52,3% 57,6% 55,6% 66,3% 63,4% 64,8%<br />
Neue Länder 82,4% 77,7% 80,1% 69,8% 65,6% 67,6% 60,6% 73,6% 69,0% 74,3% 72,4% 73,3%<br />
Gesamt 75,3% 71,1% 73,2% 65,4% 61,9% 63,6% 53,8% 60,7% 58,1% 67,9% 65,2% 66,5%<br />
1 mal Alte Länder 15,7% 19,3% 17,5% 16,1% 16,2% 16,1% 17,1% 15,2% 15,9% 16,1% 17,1% 16,6%<br />
Neue Länder 7,4% 14,5% 10,9% 13,6% 16,9% 15,3% 12,3% 8,6% 9,9% 10,5% 13,9% 12,3%<br />
Gesamt 14,0% 18,3% 16,1% 15,6% 16,3% 16,0% 16,2% 13,9% 14,8% 15,0% 16,5% 15,8%<br />
2-6 mal Alte Länder 9,1% 8,6% 8,8% 14,6% 18,5% 16,6% 19,1% 19,2% 19,1% 12,9% 14,8% 13,9%<br />
Neue Länder 9,0% 5,4% 7,3% 12,4% 15,6% 14,1% 22,6% 13,5% 16,7% 12,4% 11,1% 11,7%<br />
Gesamt 9,1% 7,9% 8,5% 14,2% 17,9% 16,1% 19,7% 18,1% 18,7% 12,8% 14,0% 13,5%<br />
öfter Alte Länder 1,8% 2,7% 2,2% 5,0% 4,4% 4,7% 11,6% 8,0% 9,4% 4,7% 4,7% 4,7%<br />
Neue Länder 1,1% 2,4% 1,7% 4,1% 1,9% 3,0% 4,5% 4,3% 4,4% 2,8% 2,7% 2,7%<br />
Gesamt 1,7% 2,6% 2,1% 4,8% 3,9% 4,3% 10,3% 7,3% 8,5% 4,3% 4,3% 4,3%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.056, gewichtet)
Tabelle A7.13: Häufigkeit der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Gynäkolog<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Gynäkologen (Frauen) bzw. e<strong>in</strong>er Urolog<strong>in</strong>/e<strong>in</strong>es Urologen (Männer) <strong>in</strong> den<br />
letzten zwölf Monaten<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 89,4% 15,7% – 72,5% 27,1% – 65,2% 56,6% – 78,8% 30,3% –<br />
Neue Länder 88,8% 9,5% – 67,6% 23,0% – 50,3% 59,3% – 74,8% 26,4% –<br />
Gesamt 89,3% 14,5% – 71,5% 26,2% – 62,6% 57,1% – 78,0% 29,5% –<br />
1 mal Alte Länder 7,9% 52,0% – 15,8% 51,2% – 18,2% 32,1% – 12,7% 46,5% –<br />
Neue Länder 7,5% 46,7% – 17,1% 43,5% – 18,5% 27,8% – 12,8% 41,0% –<br />
Gesamt 7,8% 50,9% – 16,0% 49,6% – 18,3% 31,3% – 12,7% 45,4% –<br />
2-6 mal Alte Länder 2,1% 30,9% – 10,8% 21,5% – 15,7% 10,7% – 7,8% 22,4% –<br />
Neue Länder 3,7% 41,4% – 13,5% 32,3% – 29,3% 12,3% – 11,5% 31,1% –<br />
Gesamt 2,5% 33,1% – 11,4% 23,7% – 18,1% 11,0% – 8,5% 24,1% –<br />
öfter Alte Länder 0,6% 1,3% – 0,9% 0,3% – 0,9% 0,6% – 0,8% 0,8% –<br />
Neue Länder 0,0% 2,4% – 1,8% 1,2% – 1,9% 0,6% – 1,0% 1,5% –<br />
Gesamt 0,5% 1,5% – 1,1% 0,5% – 1,0% 0,6% – 0,8% 0,9% –<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 3.005/3.064, gewichtet)<br />
* Es erfolgte e<strong>in</strong>e getrennte Erhebung der Inanspruchnahme von Gynäkolog<strong>in</strong>nen bzw. Gynäkologen <strong>und</strong> Urolog<strong>in</strong>nen bzw. Urologen. Infolgedessen kann ke<strong>in</strong> für Männer <strong>und</strong> Frauen zusammengefasster<br />
Gesamtwert ermittelt werden.<br />
349
Tabelle A7.14: Häufigkeit der Inanspruchnahme von Apotheken <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
350<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 22,1% 7,7% 14,9% 9,9% 7,3% 8,6% 8,4% 6,9% 7,5% 15,1% 7,3% 11,0%<br />
Neue Länder 20,9% 8,4% 14,8% 14,7% 10,9% 12,7% 14,6% 9,7% 11,4% 17,7% 9,6% 13,4%<br />
Gesamt 21,8% 7,8% 14,9% 10,9% 8,0% 9,4% 9,5% 7,4% 8,2% 15,6% 7,8% 11,5%<br />
1 mal Alte Länder 12,1% 6,8% 9,4% 7,7% 5,6% 6,6% 4,5% 2,9% 3,5% 9,1% 5,4% 7,1%<br />
Neue Länder 9,3% 7,1% 8,2% 7,7% 1,4% 4,4% 1,5% 2,8% 2,3% 7,5% 4,0% 5,6%<br />
Gesamt 11,5% 6,9% 9,2% 7,7% 4,7% 6,2% 4,0% 2,9% 3,3% 8,8% 5,1% 6,8%<br />
2-6 mal Alte Länder 51,7% 59,6% 55,6% 53,5% 54,6% 54,1% 46,1% 49,6% 48,3% 51,4% 55,3% 53,4%<br />
Neue Länder 59,3% 70,1% 64,6% 47,4% 57,8% 52,9% 48,9% 47,6% 48,1% 53,3% 60,3% 57,0%<br />
Gesamt 53,3% 61,7% 57,5% 52,3% 55,3% 53,8% 46,6% 49,2% 48,2% 51,7% 56,3% 54,2%<br />
öfter Alte Länder 14,1% 26,0% 20,0% 28,8% 32,5% 30,7% 41,0% 40,6% 40,7% 24,4% 32,0% 28,4%<br />
Neue Länder 10,5% 14,3% 12,3% 30,1% 29,9% 30,0% 35,0% 40,0% 38,2% 21,6% 26,1% 24,0%<br />
Gesamt 13,4% 23,6% 18,5% 29,1% 31,9% 30,5% 39,9% 40,5% 40,3% 23,8% 30,8% 27,5%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.740, gewichtet)
Tabelle A.7.15: Häufigkeit der Inanspruchnahme von Massagen, Fango, Bäder <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 86,9% 76,4% 81,7% 83,1% 74,4% 78,7% 82,3% 77,5% 79,4% 84,7% 76,0% 80,1%<br />
Neue Länder 82,5% 68,4% 75,5% 79,2% 69,4% 74,1% 76,6% 76,4% 76,5% 80,4% 70,7% 75,2%<br />
Gesamt 86,0% 74,8% 80,4% 82,3% 73,4% 77,8% 81,3% 77,3% 78,8% 83,8% 74,9% 79,1%<br />
1 mal Alte Länder 3,1% 5,6% 4,3% 1,6% 5,2% 3,5% 2,6% 4,7% 3,9% 2,5% 5,3% 3,9%<br />
Neue Länder 0,6% 4,5% 2,5% 4,4% 4,8% 4,6% 5,8% 4,9% 5,2% 2,8% 4,7% 3,8%<br />
Gesamt 2,6% 5,4% 4,0% 2,2% 5,1% 3,7% 3,1% 4,7% 4,1% 2,5% 5,1% 3,9%<br />
2-6 mal Alte Länder 4,5% 10,6% 7,5% 7,3% 10,5% 8,9% 7,7% 10,5% 9,4% 6,1% 10,5% 8,4%<br />
Neue Länder 12,3% 15,5% 13,9% 11,3% 17,7% 14,6% 8,8% 10,4% 9,8% 11,4% 15,0% 13,3%<br />
Gesamt 6,1% 11,6% 8,8% 8,1% 12,0% 10,1% 7,9% 10,5% 9,5% 7,2% 11,5% 9,4%<br />
öfter Alte Länder 5,5% 7,4% 6,4% 8,0% 9,8% 8,9% 7,4% 7,2% 7,3% 6,7% 8,2% 7,5%<br />
Neue Länder 4,7% 11,6% 8,1% 5,0% 8,2% 6,7% 8,8% 8,3% 8,5% 5,4% 9,6% 7,7%<br />
Gesamt 5,3% 8,2% 6,8% 7,4% 9,5% 8,5% 7,7% 7,5% 7,5% 6,5% 8,5% 7,5%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.748, gewichtet)<br />
351
Tabelle A7.16: Häufigkeit der Inanspruchnahme von Fußpflege <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
352<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 94,1% 79,3% 86,7% 91,0% 70,6% 80,6% 86,4% 65,5% 73,5% 91,6% 72,7% 81,6%<br />
Neue Länder 95,3% 82,6% 89,1% 89,3% 66,9% 77,7% 75,2% 56,8% 63,3% 90,0% 70,7% 79,7%<br />
Gesamt 94,4% 80,0% 87,2% 90,7% 69,8% 80,0% 84,4% 63,8% 71,6% 91,3% 72,3% 81,2%<br />
1 mal Alte Länder 1,4% 5,0% 3,2% 1,6% 5,2% 3,5% 2,3% 5,0% 4,0% 1,6% 5,1% 3,5%<br />
Neue Länder 2,3% 3,9% 3,1% 4,4% 6,1% 5,3% 4,4% 2,7% 3,3% 3,4% 4,4% 3,9%<br />
Gesamt 1,6% 4,8% 3,2% 2,2% 5,4% 3,8% 2,6% 4,6% 3,8% 2,0% 5,0% 3,6%<br />
2-6 mal Alte Länder 2,4% 11,2% 6,8% 4,2% 14,7% 9,6% 8,1% 19,4% 15,1% 4,1% 14,6% 9,6%<br />
Neue Länder 1,7% 12,9% 7,2% 4,4% 16,9% 10,9% 13,9% 26,4% 21,9% 4,6% 17,6% 11,6%<br />
Gesamt 2,3% 11,6% 6,9% 4,2% 15,2% 9,8% 9,1% 20,8% 16,4% 4,2% 15,2% 10,0%<br />
öfter Alte Länder 2,1% 4,4% 3,3% 3,2% 9,5% 6,4% 3,2% 10,1% 7,4% 2,7% 7,6% 5,3%<br />
Neue Länder 0,6% 0,6% 0,6% 1,9% 10,1% 6,2% 6,6% 14,2% 11,5% 2,0% 7,3% 4,8%<br />
Gesamt 1,8% 3,7% 2,7% 2,9% 9,6% 6,4% 3,8% 10,9% 8,2% 2,6% 7,6% 5,2%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.750, gewichtet)
Tabelle A7.17: Häufigkeit der Inanspruchnahme von Krankengymnastik <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 87,9% 85,8% 86,8% 84,4% 79,9% 82,2% 89,6% 81,8% 84,8% 86,9% 82,8% 84,7%<br />
Neue Länder 92,4% 85,2% 88,9% 92,4% 88,4% 90,3% 91,2% 83,9% 86,6% 92,2% 86,0% 88,9%<br />
Gesamt 88,8% 85,7% 87,3% 86,0% 81,7% 83,8% 89,9% 82,2% 85,1% 88,0% 83,4% 85,6%<br />
1 mal Alte Länder 3,1% 2,4% 2,7% 1,9% 2,0% 1,9% 2,3% 2,5% 2,4% 2,5% 2,3% 2,4%<br />
Neue Länder 1,7% 4,5% 3,1% 1,3% 3,4% 2,4% 1,5% 3,5% 2,8% 1,5% 3,9% 2,8%<br />
Gesamt 2,8% 2,8% 2,8% 1,8% 2,3% 2,0% 2,1% 2,7% 2,5% 2,3% 2,6% 2,5%<br />
2-6 mal Alte Länder 4,2% 4,7% 4,4% 5,4% 6,6% 6,0% 3,9% 7,3% 6,0% 4,6% 6,0% 5,3%<br />
Neue Länder 3,5% 4,5% 4,0% 3,2% 4,8% 4,0% 3,6% 6,3% 5,3% 3,4% 5,0% 4,3%<br />
Gesamt 4,0% 4,7% 4,3% 5,0% 6,2% 5,6% 3,9% 7,1% 5,9% 4,3% 5,8% 5,1%<br />
öfter Alte Länder 4,8% 7,1% 6,0% 8,3% 11,5% 9,9% 4,2% 8,4% 6,8% 6,0% 8,9% 7,5%<br />
Neue Länder 2,3% 5,8% 4,0% 3,2% 3,4% 3,3% 3,6% 6,3% 5,3% 2,8% 5,1% 4,0%<br />
Gesamt 4,3% 6,8% 5,6% 7,2% 9,8% 8,6% 4,1% 8,0% 6,5% 5,4% 8,1% 6,8%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.739, gewichtet)<br />
353
Tabelle A7.18: Häufigkeit der Inanspruchnahme Haushaltshilfen <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
354<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 94,5% 92,3% 93,4% 91,4% 88,7% 90,0% 87,1% 76,9% 80,9% 92,0% 87,1% 89,4%<br />
Neue Länder 99,4% 96,8% 98,1% 98,1% 99,3% 98,7% 95,7% 82,2% 87,0% 98,3% 94,1% 96,1%<br />
Gesamt 95,5% 93,2% 94,4% 92,8% 90,9% 91,8% 88,6% 77,9% 82,0% 93,3% 88,5% 90,7%<br />
1 mal Alte Länder 0,0% 0,9% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 1,1% 0,9% 0,2% 0,7% 0,5%<br />
Neue Länder 0,0% 0,6% 0,3% 0,0% 0,7% 0,4% 0,7% 3,4% 2,5% 0,1% 1,3% 0,8%<br />
Gesamt 0,0% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,7% 1,5% 1,2% 0,2% 0,9% 0,6%<br />
2-6 mal Alte Länder 1,0% 0,6% 0,8% 1,9% 2,6% 2,3% 1,3% 3,6% 2,7% 1,4% 2,1% 1,7%<br />
Neue Länder 0,0% 0,6% 0,3% 1,3% 0,0% 0,6% 0,7% 4,1% 2,9% 0,6% 1,3% 0,9%<br />
Gesamt 0,8% 0,6% 0,7% 1,8% 2,1% 1,9% 1,2% 3,7% 2,7% 1,2% 1,9% 1,6%<br />
öfter Alte Länder 4,5% 6,2% 5,3% 6,4% 8,4% 7,4% 10,9% 18,4% 15,5% 6,4% 10,1% 8,3%<br />
Neue Länder 0,6% 1,9% 1,2% 0,6% 0,0% 0,3% 2,9% 10,3% 7,6% 1,0% 3,3% 2,2%<br />
Gesamt 3,7% 5,3% 4,5% 5,2% 6,7% 6,0% 9,5% 16,8% 14,1% 5,3% 8,7% 7,1%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.756, gewichtet)
Tabelle A7.19: Häufigkeit der Inanspruchnahme von Heilpraktikerbehandlungen <strong>in</strong> den letzten zwölf Monaten<br />
Geburtsjahrgang (Alter) 1948-62 (40-54Jahre) 1933-47 (55-69 Jahre) 1917-32 (70-85 Jahre) Gesamt (40-85 Jahre)<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
nie Alte Länder 93,4% 92,3% 92,9% 95,2% 93,1% 94,2% 97,7% 92,4% 94,5% 94,9% 92,6% 93,7%<br />
Neue Länder 98,3% 98,1% 98,2% 95,6% 93,2% 94,3% 97,0% 95,1% 95,8% 97,1% 95,6% 96,3%<br />
Gesamt 94,4% 93,5% 94,0% 95,3% 93,1% 94,2% 97,6% 92,9% 94,7% 95,3% 93,2% 94,2%<br />
1 mal Alte Länder 1,7% 1,2% 1,5% 2,2% 1,3% 1,8% 0,7% 1,1% 0,9% 1,7% 1,2% 1,4%<br />
Neue Länder 0,0% 0,6% 0,3% 1,9% 3,4% 2,7% 0,0% 2,1% 1,3% 0,7% 2,0% 1,4%<br />
Gesamt 1,4% 1,1% 1,2% 2,2% 1,7% 1,9% 0,5% 1,3% 1,0% 1,5% 1,4% 1,4%<br />
2-6 mal Alte Länder 3,4% 4,7% 4,1% 2,5% 3,3% 2,9% 1,0% 4,3% 3,0% 2,7% 4,1% 3,4%<br />
Neue Länder 1,2% 0,6% 0,9% 1,9% 2,1% 2,0% 3,0% 2,1% 2,4% 1,7% 1,5% 1,6%<br />
Gesamt 3,0% 3,9% 3,4% 2,4% 3,0% 2,7% 1,3% 3,9% 2,9% 2,5% 3,6% 3,1%<br />
öfter Alte Länder 1,4% 1,8% 1,6% 0,0% 2,3% 1,2% 0,7% 2,2% 1,6% 0,7% 2,0% 1,4%<br />
Neue Länder 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 1,4% 1,0% 0,0% 0,7% 0,4% 0,5% 0,9% 0,7%<br />
Gesamt 1,2% 1,5% 1,4% ,1% 2,1% 1,1% 0,5% 1,9% 1,4% ,7% 1,8% 1,3%<br />
Quelle: Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.739, gewichtet)<br />
355
356
8. Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte<br />
Susanne Wurm<br />
8.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Vermutlich <strong>in</strong> allen Phasen des Lebens, von der K<strong>in</strong>dheit bis zum hohen Alter, ist die Ges<strong>und</strong>heit<br />
e<strong>in</strong> zentrales Kriterium für das persönliche Ausmaß an Lebensqualität (Whitbourne, 2002).<br />
Mit steigendem Alter ist e<strong>in</strong>e gute Ges<strong>und</strong>heit jedoch zunehmend weniger selbstverständlich. In<br />
Kapitel 7 wurde aufgezeigt, wie sich die Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte entwickelt.<br />
Deutlich wurde hierbei, dass sich das Alter nicht e<strong>in</strong>fach mit Krankheit gleichsetzen lässt, sondern<br />
sich im höheren, ebenso wie im mittleren Erwachsenenalter, e<strong>in</strong>e hohe Variabilität zeigt<br />
<strong>und</strong> somit manche Menschen <strong>in</strong> guter, andere <strong>in</strong> schlechter Ges<strong>und</strong>heit altern.<br />
Diese auch <strong>in</strong> anderen Studien gewonnene Erkenntnis spiegelt sich <strong>in</strong> der von Gerok <strong>und</strong><br />
Brandtstädter (1994) getroffenen Unterscheidung von „normalem“, „krankhaften“ <strong>und</strong> „optimalen“<br />
Altern wider. Während „normales Altern“ den Autoren zufolge nur durch „alterstypische“<br />
E<strong>in</strong>bußen gekennzeichnet ist, umfasst „krankhaftes“ Altern das Vorhandense<strong>in</strong> von spezifischen<br />
Krankheiten, Leistungs- <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen. Das „optimale“ Altern lässt sich schließlich<br />
durch e<strong>in</strong>e (gegenüber der Vergleichspopulation) überdurchschnittliche Lebenszeit, organische<br />
Funktionstüchtigkeit <strong>und</strong> subjektive Lebensqualität charakterisieren (Gerok & Brandtstädter,<br />
1994).<br />
E<strong>in</strong>e solche Unterscheidung setzt nicht nur e<strong>in</strong>er simplifizierenden Gleichsetzung von Alter <strong>und</strong><br />
Krankheit e<strong>in</strong>e differentielle Sicht auf den Alterungsprozess entgegen, sie bildet vor allem<br />
zugleich die Gr<strong>und</strong>lage für die Frage: Von welchen E<strong>in</strong>flussfaktoren hängt optimales Altern<br />
beziehungsweise e<strong>in</strong> Altern <strong>in</strong> guter Ges<strong>und</strong>heit ab?<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der demografischen Veränderungen mehren sich seit e<strong>in</strong>igen Jahren zu<br />
dieser Frage Studien unterschiedlicher diszipl<strong>in</strong>ärer Ausrichtung, unter anderem der Soziologie,<br />
Sportwissenschaft <strong>und</strong> Psychologie. In soziologischen Untersuchungen wird besonders der Frage<br />
nachgegangen, welche Aspekte sozialer Ungleichheit die Ges<strong>und</strong>heit im Alter bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Diese Betrachtung vollzieht sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die gesellschaftlichen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
(Makrosystem, Bronfenbrenner, 1979). Sportwissenschaft <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologie<br />
beschäftigen sich h<strong>in</strong>gegen mit der Bedeutung des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens. Schließlich befasst<br />
sich die Psychologie darüber h<strong>in</strong>aus auch mit der Frage, welchen E<strong>in</strong>fluss Emotionen <strong>und</strong> Kognitionen<br />
auf die Ges<strong>und</strong>heit im Alter haben. Im Gegensatz zur soziologischen Betrachtung, <strong>in</strong><br />
der stärker das Makrosystem im Vordergr<strong>und</strong> steht, konzentrieren sich Sportwissenschaften <strong>und</strong><br />
Psychologie stärker auf das e<strong>in</strong>zelne Individuum (Mikrosystem, Bronfenbrenner, 1979). Diese<br />
diszipl<strong>in</strong>spezifischen H<strong>in</strong>tergründe implizieren, dass oftmals entweder nur die Bedeutung sozialer<br />
Ungleichheit oder des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens oder der psychischen Ressourcen <strong>und</strong> Risiken<br />
357
358<br />
Susanne Wurm<br />
berücksichtigt wird, während nur selten die verschiedenen E<strong>in</strong>flussfaktoren vergleichend untersucht<br />
werden (Mielck, 2000).<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> verfolgt das vorliegende Kapitel das Ziel, soziale, (ges<strong>und</strong>heits-) verhaltensbezogene<br />
<strong>und</strong> psychische E<strong>in</strong>flussfaktoren für Ges<strong>und</strong>heit gleichermaßen zu berücksichtigen.<br />
Dabei geht das vorliegende Kapitel der Frage nach, <strong>in</strong>wieweit diese Faktoren bis <strong>in</strong>s hohe Alter<br />
relevant bleiben oder ob sich ihre jeweilige Bedeutung für die Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong>nerhalb der zweiten<br />
Lebenshälfte verändert.<br />
Physiologische Alterungsprozesse <strong>und</strong> chronische Erkrankungen haben e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung<br />
für die Ges<strong>und</strong>heit im Alter. Zugleich sollte die Bedeutung der subjektiv wahrgenommenen<br />
Ges<strong>und</strong>heit nicht unterschätzt werden, da sie e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e bessere Mortalitätsprognose als<br />
körperliche Erkrankungen ermöglicht (Idler & Benyam<strong>in</strong>i, 1997; Idler & Kasl, 1991; Menec,<br />
Chipperfield, & Raymond, 1999; Mossey & Shapiro, 1982; vgl. Kap. 7 <strong>in</strong> diesem Band) <strong>und</strong><br />
zugleich als e<strong>in</strong> Kriterium „optimalen“ Alterns anzusehen ist. Deshalb werden <strong>in</strong> den nachfolgenden<br />
Betrachtungen beide Ges<strong>und</strong>heitsaspekte berücksichtigt.<br />
E<strong>in</strong>er Vielzahl von Studien, die sich mit E<strong>in</strong>flussfaktoren für Ges<strong>und</strong>heit beschäftigen, liegen<br />
Querschnittsdaten zugr<strong>und</strong>e, die den Nachteil haben, dass Alters- <strong>und</strong> Kohorteneffekte nicht<br />
differenziert werden können <strong>und</strong> ke<strong>in</strong>e Aussagen über die Richtung der gef<strong>und</strong>enen Zusammenhänge<br />
zulassen. Im Gegensatz dazu ermöglichen Längsschnittdaten wie die des Alterssurveys,<br />
mit Hilfe von Indikatoren, die zu e<strong>in</strong>em Messzeitpunkt erhoben wurden, zu betrachten,<br />
wie gut diese die Ges<strong>und</strong>heit zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt vorhersagen können <strong>und</strong> welche Bedeutung<br />
diesen Indikatoren für die <strong>Entwicklung</strong> der Ges<strong>und</strong>heit zukommt.<br />
Erkenntnisse darüber, welche Faktoren zu e<strong>in</strong>em Altern <strong>in</strong> guter körperlicher wie subjektiver<br />
Ges<strong>und</strong>heit beitragen, geben wichtige Anhaltspunkte für Maßnahmen der Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung.<br />
Jahrzehntelang waren die höheren Altersgruppen, <strong>in</strong>sbesondere die Hochbetagten<br />
ke<strong>in</strong>e Zielgruppe präventiver Maßnahmen, da von dem „Dogma der morphologischen<br />
<strong>und</strong> physiologischen Unveränderlichkeit von E<strong>in</strong>bußen im Alter“ (Walter & Schwartz, 2001,<br />
S.192) ausgegangen wurde. Mittlerweile liegen jedoch zahlreiche Studien vor, die auf die großen<br />
Präventions- <strong>und</strong> Rehabilitationspotenziale Älterer h<strong>in</strong>weisen <strong>und</strong> deutlich machen, dass<br />
unausgeschöpfte Präventionspotenziale besonders h<strong>in</strong>sichtlich chronischer Erkrankungen <strong>und</strong><br />
physiologischer Alterungsprozesse bestehen (Kruse, 2002).<br />
Der nachfolgende Abschnitt 8.2 geht zunächst auf verschiedene Wirkfaktoren für Ges<strong>und</strong>heit<br />
e<strong>in</strong>. Im Zentrum steht dabei die nähere Beschreibung sozialer, verhaltensbezogener <strong>und</strong> psychischer<br />
Faktoren <strong>und</strong> ihrer Bedeutung für Ges<strong>und</strong>heit. Der Abschnitt schließt mit e<strong>in</strong>er Formulierung<br />
der Fragestellung ab. In Abschnitt 8.3 werden die Methoden beschrieben, d.h. Indikatoren<br />
<strong>und</strong> Auswertungsverfahren vorgestellt, die <strong>in</strong> der vorliegenden Untersuchung zum E<strong>in</strong>satz kamen.<br />
Der vierte Abschnitt des Kapitels (Abschnitt 8.4) enthält die Ergebnisse zur Vorhersage<br />
von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen. Abschließend erfolgt e<strong>in</strong>e Zusammenfassung<br />
sowie e<strong>in</strong>e Ableitung von Implikationen der vorliegenden Bef<strong>und</strong>e (vgl. Abschnitt 8.5, 8.6).
Kapitel 8: : Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
8.2 Wirkfaktoren für Ges<strong>und</strong>heit<br />
Nach zentralen E<strong>in</strong>flussfaktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankheit im Alter wird ausgehend von<br />
mehreren Modellansätzen gesucht: E<strong>in</strong>leitend werden auf der Gr<strong>und</strong>lage biomediz<strong>in</strong>ischer Ansätze<br />
(1) universelle physiologische Faktoren beschrieben, die hier aufgr<strong>und</strong> ihrer Bedeutung<br />
erwähnt werden, jedoch <strong>in</strong> nachfolgenden Auswertungen unberücksichtigt bleiben. Daran<br />
schließen sich Modelle an, die versuchen, die <strong>in</strong>dividuell unterschiedlich verlaufende Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
zu erklären:<br />
Umweltmodelle heben besonders den Stellenwert (2) sozialer Ungleichheit für die Ges<strong>und</strong>heit<br />
hervor, während Modelle der Verhaltensmediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologie (3) das <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsverhalten als wichtigen E<strong>in</strong>flussfaktor für die Ges<strong>und</strong>heit erachten. Weitere<br />
(ges<strong>und</strong>heits-) psychologische Ansätze beschäftigen sich mit (4) der Bedeutung von Emotionen<br />
<strong>und</strong> Kognitionen für die Ges<strong>und</strong>heit. Neuere Forschungsansätze betrachten h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Bedeutung von Kognitionen besonders, <strong>in</strong>wieweit auch (5) Vorstellungen über das Altern e<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heit im Alter haben.<br />
8.2.1 Physiologische Faktoren<br />
Der Alterungsprozess ist bereits alle<strong>in</strong> aufgr<strong>und</strong> altersphysiologischer Veränderungen mit nachlassender<br />
Ges<strong>und</strong>heit verb<strong>und</strong>en. Biomediz<strong>in</strong>ische Ansätze zur Erklärung von Ges<strong>und</strong>heit berücksichtigen<br />
vor allem Krankheiten, biochemische Prozesse <strong>und</strong> seit jüngerer Zeit auch verstärkt<br />
genetische Ursachen.<br />
Diskutiert wird <strong>in</strong> diesem Zusammenhang, ob physiologische Abbauprozesse biologisch determ<strong>in</strong>iert<br />
s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>er Art „programmierter Alterung“ folgen oder ob sie eher Folge von<br />
zufälligen Fehlern s<strong>in</strong>d (Kirkwood, 1996; Whitbourne, 2001). In diesem Kontext wird beispielsweise<br />
die Bedeutung metabolischer Prozesse diskutiert (etwa die Annahme alterskorrelierter<br />
Schädigungen durch die beim Stoffwechsel notwendigerweise auftretenden freien Radikale)<br />
sowie die mit dem Alter nachlassenden Reparaturmechanismen auf der Zellebene (etwa die<br />
sogenannte „Fehler-Katastrophen-Theorie“, die akkumulierte Fehler bei der DNA-Replikation<br />
annimmt).<br />
Klassische ontogenetische Modelle gehen davon aus, dass das Altern universell ist (also alle<br />
Menschen gleichermaßen betrifft), sequentiell (<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er festgelegten Abfolge) verläuft <strong>und</strong> irreversibel<br />
ist (Aldw<strong>in</strong> & Gilmer, 2004). Aus diesem Gr<strong>und</strong> stellt sich <strong>in</strong>nerhalb des Rahmens<br />
genetischer Modelle sowie anderer biomediz<strong>in</strong>ischer Ansätze höchstens die Frage von Kuration<br />
(im Falle von Krankheiten), nicht jedoch die Frage nach Möglichkeiten von Prävention <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung (Seger, 1999).<br />
So wichtig genetische Faktoren s<strong>in</strong>d, die besten Schätzungen gehen dah<strong>in</strong>, dass sie immer noch<br />
weniger als die Hälfte der Varianz von Krankheit <strong>und</strong> Mortalität im Alter erklären können<br />
(McClearn & Heller, 2000). Dies macht deutlich, dass weitere Faktoren daran beteiligt se<strong>in</strong><br />
müssen, <strong>in</strong> welcher Ges<strong>und</strong>heit Personen altern. Es wurden hierzu umwelt- <strong>und</strong> personenbezo-<br />
359
360<br />
Susanne Wurm<br />
gene Modelle entwickelt <strong>und</strong> <strong>in</strong> zahlreichen Studien der E<strong>in</strong>fluss entsprechender Modell<strong>in</strong>dikatoren<br />
auf die Ges<strong>und</strong>heit im Alter nachgewiesen, die nachfolgend dargestellt werden.<br />
8.2.2 Soziale Faktoren<br />
Zu zentralen Wirkfaktoren zählen im S<strong>in</strong>ne von „Umweltmodellen“ (z.B. Whitman, 1999) zunächst<br />
soziokulturelle, ökonomische <strong>und</strong> ökologische Faktoren, unter anderem Bildungsstand,<br />
Berufsstatus, E<strong>in</strong>kommen, Geschlecht, Familienstand <strong>und</strong> regionale Faktoren.<br />
In Rahmen von „Umweltmodellen“ wird besonders der Frage nachgegangen, welcher Zusammenhang<br />
zwischen sozialer Ungleichheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit besteht. Dabei wird im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er<br />
vertikalen Struktur sozialer Ungleichheit die gesellschaftlich hervorgebrachte Struktur ungleicher<br />
Verteilung knapper materieller <strong>und</strong> immaterieller Ressourcen verstanden (Knesebeck,<br />
1998). Der Begriff vertikal soll dabei ausdrücken, dass diese Merkmale e<strong>in</strong>e Unterteilung der<br />
Bevölkerung <strong>in</strong> oben <strong>und</strong> unten ermöglichen. Als zentrale vertikale Merkmale gelten zumeist<br />
vor allem Unterschiede <strong>in</strong> Bildung, E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Sozialstatus.<br />
In empirischen Studien wurde wiederholt gezeigt, dass die Sterblichkeit von Personen mit ger<strong>in</strong>ger<br />
Bildung höher ist, als von jenen mit hoher Bildung; ebenso gehen e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger beruflicher<br />
Status <strong>und</strong> e<strong>in</strong> niedriges E<strong>in</strong>kommen mit kürzerer Lebenserwartung e<strong>in</strong>her (Helmert, 2003;<br />
Helmert & Voges, 2002; Mielck, 2000; Mielck & Helmert, 1993). E<strong>in</strong>e Auswertung der Daten<br />
von über 112.000 AOK-Mitgliedern ergab, dass das Sterblichkeitsrisiko <strong>in</strong> Berufen mit ger<strong>in</strong>gem<br />
Berufsstatus viermal so hoch ist gegenüber dem Sterblichkeitsrisiko von Personen, die<br />
e<strong>in</strong>en Beruf mit hohem beruflichen Status ausüben (Mielck, 2000). H<strong>in</strong>sichtlich der Morbidität<br />
konnte unter anderem gezeigt werden, dass Erwachsene aus niedrigen sozialen Schichten häufiger<br />
e<strong>in</strong>en Herz<strong>in</strong>farkt erleiden, häufiger unter psychischen Störungen leiden <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere<br />
subjektive E<strong>in</strong>schätzung der eigenen Ges<strong>und</strong>heit angeben als Erwachsene aus höheren sozialen<br />
Schichten (Helmert, 2003; Marmot et al., 1991; Mielck, 2000).<br />
Entscheidend für soziale Ungleichheit ist, dass e<strong>in</strong> „sozialer Unterschied“ mit Vor- <strong>und</strong> Nachteilen<br />
verb<strong>und</strong>en ist. Soziale Unterschiede f<strong>in</strong>den sich deshalb nicht nur auf e<strong>in</strong>er vertikalen, sondern<br />
auch h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>er horizontalen Gesellschaftsbetrachtung. Als zentrale Aspekte horizontaler<br />
Unterschiede gelten unter anderem Alter, Geschlecht, Familienstand <strong>und</strong> Zahl der K<strong>in</strong>der.<br />
Geschlechtsspezifische Ges<strong>und</strong>heitsdifferenzen zeigen sich <strong>in</strong> der höheren Mortalitätsrate<br />
von Männern <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er höheren Morbiditätsrate von Frauen (Sen, 1996; zu Geschlechtsunterschieden<br />
im Alter siehe auch Kruse & Schmitt, 2002). Für den Familienstand konnte wiederholt<br />
gezeigt werden, dass Personen, die mit e<strong>in</strong>em Partner zusammenleben, e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit<br />
(Borchelt, Gilberg, Horgas, & Geiselmann, 1996) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Frühsterblichkeit<br />
(Baumann, Filipiak, Stieber, & Loewel, 1998) haben, als Alle<strong>in</strong>lebende. Auch auf die teilweise<br />
noch bestehenden, wenngleich <strong>in</strong> den letzten Jahren abnehmenden Ges<strong>und</strong>heitsdifferenzen <strong>in</strong><br />
Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland wird weiterh<strong>in</strong> h<strong>in</strong>gewiesen (Sachverständigenrat, 2001).<br />
Was den Vermittlungsmechanismus zwischen sozialen Faktoren <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit betrifft, wird<br />
angenommen, dass sozial benachteiligte Personen über ger<strong>in</strong>gere Ressourcen verfügen (z.B.<br />
Wissen, Macht, Geld, Prestige), höheren Belastungen (v.a. am Arbeitsplatz <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Familie)
Kapitel 8: : Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
ausgesetzt s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> zugleich e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Verfügbarkeit von Erholungs- <strong>und</strong> Bewältigungsressourcen<br />
haben. Neben diesen Differenzen <strong>in</strong> den Lebensverhältnissen s<strong>in</strong>d aber zugleich<br />
bedeutsame Unterschiede im Ges<strong>und</strong>heitsverhalten zu beachten: so konnte h<strong>in</strong>sichtlich der vertikalen<br />
Ungleichheit vielfach gezeigt werden, dass Personen niedrigerer Sozialschichten, ger<strong>in</strong>gerer<br />
Bildung <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gerem E<strong>in</strong>kommen vergleichsweise mehr Rauchen, höheren Alkoholkonsum<br />
haben, häufiger Übergewicht haben <strong>und</strong> weniger Sport treiben (Helmert, 2003).<br />
E<strong>in</strong>e <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die vorliegende Untersuchung bedeutsame Frage ist, ob sich die Bedeutung<br />
sozialer Faktoren für die Ges<strong>und</strong>heit mit zunehmendem Alter verändert. Dabei existieren, vor<br />
allem bezüglich der <strong>Entwicklung</strong> des Zusammenhangs zwischen sozialer Ungleichheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
über das Erwachsenenalter <strong>und</strong> Alter h<strong>in</strong>weg, verschiedene Hypothesen:<br />
(1) E<strong>in</strong>e Möglichkeit ist, dass sich die Bedeutung sozialer Ungleichheit für die Ges<strong>und</strong>heit im<br />
Alter vergrößert. Begründet wird dies damit, dass der Prozess des Alterns mit vielen Belastungen<br />
e<strong>in</strong>hergeht <strong>und</strong> dabei Personen mit ger<strong>in</strong>ger Ressourcenausstattung <strong>in</strong> besonderem Maß<br />
bee<strong>in</strong>trächtigt seien („age as double jeopardy“, Dowd & Bengston, 1978; Kumulationshypothese,<br />
Mayer & Wagner, 1996).<br />
(2) E<strong>in</strong>e andere Hypothese geht davon aus, dass sich soziale Ungleichheit <strong>in</strong> ihrer Bedeutung für<br />
die Ges<strong>und</strong>heit mit dem Alter abschwächt. Diese beruht auf dem Argument, dass Ges<strong>und</strong>heit im<br />
Alter vor allem e<strong>in</strong> Resultat biologischer Prozesse ist, von dem Angehörige aller sozialer<br />
Schichten gleichermaßen betroffen s<strong>in</strong>d („age as leveler“; Hypothese der Altersbed<strong>in</strong>gtheit).<br />
(3) Schließlich ist es auch möglich, dass die Bedeutung sozialer Ungleichheit für die Ges<strong>und</strong>heit<br />
bis <strong>in</strong>s hohe Alter gleich bleibt, da die sozialen Ungleichheiten die gleichen bleiben, wie vor der<br />
Phase des Alters (Kont<strong>in</strong>uitätshypothese, Kohli, Künem<strong>und</strong>, Motel, & Szydlik, 2000; Hypothese<br />
sozioökonomischer Differenzierung, Mayer & Wagner, 1996).<br />
Wird diesen Hypothesen mit empirischen Studien nachgegangen, s<strong>in</strong>d zweierlei Formen von<br />
Selektivität zu berücksichtigen, welche die Interpretation der Ergebnisse erschweren: Erstens ist<br />
zu bedenken, dass die Frühsterblichkeit <strong>in</strong> bestimmten Bevölkerungsgruppen (s.o.) höher ist,<br />
d.h. <strong>in</strong> diesen Bevölkerungsgruppen überleben <strong>in</strong> stärkerem Ausmaß vor allem die Ges<strong>und</strong>en.<br />
Diese Selektionseffekte können dazu führen, dass sich die Bedeutung sozialer Ungleichheit für<br />
die Ges<strong>und</strong>heit im Alter abschwächt. Zweitens ist zu berücksichtigen, dass jede Stichprobe zur<br />
Untersuchung obengenannter Hypothesen zusätzlich zugunsten der Gesünderen selektiert ist.<br />
Gr<strong>und</strong> hierfür ist, dass diese Personen mit größerer Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit an Studien teilnehmen<br />
als Personen, die durch hohe Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>bußen belastet s<strong>in</strong>d. Es ist deshalb kaum verw<strong>und</strong>erlich,<br />
dass die wenigen empirischen Studien, die diesen Hypothesen bisher nachgegangen<br />
s<strong>in</strong>d, zu ke<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>heitlichen Ergebnissen gekommen s<strong>in</strong>d (George, 1996).<br />
8.2.3 Lebensstil <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsverhalten<br />
Neben gesellschaftlichen <strong>und</strong> sozialen Faktoren trägt auch das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten dazu bei,<br />
<strong>in</strong> welcher Ges<strong>und</strong>heit Menschen altern. Im Gegensatz zum biomediz<strong>in</strong>ischen Modell, <strong>in</strong> dem<br />
Krankheiten im Vordergr<strong>und</strong> stehen, betrachten verhaltensmediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitspsychologische<br />
Ansätze das pathogene <strong>und</strong> salutogene Verhalten von Personen. Selbstschädigende<br />
361
362<br />
Susanne Wurm<br />
Verhaltensweisen wie Rauchen, Fehlernährung <strong>und</strong> Bewegungsarmut sowie ges<strong>und</strong>heitsbegünstigende<br />
Verhaltensweisen wie ges<strong>und</strong>e Ernährung, ausreichende Bewegung, gemäßigter Alkoholkonsum<br />
<strong>und</strong> möglichst ke<strong>in</strong> Tabakkonsum, bee<strong>in</strong>flussen die Beschleunigung oder Verlangsamung<br />
von Alterungsprozessen sowie die Entstehung von Krankheiten (Aldw<strong>in</strong> & Gilmer,<br />
2004; Badura, 1999; Kruse, 2002; Schwarzer, 1992). Lebensstil <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsverhalten tragen<br />
damit entscheidend zur Länge <strong>und</strong> Qualität des Lebens bei.<br />
Zwei Verhaltensweisen, die dafür bekannt s<strong>in</strong>d, dass sie e<strong>in</strong>e Vielzahl von Organfunktionen <strong>und</strong><br />
-systemen bee<strong>in</strong>flussen, s<strong>in</strong>d Rauchen <strong>und</strong> körperliche Aktivität. Der lebenslange, ges<strong>und</strong>heitsschädigende<br />
E<strong>in</strong>fluss des Rauchens ist gut belegt. Im H<strong>in</strong>blick auf chronische Erkrankungen ist<br />
Rauchen der wichtigste, modifizierbare Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen <strong>und</strong><br />
Krebserkrankungen, <strong>in</strong>sbesondere Lungenkrebs. Rauchen beschleunigt zugleich e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
von biologischen Alterungsprozessen, unter anderem die Abnahme der Lungenkapazität sowie<br />
Knochenverlust. Der Risikofaktor „Rauchen“ spielt dabei im höheren Alter e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Rolle<br />
als im jungen <strong>und</strong> mittleren Erwachsenenalter, da Ältere seltener rauchen (Bonita, 1996). Dies<br />
ist vermutlich teilweise auf mortalitätsbed<strong>in</strong>gte Selektivitätseffekte zurückzuführen.<br />
E<strong>in</strong> großes Präventions- <strong>und</strong> Rehabilitationspotenzial kommt der körperlichen Aktivität zu.<br />
Evans <strong>und</strong> Campbell gehen davon aus, dass körperliche Aktivitäten größere ges<strong>und</strong>heitsfördernde<br />
Wirkung haben, als alle Formen pharmakologischer Behandlungen: “There is no pharmacological<br />
<strong>in</strong>tervention that holds a greater promise of improv<strong>in</strong>g health and promot<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dependence<br />
<strong>in</strong> the elderly than does exercise.” (Evans & Campbell, 1993, S. 468). Körperliche<br />
Aktivität ist im gesamten Lebensverlauf wichtig, gew<strong>in</strong>nt im Alter jedoch weiter an Bedeutung<br />
(Yasunaga & Tokunaga, 2001). Ausreichende Bewegung schützt vor chronischen Krankheiten<br />
wie Osteoporose, Diabetes, Bluthochdruck <strong>und</strong> kardiovaskulären Erkrankungen <strong>und</strong> trägt – u.a.<br />
durch ihre sturzpräventive Wirkung – zur Vermeidung von funktionellen E<strong>in</strong>schränkungen bei.<br />
Zudem senken sportliche Betätigungen die Mortalität. Alle<strong>in</strong> die kardiovaskuläre Mortalität<br />
kann dadurch um die Hälfte verr<strong>in</strong>gert werden (Sachverständigenrat, 1996). Körperliche Aktivität<br />
wirkt außerdem biologischen Alterungsprozessen entgegen, <strong>in</strong>dem altersabhängige Verluste<br />
an Muskelkraft, Knochenmasse <strong>und</strong> Lungenkapazität ausgeglichen werden. Positive Effekte<br />
zeigen sich schließlich auch für das Immunsystem <strong>und</strong> die seelische Ges<strong>und</strong>heit, <strong>in</strong>sbesondere<br />
bei Depressivität. Zur Vorbeugung von Erkrankungen (<strong>in</strong>sbesondere kardiovaskulären) reicht<br />
bereits e<strong>in</strong>e 30-m<strong>in</strong>ütige körperliche Bewegung mäßiger Intensität mehrmals pro Woche aus<br />
(Walter & Schwartz, 2001). Doch dieses Präventionspotenzial wird von älteren Personen deutlich<br />
weniger genutzt als von jüngeren (Whitbourne, 2001), während Ältere bezüglich ihrer Ernährungs-<br />
<strong>und</strong> Rauchgewohnheiten durchaus ges<strong>und</strong>heitsbewusster leben als jüngere (Prohaska,<br />
Leventhal, Leventhal, & Keller, 1985).<br />
8.2.4 Emotionale <strong>und</strong> kognitive Faktoren<br />
Weitere Modelle, die besonders von der Ges<strong>und</strong>heitspsychologie, aber auch von anderen psychologischen<br />
Diszipl<strong>in</strong>en (u.a. Gerontopsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Kl<strong>in</strong>ische Psychologie)<br />
bearbeitet werden, befassen sich mit der Frage, welchen E<strong>in</strong>fluss kognitive <strong>und</strong> emotionale<br />
Aspekte auf die Ges<strong>und</strong>heit haben. Diese Faktoren können H<strong>in</strong>weise darauf geben, wa-
Kapitel 8: : Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
rum Menschen entweder aktiv Veränderungen des Körpersystems verlangsamen oder unabsichtlich<br />
beschleunigen (Whitbourne, 2001).<br />
Zu psychischen Risikofaktoren für die Ges<strong>und</strong>heit zählen negative Emotionen <strong>und</strong> Kognitionen<br />
wie Angstgefühle, E<strong>in</strong>samkeit, Fe<strong>in</strong>dseligkeit <strong>und</strong> besonders Depressionen. Negative Affekte<br />
verursachen emotionalem Distress, der sich sowohl über selbstschädigende Verhaltensweisen,<br />
als auch über physiologische Prozesse (wie z.B. der Freisetzung von Katecholam<strong>in</strong>en <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er<br />
dadurch erhöhten Herzrate) negativ auf die Ges<strong>und</strong>heit auswirken kann. Der ges<strong>und</strong>heitsschädigende<br />
E<strong>in</strong>fluss von negativen Affekten wurde besonders für die Entstehung koronarer Herzkrankheiten<br />
wiederholt gezeigt. So haben Personen mit erhöhter Fe<strong>in</strong>dseligkeit, Angstgefühlen<br />
oder Depression e<strong>in</strong>e höhere Rate an Herzerkrankungen, Herzanfällen, ebenso wie e<strong>in</strong>e erhöhte<br />
Mortalität (Aldw<strong>in</strong> & Gilmer, 2004). In H<strong>in</strong>blick auf E<strong>in</strong>samkeit konnte unter anderem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Längsschnittstudie an älteren Personen festgestellt werden, dass e<strong>in</strong>same Personen zwei Jahre<br />
später e<strong>in</strong>e deutlich schlechtere Ges<strong>und</strong>heit hatten, häufiger <strong>in</strong> Heime<strong>in</strong>richtungen gewechselt<br />
waren <strong>und</strong> früher starben (Perlman, 1988).<br />
Im Gegensatz dazu können positive Emotionen <strong>und</strong> Kognitionen als ges<strong>und</strong>heitsprotektiv angesehen<br />
werden, da sie stressm<strong>in</strong>dernd wirken <strong>und</strong> mit positivem Ges<strong>und</strong>heitsverhalten verb<strong>und</strong>en<br />
s<strong>in</strong>d. Besonders gut erforscht ist hierbei die Bedeutung von Optimismus <strong>und</strong> Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
für Ges<strong>und</strong>heit:<br />
Im Falle von Optimismus kann es sich sowohl um die positive Erklärung zurückliegender Ereignisse<br />
handeln, als auch um positive (Ergebnis-)Erwartungen an die Zukunft. Für beide Formen<br />
des Optimismus konnte wiederholt gezeigt werden, dass sie e<strong>in</strong>en günstigen E<strong>in</strong>fluss auf<br />
die Ges<strong>und</strong>heit haben, z.B. auf körperliche Symptome, das Immunsystem <strong>und</strong> den Genesungsverlauf<br />
nach Operationen (z.B. Kamen-Siegel, Rod<strong>in</strong>, Seligman, & Dwyer, 1991; Peterson,<br />
Seligman, & Valliant, 1988; Schaier & Carver, 1987; Scheier et al., 1989). Andere Arbeiten<br />
weisen allerd<strong>in</strong>gs auch auf die Grenzen e<strong>in</strong>er positiven Wirkung von Optimismus für Ges<strong>und</strong>heit<br />
h<strong>in</strong>, da e<strong>in</strong> defensiver Optimismus dazu führen kann, dass vorhandene Ges<strong>und</strong>heitsrisiken<br />
unterschätzt werden (Schwarzer, 1993).<br />
Zugleich haben auch Kontrollüberzeugungen, <strong>in</strong>sbesondere Selbstwirksamkeitserwartungen,<br />
e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung für die Ges<strong>und</strong>heit. Dabei bezieht sich Selbstwirksamkeit auf die Erwartung,<br />
mit Hilfe eigener Fähigkeiten das Leben bee<strong>in</strong>flussen zu können. In e<strong>in</strong>er Vielzahl von<br />
Studien an jüngeren wie hochaltrigen Personen konnte gezeigt werden, dass Kontrollüberzeugungen<br />
e<strong>in</strong>en günstigen E<strong>in</strong>fluss auf körperliche, subjektive <strong>und</strong> funktionelle Ges<strong>und</strong>heit sowie<br />
das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten haben (z.B. Bandura, 1992; Duffy & MacDonald, 1990; Grembowski,<br />
Donald, & Diehr, 1993; Leventhal, Leventhal, & Contrada, 1998; Rod<strong>in</strong>, 1986).<br />
8.2.5 Vorstellungen über das Altern: Alternsbezogene Kognitionen<br />
Seit r<strong>und</strong> dreißig Jahren gibt es Forschung zu „Ageism“, d.h. zu negativen E<strong>in</strong>stellungen <strong>und</strong><br />
Altersstereotypen gegenüber Älteren, zu diskrim<strong>in</strong>ierendem Verhalten <strong>und</strong> entsprechenden <strong>in</strong>stitutionalisierten<br />
Praktiken, die diese Altersstereotypen aufrecht erhalten lassen <strong>und</strong> die zur<br />
E<strong>in</strong>schränkung von Lebensqualität <strong>und</strong> Würde Älterer führen (z.B. Brewer, Dull, & Lui, 1981;<br />
363
364<br />
Susanne Wurm<br />
Hummert, 1990; Hummert, Garstka, Shaner, & Strahm, 1994; Steele, 1997; für e<strong>in</strong>e Übersicht:<br />
Nelson, 2002). E<strong>in</strong>e solche Forschung ersche<strong>in</strong>t vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der demografischen <strong>Entwicklung</strong><br />
bei gleichzeitiger Orientierung – <strong>in</strong>sbesondere der westlichen Gesellschaften – an<br />
Jugendlichkeit von zunehmender Wichtigkeit. Dieses Forschungsfeld zu „Ageism“ wird <strong>in</strong>haltlich<br />
ergänzt durch Forschungen zu <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Erwartungen an das Älterwerden sowie zum<br />
subjektiven Alterserleben (z.B. Connidis, 1989; Crockett & Hummert, 1987; Filipp, Ferr<strong>in</strong>g, &<br />
Klauer, 1989; Heckhausen & Krüger, 1993; Keller, Leventhal, & Larson, 1989).<br />
Allerd<strong>in</strong>gs wird erst seit wenigen Jahren empirisch der Frage nachgegangen, welchen E<strong>in</strong>fluss<br />
Altersstereotype <strong>und</strong> Selbstwahrnehmungen des Älterwerdens auf die Ges<strong>und</strong>heit haben. Hierzu<br />
existieren verschiedene Studien, die von der Forschergruppe um Becca R. Levy erstellt wurden.<br />
Mit Hilfe von kulturvergleichenden Studien <strong>und</strong> Experimenten konnte sie zeigen, dass Altersstereotype<br />
e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf physische Funktionen <strong>und</strong> Gedächtnisleistungen, funktionelle<br />
Ges<strong>und</strong>heitsaspekte wie das Gehen <strong>und</strong> die Handschrift sowie schließlich auch auf den Lebenswillen<br />
haben (Levy, 1998; Levy & Langer, 1994; Levy, Ashman, & Dror, 2000; Levy,<br />
Hausdorff, Hencke, & Wei, 2000; Hausdorff, Levy, & Wei, 1999). Zwei Längsschnittstudien<br />
von Levy <strong>und</strong> Kollegen konnten zudem zeigen, dass auch Selbstwahrnehmungen des Älterwerdens<br />
bedeutsam zur Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heit beitragen können. Im Fokus dieser Untersuchungen<br />
stand die Vorhersage von funktioneller Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Langlebigkeit (Levy, Slade, &<br />
Kasl, 2002; Levy, Slade, Kasl, & Kunkel, 2002). Die Ergebnisse dieser beiden Längsschnittstudien<br />
weisen auf die hohe, langfristig wirksame Bedeutung von Selbstwahrnehmungen des Älterwerdens<br />
für die Ges<strong>und</strong>heit h<strong>in</strong> <strong>und</strong> machen deutlich, dass es s<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> notwendig ersche<strong>in</strong>t,<br />
alternsbezogene Kognitionen (Selbstwahrnehmungen des Älterwerdens, Altersstereotype)<br />
auch <strong>in</strong> anderen Studien zu berücksichtigen.<br />
8.3 Fragestellung <strong>und</strong> Methoden<br />
8.3.1 Fragestellung<br />
Der vorausgehende Abschnitt beschäftigte sich damit, welche Faktoren die Ges<strong>und</strong>heit im Alter<br />
bee<strong>in</strong>flussen können. Hierbei handelt es sich zum e<strong>in</strong>en um genetische <strong>und</strong> biologische Faktoren.<br />
Doch diese können nur zu e<strong>in</strong>em Teil erklären, <strong>in</strong> welcher Weise Alterungsprozesse mit<br />
nachlassender Ges<strong>und</strong>heit zusammenhängen <strong>und</strong> warum Menschen <strong>in</strong> unterschiedlicher Ges<strong>und</strong>heit<br />
altern. Wichtige Erklärungen hierzu liefern zudem gesellschaftliche <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren. An diesen können präventive Maßnahmen ansetzen, die zu e<strong>in</strong>em Altern <strong>in</strong><br />
guter Ges<strong>und</strong>heit beitragen. H<strong>in</strong>sichtlich gesellschaftlicher <strong>und</strong> soziale Faktoren steht die Frage<br />
im Vordergr<strong>und</strong>, welche Bedeutung der sozialen Ungleichheit für die Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
im Alter zukommt. Auf der Ebene <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Verhaltensweisen verweisen bisherige Studien<br />
darauf, dass im Alter besonders die präventive Wirkung körperlicher Aktivitäten unzureichend<br />
genutzt wird. Die Betrachtung psychischer Risiken <strong>und</strong> Ressourcen machte deutlich, dass negativen<br />
Emotionen sowie vor allem Optimismus <strong>und</strong> Selbstwirksamkeit e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung für<br />
die Ges<strong>und</strong>heit beigemessen wird. Abschließend wurde betrachtet, <strong>in</strong>wieweit zudem gesellschaftliche<br />
<strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Vorstellungen vom Älterwerden <strong>und</strong> Alter die Ges<strong>und</strong>heit bee<strong>in</strong>-
Kapitel 8: : Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
flussen. Neuere Studien von Levy <strong>und</strong> Kollegen machten deutlich, dass die Folgen dieser alternsbezogenen<br />
Kognitionen für die Ges<strong>und</strong>heit nicht unterschätzt werden sollten.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der dargestellten Modelle <strong>und</strong> empirischen Bef<strong>und</strong>e lassen sich mehrere<br />
Fragen ableiten, die nachfolgend untersucht werden sollen. Dabei beziehen sich die Fragen zunächst<br />
auf die gesamte zweite Lebenshälfte <strong>und</strong> werden deshalb anhand der Gesamtstichprobe<br />
analysiert. Vertiefend erfolgt e<strong>in</strong>e altersgruppenvergleichende Betrachtung, um mögliche Unterschiede<br />
<strong>in</strong>nerhalb der zweiten Lebenshälfte aufdecken zu können.<br />
Betrachtung der Gesamtstichprobe<br />
(1) Wie gut kann soziale Ungleichheit die Ges<strong>und</strong>heit vorhersagen?<br />
(2) Haben verhaltensbezogene <strong>und</strong> psychische Faktoren darüber h<strong>in</strong>ausgehenden Vorhersagewert<br />
für die Ges<strong>und</strong>heit?<br />
(3) Welche Bedeutung kommt alternsbezogenen Kognitionen, d.h. Vorstellungen über das<br />
Älterwerden, für die Ges<strong>und</strong>heit zu? – Können diese auch dann noch die Ges<strong>und</strong>heit vorhersagen,<br />
wenn alle anderen sozialen, verhaltensbezogenen <strong>und</strong> psychologischen Modell<strong>in</strong>dikatoren<br />
bereits berücksichtigt wurden?<br />
Vergleich der Altersgruppen<br />
(1) Weisen die Ergebnisse darauf h<strong>in</strong>, dass die Bedeutung sozialer Faktoren bis zum hohen Alter<br />
gleich bleibt, zunimmt oder abnimmt?<br />
(2) Lässt sich – nach Berücksichtigung aller anderen Modell<strong>in</strong>dikatoren – feststellen, dass den<br />
alternsbezogenen Kognitionen e<strong>in</strong>e mit dem Alter gleichbleibende, zunehmende oder abnehmende<br />
Bedeutung für die Ges<strong>und</strong>heit zukommt?<br />
Von diesen Fragestellungen ausgehend veranschaulicht die folgende schematische Abbildung<br />
8.1 zusammenfassend, welche Indikatorengruppen zur Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heit berücksichtigt<br />
werden. Es handelt sich hierbei um vier Gruppen von Wirkfaktoren: soziale Faktoren, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten,<br />
psychische Faktoren sowie schließlich alternsbezogene Kognitionen, d.h.<br />
Vorstellungen über das Älterwerden.<br />
Abbildung 8.1:<br />
E<strong>in</strong>gesetzte Indikatorengruppen zur Vorhersage des Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
Erhebungszeitpunkt t1, 1996 Erhebungszeitpunkt t2, 2002<br />
Soziale Faktoren<br />
Ges<strong>und</strong>heitsverhalten<br />
Psychische Faktoren<br />
Alternsbezogene Kognitionen<br />
GESUNDHEIT<br />
365
366<br />
Susanne Wurm<br />
Die Abbildung enthält e<strong>in</strong>e Form der Darstellung, die der Analyse von Querschnittsdaten ähnelt.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs liegt im Fall von Querschnittsuntersuchungen e<strong>in</strong>e Ges<strong>und</strong>heitsmessung<br />
zugr<strong>und</strong>e, die zum selben Zeitpunkt erfolgte, wie die Erfassung der Faktoren (Prädiktoren),<br />
welche den Ges<strong>und</strong>heitszustand erklären sollen. Anhand dieser Daten lassen sich deshalb ausschließlich<br />
korrelative Aussagen treffen.<br />
Im Längsschnitt h<strong>in</strong>gegen werden die Prädiktoren zeitlich früher erhoben, als der Ges<strong>und</strong>heitszustand,<br />
so dass e<strong>in</strong>e zeitversetzte Vorhersage erfolgen kann. Dabei geht <strong>in</strong> die Vorhersage der<br />
(zeitlich nachfolgenden) Ges<strong>und</strong>heit implizit neben den Prädiktoren auch das Niveau des zeitlich<br />
vorausgehenden Ges<strong>und</strong>heitszustands e<strong>in</strong>. Dies bedeutet, dass beispielsweise der positive<br />
E<strong>in</strong>fluss ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Verhaltens auf die nachfolgende Ges<strong>und</strong>heit auch dadurch<br />
mitbed<strong>in</strong>gt ist, dass die betreffende Person bereits zum ersten Befragungszeitpunkt aufgr<strong>und</strong><br />
dieses Verhaltens e<strong>in</strong>e gute Ges<strong>und</strong>heit hatte. Diese Konf<strong>und</strong>ierung von Prädiktoren <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
erschwert die Interpretation dessen, welche Faktoren tatsächlich für Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen<br />
verantwortlich s<strong>in</strong>d.<br />
Um e<strong>in</strong>e vom ges<strong>und</strong>heitlichen Ausgangsniveau unabhängige Information über die Bedeutung<br />
der Prädiktoren zu erhalten, ist es s<strong>in</strong>nvoll, statt e<strong>in</strong>er bloßen Vorhersage des Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
zum Zeitpunkt der Wiederholungsbefragung, e<strong>in</strong>e Vorhersage der Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen<br />
zu machen. Die nachfolgende Abbildung 8.2 veranschaulicht die Betrachtung der Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung.<br />
Abbildung 8.2:<br />
E<strong>in</strong>gesetzte Indikatorengruppen zur Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen<br />
Erhebungszeitpunkt t1, 1996 Erhebungszeitpunkt t2, 2002<br />
GESUNDHEIT<br />
Soziale Faktoren<br />
Ges<strong>und</strong>heitsverhalten<br />
Psychische Faktoren<br />
Alternsbezogene Kognitionen<br />
GESUNDHEIT<br />
In diesem Fall erfolgt e<strong>in</strong> Vergleich zwischen der Ges<strong>und</strong>heit zur Erstbefragung <strong>und</strong> jener zum<br />
Zeitpunkt der Wiederholungsbefragung. E<strong>in</strong>e Veränderung zwischen diesen beiden Ges<strong>und</strong>heitsmessungen<br />
<strong>und</strong> damit die Erfassung der Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung wird ermittelt, <strong>in</strong>dem der<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand zum ersten Messzeitpunkt kontrolliert wird. Diese Technik e<strong>in</strong>er „residualisierten<br />
Regression“ ist dem Verfahren vorzuziehen, Veränderungswerte (y2-y1) zu berechnen<br />
(Aldw<strong>in</strong> & Gilmer, 2004), unter anderem, da es bei diesem Vorgehen zu ke<strong>in</strong>er Verdopplung<br />
der Messfehler kommt.<br />
Wie der Abbildung zu entnehmen ist, wird, neben den e<strong>in</strong>geführten Prädiktoren, zusätzlich der<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand zum Zeitpunkt der Ersterhebung berücksichtigt. Dieses Vorgehen zur Be-
Kapitel 8: : Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
trachtung von Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung wird <strong>in</strong> nachfolgenden Analysen präferiert, aus Vergleichsgründen<br />
werden jedoch auch Ergebnisse mit dargestellt, die auf der zeitversetzten Vorhersage<br />
des Ges<strong>und</strong>heitszustandes beruhen (Abbildung 8.1).<br />
8.3.2 Datengr<strong>und</strong>lage<br />
Den folgenden empirischen Analysen liegen die Daten der Panelstichprobe des Alterssurveys<br />
zugr<strong>und</strong>e. Es handelt sich hierbei somit um jene Personen, die zur Erstbefragung 1996 zwischen<br />
40 <strong>und</strong> 85 Jahren alt waren <strong>und</strong> entsprechend bei der Wiederholungsbefragung im Jahr 2002 im<br />
Alter von 46 <strong>und</strong> 91 Jahren waren (nähere Angaben zur Stichprobe: vgl. Kapitel 2). Für die<br />
Analysen wurden Indikatoren verwendet, die teilweise über das mündliche Interview, teilweise<br />
über den schriftlichen Fragebogen gewonnen wurden. Die Stichprobengröße beträgt dadurch<br />
n=1.286, da nur jene Personen e<strong>in</strong>bezogen wurden, die beide Befragungsteile beantworteten<br />
(vgl. Kapitel 2) 1 .<br />
Die Stichprobe wurde, wie bereits <strong>in</strong> Kapitel 2 beschrieben, nach Altersgruppe, Geschlecht <strong>und</strong><br />
Region (Ost/West) geschichtet gezogen. Diese Stichprobenschichtung wird bei nachfolgenden<br />
Regressionsanalysen berücksichtigt (vgl. Abschnitt 8.3.4). Analog zur Stichprobenschichtung<br />
werden <strong>in</strong> den Auswertungen deshalb folgende drei Altersgruppen unterschieden:<br />
(1) Die jüngste Altersgruppe ist zum zweiten Befragungszeitpunkt zwischen 46 <strong>und</strong> 60 Jahre<br />
alt (n1=564),<br />
(2) die mittlere Altersgruppe ist im Alter von 61 <strong>und</strong> 75 Jahren (n2=507),<br />
(3) die älteste Altersgruppe ist im Alter von 76 <strong>und</strong> 91 Jahren (n3=215).<br />
Die Altersangaben erfolgen an dieser Stelle für das Jahr der Wiederholungsbefragung, da sich<br />
die Ges<strong>und</strong>heitsvorhersage auf diesen Befragungszeitpunkt bezieht (vgl. Abbildung 8.2).<br />
8.3.3 Erhebungs<strong>in</strong>strumente<br />
Für die nachfolgenden Analysen werden zwei Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikatoren verwendet, deren Informationen<br />
zu beiden Befragungswellen des Alterssurveys erhoben wurden. Es handelt sich hierbei<br />
um e<strong>in</strong> Maß für die Anzahl körperlicher Erkrankungen (Multimorbidität) <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Maß für<br />
die subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung:<br />
Indikator „Anzahl körperlicher Erkrankungen, Multimorbidität“: Für <strong>in</strong>sgesamt 11 chronische<br />
Erkrankungen <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen, die per Selbstaussagen erhoben wurden, konnten die<br />
1 Fehlende E<strong>in</strong>zelwerte wurden durch Datenimputation mittels EM-Schätzverfahren ergänzt (Dempster, Laird, &<br />
Rub<strong>in</strong>, 1977). Dies hat den Vorteil, dass es bei nachfolgenden Regressionsanalysen zu ke<strong>in</strong>en systematischen Ausfallprozessen<br />
jener Personen kommt, die E<strong>in</strong>zelfragen nicht ausgefüllt haben bzw. bei denen vere<strong>in</strong>zelte Daten<strong>in</strong>formationen<br />
aufgr<strong>und</strong> von fehlerhaften Angaben (z.B. Doppelnennungen) nicht berücksichtigt werden konnten.<br />
367
368<br />
Susanne Wurm<br />
Zielpersonen angeben, ob sie von diesen betroffen s<strong>in</strong>d oder nicht. Es handelte sich hierbei unter<br />
anderem um die Frage nach dem Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Herz- oder Kreislauferkrankung, Durchblutungsstörungen,<br />
Gelenk-, Knochen-, Bandscheiben- oder Rückenleiden, Augenleiden oder<br />
Sehstörungen, Ohrenleiden oder Schwerhörigkeit. Für den Indikator „körperliche Erkrankungen“<br />
(Multimorbidität) wurde pro Person die Zahl der genannten Erkrankungen aufsummiert, so<br />
dass e<strong>in</strong> hoher Summenwert für e<strong>in</strong>e hohe Multimorbidität steht.<br />
Indikator „subjektive Ges<strong>und</strong>heit“: Die Erhebung der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit erfolgte durch die<br />
E<strong>in</strong>zelfrage „Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Ges<strong>und</strong>heitszustand?“. Die Codierung dieses<br />
Indikators erfolgte so, dass e<strong>in</strong> hoher Wert für e<strong>in</strong>e gute Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung steht.<br />
Der nachfolgenden Tabelle 8.1 kann die deskriptive Beschreibung beider Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikatoren<br />
entnommen werden.<br />
Tabelle 8.1:<br />
Statistische Kennwerte der Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikatoren<br />
Indikator Mean SD M<strong>in</strong>imum Maximum<br />
Körperl. Erkrankg. (1996) 2,32 1,78 0 10<br />
Körperl. Erkrankg. (2002) 2,46 1,82 0 10<br />
Subjekt. Ges<strong>und</strong>heit (1996) 3,63 0,78 1 5<br />
Subjekt. Ges<strong>und</strong>heit (2002) 3,49 0,78 1 5<br />
Quelle: Panelstichprobe des Alterssurveys, ungewichtet (n= 1.286)<br />
Zur Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heit werden Indikatoren e<strong>in</strong>gesetzt, die sich an den <strong>in</strong> Abschnitt 8.2<br />
vorgestellten Wirkfaktoren für Ges<strong>und</strong>heit orientieren. Es werden dementsprechend soziale<br />
Faktoren (Messung vertikaler <strong>und</strong> horizontaler Ungleichheiten), Faktoren des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens<br />
sowie psychische Faktoren unterschieden. Im folgenden werden die e<strong>in</strong>gesetzten Indikatoren<br />
kurz erläutert.<br />
Soziale Indikatoren<br />
Zentrale Dimensionen zur Messung sozioökonomischer bzw. vertikaler Ungleichheit s<strong>in</strong>d Bildungsstatus,<br />
Berufsstatus <strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommen (vgl. Abschnitt 9.2.2). Hierfür wurden folgende Indikatoren<br />
gebildet: Der Indikator ‚Bildungsstatus’ ist e<strong>in</strong> zusammengesetztes Maß aus dem genannten<br />
höchsten Schulabschluss sowie dem höchsten Ausbildungsabschluss. Unterschieden<br />
wird hierbei zwischen Personen ger<strong>in</strong>ger, mittlerer <strong>und</strong> vergleichsweise hoher Bildung. Personen<br />
‚ger<strong>in</strong>ger Bildung’ haben zumeist ke<strong>in</strong>en Schulabschluss oder e<strong>in</strong>en Hauptschulabschluss<br />
jedoch ke<strong>in</strong>e Berufsausbildung; Personen mittlerer Bildung haben zumeist e<strong>in</strong>en Hauptschulabschluss<br />
mit Berufsausbildung oder e<strong>in</strong>en Realschulabschluss ohne Berufsausbildung; Personen<br />
vergleichsweise hoher Bildung haben e<strong>in</strong>en Realschul- <strong>und</strong> Ausbildungsabschluss bzw. Abitur<br />
(nähere Angaben zur Zusammensetzung schulischer <strong>und</strong> beruflicher Bildung: Motel, 2000). Der<br />
Indikator ‚Berufsstatus’ (Prestige) misst den relativen sozialen Status e<strong>in</strong>er Person. Auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>er ISCO-Codierung offener Angaben zu beruflichen Tätigkeiten wurde das Berufsprestige<br />
nach Treiman gebildet (zum Vergleich verschiedener Prestigeskalen im Alterssur-
Kapitel 8: : Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
vey: Kohli et al., 2000). Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das Sozialprestige von<br />
Frauen oftmals wesentlich durch die Tätigkeit des Mannes mitdef<strong>in</strong>iert ist, – vor allem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Stichprobe von überwiegend älteren <strong>und</strong> alten Befragten – wird für zusammenlebende Paare das<br />
jeweils höchste Berufsprestige verwendet (haushaltsbezogenes Berufsprestige). Ebenso geht das<br />
E<strong>in</strong>kommen nicht als personen-, sondern als haushaltsbezogenes E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> die Analysen<br />
e<strong>in</strong>. Beim Äquivalenze<strong>in</strong>kommen handelt es sich um das Haushaltsnettoe<strong>in</strong>kommen, das anhand<br />
der Anzahl der Haushaltsmitglieder gewichtet wird (Motel & Wagner, 1993). Es ist damit e<strong>in</strong><br />
Maß, dass ausdrückt, wie viel Geld pro Haushaltsmitglied zur Verfügung steht.<br />
Neben vertikaler Ungleichheit gehen zusätzlich zwei Maße horizontaler Ungleichheit <strong>in</strong> die<br />
Analysen e<strong>in</strong>: Ausgehend vom Familienstand der Befragten wurde e<strong>in</strong> dichotomer Indikator zur<br />
Lebensform gebildet, der zwischen Personen unterscheidet, die mit e<strong>in</strong>em Partner zusammenleben<br />
<strong>und</strong> solchen, die alle<strong>in</strong>e leben. Ebenso wird die Anzahl der K<strong>in</strong>der berücksichtigt. Für Personen,<br />
die vier oder mehr K<strong>in</strong>der haben wurde e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Kategorie (m<strong>in</strong>destens vier<br />
K<strong>in</strong>der) gebildet.<br />
Indikatoren des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens<br />
Der hohen Bedeutung folgend, die körperliche Aktivität für die Ges<strong>und</strong>heit im Alter hat (vgl.<br />
Abschnitt 8.2.3) wurden zwei Maße zur Erfassung körperlicher Aktivität ausgewählt. Sportliche<br />
Aktivitäten wurden über e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zelfrage erfasst, mit der die Häufigkeit sportlicher Aktivitäten<br />
wie z.B. Wandern, Fußball, Gymnastik oder Schwimmen, erhoben wurde. Auf e<strong>in</strong>er sechsstufigen<br />
Skala konnten angegeben werden, sportliche Aktivitäten „nie“ bis „täglich“ auszuüben.<br />
Neben dem Sport als <strong>in</strong>tensivere körperliche Aktivität wurde auch die gemäßigtere Bewegungsform<br />
‚Spazierengehen’ erhoben. Analog zur sportlichen Aktivität wurde erfragt, wie häufig e<strong>in</strong>e<br />
Person spazieren geht.<br />
Psychische Indikatoren<br />
Zur Erfassung der Bedeutung positiver <strong>und</strong> negativer Emotionen <strong>und</strong> Kognitionen für die Ges<strong>und</strong>heit<br />
(vgl. Abschnitt 8.2.4) werden <strong>in</strong> den nachfolgenden Analysen folgende psychologische<br />
Skalen berücksichtigt, die sich über wiederholten E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> zahlreichen Studien etabliert haben:<br />
Mit Hilfe der PANAS-Skala (Positive and Negative Affect Scale; Watson, Clark, & Tellegen,<br />
1988) werden positive <strong>und</strong> negative Emotionen erfasst, mit der Lebenszufriedenheitsskala<br />
(Pavot & Diener, 1993) geht zudem die kognitive Komponente des Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>in</strong> die Analysen<br />
e<strong>in</strong>. Berücksichtigt wird zudem die HOPE-Skala (Snyder et al., 1991). Diese misst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
geme<strong>in</strong>samen Dimension Optimismus <strong>und</strong> Selbstwirksamkeitserwartungen. Ebenfalls e<strong>in</strong>gesetzt<br />
wurde die E<strong>in</strong>samkeitsskala nach De Jong-Gierveld & Kamphuis (Jong-Gierveld &<br />
Kamphuis, 1985).<br />
Zusätzlich erfolgte e<strong>in</strong>e Skalenneuentwicklung auf der Gr<strong>und</strong>lage von Fragen, mit denen die<br />
durch gesellschaftliche Stereotype wie <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Erfahrungen geprägte Sicht auf das Älterwerden<br />
erhoben wurde (vgl. Abschnitt 8.2.5). Bei den „AgeCog“-Skalen (Age-related Cognitions;<br />
Wurm, 2004) handelt es sich um vier Skalen zur Erfassung alternsbezogener Kognitionen.<br />
Diese be<strong>in</strong>halten, <strong>in</strong> welchem Maß e<strong>in</strong>e Person das Altern mit Gew<strong>in</strong>nen bzw. Verlusten ver-<br />
369
370<br />
Susanne Wurm<br />
b<strong>und</strong>en empf<strong>in</strong>det. H<strong>in</strong>sichtlich der positiven Aspekte („Gew<strong>in</strong>ne“) des Älterwerdens wird betrachtet,<br />
ob das Älterwerden als Lebensphase persönlicher Weiterentwicklung sowie e<strong>in</strong>e Lebensphase<br />
zunehmender Selbst<strong>in</strong>tegration, d.h. Zufriedenheit mit sich selbst, betrachtet wird. In<br />
H<strong>in</strong>blick auf negative Aspekte des Älterwerdens („Verluste“) werden physische Verluste <strong>und</strong><br />
soziale Verluste unterschieden. E<strong>in</strong>e deskriptive Übersicht über die e<strong>in</strong>gesetzten Indikatoren<br />
kann Tabelle 8.2 entnommen werden.<br />
Zwei Indikatoren werden <strong>in</strong> die Regressionsberechnungen als kategoriale Variablen aufgenommen.<br />
Dies betrifft zum e<strong>in</strong>en die Bildung, da bei dieser e<strong>in</strong>erseits ke<strong>in</strong> Intervallskalen-Niveau<br />
vorliegt, andererseits auch gruppenspezifische, nicht-l<strong>in</strong>eare Effekte für Ges<strong>und</strong>heit denkbar<br />
s<strong>in</strong>d (es kann beispielsweise der Fall se<strong>in</strong>, dass Personen mit mittlerem Bildungsniveau e<strong>in</strong>e<br />
schlechtere subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung haben als Personen mit ger<strong>in</strong>ger <strong>und</strong> hoher<br />
Bildung). Zum anderen betrifft dies die Schichtungsvariable „Altersgruppe“. Da es sich hierbei<br />
implizit zugleich um verschiedene Geburtskohorten handelt, s<strong>in</strong>d gr<strong>und</strong>sätzlich nicht-l<strong>in</strong>eare<br />
Kohortenunterschiede möglich. Im Fall von Ges<strong>und</strong>heit ist zwar von e<strong>in</strong>er Dom<strong>in</strong>anz der Bedeutung<br />
des Alters gegenüber der Kohorte auszugehen, dennoch wird die Variable kategorial <strong>in</strong><br />
die Analysen aufgenommen.<br />
Tabelle 8.2:<br />
Übersicht über e<strong>in</strong>gesetzte Indikatoren zur Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heit<br />
Indikatorgruppe Indikator % Mean SD M<strong>in</strong>. Max. Cronb.α<br />
Stichproben-<br />
Schichtungsfakt.<br />
Altersgruppe<br />
– – – –<br />
jüngste (46-60J.) 43,9<br />
mittlere (61-75J.) 39,4 – – – –<br />
älteste (76-91J.) 16,7 – – – –<br />
Geschlecht männlich 52,5 – – – –<br />
weiblich 47,5 – – – –<br />
Region Ost 36,5 – – – –<br />
West 63,5 – – – –<br />
Soziale Faktoren Prestige 48,4 11,97 18 78 –<br />
E<strong>in</strong>kommen 2617,4 1414,96 450 20000 –<br />
Bildung ger<strong>in</strong>ge 8,2 – – – –<br />
mittlere 46,4 – – – –<br />
hohe 45,3 – – – –<br />
Lebensform alle<strong>in</strong>leb. 19,7 – – – –<br />
zus.lebend 80,3 – – – –<br />
K<strong>in</strong>der 1,9 1,10 0 4 –<br />
Körperliche Sport 1,9 1,72 0 5 –<br />
Aktivität Spazieren gehen 3,2 1,57 0 5 –
Kapitel 8: : Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Tabelle 8.2 (fortgesetzt):<br />
Indikatorgruppe Indikator Mean SD M<strong>in</strong>. Max. Cronb.α<br />
Körperl. Aktivität Sport 1,86 1,72 0 5 –<br />
Spazieren gehen 3,15 1,57 0 5 –<br />
Psych. Faktoren Hope (‚Hoffnung’) 3,13 0,49 1 4 .86<br />
E<strong>in</strong>samkeit 1,72 0,56 1 4 .89<br />
Positive Emotionen 3,39 0,58 1 5 .86<br />
Negative Emotionen 2,08 0,49 1 3,7 .81<br />
Lebenszufriedenheit 3,78 0,79 1 5 .85<br />
Alternsbezogene AC-Weiterentwicklung 2,96 0,58 1 4 .72<br />
Kognition (AC) AC-Selbst<strong>in</strong>tegration 3,07 0,52 1 4 .66<br />
AC-Physische Verluste 2,81 0,62 1 4 .77<br />
AC-Soziale Verluste 1,70 0,59 1 4 .73<br />
Quelle: Panelstichprobe des Alterssurveys, ungewichtet (n= 1.286). Alle dargestellten Indikatoren beziehen sich auf<br />
den ersten Befragungszeitpunkt (1996)<br />
In welcher Weise die zahlreichen Indikatoren auf bivariater Ebene mite<strong>in</strong>ander zusammenhängen,<br />
kann nachfolgender Tabelle 8.3 entnommen werden. Dargestellt s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Tabelle<br />
sowohl die Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikatoren, die vorhergesagt werden sollen, als auch die hierfür e<strong>in</strong>gesetzten<br />
Prädiktoren. Diese beziehen sich e<strong>in</strong>heitlich auf Informationen, die <strong>in</strong> der Erstbefragung<br />
(1996) erhoben wurden. Zusätzlich aufgenommen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Tabelle auch die Variablen Altersgruppe,<br />
Region (Ost-/Westdeutschland) sowie Geschlecht, nach denen die Stichprobe geschichtet<br />
wurde. E<strong>in</strong>e Betrachtung der bivariaten Korrelationen macht deutlich, dass alle Korrelationen<br />
zwischen den e<strong>in</strong>gesetzten Prädiktoren kle<strong>in</strong>er als r
Tabelle 8.3:<br />
Bivariate Korrelationen aller Indikatoren<br />
372<br />
Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22<br />
1 Körp. Erkrankg. 1996 1.00<br />
2 Körp. Erkrankg. 2002 .51 1.00<br />
3 Subj. Ges.heit 1996 -.48 -.40 1.00<br />
4 Subj. Ges.heit 2002 -.33 -.40 .48 1.00<br />
5 Altersgruppe .35 .34 -.20 -.20 1.00<br />
6 Region (Ost/West) -.02 -.03 .08 .09 -.05 1.00<br />
7 Geschlecht .00 .04 -.01 -.01 -.04 -.03 1.00<br />
-.14 -.11 .16 .12 -.07 .04 .00 1.00<br />
8 Prestige 1<br />
9 E<strong>in</strong>kommen -.11 -.13 .20 .14 -.08 .28 -.05 .34 1.00<br />
10 Bildung -.20 -.17 .20 .15 -.25 -.02 -.08 .49 .31 1.00<br />
11 Lebensform -.07 -.11 .09 .14 -.17 .03 -.18 .05 .05 .09 1.00<br />
12 K<strong>in</strong>der .03 .03 .01 .02 .00 -.04 .04 -.06 -.14 -.08 .18 1.00<br />
13 Sport -.10 -.13 .18 .16 -.14 .22 .06 .16 .16 .13 .05 -.05 1.00<br />
14 Spazieren gehen .05 .07 .01 -.01 .21 .08 .08 .03 -.04 -.06 -.09 .00 .12 1.00<br />
15 Hope (‚Hoffnung’) -.15 -.10 .15 .12 .01 .01 -.06 .02 .09 .04 .08 .02 .00 .03 1.00<br />
16 E<strong>in</strong>samkeit .11 .09 -.17 -.11 -.01 .07 -.06 -.03 -.06 -.02 -.17 -.05 .01 -.05 -.32 1.00<br />
17 Posit. Emotionen -.19 -.13 .24 .18 -.14 .07 .05 .17 .19 .16 .07 -.04 .16 .06 .43 -.32 1.00<br />
18 Negat. Emotionen .14 .10 -.14 -.05 -.19 .02 .12 .02 -.03 .05 .02 .06 .08 -.04 -.31 .31 -.16 1.00<br />
19 Lebengszufriedenh. -.12 -.10 .26 .18 .11 .16 .03 .08 .22 .01 .16 .04 .05 .12 .47 -.41 .31 -.29 1.00<br />
20 AC-Weiterentwicklg 2 -.17 -.23 .24 .22 -.26 .07 .05 .10 .17 .22 .10 .02 .12 .02 .46 -.23 .48 -.11 .28 1.00<br />
Susanne Wurm<br />
21 AC-Selbst<strong>in</strong>tegration .07 .04 -.01 .01 .10 -.04 .05 -.07 .00 -.04 -.03 .06 -.01 .14 .30 -.16 .23 -.11 .16 .32 1.00<br />
22 AC-phys.Verluste .35 .32 -.43 -.25 .23 -.06 .01 -.11 -.10 -.16 -.06 .01 -.15 .00 -.14 .08 -.28 .17 -.12 -.33 .13 1.00<br />
23 AC-soziale Verluste .15 .13 -.20 -.16 .06 -.07 .03 -.15 -.14 -.15 -.19 -.02 -.08 .00 -.32 .39 -.38 .24 -.27 -.39 -.09 .30<br />
1 2<br />
Dieser Prädiktor beruht wie alle nachfolgenden auf dem ersten Erhebungszeitpunkt (1996); AC = Alternsbezogene Kognitionen (age-related cognitions)<br />
Quelle: Panelstichprobe des Alterssurveys, ungewichtet (n=1.286)
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
8.3.4 Auswertungsverfahren<br />
Zur Untersuchung der genannten Fragestellungen wurden l<strong>in</strong>eare Regressionen gerechnet. Um<br />
verschiedene Gruppen von E<strong>in</strong>flussfaktoren (u.a. soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren) betrachten<br />
zu können, wurden hierbei sequentielle Regressionen gewählt. E<strong>in</strong> solches Verfahren empfiehlt<br />
sich, wenn aufgr<strong>und</strong> theoretischer Vorüberlegungen verschiedene Variablengruppen nache<strong>in</strong>ander<br />
(hierarchisch) <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Regressionsmodell aufgenommen werden sollen (Tabachnik & Fidell,<br />
2001). Nach Kontrolle jener Variablen, welche die Stichprobenschichtung ausgleichen, kann<br />
dadurch zunächst betrachtet werden, <strong>in</strong>wieweit die Gruppe der Sozial<strong>in</strong>dikatoren Ges<strong>und</strong>heit<br />
vorhersagen kann (Modell 2, s.u.). Anschließend wird das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten (hier: körperliche<br />
Aktivität) <strong>in</strong> das Modell e<strong>in</strong>bezogen <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Schritt auch psychologische<br />
Indikatoren <strong>in</strong> das Regressionsmodell aufgenommen. Hierbei handelt sich es zunächst um die<br />
beschriebenen etablierten psychologischen Skalen. Diese Form von Hierarchisierung wurde<br />
gewählt, um zunächst die Bedeutung äußerer, sozialer Faktoren für die Ges<strong>und</strong>heit untersuchen<br />
zu können, bevor betrachtet wird, ob darüber h<strong>in</strong>ausgehend auch Verhaltensweisen <strong>und</strong> schließlich<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Emotionen <strong>und</strong> Kognitionen e<strong>in</strong>e Rolle für die Ges<strong>und</strong>heit spielen. In e<strong>in</strong>em<br />
letzten Schritt (Modell 5, s.u.) wird schließlich betrachtet, ob nach Berücksichtigung aller anderen<br />
Faktoren auch alternsbezogene Kognitionen noch e<strong>in</strong>e Ges<strong>und</strong>heitsvorhersage leisten können.<br />
Dieses methodische Vorgehen ist h<strong>in</strong>sichtlich der Bedeutung psychischer Faktoren für die<br />
Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong> konservatives Modell, da es zuvor andere E<strong>in</strong>flüsse berücksichtigt.<br />
Sofern nicht der Ges<strong>und</strong>heitszustand zum zweiten Erhebungszeitpunkt vorhergesagt werden soll<br />
(zeitversetzte Prädiktion), sondern Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen, wird zunächst der Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
zum ersten Erhebungszeitpunkt kontrolliert (Modell 0). Dieses sequentielle Vorgehen<br />
zur Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heit lässt sich wie folgt zusammenfassen:<br />
Sequentielles Regressionsmodell:<br />
Modell 0: Kontrolle des Ges<strong>und</strong>heitszustandes zum ersten Messzeitpunkt<br />
Modell 1: Kontrolle der Stichproben-Schichtungskriterien<br />
Modell 2: (zusätzliche) Aufnahme der sozialen Indikatoren<br />
Modell 3: (zusätzliche) Aufnahme der körperlichen Aktivität<br />
Modell 4: (zusätzliche) Aufnahme etablierter psychologischer Indikatoren<br />
Modell 5: (zusätzliche) Aufnahme ‚alternsbezogener Kognitionen’<br />
8.4 Ergebnisse<br />
Die folgenden Ergebnisdarstellungen untergliedern sich, den Fragestellungen folgend, <strong>in</strong> mehrere<br />
Schritte: Beg<strong>in</strong>nend mit e<strong>in</strong>er Betrachtung von Multimorbidität wird zunächst <strong>in</strong> Abschnitt<br />
8.4.1 für die Gesamtstichprobe der Frage nachgegangen, welchen Beitrag soziale Faktoren zur<br />
Vorhersage von Multimorbidität leisten können. Neben der Gruppe der Sozial<strong>in</strong>dikatoren f<strong>in</strong>den<br />
auch verhaltensbezogene <strong>und</strong> psychische Faktoren sowie die alternsbezogene Kognitionen besondere<br />
Beachtung (vgl. Frage a1 bis a3). In e<strong>in</strong>er ergänzenden Darstellung wird zusätzlich<br />
betrachtet, welche der berücksichtigten E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikatoren e<strong>in</strong>en besonderen Vorhersagewert für<br />
373
374<br />
Susanne Wurm<br />
Ges<strong>und</strong>heit haben (Frage a4). Daran schließen sich altersgruppendifferenzierte Betrachtungen<br />
an. Hierbei wird <strong>in</strong> Abschnitt 8.4.2 die Frage verfolgt, ob die Bedeutung von sozialen Faktoren<br />
zur Vorhersage von Multimorbidität <strong>in</strong>nerhalb der zweiten Lebenshälfte gleich bleibt bzw. <strong>in</strong><br />
welcher Weise sich diese verändert (vgl. Frage b1). Ebenso wird betrachtet, ob die Bedeutung<br />
alternsbezogener Kognitionen zur Vorhersage körperlicher Erkrankungen altersabhängig zunimmt,<br />
ob diese gleich bleibt oder sogar abnimmt (vgl. Frage b2).<br />
Das gleiche Vorgehen wird ergänzend zur Vorhersage der Multimorbidität auch zur Vorhersage<br />
subjektiver Ges<strong>und</strong>heit gewählt. Ergebnisse, die sich auf die Gesamtstichprobe beziehen, können<br />
Abschnitt 8.4.3 entnommen werden. Wie bereits für die Multimorbidität, erfolgt neben e<strong>in</strong>er<br />
Betrachtung der Gesamtstichprobe auch e<strong>in</strong>e altersgruppendifferenzierte Vorhersage subjektiver<br />
Ges<strong>und</strong>heit, die Abschnitt 8.4.4 zu entnehmen ist.<br />
8.4.1 Vorhersage von körperlichen Erkrankungen<br />
Zur Vorhersage der Anzahl von körperlichen Erkrankungen wurden sequentielle Regressionsmodelle<br />
berechnet. Anhand von Tabelle 8.4 ist zu entnehmen, wie gut die e<strong>in</strong>gesetzten Modelle<br />
die Anzahl körperlicher Erkrankungen (Multimorbidität) vorhersagen können.<br />
Tabelle 8.4:<br />
Vorhersage von Multimorbiditätszustand <strong>und</strong> Multimorbiditätsentwicklung<br />
Körperliche Erkrankungen (t2)<br />
zeitversetzte Prädiktion:<br />
Krankheitszustand t2<br />
Krankheitsentwicklung<br />
t1t2<br />
Modell ∆R 2 ∆R 2<br />
0 Kontrolle Erkrankungen (t1) – .262***<br />
1 Kontrolle Stichproben-Schichtung .123*** .033***<br />
2 Soziale Indikatoren .027*** .007<br />
3 Körperliche Aktivität .015* .003<br />
4 Psychische Indikatoren .033*** .007*<br />
5 Alternsbezogene Kognitionen .039*** .018***<br />
R 2 = .216 .330<br />
***p
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Betrachtet man zunächst die zeitversetzte Prädiktion körperlicher Erkrankungen (1. Ergebnisspalte,<br />
„Krankheitszustand t2“), wird deutlich, dass alle Prädiktorgruppen e<strong>in</strong>e statistisch bedeutsame<br />
Vorhersage leisten können. Die höchste Varianzaufklärung (12,3%) erfolgt hierbei<br />
über die Stichprobenschichtungs-Kriterien (Altersgruppe, Region, Geschlecht). Wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
weiteren Schritt der Ergebnisdarstellung noch deutlich wird, ist diese hohe Bedeutsamkeit alle<strong>in</strong><br />
auf die Indikatoren zur „Altersgruppe“ zurückzuführen. Dieses Ergebnis verweist auf die Altersabhängigkeit<br />
körperlicher Erkrankungen. E<strong>in</strong>e, über die Stichprobenkriterien h<strong>in</strong>ausgehende,<br />
zusätzliche Varianzaufklärung durch die Sozial<strong>in</strong>dikatoren beträgt 1,7 Prozent. Die Gruppe<br />
körperlicher Aktivität kann darüber h<strong>in</strong>ausgehend nur e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en Vorhersagebeitrag leisten<br />
(0,5%), während psychische Indikatoren r<strong>und</strong> doppelt so viel Varianz (3,3%) aufklären, im Vergleich<br />
zu den Sozial<strong>in</strong>dikatoren. Nach Berücksichtigung all dieser Indikatorgruppen bleiben<br />
auch die alternsbezogenen Kognitionen zur zeitversetzten Vorhersage des Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
bedeutsam. Abgesehen von den Stichprobenschichtungs-Kriterien (Altersgruppe) können sie<br />
Multimorbidität am besten vorhersagen (3,9% Varianzaufklärung).<br />
Während die zeitversetzte Prädiktion vom Ausgangsniveau des Krankheitszustandes zur Erstbefragung<br />
abhängig ist, enthält die zweite Ergebnisspalte die niveaubere<strong>in</strong>igte Betrachtung der<br />
Krankheitsentwicklung. Wie erwartet zeigt sich hier der vorausgehende Krankheitszustand als<br />
bestes Kriterium zur Vorhersage der nachfolgenden Multimorbidität; die nur mittlere Stabilität<br />
der Ges<strong>und</strong>heit (r=.51) macht zugleich deutlich, dass viele Personen während des Sechsjahreszeitraumes<br />
zwischen den beiden Befragungen e<strong>in</strong>e Veränderung ihres Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
erfahren haben.<br />
E<strong>in</strong>e Vorhersage der Krankheitsentwicklung mit Hilfe der sozialen Indikatoren ist h<strong>in</strong>gegen<br />
nicht möglich. Dies könnte darauf zurückzuführen se<strong>in</strong>, dass sich die Bedeutung sozialer Faktoren<br />
bereits zum Zeitpunkt der Ersterhebung auf den Ges<strong>und</strong>heitszustand ausgewirkt hatte. Es ist<br />
zu vermuten, dass sich die Wirkung sozialer Faktoren (z.B. ger<strong>in</strong>gen E<strong>in</strong>kommens) eher über<br />
e<strong>in</strong>en Zeitraum von Jahrzehnten kumulativ auf die Ges<strong>und</strong>heit auswirkt. E<strong>in</strong> Zeitraum von sechs<br />
Jahren könnte h<strong>in</strong>gegen zu kurz se<strong>in</strong>, als dass sich bereits bestehende soziale Benachteiligungen<br />
<strong>in</strong> Krankheitsentwicklungen manifestieren konnten 3 .<br />
Ebenso wenig kann das Ausmaß körperlicher Aktivität zur Erklärung der Krankheitsentwicklung<br />
beitragen. Anders h<strong>in</strong>gegen sieht es für die Gruppe der psychischen Indikatoren aus: sie<br />
leisten e<strong>in</strong>en, wenngleich ger<strong>in</strong>gen, Vorhersagebeitrag für die <strong>Entwicklung</strong> von Multimorbidität.<br />
Alternsbezogene Kognitionen erweisen sich h<strong>in</strong>gegen als beste Prädiktoren für die Krankheitsentwicklung.<br />
Das ist besonders bemerkenswert, da vor dieser Indikatorengruppe bereits alle<br />
anderen sozialen, verhaltensbezogenen <strong>und</strong> psychischen Faktoren im Regressionsmodell berücksichtigt<br />
wurden. Dies weist auf die hohe Bedeutung h<strong>in</strong>, welche alternsbezogenen Kognitionen<br />
zur Vorhersage von Multimorbidität zukommt.<br />
3 Ergänzend könnte betrachtet werden, <strong>in</strong>wieweit Veränderungen sozialer Faktoren (z.B. zwischen den Befragungszeitpunkten<br />
erfolgte E<strong>in</strong>kommensverluste) mit e<strong>in</strong>er Erhöhung der Multimorbidität verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d. In diesem Fall<br />
wird die Veränderung sozialer Faktoren mit der Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung re<strong>in</strong> korrelativ <strong>in</strong> Zusammenhang gesetzt.<br />
E<strong>in</strong>e zeitbezogene Vorhersage, welchen E<strong>in</strong>fluss soziale Veränderungen auf die Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung haben,<br />
würde h<strong>in</strong>gegen m<strong>in</strong>destens drei Befragungszeitpunkte erfordern.<br />
375
376<br />
Susanne Wurm<br />
Auch wenn bestimmte Prädiktorgruppen, wie diejenigen der sozialen Faktoren <strong>und</strong> des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens,<br />
ke<strong>in</strong>e bedeutsame Vorhersage der Krankheitsentwicklung leisten können, bedeutet<br />
dies nicht, dass zugleich alle <strong>in</strong> diesen Modellen enthaltenen E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikatoren ohne<br />
Vorhersagewert s<strong>in</strong>d. Zugleich stellt sich bei jenen Modellen, die e<strong>in</strong>e bedeutsame Vorhersage<br />
der Krankheitsentwicklung leisten konnten (d.h. psychische Faktoren, alternsbezogene Kognitionen),<br />
die Frage, welche E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikatoren hierfür besonders verantwortlich s<strong>in</strong>d.<br />
Tabelle 8.5:<br />
Indikatoren zur Vorhersage der <strong>Entwicklung</strong> von Multimorbidität<br />
Modell 0<br />
β<br />
Modell 1<br />
β<br />
Modell 2<br />
β<br />
Modell 3<br />
β<br />
Modell 4<br />
β<br />
Modell 5<br />
β<br />
körperl. Erkrankg. .51*** .44*** .44*** .43*** .41*** .39***<br />
Altersgruppe A–J 1<br />
-.24*** -.23*** -.22*** -.25*** -.20***<br />
Altersgruppe A–M -.09** -.08* -.08* -.10** -.07*<br />
Region (Ost/West) .00 .01 .03 .03 .03<br />
Geschlecht (m/w) .05 .03 .04 .03 .04<br />
Prestige -.01 .00 .00 -.01<br />
E<strong>in</strong>kommen -.06* -.06* -.05 -.05<br />
Bildung H – G 2<br />
.01 .00 .01 -.01<br />
Bildung H – M .00 .00 .01 .00<br />
Lebensform -.05 -.04 -.04 -.04<br />
K<strong>in</strong>der .01 .01 .00 .01<br />
Sport -.06* -.07** -.06*<br />
Spazieren gehen .01 .01 .02<br />
Hope/Hoffnung .00 .03<br />
E<strong>in</strong>samkeit .00 .01<br />
positive Emotionen .02 .06*<br />
negative Emotionen .07** .06*<br />
Lebenszufriedenheit -.04 -.03<br />
AC 3 -Weiterentwick. -.11**<br />
AC-Selbst<strong>in</strong>tegration .01<br />
AC-phys. Verluste .11***<br />
AC-soz. Verluste -.02<br />
R 2 = .262 .295 .302 .305 .312 .330<br />
1 Altersgruppe A-J: Vergleich der ältesten Altersgruppe (Wert 0) mit der jüngsten Altersgruppe (Wert 1)<br />
Altersgruppe A-M: Vergleich der ältesten Altersgruppe ( Wert 0) mit der mittleren Altersgruppe (Wert 1)<br />
2 Bildung H-G: Vergleich von Personen mit höherer Bildung (Wert 0) <strong>und</strong> Personen mit ger<strong>in</strong>ger Bildung (Wert 1)<br />
Bildung H-M: Vergleich von Personen mit höherer Bildung (Wert 0) <strong>und</strong> Personen mit mittlerer Bildung (Wert 1)<br />
3 AC = Alternsbezogene Kognitionen<br />
***p
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Betrachtet man die Endergebnisse dieser Regressionsberechnung, die der letzten Spalte (Modell<br />
5) von Tabelle 8.5 zu entnehmen s<strong>in</strong>d, bestätigt sich das bereits vorweg genommene Ergebnis,<br />
dass h<strong>in</strong>sichtlich der Stichprobenschichtungsfaktoren lediglich der Indikator „Altersgruppe“<br />
e<strong>in</strong>e bedeutsame Vorhersage der Krankheitsentwicklung leisten kann. Hierbei zeigen sich deutliche<br />
Unterschiede zwischen der jüngsten <strong>und</strong> der ältesten Altersgruppe, während sich die mittlere<br />
<strong>und</strong> älteste Altersgruppe weniger ausgeprägt vone<strong>in</strong>ander unterscheiden. Dies deutet daraufh<strong>in</strong>,<br />
dass sich e<strong>in</strong> deutlicher Anstieg der Multimorbidität besonders im Übergang von der<br />
jüngsten zur mittleren Altersgruppe vollzieht.<br />
Während sich ke<strong>in</strong>er der sozialen Indikatoren als bedeutsam für Krankheitsentwicklung erweist,<br />
zeigt sich, dass sportliche Aktivitäten die Krankheitsentwicklung vorhersagen können. Dies<br />
bedeutet, dass unabhängig von ihrem Ges<strong>und</strong>heitszustand zur Erstbefragung Personen langfristig<br />
von höherer körperlicher Aktivität profitieren. Bei ihnen zeigt sich über den Zeitraum von<br />
sechs Jahren e<strong>in</strong>e günstigere Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung (kle<strong>in</strong>erer Anstieg von Multimorbidität),<br />
als bei Personen, die wenig körperlich aktiv waren.<br />
Für die psychischen Indikatoren zeigt sich, dass sowohl positive als auch negative Emotionen<br />
die <strong>Entwicklung</strong> der Multimorbidität vorhersagen können. Dabei tragen nicht nur hohe negative<br />
Emotionen zu e<strong>in</strong>er ungünstigen <strong>Entwicklung</strong> bei, sondern ebenso auch positive Emotionen.<br />
Möglicherweise ist dieser Bef<strong>und</strong> dah<strong>in</strong>gehend zu deuten, dass e<strong>in</strong>e hohe Emotions<strong>in</strong>tensität<br />
(bzw. e<strong>in</strong>e damit zusammenhängende emotionale Labilität) ges<strong>und</strong>heitsschädigende Folgen<br />
haben kann, sei es direkt, z.B. über erhöhtes Stresserleben oder <strong>in</strong>direkt, beispielsweise durch<br />
risikoreichere Verhaltensweisen.<br />
Die Betrachtung der alternsbezogenen Kognitionen macht deutlich, dass sich (nach Berücksichtigung<br />
aller anderen Prädiktorgruppen) zwei der vier Indikatoren als relevant erweisen. Verb<strong>in</strong>den<br />
Personen das Älterwerden mit e<strong>in</strong>er persönlichen Weiterentwicklung, so kommt es bei ihnen<br />
zu e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>geren Anstieg der Multimorbidität als bei Personen, die e<strong>in</strong> weniger positives<br />
Bild vom Älterwerden haben. Umgekehrt kommt es zu e<strong>in</strong>em stärkeren Anstieg körperlicher<br />
Erkrankungen, wenn das Älterwerden mit e<strong>in</strong>er Zunahme physischer Verluste verb<strong>und</strong>en wird.<br />
Dabei ist auch hier zu betonen, dass es sich um Ergebnisse handelt, die unabhängig s<strong>in</strong>d vom<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand zum Zeitpunkt der Erstbefragung. Dadurch lässt sich das Antizipieren physischer<br />
Verluste sowie der e<strong>in</strong>getretene Anstieg der Multimorbidität nicht damit erklären, es<br />
handele sich hierbei primär um Personen, denen es bereits zum Zeitpunkt der Erstbefragung<br />
ges<strong>und</strong>heitlich schlechter g<strong>in</strong>g.<br />
8.4.2 Altersgruppendifferenzierte Vorhersage körperlicher Erkrankungen<br />
Ergänzend zu den Ergebnisdarstellungen für die Gesamtstichprobe sollen im Folgenden altersgruppenvergleichende<br />
Betrachtungen vorgenommen werden. Diese dienen primär zur Verfolgung<br />
von zwei Fragen (vgl. Untersuchungsfrage b1 <strong>und</strong> b2): Zum e<strong>in</strong>en der Frage, ob die Bedeutung<br />
sozialer Faktoren für die Ges<strong>und</strong>heit mit dem Alter zu- oder abnimmt bzw. gleich<br />
bleibt. Zum anderen der Frage, ob h<strong>in</strong>sichtlich alternsbezogener Kognitionen Unterschiede zwischen<br />
den Altersgruppen zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d. Letztere Betrachtung unterliegt erneut der (konservati-<br />
377
378<br />
Susanne Wurm<br />
ven) Restriktion, dass zunächst alle anderen Prädiktorengruppen <strong>in</strong> die Regressionsberechnung<br />
e<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gen, bevor alternsbezogene Kognitionen berücksichtigt werden.<br />
Erneut erfolgte die Berechnung sequentieller Regressionsanalysen, <strong>in</strong> diesem Fall jedoch getrennt<br />
nach Altersgruppe. Der nachfolgenden Tabelle 8.6 können die Ergebniszusammenfassungen<br />
zur (zeitversetzten) Vorhersage körperlicher Erkrankungen sowie der <strong>Entwicklung</strong> körperlicher<br />
Erkrankungen entnommen werden.<br />
Betrachtet man anhand von Tabelle 8.6 zunächst die Ergebnisse zur zeitversetzten Vorhersage<br />
von körperlichen Erkrankungen mittels sozialer Indikatoren, so wird deutlich, dass diese <strong>in</strong> der<br />
jüngsten (46-60 Jahre) <strong>und</strong> mittleren Altersgruppe (61-75 Jahre) die Multimorbidität vorhersagen<br />
können, nicht jedoch <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe (76-91 Jahre). Die fehlende Signifikanz <strong>in</strong><br />
der ältesten Altersgruppe ist jedoch auf die deutlich ger<strong>in</strong>gere Stichprobengröße zurückzuführen,<br />
während die Höhe der Varianzaufklärung zwischen jener der jüngsten <strong>und</strong> mittleren Altersgruppe<br />
liegt. Im Gegensatz zur Vorhersage des „Krankheitszustandes“ kann die Gruppe sozialer<br />
Indikatoren <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er der Altersgruppen e<strong>in</strong>e Vorhersage für die „Krankheitsentwicklung“ leisten.<br />
Dies entspricht den Bef<strong>und</strong>en für die Gesamtstichprobe. Das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten ist für<br />
ke<strong>in</strong>e der Altersgruppen statistisch bedeutsam. Für die Gruppe der psychologischen Indikatoren<br />
(Modell 4) sowie die alternsbezogenen Kognitionen (Modell 5) zeigt sich, dass ihre Bedeutung<br />
für körperliche Erkrankungen mit dem Alter steigt.<br />
Tabelle 8.6:<br />
Vorhersage von Multimorbidität im Altersgruppenvergleich – Zeitversetzte Prädiktion<br />
des Ges<strong>und</strong>heitszustandes <strong>und</strong> Prädiktion der Ges<strong>und</strong>heitsveränderung<br />
Jüngste Altersgruppe Mittlere Altersgr. Älteste Altersgruppe<br />
zeitversetzter<br />
Krankheits-<br />
zustand t2<br />
Krankheitsentwicklung<br />
t1t2<br />
zeitversetzter<br />
Krankheits-<br />
zustand t2<br />
Krankheitsentwicklung<br />
t1t2<br />
zeitversetzter<br />
Krankheits-<br />
zustand t2<br />
Krankheitsentwicklung<br />
t1t2<br />
Modell ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2<br />
0 Kontr.Erkrankg. (t1) – .210*** – .184*** – .201***<br />
1 Kontr. SP-Schichtg. .009 .011* .001 .002 .029* .011<br />
2 Soziale Indikatoren .024* .010 .039** .019 .028 .012<br />
3 Körperl. Aktivität .007 .005 .005 .006 .021 .010<br />
4 Psych. Indikatoren .032** .007 .045*** .016 .068** .023<br />
5 Alterns-Kognitionen .037*** .018* .044*** .015 .052* .039*<br />
R 2 = .108 .261 .135 .242 .198 .296<br />
***p
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
durch alternsbezogene Kognitionen noch als bedeutsam (∆R 2 =.052), obwohl hier zuvor herkömmliche<br />
psychische Prädiktoren e<strong>in</strong>e hohe Varianzaufklärung (∆R 2 =.068) leisten konnten.<br />
Erneut werfen die dargestellten Modellergebnisse die Frage auf, welche E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikatoren für<br />
die beschriebenen Modellbef<strong>und</strong>e besonders verantwortlich s<strong>in</strong>d. Die Ergebnisse hierzu s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
der nachfolgenden Tabelle dargestellt.<br />
Bereits anhand von Tabelle 8.6 war zu entnehmen, dass sich <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe die<br />
Stichprobenschichtung (Modell 1) als bedeutsam zur Vorhersage der Krankheitsentwicklung<br />
erweist. Anhand der nachfolgenden Tabelle 8.7 kann nachvollzogen werden, welcher E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikator<br />
hierfür verantwortlich ist.<br />
Tabelle 8.7:<br />
Altersgruppenvergleich: Indikatoren zur Vorhersage der <strong>Entwicklung</strong><br />
körperlicher Erkrankungen<br />
Jüngste Altersgr. Mittlere Altersgr. Höchste Altersgr.<br />
β β β<br />
körperliche Erkrankungen .43*** .36*** .36***<br />
Region (Ost/West) .10* .03 -.08<br />
Geschlecht .06 .04 .03<br />
Prestige -.05 -.02 .05<br />
E<strong>in</strong>kommen -.02 -.08 -.04<br />
Bildung H – G 1<br />
-.03 .01 -.06<br />
Bildung H – M -.05 -.02 -.01<br />
Lebensform -.09* -.01 -.06<br />
K<strong>in</strong>der .01 .05 -.07<br />
Sport -.05 -.08 -.09<br />
Spazieren gehen .06 .03 -.05<br />
Hope (Hoffnung) .06 .03 -.02<br />
E<strong>in</strong>samkeit .03 .01 .01<br />
positive Emotionen .05 .05 .07<br />
negative Emotionen .06 .05 .09<br />
Lebenszufriedenheit .03 -.11* -.02<br />
AC 2 -Weiterentwicklung -.06 -.10 -.18*<br />
AC-Selbst<strong>in</strong>tegration -.03 .04 .00<br />
AC-physische Verluste .12** .09 .12<br />
AC-soziale Verluste .02 -.02 -.12<br />
R 2 = .261 .242 .296<br />
***p
380<br />
Susanne Wurm<br />
westdeutsche Personen e<strong>in</strong> höherer Anstieg der Multimorbidität festzustellen als für Ostdeutsche.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der sozialen Indikatoren (Modell 2) erweist sich ebenfalls nur für die jüngste Altersgruppe<br />
e<strong>in</strong> Prädiktor als bedeutsam. Es handelt sich hierbei um die Lebensform – Personen,<br />
die mit e<strong>in</strong>em Partner zusammenleben, haben e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Anstieg der Multimorbidität zu<br />
verzeichnen als Personen, die ohne Partner leben. In den anderen beiden Altersgruppen erweist<br />
sich ke<strong>in</strong> sozialer Prädiktor als statistisch bedeutsam, was zu e<strong>in</strong>em gewissen Anteil auf die<br />
Korrelation der sozialen Indikatoren untere<strong>in</strong>ander zurückzuführen ist 4 , vor allem aber auch<br />
dadurch bed<strong>in</strong>gt ist, dass <strong>in</strong> der Tabelle nicht der nachfolgende Ges<strong>und</strong>heitszustand, sondern die<br />
Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung betrachtet wurde (vgl. Ergebnisdarstellungen <strong>in</strong> Tabelle 8.6).<br />
In der mittleren Altersgruppe (61-75 Jahre) ersche<strong>in</strong>t die Lebenszufriedenheit als bester Prädiktor<br />
zur Vorhersage körperlicher Erkrankungen. Demnach berichten Personen mit hoher Lebenszufriedenheit<br />
über e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Anstieg der Multimorbidität als jene mit ger<strong>in</strong>ger Lebenszufriedenheit.<br />
Schließlich kann wieder betrachtet werden, wie gut alternsbezogene Kognitionen (nach Berücksichtigung<br />
der sozialen <strong>und</strong> psychischen Indikatoren sowie des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens) noch die<br />
Krankheitsentwicklung vorhersagen können. Auch hier zeigen sich altersgruppenabhängige<br />
Effekte: Wird das Älterwerden mit hohen physischen Verlusten verb<strong>und</strong>en, so kann dies <strong>in</strong> der<br />
jüngsten Altersgruppe e<strong>in</strong>en Anstieg der Multimorbidität vorhersagen. Im Gegensatz dazu ist<br />
für die älteste Altersgruppe die positive Sicht auf das Älterwerden von hoher Bedeutung für den<br />
Anstieg der Multimorbidität. Personen, die das Älterwerden auch als persönliche Weiterentwicklung<br />
empf<strong>in</strong>den, haben e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Anstieg körperlicher Erkrankungen als jene mit<br />
e<strong>in</strong>er negativeren Sicht auf das Älterwerden. Die positive Vorstellung vom Älterwerden als<br />
Weiterentwicklung erweist sich für die älteste Altersgruppe zugleich als e<strong>in</strong>ziger Prädiktor <strong>in</strong><br />
der Vorhersage der Multimorbiditätsentwicklung.<br />
Nachdem nun zunächst die <strong>Entwicklung</strong> der Multimorbidität betrachtet wurde, soll im Folgenden<br />
untersucht werden, welche Bedeutung die verschiedenen Prädiktoren zur Vorhersage subjektiver<br />
Ges<strong>und</strong>heit haben.<br />
8.4.3 Vorhersage von subjektiver Ges<strong>und</strong>heit<br />
Zur Vorhersage subjektiver Ges<strong>und</strong>heit wurden die gleichen, bereits e<strong>in</strong>geführten Prädiktorgruppen<br />
verwendet <strong>und</strong> erneut sequentielle multiple Regressionen gerechnet. Das gewählte<br />
Vorgehen <strong>und</strong> die Form der Darstellung ist vergleichbar mit jener zur Vorhersage körperlicher<br />
Erkrankungen. Auch hier werden zunächst die Ergebnisse der zeitversetzten Prädiktion von<br />
subjektiver Ges<strong>und</strong>heit sowie der Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung e<strong>in</strong>ander gegenübergestellt. Anschließend<br />
wird betrachtet, welche E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikatoren sich als statistisch bedeutsam erweisen.<br />
4 In vergleichend gerechneten Regressionsmodellen mit schrittweiser Regression erwies sich für die mittlere Altersgruppe<br />
das E<strong>in</strong>kommen als bedeutsamer Indikator zur Vorhersage körperlicher Erkrankungen.
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Wie anhand der ersten Ergebnisspalte von Tabelle 8.8 deutlich wird, tragen alle Prädiktorgruppen<br />
<strong>in</strong> bedeutsamer Weise zur Vorhersage des (zeitversetzten) subjektiven Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
bei. Im Vergleich zur Vorhersage der Multimorbidität erweist sich hierbei die Stichprobenschichtung<br />
(Modell 1) als deutlich weniger bedeutsam, während soziale Indikatoren <strong>und</strong> körperliche<br />
Aktivität e<strong>in</strong>en höheren E<strong>in</strong>fluss auf die subjektive Ges<strong>und</strong>heit haben, als auf körperliche<br />
Erkrankungen – <strong>in</strong> beiden Fällen kommt es <strong>in</strong> etwa zu e<strong>in</strong>er Verdoppelung der Varianzaufklärung<br />
(∆R 2 ), wenn man diese vergleicht mit der Vorhersage körperlicher Erkrankungen. Nach<br />
Berücksichtigung der anderen Indikatorengruppen (Modelle 1 bis 3) bleiben psychische Indikatoren<br />
<strong>und</strong> alternsbezogene Kognitionen bedeutsam für die Vorhersage des subjektiven Ges<strong>und</strong>heitszustandes.<br />
Tabelle 8.8:<br />
Vorhersage von subjektivem Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsveränderung<br />
Subjektive Ges<strong>und</strong>heit (t2)<br />
zeitversetzte Prädiktion:<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand t2<br />
Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
t1t2<br />
Modell ∆R 2 ∆R 2<br />
0 Kontrolle Ges<strong>und</strong>heit (t1) – .229***<br />
1 Kontr. Stichproben-Schichtung .045*** .016***<br />
2 Soziale Indikatoren .030*** .009*<br />
3 Körperliche Aktivität .011*** .003<br />
4 Psychische Indikatoren .031*** .004<br />
5 Alternsbezogene Kognitionen .025*** .003<br />
***p
Tabelle 8.9:<br />
Indikatoren zur Vorhersage der <strong>Entwicklung</strong> von subjektiver Ges<strong>und</strong>heit<br />
382<br />
Modell 0<br />
β<br />
Modell 1<br />
β<br />
Modell 2<br />
β<br />
Modell 3<br />
β<br />
Modell 4<br />
β<br />
Susanne Wurm<br />
Modell 5<br />
β<br />
subjekt. Ges<strong>und</strong>h. .48*** .46*** .44*** .44*** .42*** .41***<br />
Altersgruppe A–J 1<br />
.17*** .14*** .13*** .14*** .13**<br />
Altersgruppe A–M .14*** .12** .12** .12** .11**<br />
Region (Ost/West) .04 .04 .03 .02 .02<br />
Geschlecht (m/w) -.01 .01 .00 .00 .00<br />
Prestige .02 .02 .02 .02<br />
E<strong>in</strong>kommen .01 .01 .00 -.01<br />
Bildung H – G 2<br />
-.01 -.01 -.01 .00<br />
Bildung H – M -.03 -.03 -.04 -.03<br />
Lebensform .08** .08** .07** .07*<br />
K<strong>in</strong>der .01 .01 .01 .01<br />
Sport .06* .06* .06*<br />
Spazieren gehen .00 .00 -.01<br />
Hope/Hoffnung .02 .00<br />
E<strong>in</strong>samkeit .01 .01<br />
positive Emotionen .02 -.01<br />
negative Emotionen .00 .01<br />
Lebenszufriedenheit .05 .05<br />
AC 3 -Weiterentwick .05<br />
AC-Selbst<strong>in</strong>tegration .02<br />
AC-phys. Verluste -.02<br />
AC-soz. Verluste -.02<br />
***p
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
können alternsbezogene Kognitionen ke<strong>in</strong>e bedeutsame Vorhersage der <strong>Entwicklung</strong> subjektiver<br />
Ges<strong>und</strong>heit leisten.<br />
8.4.4 Altersgruppendifferenzierte Vorhersage subjektiver Ges<strong>und</strong>heit<br />
In e<strong>in</strong>er abschließenden Darstellung wird auch für die subjektive Ges<strong>und</strong>heit untersucht, welche<br />
Unterschiede sich zwischen den Altersgruppen zeigen. Hierfür erfolgt zunächst (analog zu den<br />
bisherigen Ergebnisdarstellungen) e<strong>in</strong>e Betrachtung der Indikatorengruppen (Modelle), im Anschluss<br />
daran werden bedeutsame E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dikatoren aufgezeigt. Nachfolgender Tabelle 8.10<br />
können zunächst die Ergebnisse für die Indikatorengruppen entnommen werden.<br />
Tabelle 8.10:<br />
Vorhersage von subjektivem Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
im Altersgruppenvergleich<br />
Jüngste Altersgr. Mittlere Altersgr. Älteste Altersgruppe<br />
zeitversetzter<br />
Ges<strong>und</strong>heits-<br />
zustand t2<br />
Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
t1t2<br />
zeitversetzter<br />
Ges<strong>und</strong>heits-<br />
zustand t2<br />
Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
t1t2<br />
zeitversetzter<br />
Ges<strong>und</strong>heits-<br />
zustand t2<br />
Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
t1t2<br />
Modell ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2 ∆R 2<br />
0 Kontr.Ges<strong>und</strong>h. (t1) – .170*** – .253*** – .235***<br />
1 Kontr.SP-Schichtg. .013* .005 .002** .002 .025 .003<br />
2 Soziale Indikatoren .051*** .020* .035** .013 .067* .039<br />
3 Körperl. Aktivität .017** .008 .020** .006 .003 .003<br />
4 Psych. Indikatoren .034** .008 .033** .002 .051* .012<br />
5 Alterns-Kognitionen .024** .005 .030** .004 .045* .017<br />
R 2 = .139 .216 .120 .280 .191 .309<br />
***p
384<br />
Susanne Wurm<br />
Tabelle 8.11:<br />
Altersgruppenvergleich: Indikatoren zur Vorhersage der <strong>Entwicklung</strong> subjektiver Ges<strong>und</strong>heit<br />
Jüngste Altersgr. Mittlere Altersgr. Höchste Altersgr.<br />
β β β<br />
subjektive Ges<strong>und</strong>heit .32*** .49*** .41***<br />
Region (Ost/West) .05 .00 .05<br />
Geschlecht .02 -.03 .03<br />
Prestige .06 .04 -.12<br />
E<strong>in</strong>kommen -.03 .00 .05<br />
Bildung H – G 1<br />
-.04 .01 .12<br />
Bildung H – M -.10* .01 .07<br />
Lebensform .03 .11* .11<br />
K<strong>in</strong>der .00 .00 .03<br />
Sport .09* .07 -.05<br />
Spazieren gehen -.02 .03 -.03<br />
Hope (Hoffnung) .00 -.02 .01<br />
E<strong>in</strong>samkeit .01 .02 .04<br />
positive Emotionen -.01 .00 .04<br />
negative Emotionen .00 -.04 .09<br />
Lebenszufriedenh. .09 -.01 .06<br />
AC-Weiterentwicklung .00 .08 .11<br />
AC-Selbst<strong>in</strong>tegration .05 .00 -.03<br />
AC-physische Verluste -.07 .05 -.07<br />
AC-soziale Verluste -.01 -.01 -.05<br />
R 2 = .216 .280 .309<br />
1<br />
Bildung H-G: Vergleich von Personen mit höherer Bildung (Wert 0) <strong>und</strong> Personen mit ger<strong>in</strong>ger Bildung (Wert 1)<br />
Bildung H-M: Vergleich von Personen mit höherer Bildung (Wert 0) <strong>und</strong> Personen mit mittlerer Bildung (Wert 1)<br />
***p
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
leben. In der ältesten Altersgruppe erweist sich ke<strong>in</strong> Indikator als bedeutsam. Hier, wie <strong>in</strong> den<br />
anderen Altersgruppen, kann auch ke<strong>in</strong> Indikator der Gruppe alternsbezogener Kognitionen<br />
subjektive Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen vorhersagen. Dies entspricht dem Ergebnis, das sich bereits<br />
bei Betrachtung der Gesamtstichprobe zeigte.<br />
8.5 Zusammenfassung<br />
Um Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte erklären zu können, werden <strong>in</strong> Abhängigkeit<br />
von der jeweiligen fachlichen Diszipl<strong>in</strong> verschiedene Erklärungsmodelle herangezogen.<br />
Biomediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> genetische Modelle beschäftigen sich mit den physiologischen Ursachen<br />
des Alterns <strong>und</strong> mit Krankheitsentwicklungen im Alter. Neben körpereigenen Ursachen<br />
spielen für die Ges<strong>und</strong>heit jedoch auch Umwelte<strong>in</strong>flüsse, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>s Verhalten sowie Gefühle<br />
<strong>und</strong> Gedanken e<strong>in</strong>e Rolle. Diese Faktoren s<strong>in</strong>d auf gesellschaftlicher <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Ebene<br />
veränderbar. Die Erforschung ihrer Bedeutung für die Ges<strong>und</strong>heit kann deshalb mögliche Präventionspotenziale<br />
aufdecken.<br />
Die vorliegende Untersuchung verfolgte zwei zentrale Ziele: Zum e<strong>in</strong>en g<strong>in</strong>g es darum, e<strong>in</strong>en<br />
Beitrag dazu zu leisten, e<strong>in</strong>e wiederholt beklagte Forschungslücke (z.B. Badura, 1999; Knesebeck,<br />
1998) zu schließen: Durch die diszipl<strong>in</strong>äre Verankerung der verschiedenen Erklärungsmodelle<br />
konzentrieren sich die meisten Studien darauf, die Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung im Alter<br />
mit Hilfe soziologischer, psychologischer oder verhaltensmediz<strong>in</strong>ischer Modelle zu erklären.<br />
Nur selten werden h<strong>in</strong>gegen verschiedene Erklärungsansätze geme<strong>in</strong>sam berücksichtigt, weswegen<br />
<strong>in</strong> den vorliegenden Analysen diese Modelle <strong>in</strong>tegriert wurden.<br />
E<strong>in</strong> zweites Ziel war, im Rahmen dieser modell<strong>in</strong>tegrierenden Betrachtung zwei Fragen besonders<br />
hervorzuheben. Die erste Frage bezog sich auf die Bedeutung sozialer Faktoren für die<br />
Ges<strong>und</strong>heit. Diese ersche<strong>in</strong>t vor allem vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> divergierender Bef<strong>und</strong>e bedeutsam,<br />
ob sich die Relevanz sozialer Faktoren (<strong>in</strong>sbesondere solcher, die auf soziale Ungleichheit h<strong>in</strong>weisen)<br />
mit dem Alter verändert oder nicht. Über die sozialen Faktoren h<strong>in</strong>aus wurde zusätzlich<br />
das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten sowie psychische Ressourcen zur Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heit berücksichtigt.<br />
Mit der zweiten Frage wurde e<strong>in</strong> Thema aufgegriffen, zu dem sich erst seit neuerer Zeit<br />
Studien f<strong>in</strong>den lassen. Hierbei handelt es sich um die Frage, <strong>in</strong>wieweit Vorstellungen vom Älterwerden<br />
die Ges<strong>und</strong>heit bee<strong>in</strong>flussen können. Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der <strong>in</strong> westlichen Gesellschaften<br />
noch immer vorherrschenden Altersdiskrim<strong>in</strong>ierung bei gleichzeitig starker Zunahme<br />
der Gruppe der Älteren, ist diese Frage nicht nur von <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r, sondern auch von hoher<br />
gesellschaftlicher Bedeutung.<br />
1. Soziale Faktoren: Zur Frage danach, welche Bedeutung sozialen Faktoren für die Ges<strong>und</strong>heit<br />
zukommt <strong>und</strong> ob sich ihr E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heit mit steigendem Alter verändert, legen die<br />
vorliegenden Ergebnisse des Alterssurveys folgende Schlussfolgerungen nahe: Soziale Faktoren<br />
bee<strong>in</strong>flussen den Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>in</strong> bedeutsamer Weise. Dabei erweist sich weniger e<strong>in</strong><br />
spezifischer sozialer Faktor als herausragend, vielmehr sche<strong>in</strong>en verschiedene soziale Faktoren<br />
geme<strong>in</strong>sam zur Ges<strong>und</strong>heit beizutragen. Dies gilt sowohl für Personen, die am Beg<strong>in</strong>n ihrer<br />
zweiten Lebenshälfte stehen als auch für Personen im hohen Alter. Damit sprechen die Bef<strong>und</strong>e<br />
385
386<br />
Susanne Wurm<br />
am ehesten für e<strong>in</strong>e Kont<strong>in</strong>uität der Bedeutung sozialer Faktoren für die Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte.<br />
Die Ergebnisse der getrennt betrachteten Vorhersagen für den Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung<br />
legen die Annahme nahe, dass sich soziale Faktoren eher kumulativ über<br />
Jahrzehnte, das heißt über langjährige Unterschiede <strong>in</strong> der Lebensführung <strong>und</strong> nicht primär <strong>in</strong>nerhalb<br />
von e<strong>in</strong>igen wenigen Jahren auf die körperliche Ges<strong>und</strong>heit auswirken. Es wird teilweise<br />
sogar angenommen, dass sich die Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong><br />
erster L<strong>in</strong>ie vor dem 50. Lebensjahr vollziehen (Atchley, 1999).<br />
Schließlich verdeutlichen die Ergebnisse, dass soziale Faktoren besonders gut die subjektive<br />
Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung vorhersagen können. Dabei ist e<strong>in</strong>e subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung<br />
nicht alle<strong>in</strong> Ausdruck der persönlichen Wahrnehmung körperlicher Erkrankungen, sondern<br />
sie umfasst zugleich weitergehende Aspekte der Lebensqualität (vgl. Kapitel 7). Als Ges<strong>und</strong>heitsmaß<br />
ist subjektive Ges<strong>und</strong>heit von hoher Bedeutung, da sie sich als sensiblerer Indikator<br />
für das Mortalitätsrisiko erwiesen hat als der mediz<strong>in</strong>isch messbare Ges<strong>und</strong>heitszustand.<br />
2. Ges<strong>und</strong>heitsverhalten <strong>und</strong> psychische Ressourcen: Neben sozialen Faktoren wurde körperliche<br />
Aktivität als e<strong>in</strong> wichtiger Aspekt <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens berücksichtigt. H<strong>in</strong>sichtlich<br />
körperlicher Aktivität wurde deutlich, dass zwar sportliche Aktivitäten, nicht jedoch<br />
Spaziergänge e<strong>in</strong>en positiven E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heit haben. Dies bedeutet, dass körperliche<br />
Aktivität nicht allzu moderat se<strong>in</strong> sollte: Etwas Anstrengung bei körperlicher Tätigkeit, die<br />
auf die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> körperliche Kondition abgestimmt se<strong>in</strong> sollte, ist notwendig, um positive<br />
Folgen zu erzielen. Zudem wurden verschiedene psychische Ressourcen <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitsvorhersage<br />
e<strong>in</strong>bezogen. Diese erwiesen sich ebenfalls als bedeutsam für die Ges<strong>und</strong>heit. Sie bee<strong>in</strong>flussen<br />
bereits <strong>in</strong>nerhalb der untersuchten sechs Jahre die <strong>Entwicklung</strong> körperlicher Erkrankungen<br />
(im S<strong>in</strong>ne von Multimorbidität). Zugleich nehmen psychische Ressourcen, vergleichbar mit<br />
sozialen Faktoren, <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er langfristigen Wirkung E<strong>in</strong>fluss auf die körperliche <strong>und</strong> subjektive<br />
Ges<strong>und</strong>heit.<br />
3. Vorstellungen über das Älterwerden: Neben der Betrachtung sozialer Faktoren stand im Zentrum<br />
der vorliegenden Untersuchung auch die Frage, welchen Stellenwert Vorstellungen über<br />
das Älterwerden für die Ges<strong>und</strong>heit haben. Dabei wurde e<strong>in</strong> sehr konservatives Untersuchungsverfahren<br />
gewählt, <strong>in</strong>dem die Ges<strong>und</strong>heit zunächst durch e<strong>in</strong>e Reihe bekannter Faktoren (sozialer<br />
<strong>und</strong> psychischer Faktoren, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten) vorhergesagt <strong>und</strong> dann betrachtet wurde,<br />
ob Vorstellungen über das Älterwerden (alternsbezogene Kognitionen) darüber h<strong>in</strong>ausgehend<br />
die Ges<strong>und</strong>heit vorhersagen können. Trotz dieses konservativen Vorgehens erwiesen sich Vorstellungen<br />
über das Älterwerden für die Ges<strong>und</strong>heitsvorhersage als sehr bedeutsam. Vorstellungen<br />
über das Älterwerden können dabei bereits zu Beg<strong>in</strong>n der zweiten Lebenshälfte die Ges<strong>und</strong>heit<br />
bee<strong>in</strong>flussen, mit steigendem Alter nimmt ihre Bedeutung jedoch noch zu.<br />
Die Ergebnisse zu Vorstellungen über das Älterwerden legen im Gegensatz zu den sozialen<br />
Faktoren nahe, dass sie nicht nur über viele Jahre kumulativ e<strong>in</strong>e Wirkung auf die Ges<strong>und</strong>heit<br />
entfalten, sondern bereits im Zeitraum der betrachteten sechs Jahre e<strong>in</strong>en deutlichen E<strong>in</strong>fluss auf<br />
die Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung haben.
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Dies zeigte sich vor allem im H<strong>in</strong>blick auf die <strong>Entwicklung</strong> körperlicher Erkrankungen. Vorstellungen<br />
über das Älterwerden bee<strong>in</strong>flussen <strong>in</strong> bedeutsamer Weise, ob es zu e<strong>in</strong>er Zu- bzw.<br />
Abnahme oder Konstanz der Anzahl körperlicher Erkrankungen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Zeitraumes von<br />
sechs Jahren kommt – dies gilt für alle drei betrachteten Altersgruppen. Dabei haben vor allem<br />
zwei Sichtweisen auf das Älterwerden starken E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heit: Zum e<strong>in</strong>en die pessimistische<br />
Vorstellung, dass das Älterwerden mit physischen Verlusten verb<strong>und</strong>en ist. Dabei<br />
wurde deutlich, dass die Erwartung von physischen Verlusten (<strong>und</strong> zwar unabhängig davon, <strong>in</strong><br />
welchem Umfang e<strong>in</strong>e Person bei der Erstbefragung krank bzw. ges<strong>und</strong> war) zu e<strong>in</strong>em Anstieg<br />
der Multimorbidität über den Zeitraum von sechs Jahren führte. Zum anderen erwies sich auch<br />
die optimistische Vorstellung, Älterwerden als e<strong>in</strong>e Möglichkeit für persönliche Weiterentwicklung<br />
zu sehen, als ges<strong>und</strong>heitsrelevant. E<strong>in</strong>e <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne positive Sicht auf das Älterwerden<br />
erwies sich als ges<strong>und</strong>heitsprotektiv. Personen, die das Älterwerden (auch) als Phase der Weiterentwicklung<br />
sahen, hatten e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Anstieg von Krankheiten als Personen mit negativerer<br />
Sicht auf das Älterwerden – <strong>und</strong> zwar wiederum unabhängig davon, über wie viele<br />
Krankheiten die Personen zum ersten Befragungszeitpunkt berichteten.<br />
E<strong>in</strong>e nach Altersgruppen differenzierte Analyse konnte zeigen, dass <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe<br />
(76-91 Jahre) Erwartungen an das Älterwerden den größten E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heit haben.<br />
Bemerkenswert ist, dass aber auch bereits zu Beg<strong>in</strong>n der zweiten Lebenshälfte diesen alternsbezogenen<br />
Kognitionen e<strong>in</strong>e bedeutsame Rolle für die Ges<strong>und</strong>heit zukommt. Während sich bei<br />
Personen der ältesten Altersgruppe vor allem das Erleben persönlicher Weiterentwicklung wichtig<br />
für die Ges<strong>und</strong>heit herausstellte, ist für Jüngere (46-60-Jahre) vor allem ges<strong>und</strong>heitsrelevant,<br />
ob sie das Älterwerden mit physischen Verlusten verb<strong>in</strong>den oder nicht. Dieser Bef<strong>und</strong> lässt sich<br />
möglicherweise damit erklären, dass <strong>in</strong> jüngeren Jahren die „Gew<strong>in</strong>n-Verlust-Bilanz“ (Baltes,<br />
1997) <strong>in</strong>sgesamt noch positiv ausfällt. Dadurch s<strong>in</strong>d nicht primär positive Erwartungen an das<br />
Älterwerden, sondern vor allem pessimistische Erwartungen, wie die Erwartung physischer<br />
Verluste, ges<strong>und</strong>heitsrelevant. In höherem Alter h<strong>in</strong>gegen fällt die „Gew<strong>in</strong>n-Verlust-Bilanz“<br />
zunehmend negativ aus. Verb<strong>in</strong>den <strong>in</strong> diesem Alter Personen das Älterwerden mit physischen<br />
Verlusten, so handelt es sich oftmals um realistische E<strong>in</strong>schätzungen aufgr<strong>und</strong> eigener Erfahrungen.<br />
Entscheidend ist vermutlich <strong>in</strong> dieser Altersgruppe deshalb weniger, ob das Älterwerden<br />
mit Verlusten verb<strong>und</strong>en wird, sondern, ob trotz erlebter Verluste auch noch Gew<strong>in</strong>ne mit<br />
dem Älterwerden verb<strong>und</strong>en werden.<br />
Es ist wünschenswert, <strong>in</strong> vertiefenden Analysen mehr über die Wirkungswege zu erfahren, über<br />
die sich der E<strong>in</strong>fluss der verschiedenen, untersuchten Faktoren auf die Ges<strong>und</strong>heit vollzieht.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Wirkungsweise sozialer Faktoren auf die Ges<strong>und</strong>heit ist allerd<strong>in</strong>gs bereits aus<br />
verschiedenen Studien bekannt, dass Personen aus niedrigen sozialen Schichten häufiger ges<strong>und</strong>heitsabträgliche<br />
Lebensgewohnheiten (bezüglich Ernährungs- <strong>und</strong> Bewegungsverhalten,<br />
Konsum von Genussmitteln) aufweisen <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gere psychische Bewältigungsressourcen haben<br />
als Personen höherer sozialer Schichten (Mielck, 2000; Wurm & Tesch-Römer, im Druck).<br />
In weitergehenden Analysen sollte die Betrachtung deshalb dah<strong>in</strong>gehend ausgeweitet werden,<br />
ob sich unterschiedliche soziale Gruppen auch <strong>in</strong> ihrer Sicht auf das Älterwerden unterscheiden.<br />
Schließlich ist zu fragen, <strong>in</strong> welcher Weise sich Vorstellungen über das Älterwerden auf die<br />
Ges<strong>und</strong>heit auswirken – möglicherweise spielt hierbei das unterschiedliche Ges<strong>und</strong>heitsverhalten<br />
von Personen mit e<strong>in</strong>er eher positiven oder negativen Sicht auf das Älterwerden e<strong>in</strong>e Rolle.<br />
387
8.6 Implikationen<br />
388<br />
Susanne Wurm<br />
1. Soziale Faktoren: Die Ergebnisse zur Bedeutung sozialer Faktoren für die Ges<strong>und</strong>heit machen<br />
deutlich, dass soziale Faktoren (<strong>und</strong> damit auch Aspekte sozialer Ungleichheit) bis <strong>in</strong>s<br />
hohe Alter wichtig für die Ges<strong>und</strong>heit bleiben. Allerd<strong>in</strong>gs gehen mit dem Altern oftmals soziale<br />
Verluste (z.B. Verlust der Partner<strong>in</strong>/des Partners) sowie im Zusammenhang mit dem Übergang<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand Statusverluste <strong>und</strong> materielle Verluste e<strong>in</strong>her. Es ersche<strong>in</strong>t deshalb wichtig,<br />
gesellschaftlich e<strong>in</strong>en Ausgleich zu diesen sozialen Verlusten zu schaffen. Zu solchen Formen<br />
e<strong>in</strong>es Ausgleiches zählt die Stärkung der sozialen Teilhabe Älterer, d.h. die Stärkung sozialer<br />
Integration <strong>und</strong> Partizipation. Wichtig ist hierbei auch die gesellschaftliche Akzeptanz <strong>und</strong> Anerkennung<br />
Älterer, was vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der vorherrschenden, überwiegend negativen Altersstereotypen<br />
nicht als selbstverständlich angesehen werden kann. Schließlich ist es, besonders<br />
zur Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>er guten subjektiven Ges<strong>und</strong>heit bedeutsam, ältere Personen im<br />
Fall von sozialen Verlusterlebnissen zu unterstützen <strong>und</strong> zu begleiten. Die Aufrechterhaltung<br />
e<strong>in</strong>er guten subjektiven Ges<strong>und</strong>heit ist, neben dem Wert e<strong>in</strong>er hohen Lebensqualität, auch wichtig<br />
<strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Mortalitätsentwicklung. Die ungünstige Prognose bezüglich der Mortalitätsentwicklung<br />
von Personen mit schlechter subjektiver Ges<strong>und</strong>heit ist aus zahlreichen Studien<br />
bekannt.<br />
2. Ges<strong>und</strong>heitsverhalten <strong>und</strong> psychische Ressourcen: Die Ergebnisse zur Bedeutung sportlicher<br />
Aktivität für die Ges<strong>und</strong>heit machen deutlich, dass Sport auch <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte e<strong>in</strong>e<br />
wichtige präventive Funktion zukommt. Allerd<strong>in</strong>gs treibt e<strong>in</strong> großer <strong>und</strong> mit dem Altern wachsender<br />
Anteil von Personen ke<strong>in</strong>erlei Sport 5 . Es ist deshalb anzustreben, auch Ältere zu Bewegungs-<br />
bzw. sportlichen Aktivitäten zu motivieren, sie (teilweise erstmals) an sportliche Aktivitäten<br />
heranzuführen <strong>und</strong> dabei <strong>in</strong> adäquater Weise die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Konstitution zu berücksichtigen.<br />
– In H<strong>in</strong>blick auf das Ges<strong>und</strong>heitsverhalten <strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heit erweisen sich auch die<br />
psychischen Ressourcen als relevant. Die Erhöhung der psychischen Ressourcen, zu der unter<br />
anderem die Verbesserung <strong>und</strong> Stabilisierung der emotionalen Bef<strong>in</strong>dlichkeit <strong>und</strong> die Stärkung<br />
persönlicher Kontrollüberzeugungen zählt, ist e<strong>in</strong>erseits wichtig, um krankheitsbed<strong>in</strong>gte Belastungen<br />
besser bewältigen zu können. Im S<strong>in</strong>ne der (primären) Prävention fördern diese Ressourcen<br />
zudem die persönlichen Möglichkeiten, um ges<strong>und</strong>heitlich belastendes Verhalten (z.B.<br />
Rauchverhalten) reduzieren zu können.<br />
3. Vorstellungen über das Älterwerden: Im vorliegenden Kapitel wurde aufgezeigt, dass Vorstellungen<br />
über das Älterwerden e<strong>in</strong>e große Bedeutung für die Ges<strong>und</strong>heit zukommt. Die Tatsache,<br />
dass persönliche Erwartungen <strong>und</strong> Erlebensweisen die Ges<strong>und</strong>heit bee<strong>in</strong>flussen können <strong>und</strong><br />
somit „das Denken“ auch Konsequenzen auf körperlicher Ebene haben kann, ist weith<strong>in</strong> bekannt<br />
– besonders durch Forschungsarbeiten zum E<strong>in</strong>fluss von Optimismus auf die Ges<strong>und</strong>heit<br />
(z.B. Peterson, Seligman & Valliant, 1988; Schaier & Carver, 1987; Scheier et al., 1989;<br />
Schwarzer, 1994). Der Bef<strong>und</strong>, dass jedoch auch Vorstellungen über das Älterwerden die Ges<strong>und</strong>heit<br />
bee<strong>in</strong>flussen, ist neu <strong>und</strong> konnte bisher nur anhand e<strong>in</strong>er amerikanischen Studie gezeigt<br />
werden (Levy et al., 2002). Vorstellungen über das Älterwerden haben alle Personen, K<strong>in</strong>der<br />
5 Gemäß der Daten des Alterssurveys treiben 28 Prozent der 40- bis 54-Jährigen, 37 Prozent der 55- bis 69-Jährigen<br />
sowie 59 Prozent der 70- bis 85-Jährigen ke<strong>in</strong>erlei Sport.
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
wie Hochbetagte. Gerade bei Jüngeren s<strong>in</strong>d diese Vorstellungen vor allem durch gesellschaftliche<br />
Altersstereotype geprägt. Diese Stereotype haben <strong>in</strong> westlichen Gesellschaften e<strong>in</strong>e primär<br />
negative Ausrichtung. Mit zunehmendem Alter werden stereotypisierte Vorstellungen über das<br />
Älterwerden durch eigene Erfahrungen ergänzt <strong>und</strong> modifiziert, umgekehrt werden jedoch auch<br />
persönliche Erfahrungen des Älterwerdens vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> ver<strong>in</strong>nerlichter Altersstereotype<br />
<strong>in</strong>terpretiert. Dies macht deutlich, dass die Bedeutung negativer Altersstereotypen – <strong>und</strong> ihrer<br />
Konsequenzen – nicht unterschätzt werden sollte. Es ersche<strong>in</strong>t deshalb wichtig, negative Altersstereotype<br />
abzubauen <strong>und</strong> positive Seiten des Alterns stärker gesellschaftlich sichtbar zu machen.<br />
Dabei geht es nicht darum, negative Seiten des Alterns zu negieren <strong>und</strong> das Älterwerden<br />
zu idealisieren. Viel eher geht es darum, die breite Öffentlichkeit stärker über jene Forschungserkenntnisse<br />
zu <strong>in</strong>formieren, die zeigen, dass der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand nicht mit Altse<strong>in</strong><br />
oder der Vorbereitung auf das Lebensende gleichzusetzen ist. Die Lebensphase des Alters, <strong>in</strong>sbesondere<br />
des sogenannten „dritten Alters“, das derzeit bis etwa 80 Jahre angesetzt wird, hat<br />
sich <strong>in</strong> den letzten Jahren <strong>und</strong> Jahrzehnten stetig verändert <strong>und</strong> die Möglichkeiten e<strong>in</strong>er positiven<br />
Sicht auf das Älterwerden deutlich erweitert.<br />
Der Bef<strong>und</strong>, dass soziale Faktoren, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten, psychische Ressourcen <strong>und</strong> schließlich<br />
auch Vorstellungen über das Älterwerden sowohl zu Beg<strong>in</strong>n der zweiten Lebenshälfte, als<br />
auch im höheren Alter e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung für die Ges<strong>und</strong>heit haben, weist darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>in</strong><br />
Maßnahmen zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung stets gesellschaftliche, soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren<br />
gleichermaßen berücksichtigt werden sollten. E<strong>in</strong>e solche multidiszipl<strong>in</strong>äre Herangehensweise<br />
sollte dabei Aspekte wie die eigene Sicht auf das Älterwerden e<strong>in</strong>beziehen <strong>und</strong> zwar nicht erst<br />
bei jenen, die bereits e<strong>in</strong> hohes Alter erreicht haben, sondern gerade auch bei Personen, die am<br />
Beg<strong>in</strong>n ihrer zweiten Lebenshälfte stehen.<br />
389
8.7 Literatur<br />
390<br />
Susanne Wurm<br />
Atchley, R. C. (1999). Cont<strong>in</strong>uity and adaptation <strong>in</strong> ag<strong>in</strong>g. Baltimore: Johns Hopk<strong>in</strong>s University<br />
Press.<br />
Aldw<strong>in</strong>, C. M., & Gilmer, D. F. (2004). Health, illness and optimal ag<strong>in</strong>g. Thousand Oaks, CA:<br />
Sage.<br />
Badura, B. (1999). Was ist <strong>und</strong> bed<strong>in</strong>gt Ges<strong>und</strong>heit. Ges<strong>und</strong>heitswesen, 61(Sonderheft), S11-<br />
S13.<br />
Baltes, P. B. (1997). On the <strong>in</strong>complete architecture of human ontogeny: Selection, optimization,<br />
and compensation as fo<strong>und</strong>ation of developmental theory. American Psychologist,<br />
52(4), 366-380.<br />
Bandura, A. (1992). Self-efficacy mechanisms <strong>in</strong> psychobiologic function<strong>in</strong>g. In R. Schwarzer<br />
(Ed.), Self-efficacy. Thought control of action (pp. 355-394). Philadelphia: Taylor &<br />
Francis Inc.<br />
Baumann, A., Filipiak, B., Stieber, J., & Loewel, H. (1998). Familienstand <strong>und</strong> soziale Integration<br />
als Prädiktoren der Mortalität: e<strong>in</strong>e 5-Jahres-Follow-Up Studie an 55-74-Jährigen<br />
Männern <strong>und</strong> Frauen <strong>in</strong> der Region Augsburg. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie,<br />
31, 184-192.<br />
Bonita, R. (1996). Classical cardiovascular risk factors. In S. Ebrahim & A. Kalache (Eds.),<br />
Epidemiology <strong>in</strong> old age (pp. 184-189). London: BMJ.<br />
Borchelt, M., Gilberg, R., Horgas, A. L., & Geiselmann, B. (1996). Zur Bedeutung von Krankheit<br />
<strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>derung im Alter. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
(pp. 449-474). Berl<strong>in</strong>: Akademie-Verlag.<br />
Bortz, J. (1989). Statistik für Sozialwissenschaftler. Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Brewer, M. B., Dull, V., & Lui, L. (1981). Perceptions of the elderly: Stereotypes as prototypes.<br />
Journal of Personality and Social Psychology, 41(4), 656-670.Bronfenbrenner, U. (1979).<br />
The ecology of human development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.<br />
Connidis, I. (1989). The subjective experience of ag<strong>in</strong>g: correlates of divergent views. Canadian<br />
Journal of Ag<strong>in</strong>g, 8(1), 7-18.<br />
Crockett, W. H., & Hummert, M. L. (1987). Perceptions of ag<strong>in</strong>g and the elderly. In K. W.<br />
Schaie & C. Eisdorfer (Eds.), Annual review of gerontology and geriatrics (pp. 217-241).<br />
New York.<br />
Dowd, J. J., & Bengston, V. L. (1978). Ag<strong>in</strong>g <strong>in</strong> m<strong>in</strong>ority populations. An exam<strong>in</strong>ation of the<br />
double jeopardy hypothesis. Journal of Gerontology, 33(3), 427-436.<br />
Duffy, M. E., & MacDonald, E. (1990). Determ<strong>in</strong>ants of functional health of older persons. The<br />
Gerontologist, 30(4), 503-509.<br />
Ettrich, K. U. (2000). Persönlichkeit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit im mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter.<br />
In P. Mart<strong>in</strong> & K. U. Ettrich & U. Lehr & D. Roether & M. Mart<strong>in</strong> & A. Fischer-
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Cyrulies (Eds.), Aspekte der <strong>Entwicklung</strong> im mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter<br />
(pp. 47-67). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.<br />
Evans, W. J., & Campbell, W. W. (1993). Sarcopenia and age-related changes <strong>in</strong> body composition<br />
and functional capacity. Journal of Nutrition, 123, 465-468.<br />
Filipp, S.-H., Ferr<strong>in</strong>g, D., & Klauer, T. (1989). Subjektives Alterserleben - e<strong>in</strong> Merkmal erfolgreichen<br />
Alterns? Zeitschrift für Gerontopsychologie <strong>und</strong> -psychatrie, 2(1-3), 296-300.<br />
George, L. K. (1996). Social factors and illness. In N<strong>in</strong>stock, R. H., & George, L. K. (Eds.),<br />
Handbook of ag<strong>in</strong>g and the social sciences (pp. 229-252). San Diego: Academic Press.<br />
Gerok, W., & Brandtstädter, J. (1994). Normales, krankhaftes <strong>und</strong> optimales Altern: Variations-<br />
<strong>und</strong> Modifikationsspielräume. In P. B. Baltes & J. Mittelstraß & U. M. Staud<strong>in</strong>ger (Eds.),<br />
Alter <strong>und</strong> Altern: E<strong>in</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ärer Studientext zur Gerontologie - Sonderausgabe<br />
des 1992 erschienenen 5. Forschungsberichts der Akademie der Wissenschaften zu Berl<strong>in</strong><br />
(pp. 356- 385). Berl<strong>in</strong>: de Gruyter.<br />
Grembowski, D., Donald, P., & Diehr, P. (1993). Self-Efficacy and Health Behavior Among<br />
Older Adults. Journal of Health and Social Behavior, 34, 89-104.<br />
Hausdorff, J. M., Levy, B., & Wei, J. Y. (1999). The power of ageism on physical function of<br />
older persons: Reversibility of age-related gait changes. Journal of the American Geriatrics<br />
Society, 47(11), 1346-1349.<br />
Heckhausen, J., & Krüger, J. (1993). Developmental expectations for the self and most other<br />
people: Age grad<strong>in</strong>g <strong>in</strong> three functions of social comparison. Developmental Psychology,<br />
29, 539-548.<br />
Helmert, U. (2003). Soziale Ungleichheit <strong>und</strong> Krankheitsrisiken. Augsburg: Maro.<br />
Helmert, U., & Voges, W. (2002). E<strong>in</strong>flussfaktoren für die Mortalitätsentwicklung bei 50- bis<br />
69-jährigen Frauen <strong>und</strong> Männern <strong>in</strong> Westdeutschland im Zeitraum 1984-1998. Zeitschrift<br />
für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35, 450-462.<br />
Hummert, M. L. (1990). Multiple stereotypes of elderly and young adults: A comparison of<br />
structure and evaluations. Psychology and Ag<strong>in</strong>g, 5(2), 182-193.<br />
Hummert, M. L., Garstka, T. A., Shaner, J. L., & Strahm, S. (1994). Stereotypes of the elderly<br />
held by young, middle-aged, and elderly adults. Journals of Gerontology, 49(5), P240-<br />
249.<br />
Idler, E. L., & Benyam<strong>in</strong>i, Y. (1997). Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven<br />
commmunity studies. Journal of Health and Social Behavior, (38), 21-37.<br />
Idler, E. L., & Kasl, S. V. (1991). Health perceptions and survival: Do global evaluations of<br />
health status really predict mortality? Journal of Gerontology, 46, 55-65.<br />
Jong-Gierveld, J. d., & Kamphuis, F. (1985). The development of a Rasch-Type Lonel<strong>in</strong>ess<br />
Scale. Applied Psychological Measurement, 9(3), 289-299.<br />
Kamen-Siegel, L., Rod<strong>in</strong>, J., Seligman, M. P. E., & Dwyer, J. (1991). Explanatory style and<br />
cell-mediated immunity <strong>in</strong> elderly men and women. Health Psychology, 10, 229-235.<br />
391
392<br />
Susanne Wurm<br />
Keller, M. L., Leventhal, E. A., & Larson, B. (1989). Ag<strong>in</strong>g: The lived experience. International<br />
Journal of Ag<strong>in</strong>g and Human Development, 29(1), 67-82.<br />
Kirkwood, T. (1996). Mechanisms of age<strong>in</strong>g. In S. Ebrahim & A. Kalache (Eds.), Epidemiology<br />
<strong>in</strong> Old Age (pp. 3-11). London: BMJ.<br />
Knesebeck, O. v. d. (1998). Subjektive Ges<strong>und</strong>heit im Alter. Münster: Lit.<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A., & Szydlik, M. (2000). Soziale Ungleichheit. In M. Kohli<br />
& H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite Lebenshälfte - Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation<br />
im Spiegel des Alters-Survey (pp. 318-336). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kruse, A. (2002). Ges<strong>und</strong> altern. Baden-Baden: Nomos.<br />
Kruse, A., & Schmitt, E. (2002). Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankheit im hohen Alter. In K. Hurrelmann<br />
& P. Kulip (Eds.), Geschlecht, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankheit (pp. 206-221). Bern: Huber.<br />
Leventhal, H., Leventhal, E. A., & Contrada, R. J. (1998). Self-regulation, health, And behavior:<br />
A perceptual-cognitive approach. Psychology and Health, 13, 717-733.<br />
Levy, B. (1998). The <strong>in</strong>ner self of the Japanese elderly: A defense aga<strong>in</strong>st negative stereotypes<br />
of ag<strong>in</strong>g. International Journal of Ag<strong>in</strong>g & Human Development, 48(2), 131-144.<br />
Levy, B., & Langer, E. (1994). Ag<strong>in</strong>g free from negative stereotypes: Successful memory <strong>in</strong><br />
Ch<strong>in</strong>a and among the American deaf. Journal of Personality and Social Psychology,<br />
66(6), 989-997.<br />
Levy, B. R., Ashman, O., & Dror, I. (2000). To be or not to be: The effects of ag<strong>in</strong>g stereotypes<br />
on the will to live. Omega, 40(3), 409-420.<br />
Levy, B. R., Hausdorff, J. M., Hencke, R., & Wei, J. Y. (2000). Reduc<strong>in</strong>g cardiovascular stress<br />
with positive self-stereotypes of ag<strong>in</strong>g. Journal of Gerontology: Psychological Sciences,<br />
55B(4), P205-P231.<br />
Levy, B. R., Slade, M. D., & Kasl, S. V. (2002). Longitud<strong>in</strong>al benefit of positive selfperceptions<br />
of ag<strong>in</strong>g on functional health. Journal of Gerontology, 57B(5), 409-417.<br />
Levy, B. R., Slade, M. D., Kasl, S. V., & Kunkel, S. R. (2002). Longevity <strong>in</strong>creased by positive<br />
self-perceptions of ag<strong>in</strong>g. Journal of Personality and Social Psychology, 83(2), 261-270.<br />
Marmot, M. G., Smith, G. D., Stansfeld, S., Patel, C., North, F., Head, J., White, I., Brunner, E.,<br />
& Feeney, A. (1991). Health <strong>in</strong>equalities among British civil servants: The Whitehall II<br />
Study. Lancet, 337, 1387-1393.<br />
Mayer, K. U., & Wagner, M. (1996). Lebenslagen <strong>und</strong> soziale Ungleichheit im hohen Alter. In<br />
K. U. Mayer (Ed.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 251-275). Berl<strong>in</strong>: Akademie-Verlag.<br />
McClearn, G. E., & Heller, D. A. (2000). Genetics and ag<strong>in</strong>g. In S. B. Manuck & R. Jenn<strong>in</strong>gs &<br />
B. S. Rab<strong>in</strong> & A. Baum (Eds.), Behavior, health, and ag<strong>in</strong>g (pp. 1-14). Mahwah, NJ:<br />
Lawrence Erlbaum.<br />
Menec, V. H., Chipperfield, J. G., & Raymond, P. P. (1999). Self-perceptions of health: A prospective<br />
analysis of mortality, control, and health. Journal of Gerontology: Psychological<br />
Sciences, 54B(2), P85-P93.
Kapitel 8: Prädiktoren für Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Mielck, A. (2000). Soziale Ungleichheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Bern: Hans Huber.<br />
Mielck, A., & Helmert, U. (1993). Krankheit <strong>und</strong> soziale Ungleichheit: Empirische Studien <strong>in</strong><br />
West-Deutschland. In A. Mielck (Ed.), Krankheit <strong>und</strong> soziale Ungleichheit (pp. 93-124).<br />
Opladen: Leske + Budrich.<br />
Mossey, J. M., & Shapiro, E. (1982). Self-rated health: A predictor of mortality among the elderly.<br />
American Journal of Public Health, 72(8), 800-808.<br />
Motel, A., & Wagner, M. (1993). Armut im Alter? Ergebnisse der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie zur<br />
E<strong>in</strong>kommenslage alter <strong>und</strong> sehr alter Menschen. Zeitschrift für Soziologie, 22, 433-448.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. (2000). Alter <strong>und</strong> Generationenvertrag im <strong>Wandel</strong> des Sozialstaates. Berl<strong>in</strong>:<br />
Weißensee Verlag.<br />
Nelson, T. D. (2002). Stereotyp<strong>in</strong>g and prejudice aga<strong>in</strong>st older people. Cambridge, Mass.:<br />
Bradford.<br />
Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment,<br />
5(2), 164-172.<br />
Perlman, D. (1988). Lonel<strong>in</strong>e: A life-span, family perspective. In R. M. Milardo (Ed.), Families<br />
and social networks (pp. 190-220). Newbury Park, CA: Sage.<br />
Peterson, C., Seligman, M. E. P., & Valliant, G. E. (1988). Pessimistic explanatory style is a<br />
risk factor for physical illness: A Thirty-Five-Year Longitud<strong>in</strong>al Study. Journal of Personality<br />
and Social Psychology, 55(1), 23-27.<br />
Prohaska, T. R., Leventhal, E. A., Leventhal, H., & Keller, M. L. (1985). Health practices and<br />
illness cognition <strong>in</strong> young, middle aged, and elderly adults. Journal of Gerontology,<br />
40(5), 569-578.<br />
Rod<strong>in</strong>, J. (1986). Ag<strong>in</strong>g and health: Effects of the sense of control. Science, 233, 1271-1276.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen (1996). Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
<strong>in</strong> Deutschland. Kostenfaktor <strong>und</strong> Zukunftsbranche. Band I: Demographie, Morbidität,<br />
Wirtschaftlichkeitsreserven <strong>und</strong> Beschäftigung. Baden-Baden: Nomos.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen (2001). Bedarfsgerechtigkeit<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit, Band III.<br />
Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1987). Dispositional optimism and physical well-be<strong>in</strong>g: The<br />
<strong>in</strong>fluence of generalized outcome expectancies on health. Journal of Personality, 55, 169-<br />
210.<br />
Scheier, M. F., Matthews, K. A., Owens, J. F., Magovern, G. J., Lefebvre, R. C., Abbott, A. R.,<br />
& Carver, C. S. (1989). Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass<br />
surgery: the beneficial effects on physical and psychological well-be<strong>in</strong>g. Journal of Personality<br />
and Social Psychology, 57, 1024-1040.<br />
Schwarzer, R. (1992). Psychologie des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.<br />
Schwarzer, R. (1993). Defensiver <strong>und</strong> funktionaler Optimismus als Bed<strong>in</strong>gungen für Ges<strong>und</strong>heitsverhalten.<br />
Zeitschrift für Ges<strong>und</strong>heitspsychologie, 1(1), 7-31.<br />
393
394<br />
Susanne Wurm<br />
Schwarzer, R. (1994). Optimism, vulnerability, and self-beliefs as health-related cognitions: A<br />
systematic overview. Psychology and Health, 9, 161-180.<br />
Seger, W. (1999). Die Stärkung der Selbstverantwortung als Ges<strong>und</strong>heitsziel. Ges<strong>und</strong>heitswesen,<br />
61, 214-217.<br />
Sen, K. (1996). Gender. In S. Ebrahim & A. Kalache (Eds.), Epidemiology <strong>in</strong> old Age (pp. 210-<br />
220). London: BMJ.<br />
Snyder, C. R. (1998). Hope. In H. S. Friedman (Ed.), Encyclopedia of mental health (Vol. 2, pp.<br />
421- 431). San Diego: Academic Press.<br />
Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irv<strong>in</strong>g, L. M., Sigmon, S. T., Yosh<strong>in</strong>obu,<br />
L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and the ways: Development<br />
and validation of an <strong>in</strong>dividual-differences measure of hope. Journal of Personality<br />
and Social Psychology, 60(4), 570-585.<br />
Steele, C. M. (1997). A threat <strong>in</strong> the air: How stereotypes shape <strong>in</strong>tellectual identity and performance.<br />
American Psychologist, 52(6), 613-629.<br />
Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Us<strong>in</strong>g multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.<br />
Walter, U., & Schwartz, F. W. (2001). Ges<strong>und</strong>heit der Älteren <strong>und</strong> Potenziale der Prävention<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung. In Deutsches Zentrum für Altersfragen (Ed.), Expertisen zum<br />
Dritten Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung, Band 1 (pp. 145-252). Opladen: Leske +<br />
Budrich.<br />
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures<br />
of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social<br />
Psychology, 54(6), 1063-1070.<br />
Whitbourne, S. K. (2001). The physical ag<strong>in</strong>g process <strong>in</strong> midlife: Interactions with psychological<br />
and sociocultural factors. In M. E. Lachman (Ed.), Handbook of Midlife Development<br />
(pp. 109-155). New York: John Wiley & Sons, Inc.<br />
Whitbourne, S. K. (2002). The ag<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dividual. Physical and psychological Perspectives (2nd<br />
ed.). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Whitman, T. L. (1999). Conceptual frameworks for view<strong>in</strong>g health and illness. In T. L. Whitman<br />
& T. V. Merluzzi & R. D. White (Eds.), Life-span perspectives on health and illness<br />
(pp. 3-21). New Jersey: Lawrence Erlbaum.<br />
Wurm, S. & Tesch-Römer, C. (im Druck). Alter <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. In R. Schwarzer (Ed.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie.<br />
Enzyklopädie der Psychologie. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.<br />
Yasunaga, A., & Tokunaga, M. (2001). The relationships among exercise behavior, functional<br />
ADL, and psychological health <strong>in</strong> the elderly. Journal of Physiological Anthropology Applied<br />
Human Science, 20, 339-343.
9. Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
<strong>und</strong> Lebensqualität <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
Clemens Tesch-Römer <strong>und</strong> Susanne Wurm<br />
9.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität s<strong>in</strong>d zentrale Konzepte der Alterssozialberichterstattung<br />
<strong>und</strong> der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung. Auch im täg-<br />
lichen Leben s<strong>in</strong>d die Bed<strong>in</strong>gungen von „Zufriedenheit“, „Freude“ oder „Glück“ von hohem<br />
Interesse. Für die Sozialberichterstattung s<strong>in</strong>d subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
bedeutsame Indikatoren für die Bewertung gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s, die neben objektive<br />
Indikatoren wie materielle Lebenslage, Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> soziale Integration treten.<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität können als Kriterien für die Effizienz gesellschaftlicher<br />
Wohlfahrtsproduktion verstanden werden. Damit ist die kont<strong>in</strong>uierliche Beobachtung dieser<br />
subjektiven Indikatoren im zeitlichen Verlauf e<strong>in</strong>e der wichtigen Aufgaben der Sozialberichterstattung.<br />
In Ergänzung zu diesem Erkenntnis<strong>in</strong>teresse wird <strong>in</strong> der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen<br />
Alternsforschung den <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>und</strong> sozialen Bed<strong>in</strong>gungen des subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens Aufmerksamkeit gewidmet. E<strong>in</strong> Ausgangspunkt dieses Forschungsstranges ist<br />
die Beobachtung, dass die Lebensbed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>er Person <strong>und</strong> deren Bewertung nicht immer<br />
übere<strong>in</strong>stimmen. Neben den Merkmalen der Lebenssituation werden hierbei auch <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Standards <strong>und</strong> Erwartungen sowie personale Bewältigungskompetenzen bei der Verarbeitung<br />
von kritischen Lebensereignissen <strong>in</strong> den Blick genommen.<br />
Die Frage nach Lebensqualität gew<strong>in</strong>nt besondere Bedeutung mit Blick auf Altwerden <strong>und</strong><br />
Altse<strong>in</strong>. Ob die zweite Lebenshälfte als erfüllte Phase des Lebenslaufs zu charakterisieren ist,<br />
bestimmt sich auch durch das <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den älter werdender Menschen. Angesichts<br />
des demografischen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er hohen (<strong>und</strong> <strong>in</strong> Zukunft weiter steigenden) Lebenserwartung<br />
ist zu fragen, wie e<strong>in</strong>e hohe Lebensqualität von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Hälfte des Lebens<br />
sicher gestellt werden kann.<br />
Im vorliegenden Kapitel stehen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sprozesse <strong>und</strong> gesellschaftliche Veränderungen<br />
h<strong>in</strong>sichtlich subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>und</strong> Lebensqualität im Mittelpunkt des<br />
Interesses. Gibt es e<strong>in</strong>e Veränderung der Lebensqualität im Verlauf der historischen Zeit? Verändert<br />
sich die Lebensqualität mit dem Alter e<strong>in</strong>er Person? Welche Bed<strong>in</strong>gungen bee<strong>in</strong>flussen<br />
die sich wandelnde Lebensqualität von älter werdenden Menschen? Um diese Fragen zu beantworten,<br />
werden zunächst theoretische Überlegungen <strong>und</strong> daraus resultierende Untersuchungsfragen<br />
formuliert. Daran schließen sich methodische Informationen zur Datenbasis <strong>und</strong> den<br />
verwendeten Indikatoren an. Den Hauptteil des Kapitels bilden jene Bef<strong>und</strong>e aus dem Alterssurvey,<br />
die sich auf den <strong>Wandel</strong> von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität <strong>in</strong> der historischen<br />
Zeit (Kohortenvergleich) sowie im biografischen Verlauf (Panelanalyse) beziehen.<br />
395
396<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Abschließend werden die Bef<strong>und</strong>e mit Blick auf Bewältigungskompetenz <strong>und</strong> Resilienz älter<br />
werdender Menschen <strong>in</strong>terpretiert.<br />
9.2 Theoretische Überlegungen<br />
Konzeptuelle Überlegungen zu den Konstrukten subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
werden mit Blick auf die Forschungstraditionen der Sozialberichterstattung sowie der sozial-<br />
<strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung erörtert (andere Perspektiven, wie etwa die<br />
mediz<strong>in</strong>ische oder psychiatrische Sicht des Wohlbef<strong>in</strong>dens bleiben unberücksichtigt (vgl. Bull<strong>in</strong>ger,<br />
1997; Smith, Fleeson, Geiselmann, Settersten & Kunzmann, 1996). Zudem werden Modelle<br />
des Zusammenhangs zwischen Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Lebensbewertung vorgestellt.<br />
Abschließend werden Forschungsfragen formuliert.<br />
9.2.1 Die Konstrukte „Lebensqualität“ <strong>und</strong> „subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den“<br />
Innerhalb der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung wird das Konstrukt<br />
„subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den“ def<strong>in</strong>iert als emotionale <strong>und</strong> kognitive Reaktion auf Zustände, Ereignisse<br />
<strong>und</strong> Erfahrungen, mit denen e<strong>in</strong>e Person im Verlauf ihres Lebens konfrontiert wird<br />
(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; Okun, 2001). Im Bereich der Sozialberichterstattung wird<br />
<strong>in</strong> diesem Zusammenhang häufig auch der Begriff „Lebensqualität“ verwendet (Campbell,<br />
Converse & Rogers, 1976; Noll & Schöb, 2002; Zapf, 1984). Beide Begriffe weisen e<strong>in</strong>e so<br />
hohe konzeptuelle Ähnlichkeit auf, dass sie im folgenden synonym verwendet werden. Trotz<br />
dieser Ähnlichkeit zeigen sich auch Unterschiede zwischen den beiden Traditionen.<br />
In der Sozialberichterstattung steht die Wohlfahrtsproduktion von Gesellschaften im Mittelpunkt<br />
des Interesses. Zentrale Aufgabe der Sozialberichterstattung ist die Bereitstellung von Informationen<br />
über Niveau, Verteilung <strong>und</strong> Verlauf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Wohlfahrt für Sozial- <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik<br />
sowie für den allgeme<strong>in</strong>en gesellschaftlichen Diskurs (Noll, 1997; Zapf, 1977).<br />
Subjektive Reaktionen von Menschen auf ihre Lebenssituation werden als e<strong>in</strong> Bestandteil von<br />
Wohlfahrt angesehen, <strong>und</strong> zwar entweder als Komplement zu den objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
(Schupp, Habich & Zapf 1996; Zapf, 1984; Zapf & Habich 1996) oder als Indikator für die<br />
<strong>in</strong> der Biografie realisierten Lebensergebnisse (Campbell, Converse & Rodgers, 1976). Bef<strong>und</strong>e<br />
zum subjektiven Wohlergehen von Gesellschaftsmitgliedern liefern damit e<strong>in</strong>en bedeutsamen<br />
Beitrag zur Bewertung des Zustandes <strong>und</strong> der <strong>Entwicklung</strong> der betreffenden Gesellschaft. E<strong>in</strong><br />
Beispiel hierfür ist die Verwendung des globalen Indikators „allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit“<br />
für die Bewertung der „Lebbarkeit“ von Gesellschaften (Veenhoven, 2002). Neben globalen<br />
Maßen des allgeme<strong>in</strong>en subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens werden aber auch spezifische subjektive<br />
Indikatoren zu zentralen Lebensbereichen verwendet, etwa Zufriedenheit mit Ges<strong>und</strong>heit, E<strong>in</strong>kommen<br />
oder sozialen Netzwerken (Noll & Schöb, 2002).<br />
Innerhalb der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung ist die Analyse subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens häufig e<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong> übergreifende theoretische Konzeptionen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Verhaltens <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong>, etwa mit Blick auf Motive menschlichen Verhal-
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
tens oder auf die <strong>Entwicklung</strong> des Selbst im Lebenslauf (Keyes & Ryff, 1999). Ziel dieser Forschung<br />
ist e<strong>in</strong>e umfassende Beschreibung <strong>und</strong> Erklärung <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Wohlbef<strong>in</strong>dens, die e<strong>in</strong>e<br />
multidimensionale Erfassung des Konstrukts „subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den“ notwendig macht.<br />
Dabei werden nicht alle<strong>in</strong> Beurteilungen der eigenen Lebenssituation, sondern auch Stimmungen<br />
<strong>und</strong> Gefühle erfasst. Ähnlich wie <strong>in</strong> der alltäglichen Unterscheidung zwischen „Zufriedenheit“<br />
<strong>und</strong> „Glück“ lassen sich kognitive <strong>und</strong> emotionale Komponenten des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
unterscheiden (Filipp, 2002). Kognitive Bestandteile des Wohlbef<strong>in</strong>dens s<strong>in</strong>d Bewertungen<br />
der eigenen Lebenssituation, die mit Blick auf bestimmte Maßstäbe oder Zielvorstellungen<br />
vorgenommen werden. Emotionale Bestandteile des Wohlbef<strong>in</strong>dens s<strong>in</strong>d Gefühlszustände <strong>und</strong><br />
Affekte, die e<strong>in</strong>erseits als direkte Reaktionen auf Erfahrungen <strong>und</strong> Erlebnisse vorübergehende<br />
Stimmungen der Person widerspiegeln, aber auch als stabile Gr<strong>und</strong>gestimmtheiten Nähe zu<br />
Persönlichkeitseigenschaften aufweisen können. In der Forschung werden beide Dimensionen<br />
als Facetten desselben Konstrukts „subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den“ behandelt (Diener, 2000). Allerd<strong>in</strong>gs<br />
wird angenommen, dass kognitive <strong>und</strong> emotionale Komponenten des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
auf unterschiedlichen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Verarbeitungsmechanismen basieren. Zufriedenheitsurteile<br />
spiegeln den Vergleich der wahrgenommenen Lebenssituation mit Lebenszielen<br />
oder anderen Maßstäben wider. Affektive Reaktionen s<strong>in</strong>d dagegen transiente Reaktionen auf<br />
wechselnde Lebensereignisse, die – möglicherweise um e<strong>in</strong>e <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Basel<strong>in</strong>e emotionaler<br />
Gr<strong>und</strong>bef<strong>in</strong>dlichkeit – über die Zeit h<strong>in</strong>weg fluktuieren. Obwohl die zugr<strong>und</strong>eliegenden Mechanismen<br />
unterschiedlich s<strong>in</strong>d, bee<strong>in</strong>flussen sich Zufriedenheitsurteile <strong>und</strong> Gefühlszustände gegenseitig.<br />
So zeigt sich <strong>in</strong> empirischen Untersuchungen, dass kognitive <strong>und</strong> emotionale Bestandteile<br />
des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den mite<strong>in</strong>ander korrelieren. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die Korrelationen<br />
<strong>in</strong> der Regel nur von mittlerer Größe (Westerhof, 2001), so dass es auch aus empirischer<br />
Sicht s<strong>in</strong>nvoll ist, diese Aspekte bei der Beschreibung der Lebensqualität zu trennen.<br />
Zusätzlich zu der Unterscheidung zwischen kognitiven <strong>und</strong> affektiven Komponenten subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens haben sich weitere Differenzierungen als nützlich <strong>und</strong> s<strong>in</strong>nvoll erwiesen.<br />
Kognitive Zufriedenheitsurteile können sich – wie oben bereits erwähnt – entweder als allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit auf die gesamte Lebenssituation oder als bereichsspezifische Bewertungen<br />
auf e<strong>in</strong>zelne Lebensbereiche wie Arbeit, Familie oder Ges<strong>und</strong>heit beziehen (Campbell et<br />
al., 1976; Smith et al., 1996). H<strong>in</strong>sichtlich emotionaler Bef<strong>in</strong>dlichkeit wird zwischen positiven<br />
<strong>und</strong> negativen Affekten unterschieden (Bradburn, 1969). Während <strong>in</strong> unmittelbarer Anschauung<br />
das gleichzeitige Erleben positiver <strong>und</strong> negativer Emotionen nur schwer oder zum<strong>in</strong>dest nur <strong>in</strong><br />
besonderen Situationen vorstellbar ist, zeigt sich doch e<strong>in</strong>e Unabhängigkeit beider Konstrukte,<br />
wenn man die Auftretenswahrsche<strong>in</strong>lichkeit positiver <strong>und</strong> negativer Emotionen über e<strong>in</strong>en bestimmten<br />
Zeitraum <strong>in</strong> den Blick nimmt. Fragt man nach der Affekthäufigkeit <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es<br />
Zeitraums (z.B. <strong>in</strong> der letzten Woche, im letzten Monat, im letzten Jahr), so f<strong>in</strong>den sich empirisch<br />
nur ger<strong>in</strong>ge Korrelationen zwischen positivem <strong>und</strong> negativem Affekt (Watson, Clark &<br />
Tellegen, 1988). Daher werden <strong>in</strong> der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung<br />
positive <strong>und</strong> negative Affekte als unabhängige Dimensionen des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
berücksichtigt.<br />
Im vorliegenden Kontext wird das übergeordnete Konstrukt des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
bzw. der Lebensqualität anhand kognitiver <strong>und</strong> emotionaler Dimensionen def<strong>in</strong>iert. Dabei werden<br />
im Bereich der kognitiven Lebensbewertung der übergeordnete Aspekt der „allgeme<strong>in</strong>en<br />
397
398<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Lebenszufriedenheit“ <strong>und</strong> – hierarchisch untergeordnete – bereichsspezifische Zufriedenheitsurteile<br />
unterschieden. Innerhalb emotionalen Wohlbef<strong>in</strong>dens werden die vone<strong>in</strong>ander unabhängigen<br />
Komponenten des positiven <strong>und</strong> des negativen Affekts berücksichtigt.<br />
9.2.2 Objektive Lebenssituation <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
E<strong>in</strong>e zentrale Frage der Forschung zu Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität betrifft den Zusammenhang<br />
zwischen objektiver Lebenssituation <strong>und</strong> subjektiver Lebensbewertung. Dabei lassen<br />
sich drei prototypische Ansätze unterscheiden. (a) „Bottom-up“-Ansätze basieren zunächst auf<br />
der Annahme, dass subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den aus der Summe angenehmer <strong>und</strong> unangenehmer<br />
Ereignisse <strong>und</strong> Erlebnisse resultiert, die e<strong>in</strong>e Person erfährt. Für den vorliegenden Kontext ist<br />
besonders die Annahme zentral, dass die objektive Lebenssituation e<strong>in</strong>er Person, etwa h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Verfügbarkeit von Ressourcen, die Qualität von Ereignissen <strong>und</strong> Erlebnissen<br />
bestimmt. Da günstige Lebenslagen die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit für angenehme Ereignisse erhöhen,<br />
sollte auch das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den von Personen <strong>in</strong> günstigen Lebenslagen positiver<br />
se<strong>in</strong> als von Personen <strong>in</strong> ungünstigen Lebenslagen. (b) „Top-down“-Ansätze gehen davon aus,<br />
dass Personen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Prädispositionen für das Erleben von Glück oder Zufriedenheit aufweisen.<br />
Unabhängig von den Erlebnissen <strong>und</strong> Ereignissen s<strong>in</strong>d Personen mit e<strong>in</strong>er positiven<br />
Gr<strong>und</strong>stimmung glücklicher oder zufriedener als Personen mit e<strong>in</strong>er negativen Gr<strong>und</strong>stimmung.<br />
(c) Der dritte Ansatz versucht, vermittelnde Bed<strong>in</strong>gungen, wie etwa kognitive Wahrnehmungs-<br />
<strong>und</strong> Beurteilungsprozesse bei der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Bewertung der objektiven Lebenssituation zu<br />
berücksichtigen.<br />
„Bottom-up“-Ansätze des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
E<strong>in</strong> re<strong>in</strong>er „Bottom-up“-Ansatz des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens wird <strong>in</strong> der Forschung kaum<br />
vertreten. Anspruch der Sozialberichterstattung ist jedoch zum<strong>in</strong>dest, das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
von Menschen auf ihre objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen zu beziehen (Habich & Noll, 2002).<br />
Ansätze der Sozialberichterstattung gehen davon aus, dass subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den wesentlich<br />
von der Qualität des ökologischen, sozialen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Kontextes abhängt. Dabei<br />
zeigen sich <strong>in</strong> entsprechenden Untersuchungen Zusammenhänge von materieller Lage, Erwerbsstatus<br />
<strong>und</strong> Haushaltsgröße mit Lebenszufriedenheit, Glücksempf<strong>in</strong>den, geäußerten Besorgnissen<br />
<strong>und</strong> Anomie-Symptomen (Bulmahn, 2002). Auch auf gesellschaftlicher Ebene lässt sich e<strong>in</strong><br />
Zusammenhang zwischen objektiver Lebenslage <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den nachweisen. In<br />
gesellschaftsvergleichenden Studien wird regelmäßig berichtet, dass die Wohlfahrt e<strong>in</strong>es Landes<br />
<strong>und</strong> das (mittlere) subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den se<strong>in</strong>er Bewohner mite<strong>in</strong>ander korreliert s<strong>in</strong>d (Diener,<br />
1996; Fahey & Smyth, 2004; Veenhooven, 2002).<br />
Folgt man dem „Bottom-up“-Ansatz des Wohlbef<strong>in</strong>dens, so sollten jene Aspekte der objektiven<br />
Lebenssituation, die zu e<strong>in</strong>er erhöhten Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit positiver (oder negativer) Erlebnisse<br />
oder Erfahrungen führen, mit Zufriedenheit <strong>und</strong> Affekt korreliert se<strong>in</strong>. Hierzu gehören beispielsweise<br />
die Bereiche Ges<strong>und</strong>heit (E<strong>in</strong>schränkungen s<strong>in</strong>d mit negativen Erlebnissen verb<strong>und</strong>en)<br />
sowie materielle Lage (Verfügen über f<strong>in</strong>anzielle Ressourcen ist eher mit positiven Erlebnissen<br />
verb<strong>und</strong>en). In der Tat korrelieren e<strong>in</strong>ige Merkmale der objektiven Lebenssituation mit
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
dem subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den (Mannell & Dupuis, 1996; Okun, 2001). Hierzu zählen Ges<strong>und</strong>heitsstatus<br />
(<strong>und</strong> zwar <strong>in</strong>sbesondere funktionelle Ges<strong>und</strong>heit), materielle Lage, Erwerbsstatus<br />
<strong>und</strong> soziale Integration. Soziodemografische Merkmale wie Alter, Bildungsstand <strong>und</strong> ethnische<br />
Zugehörigkeit korrelieren nur ger<strong>in</strong>g mit Lebenszufriedenheit. Während die Lebenszufriedenheit<br />
mit dem Alter nicht s<strong>in</strong>kt, sche<strong>in</strong>t positiver Affekt jedoch mit dem Alter im Durchschnitt<br />
abzunehmen (Diener & Suh, 1998; Noll & Schöb, 2002). Frauen <strong>und</strong> Männer unterscheiden<br />
sich <strong>in</strong> der Regel zuungunsten der Frauen (ger<strong>in</strong>gerer positiver Affekt, höherer negativer Affekt).<br />
E<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> für diese Geschlechtsunterschiede könnte <strong>in</strong> ungleich verteilten Ressourcen<br />
<strong>und</strong> Opportunitätsstrukturen bestehen (Tesch-Römer, Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, Kondratowitz & Tomasik,<br />
2003).<br />
Trotz der Vielfalt von Zusammenhängen zwischen objektiver Lebenssituation <strong>und</strong> subjektivem<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den muss man jedoch feststellen, dass Korrelationen zwischen objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>in</strong> der Regel nur mäßig s<strong>in</strong>d 1 . Beispielsweise korrelieren<br />
materielle Lage <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit nicht sehr stark, <strong>und</strong> auch der Zusammenhang<br />
zwischen E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> der bereichsspezifischen Bewertung des Lebensstandards<br />
ist nur von mittleren Höhe (Westerhof, 2001). Entsprechend s<strong>in</strong>d die mittleren Unterschiede<br />
<strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit zwischen Personen am oberen <strong>und</strong> unteren Ende der E<strong>in</strong>kommensverteilung<br />
häufig nur ger<strong>in</strong>g (Bulmahn, 2002). Zudem kontrastiert der im Lebenslauf<br />
häufig beobachtete Anstieg des E<strong>in</strong>kommens mit e<strong>in</strong>em gleichbleibenden Niveau subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens im Lebenslauf: Die Zunahme des <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n E<strong>in</strong>kommens führt nicht unbed<strong>in</strong>gt<br />
zu e<strong>in</strong>er Erhöhung von Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> Glück (Easterl<strong>in</strong> & Schaeffer, 1999).<br />
E<strong>in</strong>e Lösung der Divergenz zwischen objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
besteht dar<strong>in</strong>, subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den als Epiphänomen zu behandeln <strong>und</strong> weitgehend<br />
zu ignorieren. Diese Lösung bildet die Basis des schwedischen „levels-of-liv<strong>in</strong>g“-Ansatzes der<br />
Sozialberichterstattung (Erikson, 1974; Noll, 2000; Vogel, 1999, 2002), <strong>in</strong> der die Wohlfahrt<br />
e<strong>in</strong>er Gesellschaft ausschließlich anhand objektiver Indikatoren beschrieben wird. E<strong>in</strong>e zweite<br />
Lösungsmöglichkeit besteht dar<strong>in</strong>, vermittelnde kognitive Prozesse der Wahrnehmung <strong>und</strong> Urteilsbildung<br />
zu analysieren. Die Berücksichtigung kognitiver Prozesse f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> empirischen<br />
Analysen nur selten E<strong>in</strong>gang, ihre Bedeutung wird jedoch oftmals bei der Interpretation von<br />
entsprechenden (divergierenden) Bef<strong>und</strong>en betont.<br />
„Top-down“-Ansätze des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
Die Bedeutung von <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Merkmalen als Bed<strong>in</strong>gung des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
wird <strong>in</strong> der Persönlichkeitspsychologie betont. Diese spricht <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Eigenschaften<br />
(„Traits“) e<strong>in</strong>e zentrale Bedeutung für subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den zu (Diener, 2000). Dieser<br />
„Top-down“-Ansatz geht davon aus, dass Individuen prädisponiert s<strong>in</strong>d, auf Ereignisse oder<br />
Situationen <strong>in</strong> positiver oder negativer Weise zu reagieren – <strong>und</strong> zwar unabhängig von den<br />
Merkmalen der jeweiligen Situation. In den Worten von Proponenten dieses Ansatzes: „Despite<br />
1 Hier deutet sich schon an, dass subjektiv positive Erlebnisse nicht alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Funktion der Situation s<strong>in</strong>d, sondern<br />
auch von <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Merkmalen der Person abhängen, also etwa von <strong>in</strong>dividuell unterschiedlichen Zielen, Werten,<br />
Erwartungen oder Vergleichsstandards. Diese Überlegungen werden weiter unten, im Abschnitt „Subjektives<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den als Integration von Situation <strong>und</strong> Person“ ausgeführt.<br />
399
400<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
circumstances, some <strong>in</strong>dividuals seem to be happy people, some unhappy people“ (Costa,<br />
McCrae & Norris, 1981, p. 79). Die jeweiligen Merkmale e<strong>in</strong>er Situation s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>nerhalb dieser<br />
Position für das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den unbedeutend. Vielmehr werden Persönlichkeitseigenschaften<br />
wie beispielsweise Neurotizismus (Erregbarkeit/Ängstlichkeit) oder Extraversion<br />
(Aufgeschlossenheit) für das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den von Personen verantwortlich gemacht.<br />
Diese Eigenschaften werden als stabile Merkmale der Person konzeptualisiert, die – zum<strong>in</strong>dest<br />
im Erwachsenenalter – kaum durch äußere Ereignisse bee<strong>in</strong>flusst oder verändert werden. E<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Bef<strong>und</strong>en spricht für die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften als Bed<strong>in</strong>gungsfaktoren<br />
subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens: Die Bewertung verschiedener Lebensbereiche durch<br />
dieselbe Person ist <strong>in</strong> der Regel sehr ähnlich (bereichsübergreifend hoch oder niedrig), die zeitliche<br />
Stabilität subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens über die Zeit hoch <strong>und</strong> die Korrelationen von subjektivem<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den mit Persönlichkeitseigenschaften oft größer als mit Merkmalen der Situation<br />
(Diener, 1996).<br />
Allerd<strong>in</strong>gs gibt es auch e<strong>in</strong>e Reihe von Phänomenen <strong>und</strong> Fragen, die im Rahmen e<strong>in</strong>es re<strong>in</strong>en<br />
„Top-down“-Ansatzes kaum zu erklären s<strong>in</strong>d. So steht die empirisch beobachtbare <strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Variation des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens über die Zeit im Widerspruch zur angenommenen<br />
Stabilität von Eigenschaften (Tesch-Römer, 1998). Insbesondere die Tatsache, dass kritische<br />
Lebensereignisse das Wohlbef<strong>in</strong>den von betroffenen Personen erheblich <strong>und</strong> langfristig<br />
verändern können, ist mit „Top-down“-Ansätzen <strong>in</strong>kompatibel. Schließlich ersetzt die Identifikation<br />
von Korrelationen zwischen Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Persönlichkeitseigenschaften nicht die<br />
Erklärung von Prozessen, die für Veränderung <strong>und</strong> Stabilität subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens verantwortlich<br />
s<strong>in</strong>d. Möglicherweise s<strong>in</strong>d affektive Reaktionen <strong>in</strong> stärkerem Maß von Persönlichkeitseigenschaften<br />
bee<strong>in</strong>flusst als kognitive Zufriedenheitsurteile. Emotionen s<strong>in</strong>d direkte Reaktionen<br />
auf Umweltreize. Insbesondere die Intensität emotionaler Reaktionen sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e starke<br />
biologische F<strong>und</strong>ierung (<strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>e Nähe zu Persönlichkeitseigenschaften) zu haben. Dies<br />
trifft für kognitive Wahrnehmungs-, Bewertungs- <strong>und</strong> Urteilsprozesse im Zuge von Zufriedenheitsaussagen<br />
<strong>in</strong> weniger starkem Maße zu. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d auch hier personale Faktoren zu<br />
beachten, wie etwa Ziele <strong>und</strong> Bewertungsstandards, die diese kognitiven Prozesse bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den als Integration von Situation <strong>und</strong> Person<br />
Die „Top-down“-Position des Wohlbef<strong>in</strong>dens stellt e<strong>in</strong>e bedeutsame Herausforderung für jene<br />
Bereiche der Sozialberichterstattung dar, die subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den ohne weitere Umstände<br />
als Indikator für die gesellschaftliche Wohlfahrtsproduktion <strong>in</strong>terpretieren. Im folgenden werden<br />
zwei Integrationsansätze vorgestellt, <strong>in</strong> denen die Bed<strong>in</strong>gungen subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>in</strong><br />
Merkmalen der Situation <strong>und</strong> <strong>in</strong> Merkmalen der Person gesehen werden (Brief, Butcher, George<br />
& L<strong>in</strong>k, 1993). Hierbei handelt es sich um die Berücksichtigung von Bewertungs- bzw. von<br />
Bewältigungsprozessen.<br />
Bewertungsprozesse: In der klassischen Studie zur „Quality of American Life“ (Campbell et al.,<br />
1976) wurde davon ausgegangen, dass Zufriedenheitsurteile vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> von Wahrnehmungs-<br />
<strong>und</strong> Beurteilungsprozessen entstehen. Zentral hierbei ist die Annahme, dass wahrgenommene<br />
Situationsmerkmale anhand persönlicher Vergleichsstandards bewertet werden. Die<br />
Bewertung von Situationsmerkmalen fließt <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Zufriedenheitsurteil zu e<strong>in</strong>em bestimmten
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Lebensbereich e<strong>in</strong>. Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit speist sich aus den jeweiligen bereichsspezifischen<br />
Zufriedenheitsurteilen. Das <strong>in</strong> der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie verwendete Kaskaden-Modell<br />
zur Vorhersage des allgeme<strong>in</strong>en subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens basiert auf diesem Modell (Smith<br />
et al., 1996, 1999): Soziodemografische Merkmale bee<strong>in</strong>flussen die objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen,<br />
diese bee<strong>in</strong>flussen subjektive Bereichsbewertungen <strong>und</strong> erst diese bereichsspezifischen<br />
Bewertungen bed<strong>in</strong>gen das Niveau des allgeme<strong>in</strong>en subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens. Beide Modelle<br />
lassen sich als Mediator-Modelle des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens charakterisieren: Zwischen<br />
dem <strong>in</strong>teressierenden Konstrukt (allgeme<strong>in</strong>es Wohlbef<strong>in</strong>den oder Lebenszufriedenheit) vermitteln<br />
e<strong>in</strong>e Reihe von <strong>in</strong>tervenierenden <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Wahrnehmungs- <strong>und</strong> Vergleichsprozessen<br />
(Mediatoren). Hierbei wird angenommen, dass Bewertungen vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> von – <strong>in</strong>dividuell<br />
unterschiedlichen – Werten, Normen <strong>und</strong> Zielen verglichen werden. Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
entsteht also nicht aufgr<strong>und</strong> von „guten“ Bed<strong>in</strong>gungen der Lebenslage, sondern aufgr<strong>und</strong><br />
von Urteilen, die e<strong>in</strong>e konkrete Lebenslage als „gut“ <strong>in</strong> Bezug auf e<strong>in</strong>en bestimmten Vergleichsmaßstab<br />
charakterisiert. E<strong>in</strong>e ähnliche Konzeption f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> der f<strong>in</strong>nischen Sozialberichterstattung<br />
(Allardt, 1993). H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> dieses Ansatzes ist die Überzeugung, dass Menschen<br />
bestimmte universelle Gr<strong>und</strong>bedürfnisse haben (die Charakterisierung dieser Motivsysteme<br />
durch die Begriffe „hav<strong>in</strong>g-lov<strong>in</strong>g-be<strong>in</strong>g“ er<strong>in</strong>nert etwa an die Motivpyramide Maslows<br />
(1954). Die mehr oder weniger vollständige Befriedigung dieser Gr<strong>und</strong>bedürfnisse ist der H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
für subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den (<strong>und</strong> für die Bewertung gesellschaftlicher Wohlfahrt).<br />
Bewältigungsprozesse: Ausgangspunkt der gerontologischen Bewältigungsforschung ist die<br />
Beobachtung, dass Menschen im Verlauf des Älterwerdens e<strong>in</strong>e Reihe von irreversiblen Verlusten<br />
erleiden. Nimmt man an, dass Verlustereignisse das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den bee<strong>in</strong>trächtigen,<br />
müsste man dementsprechend folgern, dass das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den mit zunehmendem<br />
Alter abnimmt. Die empirische Literatur hat aber wiederholt gezeigt, dass dies nicht der<br />
Fall ist. Die Korrelationen zwischen Alter <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>er Lebenszufriedenheit s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel<br />
so ger<strong>in</strong>g (Mannell & Dupuis, 1996; Smith & Baltes, 1996, p. 234), dass – gerade mit Blick<br />
auf alte <strong>und</strong> sehr alte Menschen – vom „Zufriedenheitsparadox“ gesprochen wird (Staud<strong>in</strong>ger,<br />
2000). Die hohe Adaptationsfähigkeit oder Resilienz älter werdender Menschen ist wiederholt<br />
e<strong>in</strong>drücklich beschrieben worden (Staud<strong>in</strong>ger, Fre<strong>und</strong>, L<strong>in</strong>den & Maas, 1996). Auf Diskrepanzen<br />
zwischen Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Lebensbewertung wurde auch im Rahmen der Sozialberichterstattung<br />
mit den Stichworten „Adaptation“ (Anpassung an ungünstige Lebensbed<strong>in</strong>gungen)<br />
<strong>und</strong> „Dissonanz“ (Unzufriedenheit mit günstigen Lebensbed<strong>in</strong>gungen) h<strong>in</strong>gewiesen (Zapf,<br />
1984).<br />
Mit der Erklärung der Konstanz von Lebenszufriedenheit bis <strong>in</strong> das hohe Alter haben sich e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von entwicklungs- <strong>und</strong> bewältigungspsychologischen Ansätzen befasst. Beispielsweise<br />
s<strong>in</strong>d jene Bewältigungsprozesse beschrieben worden, die auf Zielstrukturen <strong>und</strong> Vergleichsstandards<br />
<strong>in</strong> der Ause<strong>in</strong>andersetzung mit kritischen Lebensereignissen E<strong>in</strong>fluss nehmen<br />
(Brandtstädter & Rotherm<strong>und</strong>, 2002; Schulz, Wrosch & Heckhausen, 2003). Die Gr<strong>und</strong>idee<br />
dieser Ansätze besteht dar<strong>in</strong>, dass Personen im Verlauf ihres Lebens Diskrepanzen zwischen<br />
angestrebten <strong>Entwicklung</strong>szielen <strong>und</strong> aktuellem <strong>Entwicklung</strong>sstand erleben. Im hohen Alter ist<br />
es nicht selten der Fall, dass auf Gr<strong>und</strong> von <strong>Entwicklung</strong>sverlusten e<strong>in</strong> wertgeschätzter <strong>Entwicklung</strong>szustand<br />
bedroht ist. Die Höhe von Soll-Ist-Diskrepanzen bee<strong>in</strong>flusst das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
e<strong>in</strong>er Person: Je höher der Unterschied zwischen tatsächlichem <strong>und</strong> angestrebten Ent-<br />
401
402<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
wicklungsstand, desto ger<strong>in</strong>ger das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den. Im Fall e<strong>in</strong>es Unterschieds zwischen<br />
angestrebtem „Soll“ <strong>und</strong> erlebtem „Ist“-Zustand s<strong>in</strong>d zwei gr<strong>und</strong>sätzliche Lösungen für<br />
e<strong>in</strong>e Reduktion dieser Diskrepanz möglich: Zum e<strong>in</strong>en kann die Person versuchen, ihre Lebenssituation<br />
<strong>in</strong> Richtung des angestrebten Ziels zu verändern, zum andern können Zielstrukturen<br />
<strong>und</strong> Bewertungsmaßstäbe verändert werden. In beiden Fällen würde es aufgr<strong>und</strong> der Diskrepanzreduktion<br />
zwischen „Soll“- <strong>und</strong> „Ist“-Zustand zu e<strong>in</strong>er Erhöhung (bzw. e<strong>in</strong>er Wiederherstellung)<br />
von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den kommen (<strong>und</strong> natürlich ist es auch denkbar, dass beide<br />
Bewältigungsprozesse komb<strong>in</strong>iert werden). In empirischen Untersuchungen konnte gezeigt<br />
werden, dass im Alter jene Prozesse an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen, die auf Veränderung <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r<br />
Zielstrukturen <strong>und</strong> Bewertungsmaßstäbe gerichtet s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> den Zusammenhang zwischen Belastung<br />
<strong>und</strong> Zufriedenheit moderieren. Hierfür f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> der Literatur Begriffe wie „sek<strong>und</strong>äre<br />
Kontrolle“, „akkommodative Prozesse“ oder „flexible Zielanpassung“ (Brandtstädter, Rotherm<strong>und</strong><br />
& Schmitz, 1998; Schulz, Wrosch, & Heckhausen, 2003).<br />
Zwischenresümee<br />
Die Überlegungen zu „Bottom-up“-, „Top-Down“ - <strong>und</strong> <strong>in</strong>tegrierenden Ansätzen haben deutlich<br />
gemacht, dass die Analyse der Bed<strong>in</strong>gungen subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens e<strong>in</strong>e Reihe von Bed<strong>in</strong>gungsfaktoren<br />
zu berücksichtigen hat. Offensichtlich gibt es ke<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>fachen Zusammenhang<br />
zwischen Merkmalen der objektiven Lebenslage <strong>und</strong> dem subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den von Menschen.<br />
Es ist deshalb notwendig, bei der Analyse subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens Prozesse der Bewertung<br />
<strong>und</strong> Bewältigung zu berücksichtigen. Im folgenden sollen nun bislang nur implizit<br />
berücksichtigte dynamische Prozesse von <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong> des Wohlbef<strong>in</strong>dens expliziert<br />
werden.<br />
9.2.3 <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong> des Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
In der Sozialberichterstattung <strong>und</strong> der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung<br />
geht es um unterschiedliche Prozesse des <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> der <strong>Entwicklung</strong> (s. dazu auch<br />
Kapitel 1). In der Sozialberichterstattung geht es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um die Veränderungen auf gesellschaftlicher<br />
Ebene („gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong>“). In der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen<br />
Alternsforschung geht es dagegen auch um Veränderungsprozesse von Personen („<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong>sdynamik“). Im folgenden sollen Prozesse des gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s<br />
sowie <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sdynamiken erörtert <strong>und</strong> mit Fragen des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
verknüpft werden.<br />
Gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong><br />
Steht die Bewertung der gesellschaftlichen <strong>Entwicklung</strong> im Mittelpunkt des Interesses (wie dies<br />
bei der Sozialberichterstattung oder Sozialstaatsbeobachtung der Fall ist; Flora & Noll, 1999),<br />
so kommt es darauf an, das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den der Bevölkerung oder von Bevölkerungsgruppen<br />
im Verlauf der historischen Zeit zu beschreiben. Methodisch können Fragen dieser Art<br />
durch wiederholte Querschnittsuntersuchungen bearbeitet werden. Im Prozess der deutschen
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
E<strong>in</strong>igung hat sich beispielweise gezeigt, dass noch im Jahr 2000 erkennbare Unterschiede <strong>in</strong> der<br />
Lebenszufriedenheit zwischen West- <strong>und</strong> Ostdeutschen bestanden (Delhey, 2002). In e<strong>in</strong>em<br />
analytisch komplexeren Ansatz kann man danach fragen, ob die durchschnittliche E<strong>in</strong>kommensentwicklung<br />
mit der Veränderung des Wohlbef<strong>in</strong>dens korrespondiert. E<strong>in</strong> Beispiel hierfür<br />
ist der Bef<strong>und</strong>, dass <strong>in</strong> den vergangenen Jahrzehnten die durchschnittliche subjektive Zufriedenheit<br />
sukzessiv nachwachsender Kohorten (<strong>in</strong> den USA) gleich geblieben ist oder sogar abgenommen<br />
hat, obwohl das <strong>in</strong>dividuell verfügbare E<strong>in</strong>kommen, auch unter Berücksichtigung der<br />
Kaufkraft, zugenommen hat (Easterl<strong>in</strong> & Schaeffer, 1999). Dieser Bef<strong>und</strong> kann nur mit e<strong>in</strong>em<br />
(gesellschaftlichen) <strong>Wandel</strong> von Bewertungsmaßstäben <strong>in</strong>terpretiert werden. Individuelle Maßstäbe<br />
als Basis von Zufriedenheitsurteilen s<strong>in</strong>d offensichtlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Wertesystem e<strong>in</strong>gebettet,<br />
das sich im Verlauf der historischen Zeit verändert. Hier zeigt sich auch, dass gesellschaftlicher<br />
<strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Veränderungsprozesse mite<strong>in</strong>ander verknüpft s<strong>in</strong>d.<br />
Individuelle <strong>Entwicklung</strong>sdynamik<br />
E<strong>in</strong> deutlich davon zu unterscheidendes Erkenntnis<strong>in</strong>teresse betrifft die <strong>Entwicklung</strong> von Personen<br />
im Lebenslauf. Gr<strong>und</strong>sätzlich stehen dabei die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Prozesse des Älterwerdens <strong>und</strong><br />
ihre Konsequenzen für differentielles Altern im Mittelpunkt. Um Fragen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong><br />
angemessen untersuchen zu können, ist es notwendig, dieselben Personen im Verlauf der<br />
Zeit mehrfach zu befragen („Panel“ oder „Längsschnitt“). Längsschnittdaten erlauben „die Identifizierung<br />
<strong>in</strong>ter<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Unterschiede <strong>in</strong> <strong>in</strong>tra<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Veränderungen, bieten E<strong>in</strong>blicke<br />
<strong>in</strong> Determ<strong>in</strong>anten von Veränderungen <strong>und</strong> ermöglichen Analysen systemischer Zusammenhänge<br />
von Verhaltensänderungen“ (Smith & Delius, 2003, p. 229). H<strong>in</strong>sichtlich des hier zentralen<br />
Themas geht es um die Fragen, wie sich <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>s Wohlbef<strong>in</strong>den mit fortschreitendem<br />
Alter verändert <strong>und</strong> welche Aspekte der Lebenssituation für Veränderung <strong>und</strong> Stabilität des<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens verantwortlich s<strong>in</strong>d.<br />
Untersuchungsfragen<br />
Im folgenden werden drei Untersuchungsfragen spezifiziert, <strong>in</strong> denen die Überlegungen zum<br />
Zusammenhang zwischen objektiver Lebenssituation <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den mit den<br />
Ebenen des gesellschaftlichen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong>sdynamik verknüpft werden.<br />
Trends des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens: In e<strong>in</strong>em ersten Schritt sollen – im S<strong>in</strong>ne der Sozialberichterstattung<br />
– die Verläufe des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens zwischen den beiden Messzeitpunkten<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 beschrieben werden. Diese deskriptiven Analysen sollen aufzeigen, ob<br />
sich das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den der Bevölkerung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong>nerhalb der<br />
sechs Jahre, die zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 verstrichen s<strong>in</strong>d, im Mittel verändert hat. Dabei werden<br />
die Ergebnisse differenziert nach Altersgruppen, Geschlecht, Region <strong>und</strong> Schicht ausgewertet.<br />
Von besonderem Interesse hierbei ist die Frage, ob sich im Zuge der deutschen E<strong>in</strong>heit die<br />
regionalen Unterschiede zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland verr<strong>in</strong>gert haben. Datenbasis dieser<br />
Auswertungen s<strong>in</strong>d Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe (s.u. <strong>und</strong> Kapitel 2).<br />
403
404<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Objektive Lebenslage <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den im Querschnitt: In e<strong>in</strong>em zweiten Schritt<br />
soll systematischer untersucht werden, <strong>in</strong> welcher Weise Merkmale der objektiven Lebenslage<br />
mit subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den korrelieren. Dabei wird dem oben diskutierten Mediator-Modell<br />
des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens gefolgt. Somit werden nicht alle<strong>in</strong> Merkmale der objektiven<br />
Lebenssituation, sondern auch bereichsspezifische Bewertungen berücksichtigt. In den Analysen<br />
der ersten Welle hatte sich gezeigt, dass weniger die Merkmale der objektiven Lebenssituation<br />
als vielmehr bereichsspezifische Bewertungen e<strong>in</strong>e Vorhersage der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit<br />
erlauben (Westerhof, 2001). Mit den Daten der zweiten Welle des Alterssurveys<br />
kann nun überprüft werden, ob die Zusammenhänge zwischen objektiver Lebenssituation, bereichspezifischen<br />
Bewertungen <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den über die Zeit h<strong>in</strong>weg (1996 <strong>und</strong><br />
2002) stabil s<strong>in</strong>d. Dazu werden entsprechende Analysen für Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
durchgeführt.<br />
Veränderung der Lebenssituation <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den: In e<strong>in</strong>em dritten Schritt stehen<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sprozesse im Mittelpunkt der Analysen. Hier ergibt sich die Möglichkeit,<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der objektiven Lebenssituation mit Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
Bewertungen sowie Veränderungen <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Lebenszufriedenheit <strong>in</strong> Beziehung zu<br />
setzen. Entsprechend dem Mediator-Modell des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens sollten Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der objektiven Lebenssituation stärker mit Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
Bewertungen als mit Veränderungen <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Lebenszufriedenheit korrelieren. Berücksichtigt<br />
werden hierbei Veränderungen im Erwerbsstatus, <strong>in</strong> der f<strong>in</strong>anziellen Situation, im sozialen<br />
Netzwerk sowie im Ges<strong>und</strong>heitszustand. Dementsprechend stützen sich die Analysen auf<br />
die Panelstichprobe des Alterssurveys.<br />
9.3 Datenbasis<br />
Für die Analyse des <strong>Wandel</strong>s im subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den werden Basisstichprobe (1996, n=<br />
4.838) <strong>und</strong> Replikationsstichprobe (2002, n= 3.084) mite<strong>in</strong>ander verglichen. Da nicht alle Personen,<br />
mit denen e<strong>in</strong> Interview geführt wurde, auch e<strong>in</strong>en „Drop-off“-Fragebogen ausgefüllt<br />
haben, umfassen die Datensätze für jene Variablen, die ausschließlich im Fragebogen erhoben<br />
wurden, nur 4.034 Fälle (Basisstichprobe) bzw. 2.778 Fälle (Replikationsstichprobe). Beide<br />
Stichproben weisen zur Erhebung e<strong>in</strong>en Altersrange von 40 bis 85 Jahren auf; allerd<strong>in</strong>gs beruht<br />
die Basisstichprobe auf den Geburtskohorten 1911-1956, die Replikationsstichprobe auf den<br />
Geburtskohorten 1917 bis 1962.<br />
Für alle längsschnittlichen Analysen wird der Paneldatensatz verwendet. Dieser Datensatz umfasst<br />
n= 1.524 Fälle, die zu beiden Messzeitpunkten <strong>in</strong> den Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002 an der Erhebung<br />
teilgenommen haben. Für jene Variablen, die ausschließlich im Fragebogen erhoben wurden,<br />
umfasst dieser Datensatz 1.438 Fälle. Der Altersrange der Panelstichprobe umfasst im Jahr<br />
1996 die Altersgruppen 40 bis 85 Jahre <strong>und</strong> im Jahr 2002 die Altersgruppen 46 bis 91 Jahre<br />
(Geburtskohorten 1911-1956). Zu beachten ist, dass die Panelstichprobe zum ersten Messzeitpunkt<br />
e<strong>in</strong>e Untermenge der Basisstichprobe ist.<br />
Für deskriptive Analysen wurden gewichtete Daten verwendet, die im Fall von Basis- <strong>und</strong><br />
Replikationsstichprobe die Schichtungsvariablen berücksichtigen. Für multivariate Analysen
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
wurden ungewichtete Daten verwendet. Weitere Informationen zur Datenbasis <strong>und</strong> Gewichtung<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Kapitel 2 zu f<strong>in</strong>den.<br />
Als abhängige Variablen wurden kognitive <strong>und</strong> affektive Komponenten des Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
erhoben. Die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit wird mit e<strong>in</strong>er fünf Items umfassenden-Skala<br />
erhoben (Pavot & Diener, 1993). Zusätzlich werden bereichsspezifische E<strong>in</strong>schätzungen der<br />
Lebenszufriedenheit herangezogen (für die Lebensbereiche Beruf bzw. Ruhestand, Lebensstandard,<br />
Partnerschaft, Verhältnis zu Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Bekannten <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit). Die Häufigkeit<br />
des positiven <strong>und</strong> negativen Affekts wird mit der PANAS-Skala erhoben (Watson, Clark &<br />
Tellegen, 1988). Tabelle 9.1 gibt e<strong>in</strong>en Überblick (Range, arithmetischer Mittelwert, Standardabweichung<br />
<strong>und</strong> Stichprobengröße) über die den Analysen zugr<strong>und</strong>e liegenden abhängigen Variablen.<br />
Die Skalen „Lebenszufriedenheit“ (LZ), „Positiver Affekt“ (PA) <strong>und</strong> „Negativer Affekt“<br />
(NA) korrelieren <strong>in</strong> mittlerer Höhe mite<strong>in</strong>ander (im Jahr 1996: rLZ-PA=33., rLZ-NA=–.29, rPA-<br />
NA=–.14; im Jahr 2002: rLZ-PA=.49, rLZ-NA= –.38, rPA-NA=–.23). Diese Korrelationen zeigen, dass<br />
es s<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> notwendig ist, drei Facetten des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens vone<strong>in</strong>ander zu<br />
unterscheiden: Lebenszufriedenheit, positiver Affekt <strong>und</strong> negativer Affekt. Allerd<strong>in</strong>gs erkennt<br />
man auch, dass diese Facetten mite<strong>in</strong>ander zusammenhängen (<strong>und</strong> sich möglicherweise gegenseitig<br />
bee<strong>in</strong>flussen).<br />
Als soziodemografische Basis<strong>in</strong>formationen werden Angaben zu Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Region<br />
herangezogen. Als Lebenslage<strong>in</strong>dikator wird die Schichtzugehörigkeit (5-stufig) berücksichtigt.<br />
Als weitere Aspekte der Lebenssituation werden die Bereiche Erwerbsstatus, E<strong>in</strong>kommen, Partnerschaft,<br />
Netzwerkgröße <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit berücksichtigt. Für Analysen der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>Entwicklung</strong>sdynamik<br />
wurden Veränderungen <strong>in</strong> diesen Lebensbereichen zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
berücksichtigt (vgl. Abschnitt 9.5).<br />
Tabelle 9.1:<br />
Übersicht über Indikatoren des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens2 Lebenszufriedenheit<br />
1996<br />
2002<br />
Positiver Affekt<br />
1996<br />
2002<br />
Negativer Affekt<br />
1996<br />
2002<br />
Range x SD N<br />
1-5<br />
1-5<br />
1-5<br />
1-5<br />
1-5<br />
1-5<br />
3,72<br />
3,82<br />
3,33<br />
3,48<br />
2,12<br />
2,01<br />
0,83<br />
0,80<br />
0,63<br />
0,59<br />
0,53<br />
0,57<br />
Datengr<strong>und</strong>lage: Basisstichprobe (1996) <strong>und</strong> Replikationsstichprobe (2002) des Alterssurveys<br />
4.004<br />
2.775<br />
3.867<br />
2.777<br />
3.865<br />
2.778<br />
2 Das Instrument ist unter www.dza.de/download/Alterssurvey_Instrumente.pdf erhältlich.<br />
405
406<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
9.4 Gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong> des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
Vor der Darstellung von Trends im subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den soll zunächst die Situation im<br />
Jahr 2002, <strong>und</strong> zwar differenziert nach Altersgruppen, Geschlecht, Region <strong>und</strong> Schicht, beschrieben<br />
werden. Im Anschluss daran werden die Verläufe des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
zwischen den beiden Messzeitpunkten 1996 <strong>und</strong> 2002 analysiert. Berücksichtigung f<strong>in</strong>den dabei<br />
Ergebnisse, die sich auf die Aussage „Ich b<strong>in</strong> mit me<strong>in</strong>em Leben zufrieden“ sowie auf die Skalen<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit, positiver Affekt <strong>und</strong> negativer Affekt beziehen. Mit den<br />
Bef<strong>und</strong>en dieser deskriptiven Analysen lässt sich überprüfen, ob, wie stark <strong>und</strong> <strong>in</strong> welche Richtung<br />
sich das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den von 40-85-Jährigen Menschen zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
verändert hat. In diesen Analysen wird danach gefragt, ob sich allgeme<strong>in</strong>e Trends bei Angehörigen<br />
verschiedener Altersgruppen, für Frauen <strong>und</strong> Männer, Ost- <strong>und</strong> Westdeutsche sowie Angehörigen<br />
verschiedener sozialer Schichten <strong>in</strong> ähnlicher Weise vollzogen haben. Besondere<br />
Aufmerksamkeit wird dabei regionalen Unterschieden gewidmet: Zu fragen ist, ob sich die Unterschiede<br />
zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschen im subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den, die noch im Jahr<br />
1996 deutlich zu erkennen waren (Westerhof, 2001), im zeitlichen Verlauf verm<strong>in</strong>dert haben.<br />
Datenbasis dieser Auswertungen s<strong>in</strong>d die Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe des Altersurveys.<br />
9.4.1 Aussage „Ich b<strong>in</strong> zufrieden mit me<strong>in</strong>em Leben“<br />
Die Befragungsteilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -teilnehmer des Alterssurveys wurden gebeten, anzugeben,<br />
ob die Aussage „Ich b<strong>in</strong> zufrieden mit me<strong>in</strong>em Leben“ genau, eher, weder/noch, eher nicht oder<br />
gar nicht auf sie zutreffe. Diese Aussage bildete mit vier weiteren Items die Skala „Allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit“.<br />
Tabelle 9.2:<br />
Prozentsatz von Personen, die angeben, dass die Aussage „Ich b<strong>in</strong> zufrieden mit me<strong>in</strong>em<br />
Leben“ eher oder genau auf sie zutrifft. Vergleich von Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
1996 2002 p<br />
Insgesamt 83,0 84,8 *<br />
Alter Jüngste Gruppe (40-54 Jahre) 81,7 83,5 n.s.<br />
Mittlere Gruppe (55-69 Jahre) 82,5 87,5 *<br />
Älteste Gruppe (70-85 Jahre) 87,4 83,1 *<br />
Geschlecht Männer 81,8 83,8 n.s.<br />
Frauen 84,2 85,7 n.s.<br />
Region Alte Länder 85,2 86,1 n.s.<br />
Neue Länder 73,9 79,9 *<br />
Schicht Unterschicht 75,7 78,9 n.s.<br />
Untere Mittelschicht 81,6 78,6 n.s.<br />
Mittlere Mittelschicht 84,0 89,1 *<br />
Gehobene Mittelschicht 84,5 88,4 *<br />
Obere Mittelschicht 91,5 90,1 n.s.<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 3.998, gewichtet), Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.767, gewichtet),<br />
*p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Tabelle 9.2 zeigt die Anteile der Personen, auf die diese Aussage eher oder genau zutrifft (für<br />
diese Tabelle s<strong>in</strong>d die beiden Antwortkategorien zusammengefasst). In Abbildung 9.1 s<strong>in</strong>d die<br />
Bef<strong>und</strong>e graphisch dargestellt, getrennt für die Antwortkategorien „trifft eher zu“ <strong>und</strong> „trifft<br />
genau zu“ (vgl. auch Tabelle A9.1 im Anhang). Insgesamt ist die Zustimmung zu der Aussage,<br />
mit dem eigenen Leben zufrieden zu se<strong>in</strong>, sehr hoch.<br />
Abbildung 9.1:<br />
Prozentsatz von Personen, die angeben, dass die Aussage „Ich b<strong>in</strong> zufrieden mit me<strong>in</strong>em<br />
Leben“ eher bzw. genau auf sie zutrifft. Vergleich von Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
1996 "Ich b<strong>in</strong> zufrieden mit me<strong>in</strong>em Leben." 2002<br />
100<br />
75<br />
48,8<br />
34,2 48,2 36,6<br />
Insgesamt<br />
30,1<br />
38,2<br />
34,7<br />
43,8<br />
32,0<br />
36,3<br />
36,8<br />
23,4<br />
30,0<br />
30,6<br />
34,7<br />
36,8<br />
50<br />
51,6<br />
47,8<br />
43,6<br />
49,8<br />
47,9<br />
48,4<br />
50,5<br />
45,7<br />
51,0<br />
49,3<br />
47,7<br />
53,3<br />
25<br />
0<br />
Alter<br />
jüngste<br />
Altersgruppe<br />
mittlere<br />
Altersgruppe<br />
älteste<br />
Altersgruppe<br />
Geschlecht<br />
Männer<br />
Frauen<br />
Region<br />
Alte<br />
B<strong>und</strong>esländer<br />
Neue<br />
B<strong>und</strong>esländer<br />
Schicht<br />
Unterschicht<br />
untere<br />
Mittelschicht<br />
mittlere<br />
Mittelschicht<br />
gehobene<br />
Mittelschicht<br />
obere<br />
Mittelschicht<br />
52,0 31,5<br />
45,7 41,8<br />
45,1 38,0<br />
49,8 34,0<br />
46,8 38,9<br />
47,5 38,6<br />
51,3 28,6<br />
48,1 30,8<br />
47,9 30,7<br />
50,3 38,8<br />
46,3 42,1<br />
49,9 40,2<br />
0 25 50 75 100<br />
trifft genau zu trifft eher zu<br />
trifft eher zu trifft genau zu<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (N=3.998, gewichtet), Replikationsstichprobe 2002 (N=2.767, gewichtet)<br />
407
408<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Lebenszufriedenheit im Jahr 2002: Im Jahr 2002 äußern etwa 84,8 Prozent aller befragten Personen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte, mit ihrem Leben eher oder sehr zufrieden zu se<strong>in</strong>. Mehr als<br />
e<strong>in</strong> Drittel stimmte der betreffenden Aussage sogar sehr zu (s. Abbildung 9.1). Anhand der Abbildung<br />
wird zudem deutlich, dass Menschen im Alter zwischen 55 <strong>und</strong> 69 Jahren im Jahr 2002<br />
mit 87,5 Prozent häufiger als Angehörige der jüngsten <strong>und</strong> Angehörige der ältesten Gruppe<br />
äußern, mit dem Leben zufrieden zu se<strong>in</strong> (p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Ebenfalls sehr deutliche Effekte bei der Verteilung der Zufriedenheitsurteile s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Schichtzugehörigkeit zu erkennen: Dort betragen die Unterschiede zwischen Unterschicht<br />
<strong>und</strong> oberer Mittelschicht h<strong>in</strong>sichtlich der Zufriedenheitsurteile bis zu 15 Prozent. Während im<br />
Jahr 1996 75,7 Prozent der Unterschichtangehörigen zufrieden mit ihrem Leben s<strong>in</strong>d, gilt dies<br />
für 91,5 Prozent aller Personen der oberen Mittelschicht. E<strong>in</strong> Vergleich der Jahre 1996 <strong>und</strong><br />
2002 macht deutlich, dass <strong>in</strong> der mittleren <strong>und</strong> gehobenen Mittelschicht statistische bedeutsame<br />
Zuwachsraten zu erkennen s<strong>in</strong>d (mittlere Mittelschicht um 5,1 Prozent von 84,0 auf 89,1 Prozent;<br />
gehobene Mittelschicht um 3,9 Prozent von 84,5 auf 88,4 Prozent), jedoch die Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der Unterschicht <strong>und</strong> unteren Mittelschicht e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> der oberen Mittelschicht<br />
andererseits statistisch nicht bedeutsam s<strong>in</strong>d.<br />
9.4.2 Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
Die Skala „Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit“ besteht aus fünf Items, von denen e<strong>in</strong>es die eben<br />
diskutierte Zufriedenheitsaussage ist. In Tabelle 9.3 s<strong>in</strong>d die durchschnittlichen Werte dieser<br />
Skala für die Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002 getrennt nach Altersgruppen, Geschlecht, Region sowie<br />
Schichtzugehörigkeit aufgeführt (<strong>in</strong> Tabelle A9.2 s<strong>in</strong>d detaillierte Angaben zu Mittelwerten <strong>und</strong><br />
Verteilungen der Skala zu f<strong>in</strong>den). In Bezug auf die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit zeigt sich<br />
e<strong>in</strong>e leichte, aber statistisch bedeutsame Zunahme zwischen den Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002: Während<br />
die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit der 40-85-Jährigen Menschen im Jahr 1996 bei 3,72<br />
Punkten liegt, beträgt dieser Wert im Jahr 2002 3,82 Punkte (s. Tabelle 9.3). Damit liegt die<br />
allgeme<strong>in</strong>e Zufriedenheit auf e<strong>in</strong>em recht hohen Niveau (die betreffende Skala reicht von 1 bis<br />
5). Allerd<strong>in</strong>gs zeigt sich nicht für alle Untergruppen von Personen e<strong>in</strong>e Zunahme der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Lebenszufriedenheit. Im Jahr 1996 äußern die ältesten Befragten (70-85 Jahre) die höchste<br />
Zufriedenheit, im Jahr 2002 ist dies die mittlere Altersgruppe (55-69 Jahre). Während die älteste<br />
<strong>und</strong> die jüngste Gruppe stabile Werte aufweisen, zeigt sich <strong>in</strong> der mittleren Altersgruppe e<strong>in</strong>e<br />
statistisch bedeutsame Zunahme an Zufriedenheit.<br />
Frauen äußern zu beiden Zeitpunkten <strong>in</strong> stärkerem Maß Zufriedenheit als Männer. Für beide<br />
Geschlechter zeigen sich ähnliche positive Zuwächse <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Lebenszufriedenheit. Während<br />
Menschen <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern im Jahr 1996 e<strong>in</strong>e deutlich ger<strong>in</strong>gere Zufriedenheit<br />
äußern als Menschen <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern, hat sich dieser Unterschied im Jahr 2002 verr<strong>in</strong>gert.<br />
Sehr deutliche Unterschiede <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit f<strong>in</strong>den sich h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Schichtzugehörigkeit. E<strong>in</strong>en Zuwachs an geäußerter Lebenszufriedenheit zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 lässt sich zudem nur für die mittlere bis gehobene Mittelschicht f<strong>in</strong>den. Die Lebenszufriedenheit<br />
von Menschen, die der Unterschicht, der unteren Mittelschicht <strong>und</strong> der oberen<br />
Mittelschicht angehören, erhöht sich dagegen zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nicht wesentlich.<br />
409
410<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Tabelle 9.3:<br />
Mittlere Werte der Skala „Lebenszufriedenheit“ für die Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002.<br />
Vergleich von Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
1996 2002<br />
x SD x SD p<br />
Insgesamt 3,72 0,83 3,82 0,80 **<br />
Altersgruppen<br />
Jüngste Gruppe (40-54 Jahre) 3,70 0,80 3,74 0,81 n.s.<br />
Mittlere Gruppe (55-69 Jahre) 3,72 0,85 3,93 0,75 **<br />
Älteste Gruppe (70-85 Jahre) 3,79 0,83 3,79 0,85 n.s.<br />
Geschlecht<br />
Männer 3,69 0,82 3,78 0,81 **<br />
Frauen 3,76 0,83 3,85 0,80 **<br />
Region<br />
Alte B<strong>und</strong>esländer 3,78 0,81 3,85 0,81 **<br />
Neue B<strong>und</strong>esländer 3,49 0,84 3,69 0,78 **<br />
Schicht<br />
Unterschicht 3,53 0,90 3,56 0,89 n.s.<br />
Untere Mittelschicht 3,68 0,84 3,67 0,86 n.s.<br />
Mittlere Mittelschicht 3,74 0,81 3,93 0,73 **<br />
Gehobene Mittelschicht 3,80 0,79 3,93 0,73 **<br />
Obere Mittelschicht 3,92 0,68 3,99 0,72 n.s.<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 4.004, gewichtet), Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.775, gewichtet),<br />
*p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
onen zu erleben. Dieser Unterschied war im Jahr 2002 allerd<strong>in</strong>gs nahezu verschw<strong>und</strong>en: Der<br />
Zuwachs der Häufigkeit angenehmer Emotionen war <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern höher als <strong>in</strong><br />
den alten B<strong>und</strong>esländern (statistisch bedeutsame Interaktion). Deutliche Unterschiede im Erleben<br />
angenehmer Emotionen f<strong>in</strong>den sich h<strong>in</strong>sichtlich der sozialen Schicht: Hier s<strong>in</strong>d große Unterschiede<br />
zwischen Angehörigen der Unterschicht <strong>und</strong> der unteren Mittelschicht sowie Angehörigen<br />
der gehobenen <strong>und</strong> oberen Mittelschicht festzustellen. Die Unterschiede zwischen den<br />
Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002 s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit unterschiedlich: Die<br />
Zunahme der Häufigkeit positiver Emotionen zwischen beiden Jahren ist für Angehörige der<br />
obersten Schichten am größten.<br />
Tabelle 9.4:<br />
Mittlere Werte der Skala „Positiver Affekt“ für die Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002.<br />
Vergleich von Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
1996 2002<br />
x SD x SD p<br />
Insgesamt 3,33 0,63 3,48 0,59 **<br />
Altersgruppen<br />
Jüngste Gruppe (40-54 Jahre) 3,43 0,58 3,56 0,57 **<br />
Mittlere Gruppe (55-69 Jahre) 3,32 0,61 3,51 0,55 **<br />
Älteste Gruppe (70-85 Jahre) 3,06 0,70 3,26 0,66 **<br />
Geschlecht<br />
Männer 3,33 0,61 3,49 0,58 **<br />
Frauen 3,32 0,65 3,46 0,60 **<br />
Region<br />
Alte B<strong>und</strong>esländer 3,34 0,63 3,48 0,59 **<br />
Neue B<strong>und</strong>esländer 3,24 0,61 3,44 0,61 **<br />
Schicht<br />
Unterschicht 3,06 0,65 3,22 0,63 **<br />
Untere Mittelschicht 3,29 0,65 3,31 0,60 n.s.<br />
Mittlere Mittelschicht 3,39 0,57 3,56 0,54 **<br />
Gehobene Mittelschicht 3,46 0,57 3,64 0,52 **<br />
Obere Mittelschicht 3,50 0,58 3,80 0,50 **<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 4.004, gewichtet), Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.775, gewichtet),<br />
*p
Tabelle 9.5:<br />
Mittlere Werte der Skala „Negativer Affekt“ für die Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002.<br />
Vergleich von Basis- <strong>und</strong> Replikationsstichprobe<br />
412<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
1996 2002<br />
x SD x SD p<br />
Insgesamt 2,12 0,53 2,01 0,57 **<br />
Altersgruppen<br />
Jüngste Gruppe (40-54 Jahre) 2,18 0,53 2,11 0,59 **<br />
Mittlere Gruppe (55-69 Jahre) 2,10 0,52 1,95 0,54 **<br />
Älteste Gruppe (70-85 Jahre) 2,01 0,54 1,91 0,54 **<br />
Geschlecht<br />
Männer 2,06 0,53 1,97 0,57 **<br />
Frauen 2,18 0,53 2,04 0,57 **<br />
Region<br />
Alte B<strong>und</strong>esländer 2,12 0,53 2,01 0,57 **<br />
Neue B<strong>und</strong>esländer 2,12 0,52 1,99 0,58 **<br />
Schicht<br />
Unterschicht 2,17 0,60 2,07 0,63 *<br />
Untere Mittelschicht 2,12 0,54 1,99 0,59 **<br />
Mittlere Mittelschicht 2,13 0,50 2,04 0,56 **<br />
Gehobene Mittelschicht 2,10 0,50 1,97 0,56 **<br />
Obere Mittelschicht 2,09 0,53 1,98 0,50 *<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 4.004, gewichtet), Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.775, gewichtet),<br />
*p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
können anhand der hier vorgelegten deskriptiven Bef<strong>und</strong>e nicht identifiziert werden. Diesen Werten<br />
kann durchaus e<strong>in</strong> langfristiger Trend zugr<strong>und</strong>e liegen. Es kann aber nicht ausgeschlossen<br />
werden, dass es sich hierbei um kurzfristige Testzeiteffekte (Periodeneffekte) oder Methodenartefakte<br />
(etwa aufgr<strong>und</strong> von Veränderungen des Erhebungs<strong>in</strong>struments) handelt.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist es bedeutsam, dass sich nicht für alle Subgruppen ähnliche Effekte zeigten. Hierbei<br />
s<strong>in</strong>d zwei Bef<strong>und</strong>e von besonderer Bedeutung. (a) Die Zufriedenheit von Menschen, die <strong>in</strong> den<br />
neuen B<strong>und</strong>esländern leben, nahm zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 besonders deutlich zu. Es bestehen<br />
zwar auch im Jahr 2002 Unterschiede <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit, aber diese s<strong>in</strong>d im Vergleich<br />
zum Jahr 1996 erheblich kle<strong>in</strong>er geworden. (b) Angehörige der unteren sozialen Schichten zeigen<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nur ger<strong>in</strong>ge Zugew<strong>in</strong>ne <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit. Diese Zugew<strong>in</strong>ne<br />
waren für Angehörige der mittleren <strong>und</strong> gehobenen sozialen Schicht deutlich größer. Die erheblichen<br />
Unterschiede <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit zwischen sozialen Schichten blieben über den Zeitraum<br />
von sechs Jahren stabil.<br />
In den Analysen zeigt sich auch, dass die berücksichtigten Komponenten des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
(Zufriedenheit <strong>und</strong> Affekt) unterschiedliche Ergebnismuster aufweisen. Frauen geben<br />
zwar höhere Zufriedenheit an als Männer, äußern aber zugleich <strong>in</strong> höherem Maß das Erleben negativer<br />
Gefühle. Diese geschlechtsspezifischen Bef<strong>und</strong>muster s<strong>in</strong>d möglicherweise auf unterschiedliche<br />
Verarbeitungsprozesse oder auf unterschiedliches Antwortverhalten von Männern <strong>und</strong><br />
Frauen zurückzuführen: Frauen <strong>und</strong> Männer könnten sich mit Blick auf das Erleben negativer<br />
Emotionen unterscheiden; es könnte aber auch se<strong>in</strong>, dass Frauen eher bereit s<strong>in</strong>d als Männer, über<br />
das Erleben negativer Emotionen zu sprechen.<br />
Schließlich ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen Vergleichsgruppen<br />
<strong>in</strong> den meisten Fällen ger<strong>in</strong>g ausfallen (maximal e<strong>in</strong> halber Punkt auf e<strong>in</strong>er fünf-stufigen<br />
Skala). Beispielsweise geben Angehörige der oberen Mittelschicht im Jahr 2002 im Mittel e<strong>in</strong>en<br />
Wert von 4 auf der Skala „Lebenszufriedenheit“ an (dies entspricht etwa dem Urteil „trifft eher<br />
zu“), während Angehörige der Unterschicht e<strong>in</strong>en Wert von 3,5 angeben (dieser Skalenpunkt liegt<br />
zwischen den Urteilen „weder/noch“ <strong>und</strong> „trifft eher zu“). Hieran ist zu erkennen, dass neben den<br />
Merkmalen der objektiven Lebenslage wahrsche<strong>in</strong>lich weitere Faktoren das <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Zufriedenheitsurteil<br />
bee<strong>in</strong>flussen. Entsprechende Analysen werden im nächsten Abschnitt vorgenommen.<br />
9.5 Objektive Lebenslage <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
In den bislang vorgelegten Analysen wurde der E<strong>in</strong>fluss der objektiven Lebenssituation auf das<br />
subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den eher allgeme<strong>in</strong> analysiert (durch den Vergleich verschiedener Bevölkerungsgruppen).<br />
Im folgenden werden nun Analysen vorgelegt, <strong>in</strong> denen es um den E<strong>in</strong>fluss<br />
bestimmter Merkmale der Lebenslage auf das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den geht. Dabei wird der<br />
Zusammenhang zwischen Lebenslagemerkmalen, bereichsspezifischen Bewertungen <strong>und</strong> globalen<br />
Indikatoren subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens zunächst im Querschnitt analysiert. Im dann folgenden<br />
Abschnitt (9.6) werden Veränderungen der Lebenssituation mit Veränderungen des Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
<strong>in</strong> Beziehung gesetzt.<br />
413
9.5.1 Mediator-Modell des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
414<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
In der Literatur zum subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den wird davon ausgegangen, dass Zufriedenheitsurteilen<br />
Wahrnehmungs- <strong>und</strong> Beurteilungsprozesse zugr<strong>und</strong>e liegen (Campbell et al., 1976; Smith<br />
et al., 1996; 1999; s. auch Abschnitt 9.2.2). In Abbildung 9.2 ist e<strong>in</strong> entsprechendes Modell<br />
graphisch dargestellt. Lebenslagen s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong>e Reihe spezifischer Dimensionen oder Merkmale<br />
gekennzeichnet. Diese Dimensionen umfassen beispielsweise die materielle Lage (etwa<br />
Schicht <strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommen), die soziale Integration (etwa Partnerschaft, Elternschaft, E<strong>in</strong>bettung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netz), die gesellschaftliche Partizipation (etwa durch Teilnahme am Erwerbsleben<br />
oder im bürgerschaftlichen Engagement) sowie Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Abbildung 9.2:<br />
Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den als Resultat kognitiver Bewertungsprozesse<br />
(Mediator-Modell des SWB = Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den)<br />
Merkmal der<br />
Lebenssituation<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
M 4<br />
M 5<br />
Bereichsspezifische<br />
Bewertung<br />
B 1<br />
B 2<br />
B 3<br />
B 4<br />
B 5<br />
Subjektives<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
SWB<br />
Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den wird im Rahmen dieses Modells jedoch nicht direkt von den objektiven<br />
Bed<strong>in</strong>gungen der Lebenslage bee<strong>in</strong>flusst, sondern aufgr<strong>und</strong> von lebensbereichsspezifischen<br />
Bewertungen. Personen beurteilen dabei unterschiedliche Aspekte ihrer Lebenslage mit Blick<br />
auf <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Vergleichsmaßstäbe. Erst diese bereichsspezifischen Bewertungen bee<strong>in</strong>flussen<br />
das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den. Dieses Modell lässt sich auch als Mediator-Modell des subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens bezeichnen.<br />
In den Analysen der ersten Welle hatten sich Belege für das <strong>in</strong> Abbildung 9.2 dargestellte Modell<br />
gezeigt (Westerhof, 2001). Weniger die Merkmale der objektiven Lebenssituation als vielmehr<br />
die bereichsspezifischen Bewertungen erlaubten e<strong>in</strong>e Vorhersage der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit<br />
(Westerhof, 2001). Mit den Daten der zweiten Welle des Alterssurveys kann nun<br />
überprüft werden, ob die Zusammenhänge zwischen objektiver Lebenssituation, bereichspezifischen<br />
Bewertungen <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den über die Zeit h<strong>in</strong>weg (1996 <strong>und</strong> 2002) stabil<br />
s<strong>in</strong>d.
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Mit Blick auf die Komponenten des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens (Lebenszufriedenheit sowie<br />
positiver <strong>und</strong> negativer Affekt) kann man annehmen, dass dieses Modell vor allem für die kognitive<br />
Komponente des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens, die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit zutrifft.<br />
Gerade hier geht es um die Bündelung bereichsspezifischer Zufriedenheitsurteile zu e<strong>in</strong>em Gesamturteil<br />
über die eigene Lebenssituation. Das affektive System von (positiven <strong>und</strong> negativen)<br />
Emotionen sche<strong>in</strong>t dem kognitiven System der Beurteilung von Situation dagegen vorgeordnet<br />
zu se<strong>in</strong>. Positive <strong>und</strong> Negative Affekte entstehen <strong>in</strong> direkter Reaktion auf Ereignisse <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> bee<strong>in</strong>flussen ihrerseits Bewertungs- <strong>und</strong> Beurteilungsprozesse (Schwarz & Strack,<br />
1991). Emotionale Zustände wie „Glück“ oder „Niedergeschlagenheit“ werden daher weniger<br />
von kognitiven Bewertungsprozessen als vielmehr von täglichen Ereignissen („daily hassles“<br />
<strong>und</strong> „uplifts“) bee<strong>in</strong>flusst. Dies bedeutet für statistische Analysen, dass die Varianz der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Lebenszufriedenheit durch e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation von Indikatoren der Lebenslage <strong>und</strong> bereichsspezifischer<br />
Bewertungen besser erklärt werden kann als dies für die affektiven Indikatoren<br />
(positiver <strong>und</strong> negativer Affekt) zutrifft.<br />
Im Folgenden werden die drei Aspekte des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens (Lebenszufriedenheit,<br />
positiver Affekt, negativer Affekt) durch Merkmale der Lebenslage sowie durch bereichsspezifische<br />
Bewertungen vorhergesagt. Dabei wird neben den soziodemografischen Schichtungsmerkmalen<br />
(Alter, Geschlecht, Region) zusätzlich das Qualifikationsniveau mit vier Stufen<br />
berücksichtigt (ohne Berufsausbildung; niedriger Schulabschluss <strong>und</strong> nicht-akademische Berufsausbildung;<br />
mittlerer oder höherer Schulabschluss <strong>und</strong> nicht akademische Berufsausbildung;<br />
abgeschlossenes Studium). Als Merkmale der Lebenssituation werden drei Bereiche herangezogen:<br />
Materielle Lage, soziale Integration <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Indikatoren der materiellen Lage s<strong>in</strong>d<br />
nachfolgend Schicht (fünfstufig: Unterschicht, untere Mittelschicht, mittlere Mittelschicht, gehobene<br />
Mittelschicht, obere Mittelschicht) <strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommen (personenbezogenes Äquivalenze<strong>in</strong>kommen,<br />
berechnet nach den Vorgaben der OECD). Merkmale der sozialen Integration werden<br />
über das Vorhandense<strong>in</strong> von Partnerschaft, Elternschaft sowie Zahl der Netzwerkpartner<br />
berücksichtigt. Als Indikator für die körperlichen Ges<strong>und</strong>heit wird die Zahl genannter Krankheiten<br />
herangezogen. Schließlich werden als bereichsspezifische Zufriedenheitsurteile die Bewertungen<br />
des Lebensstandards, der Familienbeziehungen, der Beziehung zum Partner (bzw. der<br />
Situation ohne Partner), der Beziehungen zu Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Bekannten sowie der Ges<strong>und</strong>heit<br />
berücksichtigt.<br />
9.5.2 Bef<strong>und</strong>e<br />
In Tabelle 9.6 s<strong>in</strong>d die Ergebnisse von multiplen Regressionsanalysen für den Indikator „allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit“ zusammengestellt (jeweils für die Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002). Im Modell<br />
1 werden zunächst soziodemografischen Charakteristika sowie Indikatoren der Lebenslage<br />
als Prädiktoren für allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit verwendet. Im Modell 2 werden zusätzlich<br />
bereichsspezifische Bewertungen <strong>in</strong> die Regressionsgleichung e<strong>in</strong>geführt.<br />
Im Jahr 2002 werden durch soziodemografische Charakteristika <strong>und</strong> Merkmale der Lebenssituation<br />
etwa 17 Prozent der Varianz <strong>in</strong> der abhängigen Variable „allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit“<br />
aufgeklärt (Modell 1). Die stärksten Prädiktoren s<strong>in</strong>d dabei Ges<strong>und</strong>heitszustand (β=-.24, je mehr<br />
415
416<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Krankheiten e<strong>in</strong>e Person nennt, desto ger<strong>in</strong>ger ist ihre Lebenszufriedenheit), Alter (β=.23, mit<br />
dem Alter nimmt die Lebenszufriedenheit zu), Partnerschaft (β=.21, Personen mit Partner äußern<br />
e<strong>in</strong>e höhere Lebenszufriedenheit als Personen ohne Partner) <strong>und</strong> Äquivalenze<strong>in</strong>kommen<br />
(β=.15, je höher das E<strong>in</strong>kommen, desto höher die Lebenszufriedenheit). Fügt man <strong>in</strong> das Regressionsmodell<br />
bereichsspezifische Bewertungen e<strong>in</strong> (Modell 2), so werden im Jahr 2002 zusätzlich<br />
18 Prozent an Varianz <strong>in</strong> der abhängigen Variable aufgeklärt (die gesamte Varianzaufklärung<br />
beträgt R 2 =.35). Die stärksten Prädiktoren s<strong>in</strong>d nun vor allem bereichsspezifische Bewertungen,<br />
<strong>und</strong> zwar die Bewertung des Lebensstandards (β=.27), die Bewertung des Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
(β=.19) sowie die Bewertung der Partnerschaft (β=.15). Hierbei gilt für alle bereichsspezifischen<br />
Bewertungen: Je besser die Bewertung des jeweiligen Lebensbereichs, desto<br />
höher ist die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit.<br />
Tabelle 9.6:<br />
Ergebnisse der Regression der Skala „Lebenszufriedenheit“ auf objektive Merkmale der<br />
Lebenssituation sowie subjektive bereichsspezifische Bewertungen<br />
1996 2002<br />
Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2<br />
Beta p Beta p Beta p Beta p<br />
Alter .22 ** .16 ** .23 ** .18 **<br />
Geschlecht (0=Männer, 1= Frauen) .08 ** .04 ** .09 ** .05 **<br />
Landesteil (0=Ost, 1=West) .11 ** .08 ** .04 ** .02 n.s.<br />
Qualifikationsniveau (4 Stufen) -.04 n.s. -.07 ** -.05 * -.06 *<br />
Schicht (5 Stufen) .09 ** .03 n.s. .09 ** .04 n.s.<br />
Äquivalenze<strong>in</strong>kommen .13 ** .03 ** .15 ** .04 n.s.<br />
K<strong>in</strong>der (0=ke<strong>in</strong>e, 1= m<strong>in</strong>d. e<strong>in</strong>s) .04 * .04 ** .03 * .04 *<br />
Partner (0=ke<strong>in</strong> Partner,1=Partner) .17 ** .04 ** .21 ** .10 **<br />
Netzwerkgröße .03 n.s. .00 n.s. .08 n.s. .02 n.s.<br />
Zahl Krankheiten -.19 ** -.06 ** -.24 ** -.12 **<br />
Bewertung Lebensstandard .31 ** .27 **<br />
Bewertung Familie .09 ** .07 **<br />
Bewertung Partnerschaft .16 ** .15 **<br />
Bewertung Fre<strong>und</strong>e/Bekannte .05 ** .08 **<br />
Bewertung Ges<strong>und</strong>heitszustand .19 ** .19 **<br />
R 2 (korrigiert) .12 ** .30 ** .17 ** .35 **<br />
Zuwachs an R 2 (korrigiert) .12 ** .18 ** .17 ** .18 **<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 2.972), Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.094). * p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Die Bef<strong>und</strong>e für die Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002 weisen hohe Ähnlichkeit auf. Zu beiden Messzeitpunkten<br />
wird e<strong>in</strong> erheblicher Anteil der Varianz h<strong>in</strong>sichtlich der Lebenszufriedenheit durch<br />
soziodemografische Charakteristika <strong>und</strong> Merkmale der objektiven Lebenssituation aufgeklärt<br />
(Modell 1 1996: 12 Prozent, 2002: 17 Prozent). Die bereichsspezifischen Bewertungen, die <strong>in</strong><br />
Modell 2 Verwendung f<strong>in</strong>den, klären zu beiden Messzeitpunkten zusätzliche große Anteile an<br />
Varianz auf (1996 <strong>und</strong> 2002 jeweils 18 Prozent zusätzliche Varianzaufklärung). Auch das Muster<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Koeffizienten s<strong>in</strong>d für 1996 <strong>und</strong> 2002 ähnlich. Relevante objektive Prädiktoren<br />
s<strong>in</strong>d Alter, Ges<strong>und</strong>heitszustand, Partnerschaft sowie E<strong>in</strong>kommen. Relevante subjektive Prädiktoren<br />
s<strong>in</strong>d die entsprechenden bereichsspezifischen Bewertungen zu Ges<strong>und</strong>heit, Partnerschaft<br />
<strong>und</strong> Lebensstandard. Auf e<strong>in</strong>e Veränderung zwischen den Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002 soll dennoch<br />
aufmerksam gemacht werden: Der Unterschied <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit zwischen Ost- <strong>und</strong><br />
Westdeutschland ist zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 kle<strong>in</strong>er geworden. Während der entsprechende<br />
Koeffizient im Jahr 1996 noch signifikant war, selbst wenn alle anderen relevanten Prädiktoren<br />
berücksichtigt wurden (Modell 2, β=.08, p
418<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Tabelle 9.7:<br />
Ergebnisse der Regression der Skala „Positiver Affekt“ auf objektive Merkmale der<br />
Lebenssituation sowie subjektive bereichsspezifische Bewertungen<br />
1996 2002<br />
Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2<br />
Beta p Beta p Beta p Beta p<br />
Alter -.13 ** -.14 ** -.08 ** -.09 **<br />
Geschlecht (0=Männer, 1= Frauen) .05 ** .03 n.s. .04 * .02 n.s.<br />
Landesteil (0=Ost, 1=West) .05 ** .04 * .00 n.s. -.02 n.s.<br />
Qualifikationsniveau (4 Stufen) .03 n.s. .01 n.s. .03 n.s. .03 n.s.<br />
Schicht (5 Stufen) .12 ** .09 ** .21 ** .17 **<br />
Äquivalenze<strong>in</strong>kommen .05 ** .02 n.s. .07 ** .01 n.s.<br />
K<strong>in</strong>der (0=ke<strong>in</strong>e, 1= m<strong>in</strong>d. e<strong>in</strong>s) .01 n.s. .01 n.s. .05 * .05 **<br />
Partner (0=ke<strong>in</strong> Partner, 1=Partner) .04 n.s. -.01 n.s. .08 ** .01 n.s.<br />
Netzwerkgröße .08 ** .05 ** .08 ** .03 n.s.<br />
Zahl Krankheiten -.14 ** -.06 ** -.13 ** -.03 n.s.<br />
Bewertung Lebensstandard .10 ** .11 **<br />
Bewertung Familie .01 n.s. .03 n.s.<br />
Bewertung Partnerschaft .06 ** .13 **<br />
Bewertung Fre<strong>und</strong>e/Bekannte .12 ** .10 **<br />
Bewertung Ges<strong>und</strong>heitszustand .14 ** .21 **<br />
R 2 (korrigiert) .12 ** .17 ** .15 ** .25 **<br />
Zuwachs an R 2 (korrigiert) .12 ** .05 ** .15 ** .10 **<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 2.900), Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.096), *p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Tabelle 9.8:<br />
Ergebnisse der Regression der Skala „Negativer Affekt“ auf objektive Merkmale<br />
der Lebenssituation sowie subjektive bereichsspezifische Bewertungen<br />
1996 2002<br />
Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2<br />
Beta p Beta p Beta p Beta p<br />
Alter -.27 ** -.25 ** -.29 ** -.28 **<br />
Geschlecht (0=Männer, 1= Frauen) .12 ** .13 ** .09 ** .10 **<br />
Landesteil (0=Ost, 1=West) .02 n.s. .02 n.s. .04 n.s. .05 *<br />
Qualifikationsniveau (4 Stufen) .04 n.s. .06 * -.01 n.s. -.01 n.s.<br />
Schicht (5 Stufen) -.03 n.s. .00 n.s. .00 n.s. .03 n.s.<br />
Äquivalenze<strong>in</strong>kommen -.03 n.s. .00 n.s. -.03 n.s. .02 n.s.<br />
K<strong>in</strong>der (0=ke<strong>in</strong>e, 1= m<strong>in</strong>d. e<strong>in</strong>s) .00 n.s. .00 n.s. .01 n.s. .00 n.s.<br />
Partner (0=ke<strong>in</strong> Partner, 1=Partner) -.02 n.s. .04 n.s. -.01 n.s. .05 *<br />
Netzwerkgröße .01 n.s. .03 n.s. .02 n.s. .05 *<br />
Zahl Krankheiten .25 ** .19 ** .34 ** .29 **<br />
Bewertung Lebensstandard -.07 ** -.09 **<br />
Bewertung Familie -.02 n.s. .01 n.s.<br />
Bewertung Partnerschaft -.09 ** -.10 **<br />
Bewertung Fre<strong>und</strong>e/Bekannte -.05 * -.06 *<br />
Bewertung Ges<strong>und</strong>heitszustand -.11 * -.08 **<br />
R 2 (korrigiert) .10 ** .13 * .13 * .16 *<br />
Zuwachs an R 2 (korrigiert) .10 ** .03 * .13 * .03 *<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 2.900), Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.097), * p
420<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
zeigt sich deutlich, dass die Komponenten Lebenszufriedenheit (kognitive Beurteilung der eigenen<br />
Lebenssituation) <strong>und</strong> Affekt (Erleben von Gefühlen) unterschiedliche Facetten des subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens s<strong>in</strong>d. Lebenszufriedenheit betrifft die Beurteilung der eigenen Lebenssituation<br />
anhand von Bewertungsmaßstäben. Gefühlszustände spiegeln dagegen die Reaktion auf die<br />
Widerfahrnisse täglicher Ereignisse <strong>und</strong> Schwierigkeiten wider.<br />
Welche Merkmale der Lebenssituation haben nun besondere Bedeutung für das subjektive<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte? Die Antwort lautet: Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Lebensstandard <strong>und</strong> Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Partners s<strong>in</strong>d – <strong>in</strong>nerhalb der objektiven Merkmale<br />
der Lebenssituation – die bedeutsamsten Prädiktoren subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens. Je gesünder<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte s<strong>in</strong>d, desto zufriedener s<strong>in</strong>d sie, desto häufiger äußern sie<br />
positive Gefühle <strong>und</strong> desto seltener negative Gefühle. Höheres E<strong>in</strong>kommen korreliert mit höherer<br />
Lebenszufriedenheit, <strong>und</strong> Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>er höheren Schicht hängt mit positiven Gefühlszuständen<br />
zusammen. Das Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Partners ist mit höherer Lebenszufriedenheit<br />
verknüpft. Dies gilt auch dann, wenn andere Prädiktoren kontrolliert werden.<br />
Die Ergebnisse machen zugleich deutlich, dass <strong>in</strong>sbesondere die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
nicht alle<strong>in</strong> durch objektive Lebenslagemerkmale, sondern vor allem durch bereichsspezifische<br />
subjektive Bewertungen vorhergesagt wird. Weniger die objektive Ges<strong>und</strong>heit, die tatsächliche<br />
Höhe des E<strong>in</strong>kommens oder das Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Partners erklären die allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit, sondern die E<strong>in</strong>schätzung der eigenen Ges<strong>und</strong>heit, die Bewertung des<br />
eigenen Lebensstandards <strong>und</strong> die Zufriedenheit mit der Partnerschaftssituation. Für die Vorhersage<br />
affektiver Komponenten des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens haben bereichsspezifische Bewertungen<br />
dagegen wie erwartet weniger große Bedeutung.<br />
Insgesamt stehen die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e mit dem oben diskutierten Modell des subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang. Merkmale der objektiven Lebenssituation bee<strong>in</strong>flussen bereichsspezifische<br />
Bewertungen, diese wiederum sagen das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den, <strong>und</strong> zwar<br />
<strong>in</strong>sbesondere die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit, vorher. In dem nun folgenden Abschnitt zur<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>Entwicklung</strong>sdynamik werden sich die empirischen Analysen auf die Beziehung<br />
zwischen Veränderungen der Lebenssituation, Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen Bewertungen<br />
<strong>und</strong> Veränderungen der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit konzentrieren.<br />
9.6 Veränderungen von Lebenssituation <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
Die Querschnittsanalyse des Zusammenhang zwischen Lebenslage <strong>und</strong> subjektiver Bef<strong>in</strong>dlichkeit<br />
muss ergänzt werden um e<strong>in</strong>e dynamische Perspektive, <strong>in</strong> der Veränderungen der Lebenssituation<br />
mit Veränderungen im subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Beziehung gesetzt werden. Hier<br />
soll vor allem die Dynamik der Lebenssituation mit entsprechenden <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
Bewertungen <strong>und</strong> der Lebenszufriedenheit analysiert werden. In diesem Abschnitt<br />
stehen demnach <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sprozesse im Mittelpunkt.
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
9.6.1 Mediator-Modell der Veränderung subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
Die Psychologie der Lebensspanne (Lehr, 2003; Lachman, 2001; Staud<strong>in</strong>ger & L<strong>in</strong>denberger,<br />
2003) <strong>und</strong> die Soziologie des Lebenslaufs (Mortimer & Shanahan, 2003; Settersten, 1999; Settersten,<br />
2002) haben <strong>in</strong> den vergangenen 30 Jahren deutlich gemacht, dass sich <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong><br />
Prozesse der Veränderung <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong> nicht alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> K<strong>in</strong>dheit <strong>und</strong> Jugend, sondern auch<br />
im frühen, mittleren <strong>und</strong> hohen Erwachsenenalter vollziehen. Gerade im Erwachsenenalter <strong>und</strong><br />
Alter können <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> <strong>Entwicklung</strong>sprozesse durch Veränderungen <strong>in</strong> der Lebenssituation<br />
angestoßen werden. Zudem s<strong>in</strong>d neben graduellen, allmählichen Veränderungen der Lebenssituation<br />
auch Ereignisse zu berücksichtigen, die die gesamte Lebenssituation e<strong>in</strong>er Person verändern<br />
können (Schroots, 2003; Staud<strong>in</strong>ger & Bluck, 2001). Statuspassagen oder kritische Lebensereignisse<br />
berühren unterschiedliche Bereiche der Lebenslage teilweise tiefgreifend. Beispiele<br />
für gravierende Veränderungen der Lebenssituation f<strong>in</strong>den sich unter anderem <strong>in</strong> den<br />
Bereichen Erwerbsleben (mittleres Erwachsenenalter: Verlust des Arbeitsplatzes, höheres Erwachsenenalter:<br />
Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand), soziale Integration (Verlust des Partners durch<br />
Verwitwung, Zugew<strong>in</strong>n <strong>und</strong> Verlust von Fre<strong>und</strong>en <strong>in</strong>nerhalb des sozialen Netzes), materielle<br />
Lage (Veränderung der E<strong>in</strong>kommenssituation) sowie Ges<strong>und</strong>heit (Verbesserung oder Verschlechterung<br />
des Ges<strong>und</strong>heitszustandes, Erleben e<strong>in</strong>es Unfalls).<br />
Abbildung 9.3:<br />
Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Abhängigkeit von Veränderungen der Lebenssituation<br />
(Mediator-Modell der Veränderung subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens)<br />
Veränderungen, Statuspassagen,<br />
Kritische Lebensereignisse<br />
V 1<br />
V 2<br />
V 3<br />
V 4<br />
V 5<br />
Veränderung der<br />
Lebenssituation<br />
B 1<br />
B 2<br />
B 3<br />
B 4<br />
B 5<br />
Bereichsspezifische<br />
Bewertung<br />
SWB<br />
Subjektives<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
Mit Blick auf das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den ist nun zu fragen, wie sich Veränderungen der Lebenssituation<br />
<strong>in</strong>sbesondere auf die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit auswirken. Hierbei ist –<br />
entsprechend den Analysen im vorangegangenen Abschnitt – zu prüfen, welche Rolle bereichsspezifische<br />
Bewertungen bei Veränderungen des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens spielen. In Abbildung<br />
9.3 ist e<strong>in</strong> Analysemodell zum Zusammenhang zwischen Veränderungen der objektiven<br />
Lebenssituation <strong>und</strong> Veränderungen im subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den graphisch dargestellt. Die-<br />
421
422<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
sem Modell folgend ist empirisch zu prüfen, ob Veränderungen der Lebenssituation das subjektive<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>er Person <strong>in</strong> direkter Weise bee<strong>in</strong>flussen oder ob bereichsspezifische Bewertungen<br />
als Mediatoren wirksam s<strong>in</strong>d. Geht man davon aus, dass die Veränderungen der Lebenssituation<br />
das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den nur <strong>in</strong>direkt bee<strong>in</strong>flussen, so sollten Veränderungen<br />
der Lebenssituation bereichsspezifische Bewertungen sehr viel stärker bee<strong>in</strong>flussen als globale<br />
Indikatoren des Wohlbef<strong>in</strong>dens (<strong>in</strong>sbesondere allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit). Beispielsweise<br />
sollten Veränderungen <strong>in</strong> der materiellen Situation zu e<strong>in</strong>er Zu- oder Abnahme der Zufriedenheit<br />
mit dem Lebensstandard führen <strong>und</strong> Veränderungen im Fre<strong>und</strong>eskreis zu Veränderungen <strong>in</strong><br />
der Bewertung der sozialen Netzwerke. Die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit sollte weniger<br />
durch Veränderung der Lebenssituation als durch Veränderungen bereichsspezifischer Bewertungen<br />
bee<strong>in</strong>flusst werden.<br />
Berücksichtigt werden hierbei Veränderungen im Erwerbsstatus, <strong>in</strong> der f<strong>in</strong>anziellen Situation,<br />
im sozialen Netzwerk sowie im Ges<strong>und</strong>heitszustand. Die folgenden Analysen beschränken sich<br />
dabei auf die „allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit“ sowie bereichsspezifische Bewertungen der<br />
Bereiche Lebensstandard, soziale Beziehungen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Veränderungen der Lebenssituation<br />
werden für die Bereiche Erwerbsbeteiligung (Übergang <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit, Übergang<br />
aus der Arbeitslosigkeit, Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand), materielle Lage (Veränderung im Äquivalenze<strong>in</strong>kommen),<br />
soziales Netz (Verlust des Partners, neue Partnerschaft, Veränderung im<br />
sozialen Netzwerk) sowie Ges<strong>und</strong>heit (Zahl der Krankheiten, Erleben e<strong>in</strong>er schweren Krankheit<br />
oder e<strong>in</strong>es Unfalls) berücksichtigt. Da es sich hierbei um Veränderungen <strong>in</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Lebenslagen<br />
handelt, stützen sich die Analysen auf die Panelstichprobe des Alterssurveys. Zuvor<br />
sollen jedoch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Exkurs die Stabilitäten des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens über die Zeit<br />
(1996 <strong>und</strong> 2002) analysiert werden, um zu verdeutlichen, dass auch die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Veränderungen unterliegt (d.h. ke<strong>in</strong> zeitstabiles Merkmal darstellt).<br />
Das Vorhandense<strong>in</strong> von Veränderungen ist zentraler Ausgangspunkt für die Frage, welche Faktoren<br />
zu Veränderungen der Lebenszufriedenheit beitragen.<br />
9.6.2 Exkurs: Stabilität subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
In diesem Abschnitt wird danach gefragt, wie hoch die Stabilität des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
ist. Graphisch kann die Stabilität des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens als Streudiagramm dargestellt<br />
werden. Abbildung 9.4 zeigt Streudiagramme für die Skalen „Lebenszufriedenheit“, „Positiver<br />
Affekt“ <strong>und</strong> „Negativer Affekt“. Jedem Punkt entspricht e<strong>in</strong>e Person, die <strong>in</strong> den Jahren 1996<br />
<strong>und</strong> 2002 an der Panelbefragung des Alterssurveys teilgenommen hat. Die Werte auf der horizontalen<br />
Achse entstammen dem Jahr 1996, die Werte auf der vertikalen Achse dem Jahr 2002.<br />
Wäre das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den über den Zeitraum von sechs Jahren vollkommen stabil, so<br />
würden die Punkte auf e<strong>in</strong>er L<strong>in</strong>ie liegen (Personen, die im Jahr 1996 hohe Werte hatten, hätten<br />
auch im Jahr 2002 hohe Werte; Personen mit niedrigen Werten im Jahr 2002 hätten auch im<br />
Jahr 2002 niedrige Werte). Wie zu erkennen, ist dies für ke<strong>in</strong>e der drei Skalen der Fall: Die<br />
Werte der Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002 unterscheiden sich für viele Personen so sehr, dass e<strong>in</strong>e „Punktewolke“<br />
entsteht. Dies bedeutet, dass sich das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den von Personen <strong>in</strong>dividuell<br />
erheblich verändern kann: Ke<strong>in</strong>eswegs alle Personen, die im Jahr 1996 hohe Zufriedenheit
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
angaben, tun dies auch im Jahr 2002 – <strong>und</strong> umgekehrt s<strong>in</strong>d nicht alle im Jahr 1996 unzufriedenen<br />
Personen auch im Jahr 2002 unzufrieden.<br />
Abbildung 9.4:<br />
Streudiagramm für die Skala „Lebenszufriedenheit“ für die beiden Messzeitpunkte<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 (Panelstichprobe).<br />
2002<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Lebenszufriedenheit Positiver Affekt Negativer Affekt<br />
r=.40<br />
1<br />
1 2 3<br />
1996<br />
4 5<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
r=.40<br />
1<br />
1<br />
1 2 3<br />
1996<br />
4 5<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe (N=1.243-1.273), gewichtet<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
r=.37<br />
1 2 3 4 5<br />
1996<br />
Über die Stabilität des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens geben Stabilitätskoeffizienten Aufschluss<br />
(Stabilitätskoeffizienten können Werte zwischen 0 <strong>und</strong> 1 annehmen, wobei Werte nahe 0 für<br />
e<strong>in</strong>e sehr ger<strong>in</strong>ge Stabilität <strong>und</strong> Werte nahe 1 für e<strong>in</strong>e hohe Stabilität stehen). Die Stabilitätskoeffizienten<br />
für die drei Skalen des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens s<strong>in</strong>d von nur mittlerer Höhe (Lebenszufriedenheit:<br />
r=.40, Positiver Affekt: r=.40, Negativer Affekt: r=.37). Da die Lebenssituation<br />
von Personen im mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter relativ stabil ist, könnte man<br />
annehmen, dass die Stabilitätskoeffizienten der Zufriedenheitsurteile (die sich auf die Gesamtheit<br />
der Lebenssituation beziehen) höher s<strong>in</strong>d als die Stabilitätskoeffizienten der affektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>densmaße, die – unter der Annahme von „Bottom-up“-E<strong>in</strong>flüssen – <strong>in</strong> stärkerem<br />
Ausmaß von wechselnden Ereignissen des täglichen Lebens bee<strong>in</strong>flusst werden. Dies ist für die<br />
Gesamtstichprobe offensichtlich nicht der Fall: Alle Stabilitätskoeffizienten s<strong>in</strong>d von ähnlicher<br />
Größe.<br />
Tabelle 9.9:<br />
Stabilitäten der Skalen „Lebenszufriedenheit“, „Positiver Affekt“ <strong>und</strong> „Negativer Affekt“<br />
für die gesamte Panelstichprobe sowie für die drei Altersgruppen<br />
40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre Gesamt<br />
Lebenszufriedenheit .37 .43 .42 .40<br />
Positiver Affekt .39 .40 .31 .40<br />
Negativer Affekt .42 .32 .26 .37<br />
N 555-559 496-503 192-211 1.243-1.273<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (n= 1.243-1.273, gewichtet)<br />
423
424<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
H<strong>in</strong>sichtlich des Lebensalters könnte man erwarten, dass die Stabilitäten mit zunehmendem<br />
Alter ger<strong>in</strong>ger werden, da die Zahl unvorhergesehener kritischer Lebensereignisse mit dem Lebensalter<br />
zunimmt. In Tabelle 9.9 s<strong>in</strong>d die Stabilitäten der Skalen „Lebenszufriedenheit“, „Positiver<br />
Affekt“ <strong>und</strong> „Negativer Affekt“ für die gesamte Stichprobe sowie für drei Altersgruppen<br />
(40-54 Jahre, 55-69 Jahre, 70-85 Jahre) dargestellt. Während für die Skala „Lebenszufriedenheit“<br />
die Stabilitäten über die Altersgruppen <strong>in</strong> etwa gleich s<strong>in</strong>d, nimmt die Stabilität der Skala<br />
„positiver Affekt“ über die Altersgruppen leicht <strong>und</strong> die Stabilität der Skala „negativer Affekt“<br />
deutlich ab (die Stabilität der Skala „negativer Affekt“ ist <strong>in</strong> den beiden älteren Gruppen signifikant<br />
ger<strong>in</strong>ger als <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe).<br />
Diese Bef<strong>und</strong>e haben Bedeutung für theoretische Konzeptionen, aber auch für nachfolgende<br />
statistische Analysen. Die Stabilität subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens kann entweder auf stabile Personeigenschaften<br />
zurückgeführt werden (im S<strong>in</strong>ne der <strong>in</strong> Abschnitt 9.1 diskutierten „Top-<br />
Down“-Modelle), kann aber auch auf e<strong>in</strong>e gewisse Stabilität der Lebenssituation verweisen.<br />
Offensichtlich ist Lebenszufriedenheit über die Lebensspanne stabiler als affektive Komponenten<br />
des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens (<strong>in</strong>sbesondere die Stabilität negativer Gefühle s<strong>in</strong>kt mit dem<br />
Alter).<br />
Diese Bef<strong>und</strong>e haben aber auch Konsequenzen für die nachfolgenden statistischen Analysen. In<br />
den folgenden Analysen wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
über die Zeit h<strong>in</strong>weg bee<strong>in</strong>flussen (Zeitraum von sechs Jahren zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002).<br />
Dabei s<strong>in</strong>d nicht alle<strong>in</strong> die Veränderungen der Lebenssituation, sondern auch die (relative) Konstanz<br />
des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens zu berücksichtigen. Für die statistischen Analysen bedeutet<br />
dies, den jeweiligen Ausgangszustand e<strong>in</strong>er abhängigen Variable zu kontrollieren. Technisch<br />
werden dabei nicht die Differenzwerte der jeweiligen Skalen herangezogen (die durch Subtraktion<br />
des Endwertes vom Ausgangswert entstehen), sondern Residuen, die bei der Regression der<br />
jeweiligen Variable aus dem Jahr 2002 auf die Variable aus dem Jahr 1996 entstehen 3 . In ähnlicher<br />
Weise werden als Veränderungswerte der objektiven Lebenssituation Residuen entsprechender<br />
Regressionsanalysen verwendet.<br />
9.6.3 Bef<strong>und</strong>e<br />
Im folgenden werden Veränderungen <strong>in</strong> der objektiven Lebenssituation mit Veränderungen <strong>in</strong><br />
bereichsspezifischen Bewertungen <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>er Lebenszufriedenheit <strong>in</strong> Beziehung gesetzt.<br />
Berücksichtigt werden hierbei Veränderungen im Erwerbsstatus, <strong>in</strong> der f<strong>in</strong>anziellen Situation,<br />
im sozialen Netzwerk sowie im Ges<strong>und</strong>heitszustand.<br />
Veränderung im Erwerbsstatus<br />
Der Erwerbsstatus ist für viele Aspekte der Lebenslage von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
bedeutsam: Die f<strong>in</strong>anzielle Situation, die soziale Integration, aber auch die Strukturierung<br />
3 Der Zusammenhang zwischen e<strong>in</strong>fachen Veränderungswerten <strong>und</strong> Residualwerten ist recht hoch, variiert aber<br />
zwischen .60 <strong>und</strong> .95 für unterschiedliche Bereiche.
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
des Tages werden von der Teilnahme am Berufsleben bee<strong>in</strong>flusst (Herfurth, Kohli, & Zimmermann,<br />
2003). Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Positionen im Erwerbsleben kann demnach<br />
nicht alle<strong>in</strong> für die materielle Lage, sondern auch für andere Lebensbereiche bedeutsame<br />
Folgen haben. Im folgenden wird der Frage nachgegangen, wie sich die Veränderung des Erwerbsstatus<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 auf die Zufriedenheit von Personen auswirkt. Dabei werden<br />
bereichsspezifische Bewertungen <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit e<strong>in</strong>ander gegenübergestellt.<br />
Gemäß vorausgehend formulierter Überlegungen wird erwartet, dass die allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit weniger durch Veränderungen der Lebenssituation bee<strong>in</strong>flusst wird als<br />
bereichsspezifische Bewertungen.<br />
Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 konnten Befragungsteilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -teilnehmer des Alterssurveys<br />
durchgängig zur Erwerbsbevölkerung gehören. Hierbei handelt es sich vor allem um Personen<br />
der jüngsten <strong>und</strong> mittleren Altersgruppe (vor dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand), die erwerbstätig<br />
waren oder e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit suchten. Innerhalb dieser Gruppe von Erwerbspersonen<br />
s<strong>in</strong>d vier Veränderungskonstellationen möglich: „Kont<strong>in</strong>uierliche“ Erwerbstätigkeit (die<br />
Person hat zu beiden Zeitpunkten 1996 <strong>und</strong> 2002 angegeben, erwerbstätig zu se<strong>in</strong>), Wechsel<br />
von der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Nicht-Erwerbstätigkeit (vor allem <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit),<br />
Wechsel von der Nicht-Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Erwerbstätigkeit sowie durchgängige Nicht-<br />
Erwerbstätigkeit (etwa Langzeitarbeitslosigkeit). Diese Gruppen s<strong>in</strong>d – entsprechend den Verhältnissen<br />
am Arbeitsmarkt – sehr unterschiedlich besetzt. (Mehr Informationen zur Erwerbstätigkeit<br />
älterer Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> dem Kapitel<br />
von Engstler <strong>in</strong> diesem Berichtsband).<br />
Folgt man dem Modell der Veränderung des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens (Abbildung 9.3), so<br />
kann man annehmen, dass Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Veränderung <strong>in</strong> der Erwerbsposition stärker mit Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der Bewertung der beruflichen Situation (bzw. der Situation im Ruhestand) zusammenhängen<br />
als mit Veränderungen der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit. In Abbildung 9.5<br />
(oberer Teil der Abbildung) s<strong>in</strong>d die Verläufe der Skala „Lebenszufriedenheit“ <strong>und</strong> des Items<br />
„Bewertung von Beruf/Ruhestand“ für die vier beschriebenen Veränderungskonstellationen<br />
dargestellt. Wie deutlich zu erkennen ist, unterscheiden sich die Verläufe der bereichsspezifischen<br />
Bewertung (oben l<strong>in</strong>ks) von den Verläufen der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit (oben<br />
rechts).<br />
Kont<strong>in</strong>uierlich erwerbstätige Personen gaben zu beiden Messzeitpunkten positive Bewertungen<br />
der beruflichen Situation an; Personen, die zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben<br />
haben (oder aufgeben mussten), erlebten e<strong>in</strong>en Abfall der bereichsspezifischen Bewertung<br />
(p
426<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Ähnlich differenzierte Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischer <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>er Zufriedenheit<br />
zeigen sich für Personen, die zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand vollzogen<br />
haben (Abbildung 9.5, unterer Teil). Personen, die den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand vollzogen,<br />
zeigten im Jahr 2002 e<strong>in</strong>e deutlich positivere bereichsspezifische Bewertung als im Jahr<br />
1996 (l<strong>in</strong>ker Teil der Abbildung 9.5 unten). Die Verbesserung der bereichsspezifischen Bewertung<br />
war stärker für Personen, die aus der Nicht-Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> den Ruhestand wechseln,<br />
als für Personen, die aus der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> den Ruhestand wechseln. Die bereichsspezifische<br />
Bewertung der Situation im Ruhestand blieb für Personen, die bereits 1996 im Ruhestand<br />
waren, über die sechs Jahre stabil. Der Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand sche<strong>in</strong>t allerd<strong>in</strong>gs auch mit<br />
der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit zu korrelieren (rechter Teil der Abbildung 9.5 unten): Für<br />
beide Gruppen, die den Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand vollzogen, war die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
im Jahr 2002 etwas höher als im Jahr 1996 (p nicht erwerbstätig (n=80)<br />
Lebenszufriedenheit<br />
1996 2002<br />
Stabil erwerbstätig (n=431)<br />
Wechsel nicht-erwerbst -> erwerbstätig (n=43) Stabil nicht-erwerbstätig (n=103)<br />
(b) Ruhestand <strong>und</strong> Übergänge <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
Bewertung Beruf/Ruhestand<br />
1996 2002<br />
Wechsel erwerbstätig -> Ruhestand (n=156)<br />
Wechsel nicht-erwerbstätig -> Ruhestand (n=101)<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (gewichtet)<br />
Lebenszufriedenheit<br />
1996 2002<br />
Stabil im Ruhestand (n=442)
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Der <strong>in</strong> Abbildung 9.5 illustrierte Bef<strong>und</strong> wird auch durch e<strong>in</strong>e Analyse bestätigt, <strong>in</strong> der die statistische<br />
Interaktion zwischen Messzeitpunkt <strong>und</strong> Erwerbsstatus unter Kontrolle der Kovariaten<br />
Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Region überprüft wird. In e<strong>in</strong>em Gesamtmodell s<strong>in</strong>d Unterschiede im<br />
Verlauf zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 zwischen den (sieben) Erwerbsstatus-Gruppen nur für die<br />
Variable „Bewertung von Beruf/Ruhestand“, nicht aber für „Lebenszufriedenheit“ statistisch<br />
bedeutsam (<strong>und</strong> zwar auch dann, wenn die Variablen Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Region als Kovariaten<br />
berücksichtigt werden).<br />
Veränderungen im E<strong>in</strong>kommen<br />
In der zweiten Lebenshälfte kann es aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher Ereignisse zu Veränderungen <strong>in</strong><br />
der materiellen Lage kommen. Während der Erwerbsphase können berufliche Veränderungen<br />
wie der Übergang von der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> die Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> der Übergang von der<br />
Arbeitslosigkeit <strong>in</strong> die Erwerbstätigkeit, der Übergang von der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> den Ruhestand<br />
sowie <strong>in</strong> der Phase des Ruhestands vor allem Verwitwung zu Veränderungen der materiellen<br />
Lage führen. Die Stabilität der materiellen Lage zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 (hier def<strong>in</strong>iert als<br />
Äquivalenze<strong>in</strong>kommen nach OECD-Def<strong>in</strong>ition) ist eher hoch. Der entsprechende Stabilitätskoeffizient<br />
beträgt r=.63 für die gesamte Stichprobe (für die jüngste Altersgruppe r=.61, für die<br />
mittlere Altersgruppe r=.70 <strong>und</strong> für die älteste Altersgruppe r=.53). Trotz dieser hohen Stabilität<br />
gibt es e<strong>in</strong>e – zum Teil erhebliche – <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> E<strong>in</strong>kommensdynamik (s. das Kapitel von Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
<strong>in</strong> diesem Berichtsband).<br />
Im Folgenden soll überprüft werden, ob Veränderungen im E<strong>in</strong>kommen Veränderungen <strong>in</strong> der<br />
subjektiven Bef<strong>in</strong>dlichkeit nach sich ziehen. In Abbildung 9.6 s<strong>in</strong>d Stabilitätskoeffizienten für<br />
die beiden Zufriedenheitsvariablen, das Äquivalenze<strong>in</strong>kommen sowie die Korrelationen zwischen<br />
den Veränderungswerten im E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Zufriedenheit dargestellt (bei den<br />
Veränderungswerten handelt es sich um Residualwerte aus Regressionsanalysen, s.o.). Auf der<br />
l<strong>in</strong>ken Seite der Abbildung 9.6 s<strong>in</strong>d die Koeffizienten der abhängigen Variable „Bewertung des<br />
Lebensstandards“, auf der rechten Seite die Koeffizienten für die Skala „Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit“<br />
dargestellt. Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> Bewertung des Lebensstandards weisen mittlere<br />
Stabilitätskoeffizienten auf (r=.40 bzw. r=.42). Von Interesse s<strong>in</strong>d hier vor allem die Korrelationen<br />
zwischen den Veränderungswerten, die den Zusammenhang zwischen Veränderungen<br />
im E<strong>in</strong>kommen sowie Veränderungen <strong>in</strong> der subjektiven Bef<strong>in</strong>dlichkeit angeben (senkrechte<br />
Pfeile).<br />
427
428<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Abbildung 9.6:<br />
Zusammenhänge zwischen Veränderung des E<strong>in</strong>kommens mit Veränderungen <strong>in</strong> der Bewertung<br />
des Lebensstandards sowie der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit<br />
Bewertung des Lebensstandards<br />
Bew.<br />
Lebensstandard<br />
1996<br />
E<strong>in</strong>kommen<br />
1996<br />
.40<br />
.66<br />
Bew.<br />
Lebensstandard<br />
2002<br />
.21**<br />
E<strong>in</strong>kommen<br />
2002<br />
LZ<br />
1996<br />
E<strong>in</strong>kommen<br />
1996<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (n= 1.081, gewichtet)<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
.40<br />
.66<br />
.07*<br />
LZ<br />
2002<br />
E<strong>in</strong>kommen<br />
2002<br />
Während dieser Zusammenhang für das Item „Bewertung des Lebensstandards mit r=.21<br />
(p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der Netzwerkgröße mit Veränderungen <strong>in</strong> Zufriedenheitsurteilen <strong>in</strong> Beziehung<br />
gesetzt.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich des Partnerschaftsstatus wird im folgenden nur unterschieden, ob e<strong>in</strong>e Person angibt<br />
e<strong>in</strong>e Partnerschaft zu haben oder nicht (es wird also nicht nach ledigen, verwitweten, geschiedenen<br />
oder getrennt lebenden Personen unterschieden). Bei der Veränderung der Partnerschaft<br />
entstehen auf diese Weise vier Veränderungskonstellationen: (1) Personen, die zu beiden<br />
Messzeitpunkten angaben, e<strong>in</strong>en Partner zu haben („<strong>in</strong> Partnerschaft“). (2) Personen, die zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 den Verlust oder die Trennung von e<strong>in</strong>em Partner erlebt haben („Partnerverlust“).<br />
(3) Personen, die im Jahr 1996 ohne Partner lebten <strong>und</strong> im Jahr 2002 angaben, e<strong>in</strong>en<br />
Partner zu haben („Partnergew<strong>in</strong>n“). (4) Personen, die während des gesamten Zeitraums ke<strong>in</strong>en<br />
Partner hatten („ohne Partner“). Ähnlich wie im Fall des Erwerbsstatus zeigen sich Unterschiede<br />
<strong>in</strong> der Gruppengröße bei den verschiedenen Konstellationen <strong>in</strong> der Veränderung des Partnerschaftsstatus.<br />
Das durchschnittliche Alter dieser vier Gruppen unterscheidet sich deutlich (im Jahr 2002 betrug<br />
der Mittelwert für die Gruppen „<strong>in</strong> Partnerschaft“ 61 Jahre, „Partnergew<strong>in</strong>n“ 59 Jahre,<br />
„Partnerverlust“ 69 Jahre <strong>und</strong> „ohne Partner“ 70 Jahre). Allerd<strong>in</strong>gs war der Altersrange <strong>in</strong> allen<br />
Gruppen recht hoch (<strong>und</strong> betrug für die vier Gruppen im Jahr 2002 46-90, 46-81, 46-89 <strong>und</strong> 47-<br />
91 Jahre). Dies bedeutet, dass das Alter <strong>in</strong> entsprechenden Analysen statistisch kontrolliert werden<br />
muss.<br />
In Abbildung 9.7 s<strong>in</strong>d die durchschnittlichen Werte der bereichsspezifischen Bewertung der<br />
Situation mit (bzw. ohne Partner, l<strong>in</strong>ke Seite) sowie der Lebenszufriedenheit (rechte Seite) für<br />
die vier Gruppen des Partnerschaftsstatus dargestellt.<br />
Abbildung 9.7:<br />
Bewertung der Partnerschaft bzw. der Situation ohne Partner sowie allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit für Gruppen mit unterschiedlichen Veränderungen im<br />
Partnerschaftsstatus 1996 <strong>und</strong> 2002.<br />
5,0<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
Bewertung Partnerschaft<br />
1996 2002<br />
Ohne Partner 1996, mit Partner 2002 (n=59)<br />
Mit Partner 1996, ohne Partner 2002 (n=93)<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (gewichtet)<br />
Lebenszufriedenheit<br />
1996 2002<br />
Mit Partner 1996 <strong>und</strong> 2002 (n=1.188)<br />
Ohne Partner 1996 <strong>und</strong> 2002 (n=209)<br />
429
430<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Es ist anhand von Abbildung 9.7 deutlich zu sehen, dass es vor allem <strong>in</strong> der bereichsspezifischen<br />
Bewertung der Partnerschaftssituation deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen im<br />
Verlauf zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 gibt. Personen, die zu beiden Messzeitpunkten <strong>in</strong> Partnerschaft<br />
lebten, gaben ke<strong>in</strong>e bedeutsame Veränderung <strong>in</strong> der Bewertung der Situation <strong>in</strong> der Partnerschaft<br />
an. Personen, die e<strong>in</strong>en Partnerverlust erlitten hatten, zeigten im Jahr 2002 e<strong>in</strong>e deutlich<br />
negativere bereichsspezifische Bewertung als im Jahr 1996 (p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Abbildung 9.8:<br />
Zusammenhänge zwischen Veränderung der Netzwerkgröße mit Veränderungen <strong>in</strong> der Bewertung<br />
des Verhältnisses zu Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Bekannten sowie der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit<br />
Bewertung der Beziehungen<br />
zu Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Bekannten<br />
Bew.<br />
Fre<strong>und</strong>e<br />
Bekannte<br />
1996<br />
Netzwerk<br />
1996<br />
.20<br />
.19<br />
Bew.<br />
Fre<strong>und</strong>e<br />
Bekannte<br />
2002<br />
.23**<br />
Netzwerk<br />
2002<br />
LZ<br />
1996<br />
Netzwerk<br />
1996<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (n= 1.143; gewichtet)<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
.41<br />
.19<br />
.03 n.s.<br />
LZ<br />
2002<br />
Netzwerk<br />
2002<br />
Entsprechende Bef<strong>und</strong>e zeigen Regressionsanalysen, <strong>in</strong> denen die Zufriedenheitsvariablen des<br />
Jahres 2002 zunächst durch die Zufriedenheitsvariablen aus dem Jahr 1996 sowie durch Alter,<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Region als Kontrollvariablen vorhergesagt wurden. In e<strong>in</strong>em gesonderten Analyseschritt<br />
wurden die Veränderungswerte der sozialen Netzwerkgröße <strong>in</strong> das Regressionsmodell<br />
e<strong>in</strong>geführt. Die zusätzliche Varianzaufklärung (R 2 change) durch die Veränderung <strong>in</strong> der<br />
Netzwerkgröße beträgt für die Bewertung des Verhältnisses zu Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Bekannten 4,5<br />
Prozent, für die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit dagegen lediglich 0,5 Prozent.<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der körperlichen Ges<strong>und</strong>heit<br />
Veränderungen im Ges<strong>und</strong>heitsstatus s<strong>in</strong>d nach wie vor bedeutsamer Bestandteil des Alternsprozesses.<br />
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, an verschiedenen, vor allem<br />
chronischen Erkrankungen zu leiden (Multimorbidität) <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen, <strong>in</strong>sbesondere im<br />
Bereich der Mobilität zu erleben (Wurm & Tesch-Römer, im Druck). Zudem steigt die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit,<br />
e<strong>in</strong>en schweren Unfall oder e<strong>in</strong>e gravierende Erkrankung zu erleiden (s. zum<br />
Thema „Ges<strong>und</strong>heit“ die Kapitel von Wurm & Tesch-Römer <strong>und</strong> Wurm <strong>in</strong> diesem Berichtsband).<br />
Im folgenden werden Veränderungen im Bereich Ges<strong>und</strong>heit mit Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
<strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>en Zufriedenheitsmaßen <strong>in</strong> Beziehung gesetzt. Dabei geht es<br />
um Veränderungen h<strong>in</strong>sichtlich der Zahl von selbstberichteten Krankheiten bzw. Multimorbidität<br />
(Abbildung 9.9) sowie dem Erleben e<strong>in</strong>es Unfalls oder e<strong>in</strong>er schweren Krankheit (Abbildung<br />
9.10).<br />
In Abbildung 9.9 s<strong>in</strong>d Stabilitätskoeffizienten für die beiden Zufriedenheitsvariablen, die Zahl<br />
der selbstberichteten Krankheiten (Multimorbidität) sowie die Korrelationen zwischen den Veränderungswerten<br />
der Multimorbidität <strong>und</strong> den beiden Zufriedenheitsmaßen dargestellt (als Veränderungswerte<br />
wurden wiederum Residualwerte verwendet). Die (selbstberichtete) Multimorbidität<br />
weist e<strong>in</strong>e mittlere Stabilität auf (r=.49), ebenso wie die subjektive Ges<strong>und</strong>heit (r=.49).<br />
431
432<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Abbildung 9.9:<br />
Zusammenhänge zwischen Veränderung der Veränderung der körperlichen Ges<strong>und</strong>heit<br />
(Multimorbidität) mit Veränderungen <strong>in</strong> der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit sowie der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit<br />
Subj.<br />
Ges<strong>und</strong>heit<br />
1996<br />
Multimorbid.<br />
1996<br />
Subjektive Ges<strong>und</strong>heit<br />
.48<br />
.49<br />
Subj.<br />
Ges<strong>und</strong>heit<br />
2002<br />
-.20**<br />
Multimorbid.<br />
2002<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (n= 1.261; gewichtet)<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
LZ<br />
1996<br />
Multimorbid.<br />
1996<br />
.40<br />
.49<br />
-.12**<br />
LZ<br />
2002<br />
Multimorbid.<br />
2002<br />
Auf der l<strong>in</strong>ken Seite der Abbildung 9.9 s<strong>in</strong>d die Koeffizienten für die abhängige Variable „subjektive<br />
Ges<strong>und</strong>heit“ dargestellt. Der Zusammenhang zwischen der Veränderung <strong>in</strong> der Multimorbidität<br />
<strong>und</strong> der Veränderung <strong>in</strong> der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit beträgt r=-.20 (p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Abbildung 9.10:<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> subjektive Ges<strong>und</strong>heit für Personen, die e<strong>in</strong>en Unfall<br />
oder e<strong>in</strong>e schwere Krankheit erlebt haben, bzw. für Personen ohne Unfall oder Krankheit<br />
5,0<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
Subjektive Ges<strong>und</strong>heit<br />
1996 2002<br />
Unfall oder Krankheit zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 (n=391)<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (gewichtet)<br />
Lebenszufriedenheit<br />
1996 2002<br />
ke<strong>in</strong>/e Unfall/Krankheit (n=1.132)<br />
Personen, die e<strong>in</strong>en Unfall oder e<strong>in</strong>e schwere Krankheit erlitten haben, weisen bei der Wiederholungsbefragung<br />
im Jahr 2002 e<strong>in</strong>e schlechtere subjektive Ges<strong>und</strong>heit auf als im Jahr 1996<br />
(p
434<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Teil erheblichen – Veränderungen der Lebenssituation nur ger<strong>in</strong>g mit Veränderungen <strong>in</strong> der<br />
allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit korrelierten. Sehr viel stärkere Korrelationen konnten mit<br />
bereichsspezifischen Zufriedenheitsurteilen nachgewiesen werden. In den bisherigen Analysen<br />
ist noch nicht überprüft worden, ob es tatsächlich Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen Bewertungen<br />
s<strong>in</strong>d, die Veränderungen <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit (statistisch) erklären<br />
können. Entsprechende Analysen sollen nun abschließend vorgenommen werden.<br />
Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen Bewertungen <strong>und</strong> Lebenszufriedenheit<br />
Dabei werden Veränderungen <strong>in</strong> der objektiven Lebenssituation (hier beschränkt auf E<strong>in</strong>kommen,<br />
Partnerschaft, soziales Netz <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit) sowie Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
Bewertungen verwendet, um Veränderungen <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 vorherzusagen.<br />
In Tabelle 9.10 s<strong>in</strong>d die Ergebnisse e<strong>in</strong>er schrittweisen multiplen Regressionsanalyse für den<br />
Indikator „allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit im Jahr 2002“ zusammengestellt. Im Modell 1 wird<br />
zunächst die Variable „allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit im Jahr 1996“ e<strong>in</strong>geführt. In diesem<br />
ersten Schritt werden 15 Prozent an Varianz aufgeklärt (dies entspricht der oben mehrfach erwähnten<br />
Stabilität zwischen den beiden Messzeitpunkten). Im Modell 2 werden die Designvariablen<br />
Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Region e<strong>in</strong>geführt. Durch diesen Schritt wird ke<strong>in</strong>e weitere Varianzaufklärung<br />
erreicht; ke<strong>in</strong>er der Koeffizienten erreicht statistische Bedeutsamkeit. Im dritten<br />
Modell werden Veränderungs<strong>in</strong>formationen zu den Bereichen E<strong>in</strong>kommen, soziales Netzwerk<br />
sowie Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>geführt. Dabei werden drei Prozent zusätzliche Varianz aufgeklärt. In diesem<br />
Modell s<strong>in</strong>d (neben „Lebenszufriedenheit 1996“) nur die beiden Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikatoren –<br />
selbstberichtete Multimorbidität <strong>und</strong> Erleben e<strong>in</strong>es Unfalls oder e<strong>in</strong>er Krankheit – sowie das<br />
Alter statistisch von Bedeutung. In Modell 4 werden schließlich die Veränderungswerte der<br />
bereichsspezifischen Bewertungen zu den Bereichen Lebensstandard, Partnerschaft, Verhältnis<br />
zu Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Bekannten sowie subjektive Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>gegeben.<br />
Durch die E<strong>in</strong>führung dieser vier Prädiktoren wird die Erklärungskraft des Gesamtmodells deutlich<br />
verbessert (10 Prozent zusätzliche Varianzaufklärung). Innerhalb dieses Modells erweisen<br />
sich die vier Indikatoren zu Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen Bewertungen als hoch signifikant<br />
(daneben weisen nur noch „Lebenszufriedenheit 1996“ sowie Alter signifikante Koeffizienten<br />
auf). Insgesamt klärt dieses Modell 30 Prozent an Varianz <strong>in</strong>nerhalb der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Lebenszufriedenheit (erhoben im Jahr 2002) auf.
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Tabelle 9.10:<br />
Ergebnisse der Regression der Skala „Lebenszufriedenheit 2002“ auf „Lebenszufriedenheit<br />
1996“, Veränderungen der objektiven Lebenssituation sowie Veränderungen bereichsspezifischer<br />
Bewertungen<br />
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4<br />
Beta p Beta p Beta p Beta p<br />
Lebenszufriedenheit 1996 .32 ** .42 ** .39 ** .36 **<br />
Alter -.02 n.s. .10 * .07 *<br />
Geschlecht -.01 n.s. .02 n.s. -.01 n.s.<br />
Region (0=Ost, 1=West) .00 n.s. .00 n.s. -.02 n.s.<br />
Veränderung im E<strong>in</strong>kommen .05 n.s. .00 n.s.<br />
Veränderung im Netzwerk .05 n.s. .01 n.s.<br />
Partner 1996 <strong>und</strong> 2002 .09 n.s. .03 n.s.<br />
Ke<strong>in</strong> Partner 1996, Partner 2002 .05 n.s. .01 n.s.<br />
Partner 1996, ke<strong>in</strong> Partner 2002 -.03 n.s. .00 n.s.<br />
Veränderung Ges<strong>und</strong>heit -.09 * -.05 n.s.<br />
Unfall/Krankheit -.08 * -.04 n.s.<br />
Veränderung Bewertung Lebensstandard .21 **<br />
Veränderung Bewertung Partnerschaft .12 **<br />
Veränderung Bewertung Fre<strong>und</strong>e/Bekannte .10 **<br />
Veränderung subjektive Ges<strong>und</strong>heit .12 **<br />
R 2 (korrigiert) .18 * .18 * .20 * .30 *<br />
Zuwachs an R 2 (korrigiert) .18 * .00 .02 * .10 *<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002 (n= 968), * p
436<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Tabelle 9.11:<br />
Altersgruppendifferenzierte Analyse: Ergebnisse der Regression der Skala „Lebenszufriedenheit<br />
2002“ auf „Lebenszufriedenheit 1996“, Veränderungen der objektiven Lebenssituation<br />
sowie Veränderung bereichsspezifischer Bewertungen<br />
Jüngste<br />
Altersgruppe<br />
Mittlere<br />
Altersgruppe<br />
Älteste<br />
Altersgruppe<br />
Beta p Beta p Beta p<br />
Lebenszufriedenheit 1996 .32 ** .43 ** .35 **<br />
Alter .07 * -.04 n.s .01 n.s.<br />
Geschlecht .04 n.s. -.04 n.s. -.06 n.s.<br />
Region (0=Ost, 1=West) .06 n.s. -.11 ** .03 n.s.<br />
Veränderung im E<strong>in</strong>kommen -.04 n.s. .05 n.s. .12 n.s.<br />
Veränderung im Netzwerk .02 n.s. .01 n.s. -.04 n.s.<br />
Partner 1996 <strong>und</strong> 2002 -.11 n.s. .06 n.s. .09 n.s.<br />
Ke<strong>in</strong> Partner 1996, Partner 2002 1 -.06 n.s. .02 n.s. -- --<br />
Partner 1996, ke<strong>in</strong> Partner 2002 -.06 n.s. -.03 n.s. .13 n.s.<br />
Veränderung Ges<strong>und</strong>heit -.08 * -.01 n.s. -.08 n.s.<br />
Unfall/Krankheit -.06 n.s. -.03 n.s. -.04 n.s.<br />
Veränderung Bewertung Lebensstandard .25 ** .17 ** .13 n.s.<br />
Veränderung Bewertung Partnerschaft .16 ** .09 n.s. .13 n.s.<br />
Veränderung Bewertung Fre<strong>und</strong>e/Bekannte .10 * .10 * .13 n.s.<br />
Veränderung subjektive Ges<strong>und</strong>heit .07 n.s. .11 ** .30 **<br />
R 2 (korrigiert) .28 * .32 * .36 *<br />
N 442 392 157<br />
1 In der ältesten Altersgruppe gab es ke<strong>in</strong>e Personen, die über e<strong>in</strong>en „Partnergew<strong>in</strong>n“ berichteten.<br />
Quelle: Alterssurvey Panelstichprobe 1996-2002, * p
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Bewertungen sehr viel stärker als der globale Indikator „Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit“<br />
durch Veränderungen der Lebenssituation bee<strong>in</strong>flusst werden. Die Bef<strong>und</strong>e zeigen, dass Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der persönlichen Lebenssituation vor allem mit Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
Bewertungen zusammenhängen. Entsprechende Analysen wurden für Veränderungen im<br />
Erwerbsstatus, <strong>in</strong> der materiellen Lage, im Partnerschaftsstatus, <strong>in</strong> der Größe des Netzwerks<br />
sowie für den Ges<strong>und</strong>heitszustand vorgelegt. Zum anderen konnten Bef<strong>und</strong>e dafür vorgelegt<br />
werden, dass Veränderungen der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit vor allem mit Veränderungen<br />
<strong>in</strong> bereichsspezifische Bewertungen (<strong>und</strong> weniger mit Veränderungen der Lebenssituation)<br />
zusammenhängen. Dabei zeigten sich altersspezifische Verschiebungen <strong>in</strong> der Gewichtung von<br />
bereichsspezifischen Bewertungen. Während <strong>in</strong> den jüngeren Altersgruppen vor allem Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der Bewertung des Lebensstandards <strong>und</strong> der sozialen Integration Veränderungen <strong>in</strong><br />
der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit vorhergesagt werden, s<strong>in</strong>d dies <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe<br />
vor allem Veränderungen <strong>in</strong> der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit.<br />
9.7 Ausblick<br />
Gegenstand dieses Kapitels war die Analyse subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens im zeitlichen Verlauf.<br />
Gesellschaftlicher <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Bed<strong>in</strong>gungen <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r Veränderungen von Lebenszufriedenheit,<br />
positivem Affekt <strong>und</strong> negativem Affekt standen hierbei im Mittelpunkt. In diesem abschließenden<br />
Abschnitt werden zunächst die wesentlichen Bef<strong>und</strong>e aus der zweiten Welle des<br />
Alterssurveys – getrennt nach Ergebnissen des Kohorten- <strong>und</strong> des Panelvergleichs – zu subjektivem<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität zusammengefasst. Danach werden theoretische Implikationen<br />
dieser Ergebnisse diskutiert. Abschließend werden Handlungsempfehlungen erörtert,<br />
die sich auf die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e beziehen.<br />
9.7.1 Ergebnisse<br />
Ergebnisse I: Dimensionen des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> Emotionen stellen unterschiedliche Komponenten subjektiver Lebensqualität<br />
dar. Lebenszufriedenheit betrifft die Beurteilung der eigenen Lebenssituation anhand<br />
von Bewertungsmaßstäben. Gefühlszustände spiegeln dagegen die Reaktion auf tägliche Ereignisse<br />
<strong>und</strong> Schwierigkeiten wider. Die Notwendigkeit, diese Komponenten des subjektiven<br />
Wohlbef<strong>in</strong>dens gesondert zu betrachten, wird durch unterschiedliche empirische Bef<strong>und</strong>muster<br />
deutlich (etwa h<strong>in</strong>sichtlich Alters- <strong>und</strong> Geschlechtsunterschieden).<br />
Ergebnisse II: Trends im subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Trends: Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte äußern im Durchschnitt hohe Zufriedenheit,<br />
erleben häufig positive Emotionen <strong>und</strong> erfahren eher selten negative Gefühle. Zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 nahmen Zufriedenheit <strong>und</strong> positiver Affekt im Durchschnitt leicht zu <strong>und</strong> nega-<br />
437
438<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
tiver Affekt leicht ab. Bedeutsam ist hierbei, dass nicht für alle Gruppen der Bevölkerung die<br />
subjektive Lebensqualität <strong>in</strong> diesem Zeitraum angestiegen ist.<br />
Altersunterschiede: Die drei Komponenten subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens – Lebenszufriedenheit,<br />
positive Gefühle <strong>und</strong> negative Gefühle – verändern sich mit dem Alter <strong>in</strong> unterschiedlicher<br />
Weise. Die Lebenszufriedenheit bleibt bis <strong>in</strong>s hohe Alter stabil. Berücksichtigt man <strong>in</strong> statistischen<br />
Analysen relevante Lebenslagemerkmale <strong>und</strong> bereichsspezifische Bewertungen, so steigt<br />
die Lebenszufriedenheit mit dem Alter sogar: Je älter Menschen s<strong>in</strong>d, desto zufriedener s<strong>in</strong>d sie<br />
mit ihrem Leben. Gleichzeitig nimmt mit dem Alter die Häufigkeit erlebter Gefühle <strong>in</strong>sgesamt<br />
ab. Je älter Menschen werden, desto seltener erleben sie sowohl positive Gefühle (wie „Glück“)<br />
als auch negative Gefühle (wie „Trauer“).<br />
Geschlechtsunterschiede: Frauen äußern höhere Zufriedenheit mit ihrem Leben als Männer.<br />
Dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern verändert sich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nicht.<br />
Gleichwohl äußern Frauen <strong>in</strong> höherem Maß als Männer das Erleben negativer Gefühle. Die<br />
geschlechtsspezifischen Bef<strong>und</strong>muster h<strong>in</strong>sichtlich negativen Affekts könnten auf unterschiedliches<br />
Antwortverhalten von Männern <strong>und</strong> Frauen zurückzuführen se<strong>in</strong>: Es ist möglich, dass<br />
Frauen eher bereit s<strong>in</strong>d als Männer, das Erleben negativer Emotionen zu berichten.<br />
Regionale Unterschiede: Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 hat sich e<strong>in</strong>e Annäherung zwischen Ost-<br />
<strong>und</strong> Westdeutschland h<strong>in</strong>sichtlich der geäußerten Lebenszufriedenheit vollzogen. Die Zufriedenheit<br />
von Menschen, die <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern leben, erhöhte sich zwischen 1996 <strong>und</strong><br />
2002 stärker als bei Menschen, die <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern leben. Es bestehen zwar auch im<br />
Jahr 2002 noch regionale Unterschiede <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit. Gleichwohl ist e<strong>in</strong>e deutliche<br />
Annäherung <strong>in</strong> der Zufriedenheit von Menschen <strong>in</strong> Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland zu verzeichnen.<br />
Soziale Ungleichheit: Die Bef<strong>und</strong>e zeigen deutlich die negativen Auswirkungen sozialer Ungleichheit<br />
für subjektive Lebensqualität. Unterschiede <strong>in</strong> der Zugehörigkeit der sozialen Schicht<br />
s<strong>in</strong>d nicht alle<strong>in</strong> mit der Verfügbarkeit von Ressourcen verb<strong>und</strong>en, sondern spiegeln sich auch<br />
<strong>in</strong> der subjektiven Bef<strong>in</strong>dlichkeit. Angehörige der unteren sozialen Schichten zeigen zwischen<br />
1996 <strong>und</strong> 2002 nur ger<strong>in</strong>ge Zugew<strong>in</strong>ne <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit. Für Angehörige der mittleren<br />
<strong>und</strong> gehobenen sozialen Schicht waren die entsprechenden Zuwächse <strong>in</strong> der subjektiven<br />
Lebensqualität deutlich größer. Die erheblichen Unterschiede zwischen sozialen Schichten im<br />
subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den blieben über den Zeitraum von sechs Jahren stabil.<br />
Ergebnisse III: Objektive Lebenssituation, bereichsspezifische Bewertungen <strong>und</strong> subjektive<br />
Lebensqualität<br />
Es wurde empirisch auch geprüft, ob Merkmale der objektiven Lebenssituation das subjektive<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>er Person <strong>in</strong> direkter Weise bee<strong>in</strong>flussen oder ob bereichsspezifische Bewertungen<br />
vermittelnd wirksam s<strong>in</strong>d. Bereichsspezifische Bewertungen beziehen sich auf die E<strong>in</strong>schätzung<br />
unterschiedlicher Lebensbereiche. Menschen bewerten die verschiedenen Bereiche<br />
ihrer Lebenssituation – Arbeit, E<strong>in</strong>kommen, Familie, Fre<strong>und</strong>e, Ges<strong>und</strong>heit – anhand von Vergleichsmaßstäben<br />
<strong>und</strong> Zielvorstellungen. Erst diese bereichsspezifischen Bewertungen fließen<br />
e<strong>in</strong> <strong>in</strong> das Gesamturteil „Ich b<strong>in</strong> mit me<strong>in</strong>em Leben zufrieden“. Das Modell der <strong>in</strong>direkten Beziehung<br />
zwischen objektiver Lebenssituation <strong>und</strong> subjektiver Lebensqualität nimmt an, dass
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Merkmale der objektive Lebenssituation zunächst bereichsspezifische Bewertungen bee<strong>in</strong>flussen<br />
<strong>und</strong> dass es vor allem diese bereichsspezifischen Bewertungen s<strong>in</strong>d, die die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit<br />
e<strong>in</strong>er Person bestimmen (Veränderung der objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen <br />
Veränderung <strong>in</strong> der bereichsspezifischen Bewertung Veränderung der Lebenszufriedenheit).<br />
Objektive Lebenssituation: Ges<strong>und</strong>heit, Lebensstandard <strong>und</strong> Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Partners s<strong>in</strong>d<br />
– als Bestandteile der objektiven Lebenssituation – mit subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den verknüpft. Je<br />
gesünder Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte s<strong>in</strong>d, desto zufriedener s<strong>in</strong>d sie, desto häufiger<br />
äußern sie positive Gefühle <strong>und</strong> desto seltener negative Gefühle. Höheres E<strong>in</strong>kommen korreliert<br />
mit höherer Lebenszufriedenheit, <strong>und</strong> Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>er höheren Schicht hängt mit positiven<br />
Gefühlszuständen zusammen. Das Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Partners ist mit höherer Lebenszufriedenheit<br />
verknüpft. Dies gilt auch dann, wenn andere Merkmale der Lebenssituation kontrolliert<br />
werden.<br />
Bereichsspezifische Bewertungen: In den Analysen hat sich jedoch deutlich gezeigt, dass allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit nicht alle<strong>in</strong> durch objektive Lebenslagemerkmale, sondern – <strong>und</strong><br />
zwar <strong>in</strong> höherem Maße – durch bereichsspezifische subjektive Bewertungen vorhergesagt wird.<br />
Weniger die objektive Ges<strong>und</strong>heit, die tatsächliche Höhe des E<strong>in</strong>kommens oder das tatsächliche<br />
Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Partners als vielmehr die E<strong>in</strong>schätzung der eigenen Ges<strong>und</strong>heit, die Bewertung<br />
des eigenen Lebensstandards oder die Beurteilung der Partnerschaftssituation s<strong>in</strong>d für<br />
die Lebenszufriedenheit e<strong>in</strong>er Person von Bedeutung. Für die Vorhersage affektiver Komponenten<br />
des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens (positive <strong>und</strong> negative Gefühle) haben bereichsspezifische<br />
Bewertungen dagegen weniger große Bedeutung.<br />
Veränderungen der Lebenssituation: Auch die Analysen zur <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>Entwicklung</strong>sdynamik<br />
haben das Modell der <strong>in</strong>direkten Beziehung zwischen objektiver Lebenssituation <strong>und</strong> subjektiver<br />
Lebensqualität bestätigt. Veränderungen <strong>in</strong> der persönlichen Lebenssituation hängen<br />
vor allem mit Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen Bewertungen zusammen – <strong>und</strong> erst diese<br />
Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen Bewertungen korrelieren mit Veränderungen der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Lebenszufriedenheit. Mit dem Alter verändern sich die Gewichtungen e<strong>in</strong>zelner Lebensbereiche<br />
(bzw. deren Bewertungen) für die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit. Während <strong>in</strong><br />
den jüngeren Altersgruppen Veränderungen <strong>in</strong> der Bewertung des Lebensstandards <strong>und</strong> der<br />
sozialen Beziehungen Bedeutung für Veränderungen <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit<br />
haben, s<strong>in</strong>d dies <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe vor allem Veränderungen <strong>in</strong> der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit.<br />
9.7.2 Theoretische <strong>und</strong> sozialpolitische Implikationen<br />
Die hier vorgelegten Analysen stehen im E<strong>in</strong>klang mit Bef<strong>und</strong>en der sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen<br />
Alternsforschung. Die kognitive Komponente des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
– Lebenszufriedenheit – bleibt über den Lebenslauf stabil (Okun, 2001). Der Begriff des<br />
„Paradoxes der Lebenszufriedenheit im hohen Alter“ wird bereits seit geraumer Zeit <strong>in</strong> der Gerontologie<br />
diskutiert (Staud<strong>in</strong>ger, 2000). Hiermit ist geme<strong>in</strong>t, dass die generelle Lebenszufriedenheit<br />
im Alter recht stabil ist, obwohl man annehmen könnte, dass aufgr<strong>und</strong> zunehmender<br />
Verlusterfahrungen auch das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>geschränkt se<strong>in</strong> müsste. Diese hohe<br />
439
440<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) alter <strong>und</strong> sehr alter Menschen kann als bedeutsames Potenzial<br />
des Alters bezeichnet werden: Auch angesichts widriger Lebensumstände können Zufriedenheit<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e positive Lebense<strong>in</strong>stellung bewahrt werden. Dies wird im vorliegenden Zusammenhang<br />
<strong>in</strong>sbesondere daran deutlich, dass die allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit weniger stark von<br />
objektiven Lebenslagemerkmalen oder kritischen Lebensereignissen wie Arbeitslosigkeit,<br />
Krankheit oder Unfällen betroffen ist als bereichsspezifische Zufriedenheitsurteile.<br />
Die Bed<strong>in</strong>gungsfaktoren der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit s<strong>in</strong>d demnach nicht <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
die objektiven Lebenslagen. Vielmehr spielen hier offensichtlich bereichsspezifische Bewertungen<br />
e<strong>in</strong>e zentrale Rolle. Anhand der Daten des Alterssurveys konnte das Modell der <strong>in</strong>direkten<br />
Beziehung zwischen objektiver Lebenssituation <strong>und</strong> subjektiver Lebensqualität nicht alle<strong>in</strong><br />
anhand querschnittsbezogenen Informationen, sondern auch im Längsschnitt geprüft werden.<br />
Hier zeigt sich auch, dass die Bedeutung von Lebensbereichen e<strong>in</strong>em <strong>Wandel</strong> über die Lebensspanne<br />
unterliegt: Während e<strong>in</strong>ige Bereiche mit zunehmendem Alter bedeutsamer werden (Bewertung<br />
der eigenen Ges<strong>und</strong>heit), werden andere Bereiche weniger wichtig (Bewertung des<br />
eigenen Lebensstandards).<br />
Das Modell kann auch verwendet werden, um die Stabilität der Lebenszufriedenheit angesichts<br />
widriger Lebensumstände zu erklären (vgl. auch Smith et al., 1996). Veränderungen der Lebenssituation<br />
bee<strong>in</strong>flussen die Lebenszufriedenheit e<strong>in</strong>er Person nicht auf direktem Weg. Vielmehr<br />
werden die Auswirkungen von Veränderungen der Lebenslage zweifach „abgepuffert“.<br />
Zum e<strong>in</strong>en verändert sich je nach betroffenem Bereich der Lebenssituation zunächst nur die<br />
bereichsspezifische Bewertung: E<strong>in</strong> Zugew<strong>in</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Lebensbereich macht die entsprechende<br />
bereichsspezifische Bewertung besser, e<strong>in</strong> Verlust schlechter. Erst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Schritt<br />
wirkt sich die Veränderung der bereichsspezifischen Bewertung auf die Lebenszufriedenheit<br />
e<strong>in</strong>er Person auf. Zum anderen wird Lebenszufriedenheit nicht nur durch e<strong>in</strong>e, sondern durch<br />
viele bereichsspezifische Bewertungen bee<strong>in</strong>flusst. Dies bedeutet, dass Veränderungen <strong>in</strong> nur<br />
e<strong>in</strong>em Lebensbereich (<strong>und</strong> der entsprechenden bereichsspezifischen Bewertung) durch Stabilität<br />
<strong>in</strong> anderen Lebensbereichen aufgefangen werden kann.<br />
Überlegungen <strong>in</strong> diese Richtung würden es auch ermöglichen, die – aus der Tradition der Sozialberichterstattung<br />
– (sche<strong>in</strong>bar) <strong>in</strong>konsistenten Wohlfahrtspositionen von „dissonant“ <strong>und</strong> „adaptiert“<br />
urteilenden Personen verständlich zu machen (Zapf, 1984). In dieser Tradition werden<br />
objektive Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektive Lebensbewertungen aufe<strong>in</strong>ander bezogen. Als<br />
konsistent werden dabei die Konstellationen des „Well-Be<strong>in</strong>g“ (Zusammentreffen von guten<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> positivem Wohlbef<strong>in</strong>den) <strong>und</strong> der "Deprivation" bezeichnet (schlechte<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen gehen mit negativem Wohlbef<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>her). Als <strong>in</strong>konsistent werden die<br />
Konstellationen "Dissonanz" (Komb<strong>in</strong>ation von guten Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Unzufriedenheit)<br />
sowie "Adaptation" (Verb<strong>in</strong>dung von schlechten Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Zufriedenheit)<br />
bezeichnet. Allerd<strong>in</strong>gs zeigen sich hier auch die Grenzen der vorliegenden Analysen. Da es<br />
offensichtlich nicht die Lebensbed<strong>in</strong>gungen selbst s<strong>in</strong>d, die sich direkt auf die Lebenszufriedenheit<br />
auswirken, kann es durchaus möglich se<strong>in</strong>, dass besonders saliente bereichsspezifische Bewertungen<br />
für die auf den ersten Blick <strong>in</strong>konsistenten Konstellationen von Dissonanz <strong>und</strong> Adaption<br />
verantwortlich s<strong>in</strong>d. An dieser Stelle wird aber auch deutlich, dass es sich lohnen kann,<br />
die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e um die Analyse der Entstehung bereichsspezifischer Bewertungen
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
zu ergänzen. Hierzu wäre es notwendig, <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Vergleichsmaßstäbe oder Wertüberzeugungen<br />
zu berücksichtigen (Campbell et al., 1976).<br />
Allerd<strong>in</strong>gs deutet sich im Zusammenhang mit dem Problem der „Adaptation“ bzw. des „Zufriedenheitsparadoxes“<br />
(Staud<strong>in</strong>ger, 2000; Zapf, 1984) e<strong>in</strong> Problem an, das sozialpolitisch relevant<br />
ist. Gerade adaptierte Menschen – also die trotz Benachteiligung zufriedenen Personen – stellen<br />
aus sozial- <strong>und</strong> gesellschaftspolitischer Sicht e<strong>in</strong>e besondere Problemgruppe dar: "Die Adaptierten<br />
repräsentieren häufig die Realität von Ohnmacht <strong>und</strong> gesellschaftlichem Rückzug. Gerade<br />
sie, die sich subjektiv <strong>in</strong> greifbare Mangellagen fügen, werden häufig von den etablierten sozialpolitischen<br />
Maßnahmen nicht erreicht" (Zapf, 1984, S. 26). Unter älteren Menschen f<strong>in</strong>den<br />
sich häufiger als <strong>in</strong> anderen Altersgruppen Menschen, die <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne als „adaptiert“ zu<br />
bezeichnen s<strong>in</strong>d. So wurde <strong>in</strong> der gerontologischen Forschung wiederholt aufgezeigt, dass sich<br />
Bef<strong>und</strong>e zum objektiven Ges<strong>und</strong>heitszustand von den subjektiven E<strong>in</strong>schätzungen der eigenen<br />
Ges<strong>und</strong>heit deutlich unterscheiden (Lehr, 1997). Hohe Zufriedenheitsurteile dürfen also nicht<br />
den Blick für mögliche Situationen des Hilfe- <strong>und</strong> Unterstützungsbedarfs verstellen.<br />
Gleichwohl ist festzuhalten, dass sehr starke Belastungen oder die Kumulation verschiedener<br />
Belastungen sowie gravierende Unterschiede <strong>in</strong> der Lebenslage nicht alle<strong>in</strong> bereichsspezifische<br />
Bewertungen, sondern durchaus auch die Lebenszufriedenheit bee<strong>in</strong>flussen können. In den<br />
vorliegenden Analysen hat sich gezeigt, dass <strong>in</strong>sbesondere Schichtunterschiede sowie ges<strong>und</strong>heitliche<br />
E<strong>in</strong>bußen offensichtlich nicht vollständig durch <strong>in</strong>trapsychische Verarbeitungsmechanismen<br />
abgefedert werden. Unterschiede <strong>in</strong> der materiellen Situation <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Schichtzugehörigkeit<br />
s<strong>in</strong>d offenbar vor allem im mittleren Erwachsenenalter bedeutsam, ges<strong>und</strong>heitliche E<strong>in</strong>bußen<br />
gew<strong>in</strong>nen im höheren Erwachsenenalter an Bedeutung. Wie gezeigt wurde, können bereits<br />
h<strong>in</strong>ter kle<strong>in</strong>en Veränderungen der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit große Veränderungen<br />
<strong>in</strong> den bereichsspezifischen Bewertungen liegen. Letztere s<strong>in</strong>d oftmals verursacht durch Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der objektiven Lebenssituation. Für die Beobachtung gesellschaftlicher Trends<br />
ersche<strong>in</strong>t es daher notwendig, dass auch kle<strong>in</strong>e Unterschiede <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gere Veränderungen im<br />
(allgeme<strong>in</strong>en) subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den registriert <strong>und</strong> Ernst genommen werden.<br />
Es ist das Ziel der Senioren- <strong>und</strong> Sozialpolitik, die Lebensqualität älter werdender <strong>und</strong> alter<br />
Menschen zu wahren. Dazu gehört auch die Beobachtung des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens älter<br />
werdender Menschen. Angesichts des demografischen <strong>Wandel</strong>s <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er hohen (<strong>und</strong> <strong>in</strong> Zukunft<br />
weiter steigenden) Lebenserwartung sollte angestrebt werden, die Lebensqualität von<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Hälfte des Lebens sicherzustellen. Dabei s<strong>in</strong>d anhand des vorliegenden<br />
Kapitels folgende Empfehlungen von besonderer Bedeutung:<br />
Positiven Alternsdiskurs prägen: Die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e zeigen, dass das subjektive<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>sbesondere die Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation, bis <strong>in</strong>s fortgeschrittene<br />
Alter hoch bleibt. Dies ist, gerade angesichts e<strong>in</strong>es nicht selten negativen „Belastungsdiskurses“<br />
<strong>in</strong> den Medien, e<strong>in</strong>e positive <strong>und</strong> optimistische Botschaft. Dieser Bef<strong>und</strong> sollte<br />
zum Anlass genommen werden, den medialen Diskurs über das Alter optimistischer zu gestalten.<br />
Das negative Altersstereotyp trifft offensichtlich nicht das Selbstbild älter werdender <strong>und</strong><br />
alter Menschen. Zugleich sollte dabei jedoch nicht übersehen werden, dass gerade alte <strong>und</strong> sehr<br />
alte Menschen nur selten Unzufriedenheit mit der objektiven Lebenssituation äußern. Der an<br />
sich positiv zu bewertende Bef<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er hohen Lebenszufriedenheit auch im höheren Erwach-<br />
441
442<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
senenalter sollte nicht dazu führen, dass ältere Menschen generell aus dem Blickfeld sozialpolitischer<br />
Wachsamkeit geraten.<br />
Kle<strong>in</strong>e Unterschiede beachten: Offensichtlich müssen Ergebnisse zum subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
mit Bedacht <strong>in</strong>terpretiert werden. Der Indikator „Allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit“ ist im<br />
Durchschnitt auch unter verschiedensten Formen von Lebenslagen häufig recht hoch: Die meisten<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte s<strong>in</strong>d mit sich <strong>und</strong> ihrem Leben zufrieden. Als „Frühwarnsysteme“<br />
der Sozial- <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik s<strong>in</strong>d daher – auf konkrete Lebensbereiche<br />
bezogene – Bewertungs<strong>in</strong>dikatoren sehr viel geeigneter als Informationen über die „allgeme<strong>in</strong>e<br />
Lebenszufriedenheit“. Neben globalen Maßen des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens sollten daher vor<br />
allem bereichsspezifische Bewertungen Beachtung f<strong>in</strong>den, da diese für Unterschiede oder Veränderungen<br />
der Lebenssituation sehr viel sensibler s<strong>in</strong>d als Maße der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit.<br />
Betrachtet man ausschließlich Daten zur Lebenszufriedenheit, so sollten selbst kle<strong>in</strong>e<br />
Unterschiede oder Veränderungen der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit Beachtung f<strong>in</strong>den,<br />
da sie auf erhebliche Unterschiede oder Veränderungen der Lebenssituation h<strong>in</strong>weisen können.<br />
Annäherungen im E<strong>in</strong>igungsprozess würdigen: E<strong>in</strong> hervorzuhebendes, positives Ergebnis ist die<br />
Annäherung zwischen Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland im Ausmaß der Zufriedenheit. Dieser Bef<strong>und</strong><br />
ist e<strong>in</strong>e gute Botschaft: Offensichtlich haben sich nicht alle<strong>in</strong> die objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
von älter werdenden <strong>und</strong> alten Menschen <strong>in</strong> den sechs Jahren zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 angeglichen,<br />
sondern auch die Bewertung der eigenen Lebenssituation. Allerd<strong>in</strong>gs ist dieser Prozess<br />
noch nicht abgeschlossen: Auch im Jahr 2002 f<strong>in</strong>den sich ger<strong>in</strong>ge, aber bedeutsame Unterschiede<br />
<strong>in</strong> der subjektiven Lebensqualität zwischen Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte: Noch<br />
immer ist die Rate zufriedener <strong>und</strong> sehr zufriedener Menschen <strong>in</strong> Ostdeutschland nicht so hoch<br />
wie <strong>in</strong> Westdeutschland. Wenngleich es Erfolge bei der Annäherung „<strong>in</strong> den Köpfen der Menschen“<br />
zu verzeichnen gilt, so ist der Vere<strong>in</strong>igungsprozess auch <strong>in</strong> diesem Bereich der subjektiven<br />
Lebensqualität offensichtlich noch nicht abgeschlossen.<br />
Folgen sozialer Ungleichheit registrieren: Die größten Unterschiede zwischen verschiedenen<br />
Bevölkerungsgruppen zeigten sich h<strong>in</strong>sichtlich der Zugehörigkeit zur sozialen Schicht. Menschen<br />
<strong>in</strong> der Unterschicht <strong>und</strong> der unteren Mittelschicht äußern seltener als Menschen <strong>in</strong> den<br />
gehobenen <strong>und</strong> oberen sozialen Schichten e<strong>in</strong>e hohe Lebenszufriedenheit. Zudem zeigte sich,<br />
dass die Angehörigen der unteren Schichten kaum von dem ansonsten positiven Trend zu höherer<br />
Zufriedenheit <strong>und</strong> positivem Wohlbef<strong>in</strong>den zwischen den Jahren 1996 <strong>und</strong> 2002 profitierten.<br />
Soziale Ungleichheit wirkt sich demnach nicht alle<strong>in</strong> auf die Verteilung von Ressourcen, sondern<br />
auch auf die Verteilung subjektiver Lebensqualität aus. Dies ist umso bedeutsamer als die<br />
hier betrachteten Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte nur noch wenige Chancen haben, ihre<br />
objektive Lebenssituation durch eigene berufliche Aktivitäten nachhaltig zu verändern. Politische<br />
Maßnahmen zur Vermeidung oder Entschärfung sozialer Ungleichheit zielen zwar häufig<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf Verursachungskonstellationen (wie etwa die Erhöhung von Bildungschancen<br />
<strong>in</strong> früheren Lebensabschnitten). Die Begründung solcher Maßnahmen kann aber möglicherweise<br />
auch mit dem Verweis auf die biografischen Folgen sozialer Ungleichheit für die subjektive<br />
Lebensqualität erfolgen.
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
9.8 Literatur<br />
Allardt, E. A. (1993). Hav<strong>in</strong>g, lov<strong>in</strong>g, be<strong>in</strong>g: An alternative to the Swedish model of welfare<br />
research. In M. Nussbaum & A. Sen (Eds.), The quality of life. Oxford: Oxford University<br />
Press.<br />
Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological wellbe<strong>in</strong>g. Chicago: Ald<strong>in</strong>e.<br />
Brandststädter, J. & Greve, W.(1994). The ag<strong>in</strong>g self: Stabiliz<strong>in</strong>g and protective processes. Developmental<br />
Review, 14, 52-80<br />
Brandtstädter, J. & Rotherm<strong>und</strong>, K. (2002). The life-course dynamics of goal pursuit and goal<br />
adjustment: A two-process framework. Developmental Review, 22, 117-150.<br />
Brandtstädter, J., Rotherm<strong>und</strong>, K. & Schmitz, U. (1998). Ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong><strong>in</strong>g self-<strong>in</strong>tegrity and selfefficacy<br />
through adulthood and later life: The adaptive functions of assimilative persistence<br />
and accommodative flexibility. In J. Heckhausen & C. Dweck (Eds.), Motivation<br />
and self-regulation across the life-span (pp. 365-388). New York: Cambrigde University<br />
Press.<br />
Brief, A. P., Butcher, A. H., George, J. M. & L<strong>in</strong>k, K. E. (1993). Integrat<strong>in</strong>g bottom-up and topdown<br />
theories of subjective well-be<strong>in</strong>g: The case of health. Journal of Personality and<br />
Social Psychology, 64, 646-653.<br />
Bulmahn, T. (2002). Globalmaße des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens. In Statistisches B<strong>und</strong>esamt<br />
(Ed.), Datenreport 2002. Zahlen <strong>und</strong> Fakten über die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland (pp.<br />
423-631). Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung.<br />
Bull<strong>in</strong>ger, M. (Ed.). (1997). Lebensqualität. Bedeutung - Anforderung - Akzeptanz. Stuttgart:<br />
Schattauer.<br />
Campbell, A., Converse, P. E. & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: perceptions,<br />
evaluations, and satisfactions. New York: Russel Sage.<br />
Costa, P. T., McCrae, R. R. & Norris, A. H. (1981). Personal adjustment to ag<strong>in</strong>g: Longitud<strong>in</strong>al<br />
prediction from neuroticism and extraversion. Journal of Gerontology, 36, 78-85.<br />
Delhey, J. (2002). Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Europa. In Statistisches B<strong>und</strong>esamt<br />
(Ed.), Datenreport 2002. Zahlen <strong>und</strong> Fakten über die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
(pp. 616-623). Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung.<br />
Diener, E. (1996). Traits can be powerful, but are not enough: lessons from subjective wellbe<strong>in</strong>g.<br />
Journal of Research <strong>in</strong> Personality, 30, 389-399.<br />
Diener, E. (2000). Subjective well-be<strong>in</strong>g. American Psychologist, 55, 34-43.<br />
Diener, E. & Suh, E. M. (1998). Age and subjective well-be<strong>in</strong>g: An <strong>in</strong>ternational analysis. In K.<br />
W. Schaie & L. M. Powell (Eds.), Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Vol.<br />
17: Focus on emotion and adult development (pp. 304-324). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999). Subjective well-be<strong>in</strong>g: Three decades<br />
of progress. Psychological Bullet<strong>in</strong>, 125, 276-302.<br />
443
444<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Easterl<strong>in</strong>, R. A. & Schaeffer, C. M. (1999). Income and subjective well-be<strong>in</strong>g over the life cycle.<br />
In C. D. Ryff & V. Marshall (Eds.), The self and society <strong>in</strong> ag<strong>in</strong>g processes (pp.<br />
279-302). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Erikson, R. (1974). Welfare as a plann<strong>in</strong>g goal. Acta Sociologica, 17, 273-278.<br />
Fahey, T. & Smyth, E. (2004). Do subjective <strong>in</strong>dicators measure welfare? European Societies,<br />
6, 5-27.<br />
Filipp, S.-H. (2002). Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Lebensqualität alter <strong>und</strong> hochbetagter Frauen <strong>und</strong><br />
Männer. In Deutsches Zentrum für Altersfragen (Ed.), Expertisen zum vierten Altenbericht<br />
der B<strong>und</strong>esregierung, Band I: Das hohe Alter - Konzepte, Forschungsfelder, Lebensqualität<br />
(pp. 315-414). Hannover: V<strong>in</strong>centz.<br />
Flora, P., & Noll, H.-H. (Eds.) (1999). Sozialberichterstattung <strong>und</strong> Sozialstaatsbeobachtung.<br />
Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Fooken, I. (2002). Wege <strong>in</strong> die "Lieblosigkeit" Lebensverlaufsmuster <strong>und</strong> seelische Ges<strong>und</strong>heit<br />
bei Männern <strong>und</strong> Frauen im Kontext von Scheidungen oder Trennungen nach langjährigen<br />
Ehen. In M. Peters & J. Kipp (Eds.), Zwischen Abschied <strong>und</strong> Neubeg<strong>in</strong>n (pp. 157-<br />
172). Gießen: Psychosozial.<br />
Habich, R. & Noll, H.-H. (2002). Objektive Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
im vere<strong>in</strong>ten Deutschland. In S. B<strong>und</strong>esamt (Ed.), Datenreport 2002 (pp. 423-631).<br />
Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung.<br />
Herfurth, M., Kohli, M., & Zimmermann, K. F. (2003). Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft<br />
Problembereiche <strong>und</strong> <strong>Entwicklung</strong>stendenzen der Erwerbssituation Älterer. Opladen:<br />
Leske + Budrich<br />
Hollste<strong>in</strong>, B. (2002). Soziale Netzwerke nach der Verwitwung E<strong>in</strong>e Rekonstruktion der Veränderungen<br />
<strong>in</strong>formeller Beziehungen. Opladen: Leske + Budrich.<br />
Keyes, C. L. M. & Ryff, C. D. (1999). Psychological well-be<strong>in</strong>g <strong>in</strong> midlife. In S. L. Willis & J.<br />
D. Reid (Eds.), Life <strong>in</strong> the middle (pp. 161-180). San Diego: Academic Press.<br />
Lachman, M.E. (2001) (Ed.). Handbook of midlife development. New York: Wiley.<br />
Lehr, U. (1997). Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Lebensqualität im Alter. Zeitschrift für Gerontopsychologie<br />
<strong>und</strong> -psychiatrie, 10, 277-287.<br />
Lehr, U. (2003). Psychologie des Alterns (10 ed.). Stuttgart: UTB Quelle & Meyer<br />
Mannell, R. C. & Dupuis, S. (1996). Life satisfaction. In J. E. Birren (Ed.), Encyclopedia of<br />
gerontology (Vol. II: L-Z, pp. 59-64). San Diego: Academic Press.<br />
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.<br />
Mortimer, J.T. & Shanahan, M.S. (Eds.) (2003). Handbook of the Life Course. New York: Kluwer<br />
Academic.<br />
Noll, H.-H. (1997). Sozialberichterstattung: Zielsetzungen, Funktionen <strong>und</strong> Formen. In H.-H.<br />
Noll (Ed.), Sozialberichterstattung <strong>in</strong> Deutschland: Konzepte, Methoden <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
für Lebensbereiche <strong>und</strong> Bevölkerungsgruppen (pp. 7-16). We<strong>in</strong>heim: Juventa.
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Noll, H.-H. (2000). Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität <strong>und</strong> "neue" Wohlfahrtskonzepte.<br />
(No. P00-505). Berl<strong>in</strong>: Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung.<br />
Noll, H. H. & Schöb, A. (2002). Lebensqualität im Alter. In Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
(Ed.), Expertisen zum vierten Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung, Band I: Das hohe<br />
Alter. Konzepte, Forschungsfelder, Lebensqualität (pp. 229-313). Hannover: V<strong>in</strong>centz.<br />
Okun, M. L. (2001). Subjective well-be<strong>in</strong>g. In G. L. Maddox (Ed.), The encyclopedia of ag<strong>in</strong>g<br />
(3 ed., pp. 986-989). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Pavot, W. & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment,<br />
5(2), 164-172.<br />
Schroots, J. J. F. (2003). Life-course dynamics: A research program <strong>in</strong> progress from The Netherlands.<br />
European-Psychologist, 8, 192-199.<br />
Schulz, R., Wrosch, C. & Heckhausen, J. (2003). The life span theory of control: Issues and<br />
evidence. In S. H. Zarit, L. I. Pearl<strong>in</strong> & K. W. Schaie (Eds.), Personal control <strong>in</strong> social<br />
and life course contexts (pp. 233-262). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Schupp, J., Habich, R. & Zapf, W. (1996). Sozialberichterstattung im Längsschnitt: Auf dem<br />
Weg zu e<strong>in</strong>er dynamischen Sicht der Wohlfahrtsproduktion. In W. Zapf, J. Schupp & R.<br />
Habich (Eds.), Lebenslagen im <strong>Wandel</strong>: Sozialberichterstattung im Längsschnitt (pp.<br />
11-45). Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Schwarz, N. & Strack, F. (1991). Evaluat<strong>in</strong>g one's life: A judgment model of subjective wellbe<strong>in</strong>g.<br />
In F. Strack & M. Argyle (Eds.), Subjective well-be<strong>in</strong>g: An <strong>in</strong>terdiscipl<strong>in</strong>ary perspective<br />
(pp. 27-47). Elmsford, NY: Pergamon.<br />
Settersten, R.A. (1999). Lives <strong>in</strong> time and place. The problems and promises of developmental<br />
science. Amityville, NY: Baywood.<br />
Settersten, R. A. (Ed.). (2002). Invitation to the life course: toward new <strong>und</strong>erstand<strong>in</strong>gs of later<br />
life. Amityville, NY: Baywood Publish<strong>in</strong>g.<br />
Smith, J., & Baltes, P. B. (1996). Altern aus psychologischer Perspektive: Trends <strong>und</strong> Profile im<br />
hohen Alter. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 221-<br />
250). Berl<strong>in</strong>: Akademie Verlag.<br />
Smith, J., & Delius, J. (2003). Die längsschnittlichen Erhebungen der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
(BASE): Design, Stichproben <strong>und</strong> Schwerpunkte 1990-2002. In F. Karl (Ed.), Sozial-<br />
<strong>und</strong> verhaltenswissenschaftliche Gerontologie (pp. 225-249). We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Smith, J., Fleeson, W., Geiselmann, B., Settersten, R. & Kunzmann, U. (1996). Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
im hohen Alter: Vorhersagen aufgr<strong>und</strong> objektiver Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektiver<br />
Bewertung. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 497-<br />
523). Berl<strong>in</strong>: Akademie Verlag.<br />
Smith, J., Fleeson, W., Geiselmann, B., Settersten, R. A. J. & Kunzmann, U. (1999). Sources of<br />
well-be<strong>in</strong>g <strong>in</strong> very old age. In P. B. Baltes & K. U. Mayer (Eds.), The Berl<strong>in</strong> Ag<strong>in</strong>g<br />
Study: Ag<strong>in</strong>g from 70 to 100 (pp. 450-471). Cambridge: Cambridge University Press.<br />
445
446<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm<br />
Staud<strong>in</strong>ger, U. M. (2000). Viele Gründe sprechen dagegen <strong>und</strong> trotzdem geht es vielen Menschen<br />
gut: Das Paradox des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>des. Psychologische R<strong>und</strong>schau, 51,<br />
185-197.<br />
Staud<strong>in</strong>ger, U. M., & Bluck, S. (2001). A view on midlife development from life-span theory. In<br />
M. E. Lachman (Ed.), Handbook of midlife development (pp. 3-39). New York: Wiley<br />
Staud<strong>in</strong>ger, U., Fre<strong>und</strong>, A. M., L<strong>in</strong>den, M. & Maas, I. (1996). Selbst, Persönlichkeit <strong>und</strong> Lebensgestaltung<br />
im Alter: Psychologische Widerstandsfähigkeit <strong>und</strong> Vulnerabilität. In K.<br />
U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 321-350). Berl<strong>in</strong>: Akademie<br />
Verlag.<br />
Staud<strong>in</strong>ger, U. M., & L<strong>in</strong>denberger, U. (2003). Understand<strong>in</strong>g human development. Boston:<br />
Kluwer.<br />
Tesch-Römer, C. (1998). Alltagsaktivitäten <strong>und</strong> Tagesstimmung. Zeitschrift für Gerontologie<br />
<strong>und</strong> Geriatrie, 31, 257-262.<br />
Tesch-Römer, C., Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A., Kondratowitz, H.-J. & Tomasik, M. (2003, 21.-26.<br />
November 2003). Welfare state, gender, and age: country specific gender differences <strong>in</strong><br />
health and well-be<strong>in</strong>g. Paper presented at the 55th Annual Scientific Meet<strong>in</strong>g of the Gerontological<br />
Society of America, San Diego, CA.<br />
Veenhoven, R. (2002). Die Rückkehr der Ungleichheit <strong>in</strong> die moderne Gesellschaft? Die Verteilung<br />
der Lebenszufriedenheit <strong>in</strong> den EU-Ländern von 1973 bis 1996. In W. Glatzer, R.<br />
Habich & K. U. Mayer (Eds.), <strong>Sozialer</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> gesellschaftliche Dauerbeobachtung<br />
(pp. 273-293). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Vogel, J. (1999). Der Europäische Wohlfahrtsmix: Institutionelle Konfiguration <strong>und</strong> Verteilungsergebnis<br />
<strong>in</strong> der Europäischen Union <strong>und</strong> Schweden. E<strong>in</strong>e Längsschnitt- <strong>und</strong> vergleichende<br />
Perspektive. In P. Flora & H. H. Noll (Eds.), Sozialberichterstattung <strong>und</strong><br />
Sozialstaatsbeobachtung (pp. 73-109). Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Vogel, J. (2002). Towards a typology of European welfare production. In W. Glatzer, R. Habich<br />
& K. U. Mayer (Eds.), <strong>Sozialer</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> gesellschaftliche Dauerbeobachtung (pp.<br />
229-253). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Watson, D., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures<br />
of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social<br />
Psychology, 54, 1063-1070.<br />
Wenger, G. C., & Jerrome, D. (1999). Change and stability <strong>in</strong> confidant relationships f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs<br />
from the Bangor Longitud<strong>in</strong>al Study of Age<strong>in</strong>g. Journal of Ag<strong>in</strong>g Studies, 13, 269-294<br />
Westerhof, G. J. (2001). Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. In F. Dittmann-Kohli, C.<br />
Bode & G. F. Westerhof (Eds.), Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven<br />
(pp. 77-128). Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Wurm, S. & Tesch-Römer, C. (im Druck). Alter <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. In R. Schwarzer (Ed.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie.<br />
Enzyklopädie der Psychologie. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.
Kapitel 9: Veränderung von subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
Zapf, W. (Ed.). (1977). Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik. <strong>Sozialer</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Wohlfahrtsentwicklung.<br />
Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Zapf, W. (1984). Individuelle Wohlfahrt: Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> wahrgenommene Lebensqualität.<br />
In W. Glatzer & W. Zapf (Eds.), Lebensqualität <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Objektive Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den. (pp. 13-26). Frankfurt/Ma<strong>in</strong>:<br />
Campus.<br />
Zapf, W. & Habich, R. (1996). E<strong>in</strong>leitung. In W. Zapf & R. Habich (Eds.), Wohlfahrtsentwicklung<br />
im vere<strong>in</strong>ten Deutschland. Sozialstruktur, sozialer <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> Lebensqualität (pp.<br />
11-21). Berl<strong>in</strong>: Sigma.<br />
447
Tabelle A9.1: Kohortenvergleich 1996-2002. „Ich b<strong>in</strong> zufrieden mit me<strong>in</strong>em Leben“ (Item 3 der Skala ‚Lebenszufriedenheit’ Pavot & Diener, 1993)<br />
448<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
% % % % % % % % % % % %<br />
1996 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
trifft gar nicht zu Alte Länder 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 1,9 1,4 1,6 1,5 1,1 1,3<br />
Neue Länder 3,2 4,0 3,6 4,2 2,7 3,4 1,1 0,5 0,8 3,3 2,9 3,1<br />
Gesamt 1,4 1,6 1,5 2,4 1,3 1,9 1,7 1,2 1,4 1,9 1,4 1,6<br />
trifft eher nicht zu Alte Länder 5,3 6,6 5,9 6,4 6,7 6,5 4,0 4,5 4,3 5,5 6,1 5,9<br />
Neue Länder 13,1 10,7 11,9 10,9 10,8 10,8 6,2 7,0 6,7 11,4 10,0 10,7<br />
Gesamt 6,8 7,4 7,1 7,2 7,5 7,4 4,3 4,9 4,7 6,6 6,9 6,8<br />
weder/noch Alte Länder 9,6 7,0 8,3 8,2 7,4 7,8 7,2 5,3 6,0 8,7 6,8 7,7<br />
Neue Länder 17,1 13,8 15,5 11,6 8,1 9,8 10,7 8,6 9,4 14,2 10,7 12,4<br />
Gesamt 11,1 8,3 9,7 8,8 7,6 8,2 7,8 5,9 6,6 9,8 7,5 8,6<br />
trifft eher zu Alte Länder 53,1 50,2 51,7 47,6 46,3 47,0 45,1 41,8 43,0 49,9 47,0 48,4<br />
Neue Länder 49,1 53,3 51,2 50,9 52,1 51,5 44,6 47,0 46,2 49,2 51,7 50,5<br />
Gesamt 52,3 50,8 51,6 48,2 47,4 47,8 45,0 42,7 43,6 49,8 47,9 48,8<br />
trifft genau zu Alte Länder 30,9 35,3 33,1 35,9 38,6 37,2 41,9 47,1 45,2 34,4 39,1 36,8<br />
Neue Länder 17,6 18,2 17,9 22,5 26,3 24,4 37,3 36,8 36,9 21,8 24,8 23,4<br />
Gesamt 28,3 31,9 30,1 33,3 36,1 34,7 41,1 45,3 43,8 32,0 36,3 34,2<br />
2002 1948-1962 1933-1947 1917-1932 Gesamt<br />
trifft gar nicht zu Alte Länder 2,7 0,6 1,7 0,6 0,6 0,6 2,6 2,2 2,3 1,9 1,0 1,5<br />
Neue Länder 4,7 2,6 3,6 0,6 0,7 0,7 2,8 2,7 2,7 2,9 1,9 2,4<br />
Gesamt 3,1 1,0 2,1 0,6 0,7 0,6 2,6 2,3 2,4 2,1 1,2 1,6<br />
trifft eher nicht zu Alte Länder 7,5 3,9 5,7 3,8 2,9 3,3 4,2 7,5 6,2 5,6 4,5 5,0<br />
Neue Länder 9,9 7,8 8,9 7,5 4,8 6,1 5,6 7,4 6,8 8,3 6,6 7,4<br />
Gesamt 8,0 4,7 6,4 4,6 3,3 3,9 4,4 7,5 6,3 6,1 4,9 5,5<br />
weder/noch Alte Länder 8,6 6,5 7,6 7,0 7,7 7,3 7,1 8,2 7,8 7,7 7,4 7,5<br />
Neue Länder 10,5 9,7 10,1 9,4 11,6 10,6 3,5 13,5 9,9 9,0 11,3 10,2<br />
Gesamt 9,0 7,2 8,1 7,5 8,5 8,0 6,4 9,3 8,2 8,0 8,2 8,1<br />
trifft eher zu Alte Länder 51,7 50,4 51,1 45,6 43,7 44,6 51,8 40,9 45,1 49,5 45,6 47,5<br />
Neue Länder 52,3 59,1 55,6 50,9 48,6 49,7 49,3 42,6 45,0 51,3 51,3 51,3<br />
Gesamt 51,8 52,2 52,0 46,7 44,7 45,7 51,3 41,2 45,1 49,8 46,8 48,2<br />
trifft genau zu Alte Länder 29,5 38,6 34,0 43,0 45,0 44,1 34,4 41,2 38,6 35,3 41,5 38,6<br />
Neue Länder 22,7 20,8 21,7 31,4 34,2 32,9 38,7 33,8 35,6 28,5 28,7 28,6<br />
Gesamt 28,1 35,0 31,5 40,7 42,8 41,8 35,2 39,8 38,0 34,0 38,9 36,6<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 3.998, gewichtet), Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.767, gewichtet)
Tabelle A9.2: Kohortenvergleich 1996-2002 für die Skala „Lebenszufriedenheit“ (Pavot & Diener, 1993)<br />
1996 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,72 3,83 3,77 3,75 3,79 3,77 3,82 3,82 3,82 3,74 3,81 3,78<br />
Neue Länder 3,36 3,46 3,41 3,49 3,52 3,50 3,69 3,66 3,67 3,45 3,52 3,49<br />
Gesamt 3,65 3,76 3,70 3,70 3,74 3,72 3,80 3,79 3,79 3,69 3,76 3,72<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,77 0,79 0,78 0,85 0,83 0,84 0,82 0,85 0,84 0,81 0,82 0,81<br />
Neue Länder 0,78 0,84 0,81 0,88 0,88 0,88 0,80 0,77 0,78 0,83 0,85 0,84<br />
Gesamt 0,78 0,81 0,80 0,86 0,85 0,85 0,82 0,84 0,83 0,82 0,83 0,83<br />
2002 1948-1962 1933-1947 1917-1932 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,66 3,89 3,78 3,97 3,97 3,97 3,87 3,76 3,80 3,81 3,88 3,85<br />
Neue Länder 3,51 3,65 3,58 3,80 3,80 3,80 3,83 3,70 3,75 3,67 3,72 3,69<br />
Gesamt 3,63 3,84 3,74 3,93 3,93 3,93 3,86 3,75 3,79 3,78 3,85 3,82<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,85 0,74 0,81 0,74 0,77 0,76 0,77 0,91 0,86 0,81 0,80 0,81<br />
Neue Länder 0,83 0,80 0,82 0,75 0,66 0,70 0,76 0,82 0,80 0,80 0,76 0,78<br />
Gesamt 0,85 0,76 0,81 0,75 0,75 0,75 0,77 0,90 0,85 0,81 0,80 0,80<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 4.004, gewichtet), Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.775, gewichtet)<br />
449
Tabelle A9.3: Kohortenvergleich 1996-2002 für die Skala „Positiver Affekt“ (Watson, Clark & Tellegen, 1988)<br />
450<br />
1996 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,45 3,47 3,46 3,31 3,36 3,33 3,06 3,08 3,07 3,34 3,35 3,34<br />
Neue Länder 3,30 3,36 3,33 3,27 3,21 3,24 3,06 2,95 2,99 3,26 3,23 3,24<br />
Gesamt 3,42 3,45 3,43 3,30 3,33 3,32 3,06 3,06 3,06 3,33 3,32 3,33<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,59 0,57 0,58 0,59 0,63 0,61 0,64 0,74 0,70 0,61 0,65 0,63<br />
Neue Länder 0,57 0,58 0,58 0,58 0,60 0,59 0,62 0,71 0,68 0,58 0,63 0,61<br />
Gesamt 0,59 0,58 0,58 0,59 0,62 0,61 0,64 0,73 0,70 0,61 0,65 0,63<br />
2002 1948-1962 1933-1947 1917-1932 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,53 3,62 3,57 3,54 3,49 3,51 3,29 3,25 3,27 3,49 3,48 3,48<br />
Neue Länder 3,51 3,51 3,51 3,51 3,46 3,49 3,32 3,16 3,22 3,48 3,41 3,44<br />
Gesamt 3,53 3,60 3,56 3,53 3,49 3,51 3,29 3,23 3,26 3,49 3,46 3,48<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,58 0,54 0,56 0,53 0,55 0,54 0,63 0,68 0,66 0,58 0,60 0,59<br />
Neue Länder 0,60 0,58 0,59 0,57 0,56 0,56 0,67 0,69 0,68 0,60 0,62 0,61<br />
Gesamt 0,59 0,55 0,57 0,54 0,56 0,55 0,63 0,68 0,66 0,58 0,60 0,59<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 3.867, gewichtet), Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.777, gewichtet)
Tabelle A9.4: Kohortenvergleich 1996-2002 für die Skala „Negativer Affekt“ (Watson, Clark & Tellegen, 1988)<br />
1996 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 2,10 2,27 2,18 2,05 2,15 2,10 1,92 2,06 2,01 2,06 2,18 2,12<br />
Neue Länder 2,10 2,27 2,18 2,07 2,10 2,08 1,91 2,06 2,01 2,06 2,17 2,12<br />
Gesamt 2,10 2,27 2,18 2,06 2,14 2,10 1,92 2,06 2,01 2,06 2,18 2,12<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,51 0,53 0,53 0,52 0,53 0,53 0,56 0,53 0,54 0,53 0,54 0,53<br />
Neue Länder 0,50 0,52 0,52 0,55 0,48 0,51 0,50 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52<br />
Gesamt 0,51 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,55 0,53 0,54 0,53 0,53 0,53<br />
2002 1948-1962 1933-1947 1917-1932 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 2,09 2,16 2,12 1,89 2,01 1,95 1,87 1,93 1,91 1,97 2,05 2,01<br />
Neue Länder 2,00 2,12 2,06 1,91 1,97 1,94 1,83 1,97 1,92 1,94 2,03 1,99<br />
Gesamt 2,07 2,15 2,11 1,89 2,00 1,95 1,87 1,93 1,91 1,97 2,04 2,01<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,60 0,58 0,59 0,52 0,56 0,54 0,53 0,53 0,53 0,57 0,57 0,57<br />
Neue Länder 0,58 0,59 0,59 0,55 0,55 0,55 0,54 0,62 0,59 0,57 0,59 0,58<br />
Gesamt 0,60 0,58 0,59 0,52 0,56 0,54 0,53 0,55 0,54 0,57 0,57 0,57<br />
Quelle: Alterssurvey Basisstichprobe 1996 (n= 3.865, gewichtet), Alterssurvey Replikationsstichprobe 2002 (n= 2.778, gewichtet)<br />
451
Tabelle A9.5: Panelvergleich 1996-2002 für die Skala „Lebenszufriedenheit“ (Pavot & Diener, 1993)<br />
452<br />
1996 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,74 3,80 3,77 3,75 3,84 3,79 3,91 3,97 3,95 3,76 3,85 3,81<br />
Neue Länder 3,38 3,40 3,39 3,51 3,51 3,51 3,82 3,85 3,84 3,48 3,52 3,50<br />
Gesamt 3,67 3,72 3,69 3,70 3,77 3,74 3,90 3,95 3,93 3,71 3,78 3,75<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,76 0,83 0,79 0,84 0,85 0,84 0,70 0,66 0,67 0,78 0,80 0,79<br />
Neue Länder 0,76 0,83 0,79 0,89 0,92 0,90 0,75 0,64 0,67 0,82 0,85 0,83<br />
Gesamt 0,77 0,84 0,81 0,85 0,87 0,86 0,70 0,65 0,67 0,80 0,82 0,81<br />
2002 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,79 3,92 3,85 3,90 3,85 3,88 4,07 3,98 4,01 3,86 3,91 3,89<br />
Neue Länder 3,63 3,57 3,60 3,93 3,79 3,86 3,85 3,62 3,71 3,77 3,66 3,71<br />
Gesamt 3,76 3,85 3,80 3,90 3,84 3,87 4,03 3,92 3,96 3,85 3,86 3,85<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,71 0,69 0,70 0,74 0,77 0,75 0,69 0,70 0,69 0,72 0,72 0,72<br />
Neue Länder 0,77 0,74 0,75 0,82 0,74 0,78 0,63 0,72 0,69 0,78 0,74 0,76<br />
Gesamt 0,72 0,71 0,72 0,76 0,76 0,76 0,68 0,71 0,70 0,74 0,73 0,73<br />
Quelle: Alterssurvey Panel 1996-2002 (n= 1.233, gewichtet)
Tabelle A9.6: Panelvergleich 1996-2002 für die Skala „Positiver Affekt“ (Watson, Clark & Tellegen, 1988)<br />
1996 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,42 3,51 3,47 3,33 3,41 3,37 3,19 3,13 3,15 3,36 3,40 3,38<br />
Neue Länder 3,34 3,30 3,32 3,29 3,28 3,28 3,16 3,13 3,14 3,30 3,27 3,28<br />
Gesamt 3,41 3,47 3,44 3,32 3,38 3,35 3,18 3,13 3,15 3,35 3,37 3,36<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,61 0,56 0,59 0,53 0,67 0,60 0,57 0,66 0,63 0,58 0,64 0,61<br />
Neue Länder 0,52 0,57 0,54 0,61 0,57 0,59 0,63 0,69 0,65 0,57 0,59 0,58<br />
Gesamt 0,59 0,57 0,58 0,54 0,65 0,60 0,57 0,66 0,63 0,58 0,63 0,60<br />
2002 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 3,59 3,65 3,62 3,43 3,46 3,44 3,32 3,42 3,39 3,49 3,54 3,52<br />
Neue Länder 3,48 3,41 3,45 3,44 3,42 3,43 3,21 3,08 3,13 3,43 3,36 3,40<br />
Gesamt 3,57 3,60 3,58 3,43 3,45 3,44 3,30 3,36 3,34 3,48 3,50 3,49<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,50 0,52 0,51 0,58 0,57 0,57 0,52 0,61 0,58 0,54 0,56 0,55<br />
Neue Länder 0,53 0,72 0,63 0,59 0,54 0,56 0,85 0,82 0,82 0,59 0,68 0,64<br />
Gesamt 0,50 0,57 0,54 0,58 0,56 0,57 0,58 0,66 0,63 0,55 0,59 0,57<br />
Quelle: Alterssurvey Panel 1996-2002 (n= 1.252, gewichtet)<br />
453
Tabelle A9.7: Panelvergleich 1996-2002 für die Skala „Negativer Affekt“ (Watson, Clark & Tellegen, 1988)<br />
454<br />
1996 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 2,12 2,25 2,19 2,05 2,10 2,08 1,87 2,01 1,96 2,07 2,15 2,11<br />
Neue Länder 2,07 2,31 2,19 2,01 2,08 2,05 1,90 2,00 1,97 2,03 2,18 2,11<br />
Gesamt 2,11 2,26 2,19 2,05 2,10 2,07 1,88 2,01 1,96 2,06 2,16 2,11<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,48 0,55 0,52 0,47 0,49 0,48 0,49 0,48 0,49 0,48 0,53 0,51<br />
Neue Länder 0,48 0,56 0,53 0,50 0,45 0,47 0,48 0,45 0,46 0,49 0,52 0,51<br />
Gesamt 0,48 0,55 0,53 0,47 0,48 0,48 0,49 0,47 0,48 0,48 0,52 0,51<br />
2002 1942-1956 1927-1941 1911-1926 Gesamt<br />
Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt<br />
Mittelwert Alte Länder 2,02 2,17 2,09 1,89 2,08 1,98 1,83 1,92 1,88 1,95 2,09 2,02<br />
Neue Länder 2,00 2,24 2,13 1,76 2,06 1,91 1,83 2,07 1,99 1,89 2,15 2,03<br />
Gesamt 2,02 2,18 2,10 1,87 2,08 1,97 1,83 1,95 1,90 1,94 2,10 2,02<br />
Standardabweichung Alte Länder 0,49 0,45 0,48 0,49 0,51 0,51 0,52 0,57 0,55 0,50 0,50 0,50<br />
Neue Länder 0,49 0,61 0,56 0,46 0,59 0,55 0,53 0,57 0,56 0,49 0,60 0,56<br />
Gesamt 0,49 0,49 0,49 0,49 0,52 0,51 0,52 0,57 0,55 0,50 0,52 0,52<br />
Quelle: Alterssurvey Panel 1996-2002 (n= 1.243, gewichtet)
10. Die Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländer <strong>in</strong> Deutschland<br />
Helen Krumme & Andreas Hoff<br />
10.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Die mit dem Begriff „Altern der Gesellschaft“ bezeichnete demografische <strong>Entwicklung</strong> beschränkt<br />
sich nicht alle<strong>in</strong> auf deutsche Staatsangehörige – auch unter der <strong>in</strong> Deutschland lebenden<br />
nicht-deutschen Bevölkerung ist der Anteil Älterer <strong>in</strong> den letzten Jahren gestiegen, wobei<br />
die Zuwachsraten <strong>in</strong> dieser Bevölkerungsgruppe sogar höher lagen als <strong>in</strong> der deutschen Bevölkerungsmehrheit<br />
(z.B. Enquete-Kommission, 1998). Nach Daten der Bevölkerungsfortschreibung<br />
des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes nahm die Zahl der älteren Ausländer (60 Jahre <strong>und</strong> älter)<br />
von 1995 bis 2001 um 55,9 Prozent auf 666.850 Personen zu, während gleichzeitig die Gesamtzahl<br />
der ausländischen Bevölkerung leicht zurückg<strong>in</strong>g. Die Zunahme bei den älteren Deutschen<br />
betrug im gleichen Zeitraum lediglich 14,4 Prozent. Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung<br />
zeigen, dass sich diese <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den nächsten Jahren verstärkt fortsetzen wird. So wird<br />
sich nach der mittleren Variante der Modellrechnungen die Zahl der 60-jährigen <strong>und</strong> älteren<br />
Ausländer von 1999 bis 2010 mehr als verdoppeln <strong>und</strong> bis 2030 auf 2,5 Millionen fast verfünffachen<br />
(Adolph, 2001). Bei dieser Prognose sollte allerd<strong>in</strong>gs berücksichtigt werden, dass Vorhersagen<br />
über die <strong>Entwicklung</strong> der ausländischen Bevölkerungsgruppe aufgr<strong>und</strong> von Fluktuation<br />
durch Zu- <strong>und</strong> Abwanderung sowie E<strong>in</strong>bürgerung weniger treffsicher s<strong>in</strong>d als jene, die die<br />
deutsche Bevölkerung betreffen.<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> dieses Alterungsprozesses der ausländischen Bevölkerung, der außer <strong>in</strong> Deutschland<br />
auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen anderen westeuropäischen Ländern zu beobachten ist (vgl. zum Beispiel<br />
Bolzman, Poncioni-Derigo, Vial, & Fibbi, 2004), ist neben den über die Jahre <strong>in</strong>sgesamt gesunkenen<br />
Fertilitätsraten das Immigrationsgeschehen nach dem Zweiten Weltkrieg. So zeigen Daten<br />
zu Nationalität <strong>und</strong> Aufenthaltsdauer, dass es sich bei e<strong>in</strong>em großen Teil der Älteren um<br />
Arbeitsmigranten <strong>und</strong> -migrant<strong>in</strong>nen handelt, die auf der Gr<strong>und</strong>lage von bilateralen Anwerbeabkommen<br />
zwischen 1955 <strong>und</strong> 1973 aus verschiedenen Mittelmeerstaaten <strong>in</strong> die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
kamen <strong>und</strong> entgegen ursprünglich an Rückkehr orientierten Lebensentwürfen <strong>in</strong> Deutschland<br />
blieben (vgl. DZA, 2003) 1 . Die Anwerbepraxis, nach der mehr männliche als weibliche <strong>und</strong><br />
eher jüngere als ältere Arbeitskräfte e<strong>in</strong>gestellt wurden, erklärt auch die sich von der deutschen<br />
Bevölkerungsmehrheit unterscheidende Geschlechts- <strong>und</strong> Altersstruktur der älteren Ausländer.<br />
So f<strong>in</strong>det sich bei den bis 75-jährigen Ausländern e<strong>in</strong> Männerüberschuss. Außerdem s<strong>in</strong>d ältere<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer noch überwiegend "junge Alte": Im Jahr 2001 waren 11,1<br />
1 Die amtliche Statistik (Bevölkerungsfortschreibung, Ausländerzentralregister, Mikrozensus, Zu- <strong>und</strong> Fortzugsstatistik)<br />
erfasst nicht den Migrationsanlass, sondern lediglich – <strong>in</strong> den Datenquellen unterschiedlich differenziert - die<br />
Staatsangehörigkeit bzw. das Herkunftsland sowie die Aufenthaltsdauer.<br />
455
456<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Prozent der <strong>in</strong>sgesamt 7,3 Mio. Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen zwischen 50 <strong>und</strong> 59 Jahre alt,<br />
was <strong>in</strong> etwa dem Anteil dieser Altersgruppe an der deutschen Bevölkerung entspricht (11,9 Prozent).<br />
Im Gegensatz dazu waren nur 9,1 Prozent der ausländischen Bevölkerung 60 Jahre <strong>und</strong><br />
älter während der Anteil dieser Altersgruppe an der deutschen Bevölkerung mit 25,6 Prozent<br />
fast dreimal so hoch lag (Deutsches Zentrum für Altersfragen – Gerostat, 2003).<br />
Die Gruppe der älteren Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen (60 Jahre alt <strong>und</strong> älter) ist h<strong>in</strong>sichtlich<br />
ihrer Nationalität, des Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>s sowie des sozialen <strong>und</strong> rechtlichen Status sehr<br />
heterogen (vgl. auch Dietzel-Papakyriakou & Olbermann, 1998). Insgesamt stellen gegenwärtig<br />
die Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer aus den Anwerbestaaten 2 den zahlenmäßig größten Teil der<br />
heute älteren ausländischen Bevölkerung (vgl. Tabelle 10.1 unten). Ihr Anteil ist <strong>in</strong> den vergangenen<br />
Jahren gestiegen <strong>und</strong> er wird weiter zunehmen (vgl. BMFSFJ, 2000). Neben den Arbeitsmigranten<br />
<strong>und</strong> -migrant<strong>in</strong>nen aus den Anwerbeländern gehören dieser Bevölkerungsgruppe<br />
aber auch Ältere aus Anra<strong>in</strong>erstaaten wie Österreich, Niederlande <strong>und</strong> Polen an, die zum Teil<br />
schon lange <strong>in</strong> Deutschland leben: 2,6 Prozent der 50 bis 64-Jährigen <strong>und</strong> 7,6 Prozent der 65-<br />
Jährigen <strong>und</strong> Älteren wurden <strong>in</strong> Deutschland geboren <strong>und</strong> behielten ihre ausländische Staatsangehörigkeit.<br />
Zehn Prozent der 50 bis 64-Jährigen <strong>und</strong> 14,4 Prozent der 65-Jährigen <strong>und</strong> Älteren<br />
reisten <strong>in</strong> den vergangenen 10 Jahren e<strong>in</strong> (DZA, 2003). Darunter s<strong>in</strong>d auch Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>und</strong> Asylbewerber<br />
aus Nicht-EU-Staaten. Unter den heute Asylsuchenden s<strong>in</strong>d Ältere allerd<strong>in</strong>gs unterrepräsentiert<br />
(vgl. Dietzel-Papakyriakou & Olbermann, 1998).<br />
Tabelle 10.1:<br />
Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung (60 Jahre <strong>und</strong> älter) <strong>in</strong> Deutschland<br />
nach Staatsangehörigkeit (Stand: 31.12.2002)<br />
Staatsangehörigkeit Anteil (<strong>in</strong> Prozent) Anzahl<br />
Gesamt 100,0 711.000<br />
Türkei 24,8 176.100<br />
Ehem. Jugoslawien 15,5 110.000<br />
Italien 9,8 69.900<br />
Griechenland 7,5 53.100<br />
Ehem. Sowjetunion 7,1 50.700<br />
Andere 35,3 251.000<br />
Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2002, Tab. 6, S. 22ff.<br />
Der Anteil der Älteren an den Kriegsflüchtl<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> Kont<strong>in</strong>gentflüchtl<strong>in</strong>gen der letzten Jahre<br />
ist dagegen größer. Das liegt daran, dass die Migration <strong>in</strong> den letzten Jahren häufig im Familienverband<br />
stattfand. Unter den Älteren, die erst <strong>in</strong> den vergangenen Jahren immigriert s<strong>in</strong>d,<br />
f<strong>in</strong>den sich außerdem hilfe- oder pflegebedürftige Eltern, die von ihren K<strong>in</strong>dern für die Versorgung<br />
nach Deutschland geholt wurden (vgl. BMFSFJ, 2000). Des weiteren gehören zur Gruppe<br />
2 Darunter bef<strong>in</strong>den sich neben den Arbeitsmigranten <strong>und</strong> -migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> ihren Ehepartnern bzw. -partner<strong>in</strong>nen<br />
auch Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>und</strong> anerkannte Asylbewerber.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
der älteren Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen ehemalige Kriegsgefangene, ehemalige Mitglieder<br />
von <strong>in</strong> Deutschland stationierten ausländischen Streitkräften sowie Spätaussiedler, die nicht<br />
anerkannt wurden <strong>und</strong> daher nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, aber e<strong>in</strong>e Aufenthaltserlaubnis<br />
bekamen (vgl. Hamburg, 1998). E<strong>in</strong>gebürgerte <strong>und</strong> als Aussiedler bzw. Spätaussiedler<br />
anerkannte Personen gehören rechtlich nicht zu den Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern (vgl. H<strong>in</strong>richs,<br />
2003), auch wenn sie als Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Migranten mit all jenen, die nicht <strong>in</strong> Deutschland<br />
geboren wurden, e<strong>in</strong>e Migrationsbiografie teilen.<br />
Die soziale Bedeutung der oben beschriebenen demografischen <strong>Entwicklung</strong> des Alterns der<br />
ausländischen Bevölkerung wurde <strong>in</strong> den vergangenen Jahren zunehmend erkannt (z.B. Dietzel-<br />
Papakyriakou, 1993; Olbermann, 1993; Schulte, 1995; Eggen, 1997; Naegele & Olbermann,<br />
1997; Mart<strong>in</strong>ez & Avgoustis, 1998; Dietzel-Papakyriakou & Olbermann, 1998; Schneiderhe<strong>in</strong>z,<br />
1998; Kulbach, 1999; Tufan, 1999; BMFSFJ, 1999; 2000; 2001; DZA, 2003). Seit Ende der<br />
1980er Jahre wurden zunächst die Wohlfahrtsverbände <strong>und</strong> Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsdienste<br />
verstärkt auf die Probleme der älter werdenden Arbeitsmigranten aufmerksam. Ab Anfang der<br />
1990er Jahre beschäftigten sich auch die Sozialwissenschaften mit dem Thema, vorrangig mit<br />
praxisbezogenen Fragestellungen beispielsweise zur Lebenssituation oder der Versorgung im<br />
Pflegefall. So gibt es <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>e Reihe von Studien, die verschiedene Lebensbereiche der<br />
älteren Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen bzw. Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen untersuchen (vgl. die<br />
Überblicke bei Zoll, 1997 <strong>und</strong> Söhn, 2000). Sie s<strong>in</strong>d meist <strong>in</strong> enger Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden<br />
<strong>und</strong> zum Teil als Auftragsforschung der (b<strong>und</strong>es-)politischen Institutionen entstanden.<br />
Die Studien setzen zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte, be<strong>in</strong>halten <strong>in</strong>sgesamt aber<br />
alle ähnliche Fragen zu den zentralen Lebensbereichen älterer Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen.<br />
Diese beschränken sich fast ausschließlich auf die Nationalität der angeworbenen Arbeitsmigranten<br />
<strong>und</strong> -migrant<strong>in</strong>nen. Aufgr<strong>und</strong> des Erkenntnis<strong>in</strong>teresses, das sich überwiegend an den<br />
neuen Anforderungen an die Sozialpolitik <strong>und</strong> Sozialen Dienste orientiert, ist das Analyseziel<br />
lediglich e<strong>in</strong>e Deskription der Ergebnisse.<br />
Vier größere Studien s<strong>in</strong>d hervorzuheben, auf deren Ergebnisse sich die verschiedenen Veröffentlichungen<br />
zu dem Thema der älteren Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> der Regel stützen: E<strong>in</strong>e<br />
erste Studie mit <strong>in</strong> Deutschland lebenden älteren Türken <strong>und</strong> Italienern wurde 1991 vom Zentrum<br />
für Türkeistudien im Auftrag des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Arbeit <strong>und</strong> Sozialforschung<br />
durchgeführt (Zentrum für Türkeistudien, 1992). Befragt wurden etwa 200 Personen <strong>in</strong> Duisburg,<br />
Köln <strong>und</strong> München zu ihrer Migrationsbiografie, der aktuellen Lebenssituation <strong>und</strong> ihren<br />
Zukunftsplänen. E<strong>in</strong>e andere Studie, die von 1993 bis 1995 <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen als Panelbefragung<br />
durchgeführt wurde, hatte neben der Erhebung von Daten zur Lebenssituation, die<br />
Evaluierung bestehender Angebote der Altenhilfe, sowie die <strong>Entwicklung</strong>, Erprobung <strong>und</strong> Evaluierung<br />
neuer gruppenspezifischer Konzepte für die Sozialen Altendienste zur Aufgabe. Etwa<br />
100 Personen (Herkunftsländer: Spanien, Griechenland, ehemaliges Jugoslawien, Türkei) wurden<br />
im Auftrag des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung unter Zusammenarbeit<br />
mit drei großen Wohlfahrtsverbänden untersucht (Olbermann & Dietzel-Papakyriakou, 1995).<br />
E<strong>in</strong>e weitere größere Untersuchung zur sozialen Lage ältere Migranten, an der 320 Ältere italienischer,<br />
jugoslawischer, portugiesischer <strong>und</strong> spanischer Nationalität teilnahmen, war Inhalt e<strong>in</strong>es<br />
studentischen Studienprojektes <strong>in</strong> Essen <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit dem dortigen Caritasverband<br />
(Zoll, 1997). Die bisher größte Studie zum Thema wurde 1998 <strong>in</strong> Hamburg vom Senat <strong>in</strong><br />
457
458<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Auftrag gegeben <strong>und</strong> mit etwa 1000 Älteren der <strong>in</strong> Hamburg am häufigsten vertretenen ausländischen<br />
Nationalitäten durchgeführt (Hamburg, 1998). Anfang der 1990er Jahre erhobene Daten<br />
zur Lebens- <strong>und</strong> Wohnsituation deutscher Älterer wurden hier zum Teil zu Vergleichszwecken<br />
herangezogen. Dies ist zugleich die bisher e<strong>in</strong>zige Untersuchung, die e<strong>in</strong>en Vergleich mit der<br />
gleichaltrigen e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerung ermöglicht. Diese Daten waren e<strong>in</strong>ige Jahre früher<br />
erhoben worden.<br />
Die Ergebnisse der oben genannten Untersuchungen stimmen weitgehend übere<strong>in</strong>. So wird bei<br />
den Migranten aus den Anwerbeländern auf den auf Rückkehr ausgerichteten Lebensentwurf<br />
h<strong>in</strong>gewiesen (Rückkehrorientierung). Als Gründe für die faktische Niederlassung <strong>in</strong> Deutschland<br />
werden u.a. die familiären B<strong>in</strong>dungen an Deutschland, das bessere Ges<strong>und</strong>heitssystem <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>e Entfremdung vom Herkunftskontext genannt. Dennoch besteht bei vielen Älteren weiterh<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong> Wunsch nach Rückkehr. Über die Zahl der tatsächlichen Rückkehrer liegen jedoch wenig<br />
Informationen vor. Rückkehrwillige s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den <strong>in</strong> Deutschland durchgeführten Untersuchungen<br />
unterrepräsentiert. Als Alternative zu Verbleib bzw. Heimkehr f<strong>in</strong>det sich bei e<strong>in</strong>er großen Zahl<br />
von älteren Migranten die Vorstellung oder bereits dessen Ausführung, zwischen Herkunftsland<br />
<strong>und</strong> Deutschland zu pendeln (vgl. auch Dietzel-Papakyriakou, 1999; Krumme, 2004).<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der materiellen Lage wurde <strong>in</strong> diesen Studien auf überwiegend unterdurchschnittliche<br />
Rentene<strong>in</strong>kommen der ausländischen Älteren h<strong>in</strong>gewiesen. Sie s<strong>in</strong>d Resultat der ger<strong>in</strong>geren<br />
Beitragszeiten, der niedrigen Rentenbeiträge aus un- <strong>und</strong> niedrigqualifizierten Beschäftigungen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>em häufig früheren krankheitsbed<strong>in</strong>gten Austritt aus dem Erwerbsleben. Die besonders<br />
schweren Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen der „Gastarbeiter“, sowie psychische Belastungen durch die<br />
Migrationssituation werden auch als Erklärungsfaktoren für den von e<strong>in</strong>em Großteil der Älteren<br />
genannten schlechten persönlichen Ges<strong>und</strong>heitszustand angeführt. E<strong>in</strong> unterdurchschnittlicher<br />
Wohnstandard <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Integration, u.a. aufgr<strong>und</strong> mangelhafter Deutschkenntnisse, s<strong>in</strong>d<br />
weitere Charakteristika der älteren ausländischen Bevölkerung. Die Familienbeziehungen zeigen<br />
sich <strong>in</strong> den meisten Fällen als eng, Mehrgenerationenhaushalte s<strong>in</strong>d jedoch nicht die dom<strong>in</strong>ante<br />
Haushaltskonstellation.<br />
Kennzeichnend für die bisherige Datenlage ist, dass die wenigen Studien zu älteren Migranten<br />
bzw. Ausländern mit relativ ger<strong>in</strong>gen Fallzahlen nur regional begrenzt durchgeführt wurden <strong>und</strong><br />
Repräsentativität nicht oder nur für sehr spezifische Gr<strong>und</strong>gesamtheiten beansprucht werden<br />
kann. Vorliegende b<strong>und</strong>esweite Surveys der Sozialberichterstattung dagegen umfassen häufig<br />
nur Deutsche. Ausnahmen bilden der Mikrozensus, der allerd<strong>in</strong>gs nur sehr spezifische amtliche<br />
Daten zu ausländischen Haushalten zur Verfügung stellt, <strong>und</strong> das Sozioökonomische Panel<br />
(SOEP), das mit e<strong>in</strong>er eigenen Ausländerstichprobe repräsentative Aussagen über bestimmte<br />
Nationalitätengruppen für das gesamte B<strong>und</strong>esgebiet zulässt. Daneben gibt es bisher ke<strong>in</strong>e für<br />
ganz Deutschland repräsentativen Daten zu älteren Ausländern. Die Datenlage für die Beschreibung<br />
ihrer Lebensumstände im Rahmen der nationalen Sozialberichterstattung gilt daher als<br />
äußerst schlecht (vgl. Adolph, 2001). Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> wurde im Jahr 2002 zeitgleich<br />
mit der Panel- <strong>und</strong> der Replikationsstichprobe der zweiten Welle des Alterssurveys e<strong>in</strong>e sogenannte<br />
Ausländerstichprobe gezogen, welche die 40- bis 85-jährigen Nicht-Deutschen <strong>in</strong><br />
Deutschland berücksichtigt. Erstmals liegen damit deutschlandweite Daten vor, die e<strong>in</strong>e umfassende<br />
Untersuchung der "zweiten Lebenshälfte", also des mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalters<br />
der Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit ermöglichen.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Dieses Kapitel verfolgt das Ziel, die Lebenssituation der heute <strong>und</strong> <strong>in</strong> absehbarer Zukunft älteren<br />
Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit zu untersuchen <strong>und</strong> mit den Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
der gleichaltrigen deutschen Wohnbevölkerung zu vergleichen. Die Datenbasis für diesen<br />
Vergleich bilden die Ausländerstichprobe <strong>und</strong> die Replikationsstichprobe des Alterssurveys<br />
2002. Die Analyse leistet e<strong>in</strong>en Beitrag sowohl zur Alterssozialberichterstattung als auch zur<br />
sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Alternsforschung. Sie ist dabei primär deskriptiv <strong>und</strong><br />
thematisch breit angelegt (mehr dazu im E<strong>in</strong>leitungskapitel 1 des vorliegenden Berichts).<br />
Drei Konzepte bilden den theoretischen Rahmen. Das Konzept der Lebensqualität ist e<strong>in</strong> zentraler<br />
Aspekt der theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen des Alterssurvey (vgl. Kapitel 1 des vorliegenden Bandes<br />
sowie Kohli, Künem<strong>und</strong>, Motel, & Szydlik, 2000; Tesch-Römer, Wurm, Hoff, & Engstler,<br />
2002; Hoff, Tesch-Römer, Wurm, & Engstler, 2003). Individuelle Wohlfahrt wird hier als<br />
Konstellation von objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> subjektivem Wohlbef<strong>in</strong>den def<strong>in</strong>iert <strong>und</strong><br />
operationalisiert. Ziel ist dementsprechend die Untersuchung des Niveaus <strong>und</strong> der Verteilung<br />
der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Wohlfahrt bzw. Lebensqualität <strong>und</strong> gruppenspezifischer Wohlfahrtslagen.<br />
Neben der Wohlfahrtsmessung verfolgt der Alterssurvey die Frage nach Formen von Vergesellschaftung<br />
der Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte (vgl. Kohli et al., 2000; Hoff et al., 2003).<br />
Soziale Beziehungen, konsumtive oder produktive Tätigkeiten <strong>und</strong> Partizipation des Individuums<br />
<strong>in</strong> verschiedenen Bereichen der Gesellschaft (Staat, Markt, Zivilgesellschaft, Familie)<br />
s<strong>in</strong>d demnach nicht nur h<strong>in</strong>sichtlich ihres Beitrages zur Wohlfahrt des Individuums von Relevanz,<br />
sondern auch <strong>in</strong> Bezug auf den Grad se<strong>in</strong>er sozialen E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung (Integration). Dieser<br />
Aspekt ist von besonderem Interesse für Menschen, die mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben<br />
e<strong>in</strong>en wichtigen Bereich der Vergesellschaftung verlassen oder auch für Migranten, die<br />
nach erfolgter Migration auf e<strong>in</strong>e ihnen fremde Gesellschaft treffen.<br />
Das dritte Rahmenkonzept des Alterssurveys bezieht sich auf den Aspekt der Integration der<br />
Zugewanderten <strong>in</strong> die verschiedenen Bereiche der Ankunftsgesellschaft. Soziale Integration<br />
stellt neben Wanderungstheorien e<strong>in</strong>en zentralen Bereich der Migrationsforschung dar (vgl.<br />
Han, 2000; Treibel, 2003). Wichtige Beiträge stammen beispielsweise von Hoffmann-Nowotny<br />
(1973), der „Integration“ als die Partizipation der Zuwanderer an der Statusstruktur (berufliche<br />
Stellung, E<strong>in</strong>kommen, Bildung, rechtliche Stellung, Wohnen) def<strong>in</strong>iert (Hoffmann-Nowotny,<br />
1973: 171). Esser (1980) spricht von „kultureller, struktureller, sozialer <strong>und</strong> identifikativer Assimilation“<br />
<strong>und</strong> me<strong>in</strong>t „e<strong>in</strong>en Zustand der Ähnlichkeit des Wanderers <strong>in</strong> Handlungsweisen, Orientierungen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>teraktiver Verflechtung zum Aufnahmesystem“ (Esser, 1980: 22). Gegen-<br />
stand dieser Ansätze s<strong>in</strong>d Deskription <strong>und</strong> Erklärung von strukturellen Unterschieden zwischen<br />
Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>heimischen.<br />
Die zentrale Frage der vorliegenden Analyse ist, ob es Unterschiede h<strong>in</strong>sichtlich der Wohlfahrtslage<br />
<strong>und</strong> den Vergesellschaftungsformen zwischen älteren Menschen nichtdeutscher <strong>und</strong><br />
deutscher Staatsangehörigkeit gibt. E<strong>in</strong>e Hypothese lautet, dass Menschen ausländischer Herkunft<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer Migrationsbiografie <strong>und</strong> der diskrim<strong>in</strong>ierenden Lebensumstände <strong>in</strong> der<br />
Ankunftsgesellschaft e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Vergesellschaftungsgrad aufweisen <strong>und</strong> ihre Lebensumstände<br />
von ger<strong>in</strong>gerer Lebensqualität gekennzeichnet s<strong>in</strong>d. Dies postuliert beispielsweise die <strong>in</strong><br />
den Vere<strong>in</strong>igten Staaten entwickelte <strong>und</strong> <strong>in</strong>zwischen kritisch diskutierte These der „double jeopardy“<br />
(vgl. Prahl & Schroeter, 1996), nach der ältere Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen bzw. Ange-<br />
459
460<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
hörige ethnischer M<strong>in</strong>derheiten als Mitglieder der Altenpopulation e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> der ethnischen<br />
M<strong>in</strong>derheit andererseits doppelt belastet <strong>und</strong> benachteiligt s<strong>in</strong>d. Als Gegenhypothese zu dieser<br />
Defizitperspektive ließe sich erstens formulieren, dass die Ausländer- <strong>und</strong> Migrantenpopulation<br />
sehr heterogen ist. Der Vergleich mit der e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerung erfordert dementsprechend<br />
e<strong>in</strong>e differenziertere Herangehensweise. Zweitens könnte aus e<strong>in</strong>er Ressourcenperspektive<br />
angenommen werden, dass die Lebensqualität <strong>und</strong> der Vergesellschaftungsgrad bei älteren<br />
Nichtdeutschen bzw. Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen größer ist, da sie über bestimmte migrations-<br />
oder kulturbed<strong>in</strong>gte Ressourcen verfügen, auf die E<strong>in</strong>heimische nicht zurückgreifen können<br />
(vgl. BMFSFJ, 2001)<br />
Abschließend soll <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>leitung kurz auf die verwendete Term<strong>in</strong>ologie e<strong>in</strong>gegangen werden.<br />
Der Begriff „Ausländer<strong>in</strong>“ bzw. „Ausländer“ wird heutzutage außerhalb von rechtlichen <strong>und</strong><br />
statistischen Kontexten aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er stereotypisierenden <strong>und</strong> diskrim<strong>in</strong>ierenden Konnotation<br />
weitgehend vermieden. So wird beispielsweise <strong>in</strong> der Literatur zu älteren Menschen ausländischer<br />
Herkunft fast ausschließlich <strong>und</strong> zum Teil synonym von „Migranten“ bzw. „Migrant<strong>in</strong>nen“<br />
gesprochen (siehe dazu auch Dietzel-Papakyriakou & Olbermann, 1998; BMFSFJ, 1999).<br />
Im vorliegenden Kapitel werden beide Begriffe <strong>in</strong> ihrer ursprünglichen Bedeutung gebraucht.<br />
Die Begriffe „Ausländer“ bzw. „Nichtdeutsche“ verweisen auf e<strong>in</strong>e Unterscheidung auf Gr<strong>und</strong>lage<br />
der formalen Staatsangehörigkeit. Sie bezeichnen die Menschen mit ausschließlich ausländischer<br />
Staatsangehörigkeit (vgl. H<strong>in</strong>richs, 2003: 5), welche die Gr<strong>und</strong>gesamtheit der Ausländerstichprobe<br />
des Altersurveys bildet. Als „Migranten“ oder „Zuwanderer“ werden h<strong>in</strong>gegen<br />
die Menschen bezeichnet, die bisher m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal ihren Lebensmittelpunkt für e<strong>in</strong>e nicht<br />
unerhebliche Zeitdauer von e<strong>in</strong>em Land <strong>in</strong> e<strong>in</strong> anderes (<strong>in</strong> diesem Fall Deutschland) verlegt<br />
haben (vgl. Treibel, 2003: 21).<br />
Das Kapitel ist folgendermaßen gegliedert: Im folgenden Abschnitt wird zunächst e<strong>in</strong>e umfassende<br />
Beschreibung der Ausländerstichprobe vorgenommen. Im Anschluss daran folgen die<br />
Ergebnisse themenspezifischer deskriptiver Analysen. Zur Beschreibung der Lebenssituation<br />
wurden folgende Themenbereiche ausgewählt: die materielle Lage, e<strong>in</strong>schließlich E<strong>in</strong>kommen<br />
<strong>und</strong> Wohnsituation (Unterkapitel 3), Ges<strong>und</strong>heit (Unterkapitel 4), gesellschaftliche Partizipation<br />
(Unterkapitel 5), <strong>in</strong>tergenerationale Familienbeziehungen (Unterkapitel 6) <strong>und</strong> soziale Unterstützung<br />
(Unterkapitel 7). Abschließend werden die zentralen Ergebnisse dieser Analysen <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em achten Abschnitt zusammengefasst.<br />
10.2 Stichprobenbeschreibung<br />
10.2.1 Datenbasis<br />
Die Ausländerstichprobe wurde mit dem Ziel erhoben, e<strong>in</strong>e Datenbasis für die Analyse der Lebensumstände<br />
der nicht-deutschen Bevölkerung im Alter von 40 bis 85 Jahren bereitzustellen.<br />
Zielgruppe s<strong>in</strong>d die Personen, die nur e<strong>in</strong>e ausländische Staatsangehörigkeit haben. Personen,<br />
die über die deutsche oder e<strong>in</strong>e deutsche <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e weitere Staatsangehörigkeit verfügen („Doppelstaatler“)<br />
wurden der Replikationsstichprobe zugeordnet. Maßgebend war dabei die Informa-
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
tion der E<strong>in</strong>wohnermeldeämter über das Vorhandense<strong>in</strong> oder Fehlen e<strong>in</strong>er deutschen Staatsangehörigkeit.<br />
Für die ausländische Bevölkerungsgruppe wurden die gleichen Fragebögen <strong>in</strong> deutscher<br />
Sprache e<strong>in</strong>gesetzt wie <strong>in</strong> der Replikationsstichprobe, so dass die Gr<strong>und</strong>gesamtheit der<br />
Ausländerstichprobe als „Nichtdeutsche Personen <strong>in</strong> Privathaushalten im Alter von 40 bis 85<br />
Jahren, die der deutschen Sprache mächtig s<strong>in</strong>d“ zu def<strong>in</strong>ieren ist.<br />
Aufgr<strong>und</strong> des zum Teil sehr ger<strong>in</strong>gen Anteils von Nichtdeutschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Stichprobenzellen<br />
des für die Replikationsstichprobe verwendeten Stichprobenplans (vor allem <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
<strong>und</strong> bei den Hochaltrigen) wurde die Ausländerstichprobe proportional, d.h. ohne Schichtung<br />
erhoben. Die Auswahl der Bruttostichprobe erfolgte durch Zufallsziehung aus den Registern der<br />
E<strong>in</strong>wohnermeldeämter. Aus zunächst 60.000 gezogenen Adressen ergaben sich 3.255 Adressen<br />
von Personen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit. Nach Abzug der neutralen<br />
<strong>und</strong> systematischen Ausfälle konnten 628 Interviews geführt werden, von denen 588 auswertbar<br />
waren. Mit der Nacherhebung des Jahrgangs 1962 konnten diese um fünf weitere auswertbare<br />
Interviews ergänzt werden, so dass <strong>in</strong>sgesamt 593 Interviews zur Auswertung vorlagen. Bei der<br />
Realisierung der Interviews gab es drei zentrale Problemfelder, die maßgeblich zu der ger<strong>in</strong>gen<br />
Ausschöpfungsquote der realisierten (26,8 Prozent) <strong>und</strong> der auswertbaren (25,1 Prozent) Interviews<br />
beitrugen. Erstens war die Qualität der Adressen deutlich schlechter als bei der Replikationsstichprobe.<br />
Zweitens verfügten 10 Prozent der Zielpersonen aus der Bruttostichprobe nicht<br />
über ausreichende Deutschkenntnisse, um an dem Interview teilzunehmen 3 . Drittens war die<br />
Erreichbarkeit der nichtdeutschen Zielpersonen deutlich schwieriger als bei den deutschen Zielpersonen.<br />
Die Teilnahmebereitschaft der erreichten Zielpersonen war jedoch besser als <strong>in</strong> der<br />
Replikationsstichprobe (<strong>in</strong>fas, 2003; vgl. auch die Ausführungen zur Stichprobenziehung <strong>in</strong><br />
Kapitel 2 des vorliegenden Berichts).<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf die Staatsangehörigkeit zeigten sich bei der Datenbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er nicht<br />
unerheblichen Zahl von Fällen Inkonsistenzen zwischen den von <strong>in</strong>fas verwendeten Informationen<br />
der E<strong>in</strong>wohnermeldeämter, auf denen die Stichprobenzuordnung beruht 4 , <strong>und</strong> der Eigenangabe<br />
der befragten Personen. Auf die Frage „Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?“ (Frage<br />
329), antworteten 90 Personen (15,2 Prozent) der Ausländerstichprobe, ausschließlich über e<strong>in</strong>e<br />
deutsche Staatsangehörigkeit zu verfügen. Aus der Ausländerstichprobe gaben 31 Personen (5,2<br />
Prozent) mehr als e<strong>in</strong>e Staatsangehörigkeit an, s<strong>in</strong>d demnach also Doppelstaatler. Die Ursache<br />
für diese Inkonsistenz konnte nicht geklärt werden. Verschiedene Fehlerquellen s<strong>in</strong>d denkbar.<br />
So könnte es sich um subjektive Divergenzen des befragten Individuums zu se<strong>in</strong>er offiziellen<br />
Staatsangehörigkeit handeln, um Fehler bei der Stichprobenzuordnung auf Gr<strong>und</strong>lage der, von<br />
3 Es gibt ke<strong>in</strong>e amtlichen Daten oder Informationen zu den Deutschkenntnissen der nichtdeutschen Bevölkerung, die<br />
H<strong>in</strong>weise darauf geben könnten, <strong>in</strong> welchem Ausmaß dieser Ausfall <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene Selektivität die Repräsentativität<br />
der Stichprobe tatsächlich schmälert. Nach Daten des Sozioökonomischen Panels schätzen 7 Prozent<br />
der Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer im Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren ihre mündlichen Deutschkenntnisse als eher<br />
schlecht e<strong>in</strong> <strong>und</strong> 9 Prozent geben an, gar ke<strong>in</strong> Deutsch sprechen zu können. Als „es geht“ beurteilen 36 Prozent<br />
ihre mündlichen deutschen Sprachkenntnisse – 23 Prozent bezeichnen sie als „sehr gut“, 25 Prozent als „gut“ (Eigene<br />
Berechnung, SOEP 2001, gewichtet).<br />
4 Sofern dem E<strong>in</strong>wohnermeldeamt ke<strong>in</strong>e Angabe zur Staatsangehörigkeit vorlag, erfolgte die Zuordnung anhand der<br />
Angabe des Interviewers im Fragebogen.<br />
461
462<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
den Meldeämtern gelieferten, Adressen oder um e<strong>in</strong>e nicht korrekte, möglicherweise nicht aktuelle<br />
Registration der Staatsangehörigkeit bei der zuständigen Meldebehörde. Auch der zeitliche<br />
Abstand zwischen Stichprobenziehung <strong>und</strong> Interviewdurchführung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> diesem Zeitraum<br />
erfolgte E<strong>in</strong>bürgerung könnte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Fällen dazu geführt haben, dass die Stichprobenzuordnung<br />
<strong>und</strong> die Selbstangabe der befragten Person nicht übere<strong>in</strong>stimmen. Zur Überprüfung der<br />
Plausibilität der Eigenangabe wurden Indikatoren aus dem Interview herangezogen, die Aufschluss<br />
über das Vorliegen e<strong>in</strong>er deutschen Staatsangehörigkeit geben können (e<strong>in</strong>e nähere Beschreibung<br />
des Auswahlprozesses f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Kapitel 2 des vorliegenden Berichts). Im Ergebnis<br />
dieser sorgfältigen Prüfung wurden sieben Personen aus der Ausländerstichprobe ausgeschlossen,<br />
bei denen mit e<strong>in</strong>iger Sicherheit davon ausgegangen werden konnte, dass es sich um<br />
Deutsche handelt. Nach Ausschluss dieser Personen liegt die Gesamtzahl der auswertbaren Interviews<br />
somit bei 586. Die vorliegende Ausländerstichprobe weist daher erstens aufgr<strong>und</strong> der<br />
relativ hohen Zahl unplausibler Fälle <strong>in</strong> der Staatsangehörigkeit <strong>und</strong> zweitens mit der Selektivität<br />
aufgr<strong>und</strong> der für das Interview erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse Besonderheiten<br />
auf, die bei der Datenauswertung <strong>und</strong> -<strong>in</strong>terpretation berücksichtigt werden müssen. E<strong>in</strong> Vergleich<br />
der Verteilungen zentraler Merkmale <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe mit dem Mikrozensus<br />
2002 zeigt dennoch große Übere<strong>in</strong>stimmungen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass<br />
die Ausländerstichprobe die Bevölkerungsgruppe der nichtdeutschen Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte dennoch relativ gut repräsentiert (vgl. Tabelle 10.2).<br />
Tabelle 10.2:<br />
Verteilung ausgewählter Merkmale <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe <strong>und</strong><br />
im Mikrozensus 2002 (Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Ausländerstichprobe Mikrozensus 2002 1<br />
Alter:<br />
40 – 54 59,2 59,2<br />
55 – 69 32,1 34,7<br />
70 – 85 (70+) 8,7 6,1 2<br />
Geschlecht:<br />
Männlich 52,0 54,0<br />
Weiblich 48,0 46,0<br />
Landesteil:<br />
West 93,7 97,4<br />
Ost 6,3 2,6<br />
Familienstand:<br />
Ledig 5,8 6,3<br />
Verheiratet 78,0 80,4<br />
geschieden, verwitwet 16,2 13,4<br />
Erwerbsstatus:<br />
Erwerbstätig 51,4 50,1<br />
nicht erwerbstätig 48,6 49,9<br />
Haushaltsgröße:<br />
1 Person 14,7 15,5 3<br />
2 <strong>und</strong> mehr 85,3 84,5 3<br />
1 Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung; 2 70 <strong>und</strong> mehr Jahre alt; 3 Haushalte mit deutscher Bezugsperson.<br />
Quellen: Alterssurvey - Ausländerstichprobe 2002 (n= 586); Deutsches Zentrum für Altersfragen – Gerostat;<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2003a: 47, 2003b; S. 109)
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Abschließend wird <strong>in</strong> der nachfolgenden Tabelle 10.3 der Stichprobenplan der Ausländerstichprobe<br />
vorgestellt. Nur 37 der befragten 586 Personen kamen aus den neuen B<strong>und</strong>esländern – 94<br />
Prozent der Befragten leben auf dem Gebiet der alten B<strong>und</strong>esrepublik. Angesichts der Tatsache,<br />
dass der Anteil von Personen mit nichtdeutscher Staatsbürgerschaft an der ostdeutschen Wohnbevölkerung<br />
(alle Altersgruppen, nicht auf die zweite Lebenshälfte beschränkt) gerade e<strong>in</strong>mal<br />
0,8 Prozent beträgt (BMFSJF, 2000, S. 65), ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Jedoch auch<br />
<strong>in</strong> den Gebieten Deutschlands mit dem höchsten Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung gibt<br />
es e<strong>in</strong>e besonders hohe Konzentration <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen wenigen urbanen Ballungszentren (Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen). Dieses Ergebnis hat jedoch zur Konsequenz, dass mit<br />
den Daten der Ausländerstichprobe des Alterssurveys 2002 praktisch nur Aussagen über die <strong>in</strong><br />
den alten B<strong>und</strong>esländern lebenden Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer gemacht werden können.<br />
Tabelle 10.3:<br />
Stichprobenplan der Ausländerstichprobe 2002 (nach Geschlecht, Alter, Landesteil);<br />
Anzahl der Personen (n) <strong>und</strong> Prozentangaben (%)<br />
Landesteil Geschlecht Altersgruppen Gesamt<br />
40-54 55-69 70-85<br />
n % n % n % n %<br />
Ost<br />
West<br />
männlich 11 2 7 1 2 0,3 20 3<br />
weiblich 8 1 5 1 4 1 17 3<br />
zusammen 19 3 12 2 6 1 37 6<br />
männlich 156 27 105 18 24 4 285 49<br />
weiblich 172 29 71 12 21 4 264 45<br />
zusammen 328 56 176 30 45 8 549 94<br />
Gesamt 347 59 188 32 51 9 586 100<br />
Quelle: Ausländerstichprobe 2002 (n= 586), ungewichtet; Abweichungen zu 100 Prozent bei Summenbildungen s<strong>in</strong>d<br />
r<strong>und</strong>ungsbed<strong>in</strong>gt.<br />
Abgesehen von dieser großen Diskrepanz h<strong>in</strong>sichtlich des Wohnorts der Befragten ist die älteste<br />
Altersgruppe der 70- bis 85-jährigen Personen deutlich unterbesetzt. Nur 9 Prozent der Befragten<br />
gehören der ältesten Altersgruppe des Alterssurveys an. Den größten Anteil machen die 40-<br />
bis 54-Jährigen mit fast 60 Prozent aller Befragten aus. In Bezug auf Geschlecht ergibt sich nur<br />
e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gfügiges Übergewicht männlicher Befragter: 52 Prozent s<strong>in</strong>d Männer.<br />
Nachdem <strong>in</strong> diesem Abschnitt die Besonderheiten der Stichprobe des Alterssurveys beschrieben<br />
wurden, erfolgt im nächsten Abschnitt e<strong>in</strong>e differenzierte Betrachtung soziodemografischer <strong>und</strong><br />
sozialstruktureller Merkmale.<br />
463
10.2.2 Soziodemografische <strong>und</strong> sozialstrukturelle Merkmale<br />
464<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Der Großteil der Befragten <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe ist aus e<strong>in</strong>em anderen Land nach<br />
Deutschland immigriert <strong>und</strong> <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne <strong>in</strong>ternationale Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen. Die<br />
hier verwendete Def<strong>in</strong>ition von „Migrant“ bzw. „Migrant<strong>in</strong>“ bezieht sich auf den Geburtsort<br />
bzw. den Ort des Aufwachsens: E<strong>in</strong>e Person gilt als Migrant oder Migrant<strong>in</strong>, wenn sich ihr Geburtsort<br />
nicht auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands bef<strong>in</strong>det oder aber sie <strong>in</strong> den früheren<br />
deutschen Ostgebieten geboren wurde, aber nach der doppelten Staatsgründung 1949 <strong>in</strong> die<br />
Grenzen des heutigen Deutschlands immigrierte 5 . Außerdem gelten die Personen als Migranten<br />
<strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen, die zwar <strong>in</strong> Deutschland geboren wurden, ihre überwiegende K<strong>in</strong>dheit jedoch<br />
im Ausland verbrachten (Remigranten). Demnach s<strong>in</strong>d 95 Prozent der Befragten Migranten<br />
<strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> 5 Prozent Nichtmigranten <strong>und</strong> Nichtmigrant<strong>in</strong>nen. Die meisten nichtdeutschen<br />
Migranten verbrachten ihre überwiegende K<strong>in</strong>dheit <strong>und</strong> Jugendzeit bis zum 16. Lebensjahr<br />
<strong>in</strong> dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie heute noch haben. Von den Migranten<br />
<strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe, die ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit<br />
angeben, wuchsen 41 Prozent (n= 34) <strong>in</strong> den Staaten der ehemaligen Sowjetunion auf, 8<br />
Prozent (n= 7) <strong>in</strong> den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens <strong>und</strong> 7 Prozent (n= 6) <strong>in</strong> den ehemaligen<br />
deutschen Ostgebieten. E<strong>in</strong> gutes Drittel der Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> der Ausländerstichprobe<br />
(37 Prozent) reiste zwischen 1955 <strong>und</strong> 1973, d.h. <strong>in</strong> der Anwerbephase der Arbeitsmigration,<br />
e<strong>in</strong>. Weitere 29 Prozent der Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Migranten immigrierten im Anschluss<br />
an den Anwerbestopp bis 1989, zum Teil als Familienangehörige, die von den Arbeitsmigranten<br />
der ersten Generation nachgeholt wurden. E<strong>in</strong> Drittel reiste erst seit dem Fall des<br />
„Eisernen Vorhangs“ 1990 e<strong>in</strong>, lebt also erst seit vergleichsweise wenigen Jahren <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Die Ausländerstichprobe des Alterssurveys 2002 umfasst viele verschiedene Nationalitätengruppen.<br />
E<strong>in</strong>e detaillierte Übersicht über die Verteilung nach Staatsangehörigkeit <strong>in</strong> der bere<strong>in</strong>igten<br />
Ausländerstichprobe des Alterssurveys gibt Tabelle 10.A1 im Anhang.<br />
In der Stichprobenbevölkerung zeigt sich die im Vergleich zur deutschen Bevölkerung jüngere<br />
Alterstruktur der ausländischen Bevölkerung (vgl. auch Tabelle 10.3). So gehören 59 Prozent<br />
der befragten Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen der jüngsten Altersgruppe (40-54 Jahre) an, 32<br />
Prozent s<strong>in</strong>d zwischen 55 <strong>und</strong> 69 Jahre alt <strong>und</strong> lediglich 9 Prozent 70 bis 85 Jahre alt. Im Vergleich<br />
dazu gehören <strong>in</strong> der Replikationsstichprobe 22 Prozent der ältesten Altersgruppe an. Jedoch<br />
ist auch hier der Anteil derjenigen <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe mit 42 Prozent am höchsten,<br />
36 Prozent der Deutschen s<strong>in</strong>d 55 bis 69 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt der Deutschen ist<br />
dementsprechend mit 58,7 Jahren signifikant höher als bei den Nichtdeutschen (53,7 Jahre).<br />
Wie <strong>in</strong> Tabelle 10.3 gezeigt, bef<strong>in</strong>den sich unter den Personen mit ausschließlich ausländischer<br />
Staatsangehörigkeit etwas mehr Männer als Frauen. Bei den <strong>in</strong> der Replikationsstichprobe befragten<br />
Deutschen ist das Verhältnis h<strong>in</strong>gegen umgekehrt, wobei es jedoch altersgruppenspezifische<br />
Unterschiede gibt (vgl. Tabelle 10.4 auf der folgenden Seite). Auch zwischen den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Nationalitäten gibt es deutliche Unterschiede. So s<strong>in</strong>d unter den Befragten aus Griechenland,<br />
Italien, Ex-Jugoslawien <strong>und</strong> der früheren Sowjetunion deutlich mehr Männer als Frauen.<br />
5 Die Hauptphase der Flucht <strong>und</strong> Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten endete 1948.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Im Gegensatz dazu s<strong>in</strong>d unter den polnischen <strong>und</strong> unter den türkischen Befragten Frauen <strong>in</strong> der<br />
Mehrheit. Die deutsche Bevölkerung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte weist e<strong>in</strong> durchschnittlich<br />
höheres Schul- <strong>und</strong> Ausbildungsniveau auf als die gleichaltrige ausländische Wohnbevölkerung.<br />
Maximal e<strong>in</strong>en Hauptschulabschluss (<strong>in</strong> Tabelle 10.4 Schulausbildung auf niedrigem Niveau 6 )<br />
haben demnach etwas mehr als die Hälfte der Deutschen, aber nahezu zwei Drittel der ausländischen<br />
Staatsangehörigen.<br />
Tabelle 10.4:<br />
Soziodemografische <strong>und</strong> sozialstrukturelle Merkmale der Populationen der Ausländer<strong>und</strong><br />
Replikationsstichprobe<br />
Ausländerstichprobe Replikationsstichprobe<br />
Gesamt Prozent n Prozent n<br />
Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> Migrant/<strong>in</strong><br />
Nichtmigrant/<strong>in</strong><br />
Immigrations-<br />
zeitraum<br />
(bei Migration)<br />
1940-1954<br />
1955-1973<br />
1974-1989<br />
nach 1990<br />
Geschlecht Weiblich<br />
Männlich<br />
Alter 40-54 Jahre<br />
55-69 Jahre<br />
70-85 Jahre<br />
Schulausbildung Niedrig<br />
Mittel<br />
Hoch<br />
Berufsausbildung Ke<strong>in</strong>e bzw. ke<strong>in</strong>e Angabe<br />
Nicht-akadem. Ausbildg.<br />
Studium<br />
Erwerbsstatus Aktiv erwerbstätig<br />
Im Ruhestand<br />
Sonst. Nicht-Erwerbstätige<br />
Schichtzugehörigkeit Unterschicht<br />
Untere Mittelschicht<br />
mittlere Mittelschicht<br />
gehobene Mittelschicht<br />
obere Mittelschicht<br />
94,8<br />
5,2<br />
1,3<br />
37,3<br />
29,3<br />
32,1<br />
48,0<br />
52,0<br />
59,2<br />
32,1<br />
8,7<br />
65,0<br />
32,8<br />
2,2<br />
37,4<br />
57,5<br />
5,1<br />
50,7<br />
17,6<br />
31,7<br />
25,2<br />
25,2<br />
16,7<br />
23,7<br />
9,3<br />
552<br />
30<br />
7<br />
201<br />
158<br />
173<br />
281<br />
305<br />
347<br />
188<br />
51<br />
381<br />
192<br />
13<br />
219<br />
337<br />
30<br />
297<br />
103<br />
186<br />
136<br />
136<br />
90<br />
128<br />
50<br />
6,6<br />
93,4<br />
27,4<br />
20,1<br />
23,5<br />
29,0<br />
52,9<br />
47,1<br />
42,3<br />
35,7<br />
22,0<br />
54,7<br />
30,3<br />
15,1<br />
14,7<br />
68,0<br />
17,3<br />
43,6<br />
40,6<br />
15,8<br />
5,6<br />
22,1<br />
28,5<br />
30,1<br />
13,7<br />
205<br />
2877<br />
51<br />
37<br />
44<br />
54<br />
1632<br />
1452<br />
1304<br />
1099<br />
679<br />
1686<br />
933<br />
465<br />
454<br />
2097<br />
533<br />
1346<br />
1253<br />
486<br />
Gesamt 100,0 586 100,0 384<br />
Quelle: Alterssurvey, Ausländerstichprobe 2002, Replikationsstichprobe 2002, gewichtet.<br />
6 Wegen der nicht mit dem deutschen Bildungssystem vergleichbaren Abschlüsse wurde diese e<strong>in</strong>fache Term<strong>in</strong>olo-<br />
gie gewählt.<br />
155<br />
614<br />
789<br />
834<br />
380<br />
465
466<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
E<strong>in</strong> nahezu ausgewogenes Verhältnis gibt es im H<strong>in</strong>blick auf mittlere Reife oder Fachhochschulreife:<br />
jeweils e<strong>in</strong> knappes Drittel der Deutschen <strong>und</strong> der Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
haben e<strong>in</strong>en mittleren Schulabschluss. Abitur oder Hochschulreife hatte nur e<strong>in</strong>e verschw<strong>in</strong>dend<br />
kle<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>derheit der ausländischen Befragten (2 Prozent), aber immerh<strong>in</strong> 15 Prozent der Deutschen.<br />
Insgesamt schlossen 99 Prozent der Deutschen im Alter zwischen 40 <strong>und</strong> 85 Jahren die<br />
Pflichtschule oder e<strong>in</strong>e weiterführende Schule mit e<strong>in</strong>em Abschluss ab. In der ausländischen<br />
Bevölkerung s<strong>in</strong>d dies lediglich 80 Prozent. Knapp 6 Prozent der Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
besuchten gar ke<strong>in</strong>e Schule, weitere 15 Prozent verließen sie ohne e<strong>in</strong>en Abschluss. Besonders<br />
unter den türkischen Staatsangehörigen s<strong>in</strong>d die Werte <strong>in</strong> den letzteren Kategorien hoch.<br />
Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion haben dagegen<br />
besonders häufig e<strong>in</strong>en höheren Schulabschluss. Knapp 15 Prozent der Deutschen, aber deutlich<br />
mehr als e<strong>in</strong> Drittel der ausländischen Befragten hat zudem ke<strong>in</strong>e Berufsausbildung abgeschlossen.<br />
Dies trifft nicht nur für die meisten türkischen Staatsangehörigen zu, sondern auch für den<br />
Großteil der griechischen <strong>und</strong> italienischen Staatsbürger. E<strong>in</strong>en Hochschulabschluss haben 17<br />
Prozent der Deutschen, aber nur 5 Prozent der Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen.<br />
Gut die Hälfte der befragten Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen ist noch erwerbstätig, e<strong>in</strong> weiteres<br />
Drittel aus verschiedenen anderen Gründen (Vorruhestand/Frührente, Arbeitslosigkeit, Umschulung,<br />
Hausfrau/Hausmann) nicht erwerbstätig, 18 Prozent bef<strong>in</strong>den sich im Ruhestand. Der vergleichsweise<br />
hohe Anteil Erwerbstätiger im Vergleich zur deutschen Wohnbevölkerung ergibt<br />
sich aus der jüngeren Altersstruktur (siehe oben). Dementsprechend ist umgekehrt der Anteil<br />
der Deutschen im Ruhestand deutlich höher als jener der Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer. Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländer s<strong>in</strong>d fast doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie Deutsche:<br />
Bezogen auf die sich noch nicht im Ruhestand bef<strong>in</strong>dlichen befragten Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Ausländer s<strong>in</strong>d 15 Prozent arbeitslos verglichen mit nur 8 Prozent der noch erwerbsfähigen<br />
Deutschen.<br />
Die Zahlen zur sozialen Schichtzugehörigkeit zeigen <strong>in</strong> der beruflichen Stellung deutliche Unterschiede<br />
zwischen deutschen <strong>und</strong> nichtdeutschen Staatsangehörigen. Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
s<strong>in</strong>d im Vergleich zur deutschen Wohnbevölkerung <strong>in</strong> den unteren sozialen Schichten<br />
deutlich überrepräsentiert. E<strong>in</strong> Viertel der befragten Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen gehört der<br />
Unterschicht an – das ist fast fünf mal soviel wie unter den Deutschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte.<br />
In diesem Abschnitt erfolgte zunächst e<strong>in</strong>e umfassende Beschreibung von Merkmalen der Ausländerstichprobe.<br />
Im Anschluss daran wurden wesentliche soziodemografische <strong>und</strong> sozialstrukturelle<br />
Charakteristika von Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> Deutschen andererseits<br />
verglichen. Besonders auffallend ist dabei die <strong>in</strong>sgesamt jüngere Altersstruktur, das durchschnittlich<br />
ger<strong>in</strong>gere Schulbildungs- <strong>und</strong> Berufsausbildungsniveau <strong>und</strong> die stärkere Betroffenheit<br />
von Arbeitslosigkeit der ausländischen Befragten, was sich auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Überrepräsentation<br />
<strong>in</strong> den unteren sozialen Schichten widerspiegelt. Nach diesem allgeme<strong>in</strong>en Überblick über<br />
wichtige soziodemografische Indikatoren werden nun e<strong>in</strong>ige Lebensbereiche vertiefend betrachtet.<br />
Wir beg<strong>in</strong>nen mit dem Vergleich der materiellen Lage der ausländischen <strong>und</strong> deutschen 40-<br />
bis 85-Jährigen.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
10.3 Materielle Lage<br />
Die materielle Lage besteht nicht nur aus den E<strong>in</strong>kommensverhältnissen, sondern schließt auch<br />
die Betrachtung nicht-monetärer Aspekte wie der Wohnbed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>. In diesem Unterkapitel<br />
werden zunächst E<strong>in</strong>kommensverteilungen von ausländischen <strong>und</strong> deutschen Befragten detailliert<br />
betrachtet. Das schließt auch e<strong>in</strong>e nach Armuts- <strong>und</strong> Wohlstandslagen differenzierte<br />
Betrachtung e<strong>in</strong>. Im Anschluss daran werden die Wohnverhältnisse von Ausländern <strong>und</strong> Deutschen<br />
verglichen.<br />
10.3.1 E<strong>in</strong>kommen<br />
Die verfügbaren wirtschaftlichen Mittel <strong>in</strong> Form von E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen bestimmen als<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong> Ressourcen den Spielraum für die aktuelle Lebensgestaltung <strong>und</strong> haben bedeutenden<br />
E<strong>in</strong>fluss auf die Lebenssituation im Alter. E<strong>in</strong>e gesicherte materielle Existenzgr<strong>und</strong>lage ist<br />
wesentliche Voraussetzung für e<strong>in</strong>e aktive <strong>und</strong> selbstständige Lebensführung. Ger<strong>in</strong>ge f<strong>in</strong>anzielle<br />
Ressourcen dagegen weisen auf Problemlagen (vgl. Motel, 2000). Das E<strong>in</strong>kommen ist<br />
zugleich Ausdruck aktueller <strong>und</strong> vergangener Formen von E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> verschiedene gesellschaftliche<br />
Institutionen. Während der direkte Arbeitsmarktbezug über das Erwerbse<strong>in</strong>kommen<br />
mit höherem Alter aufgr<strong>und</strong> des Übergangs <strong>in</strong> den Ruhestand an Bedeutung verliert, spielt die<br />
Erwerbsbiografie beim Rentenbezug weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e zentrale Rolle, da sich die Rentenhöhe bekanntlich<br />
nach Beitragsdauer <strong>und</strong> Beitragshöhe im Verlauf der Erwerbsbiografie richtet. Wie<br />
bisherige Daten zeigen, führt <strong>in</strong>sbesondere diese Regelung zu ger<strong>in</strong>geren Rentene<strong>in</strong>kommen bei<br />
älteren Ausländern als bei der deutschen älteren Bevölkerung (z.B. Eggen, 1997; Hamburg,<br />
1998).<br />
Die oben beschriebene, auf der beruflichen Stellung basierende Schichtungsstruktur der beiden<br />
Bevölkerungsgruppen f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>kommensverteilung wieder. Die E<strong>in</strong>kommenssituation<br />
der Nichtdeutschen ist deutlich schlechter als die der Deutschen (p
468<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Abbildung 10.1:<br />
E<strong>in</strong>kommensverteilung (Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> Euro nach neuer OECD-Skala)<br />
Ausländ.<br />
Deutsch<br />
A 40-54<br />
D 40-54<br />
A 55-69<br />
D 55-69<br />
A 70-85<br />
D 70-85<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
bis € 510<br />
€ 511-919<br />
€ 920-1.277<br />
€ 1.278-2.299<br />
€ 2.300 u. mehr<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 2726), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 511).<br />
In der folgenden Tabelle 10.5 wird e<strong>in</strong> Überblick über die E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Vermögenssituation<br />
von Ausländern <strong>und</strong> Deutschen gegeben. Das mittlere Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommen der ausländischen<br />
Befragten liegt mit 1.113 € um durchschnittlich 366 € unter dem der Deutschen <strong>in</strong><br />
der zweiten Lebenshälfte. Der E<strong>in</strong>kommensunterschied zwischen ausländischen <strong>und</strong> deutschen<br />
Befragten ist <strong>in</strong> der jüngsten Altersgruppe noch stärker ausgeprägt, während nach dem Übergang<br />
<strong>in</strong> den Ruhestand e<strong>in</strong>e leichte Annäherung der Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommen stattf<strong>in</strong>det. Die<br />
durchschnittliche E<strong>in</strong>kommensdifferenz ist bei den 40- bis 54-Jährigen mit 439 € am größten<br />
<strong>und</strong> bei den 70- bis 85-Jährigen mit 225 € am ger<strong>in</strong>gsten (vgl. erste Zeile von Tabelle 10.5).<br />
Tabelle 10.5:<br />
E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Vermögensverteilung (Angaben <strong>in</strong> Euro bzw. Prozent)<br />
mittleres NÄE 1<br />
<strong>in</strong> Euro<br />
E<strong>in</strong>kommensarmut<br />
Gesamt 40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre<br />
ND 2 D 3<br />
sig. 4<br />
ND D sig. ND D sig. ND D sig.<br />
1113 1479 ** 1131 1570 ** 1089 1479 ** 1075 1300 *<br />
25,6 9,9 ** 25,7 9,4 ** 26,9 10,5 ** 20,0 9,9 *<br />
Sozialhilfebezug 7,8 1,4 ** 6,6 2,2 ** 11,2 0,7 ** / 1,0 n.s.<br />
Schulden 16,8 16,2 n.s. 22,8 26,6 n.s. 8,6 11,8 n.s. 5,4 3,4 n.s.<br />
E<strong>in</strong>kommensreichtum<br />
2,3 7,1 ** 1,7 9,0 ** 4,1 7,1 n.s. - 3,4 n.s.<br />
Vermögen 57,9 78,4 ** 59,9 79,5 ** 57,3 79,9 ** 45,9 73,5 **<br />
1 NÄE = Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommen; 2 ND=Nicht-Deutsche; 3 D=Deutsche; 4 sig.=Signifikanzniveau, ** p
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Armut wird hier relativ auf der Basis des durchschnittlichen Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommens def<strong>in</strong>iert.<br />
Dabei wird das Konzept des ersten Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsberichts der B<strong>und</strong>esregierung<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> die Betrachtung nicht ausschließlich auf Armut beschränkt (vgl. BMAS,<br />
2001). Dementsprechend erlaubt die Betrachtung beider Seiten e<strong>in</strong>e differenziertere Betrachtung<br />
der Lebenslagen <strong>in</strong> Deutschland. E<strong>in</strong>e Person gilt demnach als arm, wenn ihr monatliches Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommen<br />
weniger als 50 Prozent des Durchschnittse<strong>in</strong>kommens aller Deutschen<br />
<strong>und</strong> Ausländer bzw. Ausländer<strong>in</strong>nen beträgt. Im Jahr 2002 lag die relative Armutsgrenze demnach<br />
bei 680 €. Wie angesichts der E<strong>in</strong>kommensverteilung zu erwarten, s<strong>in</strong>d Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländer mit 25,6 Prozent deutlich häufiger von E<strong>in</strong>kommensarmut betroffen als Deutsche<br />
(vgl. Tabelle 10.5 oben). Der Unterschied bleibt <strong>in</strong> allen Altersgruppen bedeutsam. Während<br />
deutsche Frauen <strong>in</strong> der höchsten Altersgruppe häufiger von Armut betroffen s<strong>in</strong>d als Männer<br />
(p
Abbildung 10.2:<br />
Subjektive Bewertung des Lebensstandards<br />
Ausländ.<br />
470<br />
Deutsch<br />
A 40-54<br />
D 40-54<br />
A 55-69<br />
D 55-69<br />
A 70-85<br />
D 70-85<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
sehr schlecht<br />
schlecht<br />
mittel<br />
gut<br />
sehr gut<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3074), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 577), nicht<br />
gewichtet.<br />
10.3.2 Wohnen<br />
Mit dem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand <strong>und</strong> dem Verlust arbeitsweltlicher Bezüge sowie ges<strong>und</strong>heitlich<br />
bed<strong>in</strong>gten Mobilitätse<strong>in</strong>schränkungen gew<strong>in</strong>nt der Wohnbereich im Alter zunehmend an<br />
Bedeutung. Die Wohnsituation stellt e<strong>in</strong>e Ressource dar: Wohnqualität <strong>und</strong> Wohnausstattung<br />
bestimmen die Möglichkeiten der Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>er selbstständigen Lebensführung im<br />
Alter. Bisherige Studienergebnisse belegen e<strong>in</strong>e schlechtere Wohnversorgung für ältere Migranten<br />
<strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen als für ältere Nichtmigranten <strong>und</strong> -migrant<strong>in</strong>nen, was zum Teil auf deren<br />
Überrepräsentanz <strong>in</strong> urbanen Zentren zurückgeführt werden kann (Dietzel-Papakyriakou &<br />
Olbermann, 1998).<br />
Die Daten des Alterssurveys weisen <strong>in</strong> die gleiche Richtung. Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
s<strong>in</strong>d auch <strong>in</strong> diesem Aspekt der materiellen Lage gegenüber Deutschen benachteiligt. Zum e<strong>in</strong>en<br />
verfügen Deutsche gr<strong>und</strong>sätzlich häufiger über Wohnungseigentum. Etwas mehr als e<strong>in</strong> Drittel<br />
der Deutschen wohnt zur Miete – aber fast drei Viertel der ausländischen Staatsangehörigen.<br />
Außerdem leben Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Wohnungen bzw. Häusern. Da <strong>in</strong><br />
den Haushalten von Nichtdeutschen zudem durchschnittlich mehr Personen leben als <strong>in</strong> deutschen<br />
(vgl. Kapitel 10.6) ergibt sich für ausländische Haushalte e<strong>in</strong>e deutlich größere Wohndichte.<br />
Während <strong>in</strong> deutschen Haushalten jedem Haushaltsmitglied durchschnittlich zwei Zimmer<br />
zur Verfügung stehen, s<strong>in</strong>d dies bei nichtdeutschen Staatsangehörigen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
im Mittel nur 1,4 Zimmer pro Person (ohne Küche, Bad, WC). E<strong>in</strong>e Betrachtung<br />
nach Wohnfläche kommt zu dem gleichen Ergebnis: Stehen jedem Ausländer bzw. jeder Ausländer<strong>in</strong><br />
im Mittel 36,9 m² Wohnfläche zur Verfügung, hat jeder Deutsche bzw. jede Deutsche<br />
durchschnittlich 51,8 m² zur Verfügung.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Als möglicher Gr<strong>und</strong> für diese Differenzen wird <strong>in</strong> der Literatur der höhere Anteil von Großstädtern<br />
unter Ausländern angeführt. Da der Wohnraum <strong>in</strong> Städten durchschnittlich kle<strong>in</strong>er <strong>und</strong><br />
die Wohndichte größer ist, könnte die räumliche Verteilung das Ergebnis verzerren. Die Daten<br />
des Alterssurveys bestätigen die ungleiche räumliche Verteilung: Während fast die Hälfte der<br />
Deutschen <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>städten mit bis zu 20.000 E<strong>in</strong>wohnern lebt, s<strong>in</strong>d dies bei Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Ausländern lediglich e<strong>in</strong> Drittel. In Mittelstädten (Städte mit 20.000 bis unter 100.000 E<strong>in</strong>wohnern)<br />
s<strong>in</strong>d die Anteile beider Bevölkerungsgruppen mit ca. 23 Prozent ungefähr gleich groß. In<br />
Großstädten mit 100.000 <strong>und</strong> mehr E<strong>in</strong>wohnern leben dagegen mehr als 44 Prozent der befragten<br />
Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen verglichen mit nur 30 Prozent der Deutschen. Auch bei Kontrolle<br />
für die Geme<strong>in</strong>degröße bleiben die Differenzen für beide Messarten der Wohndichte hoch<br />
signifikant: In jeder Geme<strong>in</strong>degrößenklasse bestehen die Unterschiede weiterh<strong>in</strong>. So beträgt die<br />
Wohndichte (Wohngröße <strong>in</strong> qm² pro Person) für Deutsche <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Orten 53,8 qm², <strong>in</strong> mittelgroßen<br />
Städten 51,3qm² <strong>und</strong> <strong>in</strong> Großstädten 49,1qm². Für Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen ist sie<br />
jeweils deutlich niedriger: <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Orten 38,7 qm², <strong>in</strong> mittelgroßen Städten 35,4qm² <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
Großstädten 36 qm². Der Unterschied <strong>in</strong> der Wohnungsgröße bzw. Wohndichte kann also nicht<br />
alle<strong>in</strong> mit dem größeren Anteil von (Groß-)Städtern unter den Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit<br />
erklärt werden kann.<br />
Auch <strong>in</strong> der Ausstattung der Wohnungen unterscheiden sich die Wohnverhältnisse von Deutschen<br />
<strong>und</strong> Ausländern bzw. Ausländer<strong>in</strong>nen. Ke<strong>in</strong>e signifikanten Unterschiede gibt es bei der<br />
Ausstattung mit Zentral- oder Etagenheizung. Nichtdeutsche Befragte haben jedoch signifikant<br />
seltener e<strong>in</strong>en Balkon, e<strong>in</strong>e Terrasse oder e<strong>in</strong>en Garten. Außerdem fehlt ihnen im Vergleich zu<br />
deutschen Haushalten signifikant häufiger e<strong>in</strong>e Wasch- <strong>und</strong> Spülmasch<strong>in</strong>e, e<strong>in</strong> Tiefkühlschrank,<br />
e<strong>in</strong> Computer sowie e<strong>in</strong> Auto.<br />
Abbildung 10.3:<br />
Wohnzufriedenheit<br />
Prozent<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Nichtdeutsche Deutsche<br />
Staatsangehörigkeit<br />
gut/sehr gut mittel schlecht/sehr schlecht<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3080), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 580),<br />
nicht gewichtet.<br />
471
472<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Wie schon bei den E<strong>in</strong>kommensverhältnissen spiegeln sich die objektiven Wohnverhältnisse im<br />
subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den der ausländischen Befragten wider. Insgesamt bewerten Ausländer<br />
<strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen ihre Wohnsituation deutlich schlechter als die Deutschen (p
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Abbildung 10.4:<br />
Subjektive Bewertung des Ges<strong>und</strong>heitszustandes<br />
Ausländ.<br />
Deutsch<br />
A 40-54<br />
D 40-54<br />
A 55-69<br />
D 55-69<br />
A 70-85<br />
D 70-85<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
sehr schlecht<br />
schlecht<br />
mittel<br />
gut<br />
sehr gut<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3081), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 585), nicht<br />
gewichtet.<br />
In e<strong>in</strong>em weiteren Schritt werden die Auswirkungen der ges<strong>und</strong>heitlichen Situation auf die Verrichtung<br />
alltäglicher Arbeiten zwischen Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen verglichen (vgl. Tabelle<br />
10.6 unten). Datengr<strong>und</strong>lage bildet die Subskala „Körperliche Funktionsfähigkeit (Mobilität /<br />
Aktivitäten des täglichen Lebens; kurz: KÖFU)“ des SF-36-Fragebogens. Der SF-36-<br />
Fragebogen ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternational anerkanntes Instrument zur Messung der ges<strong>und</strong>heitsbezogenen<br />
Lebensqualität (Radoschewski & Bellach, 1999; Kirchberger, 2000) für detailliertere Ausführungen<br />
zu diesem Instrument vgl. Kapitel 7 „Ges<strong>und</strong>heit, Hilfebedarf <strong>und</strong> Versorgung“ im vorliegenden<br />
Band).<br />
Tabelle 10.6:<br />
Ges<strong>und</strong>heitliche E<strong>in</strong>schränkungen bei alltäglichen Tätigkeiten nach Staatsangehörigkeit <strong>und</strong><br />
Alter (nur starke E<strong>in</strong>schränkungen, Angaben <strong>in</strong> Prozent)<br />
Anstrengende Tätigkeit<br />
Taschen tragen<br />
Mehrere Treppen steigen<br />
Sich bücken, knien<br />
Mehrere Kreuzg. zu Fuß<br />
Baden/anziehen<br />
Gesamt 40 bis 54 Jahre 55 bis 69 Jahre 70 bis 85 Jahre<br />
ND D ND D ND D ND D<br />
18,8<br />
6,5<br />
8,5<br />
8,0<br />
5,1<br />
2,9<br />
24,2<br />
8,0<br />
8,9<br />
10,2<br />
6,7<br />
2,5<br />
10,4<br />
2,3<br />
3,5<br />
4,6<br />
1,7<br />
1,2<br />
9,7<br />
2,6<br />
3,3<br />
4,1<br />
2,1<br />
0,9<br />
22,3<br />
7,4<br />
9,1<br />
10,1<br />
5,9<br />
2,1<br />
24,6<br />
7,3<br />
7,6<br />
10,3<br />
5,1<br />
1,8<br />
64,0<br />
31,4<br />
41,2<br />
23,5<br />
25,5<br />
17,6<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3073), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 586), nicht<br />
gewichtet.<br />
51,4<br />
19,6<br />
21,7<br />
21,8<br />
18,5<br />
6,8<br />
473
474<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Zum Vergleich herangezogen wurden nur schwere E<strong>in</strong>schränkungen der jeweiligen Dimensionen<br />
mit dem Ziel, e<strong>in</strong>e signifikante M<strong>in</strong>derung der Lebensqualität zu erfassen. Betrachtet man<br />
alle Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte, so ergeben sich kaum Unterschiede zwischen<br />
Nichtdeutschen <strong>und</strong> Deutschen. Die e<strong>in</strong>zige Ausnahme bilden anstrengende Tätigkeiten, bei<br />
denen sich e<strong>in</strong> deutlich größerer Teil der Deutschen stark e<strong>in</strong>geschränkt fühlt. Beim altersgruppenspezifischen<br />
Vergleich beider Bevölkerungsgruppen fällt auf, dass die ausländischen 70- bis<br />
85-Jährigen <strong>in</strong> allen Kategorien deutlich häufiger über starke E<strong>in</strong>schränkungen berichten als die<br />
gleichaltrigen Deutschen. In den beiden jüngeren Altersgruppen gibt es h<strong>in</strong>gegen kaum Unterschiede<br />
zwischen Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen.<br />
Insgesamt kann daher konstatiert werden, dass sich die Lebensqualität von Deutschen <strong>und</strong> Menschen<br />
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit im H<strong>in</strong>blick auf die selbst wahrgenommenen ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
E<strong>in</strong>schränkungen <strong>und</strong> den Hilfebedarf kaum unterscheiden. Dies gilt jedoch nicht für<br />
die älteste Altersgruppe, <strong>in</strong> der Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer deutlich öfter mit E<strong>in</strong>schränkungen<br />
leben müssen. Dieses Ergebnis überrascht angesichts der Ergebnisse, die aus anderen Studien<br />
bisher bekannt s<strong>in</strong>d. Im Rahmen weiterer Analysen ist außerdem die Frage zu beantworten,<br />
ob <strong>und</strong> <strong>in</strong>wiefern die Heterogenität der Gruppe der Nichtdeutschen nivellierend wirkt, <strong>und</strong> ob es<br />
unter den Menschen deutscher <strong>und</strong> nichtdeutscher Staatsangehörigkeit jeweils bestimmte Personengruppen<br />
gibt, deren Hilfebedarf besonders groß ist.<br />
10.5 Gesellschaftliche Partizipation<br />
Der Ges<strong>und</strong>heitszustand bee<strong>in</strong>flusst nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Möglichkeiten<br />
gesellschaftlicher Partizipation <strong>und</strong> aktiven sozialen Engagements. Im Folgenden soll e<strong>in</strong><br />
kurzer Überblick über die gesellschaftliche Partizipation im Rahmen von Vere<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Organisationen<br />
gegeben werden. Sie stellt e<strong>in</strong>en weiteren wichtigen Aspekt im Kontext der sozialen<br />
Lage <strong>und</strong> der Lebensqualität dar. So bieten Mitgliedschaft <strong>und</strong> Engagement <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en <strong>und</strong><br />
Organisationen nicht nur e<strong>in</strong>e Möglichkeit der Zeitgestaltung, sondern auch der Teilhabe am<br />
sozialen <strong>und</strong> politischen Leben. Gesellschaftliches Engagement kann durch die Erfahrung von<br />
Kompetenz <strong>und</strong> Wertschätzung durch andere zu e<strong>in</strong>er erhöhten Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
beitragen. Nach dem Ausscheiden aus dem gesellschaftlichen Bereich der Arbeit<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er nach der Migration möglicherweise noch fremden Umgebung kommt dieser Art der<br />
Beschäftigung, Partizipation <strong>und</strong> Integration besondere Bedeutung zu (vgl. Kohli & Künem<strong>und</strong>,<br />
1996; Künem<strong>und</strong>, 2000a).<br />
Die Bedeutung von Partizipation <strong>in</strong> eigenethnischen Vere<strong>in</strong>en für den Integrationsverlauf ist<br />
umstritten. Als positive <strong>in</strong>tegrationsfördernde Funktion für Migranten bzw. Menschen ausländischer<br />
Herkunft wird die praktische <strong>und</strong> soziale Unterstützung genannt (vgl.Elwert, 1982). So<br />
bieten diese Vere<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>en Rückzug <strong>in</strong>s ethnische Milieu, e<strong>in</strong>e kulturelle Selbstvergewisserung<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>en Ort, an dem Hilfe zum Umgang mit der Ankunftsgesellschaft ausgetauscht werden.<br />
Andererseits wird argumentiert, dass durch diese E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der für die Integration eigentlich<br />
notwendige Bezug <strong>und</strong> Kontakt zur Aufnahmegesellschaft vernachlässigt wird (z.B. Esser,<br />
1986). Wenngleich <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>e Reihe von Arbeiten die Funktion von Migrantenorganisationen<br />
thematisieren (z.B. Diehl, Urbahn, & Esser, 1998; Diehl, 2000), gibt es kaum Forschungs-
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
erkenntnisse zur sozialen Partizipation älterer Menschen ausländischer Herkunft. Der Alterssurvey<br />
stellt Daten für e<strong>in</strong>e erste Exploration des Partizipations- <strong>und</strong> Organisationsgrades älterer<br />
Menschen ausländischer Herkunft zur Verfügung. Das verwendete Instrument hat jedoch den<br />
Nachteil, dass es primär zur Erfassung des Partizipationsgrades der deutschen Bevölkerung<br />
entwickelt wurde – e<strong>in</strong>e gesonderte Abfrage ausländer- <strong>und</strong> migrantenspezifischer Informationen<br />
zu Vere<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Organisationen, wie beispielsweise ihre ethnische Zusammensetzung <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>haltlichen Ziele, fehlen. Die folgende Abbildung 10.5 gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die Häufigkeit<br />
der Mitgliedschaft <strong>in</strong> ausgewählten Gruppen. Dabei wurde differenziert zwischen Gruppen,<br />
die sich ausschließlich an Menschen im Ruhestand richten <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>en Gruppen.<br />
Abbildung 10.5:<br />
Häufigkeit der Mitgliedschaft <strong>in</strong> Gruppen für Rentner, allgeme<strong>in</strong>en Gruppen <strong>und</strong> <strong>in</strong>sgesamt<br />
Prozent<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Nichtdeutsche Deutsche<br />
Staatsangehörigkeit<br />
Gruppen für Rentner<br />
allgeme<strong>in</strong>e Gruppen<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3084), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 586), ungewichtet.<br />
Abbildung 10.5 zeigt, dass Gruppenmitgliedschaften unter Deutschen viel weiter verbreitet s<strong>in</strong>d<br />
als unter Ausländern <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen. Während mehr als die Hälfte der Deutschen Mitglied<br />
<strong>in</strong> m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em Vere<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>er Gruppe ist, trifft dies nur auf e<strong>in</strong> gutes Viertel der befragten<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer zu. Gruppen für Renter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Rentner spielen für<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Rolle. Mit zunehmendem Alter verr<strong>in</strong>gert sich<br />
sowohl für Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer als auch für Deutsche der Organisationsgrad. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
nimmt der Anteil von Gruppenmitgliedschaften bei den Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern<br />
weniger stark ab: Während 29 Prozent der 40- bis 54-Jährigen Mitglied e<strong>in</strong>er Gruppe s<strong>in</strong>d, verr<strong>in</strong>gert<br />
sich dieser Anteil bei den 55- bis 69-Jährigen kaum (28 Prozent). Auch 22 Prozent der<br />
70- bis 85-jährigen Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer ist noch Mitglied <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vere<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong>er<br />
Gruppe. Bei den Deutschen ist zwar der Anteil der Aktiven <strong>in</strong> allen Altersgruppen deutlich höher<br />
– er nimmt aber unter den Ältesten auch stärker ab (43 Prozent gegenüber von 55 Prozent <strong>in</strong><br />
den jüngeren Altersgruppen).<br />
Nichtdeutsche <strong>und</strong> Deutsche unterscheiden sich auch <strong>in</strong> der Häufigkeit ihres Engagements, allerd<strong>in</strong>gs<br />
<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maße als erwartet. Die Hälfte der Deutschen nimmt m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal<br />
475
476<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
wöchentlich an Gruppenaktivitäten teil, bei den Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern s<strong>in</strong>d das immerh<strong>in</strong><br />
auch 42 Prozent. Das <strong>in</strong>sgesamt zeitlich umfangreichere Engagement der Deutschen<br />
hängt vermutlich damit zusammen, dass diese Bevölkerungsgruppe auch häufiger e<strong>in</strong> Ehrenamt<br />
<strong>in</strong>ne hat (p
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
10.6 Intergenerationale Familienbeziehungen<br />
Mit zunehmendem Bedarf im höheren Lebensalter gew<strong>in</strong>nt schließlich die Frage nach familiären<br />
<strong>und</strong> außerfamiliären Unterstützungspotenzialen <strong>und</strong> Hilfeleistungen an Bedeutung. Diesem<br />
Aspekt der sozialen Lage älterer Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen soll <strong>in</strong> diesem Unterkapitel<br />
ausführlicher nachgegangen werden. Die E<strong>in</strong>bettung <strong>in</strong> soziale Beziehungen ist e<strong>in</strong>e wichtige<br />
Form gesellschaftlicher Integration. Für Menschen nichtdeutscher Herkunft stellt sich <strong>in</strong> besonderer<br />
Weise die Frage nach dem E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>in</strong> Netzwerkbeziehungen. Im Zuge e<strong>in</strong>er<br />
grenzüberschreitenden, länger andauernden oder endgültigen Emigration werden soziale Netzwerke<br />
im Herkunftsland verlassen. Wenngleich sie bis zu e<strong>in</strong>em gewissen Grad transnational<br />
weitergeführt werden können, müssen im Zielland neue soziale Beziehungen aufgebaut werden.<br />
Ausgrenzungs- <strong>und</strong> Diskrim<strong>in</strong>ierungserfahrungen sowie nicht ausreichende Sprachkenntnisse<br />
erschweren den Kontaktaufbau zu E<strong>in</strong>heimischen.<br />
Fand e<strong>in</strong>e Migration im Familienverband statt, so stellen familiäre Beziehungen e<strong>in</strong>e wichtige<br />
Ressource dar. In der Forschung wird auf die große soziale Bedeutung von eigenethnischen<br />
Netzwerken h<strong>in</strong>gewiesen (für Ältere z.B. Dietzel-Papakyriakou, 1993). Ihr Beitrag zur Lebensqualität<br />
<strong>und</strong> Integration ist jedoch durchaus ambivalent. Während beispielsweise e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
<strong>in</strong> die Familie oder andere ethnisch-sozial weitgehend homogene Gruppen vor allem emotionale<br />
Sicherheit bieten kann, ist das <strong>in</strong>strumentelle <strong>und</strong> kognitive Hilfepotenzial <strong>in</strong> ethnisch<br />
<strong>und</strong> sozial heterogenen Netzwerken größer.<br />
Im Folgenden stehen Haushalt <strong>und</strong> Familie im Mittelpunkt der Betrachtung. Generationenbeziehungen<br />
werden <strong>in</strong> Deutschland nicht mehr primär <strong>in</strong>nerhalb des Familienhaushalts gelebt,<br />
sondern <strong>in</strong> aus mehreren Haushalten bestehenden ‚multilokalen Mehrgenerationenfamilien’<br />
(Bertram, 2000). Deshalb werden die Beziehungen zu Familienmitgliedern <strong>in</strong>nerhalb der erweiterten<br />
Familie getrennt von den Beziehungen zu Haushaltsmitgliedern betrachtet. Im Mittelpunkt<br />
stehen <strong>in</strong>sbesondere die <strong>in</strong>tergenerationalen Beziehungen zwischen erwachsenen K<strong>in</strong>dern<br />
<strong>und</strong> ihren Eltern. Generationenbeziehungen s<strong>in</strong>d im Zuge des demografischen <strong>Wandel</strong>s <strong>in</strong> den<br />
letzten Jahrzehnten verstärkt <strong>in</strong> den Fokus wissenschaftlichen Interesses gerückt. Für die Deutschen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte konnte auf Basis der Alterssurvey-Daten aus der Ersterhebung<br />
gezeigt werden, dass Generationenbeziehungen nach wie vor gelebt werden <strong>und</strong> überwiegend<br />
eng <strong>und</strong> solidarisch s<strong>in</strong>d (z.B.Kohli et al., 2000; Szydlik, 2000).<br />
Für Menschen nichtdeutscher Herkunft könnte man vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Migrations- <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>er unter Umständen problematischen Integrationserfahrung im Ankunftsland annehmen, dass<br />
die Familie Kompensationsfunktionen übernimmt <strong>und</strong> ganz besonders wichtig wird. Andererseits<br />
könnten die Migration bzw. das Aufwachsen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anderen kulturellen <strong>und</strong> sozialen<br />
Kontext, sowie die aktuelle, durch den Migranten- <strong>und</strong> Ausländerstatus bestimmte rechtliche,<br />
ökonomische <strong>und</strong> familiäre Situation im Aufnahmeland auch zu Generationenkonflikten führen.<br />
Ohne hier auf mögliche Ursachen e<strong>in</strong>gehen zu können, werden drei zentrale Dimensionen von<br />
Generationenbeziehungen deskriptiv untersucht: Wohnentfernung, Kontakthäufigkeit <strong>und</strong> Beziehungsenge.<br />
Dem Austausch von sozialer Unterstützung wird aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er herausragenden<br />
Bedeutung e<strong>in</strong> separates Unterkapitel (Unterkapitel 10.7) gewidmet. In e<strong>in</strong>em ersten Schritt<br />
wird jedoch zunächst beschrieben, <strong>in</strong>wiefern sich das erweiterte Familienetzwerk von Nicht-<br />
477
478<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
deutschen von jenen deutscher 40- bis 85-Jähriger unterscheidet. Im Anschluss daran erfolgt e<strong>in</strong><br />
Vergleich der jeweiligen Haushaltsstruktur.<br />
10.6.1 Strukturell verfügbare Familienmitglieder<br />
In e<strong>in</strong>em ersten Schritt wird untersucht, welche Personen zum Familiennetzwerk ausländischer<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte gehören. Die nachfolgende Abbildung 10.6 beschränkt<br />
sich dabei <strong>in</strong> der Darstellung auf den Kern <strong>in</strong>tergenerationaler Beziehungen, nämlich die Eltern-<br />
K<strong>in</strong>d-Beziehung sowie zwei weitere, für Familienbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte besonders<br />
wichtige Personengruppen – Geschwister <strong>und</strong> Enkel (zur zunehmenden Bedeutung von<br />
Geschwistern im Alter vgl. Connidis, 2001).<br />
Abbildung 10.6:<br />
Familienangehörige verschiedener Generationen nach Vorhandense<strong>in</strong><br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Gesamt 40 bis 54-Jährige<br />
Elt ern Geschwist er K<strong>in</strong>der Enkel<br />
Familienangehörige<br />
Nichtdeutsche Deut sche<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Elt ern Geschwist er K<strong>in</strong>der Enkel<br />
Familienangehörige<br />
55 bis 69-Jährige 70 bis 85-Jährige<br />
Elt ern Geschwist er K<strong>in</strong>der Enkel<br />
Familienangehörige<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Elt ern Geschwist er K<strong>in</strong>der Enkel<br />
Familienangehörige<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3084), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 586), ungewichtet.<br />
Die große Mehrheit von 85 Prozent der Befragten hat K<strong>in</strong>der (vgl. Abbildung 10.6, oben l<strong>in</strong>ks).<br />
Etwas überraschend ist die Tatsache, dass der Anteil der K<strong>in</strong>derlosen bei den ausländischen<br />
Befragten genauso groß war wie bei den Deutschen. Außerdem haben die deutschen 40- bis 85-<br />
Jährigen deutlich öfter Enkel. Im Gegensatz dazu geben jedoch die ausländischen Befragten<br />
häufiger Geschwister <strong>und</strong> auch ihre Eltern als Mitglieder der erweiterten Familie an. Das liegt
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
zum Teil am durchschnittlich niedrigeren Alter der nichtdeutschen Befragten. Wenn man das<br />
Alter kontrolliert, ergibt sich folgendes Bild: Bei knapp 80 Prozent der 40- bis 54-jährigen<br />
Deutschen lebt m<strong>in</strong>destens noch e<strong>in</strong> Elternteil, was signifikant häufiger ist als bei den Nichtdeutschen<br />
(Abbildung 10.6, oben rechts). In der mittleren Altersgruppe gibt es diesbezüglich<br />
ke<strong>in</strong>e Differenzen.<br />
10.6.2 Haushaltsstruktur<br />
Haushaltsgröße <strong>und</strong> Haushaltszusammensetzung bestimmen nicht nur die Wohnsituation entscheidend<br />
mit. So können beispielsweise größere Haushalte <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Wohnungen als belastend<br />
empf<strong>und</strong>en werden (hohe Wohndichte) (vgl. Abschnitt 10.3). Betrachtet man die Haushaltsgröße<br />
jedoch aus e<strong>in</strong>er Unterstützungsperspektive stehen <strong>in</strong> größeren Haushalten mehr<br />
potentielle Helfer zur Verfügung. Menschen, die alle<strong>in</strong> leben, haben ke<strong>in</strong> vergleichbares unmittelbares<br />
Unterstützungspotenzial. In der deutschen Bevölkerung betrifft das vor allem hochaltrige<br />
Frauen, deren Lebenspartner bereits verstorben s<strong>in</strong>d. Für ältere Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen<br />
zeigen bisherige Daten e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren S<strong>in</strong>gularisierungsgrad, im Vergleich zur e<strong>in</strong>heimischen<br />
Bevölkerung größere Haushalte, <strong>in</strong> denen mehr Generationen unmittelbar zusammenleben. Daraus<br />
ergibt sich e<strong>in</strong>e relativ große Heterogenität der Wohnsituation (vgl. Dietzel-Papakyriakou &<br />
Olbermann, 1998).<br />
Die Daten des Alterssurveys bestätigen diese Ergebnisse (vgl. Tabelle 10.8 unten). Der Anteil<br />
der Alle<strong>in</strong>lebenden ist unter den nichtdeutschen Staatsangehörigen signifikant ger<strong>in</strong>ger als unter<br />
den Deutschen (vgl. letzte Zeile <strong>in</strong> Tabelle 10.8). E<strong>in</strong>personenhaushalte s<strong>in</strong>d erwartungsgemäß<br />
unter den 70- bis 85-Jährigen beider Bevölkerungsgruppen am weitesten verbreitet. Das durchschnittlich<br />
niedrigere Alter der Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ist<br />
der entscheidende Faktor für den ger<strong>in</strong>geren S<strong>in</strong>gularisierungsgrad. Da die befragten Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländer im Durchschnitt jünger s<strong>in</strong>d als die Deutschen, leben sie häufiger als diese<br />
<strong>in</strong> Paarhaushalten. Kontrolliert man das Alter, so verschw<strong>in</strong>det der signifikante Unterschied.<br />
Tabelle 10.8:<br />
Anteil von Alle<strong>in</strong>lebenden <strong>und</strong> durchschnittliche Haushaltsgröße<br />
Anteil Alle<strong>in</strong>lebender<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
ND 1<br />
D 2<br />
sig. 3<br />
Durchschnittliche<br />
Haushaltsgröße (Personen)<br />
ND D sig.<br />
40 – 54 Jahre 10,4 12,7 n.s. 3,3 2,9 **<br />
55 – 69 Jahre 16,5 17,2 n.s. 2,4 2,1 **<br />
70 – 85 Jahre 37,3 41,6 n.s. 1,8 1,7 n.s.<br />
Weiblich 14,9 25,4 ** 2,8 2,2 **<br />
Männlich 14,4 14,9 n.s. 2,9 2,5 **<br />
Gesamt 14,7 20,5 ** 2,9 2,4 **<br />
1 ND=Nicht-Deutsch, 2 D=Deutsch, 3 sig.=Signifikanzniveau; ** p < 0.01, * p < 0.05.<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3084), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 586), ungewichtet.<br />
479
480<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Die jeweiligen Anteile der Alle<strong>in</strong>lebenden s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> allen drei Altersgruppen annähernd gleich<br />
groß. Daneben tritt bei den Deutschen der erwartete Geschlechtsunterschied auf: Frauen leben<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer durchschnittlich höheren Lebenserwartung viel häufiger alle<strong>in</strong> als Männer. In<br />
scharfem Kontrast dazu gibt es ke<strong>in</strong>en bedeutsamen Unterschied <strong>in</strong> der Verbreitung Alle<strong>in</strong>lebender<br />
zwischen ausländischen Männern <strong>und</strong> Frauen (vgl. Tabelle 10.8).<br />
In Bezug auf die Haushaltsgröße zeigen sich ebenfalls die erwarteten Muster. Mit durchschnittlich<br />
2,9 Personen s<strong>in</strong>d Haushalte von Ausländern <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
signifikant größer als die Haushalte von Deutschen, <strong>in</strong> denen durchschnittlich 2,3 Personen<br />
leben (vgl. Tabelle 10.8 oben). Bei e<strong>in</strong>er altersgruppenspezifischen Betrachtung bleibt dieser<br />
Effekt <strong>in</strong> der jüngeren <strong>und</strong> mittleren Altersgruppe bestehen. Bei den 70- bis 85-Jährigen gibt<br />
es jedoch ke<strong>in</strong>e signifikanten Unterschiede zwischen Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen. Die geschlechtsspezifische<br />
Betrachtung br<strong>in</strong>gt den aus deutscher Sicht unerwarteten Bef<strong>und</strong>, dass sich<br />
die durchschnittlichen Haushaltsgrößen von ausländischen Frauen <strong>und</strong> Männern kaum unterscheiden.<br />
Dieses Ergebnis überrascht <strong>in</strong>sofern, als dass deutsche Männer aufgr<strong>und</strong> ihrer ger<strong>in</strong>geren<br />
Lebenserwartung <strong>in</strong> durchschnittlich größeren Haushalten leben als Frauen.<br />
Im folgenden wird der Blickw<strong>in</strong>kel auf haushaltsspezifische Generationenkonstellationen erweitert.<br />
Außerdem erfolgt neben der bisher auf den Vergleich von Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen<br />
beschränkte Perspektive erstmals auch e<strong>in</strong>e nach ethnischen Gruppen differenziertere Betrachtungsweise.<br />
Abbildung 10.7 offenbart deutliche Unterschiede <strong>in</strong> der Generationenstruktur von<br />
deutschen Haushalten e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> nichtdeutschen andererseits. Während <strong>in</strong> deutschen Hauhalten<br />
E<strong>in</strong>generationenkonstellationen dom<strong>in</strong>ieren, gibt es <strong>in</strong> den meisten ausländischen Haushalten<br />
zwei Generationen. Dabei handelt es sich <strong>in</strong> der Regel um Eltern mit ihren K<strong>in</strong>dern.<br />
Abbildung 10.7:<br />
Haushaltsspezifische Generationenkonstellationen<br />
Deutsche<br />
Ausländ.<br />
Türkisch<br />
Ex-Jugoslaw.<br />
Italienisch<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
1Gen.-alle<strong>in</strong><br />
1Gen.-m.Part.<br />
2Generationen<br />
3Generationen<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3050), gewichtet, Ausländerstichprobe (n= 584), ungewichtet.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Zwei Drittel der Deutschen leben <strong>in</strong> E<strong>in</strong>generationenhaushalten, wovon 45 Prozent auf Paarhaushalte<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Fünftel auf Alle<strong>in</strong>lebende entfällt (vgl. auch Kapitel 5 <strong>in</strong> diesem Band). Dreigenerationenhaushalte<br />
h<strong>in</strong>gegen spielen nur e<strong>in</strong>e untergeordnete Rolle <strong>und</strong> treten auch <strong>in</strong> ausländischen<br />
Haushalten nur unwesentlich öfter auf als <strong>in</strong> deutschen. Bei der nach ausgewählten<br />
Staatsangehörigkeitsgruppen differenzierten Betrachtung fallen die Menschen türkischer Herkunft<br />
auf: sie leben besonders häufig <strong>in</strong> Zweigenerationenhaushalten mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em<br />
K<strong>in</strong>d. Dafür ist der Anteil der Alle<strong>in</strong>lebenden hier besonders ger<strong>in</strong>g.<br />
10.6.3 Wohnentfernung<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n dieses Kapitels wurde die Frage aufgeworfen, <strong>in</strong>wieweit sich die Familiennetzwerke<br />
ausländischer Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte von den gleichaltrigen Deutschen unterscheiden.<br />
Die geographische Entfernung ist Teil der Opportunitätsstruktur von Generationenbeziehungen.<br />
Sie bestimmt <strong>in</strong> zentraler Weise die Möglichkeiten der Interaktion <strong>und</strong> damit die<br />
anderen Dimensionen <strong>in</strong>tergenerationaler Beziehungen. Obwohl dank moderner Kommunikationsmedien<br />
die Aufrechterhaltung der Familienbeziehungen nicht mehr ausschließlich an den<br />
persönlichen Kontakt geknüpft ist, korreliert doch e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Wohnentfernung mit <strong>in</strong>tensiveren<br />
Beziehungen <strong>und</strong> erhöht die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit sozialer Unterstützung (Lauterbach, 2001;<br />
Marbach, 1994). Auf der Basis des Alterssurveys kann die Wohnentfernung zwischen Eltern<br />
<strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern analysiert werden. Die Befragten können sich dabei <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Doppelrolle bef<strong>in</strong>den<br />
– e<strong>in</strong>mal als Eltern erwachsener K<strong>in</strong>der, zum anderen im Verhältnis zu ihren eigenen Eltern. Die<br />
zentrale Frage lautet hier, ob ausländische Staatsangehörige durch e<strong>in</strong>e vergleichbare oder ger<strong>in</strong>gere<br />
Wohnentfernung zu dem am nächsten wohnenden K<strong>in</strong>d bzw. Elternteil über ähnliche<br />
oder größere Möglichkeiten der direkten Kommunikation verfügen wie Deutsche. Von besonderem<br />
Interesse ist dabei, welchen Anteil transnationale Eltern-K<strong>in</strong>d-Interaktionen haben. Tabelle<br />
10.9 enthält die Wohnentfernungen von erwachsenen K<strong>in</strong>dern zu ihren Eltern e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> die<br />
der befragten Eltern zu ihren K<strong>in</strong>dern andererseits.<br />
Transnationale soziale Beziehungen zeigen sich <strong>in</strong> besonders großem Ausmaß bei den Eltern<br />
der hier untersuchten nichtdeutschen Staatsangehörigen. Sowohl Deutsche als auch Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländer leben eher selten mit ihren Eltern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushalt. Während aber 85<br />
Prozent der deutschen Eltern maximal <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anderen Ort leben, der <strong>in</strong>nerhalb von 2 St<strong>und</strong>en<br />
zu erreichen ist, leben drei Viertel der ausländischen Eltern im Ausland. Dieser Anteil ist bei<br />
den Staatsangehörigen aus dem ehemaligen Jugoslawien mit 96 Prozent am höchsten, gefolgt<br />
von italienischen (81 Prozent) <strong>und</strong> türkischen Staatsangehörigen (73 Prozent). Dies kann mit<br />
dem Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> erklärt werden. Bei den hier <strong>in</strong>teressierenden 40-85-Jährigen nichtdeutschen<br />
Staatsangehörigen handelt es sich vorwiegend um Migranten <strong>und</strong> Migrant<strong>in</strong>nen der<br />
ersten Generation, die ihre Eltern im Herkunftsland zurückließen. Im Fall von Angehörigen der<br />
zweiten Generation kann es sich um Eltern handeln, die zurückgekehrt s<strong>in</strong>d. Inwiefern transnationale<br />
Pendler berücksichtigt werden – e<strong>in</strong> Phänomen, das unter Arbeitsmigranten im Ruhestand<br />
zunehmend zu beobachten ist – kann anhand der Alterssurvey-Daten nicht festgestellt<br />
werden. Es ist zu vermuten, dass die transnationale Familienorganisation weitere Aspekte von<br />
Generationenbeziehungen <strong>und</strong> die Struktur des sozialen Netzwerks <strong>in</strong>sgesamt bee<strong>in</strong>flusst. Bei<br />
den Deutschen beträgt der Anteil der im Ausland lebenden Eltern lediglich knapp 2 Prozent.<br />
481
Tabelle 10.9:<br />
Wohnentfernung zum nächstwohnenden Elternteil bzw. K<strong>in</strong>d (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Wohnentf. zu Eltern:<br />
Gleiches Haus/Haushalt<br />
Nachbarschaft<br />
Gleicher Ort<br />
And. Ort, max. 2 Std.<br />
Weiter entfernt, <strong>in</strong> D<br />
Ausland<br />
Wohnentf. zu K<strong>in</strong>dern:<br />
Gleiches Haus/Haushalt<br />
Nachbarschaft<br />
Gleicher Ort<br />
And. Ort, max. 2 Std.<br />
Weiter entfernt, <strong>in</strong> D.<br />
Ausland<br />
482<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Gesamt 40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre<br />
ND D ND D ND D ND D<br />
3,9<br />
3,1<br />
8,9<br />
8,1<br />
3,5<br />
72,6<br />
54,7<br />
9,7<br />
13,8<br />
10,2<br />
4,1<br />
7,5<br />
10,8<br />
13,0<br />
26,1<br />
35,0<br />
13,1<br />
1,9<br />
39,7<br />
12,2<br />
20,1<br />
20,8<br />
6,2<br />
1,0<br />
3,3<br />
3,3<br />
9,8<br />
8,9<br />
3,7<br />
71,0<br />
69,5<br />
3,1<br />
12,8<br />
7,1<br />
2,2<br />
5,3<br />
10,4<br />
12,7<br />
25,7<br />
35,8<br />
13,1<br />
2,3<br />
67,5<br />
4,9<br />
9,4<br />
13,2<br />
4,4<br />
0,7<br />
6,8<br />
2,3<br />
4,5<br />
4,5<br />
2,3<br />
79,5<br />
40,4<br />
15,9<br />
14,6<br />
15,2<br />
4,6<br />
9,3<br />
12,9<br />
14,8<br />
27,6<br />
31,0<br />
13,8<br />
-<br />
27,3<br />
14,3<br />
23,8<br />
26,1<br />
7,7<br />
0,8<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe, (n= 2464), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 413),<br />
nicht gewichtet.<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
22,2<br />
25,0<br />
16,7<br />
8,3<br />
13,9<br />
13,9<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
22,2<br />
18,9<br />
28,7<br />
22,4<br />
6,2<br />
1,5<br />
Die Daten zur Wohnentfernung zu K<strong>in</strong>dern zeigen zunächst den oben bereits erwähnten Bef<strong>und</strong>,<br />
dass Ausländer häufiger mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em K<strong>in</strong>d zusammen im gleichen Haushalt leben als<br />
Deutsche (54,7 gegenüber 39,7 Prozent). Wenn auch die Anteile der Deutschen mit m<strong>in</strong>destens<br />
e<strong>in</strong>em K<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Nachbarschaft bzw. im gleichen Ort größer s<strong>in</strong>d als bei den Nichtdeutschen,<br />
verfügen mit 78 Prozent immer noch mehr nichtdeutsche Staatsangehörige als deutsche (72<br />
Prozent) über K<strong>in</strong>der vor Ort. In den Altersgruppen unterscheiden sich die Anteile <strong>in</strong> der Koresidenz<br />
mit K<strong>in</strong>dern kaum. Offensichtlich handelt es sich hier um e<strong>in</strong>en Alterseffekt vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der jüngeren Altersstruktur der Ausländer. Unterschiede zwischen Deutschen <strong>und</strong><br />
Ausländern bleiben jedoch im H<strong>in</strong>blick auf die weitere Wohnentfernung bedeutsam. Als problematisch<br />
h<strong>in</strong>sichtlich der Voraussetzungen für häufige direkte Kontakte <strong>und</strong> Hilfeleistungen ist<br />
die Lage der Personen e<strong>in</strong>zuschätzen, deren K<strong>in</strong>der weiter weg, d.h. mehr als zwei St<strong>und</strong>en<br />
entfernt, leben. Dies s<strong>in</strong>d bei den Deutschen 7 Prozent <strong>und</strong> bei den Ausländern knapp 12 Prozent.<br />
Bei den 55 bis 85-jährigen Ausländern beträgt der Anteil sogar 28 Prozent. Im Fall der im<br />
Ausland lebenden K<strong>in</strong>der handelt es sich entweder um Personen, die ohne ihre K<strong>in</strong>der nach<br />
Deutschland immigriert s<strong>in</strong>d, oder um Eltern remigrierter K<strong>in</strong>der. Da nicht spezifiziert wurde,<br />
ob mit „Ausland“ das Herkunftsland der befragten Person geme<strong>in</strong>t ist, kann es sich auch um<br />
andere Arten von Auslandsaufenthalten handeln. S<strong>in</strong>d diese dauerhaft, so fehlt den Eltern e<strong>in</strong><br />
zentrales Unterstützungspotenzial, das zur Vermeidung von Notlagen durch andere verwandtschaftliche<br />
oder professionelle Hilfe kompensiert werden muss.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
10.6.4 Kontakthäufigkeit<br />
Die Kontakthäufigkeit stellt e<strong>in</strong>e weitere wichtige Dimension von Generationenbeziehungen<br />
dar, die verschiedene Formen von geme<strong>in</strong>samen Aktivitäten umfasst. Hier wurde erfragt, wie<br />
häufig man mite<strong>in</strong>ander Kontakt hat, beispielsweise durch Besuche, Briefe oder Telefonate.<br />
Neben der <strong>in</strong>sgesamt ger<strong>in</strong>gen Wohnentfernung zu den K<strong>in</strong>dern unterstreichen die Daten zur<br />
Kontakthäufigkeit das Bild der regen Generationenbeziehungen. In Tabelle 10.10 wurde jeweils<br />
die Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehung mit dem häufigsten Kontakt dargestellt. Von den 70- bis 85-Jährigen<br />
hatten nur noch sieben Deutsche <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e nichtdeutsche Person noch lebende Eltern, so dass<br />
aufgr<strong>und</strong> der ger<strong>in</strong>gen Fallzahl auf e<strong>in</strong>e Darstellung verzichtet wurde.<br />
Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen unterscheiden sich <strong>in</strong> ihrer Kontakthäufigkeit zu ihren Eltern<br />
erheblich von Deutschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Während die Mehrheit der Deutschen<br />
zum<strong>in</strong>dest wöchentlich mit den Eltern <strong>in</strong> Kontakt steht, ist dies bei Nichtdeutschen deutlich<br />
weniger häufig der Fall. Das liegt <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie daran, dass e<strong>in</strong> großer Teil der ausländischen<br />
Eltern im Herkunftsland lebt. E<strong>in</strong>e regelmäßige Kommunikation ist also nur e<strong>in</strong>geschränkt möglich.<br />
Dies gilt für alle Altersgruppen. Auch die Kontakthäufigkeit zu den K<strong>in</strong>dern unterscheidet<br />
sich zwischen Nichtdeutschen <strong>und</strong> Deutschen. Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer stehen durchschnittlich<br />
häufiger mit ihren K<strong>in</strong>dern im Kontakt. Dabei tritt dieser Unterschied vor allem <strong>in</strong><br />
der mittleren <strong>und</strong> der ältesten Altersgruppe auf, <strong>in</strong> der jüngsten ist die Kontakthäufigkeit für<br />
beide Bevölkerungsgruppen ähnlich.<br />
Tabelle 10.10:<br />
Kontakthäufigkeit zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Kontakt zu Eltern:<br />
Täglich<br />
Mehrmals pro Woche<br />
E<strong>in</strong>mal pro Woche<br />
1 bis 3mal im Monat<br />
Mehrmals im Jahr<br />
Seltener<br />
Nie<br />
Kontakt zu K<strong>in</strong>dern:<br />
Täglich<br />
Mehrmals pro Woche<br />
E<strong>in</strong>mal pro Woche<br />
1 bis 3mal im Monat<br />
Mehrmals im Jahr<br />
Seltener<br />
Nie<br />
Gesamt 40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre<br />
ND D ND D ND D ND D<br />
8,3<br />
15,8<br />
28,9<br />
24,8<br />
10,5<br />
10,2<br />
1,5<br />
65,6<br />
16,9<br />
7,5<br />
5,3<br />
3,4<br />
1,2<br />
0,2<br />
24,4<br />
31,4<br />
23,6<br />
13,0<br />
5,0<br />
0,7<br />
-<br />
52,4<br />
26,9<br />
11,3<br />
5,3<br />
2,2<br />
0,8<br />
1,1<br />
7,7<br />
16,4<br />
29,1<br />
24,1<br />
10,0<br />
10,9<br />
1,8<br />
75,4<br />
11,4<br />
5,3<br />
3,1<br />
2,6<br />
1,8<br />
0,4<br />
21,8<br />
32,6<br />
24,2<br />
13,9<br />
4,6<br />
0,9<br />
1,9<br />
72,8<br />
14,3<br />
6,0<br />
3,5<br />
1,4<br />
0,6<br />
1,5<br />
11,1<br />
13,3<br />
26,7<br />
28,9<br />
13,3<br />
6,7<br />
-<br />
53,6<br />
23,8<br />
9,3<br />
8,6<br />
4,0<br />
0,7<br />
-<br />
34,5<br />
26,8<br />
21,4<br />
9,1<br />
6,8<br />
-<br />
1,4<br />
41,8<br />
33,9<br />
14,3<br />
5,2<br />
2,4<br />
1,1<br />
1,2<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
52,8<br />
22,2<br />
13,9<br />
5,6<br />
5,6<br />
-<br />
-<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
42,3<br />
32,5<br />
13,6<br />
7,9<br />
2,9<br />
0,5<br />
0,3<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe, (n= 2480), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 305), nicht gewichtet.<br />
483
10.6.5 Enge der Beziehung<br />
484<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Im Folgenden wird die subjektive E<strong>in</strong>schätzung der emotionalen Enge der Beziehung untersucht.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass es nicht um e<strong>in</strong>e Beziehungsbewertung<br />
nach den Kriterien gut/schlecht geht. Häufig s<strong>in</strong>d nämlich gerade enge Beziehungen nicht ausschließlich<br />
positiv, sondern auch konfliktbeladen, <strong>und</strong> werden <strong>in</strong>sgesamt beispielsweise ambivalent<br />
erlebt (vgl. Lüscher & Pillemer, 1996; 1998; Lüscher, 2000). Außerdem ist bei dieser subjektiven<br />
Variable e<strong>in</strong> möglicherweise kulturspezifisches Antwortverhalten zu berücksichtigen.<br />
Insgesamt zeigt sich zwischen Deutschen <strong>und</strong> Ausländern bzw. Ausländer<strong>in</strong>nen erneut e<strong>in</strong> erstaunlich<br />
e<strong>in</strong>heitliches Bild (vgl. Tabelle 10.11 unten).<br />
Tabelle 10.11:<br />
Verb<strong>und</strong>enheit zwischen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Verb<strong>und</strong>enh. mit Eltern<br />
Sehr eng<br />
Eng<br />
Mittel<br />
Weniger eng<br />
Überhaupt nicht eng<br />
Verb<strong>und</strong>enh. zu K<strong>in</strong>dern:<br />
Sehr eng<br />
Eng<br />
Mittel<br />
Weniger eng<br />
Überhaupt nicht eng<br />
Gesamt 40-54 Jahre 55-69 Jahre 70-85 Jahre<br />
ND D ND D ND D ND D<br />
43,9<br />
38,4<br />
12,9<br />
2,7<br />
2,0<br />
71,7<br />
22,3<br />
4,1<br />
1,5<br />
0,5<br />
38,6<br />
40,8<br />
14,9<br />
3,8<br />
1,9<br />
66,5<br />
27,8<br />
4,0<br />
0,8<br />
0,8<br />
41,2<br />
39,3<br />
14,2<br />
2,8<br />
2,4<br />
75,7<br />
18,6<br />
3,5<br />
1,3<br />
0,9<br />
37,8<br />
42,1<br />
14,6<br />
3,6<br />
1,9<br />
75,2<br />
19,4<br />
3,5<br />
1,1<br />
0,7<br />
55,8<br />
34,9<br />
7,0<br />
2,3<br />
-<br />
66,9<br />
26,5<br />
4,6<br />
2,0<br />
-<br />
41,7<br />
36,0<br />
16,6<br />
3,8<br />
1,9<br />
61,5<br />
32,3<br />
4,2<br />
0,8<br />
1,1<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
66,7<br />
27,8<br />
5,6<br />
-<br />
-<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
62,8<br />
31,8<br />
4,3<br />
0,5<br />
0,5<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 2363), gewichtet; Ausländerstichprobe (n= 413), ungewichtet.<br />
Der Anteil der sehr engen Beziehungen zu den K<strong>in</strong>dern ist unter den ausländischen Staatsangehörigen<br />
etwas höher. Zu den K<strong>in</strong>dern bestehen also <strong>in</strong> beiden Gruppen ganz überwiegend nicht<br />
nur regelmäßig häufige Kontakte, sondern auch enge emotionale Beziehungen. Auffällig ist der<br />
Unterschied zur Beurteilung der Elternbeziehungen, der sowohl bei den Deutschen als auch bei<br />
den Ausländern <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen der „Intergenerational Stake“ -Hypothese entspricht (vgl.<br />
Giarusso, Stall<strong>in</strong>gs, & Bengtson, 1995), nach der Eltern <strong>in</strong> der Regel von engeren Beziehungen<br />
zu ihren K<strong>in</strong>dern berichten als diese umgekehrt zu ihnen. Dabei s<strong>in</strong>d die Beziehungen der Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländer zu ihren Eltern – entgegen den Erwartungen angesichts der ger<strong>in</strong>geren<br />
Kontakthäufigkeit – noch enger als bei den Deutschen. Es gibt offensichtlich e<strong>in</strong>ige Fälle,<br />
die trotz relativ seltenen Kontakts zu den Eltern die Beziehung als eng bewerten. Die Transnationalität<br />
der Familie hat also E<strong>in</strong>fluss auf die Kontakthäufigkeit, nicht aber auf das Gefühl der<br />
Verb<strong>und</strong>enheit.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
10.7 Soziale Unterstützung<br />
In der öffentlichen Diskussion der Folgen des demografischen <strong>Wandel</strong>s wird immer wieder die<br />
Sorge geäußert, dass die abnehmende K<strong>in</strong>derzahl <strong>in</strong> deutschen Familien bei gleichzeitiger Zunahme<br />
der Anzahl hochaltriger Personen <strong>in</strong> Zukunft zu e<strong>in</strong>er Überlastung familialer Unterstützungsnetzwerke<br />
führen wird. Noch leben <strong>in</strong> ausländischen Familien mehr K<strong>in</strong>der als <strong>in</strong> deutschen.<br />
Wie jedoch e<strong>in</strong>gangs festgestellt wurde, bef<strong>in</strong>det sich die ausländische Bevölkerungsgruppe<br />
<strong>in</strong> Deutschland auf dem besten Wege, den Altersstrukturwandel <strong>in</strong> verschärftem Tempo<br />
nachzuholen. Es stellt sich die Frage, ob sich daraus für nichtdeutsche Familien die gleichen<br />
Probleme ergeben wie für die deutschen.<br />
Daneben ist zu fragen, ob sich die Rollenverteilung <strong>in</strong>nerhalb des sozialen Unterstützungsnetzwerks<br />
bei Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern von jener der Deutschen unterscheidet. Ausgangspunkt<br />
ist das nach wie vor gängige Altersbild der hilfebedürftigen Alten, die auf Unterstützung<br />
ihrer K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> anderer Familienangehöriger angewiesen s<strong>in</strong>d. Für die deutsche Bevölkerung<br />
haben gerade die Autoren der ersten Welle des Alterssurveys den Nachweis erbracht, dass gerade<br />
die Älteren ganz entscheidende Hilfen für die Jüngeren bereitstellen, sei es durch Betreuung<br />
ihrer Enkel oder sei es durch die Gewährung f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung (z. B.Kohli et al., 2000;<br />
Künem<strong>und</strong> & Hollste<strong>in</strong>, 2000; Motel & Szydlik, 1999; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, 2000). Die Ausweitung<br />
der Datenbasis um e<strong>in</strong>e separate Stichprobe für die ausländische Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland<br />
bietet erweiterte Möglichkeiten zur Beschreibung des Austauschs von sozialer Unterstützung.<br />
10.7.1 Unterstützungspotenziale <strong>und</strong> Unterstützungspersonen<br />
Nach der Untersuchung zentraler Beziehungsparameter <strong>in</strong>tergenerationaler familialer Beziehungen<br />
im vorangegangenen Unterkapitel, stehen nun die sozialen Unterstützungsbeziehungen im<br />
Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Geben von Hilfe verb<strong>in</strong>det sich mit dem Gefühl, gebraucht<br />
zu werden, <strong>und</strong> erhöht das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den. Die Existenz von Unterstützungsnetzwerken<br />
stellt e<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag zur Lebensqualität dar (Künem<strong>und</strong> & Hollste<strong>in</strong>, 2000). So<br />
kann beispielsweise familiäre Unterstützung <strong>und</strong> Zuwendung die Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>er<br />
selbstständigen Lebensführung <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Leben im vertrauten Umfeld ermöglichen. Dabei s<strong>in</strong>d<br />
Ältere gr<strong>und</strong>sätzlich nicht nur Empfänger von Unterstützungsleistungen, sondern leisten selbst<br />
auch Unterstützung. Auf Gr<strong>und</strong>lage der Daten des Alterssurveys konnte der Nachweis erbracht<br />
werden, dass Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte tatsächlich mehr Unterstützung leisten als<br />
sie im Gegenzug erhalten (Kohli et al., 2000; vgl. auch Kapitel 5 im vorliegenden Bericht). Natürlich<br />
beziehen sich diese Ergebnisse nur auf die deutsche Wohnbevölkerung. Es stellt sich nun<br />
also die Frage, ob für die ausländische Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong> ähnliches Muster festgestellt<br />
werden kann.<br />
Im Alterssurvey werden vier Formen der Unterstützung unterschieden: kognitive, emotionale,<br />
<strong>in</strong>strumentelle <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzielle. Kognitive Unterstützung wird operationalisiert als Rat bei wichtigen<br />
persönlichen Entscheidungen, emotionale Unterstützung als Trost <strong>und</strong> Aufmunterung, z.B.<br />
bei Traurigkeit, <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung als Hilfe im Haushalt, z.B. beim Saubermachen,<br />
485
486<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
bei kle<strong>in</strong>eren Reparaturen oder beim E<strong>in</strong>kaufen sowie f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung als Geld- <strong>und</strong><br />
größere Sachgeschenke oder regelmäßige f<strong>in</strong>anzielle Zuwendungen. Im folgenden wird die<br />
Darstellung zunächst auf die ersten drei Unterstützungstypen beschränkt. Abbildung 10.8 vergleicht<br />
das Nichtdeutschen <strong>und</strong> Deutschen zur Verfügung stehende Unterstützungspotenzial.<br />
Die l<strong>in</strong>ke Grafik benennt den Anteil der Befragten, die angaben, sich im Bedarfsfall an m<strong>in</strong>destens<br />
e<strong>in</strong>e konkrete Unterstützungsperson wenden zu können. Die rechte Grafik benennt die<br />
durchschnittliche Anzahl von potentiellen Helfern <strong>und</strong> Helfer<strong>in</strong>nen pro Unterstützungstyp.<br />
Abbildung 10.8:<br />
Anteil der Personen, die über potentielle Unterstützung verfügen <strong>und</strong> durchschnittliche Zahl<br />
der genannten potentiellen Unterstützungspersonen<br />
Mittelwert<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
kognitiv emotional<br />
Staatsangehörigkeit<br />
<strong>in</strong>strumentell<br />
Nichtdeutsche Deutsche<br />
Prozent<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
kognitiv emotional<br />
Staatsangehörigkeit<br />
<strong>in</strong>strumentell<br />
Nichtdeutsche Deutsche<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 3084), gewichtet, Ausländerstichprobe (n= 586), ungewichtet.<br />
Beim Blick auf den Anteil der verfügbaren Helfer je Unterstützungstyp fällt auf, dass sich die<br />
Unterstützungspotenziale von Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen kaum unterscheiden. Lediglich<br />
bei <strong>in</strong>strumenteller Unterstützung ist der Anteil der Deutschen größer, welcher das Vorhandense<strong>in</strong><br />
potentieller Haushaltshelfer, die nicht selbst im Haushalt leben, benennt. Angesichts der<br />
Tatsache, dass die ausländische Bevölkerungsgruppe noch deutlich häufiger mit K<strong>in</strong>dern zusammenlebt<br />
als die gleichaltrigen Deutschen, ergibt sich daraus e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Notwendigkeit,<br />
<strong>in</strong>strumentelle Hilfen von außerhalb des Haushalts e<strong>in</strong>zuholen.<br />
Unterschiede zwischen Nichtdeutschen <strong>und</strong> Deutschen f<strong>in</strong>den sich im H<strong>in</strong>blick auf die mittlere<br />
Zahl der genannten Unterstützungspersonen 8 . Wenn Deutsche Rat gebende Personen nennen,<br />
dann s<strong>in</strong>d dies durchschnittlich mehr als bei Ausländern <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen. Deutsche Frauen<br />
nennen durchschnittlich mehr Personen als deutsche Männer, bei den Nichtdeutschen gibt es<br />
ke<strong>in</strong>en Geschlechterunterschied. Auch das Alter spielt wiederum nur bei den Deutschen e<strong>in</strong>e<br />
Rolle: Jüngere nennen durchschnittlich mehr Personen.<br />
Im Gegensatz zum kognitiven Unterstützungspotenzial ist der Unterschied <strong>in</strong> der mittleren Personenzahl<br />
beim emotionalen Unterstützungspotenzial zwischen Deutschen <strong>und</strong> Ausländern<br />
8 Es konnten fünf Personen aufgeführt werden, sowie die Angabe ob mehr als fünf Personen genannt wurden. Dies<br />
wurde mit sechs codiert. Insofern handelt es sich um e<strong>in</strong>e eher konservative Schätzung. Die Mittelwerte beziehen<br />
sich hier auf die Personen, die m<strong>in</strong>d. e<strong>in</strong>e Unterstützungsperson angeben.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
nicht statistisch signifikant. Jedoch f<strong>in</strong>det sich auch hier der oben beschriebene Alterseffekt für<br />
die Deutschen. Die Geschlechtsunterschiede s<strong>in</strong>d hier sowohl bei Deutschen als auch bei Nichtdeutschen<br />
bedeutsam.<br />
Bei dem <strong>in</strong>sgesamt ger<strong>in</strong>gen Unterstützungspotenzial <strong>und</strong> dem signifikanten Unterschied zwischen<br />
der deutschen <strong>und</strong> der nichtdeutschen Bevölkerungsgruppe im Erhalt <strong>in</strong>strumenteller Hilfe<br />
ist zu berücksichtigen, dass nur nach Unterstützungspersonen außerhalb des Haushalts gefragt<br />
wurde. Demnach können mehr Deutsche auf <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung von Personen<br />
außerhalb des Haushalts zurückgreifen. Angesichts des höheren Anteils an Zweigenerationenhaushalten<br />
mit K<strong>in</strong>dern unter den Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern ersche<strong>in</strong>t es aber nicht unwahrsche<strong>in</strong>lich,<br />
dass Nichtdeutsche <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maße auf <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung von<br />
außerhalb des Haushalts angewiesen s<strong>in</strong>d. Wie die Analysen <strong>in</strong> Kapitel 5 des vorliegenden Berichtsbandes<br />
gezeigt haben, werden zudem Haushaltshilfen vor allem von 70- bis 85-Jährigen<br />
benötigt. Diese Altersgruppe ist jedoch bei den Nichtdeutschen klar unterrepräsentiert, so dass<br />
die Notwendigkeit dieser Form von Unterstützung nicht <strong>in</strong> demselben Umfang gegeben ist wie<br />
unter Deutschen.<br />
Während bisher nur die Personen betrachtet wurden, die überhaupt potentielle Helfer <strong>und</strong> Helfer<strong>in</strong>nen<br />
genannt hatten, wenden wir uns nun denjenigen zu, die über ke<strong>in</strong> Unterstützungspotenzial<br />
verfügen. In beiden Bevölkerungsgruppen hatte etwa e<strong>in</strong> Zehntel ke<strong>in</strong>en Zugang zu potentiellen<br />
Helfer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Helfern. Dabei war das Fehlen von kognitiven <strong>und</strong> emotionalen Hilfspersonen<br />
bei älteren Deutschen stärker ausgeprägt als bei jüngeren. Bei den Ausländern <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
gibt es h<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong>en klaren Geschlechtseffekt bei kognitiver <strong>und</strong> <strong>in</strong>strumenteller<br />
Unterstützung, aber ke<strong>in</strong>en Alterseffekt.<br />
Im folgenden wird exemplarisch am Beispiel kognitiver Unterstützung e<strong>in</strong> differenzierterer<br />
Blick auf das Unterstützungspotenzial e<strong>in</strong>zelner Nationalitätengruppen geworfen. Gibt es Unterschiede<br />
<strong>in</strong> der Häufigkeit der Nennung von potentiellen Helfer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Helfern nach Nationalität?<br />
E<strong>in</strong> guter Rat <strong>in</strong> schwierigen persönlichen Entscheidungssituationen setzt Wissen <strong>und</strong><br />
Erfahrung der Rat gebenden Person ebenso voraus wie e<strong>in</strong>e gewisse Vertrauensbasis zwischen<br />
Hilfesuchenden <strong>und</strong> Hilfeleistenden. In Tabelle 10.12 werden die kognitiven Unterstützungspotenziale<br />
von Menschen türkischer, ex-jugoslawischer <strong>und</strong> italienischer Staatsbürgerschaft verglichen.<br />
Die zentrale Unterstützungsperson im Fall von wichtigen persönlichen Entscheidungen ist sowohl<br />
für Deutsche als auch für Nichtdeutsche der Lebenspartner oder die Lebenspartner<strong>in</strong>.<br />
Demgegenüber spielen K<strong>in</strong>der e<strong>in</strong>e deutliche ger<strong>in</strong>gere Rolle, werden aber auch <strong>in</strong> dieser spezifischen<br />
Dimension sozialer Unterstützung noch vor Fre<strong>und</strong>en am zweithäufigsten genannt.<br />
Eltern haben wiederum e<strong>in</strong>e größere Bedeutung für Deutsche als für Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen,<br />
während weitere Verwandte <strong>in</strong> beiden Bevölkerungsgruppen nur selten genannt werden.<br />
Bei den türkischen Staatsangehörigen zeigt sich jedoch e<strong>in</strong> davon abweichendes Muster. Der<br />
Partner bzw. die Partner<strong>in</strong> wird zwar am häufigsten als Unterstützungsperson angeführt, aber<br />
deutlich seltener als von den Deutschen <strong>und</strong> den Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern <strong>in</strong>sgesamt.<br />
Dafür spielen K<strong>in</strong>der tendenziell e<strong>in</strong>e größere Rolle. Eltern, Geschwister <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e werden<br />
h<strong>in</strong>gegen seltener genannt. Die kognitiven Unterstützungspotenziale von Menschen aus dem<br />
487
488<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
früheren Jugoslawien <strong>und</strong> aus Italien ähneln <strong>in</strong> starkem Maße den <strong>in</strong> der deutschen Bevölkerung<br />
verbreiteten Mustern. So messen jugoslawische Staatsangehörige Fre<strong>und</strong>en im Fall von kognitiver<br />
Hilfe e<strong>in</strong>e ähnlich zentrale Rolle wie K<strong>in</strong>dern bei, während für Italiener <strong>und</strong> Italiener<strong>in</strong>nen<br />
neben der eigenen Kernfamilie <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en auch die Herkunftsfamilie vergleichsweise bedeutsam<br />
ist.<br />
Tabelle 10.12:<br />
Häufigkeit der Nennung von potentiellen Ratgebern (<strong>in</strong> Prozent)<br />
Deutsche Nichtdeutsche Türken Jugoslawen Italiener<br />
Partner 65,2 65,4 58,9 64,2 57,4<br />
K<strong>in</strong>der 29,2 27,1 43,2** 26,9 27,7<br />
Eltern 9,1 5,1** 3,2* 6,0 8,5<br />
Geschwister<br />
14,0 13,5<br />
6,3* 9,0 12,8<br />
And. Verw. 8,5 7,0 3,2 7,5 6,4<br />
Fre<strong>und</strong>e 23,5 20,3 9,5** 28,4 19,1<br />
Nachbarn/Kolleg. 3,2 3,4 1,1 1,5 4,3<br />
And. Pers. 3,7 2,4 2,1 3,0 4,3<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe, (n= 3084), gewichtet, Ausländerstichprobe (n= 586), ungewichtet.<br />
Signifikanztests beziehen sich auf Vergleiche zwischen Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen bzw. Deutschen <strong>und</strong> Personen<br />
mit der jeweiligen Staatsangehörigkeit: ** p
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Tabelle 10.13:<br />
Transfers <strong>und</strong> Hilfen von <strong>und</strong> an 40 bis 54-Jährige (<strong>in</strong> Prozent)<br />
F<strong>in</strong>anzielle Transfers Instrumentelle Hilfen<br />
ND D sig. ND D sig.<br />
von Eltern 4,4 9,2 ** 2,2 6,3 *<br />
an Eltern 15,7 2,9 ** 6,2 24,1 **<br />
von K<strong>in</strong>dern 1,4 0,9 n.s. 3,7 4,4 n.s.<br />
an K<strong>in</strong>der 18,0 22,9 n.s. 3,7 2,9 n.s.<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 1043), gewichtet, Ausländerstichprobe (n= 295), ungewichtet.<br />
Personen mit (Schwieger-)Eltern bzw. erwachsenen K<strong>in</strong>dern außerhalb des Haushalts.<br />
Die Daten für die mittlere Generation bestätigen das für die Deutschen aus der ersten Welle des<br />
Alterssurveys bekannte Muster, wonach f<strong>in</strong>anzielle Transfers vorrangig von der älteren an die<br />
jüngere Generation geleistet werden, während umgekehrt häufiger Mitglieder der jüngeren Generation<br />
<strong>in</strong>strumentelle Hilfe an Mitglieder der älteren Generationen leisten (Kohli et al., 2000).<br />
Interessant ist, dass dieses Muster für Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen nicht gilt. Zwar geben mit<br />
18 Prozent auch Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer weitaus häufiger f<strong>in</strong>anzielle Transfers an ihre<br />
K<strong>in</strong>der als sie von ihnen erhalten (1,4 Prozent). Deutlich mehr Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit<br />
unterstützen jedoch auch ihre Eltern f<strong>in</strong>anziell (16 Prozent). Das liegt daran, dass<br />
die große Mehrheit der Eltern ausländischer Befragter im Ausland lebt (vgl. Abschnitt 10.6.3<br />
zur Wohnentfernung). Dieses Ergebnis ist e<strong>in</strong> Beleg dafür, dass Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
ihre Angehörigen im Herkunftsland noch lange f<strong>in</strong>anziell unterstützen.<br />
Damit bef<strong>in</strong>den sich Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen der mittleren Generation also im Vergleich<br />
zu gleichaltrigen Deutschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er besonders belastenden Gebersituation, ohne selbst nennenswert<br />
(<strong>in</strong>strumentelle) Unterstützung zu erhalten. Instrumentelle Unterstützung setzt relative<br />
räumliche Nähe voraus, die <strong>in</strong> transnationalen Familienzusammenhängen nicht gegeben ist.<br />
Eltern, die im ökonomisch schlechter gestellten Herkunftsland leben oder dorth<strong>in</strong> zurückgekehrt<br />
s<strong>in</strong>d, werden von ihren K<strong>in</strong>dern f<strong>in</strong>anziell unterstützt. Diese transnationalen Rücküberweisungen<br />
s<strong>in</strong>d vor allem im Zusammenhang von Arbeitsmigration nicht nur Teil des oftmals familiären<br />
Migrationsprojekts, sie kompensieren teilweise auch die <strong>in</strong>strumentelle Hilfe, die aufgr<strong>und</strong><br />
der räumlichen Trennung nicht oder nur selten möglich ist.<br />
Im Folgenden werden die mittlere <strong>und</strong> die ältere Altersgruppe des Alterssurveys zusammengefasst,<br />
um nicht nur die Austauschbeziehungen zwischen Eltern <strong>und</strong> erwachsenen K<strong>in</strong>dern, sondern<br />
auch die zwischen Großeltern <strong>und</strong> Enkeln untersuchen zu können. Dies setzt die gleichzeitige<br />
Betrachtung beider Altersgruppen voraus. Erst bei den 70- bis 85-jährigen Befragten treten<br />
Enkel <strong>in</strong> ausreichender Anzahl auf, um diese Austauschbeziehungen untersuchen zu können.<br />
Die <strong>in</strong> Tabelle 10.13 beschriebenen Muster des Austauschs f<strong>in</strong>anzieller <strong>und</strong> <strong>in</strong>strumenteller<br />
Unterstützung zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> ähnlicher Weise auch bei den 55- bis<br />
85-Jährigen (vgl. Tabelle 10.14 unten).<br />
489
Tabelle 10.14:<br />
Transfers <strong>und</strong> Hilfen von <strong>und</strong> an 55 bis 85-Jährige<br />
490<br />
F<strong>in</strong>anzielle Transfers Instrumentelle Hilfen<br />
ND D sig. ND D sig.<br />
von Eltern - 4,3 * - 1,9 n.s.<br />
an Eltern 11,4 1,9 ** 8,0 17,6 n.s.<br />
von K<strong>in</strong>dern 4,5 1,9 * 10,1 13,0 n.s.<br />
an K<strong>in</strong>der 16,6 25,7 ** 6,0 7,5 n.s.<br />
von Enkeln - 0,3 n.s. - 1,2 n.s.<br />
an Enkel 12,8 16,2 n.s. - 0,3 n.s.<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Quelle: Alterssurvey 2002, Replikationsstichprobe (n= 1582), gewichtet, Ausländerstichprobe (n= 199), ungewichtet.<br />
Personen mit Eltern, K<strong>in</strong>dern bzw. Enkeln außerhalb des Haushalts.<br />
F<strong>in</strong>anzielle Transfers von Seiten der Eltern s<strong>in</strong>d häufiger bei älteren Deutschen. Ausländer <strong>und</strong><br />
Ausländer<strong>in</strong>nen leisten <strong>in</strong> dieser Altersgruppe wiederum zu e<strong>in</strong>em bedeutsamen Teil f<strong>in</strong>anzielle<br />
Hilfe an ihre Eltern. Im Austausch <strong>in</strong>strumenteller Hilfen unterscheiden sich Ausländer <strong>und</strong><br />
Ausländer<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> Deutsche andererseits <strong>in</strong>teressanterweise nicht mehr. Auch im<br />
H<strong>in</strong>blick auf Unterstützungsaustausch mit eigenen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Enkeln lässt sich anhand der<br />
Daten e<strong>in</strong> sehr ähnliches Muster bei deutschen <strong>und</strong> nichtdeutschen Älteren konstatieren. Es<br />
entspricht dem Bild, das oben bereits für die Deutschen beschrieben wurde: Die älteren Menschen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte s<strong>in</strong>d f<strong>in</strong>anziell <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Geber an beide jüngeren Generationen<br />
<strong>und</strong> im H<strong>in</strong>blick auf nichtmonetäre Hilfen vor allem Empfänger – allerd<strong>in</strong>gs fast ausschließlich<br />
seitens der K<strong>in</strong>dergeneration. Enkeln kommt hier nur e<strong>in</strong>e sehr marg<strong>in</strong>ale Rolle zu.<br />
Insgesamt zeigen die Daten des Alterssurvey, dass Ausländer <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> ähnlichem Maße<br />
sozial e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d wie Deutsche. Die Kernfamilie ist sowohl für Deutsche als auch für<br />
Ausländer zentraler sozialer Bezugspunkt. Der weitaus größte Teil verfügt ebenso wie der größte<br />
Teil der Deutschen über soziale Kontakte sowie potentielle Unterstützung <strong>und</strong> damit über<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzung für positive Lebensqualität <strong>und</strong> soziale Integration. E<strong>in</strong> Austausch<br />
<strong>und</strong> soziale Unterstützung zwischen den Generationen f<strong>in</strong>det statt.<br />
Das Niveau ist bei Ausländern fast durchgängig niedriger als bei Deutschen. Allerd<strong>in</strong>gs muss<br />
im H<strong>in</strong>blick auf <strong>in</strong>strumentelle Hilfe berücksichtigt werden, dass nur nach Personen außerhalb<br />
des Haushalts gefragt wurde. Insgesamt können die <strong>in</strong>tergenerationalen Beziehungen sowohl für<br />
Deutsche als auch für Nichtdeutsche als überwiegend räumlich nah, emotional eng, von häufigem<br />
Kontakt <strong>und</strong> ähnlichen Unterstützungsmustern geprägt, beschrieben werden. Bedeutsame<br />
Unterschiede zwischen den beiden Staatsangehörigkeitsgruppen f<strong>in</strong>den sich jedoch <strong>in</strong> den Beziehungen<br />
zu den Eltern. Sie s<strong>in</strong>d von der Tatsache bestimmt, dass e<strong>in</strong> Großteil der Eltern der<br />
Nichtdeutschen im Ausland lebt. Diese Beziehungen werden transnational gepflegt. Kennzeichnend<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere, aber immer noch überwiegend rege Kontakthäufigkeit <strong>und</strong> vergleichsweise<br />
häufige f<strong>in</strong>anzielle Transfers. Ausländer bewerten ihre Elternbeziehungen bei größerer<br />
räumlicher Entfernung <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gerer Kontakthäufigkeit <strong>in</strong>sgesamt enger als die Deutschen.<br />
Neben kulturellen Unterschieden trägt möglicherweise die größere Entfernung dazu bei.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
10.8 Zusammenfassung <strong>und</strong> Implikationen<br />
10.8.1 Zusammenfassung<br />
Die Ausländerstichprobe des Alterssurveys bietet e<strong>in</strong>e Datenbasis für die Analyse zentraler<br />
Dimensionen der Lebenssituation von Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit <strong>in</strong> der<br />
zweiten Lebenshälfte. In diesem Kapitel wurden zentrale Dimensionen der sozialen Lage im<br />
H<strong>in</strong>blick auf ihre Bedeutung für die Lebensqualität <strong>und</strong> den Grad der Teilhabe <strong>und</strong> Integration<br />
der älteren Ausländer betrachtet, mit e<strong>in</strong>em thematischen Schwerpunkt auf dem Aspekt der<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> Familienbeziehungen <strong>und</strong> Unterstützungsnetzwerke.<br />
Die Daten bestätigen die bisherigen Kenntnisse zur materiellen Lage älterer Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen.<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer verfügen im Durchschnitt über niedrigere E<strong>in</strong>kommen<br />
als gleichaltrige Deutsche. Dementsprechend s<strong>in</strong>d sie häufiger von Armut betroffen als<br />
Deutsche <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d seltener wohlhabend. Sie besitzen seltener Wohneigentum <strong>und</strong> teilen sich<br />
ihre durchschnittlich kle<strong>in</strong>eren <strong>und</strong> weniger gut ausgestatteten Wohnungen mit mehr Personen.<br />
Diese Schlechterstellung <strong>in</strong> den objektiven Lebensbed<strong>in</strong>gungen im Vergleich zu den Deutschen<br />
f<strong>in</strong>det ihren Ausdruck <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>sgesamt niedrigerem subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den. Anders als<br />
bei den Deutschen, bei denen sich die Situation hochaltriger, zumeist verwitweter <strong>und</strong> demzufolge<br />
alle<strong>in</strong>lebender Frauen als besonders problematisch darstellt, gibt es bei Ausländer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ausländern <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ke<strong>in</strong>en vergleichbaren Geschlechtseffekt.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> nachteiliger Arbeits- <strong>und</strong> Wohnbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit e<strong>in</strong>em<br />
von e<strong>in</strong>er Migrationsbiografie geprägten Leben war e<strong>in</strong>e deutlich schlechtere ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Situation im Vergleich zu den Deutschen erwartet worden. Daten zur subjektiven Bewertung<br />
des Ges<strong>und</strong>heitszustandes, zu ges<strong>und</strong>heitlichen E<strong>in</strong>schränkungen <strong>und</strong> Hilfebedarf bestätigen<br />
diese Hypothese jedoch nicht. Allerd<strong>in</strong>gs schätzen Nichtdeutsche mittleren Alters ihre Ges<strong>und</strong>heit<br />
deutlich schlechter e<strong>in</strong> als gleichaltrige Deutsche. Unterschiede bei Kontrolle des Alters<br />
s<strong>in</strong>d demnach e<strong>in</strong> H<strong>in</strong>weis darauf, dass die große Heterogenität der ausländischen Bevölkerung<br />
<strong>in</strong> gewisser Weise nivellierend wirkt.<br />
E<strong>in</strong>e Form der gesellschaftlichen Integration <strong>und</strong> Partizipation am sozialen <strong>und</strong> politischen Leben<br />
stellt das Engagement <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Organisationen dar. Obwohl der Organisationsgrad<br />
von Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern h<strong>in</strong>ter dem der gleichaltrigen Deutschen zurückbleibt, ist<br />
der Abstand weitaus ger<strong>in</strong>ger als erwartet. Außerdem gilt zu bedenken, dass das Erhebungs<strong>in</strong>strument<br />
primär auf die Bedürfnisse der deutschen Bevölkerung zugeschnitten war.<br />
Soziale E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung f<strong>in</strong>det durch familiale <strong>und</strong> außerfamiliale Beziehungen <strong>und</strong> Unterstützungsnetzwerke<br />
statt. Ausländer <strong>und</strong> Ausländer<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem gesellschaftlichen Bereich ebenso<br />
<strong>in</strong>tegriert wie Deutsche, d.h. sie s<strong>in</strong>d nicht häufiger von Vere<strong>in</strong>samung <strong>und</strong> Isolation betroffen.<br />
Andererseits ist der Grad der sozialen Integration auch nicht nennenswert größer als bei<br />
Deutschen. Es gibt jedoch durchaus e<strong>in</strong>e Reihe von Unterschieden: Nichtdeutsche leben <strong>in</strong><br />
durchschnittlich größeren Haushalten <strong>und</strong> öfter <strong>in</strong> Zweigenerationenhaushalten mit ihren K<strong>in</strong>dern.<br />
491
492<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Die Familie nimmt im Leben von Nichtdeutschen ebenso e<strong>in</strong>e zentrale Stellung e<strong>in</strong> wie bei den<br />
Deutschen. Der Großteil der K<strong>in</strong>der von Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen lebt <strong>in</strong> der näheren<br />
Umgebung der Eltern <strong>und</strong> bietet so die Möglichkeit für direkte Interaktion <strong>und</strong> Kommunikation.<br />
E<strong>in</strong> zentraler Unterschied besteht jedoch dar<strong>in</strong>, dass von e<strong>in</strong>em nicht ger<strong>in</strong>gen Teil der Nichtdeutschen<br />
alle K<strong>in</strong>der im Ausland leben. Noch bedeutsamer ist jedoch die Transnationalität <strong>in</strong><br />
der Beziehung zu den Eltern – bei den nichtdeutschen Staatsangehörigen leben diese überwiegend<br />
im Ausland. Die Wohnentfernung hat offensichtlich Auswirkungen auf die Kontakthäufigkeit,<br />
jedoch nicht auf die empf<strong>und</strong>ene Enge der Beziehung. Während Deutsche häufiger Kontakt<br />
zu ihren näher wohnenden Eltern pflegen, haben Nichtdeutsche zwar seltener Kontakt zu<br />
ihren weiter entfernt wohnenden Eltern, bezeichnen die Beziehung jedoch ebenfalls als eng<br />
bzw. sehr eng.<br />
E<strong>in</strong> <strong>in</strong>teressantes Muster ergibt sich auch im H<strong>in</strong>blick auf f<strong>in</strong>anzielle <strong>und</strong> <strong>in</strong>strumentelle Hilfen.<br />
Im Gegensatz zu den aus der ersten Welle des Alterssurveys bekannten Ergebnissen für die<br />
deutschen 40- bis 85-Jährigen, erhalten nichtdeutsche Angehörige der mittleren Generation<br />
nicht nur wenig f<strong>in</strong>anzielle Hilfen von ihren Eltern – sie leisten auch umgekehrt mehr f<strong>in</strong>anzielle<br />
Unterstützung an ihre im Herkunftsland lebenden Eltern. Dies kann zum e<strong>in</strong>en mit dem i.d.R.<br />
vorhandenen ökonomischen Gefälle zwischen Aufnahmeland <strong>und</strong> Herkunftsland erklärt werden<br />
<strong>und</strong> dem Bedarf der Eltern im wirtschaftlich schwächeren Herkunftsland. Zum anderen stellen<br />
f<strong>in</strong>anzielle Transfers vermutlich auch e<strong>in</strong>e Kompensation für – aufgr<strong>und</strong> der großen räumlichen<br />
Entfernung – nicht zu realisierende <strong>in</strong>strumentellen Hilfe dar.<br />
10.8.2 Sozial- <strong>und</strong> gesellschaftspolitische Implikationen<br />
Der Alterssurvey bietet umfangreiches Datenmaterial für e<strong>in</strong>e Analyse vielfältiger Lebensbereiche<br />
der ausländischen <strong>und</strong> der deutschen Bevölkerung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Die besondere<br />
Stärke des Alterssurveys besteht dar<strong>in</strong>, dass Interaktionen zwischen e<strong>in</strong>zelnen Lebensbereichen<br />
im Detail analysiert werden können. Die ausländische Bevölkerungsgruppe <strong>in</strong> Deutschland<br />
ist <strong>in</strong> sich jedoch sehr heterogen <strong>und</strong> besteht aus vielen ethnischen Gruppen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Vielzahl<br />
von Nationalitäten (vgl. auch Tabelle 10.A1 im Anhang). Dies erschwert zum e<strong>in</strong>en die<br />
Datenanalyse <strong>und</strong> die Aussagekraft der Analyseergebnisse, da jeweils nur ger<strong>in</strong>ge Fallzahlen<br />
zur Verfügung stehen. Zum anderen ist es kaum möglich, e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Sozialpolitik für alle<br />
ausländischen Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte zu gestalten. Dennoch wird im folgenden<br />
der Versuch unternommen, auf der Basis gewisser Regelmäßigkeiten <strong>in</strong> den Lebensverhältnissen<br />
40- bis 85-jähriger Nichtdeutscher, sozial- <strong>und</strong> gesellschaftspolitische Empfehlungen zu<br />
geben.<br />
Das aus der Literatur zur allgeme<strong>in</strong>en Lebenssituation von Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern <strong>in</strong><br />
Deutschland h<strong>in</strong>länglich bekannte Ergebnis relativer sozio-ökonomischer Deprivation (ger<strong>in</strong>gere<br />
Schul- <strong>und</strong> Berufsbildungsqualifikationen, niedrige E<strong>in</strong>kommen, stärkere Betroffenheit von<br />
Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> Armut – <strong>und</strong> daraus folgend niedrigere Altersrenten, seltener Wohneigentum)<br />
wurde mit den Daten des Alterssurveys bestätigt. Ausländische Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte s<strong>in</strong>d dementsprechend stärker auf staatliche f<strong>in</strong>anzielle Transfers angewiesen als<br />
gleichaltrige Deutsche. Diese stärkere Bedürftigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass ausländi-
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
sche Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ke<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung von ihren (im Herkunftsland)<br />
lebenden Eltern erwarten können. Im Gegenteil, die <strong>in</strong> Deutschland lebenden 40- bis<br />
85-Jährigen spielen selbst e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle als f<strong>in</strong>anzielle Unterstützer ihrer im Herkunftsland<br />
zurückgebliebenen Familienangehörigen. Die deutsche Sozialpolitik sieht sich dementsprechend<br />
dem Dilemma gegenüber, mit f<strong>in</strong>anziellen staatlichen Transfers nicht nur bedürftige<br />
ausländische Menschen im eigenen Land, sondern de facto auch noch bedürftigere Menschen<br />
im Ausland zu unterstützen.<br />
Auf der anderen Seite s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Deutschland lebende Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem<br />
Maße auf <strong>in</strong>strumentelle Haushaltshilfen angewiesen. Das liegt zum e<strong>in</strong>en dar<strong>in</strong>, dass sie<br />
öfter mit K<strong>in</strong>dern im eigenen Haushalt leben <strong>und</strong> so auf dieses Unterstützungspotenzial zurückgreifen<br />
können. Zu bedenken gilt jedoch, dass die Arbeitsmigrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -migranten der ersten<br />
Anwerbungswellen <strong>in</strong> den 1950er Jahren erst <strong>in</strong> den nächsten Jahren die Lebensphase der<br />
Hochaltrigkeit erreichen werden. Die verstärkte Notwendigkeit außerhäuslicher <strong>in</strong>strumenteller<br />
Hilfen ergibt sich jedoch auch <strong>in</strong> der deutschen Bevölkerung erst ab e<strong>in</strong>em Alter von 70 Jahren.<br />
Es ist also fraglich, ob es sich bei diesem Ergebnis um e<strong>in</strong>en genu<strong>in</strong>en Unterschied zwischen<br />
Nichtdeutschen <strong>und</strong> Deutschen oder lediglich um e<strong>in</strong>en Alterseffekt der im Durchschnitt jüngeren<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer handelt. Es ist e<strong>in</strong>e wesentliche Aufgabe zukünftiger Alterssozialberichterstattung,<br />
dieser Frage nachzugehen.<br />
Sollte das Letztere der Fall se<strong>in</strong>, dann werden hochaltrige Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer <strong>in</strong><br />
Zukunft ebenfalls auf externe <strong>in</strong>strumentelle Hilfen angewiesen se<strong>in</strong>. Aufgr<strong>und</strong> der zuvor beschrieben,<br />
ökonomisch deprivierten Lebensumstände werden sie jedoch kaum <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong>,<br />
für Haushaltshilfen zu bezahlen. Hochaltrige Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer könnten so zu e<strong>in</strong>er<br />
wesentlichen Zielgruppe zukünftiger sozialpolitischer Interventionen werden.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist es notwendig, bei der Planung zukünftiger ambulanter <strong>und</strong> stationärer Pflegestrukturen<br />
die besonderen Bedürfnisse dieser, aus anderen Kulturkreisen stammenden Personen<br />
zu berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass sich mit der rapiden Alterung der ausländischen<br />
Bevölkerungsgruppe e<strong>in</strong> starker zusätzlicher Bedarf an Pflegee<strong>in</strong>richtungen ergeben<br />
wird. Dabei sollte besonderer Wert auf e<strong>in</strong>e kultursensible Pflege gelegt werden.<br />
Es ist e<strong>in</strong>e wesentliche Aufgabe deutscher Gesellschafts- <strong>und</strong> Sozialpolitik, zu e<strong>in</strong>er gel<strong>in</strong>genden<br />
Integration ausländischer Menschen beizutragen. Die Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen<br />
wird am besten durch umfassende Bildungsangebote für alle Altersgruppen erhöht. Dies bedeutet<br />
u.a. Sprachkurse auch für ältere Menschen anzubieten. Langfristig noch wichtiger ist es aber,<br />
schulische <strong>und</strong> berufliche Qualifikationen der jüngeren Generationen zu erhöhen, um diese <strong>in</strong><br />
die Lage zu versetzen, sich selbst <strong>und</strong> ihren Familienangehörigen zu helfen. Das ist das Ziel<br />
e<strong>in</strong>er aktivierenden Sozialpolitik – <strong>und</strong> das ist auch das Ziel e<strong>in</strong>er erfolgreichen Generationenpolitik<br />
(vgl. dazu auch die Ausführungen <strong>in</strong> Kapitel 5).<br />
493
10.9 Literatur<br />
494<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Adolph, H. (2001). Die Situation älterer Migranten <strong>in</strong> Deutschland im Spiegel des Dritten Altenberichts<br />
der B<strong>und</strong>esregierung, Berl<strong>in</strong>.<br />
Bertram, H. (2000). Die verborgenen familiären Beziehungen <strong>in</strong> Deutschland: Die multilokale<br />
Mehrgenerationenfamilie. In M. Kohli & M. Szydlik (Eds.), Generationen <strong>in</strong> Familie<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft (pp. 97-121). Opladen: Leske + Budrich.<br />
BMAS, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung (Ed.). (2001). Lebenslagen <strong>in</strong><br />
Deutschland. Der erste Armuts- <strong>und</strong> Reichtumsbericht der B<strong>und</strong>esregierung. Bonn:<br />
BMAS.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Ed.). (1999). Ältere<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer <strong>in</strong> Deutschland. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Ed.). (2000). Familien<br />
ausländischer Herkunft <strong>in</strong> Deutschland. Leistungen, Belastungen, Herausforderungen.<br />
Sechster Familienbericht. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Ed.). (2001). Dritter<br />
Altenbericht. Allgeme<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme der Lebenssituation älterer Menschen <strong>in</strong><br />
Deutschland. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.<br />
Bolzman, C., Poncioni-Derigo, R., Vial, M., & Fibbi, R. (2004). Old labour migrants well be<strong>in</strong>g<br />
<strong>in</strong> Europe: the case of Switzerland. Age<strong>in</strong>g and Society, 24(3), 411-429.<br />
Connidis, I. A. (2001). Family ties & age<strong>in</strong>g. Thousand Oaks: Sage.<br />
Diehl, C. (2000). Die Partizipation von Migranten <strong>in</strong> Deutschland. Rückzug oder Mobilisierung?<br />
Opladen: Leske + Budrich.<br />
Diehl, C., Urbahn, J., & Esser, H. (1998). Die soziale <strong>und</strong> politische Partizipation von Zuwanderern<br />
<strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.<br />
Dietzel-Papakyriakou, M. (1993). Altern <strong>in</strong> der Migration. Die Arbeitsmigranten vor dem Dilemma:<br />
Zurückkehren oder bleiben? Stuttgart: Enke.<br />
Dietzel-Papakyriakou, M. (1999). Wanderungen alter Menschen - das Beispiel der Rückwanderungen<br />
der älteren Arbeitsmigranten. In G. Naegele & R.-M. Schütz (Eds.), Soziale Gerontologie<br />
<strong>und</strong> Sozialpolitik für ältere Menschen (pp. 141-156). Wiesbaden: Westdeutscher<br />
Verlag.<br />
Dietzel-Papakyriakou, M., & Olbermann, E. (1998). Wohnsituation älterer Migranten <strong>in</strong><br />
Deutschland. In D. Z. f. Altersfragen (Ed.), Wohnverhältnisse älterer Migranten. Expertisenband<br />
4 zum Zweiten Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
DZA, Deutsches Zentrum für Altersfragen (2003). Ältere Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Migranten <strong>in</strong><br />
Deutschland. Informationsdienst Alterfragen. Themenheft "Ältere Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Migranten", 30(1), 11-13.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Eggen, B. (1997). Familiale <strong>und</strong> ökonomische Lage älterer Deutscher <strong>und</strong> Ausländer. In K.<br />
Eckart & S. Gr<strong>und</strong>mann (Eds.), Demographischer <strong>Wandel</strong> <strong>in</strong> der demographischen Dimension<br />
<strong>und</strong> Perspektive (pp. 83-110). Berl<strong>in</strong>: Duncker & Humblot.<br />
Elwert, G. (1982). Probleme der Ausländer<strong>in</strong>tegration. Gesellschaftliche Integration durch B<strong>in</strong>nen<strong>in</strong>tegration?<br />
Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie, 34(4), 717-<br />
731.<br />
Enquete-Kommission (Ed.). (1998). Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Demographischer<br />
<strong>Wandel</strong>" - Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an<br />
den e<strong>in</strong>zelnen <strong>und</strong> die Politik. Bonn: Deutscher B<strong>und</strong>estag.<br />
Esser, H. (1980). Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation <strong>und</strong> Integration von Wanderern,<br />
ethnischen Gruppen <strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheiten. E<strong>in</strong>e handlungstheoretische Analyse.<br />
Neuwied: Luchterhand.<br />
Esser, H. (1986). Ethnische Kolonien: 'B<strong>in</strong>nen<strong>in</strong>tegration' oder gesellschaftliche Isolation? In J.<br />
H. P. Hoffmeyer-Zlotnik (Ed.), Segregation <strong>und</strong> Integration. Die Situation von Arbeitsmigranten<br />
im Aufnahmeland (pp. 106-117). Mannheim: Forschung, Raum <strong>und</strong> Gesellschaft.<br />
Giarusso, R., Stall<strong>in</strong>gs, M., & Bengtson, V. L. (1995). The "<strong>in</strong>tergenerational stake" hypothesis<br />
revisited: Parent-child differences <strong>in</strong> perceptions of relationships 20 years later. In V. L.<br />
Bengtson & K. Warner Schaie & L. M. Burton (Eds.), Adult <strong>in</strong>tergenerational relations:<br />
Effects of societal change (pp. 227-263). New York: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Hamburg, F. u. H. (1998). Älter werden <strong>in</strong> der Fremde. Wohn- <strong>und</strong> Lebenssituation älterer ausländischer<br />
Hamburger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Hamburger. Hamburg: Freie <strong>und</strong> Hansestadt Hamburg.<br />
Han, P. (2000). Soziologie der Migration. Stuttgart: Lucius & Lucius.<br />
H<strong>in</strong>richs, W. (2003). Ausländische Bevölkerungsgruppen <strong>in</strong> Deutschland. Integrationschancen<br />
1985 <strong>und</strong> 2000. Berl<strong>in</strong>: Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung.<br />
Hoff, A., Tesch-Römer, C., Wurm, S., & Engstler, H. (2003). "Die zweite Lebenshälfte" - der<br />
Alterssurvey zwischen gerontologischer Längsschnittanalyse <strong>und</strong> Alterssozialberichterstattung<br />
im Längsschnitt. In F. Karl (Ed.), Sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftliche Gerontologie.<br />
We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Hoffmann-Nowotny, H.-J. (1973). Soziologie des Fremdarbeiterproblems. Stuttgart: Enke.<br />
<strong>in</strong>fas. (2003). Alterssurvey - Die zweite Lebenshälfte. Methodenbericht zur Erhebung der zweiten<br />
Welle 2002. Bonn: <strong>in</strong>fas.<br />
Kirchberger, I. (2000). Der SF-36-Fragebogen zum Ges<strong>und</strong>heitszustand: Anwendung, Auswertung<br />
<strong>und</strong> Interpretation. In U. Ravens-Sieberer & A. Cieza (Eds.), Lebensqualität <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsökonomie <strong>in</strong> der Mediz<strong>in</strong> (pp. 73-85). Landsberg: ecomed.<br />
Kohli, M., & Künem<strong>und</strong>, H. (1996). Nachberufliche Tätigkeitsfelder - Konzepte, Forschungslagen,<br />
Empirie. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
495
496<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A., & Szydlik, M. (2000). Generationenbeziehungen. In M.<br />
Kohli u. H. Künem<strong>und</strong> (Ed.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation<br />
im Spiegel des Alters-Survey (pp. 176-211). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Krumme, H. (2004). Fortwährende Remigration: Das transnationale Pendeln türkischer Arbeitsmigrant<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Arbeitsmigranten im Ruhestand. Zeitschrift für Soziologie, 2,<br />
138-153.<br />
Kulbach, R. (1999). Probleme älterer Migranten <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Soziale<br />
Arbeit, 10-11, 392-398.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2000a). "Produktive" Tätigkeiten. In M. Kohli u. H. Künem<strong>und</strong> (Ed.), Die zweite<br />
Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-Survey<br />
(pp. 277-317). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2000b). Ges<strong>und</strong>heit. In M. Kohli u. H. Künem<strong>und</strong> (Ed.), Die zweite Lebenshälfte.<br />
Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-Survey (pp. 102-123).<br />
Opladen: Leske + Budrich.<br />
Künem<strong>und</strong>, H., & Hollste<strong>in</strong>, B. (2000). Soziale Beziehungen <strong>und</strong> Unterstützungsnetzwerke. In<br />
M. Kohli u. H. Künem<strong>und</strong> (Ed.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong><br />
Partizipation im Spiegel des Alters-Survey (pp. 212-276). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Lauterbach, W., & Pillemer, K. (2001). Social structure and the family: A United States - Germany<br />
comparison of residential proximity between parents and adult children. Zeitschrift<br />
für Familienforschung, 13(1), 68-88.<br />
Lechner, I., & Mielck, A. (1998). Die Verkle<strong>in</strong>erung des 'Healthy-Migrant-Effects': <strong>Entwicklung</strong><br />
der Morbidität von ausländischen <strong>und</strong> deutschen Befragten im sozioökonomischen<br />
Panel 1984-1992. Ges<strong>und</strong>heitswesen, 60, 715-720.<br />
Lüscher, K. (2000). Die Ambivalenz von Generationenbeziehungen - e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e heuristische<br />
Hypothese. In M. Kohli (Ed.), Generationen im Familie <strong>und</strong> Gesellschaft (pp. 138-<br />
161). Opladen.<br />
Lüscher, K., & Pillemer, K. (1996). Die Ambivalenz familialer Generationenbeziehungen Konzeptuelle<br />
Überlegungen zu e<strong>in</strong>em aktuellen Thema der familienwissenschaftlichen Forschung.<br />
Konstanz.<br />
Lüscher, K., & Pillemer, L. (1998). Intergenerational ambivalence: A new approach to the study<br />
of parent-child relations <strong>in</strong> later life. Journal of Marriage and the Family, 60, 413-425.<br />
Marbach, J. H. (1994). Der E<strong>in</strong>fluß von K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Wohnentfernung auf die Beziehungen<br />
zwischen Eltern <strong>und</strong> Großeltern: E<strong>in</strong>e Prüfung des quasi-experimentellen Designs der<br />
Mehrgenerationenstudie. In W. Bien (Ed.), Eigen<strong>in</strong>teresse oder Solidarität. Beziehungen<br />
<strong>in</strong> modernen Mehrgenerationenfamilien (pp. 77-112). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Mart<strong>in</strong>ez, H. M., & Avgoustis, G. (1998). Ältere Migranten <strong>und</strong> Selbstorganisation. Bonn:<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der Immigrantenverbände <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik e.V.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Motel, A. (2000). E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Vermögen. In M. K. u. H. Künem<strong>und</strong> (Ed.), Die zweite Lebenshälfte.<br />
Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-Survey (pp.<br />
41-101). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Motel, A., & Szydlik, M. (1999). Private Transfers zwischen den Generationen. Zeitschrift für<br />
Soziologie, 28, 3-22.<br />
Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. (2000). Alter <strong>und</strong> Generationenvertrag im <strong>Wandel</strong> des Sozialstaats. Alterssicherung<br />
<strong>und</strong> private Generationenbeziehungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Berl<strong>in</strong>:<br />
Weißensee.<br />
Naegele, G., & Olbermann, E. (1997). Ältere Ausländer - ihre Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Zukunftsperspektiven<br />
im Prozess des demographischen <strong>Wandel</strong>s. In K. Eckart & S.<br />
Gr<strong>und</strong>mann (Eds.), Demographischer <strong>Wandel</strong> <strong>in</strong> der demographischen Dimension <strong>und</strong><br />
Perspektive (pp. 71-81). Berl<strong>in</strong>: Duncker & Humblot.<br />
Olbermann, E. (1993). Ältere Ausländer - e<strong>in</strong>e Zielgruppe für Altenarbeit <strong>und</strong> -politik. In S.<br />
Kühnert & G. Naegele (Eds.), Perspektiven moderner Altenpolitik <strong>und</strong> Altenarbeit (pp.<br />
149-170). Hannover: V<strong>in</strong>centz.<br />
Olbermann, E., & Dietzel-Papakyriakou, M. (1995). <strong>Entwicklung</strong> von Konzepten <strong>und</strong> Handlungsstrategien<br />
für die Versorgung älter werdender <strong>und</strong> älterer Ausländer. Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung.<br />
Prahl, H.-W., & Schroeter, K.-R. (1996). Soziologie des Alterns. Paderborn: Schön<strong>in</strong>gh.<br />
Radoschewski, M., & Bellach, B.-M. (1999). Der SF-36 im B<strong>und</strong>es- Ges<strong>und</strong>heits-Survey- Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Anforderungen der Nutzung auf der Bevölkerungsebene. Ges<strong>und</strong>heitswesen,<br />
61(2), 191-199.<br />
Schneiderhe<strong>in</strong>z, K. (1998). Regionale Unterschiede der Wohnverhältnisse älterer Migranten <strong>in</strong><br />
Deutschland. In D. Z. f. Altersfragen (Ed.), Wohnverhältnisse älterer Migranten. Expertisenband<br />
4 zum Zweiten Altenbericht der B<strong>und</strong>esregierung. Frankfurt/Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Schulte, A. (1995). Zur Lebenssituation <strong>und</strong> Integration älterer Migranten <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. In W. Seifert (Ed.), Wie Migranten leben: Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong><br />
soziale Lage der ausländischen Bevölkerung <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik (pp. 61-73). Berl<strong>in</strong>:<br />
Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung.<br />
Söhn, N. (2000). Rechercheprojekt zum Thema "Ältere MigrantInnen" - Literatur <strong>und</strong> Daten.<br />
Unveröffentlichter Bericht. Berl<strong>in</strong>: Freie Universität.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (Ed.) (2002): Bevölkerung <strong>und</strong> Erwerbstätigkeit -Ausländische Bevölkerung<br />
sowie E<strong>in</strong>bürgerungen. Fachserie 1, Reihe 2.<br />
Wiesbaden.Szydlik, M. (2000). Lebenslange Solidarität? Generationenbeziehungen zwischen<br />
erwachsenen K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern. Opladen: Leske + Budrich.<br />
Tesch-Römer, C., Wurm, S., Hoff, A., & Engstler, H. (2002). Alterssozialberichterstattung im<br />
Längsschnitt: Die zweite Welle des Alterssurveys. In A. Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel & U. Kelle<br />
(Eds.), Perspektiven der empirischen Alter(n)ssoziologie (pp. 155-190). Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
497
498<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff<br />
Treibel, A. (2003). Migration <strong>in</strong> modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von E<strong>in</strong>wanderung,<br />
Gastarbeit <strong>und</strong> Flucht. We<strong>in</strong>heim: Juventa.<br />
Tufan, I. (1999). Über die ges<strong>und</strong>heitliche Lage der älteren türkischen MigrantInnen <strong>in</strong><br />
Deutschland. IZA: Zeitschrift für Migration <strong>und</strong> Soziale Arbeit, 2, 50-53.<br />
Zentrum für Türkeistudien. (1992). Lebenssituation <strong>und</strong> spezifische Problemlage älterer ausländischer<br />
E<strong>in</strong>wohner <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung.<br />
Zoll, R. (Ed.). (1997). Die soziale Lage älterer MigrantInnen <strong>in</strong> Deutschland. Münster: Lit.
Kapitel 10: Lebenssituation älterer Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer<br />
Tabelle A10.1: Zusammensetzung der Ausländerstichprobe des Alterssurveys (2002)<br />
nach Staatsangehörigkeit (Selbstangabe, Frage 329)<br />
Fallzahl (n) Anteil an der Stichprobe<br />
(Prozent)<br />
Europa<br />
EU-Mitgliedsländer (bis 30.05.2004)<br />
Italien 47 8,0<br />
Griechenland 27 4,6<br />
Österreich 28 4,8<br />
Niederlande 18 3,1<br />
Frankreich 12 2,0<br />
Großbritannien 9 1,5<br />
Portugal 5 0,9<br />
Spanien 4 0,7<br />
Irland 2 0,3<br />
F<strong>in</strong>nland 2 0,3<br />
Belgien 1 0,2<br />
Dänemark 1 0,2<br />
Schweden 1 0,2<br />
Türkei 95 16,2<br />
Schweiz 7 1,2<br />
Island 1 0,2<br />
Osteuropa<br />
Staaten des ehemaligen Jugoslawien 67 11,4<br />
Staaten der ehemaligen Sowjetunion 35 6,0<br />
Polen 13 2,2<br />
Tschechien/Slowakei/Tschechoslowakei 6 1,1<br />
Rumänien 5 0,9<br />
Ungarn 3 0,5<br />
Nord- <strong>und</strong> Südamerika<br />
USA 16 2,7<br />
Brasilien 1 0,2<br />
Kolumbien 1 0,2<br />
Peru 1 0,2<br />
Afrika<br />
Ghana 3 0,5<br />
Algerien 1 0,2<br />
Eritrea 1 0,2<br />
Marokko 1 0,2<br />
Sambia 1 0,2<br />
Senegal 1 0,2<br />
Tunesien 1 0,2<br />
499
Tabelle A10.1 (fortgesetzt)<br />
500<br />
Fallzahl (n) Anteil an der Stichprobe<br />
(Prozent)<br />
Naher <strong>und</strong> mittlerer Osten<br />
Irak 3 0,5<br />
Libanon 3 0,5<br />
Israel 1 0,2<br />
Jordanien 1 0,2<br />
Kurdistan 1 0,2<br />
Paläst<strong>in</strong>a/Jordanien 1 0,2<br />
Asien<br />
Iran 6 1,0<br />
Indien 5 0,9<br />
Afghanistan 4 0,7<br />
Vietnam 4 0,7<br />
Ch<strong>in</strong>a 3 0,5<br />
Malaysia 3 0,5<br />
Philipp<strong>in</strong>en 3 0,5<br />
Thailand 3 0,5<br />
Pakistan 2 0,3<br />
Japan 1 0,2<br />
Indonesien 1 0,2<br />
Korea 1 0,2<br />
S<strong>in</strong>gapur 1 0,2<br />
Sri Lanka 1 0,2<br />
Australien 2 0,3<br />
Doppelstaatler: zwei ausländ. 1 0,2<br />
Deutschland 83 14,2<br />
Doppelstaatler: dt.u. ausländ. 31 5,3<br />
Staatenlos 3 0,5<br />
Gesamt 586 100,0<br />
Quelle: Ausländerstichprobe 2002 (n= 586)<br />
Helen Krumme, Andreas Hoff
11. Implikationen des Alterssurveys für<br />
Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff,<br />
Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
11.1 E<strong>in</strong>leitung<br />
E<strong>in</strong>e so umfassende <strong>und</strong> breit angelegte Studie wie der Alterssurvey liefert Informationen <strong>und</strong><br />
Erkenntnisse zu sozialem <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>Entwicklung</strong>sdynamiken <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte. Diese s<strong>in</strong>d nicht alle<strong>in</strong> für die sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftliche Alternswissenschaft<br />
von Bedeutung. Sie dienen – im S<strong>in</strong>ne von Sozialberichterstattung – auch dazu, Beiträge<br />
für die Beratung der Politik sowie für gesellschaftliche Diskurse zu leisten. In dieser abschließenden<br />
Zusammenschau geht es nun um die Implikationen, die die Ergebnisse der zweiten<br />
Welle des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik haben können. Dabei möchten<br />
wir uns auf jene gesellschaftlichen <strong>und</strong> politischen Diskurse beziehen, <strong>in</strong> denen der demografische<br />
<strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> die aus diesem <strong>Wandel</strong> erwachsenen Konsequenzen thematisiert werden (unabhängig<br />
davon, ob es sich dabei um sichere, wahrsche<strong>in</strong>lich oder nur erwünschte bzw. befürchtete<br />
Konsequenzen handelt). An dieser Stelle möchten wir drei Diskurse zum demografischen<br />
<strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> zur gesellschaftlichen Bedeutung von Alter <strong>und</strong> Altern unterscheiden, die zum Teil<br />
gegensätzliche Aussagen über die Implikationen des demografischen <strong>Wandel</strong>s machen, zum<br />
Teil aber auch unterschiedliche Themen <strong>und</strong> Argumentationsebenen aufweisen: Bedarfs- <strong>und</strong><br />
Versorgungsdiskurs sowie Belastungsdiskurs <strong>und</strong> Potenzialdiskurs. Diese Diskurse sollen im<br />
folgenden zunächst prototypisch skizziert werden. Anschließend soll gefragt werden, <strong>in</strong>wiefern<br />
ausgewählte Bef<strong>und</strong>e der zweiten Welle des Alterssurveys für diese Diskurse von Relevanz<br />
s<strong>in</strong>d. Dabei sollen aufbauend auf den Schlussfolgerungen der E<strong>in</strong>zelkapitel auch Implikationen<br />
für die Gesellschafts- <strong>und</strong> Sozialpolitik diskutiert werden. (Es sei darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass die<br />
theoretischen <strong>und</strong> praktischen Implikationen der Bef<strong>und</strong>e <strong>in</strong> den jeweiligen thematischen Kapiteln<br />
umfassender erörtert werden).<br />
Bedarfs- <strong>und</strong> Versorgungsdiskurs: Die Analyse des Verhältnisses zwischen Bedarfen älterer<br />
Menschen <strong>und</strong> ihrer Versorgung durch sozialstaatliche Sicherungssysteme hat <strong>in</strong> der sozialen<br />
Gerontologie e<strong>in</strong>e bedeutende Tradition (Dieck & Naegele, 1993; 1978), wobei die Sicht des<br />
Alters als „soziales Problem“ auch kritisch diskutiert wird (Kondratowitz, 1999). Bei diesem<br />
Diskurs geht es gr<strong>und</strong>sätzlich um die Frage, wie die Lebenslagen älterer Menschen zu bewerten<br />
s<strong>in</strong>d bzw. ob die Bedarfe älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen durch sozialstaatliche, marktliche<br />
<strong>und</strong> ehrenamtliche Versorgungsangebote gedeckt werden. Als prom<strong>in</strong>ente Beispiele für e<strong>in</strong>e<br />
Sozialberichterstattung, die im Rahmen dieses Bedarfs- <strong>und</strong> Versorgungsdiskurses vorgelegt<br />
wurden, können e<strong>in</strong>ige der Altenberichte der B<strong>und</strong>esregierung genannt werden. So wurde beispielsweise<br />
im zweiten Altenbericht die Wohnsituation älterer Menschen ausführlich bewertet<br />
(BMFSFJ, 1998). Der vierte Altenbericht nahm die Situation sehr alter Menschen <strong>in</strong> den Blick,<br />
wobei die Versorgung hochaltriger Menschen mit demenziellen Erkrankungen <strong>in</strong> besonderem<br />
501
502<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Maße berücksichtigt wurde (BMFSFJ, 2002). E<strong>in</strong>e ähnliche, bedarfs- <strong>und</strong> versorgungsbezogene<br />
Perspektive f<strong>in</strong>det sich auch im Ausblick des Berichts zur ersten Welle des Alterssurveys (Kohli<br />
& Künem<strong>und</strong>, 2000). Dabei wurde mit Blick auf die Bewertung der Lebenssituation von Menschen<br />
<strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte festgestellt, dass die vorgelegten Bef<strong>und</strong>e nicht dazu angetan<br />
seien, „das heutige Alter zu dramatisieren oder gar zu skandalisieren“ (Kohli & Künem<strong>und</strong>,<br />
2000, S. 337). Insgesamt, so das Resümee der ersten Welle des Alterssurveys, sei die Lebenssituation<br />
von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> Bezug auf materielle Situation, Ges<strong>und</strong>heitszustand,<br />
Wohnsituation <strong>und</strong> soziale Integration als gut e<strong>in</strong>zuschätzen, wobei Differenzierungen<br />
<strong>und</strong> soziale Ungleichheiten auch <strong>in</strong> der Phase des Alters bestehen bleiben.<br />
Belastungsdiskurs: Während es bei dem „Bedarfs- <strong>und</strong> Versorgungsdiskurs“ zunächst nur um<br />
e<strong>in</strong>e Bewertung der Angemessenheit von Versorgungsstrukturen angesichts von vorhandenen<br />
Bedarfen geht, werden <strong>in</strong>nerhalb der öffentlichen Debatte auch die gesellschaftlichen Kosten<br />
e<strong>in</strong>er umfassenden Versorgung älterer Menschen diskutiert. Bei der E<strong>in</strong>schätzung des demografischen<br />
<strong>Wandel</strong>s wird <strong>in</strong> den Medien der wachsende Anteil älterer Menschen an der Gesellschaft<br />
häufig mit steigenden ökonomischen Belastungen <strong>in</strong> Zusammenhang gebracht. Im Rahmen<br />
dieses „Belastungsdiskurses“ wird auf wachsende Beitragssätze <strong>in</strong> der Renten-, Kranken-<br />
<strong>und</strong> Pflegeversicherung h<strong>in</strong>gewiesen, deren Ursachen im demografischen <strong>Wandel</strong> zu suchen<br />
seien <strong>und</strong> deren bedrohliche Auswirkungen vor dem „demografischen Kippen“ der Gesellschaft,<br />
also dem Zeitpunkt, <strong>in</strong> dem ältere Menschen die Mehrheit der Wählerschaft stellen, abgewehrt<br />
werden müssten (S<strong>in</strong>n & Übelmesser, 2000). Zudem wird darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass das Altern<br />
der Erwerbsbevölkerung negative Konsequenzen für die wirtschaftliche <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong>sgesamt<br />
habe, da e<strong>in</strong>e alternde Erwerbsbevölkerung weniger leistungsfähig <strong>und</strong> <strong>in</strong>novativ sei (Hoffmann,<br />
Köhler, & Sauer, 1999). In diesem Zusammenhang wird auch nicht selten das Problem<br />
der „<strong>in</strong>tergenerationalen Gerechtigkeit“ diskutiert. Dabei wird darauf verwiesen, dass <strong>in</strong> den<br />
sozialen Sicherungssystemen die Renditen für zukünftige Generationen von Ruheständlern im<br />
Vergleich mit aktuellen Rentnergenerationen s<strong>in</strong>ken werde, <strong>und</strong> es werden Vorschläge gemacht,<br />
wie e<strong>in</strong>e solchermaßen bestimmte Gerechtigkeit zwischen den Generationen herzustellen sei<br />
(Tremmel, 1997). Insgesamt wird im Rahmen des „Belastungsdiskurses“ der demografische<br />
<strong>Wandel</strong> als Problem <strong>und</strong> Gefährdung für den Zusammenhalt der Gesellschaft <strong>und</strong> die Existenz<br />
sozialstaatlicher Institutionen gesehen. Die Bef<strong>und</strong>e der im Rahmen des „Bedarfs- <strong>und</strong> Versorgungsdiskurses“<br />
vorgelegten Sozialberichterstattung zur <strong>in</strong>sgesamt als gut e<strong>in</strong>zuschätzenden<br />
Lebenssituation vieler älterer Menschen können dabei sogar als Argument für die Möglichkeit<br />
(oder Notwendigkeit) von Kürzungen sozialstaatlicher Leistungen e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />
Potenzialdiskurs: Der „Belastungsdiskurs“ des Alter(n)s wird aus ethischer <strong>und</strong> ökonomischer<br />
Sicht kritisiert (Gronemeyer, 1996; Schmähl, 2002). Dabei wird nicht alle<strong>in</strong> darauf verwiesen,<br />
dass mit bestimmten Maßnahmen, wie etwa der Verlängerung der Lebensarbeit, die Herausforderungen<br />
des demografischen <strong>Wandel</strong>s erfolgreich bewältigt werden könnten, sondern es werden<br />
auch potenziell positive Aspekte des Alters <strong>und</strong> Alterns herausgestellt. Wie bereits seit längerem<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Gerontologie (P.B. Baltes, 1984; Lehr, 1978; Thomae & Lehr, 1973), wird<br />
zunehmend auch <strong>in</strong> der politischen Diskussion der demografische <strong>Wandel</strong> unter der Perspektive<br />
e<strong>in</strong>es bislang zu wenig genutzten <strong>und</strong> <strong>in</strong> Zukunft besser zu realisierenden Potenzials des Alters<br />
geführt. Bereits im dritten Altenbericht wurde nicht alle<strong>in</strong> die Frage gestellt, welche gesellschaftlichen<br />
Ressourcen für e<strong>in</strong> gutes Leben im Alter bereitgestellt werden müssen, sondern
Kapitel 11: Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
auch, welche Ressourcen ältere Menschen <strong>in</strong> die Gesellschaft e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen können (BMFSFJ,<br />
2001). Der fünfte Altenbericht, der gegenwärtig erstellt wird, ist schließlich ganz explizit den<br />
„Potenzialen des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft“ gewidmet (so der Titel des Berichtsauftrages).<br />
Der Potenzialdiskurs des Alter(n)s stützt sich auf die Ergebnisse unterschiedlicher Diszipl<strong>in</strong>en.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong>spsychologie der Lebensspanne beschreibt seit längerem die zweidimensionale<br />
<strong>Entwicklung</strong> kognitiver Kompetenz mit der Möglichkeit der Plastizität basaler kognitiver<br />
Prozesse e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> der Stabilität wissensbasierter Komponenten andererseits (P.B.<br />
Baltes, 1984), wobei e<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränkter Optimismus kaum mehr vertreten wird (P.B. Baltes,<br />
2003). Auch die Arbeitswissenschaft hat e<strong>in</strong>drucksvoll belegt, dass Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz<br />
kaum mit dem Lebensalter korreliert (Dittmann-Kohli, Sowarka, & Timmer, 1997).<br />
Innerhalb der Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften wurde zudem wiederholt gezeigt, dass die Ges<strong>und</strong>heit<br />
nachwachsender Kohorten älter werdender Menschen im historischen Verlauf immer besser<br />
geworden ist, so dass die Leistungsfähigkeit vor allem jüngerer Ruheständler <strong>in</strong> der Regel sehr<br />
hoch ist (Manton & Gu, 2004, <strong>in</strong> press). In diesem Zusammenhang wurde auch darauf h<strong>in</strong>gewiesen,<br />
dass die Übernahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten <strong>und</strong> bürgerschaftlichem Engagement<br />
älterer Menschen bereits jetzt weitverbreitet sei, aber durch geeignete Opportunitätsstrukturen<br />
sogar noch gesteigert werden könne (Künem<strong>und</strong>, 2000). Insgesamt betont der „Potenzialdiskurs“<br />
also die positiven Aspekte oder Möglichkeiten des demografischen <strong>Wandel</strong>s.<br />
Wie an dieser kurzen Skizze zu erkennen ist, stehen die Diskurse des demografischen <strong>Wandel</strong>s<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em komplexen Beziehungs- <strong>und</strong> Spannungsverhältnis. Bei der Ause<strong>in</strong>andersetzung zwischen<br />
Proponenten von Belastungs- <strong>und</strong> Potenzialdiskurs geht es letztlich darum, ob es angemessener<br />
sei, den demografischen <strong>Wandel</strong> als Bedrohung oder Chance e<strong>in</strong>er Gesellschaft zu<br />
<strong>in</strong>terpretieren (<strong>und</strong> darum, welche politischen Maßnahmen angesichts der jeweiligen Szenarien<br />
e<strong>in</strong>zusetzen s<strong>in</strong>d). Dagegen wird im Bedarfs- <strong>und</strong> Versorgungsdiskurs e<strong>in</strong> „gutes Leben“ im<br />
Alter (im S<strong>in</strong>ne von Lebensqualität <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den) thematisiert, wobei gute Nachrichten<br />
zur Lebenssituation im Rahmen des Belastungsdiskurses möglicherweise als Argumente für die<br />
E<strong>in</strong>schränkung von Versorgungsleistungen verwendet werden. Im folgenden soll der Versuch<br />
unternommen werden, die Bef<strong>und</strong>e der zweiten Welle auf diese Diskurse zu beziehen – um so<br />
die Wahl angemessener Interventionen mit Argumenten zu stützen.<br />
11.2 Erwerbstätigkeit<br />
Die zweite Welle des Alterssurveys hat gezeigt, dass sich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 e<strong>in</strong>e Trendwende<br />
h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em längeren Verbleib im Erwerbsleben andeutet. Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
kam es zu deutlichen Veränderungen <strong>in</strong> den <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Erwartungen e<strong>in</strong>es frühen Ruhestandes:<br />
Ältere Arbeitnehmer planen im Jahr 2002 sehr viel seltener als im Jahr 1996, mit 60 Jahren<br />
oder früher <strong>in</strong> den Ruhestand zu gehen. Allerd<strong>in</strong>gs ist diese Veränderung noch nicht begleitet<br />
von klaren Vorstellungen darüber, bis zu welchem Lebensalter die betreffenden Personen weiter<br />
arbeiten wollen. Offensichtlich haben die zahlreichen gesetzlichen Maßnahmen der vergangenen<br />
Jahre zur Verr<strong>in</strong>gerung der Anreize für e<strong>in</strong>en frühzeitigen Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand erste<br />
Wirkungen entfaltet, die sich vor allem <strong>in</strong> den Erwerbsbeendigungsplänen, aber noch nicht <strong>in</strong><br />
gleicher Weise <strong>in</strong> der Erwerbsbeteiligung <strong>und</strong> dem Ausstiegsalter niederschlagen. Während sich<br />
<strong>in</strong> den Erwartungen <strong>und</strong> Plänen bereits e<strong>in</strong>e deutliche Abkehr vom frühen Ausscheiden aus dem<br />
503
504<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Erwerbsleben zeigt, ist e<strong>in</strong>e solche Trendwende bei Betrachtung der altersspezifischen Erwerbsbeteiligung<br />
<strong>und</strong> des tatsächlichen Ausstiegsalters erst im Ansatz zu erkennen. Diese Bef<strong>und</strong>e<br />
könnten bedeuten, dass älter werdende Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer ihre eigenen<br />
Lebensplanungen mit Blick auf e<strong>in</strong>e biografisch verlängerte Erwerbsphase verändert haben.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs setzt e<strong>in</strong> längerer Verbleib im Beschäftigungssystem e<strong>in</strong>e entsprechende Nachfrage<br />
nach älteren Arbeitskräften voraus. Betrachtet man die <strong>Entwicklung</strong>en auf dem Arbeitsmarkt, so<br />
s<strong>in</strong>d Zweifel angebracht, ob es <strong>in</strong> Zukunft tatsächlich zu e<strong>in</strong>er verlängerten Erwerbsphase kommen<br />
wird. Werden Betriebe auch weiterh<strong>in</strong> die Frühausgliederung älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmer praktizieren, so bedeutet dies für die betroffenen Personen, dass sich die<br />
Dauer der Arbeitslosigkeit bis zum Rentene<strong>in</strong>tritt verlängert <strong>und</strong> zugleich die f<strong>in</strong>anzielle Absicherung<br />
verschlechtert (Barkholt, 2001). Maßnahmen, die <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie darauf abzielen, den<br />
Druck zum Anbieten der eigenen Arbeitskraft zu erhöhen, werden vermutlich nicht ausreichen,<br />
um das von der Europäischen Union vorgegebene Ziel e<strong>in</strong>er Erwerbstätigenquote von 50 Prozent<br />
der älteren Arbeitskräfte bis 2010 zu erreichen. Notwendig s<strong>in</strong>d flankierende Maßnahmen,<br />
die die Arbeitsfähigkeit fördern <strong>und</strong> die Nachfrage nach älteren Arbeitskräften stimulieren<br />
(Behrend, 2002). Ob diese Nachfrage ausgerechnet durch die Beseitigung des Kündigungsschutzes<br />
gesteigert werden kann, wie derzeit von Manchen gefordert, ist jedoch ungewiss. Zunächst<br />
ist davon auszugehen, dass dies die Möglichkeiten der Ausgliederung älterer Arbeitskräfte<br />
erleichtert. Ob dies ausgeglichen werden kann durch den Abbau der Hemmnisse zur Wiedere<strong>in</strong>stellung<br />
älterer Arbeitsloser, ist unsicher.<br />
Wichtige Voraussetzungen für e<strong>in</strong> Gel<strong>in</strong>gen des Umsteuerns zu e<strong>in</strong>em längeren Verbleib im<br />
Erwerbsleben <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Akzeptanz bei Beschäftigten <strong>und</strong> Betrieben s<strong>in</strong>d die Überw<strong>in</strong>dung der<br />
Wachstumsschwäche, e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Entspannung des Arbeitsmarkts, der Abbau von Vorbehalten<br />
gegenüber älteren Arbeitskräften sowie die Verbesserung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong><br />
die Förderung ihrer Arbeitsfähigkeit <strong>und</strong> -motivation. Unter diesen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen könnte<br />
es <strong>in</strong> Zukunft möglich se<strong>in</strong>, die Potenziale älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer besser<br />
zu nutzen als dies im Augenblick der Fall ist. Die <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n Voraussetzungen <strong>in</strong> Form sich<br />
wandelnder Lebensentwürfe <strong>und</strong> -planungen sche<strong>in</strong>en allmählich zu stehen. Und mit der Akzeptanz<br />
e<strong>in</strong>er längeren Erwerbsphase im Lebenslauf <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er sich verlängernden tatsächlichen<br />
Erwerbsphase könnten auch die Belastungen der sozialen Sicherungssysteme, <strong>in</strong>sbesondere<br />
durch die immer noch praktizierten Formen der Frühverrentung, deutlich verr<strong>in</strong>gert werden.<br />
11.3 Materielle Lage<br />
Die aktuelle materielle Lage älterer Menschen wird <strong>in</strong> der Sozialberichterstattung <strong>in</strong> der Regel<br />
als recht gut bezeichnet (BMFSFJ, 2001), wobei sich allerd<strong>in</strong>gs das Ausmaß sozialer Ungleichheiten<br />
bis <strong>in</strong> das dritte <strong>und</strong> vierte Lebensalter nicht verr<strong>in</strong>gert (Kohli, Künem<strong>und</strong>, Motel, &<br />
Szydlik, 2000). Die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e der zweiten Welle des Alterssurveys zeigen allerd<strong>in</strong>gs,<br />
dass sich die aktuell positive Situation älterer Menschen <strong>in</strong> Zukunft verändern kann, da<br />
künftige <strong>Entwicklung</strong>en der Ruhestandse<strong>in</strong>kommen möglicherweise nicht mit den Erwerbse<strong>in</strong>kommen<br />
<strong>in</strong> der Lebensmitte Schritt halten werden. Zugleich s<strong>in</strong>d Ausdifferenzierungen der<br />
Verteilungen zu erwarten. Beide Tendenzen lassen sich mit gewissen E<strong>in</strong>schränkungen bereits
Kapitel 11: Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
heute ausmachen. Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 haben <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> Ostdeutschland die E<strong>in</strong>kommen<br />
der über 70-Jährigen nicht mit jenen der Jüngeren Schritt gehalten. In Ostdeutschland<br />
ist auch e<strong>in</strong>e Ausdifferenzierung der E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte festzustellen.<br />
Dieser Bef<strong>und</strong> f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> dieser Weise <strong>in</strong> Westdeutschland nicht (dort zeigen sich leichte<br />
Verstärkungen der Ungleichheit nur bei den unter 70-jährigen Männern; zudem stellt sich die<br />
E<strong>in</strong>kommensverteilung im Westen im Jahr 2002 sogar leicht homogener dar als noch sechs<br />
Jahre zuvor).<br />
Entgegen der Erwartung, dass E<strong>in</strong>kommen älterer Menschen stabil seien, zeigt sich, dass Auf-<br />
oder Abstiege <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>kommensverteilung durchaus häufig vorzuf<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d. In den oberen<br />
Altersgruppen ist der Anteil stabiler E<strong>in</strong>kommen jedoch merklich höher. Aufstiege f<strong>in</strong>den sich<br />
besonders häufig unter den jüngeren Menschen, die aufgr<strong>und</strong> ihrer Teilhabe am Erwerbsleben<br />
auch über höhere Chancen verfügen, ihre E<strong>in</strong>kommenssituation zu verbessern. Zudem ist zu<br />
konstatieren, dass die Altersgruppen im erwerbsfähigen Alter im Mittel zu den Aufsteigern zu<br />
zählen s<strong>in</strong>d, da sie im Vergleich mit der allgeme<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>kommensentwicklung überproportionale<br />
Gew<strong>in</strong>ne realisieren konnten, während die Personen im Ruhestandsalter im Mittel absteigen.<br />
Besonders häufig s<strong>in</strong>d Abstiege <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe <strong>in</strong> Ostdeutschland. Dort f<strong>in</strong>den sich<br />
auch seltener Aufstiege <strong>in</strong> der relativen E<strong>in</strong>kommensposition.<br />
Die Ergebnisse zu Armut <strong>und</strong> Wohlstand entsprechen teilweise den Tendenzen, die sich mit<br />
Blick auf das E<strong>in</strong>kommen zeigen. Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 gibt es e<strong>in</strong>en leichten Anstieg der<br />
Armutsquoten <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte, die allerd<strong>in</strong>gs auf die <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
zurückzuführen ist. Während die Armutsquote <strong>in</strong> Westdeutschland nahezu konstant bleibt,<br />
steigt sie <strong>in</strong> Ostdeutschland deutlich an. Dieser Unterschied tritt unter den über 70-Jährigen am<br />
deutlichsten zu Tage. Auch die positive <strong>Entwicklung</strong> des Anteils hoher E<strong>in</strong>kommen f<strong>in</strong>det vor<br />
allem <strong>in</strong> Westdeutschland statt: Gew<strong>in</strong>ner sche<strong>in</strong>en hier die 55- bis 69-jährigen westdeutschen<br />
Männer zu se<strong>in</strong>. Die ältesten Menschen <strong>in</strong> Ostdeutschland partizipieren dagegen nach wie vor<br />
kaum an hohen E<strong>in</strong>kommen. H<strong>in</strong>sichtlich Vermögen <strong>und</strong> Verschuldung zeigen sich <strong>in</strong> den Niveaus<br />
kaum Veränderungen über die Zeit, <strong>und</strong> die Differenzen zwischen West <strong>und</strong> Ost bleiben<br />
bestehen. Auch hier deutet sich die besondere Problemlage der Ältesten <strong>in</strong> Ostdeutschland an:<br />
Den zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nur wenig gestiegenen E<strong>in</strong>kommen steht e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Vermögensausstattung<br />
zur Seite.<br />
Die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e zur materiellen Situation älterer Menschen <strong>in</strong> Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland<br />
zeigen e<strong>in</strong> differenziertes Bild. Die materielle Lage älterer <strong>und</strong> alter Menschen ist<br />
gegenwärtig im Mittel als gut e<strong>in</strong>zuschätzen. In diesem S<strong>in</strong>ne ist hier e<strong>in</strong> Potenzial für Produkte<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen vorhanden, dass möglicherweise durch adäquate Angebote erschlossen<br />
werden kann. Dennoch ist zu betonen, dass die Unterschiede im Alter groß (<strong>und</strong> offenk<strong>und</strong>ig<br />
recht stabil) s<strong>in</strong>d. Mit Blick auf mögliche Wirkungen ist daher zu fragen, ob Anpassungen im<br />
Bereich der sozialen Sicherung e<strong>in</strong>e geeignete Maßnahme s<strong>in</strong>d, um Beitragsbelastungen zu verr<strong>in</strong>gern,<br />
zumal die Ausweitung der Lebensarbeitszeit e<strong>in</strong>e alternative <strong>und</strong> möglicherweise mit<br />
weniger negativen Effekten behaftete Maßnahme ist.<br />
505
506<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
11.4 Familie <strong>und</strong> <strong>in</strong>tergenerationale Unterstützung<br />
Der demografische <strong>Wandel</strong> berührt <strong>in</strong> direkter Weise die soziale E<strong>in</strong>bettung älter werdender <strong>und</strong><br />
alter Menschen, vor allem <strong>in</strong>nerhalb der Familie. Generationenbeziehungen werden heute vor<br />
allem im ‚multilokalen Familienverb<strong>und</strong>’ gelebt: Die Angehörigen e<strong>in</strong>er Familie wohnen nicht<br />
unbed<strong>in</strong>gt im selben Haushalt, aber sie halten mite<strong>in</strong>ander Kontakt <strong>und</strong> unterstützen sich regelmäßig.<br />
Die meisten Deutschen leben dabei heute <strong>in</strong> Konstellationen von drei Generationen. In<br />
den Ergebnissen der zweiten Welle des Alterssurveys machen sich jedoch erste Anzeichen für<br />
die Auswirkungen des demografischen <strong>Wandel</strong>s bei der jüngsten Altersgruppe bemerkbar. Hier<br />
konnte zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 <strong>in</strong> den Familien e<strong>in</strong>e Verschiebung des Anteils von Drei-<br />
Generationen-Konstellationen h<strong>in</strong> zu Zwei-Generationen-Konstellationen beobachtet werden.<br />
Auch die Zusammensetzung der Haushalte der 40- bis 85-Jährigen verändern sich. Im Vergleich<br />
zu 1996 hat sich im Jahr 2002 sowohl der Anteil von Alle<strong>in</strong>lebenden, als auch der von Paaren<br />
ohne K<strong>in</strong>der deutlich erhöht. Mit dem weiteren Anstieg k<strong>in</strong>derloser Haushalte wird sich <strong>in</strong> den<br />
nächsten Jahren der Anteil von E<strong>in</strong>-Generationen-Haushalten weiter erhöhen. Obwohl die überwiegende<br />
Mehrheit der Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> räumlicher Nähe zu ihren<br />
K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Eltern lebt, ist die Wohnentfernung zwischen Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern 2002 größer als<br />
vor sechs Jahren. Vor allem der Anteil von am selben Ort lebenden K<strong>in</strong>dern hat im Vergleich zu<br />
1996 abgenommen. Koresidenz von Eltern <strong>und</strong> erwachsenen K<strong>in</strong>dern ist 2002 noch weniger<br />
weit verbreitet als vor sechs Jahren.<br />
Die Beziehungen zur Familie werden von Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte <strong>in</strong> der Regel<br />
als positiv e<strong>in</strong>geschätzt. Diese Bewertungen s<strong>in</strong>d zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 sogar noch positiver<br />
geworden. In E<strong>in</strong>klang damit werden Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen durch e<strong>in</strong> Gefühl großer Verb<strong>und</strong>enheit<br />
charakterisiert. Die wichtigsten Kontaktpersonen älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen<br />
s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> bleiben Familienangehörige. Allerd<strong>in</strong>gs hat sich die Kontakthäufigkeit zwischen<br />
Eltern <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern <strong>in</strong>nerhalb der sechs Jahre zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 etwas verr<strong>in</strong>gert. Zu<br />
betonen ist, dass Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ke<strong>in</strong>eswegs e<strong>in</strong>e Last für die Familienmitglieder<br />
der jüngeren Generationen s<strong>in</strong>d. Im Gegenteil leisten ältere Familienmitglieder mehr<br />
Unterstützung als sie umgekehrt erhalten. Im Jahre 2002 hat sich dieser Unterschied sogar noch<br />
vergrößert: Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte erhalten im Jahr 2002 weniger Unterstützung<br />
als im Jahr 1996.<br />
Es stellt sich nun die Frage, was staatliche Sozialpolitik zur Stärkung <strong>in</strong>tergenerationaler Familienbeziehungen<br />
beitragen kann. Das Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip, auf dem der deutsche Sozialstaat<br />
beruht, hat <strong>in</strong> der Vergangenheit dazu geführt, dass Familien <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e Vielzahl von<br />
Aufgaben übernommen haben, die <strong>in</strong> anderen Gesellschaftssystemen von anderen Institutionen<br />
getragen werden. Indem Menschen <strong>in</strong>formelle Unterstützung leisten, entlasten sie den Sozialstaat<br />
von Aufwendungen, die andernfalls für formelle Hilfestrukturen bereitgestellt werden<br />
müssten. Sozialpolitik besteht jedoch nicht nur <strong>in</strong> der Bereitstellung von Versorgungsleistungen<br />
– zu Sozialpolitik gehört auch die Schaffung von geeigneten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Hilfe<br />
zur Selbsthilfe <strong>und</strong> für das Zusammenführen der Generationen. E<strong>in</strong> Beispiel hierfür ist die Integration<br />
der bisher separat geführten politischen Handlungsfelder von Familien-, K<strong>in</strong>der-, Senioren-<br />
<strong>und</strong> Bildungspolitik zu e<strong>in</strong>er „Generationenpolitik“ (Lüscher & Liegle, 2003). Dabei<br />
handelt es sich um e<strong>in</strong> gesellschaftspolitisches Programm zur Förderung des künftigen Zusam-
Kapitel 11: Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
menlebens von Generationen. Generationenpolitik setzt die Kooperation verschiedener gesellschaftlicher<br />
Akteure (Staat, Kirchen, Verbände, Unternehmen, etc.) voraus. E<strong>in</strong>e koord<strong>in</strong>ierte<br />
Generationenpolitik hat die Interessen aller Generationen im Blick <strong>und</strong> geht von den Leitideen<br />
der Generationengerechtigkeit, wechselseitiger Verantwortung <strong>und</strong> der Verantwortung für die<br />
Zukunft im S<strong>in</strong>ne von Nachhaltigkeit aus. Dies kann dar<strong>in</strong> bestehen, dass Begegnungsmöglichkeiten<br />
für jüngere <strong>und</strong> ältere Menschen geschaffen werden (etwa über Wissens- oder Zeitzeugenbörsen)<br />
<strong>und</strong> dass ältere Menschen Verantwortung für jüngere Menschen übernehmen (etwa<br />
<strong>in</strong> Bildungs- oder Betreuungse<strong>in</strong>richtungen). In diesem S<strong>in</strong>ne könnte es gel<strong>in</strong>gen, das Potenzial<br />
des Alters zu nutzen, um das Mite<strong>in</strong>ander der Generationen zu verbessern.<br />
11.5 Gesellschaftliche Partizipation<br />
Das Potenzial des Alters wird sehr deutlich <strong>in</strong> den produktiven Tätigkeiten des bürgerschaftlichen<br />
Engagements. Die Übernahme an Verantwortung <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en oder anderen Institutionen,<br />
aber auch die Beteiligung an Pflegetätigkeiten <strong>und</strong> Betreuung von K<strong>in</strong>dern s<strong>in</strong>d bedeutsame<br />
bürgerschaftliche Aufgaben. Für die meisten dieser Tätigkeiten gilt jedoch, dass sie – wenn<br />
auch <strong>in</strong> unterschiedlichem Ausmaß – mit zunehmendem Alter seltener ausgeübt werden. Im<br />
Bereich des ehrenamtlichen Engagements fällt der Rückgang der Partizipation im höheren Alter<br />
weniger dramatisch als etwa bei der Erwerbstätigkeit aus, ist aber immer noch erheblich. Die<br />
Beteiligung an ehrenamtlichen Tätigkeiten geht von der jüngsten zur ältesten Altersgruppe um<br />
mehr als die Hälfte zurück. In Zukunft könnte sich jedoch im Zuge der Verbesserung der <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n<br />
Ressourcen der Personenkreis der ehrenamtlich aktiven älteren Menschen erweitern:<br />
Bislang weist jede jüngere Ruhestandskohorte e<strong>in</strong> höheres Ausbildungsniveau <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e bessere<br />
Ges<strong>und</strong>heit auf, verfügt also über mehr Ressourcen für Aktivität als die Geburtsjahrgänge zuvor.<br />
Da Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> vor allem Bildungsniveau mit der Beteiligung im Bereich z.B. des ehrenamtlichen<br />
Engagements oder der Bildung zusammenhängen, kann mit e<strong>in</strong>er stärkeren Beteiligung<br />
<strong>in</strong> diesen Bereichen gerechnet werden. Zugleich dürfte sich jedoch der Anspruch auf<br />
s<strong>in</strong>nvolle Aktivität als Folge der gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse erhöhen. Dieses<br />
bereits vorhandene <strong>und</strong> <strong>in</strong> Zukunft noch zunehmende Potenzial des Alters durch geeignete Angebote<br />
<strong>und</strong> Opportunitätsstrukturen zu realisieren, ist e<strong>in</strong> bedeutsames seniorenpolitisches Ziel<br />
(Braun, Burmeister, & Engels, 2004).<br />
11.6 Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Versorgung<br />
In guter Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong> hohes Alter zu erreichen, ist e<strong>in</strong> Ziel, das nicht alle<strong>in</strong> älter werdende<br />
<strong>und</strong> alte Menschen haben, sondern das auch hohe Priorität <strong>in</strong> der Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitspolitik<br />
besitzt. Die Ergebnisse der zweiten Welle des Alterssurveys haben gezeigt, dass es über die<br />
untersuchten Altersgruppen h<strong>in</strong>weg zu e<strong>in</strong>em Anstieg der Erkrankungen <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Beschwerden kommt. Dies bestätigt die Bef<strong>und</strong>e anderer Studien, etwa der Berl<strong>in</strong>er Altersstudie<br />
(Ste<strong>in</strong>hagen-Thiessen & Borchelt, 1996). Neben diesem Anstieg von oftmals chronischen<br />
Erkrankungen kommt es im höheren Alter auch zu e<strong>in</strong>er erhöhten Häufigkeit von Unfällen<br />
<strong>und</strong> akuten Erkrankungen. Zudem gibt es Altersgruppenunterschiede h<strong>in</strong>sichtlich Mobilität<br />
507
508<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
<strong>und</strong> subjektiver Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung. Frauen weisen im höheren Lebensalter e<strong>in</strong>e höhere<br />
Bee<strong>in</strong>trächtigung der Mobilität auf als Männer, was möglicherweise mit der höheren Frühsterblichkeit<br />
von Männern zu erklären ist. Die subjektive Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>schätzung fällt mit höherem<br />
Alter zunehmend ungünstiger aus <strong>und</strong> korrespondiert damit mit der Zunahme körperlicher Erkrankungen.<br />
Diesen, teilweise bereits aus anderen Studien bekannten Ergebnissen, die e<strong>in</strong>e Abnahme der<br />
Ges<strong>und</strong>heit mit wachsendem Alter belegen, ist jedoch e<strong>in</strong> bedeutsamer Bef<strong>und</strong> zum <strong>Wandel</strong> des<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustandes <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte – <strong>und</strong> zwar <strong>in</strong>nerhalb des kurzen Zeitraums<br />
zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 – zur Seite zur stellen. Die Ergebnisse der Kohortenvergleiche zwischen<br />
den 40- bis 85-Jährigen der Jahre 1996 <strong>und</strong> 2002 zeigen, dass nachfolgende Geburtskohorten<br />
e<strong>in</strong>e bessere Ges<strong>und</strong>heit, d.h. e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Multimorbidität <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Zahl von<br />
bedeutsamen Beschwerden haben als früher Geborene. Insgesamt kann man feststellen, dass die,<br />
durch e<strong>in</strong>e höhere Lebenserwartung „gewonnenen“ Lebensjahre nicht durch schlechte Ges<strong>und</strong>heit<br />
gekennzeichnet s<strong>in</strong>d, sondern dass die gewonnene Lebenszeit eher <strong>in</strong> guter Ges<strong>und</strong>heit<br />
verbracht werden kann. Die Ergebnisse der zweiten Welle des Alterssurveys weisen m<strong>in</strong>destens<br />
auf e<strong>in</strong>e Morbiditätskonstanz h<strong>in</strong>, s<strong>in</strong>d jedoch auch mit der Theorie der Morbiditätskompression<br />
vere<strong>in</strong>bar, die besagt, dass durch geeignete ges<strong>und</strong>heitsfördernde <strong>und</strong> präventive Maßnahmen<br />
das Auftreten von Krankheiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e kurze Phase am Lebensende „komprimiert“ werden kann.<br />
Denkbar ist allerd<strong>in</strong>gs, dass die gef<strong>und</strong>enen Kohortenunterschiede nicht mehr für die Phase der<br />
Hochaltrigkeit bestehen. Denn es ist möglich, dass zwar die nachfolgenden Kohorten mit e<strong>in</strong>em<br />
besseren ges<strong>und</strong>heitlichen Ausgangsniveau die Phase der Hochaltrigkeit beg<strong>in</strong>nen, dieser Vorteil<br />
jedoch nicht vor großen Verlusten <strong>in</strong> dieser letzten Lebensphase schützt (P.B. Baltes, 1997).<br />
Aus heutiger Sicht ist bekannt, dass <strong>in</strong> der Lebensphase der Hochaltrigkeit unter anderem die<br />
Prävalenz von Demenzen stark zunimmt. Etwa jede vierte Person zwischen 85 <strong>und</strong> 89 Jahren<br />
<strong>und</strong> jede dritte Person ab 90 Jahren ist gegenwärtig hiervon betroffen (BMFSFJ, 2002).<br />
Dennoch bestärken die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e die Annahme, dass Maßnahmen der Prävention<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation das Potenzial älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen für e<strong>in</strong> Leben <strong>in</strong> gesellschaftlicher<br />
Partizipation sowie <strong>in</strong> Selbstbestimmtheit <strong>und</strong> Selbständigkeit fördern können. Die<br />
Ergebnisse zum Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte geben H<strong>in</strong>weise auf verschiedene<br />
Präventionspotenziale. Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, dass chronische Erkrankungen „mitaltern“,<br />
d.h. bis <strong>in</strong>s hohe Alter fortbestehen <strong>und</strong> Folgeerkrankungen sowie Funktionse<strong>in</strong>bußen verursachen<br />
können, ersche<strong>in</strong>t es wichtig, möglichst früh im Lebensverlauf die Chronifizierung von<br />
Erkrankungen <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen zu vermeiden. Die hohe Zahl der 40- bis 54-Jährigen, die<br />
zwei oder mehr Erkrankungen angeben bzw. E<strong>in</strong>schränkungen h<strong>in</strong>sichtlich anstrengender Tätigkeiten<br />
nennen, weist auf entsprechenden Präventions- <strong>und</strong> Rehabilitationsbedarf h<strong>in</strong>. Die<br />
Möglichkeiten, dauerhafte Multimorbidität <strong>und</strong> Funktionse<strong>in</strong>bußen zu vermeiden, s<strong>in</strong>d im mittleren<br />
Erwachsenenalter zumeist am größten. Aber auch h<strong>in</strong>sichtlich der älteren Altersgruppen<br />
sollten die hohen präventiven Potenziale nicht unterschätzt werden. E<strong>in</strong>e Vielzahl von Erkrankungen,<br />
unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen <strong>und</strong> Diabetes<br />
mellitus (Typ II), weisen bis <strong>in</strong>s hohe Alter deutliche Präventionspotenziale auf. Dabei nimmt<br />
mit steigendem Alter besonders die Bedeutung von Tertiärprävention zu, d.h. die Vermeidung<br />
oder Verzögerung der Verschlimmerung e<strong>in</strong>er Erkrankung sowie die Verh<strong>in</strong>derung oder Milderung<br />
bleibender Funktionse<strong>in</strong>bußen.
Kapitel 11: Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
Die Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Empfehlungen, die sich auf die Kohortenvergleiche zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002<br />
stützen, können ergänzt werden durch längsschnittliche Analysen der zweiten Welle, <strong>in</strong> denen<br />
e<strong>in</strong>e Vorhersage von Ges<strong>und</strong>heitsveränderungen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte vorgenommen<br />
wurde. Dabei wurden als potenzielle E<strong>in</strong>flussgrößen verschiedene soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren,<br />
<strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>s Verhalten sowie zusätzlich E<strong>in</strong>stellungen gegenüber dem Älterwerden berücksichtigt.<br />
Die Ergebnisse legen die Annahme nahe, dass sich soziale Faktoren kumulativ<br />
über langandauernde, stabile Lebensstile auf die körperliche Ges<strong>und</strong>heit auswirken. H<strong>in</strong>sichtlich<br />
des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens wurde deutlich, dass zwar sportliche Aktivitäten, nicht jedoch Spaziergänge<br />
e<strong>in</strong>en positiven E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heit haben. Die Ergebnisse zu E<strong>in</strong>stellungen<br />
legen nahe, dass Vorstellungen über das Älterwerden im Zeitraum der betrachteten sechs Jahre<br />
e<strong>in</strong>en deutlichen E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heitsentwicklung haben. Vorstellungen über das Älterwerden<br />
bee<strong>in</strong>flussen <strong>in</strong> erstaunlicher Weise, ob es zu e<strong>in</strong>er Zu- bzw. Abnahme oder Konstanz<br />
der Anzahl körperlicher Erkrankungen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Zeitraumes von sechs Jahren kommt –<br />
dies gilt für alle drei betrachteten Altersgruppen. Dabei haben vor allem zwei Sichtweisen auf<br />
das Älterwerden starken E<strong>in</strong>fluss auf die Ges<strong>und</strong>heit: Zum e<strong>in</strong>en die pessimistische Vorstellung,<br />
dass das Älterwerden mit physischen Verlusten verb<strong>und</strong>en ist. Dabei wurde deutlich, dass die<br />
Erwartung von physischen Verlusten (<strong>und</strong> zwar unabhängig davon, <strong>in</strong> welchem Umfang e<strong>in</strong>e<br />
Person bei der Erstbefragung krank bzw. ges<strong>und</strong> war) zu e<strong>in</strong>em Anstieg der Multimorbidität<br />
über den Zeitraum von sechs Jahren führte. Zum anderen erwies sich auch die optimistische<br />
Vorstellung, Älterwerden als e<strong>in</strong>e Möglichkeit für persönliche Weiterentwicklung zu sehen, als<br />
ges<strong>und</strong>heitsrelevant. E<strong>in</strong>e <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne positive Sicht auf das Älterwerden erwies sich als<br />
ges<strong>und</strong>heitsprotektiv. Personen, die das Älterwerden (auch) als Phase der Weiterentwicklung<br />
sahen, hatten e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Anstieg von Krankheiten als Personen mit negativerer Sicht auf<br />
das Älterwerden – <strong>und</strong> zwar wiederum unabhängig davon, über wie viele Krankheiten die Personen<br />
zum ersten Befragungszeitpunkt berichteten.<br />
Der Bef<strong>und</strong>, dass soziale Faktoren, Ges<strong>und</strong>heitsverhalten, psychische Ressourcen <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere<br />
Vorstellungen über das Älterwerden sowohl zu Beg<strong>in</strong>n der zweiten Lebenshälfte als<br />
auch im höheren Alter e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung für die Ges<strong>und</strong>heit haben, weist darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>in</strong><br />
Maßnahmen zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung stets gesellschaftliche, soziale <strong>und</strong> psychische Faktoren<br />
gleichermaßen berücksichtigt werden sollten. E<strong>in</strong>e solche multidiszipl<strong>in</strong>äre Herangehensweise<br />
sollte dabei Aspekte wie die eigene Sicht auf das Älterwerden e<strong>in</strong>beziehen <strong>und</strong> zwar nicht erst<br />
bei jenen, die bereits e<strong>in</strong> hohes Alter erreicht haben, sondern gerade auch bei Personen, die am<br />
Beg<strong>in</strong>n ihrer zweiten Lebenshälfte stehen.<br />
11.7 Subjektives Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
Neben dem Ges<strong>und</strong>heitszustand ist das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den e<strong>in</strong> bedeutsamer Bestandteil<br />
e<strong>in</strong>es guten Lebens im Alter. Lebenszufriedenheit <strong>und</strong> Gefühle stellen unterschiedliche Komponenten<br />
subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens dar. Lebenszufriedenheit betrifft die Beurteilung der eigenen<br />
Lebenssituation anhand von Bewertungsmaßstäben. Gefühlszustände spiegeln dagegen die Reaktion<br />
auf tägliche Ereignisse <strong>und</strong> Schwierigkeiten wider. Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte<br />
äußern im Durchschnitt hohe Zufriedenheit, erleben häufig positive Emotionen <strong>und</strong> erfahren eher<br />
selten negative Gefühle. Zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nahmen Zufriedenheit <strong>und</strong> positiver Affekt im<br />
509
510<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
Durchschnitt leicht zu <strong>und</strong> negativer Affekt leicht ab. Die Komponenten subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens<br />
– Lebenszufriedenheit, positive Gefühle <strong>und</strong> negative Gefühle – verändern sich mit dem<br />
Alter <strong>in</strong> unterschiedlicher Weise. Die Lebenszufriedenheit bleibt bis <strong>in</strong>s hohe Alter zum<strong>in</strong>dest<br />
stabil, <strong>und</strong> es zeigen sich sogar H<strong>in</strong>weise, dass Lebenszufriedenheit mit dem Alter tendenziell<br />
ansteigt. Gleichzeitig nimmt mit dem Alter die Häufigkeit erlebter Gefühle <strong>in</strong>sgesamt ab. Je<br />
älter Menschen werden, desto seltener erleben sie sowohl positive Gefühle (wie „Glück“) als<br />
auch negative Gefühle (wie „Trauer“).<br />
Frauen äußern höhere Zufriedenheit mit ihrem Leben als Männer. Dieser Unterschied zwischen<br />
den Geschlechtern verändert sich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nicht. Gleichwohl äußern Frauen auch<br />
<strong>in</strong> höherem Maß als Männer das Erleben negativer Gefühle. Die geschlechtsspezifischen Bef<strong>und</strong>muster<br />
h<strong>in</strong>sichtlich negativen Affekts könnten auf unterschiedliches Antwortverhalten von Männern<br />
<strong>und</strong> Frauen zurückzuführen se<strong>in</strong>: Es ist möglich, dass Frauen eher bereit s<strong>in</strong>d als Männer, das<br />
Erleben negativer Emotionen zu berichten. E<strong>in</strong> hervorzuhebendes, positiv zu bewertendes Ergebnis<br />
bezieht sich auf die Annäherung zwischen Ost <strong>und</strong> Westdeutschland. Die Zufriedenheit von<br />
Menschen, die <strong>in</strong> den neuen B<strong>und</strong>esländern leben, erhöhte sich zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 stärker<br />
als bei Menschen, die <strong>in</strong> den alten B<strong>und</strong>esländern leben. Es bestehen zwar auch im Jahr 2002 noch<br />
regionale Unterschiede <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit. Gleichwohl ist e<strong>in</strong>e deutliche Annäherung <strong>in</strong><br />
der Zufriedenheit von Menschen <strong>in</strong> Ost- <strong>und</strong> Westdeutschland zu verzeichnen. H<strong>in</strong>sichtlich sozialer<br />
Ungleichheit zeigen die Bef<strong>und</strong>e deutlich Unterschiede zuungunsten der Angehörigen unterer<br />
sozialer Schichten. Dieser E<strong>in</strong>fluss der Schicht zeigt sich auch <strong>in</strong> anderen Studien (Bulmahn,<br />
2002). Angehörige der unteren sozialen Schichten zeigen zudem zwischen 1996 <strong>und</strong> 2002 nur<br />
ger<strong>in</strong>ge Zugew<strong>in</strong>ne <strong>in</strong> der Lebenszufriedenheit. Für Angehörige der mittleren <strong>und</strong> gehobenen<br />
sozialen Schicht waren die entsprechenden Zuwächse <strong>in</strong> der subjektiven Lebensqualität deutlich<br />
größer. Die erheblichen Unterschiede zwischen sozialen Schichten im subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
blieben über den Zeitraum von sechs Jahren stabil.<br />
Die längsschnittlichen Analysen zur <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>n <strong>Entwicklung</strong>sdynamik zeigen, dass Veränderungen<br />
<strong>in</strong> der persönlichen Lebenssituation vor allem mit Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
Bewertungen zusammen hängen – <strong>und</strong> erst diese Veränderungen <strong>in</strong> bereichsspezifischen<br />
Bewertungen korrelieren mit Veränderungen der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit. Mit dem<br />
Alter verändern sich die Gewichtungen der Bewertung verschiedener Lebensbereiche für die<br />
allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit. Während <strong>in</strong> den jüngeren Altersgruppen Veränderungen <strong>in</strong> der<br />
Bewertung des Lebensstandards <strong>und</strong> der sozialen Beziehungen Bedeutung für Veränderungen <strong>in</strong><br />
der allgeme<strong>in</strong>en Lebenszufriedenheit haben, s<strong>in</strong>d dies <strong>in</strong> der ältesten Altersgruppe vor allem<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der subjektiven Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e belegen, dass das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation, bis <strong>in</strong>s fortgeschrittene Alter hoch bleibt. Dies<br />
ist, gerade angesichts e<strong>in</strong>es nicht selten negativen „Belastungsdiskurses“ <strong>in</strong> den Medien, e<strong>in</strong>e<br />
positive <strong>und</strong> optimistische Botschaft. Dieser Bef<strong>und</strong> sollte zum Anlass genommen werden, den<br />
medialen Diskurs über das Alter optimistischer zu gestalten. Das negative Altersstereotyp trifft<br />
offensichtlich nicht das Selbstbild älter werdender <strong>und</strong> alter Menschen. Zugleich sollte dabei<br />
jedoch nicht übersehen werden, dass gerade alte <strong>und</strong> sehr alte Menschen nur selten Unzufriedenheit<br />
mit der objektiven Lebenssituation äußern. Der an sich positiv zu bewertende Bef<strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>er hohen Lebenszufriedenheit auch im höheren Erwachsenenalter sollte nicht dazu führen,
Kapitel 11: Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
dass ältere Menschen generell aus dem Blickfeld sozialpolitischer Wachsamkeit geraten. Dies<br />
zeigt sich <strong>in</strong>sbesondere h<strong>in</strong>sichtlich des E<strong>in</strong>flusses sozialer Ungleichheit für das subjektive<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den.<br />
11.8 Die Lebenssituation der ausländischen Bevölkerung <strong>in</strong><br />
Deutschland<br />
Der Alterssurvey bietet umfangreiches Datenmaterial für e<strong>in</strong>e Analyse vielfältiger Lebensbereiche<br />
der ausländischen <strong>und</strong> der deutschen Bevölkerung <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte. Die besondere<br />
Stärke des Alterssurveys besteht dar<strong>in</strong>, dass Interaktionen zwischen e<strong>in</strong>zelnen Lebensbereichen<br />
im Detail analysiert werden können. Die ausländische Bevölkerungsgruppe <strong>in</strong> Deutschland<br />
ist <strong>in</strong> sich jedoch sehr heterogen <strong>und</strong> besteht aus vielen ethnischen Gruppen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Vielzahl<br />
von Nationalitäten. Dies erschwert zum e<strong>in</strong>en die Datenanalyse <strong>und</strong> die Aussagekraft der<br />
Analyseergebnisse, da jeweils nur ger<strong>in</strong>ge Fallzahlen zur Verfügung stehen. Zum anderen ist es<br />
kaum möglich, e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Sozialpolitik für alle ausländischen Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte zu gestalten. Dennoch wird im folgenden der Versuch unternommen, auf der Basis<br />
gewisser Regelmäßigkeiten <strong>in</strong> den Lebensverhältnissen 40- bis 85-jähriger Nichtdeutscher sozial-<br />
<strong>und</strong> gesellschaftspolitische Empfehlungen zu geben.<br />
Das aus der Literatur zur allgeme<strong>in</strong>en Lebenssituation von Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländern <strong>in</strong><br />
Deutschland h<strong>in</strong>länglich bekannte Ergebnis relativer sozioökonomischer Deprivation (ger<strong>in</strong>gere<br />
Schul- <strong>und</strong> Berufsbildungsqualifikationen, niedrige E<strong>in</strong>kommen, stärkere Betroffenheit von<br />
Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> Armut – <strong>und</strong> daraus folgend niedrigere Altersrenten, seltener Wohneigentum)<br />
wurde mit den Daten des Alterssurveys bestätigt. Ausländische Menschen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Lebenshälfte s<strong>in</strong>d dementsprechend stärker auf staatliche f<strong>in</strong>anzielle Transfers angewiesen als<br />
gleichaltrige Deutsche. Diese stärkere Bedürftigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass ausländische<br />
Menschen <strong>in</strong> der zweiten Lebenshälfte ke<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung von ihren (im Herkunftsland)<br />
lebenden Eltern erwarten können. Im Gegenteil, die <strong>in</strong> Deutschland lebenden 40- bis<br />
85-Jährigen selbst spielen e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle als f<strong>in</strong>anzielle Unterstützer ihrer im Herkunftsland<br />
zurückgebliebenen Familienangehörigen.<br />
Die Familie nimmt – sowohl bei Deutschen als auch bei Ausländern – e<strong>in</strong>e zentrale Stellung<br />
e<strong>in</strong>. Der Großteil der K<strong>in</strong>der von Deutschen <strong>und</strong> Nichtdeutschen lebt <strong>in</strong> der näheren Umgebung<br />
der Eltern <strong>und</strong> bietet so die Möglichkeit für direkte Interaktion <strong>und</strong> Kommunikation. E<strong>in</strong> zentraler<br />
Unterschied besteht jedoch dar<strong>in</strong>, dass die K<strong>in</strong>der e<strong>in</strong>es erheblichen Teils der Nichtdeutschen<br />
im Ausland leben. Noch bedeutsamer ist jedoch die Transnationalität <strong>in</strong> der Beziehung zu den<br />
Eltern, die bei den nichtdeutschen Staatsangehörigen zum weit überwiegenden Teil im Ausland<br />
leben. Die Wohnentfernung hat zwar Auswirkungen auf die Kontakthäufigkeit, nicht aber auf<br />
die empf<strong>und</strong>ene Enge der Beziehung. Während also Deutsche häufiger Kontakt zu ihren näher<br />
wohnenden Eltern pflegen, haben Nichtdeutsche zwar seltener Kontakt zu ihren weiter entfernt<br />
wohnenden Eltern, bezeichnen die Beziehung jedoch ebenfalls als eng bzw. sehr eng. Die <strong>in</strong><br />
Deutschland lebenden Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maße auf <strong>in</strong>strumentelle<br />
Haushaltshilfen angewiesen. Das liegt zum e<strong>in</strong>en vermutlich dar<strong>in</strong> begründet, dass sie öfter<br />
mit K<strong>in</strong>dern im eigenen Haushalt leben <strong>und</strong> so auf dieses Unterstützungspotenzial zurückgreifen<br />
511
512<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
können. Zu bedenken ist jedoch, dass die Arbeitsmigrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -migranten der ersten Anwerbungswellen<br />
<strong>in</strong> den 1950er Jahren erst <strong>in</strong> den nächsten Jahren die Lebensphase der Hochaltrigkeit<br />
erreichen werden. Die verstärkte Notwendigkeit außerhäuslicher <strong>in</strong>strumenteller Hilfen<br />
ergibt sich jedoch auch <strong>in</strong> der deutschen Bevölkerung erst ab e<strong>in</strong>em Alter von 70 Jahren. Es ist<br />
also fraglich, ob es sich bei diesem Ergebnis um e<strong>in</strong>en genu<strong>in</strong>en Unterschied zwischen Nichtdeutschen<br />
<strong>und</strong> Deutschen oder lediglich um e<strong>in</strong>en Alterseffekt der im Durchschnitt jüngeren<br />
Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer handelt. Es ist e<strong>in</strong>e wesentliche Aufgabe zukünftiger Alterssozialberichterstattung,<br />
dieser Frage nachzugehen.<br />
Sollte das Letztere der Fall se<strong>in</strong>, dann werden hochaltrige Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer <strong>in</strong><br />
Zukunft ebenfalls auf externe <strong>in</strong>strumentelle Hilfen angewiesen se<strong>in</strong>. Aufgr<strong>und</strong> der zuvor beschriebenen,<br />
ökonomisch deprivierten Lebensumstände werden sie jedoch kaum <strong>in</strong> der Lage<br />
se<strong>in</strong>, für Haushaltshilfen zu bezahlen. Hochaltrige Ausländer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ausländer könnten so zu<br />
e<strong>in</strong>er wesentlichen Zielgruppe zukünftiger sozialpolitischer Interventionen werden. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus ist es notwendig, bei der Planung zukünftiger ambulanter <strong>und</strong> stationärer Pflegestrukturen<br />
die besonderen Bedürfnisse dieser aus anderen Kulturkreisen stammenden Personen zu berücksichtigen.<br />
Es ist davon auszugehen, dass sich mit der rapiden Alterung der ausländischen<br />
Bevölkerungsgruppe e<strong>in</strong> starker zusätzlicher Bedarf an Pflegee<strong>in</strong>richtungen ergeben wird. Dabei<br />
sollte besonderer Wert auf e<strong>in</strong>e kultursensible Pflege gelegt werden. Es ist e<strong>in</strong>e wesentliche<br />
Aufgabe deutscher Gesellschafts- <strong>und</strong> Sozialpolitik, zu e<strong>in</strong>er gel<strong>in</strong>genden Integration ausländischer<br />
Menschen beizutragen. Die Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen wird am besten durch<br />
umfassende Bildungsangebote für alle Altersgruppen erhöht. Dies bedeutet u.a. Sprachkurse<br />
auch für ältere Menschen anzubieten. Langfristig noch wichtiger ist es aber, schulische <strong>und</strong><br />
berufliche Qualifikationen der jüngeren Generationen zu erhöhen, um diese <strong>in</strong> die Lage zu versetzen,<br />
sich selbst <strong>und</strong> ihren Familienangehörigen zu helfen. Das ist das Ziel e<strong>in</strong>er aktivierenden<br />
Sozialpolitik <strong>und</strong> zugleich das Ziel e<strong>in</strong>er erfolgreichen Generationenpolitik.<br />
11.9 Ausblick<br />
Der demografische <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Veränderungen stellen Gesellschaft,<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Politik e<strong>in</strong>erseits vor große Herausforderungen (Enquete-Kommission, 2002),<br />
bieten andererseits aber auch Chancen für gesellschaftliche Weiterentwicklung (Qualls & Abeles,<br />
2000). Die zweite Welle des Alterssurveys stellt für Akteure <strong>in</strong> Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Politik umfassende Informationen zu sozialem <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> <strong><strong>in</strong>dividuelle</strong>r <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> der<br />
zweiten Lebenshälfte zusammen. Die gegenwärtigen <strong>und</strong> auch künftigen Generationen älterer<br />
Menschen verfügen über zahlreiche Ressourcen, die bereits jetzt im Rahmen von familialer<br />
Unterstützung <strong>und</strong> bürgerschaftlichem Engagement gesellschaftlich nutzbar gemacht werden,<br />
die aber <strong>in</strong> Zukunft möglicherweise noch breiter aktiviert werden können.<br />
Im S<strong>in</strong>ne des oben skizzierten „Bedarfs- <strong>und</strong> Versorgungsdiskurses“ lassen die Bef<strong>und</strong>e zu den<br />
verschiedenen Themen erkennen, dass es der gegenwärtigen Generation älterer Menschen recht<br />
gut geht. Die E<strong>in</strong>kommenssituation ist im Durchschnitt als adäquat zu bezeichnen, die soziale<br />
Integration <strong>in</strong> Familie <strong>und</strong> soziale Netzwerke ist gut <strong>und</strong> das subjektive Wohlbef<strong>in</strong>den ist hoch.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist dabei zu berücksichtigen, dass durch Durchschnittswerte die zum Teil bestehen-
Kapitel 11: Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
den, erheblichen Differenzierungen <strong>und</strong> sozialen Ungleichheiten verdeckt werden, die nach wie<br />
vor e<strong>in</strong>e Herausforderung für Gesellschafts- <strong>und</strong> Sozialpolitik darstellen. Zudem machen die<br />
Bef<strong>und</strong>e zum sozialen <strong>Wandel</strong> deutlich, dass zukünftig <strong>in</strong> den Bereichen materielle Versorgung<br />
<strong>und</strong> soziale Integration möglicherweise mit e<strong>in</strong>em Anstieg von Problemlagen zu rechnen ist.<br />
Sollte die Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung <strong>in</strong> Zukunft durch Dämpfungsmaßnahmen<br />
s<strong>in</strong>ken, so ist gerade bei bedürftigen Haushalten nicht davon auszugehen, dass sie <strong>in</strong> der<br />
Lage se<strong>in</strong> werden, kompensierende private Alterssicherungen abzuschließen. Der <strong>Wandel</strong> <strong>in</strong> der<br />
Zusammensetzung von Familien, die weiterh<strong>in</strong> steigende K<strong>in</strong>derlosigkeit nachwachsender Generationen<br />
sowie die ansteigende Mobilität der K<strong>in</strong>dergenerationen kann <strong>in</strong> Zukunft ebenfalls<br />
zu häufiger werdenden Konstellationen brüchiger sozialer Unterstützungsnetzwerke führen.<br />
Hier ist es sicherlich notwendig, geeignete sozialpolitische Maßnahmen im Bereich der sozialen<br />
Sicherung sowie der Unterstützung von älteren Menschen mit Hilfe- <strong>und</strong> Pflegebedarf bereitzustellen.<br />
Diese <strong>Entwicklung</strong>en lassen es geraten ersche<strong>in</strong>en, nicht allzu voreilig Entwarnung mit<br />
Blick auf den Hilfebedarf alter <strong>und</strong> sehr alter Menschen zu geben.<br />
Gleichwohl lassen sich <strong>in</strong> den Bef<strong>und</strong>en der zweiten Welle des Alterssurveys auch sehr positive<br />
<strong>und</strong> optimistisch stimmende Botschaften entnehmen. Offenk<strong>und</strong>ig hält der Trend zu verbesserter<br />
Ges<strong>und</strong>heit nachwachsender Generationen an. Deutliche Anzeichen für verbesserte Ges<strong>und</strong>heit<br />
der zukünftigen „jungen Alten“ ließen sich <strong>in</strong> den Bef<strong>und</strong>en ablesen. Gerade hier ist jedoch<br />
zu betonen, dass die ges<strong>und</strong>heitlichen Potenziale älter werdender Menschen durch Maßnahmen<br />
der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Prävention gestützt werden sollten. Der Blick auf die <strong>in</strong> der Regel<br />
recht gute Ges<strong>und</strong>heit von Menschen zwischen 40 <strong>und</strong> 70 Jahren lässt auch den Schluss zu,<br />
dass ges<strong>und</strong>heitliche Gründe kaum gegen e<strong>in</strong>e Verlängerung der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit<br />
sprechen. Dazu kommt die Tatsache, dass sich <strong>in</strong> den Köpfen älter werdender Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmer offensichtlich e<strong>in</strong> <strong>Wandel</strong> h<strong>in</strong>sichtlich der eigenen Lebensplanung<br />
vollzieht: Immer weniger ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer planen e<strong>in</strong>en Berufsausstieg<br />
mit 60 Jahren. Allerd<strong>in</strong>gs muss hierbei bedacht werden, dass im Arbeitsmarkt gegenwärtig<br />
noch ke<strong>in</strong>e starke Nachfrage nach (älteren) Arbeitskräften besteht. Daher s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> jedem<br />
Fall Maßnahmen der Schonung <strong>und</strong> Pflege von Humankapitalressourcen, die auch <strong>in</strong> der<br />
Verantwortung von Betrieben liegen, sowie der flankierenden Absicherung angesichts e<strong>in</strong>es<br />
gegenwärtig wenig dynamischen Arbeitsmarktes notwendig.<br />
Wir hoffen, dass die hier vorgelegten Bef<strong>und</strong>e dabei helfen werden, die Herausforderungen des<br />
demografischen <strong>Wandel</strong>s nicht ausschließlich unter der Perspektive der gesellschaftlichen Belastungen<br />
<strong>und</strong> ihrer Verteilung zu sehen. Vielmehr denken wir, dass es e<strong>in</strong>e Reihe von Chancen<br />
gibt, die der demografische <strong>Wandel</strong> <strong>und</strong> die sich daran anschließenden gesellschaftlichen Veränderungen<br />
bieten. Sich den Herausforderungen optimistisch zu stellen <strong>und</strong> die Chancen produktiv<br />
zu nutzen, sollte das Ziel geme<strong>in</strong>samer Anstrengungen von Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong><br />
Politik se<strong>in</strong>.<br />
513
514<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
11.10 Literatur<br />
Baltes, P. B. (1984). Intelligenz im Alter. Spektrum der Wissenschaft, Mai 1984, 46-60.<br />
Baltes, P. B. (1997). On the <strong>in</strong>complete architecture of human ontogeny: selection, optimization,<br />
and compensation as fo<strong>und</strong>ation of developmental theory. American Psychologist,<br />
52, 366-380.<br />
Baltes, P. B. (2003). On the <strong>in</strong>complete architecture of human ontogeny. Selection, optimization,<br />
and compensation as fo<strong>und</strong>ation of development theory. In U. M. Staud<strong>in</strong>ger & U.<br />
L<strong>in</strong>denberger (Eds.), Understand<strong>in</strong>g human development (pp. 17-43). Boston.<br />
Barkholdt, C. (2001). Prekärer Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.<br />
Behrend, C. (Ed.) (2002). Chancen für die Erwerbsarbeit im Alter. Opladen: Leske u. Budrich.<br />
Bertelsmann Stiftung. (2003a). Altersvorsorge 2003: Wer hat sie, wer will sie? Private <strong>und</strong><br />
betriebliche Altersvorsorge der 30- bis 50-Jährigen <strong>in</strong> Deutschland (Bertelsmann Stiftung<br />
Vorsorgestudien 18). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.<br />
Bertelsmann Stiftung (Ed.). (2003b). Vorsorgereport. Private Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Ed.). (1998). Zweiter<br />
Bericht zur Lage der älteren Generation <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland: Wohnen<br />
im Alter. Bonn: BMFSFJ.<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Ed.). (2001). Alter <strong>und</strong><br />
Gesellschaft. Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. Bonn: BMFSFJ (zugleich B<strong>und</strong>estagsdrucksache 14/5130).<br />
BMFSFJ, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Ed.). (2002). Vierter<br />
Bericht zur Lage der älteren Generation <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland: Risiken,<br />
Lebensqualität <strong>und</strong> Versorgung Hochaltriger - unter besonderer Berücksichtigung dementieller<br />
Erkrankungen. Bonn: BMFSFJ (zugleich B<strong>und</strong>estagsdrucksache 14/8822).<br />
Braun, J., Burmeister, J., & Engels, D. (Eds.). (2004). seniorTra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>: Neue Verantwortungsrolle<br />
<strong>und</strong> Engagement <strong>in</strong> Kommunen. Köln: Institut für sozialwissenschaftliche Analysen<br />
<strong>und</strong> Beratung.<br />
Bulmahn, T. (2002). Globalmaße des subjektiven Wohlbef<strong>in</strong>dens. In Statistisches B<strong>und</strong>esamt<br />
(Ed.), Datenreport 2002. Zahlen <strong>und</strong> Fakten über die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland (pp.<br />
423-631). Bonn: B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung.<br />
Dieck, M., & Naegele, G. (Eds.). (1978). Sozialpolitik für ältere Menschen. Heidelberg: Quelle<br />
& Meyer.<br />
Dieck, M., & Naegele, G. (1993). "Neue Alte" <strong>und</strong> alte soziale Ungleichheiten - vernachlässigte<br />
Dimensionen <strong>in</strong> der Diskussion des Altersstrukturwandels. In G. Naegele & H. P. Tews<br />
(Eds.), Lebenslagen im Strukturwandel des Alters (pp. 43-60). Opladen: Westdeutscher<br />
Verlag.
Kapitel 11: Implikationen des Alterssurveys für Gesellschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
Dittmann-Kohli, F., Sowarka, D., & Timmer, E. (1997). Beruf <strong>und</strong> Alltag: Leistungsprobleme<br />
<strong>und</strong> Lernaufgaben im mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter. In F. E. We<strong>in</strong>ert & H.<br />
Mandl (Eds.), Psychologie der Erwachsenenbildung. Enzyklopädie für Psychologie,<br />
Themenbereich D, Praxisgebiete, Serie I, Pädagogische Psychologie, Band 4 (pp. 197-<br />
235). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.<br />
Enquete-Kommission. (2002). Schlussbericht der Enquete-Kommission "Demographischer<br />
<strong>Wandel</strong> - Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den e<strong>in</strong>zelnen<br />
<strong>und</strong> die Politik". Berl<strong>in</strong>: Deutscher B<strong>und</strong>estag.<br />
Gronemeyer, R. (1996). Die gesellschaftlichen Belastungsdiskurse <strong>und</strong> die Solidarität der Generationen.<br />
In B. D<strong>in</strong>kel (Ed.), KAB-Altenarbeit (pp. 147-155). Bornheim: KAB.<br />
Hoffmann, M., Köhler, A., & Sauer, U. (1999). Omas kontra Enkel. Wirtschaftswoche, 1999 (9.<br />
September 1999), 32-42.<br />
Kohli, M., & Künem<strong>und</strong>, H. (2000). Bewertung <strong>und</strong> Ausblick. In M. Kohli & H. Künem<strong>und</strong><br />
(Eds.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel<br />
des Alters-Survey. (pp. 337-342). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kohli, M., Künem<strong>und</strong>, H., Motel, A., & Szydlik, M. (2000). Soziale Ungleichheit. In M. Kohli<br />
& H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation<br />
im Spiegel des Alters-Survey. (pp. 318-333). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Kondratowitz, H. J. v. (1999). Alter <strong>und</strong> Altern. In G. Albrecht, A. Groenemeyer & F. W. Stallberg<br />
(Eds.), Handbuch soziale Probleme (pp. 236-254). Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Kruse, A. (2002). Ges<strong>und</strong> altern. Baden Baden: Nomos.<br />
Künem<strong>und</strong>, H. (2000). "Produktive" Tätigkeiten. In M. Kohli & H. Künem<strong>und</strong> (Eds.), Die zweite<br />
Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage <strong>und</strong> Partizipation im Spiegel des Alters-Survey.<br />
(pp. 277-317). Opladen: Leske + Budrich.<br />
Lehr, U. (1978). Körperliche <strong>und</strong> geistige Aktivität - e<strong>in</strong>e Voraussetzung für e<strong>in</strong> erfolgreiches<br />
Altern. Zeitschrift für Gerontologie, 11, 290-299.<br />
Lüscher, K., & Liegle, L. (2003). Generationenbeziehungen <strong>in</strong> Familie <strong>und</strong> Gesellschaft. Konstanz:<br />
UVK Verlagsgesellschaft.<br />
Manton, K. G., & Gu, X. (2004, <strong>in</strong> press). Canges <strong>in</strong> physical and mental function <strong>in</strong> older people:<br />
Look<strong>in</strong>g back and look<strong>in</strong>g ahead. In H.-W. Wahl, C. Tesch-Roemer & A. Hoff<br />
(Eds.), New dynamics <strong>in</strong> old age: Individual, environmental and societal perspectives.<br />
Amityville, NY: Baywood.<br />
Qualls, S. H., & Abeles, N. (Eds.). (2000). Psychology and the ag<strong>in</strong>g revolution. Wash<strong>in</strong>gton:<br />
American Psychological Association.<br />
Schmähl, W. (2002). Leben die "Alten" auf Kosten der "Jungen"? Anmerkungen zur Belastungsverteilung<br />
zwischen "Generationen" <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Bevölkerung aus ökonomischer<br />
Perspektive. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35(4), 304-314.<br />
515
516<br />
Clemens Tesch-Römer, Susanne Wurm, Andreas Hoff, Heribert Engstler <strong>und</strong> Andreas Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel<br />
S<strong>in</strong>n, H.-W., & Übelmesser, S. (2000). Wann kippt Deutschland um? ifo Schnelldienst, 53, 20-<br />
25.<br />
Ste<strong>in</strong>hagen-Thiessen, E., & Borchelt, M. (1996). Morbidität, Medikation <strong>und</strong> Funktionalität im<br />
Alter. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berl<strong>in</strong>er Altersstudie (pp. 151-183).<br />
Berl<strong>in</strong>: Akademie Verlag.<br />
Thomae, H., & Lehr, U. (1973). Berufliche Leistungsfähigkeit im mittleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter<br />
- e<strong>in</strong>e Analyse des Forschungsstands. Gött<strong>in</strong>gen: Schwartz.<br />
Tremmel, J. (1997). Wie die gesetzliche Rentenversicherung nach dem Pr<strong>in</strong>zip der Generationengerechtigkeit<br />
reformiert werden kann. In Gesellschaft für die Rechte zukünftiger<br />
Generationen (Ed.), Ihr habt dieses Land nur von uns geborgt (pp. 149-240). Hamburg:<br />
Rasch <strong>und</strong> Röhr<strong>in</strong>g.