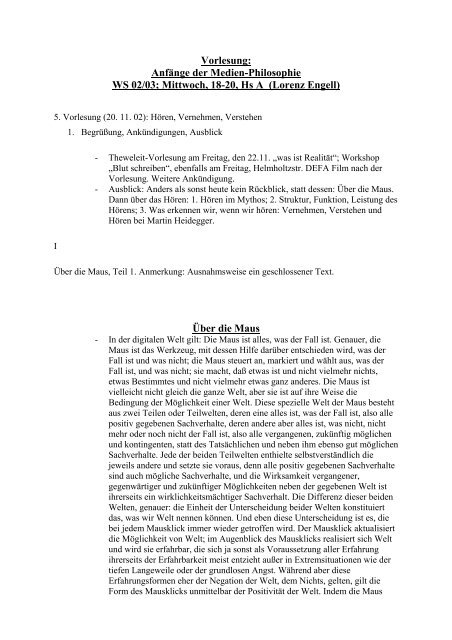Hören, Vernehmen, Verstehen
Hören, Vernehmen, Verstehen
Hören, Vernehmen, Verstehen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorlesung:<br />
Anfänge der Medien-Philosophie<br />
WS 02/03; Mittwoch, 18-20, Hs A (Lorenz Engell)<br />
5. Vorlesung (20. 11. 02): <strong>Hören</strong>, <strong>Vernehmen</strong>, <strong>Verstehen</strong><br />
I<br />
1. Begrüßung, Ankündigungen, Ausblick<br />
- Theweleit-Vorlesung am Freitag, den 22.11. „was ist Realität“; Workshop<br />
„Blut schreiben“, ebenfalls am Freitag, Helmholtzstr. DEFA Film nach der<br />
Vorlesung. Weitere Ankündigung.<br />
- Ausblick: Anders als sonst heute kein Rückblick, statt dessen: Über die Maus.<br />
Dann über das <strong>Hören</strong>: 1. <strong>Hören</strong> im Mythos; 2. Struktur, Funktion, Leistung des<br />
<strong>Hören</strong>s; 3. Was erkennen wir, wenn wir hören: <strong>Vernehmen</strong>, <strong>Verstehen</strong> und<br />
<strong>Hören</strong> bei Martin Heidegger.<br />
Über die Maus, Teil 1. Anmerkung: Ausnahmsweise ein geschlossener Text.<br />
Über die Maus<br />
- In der digitalen Welt gilt: Die Maus ist alles, was der Fall ist. Genauer, die<br />
Maus ist das Werkzeug, mit dessen Hilfe darüber entschieden wird, was der<br />
Fall ist und was nicht; die Maus steuert an, markiert und wählt aus, was der<br />
Fall ist, und was nicht; sie macht, daß etwas ist und nicht vielmehr nichts,<br />
etwas Bestimmtes und nicht vielmehr etwas ganz anderes. Die Maus ist<br />
vielleicht nicht gleich die ganze Welt, aber sie ist auf ihre Weise die<br />
Bedingung der Möglichkeit einer Welt. Diese spezielle Welt der Maus besteht<br />
aus zwei Teilen oder Teilwelten, deren eine alles ist, was der Fall ist, also alle<br />
positiv gegebenen Sachverhalte, deren andere aber alles ist, was nicht, nicht<br />
mehr oder noch nicht der Fall ist, also alle vergangenen, zukünftig möglichen<br />
und kontingenten, statt des Tatsächlichen und neben ihm ebenso gut möglichen<br />
Sachverhalte. Jede der beiden Teilwelten enthielte selbstverständlich die<br />
jeweils andere und setzte sie voraus, denn alle positiv gegebenen Sachverhalte<br />
sind auch mögliche Sachverhalte, und die Wirksamkeit vergangener,<br />
gegenwärtiger und zukünftiger Möglichkeiten neben der gegebenen Welt ist<br />
ihrerseits ein wirklichkeitsmächtiger Sachverhalt. Die Differenz dieser beiden<br />
Welten, genauer: die Einheit der Unterscheidung beider Welten konstituiert<br />
das, was wir Welt nennen können. Und eben diese Unterscheidung ist es, die<br />
bei jedem Mausklick immer wieder getroffen wird. Der Mausklick aktualisiert<br />
die Möglichkeit von Welt; im Augenblick des Mausklicks realisiert sich Welt<br />
und wird sie erfahrbar, die sich ja sonst als Voraussetzung aller Erfahrung<br />
ihrerseits der Erfahrbarkeit meist entzieht außer in Extremsituationen wie der<br />
tiefen Langeweile oder der grundlosen Angst. Während aber diese<br />
Erfahrungsformen eher der Negation der Welt, dem Nichts, gelten, gilt die<br />
Form des Mausklicks unmittelbar der Positivität der Welt. Indem die Maus
zwischen dem positiv Gegebenen und dem daneben und als nächstes auch<br />
Möglichen unterscheidet, etwas in die Welt der Sachverhalte hebt, anderes<br />
aber ins das Reich des bloß Möglichen verweist, aktualisiert sie deren<br />
Differenz und bejaht damit die Welt. Wo Angst und Langeweile die Welt<br />
durch Negation zum Vorschein bringen, da verhält sich die Maus grundsätzlich<br />
affirmativ zur Welt.<br />
- Keine Sorge, wenn dies etwas rätselhaft erscheint, ich komme darauf zurück.<br />
Denn diese Betrachtungen über die Welt der Maus greifen zunächst weit<br />
voraus. Für sich genommen nämlich ist die Maus erst einmal so gut wie gar<br />
nichts. Funktion besitzt und Sinn entfaltet sie erst als Teil eines umfassenderen<br />
technischen Gefüges, in das sie eingelassen ist, und das etwa Betriebssysteme,<br />
Benutzeroberflächen, Vernetzungsformen mit umgreift. Nur im Verein mit der<br />
Fenstertechnologie und den Schaltflächen etwa kann die Maus greifen. Hierin<br />
gleichen sich viele Schreib-, Werk- oder Denkzeuge, Medien, die je für sich<br />
allein genommen wenig oder nichts vermögen und der Ergänzung durch<br />
Komplemente bedürfen, syntagmatische Zusammenhänge ausbilden. Zum<br />
Bleistift gehört das Papier, zum Buchdruck die Buchbinderkunst, zum<br />
Hochhaus der Fahrstuhl, zur Eisenbahn der Telegraph; die Fernbedienung gibt<br />
Sinn nur im Verein mit Kabel- und Satellitenempfang (und umgekehrt), der<br />
Walkman setzt die Compact Cassette voraus, die wiederum ohne den Walkman<br />
vermutlich längst vom Markt verschwunden wäre. Hinzu kommt, daß der<br />
Beitrag der Maus zu unseren Gedanken gar nicht unbedingt eng an die Maus<br />
gebunden ist. Die physische, gegenständliche Maus ist auf einer<br />
paradigmatischen Achse ersetzbar, etwa durch Trackball oder Touchpad. Die<br />
konkrete Maus ist eine mögliche Kristallisationsform ihrer Funktion im<br />
Kontext, eben der Mausfunktion, unter vielen anderen, auch wenn sie<br />
möglicherweise eine ideale Form ausbildet. In beiden Eigenschaften, der<br />
syntagmatischen Komplementarität mit anderen einerseits und der funktionalen<br />
paradigmatischen Substituierbarkeit durch andere andererseits, erweist sich die<br />
Maus als ein typisches Medium. Medien bilden noch immer<br />
Systemzusammenhänge aus, sie beziehen sich stets auf andere Medien, die sie<br />
zu Komplexen ergänzen oder in Komplexen ersetzen können. Schon Marshall<br />
McLuhan wußte, daß man Medien weniger in der Differenzperspektive<br />
erklären kann im Hinblick auf irgend eine außerhalb ihrer liegende Realität<br />
und sog. „Inhalte“, als vielmehr in der funktionalen Perspektive im Hinblick<br />
auf die Funktionen, die sie im Gefüge der Medien einnehmen, auf den<br />
Zusammenhang, der sie mit anderen zusammenschließt.<br />
- Die Mausfunktion ist ihrerseits komplex, sie kann ihrerseits – getreu den<br />
Fundamentalkategorien Peirces - aufgegliedert werden in drei Teilbereiche.<br />
Erstens oder als Erstheit ist die Maus funktional in sich, ohne weitere Hinsicht<br />
auf das, was sie leistet oder bedeutet. Damit hat die Maus, wie Morris dies<br />
nennt, syntaktische Funktionen für das materielle und visuelle Geschehen auf<br />
der Bildschirmoberfläche; das Ausgangsmaterial, mit dem sie arbeitet, sind<br />
bestimmte Handbewegungen und Handlungen, die sie einer strengen<br />
Systematik in der Art einer Grammatik unterwirft. Zweitens oder als Zweitheit<br />
steht die Maus in einer Beziehung zu etwas anderem; koordiniert sie die<br />
Geschehensabläufe auf der Bildschirmoberfläche mit solchen außerhalb des<br />
Bildschirms in der physischen und gedanklichen Welt des Nutzers ebenso wie<br />
in der technischen Binnenwelt des Geräts. Sie besitzt dann in der semantischen<br />
Dimension eine Repräsentationsfunktion, indem sie etwa Bewegungen des<br />
Nutzers und Abläufe des Programms miteinander verschränkt und auch auf
dem Bildschirm ablesbar, sichtbar macht, auf- und anzeigt. Und erst drittens<br />
oder als Drittheit, in der pragmatischen Dimension in der Terminologie<br />
Morris’, stellt sie Zusammenhänge her, indem sie Dinge außerhalb ihrer selbst<br />
miteinander verknüpft. Sie läßt Verbindungen und Zusammenhänge erstehen<br />
und schießlich gibt sie, was uns mit Nietzsche am meisten interessiert, der<br />
Welt, die sie erschließt, eine bestimmte und bestimmbare Form, interpretiert<br />
sie die Welt, erzeugt sie Wahrnehmungs-, Sinngebungs- und<br />
Denkgewohnheiten.<br />
2. Erste Unterbrechung<br />
4. Fortsetzung<br />
- Nachbetrachtung zu Erstheit, Zeitheit, Drittheit: Natürlich ist die Maus als<br />
technisch konstituiertes, real begegnendes Artefakt immer vom Charakter der<br />
Zweitheit.<br />
- Dennoch können auch an realen Gegenständen die drei Kategorien<br />
unterschieden werden, wenigstens analytisch, weil Zweitheit immer Erstheit<br />
einschließt; und weil diese Unterscheidung immer schon Drittheit erfordert (es<br />
gibt auch andere Argumente, aber das soll hier genügen).<br />
- Der erste, der syntaktische Funktionsbereich der Maus umfaßt folglich das<br />
Rohmaterial, aus dem das Maushandeln sich aufbaut; all das, was die<br />
Bewegung des Cursors über das Bildfeld betrifft (und dasjenige der Maus<br />
selbst über den Mauspad, die Handbewegung). Das ist zunächst und zuerst das<br />
bloße, oft zunächst noch orientierungslose Fahren und Schwenken über die<br />
Bildschirmoberfläche. Es hat mitunter, zu Beginn einer Computersitzung, rein<br />
phatische Funktion und meldet Gerät und Betriebssystem zur Stelle. Dann aber<br />
folgt das mehr oder weniger gezielte Suchen oder gar Aufsuchen bestimmter<br />
Stellen auf der Bildschirmoberfläche, wie auch entsprechend das Innehalten,<br />
das Ansteuern, Anzeigen und Hervorheben bestimmter Punkte, Flächen und<br />
Fenster. Jeder beliebige Punkt der Bildschrimoberfläche kann von jedem<br />
beliebigen anderen aus auf jedem beliebigen Weg angesteuert und aufgesucht<br />
werden. Es gibt, trotz oder gar wegen der digitalen, also diskreten<br />
Bildtechnologie etwa des Flüssigkristalbildschirms keine feste Organisation<br />
der Fläche etwa in Zeilen, Linien und Spalten mehr und keine diskrete Struktur<br />
der Nutzeroberfläche. Damit gewinnt die Maus auf der Bildschirmoberfläche<br />
etwas von der Freiheit des Blicks im Raum oder derjenigen des Zeichenstifts<br />
auf dem Papier zurück und führt über das konventionelle Schreiben hinaus, das<br />
sich die Welt schließlich in geordneten Bahnen erschließt. Zweitens gehört in<br />
diesen Bereich materieller Funktion der Maus essentiell das Auswählen durch<br />
den berühmten Mausklick, die Betätigung der Taste. Am Übergang vom<br />
Ansteuern zum Anklicken können sehr schön die Selektionsstufen der -<br />
revidierbaren, noch virtuellen - Vorauswahl und der gültigen Wahl markiert<br />
werden, wie sie für den Aufbau von Sinnsystemen kennzeichnend ist, in denen<br />
an eine Aussage oder an eine Handlung keineswegs irgend eine beliebige<br />
andere als sinnvoll folgen kann, wohl aber eine sehr große, durch den<br />
Sinnrahmen schon vorstrukturierte und vorausgewählte Vielzahl, aus der dann<br />
eine aktuelle Folgehandlung oder Folgeaussage sinnhaft ausgewählt wird. Auf<br />
das bloße Abschwenken eines möglichen Angebots folgt also im Mausklick<br />
eine Entscheidung für etwas Bestimmtes und gegen etwas oder alles andere,
wobei diese Entscheidung in aller Regel weitere Entscheidungsmöglichkeiten<br />
oder weiteren Entscheidungszwang nach sich zieht; neue Fenster werden<br />
geöffnet, die neue Betrachtung erfordern und neue Selektionsmöglichkeiten<br />
darbieten. Schließlich wäre eine dritte Variante des materiellen<br />
Funktionsbereichs zu nennen, nämlich die Kombination der beiden ersten, also<br />
die Bewegung der Maus bei gedrückter Taste bzw. die Veränderung der<br />
Flächen und Fenster, das Verkleinern, Vergrößern und Umsortieren, die<br />
Verschiebung der Fenster und Symbole, das berühmte „Ziehen“, mit dem man<br />
etwa ein Dokument „hervorziehen“ oder von einem Ordner in einen anderen<br />
„hinüberziehen“ kann. Damit ist bereits der Bereich der Bearbeitung benannt,<br />
d. h. des Eingriffs in die vorstrukturierte Welt, die jetzt nicht mehr nur als<br />
nachvollziehbarer Entscheidungsbaum, als Selektionsmasse zur Verfügung<br />
steht, sondern zu einer regelrechten Umgebung (und damit erst überhaupt zu so<br />
etwas wie einer Welt) werden kann, an und in der, neben den reversiblen, auch<br />
irreversible, in dieser Form so nicht vorselegierte Handlungen vorgenommen<br />
werden können, eine dynamische, temporalisierte Welt also. In allen drei<br />
Fällen, dem Fahren, dem Klicken und dem Ziehen, entwickeln sich im übrigen<br />
alsbald routinemäßige Handlungs- und Bewegungsbabfolgen, optimierte<br />
Standardverläufe, Programmen ähnlich. Zwischen den programmierten<br />
Abläufen des Rechners und jenen des Nutzers muß hier nicht unterschieden<br />
werden; die Maus funktioniert gleichsam in beiderlei Richtung, indem sie nicht<br />
nur dem Rechner sagt, was er als nächstes tun soll, sondern auch dem Nutzer,<br />
und so Vorschriften und Befehle in beiderlei Richtung und Hinsicht erteilt.<br />
3. Zweite Unterbrechung: Iconizität, Indexikalität und Symbolizität<br />
- Damit komen wir zur zweiten Ebene der Maus, nämlich zu ihrer<br />
Darstellungsfunktion<br />
- Dazu eine grundsätzliche, wichtige Erweiterung: Erstheit, Zweitheit und<br />
Drittheit sind nicht nur zusammen gegeben, sondern sie können auch<br />
aufeinander bezogen, aufeinander abgebildet werden.<br />
- Das ist ja auch ganz logisch: Seiendes jeder Kategorie kann auftreten oder<br />
gegeben sein wiederum im Modus der Erstheit, Zweitheit oder Drittheit.<br />
- Für den besonderen Fall der Zweitheit bedeutet das: Die beiden in der<br />
Zweitheit zusammen auftretenden Gegebenheiten können je nach der Art ihres<br />
Zusammehangs unterschieden werden:<br />
- Haben Sie etwas gemeinsam (Ähnlichkeit): Erstheit des Zusammenhangs (das<br />
kann aber auch z.B. der Ort oder der Zeitpunkt ihres Auftretens sein o.ä.);<br />
- Treten sie als Ursache und Wirkung bzw. Grund und Folge auf: Zweitheit des<br />
Zusammenhangs;<br />
- Treten sie als frei gestifteter Zusammenhang auf, der konventionell (also über<br />
etwas Drittes, Unabhängiges) vermittelt ist: Drittheit des Zusammenhangs.<br />
- Erstheit: ICONIZITÄT, Zweitheit: INDEXIKALITÄT, Drittheit:<br />
SYMBOLIZITÄT<br />
4. Fortsetzung Maus<br />
- Im zweiten Funktionsbereich, dem Bereich der Semantik oder der<br />
Repräsentation, haben wir es dagegen mit Visualisierungen, Koordinationen<br />
und Anzeigen sowie mit komplexen Darstellungsvorgängen zu tun. Als erstes<br />
und für sich genommen stellt die Maus natürlich, aufgrund ihrer ergonomisch
gewonnen Form, eine Maus dar; allein dies schon, die Metapher der Maus,<br />
immerhin ein Lebewesen, und ein niedliches dazu, bietet viel Raum für<br />
Interpretation. Die iconischen und indexikalischen Darstellungsbeziehungen<br />
des gesamten Maus-Komplexes aber sind hier von größerem funktionalen<br />
Gewicht. In einer ganzen Kette von Analogiebeziehungen - und auch<br />
Analogiebeziehungen können digital codiert sein -, die zum Teil physiologisch<br />
begründet sind, zum Teil technisch und zum Teil rein konventionell,<br />
repräsentiert der Cursor auf dem Bildschirm den Blick des Benutzers auf<br />
einzelne Teile und Ausschnitte des Bildfeldes, oder genauer: den Focus; und<br />
zwar sowohl den Focus als Blick- und visuelles Schärfezentrum wie auch als<br />
Zentrum der Aufmerksamkeit, jenseits dessen zunächst ein Unschärfebereich,<br />
eine Dunstzone noch abgeblendeter möglicher nächster oder vorhergehender<br />
Focusssierung liegt. Diese Kette verläuft von der Aufmerksamkeit des Blicks<br />
über die Auge-Hand-Beziehung zur Maus selbst und von dort über das<br />
Mousepad bis zum Cursor auf dem Bildschirm. In vielen Anwendungen<br />
repräsentiert der Cursor sogar den Benutzer selbst, nämlich alle seine<br />
funktionalen Handlungsmöglichkeiten in der dargebotenen Welt. Daraufhin<br />
erst wird es möglich und sinnvoll, den Cursor auch visuell als Figur, als<br />
Abbildung einer Hand, eines Körpers zu gestalten und ihn als virtuelle Person,<br />
als Avatar im wahrsten Sinne des Wortes auszuführen, wie er uns<br />
beispielsweise im Videospiel begegnet. Die nächste, die indexikalische Stufe<br />
der Repräsentationsfunktion wird wiederum im Mausklick erreicht, diesem<br />
technischen und auch epistemologischen Zentrum des gesamten Maus-<br />
Komplexes. Der Cursor repräsentiert jetzt die Hand; genauer: den Zeigefinger,<br />
das digitum des Benutzers und das Moment der Berührung. Das Aufleuchten,<br />
Hinterlegen, Beschriften oder sonstige Herausheben des repräsentiert die<br />
Deixis, die Zeigehandlung, durch die die eigentliche Selektion bereits angelegt<br />
und dann in der Berührung der Taste realisiert wird. Die gesamte<br />
Kulturtheorie der Deixis, die semiotischen, psychologischen und<br />
epistemologischen Verzweigungen der elementaren und primären „Dies-Dort-<br />
Du-Dann“-Relation und des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs, die durch<br />
die Deixis aufgepannt wird und die bis hin zu magischen und rituellen<br />
Praktiken der Berührung und des Handauflegens, zu den Schöpfungsmythen<br />
und zu seltsamen Alltagsbräuchen wie dem Händedruck führt, braucht hier<br />
nicht ausgeführt zu werden. Wichtig ist, daß durch den Mausklick in dem<br />
durch den Bildschirm zur Unterscheidung freigegebenen Material eine<br />
konkrete Unterscheidung getroffen wird (dieses hier und alles andere -<br />
wenigstens jetzt erst einmal - nicht), und zugleich die ausgewählte Seite der<br />
Unterscheidung positiv markiert, bezeichnet wird (dies hier). Die Maus wählt<br />
jedoch nicht nur aus, sie löst auch aus und gibt ganze Handlungsroutinen frei,<br />
die sich sich entlang mehr oder weniger fester Schemata aus dem<br />
Zusammenspiel der getroffenen Wahl und der dadurch ausgelösten Arbeit des<br />
Rechners selbst ergeben. Auch zum Phänomen der Auslösung als der<br />
spezifischen Funktion des Schalters existiert eine ausgearbeiteter<br />
Theoriekontext, in dem insbesondere als Kern maschineller und<br />
maschinisierter Vorgänge nicht etwa der energetische oder der mechanische<br />
Prozeß ausgemacht wird, sondern vielmehr der regelungstechnische Eingriff<br />
der Unterbrechung und Auslösung der mechanischen Bewegung. In diesem<br />
Sinne repräsentiert die Maus nicht nur die Welt des Benutzers und seine<br />
Handlungsmöglichkeiten auf dem Bildschirm, sondern zugleich auch die Welt<br />
des Gerätes und seiner Möglichkeiten; gleichsam das Innere des Geräts oder
doch einen Teil davon. Erst dadurch wird der Bildschirm zur Schnittstelle oder<br />
zur Berührungsfläche des Mensch-Maschine-Zusammenhangs. Der Mausklick<br />
wird zu einem Befehl, und erst dadurch wird, wie vorhin beim Avatar, die<br />
Einrichtung konventioneller oder iconischer Schaltflächen sinnvoll, die<br />
bestimmte Arbeitsvorgänge in toto repräsentieren und bei Berührung und<br />
Anwahl auslösen.<br />
- In der dritten, der symbolischen Stufe der Repräsentationsfunktion schließlich<br />
läßt sich die Maus zunächst als Performanzsymbol für die Funktions- und<br />
Leistungsfähigkeit der digitalen Informationsverarbeitung überhaupt lesen,<br />
pars pro toto für den medialen Gesamtzusammenhang, für den und in dem sie<br />
steht. Ähnlich wie bei der Fernbedienung hat, wer die Maus hat, auch die<br />
Macht über das Geschehen auf dem Bildschirm, die anderen können nur über<br />
die Schulter schauen. Weiterhin nimmt sie, etwa als avancierte Designermaus,<br />
Anteil am Haushalt kultureller Statussymbole, in dem jedes Ding als Ware mit<br />
Bedeutsamkeit zur Aussage beispielsweise über seinen Besitzer aufgeladen<br />
wird. Sinn und Funktion der Maus konvergieren hier typischerweise mit<br />
ökonomischen Werten.<br />
- Damit kommen wir zur Frage nach dem Sinn der Maus als dem<br />
Zusammenhang, den sie stiftet. Wir betrachten sie abschließend unter dem<br />
Aspekt der Drittheit und kehren somit zurück zum Problem einer möglichen<br />
Welt der Maus, nach den Welterschließungs- und Sinngebungsstrategien dieses<br />
Werkzeugs. Die Welt der Maus ist in Sonderheit gekennzeichnet durch das<br />
Nebeneinander von Wirklichem und Möglichem - oder von Aktuellem und<br />
Virtuzellem - , das sich in den motiven der Selektivität, wie gesehen, realisiert.<br />
der gängige, aber logisch eher merkwürdige Ausdruck von der „Virtuellen<br />
Realität“ hat hier seinen Sinn. Gilles Delueze spricht, wenngleich nicht in<br />
Hinsicht auf die Maus, sondern im Rahmen seiner Philosophie des Kinos, von<br />
einer Koaleszenz, einem Nebeneinanderliegen oder Oszillieren von<br />
Wirklichkeit ud Möglichkeit. Er macht zudem diese Modalitätenverschiebung<br />
als den Grund der Zeit aus. Demnach wäre die Maus also eine Zeitmaschine,<br />
die die verschiedensten Schichten des Abgelegten, des Noch-zu Betrachtenden<br />
oder Noch-zu Lesenden und des gerade jetzt Wirksamen, des „Geöffneten“<br />
oder „Aktivierten“ übereinander und nebeneinander legen und sogar in iher<br />
Schichtung beliebig verändern, etwa Abgelegtes wieder hervorziehen, kann.<br />
Das Interessante an dieser Anordnung der Zeiten in Schichten ist die<br />
Verräumlichung: Natürlich findet hier eine Projektion der Zeit in den Raum<br />
statt, aber der Projektionsraum (oder der Raum der Bearbeitung) ist ein<br />
Grenzfall zwischen Raum und Fläche. Das Desktop ist flächig, erlaubt aber<br />
eine Tiefenstaffelung von Flächen, ohne jedoch gänzlich in den<br />
Dreidimensionalen Raum auszuweiten. Man könnte auch in der Frage von<br />
Raum und Fläche von einer Koaleszenz, einem Nebeneinander beider<br />
Geometrien sprechen, die das Nebeneinander des Möglichen und des<br />
Wirklichen abbildet. In jedem Fall ist in der Welt der Maus alles, was<br />
erscheint, ein Produkt einer Wahl, die auch anders hätte ausfallen können und<br />
in vielen Fällen sogar spurlos revidierbar ist. Die Wirklichkeit ist eine<br />
kontigente Realität, die Möglichkeit eine virtuelle Realität, und zwischen<br />
beiden herrscht eine Selektionsbeziehung. Jede an- und ausgewählte Variante<br />
weist dabei imer schon und immer noch von sich selbst weg auf die nächst zu<br />
wählende oder die vorangegangene Wahl. Eine Webseite lädt nicht zum
Verweilen ein; die wichtigsten Flächen sind die Weiter- und<br />
Zurückschaltbefehle. Der Nutzer ist nie so richtig da, wo er gerade ist, sondern<br />
immer schon und immer noch woanders, dort. wo er herkommt oder dort, wo<br />
er als nächste hingehen könnte; und er fühlt sich immer weggezogen. Wir<br />
kennen den Effekt auch von der Fernbedienung, die das Verharren bei Ein- und<br />
Demselben zugunsten des Wechsels zum Anderen unwahrscheinlich macht. Es<br />
braucht nicht hervorgehoben zu werden, wie sehr diese Verfassung der<br />
digitalen Welt als Produkt von Wahl und Auswahl, als gesamtraum zu<br />
treffender Wahlen, auch die Suggestivkraft der revidierbaren Wahl, der<br />
umkehrbaren Entscheidung, der Gleichzeitigkeit des Nebeneinander<br />
Möglichen - das Eine und das Andere auch -, das Prinzip des Hier und zugleich<br />
anderswo, das auch beispielsweise in Medien wie dem Walkman und ganz<br />
besonders dem Handy wirksam ist, sich pragmatisch wie phänomenal in den<br />
Funktionszusammenhang eines hochgezüchteten Konsum- und<br />
Dienstleistungskapitalismus mit seinen Flexibilisierungsanforderungen, seinem<br />
Ubiquitätsdruck und seinen Komplexitätszumutungen fügt.<br />
- Das Restproblem jedoch bleibt der prekäre Status der so beschaffenen Welt<br />
selbst. Denn die digitale Welt als eine mithilfe geeigneter Werkzeuge - und<br />
zwar als Werkzeuge erkennbare Werkzeuge wie eben der Maus - eigens und<br />
künstlich verfertigte Welt ist nicht nur Fläche, Raum und Rahmen der<br />
Wählbarkeit, sondern selbstverständlich ihrerseits nur plural und kontingent<br />
vorstellbar, ein Selektionsprodukt, das genauso gut ganz anders ausfallen<br />
könnte. Damit ist das, was wir traditionell als „Die Welt“ für den Inbegriff der<br />
Einheit und der Differenzlosigkeit, für Allheit schlechthin halten, die uns auch<br />
allen gleichermaßen und vorazussetzungslos gegeben ist und der nur der<br />
Abgrund des Nichts gegenübersteht, nur mehr als unentrinnbare Vielheit zu<br />
haben, zu der es aber andererseits nicht einmal mehr ein Nichts als<br />
undenkbaren Außenraum zu geben scheint. Die digitale Welt ist aufgespalten,<br />
differenziert, plural, einerseits eine reine Innenwelt aber, ohne Außenraum<br />
andererseits. Die allfällige Rede von der Globalisierung hat genau hier ihren<br />
Sinnkern, sie meint nämlich eine binnendifferenzierte, aber unentrinnbare,<br />
gleichsam nur noch von innen begehbare Innenwelt ohne Außenansicht.<br />
Gemeinsamkeit kann in der digitalen Welt weder vorausgesetzt noch einfach<br />
angetroffen werden, die Welt ist keine bedingungslose Folie der<br />
Gemeinsamkeit mehr. Gemeinsamkeit muß vielmehr immer erst gewählt, jedes<br />
Mal einzeln erdacht und hergestellt werden, und es gäbe auch stets<br />
Alternativen zu ihr, so daß sie immer fragil, temporär und gefährdet bleibt. Die<br />
einzige apriorische Gemeinsamkeit, die niemand in Frage stellen kann, weil<br />
die Mittel dazu fehlen würden, sind eben die Mittel selbst, sind die Werkzeuge<br />
der Weltgenerierung, der Sinnerfahrung und der Selektion, von Nietzsches<br />
Schreibmaschine bis zur heutigen Computermaus.
II<br />
Überleitung und Einleitung: <strong>Hören</strong>.<br />
- Soweit zum Tasten und zur technischen Instrumentierung des Tastens bis<br />
heute.<br />
- Nun: Übergang zum nächsten „Sinn“, nämlich dem Hörsinn.<br />
- Christoph Willibald Gluck: Che farò senza Euridice<br />
2. Vom Mythos des <strong>Hören</strong>s: Orpheus und Hermes<br />
- Orpheus, Sohn der für das Epos zuständigen Muse Kalliope, war berühmt für<br />
seine Qualitäten als Musiker und Sänger. Zwei Beispiele: Seine Durchfahrt<br />
durch die Straße von Messina (an der die Sirenen zu hören waren) mit den<br />
Argonauten: er besänftigte die Sirenen durch sein Spiel und gelangte hindurch<br />
(anders Odysseus, der seinen Gefährten die Ohren verstopfen und sich an den<br />
Mast binden ließ).<br />
- Zweites Beispiel: Orpheus und Euridice: Orpheus gelingt es durch sein Spiel,<br />
Hades zur Rückgabe seiner verstorbenen Frau zu bewegen; leider dreht sie sich<br />
auf dem Rückweg verbotswidrig um und muß doch zurück ins Totenreich.<br />
- ein anderer Mythos: Argos und Hermes. Zeus begehrt die schöne Io und<br />
verwandelt sie, um keinen Verdacht bei der eifersüchtigen Hera zu erregen, in<br />
eine Kuh, sich selbst in einen Stier. Hera, mißtrauisch, stellt aber die Kuh unter<br />
Dauerbewachung durch Argus, dessen Haut über und über mit Augen bedeckt<br />
ist und der deshalb in alle Richtungen zugleich sehen kann.<br />
- Zeus beauftragt Hermes deamit, Argus aus dem Weg zu räumen. Da man sich<br />
dem Argus aber nicht unbemerkt nähern kann, erfindet Hermes die Panflöte.<br />
Mit dem Flötenspiel gelingt es ihm, den Argus willenlos und arglos zu machen<br />
und ihn anschließend zu erschlagen.<br />
- Hera häutet den Erschlagenen dann ab und verleiht seine Haut dem Pfau.<br />
3. Struktur, Funktion und Leistung des Hörsinns<br />
- Was sagt uns das über das <strong>Hören</strong> ?<br />
- Raumstruktur: Tastsinn war auf den Punkt, auf die Berührung gerichtet; bei<br />
Dauerbeanspruchung „schaltet“ er „ab“. Sehsinn ist auf die Lokalisierung im<br />
Raum, die präzise Beobachtung gerichtet (Linienmetapher). Dagegen Hörsinn:<br />
Umgreifend, räumlich, Serres: „Global“. Daher die Überlegenheit des<br />
Flötenspiels gegenüber der Pan-Optik.<br />
- Zeitstruktur: Tastinn auf die Differenz vorher-nachher selbst gerichtet:<br />
Zeitpunkt, in dem das Differenzierte noch zugleich präsent ist. Sehsinn:<br />
Lineare Anordnung von Vorher und Nachher. Dagegen Hörsinn:<br />
Zusammenziehen des Gehörten in die Dauer, Beispiel Geräusch, Musik, aber<br />
auch Rede: Jedesmal wird das Nacheinander Erklingende zu einem Kontinuum<br />
zusammengezogen (Bergson, Husserl weiten in einem nahezu gleichlautenden<br />
Beispiel, den Glockentönen, darauf hin).
- Aber nicht nur in Zeit und Raum, sondern offenbar auch in der Dimension der<br />
Sozialität wirkt der Hörsinn zusammenziehend, Zusammenhang stiftend: Im<br />
Mythos immer wieder Aufgehgen des Individuums in einem Zusammenhang<br />
als Verlust des Willens oder der Gefährlichkeit, Betörung, Betäubung,<br />
Ablenkung usw.: Vereinnahmung. Überschreitung des Subjekts (Tastsinn:<br />
Unterschreitung).<br />
- Diese Überschreitung macht aber Selbsterfahrung des Subjekts erst möglich:<br />
Nur, wenn ich mich gleichsam von außen wahrnehmen kann, kann oich mich<br />
als Subjekt wahrnehmen und, wie wir sehen werden, auch die Anderen als<br />
Andere Subjekte.<br />
- Dafür fundamental. Die Rückkopplung von Stimme und Ohr: Externalisierung<br />
und Wiederaneignung; Zu sich selbst in Unterschied treten. Diese<br />
Rückkopplung ist auch, anders als die etwa Auge-Hand, nicht unterbrechbar<br />
und durch nichts anderes zu ersetzen. (Tasten ohne Sehen ist möglich;<br />
Sprechen ohne <strong>Hören</strong> aber nicht: Nur wer hört, kann sprechen, wer spricht.<br />
muß es hören). So wie die Hand genau am Übergang von Wahrnehmung und<br />
Handlung operiert (und sie folglich unterscheidbar macht), so das Ohr an<br />
demjenigen von Wahrnehmung und Kommunikation.<br />
- Überhaupt ist das Ohr natürlich privilegiert, weil es das Sprachprivileg trägt,<br />
aber dazu in einer anderen Vorlesung mehr.<br />
- Wenn Taster und Schalter die Externalisierungen, Technologisierungen des<br />
Tastsinns sind, dann ist die Technologisierung des Hörsinns nicht etwa der<br />
Lautsprecher oder das Mikrofon o.ä., sondern der<br />
Rückkopplungsmechanismus; Fliehkraftregler, Thermostat und Schaltkreis<br />
stehen in der Dimension des <strong>Hören</strong>s.<br />
- Schließlich eine Ansicht, die uzur Diskussion Anlaß gibt: Rudolf Arnheim<br />
(Anschauliches Denken): Im Hörsinn (Beispiel: Musik) denken wir rein<br />
differentiell, syntaktisch. Klänge stellen nichts dar, sie sind (anders als andere,<br />
von denen wir sie unterscheiden). Sie verweisen uns nicht an die Dinge.<br />
Deshalkb, so Arnheim, ist <strong>Hören</strong> ein Modus, in dem wir nicht über die Welt<br />
(oder besser: Die Dinge in ihr) nachdenken. Das ist dem Sehen vorbehalten.<br />
5. Martin Heidegger: Aisthesis und Noein<br />
- Das gibt Anlaß zu der Frage: Was erkennen wir, wenn wir hören ? Heidegger<br />
spricht von einem spezifischen Erkenntnistyp, den er im Gegensatz zum<br />
„Erkennen“ (im engeren Sinne) als „<strong>Vernehmen</strong>“ bezeichnetund im<br />
Griechischen sowohl mit dem Begriff des „noein“ (im allgemeinen mit<br />
„Erkennen“ übersetzt, von Heidegger als „schlichtes <strong>Vernehmen</strong>“) identifiziert<br />
als auch mit dem der „aisthesis“ (im allgemeinen als „Wahrnehmung“<br />
bezeichnet).<br />
- Diesen Erkenntnistyp präpariert er aus seiner Aristoteles Lektüre heraus.<br />
Erkenntnis, so Aristoteles laut Heidegger, ist eine Frage des Zusammenhangs.<br />
Erkennen heißt, etwas ALS etwas zu behandeln. Behandelt man es als das, was<br />
es ist, so ist das eine richtige Erkenntis. Behandelt man es als das, was es nicht<br />
ist, so ist das eine falsche Erkenntis. Das gilt auch und besonders für
sprachliche Behandlung : Aussage. Etwas aussagen heißt, es mit etwas<br />
zusammenzuziehen, es als dies oder jenes anzusprechen oder nicht.<br />
- In jeder Erkenntis und jeder wahren Aussage sind also immer zwei Ebenen<br />
enthalten: Das, was behandelt bzw. angesprochen wird und das, ALS das es<br />
angesprochen bzw. behandelt wird. Normalerweise sind beide identisch, dann<br />
fällt das gar nicht auf. Erst wenn sie nicht identisch sind, nämlich: das Auto als<br />
Haus, der Tisch als Stuhl usw. behandelt bzw. angesprochen wird, ist Irrtum<br />
die Folge und fällt auf, daß es beide Ebenen gibt.<br />
- Kommentar dazu nebenbei: Das hängt natürlich mit der ZWEITHEIT alles<br />
Begegnenden zusammen. Dioes erlaubt es, etwas als etwas zu behandeln.<br />
- Das wird deutlich, wenn Aristoteles von allem Wirklichen als<br />
Zusammengesetztem spricht, das also so oder anders zusammengesetzt ist. Die<br />
Wahrheit sagen heißt dann, das sprachlich zusammen zu bringen, was<br />
zuzsammen gehört, und das sprachlich zu trennen (nämlich: durch negation),<br />
was nicht zusammengehört.<br />
- Heidegger weiter: Es gibt aber bei Aristoteles auch eine Ausnahme, solches<br />
Seiende nämlich, das nicht zusammengesetzt ist, sondern elementar und<br />
primär. Es kann nicht als etwas angesprochen werden, nicht als etwas<br />
wahrgenommen werden, weil es immer nur das ist, was es ist. Wir würden<br />
sagen: ERSTHEIT.<br />
- Solches Seiende, das nie verstellt werden kann, ist nur die aisthesis bzw. dem<br />
noein zugänglich, es ist darüber kein Irrtum möglich (sondern nur<br />
nichtwahrnehmen). Dies nennt Heidegger das „schlichte <strong>Vernehmen</strong>“.<br />
- Erkenntnis vom Typ des <strong>Hören</strong>s wäre also gerichtet auf derlei Erstheiten, oder<br />
anders: während etwa das Sehen speziell auf Zweitheit gerichtet ist (auch wenn<br />
die immer Erstheit involviert), ist das <strong>Hören</strong> mehr als jeder andere Sinn in der<br />
Lage, Erstheiten wahrzunehmen; das, was noch vor dem „Etwas“ liegt. Das<br />
könnte auch Arnheim meinen.<br />
- Oder anders, richtiger formulirt: der Hörsinn wird vom Sehsinn danach<br />
unterschieden, daß er sich speziell auf Erstheit richten kann; er wird zur<br />
Metapher dafür.<br />
6. Heidegger (Forts.): <strong>Verstehen</strong><br />
- An anderer Stelle entwickelt Heidegger eine andere Formulierung für eine<br />
Weise des Erkennens, die von dem Erkennen von etwas als etwas Bestimmtes,<br />
dem klaren Erkennen usw. verschieden ist und ihm vorgelagert. Auch sie<br />
bezeichnet er mit einer akustischen Metapher, nämlich dem <strong>Verstehen</strong>.<br />
- „<strong>Verstehen</strong>“ bezeichnet im Alltagsgebrauch sowohl das mentale Geschehen als<br />
auch die bloße Wahrnehmung: Erneut <strong>Hören</strong> als Differenz beider,<br />
Wahrnehumg und Kommunikation.<br />
- Heidegger: Alle Gegenstände, die uns begegnen, bilden einen Zusammenhang,<br />
etwa haben sie einen Zweck, oder gehören zueinander, sind miteinander<br />
verbunden usw.: Zeugzusammenhang, Verweisung. Wichtig: Für heidegger ist<br />
dieser Zusammenhang nicht eine Überschreitung es Einzeldings, also vom<br />
Einzelgegenstand her zu denken (denn wie soll das auch gehen ?), sondern
immer umgekehrt: Der Gegenstand „bezeichnet“, „aktualisiert“ eine Stelle in<br />
einem Zusammenhang. Der Zusammenhang ist primär. Die Anerkennung<br />
dieser primären Eingelassenheit des Einzeldings in einen Zusammenhang<br />
nennt Heidegger: „Bewendenlassen“: Bestehenlassen in dem Zusammenhang,<br />
in dem es steht.<br />
- Dieser Zusammenhang ist als konkreter z.B. Gebrauchs- oder Verwendugs,<br />
Zweck oder auch Sinnzusammenhang letztlich immer auch nur Teil größerer<br />
Verweisungsganzer und letztlich der Welt im Ganzen (im Gegensatz zur<br />
Anhäufung von Einzeldingen).<br />
- Die Fähigkeit des menschlichen Daseins, dieses Ganze bestehen zu lassen,<br />
nennt Heidegger das <strong>Verstehen</strong>. Das <strong>Verstehen</strong> bezieht sich also auf die<br />
Eingelassenheit jedes Einzeldings in die Welt und letztlich auf die Welt als<br />
Gesamtzusammenhang, Das Besondere ist aber, daß das Dasein das kann, weil<br />
es selbst immer in die Welt eingebunden ist, nicht außerhalb ihrer steht.<br />
Deshalb begreift sich das Dasein letztlich im verstehen selbst als, wie<br />
Heidegger sagt, „in der Welt Sein“. Weil das Dasein die Welt versteht, versteht<br />
es sich, und zwar als dasjenige Seiende, das die Welt versteht.<br />
- „Wenn dem Dasein wesenhaft die Seinsart des In der Welt Seins zukommt,<br />
dann gehgört zum wesenhaften bestand seines Seinsverständnisses das<br />
<strong>Verstehen</strong> von In der Welt Sein. Das vorgängige Erschließen dessen,<br />
woraufhin die Freigabe des innerweltlichen Begegnenden erfolgt, ist nichts<br />
anderes als das <strong>Verstehen</strong> von Welt, zu der sich das Dasein schon immer<br />
verhält.“ (SuZ, 86).<br />
- „<strong>Verstehen</strong>“ ist als Wort dem Bezirk des Hölrens entnommen. Wenn Arnheim<br />
also sagt, daß das <strong>Hören</strong> nicht auf die Dinge im Einzelnen gerichtet ist und daß<br />
<strong>Hören</strong> nicht heißen kann, über die Welt nachzudenken, dann könnte dies mit<br />
Heidegger dahin gewendet werden, daß statt dessen <strong>Hören</strong> heißen kann, IN<br />
DER WELT nachzudenken: Aspekt des Umgreifenden, des Globalisierenden<br />
beim <strong>Hören</strong>.<br />
7. Heidegger: <strong>Hören</strong><br />
- Auch das <strong>Hören</strong> taucht schließlich bei Heidegger (nach <strong>Vernehmen</strong> und<br />
<strong>Verstehen</strong>) auf. Und auch er schreibt dem <strong>Hören</strong> ein spezielles Verhältnis zur<br />
Kommunikation und damit zur Sozialität zu:<br />
- In der Welt nämlich begegnen wir nicht nur Gegenständen, sondern auch<br />
anderen Menschen, also dem anderen Dasein. Menschliches Dasein ist deshalb<br />
nicht nur durch In der Welt sein besonders bezeichnet (da es die Welt, wie<br />
gesehen, verstehen kann), sondern auch durch die Begegnung mit dem anderen<br />
Dasein, dem (Heidegger) Mit-Sein. Mit-Sein gehört wesentlich zum Dasein.<br />
- Der Andere begegnet uns aber besonders als sprechendes Dasein. Wir können<br />
die Anderen von den begegnenden Dingen zunächst deshalb unterscheiden,<br />
weil sie sprechen. Hier wird also, um über Heidegger hinaus zu gehen, die<br />
primäre Rückkopplungsschleife erweitert, verdoppelt: Ich nehme den<br />
sprechenden Anderen als Meines Gleichen wahr, nämlich als einen, der sich<br />
beim Sprechen ebenfalls selber wahrnimmt und deshalb für sich selbst
8. Schluß<br />
ebenfalls da ist. ich erkenne mich selber (nicht als Individuum, sondern als<br />
Dasein) im Anderen.<br />
- Heidegger formuliert so: „Das Reden ist für das <strong>Hören</strong> konstitutiv. Und wie die<br />
sprachliche Verlautbarung in der Rede gründet, so das akustische <strong>Vernehmen</strong><br />
im <strong>Hören</strong>. Das <strong>Hören</strong> auf (jemanden, L.E.) ist das existenziale Offensein des<br />
Daseins als Mit-Sein für den Anderen. Das <strong>Hören</strong> konstituiert sogar die<br />
primäre eigentliche Offenheit des Daseins für sein eigenes Sein-Können. als<br />
<strong>Hören</strong> der Stimme des Freundes, den jedes Dasein bei sich trägt“. (SuZ, 163)<br />
- Für Heidegger ist also die Stimme des Anderen primär; die vermeintlich<br />
ursprüngliche Rückkopplung als Selbstwahrnehmung ist die – internalisierte -<br />
Folgeerscheinung: Das Mitsein ist konstitutiv.<br />
- „Das Dasein hört, weil es versteht (und nicht umgekehrt, L.E.). Als<br />
verstehendes In der Welt Sein mit den Anderen ist es dann Mitdasein und ihm<br />
selbst hörig und in dieser Hörigkeit zugehörig. Das Aufeinander <strong>Hören</strong>. in dem<br />
sich das Mitdasein ausbildet, hat die möglichen Weisen des Folgens,<br />
Mitgehens, die provativen Modi des Nicht <strong>Hören</strong>s, des Widersetzens, des<br />
Trotzes, der Abwehr“. (SuZ, 163).<br />
- Hier kehrt also das Sozialisierungsmotiv wieder und auch das<br />
Überwältigungsmotiv, die Hörigkeit, klingt wieder an, die wir im Mythos<br />
schon angetroffen haben. Heidegger verwendet dann ja auch viel Mühe auf die<br />
Analyse der Verfalllsformen des Mitdaseins, nämlich der Verfallenheit an das<br />
„Man“, das „Gerede“, die Öffentlichkeit usw.<br />
- Alle technischen Instrumentierungen der Stimme, von den Musikinstrumenten<br />
bis zu den modernen Schallaufzeicnungs- und Verstärkungstechniken, müssen<br />
in diesem Zusammenhang gesehen werden. Heideggers Gedanken halten dazu<br />
an, auch Massenmedien über die Hör- und <strong>Verstehen</strong>sfunktion aufzuschlüseln.<br />
Nächstes Mal deshalb als Ausblick: Über das Radio.