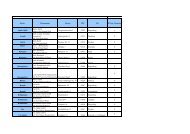Erforschung von Alltags- und Popularkulturen
Erforschung von Alltags- und Popularkulturen
Erforschung von Alltags- und Popularkulturen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
— 1 —<br />
<strong>Erforschung</strong> <strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong><br />
Es müssen die einführende Übung (Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche<br />
der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e) <strong>und</strong> ein Seminar absolviert werden. Es wird<br />
empfohlen, zunächst die Übung zu besuchen <strong>und</strong> im darauffolgenden Semester eines der<br />
angebotenen Seminare.<br />
Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e (2 SWS, Credits: EWS: 2-3;<br />
GWS: 2-3; Freier Bereich: 2-3; GaF: 2)<br />
0406624 Mi 12:00 - 14:00 wöchentl. 18.04.2012 - 11.07.2012 1.003 / ZHSG Kestler-Joosten<br />
Inhalt Diese Übung gibt eine allgemeine Einführung in das Forschungsfeld Kultur. Anhand eines fachgeschichtlichen Überblicks wird aufgezeigt, wie<br />
die bis heute wirkungsmächtige Vorstellung <strong>von</strong> ‚Volkskultur‘ im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert als Konstrukt bürgerlich-elitärer Kreise aufkam <strong>und</strong> mit der<br />
‚Volkstumspflege‘ des NS-Regimes politisch missbraucht wurde. Seit den späten 1960er Jahren bildet die Analyse populärer <strong>Alltags</strong>kulturen<br />
<strong>und</strong> Lebenswelten die Forschungsperspektive der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e (Empirische Kulturwissenschaft, Kulturanthropologie).<br />
Entsprechende Vorgehensweisen <strong>und</strong> fachlich f<strong>und</strong>ierte Ergebnisse präsentieren „Short Cuts“ ausgewählter Themenfelder, wie z.B. mündliches<br />
Erzählen, Museum <strong>und</strong> materielle Kultur, Bräuche <strong>und</strong> Rituale, das Verhältnis Natur: Kultur oder Jugendkulturen <strong>und</strong> Lebensstile. Darüber hinaus<br />
werden Quellenbereiche, Methoden <strong>und</strong> Fachtermini der Kulturforschung (affirmativer <strong>und</strong> weiter Kulturbegriff, Kulturtransfers, Interkulturelle<br />
Kommunikation, Alltag, Folklorismus, Identität etc.) vorgestellt <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>züge wissenschaftlichen Arbeitens geübt.<br />
Hinweise Gilt nur für Studierenden in den alten Lehramtsstudiengängen (EWS nach LPO I): Die Teilnahme (kein Referat, keine Klausur) ist Voraussetzung<br />
für den Besuch <strong>von</strong> Seminaren, in denen der prüfungsrelevante benotete EWS-Schein erworben werden kann.<br />
Literatur Harvolk, Edgar: Wege der Volksk<strong>und</strong>e in Bayern. Ein Handbuch. Würzburg 1987; Brednich, Rolf Wilhelm (Hg.): Gr<strong>und</strong>riss der Volksk<strong>und</strong>e.<br />
Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. 3., überarb. <strong>und</strong> erw. Aufl. Berlin 2001; Göttsch, Silke / Lehmann, Albrecht (Hg.):<br />
Methoden der Volksk<strong>und</strong>e. Positionen, Quellen <strong>und</strong> Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. Berlin 2001.<br />
Reise <strong>und</strong> Tourismus als volksk<strong>und</strong>liches Forschungsfeld (2 SWS, Credits: BA-HF+NF: 4; GWS-<strong>und</strong> GaF-Bereich: 3; Freier<br />
Bereich: 2)<br />
0406616 Mi 16:00 - 18:00 wöchentl. 18.04.2012 - 11.07.2012 1.003 / ZHSG Kestler-Joosten<br />
Inhalt Auch wenn die Begriffe der Reise <strong>und</strong> des Tourismus häufig synonym gebraucht werden, handelt es sich ursprünglich um sehr unterschiedliche<br />
Phänomene. So lassen sich Einzelreisen bereits früh in der Geschichte nachweisen, zum Beispiel in Form der mittelalterlichen Pilgerreise oder<br />
der Wanderschaft <strong>von</strong> Handwerksgesellen. Zu diesen Formen tritt ab dem 17. <strong>und</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert die so genannte Grand Tour junger Adliger,<br />
die bereits erste Aspekte des modernen Tourismus aufweist. Dieser bildet sich als Massenphänomen erst im Verlauf des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts heraus<br />
<strong>und</strong> ist eingeb<strong>und</strong>en in eine große Zahl sozialer <strong>und</strong> wirtschaftlicher Neuerungen. Reise <strong>und</strong> Tourismus stehen dabei in Zusammenhang mit<br />
unterschiedlichen Formen des Bewegens, Wahrnehmens <strong>und</strong> Erfahrens. Die Beispiele dafür sind vielfältig: So veränderte etwa die Eisenbahnreise<br />
die Wahrnehmung großer Entfernungen <strong>und</strong> stellte zugleich neue Forderungen an die Exaktheit der Zeitmessung. In der Fremde wurde <strong>und</strong> wird<br />
man mit ungewohnten Aspekten des <strong>Alltags</strong>lebens konfrontiert – man denke nur an exotisches Essen. Auch in der Sachkultur finden sich deutliche<br />
Spuren des Reisens, etwa in Form des Souvenirs. Diese <strong>und</strong> weitere Aspekte eines vielschichtigen <strong>und</strong> spannenden Forschungsfeldes sollen im<br />
Seminar gemeinsam erarbeitet werden.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Bausinger, Hermann: Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus. München 1991; Gyr, Ueli: Tourismus <strong>und</strong> Tourismusforschung. In:<br />
Brednich, Rolf-Wilhelm (Hg.): Gr<strong>und</strong>riß der Volksk<strong>und</strong>e. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. 3., überarb. u. erw. Aufl.<br />
Berlin 2001, S. 469-489; Köstlin, Konrad: Souvenir. Das kleine Geschenk als Gedächtnisstütze. In: Alber, Wolfgang: Übriges. Kopflose Beiträge zu<br />
einer volksk<strong>und</strong>lichen Anatomie. Utz Jeggle zum 22. Juni 1991. Tübingen 1991, S. 131-141; Lauterbach, Burkhart R.: Tourismus. Eine Einführung<br />
aus Sicht der volksk<strong>und</strong>lichen Kulturwissenschaft. Würzburg 2008; Moser, Johannes / Seidl, Daniella (Hg.): Dinge auf Reisen. Materielle Kultur <strong>und</strong><br />
Tourismus (Münchner Beiträge zur Volksk<strong>und</strong>e, Bd. 38). Münster u.a. 2009.
— 2 —<br />
Helden! „Von Jeann d´Arc, Superman <strong>und</strong> Pippi Langstrumpf” (2 SWS, Credits: BA-HF+NF: 4; GWS-<strong>und</strong> GaF-Bereich: 3; Freier<br />
Bereich: 2)<br />
0406615 Do 14:00 - 16:00 wöchentl. 19.04.2012 - 12.07.2012 2.006 / ZHSG Dinkl<br />
Inhalt Ihre Anzahl ist groß <strong>und</strong> nicht minder ihre Verschiedenheit. Helden, wie sie <strong>von</strong> Beowulf im gleichnamigen Mittelalterepos verkörpert werden,<br />
stehen Volks- National- <strong>und</strong> Kriegshelden gegenüber, während neben rein fiktiven Helden, uns aus Kindertagen als Cowboy, Superman oder Pippi<br />
Langstrumpf bekannt, Science-Fiction-Helden in Film <strong>und</strong> Spiel täglich für die Rettung der Menschheit kämpfen. Diesen „klassischen“ Helden gesellte<br />
sich jüngst eine „neue“ Helden-Gattung hinzu, Helden, aus ganz „normalen“ Menschen bestehend, die sich um besondere Verdienste – sei es in<br />
Wirtschaft, Politik oder Alltag – bemüht gemacht haben.<br />
Was aber braucht es, um ein Held oder eine Heldin zu werden? Wie werden diese inszeniert? Welchen Wandel hat das Heldenbild seit dem Mittelalter<br />
durchlebt? Wo liegt der Unterschied zwischen Held <strong>und</strong> Antiheld? Und wozu brauchen wir überhaupt Helden <strong>und</strong> gibt es diese wirklich oder enttarnen<br />
sie sich bei genauerem Hinsehen doch als generalisierte Vorbilder <strong>und</strong> Stereotype?<br />
Diesen <strong>und</strong> weiteren Fragen soll im Verlauf des Seminars nachgegangen werden, indem Heldenfiguren vom Mittelalter bis heute genauer unter<br />
die Lupe genommen werden.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Griesner, Dietmar: Die kleinen Helden. Kinderbuchfiguren <strong>und</strong> ihre Vorbilder. München u.a. 1987. Hammer, Andreas: Helden <strong>und</strong> Heilige. Kulturelle<br />
<strong>und</strong> literarische Integrationsfiguren des europäischen Mittelalters. Heidelberg 2010. Kienitz, Sabine: Beschädigte Helden. Kriegsinvalidität <strong>und</strong><br />
Körperbilder 1914-1923. Paderborn u.a. 2008. Röhrich, Lutz: „<strong>und</strong> weil sie nicht gestorben sind…“ Anthropologie, Kulturgeschichte <strong>und</strong> Deutung<br />
<strong>von</strong> Märchen. Köln 2002.<br />
Geschichte der Sauberkeit oder – die Hygienisierung des <strong>Alltags</strong>lebens (2 SWS, Credits: BA-HF: 3; GWS-<strong>und</strong> GaF-Bereich: 3,<br />
Freier Bereich: 2)<br />
0406618 Mi 12:00 - 14:00 wöchentl. 18.04.2012 - 11.07.2012 1.006 / ZHSG Dinkl<br />
Inhalt Nach dem Aufstehen Zähneputzen, vor dem Essen Hände waschen, nicht mit Straßenschuhen die Wohnung betreten – unser Alltag <strong>und</strong> Handeln<br />
sind durchdrungen <strong>von</strong> selbstverständlich gewordenen Abläufen, die durch Vorstellungen über Hygiene <strong>und</strong> Reinlichkeit bestimmt werden, oft ohne<br />
den Kontext <strong>von</strong> Notwendigkeit <strong>und</strong> Entwicklung dieser zu hinterfragen. Unser „westeuropäischer Standard“ ist kulturell geprägt wie geformt <strong>und</strong><br />
weist sich als historischer Prozess beginnend seit der Mitte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts, bestehend aus vermehrtem Wissen im medizinischen Bereich über<br />
Zusammenhänge <strong>von</strong> Erregern <strong>und</strong> Krankheiten, geführt <strong>von</strong> Medizinern wie Pädagogen, aus. Doch was führte zu diesem Prozess bis zu unseren<br />
heutigen Normen <strong>und</strong> Maßstäben, wodurch wandelte sich unser Hygieneverhalten, welche Rolle spielt der <strong>von</strong> Norbert Elias postulierte Mechanismus<br />
der Selbstdisziplinierung <strong>und</strong> welche Faktoren nebst Akteuren führten uns zu den heute üblichen, „normierten“, ja geforderten Sauberkeitsstandards?<br />
All diesen Fragen soll im Verlauf des Seminars vom Mittelalter bis heute nachgespürt werden indem Veränderungen sowohl im privaten als auch<br />
öffentlichen Raum <strong>und</strong> den zugr<strong>und</strong>e liegenden Diskursen erörtert werden.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Armeskamp, Daniele / Stemmer, Daniela: „Wo geht´s denn hier aufs Klo?“ Sauberkeit auf dem Land im 19. <strong>und</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>ert. Ein<br />
Ausstellungsprojekt des Seminars für EE/VK Münster. In: Binder, Beate / Göttsch, Silke / Kaschuba, Wolfgang / Vanja, Konrad (Hrsg.): Ort.<br />
Arbeit. Körper. Ethnographie europäischer Modernen. Münster 2005, S. 543-547; Corbin, Alain: Pesthauch <strong>und</strong> Blütenduft. Eine Geschichte<br />
des Geruchs. Berlin 1984. Frey, Emanuel: Der reinliche Bürger. Göttingen 1997; Gleichmann, Peter u.a. (Hrsg.): Materialien zu Norbert Elias<br />
Zivilisationstheorie. Frankfurt 1979; Stolz, Susanne: Die Handwerke des Körpers (1200-1914). Bader, Barbier, Perückenmacher, Friseur; Folge<br />
<strong>und</strong> Ausdruck historischen Körperverständnisses. Marburg 1992; Vigarello, Georges: Wasser <strong>und</strong> Seife, Puder <strong>und</strong> Parfüm. Geschichte der<br />
Körperhygiene seit dem Mittelalter. Frankfurt 1988.<br />
Als die Maschinen kamen - Strukturwandel in Bayern nach 1945 (2 SWS, Credits: BA-HF: 3; GaF: 3; EWS: 2-3; GWS: 3; Freier<br />
Bereich: 2)<br />
0406653 Do 16:00 - 18:00 wöchentl. 19.04.2012 - 12.07.2012 ÜR 12 / Phil.-Geb. Fuchs<br />
Inhalt Im Seminar wird die Phase des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg in den Bereichen der Wirtschaft, Warenversorgung, Mobilität <strong>und</strong><br />
Landwirtschaft in Bayern analysiert. Die Herausforderungen der Nachkriegszeit eines agrarisch geprägten Raums, dessen Bewohner nicht nur mit<br />
Kriegszerstörungen sondern auch der Intergration zahlreicher Flüchtlinge konfontiert waren, werden unter anderem anhand <strong>von</strong> Ergebnissen des<br />
Zeitzeugenprojekts "Unterfranken in der Nachkriegszeit" dargestellt.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Daxelmüller, Christoph et.al. (Hg.): Wiederaufbau <strong>und</strong> Wirtschaftsw<strong>und</strong>er. Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte <strong>und</strong> Kultur Bd. 57.<br />
Augsburg 2009.
— 3 —<br />
"Stadtluft macht frei" - Entwicklung <strong>und</strong> Funktionen der europäischen Stadtgesellschaften seit dem Mittelalter (2 SWS,<br />
Credits: BA-HF+NF: 3; GWS-<strong>und</strong> GaF-Bereich: 3; Freier Bereich: 2)<br />
0406661 Mo 16:00 - 18:00 wöchentl. 23.04.2012 - 09.07.2012 ÜR 08 / Phil.-Geb. Fuchs<br />
Inhalt Aufklärung <strong>und</strong> Fortschrittsglaube erzeugten verzerrte Bilder des Lebens im Mittelalter. Die darauf basierenden, teils romantisch verfremdeten<br />
Ansichten des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts bestimmen noch heute in populären Darstellungsformen die Vorstellung über mittelalterliche Lebenswelten. Im<br />
Rahmen des Seminars werden Geschichte <strong>und</strong> kulturelle Entwicklungen mittelalterlicher Stadtgesellschaften sowie deren heutige Wahrnehmung<br />
nachvollzogen.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Bosl, Karl. Die bayerische Stadt in Mittelalter <strong>und</strong> Neuzeit. Regensburg 1988; Jahn, Wolfgang; Brockhoff Evamaria (Hgg.): Edel <strong>und</strong> Frei. Franken<br />
im Mittelalter. (Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte <strong>und</strong> Kultur 47/04). Augsburg 2004; Platz, Thomas (Hg.): Mittelalterliches Leben in<br />
Franken. Forchheim 1998.<br />
Kircheninventar <strong>von</strong> der Gotik bis zur Gegenwart (2 SWS, Credits: BA-HF: 3; BA-NF: 2; GWS-<strong>und</strong> GaF-Bereich: 3; Freier Bereich: 2)<br />
0406640 Mo 18:00 - 20:00 wöchentl. 23.04.2012 - 09.07.2012 ÜR 08 / Phil.-Geb. Wagner<br />
Inhalt Chorgestühle, Kirchenbänke, Beichtstühle, Sakristeischränke oder Kanzeln. Als Zeugnisse der Sachkultur steht unterschiedliches Kircheninventar<br />
im Mittelpunkt dieses Seminars. Von der Gotik bis zur Gegenwart lassen sich handwerkliche Techniken, liturgische Bedingungen, kunsthistorische<br />
Formen <strong>und</strong> andere Merkmale außergewöhnlich gut am Kircheninventar ablesen. Neben den eigentlichen Objekten werden die Quellenforschung,<br />
kirchliche Vorgaben, liturgische Veränderungen z.B. aufgr<strong>und</strong> der Reformation eine Rolle spielen. Ein Blick auf die Säkularisation mit der Zerstreuung<br />
zahlreicher Kircheneinrichtungen, aber auch den Herausforderungen des modernen Kirchenbaus für das Kircheninventar r<strong>und</strong>en die spannende<br />
Thematik ab. Mit Exkursionen in Museen <strong>und</strong> Kirchen.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Lenssen, Jürgen: Zukunft der Kirchen <strong>und</strong> Kirchenbauten in den kommenden Jahrzehnten. München 2008. In: Greipel, Johannes: 100 Jahre<br />
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, S. 49-52; Kirchenmöbel aus alter <strong>und</strong> neuer Zeit. Berlin 1893; Sammlung <strong>von</strong> Altären, Kanzeln,<br />
Taufbecken, Beicht- <strong>und</strong> Kirchenstühlen, Orgeln usw. Sobel, Hildegard: Die Kirchenmöbel Erhart Falckeners <strong>und</strong> seiner Werkstatt. Mainz 1980;<br />
Lenssen, Jürgen: Aufbruch im Kirchenbau. Würzburg 1989; Fels, Gertrud: Historismus im Kirchenraum: Das Atelier des Franz Wilhelm Driesler.<br />
Würzburg 1996; Christoph Daxelmüller: Volksfrömmigkeit. In: Rolf W. Brednich: Gr<strong>und</strong>riss der Volksk<strong>und</strong>e. Einführung in die Forschungsfelder<br />
der europäischen Ethnologie; Berlin 2001, S. 491-513. Heidelmann, Hildegard / Meißner, Helmuth: Evangelische Beichtstühle in Franken. Bad<br />
Windsheim 2001; Keller, Bettina: Barocke Sakristeien in Süddeutschland. Petersberg 2009; Brückner, Wolfgang: Lutherische Bekenntnisgemälde<br />
des 16. bis 18. Jahrh<strong>und</strong>erts. Regensburg 2007; Brenninger, Georg: Der Historismus in Kirchenbau <strong>und</strong> Kirchenausstattung Niederbayerns - ein<br />
Beitrag zur Liturgie- <strong>und</strong> Frömmigkeitsgeschichte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts. München 1989.<br />
Odenwald <strong>und</strong> Bauland. Biographie einer Region (2 SWS, Credits: BA-HF: 3; GaF: 3; EWS: 2-3; GWS: 3; Freier Bereich: 2)<br />
0406654 Di 18:00 - 20:00 wöchentl. 24.04.2012 - 10.07.2012 ÜR 22 / Phil.-Geb. Sauer<br />
Inhalt Das Gebiet zwischen Neckar, Jagst, Main <strong>und</strong> Tauber wird seit Jahrh<strong>und</strong>erten als Odenwald bezeichnet. Mit dieser Region verband bereits Sebastian<br />
Münster negative Assoziationen <strong>von</strong> Rückständigkeit <strong>und</strong> Hinterwäldler-Dasein. Ein Image <strong>von</strong> dem sich bereits im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert die Bewohner<br />
der östlichen Hälfte der Region durch Ihre Zugehörigkeit zum vermeintlich fortschrittlicheren Bauland abzugrenzen versuchten. Erst im 19. <strong>und</strong> vor<br />
allem im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert wurde dieser negativ konnotierte „Perzeptionscode“ bewusst verändert <strong>und</strong> regionale Identität unter anderen Vorzeichen<br />
konstruiert. Im Fokus des Seminars steht dieser auf verschiedenen Ebenen ablaufende Prozess der Regionalisierung. Die historische Fixierung auf<br />
bestimmte Kulturphänomene steht ebenso im Mittelpunkt wie die Konstrukteure dieses Heimatverständnisses <strong>und</strong> die Situation heute mit aktuellen<br />
Marketing- <strong>und</strong> Tourismus-Strategien verschiedener regionaler Akteure.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Assion, Peter: „Odenwald“ <strong>und</strong> „Bauland“. Zur Geschichte der beiden Begriffsbildungen. In: Wackerfuß, Winfried: Beiträge zur <strong>Erforschung</strong> des<br />
Odenwaldes <strong>und</strong> seiner Randlandschaften, II. FS Hans H. Weber. Breuberg 1977. S. 23-36; Köstlin, Konrad: Die Regionalisierung <strong>von</strong> Kultur. In:<br />
Ders./Bausinger, Hermann (Hggs.): Heimat <strong>und</strong> Identität. Probleme regionaler Kultur. (Studien zur Volksk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Kulturgeschichte Schleswig-<br />
Holsteins, 7). Neumünster 1980. S. 25-38; Seidenspinner, Wolfgang: Die Erfindung des Madonnenländchens. Die kulturelle Regionalisierung des<br />
Badischen Frankenlands zwischen Heimat <strong>und</strong> Nation. (Zwischen Neckar <strong>und</strong> Main. Schriftenreihe des Vereins Bezirksmuseum e.V. Buchen, 30).<br />
Buchen 2004.
— 4 —<br />
Kaffee, Tabak, Bier - Ein Streifzug durch die Kulturgeschichte des Genusses (2 SWS, Credits: BA-HF+NF: 4; GWS- <strong>und</strong> GaF-<br />
Bereich: 3; Freier Bereich: 2)<br />
0406638 Mo 08:00 - 10:00 wöchentl. 23.04.2012 - 09.07.2012 ÜR 19 / Phil.-Geb. Wiesemann<br />
Inhalt Genussmittel haben im Alltag des Menschen schon seit Jahrh<strong>und</strong>erten eine enorme Bedeutung. Nicht nur geschmackliche Eigenschaften,<br />
sondern vor allem kulturelle Zuschreibungen <strong>und</strong> Bewertungen spielen dabei eine große Rolle. Außerdem bestimmten <strong>und</strong> bestimmen sie die<br />
Geschichte des neuzeitlichen Menschen. Das Seminar wird sich sowohl mit Fragen der zeitlichen, räumlichen <strong>und</strong> sozialen Verbreitungsprozesse<br />
der verschiedensten Genussmittel beschäftigen, mit Herstellern <strong>und</strong> Herstellungsprozessen <strong>und</strong> Fragen nachgehen wie: Warum kommt es<br />
zu einer bestimmten Zeit zur Verbreitung bestimmter Genussmittel? Sind sie reiner Zufall kolonialer Entdeckungen oder befriedigen sie neue<br />
Gr<strong>und</strong>bedürfnisse, die es vorher nicht gab? Aber auch den Modalitäten des Konsums wird nachgegangen <strong>und</strong> gefragt: Was wird verbraucht? Wo<br />
wird verbraucht? Wie wird verbraucht? Warum wird verbraucht? Und welche alltagskulturellen Funktionen lassen sich jeweils ausmachen?<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Hengartner, Thomas / Christoph, Maria Merki (Hg.): Genussmittel. Eine Kulturgeschichte. Frankfurt a. M. 1999; Schivelbusch, Wolfgang: Das<br />
Paradies, der Geschmack <strong>und</strong> die Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel. Frankfurt a. M. 1990.<br />
Polnische Priesterhäftlinge in Konzentrationslagern (2 SWS, Credits: BA-HF+NF: 3; GWS-<strong>und</strong> GaF-Bereich: 3; Freier Bereich: 2)<br />
0406622 Do 18:00 - 20:00 wöchentl. 19.04.2012 - 12.07.2012 ÜR 10 / Phil.-Geb. Uziel<br />
Inhalt Thema des Seminars sind die polnischen Priesterhäftlinge in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Im Seminar sollen sowohl ihr Leben<br />
in den Konzentrationslagern <strong>und</strong> ihr Platz innerhalb der besonderen Gruppe der geistlichen Häftlinge als auch ihr Verhältnis zu u.a. den deutschen<br />
Priesterhäftlingen erarbeitet werden. Auch das Interesse der Nationalsozialisten am polnischen Klerus <strong>und</strong> an dessen Zerstörung wird behandelt.<br />
Weiterhin ist der Umgang der katholischen Kirche <strong>und</strong> ihrer Mitglieder in Polen mit den polnischen Priesterhäftlingen nach dem zweiten Weltkrieg<br />
ein Bestandteil des Seminars. Gearbeitet wird u. a. mit autobiographischen Quellen <strong>und</strong> Berichten ehemaliger KZ-Häftlinge.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Weiler, Eugen / Thoma, Emil (Hrsg.): Die Geistlichen in Dachau sowie in anderen Konzentrationslagern <strong>und</strong> Gefängnissen. Mödling, 1971; Je#,<br />
Ignacy: Licht <strong>und</strong> Dunkel, preiset den Herrn! Erinnerungen eines polnischen Bischofs an die Zeit im KZ Dachau. Würzburg, 1994.<br />
Sehnsucht Heimat - doch wo ist die Heimat? Zur Geschichte der Russlanddeutschen (2 SWS, Credits: BA-HF+NF: 3; GWS-<br />
<strong>und</strong> GaF-Bereich: 3; Freier Bereich: 2)<br />
0406621 Mi 18:00 - 20:00 wöchentl. 18.04.2012 - 11.07.2012 HS 07 / Phil.-Geb. Förderer<br />
Inhalt Seit dem 18. Jahrh<strong>und</strong>ert zogen die Deutschen in die Weiten Russlands, um dort ihr Glück zu suchen. Vor allem waren es Bauern, Landarbeiter<br />
<strong>und</strong> Handwerker, die in Russland eine neue Heimat suchten, da es in Deutschland geringe Lebenschancen gab. Die ersten Kolonisten lebten<br />
dabei unter schwierigsten Bedingungen, erst die zweite Generation begann erfolgreich zu werden. Sie errichteten viele kleine Siedlungen mit meist<br />
deutschen Namen, mit deutschen Formen der Selbstverwaltung <strong>und</strong> später auch mit deutschen Schulen. Dabei haben sie ein blühendes, vorwiegend<br />
landwirtschaftlich geprägtes Land <strong>und</strong> eine reiche Kultur geschaffen. Die russische Revolution, vor allem jedoch der Zweite Weltkrieg, haben den<br />
Zuwanderern Flucht <strong>und</strong> Vertreibung gebracht. Diese Zeit war geprägt <strong>von</strong> Deportationen, Zwangsarbeit <strong>und</strong> langandauernder Rechtlosigkeit. Viele<br />
<strong>von</strong> ihnen kehrten zurück in den Westen, mit der Hoffnung, den Kindern dort bessere Lebenschancen zu ermöglichen, als es ihnen selbst vergönnt<br />
war. Zudem erschien die Ausreise als einzige Möglichkeit, um einen Platz, an dem man akzeptiert wird, d.h. der einem Heimat bedeutet, zu erlangen.<br />
Das Seminar führt zum einen in die Geschichte der Russlanddeutschen seit Katharina II. ein <strong>und</strong> zum anderen werden aus volksk<strong>und</strong>licher Sicht<br />
die Aspekte des <strong>Alltags</strong>lebens, die Sitten <strong>und</strong> die Bräuche behandelt. Es soll zeigen, unter welch schwierigen Bedingungen sie über Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
hinweg ihre kulturelle <strong>und</strong> nationale Identität bewahrt haben <strong>und</strong> welche Probleme im Prozess der Integration in Deutschland entstanden.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.
— 5 —<br />
Die Entwicklung des Warenhauses Hertie - Wagnis <strong>und</strong> Herausforderung (2 SWS, Credits: BA-HF+NF: 4; GWS-<strong>und</strong> GaF-<br />
Bereich: 3; Freier Bereich: 2)<br />
0406639 Mi 18:00 - 20:00 wöchentl. 18.04.2012 - 11.07.2012 ÜR 10 / Phil.-Geb. Arbesmann<br />
Inhalt Ab der Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts entwickelte sich das Warenhauswesen in Europa <strong>und</strong> ebnete damit nicht nur den Weg für den neuartigen<br />
Einzelhandel, sondern auch für die moderne Gesellschaft. Ausgehend <strong>von</strong> den Metropolen Paris <strong>und</strong> London setzte sich der Trend der<br />
"Konsumtempel" rasch in Deutschland durch <strong>und</strong> mündete in die Etablierung einer einflussreichen Verkaufsinstitution. Untrennbar mit dieser<br />
Entwicklung ist ein Name verb<strong>und</strong>en: Hertie. Das jüdische Warenhausimperium der Familie Tietz hat - trotz zahlreicher Widrigkeiten - einen<br />
nachhaltigen Beitrag zur Genese der <strong>Alltags</strong>kultur geleistet, der sich bis heute nachverfolgen lässt. Im Rahmen des Seminars sollen neben den<br />
Akteuren der Familie Tietz <strong>und</strong> den diversen Erfolgskomponenten vor allem die mannigfaltigen Herausforderungen untersucht werden, mit denen<br />
das Warenhaus Hertie konfrontiert wurde.<br />
Hinweise Achtung: Diese Lehrveranstaltung ist im Rahmen der Lehramtsstudiengänge (GWS- oder Freier Bereich) ein Teil des Moduls „<strong>Erforschung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Alltags</strong>- <strong>und</strong> <strong>Popularkulturen</strong>“, das insgesamt 5 ECTS umfasst. Deshalb sollte sie nur dann belegt werden, wenn zeitgleich die<br />
Veranstaltung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegt wird.<br />
Wenn Sie 3 ECTS aus der Europäischen Ethnologie / Volksk<strong>und</strong>e in den GWS- bzw. Freien Bereich einbringen wollen, müssen Sie<br />
stattdessen die Übung „0406624: Genese, Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>und</strong> Gegenstandsbereiche der Europäischen Ethnologie/Volksk<strong>und</strong>e“ belegen.<br />
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Judith Kestler M.A. oder Sebastian Kestler-Joosten M. A.<br />
Literatur Frei, Helmut: Tempel der Kauflust. Eine Geschichte der Warenhauskultur. Leipzig 1997; Köhler, Friedrich W.: Zur Geschichte der Warenhäuser.<br />
Seenot <strong>und</strong> Untergang des Hertie-Konzerns. Frankfurt a.M. 1997; Tietz, Georg: Hermann Tietz. Geschichte einer Familie <strong>und</strong> ihrer Warenhäuser.<br />
Stuttgart 1965.