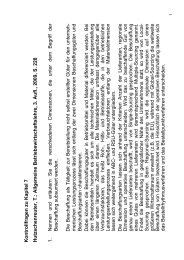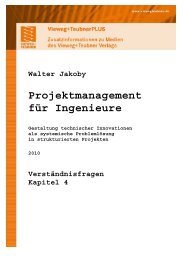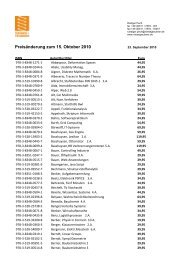Anhang 1: Erhebungsplan Tandem
Anhang 1: Erhebungsplan Tandem
Anhang 1: Erhebungsplan Tandem
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rekonstruktiv-responsive Evaluation in der Praxis.<br />
Neue Perspektiven dokumentarischer Evaluationsforschung<br />
<strong>Anhang</strong><br />
Juliane Lamprecht
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Forschungsdesign/Erhebungs- und Auswertungszeitplan ...................................... 2<br />
2. Gegenüberstellung der Sozialdaten der drei Grundschulen ................................... 4<br />
3. Gegenüberstellung der Sozialdaten der drei Kindertagesstätten ............................ 5<br />
4. Exemplarische Textinterpretation ........................................................................... 6<br />
5. Power-Point-Präsentation zu den ersten responsiven Evaluationsgesprächen........ 11<br />
6. Textgrundlage für die ersten responsiven Evaluationsgespräche mit den<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen und den Moderatorinnen ............................................................. 15<br />
7. Power-Point-Präsentation zu den zweiten responsiven Evaluationsgesprächen..... 29<br />
8. Textgrundlage für die zweiten responsiven Evaluationsgespräche mit den<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen und den Moderatorinnen ............................................................ 33<br />
9. Raumskizzen der <strong>Tandem</strong>sitzungen und Evaluationsgespräche ............................ 57<br />
10. Videointerpretationen ............................................................................................. 61<br />
11. Sozialdaten der Teilnehmer/innen .......................................................................... 67<br />
12. Beschreibungen der <strong>Tandem</strong>gruppen durch die Moderatorinnen .......................... 80<br />
13. Transkriptionsregeln ............................................................................................... 83<br />
14. Literaturverzeichnis des <strong>Anhang</strong>s ......................................................................... 85
1. Forschungsdesign/Erhebungs- und<br />
Auswertungszeitplan<br />
Moderierte<br />
<strong>Tandem</strong>gruppentreffen<br />
(von Moderator/innen<br />
der Stiftung<br />
organisiert)<br />
Evaluationsgespräch<br />
(inhaltlich offen, an<br />
Selbstläufigkeit<br />
orientiert)<br />
Moderierte<br />
<strong>Tandem</strong>gruppentreffen<br />
(von Moderator/innen<br />
der Stiftung<br />
organisiert)<br />
1. Auswertungsphase<br />
Moderierte<br />
<strong>Tandem</strong>gruppentreffen<br />
(von Moderator/innen<br />
der Stiftung<br />
organisiert)<br />
Erstes responsives<br />
Evaluationsgespräch<br />
auf der Grundlage<br />
empirischer<br />
Rekonstruktionen und<br />
Erhebungsverfahren 2009 2010<br />
TB/VG<br />
GD/TB/VG<br />
TB/VG<br />
TB/VG<br />
GD/TB/VG<br />
Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr.<br />
2
dazu ausgewählten<br />
Fotos<br />
Moderierte<br />
<strong>Tandem</strong>gruppentreffen<br />
(von Moderator/innen<br />
der Stiftung<br />
organisiert)<br />
TB/VG<br />
2. Auswertungsphase Zwischen-<br />
Moderierte<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen-treffen<br />
(von Moderator/innen<br />
der Stiftung<br />
organisiert)<br />
Zweites responsives<br />
Evaluationsgespräch<br />
auf der Grundlage<br />
empirischer<br />
Rekonstruktionen und<br />
Videopassagen der<br />
<strong>Tandem</strong>sitzungen<br />
bericht<br />
TB/VG<br />
GD/TB/VG<br />
3. Auswertungsphase Abschluss-<br />
GD= Gruppendiskussion<br />
bericht<br />
TB= Teilnehmende Beobachtung<br />
VG= Videographie<br />
Erhebungen in den monatlichen Sitzungen der<br />
verschiedenen <strong>Tandem</strong>gruppen (TB / VG).<br />
Responsives Evaluationsgespräch in jeder der<br />
drei <strong>Tandem</strong>gruppen und der<br />
Moderatorinnengruppe, die teilnehmend<br />
beobachtet und videographiert werden .<br />
Auswertung des empirischen Datenmaterials.<br />
3
2. Gegenüberstellung der Sozialdaten der drei<br />
Grundschulen<br />
Anzahl der<br />
Grundschulkinder 1<br />
Anzahl der Anträge<br />
auf Lehrmittel-<br />
freiheit<br />
Prozentualer Anteil<br />
San Francisco 90 10 11,1%<br />
New York 60 30 50%<br />
Paris 80 ca. 25 ca. 31,3%<br />
1 Entsprechend den Prinzipien responsiver Evaluationsstudien, die die Belange bzw. Selbstbeschreibungen<br />
von Organisationen in den Mittelpunkt der Untersuchung rücken, basieren diese Zahlen auf<br />
Selbstauskünften der Schul- und Kindertagesstätten-Leitungen. Sie wurden per Mail und Telefon<br />
erhoben.<br />
4
3. Gegenüberstellung der Sozialdaten der drei<br />
Kindertagesstätten<br />
Anzahl der Kita-<br />
kinder<br />
Jugendamt<br />
übernimmt<br />
Essensgeld<br />
San Francisco 90 5 5,6%<br />
New York –<br />
evangelische<br />
Kindertagesstätte<br />
New York –<br />
katholische<br />
Kindertagesstätte<br />
New York –<br />
konfessions-<br />
übergreifende<br />
Kindertagesstätte<br />
60 25 41,7%<br />
65 20 30,8%<br />
120 40 33,3%<br />
Paris 65 15 23,1%<br />
Prozentualer Anteil<br />
5
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
4. Exemplarische Textinterpretation<br />
Die Anwendung der methodischen Schritte wird im Folgenden in ihrer Funktion für das<br />
Fallverständnis hervorgehoben.<br />
Diskussionsabschnitt zum Oberthema Waldtag:<br />
Ew1: Ja. (.) un die letzte große Sache die ich noch so in Erinnerung hab<br />
vor den Ferien der gemeinsame Waldtag. (.) Mmh.<br />
Lw2: Ah ja. (.) Das stimmt.<br />
LLw3: Ja.<br />
Ew1: Von der dritten Klasse mit unsren Vorschulkindern. Also wir sind<br />
zusammen in den Wald=hatten (.) wirklich en ganz tollen<br />
Vormittag=die haben sich gefunden die Kinder<br />
? Mmh.<br />
Ew1: Un die Kinder haben praktisch ihr Patenkind für die (.) für die erste<br />
Klasse gesucht und<br />
Lw2: Mmh.<br />
Ew1: es is nicht mehr so gelaufen wie in den äh<br />
vergangenen Jahres dass es anonym war, (.) man hat äh jedem Kind<br />
ein neues aso Erstklässler zugeteilt, sondern es war jetz so die Kinder<br />
konnten so nach Sympathie wen kenn ich, wer is mir sympathisch<br />
? Mmh.<br />
ELw2: Un das war en voller @Erfolg@ (.)<br />
Ew1: Mmh.<br />
Lw2: @(.)@<br />
ELw2: Auf dem Hinweg sind=wa alle<br />
noch schön @KiTa-Kinder Schule getrennt<br />
6
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
Lw2: @(2)@<br />
ELw2: @(.)@<br />
Ew1: Un auf=m Rückweg gingen die dann so ((deutet ein Hand in Hand<br />
gehen an)) per @Hand@.<br />
Alle: @(2)@<br />
Ew1: Und bei manchen das war so schön (.) ich erinner mich an zwei ganz<br />
Lw2: @<br />
äh (.) leb@hafte Kinder@ von uns. Die gingen dann brav an der<br />
@Hand@ rechts und links von nem Drittklässler<br />
Formulierende Interpretation<br />
Oberthema: Der gemeinsame Waldtag<br />
Unterthemen:<br />
1-6: Vor den Ferien hat der gemeinsame Waldtag – „ein ganz toller Vormittag“ – mit<br />
den Kindern der dritten Klassen und mit den Vorschulkindern stattgefunden.<br />
6-19: Im Gegensatz zum letzten Jahr haben sich die Kinder dieses Mal „selbst gefunden“.<br />
Sie haben sich ein Patenkind nach „Sympathie“ ausgesucht und wurden einander<br />
nicht „anonym“ zugeordnet.<br />
19-26: Während die KiTa-Kinder und die Schüler/innen auf dem Hinweg getrennt<br />
voneinander gegangen sind, sind Kinder und Schüler/innen auf dem Rückweg<br />
„Hand in Hand“ gegangen.<br />
26-30: „Lebhafte Kinder“ gingen dann „brav“ an der Seite eines Drittklässlers.<br />
Reflektierende Interpretation<br />
1-2: Initiierung des Themas (Waldtag) durch Ew1<br />
Ew1 erzählt von dem Waldtag als der letzten großen Sache und misst dieser Aktion<br />
somit besondere und positive Bedeutung zu.<br />
7
3-4: Zustimmung von Lw2 und LLw3<br />
Lw2 und LLw3 bestätigen die positive Rahmung dieses Ereignisses, indem sie Ew1<br />
zustimmen.<br />
5-7: Elaboration durch Ew1<br />
Die Beschreibung der Kinder erfolgt einerseits entlang ihrer institutionellen<br />
Zugehörigkeit: Ew1 unterscheidet sie als Vorschulkinder bzw. als Kinder der<br />
dritten Klasse. Andererseits wird ihnen eine eigeninitiative Haltung zugeschrieben<br />
und dabei positiv hervorgehoben, dass sie institutionenübergreifend aufeinander<br />
zugegangen sind.<br />
8: Zustimmung von ?<br />
Ein akustisch nicht zu identifizierendes Gruppenmitglied stimmt dieser<br />
Beschreibung zu.<br />
9-15: Differenzierung der Information durch Ew2:<br />
Einer gezielten Zuordnung der Kinder, die im vorangegangenen Jahr auf der Basis<br />
eines anonymisierten Vorgehens erfolgte, stellt Ew2 den positiven Horizont<br />
gegenüber, dass die Kinder in diesem Jahr Begegnungsformen nach Sympathie frei<br />
wählen. Es kommt erneut zu einer Attribuierung der Kinder als selbstwirksam<br />
handelnde Akteure, der die Erzieherinnen und Lehrerinnen implizit als diejenigen<br />
gegenüberstehen, die den Rahmen – wie bspw. einen Waldtag – für derartige<br />
Konstellationen bereithalten.<br />
16: Zustimmung von ?<br />
Ein akustisch nicht zu identifizierendes Gruppenmitglied stimmt der Erzählung und<br />
der damit verbundenen Argumentation zu.<br />
17: Anschlussproposition durch ELw2<br />
ELw2 bewertet diese Aktion als vollen Erfolg und rahmt sie somit als ein<br />
gelungenes Kooperationsgeschehen.<br />
8
18-19: Zustimmung von Ew1 und Lw2<br />
Ew1 und Lw2 stimmen dieser Bewertung lachend und somit auch den impliziten<br />
Qualitätskriterien des Erfolgs zu.<br />
20-21: Elaboration der Anschlussproposition<br />
Den Erfolg kennzeichnet die Überwindung institutioneller Differenzen durch die<br />
Kinder selbst.<br />
22-23: Lachende Zustimmung<br />
Den Anschlüssen ist zu entnehmen, dass in dieser <strong>Tandem</strong>gruppe eine heitere<br />
zustimmende Atmosphäre durch gemeinsames Lachen erzeugt wird.<br />
24-25: Anschlussproposition durch Ew1<br />
Die Differenzierung, dass die Kinder auf dem Rückweg dann Hand in Hand gehen,<br />
zeigt die Betonung einer zugrunde gelegten Entwicklungslogik von den<br />
Beziehungen zwischen den Kindern.<br />
26: Gemeinsames Lachen<br />
27-29: Differenzierung durch Elaboration von Ew1<br />
Ew1 betont, wie die ursprünglich lebhaften, wild-dynamischen Kindergartenkinder<br />
durch den Kontakt zu den Schulkindern dann brav, gesittet und geordnet, an den<br />
Händen von Drittklässlern zurückkehren. Hier zeigen sich erneut ihre Konstruktion<br />
einer Entwicklungslogik sowie eine Argumentationsfigur, bei der der Kontakt<br />
zwischen den Kindergartenkindern und Schulkindern positiven Einfluss auf die<br />
Veränderung des Verhaltens der Jüngeren durch die Älteren nimmt.<br />
30: Zustimmendes Lachen durch Lw2<br />
Die Diskursorganisation ist univok und parallelisierend strukturiert, die<br />
Erfahrungen und deren Bewertung werden institutionenübergreifend geteilt. Die<br />
Textsorten erzählender Beschreibung deuten im Gegensatz zu argumentierendem<br />
Theoretisieren daraufhin, dass die Beteiligten in dieser Passage ihre (gemeinsamen)<br />
9
Erfahrungen schildern. Auf der Grundlage ihrer Erzählungen lassen sich daher<br />
handlungsleitende Orientierungsrahmen rekonstruieren.<br />
10
5. Power-Point-Präsentation zu den ersten responsiven<br />
Evaluationsgesprächen<br />
Folie 1:<br />
Folie 2:<br />
11
Folie 3:<br />
Folien 4-10: 2<br />
Auf den Power-Point-Folien 4-10 wurden den pädagogischen Akteuren Fotos von<br />
Situationen gezeigt, von denen die Erzieherinnen, Lehrer/innen und Moderatorinnen in der<br />
ersten Gruppendiskussion erzählt haben. Sie präsentierten:<br />
eine Abbildung von zwei Bewertungsbögen in Anlehnung an die Beschreibung von<br />
Bewertungsverfahren, die in der Kooperationspraxis entwickelt wurden (Folie 4).<br />
ein Gleis, an dem Kinder und erwachsene Personen neben einem Zug stehen, in<br />
Anlehnung an die beschriebenen Ausflüge (Folie 5).<br />
einen Bach und am steinigen Bachufer stehende Kinder bzw. erwachsene Personen,<br />
in Anlehnung an die Erzählungen von gemeinsamen Aktionstagen, die draußen in<br />
der Natur stattfanden (Folie 6).<br />
2 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Fotos hier nicht abgebildet. Stattdessen wird ihre<br />
Auswahl forschungsmethodisch im Zusammenhang mit den Erzählungen der pädagogischen Akteure<br />
dargestellt.<br />
12
Erwachsene, die an einem Tisch mit aufgeschlagenen Ordnern sitzen und in eine<br />
Diskussion vertieft scheinen, in Anlehnung an die Besprechungssituationen, von<br />
denen die <strong>Tandem</strong>gruppen berichten (Folie 7).<br />
zwei Erwachsene, die sich frontal zueinander gewandt anschreien, in Anlehnung an<br />
die Konfliktsituationen, von denen die <strong>Tandem</strong>gruppen erzählt haben (Folie 8).<br />
einen Raum, in dem viele Erwachsene frontal ausgerichtet sitzen. Eine Person mit<br />
Kärtchen in der Hand steht und moderiert, in Anlehnung an Fortbildungen, von<br />
denen die pädagogischen Akteure erzählt haben (Folie 9).<br />
einen Mann, der neben einem Flipchart vor einigen Erwachsenen steht und darauf<br />
Folie 11:<br />
etwas notiert, in Anlehnung an die Beschreibungen von Moderationssituationen<br />
(Folie 10).<br />
13
Folie 12:<br />
14
6. Textgrundlage für die ersten responsiven<br />
Evaluationsgespräche mit den <strong>Tandem</strong>gruppen und<br />
den Moderatorinnen<br />
(Präsentation der ersten drei Power-Point-Folien) 3<br />
I. Einführung: Vorgehen und Methode<br />
Drei Themen werden in allen Gruppendiskussionen von den <strong>Tandem</strong>gruppen und von den<br />
Moderatorinnen diskutiert und daher im Folgenden aufgegriffen: Erstens die<br />
Beobachtungsbögen, die Bewertungsmedien und die Aktionstage, zweitens die<br />
Zusammenarbeit und die Auseinandersetzungen sowie drittens Moderationsmetaphern, die<br />
entfaltet wurden.<br />
Die Gruppen wurden mit Städtenamen maskiert und nun möchte ich kurz zu jeder<br />
Gruppe etwas sagen: Wie der Diskursverlauf war, was wesentliche Themen für sie sind<br />
und welche Diskursmodi ihre alltagstypischen Interaktionsmuster zeigen, d.h. wie sie sich<br />
so unterhalten und was das vielleicht für ihren Alltag bedeutet. Vielleicht können Sie<br />
einfach dazu beschreiben, was Ihnen einfällt, ob Sie ein Bild von der Gruppe bekommen,<br />
ob Sie das kennen.<br />
II. Fallbeschreibung<br />
Der <strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit zunächst als<br />
von außen auferlegtes Programm („mehr so aus der Notwendigkeit heraus müssen ja n paar<br />
Dinge geregelt werden“) sich dann zu einer alltäglichen Selbstverständlichkeit gewandelt<br />
3 Die meisten Passagen wurden von der Evaluatorin frei gesprochen. Das Dokument diente ihr lediglich zur<br />
Erinnerung bzw. als Grundlage für die Transkripte und zur Gedankenstütze bei der Präsentation der<br />
Interpretationen. Die Textform der direkten Anrede dient der Evaluatorin zur Vorbereitung. Die<br />
Formulierungen sind daher an einigen Stellen umgangssprachlich gewählt, um eine offene, alltagsnahe<br />
Artikulationsatmosphäre zu schaffen. Zum besseren Verständnis wurde der Vortrag für den vorliegenden<br />
<strong>Anhang</strong> mit einer Untergliederung versehen. Direkte Fragen an das Publikum sind unterstrichen,<br />
Handlungsvorgänge während des Vortrags eingeklammert.<br />
15
hat: „und mittlerweile gehört es einfach dazu“. Sie beschreiben, wie sich die Haltungen der<br />
verschiedenen Institutionen im Rahmen der Zusammenarbeit verändert haben und betonen,<br />
dass Kooperation keine Gefolgschaft der KiTa gegenüber der Schule bedeutet. Auch an<br />
dem Thema der Dokumentationsbögen beschreiben sie, wie die Kinder in den<br />
verschiedenen Institutionen unterschiedlich gesehen und gefördert werden und werden<br />
sollen 4 . Am Waldtag und am gemeinsamen Elternabend soll den Eltern und der<br />
Öffentlichkeit gezeigt werden, dass „der Übergang in einer Hand ist und wohlwollend für<br />
das Kind“. Ihnen ist es wichtig, dass die Eltern die Kooperation positiv mittragen. Deren<br />
Anerkennung ist ihnen wichtig und so reagieren sie auf eine Irritation, die seitens der<br />
Eltern auftritt, als diese die Beobachtungsbögen sehen und sich beschweren, indem die<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe sich entscheidet, die Bewertungsform „offener zu gestalten als plus und<br />
minus“. Sie diskutieren in einem antithetischen Modus („ja, aber“), der Differenzen als<br />
Voraussetzung für einen Austausch bzw. als ihre Form der Gruppenbildung verdeutlicht.<br />
Der <strong>Tandem</strong>gruppe Paris ist es wichtig, dass die gemeinsame Arbeit „lückenlose<br />
Übergange des Förderns“ bzw. „lückenlose Dokumentation und Problemweitergabe“<br />
ermöglicht. Sie finden es bspw. positiv, wenn die neuen Schüler bereits wissen, wie sie<br />
sich im Schulgebäude zu Recht finden, und man ihnen die Wege nicht mehr zeigen muss. 5<br />
Diese <strong>Tandem</strong>gruppe ist positiv an klaren Strukturen und effektivem Arbeiten orientiert<br />
(„also mangelnde Motivation kann man uns nicht nachweisen“). Wenn keine<br />
„verbindlichen Entscheidungen“ getroffen werden, erleben sie die Treffen als „vertane<br />
Zeit“. Sie loben an der Moderation, dass „sie viel Struktur gegeben hat“ und „finden es<br />
hilfreich, wenn einer was festlegt“, „alle auf einen Nenner bringt“. Den Lehrerinnen ist es<br />
wichtig, dass Sitzungen, aber auch der Schuleinstieg effektiver gestaltet werden<br />
(„Besprechungen mit qualitativ wichtigen Informationen zu füllen is in Teams immer<br />
problematisch“), während es den Erzieherinnen ein Anliegen ist, ein Vertrauensverhältnis<br />
zu den Lehrerinnen aufzubauen, damit „Ängste wegfallen“, und die Schule zu kennen<br />
(„wissen was da so los is“). Neben effektivem Arbeiten geht es ihnen in der Arbeit der<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe auch darum, die emotionale Seite der Zusammenarbeit („wo man jetzt<br />
denkt da hab ich jetzt nich bei verloren“) z.B. bei Konflikten („einander auf die Füße<br />
treten“) zu bearbeiten. Erzieherinnen und Lehrerinnen ist es wichtig, öffentliche Aktionen<br />
4 Die Begriffsverwendung „sollen“ repräsentiert die normative Ebene ihrer Beschreibungen und somit<br />
evaluative Aspekte ihrer Orientierungen.<br />
5 Hier zeigt sich eine fremdattribuierte Leistungsorientierung.<br />
16
(„en Aushängeschild“) nicht nur zu machen, um die Arbeit der <strong>Tandem</strong>gruppe zu<br />
dokumentieren, sondern die Aktionen sollen selbst pädagogisch wertvoll sein („wo man<br />
dann auch wirklich wegen der Zusammenarbeit und nich nur wegen nem Fest hier<br />
herkommt“), was manchmal dazu führt, dass wegen des Anspruchs Abstand von der<br />
Umsetzung der Aktion genommen wird. Darin zeigt sich ein besonderer Leistungsanspruch<br />
an die Arbeit der <strong>Tandem</strong>gruppe. Ihre Art zu diskutieren, zeichnet sich durch verschiedene<br />
Standpunkte aus, die nebeneinander bestehen bleiben.<br />
Der <strong>Tandem</strong>gruppe New York ist es wichtig, dass durch die Zusammenarbeit im<br />
Rahmen der <strong>Tandem</strong>gruppe eine „tolle Sache ins Laufen gekommen ist“. Man hätte zwar<br />
eine „Fehleinschätzung bezüglich des zeitlichen Aufwands getroffen“, letztendlich sei aber<br />
„alles viel einfacher geworden“. Ebenfalls relevant ist es für die <strong>Tandem</strong>gruppe New York,<br />
Entscheidungen im richtigen Rahmen zu treffen, d.h. sie achten auf geregelte<br />
Zuständigkeiten innerhalb ihrer Institutionen und das Einhalten von Verabredungen. So<br />
entscheiden sie sich bspw., dass die Gruppendiskussion nicht der Ort ist, an dem über<br />
Kann-Kinder oder Beobachtungsbögen gesprochen wird. Außerdem sollen abwesende<br />
Leitungskräfte in den Prozess der Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Der<br />
Aktionstag dient ihnen zur Dokumentation ihrer Arbeit, sie fühlen sich verpflichtet, nicht<br />
nur inhaltlich-konzeptionell zu arbeiten, sondern auch praktischen Aktivitäten<br />
durchzuführen. Durch die Aktionstage sind die „Eltern viel beruhigter“ und sie sehen ihr<br />
„Ziel den Schukis den Übergang zu erleichtern“ als erfolgreich. Regelmäßige Aktionen,<br />
wie die Einrichtung einer Bibliothek in der Schule, die auch von der KiTa genutzt wird,<br />
sehen sie als „das was das <strong>Tandem</strong> ausmacht.“ Die Arbeit der <strong>Tandem</strong>gruppe wird nach<br />
ihrer Meinung nur sichtbar in solchen Aktionen, ansonsten „kann man von außen nicht<br />
nachvollziehen was wir in den drei Jahren gearbeitet haben.“<br />
Beim Diskutieren ist es ihnen wichtig, dass die Entscheidungen von den<br />
Leitungskräften bestimmt und getragen werden.<br />
Wie hört sich das für Sie an? Kennen Sie das? Beschreiben Sie doch mal. Bekommen<br />
Sie ein Bild? Erzählen Sie mal so.<br />
Die Moderatorinnen legen Wert darauf, ihre eigene Rolle immer wieder kritisch zu<br />
hinterfragen, d.h. Moderation als einen Ort zu gestalten, an dem die Beteiligten selbst aktiv<br />
werden. Sie beschreiben sich in dem Spannungsverhältnis, durch ihre strukturierenden und<br />
organisatorischen Impulse, die <strong>Tandem</strong>gruppe zu beeinflussen, es aber zugleich bei<br />
Entscheidungen nicht zu stark beeinflussen zu wollen. Sie fragen sich, wie der<br />
17
„Ablösungsprozess“ gestaltet werden kann, ohne dass die <strong>Tandem</strong>gruppen einfach so<br />
weiter machen wie bisher. Sie diskutieren in unterschiedlichen Modi, je nach Thema<br />
kommt ein antithetischer oder univoker Modus zum Tragen. Es gibt also Erfahrungen, die<br />
sie wie aus einem Munde beschreiben, und Erfahrungen, bei denen sie ähnliche Erlebnisse<br />
unterschiedlich beschreiben. Sozialität wird hier also einerseits als gemeinsame<br />
Perspektive erlebt, andererseits werden unterschiedliche Blickwinkel als konstitutiv<br />
vorausgesetzt.<br />
Kennen Sie das? Wie erleben Sie das, solche Situationen?<br />
III. Themenschwerpunkte<br />
Themenschwerpunkt I: Beobachtungs- und Bewertungsinstrumente und Aktionstage als<br />
konstitutive Elemente des Übergangs 6<br />
Ich habe den Erzählungen entnommen, dass die <strong>Tandem</strong>gruppen mit zwei Hauptaktivitäten<br />
beschäftigt sind: Zum einen, Bewertungs- und Dokumentationsbögen abzustimmen und<br />
dabei die eigenen Wünsche nicht aus den Augen zu verlieren, und zum anderen mit<br />
Aktionen, die der Außenpräsentation dienen. 7<br />
Diskussionsabschnitt zum Thema Elternarbeit – <strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco 8<br />
LLm1: Aber das ist manchmal auch n Vorteil von <strong>Tandem</strong> da haben wir uns eben<br />
noch kurz unterhalten mmh(.)dass wenn hier Eltern kommen die sagen ja<br />
unser Kind soll n bisschen früher in die Schule( ) dann können wir da etwas<br />
6 Die Ergebnisse dieses Schwerpunkts lassen sich inhaltlich mit den Programmzielen der „individuellen<br />
Förderung“ von Kindern sowie der „Zusammenarbeit und Austausch mit den Eltern“ als auch mit dem<br />
Vorhaben „Gemeinsamer Bildungsprojekte“ relationieren: Hier zeigt sich, wie die Beteiligten<br />
entsprechend institutioneller und infolge der zwei Jahre Programmlaufzeit institutionalisierter Logiken,<br />
(neue) Aufgaben der Frühförderung in ihrem Alltag umsetzen.<br />
7 Die impliziten Logiken zeige ich an komparativen Analysen und lese auch Transkriptbeispiele vor.<br />
Transkriptbeispiele der anderen eignen sich, um die Ebene konjunktiven Verstehens durch Einblicke in<br />
andere Standortgebundenheiten wechselseitig zu ermöglichen. Dabei wird untersucht, ob und wie<br />
Transkripte Brücken zwischen den Beteiligten schlagen: Ähnlichkeiten und Kontraste zwischen den<br />
Gruppen lassen sich auch auf dieser Ebene bereits zeigen. Aus Gründen der Anonymisierung habe ich<br />
mich im Kontext der responsiven Evaluationsgespräche gegen das Abspielen von Audio-Beispielen<br />
entschieden.<br />
8 Die Systematik wird im Rahmen der responsiven Evaluationsgespräche – im Gegensatz zur Systematik<br />
der Darstellung innerhalb des Buches, die der Leserfreundlichkeit dienen soll – variiert, um so einerseits<br />
eine höhere Anonymisierung zu erzeugen und andererseits die Einblicke in andere<br />
Standortgebundenheiten nicht zu schnell zu stereotypisieren.<br />
18
machen oder geht dass und wir immer ganz klar sagen dann ◦letztenendes<br />
hat die Entscheidung ja die Schulleitung◦ aber ich kann mir natürlich ihr<br />
Kind jetzt anschauen ne halbe Stunde Stunde aber sag ich wir sprechen<br />
immer mit den ◦Erzieherinnen aus den Kindertagesstätten◦ weil die kennen<br />
ja ihr Kind am besten die können am besten urteilen obs schulfähig ist oder<br />
nicht ich als Lehrer(.) ich kenn das Kind ja nit ne und da das fand ich<br />
eigentlich ne schöne Sache dass da auch einfach nach außen hin klar<br />
gezeigt wird Leute hier wird zusammen gearbeitet es kann nit sein da gibt<br />
es dann Eltern die wollen einen dann ausspielen( )die sagen dann mmh ah jo<br />
es ist alles in Ordnung mit dem Kind und eh wollen nicht dass man mit dem<br />
Kindergarten wirklich (be)arbeiteten tut und dann ◦ist mir sowieso alles<br />
klar◦ und das ist ok dann [scherzhaft] es is noch nit soweit ist dass dann<br />
eigentlich ne schöne Sache das man dann da natürlich mit Einverständnis<br />
der Eltern ( ) äh anrufen kann und sagen hier was haltet ihr von dem Kind<br />
und (.) dass kann ich auch wirklich dass Herr Schulz und ich dann ( ) da uns<br />
ganz verlassen auch auf die Erzieherinnen und wir würden da jetzt nicht ne<br />
Entscheidung treffen ◦nach dem Motte na ja unn... lass die kommen<br />
◦sondern uns ist da ganz wichtig ◦was sagen die Erzieher zu dem Kind ok(.)<br />
das denk ich auch für die Eltern ein Zeichen aha wir könne da net machen<br />
was wir wollen mmh und◦<br />
Wie hört sich das für Sie an? Kennen Sie das?<br />
Interpretation für das responsive Evaluationsgespräch<br />
Für die <strong>Tandem</strong>gruppe New York ist die Frage der Dokumentations- und Bewertungsbögen<br />
auch auf einer interaktiven Ebene, einem zwischenmenschlichen Austausch – und nicht nur<br />
als Papierform – gegeben. Sie betonen, dass die Kenntnis über die Kinder bei Personen<br />
liegt. Wenn die Schule durch Anfragen der Eltern in die Situation kommt, darüber<br />
entscheiden zu müssen, ob Kinder bereits schulfähig sind, tauschen sie sich informell mit<br />
Erzieherinnen aus. Daran wird deutlich, dass diese Form der Bewertung als kollegialer<br />
Zusammenschluss in Abgrenzung zu Wünschen der Eltern verstanden wird. Dabei kommt<br />
es zu einer anerkennenden Geste der Schule gegenüber der KiTa („lassen die dann nich<br />
19
einfach kommen sondern uns is ganz wichtig was sagen die Erzieher zu dem Kind “). D.h.,<br />
die Schule sieht sich in der Führungsrolle zu entscheiden, ggf. gegen die Wünsche der<br />
Eltern. Dabei verlässt sie sich auf die Urteilskraft der Erzieherinnen. Hierdurch entsteht<br />
eine Abgrenzung zwischen dem Fachpersonal und den Eltern. Erzieherinnen und<br />
Lehrerinnen arbeiten gemeinsam und betonen, dass „einfach nach außen hin klar gezeigt<br />
wird Leute hier wird zusammengearbeitet“.<br />
Wie erleben Sie das? Kennen Sie solche Situationen?<br />
Der folgende Transkriptabschnitt greift das zweite Thema auf, bei dem die Beteiligten<br />
von einem gemeinsamen Aktionstag berichten:<br />
Diskussionsabschnitt zum Oberthema ‚Waldtag‘ – <strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco<br />
Ew1: Ja. (.) un die letzte große Sache die ich noch so in Erinnerung hab<br />
vor den Ferien der gemeinsame Waldtag. (.)Mmh.<br />
Lw2: Ah ja. (.) Das stimmt.<br />
LLw3: Ja.<br />
Ew1: Von der dritten Klasse mit unsren Vorschulkindern. Also wir sind<br />
zusammen in den Wald=hatten (.) wirklich en ganz tollen Vormittag=die<br />
haben sich gefunden die Kinder<br />
? Mmh.<br />
Ew1: Un die Kinder haben praktisch ihr Patenkind für die (.) für die erste<br />
Klasse gesucht und<br />
Lw2: Mmh.<br />
Ew1: es is nicht mehr so gelaufen wie in den äh<br />
vergangenen Jahres dass es anonym war, (.) man hat äh jedem Kind<br />
ein neues aso Erstklässler zugeteilt, sondern es war jetz so die Kinder<br />
konnten so nach Sympathie wen kenn ich, wer is mir sympathisch<br />
? Mmh.<br />
ELw2: Un das war en voller @Erfolg@ (.)<br />
Ew1: Mmh.<br />
Lw2: @(.)@<br />
20
ELw2: Auf dem Hinweg sind=wa alle<br />
noch schön @KiTa-Kinder Schule getrennt<br />
Lw2: @(2)@<br />
ELw2: @(.)@<br />
Ew1: Un auf=m Rückweg gingen die dann so ((deutet ein Hand in Hand<br />
gehen an)) per @Hand@.<br />
Alle: @(2)@<br />
Ew1: Und bei manchen das war so schön (.) ich erinner mich an zwei ganz<br />
äh (.) leb@hafte Kinder@ von uns. Die gingen dann brav an der<br />
@Hand@ rechts und links von nem Drittklässler<br />
Lw2: @(.)@<br />
Für die <strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco steht der Waldtag für überraschende, unplanbare<br />
Aktionen der Kooperation. Sie beschreiben, dass es schön ist, wie sich die Kinder bei einer<br />
solchen Aktion annähern: Sie gehen getrennt in den Wald und kehren „Hand in Hand“<br />
zurück. Kinder-Patenschaften werden als institutionelle Brücke von den Beteiligten in<br />
diesem Sinne deshalb positiv bewertet, weil sie nicht institutionell organisiert werden,<br />
sondern aus einer spontanen Situation entstehen („nich mehr anonym man hat jedem Kind<br />
ein Kind zugeteilt, sondern sie konnten so nach Sympathie wenn kenn ich wer is mir<br />
sympathisch“). Der Umgang mit Differenz wird also dann als erfolgreich beschrieben,<br />
wenn er nicht institutionalisiert erfolgt. 9<br />
Kennen Sie das? Wie hört sich das für Sie an?<br />
Diskussionsabschnitt zum Thema AGs als gemeinsame Schnittstelle der Arbeit –<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe Paris<br />
Für die <strong>Tandem</strong>gruppe Paris ist es wichtig, dass „ein schnellerer Start in die Schule“<br />
möglich wird. Dies wollen sie zum einen dadurch erreichen, dass „diese ganz großen<br />
Ängste und Aufregungen was passiert am ersten Schultag“ wegfallen und zum anderen<br />
überlegen, wie Informationen über die Kinder vor dem Schuleinstieg bereits weitergeben<br />
9 Diese Haltung entspricht ihrer Reaktion der Abwehr in den responsiven Evaluationsgesprächen<br />
gegenüber einer Orientierung einer anderen <strong>Tandem</strong>gruppe, bei dem klare Strukturen und Orte für<br />
Themen festgelegt werden.<br />
21
werden können. Dies könnte durch die Frage an die Erzieherinnen ermöglicht werden,<br />
„wie man die Kinder für sich gewinnen kann“. Auch hier geht es um die Legitimation der<br />
eigenen Diagnose den Eltern gegenüber. Dokumente werden als Absicherung des eigenen<br />
professionellen Wirkens eingesetzt: „man unterschriebene Dokumente auf dem<br />
Schreibtisch (hat) und zusehen muss wie s Kind den Bach runter geht“. D.h., es wird die<br />
Erfahrung reflektiert, dass die Dokumentationsbögen dazu dienen, Defizite festzuhalten<br />
und entsprechende Fördermaßnahmen vorzuschlagen, die jedoch von den Eltern<br />
offensichtlich ignoriert werden. Diese Frustration wird dann ebenfalls über eine kollegiale<br />
Absicherung bearbeitet.<br />
Die AGs stellen für die <strong>Tandem</strong>gruppe einen Ort dar, an „dem sie auf einen<br />
gemeinsamen Nenner kommen“, weil sie sich entschieden haben, dass „der Druck<br />
wegfällt, ein Ergebnis zu erzielen“, trotzdem meinen sie, „nur noch nich die richtige<br />
Schnittstelle gefunden zu haben“ und beschreiben unterschiedliche pädagogische<br />
Vorstellungen.<br />
Ew2: also da hatten wir uns auch letztes Mal drauf geeinigt (.) AG lassen wir erst<br />
mal diesen Raum AG um dieses gemeinsam anzugreifen also ich hab jetzt<br />
eben sollen wir es jetzt einfach dabei belassen oder sollen wir sagen<br />
trotzdem jeder eigene wir haben die AG als gemeinsame Schnittstelle sind<br />
damit auch alle zufrieden dass es jetzt eben für die Schule auch n<br />
bewertungsfreier Raum sein kann deswegen dieser Druck so nicht<br />
vorhanden ist und dann is es aber so das jede Einrichtung für sich trotzdem<br />
im Bereich NaWi weiterbilden möchte( ) fitter machen möchte so hör ich<br />
das jetzt raus und sie sagen jetzt eher jeder macht für sich und dann gucken<br />
wir eben irgendwann noch mal oder sagen sie eher also das verstehe ich<br />
jetzt gerade nicht eigentlich wollen wir ja schon das gemeinsam machen nur<br />
finden wir jetzt momentan noch nicht die richtige Schnittstelle außer der AG<br />
ELw3: das is grundsätzlich mal so mein Anliegen erstmal gewesen das war so die<br />
Ausgangssituation mmh mit der ich letztes Mal auch so in der <strong>Tandem</strong><br />
gekommen bin und äh ja Unmut (.) stimmt so schon (.) irgendwo n bisschen<br />
ähm das hab ich aber jetzt es ist ok wieder aber es war schon so das ich<br />
diese Gemeinsamkeit nicht mehr so gefunden habe wie ich dat einfach<br />
vorher angedacht hatte äh ich mein klar das von den Schulen her<br />
22
Überprüfbarkeit da sein muss klar das das nicht anders laufen kann klar<br />
mmh aber auf der anderen Seite wir kommen mit nem ganz anderen Ansatz<br />
für uns ist im Moment Partizipation die Geschichte schlecht hin in dem<br />
Haus und das würde dem ganz widersprechen so vorgefertigte Dinge zu<br />
machen und also ich würd also ich bin nach wie vor bereit auf den Weg in<br />
die Richtung zu machen Dinge anzugucken und vielleicht Möglichkeiten zu<br />
finden<br />
Hier zeigen sich ungelöste und widersprüchliche Differenzen, die nebeneinander bestehen<br />
bleiben, wobei es zu Frustrationen der Beteiligten kommt.<br />
Kennen Sie das?<br />
Diskussionsabschnitt paradoxe, professionelle Aufgabe – Moderatorinnen<br />
Sowohl Aktivitäten als auch Beurteilungsbögen werden von den Moderatorinnen im<br />
Rahmen ihrer paradoxen Aufgabe, die Teilnehmer zu beraten („sind alles Empfehlungen“),<br />
ohne ihnen Vorschriften zu machen („ich habe gar nichts gesagt“), bearbeitet. Wie ist das<br />
so mit den erwähnten „Bauchschmerzen“ rund um die Dokumentationsbögen in den<br />
Moderationen?<br />
Themenschwerpunkt 2: Konflikte in der Zusammenarbeit der <strong>Tandem</strong>gruppen – zu<br />
tandemspezifischem Erzeugen und Bearbeiten von Differenzen: Wie lösen die Beteiligten<br />
Konflikte, welche Rolle schreiben sie sich bei diesen Konflikten zu?<br />
Konflikte werden auf expliziter Ebene selbstverständlich zwischen den Institutionen –<br />
weder zwischen Generationen noch zwischen Moderatorin und <strong>Tandem</strong>gruppe –<br />
angesiedelt, was der DKJS-Projekt-Programmatik entspricht. Auf impliziter Ebene<br />
hingegen zeigt sich, dass Sie sich professionsübergreifend einig sind, worüber es sich wie<br />
auseinanderzusetzen gilt.<br />
Für die <strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco ergibt sich ein Konflikt, wenn für die Beteiligten<br />
der Eindruck entsteht, „die Schule kommt jetzt und will uns da irgendwas erzählen“ und<br />
23
infolge der Moderation nun der „Kindergarten auch sagt Stopp da machen wir nicht mit“. 10<br />
Moderation wird hier als Medium verstanden, um die Unterschiedlichkeiten zu verstärken.<br />
Diese Differenzierung wird auf impliziter Ebene von beiden Institutionen betont und<br />
erweist sich als konstitutiv für die Kooperation, indem diese nicht als institutionelle<br />
Gefolgschaft verstanden wird. Am Beispiel der Dokumentationsbögen wird dieser<br />
Differenzierungsmodus anschaulich: Die Schule wartet zuerst ab, für welche Form der<br />
Dokumentation die KiTa sich entscheidet; dann kommen sie gemeinsam zu dem Schluss,<br />
dass keine einheitliche Dokumentation erforderlich ist, sondern die Schule ihren<br />
Beobachtungsbogen an den der KiTa anhängen kann. Dabei geht es ihnen darum, die<br />
Kontinuität der Dokumentation aufrecht zu erhalten und dafür eine pragmatische Lösung<br />
zu finden. Auf der Gesprächsebene werden Konflikte bearbeitet, indem sie antithetisch<br />
elaboriert werden – unterschiedliche Standpunkte als verschiedene Blickwinkel thematisch<br />
werden – und dann in Übereinkünften enden, die jedoch keine Einigung bedeuten, sondern<br />
die Unterschiedlichkeiten organisatorisch umsetzen und als pädagogisch wertvoll rahmen.<br />
An welchen Orten kommt Unterschiedlichkeit für sie zum Tragen und wie wird sie<br />
bearbeitet?<br />
Den Gruppenmitgliedern der <strong>Tandem</strong>gruppe New York ist bei dem Erzeugen und<br />
Bearbeiten von Konflikten institutionenübergreifend wichtig, dass sie immer im richtigen<br />
Rahmen verhandelt werden, d.h., dass entsprechende Experten als Autoritäten zugegen<br />
sind, bspw. dass nicht in einer Gruppendiskussion über Kann-Kinder diskutiert wird oder<br />
die Erzieherin die Zuständigen mit ihrem Problem anspricht. Ihnen ist also nicht wichtig,<br />
dass spontan und direkt an Konflikten gearbeitet wird, sondern diese in einem<br />
entsprechenden Rahmen verhandelt werden, in welchem die Entscheidungsträger<br />
anwesend sind. Dabei kommt es zu zeitlich-räumlichen Verschiebungen der Konflikte. Es<br />
zeigt sich eine positive Orientierung an Experten und klaren, eindeutigen Strukturen bzw.<br />
an verbindlichen Absprachen.<br />
Auf der Gesprächsebene werden Konflikte bearbeitet, indem Leitungen darauf achten,<br />
ob das der richtige Ort zum Austragen eines Konflikts sei. Wird sich dagegen entschieden,<br />
wird das Thema oder die Diskussion abgebrochen und auf einen anderen Ort vertagt.<br />
Wie erleben Sie es, wenn Konflikte außerhalb von den richtigen Rahmen oder Orten<br />
auftreten?<br />
10 Dieses Muster zeigt sich auch an der Diskussion zu den Beobachtungsbögen, wenn die Schule genervt<br />
fragt, wie sich die KiTa nun entschieden hat und somit implizit die Gesprächsführung übernimmt, die<br />
KiTa aber Widerstand leistet.<br />
24
Für die <strong>Tandem</strong>gruppe Paris ist es wichtig zu betonen, dass die Arbeit der<br />
verschiedenen Institutionen nicht einfach so nebeneinander herlaufen soll („dass man sich<br />
auch noch mal kurzschließt und dann noch mal trifft und bespricht“), sondern<br />
Informationen richtig und nicht so kurzfristig weitergegeben werden. Mangelnde<br />
Kommunikation wird einerseits auf gegebene Umstände bezogen, indem z.B. der<br />
Krankheitswelle als Grund herangezogen wird. Andererseits wird beschrieben, dass sie ein<br />
höheres Niveau haben sollte, damit es sich lohnt („wäre mir eher daran gelegen die Zeit die<br />
wir haben qualitativ sinnvoll mit wichtigen Informationen zu füllen“). Darin zeigt sich,<br />
dass sie die Kooperation auch auf inhaltlich konzeptioneller Ebene ansiedeln: „zum<br />
Beispiel was findet jetzt in der AG genau statt“. Der Konflikt, der sich aus einem<br />
organisatorischen Konflikt heraus ergab („plötzlich 20 Kinder im Raum standen“), wird<br />
von ihnen auf die Ebene inhaltlicher Auseinandersetzung gebracht („dass wir<br />
untereinander einfach mehr voneinander wissen“, „jetzt an nem Punkt sind wo wir<br />
inhaltlich einfach miteinander diskutieren können“, „jetzt in der Situation schon viel Sinn<br />
weil wir dann auch nen Blick haben wie können die Kinder dat in der Schule<br />
weiterleben“).<br />
Auf der Gesprächsebene werden Konflikte bearbeitet, indem unterschiedliche<br />
Standpunkte nebeneinander bestehen bleiben oder im verdeckten, divergenten Modus<br />
bearbeitet werden.<br />
Wie ist das so mit den Konflikten?<br />
Orte für Konflikte werden von den Moderatorinnen außerhalb der Moderationen<br />
angesiedelt. Es wurde beschrieben, dass Konflikte, z.B. wenn neue Gruppenmitglieder<br />
unangekündigt in die <strong>Tandem</strong>gruppen kommen oder zwischen den Beteiligten entstehen,<br />
häufig durch Anrufe nach der <strong>Tandem</strong>sitzung bearbeitet werden. Das Vorgehen, diese<br />
Konflikte mit in die <strong>Tandem</strong>gruppen zu nehmen und dort „offen“ darüber zu sprechen,<br />
wird als problematisch erlebt. So wurde bspw. die Erfahrung beschrieben, dass die<br />
Beteiligten den Konflikt negieren und das Problem der Moderatorin zuschreiben wird, sie<br />
sich also dann gegen sie „verbünden“. Sie beschreiben außerdem den inhaltlichen Konflikt,<br />
dass auch der fachliche Austausch nicht in den Moderationen, sondern außerhalb<br />
stattfindet, und fragen sich, was die Qualität der <strong>Tandem</strong>gruppen auszeichnet (M2: „was ist<br />
die Qualität? Dass sie sich hoch pädagogische Themen diskutieren, oder dass sie<br />
selbstständig werden? Oder ist beides die Qualität und dann spricht das eine für eine<br />
kontinuierliche“).<br />
25
Wie erleben sie das mit den Orten für Konflikte? Wie ist es mit der Qualität? Wie<br />
arbeiten sie daran?<br />
Themenschwerpunkt 3: Interpretation und Fokussierungsmetaphern für „Moderation“ und<br />
für deren Nachhaltigkeit<br />
Welche (Fokussierungs-)Metaphern haben Sie in ihren Erzählungen für Moderation<br />
entfaltet? Wie erleben Sie sie?<br />
Für die <strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco zeigt sich die Bedeutung von Moderation in<br />
folgenden Sprachbildern: „Es is ja auch der Blick von außen drauf der dann immer auch<br />
noch das Ganze so n bisschen geleitet hat und geguckt hat und auch zusammengefasst hat<br />
von ner anderen Position aus. Neutral“. Und dann fragt sie wie es uns gegangen is und<br />
dann kommen wir ins Gespräch und wenn wir vom Wege abkommen führt sie uns wieder<br />
auf den Weg“. „Pointieren, Zusammenfassen, andere Blickpunkte einzubringen“. Sie<br />
beschreiben, dass ihnen ohne die Moderation der „Anstoß“ fehlt. In ihren Sprachbildern<br />
werden die gewünschte Distanz zur Moderatorin und die damit einhergehende<br />
Differenzierung deutlich, die eine positive Orientierung an Autonomie dokumentiert.<br />
Die <strong>Tandem</strong>gruppe New York beschreibt die Bedeutung der Moderation in den<br />
Sprachbildern: Die Moderation ist „entlastend für den Ablauf“ und unterstreicht somit die<br />
durch die Moderation entstehende Struktur. Des Weiteren ist ihnen wichtig, dass die<br />
Moderation „bei Themenabweichungen wieder zurück zum Thema geführt hat“. Implizit<br />
geht die <strong>Tandem</strong>gruppe hierbei davon aus, dass die Moderatorin den „richtigen Weg“ für<br />
den Verlauf der <strong>Tandem</strong>gruppen weiß und führt. Im Vergleichshorizont zu den in ihren<br />
Einrichtungen erlebten Teamsitzungen „gibt (es) in den <strong>Tandem</strong>sitzungen sehr wenig<br />
Nebengespräche“, was die <strong>Tandem</strong>teilnehmer auf die Moderation rückbeziehen, die für sie<br />
eine Führungsrolle, eine Autorität symbolisiert, von der sie sich nun „abnabeln“ müssen.<br />
Für die <strong>Tandem</strong>gruppe Paris zeigt sich die Bedeutung der Moderation in den<br />
Sprachbildern: „hat uns unterbrochen wenn wir vom Weg abgekommen sind und das<br />
Ganze zusammengefasst“, „weil wir auch häufig Dinge diskutieren, die wir eigentlich<br />
nicht diskutieren sollten“, Moderation strukturiert den Verlauf: „Moderatoren sind einfach<br />
außen vor und haben ne andere Sicht“. Sie „liefert Struktur, hilfreich wenn einer was<br />
festlegt“, man sich nicht „so leicht aus der Affäre“ ziehen kann. Für sie ist das Wegfallen<br />
der Moderatorin eine „Prüfung“, worin sich erneut ihre positive Orientierung und ihr<br />
26
Anspruch an Leistung dokumentiert. Die Prüfung geht für sie noch weiter, das Ende der<br />
Moderation wird als Selbst-Überprüfung beschrieben, welche Wichtigkeit der<br />
Zusammenarbeit dann noch, von den beiden Institutionen, eingeräumt wird. Es besteht die<br />
Befürchtung, dass langfristig ein Auseinanderfallen der Kooperation entstehen könnte,<br />
„dass man dann guckt dass man wir wieder zusammenkommen dass das uns nit irgendwie<br />
langfristig wieder auseinanderbröselt“, wenn die Moderation beendet wird.<br />
Für sie stellt sich die Frage, wer sich nach der Moderation verantwortlich fühlen wird, die<br />
Zusammenarbeit weiterzuführen.<br />
Für die Moderatorinnen sind Metaphern der Moderation auf ihr professionelles<br />
Selbstverständnis bezogen: Sie unterscheiden zwischen „Rolle“, „Person“ und „Mensch“<br />
und fragen sich, ob Moderation eine „Abwicklungsinstitution unter Zugzwang“ wird und<br />
fachlicher Austausch am Rande oder in der Pause stattfindet“. Es zeigt sich eine sachlich-<br />
konzeptionelle Metaphorik, die das eigene Wirken theoretisierend entwirft. Hier wird<br />
deutlich, wie sie die Bereiche der Organisation und des fachlichen Austauschs einander<br />
diametral gegenüberstellen. In den <strong>Tandem</strong>gruppen werden hingegen die organisatorischen<br />
Aufgaben oftmals bereits als inhaltlicher Austausch erlebt, bspw. wenn es um die<br />
Aktivitäten geht, bei denen implizit unterschiedliche Konzeptionen von Kind oder Qualität<br />
verhandelt werden.<br />
Wie erleben sie die Theorie ihrer Praxis? Wie ist es mit Organisation und Inhalt?<br />
(Präsentation der Power-Point-Folien 4-10, sodass Bilder und Metaphern in zeitlicher<br />
Abfolge diskutiert werden.)<br />
IV. Abschluss<br />
(Präsentation der Power-Point-Folie 11)<br />
Programm-Ziele der Moderation in ein Verhältnis zu den Rekonstruktionen der impliziten<br />
Werthaltungen und Bewertungen setzen:<br />
In den Programmzielen 11 wird zur Aufgabe deklariert, Unterschiede zwischen<br />
Erzieherinnen und Lehrerinnen zu managen. Sie beschreiben noch ganz andere<br />
Differenzen.<br />
11 Entsprechend dem Erkenntnisinteresse der Auftraggeber an Nachhaltigkeitsprozessen des<br />
<strong>Tandem</strong>projekts habe ich aus den zahlreichen Programmzielen (vgl. DKJS 2008) jene ausgewählt, die<br />
neben Fragen der Professionalisierung von Erzieherinnen und Lehrerinnen organisationsentwicklerische<br />
Prozesse entlang institutioneller Logiken aufgreifen.<br />
27
Wie erleben sie das?<br />
Außerdem halten die Programmziele fest, dass die Moderation für die Organisation und<br />
den fachlichen Austausch innerhalb der <strong>Tandem</strong>gruppen zuständig ist. So steht in den<br />
Zielen bspw., dass sich die Moderationssituation durch „regelmäßige Gespräche zwischen<br />
den pädagogischen Fachkräften aus den Einrichtungen“ und „einer bedarfsorientierten<br />
fachlichen Unterstützung der Arbeit in den <strong>Tandem</strong>s“ auszeichnet. Sie beschrieben<br />
hingegen, dass die Arbeit der Moderatorin darin besteht, die Gespräche zu strukturieren<br />
und einem Ergebnis zuzuführen.<br />
Wie stellen Sie sich die Arbeit in Zukunft vor? Wenn sie sich was wünschen könnten,<br />
was wäre das? Wie wollen sie jetzt weiter machen? Wie klingt das für sie was sie so gehört<br />
haben? Woran möchten sie weiterarbeiten? 12<br />
V. Ausblick<br />
(Präsentation der 12. Power-Point-Folie)<br />
So geht es jetzt weiter: nächste Erhebungsphase.<br />
Wir würden beim nächsten Mal gern auch die Interpretationen von Videopassagen mit in<br />
das responsive Evaluationsgespräch einbeziehen, wie schätzen Sie das ein?<br />
12 Die Evaluierten werden auf diese Weise mit in den Forschungsprozess einbezogen. Die Frage ist bewusst<br />
so offen gehalten, dass die <strong>Tandem</strong>gruppen sie auf die Evaluation und/oder auf ihren Projektalltag<br />
beziehen können.<br />
28
7. Power-Point-Präsentation zu den zweiten responsiven<br />
Evaluationsgesprächen<br />
Folie 1:<br />
Folie 2:<br />
29
Folie 3:<br />
Folie 4:<br />
30
Folie 5:<br />
Folie 6:<br />
31
Folie 7:<br />
32
8. Textgrundlage für die zweiten responsiven<br />
Evaluationsgespräche mit den <strong>Tandem</strong>gruppen und den<br />
Moderatorinnen<br />
Methodisches Vorgehen 13 :<br />
(Präsentation der ersten Power-Point-Folie)<br />
Ihrem Anliegen, Einblicke in unterschiedliche Standortgebundenheiten zu erproben,<br />
möchte ich gern am Beispiel von expliziten Bewertungen und impliziten Werthaltungen<br />
auf der Grundlage von drei Oberthemen nachgehen:<br />
Themenschwerpunkt 1: Abgrenzung von anderen <strong>Tandem</strong>gruppen<br />
In allen Gruppendiskussionen der <strong>Tandem</strong>gruppen zeigt sich die Tendenz der<br />
Selbstaufwertung – und die Selbstzuschreibung eines Exklusivitätsstatus – durch die<br />
Abgrenzung vom Vorgehen der anderen. Sie wird jedoch entsprechend falleigener Logiken<br />
unterschiedlich elaboriert:<br />
Alle <strong>Tandem</strong>gruppen beschreiben sich bzw. ihre eigene Gruppe als besonders in<br />
Abgrenzung zu anderen, das möchte ich an drei Beispielen zeigen:<br />
13 Bei dem zweiten responsiven Evaluationsgespräch unterscheiden sich die Tischvorlagen von<br />
Moderatorinnen und <strong>Tandem</strong>mitgliedern nicht, da es in dieser Evaluationsphase, im Unterschied zum<br />
ersten Evaluationsgespräch auch für die <strong>Tandem</strong>s zentral ist, sich in die Standortgebundenheiten der<br />
Moderatorinnen zu versetzen, um zu üben, alternative Bewertungshaltungen im Vergleich zu eigenen<br />
nachzuvollziehen. Wie bei den ersten Evaluationsgesprächen wird bei der Präsentation der Transkripte<br />
und Rekonstruktionen variiert, mal werden nur Transkripte, mal Transkripte und (kurze)<br />
Rekonstruktionen vorgestellt, um den Beteiligten auf diese Weise eine abwechslungsreiche Systematik<br />
der Darstellung zu offerieren. Fragen von der Evaluatorin werden erst nach der Präsentation von<br />
mindestens zwei Beispielen gestellt, um so die komparative Analyse in die Didaktik der responsiven<br />
Evaluationsgespräche zu integrieren. Auch im zweiten Evaluationsgespräch wird die Reihenfolge der<br />
<strong>Tandem</strong>s innerhalb der drei Oberthemen variiert, um die Anonymität zu erhöhen.<br />
33
<strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco<br />
Ew2: Um zu betonen dass jede Einrichtung schon ihre eigene Einrichtung is un<br />
auch bleiben kann und muss und soll und trotzdem, so die Notwendigkeit<br />
der Zusammenarbeit zum Wohl des einzelnen Kindes einfach, dass uns das<br />
wichtig ist und ich find es ist gut wiedergegeben, also ich kann mich da total<br />
gut drin finden und zu dem anderen find ich da (2) kann man sich auch<br />
kaum äußern, man war nicht dabei man hat die Zeit nicht miterlebt und ja<br />
das is für mich jetzt auch n´ bisschen wirkt eher sagen wir mal jetzt so banal<br />
gesagt dünner vom inhaltl vom Inhalt gesehen wie unser´s. Unser´s is<br />
schon mit (.) Leben und mit Inhalt gefüllt. Aber wahrscheinlich wirkt es<br />
auch so auf einen, weil man es ja selbst mit getragen hat und mit begleitet<br />
hat die Jahre, es is natürlich schwer so n´ paar Sätze von nem andern Team<br />
jetzt so zu bewerten oder zu beurteilen, das find ich schon schwierig<br />
I1: Mmh<br />
LLw3: Allen gerecht<br />
zu werden<br />
ELw2: Ja mmh<br />
Ihre eigene „mit Leben und mit Inhalt“ gefüllte <strong>Tandem</strong>gruppenarbeit wird mit der etwas<br />
„dünn“ erscheinenden Arbeit der anderen <strong>Tandem</strong>gruppen kontrastiert.<br />
Die Teilnehmer grenzen sich in diesem Diskussionsabschnitt explizit von den anderen<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen ab und bringen somit implizit ihre eigene Exklusivitätsvorstellung zum<br />
Ausdruck, die sich für sie durch „lebendige“ und „inhaltlich hochwertige“ Arbeit<br />
begründet. Diese relativieren sie durch den Zusatz, „man kennt sich ja selbst am besten“,<br />
wobei erneut ihre falleigene Logik zum Tragen kommt, Differenzen als konstitutiv für die<br />
Wahrnehmung anderer zugrunde zu legen. Dies zeigt sich auch an der expliziten<br />
Bewertung, dass „jede Einrichtung ihre eigene Einrichtung is und auch bleiben kann“<br />
sowie der Betonung, die anderen nicht beurteilen zu können: „Aber wahrscheinlich wirkt<br />
es auch so auf einen weil man es ja selbst mit getragen hat und mit begleitet hat die Jahre,<br />
es is natürlich schwer so n paar Sätze von dem anderen Team jetzt so zu bewerten oder zu<br />
beurteilen.“ Implizit wird hier betont, dass ein Urteil auf der Grundlage von Erfahrungen<br />
34
asieren sollte und ihnen somit nicht zustehe. Dies entspricht ihrer falleigenen Logik, sich<br />
an Erfahrung, Erlebnissen und Stimmungen zu orientieren.<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe Paris<br />
Ew2: Heißt des, die haben seither drauf gewartet? Seither hatten die keinen<br />
Rahmen, sich da abzugrenzen?<br />
Ew3 Also generell is es ja nicht schlimm, wenn man sagt, so – hamm wir ja bei<br />
der AG, bei der AG hatten wir uns ja auch anders geeignet als es vorher<br />
eigentlich geplant war.<br />
Ew1 Ja<br />
Ew3 Generell find ichs ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, so wir machen<br />
unser Ding, ihr macht euer Ding aber irgendwie suchen wir doch immer<br />
einen gemeinsamen Nenner, ne?<br />
So würde ich das (.) sehen<br />
Lw2 solange des zeitlich begrenzt ist, oder es ne Aussicht<br />
darauf gibt, es sich wieder annähern zu lassen, find ich das überhaupt nich<br />
schlimm. Oder wenn es auch manche Ansichten sind, wie bei euch der<br />
Zugang zu, bei uns eben <br />
Ew1 ja mhmh, genau<br />
Lw2 wars ein anderer. Allein wenn s im Kopf ein anderer ist. Dann gibt’s das<br />
dann ist das auch so. Dann muss man die Unterschiedlichkeiten, also ich<br />
find, die kann man auch mal akzeptieren.<br />
Ew3 Aber nicht generell. Soll ja nicht alles unterschiedlich sein.<br />
Lw2 Ist ja auch nich stabil.<br />
Es ist ja auch nichts Stabiles. man kann ja auch mal sagen so geht’s auch, so<br />
hab ich das noch nich gesehen.<br />
Auch hier erfolgt eine Anerkennungsstrategie, bei der Selbstaufwertung an die Abwertung<br />
der bzw. Abgrenzung von den anderen <strong>Tandem</strong>gruppen verfolgt wird. Explizit wird es als<br />
positiv bewertet, immer wieder auf einen Nenner zu kommen und eine implizite<br />
Werthaltung zeigt sich an der positiven Orientierung an temporärer Unterschiedlichkeit.<br />
35
<strong>Tandem</strong>gruppe New York 14<br />
Ew2: Also wir finden immer so ne Lösung mit denen alle zufrieden sind. Alle<br />
Beteiligten also <br />
ELw5: hm ja klar<br />
Lw1: Das würde ich in dem Fall hier nicht jetzt sagen.<br />
ELw5: Also Also ich denke dass wir alle hier schon sehr<br />
Harmonie bedürftig sind in in unsrem <strong>Tandem</strong> und dat wir immer zu nem<br />
Ziel gekommen sind äh dat man sich was versucht auf den andern<br />
einzulassen und en gemeinsames Ziel halt zu haben und das hört sich da<br />
schon anders an. Dat hört sich so n bisschen an als wären die bisschen<br />
enttäuscht oder dass es sich schwieriger entwickelt hat ja als am Anfang<br />
gedacht<br />
Ew2: mhm (14)<br />
Ew1: Ja aber wahrscheinlich stoßen da so viele unterschiedliche Richtungen<br />
aufeinander dass es dann wirklich schwierig ist auf einen Nenner zu<br />
kommen beziehungsweise es war ja in dem äh vorherigen ähm Dialog dass<br />
jeder seine Meinung so stehen lässt im Raum (.) so aber dann is es ja<br />
wirklich @schwierig zusammen zu arbeiten@ bei denen ähm [räuspert sich]<br />
ja<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe New York ist es bei Konflikten – in Abgrenzung zu anderen<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen – wichtig, dass „alle auf einen Nenner kommen“, „ne Lösung gefunden<br />
wird, mit der alle zufrieden sind“. Das Bedürfnis nach „Harmonie“ und „zu nem Ziel zu<br />
kommen“ sind ihre expliziten Bewertungskriterien, die eine Konsens- sowie<br />
Leistungsorientierung markieren. Ihre Kombination bildet die implizite Werthaltung, dass<br />
der Dialog die Basis guter Zusammenarbeit bzw. den Umgang mit Konflikten bildet: Wenn<br />
„jeder seine Meinung so im Raum stehen lässt“, wird es „wirklich schwierig so zusammen<br />
14 Notizen aus dem Beobachtungsprotokoll: Im Vergleich zu den anderen <strong>Tandem</strong>gruppen, aber auch zur<br />
Gruppendiskussion ist das responsive Evaluationsgespräch in dieser <strong>Tandem</strong>gruppe von einer besonderen<br />
Anspannung und Aufgeregtheit geprägt. Sie wollen bei ihren Reaktionen auf die Interpretationen alles<br />
richtig machen und sind stark auf mich als Evaluatorin fokussiert. Es entstehen immer wieder lange<br />
Pausen von 14 oder sogar 25 Sekunden, in denen sie mich fragend anschauen. Während des gesamten<br />
Gesprächs entschuldigen sie sich mehrfach, dass sie die Methode noch nicht so gut beherrschen und dass<br />
alles ganz neu für sie sei. Darin dokumentiert sich ihre positive Orientierung an Autorität und<br />
hierarchisch organisierten Beziehungsmustern.<br />
36
zu arbeiten“. Wie diese Einigung, die Bearbeitung „unterschiedlicher Richtungen“<br />
herbeigeführt werden kann, bleibt in diesem Abschnitt jedoch offen. In anderen Passagen<br />
zeigt sich, dass sie die Aufgabe, „alle auf einen Nenner zu bringen“ – für sie die Basis der<br />
Kooperation – einer Autoritätspersonen zuschreiben, wie bspw. der Moderatorin,<br />
Evaluatorin 15 oder Leitungskräften und somit im Alltag eine hierarchisierende<br />
Konfliktbearbeitung beschreiben.<br />
Sie haben nun drei ganz unterschiedliche Bewertungspraktiken von<br />
Kooperationsgefügen kennengelernt? Wie erleben Sie das? Was fällt Ihnen im Vergleich<br />
zu den anderen auf?<br />
Moderatorinnen<br />
I: ((liest Transkript von <strong>Tandem</strong>gruppe New York zur Zusammenarbeit<br />
von KiTa und Grundschule zur Abgrenzung von den Eltern vor))<br />
Md3: ((seufzt<br />
abwertend)) <br />
15 Im folgenden Transkript zeigen sich auf inhaltlicher und auf diskursorganisatorischer Ebene eine positive<br />
Orientierung an Anerkennung: Sie wird selbst- und fremdreferentiell elaboriert: „froh sein dass wir<br />
teilhaben dürfen“, „gut dass ich in diesem <strong>Tandem</strong> bin“.<br />
I1: Ja genau und jetzt promoviere ich und muss ähm @nächsten Sommer abgeben@.<br />
Alle: @(.)@<br />
Ew5: Dann viel Erfolg.<br />
I1: ( ) ja und dann ist das auch ein Teil davon ja und ähm genau.<br />
Ew5: Ja (.)Schön<br />
Ew1: Ja dann können wir froh sein, dass wir da dran teilhaben dürfen @(.)@<br />
I1: Ja ich bin ihnen eher dankbar, dass ich @das hier@<br />
Lw1: Ich dachte gut dass ich in diesem <strong>Tandem</strong> bin<br />
(.) in New York<br />
Ew1: Ja<br />
Alle: @7@<br />
Ew5: das hab ich auch schon gedacht ja @2@ ja gut @ja das ist wohl besser@<br />
Ew4: Nur das mit dem Expertengespräch das haben wir ja nit @wiedererkannt@<br />
Ew1: Gut<br />
I1: Also gut das nehm ich mit<br />
Ew5: @das ist gut@<br />
I1: den Wunsch nach Kopien und das wir das ein<br />
bisschen fokussierter mit den Informationen machen. also nicht so viel (.) sondern lieber<br />
fokussiert? Nehm ich mit. Gibt es sonst noch was sie gerne<br />
Ew5: @(.)@<br />
37
Md1: is ja<br />
interessant das der Datenschutz gar keine Rolle spielt is ja überhaupt nich<br />
angesprochen worden<br />
Md3: doch doch ja das Einverständnis der Eltern<br />
Md2: ja doch<br />
Md1: ja? War des<br />
Md2: des nimmt wenn die dann da anrufen natürlich noch ne Einverständnis der<br />
Eltern<br />
Md1: anrufen ja aber nich schriftlich ne<br />
Md2: ne natürlich nach Einverständnis<br />
Md3: Einverständniserklärung der Eltern aber darum gehts ja gar nich<br />
Md2: ((atmet hörbar aus))<br />
Md3: ja all äh das is zum Beispiel so n Thema @<br />
Md2: @<br />
Md1: @<br />
Md3: da werd ich da wär ich manchmal froh<br />
ich wäre die Fortbildnerin die ihre Expertenmeinung im <strong>Tandem</strong> äußern<br />
darf und nich die Moderatorin die da sitzt und denkt so oh Leute hätte ich n<br />
((alle lachen))<br />
Md1: genau<br />
Md3: Kind ich weiss nich ob ich s hier hinbringen wollte ganz ehrlich also ich<br />
mein dass sie das in der Runde also für mich schwingen da spontan zwei<br />
Dinge mit das eine is so ne so hab ich s auch immer in den Diskussionen<br />
erlebt das eine is so ne Aufwertung von Lehrkräften gegenüber dem was<br />
Erzieherinnen machen und das wird ja extrem oft in so ner kleinen Passage<br />
betont dass äh quasi sie sagen äh ihre Meinung is uns wichtig und wir<br />
erkennen sie an als Professionelle und äh ähm wir hören auch auf das was<br />
sie sagen ähm das wird ganz oft gesagt wenn aber konkrete Fälle passieren<br />
merkt man das is gar nich so also des is in den seltensten Fällen so und vor<br />
allem das Bild das da von Eltern gezeichnet wird und von deren<br />
Erziehungsrecht und Pflicht find ich furchtbar find ich katastrophal mich<br />
38
egt das jedes Mal auf das is jedes Mal so n Thema wo ich da sitze und<br />
denke so nee das kann doch echt net sein<br />
Den ersten Bezugspunkt bildet hier die Klärung des formal richtigen Vorgehens<br />
(„Einverständniserklärung der Eltern“), was Md3 abbricht („aber darum geht’s ja auch gar<br />
nich“). Daran schließen die Moderatorinnen die Auseinandersetzung mit ihrer Rolle an:<br />
Explizit wird hier bewertet, dass die Beteiligten entgegen ihrer Ausführungen ihr Ziel nicht<br />
erreicht haben („des is in den seltensten Fällen so“). Dieses Ziel wird mit der eigenen<br />
professionellen Haltung in Verbindung gebracht: („da wär ich gern Fortbildnerin“).<br />
Implizit zeigt sich somit die Werthaltung, dass es ein bestimmtes Ziel zu erreichen gibt:<br />
eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen den Institutionen sowie ihre gesprächs-<br />
bereite Haltung den Eltern gegenüber. Das eigene professionelle Vorgehen steht dem<br />
Erreichen dieses Zieles jedoch aus ihrer Perspektive im Weg.<br />
Wie erleben Sie das? Kennen Sie das?<br />
Themenschwerpunkt 2: Reaktionen auf Fotos der ersten responsiven Evaluationsgespräche<br />
Welche Werthaltungen zeigen sich in den Sprachbildern, die in Form metaphorisch dichter<br />
Beschreibungen artikuliert werden, während Sie beim letzten Evaluationsgespräch die<br />
Fotos angeschaut haben?<br />
Bei allen <strong>Tandem</strong>gruppen und den Moderatorinnen hat sich fallübergreifend gezeigt,<br />
dass ihre Orientierungen während der Präsentation der Fotos bei den ersten responsiven<br />
Evaluationsgespräch (metaphorisch) verdichtet und weniger reflexiv zum Tragen kommen.<br />
In Abgrenzung zu anderen Passagen evozieren die Fotos alternative Perspektiven auf<br />
und Bezüge zur eigenen Kooperationspraxis. 16<br />
16 Zusammenfassender Überblick:<br />
- <strong>Tandem</strong> San Francisco: Relativierung der sonst stark betonten autonomen Orientierung („so n<br />
Anstoß war schon von ihr“).<br />
- <strong>Tandem</strong> New York: persönliches Sprechen, sonst kommt Außenorientierung stärker zum Tragen<br />
(„gefällt mir sofort“). Hier wird auf eine sinnlich aisthetische Ebene abgehoben und die eigene<br />
Sicht mit Attribuierungen auf die Kinder verknüpft.<br />
- <strong>Tandem</strong> Paris: einzige Passage in der selbstreferentiell bzw. implizit selbstkritisch gesprochen<br />
wird.<br />
- Moderatorinnen: heben auf symbolische Ordnung ab (Anzug, ...) und überlegen sich konkrete<br />
Variationsmöglichkeiten des eigenen professionellen Vorgehens.<br />
39
<strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco<br />
Ew2: Also mir gefällt das hier am besten.<br />
Lw1: @(.)@ Ja<br />
Ew1: Man selbst man spürt es aber man ist begleitet.<br />
Ew2: Ja Ja<br />
Ew1: Ja aber man erfährt es selbst.<br />
LLw3 Mmh das hätt ich jetzt auch spontan, dass es passt<br />
Ew2: Die Kinder sind mit drin<br />
Ew1: Das is es.<br />
Lw1: Genau.(3)<br />
LLw3: So n Anstoß<br />
Ew1: War schon von ihr. Der kam schon von ihr. Ja. (6)<br />
Ew2: Weil manchmal da sitzt man auch etwas oder man ne und ähm<br />
Lw1: Ja.<br />
Ew1: Dann braucht<br />
man einfach mal jetzt<br />
Ew2: Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht<br />
Ew1: Genau ja. Und dann is is des ok, ne. Das war das gute an der Moderation<br />
und ähm so ist das hier bei dem Bild ja auch, wie kann ich den Weg weiter<br />
gehen, ohne dass ich nasse Füße bekomme, ne. Zum Beispiel ne<br />
Implizit wird hier zum Ausdruck gebracht, dass die Rolle der Moderatorin für die<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe darin besteht, ihnen in Momenten der Unsicherheit – wenn man den Wald<br />
vor lauter Bäumen nicht sieht – Denkanstöße zu geben („dann is es ok“), die ihre<br />
selbstständige Arbeit wieder ins Laufen bringen. Implizit zeigt sich hier, wiederholt im<br />
Diskussionsverlauf, eine positive Orientierung an Autonomie („der kam schon von ihr“)<br />
und an der Stimmung bzw. Atmosphäre („man selbst man spürt es aber man ist begleitet“,<br />
„ja aber man erfährt es auch selbst“). Moderation wird somit explizit positiv bewertet,<br />
wenn sie den Wunsch nach eigenständiger Arbeit berücksichtigt („das war das gute an der<br />
Moderation“). Im Rahmen dieser gewohnten Orientierung wird hier anders als in anderen<br />
Passagen das eigene Unvermögen, die Möglichkeit des Scheiterns formuliert („weil<br />
manchmal da sitzt man auch etwas“, „man sieht den Wald vor lauter Bäumen nich“).<br />
40
Kennen sie diese unterschiedlichen Gefühle? Erfahrungen? 17<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe Paris<br />
Ew2: gemeines Gewitter?<br />
Ew3: Ich wollt grad sagen, da sieht man schön die dicke Wolke<br />
Lw2: ja<br />
Stimmt@<br />
Ew3: Wenn wir uns ausgebrüllt haben dann zieht die Wolke weg. dann ist der<br />
Himmel wieder<br />
Ew1: Ich glaube auch wir kommen doch alle aus Jobs wo man so’n<br />
so’n übergroßes Harmoniebedürfnis hat und ich glaube uns würde arbeiten<br />
manchmal viel einfacher fallen wenn wir uns davon ein Stückweit davon<br />
verabschieden würden zumindest ein Ziel das man haben könnte<br />
Ew4 Weniger Harmonie?<br />
Alle: @<br />
Ew1: Konflikte zulassen und…(.) manchmal hat man diese °vermeintliche°<br />
Harmonie und die ist ja gar net unbedingt Harmonie<br />
Lw2: Und das ist gefährlicher als äh<br />
Ew1: genau<br />
Lw2: als wenn es mal knallt.<br />
Explizit wird hier betont, dass zu viel Harmonie nicht gut ist und zugleich ein<br />
Harmoniebedürfnis als professionell bedingt gerahmt („wir kommen doch alle aus Jobs“).<br />
Implizit zeigt sich die Werthaltung, dass Konflikte – oppositionelle Haltungen –<br />
ausgetragen werden sollten und dabei als temporärer Aushandlungsprozess in Ordnung<br />
sind („wenn wir uns angebrüllt haben zieht die Wolke weg“). Differenzen die Kooperation<br />
jedoch nicht kontinuierlich prägen dürfen. Implizit wird deutlich, dass dieser Umgang mit<br />
Konflikten ein normativer Horizont ist und der Konflikt, den dessen Umsetzung bedeutete<br />
– der sich in der Unklarheit der Nachfrage „weniger Harmonie“ dokumentiert und sich in<br />
dem Lachen und den humorvollen Anschlüssen ausdrückt – auf die Zukunft verschoben<br />
17 Die oben dargelegte fallexterne komparative Analyse wird im Evaluationsgespräch durch eine fallinterne<br />
komparative Analyse variiert, die sich entlang der Reaktionen auf die Fotos entfalten lassen.<br />
41
wird („zumindest ein Ziel das man haben könnte“). „Konflikt zulassen“ scheint ein<br />
brisantes Thema („die gar net unbedingt Harmonie“ „und das is gefährlicher als wenn es<br />
mal knallt“) zu sein, dessen Bearbeitung durch Verschiebungen auf eine andere Zeit<br />
erfolgt. Darin zeigt sich eine ambivalente Werthaltung zwischen der Vorstellung, dass der<br />
Himmel sowohl da ist, nachdem die Wolke weggezogen ist, also der positiven Vorstellung<br />
von einem offenen Umgang mit Konflikten, als auch der Erfahrung „vermeintlicher<br />
Harmonie“. Der Erwartungshorizont offener Konflikte bleibt auf diese Weise unverbunden<br />
mit Praxiserfahrungen, wodurch der Konflikt, dass keine Konflikte zugelassen werden –<br />
hier einmalig selbstreferentiell – zum Tragen kommt.<br />
Kennen Sie so Situationen, in denen man hin- und hergerissen ist, zwischen zwei Polen,<br />
zwei Interessen?<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe New York<br />
ELw4: Also sofort das zweite Bild gefällt mir sofort.<br />
Alle: hmm<br />
Ew4: Ist fast das einzige das mir gefällt also wo ich ein positives Gefühl hab<br />
sagen wir mal so. Was ich mir aussuchen würde wenn ich mir eins davon<br />
aussuchen würd. ähm<br />
Lw1: wenn es darum geht in welche Situation man als nächstes geraten sollte<br />
dann<br />
Elw4: Ja genau<br />
Lw1: Dann am liebsten die.<br />
ELw4: Ja weil da ist Natur äh da hörst du vielleicht die Vögel und hörst<br />
den Bach plätschern und äh ich stell mir auch grad vor dat das vielleicht<br />
auch interessant ist wat die Kinder da machen dat das ganz spannend ist und<br />
die gucken ja auch ja.<br />
Ew3: und das sind die absoluten No-Goes (bezugnehmend auf Bild 4, Folie 8)<br />
Alle: @(.)@<br />
Lw1: ja unsre Arbeit ist ja die mit Kindern deswegen haben wir ja denke ich alle<br />
diesen Beruf gewählt. Ich weiß nicht, nicht weil wir uns gerne darstellen<br />
oder Karriere machen wollen also denk ich jetzt mal. So ja ist einfach schön<br />
und grad das sind die Momente so Ausflüge mit Kindern die bleiben ja also<br />
42
Ew1: Ja<br />
daran erinnere ich mich noch ganz lange daran erinnern sich die Kinder<br />
wahrscheinlich noch Jahre oder man erinnert sich selber auch noch ich<br />
weiss selber noch vom Kindergarten von der Grundschule Ausflüge die ich<br />
gemacht habe<br />
Lw1: und von irgendwelchen ja Fortbildungen die ich gemacht habe des<br />
verschwindet, das is dann oft auch sehr anstrengend.<br />
Die erste Reaktion auf die Bilder – wird wie in <strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco – auch hier<br />
auf eine sinnlich-aisthetische Gefühlsebene („da hörst du vielleicht die Vögel und hörst<br />
den Bach plätschern“) bezogen. Dort siedeln die Beteiligten implizit somit ihr<br />
Beurteilungsorgan für das Empfinden von Schönheit an („das zweite Bild gefällt mir<br />
sofort“). Eine wesentliche Perspektive ist für sie dabei die auf die Kinder („stell mir auch<br />
grad vor dat das ganz spannend is wat die Kinder machen“). Anders als in anderen<br />
Passagen wird die selbstreferentielle Perspektive hier mit der der Kinder verbunden<br />
(„erinnern sich die Kinder“ „oder man erinnert sich selber auch noch“). Gemeinsame<br />
Erfahrungen werden Fortbildungen kritisch gegenübergestellt. Dabei zeigt sich eine<br />
implizite Orientierung an nachhaltigen Erlebnissen, die an Gemeinsamkeit und Natur<br />
gebunden werden. Sie stellen einen Maximalkontrast zu den „absoluten No-Goes“ –<br />
negativen Horizonten – dar: Die Beteiligten grenzen sich von Professionen ab, die auf<br />
Selbstdarstellung und Karriere abzielen. Stattdessen heben sie hervor, dass es die<br />
Erinnerungen an Erlebnisse mit den Kindern in der Natur im Gegensatz zu oft<br />
anstrengenden Fortbildungen sind, die ihren Beruf ausmachen. Die explizite Abwertung<br />
von Karriere, Selbstdarstellung und Fortbildungen wird vor dem Hintergrund einer<br />
sinnlich-ästhetischen Werthaltung nachvollziehbar, die die positive Orientierung an<br />
erfahrungsbasierten bzw. nachhaltigen Kooperationstätigkeiten verdeutlicht.<br />
Kennen Sie das, sich zu erinnern, wie man selbst als Kind erlebt hat und daran das<br />
erwachsene professionelle Handeln auszurichten?<br />
43
Moderatorinnen<br />
I: ((zeigt die Bilder)) Hier war die Frage mit dem Überblick kennt ihr das oder<br />
das (2) wie sieht des für Euch aus oder das (4) Gibt s ein Bild das Euch<br />
besonders anspricht oder abschreckt<br />
Md2: also ich find das letzte ganz gut weil man einfach noch mal die äh<br />
die Flipcharts sieht äh die Visualisierung ähm weil ich es immer wichtig<br />
find zu visualisieren des ähm ja <br />
Md3: ja das letzte is auch das<br />
Einzige was mir vertrauter vorkommt wobei es jetzt hier wieder so is dass<br />
äh also wenn überhaupt vertraut dann äh durch ähm eben ja den Flipchart<br />
und die Visualisierung wobei wir auch mit Karten und so je nachdem mal<br />
gearbeitet haben aber so ähm extrem wie es jetzt hier is empfinde ich es jetzt<br />
nich weil zum Beispiel der Anzug find ich is schon symbolisch und das äh<br />
drückt ja was aus äh so nee und ähm äh dass is jetzt bei uns weniger und<br />
auch dass die alle in einer Reihe so vor ihm sitzen so wie ne Schulklasse vor<br />
nem Lehrer <br />
Md2: mhm<br />
Md1: ja<br />
Md3: weil wir sitzen stehen ja nich permanent also die andern sitzen im Kreis und<br />
Md2: hmh<br />
Md3: stehen zwischendurch auf um Dinger halt einfach noch mal zu visualisieren<br />
festzuhalten oder darüber dann zu sprechen drauf zu zeigen und so weil dass<br />
n Gespräch äh also ich find ich empfind das als große Hilfe n Gespräch zu<br />
strukturieren und die <strong>Tandem</strong>meinung festhalten<br />
Auch bei der Präsentation der Fotos setzen sich die Moderatorinnen mit ihrer<br />
professionellen Rolle auseinander und bewerten das Medium des Visualisierens, das<br />
Flipchart, explizit positiv. Es ermöglicht ihnen, die „<strong>Tandem</strong>meinung festzuhalten“ und<br />
somit eine Abgrenzung von dem metaphorisch entfalteten Selbstbild eines Lehrers, das ex<br />
negativo ihren positiven Horizont professionellen Umgangs mit den <strong>Tandem</strong>grupen zeigt<br />
(„der Anzug (...) und auch dass die alle in einer Reihe so vor ihm sitzen“). Anzug und<br />
Sitzordnung symbolisieren für sie formalisierte Arbeitsbeziehungen, von denen sie sich<br />
44
abgrenzen. An dem Artefakt Flipchart vereinen sie ihr sonst widersprüchlich kritisiertes<br />
Doppelmandat, einerseits zu strukturieren und andererseits auf die <strong>Tandem</strong>gruppe<br />
einzugehen.<br />
Kennen Sie das, zwei ganz unterschiedlichen Aufgaben gleichzeitig nachzugehen? Oder<br />
das Gefühl zu haben, ihnen nachgehen zu müssen?<br />
Themenschwerpunkt 3: Reaktionen der <strong>Tandem</strong>gruppen und Moderatorinnen auf<br />
Interpretationen der Evaluatorin zum jeweils eigenen Fall<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco reagiert hier auf eine Interpretation der Evaluatorin zum<br />
Beginn der Programmzeit. Sie hatten erzählt, dass Sie sich zunächst an den Vorgaben<br />
orientiert hatten und dann immer mehr eine eigene Kooperationspraxis entwickelt haben.<br />
I: ((Liest Interpretation der Eingangspassage vor.))<br />
Ew2: War das so?<br />
Ew1: Kann man schon so sehen würd ich sagen. Einfach die Notwendigkeit auch<br />
vom Land Rheinlandpfalz<br />
Ew2: Is uns ja vorgegeben worden<br />
ELw3: ( )<br />
LLw3: Das is uns nit<br />
vorgegeben worden<br />
Lw1: Nein die Zusammenarbeit<br />
Ew2: Ja die Zusammenarbeit aber mit KiTa und Schule, die is vorgegeben, schon.<br />
Ew1: Und wir hamm ne Notwendigkeit auch gesehen.<br />
Ew2: Ja<br />
LLw3: Der Zusammenarbeit also es kam mir jetzt so als wenn es so von Außen<br />
aufgedrückt worden wär<br />
Ew2: Mmh das hört sich so an aber ( )<br />
LLw3: Das war es aber nicht das<br />
wollte ich nur klarstellen also ich denke so darf man´s nit sehn<br />
Lw1: Mmh<br />
Lw3: also es kam bei mir eher negativ rüber<br />
Ew2: Ja Ja<br />
45
LLw3: Und das war´s nit<br />
Ew1: Vielleicht sollten ma das anders, kann man das umändern?<br />
( )<br />
I: Jederzeit<br />
Lw2: (vielleicht kann man das umformulieren)<br />
LLw3: Weil es is es war so es waren ja auch Kontakte da und äh diese<br />
Intensivierung dass war uns wichtig und deshalb wollten wa halt auch das<br />
<strong>Tandem</strong> also des war (.) also nicht weil des von Außen also kam. Da hab<br />
ich mich jetzt net wiedergefunden.<br />
Ew1: Lesen sie es noch mal vor bitte.<br />
Die explizite Bewertung der Interpretation „des is auch alles richtig aber der Anfang des is<br />
mir einfach zu negativ oder“ verdeutlicht einen differenzierenden Zugang.<br />
Hier zeigt sich erneut eine Werthaltung, die sich in eigenaktivem und initiativem<br />
Artikulieren von Differenzen zeigt. Sie kommt sowohl auf inhaltlicher als auch auf<br />
diskursorganisatorischer Ebene zum Tragen: Sie bitten – schlussendlich, nach einer<br />
antithetischen Auseinandersetzung, die die Differenzbearbeitung innerhalb der<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe zeigt – die Evaluatorin, den Text so zu ändern, dass sie die Kooperation als<br />
nicht von außen auferlegtes Programm erlebt haben. Somit kritisieren sie implizit die<br />
Interpretation auf der Grundlage ihrer Erfahrung („wie s sich anhört wir ham´s halt<br />
gemacht weil s von außen aufgedrückt wurde und des war s net“).<br />
Dabei bestimmt für diese <strong>Tandem</strong>gruppe der Modus der Artikulation, die Atmosphäre,<br />
ein achtsamer Umgang, den Grad ihrer Akzeptanz („ich hab s auch so empfunden“). 18<br />
18 Fallinterne komparative Analysen zeigen dies bspw. an der Abgrenzung des Bildes, bei dem sich zwei<br />
Kollegen anschreien:<br />
? Na also wenn wir mal soweit sind ( )<br />
Me: └@(.)@<br />
? └dann ist alles zu spät<br />
Me: @(3)@<br />
? Nicht unter Kollegen oder?<br />
Lw3: Oh das würd ich net emal<br />
? Ehrlich<br />
? @(.)@<br />
Lw3: Je nachdem was da aufkommt dass<br />
? Mmh<br />
? Oh nee sie glauben gar nit was es alles gibt.<br />
Me: @(.)@<br />
46
<strong>Tandem</strong>gruppe Paris reagiert hier auf eine Interpretation der Evaluatorin zu einer<br />
Konfliktsituation, die sie im ersten Evaluationsgespräch beschrieben haben.<br />
I: ((Liest Interpretation/Fallbeschreibung zum Umgang mit Konflikten in<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe Paris und ein Transkript vor.)) Wie erleben sie das?<br />
Ew1: Als einen Teilaspekt eines Konflikts (.) das ist ein Konflikt der eigentlich äh<br />
nicht unbedingt stellvertretend für die Zusammenarbeit steht.<br />
Lw1: Das war, so wie du eben sagtest man ist da mit unterschiedlichen<br />
Erwartungen darein gegangen?<br />
Ew1: Genau<br />
Lw1: Wo die Vorstellungen nicht genau formuliert waren.<br />
Ew1: Genau<br />
Lw1: und dadurch kam das dann.<br />
Ew1: Die Situation ist auch schon so gewesen die hab ich auch noch so im<br />
Hinterkopf<br />
Lw1: Das war das Treffen in der Schule<br />
Elw4: Ja, wobei ich auch noch, also ich wollte hier jetzt noch hinzufügen, dass<br />
man zum späteren Zeitpunkt - also erst ihr macht euers wir machen unseres<br />
aber dass man dann zu nem späteren Zeitpunkt wieder zusammen kommt<br />
Ew3: ( )<br />
Ew2: ( )<br />
Ew1: Das war aber bei dem zweiten Schritt der war noch nicht absehbar?<br />
Lw1: mhmhm (=nein)<br />
Ew1: Also für mich,<br />
ELw4: mmmh. ne,<br />
Lw1: Für mich schon<br />
Lw2: Also für war das net so klar<br />
ELw4: Das war das was ich im Hinterkopf hatte<br />
Lw2: Ja ich auch (.) also<br />
wirklich <br />
Lw1: Zu dem<br />
Zeitpunkt war das aber noch net so. sondern wir hatten schon<br />
47
Lw2: Aber wir hatten schon (?)<br />
Lw1: unsere Vorstellungen zur AG formuliert das war das Treffen in der Schule<br />
ne?<br />
Ew1: Genau,<br />
Lw1: Da hattet ihr eure Vorstellungen dass ihr das so frei haben wollt<br />
und von der Schule so mehr von der Schule übergestülpt werden sollte aber<br />
es musste mehr kontrollierbar sein und äh und net ganz so frei man kann<br />
das net so laufen lassen da kam es schon zu ner sehr regen Diskussion und<br />
dann habt ihr aber nochmal genauer erklärt wie ihr euch das vorstellt. (.) und<br />
dass ihr schon eingreift wenn ihr merkt es läuft nicht und nicht einfach alles<br />
laufen lasst und nicht wir haben so angefangen jetzt läufts so weiter sondern<br />
so gesagt habt (.) dass ihr beobachtet das ja und könnt schon eingreifen.<br />
Und dann kam man erst nach ner längeren Zeit zu dieser Entscheidung<br />
Lw2: Es war ja auch klar es ist ein Versuch.<br />
Auf expliziter Ebene wird der in den Interpretationen aufgegriffene Konflikt auf unklare<br />
Absprachen zurückgeführt („Teilaspekt“, „mit unterschiedlichen Erwartungen“,<br />
„Vorstellungen nich genau formuliert“) und darin die positive Bewertung effektiv-<br />
effizienter Zusammenarbeit – ex negativo – zum Ausdruck gebracht. Diese positive<br />
Bewertung einer Zusammenarbeit, die von eindeutigen und klaren Absprachen und<br />
Konfliktlösungen geprägt ist, wird implizit ihrer Alltagserfahrung der Konfliktbearbeitung<br />
bzw. der Interpretation, dass Konflikte ungelöst bleiben, gegenübergestellt: „die Situation<br />
is auch schon so gewesen das hab ich noch im Hinterkopf“. Diese Bestätigung scheint<br />
heikel zu sein („ist auch schon so gewesen“) und führt ad hoc in eine neue kontroverse<br />
Auseinandersetzung („nee“; „für mich schon“). Beschrieben wird dann ein länger<br />
andauernder Konflikt zwischen den Institutionen („hattet ihr Eure Vorstellungen dass ihr<br />
des so frei haben wollt“) („nach längerer Zeit zu dieser Entscheidung“), der sich auf<br />
unterschiedliche Beobachtungspraktiken und differente Wünsche und Vorgehensweisen<br />
der Institutionen bezieht, explizit jedoch relativiert wird („der nich unbedingt<br />
stellvertretend für die Kooperation steht“). Darin zeigt sich eine positive Werthaltung<br />
konfliktfreier Zusammenarbeit. Sie führt dazu, dass die beschriebenen Konflikte nur dann<br />
über einen längeren Zeitraum andauern dürfen, wenn sie zu einem erfolgreichen Ende –<br />
das bedeutet hier, einem konsensuellen Fazit – führen („am Ende wieder<br />
48
zusammenkommt“). Es stellt sich jedoch heraus, dass sie – nach wie vor – von<br />
unterschiedlichen Vorstellungen der Institutionen bestimmt sind und müssen – im Sinne<br />
der falleigenen Logik – daher auf expliziter Ebene erneut relativiert als „Versuch“ gerahmt<br />
werden. Dabei geraten Konflikte der Zusammenarbeit, die sich auf institutionelle<br />
Differenzen beziehen, nicht als Element der Zusammenarbeit in den Blick, sondern werden<br />
als Sonderfall und Nebeneffekt gerahmt und somit nicht direkt bearbeitbar („nicht<br />
stellvertretend“).<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe New York reagiert im Folgenden auf eine Rekonstruktion der<br />
Evaluatorin, dass ihre <strong>Tandem</strong>gruppe auf bestimmte Gegebenheiten, den richtigen Rahmen<br />
für bestimmte Themen, achtet.<br />
I: ((liest Transkript und Interpretation/Fallbeschreibung zum richtigen Kontext<br />
für bestimmte Auseinandersetzungen und das dazugehörige Transkript<br />
vor.)) Wie erleben Sie das?<br />
ELw4: Also ich find jetzt interessant die Interpretation et ist klar das die ihnen da<br />
jetzt kommt aber ich finde das interessant da jetzt die Interpretation zu<br />
ziehen also dass wir letztens mal bei der Gruppendiskussion gesagt haben<br />
wir diskutieren nicht jetzt über die @Expertenregel@<br />
Alle: @(.)@<br />
ELw4: dass das jetzt so da steht das hört sich ganz anders an @als das was wir da<br />
gesagt haben@ für mich jetzt ne<br />
Ew1: aber letzten Endes ist es glaube ich äh so dass wenn wir über n Konflikte<br />
sprechen ähm. das wurde ja dann auch erst geklärt als wir zusammen in der<br />
Runde waren <br />
ELw5: Ja<br />
Ew1: und nicht zwischen Tür und Angel sondern eben wirklich in der in der<br />
Gemeinschaft ich glaub schon dass wenn irgendwas ist dass man dann eben<br />
tatsächlich diesen diesen passenden Rahmen dann sucht und das dann nicht<br />
irgendwie an ner unnötigen Stelle macht wo s nicht hinpasst auch wenn das<br />
jetzt in dem einen Punkt an den ich mich jetzt nich erinnere etwas<br />
überinterpretiert war?<br />
49
<strong>Tandem</strong>gruppe New York reagiert auf die Interpretation überrascht und äußert, dass die<br />
Interpretation als „interessant“ empfunden wird. Sie kritisiert, „dass das jetzt so da steht<br />
das hört sich ganz anders an @als das was wir da gesagt haben@“, somit grenzt sich<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe New York direkt explizit von der Interpretation ab, ohne die Autorität der<br />
Evaluatorin infrage zu stellen („die Interpretation et is klar dat die ihnen da jetzt kommt“).<br />
Dennoch wird das Vorgehen der Evaluatorin implizit kritisiert („interessant da jetzt die<br />
Interpretation zu ziehen“). Hier zeigt sich ein Bild für den Status der Interpretationen als<br />
„Schlussziehens“. Somit wird der Evaluatorin zugeschrieben, die Ergebnisse zu<br />
bestimmen. Dies zeigt sich auch in der impliziten Legitimierung bzw. Wiederholung der<br />
Interpretation („diesen diesen passenden Rahmen sucht“). Die Abgrenzung von der<br />
Interpretation erfolgt abgeschwächt („etwas überinterpretiert“) und unklar, wodurch die<br />
Kritik nicht aufzugreifen ist und somit – auch ob der Autoritätszuschreibung („klar das die<br />
ihnen da jetzt kommt“) – nicht zur Diskussion steht („in dem einen Punkt an den ich mich<br />
nich erinnere etwas überinterpretiert“). Die explizite Bewertung der Überinterpretation<br />
steht der impliziten Werthaltung, bei der Autoritäten anerkannt werden, zunächst<br />
widersprüchlich gegenüber.<br />
Sie haben nun drei ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Rekonstruktionen der<br />
Evaluatorin kennengelernt. Wie hört sich das für sie an?<br />
Die Moderatorinnen reagieren in der folgenden Passage auf eine Interpretation der<br />
Evaluatorin, in der sie ihr Abhängigkeitsverhältnis zu den <strong>Tandem</strong>gruppen entfaltet hatten.<br />
I: ((Liest Interpretation/Fallbeschreibung zum Umgang mit Abhängig-<br />
Md2: Joa<br />
keitsgefühlen der Moderatorin von der Bewertung der <strong>Tandem</strong>gruppen und<br />
ein Transkript dazu vor.)) Wie erleben sie das?<br />
Md1: Nee also ne so hab ich unsere Diskussion also nich äh aufgenommen also<br />
so <br />
Md3: mhm<br />
Md1: so hab ich unsere Diskussion nich<br />
aufgenommen dieses extreme selbstkritische ähm äh Ringen nach<br />
Anerkennung ähm äh also so hab ich unsere Diskussion nich aufgefasst (1)<br />
Md2: ((atmet hörbar))<br />
50
Md1: also ich würd ich auch nich sagen dass dass ich um Anerkennung ringe also<br />
das das äh das hat sich jetzt für mich so angehört als wenn wir so sehr<br />
stark selbstkritisch und so und ich mein natürlich sind wir<br />
selbstkritischund das müssen wir müssen uns ja auch immer wieder<br />
hinterfragen aber das äh dass das jetzt so die Ergebnisse der Interpretation<br />
von der letzten Gruppendiskussion sind das überrascht mich dann doch also<br />
das das hätt ich jetzt nich so empfunden<br />
Md3: Ist das jetzt das was du auf der Basis unserer Gespräche? Oder schon mit der<br />
Perspektive der <strong>Tandem</strong>s? Nee ohne?<br />
I: hmhmhm? Wir ham ja thematische Verläufe gemacht ham geguckt welche<br />
Themen sind relevant und wie werden die bearbeitet. jetzt sind wir gerade<br />
erstmal auf der Ebene dass ich einfach die verschiedenen Gruppen<br />
beschreibe aber ich bin ja dankbar wenn du ihr sagt äh<br />
Md2: die Frage is ja wie<br />
definiert man diesen Begriff um Anerkennung ringen wir du es genannt hast<br />
Md3: Frage is nur die ich finde is auch den Begriff Anerkennung ich kann mich<br />
Md1: @<br />
Md2: @<br />
I: @<br />
an das Zitat erinnern dass du genannt hast und ich glaube schon dass es zum<br />
Teil auch darum geht sicherlich will man auch einfach so für das was man<br />
so tut anerkannt werden also das geht mir schon auch so aber das is jetzt<br />
nich mein oberstes Ziel sag ich mal also ich kann da auch durchaus mal<br />
wegfahren und äh denken so ähmhmh h@mh<br />
Md3: des war jetzt heute halt so und äh is jetzt @ super angekommen was du so<br />
gemacht hast und fall dann halt nich direkt ins Leid ja ja aber wenn wenn<br />
ich mir des andere Extrem vorstelle keine Anerkennung dann hätt ich damit<br />
definitiv n Problem<br />
Md1: natürlich des mein ich ja auch<br />
Md2: also äh nee aber wenn man so<br />
Md3: aber es is kein Kämpfen um<br />
Anerkennung <br />
51
Md2: also die erkennen<br />
mich an ähm die akzeptieren mich das is mir in den <strong>Tandem</strong>s eigentlich ähm<br />
hmh in den <strong>Tandem</strong> <strong>Tandem</strong>s noch nich passiert das ich jetzt den Eindruck<br />
hab ich bin hier völlig überflüssig oder die brauchen oder wollen mich nich<br />
Md3: mhm ich<br />
glaub dass das bei dir auch mehr so ne Klimtgeschichte is die dann da so n<br />
bisschen einfließt<br />
Md2: ja da is des mal genau ja<br />
Md3: ja also könnt ich mir vorstellen 19<br />
Anerkennung wird hier zum Gegenstand der Bearbeitung von Abhängigkeitsverhältnissen.<br />
Auf der Grundlage des Transkriptbeispiels elaborieren sie die Bedeutung eines<br />
anerkennenden Verhältnisses zu den <strong>Tandem</strong>s, das sie hier selbstreferentiell bewerten. Es<br />
bleibt bei dem Spannungsverhältnis, nicht um Anerkennung ringen oder kämpfen zu<br />
wollen und dennoch Akzeptanz als Basis der Beziehung zu den <strong>Tandem</strong>gruppen zu<br />
beschreiben.<br />
Sie greifen die Interpretationen somit kritisch auf und bearbeiten entlang der Metapher<br />
Anerkennung eigene Praxiserfahrungen. Die explizite Bewertung, nicht um Anerkennung<br />
ringen zu wollen, steht im Gegensatz zu der impliziten Werthaltung, Akzeptanz als Basis<br />
der Beziehungen zu den <strong>Tandem</strong>gruppen zu erleben. Dieses Spannungsverhältnis bleibt<br />
aufrecht und konstituiert somit die eigene professionelle Logik bzw. wird durch eine<br />
Transposition verschoben und somit unbearbeitbar gemacht („so ne Klimtgeschichte“).<br />
Deshalb ist eine fallinterne komparative Analyse sinnvoll. Hierzu wird eine Reaktion<br />
der Moderatorinnen auf die Interpretation der Evaluatorin analysiert, in der erzählt wird,<br />
dass sie Konflikte als etwas erleben, das primär außerhalb der Moderationssituation<br />
stattfindet:<br />
I: ((Liest Interpretation/Fallbeschreibung zu Konfliktmodi der Moderatorinnen<br />
vor)) Wie erleben sie das?<br />
Md1: da stellen sich für mich damit ganz viele Fragen<br />
19 Es werden nur Ausschnitte des Transkripts vorgelesen, je nach (unruhiger) Atmosphäre wird spontan<br />
gekürzt.<br />
52
I: ja<br />
Md1: Konflikte is n großer Begriff? und dann is die Frage welche Konflikte<br />
haben Platz in der Moderation ((spricht in vorwurfsvollem Ton)) einer<br />
<strong>Tandem</strong>sitzung die durch die Moderatorin begleitet is äh un äh dann würd<br />
ich noch mal unterscheiden organisatorische ähm persönliche ähm<br />
fachliche Konflikte und äh und (.) ich stell mir die Frage? (.) ähm inwieweit<br />
müssen Konflikte äh bis ins letzte ähm bearbeitet werden innerhalb der<br />
Moderation oder is die Mediation dann einfach n Ort? um um diese<br />
Konflikte zu bearbeiten? (8)<br />
Md3: hmh (2) keine Ahnung ehrlich gesagt ((mit<br />
genervtem seufzenden Tonfall)) also ich find das kommt immer auf die<br />
Intensität an also bisher war s zum Beispiel also ich kann nur sagen wie es<br />
war und bisher hatte ich nie den Eindruck jetzt brauchen wir noch n<br />
externen Mediator weil hier äh explodiert s oder also so<br />
Md2: hmh also s war eh so<br />
hatt ich ja auch bei der Gruppendiskussion schon gesagt es gab immer<br />
wieder Konflikte aber das war nie so dass die so massiv waren im Gegenteil<br />
das Gute is ja ähm äh gerade am Anfang wurden viele Konflikte benannt die<br />
es einfach vor der Zusammenarbeit gaben und die dann in der<br />
<strong>Tandem</strong>konstellation angesprochen werden konnten und da überhaupt mal<br />
zum Thema wurden wie mit den Kann Kindern zum Beispiel wie wie geht<br />
man damit um das is ja n Konflikt den die haben ähm ((schluckt)) der dann<br />
dort ähm besprochen werden kann? für den verschiedene Lösungen<br />
entwickelt werden können aber ich seh in der Tat das <strong>Tandem</strong> in den<br />
seltensten Fällen als den Raum indem die Konflikte gelöst werden außer bei<br />
einem wo immer Leitung dabei is weil sonst solche Entscheidungen zu<br />
fällen is Leitungsentscheidung und is die Leitung nich da wie in dem<br />
<strong>Tandem</strong> mit den Kann Kindern da sitzt ja keine Leitungskraft mehr oder<br />
eine punktuell die andere nie und wieder eine auch nie dann kann da keine<br />
Entscheidung gefällt werden sondern was das <strong>Tandem</strong> macht is quasi Ideen<br />
entwickeln Strategien und Lösungen entwickeln die aber jeweils in den<br />
Einrichtungen mit den Leitungen abgestimmt werden müssen und dann<br />
kommt man wieder zusammen und spricht darüber ähm was sie halt im<br />
53
<strong>Tandem</strong> haben is eben Zeit und Raum darüber zu diskutieren und<br />
verschiedene Lösungen zu entwickeln aber ähm äh sie können nich<br />
entscheiden wie sie vorgehen das <strong>Tandem</strong> is in den seltensten Fällen äh ähm<br />
eine äh Entscheidungsgremium äh es sei denn is eben so wie bei dem<br />
anderen halt wo quasi sowieso schon das ganze Lehrerkollegium da sitzt<br />
und auch fast alle Erzieherinnen und wo Leitung dann immer da is weil die<br />
Leitungsfunktion is immer ne ganz wichtige und dann kommt s immer drauf<br />
an was sin s für Konflikte wenn es zum Beispiel so n Konflikt is wie<br />
Aktionstag ähm (.) äh die Eltern solln äh gefra= oder Eltern solln jeweils in<br />
den Einrichtungen befragt werden wer kann Stände organisieren und eine<br />
Einrichtungen verpennt das einfach fragt ihre Eltern nich und deswegen sin<br />
nur zehn Eltern da statt<br />
Md2: mhm<br />
Md3: un sie brauchen dringend noch zehn dann is das<br />
schon mal n Konflikt weil man sagt Mensch Leute ihr habt s vergessen was<br />
mache n wa denn jetzt? das is dann was das is im <strong>Tandem</strong> entstanden und<br />
wird dann auch im <strong>Tandem</strong> in der Gruppe gelöst aber das is n Problem das<br />
würd ich jetzt noch nich als Konflikt bezeichnen<br />
Konflikt und Anerkennung werden zunächst als Begriffe, d.h. auf einer relativ abstrakten<br />
Ebene aufgegriffen und daran implizit die eigene Rolle problematisiert.<br />
Die Frage des Ortes wird selbstreferentiell aufgegriffen und somit das eigene<br />
professionelles Vorgehen implizit legitimiert (wie beim Thema Anerkennung auch). Hier<br />
wird auf diskursorganisatorischer und auf inhaltlicher Ebene eine Abgrenzung von der<br />
Interpretation durch eine distanzierend-reflektierende Haltung eingenommen, die eine<br />
implizite Bearbeitung der Frage, ob sie alles richtig machen, erlaubt. Implizite Zweifel<br />
werden auf einer theoretisierend abstrakter Ebene bearbeitet, die eine Verknüpfung von<br />
Erwartungshorizonten und Erfahrungspraxis durch die Bearbeitung der Erwartungs-<br />
horizonte auf reflexiver Ebene entsprechend der falleigenen Bewertungslogik verhindert.<br />
Die Differenz zwischen Alltagspraxis und Erwartungshorizont bietet das<br />
Identifikationsangebot.<br />
Die Interpretationen zu den Perspektiven der <strong>Tandem</strong>gruppen werden von den<br />
Moderatorinnen in ihr Gegenteil gewendet: Stellt die Evaluatorin vor, wie die<br />
54
<strong>Tandem</strong>gruppen implizit thematisieren, dass Konflikte in den Sitzungen selten ausgetragen<br />
werden, betonen die Moderatorinnen daraufhin, dass Konflikte in den <strong>Tandem</strong>sitzungen<br />
überhaupt erst zur Sprache kommen könnten. Zu der Frage, wofür die <strong>Tandem</strong>gruppe der<br />
richtige Ort ist, entstehen dann widersprüchlich Beschreibungen: „sie können Lösungen<br />
und Strategien entwickeln“, „aber nich entscheiden wie sie vorgehn.“<br />
Wie erleben Sie das? Wofür ist die <strong>Tandem</strong>gruppe der richtige Ort?<br />
DVD-Präsentation: 20<br />
Ich möchte Ihnen nun zwei Passagen zeigen, die die unterschiedlichen <strong>Tandem</strong>gruppen in<br />
ähnlichen Situationen zeigt. Zu Beginn werden drei Videopassagen zu sehen sein, in denen<br />
die Beteiligten auf die Präsentation des Evaluationsvorhabens reagieren. Darauf folgen<br />
erneut drei Passagen, die die jeweiligen <strong>Tandem</strong>gruppen beim Notieren von Terminen<br />
abbildet. Wir interessieren uns für alles was Sie sehen, was Ihnen auffällt und wichtig<br />
erscheint.<br />
(Präsentation der DVD-Passagen; vgl. Beschreibung des DVD-Inhalts <strong>Anhang</strong>, Kap. 10)<br />
Einordnung in die Programmziele<br />
(Präsentation der PPP-Folie 4)<br />
Dass die Programmziele verbindende Vorhaben neben Professionalisierungsprozessen<br />
nun Organisationsentwicklungsinstrumente entwickeln und etablieren, lässt sich an dem<br />
Ergebnis der „<strong>Tandem</strong>identitäten“ und ihrer fallspezifischen projektalltäglichen<br />
Umsetzung präzisieren. Differenzen zeigen sich nach einer Projektlaufzeit von zwei Jahren<br />
weniger zwischen Erzieherinnen und Lehrerinnen als zwischen den verschiedenen<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen. Ihnen ist es somit gelungen, zu falleigenen „Organisationseinheiten“ zu<br />
werden, die sich in ihrem Modus Operandi der Programmumsetzung voneinander<br />
unterscheiden.<br />
20 Der Einsatz von Videopassagen in responsiven Evaluationsgesprächen stellt Evaluator/innen vor die<br />
Herausforderung, datenschutzrechtliche Bedingungen zu klären und zu berücksichtigen. In der hier<br />
vorgestellten Studie haben die Mitglieder der <strong>Tandem</strong>gruppen und die Auftraggeber das Material zu<br />
Lehrzwecken autorisiert, sodass ich die DVD in den Evaluationsgesprächen einsetzen konnte.<br />
55
Ausblick<br />
Wunsch nach Kopien – es wird einen Abschlussbericht geben, den dann die DKJS<br />
bekommt und sicher als Dank für Ihre Mitarbeit an Sie weitergeben wird. Ferner hoffe ich,<br />
dass die Gespräche Sie inspiriert haben, andere neue Perspektiven auf die eigene Praxis<br />
einzunehmen und Sie auf neue alternative Evaluationsmethoden neugierig gemacht haben.<br />
56
9. Raumskizzen der <strong>Tandem</strong>gruppensitzungen und<br />
Evaluationsgespräche<br />
Die im Folgenden dargestellten Raumskizzen vermitteln einen ersten Eindruck der<br />
fallspezifischen räumlichen Gestaltung von <strong>Tandem</strong>sitzungen. Sie basieren auf<br />
Fotogrammen der Räume, auf deren Abbildung hier zu Anonymisierungszwecken<br />
verzichtet wird. Die Anordnung von Tischen sowie die Distanz der Teilnehmer/innen<br />
zueinander erweisen sich als interessante Zugänge zu Bewertungslogiken auf räumlicher<br />
Ebene.<br />
57
<strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco 21 sitzt bei der ersten Evaluationserhebung an einem kleinen<br />
Tisch in ihrem Klassenraum eng beieinander. Die Tische wurden für das<br />
Evaluationsgespräch zusammengestellt. Die Kooperationspraxis wird auf diese Weise<br />
inmitten ihres alltäglichen Professionsfeldes angesiedelt, das von Artefakten der Kinder<br />
und dem Schulalltag geprägt ist 22 .<br />
Die <strong>Tandem</strong>sitzung in Paris findet hingegen in einem Dachzimmer statt, das sonst<br />
offenbar kaum genutzt wird. Die Stühle sind in einem Viereck angeordnet, das eng an<br />
einen Raumpfeiler anschließt und somit die Person, die zwischen dem Raumpfeiler und<br />
den Tischen sitzt, in ihrer Bewegungsfreiheit begrenzt. Die <strong>Tandem</strong>mitglieder sitzen<br />
21 Dieses <strong>Tandem</strong> hat eigenständig und unabhängig von der DKJS-Moderatorin einen Termin für das erste<br />
Evaluationsgespräch vereinbart, daher sind sie – im Gegensatz zu den anderen <strong>Tandem</strong>s – bei der ersten<br />
Begegnung allein mit der Evaluatorin und ihrem Mitarbeiter allein. Auch darin zeigen sich bereits<br />
autonomieorientierte Haltungen der <strong>Tandem</strong>mitglieder.<br />
22 Videopassagen von weiteren <strong>Tandem</strong>gruppensitzungen zeigen sie in einem Raum der Kindertagesstätte,<br />
bei dem ähnliche Raumarrangements als Orte zur alltäglichen Durchführung von Kooperationstreffen<br />
gewählt werden: Wir sitzen auch dort auf kleinen Kinderstühlen um einen Kindertisch in einem<br />
Gruppenraum – nicht im Leitungs- oder Mitarbeiterzimmer – neben einem großen gelben Tuch, das wie<br />
ein Segel gespannt ist und offenbar eine Höhle für die Kinder darstellt.<br />
58
aufgereiht an einer Seite des Tischarrangements und blicken zur Moderatorin. Der Raum<br />
ist von Artefakten geprägt, die unbenutzt bleiben, so bspw. das Kaffeetablett oder der<br />
Flipchart, der sich abseits des Sitzarrangements befindet und somit außerhalb des<br />
Blickfeldes der Beteiligten. Die Kooperationspraxis wird hier in einem unklaren, offen<br />
strukturierten Raum durchgeführt. 23<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe New York veranstaltet die Gruppensitzungen und Evaluationsgespräche im<br />
Lehrerzimmer der Grundschule. Die Leitungskraft einer KiTa sitzt am Kopfende und<br />
zwischen ihr und den Teilnehmerinnen sowie an anderen Stellen rund um den Tisch sind<br />
Stühle zwischen den Beteiligten freigelassen. Die Kooperationspraxis wird hier in einem<br />
Raum der Leitungskräfte der Institution angesiedelt, in dem sich strukturell-<br />
organisatorische Artefakte, wie bspw. eine Pinnwand, auf der wöchentliche Vorhaben bzw.<br />
die Delegation von Aufgaben für alle einsehbar sind, befinden. 24<br />
23 Alle <strong>Tandem</strong>sitzungen und Evaluationsgespräche finden in diesem Raum statt.<br />
24 Auch bei den Treffen in einer Kindertagesstätte treffen wir uns in dem Besprechungsraum der Leitung.<br />
59
Die Moderatorinnen treffen wir zum Evaluationsgespräch in ihrem Büro – und sind<br />
umgeben von ihren Arbeitsmaterialien. Der Raum ist von Artefakten wie Büchern,<br />
Konzeptentwürfen und technischen Arbeitsgeräten geprägt. Sie inszenieren die<br />
<strong>Tandem</strong>begleitung in einem professionell-konzeptuellen Professionsfeld.<br />
60
10. Videointerpretationen<br />
Exemplarische Analyse einer von den <strong>Tandem</strong>mitgliedern fallübergreifend interaktiv<br />
dicht rezipierten Videosequenz – Ansätze zu videobasierten Rekonstruktionen von<br />
Bewertungslogiken 25<br />
Die folgende Interpretation stammt aus den Videopassagen, die den pädagogischen<br />
Akteuren im zweiten responsiven Evaluationsgespräch gezeigt wurden. Die ersten<br />
Passagen zeigen eine Situation, die sich in allen <strong>Tandem</strong>gruppen und bei den<br />
Moderatorinnen strukturidentisch ergeben hat. Videografiert wurde in den vier Gruppen<br />
die Präsentation der Evaluation, d.h. die erste Begegnung der Beteiligten mit der<br />
Evaluatorin, bei der das Vorgehen und die Methoden vorgestellt wurden. Diese<br />
Videopassage stellt die Eingangssequenz des Gesamtprodukts in allen vier Gruppen dar.<br />
Wie in den Videopassagen deutlich wird, beziehen sich alle <strong>Tandem</strong>gruppen 26 in<br />
spezifischer Weise auf die Evaluatorin und ihre Kamera: Als geladenen Gast<br />
(<strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco), als bedrohliche Neue (<strong>Tandem</strong>gruppe Paris) oder als eine<br />
sich zu behauptende bzw. unterordnende Expertin (<strong>Tandem</strong>gruppe New York). 27 Die<br />
zweite Sequenz zeigt ebenfalls eine Situation, in der strukturidentische Erfahrungsräume<br />
der vier Gruppen zum Tragen kommen. So hat sich die Tatsache, dass alle Beteiligten ihre<br />
Aufmerksamkeit dem Aufschreiben von Terminen oder gemeinsamen Vorhaben widmen,<br />
als gruppentypisches Ereignis herausgestellt: als buntes Treiben (<strong>Tandem</strong>gruppe San<br />
25 Die Reaktionen der Beteiligten auf die entsprechenden Videopassagen lassen sich durch eine<br />
Relationierung von Zeitangaben der Videopassagen und Gruppendiskussionen nachvollziehen. So kann<br />
festgestellt werden, während welcher Videosequenz die Mitglieder der <strong>Tandem</strong>gruppen ihre Erzählungen<br />
entfalten und welche Alltagsbezüge sie dabei herstellen.<br />
26 Da sich die Moderatorinnen auf die Passagen mit den <strong>Tandem</strong>gruppen bezogen haben, werden sie für die<br />
Analysen ihrer Bewertungslogiken weiterverfolgt. Sie eröffnen ihnen einen Zugang zu impliziten<br />
Interaktionsordnungen zwischen ihnen und den <strong>Tandem</strong>gruppen, der für sie offenbar relevanter als die<br />
Passagen ist, in denen sie allein mit der Evaluatorin zu sehen sind.<br />
27 Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt keine Darstellung der detaillierten Videoanalysen, da – ähnlich wie bei<br />
den Fotos – das vorrangige Erkenntnisinteresse auf der Rezeption von Videopassagen durch die<br />
Beforschten liegt.<br />
61
Francisco), als durch die Moderatorin am Flipchart geordneter Vorgang (<strong>Tandem</strong>gruppe<br />
Paris), als durch Leitungskräfte überprüfte Leistung (<strong>Tandem</strong>gruppe New York).<br />
Die drei Passagen von zwei strukturidentischen Situationen heben hervor, wie<br />
unterschiedlich die Beteiligten in ihren körperlich-gestischen Bezugnahmen auf die<br />
Evaluatorin aber auch in der Situation des Aufschreibens (inter-)agieren.<br />
Sie führen exemplarisch vor Augen, wie Sprechakte zu Aufführungen werden, die<br />
interaktiv, körperlich, räumlich und atmosphärisch inszeniert sind (vgl. Fischer-Lichte<br />
2004). Dabei hat es sich als hilfreich herausgestellt, auf non-verbale körperliche<br />
Bewegungen zu achten, die die verbalen Äußerungen rahmen, irritieren und erweitern. Sie<br />
werden im Folgenden als Gesten in den Blick genommen. Birgit Althans hebt in ihrer<br />
diskursanalytischen Untersuchung methodologischer Zugänge zu Gesten unter Rückgriff<br />
auf Pierre Bourdieu hervor, dass das pädagogische Interesse an der Untersuchung von<br />
körperlichen Dimensionen des Sprechens darin liegt,<br />
„wie und in welchen Kontexten der Erziehung und Sozialisation die „stille Pädagogik“ zum Tragen<br />
kommt (Bourdieu 1987). Bourdieu beschreibt unter diesem Begriff, den er immer wieder aufgriff<br />
(Bourdieu 1987, 2001), das in Lehr-Lernsituationen ritualisierte Zusammenwirken von verbalen und<br />
non-verbalen Gesten, die körperlich so habitualisiert werden, dass sie in ihrem Ablauf nur schwer<br />
durchbrochen werden können – (...) Des Weiteren wird die These vertreten, dass die so aufgespürten<br />
„pädagogischen“ Gesten (...) erst in ihren Irritationen – erst als ‚Unterbrechung von Abläufen’<br />
sichtbar werden, in Erscheinung treten. Kurz: (...) ob Lernvorgänge als ‚responsive Akte’ nicht erst<br />
in der stockenden Geste sichtbar werden.“ (Althans 2011: 253)<br />
Ähnliche Beobachtungen wurden in den Moderationssitzungen gemacht. So erwiesen sich<br />
Gesten als vieldeutige Hinweise auf Bewertungslogiken: Die Beteiligten bezogen sich etwa<br />
auf das Zurücklehnen eines Schulleiters oder den gestreckten Zeigefinger einer KiTa-<br />
Leiterin ganz unterschiedlich. Besonders die unerwarteten Reaktionen, die innerhalb der<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen zu stockenden, unterbrechenden Momenten des Ablaufes führten, wie<br />
etwa das den Blickkontakt untermalende gemeinsame Stirnrunzeln zweier Erzieherinnen<br />
als Reaktion auf die Präsentation der Evaluation, pointieren soziale Gesten als<br />
konstituierende Medien von Sprechakten und Hinweise auf Bewertungslogiken der<br />
Beteiligten. Der Blick auf das Filmmaterial eröffnet bei der Untersuchung von<br />
tandemspezifischen Gesten eine differenzierte Sichtweise auf das Zusammenwirken von<br />
Sprache, Körper und Raum. „In Gesten drücken sich soziale Beziehungen und Emotionen<br />
62
aus, die oft weder denen bewusst sind, die sie vollziehen, noch ins Bewusstsein derer<br />
gelangen, die sie wahrnehmen und auf sie reagieren“ (Wulf 2010: 7).<br />
Während es sich für rekonstruktiv-responsive Evaluationsstudien bewährt hat, in<br />
teilnehmenden Beobachtungen den organisationsspezifischen Gebrauch von Artefakten als<br />
Bezugspunkt für Rekonstruktionen von Bewertungslogiken heranzuziehen, eröffnen<br />
Videoanalysen Zugänge zu sozialen Artikulationen von Bewertungslogiken – wie Gesten<br />
oder Rituale – in ihrer simultan-sequenziellen Struktur (vgl. Wagner-Willi 2004).<br />
Entsprechend dem responsiven Erkenntnisinteresse an den Relevanzsystemen der<br />
Beteiligten wird im Folgenden eine Passage exemplarisch interpretiert, auf deren<br />
Präsentation die <strong>Tandem</strong>mitglieder im zweiten Evaluationsgespräch Bezug nehmen. 28<br />
Die Selektion der Videopassagen erfolgt in rekonstruktiv-responsiven Evaluationen<br />
somit einerseits entlang der Rezeption der pädagogischen Akteure und andererseits entlang<br />
der Rekonstruktion von Fokussierungsakten (vgl. Nentwig-Gesemann 2002). Die geteilten<br />
bzw. interaktiv hergestellten Gesten eignen sich hierbei zur Untersuchung der poietischen<br />
und praktischen Artikulation von Bewertungslogiken der <strong>Tandem</strong>gruppen.<br />
„Gesten sind mehr als die Verwirklichung von Intentionen. Dieses ‚Mehr‘ besteht u.a. in der Art und<br />
Weise, in der Handelnde Gesten gebrauchen und mit ihnen Ziele zu realisieren versuchen. (...) Der<br />
Charakter und die Qualität sozialer Beziehungen hängen davon ab, welche Gesten Menschen<br />
entwickeln, wie sie Gesten einsetzen, welche körperlichen Abstände sie einhalten und welche<br />
Körperhaltungen sie entwickeln.“ (Wulf 2010: 17)<br />
Demzufolge ist es für Evaluationsstudien entscheidend, sich auf den Gebrauch der<br />
bewertenden Gesten im Hinblick auf deren alltagspraktische Relevanz sowie auf deren<br />
innovatives Potential zu konzentrieren. 29<br />
28 Dies lässt sich über die Zeitangaben des präsentierten Films in Relation zu den Zeitangaben der<br />
Gruppendiskussionen der Evaluationsgespräche identifizieren.<br />
29 Die Kritik von Amelie Klambeck aufgreifend, werden dabei verbale und non-verbale Aspekte des<br />
Sprechens nicht isoliert voneinander rekonstruiert (vgl. Klambeck 2007). Diese Kritik wird auch von<br />
Monika Wagner-Willi unter methodologischen Gesichtspunkten plausibel, die das alltägliche<br />
Zusammenspiel von verbalen und non-verbalen Aspekten des Interagierens in ihrer Reziprozität<br />
praxistheoretisch begründet (vgl. Wagner-Willi 2010).<br />
63
Explorationen einer videobasierten Interpretation von tandemspezifischen Gesten als<br />
Bewertungslogiken<br />
Eine typische Situation für die <strong>Tandem</strong>sitzungen sind die Phasen der<br />
Terminvereinbarungen, mit denen sowohl organisatorische als auch inhaltliche Fragen der<br />
Kooperation verbunden sind (vgl. Kap. 2.4). Sie lassen sich insofern als Fokussierungsakte<br />
untersuchen, als sie sich auf der körperlich-gestisch und mimischen Ebene als prekäre,<br />
aufgeregte und überspitzte Gruppensituationen herausstellen, in denen sich die Beteiligten<br />
ihrer Relevanzsysteme versichern, ohne diese metakommunikativ aufzugreifen: Weniger<br />
das Sprechen als die damit verbundenen Gesten und die Mimik konstituieren dabei die<br />
tandemspezifischen Vereinbarungsbewegungen und -rhythmen (vgl. Tervooren 2001).<br />
Abtauchen – eine tandemspezifische Geste ambivalent-autoritätsbezogener<br />
Kooperationsmodi<br />
In <strong>Tandem</strong>gruppe New York 30 gestalten sich diese Situationen entlang einer ambivalenten<br />
Aufführung von Autorität der dem Tisch vorsitzenden Leitungskräfte, zwei Kita- und<br />
einem Schulleiter und den beteiligten fünf Erzieherinnen und einer Lehrerin. 31<br />
Mit hochgezogenen Schultern und eingezogenem Kopf blickt die KiTa-Leiterin 32 auf die<br />
Frage einer Erzieherin, ob der Termin des Elternabends noch festzulegen sei, zu dem<br />
Schulleiter, der am anderen Ende des Tisches (vor-)sitzt. Sie blicken einander an und<br />
bestimmen mit einer abwinkenden (Hand-)Geste, dass nun eigentlich nicht die Zeit sei, den<br />
nächsten Termin dafür festzulegen. In ihre Blickkontaktlinie gerät jedoch zeitgleich der<br />
Finger und Arm einer Erzieherin, die sich mit schlangenähnlichen Bewegung meldet.<br />
Beide richten sich körperlich auf und holen beinahe synchron Luft, die ihre Oberkörper<br />
erweitert. Der Schulleiter legt den Kopf zur Seite: Ja? Die Erzieherin schaut niemanden in<br />
der Runde an, sondern blickt in die Richtung ihrer Sitznachbarin. Diese nickt ihr – sie<br />
anblickend – zu und schließt dabei zustimmend, erneut nickend, die Augen. Daraufhin sagt<br />
sie mit gebrochener Stimme, dass der Termin für den Elternabend nun aber doch festgelegt<br />
30 Ikonographische Interpretationen werden im Folgenden von vor-ikonographischen Deskriptionen durch<br />
einen Unterstrich gekennzeichnet.<br />
31 Zur Interpretation der Zusammensetzung der <strong>Tandem</strong>s vgl. 2.7; <strong>Anhang</strong> Kap. 11).<br />
32 Entsprechend dem Erkenntnisinteresse an organisationstheoretischen Zusammenhängen in der<br />
<strong>Tandem</strong>gruppenarbeit werden die Teilnehmer/innen mit ihren professionellen Zugehörigkeiten/Funktionen<br />
benannt.<br />
64
werden müsse und wendet im gleichen Moment ihren Oberkörper von der Gruppe ab und<br />
nur ihrer Sitznachbarin zu, als spräche sie zu ihr oder als suche sie ihren Schutz. Die<br />
Leitungskräfte schauen sich mit einem Stirnrunzeln an und verschränken kurz darauf beide<br />
die Arme vor dem Oberkörper. Zeitgleich gehen die Blicke von zwei anderen Erzieher-<br />
innen und einer Lehrerin regungslos, die Luft anhaltend, aus der Gruppe heraus: In die<br />
Luft, an die gegenüber liegende Wand oder sie betrachten die gestreckten Finger der<br />
eigenen Händen. Die zurückgenommenen Körper, die Blicke in die Luft wirken wie ein<br />
Abtauchen, das als Folge der Äußerung von der Erzieherin scheint. Überraschenderweise<br />
drehen auch die beiden Leitungskräfte daraufhin ihre Körper aus dem Kreis und schauen<br />
zur Seite bzw. auf den Boden, als würden sie mit abtauchen. Noch dreißig Sekunden<br />
scheint die Zeit stillzustehen, bis schließlich eine KiTa-Leiterin, die bis dahin in ihren<br />
Kalender schaute, sagt, man wolle jetzt ja nichts für alle vorgeben, aber lege nun den 21.<br />
fest.<br />
In dieser Szene führen die Leitungskräfte und die Mitglieder der <strong>Tandem</strong>gruppe ihren<br />
Umgang mit Autorität auf. Der Impuls der Erzieherin, auf die Notwendigkeit einer<br />
Terminentscheidung hinzuweisen, wird von einer Leitungskraft ambivalent aufgegriffen.<br />
Ihre Körpersprache zeigt gegensätzliche Gesten: In sich zusammengesunken und mit<br />
eingezogenem Kopf wertet sie das Anliegen der Erzieherin durch ein – mit dem Schulleiter<br />
synchron erfolgendes Abwinken – ab. Das Stocken und das betretene Schweigen, das auf<br />
ihr Stirnrunzeln folgen, zeigt die „stille Pädagogik“: Eigentlich entscheiden sie, wann<br />
etwas wie im Rahmen der Kooperation anzusprechen und zu regeln ist. Doch bereits ihre<br />
simultan artikulierte Unterordnung, die in ihrer Körperhaltung zum Ausdruck gebracht<br />
wird, zeigt die unentschiedene Autoritätshaltung. Hier wird ausgehandelt, wie Leitungen<br />
und Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen Entscheidungen treffen. Im Moment der<br />
Entscheidung gehen alle Beteiligten körperlich aus der Situation, wenden sich ab, schauen<br />
aus dem Kreis heraus oder schließen Bündnisse mit einem Sitznachbarn.<br />
Bewertungslogiken dieser <strong>Tandem</strong>gruppe beinhalten eine körperlich-atmosphärisch<br />
nachvollziehbare Ambivalenz: Autorität anzurufen, indem sie unterlaufen wird. Sie zeigt<br />
sich in uneindeutigen Bewegungen und Körperhaltungen der Beteiligten, die die<br />
Aushandlung von Entscheidungsmacht konstituieren.<br />
Das potentielle Infragestellen dieser Ordnung wird zu einem Fokussierungsakt, in dem<br />
sich die Beteiligten simultan und sequenziell ihrer ambivalenten Haltung zu<br />
autoritätsbezogenen Entscheidungskulturen überspitzt vergewissern und sie somit erneut<br />
65
etablieren. Die verbale Interaktion, den Termin festzulegen, unterbricht den non-verbalen<br />
Interaktionsfluss und stellt die ihre auf diese Weise institutionalisierte Rollenordnung<br />
wieder her. Es zeigen sich divergente Elemente von Fokussierungsakten<br />
autoritätsbezogener Ordnungen.<br />
66
11. Sozialdaten der Teilnehmer/innen<br />
Die im Folgenden tabellarisch angeführten Informationen entstammen einer Fragebogenerhebung:<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco<br />
Alter 55 46 40 26 56<br />
Geschlecht W W W W W<br />
(Berufliche)<br />
Ausbildung<br />
(Leitungs-)Position in<br />
der KiTa oder Schule<br />
Tätigkeitsfeld in der<br />
KiTa oder Schule<br />
Beschäftigt an<br />
KiTa/Schule seit<br />
Erzieherin Förderschullehrerin Fachwirtin in Organisation<br />
und Führung<br />
Lehrerin Lehrerin<br />
Gruppenleitung Standortleitung der KiTa Klassenlehrerin Schulleitung<br />
Arbeit in der Gruppe Förderung von Schülern<br />
im Rahmen der<br />
integrierten Förderung<br />
Erzieherin Klassenlehrerin, <strong>Tandem</strong>,<br />
Fachberatung, Deutsch,<br />
Verkehrsobfrau<br />
Schulleitung<br />
1995 2008/2009 1 Jahr Februar 2008 6 Jahren<br />
67
Tätig als Lehrer/in<br />
oder Erzieher/in seit<br />
Vollzeit oder Teilzeit<br />
beschäftigt und andere<br />
(beruflichen/ehrenamt-<br />
lichen) Tätigkeiten<br />
Nimmt teil an<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe und an<br />
Moderation seit<br />
Was finden Sie<br />
besonders positiv an<br />
der Moderation und an<br />
den <strong>Tandem</strong>gruppen?<br />
1997 16 Jahren 3 Jahren 28 Jahren<br />
Teilzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit, Ehrenamt bei<br />
Nestwärme, Fortbildung<br />
Deutsch als Fremdsprache,<br />
Weiterbildung Musik in<br />
der Grundschule<br />
Seit 1997 Lektorin in<br />
der Kirche<br />
2,5 Jahren 1 Jahr 2008/2009 1 Jahr Februar 2008 2,5 Jahren<br />
Neutraler Blick,<br />
Hilfestellung in<br />
schwierigen Situationen,<br />
sympathisch, fachlich sehr<br />
kompetente Moderatorin<br />
Das Aufzeigen eines<br />
äußeren möglichen<br />
Rahmens, an denen sich<br />
Ziele/Projekte orientieren<br />
können. Das Umsetzen<br />
verhältnismäßig objektiver<br />
Standpunkt der<br />
Moderatorin<br />
Moderation: Neutrales<br />
Verhalten Blick von<br />
außen, Vorschläge<br />
vermitteln<br />
<strong>Tandem</strong>: Die<br />
Zusammenarbeit mit der<br />
GS, näheres<br />
Kennenlernen,<br />
gemeinsamer Blick aufs<br />
Kind<br />
Strukturierung,<br />
Zusammenfassung der<br />
Ergebnisse, neutraler Blick<br />
auf beide Institutionen<br />
Der Blick von außen<br />
auf die Probleme,<br />
neutrale Führung<br />
68
Welche Kritik haben<br />
Sie?<br />
Wirkung der<br />
Moderation im<br />
Verhältnis zu anderen<br />
Methoden, mit denen<br />
man arbeitet oder<br />
kennt<br />
Wunsch, was sich<br />
ändern sollte<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe Paris<br />
Zeitmangel Begrenzung auf 3 Jahre,<br />
die Verschiedenheit der<br />
Institutionen (dass auch<br />
die Verschiedenheit<br />
bleibt!)<br />
Sehr positiv Unterstützend, hilfreich,<br />
Konkretere<br />
Gesprächsführung<br />
gibt Sicherheit<br />
Dass regelmäßig Protokoll<br />
geführt wird<br />
Zeitaufwand Begrenzung auf 3<br />
Jahre<br />
Strukturierend, positiv Gut<br />
Alter 43 50 50 28 42 49 21<br />
Geschlecht W W W W W W W<br />
(Berufliche)<br />
Ausbildung<br />
Erzieherin Soz. Fachwirt Kinderpflegerin Grund- und<br />
Hauptschullehrerin<br />
Studium LA/Dipl.<br />
Päd.<br />
Studium Lehramt<br />
an GS/HS<br />
Nein<br />
Erzieherin<br />
69
(Leitungs-)<br />
Position in der<br />
KiTa oder<br />
Schule<br />
Tätigkeitsfeld<br />
in der KiTa<br />
oder Schule<br />
Beschäftigt an<br />
KiTa/Schule<br />
seit<br />
Tätig als<br />
Lehrer/in/Er-<br />
zieher/in seit<br />
Vollzeit oder<br />
Teilzeit<br />
beschäftigt und<br />
andere (beruf-<br />
liche/ehren-<br />
amtliche)<br />
Tätigkeiten<br />
Nimmt teil an<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe<br />
Gruppenleitung,<br />
stellvertretende<br />
Leitung<br />
Geöffnete Gruppe<br />
(2-6Jährige)<br />
KiTa-Leitung Mitarbeiterin in<br />
Verwaltung/Lei-<br />
tung, wenig Arbeit<br />
mit Kindern<br />
2001 3 Jahren als<br />
1986 mit 6,5<br />
Jahren<br />
Unterbrechung<br />
Elternzeit<br />
Leitung<br />
einer Regelgruppe<br />
(3-5jährige)<br />
(nur)<br />
Klassenlehrerin<br />
Klasse 1<br />
Lehrerin Lehrerin<br />
Personalrat<br />
Mitarbeiterin in<br />
Sinus- Beauftragte Unterricht Lehrerin Bildung,<br />
einer Regelgruppe<br />
Betreuung,<br />
Erziehung von<br />
Kindern im Alter<br />
zw. 3-6 Jahren<br />
1987 2007 1997 1995 1.8.2007<br />
17 Jahren 1987 2006 1995 1983 3.8.2008<br />
Teilzeit Vollzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit,<br />
Pfarrgemeinde:<br />
Kinderkirche,<br />
Jugendtreff<br />
Vollzeit<br />
Seit Beginn 3 Jahren 3 Jahren 2007 Von Anfang an 2006 (3Jahre) Herbst 2007<br />
70
und an<br />
Moderation seit<br />
Was finden Sie<br />
besonders<br />
positiv an der<br />
Moderation<br />
und an den<br />
<strong>Tandem</strong>-<br />
gruppen?<br />
Struktur die<br />
Moderator schafft,<br />
regelmäßiger<br />
Austausch,<br />
kennenlernen der<br />
Kollegen, der<br />
Schule,<br />
kennenlernen des<br />
schulischen Lernen<br />
(? Lernen,<br />
Selbstständigkeit),<br />
Es entwickelt sich<br />
eine<br />
Zusammenarbeit<br />
auf Augenhöhe,<br />
Übergang KiTa-<br />
Schule ist auch für<br />
Erzieher<br />
überschaubarer<br />
geworden (man<br />
bekommt<br />
Rückmeldung über<br />
Entwicklung der<br />
Der Übergang wird<br />
durch die<br />
Zusammenarbeit<br />
real erleichtert,<br />
Hemmschwellen<br />
zw. Lehrern und<br />
Team der KiTa<br />
wurden abgebaut,<br />
Arbeit effektiver<br />
im Hinblick auf<br />
Kooperation.<br />
Dank an die<br />
Moderation des<br />
<strong>Tandem</strong>s, die uns<br />
immer wieder<br />
gesammelt und auf<br />
den Punkt<br />
gebracht.<br />
Regelmäßiger<br />
Austausch, klare<br />
Zielvereinbarunge<br />
n und der<br />
Umsetzung dieser,<br />
Kennenlernen der<br />
Arbeitsweise bzw.<br />
Methode der<br />
Schule<br />
Atmosphäre, gute<br />
Absprachen,<br />
nimmt Stimmung<br />
wahr, immer<br />
objektiv<br />
Moderation:<br />
zuhören können,<br />
auf den Punkt<br />
bringen,<br />
Zuverlässigkeit,<br />
Zwischentöne<br />
heraushören<br />
<strong>Tandem</strong>s: mehr<br />
päd.<br />
Zusammenarbeit,<br />
mehr gegenseitige<br />
Wertschätzung,<br />
Strukturiertes<br />
arbeiten<br />
„Nachhaltigkeit“<br />
Setzt Impulse, hat<br />
erheblich zur<br />
Zusammenarbeit<br />
zwischen KiTa<br />
und GS<br />
beigetragen<br />
Diskussion konkret<br />
zusammenfassen,<br />
Denkanstöße<br />
geben, den<br />
Blickwinkel des<br />
Gegenübers<br />
beleuchten,<br />
verständlich<br />
machen,<br />
Gemeinsamkeiten<br />
der Institutionen<br />
aus Gesprächen<br />
filtern und<br />
herausstellen,<br />
Terminabsprachen<br />
vorantreiben,<br />
Absprachen<br />
verbindlich machen<br />
71
Kritische<br />
Beurteilung<br />
Wirkung der<br />
Moderation im<br />
Verhältnis zu<br />
anderen<br />
Methoden, mit<br />
denen man<br />
arbeitet oder<br />
kennt<br />
Kinder) tauscht<br />
sich über Probleme<br />
von Kindern aus,<br />
aber auch über<br />
Fortschritte usw.<br />
Keine Kritik Für Schulleitung<br />
Die Moderation<br />
wirkt auf mich<br />
offener,<br />
strukturiert nur<br />
grob, fasst<br />
Ergebnisse<br />
zusammen, führt<br />
durch den<br />
wie KiTa-Leitung<br />
müsste die<br />
Teilnahme<br />
verbindlich sein<br />
oder andere<br />
Teammitglieder<br />
bzw. Lehrer<br />
müssten eigen-<br />
verantwortlich<br />
entscheiden<br />
können.<br />
Die Moderation<br />
von außen schafft<br />
Vorteile, da die<br />
Moderation nicht<br />
in den päd. Alltag<br />
involviert ist. Die<br />
Methodenvielfalt<br />
ist größer.<br />
Sehr strukturiert,<br />
ergebnisorientiert<br />
Zeitlicher Umfang<br />
(3std. zu lang),<br />
teilweise Unterton<br />
etwas negativ<br />
Sehr locker,<br />
dennoch<br />
zielführend, gut:<br />
Dokumentation<br />
Qualifiziert,<br />
strukturiert,<br />
einfühlend, Leider<br />
kenne ich wenige<br />
„Arten“ von<br />
Moderation, mit<br />
denen ich<br />
vergleichen<br />
Workshops an der<br />
Uni haben oft<br />
nicht den<br />
Erwartungen<br />
entsprochen<br />
Die Moderation<br />
zieht sich aus dem<br />
Geschehen<br />
heraus/nimmt<br />
passiv teil<br />
72
Wunsch, was<br />
sich ändern<br />
sollte<br />
Nachmittag, gibt<br />
aber kein<br />
Programm vor, wie<br />
23 Fortbildner, die<br />
best. Themen<br />
bearbeitet haben<br />
wollen/müssen.<br />
Moderation<br />
arbeitet auf<br />
Selbstständigkeit<br />
hin.<br />
Mein konkreter<br />
Wunsch an die<br />
KollegInnen wäre<br />
noch mit mehr<br />
Verbindlichkeit<br />
(Terminabsprachen<br />
/sich engagieren,<br />
wirklich<br />
Zusammenarbeit<br />
wollen) an <strong>Tandem</strong><br />
heranzugehen<br />
In der<br />
Zusammenarbeit<br />
sollte noch mehr<br />
Austausch<br />
stattfinden. Auch<br />
Probleme?<br />
einander müssten<br />
konkret behandelt<br />
werden.<br />
könnte<br />
Nein Gerne auch mal<br />
Vorschläge der<br />
Moderatorin<br />
einbringen<br />
Konkreter<br />
Austausch mit<br />
anderen <strong>Tandem</strong>s<br />
73
<strong>Tandem</strong>gruppe New York<br />
Alter 44 37 35 49 26 45 38<br />
Geschlecht M W W W W W W<br />
(Berufliche)<br />
Ausbildung<br />
(Leitungs-)<br />
Position in der<br />
KiTa oder<br />
Schule<br />
Tätigkeitsfeld<br />
in der KiTa<br />
oder Schule<br />
Grundschullehrer Erzieherin Erzieherin,<br />
Theaterpädagogin<br />
Erzieherin Erzieherin Rechtsanwaltsfa<br />
changestellte,<br />
Erzieherin,<br />
Ökologie<br />
Fernstudium<br />
Lehrerin<br />
Konrektor Gruppenleiterin Leitung einer KiTa KiTa Gruppenleiterin Gruppenleiterin KiTa-Leiterin Lehrerin/Klassen-<br />
Alles Arbeit in der<br />
Kindergruppe,<br />
Bürotätigkeiten,<br />
Anmeldegesprä-<br />
che, Dienstpläne,<br />
Teilnahme an<br />
verschiedenen<br />
Sitzungen<br />
Gruppenleitung, päd.<br />
Arbeit mit Kindern,<br />
<strong>Tandem</strong>arbeit, BVE(?)<br />
lehrerin<br />
Alles Leiterin Alle Fächer<br />
Beschäftigt an 1992 1.3.2006 1995 2005 9 Jahren 10 Jahren<br />
74
KiTa/Schule<br />
seit<br />
Tätig als<br />
Lehrer/in/Erzie<br />
her/in seit<br />
Vollzeit oder<br />
Teilzeit<br />
beschäftigt und<br />
andere<br />
(beruflichen/eh<br />
renamtlichen)<br />
Tätigkeiten<br />
Nimmt teil an<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe<br />
und an<br />
Moderation seit<br />
Was finden Sie<br />
besonders<br />
positiv an der<br />
Moderation<br />
und an den<br />
<strong>Tandem</strong>-<br />
gruppen?<br />
15 Jahren 1991 13 Jahren 1995 2005 12 Jahren 15 Jahren<br />
Vollzeit,<br />
Fortbildungs-<br />
Referent/Dozent,<br />
Trainer<br />
(?Leichtathletik)<br />
Seit Beginn (seit 2<br />
Monaten nicht<br />
mehr)<br />
Moderation:<br />
Offenheit,<br />
Objektivität,<br />
Professionalität,<br />
Zielorientiert<br />
<strong>Tandem</strong>: dass eine<br />
Gruppe entstanden<br />
ist, die einen<br />
Vollzeit Vollzeit, nebenher:<br />
Seit Beginn<br />
(2006?)<br />
Strukturierung,<br />
Planung und<br />
Durchführung sehr<br />
ergebnisorientiert,<br />
geht auf Wünsche<br />
der<br />
<strong>Tandem</strong>mitglieder<br />
ein, man lernt<br />
Kollegen aus<br />
Studium soziale<br />
Arbeit, diverse<br />
andere Tätigkeiten<br />
in der Gemeinde<br />
(z.B. Chor)<br />
Teilzeit Vollzeit Vollzeit,<br />
1 Jahr 2006 2006 (Von<br />
Die strukturierte<br />
und professionelle<br />
Vorbereitung und<br />
Durchführung<br />
Organisation wird von<br />
Moderatorin<br />
übernommen,<br />
strukturiertes Arbeiten.<br />
<strong>Tandem</strong>s: Das Ziel,<br />
dass wir für die Kinder<br />
erreichen, Kontakte zu<br />
den „Nachbarn“, ich<br />
habe die Möglichkeit,<br />
Anfang an)<br />
Struktur,<br />
Organisation,<br />
Regelmäßigkeit<br />
der Treffen,<br />
neue Ideen<br />
werden<br />
vorgestellt, hohe<br />
fachliche<br />
Kompetenz,<br />
Ortsvorsteherin,<br />
ObFrau für<br />
Öffentlichkeitsar<br />
beit<br />
Teilzeit, Trainerin<br />
(Turnen)<br />
3 Jahren Diesen Sommer<br />
Regelmäßigkeit,<br />
gute<br />
Vorbereitung,<br />
Fachlichkeit und<br />
Sprachlichkeit.<br />
Ich habe die<br />
Moderation heute<br />
erste kennengelernt,<br />
deshalb kann ich<br />
die folgenden<br />
Fragen nicht<br />
beantworten<br />
75
Kritische<br />
Beurteilung<br />
gemeinsamen Weg<br />
geht<br />
anderen<br />
Einrichtungen<br />
besser kennen, hat<br />
Einblick in die<br />
verschiedenen<br />
KiTas,<br />
Grundschulen und<br />
kann so<br />
gemeinsam am<br />
gemeinsamen Ziel<br />
„Übergang KiTa-<br />
Grundschule“<br />
arbeiten<br />
Zeitaufwand sehr<br />
hoch, schwierig<br />
mit dem<br />
Dienstplan<br />
vereinbaren,<br />
dennoch sehr<br />
hoher Nutzen für<br />
alle beteiligten<br />
<strong>Tandem</strong>mitglieder,<br />
Kolleginnen,<br />
Kinder und Eltern<br />
Die<br />
Zukunftsaussicht,<br />
ohne Moderation<br />
zurechtkommen zu<br />
müssen.<br />
viel dazu zu lernen,<br />
weil ich über<br />
Tellerrand blicken<br />
kann und dazu viele<br />
verschiedene<br />
Gelegenheiten dazu<br />
habe<br />
Hoher Zeitaufwand,<br />
<strong>Tandem</strong>s gibt es jetzt<br />
nur ? und es ist nur<br />
Modellprojekt, sollte<br />
irgendwie<br />
weitergehen, hoher<br />
Kostenaufwand<br />
gutes<br />
Einfühlungsver<br />
mögen, gute<br />
Zusammenarbei<br />
t, offener<br />
Umgang<br />
Sehr<br />
strukturiertes<br />
und klares<br />
Arbeiten, gutes<br />
Miteinander,<br />
konstruktive<br />
Arbeitsweise<br />
76
Wirkung der<br />
Moderation im<br />
Verhältnis zu<br />
anderen<br />
Methoden, mit<br />
denen man<br />
arbeitet oder<br />
kennt<br />
Wunsch, was<br />
sich ändern<br />
sollte<br />
Siehe bei „Was<br />
finden Sie<br />
besonders positive<br />
Bemerkung an der<br />
Moderation und an<br />
den <strong>Tandem</strong>s?“<br />
Durch die<br />
Moderation haben<br />
wir nie unser Ziel<br />
aus den Augen<br />
verloren und sind<br />
immer wieder auf<br />
den eigentlichen<br />
Punkt<br />
zurückgekommen.<br />
So konnten wir all<br />
das erreichen, was<br />
wir bis jetzt schon<br />
umgesetzt haben.<br />
Nach Ablauf von<br />
<strong>Tandem</strong> hoffe ich,<br />
dass wir es<br />
schaffen, <strong>Tandem</strong><br />
auch ohne<br />
Moderatorin<br />
weiterzuführen.<br />
Eine Person, die<br />
von außen in ein<br />
Team herein<br />
kommt, hat eine<br />
größere<br />
professionelle<br />
Distanz zu den<br />
einzelnen Themen<br />
und kommt<br />
deshalb nur selten<br />
„vom Wege“ ab.<br />
Sitzungen sind<br />
somit produktiver<br />
und zielgerichteter<br />
als ohne<br />
Moderation.<br />
Eine effiziente<br />
Methode, effizienter<br />
und arbeitsintensiver<br />
wie andere,<br />
dauerhafter, weil über<br />
längere Zeit,<br />
Erfahrungen der<br />
Moderatorin können<br />
weitergegeben werden<br />
Der Übergang ist die<br />
Phase ohne<br />
Moderation muss<br />
rechtzeitig „geübt“<br />
werden. Wenn<br />
rechtzeitig bekannt,<br />
wer es ist: Besuch der<br />
Lehrerinnen in KiTa<br />
vor Sommerferien.<br />
Sehr kompetent<br />
„Öffnung des<br />
Törchens“,<br />
näheres<br />
Kennenlernen<br />
aller<br />
Lehrer/innen der<br />
GS, Umgang<br />
mit<br />
Kann(?)kindern<br />
77
Moderatorinnen<br />
Alter 28 29 30<br />
Geschlecht W W W<br />
(Berufliche) Ausbildung Diplom-Pädagogin Diplom-Pädagogin Soziologie (M.A.)<br />
(Leitungs-)Position in der DKJS Ja Nein nein<br />
Tätigkeitsfeld in der DKJS Moderatorin, Regionale<br />
Programmleiterin<br />
Moderatorin Moderatorin<br />
Beschäftigt bei der DKJS seit April 2008 Freiberuflich seit Oktober 2009 Vermittelt über die Universität Trier seit<br />
August 2008<br />
Tätig als Moderatorin seit Januar 2007 Seit Oktober 2009 August 2008<br />
Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt und<br />
andere (beruflichen/ehrenamtlichen)<br />
Tätigkeiten<br />
Vollzeit<br />
Fortbildnerin für Erzieherinnen<br />
Evaluatorin<br />
Schülerfirmenberaterin Ehrenamt Naturfreunde<br />
Arbeitet als <strong>Tandem</strong>moteratorin seit Januar 2007 Seit Oktober 2009 Seit August 2008<br />
Was finden Sie besonders positiv an<br />
der Moderation und an den<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen?<br />
Die Begleitung und Unterstützung<br />
von engagierten Pädagoginnen, die<br />
ihre Arbeit weiterentwickeln wollen<br />
Moderation bietet im Vergleich zur<br />
Beratung einen offeneren Rahmen.<br />
Damit meine ich, dass zwar in beiden<br />
Fällen gelenkt wird (Moderation <br />
Ergebnis, Beratung bestimmte<br />
Schritte Ergebnis), aber die Vorgaben<br />
(„nun sollten folgende Schritte gemacht<br />
werden“ - Beratung) bei der Moderation<br />
Dankbarkeit der <strong>Tandem</strong>s zu erfahren.<br />
78
Kritische Beurteilung Begrenzte Einflussnahmen nie<br />
Wirkung der Moderation im<br />
Verhältnis zu anderen Methoden, mit<br />
denen man arbeitet oder kennt<br />
messen zu können, was was bewirkt.<br />
Gruppen dabei unterstützen,<br />
Entwicklungsprozesse zu<br />
organisieren und zu planen.<br />
Hebammenfunktion bzw. Hilfe, es<br />
selbst zu tun<br />
Wunsch, was sich ändern sollte Wissensgenerierung, um zu<br />
Moderation schulen zu können<br />
offener bis kaum vorhanden sind.<br />
Da ich noch nicht lange moderiere,<br />
sondern bisher mehr beraten habe, wirkt<br />
Beratung auf mich klarer und<br />
strukturierter. Demgegenüber erscheint<br />
Moderation während des Gesprächs bzw.<br />
Prozesses nur halb strukturiert.<br />
- neutrale Position<br />
- nur eine lenkende Funktion<br />
Manchmal fällt es mir schwer, neutral zu<br />
bleiben und ich muss mich oft<br />
zurückhalten, damit ich die <strong>Tandem</strong>s nicht<br />
untereinander vergleiche und die<br />
Individualität eines jeden anerkenne und<br />
akzeptiere.<br />
Außerdem fällt es mir manchmal schwer,<br />
Probleme, die ich sehe, offen<br />
anzusprechen und dabei zu riskieren, dass<br />
sich Personen angegriffen fühlen.<br />
Keine Angaben Größere Eigenständigkeit und<br />
Selbstorganisation der <strong>Tandem</strong>s<br />
79
12. Beschreibungen der <strong>Tandem</strong>gruppen durch die<br />
Moderatorinnen<br />
Zur Untersuchung von Attribuierungsprozessen wurden die Moderatorinnen gebeten, die<br />
<strong>Tandem</strong>gruppen zu beschreiben, um somit auch die Ebene ihrer kommunikativ-reflexiver<br />
Zugänge zu den <strong>Tandem</strong>gruppen mit einzubeziehen. Die folgenden Zeilen stammen aus<br />
einer E-Mail der Projektleiterin:<br />
„Zunächst waren eine möglichst große geographische Distanz, die Größe der <strong>Tandem</strong>s, besonders<br />
gute und normale <strong>Tandem</strong>s für uns ausschlaggebende Kriterien, die aber nicht wirklich zu einer<br />
Konsequenz führten. Nachdem wir heute morgen mit Frau Bertoin im Team saßen, hat sie uns noch<br />
mal neue Entscheidungskriterien (zusätzlich zu den bereits erwähnten) genannt. Hinzu kamen<br />
Trägerzugehörigkeit, pädagogische / konzeptionelle Schwerpunkte der Einrichtungen, Größe noch<br />
mal differenziert nach ländlich und städtisch. Schließlich haben wir uns für Serig entschieden, weil<br />
es ein großes <strong>Tandem</strong> im ländlichen Raum ist und weil alle Bildungseinrichtungen im Elementar-<br />
und Primarbereich der Stadt im <strong>Tandem</strong> sind. Außerdem gibt es hier verschiedene Trägerstrukturen.<br />
Für Paris haben wir uns entschieden, weil es ein kleines <strong>Tandem</strong> an der Grenze ländlich/städtisch ist<br />
und Paris eine Schwerpunktschule ist. Für New York haben wir uns entschieden, weil auch hier eine<br />
Trägervielfalt gegeben ist, es ist ein großes <strong>Tandem</strong> im städtischen Raum, das <strong>Tandem</strong> ist<br />
gewachsen (musste also einmal seine Form ändern).<br />
Gut und schlecht waren keine Kategorien mehr, da diese uns auch nicht wirklich weitergeholfen<br />
haben, da wir keine schlechten <strong>Tandem</strong>s haben. Es gibt gute und bessere, aber keine wirklich<br />
schlechten. Besser quasi in der Hinsicht, wie „sie kooperieren gut miteinander“, die kommen gut<br />
miteinander aus, hier funktioniert die Koordination und Koordination, vielleicht auch: die sind mir<br />
sympathisch, sie respektieren sich, hier arbeitet jeder mit, jeder trägt Verantwortung, so in der Art.“<br />
Hier zeigt sich, dass die Auswahl der <strong>Tandem</strong>gruppen entlang sachlich-konzeptioneller<br />
Kriterien, nämlich nach äußeren Strukturmerkmalen, erfolgte. Dies lässt sich zum einen<br />
auf ihr Interesse, mit dem Projekt zu expandieren zurückführen, andererseits wird darin<br />
auch ihr Zugang zu den <strong>Tandem</strong>s, der hier weniger persönlich, sondern stärker strukturell<br />
geprägt ist, erkennbar.<br />
80
Gedächtnisprotokolle einer studentischen Hilfskraft der DKJS zur ersten<br />
Kontaktaufnahme mit den <strong>Tandem</strong>gruppen:<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe Serrig:<br />
- Die Kita Herofd, die Kita Sumpa und die Grundschule Billertal haben sich gegen<br />
die Evaluation ausgesprochen, da sie nicht mehr Zeit investieren können/wollen.<br />
- Die Kita Kientz war spontan sehr interessiert an der Evaluation und hat von sich<br />
aus mehrere Terminvorschläge gemacht. Als ich Ihnen absagen musste, waren sie<br />
sehr enttäuscht und haben angeboten, bei Bedarf jederzeit Fragen zu beantworten<br />
oder sich anderweitig zur Verfügung zu stellen.<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe San Francisco:<br />
- Sowohl die Kita als auch die Grundschule sind interessiert an der Evaluation und<br />
wirkten am Telefon sehr engagiert. Die Terminfindung erwies sich als äußerst<br />
problemlos.<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe New York:<br />
- Hier zeigte besonders großes Interesse die Leiterin der Kita St. Nikolaus. Sie<br />
erkannte klar auch den Nutzen für Ihre Arbeit und setzt große Hoffnung hinein, die<br />
eigene Arbeit zu optimieren. Die Leiterin wirkte im Gespräch im Hinblick auf<br />
Bildungsfragen sehr „fit“ und engagiert.<br />
- Das Gespräch mit der Kiga St. Moritz verlief weniger euphorisch. Die Leiterin<br />
wirkte relativ genervt und reichte mich sofort an eine Kollegin weiter. Sie erklärten<br />
sich dazu bereit, allerdings war ein wenig Überredungskunst notwendig.<br />
- In der Grundschule ist das Problem, dass die beiden „alten“ <strong>Tandem</strong>mitglieder<br />
nicht mehr dabei sind und neue Kollegen nun an den moderierten Treffen<br />
teilnehmen. Somit würde es keinen Sinn machen, wenn die „Neuen“ an der<br />
Evaluation teilnehmen. „Ihr verlangt aber ganz schön viel von uns“ so seine<br />
Reaktion am Telefon, allerdings fügte er lachend hinzu, dass er optimistisch sei,<br />
dass er an der Diskussion teilnehmen wird.<br />
81
- Der Kiga Heinig war auch interessiert, allerdings führten auch sie das Zeitproblem<br />
an und sagten, dass sie nur teilnehmen können, wenn die GD im Anschluss an ein<br />
<strong>Tandem</strong>treffen stattfindet.<br />
<strong>Tandem</strong>gruppe Paris:<br />
- Die Kita St. Karolin war von Anfang an am euphorischsten. Sie kamen auch schon<br />
direkt im Anschluss auf die Präsentation der Evaluation bei einem Netzwerktreffen<br />
auf Frau Merten zu und fragten, ob sie teilnehmen können. Ein Zeitproblem sahen<br />
sie überhaupt nicht. Auf die Frage von mir, wie viele Kolleginnen teilnehmen<br />
können antwortete sie „Wie viele brauchen sie denn? Also 6 Leute kann ich<br />
mitbringen“.<br />
- Die Grundschule war eher skeptisch und hat den Nutzen noch nicht erkannt. Sie<br />
war zwar sehr freundlich, aber machte deutlich klar, dass sie nur teilnehmen<br />
können, wenn es im Anschluss an ein moderiertes Treffen stattfindet und Frau<br />
Simpatz vielleicht eine Stunde kürzer moderieren wird.<br />
Hier deuten sich bereits falleigene Logiken in Reaktion auf das Treffen an, die sich auf der<br />
Basis der Rekonstruktionen vertiefen und ausdifferenzieren ließen.<br />
Seitens der stud. Hilfskraft zeigt sich eine Leistungs- und Erfolgsorientierung, die sie auch<br />
auf die <strong>Tandem</strong>gruppen attribuiert und an organisiertem Engagement festmacht.<br />
82
13. Transkriptionsregeln<br />
Die verwendeten und im Folgenden aufgeführten Transkriptionsregeln richten sich nach<br />
Bohnsack (vgl. Bohnsack 2007, S. 235f.)<br />
Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel<br />
Ende einer Überlappung<br />
(.) Pause bis zu einer Sekunde<br />
(2) Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert<br />
nein betont<br />
nein laut (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin)<br />
°nee° sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin)<br />
. stark sinkende Intonation<br />
; schwach sinkende Intonation<br />
? stark steigende Intonation<br />
, schwach steigende Intonation<br />
viellei- Abbruch eines Wortes<br />
oh=nee Wortverschleifung<br />
nei::n Dehnung, die Häufigkeit vom : entspricht der Länge der Dehnung<br />
(doch) Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen<br />
( ) unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammer entspricht etwa der Dauer<br />
der unverständlichen Äußerung<br />
((stöhnt)) Kommentare bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nicht-verbalen oder<br />
gesprächsexternen Ereignissen; die Länge der Klammer entspricht im Falle der<br />
Kommentierung parasprachlicher Äußerungen (z. B. Stöhnen) etwa der Dauer der<br />
Äußerung.<br />
In vereinfachten Versionen des Transkriptionssystems kann auch Lachen auf diese<br />
Weise symbolisiert werden. In komplexeren Versionen wird Lachen wie folgt<br />
symbolisiert:<br />
@nein@ lachend gesprochen<br />
@(.)@ kurzes Auflachen<br />
83
@(3)@ 3 Sek. Lachen<br />
für biografische Interviews zusätzlich:<br />
//mhm// Hörersignal des Interviewers, wenn das „mhm“ nicht überlappend ist<br />
Groß- und Kleinschreibung:<br />
Hauptwörter werden groß geschrieben, und bei Neuansetzen eines Sprechers/einer Sprecherin am<br />
Beginn eines ‚Häkchens‘ wird das erste Wort mit Großbuchstaben begonnen. Nach Satzzeichen<br />
wird klein weitergeschrieben, um deutlich zu machen, dass Satzzeichen die Intonation anzeigen<br />
und nicht grammatikalisch gesetzt werden.<br />
Maskierung:<br />
Allen Personen einer Gruppendiskussion wird ein Buchstabe zugewiesen. Diesem wird je<br />
nach Geschlecht „w“ (für weiblich) oder „m“ (für männlich) hinzugefügt. Die Zuweisung<br />
lautet bei einer Diskussion mit 3 Erzieherinnen, 1 Leitungskraft einer Kindertagesstätte<br />
und 2 Lehrerinnen und 1 Schulleitung Ew1, Ew2, Ew3, ELw4, Lw1, Lw2, LLm1. Dieser<br />
Buchstabe bleibt auch bei allen etwaigen weiteren Erhebungen bzw. bei der teilnehmenden<br />
Beobachtung bestehen, bei denen die Person beteiligt ist.<br />
Alle Ortsangaben (Straße, Plätze, Bezirke) werden maskiert.<br />
Namen, die in der Gruppendiskussion bzw. den responsiven Evaluationsgesprächen genannt<br />
werden, werden durch erdachte Namen ersetzt. Dabei wurden in der vorliegenden Studie,<br />
Ortsnamen für die <strong>Tandem</strong>gruppen gewählt, die eine Anonymisierung erhöhten.<br />
84
14. Literaturverzeichnis des <strong>Anhang</strong>s<br />
Althans, Birgit (2011): Befremdete Gesten. Von der Macht des Pädagogischen in politisch-medialen<br />
Inszenierungen. In: Wulf, Christoph et al. (Hrsg.): Die Geste in Erziehung, Bildung und Sozialisation.<br />
Wiesbaden, S. 251-276<br />
Bohnsack, Ralf (2007): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden. Opladen<br />
Bourdieu, Pierre (1987): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am Main<br />
Bourdieu, Pierre (2001): Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt am Main<br />
DKJS (2008): <strong>Tandem</strong>. Unterschiede managen! Konzept zur Fortführung des Programms „ponte“ in der<br />
Region Trier. Vorgelegt von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Berlin<br />
Fischer-Lichte, Erika (2004): Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main<br />
Klambeck, Amelie (2007): Das hysterische Theater unter der Lupe. Klinische Zeichen psychogener<br />
Gangstörungen. Wege der dokumentarischen Rekonstruktion von Körperbewegungen auf der<br />
Grundlage von Videografien. Göttingen<br />
Nentwig-Gesemann, Iris (2002): Gruppendiskussion mit Kindern. Die dokumentarische Interpretation von<br />
Spielpraxis und Diskursorganisation. In: Zeitschrift für Qualitative Bildungs-, Beratungs-, und<br />
Sozialforschung 2002. 1, S. 41-63<br />
Tervooren, Anja (2001): Im Spielraum von Geschlecht und Begehren. Ethnographie der ausgehenden<br />
Kindheit. Weinheim/München<br />
Wagner-Willi, Monika (2004): Videointerpretation als mehrdimensionale Mikroanalyse am Beispiel<br />
schulischer Alltagsszenen. In: ZBBS 2004. 1, S. 49-66<br />
Wagner-Willi, Monika (2010): Dokumentarische Videoanalyse. Unveröffentlichtes Manuskript. Eisenach.<br />
Wulf, Christoph (2010): Einleitung. In: ders. et al. (Hrsg.): Die Geste in Erziehung, Bildung und<br />
Sozialisation. Ethnographische Feldstudien. Wiesbaden, S. 7-27<br />
85