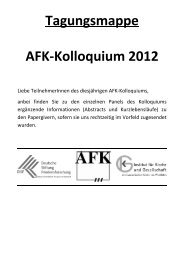Paper - Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (AFK)
Paper - Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (AFK)
Paper - Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (AFK)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Philipp Rückheim (GSL der Universität Luzern, philipp.rueckheim@gmail.com); Beitrag <strong>für</strong> das 45.<br />
Kolloquium der <strong>Arbeitsgemeinschaft</strong> <strong>für</strong> <strong>Friedens</strong>- <strong>und</strong> <strong>Konfliktforschung</strong>, zum Thema: Frieden<br />
mit/ohne Grenzen (Panel: Konflikteskalation <strong>und</strong> die Dynamiken von Grenzziehungen – Theoretische<br />
Perspektiven, Moderation Prof. Dr. Thorsten Bonacker, 01.03.2013).<br />
Titel: Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum: Wie Zivilcourage <strong>und</strong><br />
Videoüberwachung Konflikte verschärfen<br />
Zusammenfassung: Welche Grenzen sind <strong>für</strong> folgenreiche Konflikte entscheidend? Dieser Beitrag<br />
vertritt die systemtheoretische These, dass dies nicht zwingend davon abhängt, ob es um politische<br />
Grenzen, Unterdrückung, ökonomische Ungleichheit oder Gewalt geht. Systemtheoretisch wird ein<br />
Konflikt dann bedeutsam, wenn es gelingt, dass er <strong>für</strong> Abwesende des Konfliktgeschehens als relevant<br />
erscheint. Dies verweist auf das Thema <strong>und</strong> die Beobachtung des Konflikts. Konfliktsoziologisch wird<br />
gefordert, bei bedeutsamen Konflikten weniger auf die Streitenden <strong>und</strong> ihre Gründe zu achten, als<br />
vielmehr auf ihre Streitthemen <strong>und</strong> deren Publikum. Der Beitrag grenzt zunächst die<br />
systemtheoretische These ab (1.) <strong>und</strong> erläutert eine Implikation seines Konfliktbegriffs (2.).<br />
Entscheidend ist, die Beobachtung des Konflikts durch ein Publikum als motivierenden Faktor des<br />
Konfliktgeschehens darzulegen (3.). Einmischung kann nicht nur Konflikte entscheiden, sondern auch<br />
aus Mücken Elefanten machen. Dies wird an Moral als Konfliktthema <strong>und</strong> der Beobachtung durch<br />
Videoüberwachung verdeutlicht (4.). Videoüberwachung kann Einmischen motivieren <strong>und</strong> aus<br />
Bagatellen folgenreiche Konflikte generieren, wenn ein couragiertes Selbst seine (moralische)<br />
Gesamtbeurteilung riskiert sieht. Der Beitrag wählt Moral, um zu betonen, dass die Bedeutsamkeit<br />
eines Konflikts nicht zwingend von politischen oder religiösen Grenzzuschreibungen abhängt, sondern<br />
vom Konfliktthema <strong>und</strong> der Beobachtbarkeit des Konfliktgeschehens. Hiermit verknüpft sich eine<br />
allgemeinere These, die sich auch an der Ausdifferenzierung des modernen Sports studieren lässt (5.).<br />
Konflikte dennoch auf Weltkarten zu visualisieren, hat meist weniger mit dem tatsächlichen Konflikt<br />
als vielmehr mit einer einfachen Erschließung des Konfliktgeschehens zu tun. Zugespitzt: Nicht die<br />
Streitenden <strong>und</strong> ihre Interessen allein, sondern auch das Publikum entscheiden über Anfang,<br />
Eskalation, Ende <strong>und</strong> Folgen eines Konflikts.<br />
Person: Philipp Rückheim absolviert seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Zeppelin<br />
Universität <strong>und</strong> wechselt zum Master in ‚Weltgesellschaft <strong>und</strong> Weltpolitik‘ an die Universität Luzern.<br />
Seit 2012 ist er an der dortigen Graduierten Schule Doktorand <strong>und</strong> wird betreut von Prof. Dr. Rudolf<br />
Stichweh (Universität Bonn). Dissertationsthema ist ein Beitrag zur <strong>Konfliktforschung</strong>, der auf Niklas<br />
Luhmanns Problematisierungen eben dieser reagiert. Es geht darum, Konflikte als eine Form der<br />
Kommunikation zu verstehen <strong>und</strong> ihre Ausdifferenzierung vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Weltgesellschaft<br />
zu betrachten. Der folgende Beitrag dient dem Autor als Ausgangspunkt <strong>für</strong> die Frage nach der<br />
Ausdifferenzierung eines Konfliktsystems.
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum: Wie<br />
Zivilcourage <strong>und</strong> Videoüberwachung Konflikte verschärfen<br />
1. Grenzen folgenreicher Konflikte: Interaktion/Gesellschaft statt<br />
Nationalstaaten<br />
Die Beschreibung des Kolloquiums legt es nahe Frieden <strong>und</strong> Konflikt vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
nationalstaatlicher Grenzen zu diskutieren. Ich zitiere: „Die größte Aufmerksamkeit hinsichtlich des<br />
<strong>Friedens</strong> verdienen politische Grenzen.“ 1 Auch ein 2011 (Grätz <strong>und</strong> Knopp) erschienenes<br />
Herausgeberband namens ‚Konfliktkulturen‘ betont bis auf zwei Ausnahmen, die entscheidende Rolle<br />
politischer Grenzziehungen <strong>für</strong> die Erzeugung <strong>und</strong> Lösung von Konflikten. 2<br />
Mein Eindruck ist, dass hier implizit ein nationalstaatengeb<strong>und</strong>ener Gesellschaftsbegriff unterstellt<br />
wird. Wie in Immanuel Kants (1784: vierter Satz) Idee wird ein angeblich angeborener „Antagonism“<br />
des Menschen Bezugspunkt <strong>für</strong> politische Ordnungsinitiativen. Politik <strong>und</strong> Recht sichern diesem<br />
Antagonism seine Entwicklung. Soziologisch-systemtheoretisch leuchtet nun einerseits die Rolle der<br />
Politik <strong>und</strong> ihrer legitimen Gewalt ein, ermöglicht sie doch Konflikte, wenn nicht sofort mit dem<br />
Einsatz physischer Gewalt gerechnet werden muss. Dies hat Niklas Luhmann nicht nur der Politik,<br />
sondern auch der Durchsetzung subjektiver Rechte zugeschrieben <strong>und</strong> der Entstehung sich ad hoc<br />
mobilisierender, sozialer Bewegungen (Luhmann, 1984: Kap. 9: X). Doch andererseits weisen<br />
soziologische Theorien des Konflikts daraufhin, dass die Bedeutsamkeit eines Konflikts nicht von<br />
politischen Faktoren allein abhängt.<br />
Bevor ich zu meinem Forschungsinteresse überleite, lassen Sie mich drei konfliktsoziologische<br />
Kronzeugen zitieren. Randall Collins hat unter dem bezeichnenden Titel ‚Conflict Sociology‘<br />
erläutert, dass der Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong> Konflikt in Nutzenmaximierung einzelner liegt, was vor allem dann zum<br />
Konflikt führt, wenn Zwang empf<strong>und</strong>en wird. Ich zitiere Collins: „being coerced is an intrinsically<br />
unpleasant experience, and hence … calls forth conflict“ (Collins, 1975: 59). Ähnlich formulierte auch<br />
Ralf Dahrendorf seinen Ausgangspunkt, wo es heißt: „Wir setzen voraus, daß Konflikt allgegenwärtig<br />
ist, weil Zwang allgegenwärtig ist, wo immer Menschen sich soziale Verbände schaffen. In einem<br />
formalen Sinn ist es stets die Gr<strong>und</strong>lage des Zwanges, um die es in sozialen Konflikten geht.“<br />
(Dahrendorf, 1967: 262) Auch der sich dazu unterscheidende Axel Honneth formuliert, Konflikte<br />
nehmen, ich zitiere: „statt von vorgegebenen Interessenlagen [nehmen Konflikte] von moralischen<br />
Unrechtsempfindungen [ihren] […] Ausgang“ (Honneth, 1992: 259; Paul, 2007).<br />
Ich möchte Ihnen hier nun eine Alternative vorstellen, die Konfliktauslöser weder auf empf<strong>und</strong>enen<br />
Zwang oder Interessensgegensätzen, noch auf Unrechtsempfindungen oder Anerkennungsverfall<br />
festlegt, sondern Gesellschaft <strong>und</strong> damit auch Konflikt, als Kommunikation begreift. Ich meine damit<br />
Niklas Luhmanns (1984: Kap. 9) Ausarbeitungen. Die Rezeption scheint sich auf Fragen des<br />
Terrorismus <strong>und</strong> Kriegs sowie auf Politik <strong>und</strong> Recht zu konzentrieren. 3 Luhmanns These ist aber<br />
allgemeiner <strong>und</strong> besagt, dass Konflikt nur eine Form der Kommunikation sein kann, also nicht auf<br />
Bewusstsein oder Empfindung basiert. Auch führen gegensätzliche Interessen, politische<br />
1<br />
Zitiert aus dem: Call for Panels & <strong>Paper</strong>s <strong>für</strong> das 45. Kolloquium der <strong>Arbeitsgemeinschaft</strong> <strong>für</strong> <strong>Friedens</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Konfliktforschung</strong> (erster Absatz, dritter Satz). Dieser Bemerkung folgt eine Betonung territorialer Kontrolle,<br />
Normen <strong>und</strong> der Ambivalenz staatlicher Grenzen.<br />
2<br />
Weder Beobachtung, noch Moral oder Zeit scheinen eine vergleichbare Aufmerksamkeit zu verdienen.<br />
3<br />
Eine Einführung findet sich bei Thorsten Bonacker (2008), der aber einige Beiträge angefügt werden könnten<br />
(so z.B. zum Konflikt als Prozess: Messmer, 2003; zum Zusammenhang von Beobachtung <strong>und</strong> Handlung:<br />
Simon, 2004; zur Betroffenheit <strong>und</strong> Vorsorge psychischer Systeme: Türk, 2011).<br />
2<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
Unterdrückung oder ökonomische Ungleichheit nicht zwingend zum Konflikt. Auslöser <strong>für</strong> Konflikte<br />
ist stattdessen, ganz banal <strong>und</strong> allgemein, ein mitgeteiltes, verstandenes Nein, das als Antwort einer<br />
vorherigen Kommunikation verstanden wird. Sein Konfliktbegriff lautet, ich zitiere: „Von Konflikt<br />
wollen wir immer dann sprechen, wenn einer Kommunikation widersprochen wird.“ (Luhmann, 1984:<br />
530)<br />
Da es dem Kolloquium um Fragen des <strong>Friedens</strong> <strong>und</strong> hier um Konflikteskalation geht, interessiert<br />
mich, wie Niklas Luhmann, den Unterschied zwischen alltäglich anfallenden Neins, die „meist rasch<br />
bereinigte Bagatellen“ sind <strong>und</strong> folgenreichen Konfliktsystemen konstruiert (ebd.: 534). Ich möchte<br />
Ihnen vorschlagen, dass es auch hierbei um Grenzen geht, doch nicht nur um Grenzen zwischen oder<br />
innerhalb von Nationalstaaten, sondern um die von Anwesenheit <strong>und</strong> Abwesenheit, von Interaktion<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft (Luhmann, 2009). Nur Konflikte, die relevant <strong>für</strong> Abwesende scheinen, werden zum<br />
ernsthaften Konfliktsystem, die dann andere Konflikte auslösen <strong>und</strong> sich so fortsetzen. Die<br />
entscheidende Frage ist, wie diese Relevanz entsteht <strong>und</strong> Luhmann antwortet darauf, mit dem Verweis<br />
auf das Konfliktthema. Anstelle davon auszugehen, dass Bedrohungen des <strong>Friedens</strong> <strong>und</strong><br />
Konflikteskalation in territorialstaatlichen Grenzen ihren Anlass finden, provoziert Luhmann damit,<br />
dass zumindest <strong>für</strong> die Moderne, folgenreiche Konfliktsysteme überall entstehen können, mitunter<br />
ganz unabhängig von politischen Grenzziehungen, ökonomischen Ungleichheiten oder Zwängen.<br />
Entscheidend ist nur, dass ein Konflikt auch <strong>für</strong> Abwesende relevant ist <strong>und</strong> das hängt mit seinem<br />
Thema zusammen. Es muss sich um ein Thema handeln, an dem sich durch Gründe, Motive,<br />
Interessen usw. Beiträge anhängen, ordnen <strong>und</strong> ablehnen lassen. Ich möchte Ihnen diese These nun<br />
illustrieren. Vergleichbar zum modernen Sport (Guttmann, 1978; Werron, 2010a), ist die Beobachtung<br />
eines Konflikts der Brandstifter <strong>und</strong> nicht das direkte Konfliktgeschehen (als Gegenmeinung siehe<br />
Werron, 2010b). Wenn das stimmen sollte, ließe sich von der Konfliktsoziologie fordern, ihre<br />
Aufmerksamkeit weniger auf die Konfliktparteien zu richten, wie etwa das Recht, die Massenmedien,<br />
Therapie oder andere an Opfer-Täter-Adressen orientierte Beobachter, als vielmehr auf ihr Thema <strong>und</strong><br />
Publikum. Kurz: Nicht die Konfliktparteien entscheiden über Krieg oder Frieden, sondern ihr<br />
Konfliktthema <strong>und</strong> das durch dieses Thema rekrutierte, abwesende Publikum.<br />
2. Konfliktbegriff: Kommunizierter Widerspruch <strong>und</strong> Vereinfachung<br />
Bevor ich zur Frage komme, wovon der Unterschied zwischen Bagatellen <strong>und</strong> folgenreiche<br />
Konfliktsysteme laut der Systemtheorie sensu Luhmann abhängt, scheint eine Bemerkung zum hier<br />
benutzten Konfliktbegriff erforderlich. Luhmann nennt Konflikte kommunizierte Widersprüche.<br />
Damit ist bereits einiges festgelegt. Als eine Form der Kommunikation, die das Nein anstelle des Ja<br />
benutzt, ist ein Konflikt nicht direkt beobachtbar. Damit Kommunikation beobachtbar wird, um selbst<br />
anschließbar zu werden, benötigt sie eine Zurechnung auf Adressen <strong>und</strong> Handlungen, die die ihr zu<br />
Gr<strong>und</strong>e liegenden Selektionen von Mitteilung, Information <strong>und</strong> Verstehen asymmetrisiert <strong>und</strong> den<br />
Mitteilungsaspekt betont (Luhmann, 1984: 227).<br />
Man kann die Schwierigkeiten Konflikte beobachtbar zu machen an den diversen Konfliktindizes<br />
erschließen, die häufig Weltkarten <strong>und</strong> Rankings – mit Verweis auf Territorialstaaten – nutzen, um<br />
anhand verschiedener Kennzahlen Frieden <strong>und</strong> Konflikt zu rekonstruieren. 4 Diese komplexen Indizes<br />
erlauben zwar einerseits eine einfache, anhand von vergleichbaren Zahlenwerten zugängliche<br />
Beurteilung. Andererseits zeigen sie aber, dass ein Konflikt nicht nur die Mitteilung eines Neins<br />
meint, sondern von anderen Umständen, die in diesem Falle, einzelne Nationalstaaten, ihre innen- <strong>und</strong><br />
außenpolitischen Beziehungen, Budgetverteilung, Rechtslage usw. betreffen, abhängen.<br />
4<br />
Siehe z.B. den Global Peace Index 2012, der 23 Indikatoren nutzt, um Nationalstaaten (!) danach zu bewerten<br />
<strong>und</strong> tabellarisch zu vergleichen, wie friedlich sie sind: http://economicsandpeace.org/ (04.02.2013).<br />
3<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
Diese situativen Faktoren des Neins lassen sich nicht nur <strong>für</strong> Staaten, sondern auch <strong>für</strong> Organisationen<br />
erkennen. Das <strong>für</strong> seine Konfliktvermeidung möglicherweise zu Unrecht berühmte China bietet hier<strong>für</strong><br />
interessante Einsichten. 5 Eine sozialpsychologische Befragung von 85 Managern chinesischer<br />
Staatsunternehmen zeigte, dass diese zumeist Konflikte vermieden <strong>und</strong> widersprüchliche Erwartungen<br />
befolgten (‚conforming‘), hingegen aber in einem Drittel der Fälle Ablehnungen erst dann mitteilten,<br />
wenn sie sich der Unterstützung Dritter sicher waren (Tjosvold <strong>und</strong> Sun, 2002). Auch experimentelle<br />
Studien, wie die im Band Equivocal Communication (Bavelas et al., 1990) versammelten, zeigen wie<br />
dieses Organisationsbeispiel, dass ein Nein meist nur dann mitgeteilt <strong>und</strong> einem Konflikt nur dann<br />
auftrieb gegeben wird, wenn die Situation dazu einlädt. Dieselbe Erkenntnis geht vom sogenannten<br />
bystander-effect aus (Manning et al., 2007), auf den ich zurückkommen werde. Ein Konflikt entsteht<br />
also nicht willkürlich! Konflikte nur anhand von Handlungen zu beschreiben, mag <strong>für</strong> die<br />
Selbstsimplifikation des Konfliktgeschehens <strong>und</strong> <strong>für</strong> Fremdbeobachtungen durch das Recht oder<br />
soziale Bewegungen wichtig sein, wäre aber <strong>für</strong> eine wissenschaftliche Fremdbeschreibung eine<br />
unnötige Reduktion des tatsächlichen Geschehens. 6 Dass ‚politische Grenzen‘ häufig als Bezugspunkt<br />
<strong>für</strong> die Frage nach Frieden <strong>und</strong> Konflikt dienen, mag damit zusammenhängen, dass weder Konflikt<br />
noch Frieden direkt beobachtbar sind. Diese fehlende Direktheit des Konflikts macht komplexe<br />
Vereinfachungen wie Indizes notwendig, die wiederum der Vergleichbarkeit wegen an ‚politische<br />
Grenzen‘ orientiert werden.<br />
Die systemtheoretische These, wonach Konflikte als Kommunikationen nicht willkürlich entstehen,<br />
hängt mit dem Gr<strong>und</strong>begriff Kommunikation zusammen, wozu es bei Luhmann heißt, dass die<br />
Kommunikation sich „von hinten her ermöglicht, gegenläufig zum Zeitablauf des Prozesses.“<br />
(Luhmann, 1984: 198) Für uns heißt dies, dass „das Neuanfangen von Konflikten … in einem zwar<br />
nicht zwingenden, aber hochwahrscheinlichen Zusammenhang steht mit den Reproduktionschancen<br />
des Konflikts.“ (ebd.: 538) Darum lässt sich eine zu erfolgreiche Konfliktlösung auch skeptisch<br />
beurteilen, fallen damit doch Möglichkeiten weg, Nein zu sagen. Andere Neinsagebereitschaften<br />
bleiben aus, ohne aber, dass irgendjemand in der heutigen, hochkomplexen Gesellschaft wissen<br />
könnte, wozu man in Zukunft noch alles Nein sagen sollte. Diese Rückwärtsgewandtheit der<br />
Erwartungen der Konfliktkommunikation, führt direkt in meine These, dass die Bedeutsamkeit eines<br />
Konflikts von seiner Relevanz <strong>für</strong> Abwesende abhänge.<br />
3. Zur Beobachtung von Konflikten: Die Relevanz Abwesender<br />
Abstrakt besehen besagt die These, dass das Beobachten von Konfliktgeschehen durch Abwesende<br />
<strong>und</strong> das Beobachten dieses Beobachtens durch die im Konflikt verwickelten Anwesenden, den<br />
Konflikt verschärfen. 7 Die Schädigungshandlung allein entscheidet nicht über die Bedeutsamkeit eines<br />
Konflikts, sondern die Beobachtung, geäußerte Erwartung <strong>und</strong> Zurechnung solcher Schädigungen.<br />
5<br />
Das in China Konfliktvermeidung wichtig sei, zumindest aus Sicht von Fremdbeschreibungen, wie<br />
Reiseberichte (Wickert, 1988), lässt sich ebenso finden, wie das Gegenteil, wonach die chinesische Philosophie<br />
auch Streit nahe legt (siehe Shi Ming in Grätz <strong>und</strong> Knopp, 2011: 119-124) <strong>und</strong> die Organisationsforschung dies<br />
berücksichtigen sollte (Lin, 2010).<br />
6<br />
„Als Ausgangspunkt ist festzuhalten, daß Kommunikation nicht als Handlung <strong>und</strong> der Kommunikationsprozeß<br />
nicht als Kette von Handlungen begriffen werden kann. Die Kommunikation bezieht mehr selektive Ereignisse<br />
in ihre Einheit ein als nur den Akt der Mitteilung. Man kann den Kommunikationsprozeß deshalb nicht voll<br />
erfassen, wenn man nicht mehr sieht als die Mitteilungen, von denen eine die andere auslöst. In die<br />
Kommunikation geht immer auch die Selektivität des Mitgeteilten, der Information, <strong>und</strong> die Selektivität des<br />
Verstehens ein, <strong>und</strong> gerade die Differenzen, die diese Einheit ermöglichen, machen das Wesen der<br />
Kommunikation aus.“ (Luhmann, 1984: 225f.)<br />
7<br />
Beobachtung setzt sich aus Obacht <strong>und</strong> Achtung zusammen.<br />
4<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
Ich möchte Ihnen hierzu zwei soziologische Thesen vorstellen. Noch einmal Axel Honneth, der zwar<br />
meinte, bei sozialen Kämpfen ginge es um „Unrechtsempfindungen“ (1992: 259), also psychische<br />
Operationen, der aber auch die Rolle einer sogenannten „kollektiven Semantik“ anführt. Konflikte<br />
hängen von der - ich zitiere: „Existenz einer kollektiven Semantik [ab], […] die die persönlichen<br />
Enttäuschungserfahrungen als etwas zu interpretieren erlaubt, wovon nicht nur das individuelle Ich,<br />
sondern ein Kreis von vielen anderen Subjekten ebenfalls betroffen ist.“ (Honneth, 1992: 262) Bei<br />
Luhmann findet man eine ähnliche Formulierung, dort heißt es: „Wenn in interaktionellen Konflikten<br />
… Anzeichen einer die Interaktion überschreitenden gesellschaftlichen Relevanz auftauchen, ist die<br />
Wahrscheinlichkeit höher, daß der Konflikt verbreitet, vertieft, perpetuiert wird.“ (Luhmann, 1984:<br />
535) Beide betonen, dass es auf das Thema des Konflikts ankommt <strong>und</strong> darauf, andere, die im<br />
Konfliktgeschehen nicht direkt involviert sind als Beobachter zu rekrutieren. Der Konflikt muss<br />
Anzeichen aufweisen, dass er nicht nur <strong>für</strong> die Anwesenden Relevanz hat <strong>und</strong> mit dem Ende ihrer<br />
gemeinsamen Interaktion erlischt. Den Anwesenden muss deutlich werden, dass von dieser Interaktion<br />
eine Relevanz ausgeht, die die Grenze dieser einzelnen Interaktion übergreift. Kurz: Es geht um die<br />
Berücksichtigung Abwesender <strong>und</strong> speziell, um deren Beobachtung des Konfliktgeschehens.<br />
Lassen Sie mich diese Formulierung mit kursorischen Beispielen stützen. Ein frühes Indiz habe ich bei<br />
Tacitus gef<strong>und</strong>en, wo dieser die Kämpfe nicht nur einschränkende, sondern auch motivierende Rolle<br />
der Frauen <strong>und</strong> Kinder betont: „Sie [die Frauen <strong>und</strong> Kinder der Kämpfer] sind <strong>für</strong> jeden die heiligsten<br />
Zeugen, sie die größten Lobspender … ja sie bringen den Kämpfenden Stärkung <strong>und</strong> Ermutigung.“<br />
(Tacitus, 1968: 15 VII) Das motivierende Publikum der Kämpfenden sind bereits damals nicht nur die<br />
Obrigkeit, Feldherren <strong>und</strong> Gegner, sondern auch die Beobachtungen, die von Frauen <strong>und</strong> Kinder der<br />
Kämpfenden ausgehen. Vielleicht verknüpfen sich damit Hinweise, auf die konfliktfördernde Stellung<br />
der Frau, die ihr unter dem Namen Xanthippe in der griechischen Antike sowie an manchen Stellen<br />
der Bibel zugeschrieben wird. 8 Hamed Abdel-Samad (in Grätz <strong>und</strong> Knopp, 2011: 85f.) weist<br />
beispielsweise daraufhin, dass „das Wort <strong>für</strong> Verwirrung im Arabischen, ‚Fitna‘ […], auch das Wort<br />
<strong>für</strong> Spaltung <strong>und</strong> Verführung durch eine Frau“ meine. Was die Rolle der Frau in Konflikten auch sei,<br />
zumindest <strong>für</strong> verbale Konflikte bei Tischgesprächen von Familien haben Vuchinich et al. (1988:<br />
1998) festgestellt, dass Töchter <strong>und</strong> Mütter wesentlich öfter intervenieren, als Väter <strong>und</strong> Söhne – was<br />
vermuten lässt, dass sie von den Streitenden als Beobachter berücksichtigt werden.<br />
Ein anderes Beispiel lässt sich im Zitat sehen: „Vier feindselige Zeitungen sind mehr zu <strong>für</strong>chten als<br />
tausend Bajonette“ (das Napoleon zugeschrieben wird). In der modernen Politik sind zahlreiche<br />
Strategien bekannt, die darauf zielen, Widerspruch motivierende Themen dem Publikum, der<br />
öffentlichen Meinung also, erst gar nicht vorzustellen <strong>und</strong> damit ablenkende Konflikte vorzubeugen. 9<br />
Aber auch Mahatma Gandhis Ablehnung zur Intervention der Internationalen Gemeinschaft im<br />
Pakistan-Indien-Konflikt um Kaschmir ist ein Indiz <strong>für</strong> das Wissen, um die ambivalente Relevanz<br />
Abwesender (der Beitrag von Faisal Devji in Grätz <strong>und</strong> Knopp, 2011: insbesondere S. 24f.). Laut<br />
Faisal Devij war Gandhi der Ansicht, dass eine entscheidende Schlacht zwischen den Feinden besser<br />
wäre, als eine ‚künstliche‘, durch die Interventionsmächte ermöglichte, Aufblähung der Kräfte. Traut<br />
man Devijs Interpretation, hat die Intervention Dritter zu ‚Stellvertreterkriegen‘ in Afghanistan <strong>und</strong><br />
Terrorismus, also zu einem ‚Schrecken ohne Ende‘ geführt.<br />
Ganz ähnlich ambivalent hat auch eine Studie mit dem bezeichnenden Titel, ‚Wo der Spaß aufhört...<br />
Jugendliche <strong>und</strong> ihre Perspektive auf Konflikte in Sozialen Netzwerkdiensten‘ bezüglich der<br />
Intervention Dritter geurteilt (Wagner et al., 2012). Auch Jugendliche bewerten die Beobachtung <strong>und</strong><br />
8<br />
„Es ist besser wohnen im Winkel auf dem Dach, denn bei einem zänkischen Weibe in einem Haus<br />
beisammen.“ (Spruch 21.9, unter: http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/sprueche/21/#9, 04.02.2013)<br />
9<br />
Hinweise finden sich im Knebeln (Holmes, 1988) wie im ‚blame avoidance‘ demokratischer – <strong>und</strong> somit durch<br />
Streit bzw. Opposition gekennzeichneter – Politik (zur Übersicht siehe Weaver, 1986: 385).<br />
5<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
Einmischung Dritter als Konflikteskalation. Einerseits werden manche Konflikte gerade darum Online<br />
ausgetragen, da sich eine breitere Öffentlichkeit rekrutieren ließe (Wagner et al., 2012: 40). 10<br />
Andererseits wird aber auch die Gefahr gesehen, dass intervenierende Dritte etwas missverstehen <strong>und</strong><br />
unnötig aufblasen. 11 Leider beschränkt sich diese Studie auf Schüler in München, die sich im Leben<br />
unter Unbekannten in Großstädten (Weber, 2007) auch aus dem Weg gehen können <strong>und</strong> nicht, wie in<br />
ländlichen Schulen, damit rechnen müssen, sich im Verein, Bus oder Club wiederzusehen. Um Ihnen<br />
aber die konflikteskalierende Bewertung einer einmischenden, vom direkten Geschehen abwesenden,<br />
Öffentlichkeit zu verdeutlichen, zitiere ich einen Hauptschüler aus München: „Ja, die mischen sich<br />
dann ein, dann gibt’s so n großes Trara <strong>und</strong> dann machen die aus ner Mücke n Elefanten“ (Wagner et<br />
al., 2012: 40).<br />
Ich hoffe an diesen kursorischen Beispielen gezeigt zu haben, dass die Beobachtung eines Konflikts,<br />
v.a. durch Dritte <strong>und</strong> deren potentielle Intervention, aus verschiedenen Perspektiven durchaus<br />
konfliktfördernd bewertet wird. Hierzu lassen sich auch Gegenmeinungen finden, die z.B. restriktive<br />
Verfahren des Rechts danach bewerten, welche Möglichkeiten es bereitstellt, Konflikte mehr oder<br />
weniger friedlich zu erzeugen <strong>und</strong> zu bearbeiten (Messmer, 2005), doch hängt eine solche Bewertung<br />
wohl vom Standpunkt <strong>und</strong> dem Zeitpunkt der Beurteilung ab. Anders als z.B. von Tobias Werron<br />
(2010b) am Unterschied direkter Konflikte <strong>und</strong> indirekter Konkurrenz dargelegt <strong>und</strong> von<br />
Eskalationsmodellen der Konfliktsoziologie unterstellt (Messmer, 2003; Collins, 1975), können<br />
Konflikte durchaus ohne Einsatz physischer Gewalt <strong>und</strong> Zwang existentiell bedeutsam werden, wie<br />
man es an Konflikten in Online-Netzwerken von Schüler sehen kann (Manipulieren oder Löschen<br />
eines Accounts). Die Bedeutsamkeit hängt mit dem Thema des Konflikts <strong>und</strong> der Beobachtbarkeit<br />
zusammen <strong>und</strong> nicht mit der einzelnen, konkreten Verhaltensweise der Streitenden.<br />
Diese These lässt sich spezifizieren. Honneth <strong>und</strong> Luhmann haben beide darauf hingewiesen, dass ein<br />
Konflikt weder ausschließlich an Interessen noch nur durch politische Themen seine Bedeutsamkeit<br />
gewinnt. Die Karriere eines Konflikts hängt davon ab, ob er <strong>für</strong> vom gegenwärtigen<br />
Konfliktgeschehen Abwesende – da<strong>für</strong> oder dagegen, dass ist bekanntlich egal – Unterstützung<br />
rekrutieren kann. 12 Sie hängt ganz alltäglich davon ab, dass der Konflikt einem als relevant erachteten<br />
Thema zuzurechnen ist. Das Konfliktthema ermöglicht Beiträge zu generieren, die wiederum<br />
abgelehnt werden können <strong>und</strong> den Konflikt damit weiter ausdifferenzieren. Auch <strong>für</strong> ablehnende<br />
Kommunikation gilt, dass ein Zusammenhang zwischen Medien der Verbreitung von Kommunikation<br />
<strong>und</strong> der Möglichkeit, ein Thema durch Beiträge auszudifferenzieren, besteht (Luhmann, 1984: 212f.,<br />
224, 1998: 468f.). Die oben beschriebene Ambivalenz gegenüber Dritter, bezeichnet kursorisch, dass<br />
dieser Unterschied von Interaktion <strong>und</strong> Relevanz dieser Interaktion <strong>für</strong> Abwesende (Gesellschaft), von<br />
den Konfliktparteien gesehen wird.<br />
10<br />
Die Begründung der Gewalteindämmung scheint anhand berühmter Suizid-Fälle auszufallen. Doch die Form<br />
der Online-Gewalt kennt nicht nur Offline-Suizid, sondern, wie die Studie zeigt, auch die Melde-Funktion, die<br />
zwar schützen aber auch zum Online-Tod führen kann. Letztere wenn sie darauf zielt, Accounts <strong>und</strong> ihre<br />
Handlungen (Pinnwand, Fotos, Fre<strong>und</strong>schaften, Mitgliedschaften, Applikationen) auszuradieren <strong>und</strong> die dahinter<br />
liegende Adresse ohne Geschichte zurückzulassen. Ganz ähnlich beschreibt James Baldwin (1998: 125) dies als<br />
eine Folge der Sklaverei.<br />
11<br />
Eine interessante, leider aber nicht weiter erläuterte Feststellung der Studie lautet: „Andererseits besteht <strong>für</strong> die<br />
Jugendlichen auch die Option, einen Konflikt gezielt aus der Öffentlichkeit herauszunehmen <strong>und</strong> in private<br />
Räume zu verlagern. Von den Befragten wird dies als deeskalierende Handlungsstrategie benannt“ (Wagner et<br />
al., 2012: 41 Herv. P.R.).<br />
12<br />
Neben einer ‚kollektiven Semantik‘ (Honneth, 1992), die Luhmann (1984: 536) eine „Semantik der<br />
‚Diskriminierung‘“ nennt, führen beide Autoren Moral <strong>und</strong> Luhmann auch „Spezialorganisationen“ wie<br />
Gewerkschaften <strong>und</strong> NGOs, Verweise auf Politik <strong>und</strong> Recht an.<br />
6<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
4. Zur Moral: Konfliktverschärfung durch Videoüberwachung<br />
In Differenz zur Suggestion der Ausschreibung des Kolloquiums, die politische Grenzen als besonders<br />
wichtig wertet, habe ich zur Verdeutlichung meiner These, dass dies zu spezifisch <strong>und</strong> einfach ist,<br />
Videoüberwachung als abschließendes Beispiel gewählt. Ich möchte Ihnen illustrieren, dass man mit<br />
der These, die Folgen eines Konflikts hängen nicht primär vom Konfliktgeschehen, sondern von<br />
dessen Beobachtung durch (noch) Abwesende ab, Erkenntnisse bezüglich Überwachung, Zivilcourage<br />
<strong>und</strong> Intervention bekommt. Primär geht es mir hier nicht um die Konflikteindämmung durch<br />
Videoüberwachung, sondern um eine Erklärung <strong>für</strong> die ihr zugeschriebene Konfliktverschärfung.<br />
Blickt man in die Debatten, die um Videoüberwachung öffentlicher Räume geführt werden, hat man<br />
den Eindruck, Videoüberwachung bindet die Beobachteten. Datenschutz <strong>und</strong> Stigmatisierung<br />
einerseits, Sicherheit <strong>und</strong> Kosten andererseits, sind die entsprechenden Stichwörter. Mich interessiert<br />
dieser unterstellte Bindungseffekt <strong>und</strong> ich denke, eine Alternative zu geläufigen Begründungen,<br />
warum Videoüberwachung Kriminalität erhöhe, anführen zu können (am Beispiel des Hansaplatzes in<br />
Hamburg siehe Imke Schmincke in Grätz <strong>und</strong> Knopp, 2011: 51). Eine Metaanalyse zu den Effekten<br />
solcher Überwachung kommt zum Ergebnis, dass zwar Parkhäuser weniger Diebstahl zu verzeichnen<br />
haben, sich dies hingegen von Gewalt auf öffentlichen Plätzen <strong>und</strong> Transport nicht eindeutig<br />
nachweisen lässt (Welsh <strong>und</strong> Farrington, 2008: 14f.). Im Gegenteil, kann Videoüberwachung<br />
insbesondere Gewaltkriminalität steigern <strong>und</strong> dies nicht nur, weil sie diese verlagert (Verlagerung),<br />
sondern auch durch ein überzogenes Vertrauen in die Überwachung (Unbekümmertheit) <strong>und</strong> dadurch,<br />
dass mehr Fälle berichtet werden (Registrierung). 13 Diesen drei Gründen möchte ich einen weiteren<br />
Anfügen, der das Konfliktthema Moral bzw. Zivilcourage mit dem Sich-beobachtet-Wissen bzw.<br />
Verbreitungsmedien der Kommunikation verknüpft. Mir geht es darum, zu zeigen, dass Überwachung,<br />
ob durch Videokameras an Gebäuden oder in ubiquitär verfügbaren Mobiltelefonen auch ein<br />
Konfliktauslöser <strong>und</strong> -Verstärker sein kann.<br />
Wie man von terroristischen Weltereignissen weiß, sind ihr Ziel <strong>und</strong> ihre Umsetzung nicht willkürlich.<br />
Sie hängen maßgeblich davon ab, dass sie einer weltweiten Beobachtung zugänglich sind, deren<br />
Erwartungen sie verunsichern (Stichweh, 2006: 283f.). Doch nicht nur der Terrorismus bietet<br />
Beispiele da<strong>für</strong>, dass die Präsenz von Videoaufzeichnung dazu führen kann, Konflikte überhaupt erst<br />
zu motivieren. Auch das sogenannte ‚Happy Slapping‘ oder ‚Cyber-Bullying‘ bieten Möglichkeiten,<br />
Gewalteinsatz <strong>und</strong> Konflikte nicht Anwesenden mitzuteilen <strong>und</strong> gerade darum Konflikte zu<br />
motovieren. Man muss dies nicht psychologisch anhand einer Kompensation <strong>für</strong> einen<br />
Anerkennungsverfall erklären, der als Folge von Sozialisation <strong>und</strong> Erziehung Gewalteinsatz als letzte<br />
Chance sieht (Paul, 2007; Anhut, 2008; Sponsel, 2001). 14 Es reicht der Hinweis auf<br />
Verbreitungsmedien, die eine ‚technisch separierte Beobachtung‘ zulassen, die sich von den situativen<br />
Anforderungen des Konfliktgeschehens entbinden kann (Luhmann, 1984: 409). Hier kommt der<br />
systemtheoretisch interessante Aspekt einer unterstellten Videoüberwachung <strong>und</strong> ihrer<br />
Bindungswirkung zu tragen.<br />
13<br />
„CCTV could also cause crime to increase. For example, it could give potential victims a false sense of<br />
security and make them more vulnerable because they relax their vigilance or stop taking precautions, such as<br />
walking in groups at night and not wearing expensive jewelry. It may encourage increased reporting of crimes to<br />
the police and increased recording of crimes by the police. CCTV may also cause crime to be displaced to other<br />
locations, times, or victims.“ (Welsh <strong>und</strong> Farrington, 2008: 4)<br />
14<br />
Bei Paul heißt es: „Die zeitgenössische Schamlosigkeit ist Ausdruck uneingestandener, verhüllter <strong>und</strong><br />
tabuisierter Scham; als solche jedoch steigert sie die Gewalt, ist deren Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> nicht ihre Schranke. … In der<br />
Konsequenz verhallt der Ruf nach Anerkennung, der wesentlich zur Scham gehört, in leeren Räumen. Und um<br />
die ausbleibende Anerkennung zu kompensieren, kommt es zu inszenierten Schamlosigkeiten <strong>und</strong> gewaltsamem<br />
Handeln.“ (Paul, 2007: 95)<br />
7<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
Einerseits ist zu attestieren, wie Rudolf Stichweh anhand soziologischer Beschreibungen zeigt, dass<br />
die Moderne von ihren Personen eine gewisse Indifferenz abverlangt. Es geht darum, wie Stichweh<br />
schreibt, „sich nicht auf alle diese Anderen bezogen zu fühlen. Psychische Störungen, in denen genau<br />
dies nicht gelingt <strong>und</strong> es zu einer Überflutung des Selbst kommt, machen die Unselbstverständlichkeit<br />
dieser Leistung deutlich, wie sie gleichzeitig auch darauf hindeuten, daß diese Leistung heute normativ<br />
erwartet wird.“ (Stichweh, 2010: 171f.; <strong>für</strong> Beispiele siehe Milgram, 1970) Gerade die Aufrufe zur<br />
Zivilcourage zeigen aber, dass es Konfliktthemen gibt, die ein Intervenieren nahe legen (z.B. bei einer<br />
moralisch bewerteten Diskriminierung). Ich möchte die These vertreten, dass zwar einerseits Konflikte<br />
durch Videoüberwachung eingeschränkt werden können, wenn z.B. ein Autodiebstahl im Parkhaus<br />
aufgr<strong>und</strong> dieser unterbleibt (Welsh <strong>und</strong> Farrington, 2008). Auch das Vertrauen in Videoüberwachung,<br />
in spezialisierte Rollen wie ‚neighborhood watch‘ oder den Streitenden eine „bürgerliche Gesittetheit<br />
in der Form einer minimal wohlwollenden Intention“ zu unterstellen (Stichweh, 2010: 170) kann<br />
motivieren, nicht einzugreifen <strong>und</strong> dem Streitgeschehen damit keine interaktionsübergreifende<br />
Relevanz zuzusprechen. Die sozialpsychologische Forschung hat unter dem Begriff bystander-effect<br />
situative Faktoren, die <strong>für</strong> das Nicht-Helfen verantwortlich sind, beschrieben (zum Überblick Emrich,<br />
1998). 15 Andererseits, scheint aber gerade die „technische Separierung der Beobachtung“ (Luhmann,<br />
1984: 409) auch dazu zu veranlassen, sich nicht nur auf Andere zu verlassen, sondern selbst zu<br />
intervenieren – <strong>und</strong> dies v.a. dann, wenn nur wenige andere Anwesend sind oder diese auch eingreifen<br />
<strong>und</strong> man nicht in Eile ist, sondern z.B. auf seine Bahn wartet (interessant zum Zeitdruck Darley <strong>und</strong><br />
Batson, 1973). Aus einer Pöbelei kann so schnell ein gewaltsamer, mitunter tödlich verlaufender<br />
Konflikt werden (Totschlag, Löschen eines Accounts), der dann Proteste, Gesetzesänderungen <strong>und</strong><br />
andere Maßnahmen auslösen kann. Die anfänglichen Streitparteien hätten vielleicht eine schnell<br />
bereinigte Bagatelle gehabt, eine Mücke. Das Einmischen anderer, verschärft den Konflikt.<br />
Die Einmischung ist von der Annahme motiviert, beobachtet zu werden. Das technisch separierte<br />
Beobachten, durch die Berichterstattung der Massenmedien, lässt die sich potentiell Einmischenden<br />
entweder couragiert erscheinen <strong>und</strong> Achtung erlangen oder aber beim Wegschauen, zu Missachtung<br />
führen. Wolfram Heuer hat in Interviews mit widerspenstigen DDR-Bürgern erkannt, dass diese mit<br />
der Zeit, regelrecht nach „interaktiven Konfliktstoffen“ suchen <strong>und</strong> Konflikte mitunter selbst<br />
„herbeiführen“. 16 Auch hier ist es die Erwartung, dass das Konfliktgeschehen eine Relevanz hat, die<br />
über das gegenwärtige Konfliktgeschehen hinaus weist, die dazu führt, dass der Konflikt an<br />
Bedeutung gewinnt. Systemtheoretisch lässt sich daran ein Bindungseffekt vom antizipierten<br />
Beobachtet werden erschließen, der als Bindungseffekt auf die Sozialdimension von Sinn <strong>und</strong> damit<br />
auf Moral verweist.<br />
Wie oben erläutert, ist Moral einer der Mechanismen, der Konflikte aufwertet. Wie die Scham, verteilt<br />
Moral Achtung <strong>und</strong> Missachtung nicht nur auf Einzelaspekte, sondern auf die gesamte Person (Paul,<br />
2007) 17 . Diese „funktional diffus[e]“ Gesamtbeurteilung der Moral lädt zum öffentlichen Streit ein<br />
15 Dieses Vertrauen scheint mit der Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong> die geringe Interventionsbereitschaft im Fall ‚Kitty Genovese‘ von<br />
1964 ebenso zu sein (interessant hierzu Manning et al., 2007), wie in der ignorierten Vergewaltigung in einer<br />
Hamburger S-Bahn (Kleine-Brockhoff, 1997).<br />
16 „Couragierte Menschen werden mit zunehmender Erfahrung Experten <strong>für</strong> das Aufspüren von interaktiven<br />
Konfliktstoffen, die sie persönlich sehr berühren. […] Es sind immer wieder ähnliche Konstellationen, in denen<br />
sich die Akteure zu abweichenden <strong>und</strong> mutigen Handeln herausgeforderter sehen, oder die sie gelegentlich auch<br />
unbewußt herbeiführen.“ Auch nach der Wiedervereinigung würde die „Mehrheit der Befragten […] der<br />
Bevölkerung [weiterhin] Vorwürfe“ machen (Heuer, 1998: 155f.), Neinsagebereitschaften also verstärken <strong>und</strong><br />
motivieren.<br />
17 „Die Scham sanktioniert die gesamte Person; […] Die Schuld hingegen bezieht sich auf ein bestimmtes Tun“<br />
(Paul, 2007: 91).<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013<br />
8
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
(Luhmann, 1984: 317). 18 Meine These ist, dass das in Rechnung stellen, von einer ‚technisch<br />
separierten‘ Beobachtung aus einer Bagatelle über Einmischung einen Konflikt generieren kann. Als<br />
Kommunikation orientiert sich auch der Konflikt an Erwartungen, also gegenläufig zur Zeit des<br />
Kommunikationsprozesses (siehe oben 2.). Zu dieser Orientierung gehören die Wahrscheinlichkeit<br />
einer Aufzeichnung <strong>und</strong> deren Folgen <strong>für</strong> eine diffuse Gesamtbeurteilung der eigenen oder einer<br />
anderen Person. Durch Videoaufzeichnung werden massenmedial verwertbare Sequenzen erhalten, die<br />
eine spätere Beobachtung ermöglichen, vom gegenwärtigen Handlungsgeschehen aber antizipiert<br />
werden <strong>und</strong> Einmischung motiviert. So kann aus einer Mücke ein folgenreicher Elefant werden. Das<br />
dies geschieht, lässt sich an terroristische Weltereignisse sehen <strong>und</strong> kann erklären, warum<br />
Gewaltkriminalität trotz Videoüberwachung nicht zwingend abnimmt. 19 Eine Zunahme von<br />
Verbrechen trotz fest installierter oder mobil verfügbarer Videoaufzeichnung ist mit dieser Theorie,<br />
nicht nur auf Verlagerung, Unbekümmertheit oder Registrierung zurückzuführen (Greveler, 2012;<br />
Welsh <strong>und</strong> Farrington, 2008).<br />
Bedenkt man die Bindungswirkung ‚technisch separierter Beobachtung‘, die zu einem späteren<br />
Zeitpunkt, zu moralischen Urteilen führen kann, die dann die gesamte Person betreffen, lässt sich ein<br />
weiterer Gr<strong>und</strong> in der Einmischung couragierter BürgerInnen erkennen. Wolfram Heuers (1998: 155)<br />
Ergebnisse zeigen, dass das Handeln der Zivilcourage, wenn überhaupt, dann nicht aus<br />
gemeinschaftlichen, sondern aus partikulären Motiven heraus entsteht, denen es darum geht, eine<br />
verunsicherte „Ich-Identität wiederherzustellen“ (vgl. zum Terrorismus als Umgang mit Kontingenz<br />
Japp, 2007: 176f.). Die „Ich-Selektion“ (Luhmann, 1984: 373) wird damit konfrontiert, entweder<br />
später als indifferent oder couragiert zu erscheinen. Je nachdem, wie diese Frage entschieden wird<br />
oder welche Möglichkeiten bereitstehen, diese Bewertung von vornherein abzuschieben (Telefonieren,<br />
Eile, Vertrauen auf Gesittetheit <strong>und</strong> auf Überwachung), legt dies ein entsprechendes öffentliches<br />
Verhalten nahe. Einerseits mag Videoaufzeichnung helfen Verbrechen <strong>und</strong> Konflikte einzudämmen,<br />
andererseits provoziert sie diese.<br />
5. Schlussbemerkung: Publikum <strong>und</strong> folgenreiche Konfliktsysteme<br />
Ich hoffe Sie mit der These überrascht zu haben, dass das abwesende Publikum eines<br />
Konfliktgeschehens mehr Beachtung von der <strong>Konfliktforschung</strong> verdienen sollte, als die Gründe der<br />
Streitparteien oder der Prozess des Konfliktgeschehens. Wichtige Anschlussfragen wären darum:<br />
- Wie kann das hochintegrative Konfliktgeschehen überhaupt ignoriert oder beobachtet werden<br />
<strong>und</strong> variiert dies historisch, technisch <strong>und</strong> an Konfliktthemen;<br />
- lassen sich Werte <strong>für</strong> das Konflikterleben identifizieren (z.B. Unterhaltung, Abschreckung);<br />
- welche Funktion kommt dem Erleben <strong>und</strong> Beobachten <strong>für</strong> die Streitenden, ihr Streitthema <strong>und</strong><br />
dessen Regulierung zu <strong>und</strong> wie beschreiben diese Streitenden ihr Publikum;<br />
- verändert die Beobachtung das Konfliktgeschehen <strong>und</strong> wirkt dies auf das Publikum zurück?<br />
Tobias Werron (2010a: 64-71) hat in seiner Dissertation zur Entstehung des modernen Sports gezeigt,<br />
wie nicht nur Wettkampfbetrieb <strong>und</strong> Regeln, sondern auch die technisch ermöglichte Inklusion des<br />
Publikums dazu geführt hat (ebd.: 255f.), sportliche Leistungen global zu vergleichen. Das Publikum,<br />
so Werrons innovative These, ist neben Wettkampfbetrieb <strong>und</strong> Regeln einer der Mechanismen, der<br />
18<br />
„Auch Moral […] wirk[t] konfliktfördernd, indem sie in Aussicht stell[t], daß man mit der eigenen Position<br />
auf der richtigen Seite liegt <strong>und</strong> die Gegenseite der öffentlichen Ablehnung […] aussetzen kann.“ (ebd.: 535)<br />
19<br />
Insgesamt konnte in Stadtzentren ein Kriminalitätsrückgang von 7% <strong>und</strong> in Parkhäusern von 51% verzeichnet<br />
werden. Interessant ist, dass es zu einer Zunahme von ‚violent crimes‘ im Stadtzentrum Cambridges, im<br />
Vergleich zu dessen Kontrollgruppe kam (siehe Welsh <strong>und</strong> Farrington, 2008: 14, 16f.). Für einen Einzelfall,<br />
siehe die Intervention eines couragierten Bürgers (Diehl <strong>und</strong> Langer, 2009).<br />
9<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
dazu führt, dass sportliche Leistungen, über das lokale Wettkampfgeschehen hinaus, global<br />
aufeinander bezogen, bewertet, verglichen, projektiert <strong>und</strong> damit schließlich motiviert werden. Für<br />
mich stellt sich hier die Frage, ob dies auch von der Ausdifferenzierung folgenreicher Konfliktsysteme<br />
zu behaupten ist. Konfliktthemen scheinen ein Publikum zu rekrutieren, das Schädigungen zuschreibt,<br />
Gründe unterstellt <strong>und</strong> Reaktionen projektiert. Dadurch stattet das Publikum, das Konfliktgeschehen<br />
mit interaktionsübergreifende Relevanz aus. Vielleicht ließe sich sagen, dass es bei den Möglichkeiten<br />
der Beobachtung ebenso Verschiebungen gibt, wie bei den Konfliktthemen. War <strong>für</strong> nationalstaatliche<br />
Gesellschaftssysteme der Verweis auf Politik wichtig, um einen Konflikt als relevant erscheinen zu<br />
lassen, mag das in der primär funktional differenzierten Weltgesellschaft nicht zwingend der Fall zu<br />
sein. Nicht nur die Beobachtung lässt sich durch Medien der Kommunikation, internationalen<br />
Tourismus, globale Rankings <strong>und</strong> vielen anderen Strukturen global orientieren, sondern es ist –<br />
zumindest systemtheoretisch – zu attestieren, dass die moderne Gesellschaft, die Politik als ein<br />
Funktionssystem neben andere verordnet. Jedes dieser Funktionssysteme kann Konflikte auslösen,<br />
sofern darauf spezialisierte ‚Parasiten‘, ob Supertheorien oder investigativer Journalismus,<br />
Widersprüche konstituieren <strong>und</strong> mitteilen (Stichweh, 2005: 61). Auf Ebene eines Einzelnen, kann<br />
gerade Moral, die eine Person in all ihren Hinsichten bewertet, ein folgenreiches Konfliktthema<br />
werden <strong>und</strong> nicht nur Unterdrückung, ökonomische Ungleichheit, F<strong>und</strong>amentalismus oder<br />
Diskriminierung. Konflikte generieren durch ihre Themen Beiträge <strong>und</strong> damit Fortsetzbarkeit.<br />
Ich hoffe auch gezeigt zu haben, dass ein Vertrauen auf Konflikte als Reinigungskräfte, riskant ist.<br />
Konflikte entbrennen nicht an den – <strong>für</strong> wen auch immer – wichtigsten Stellen, sondern hängen von<br />
der Inklusion eines Publikums ab. Vielleicht lässt sich auch von folgenreichen Konflikten sagen, dass<br />
sie nicht gleichverteilt, hier <strong>und</strong> dort, überraschend entstehen, sondern extremverteilt (hierzu allgemein<br />
Barabási <strong>und</strong> Albert, 1999). Nur wenige Themen – z.B. Fremdheit, Ungleichheit, Legitimität,<br />
Unterdrückung, Ökologie, Anerkennung – erlangen rasant gesellschaftliche Relevanz. Die meisten<br />
anderen Ablehnungen verhallen – zum Beispiel eine abgewiesene Liebeserklärung – oder, wie in<br />
Organisationen typisch, dürfen nur äußerst restriktiv geäußert werden – mit Folgen <strong>für</strong> Beratung <strong>und</strong><br />
psychische Systeme (früher Rückenleiden, heute Burn-Out). Auf Hinweise hierzu <strong>und</strong> zur Rolle des<br />
Publikums, bin ich sehr gespannt.<br />
Ende<br />
Philipp Rückheim, GSL Universität Luzern, Februar 2013<br />
Literatur<br />
ANHUT, R. 2008. Die Konflikttheorie der Desintegrationstheorie. In: BONACKER, T. (hg.)<br />
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien. Eine Einführung. Wiesbaden, VS Verlag <strong>für</strong><br />
Sozialwissenschaften, 4. Aufl., S. 381-407.<br />
BALDWIN, J. 1998. Stranger in the Village. Collected Essays. The Library of America. S. 117-129.<br />
BARABÁSI, A.-L. & ALBERT, R. 1999. Emergence of Scaling in Random Networks. Science, 286, S. 509-<br />
512.<br />
BAVELAS, B. J., BLACK, A., CHOVIL, N. & MULLETT, J. 1990. Equivocal Communication, Sage<br />
Publications.<br />
BONACKER, T. 2008. Die Konflikttheorie der autopoietischen Systemtheorie. Sozialwissenschaftliche<br />
Konflikttheorien: Eine Einführung. Wiesbaden, VS Verlag <strong>für</strong> Sozialwissenschaften. S. 267-291.<br />
COLLINS, R. 1975. Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science, New York, Academic Press.<br />
DAHRENDORF, R. 1967. Pfade aus Utopia. Zu einer Neuorientierung der soziologischen Analyse. Pfade aus<br />
Utopia. Arbeiten zur Theorie <strong>und</strong> Methode der Soziologie. Gesammelte Abhandlungen I. München,<br />
Piper. S. 242-263. Erstveröffentlicht 1958 im American Journal of Sociology.<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013<br />
10
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
DARLEY, J. M. & BATSON, D. C. 1973. "From Jerusalem to Jericho": A Study Of Situational And<br />
Dispositional Variables In Helping Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 27, S. 100-<br />
108.<br />
DIEHL, J. & LANGER, A. 2009. S-Bahn-Überfall in München: Warum Videokameras Gewaltexzesse nicht<br />
verhindern. Spiegel Online [Online]. Unter: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/s-bahn-ueberfall-inmuenchen-warum-videokameras-gewaltexzesse-nicht-verhindern-a-648916.html<br />
[abgerufen am<br />
02.05.2010].<br />
EMRICH, M. 1998. Gleichgültigkeit <strong>und</strong> Altruismus im Spiegel der Sozialpsychologie. In: KRAUSE, P. &<br />
SCHWELLING, B. (hrsg.) Gleichgültigkeit <strong>und</strong> Gesellschaft: Interdisziplinäre Annäherungen an ein<br />
Phänomen. Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz. S. 137-150.<br />
GRÄTZ, R. & KNOPP, H.-G. (hrsg.) 2011. Konfliktkulturen. Texte zu Politik, Gesellschaft, Alltag <strong>und</strong> Kunst,<br />
Göttingen: Steidl Aufl.<br />
GREVELER, U. 2012. Wenn Straftaten nach Videoüberwachung ansteigen: Über den Nutzen der bildlichen<br />
Überwachung des öffentlichen Raumes. SciLogs [Online]. Unter:<br />
http://www.scilogs.de/wblogs/blog/datentyp/allgemein/2012-12-26/wenn-straftaten-nach-videoberwachung-ansteigen<br />
[abgerufen am 02.01.2013].<br />
GUTTMANN, A. 1978. From ritual to record : the nature of modern sports, New York, Columbia Univ. Press.<br />
HEUER, W. 1998. "Ich kann nicht anders. Ich muß reden." Eine Untersuchung über den Habitus couragierter<br />
Menschen. In: KRAUSE, P. & SCHWELLING, B. (hrsg.) Gleichgültigkeit <strong>und</strong> Gesellschaft:<br />
Interdisziplinäre Annäherungen an ein Phänomen. Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz. S. 151-164.<br />
HOLMES, S. 1988. Gag rules or the politics of omission. In: ELSTER, J. & SLAGSTAD, R. (hrsg.)<br />
Constitutionalism and Democracy. Cambridge, Cambridge University Press. S. 19-58.<br />
HONNETH, A. 1992. Mißachtung <strong>und</strong> Widerstand: zur moralischen Logik sozialer Konflikte. Kampf um<br />
Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main, Suhrkamp. S. 256-<br />
273.<br />
JAPP, K. P. 2007. Terrorismus als Konfliktsystem. In: KRON, T. & REDDIG, M. (hrsg.) Analysen des<br />
transnationalen Terrorismus. Wiesbaden, VS Verlag <strong>für</strong> Sozialwissenschaften. S. 166-193.<br />
KANT, I. 1784. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Berlinische Monatsschrift, S.<br />
385-411.<br />
KLEINE-BROCKHOFF, T. 1997. Vergewaltigung in der S-Bahn: Fürs Wegsehen gibt es viele Gründe. Die Zeit<br />
Online [Online]. Unter: http://www.zeit.de/1997/18/wegschau.txt.19970425.xml/komplettansicht<br />
[abgerufen am 04.02.2013].<br />
LIN, C. 2010. Studying Chinese culture and conflict: a research agenda. International Journal of Conflict<br />
Management, 21, S. 70-93.<br />
LUHMANN, N. 1984. Soziale Systeme. Gr<strong>und</strong>riß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp.<br />
LUHMANN, N. 1998. Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2 Bd. 1997.<br />
LUHMANN, N. 2009. Interaktion, Organisation, Gesellschaft. Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie<br />
der Gesellschaft. Wiesbaden, VS Verlag <strong>für</strong> Sozialwissenschaften, 6. Aufl., S. 9-24.<br />
Erstveröffentlichung in: Gerhardt, M. (Hrsg.): Die Zukunft der Philosophie, München 1975, S. 85-107.<br />
MANNING, R., LEVINE, M. & COLLINS, A. 2007. The Kitty Genovese Murder and the Social Psychology of<br />
Helping: The Parable of the 38 Witnesses. American Psychologist, 62, S. 555-562.<br />
MESSMER, H. 2003. Der soziale Konflikt. Kommunikative Emergenz <strong>und</strong> systemische Reproduktion, Stuttgart,<br />
Lucius & Lucius.<br />
MESSMER, H. 2005. Zur kommunikativen Neutralisierung sozialer Konflikte in den Verfahren des Rechts. In:<br />
LERCH, K. D. (hg.) Recht vermitteln: Strukturen, Formen <strong>und</strong> Medien der Kommunikation im Recht.<br />
Die Sprache des Rechts, Bd. 3. Berlin, Walter de Gruyter. S. 233-266.<br />
MILGRAM, S. 1970. The Experience of Living in Cities. Adaptations to urban overload create characteristic<br />
qualities of city life that can be measured. Science, 167, S. 1461-1468.<br />
PAUL, A. T. 2007. Die Gewalt der Scham: Elias, Duerr <strong>und</strong> das Problem der Historizität menschlicher Gefühle.<br />
Mittelweg, 36, S. 77-99.<br />
SIMON, F. B. 2004. Tödliche Konflikte. Zur Selbstorganisation privater <strong>und</strong> öffentlicher Kriege, Heidelberg,<br />
Carl-Auer-Systeme Verlag, zweite, korrigierte <strong>und</strong> erweiterte Auflage Aufl.<br />
SPONSEL, R. 2001. Bindungs-Paradoxa, pathologische Bindungen <strong>und</strong> andere nicht ohne weiteres verständliche<br />
Bindungserscheinungen - auch im Alltag. Fachtagung Bindungstheorie. ARGE Sozialpädagogik /<br />
Akademie <strong>für</strong> Psychoanalyse in Wien.<br />
STICHWEH, R. 2005. Inklusion <strong>und</strong> Exklusion: Studien zur Gesellschaftstheorie, Bielefeld, Transcript.<br />
STICHWEH, R. 2006. Der 11. September 2001 <strong>und</strong> seine Folgen <strong>für</strong> die Entwicklung der Weltgesellschaft: Zur<br />
Genese des terroristischen Weltereignisses. In: BONACKER, T. & WELLER, C. (hrsg.) Konflikte der<br />
Weltgesellschaft. Akteure - Strukturen - Dynamiken. Frankfurt am Main/New York. S. 279-292.<br />
STICHWEH, R. 2010. Fremdheit in der Weltgesellschaft: Indifferenz <strong>und</strong> Minimalsympathie. Der Fremde.<br />
Studien zu Soziologie <strong>und</strong> Sozialgeschichte. Frankfurt am Main, Suhrkamp. S. 162-176. Gestrich, A.<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013<br />
11
Zur Bedeutsamkeit des Konflikts durch Thema <strong>und</strong> Publikum<br />
<strong>und</strong> Raphael L. (Hg.), Inklusion / Exklusion. Studien zu Fremdheit <strong>und</strong> Armut von der Antike bis zur<br />
Gegenwart, Frankfurt am Main: Lang, 2004, S. 35-47.<br />
TACITUS 1968. Germania. Lateinisch <strong>und</strong> Deutsch, München, Rowohlt.<br />
TJOSVOLD, D. & SUN, H. F. 2002. Understanding Conflict Avoidance: Relationship, Motivations, Actions,<br />
and Consequences. International Journal of Conflict Management, 13, S. 142-164.<br />
TÜRK, J. 2011. Die Immunität der Literatur, Kindle Edition.<br />
VUCHINICH, S., EMERY, R. E. & CASSIDY, J. 1988. Family Members as Third Parties in Dyadic Family<br />
Conflict: Strategies, Alliances, and Outcomes. Child Development, 59, S. 1293-1302.<br />
WAGNER, U., BRÜGGEN, N., GERLICHER, P. & SCHEMMERLING, M. 2012. Wo der Spaß aufhört...<br />
Jugendliche <strong>und</strong> ihre Perspektive auf Konflikte in Sozialen Netzwerkdiensten. Teilstudie im Projekt<br />
"Das Internet als Rezeptions- <strong>und</strong> Präsentationsplattform <strong>für</strong> Jugendliche" im Auftrag der Bayerischen<br />
Landeszentrale <strong>für</strong> neue Medien (BLM). München: JFF – Institut <strong>für</strong> Medienpädagogik in Forschung<br />
<strong>und</strong> Praxis.<br />
WEAVER, K. R. 1986. The Politics of Blame Avoidance. Journal of Public Policy, 6, S. 371-398.<br />
WEBER, M. 2007. Die Stadt. In: RUNKEL, G. (hg.) Die Stadt. Hamburg, LIT Verlag. S. 7-26.<br />
WELSH, B. P. & FARRINGTON, D. C. 2008. Effects of closed circuit television surveillance on crime.<br />
Campbell Systematic Reviews, 17.<br />
WERRON, T. 2010a. Der Weltsport <strong>und</strong> sein Publikum. Zur Autonomie <strong>und</strong> Entstehung des modernen Sports,<br />
Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, 1 Aufl.<br />
WERRON, T. 2010b. Direkte Konflikte, indirekte Konkurrenzen: Unterscheidung <strong>und</strong> Vergleich zweier Formen<br />
des Kampfes. Zeitschrift <strong>für</strong> Soziologie, 39, S. 302-318.<br />
WICKERT, E. 1988. Die geheimen Andeutungen der Chinesen. Der fremde Osten: China <strong>und</strong> Japan. Stuttgart,<br />
Deutsche Verlags-Anstalt. S. 181-190.<br />
Beitrag von Philipp Rückheim zum 45.<strong>AFK</strong>-Kolloquium, 2013<br />
12