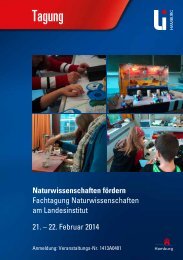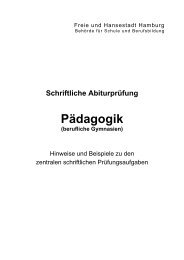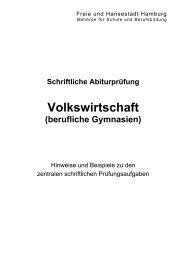Ausbildungsqualität im Vorbereitungsdienst. Evaluation aus Anlass ...
Ausbildungsqualität im Vorbereitungsdienst. Evaluation aus Anlass ...
Ausbildungsqualität im Vorbereitungsdienst. Evaluation aus Anlass ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Ausbildungsqualität</strong> <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong><br />
Dr. Monika Renz<br />
Andreas Soltau<br />
<strong>Evaluation</strong>sbüro<br />
Tel. 428 842 229<br />
Monika.Renz@li-hamburg.de<br />
<strong>Evaluation</strong> <strong>aus</strong> <strong>Anlass</strong> des Projekts „Ausbildung 2013“<br />
April 2012
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einordnung und Zielsetzung ........................................................................................... 3<br />
2 Anlage der Befragungen ................................................................................................. 4<br />
3 Ergebnisse der Erhebungen ........................................................................................... 6<br />
3.1 Veranstaltungsformate am Landesinstitut ....................................................................... 6<br />
Fazit zu den Veranstaltungsformaten ........................................................................... 16<br />
3.2 Ausbildungselemente in geteilter Verantwortung von Landesinstitut und<br />
Ausbildungsschulen ...................................................................................................... 17<br />
Fazit zu den Ausbildungselementen ............................................................................. 21<br />
3.3 Organisation des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es ...................................................................... 22<br />
Fazit zur Organisation des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es ........................................................ 29<br />
3.4 Leistungsbewertung und Prüfungen ............................................................................. 30<br />
Fazit zu Leistungsbewertung und Prüfungen ................................................................ 39<br />
3.5 Einschätzung der Seminarleitungen zum Kompetenzerwerb ........................................ 40<br />
Fazit zum Kompetenzerwerb ........................................................................................ 44<br />
4 Zusammenfassung der Ergebnisse .............................................................................. 45<br />
2
1 Einordnung und Zielsetzung<br />
Im Rahmen der Reform der Lehrerbildung in Hamburg kam es ab 2004 zu substantiellen Veränderungen<br />
<strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong>. Die Neugestaltung des Referendariats durch veränderte Zeitstrukturen<br />
und die Implementierung von Ausbildungscurricula war Gegenstand einer umfassenden<br />
wissenschaftlichen <strong>Evaluation</strong>, die 2006 abgeschlossen wurde 1 . Seither wurden <strong>aus</strong>gewählte<br />
strukturelle und qualitative Aspekte der Ausbildung in unterschiedlichen <strong>Evaluation</strong>ssettings auf<br />
den Prüfstand gestellt. Einen solchen besonderen Fokus hatten etwa die <strong>Evaluation</strong> eines Lehramts-übergreifenden<br />
Hauptseminars 2 und eine Studie zum Lehrertraining 3 . Module – als <strong>im</strong><br />
Rahmen der Reform neu <strong>im</strong>plementiertes Format der Ausbildung – werden in der Abteilung Ausbildung<br />
(LIA) regelhaft evaluiert; mit einem standardisierten Fragebogen finden zu allen Modulen<br />
Onlinebefragungen statt, die für ein Feedback an die Veranstaltungsleitungen und auf aggregierter<br />
Ebene <strong>aus</strong>gewertet werden. Erkenntnisse zur Qualität der Haupt- und Fachseminare lieferten<br />
u.a. drei sog. Zentrale Veranstaltungsevaluationen des Landesinstituts in den Jahren 2007, 2009<br />
und 2010, die auf der Ebene von Seminaren, Unterabteilungen und der gesamten Abteilung LIA<br />
<strong>aus</strong>gewertet wurden. Hier gilt allerdings die Einschränkung, dass diese LI-übergreifenden <strong>Evaluation</strong>en<br />
nicht allen Bedarfen der Abteilung Ausbildung Rechnung tragen können. Schließlich hat<br />
die Abteilung Ausbildung eine hoch entwickelte Kultur des Feedbacks von Referendarinnen und<br />
Referendaren an Seminarleitungen, von Seminarleitungen an Leitungskräfte, von Teilnehmenden<br />
diverser Angebote an die Veranstalter und <strong>im</strong> Rahmen moderierter Verfahren der Reflexion über<br />
Qualität. In der Summe ist damit bereits ein reiches Wissen über die Qualität der Ausbildung einschließlich<br />
bekannter Schwächen und anerkannter Entwicklungsbedarfe vorhanden.<br />
Ab 2013 steht nun erneut ein Strukturwandel bevor, wenn Absolventinnen und Absolventen der<br />
Bachelor-Master-Struktur in die zweite Phase der Ausbildung eintreten. In die Konzeptentwicklung<br />
<strong>im</strong> Rahmen des Projekts „Ausbildung 2013“ sollte empirisch gewonnenes Wissen über die<br />
Qualität der Ausbildung <strong>aus</strong> verschiedenen Perspektiven eingehen. Aus diesem Grund fanden <strong>im</strong><br />
Herbst 2011 Befragungen von Referendarinnen und Referendaren sowie Seminarleitungen statt.<br />
Die Erhebungen verfolgten das Ziel, eine Einschätzung des Lehrernachwuchses zum gegenwärtigen<br />
Stand der Ausbildung einzuholen, insbesondere zu den Veranstaltungsformaten und Ausbildungskomponenten,<br />
zur Kohärenz der Ausbildung und zum Prüfungswesen. Des Weiteren<br />
sollte die Umfrage den Referendarinnen und Referendaren Gelegenheit geben, am Prozess der<br />
Neugestaltung teilzuhaben und Vorschläge einzubringen. In ähnlicher Weise sollten auch die<br />
Haupt- und Fachseminarleitungen sowie Lehrertrainer eine Einschätzung des Status quo abgeben.<br />
Zugleich sollte die Befragung die bereits angelegte Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen<br />
am Reformprozess unterstützen.<br />
1 Hamburger Reform der Lehrerbildung. <strong>Evaluation</strong> der Umgestaltung der zweiten Phase. Abschlussbericht<br />
vom November 2006 von Prof. Dr. Eva Arnold, Universität Hamburg<br />
2 Begleitende <strong>Evaluation</strong> eines lehramtsübergreifenden Pilotseminars für Referendare und Referendarinnen.<br />
Abschlussbericht vom September 2010 von Dr. Ute Marie Metje<br />
3 Die Wirksamkeit des Lehrertrainings. Eine Studie mit Referendar/innen der Ausbildungskohorten 05/2009<br />
und 11/2010. Abschlussbericht vom Dezember 2011 von Dr. Julia Kosinar.<br />
3
2 Anlage der Befragungen<br />
Die Durchführung der Befragungen erfolgte in der Federführung des <strong>Evaluation</strong>sbüros am LI in<br />
Abst<strong>im</strong>mung mit dem Leitungsteam der Abteilung LIA und dem Personalrat der Referendare. Da<br />
sowohl bei den Referendarinnen und Referendaren als auch bei den Seminarleitungen und weiteren<br />
Trainern eine <strong>aus</strong>reichende Medienaffinität vor<strong>aus</strong>gesetzt werden konnte, wurde das Onlinebefragungsportal<br />
des LI eingesetzt. Sämtliche Referendarinnen und Referendare sowie das<br />
gesamte lehrende Personal wurden durch Email zur Befragung eingeladen und hatten von Ende<br />
September bis Anfang Oktober 2011 zwölf Tage Zeit zur Beantwortung.<br />
Die Online-Fragebögen waren so angelegt, dass in weiten Teilen Vergleiche zwischen der Gruppe<br />
der Referendarinnen und Referendare einerseits und den Seminarleitungen andererseits<br />
möglich sind. Die gemeinsamen Itemblöcke umfassten insbesondere folgende Themen:<br />
• Bewertung der Veranstaltungsformate am LI (einschließlich Einschätzung bezüglich künftigem<br />
Stellenwert)<br />
• Bewertung aller Ausbildungselemente (einschließlich derjenigen an Ausbildungsschulen)<br />
• Bewertung organisatorischer Aspekte (u.a. Zeitstrukturen, Zusammenarbeit am LI und zwischen<br />
den Ausbildungsorten, Situation an der Ausbildungsschule)<br />
• Einschätzung von Leistungsbewertung und Prüfungen (einschließlich Anregungen für die<br />
künftige Gestaltung)<br />
Auf die Seminarleitungen beschränkt blieb ein Fragenkomplex, der eine globale Einschätzung<br />
zum Kompetenzerwerb vor dem Hintergrund des neu gefassten Referenzrahmens zum Ziel hatte.<br />
Eine Reihe von Frage-Items wurde der <strong>Evaluation</strong> von Prof. Arnold (2006) entnommen. Dadurch<br />
ist es möglich, an best<strong>im</strong>mten Stellen Beharrungs- wie Veränderungstendenzen zu identifizieren,<br />
indem die aktuellen Antworten der Seminarleitungen sowie der Referendarinnen und Referendare<br />
<strong>aus</strong> 2011 mit den bei Arnold (2006) veröffentlichten Daten verglichen werden.<br />
Zu den Befragungen eingeladen waren insgesamt 1021 Referendarinnen und Referendare sowie<br />
187 Seminarleiterinnen und Seminarleiter einschließlich Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer.<br />
Trotz intensiver Werbung blieb die Beteiligung bedauerlicherweise hinter den Erwartungen zurück.<br />
Sie liegt für die Referendarinnen und Referendare bei 24%, für das lehrende Personal bei<br />
42%. Siehe Tabelle 1.<br />
Die Onlinebefragungen beider Gruppen boten auch reichlich Gelegenheit zu freien Anmerkungen.<br />
Die Auswertung dieser Rückmeldungen erfolgte durch die Abteilung Ausbildung <strong>im</strong> Rahmen<br />
des Diskussionsprozesses „Ausbildung 2013“. Der vorliegende Bericht beschränkt sich auf eine<br />
Darstellung des standardisierten Teils der Erhebungen.<br />
4
Tabelle 1: Stichprobengrößen und Rücklaufquoten der Erhebung<br />
ReferendarInnen (2011) Seminarleitungen (2011)<br />
Grundgesamtheit 1021 187<br />
Stichprobe (N) 256 79<br />
weiblich 179 (68%) 44 (56%)<br />
männlich 76 (29%) 34 (43%)<br />
Rücklaufquote in Prozent 24 42<br />
Bemerkenswert ist, dass sich die Rücklaufquoten der Referendarserhebung deutlich zwischen<br />
den Lehrämtern unterscheiden. Die höchste Bereitschaft, sich an der Befragung zu beteiligen,<br />
war bei den Referendarinnen und Referendaren für das Lehramt an beruflichen Schulen vorhanden<br />
(Tabelle 2). Eine inzwischen gut entwickelte Feedbackkultur an beruflichen Schulen und die<br />
Häufigkeit von Mitarbeiter- und Kundenbefragungen in Betrieben könnten der Grund für die größere<br />
Aufgeschlossenheit dieses Personenkreises für eine Befragung sein.<br />
Tabelle 2: Lehramtsspezifische Stichprobenverteilung der Referendarserhebung<br />
Lehramt Pr<strong>im</strong>arstufe &<br />
Sekundarstufe I mit<br />
Sonderschule - LIA 1<br />
5<br />
Lehramt Gymnasien und<br />
Stadtteilschulen mit<br />
Sekundarstufe II - LIA 2<br />
Lehramt Berufliche<br />
Schulen - LIA 3<br />
Grundgesamtheit 464 371 182<br />
Stichprobe (N) 94 84 77<br />
Rücklaufquote in Prozent 20 23 42
3 Ergebnisse der Erhebungen<br />
3.1 Veranstaltungsformate am Landesinstitut<br />
Gegenstand der Befragung der Referendarinnen und Referendare waren zunächst die klassischen<br />
Veranstaltungsformate Hauptseminar, Fachseminar und Lehrertraining, die das Rückgrat<br />
der Ausbildung – auch <strong>im</strong> Sinne zeitlicher Kontinuität - darstellen. Das Antwortformat war vierstufig.<br />
Die Ergebnisse werden bezogen auf die Gesamtstichprobe als Verteilungen aufbereitet, Vergleiche<br />
zwischen den Lehrämtern bzw. zwischen den Veranstaltungsformaten erfolgen auf der<br />
Grundlage von Mittelwerten und graphisch repräsentierten Standardabweichungen. Dabei werden<br />
bei den lehramtsbezogenen Vergleichen signifikante Abweichungen markiert.<br />
Bei der Bewertung des Veranstaltungsformats Hauptseminar fällt zunächst auf, dass die Referendarinnen<br />
und Referendare mit Anteilen von 42% bzw. 34% nicht oder eher nicht der Meinung<br />
sind, dass auf individuelle Vor<strong>aus</strong>setzungen bzw. individuelle Interessen eingegangen werden<br />
kann (Abb. 1). Besonders geschätzt wird am Hauptseminar wiederum die Kontinuität, mit einer<br />
Zust<strong>im</strong>mung von 90%.<br />
Wie bewerten Sie die Veranstaltungsform Hauptseminar?<br />
Die Inhalte sind sinnvoll gewählt.<br />
Die Arbeitsformen sind angemessen.<br />
Das Anforderungsniveau ist angemessen.<br />
Auf individuelle Vor<strong>aus</strong>setzungen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Auf individuelle Interessen kann eingegangen<br />
werden.<br />
st<strong>im</strong>me voll zu st<strong>im</strong>me eher zu st<strong>im</strong>me eher nicht zu st<strong>im</strong>me nicht zu missing<br />
Der kontinuierliche Charakter ist für die<br />
Ausbildung wichtig.<br />
Abbildung 1: Bewertung der Veranstaltungsform Hauptseminar<br />
16%<br />
18%<br />
Unterschiede zwischen den Lehrämtern fallen hier gering <strong>aus</strong>, signifikant ist nur die höhere Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>im</strong> beruflichen Lehramt zu der Aussage, dass das Anforderungsniveau angemessen<br />
sei (Abb. 2).<br />
6<br />
42%<br />
37%<br />
40%<br />
39%<br />
74%<br />
46%<br />
48%<br />
45%<br />
42%<br />
33%<br />
26%<br />
16%<br />
9%<br />
11%<br />
12% 3%<br />
9%<br />
8%<br />
6%<br />
2%<br />
2%<br />
2%<br />
ReferendarInnen (N=256)
Wie bewerten Sie die<br />
Veranstaltungsform<br />
Hauptseminar?<br />
Die Inhalte sind sinnvoll gewählt.<br />
Die Arbeitsformen sind angemessen.<br />
Das Anforderungsniveau ist angemessen.<br />
Auf individuelle Vor<strong>aus</strong>setzungen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Auf individuelle Interessen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Der kontinuierliche Charakter der<br />
Hauptseminargruppe ist für die Ausbildung<br />
wichtig.<br />
3,24<br />
3,29<br />
3,36<br />
3,11<br />
3,25<br />
3,35<br />
3,16<br />
3,11<br />
3,44<br />
2,60<br />
2,54<br />
2,79<br />
2,75<br />
2,62<br />
2,92<br />
3,61<br />
3,69<br />
3,68<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
Abbildung 2: Lehramtsspezifische Bewertung der Veranstaltungsform Hauptseminar<br />
Wie bewerten Sie die Veranstaltungsform Fachseminar?<br />
Die Inhalte sind sinnvoll gewählt.<br />
Die Arbeitsformen sind angemessen.<br />
Das Anforderungsniveau ist angemessen.<br />
Auf individuelle Vor<strong>aus</strong>setzungen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Auf individuelle Interessen kann eingegangen<br />
werden.<br />
Abbildung 3: Bewertung der Veranstaltungsform Fachseminar<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
24%<br />
23%<br />
32%<br />
7<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
43%<br />
37%<br />
59%<br />
37%<br />
42%<br />
49%<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
49%<br />
43%<br />
29%<br />
25%<br />
32%<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me voll zu st<strong>im</strong>me eher zu st<strong>im</strong>me eher nicht zu st<strong>im</strong>me nicht zu missing<br />
Der kontinuierliche Charakter ist für die<br />
Ausbildung wichtig.<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)<br />
11% 1%<br />
14%<br />
2%<br />
10% 2%<br />
6%<br />
6%<br />
6% 0%<br />
ReferendarInnen (N=256)
Die Bewertung der Veranstaltung Fachseminar folgt <strong>im</strong> Großen und Ganzen dem Muster des<br />
Hauptseminars (Abb. 3). Auch hier ist die Einschätzung bezüglich Individualisierung eher verhalten.<br />
Tendenziell ist die Zufriedenheit der Referendarinnen und Referendare für das Lehramt an<br />
Gymnasien geringer, wenn auch nicht <strong>im</strong>mer nachweislich signifikant (Abb. 4).<br />
Wie bewerten Sie die<br />
Veranstaltungsform<br />
Fachseminar?<br />
Die Inhalte sind sinnvoll gewählt.<br />
Die Arbeitsformen sind angemessen.<br />
Das Anforderungsniveau ist angemessen.<br />
Auf individuelle Vor<strong>aus</strong>setzungen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Auf individuelle Interessen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Der kontinuierliche Charakter der<br />
Fachseminargruppe ist für die Ausbildung<br />
wichtig.<br />
3,37<br />
3,23<br />
3,36<br />
3,15<br />
2,94<br />
3,34<br />
3,32<br />
3,08<br />
3,32<br />
2,94<br />
2,63<br />
2,88<br />
2,94<br />
2,67<br />
2,93<br />
3,50<br />
3,52<br />
3,58<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Abbildung 4: Lehramtsspezifische Bewertung der Veranstaltungsform Fachseminar<br />
Abweichungen von der Bewertung der Hauptseminare und Fachseminare weist die Einschätzung<br />
des Lehrertrainings auf. Angesichts der Besonderheiten dieser Ausbildungskomponente und vor<br />
dem Hintergrund von Ergebnissen der zentralen Veranstaltungsevaluationen am LI und einer<br />
qualitativen <strong>Evaluation</strong>sstudie zum Lehrertraining (siehe Fußnote 3 auf S. 3) sind diese nicht<br />
überraschend. Abb. 5 stellt das Meinungsbild dar, das sich <strong>im</strong> Übrigen nicht nach Lehrämtern<br />
unterscheidet.<br />
8<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Veranstaltungsform Lehrertraining?<br />
Die Inhalte sind sinnvoll gewählt.<br />
Die Arbeitsformen sind angemessen.<br />
Das Anforderungsniveau ist angemessen.<br />
Auf individuelle Vor<strong>aus</strong>setzungen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Auf individuelle Interessen kann eingegangen<br />
werden.<br />
st<strong>im</strong>me voll zu st<strong>im</strong>me eher zu st<strong>im</strong>me eher nicht zu st<strong>im</strong>me nicht zu missing<br />
Der kontinuierliche Charakter ist für die<br />
Ausbildung wichtig.<br />
Abbildung 5: Bewertung der Veranstaltungsform Lehrertraining<br />
18%<br />
18%<br />
Zu denken geben sollte nicht nur die aktuell eher kritische Einschätzung des Formats Lehrertraining,<br />
sondern auch die Tendenz, diese Ausbildungskomponente stärker als in der Vergangenheit<br />
in Frage zu stellen. Zum Zeitpunkt der <strong>Evaluation</strong> der Ausbildungsreform 2006 (siehe S. 3, Fußnote<br />
1) war offenbar die Akzeptanz des noch neuen Formats, auf das sich vielfältige Erwartungen<br />
richteten, erkennbar höher. Über einige „Generationen“ von Referendarinnen und Referendaren<br />
hinweg kam es offenbar zu einem Imageverlust. Abb. 6 enthält einen Vergleich identischer Frageitems<br />
<strong>aus</strong> den Befragungen von 2006 und 2011.<br />
9<br />
24%<br />
29%<br />
30%<br />
35%<br />
40%<br />
39%<br />
34%<br />
24%<br />
42%<br />
39%<br />
20%<br />
27%<br />
28%<br />
24%<br />
17%<br />
13%<br />
13%<br />
13%<br />
15%<br />
23%<br />
3%<br />
2%<br />
3%<br />
10% 3%<br />
9% 3%<br />
3%<br />
ReferendarInnen (N=256)
Wie bewerten Sie die<br />
Veranstaltungsform<br />
Lehrertraining?<br />
Die Inhalte sind sinnvoll gewählt.<br />
Die Arbeitsformen sind angemessen.<br />
Das Anforderungsniveau ist<br />
angemessen.<br />
Abbildung 6: Vergleich der Bewertung des Lehrertrainings mit Arnold (2006)<br />
3,10<br />
2,65<br />
3,17<br />
2,63<br />
3,16<br />
2,69<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (2006, N=178, Arnold Befr. 4)<br />
ReferendarInnen (2011, N=256)<br />
Der Vergleich der Veranstaltungsformate Hauptseminar, Fachseminar und Lehrertraining macht<br />
die Stärken und Schwächen <strong>im</strong> Lichte der Einschätzung der Referendarinnen und Referendare<br />
noch einmal deutlich (Abb. 7). Während das Lehrertraining das Eingehen auf individuelle Interessen<br />
und Ausgangslagen eher ermöglicht als Seminare, werden Inhalte, Arbeitsformen und Anforderungen<br />
kritisch beurteilt.<br />
10<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me zu<br />
(4.0)
Die Inhalte sind sinnvoll gewählt.<br />
Die Arbeitsformen sind angemessen.<br />
Das Anforderungsniveau ist<br />
angemessen.<br />
Auf individuelle Vor<strong>aus</strong>setzungen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Auf individuelle Interessen kann<br />
eingegangen werden.<br />
Der kontinuierliche Charakter ist für<br />
die Ausbildung wichtig.<br />
3,30<br />
3,32<br />
2,65<br />
3,23<br />
3,14<br />
2,63<br />
3,23<br />
3,24<br />
2,69<br />
2,64<br />
2,82<br />
2,92<br />
2,76<br />
2,85<br />
3,05<br />
3,66<br />
3,53<br />
2,62<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
Hauptseminar Fachseminar Lehrertraining<br />
Abbildung 7: Vergleichende Bewertung der Veranstaltungsformen Hauptseminar, Fachseminar und<br />
Lehrertraining<br />
Nicht <strong>im</strong> Fokus dieser <strong>Evaluation</strong> standen Module und selbst gesteuerte Gruppen. Die Module<br />
sind Gegenstand regelhafter <strong>Evaluation</strong> in der Abteilung LIA. Die selbst gesteuerten Gruppen<br />
haben unterschiedliche Formen und Zielsetzungen. Ihre Wirksamkeit sollte auf den Prüfstand<br />
gestellt werden, wenn eine erste Stabilisierung eingetreten ist.<br />
Mit Bezug auf die Frage, welche Bedeutung einzelnen Formaten für den Kompetenzaufbau <strong>im</strong><br />
Referendariat zukommt, wurden jedoch auch Module und selbst gesteuerte Gruppen in den Blick<br />
genommen. Hier sollen auch die Einschätzungen der Referendarinnen und Referendare und der<br />
Seminarleitungen einander gegenüber gestellt werden (Abb. 8).<br />
Be<strong>im</strong> Vergleich zeigt sich, dass das lehrende Personal sowohl dem Lehrertraining als auch den<br />
selbst gesteuerten Gruppen einen höheren Stellenwert für den Kompetenzaufbau einräumt als<br />
die Referendarinnen und Referendare. Unterschiede nach Lehrämtern zeigen sich <strong>aus</strong>schließlich<br />
bei der Meinungsäußerung zu selbst gesteuerten Gruppen (Abb. 9). Referendarinnen und Referendare<br />
<strong>im</strong> Lehramt für berufliche Schulen haben damit offenbar gute Erfahrungen gemacht oder<br />
zeichnen sich durch einen Habitus des selbständigen Arbeitens <strong>im</strong> Team <strong>aus</strong>.<br />
11<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me zu<br />
(4.0)<br />
ReferendarInnen (N=256)
Wie schätzen Sie die Bedeutung der einzelnen Veranstaltungsformen für den<br />
Aufbau professioneller Kompetenzen ein?<br />
Hauptseminar<br />
Fachseminar<br />
Lehrertraining<br />
Module<br />
selbst gesteuerte<br />
Gruppen<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
3,48<br />
3,70<br />
3,70<br />
3,93<br />
2,36<br />
2,77<br />
2,67<br />
2,71<br />
2,37<br />
2,75<br />
unwichtig<br />
(1.0)<br />
eher<br />
unwichtig<br />
(2.0)<br />
Abbildung 8: Bedeutung unterschiedlicher Veranstaltungsformen für Kompetenzaufbau<br />
Wie schätzen Sie die Bedeutung der<br />
einzelnen Veranstaltungsformen für den<br />
Aufbau professioneller Kompetenzen ein?<br />
Hauptseminar<br />
Fachseminar<br />
Lehrertraining<br />
Module<br />
selbst gesteuerte Gruppen<br />
3,37<br />
3,46<br />
3,62<br />
3,68<br />
3,68<br />
3,78<br />
2,32<br />
2,36<br />
2,39<br />
2,70<br />
2,67<br />
2,62<br />
2,38<br />
2,14<br />
2,61<br />
unwichtig<br />
(1.0)<br />
Abbildung 9: Lehramtsspezifische Bedeutung unterschiedlicher Veranstaltungsformen für Kompetenzaufbau<br />
12<br />
eher<br />
wichtig<br />
(3.0)<br />
sehr<br />
wichtig<br />
(4.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
eher unwichtig<br />
(2.0)<br />
*sign.<br />
eher wichtig<br />
(3.0)<br />
sehr wichtig<br />
(4.0)
Sowohl Referendarinnen und Referendare als auch Seminarleitungen wurden auch danach befragt,<br />
wie sie die Beziehungen zwischen den Veranstaltungsformaten beurteilen. Beide Seiten<br />
sind sich darin einig, dass die Formate <strong>im</strong> Wesentlichen klare Funktionen haben und dass es<br />
tendenziell auch gelingt, ergänzende Inhalte zu behandeln. Gleichzeitig sind sich aber auch Ausbilder<br />
und Lehrernachwuchs übereinst<strong>im</strong>mend bewusst, dass die wechselseitige Abst<strong>im</strong>mung<br />
und Vernetzung noch zu wünschen übrig lassen. Siehe Abb. 10.<br />
Es gelingt...<br />
...den einzelnen<br />
Veranstaltungsformen deutlich<br />
unterscheidbare Funktionen<br />
zuzuweisen.<br />
...in den einzelnen<br />
Veranstaltungsformen einander<br />
ergänzende Inhalte zu behandeln.<br />
...die Inhalte und Themen der<br />
verschiedenen Veranstaltungsformen<br />
aufeinander abzust<strong>im</strong>men.<br />
...die Lernprozesse in den<br />
verschiedenen Veranstaltungsformen<br />
zu vernetzen.<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Abbildung 10: Vernetzung und Koordination der Ausbildungskomponenten<br />
3,19<br />
3,34<br />
2,77<br />
2,86<br />
2,18<br />
2,19<br />
2,17<br />
2,15<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
Dieses Meinungsbild hat sich <strong>im</strong> Übrigen in fünf Jahren, seit der <strong>Evaluation</strong> der Ausbildungsreform<br />
durch Prof. Arnold, nicht geändert (Abb. 11-12). Die inhaltliche Abst<strong>im</strong>mung der Ausbildungsinhalte<br />
über die verschiedenen Komponenten hinweg erweist sich als besondere Her<strong>aus</strong>forderung.<br />
13<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me zu<br />
(4.0)
Es gelingt...<br />
...den einzelnen<br />
Veranstaltungsformen deutlich<br />
unterscheidbare Funktionen<br />
zuzuweisen.<br />
...in den einzelnen<br />
Veranstaltungsformen einander<br />
ergänzende Inhalte zu behandeln.<br />
...die Inhalte und Themen der<br />
verschiedenen Veranstaltungsformen<br />
aufeinander abzust<strong>im</strong>men.<br />
3,07<br />
3,34<br />
2,82<br />
2,86<br />
2,10<br />
2,19<br />
Abbildung 11: Vernetzung und Koordination der Veranstaltungsformate; Vergleich mit Arnold<br />
(2006) <strong>aus</strong> Sicht der Seminarleitungen<br />
Es gelingt...<br />
...den einzelnen<br />
Veranstaltungsformen deutlich<br />
unterscheidbare Funktionen<br />
zuzuweisen.<br />
...in den einzelnen<br />
Veranstaltungsformen einander<br />
ergänzende Inhalte zu behandeln.<br />
...die Inhalte und Themen der<br />
verschiedenen Veranstaltungsformen<br />
aufeinander abzust<strong>im</strong>men.<br />
Seminarleitungen (2004-2005, N=134, Arnold Befr. 1,2,3)<br />
Seminarleitungen (2011, N=79)<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
3,34<br />
3,19<br />
2,86<br />
2,77<br />
2,08<br />
2,18<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
Abbildung 12: Vernetzung und Koordination der Veranstaltungsformate; Vergleich mit Arnold<br />
(2006) <strong>aus</strong> Sicht der Referendarinnen und Referendare<br />
14<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
ReferendarInnen (2004-2006, N=592, Arnold Befr. 1-4)<br />
ReferendarInnen (2011, N=256)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me zu<br />
(4.0)<br />
st<strong>im</strong>me zu<br />
(4.0)
Im Hinblick auf die bevorstehende Reform der zweiten Phase der Lehrerbildung wurde von den<br />
Befragten eine Einschätzung erbeten, welchen Stellenwert die einzelnen Veranstaltungstypen<br />
künftig haben sollten. Einig sind sich Referendarinnen und Referendare wie auch Seminarleitungen<br />
darin, die klassischen Seminarformate eher zu stärken und fächerübergreifende und themenspezifische<br />
Angebote sowie Formate mit hoher Interaktion und Eigenbeteiligung eher zu reduzieren.<br />
Welchen Stellenwert würden Sie diesen<br />
Veranstaltungsformen in Zukunft zuweisen?<br />
Hauptseminar<br />
Fachseminar<br />
Lehrertraining<br />
Module<br />
selbst gesteuerte<br />
Gruppen<br />
reduzieren<br />
(-1.0)<br />
Abbildung 13: Zukünftiger Stellenwert unterschiedlicher Veranstaltungsformen<br />
Die vertretenen Positionen sind allerdings nicht unabhängig vom Lehramt. Besonders stark<br />
scheint die Neigung, die Ausbildung auf Haupt- und Fachseminare zu konzentrieren, bei Referendarinnen<br />
und Referendaren für das Lehramt an Gymnasien. Selbst gesteuerte Gruppen wiederum<br />
möchten künftige Lehrkräfte an beruflichen Schulen weniger gerne „opfern“ als ihre Kolleginnen<br />
und Kollegen. Siehe Abb. 14.<br />
15<br />
ReferendarInnen (N=256)<br />
Seminarleitungen (N=79)<br />
-0,40<br />
-0,43<br />
-0,17<br />
-0,40<br />
-0,46<br />
-0,24<br />
0,32<br />
0,34<br />
0,48<br />
0,67<br />
beibehalten<br />
(0.0)<br />
stärken<br />
(1.0)
Welchen Stellenwert würden Sie<br />
diesen Veranstaltungsformen in<br />
Zukunft zuweisen?<br />
Hauptseminar<br />
Fachseminar<br />
Lehrertraining<br />
Module<br />
selbst gesteuerte<br />
Gruppen<br />
reduzieren<br />
(-1.0)<br />
Abbildung 14: Lehramtsspezifische Einschätzung zum zukünftigen Stellenwert unterschiedlicher<br />
Veranstaltungsformen<br />
Fazit zu den Veranstaltungsformaten<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Die Zufriedenheit der Referendarinnen und Referendare mit Haupt- und Fachseminaren ist insgesamt<br />
hoch, wenn auch die Berücksichtigung individueller Bedarfe und Interessen kritisch beurteilt<br />
wird. Sie plädieren sogar für eine Ausweitung dieser Formate bei künftigen Ausbildungsreformen<br />
(und sind sich hier mit den Seminarleitungen einig). Die Bewertung des Lehrertrainings<br />
bleibt dahinter zurück, sieht man von Stärken bei der Individualisierung ab. Beide Gruppen von<br />
Befragten sprechen sich eher für eine Reduzierung <strong>aus</strong>. Für den Aufbau professioneller Kompetenzen<br />
kommt nach einhelliger Meinung Haupt- und Fachseminaren <strong>im</strong> Vergleich mit Lehrertraining,<br />
Modulen und selbst gesteuerten Gruppen die größte Bedeutung zu. Unterschiede zeigen<br />
sich punktuell zwischen den Lehrämtern. Referendarinnen und Referendare an beruflichen Schulen<br />
(die <strong>im</strong> Übrigen überproportional an der Befragung beteiligt sind) sind tendenziell zufriedener,<br />
wissen selbst gesteuerte Gruppen eher zu schätzen, halten aber Lehrertraining für eher verzichtbar.<br />
Referendarinnen und Referendare an Gymnasien sind in den Fachseminaren tendenziell<br />
weniger zufrieden und möchten Haupt- und Fachseminare gestärkt wissen, während sie von<br />
selbst gesteuerten Gruppen weniger überzeugt sind.<br />
16<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
-0,40<br />
-0,32<br />
-0,51<br />
-0,18<br />
-0,11<br />
-0,22<br />
-0,49<br />
-0,57<br />
-0,32<br />
0,22<br />
0,50<br />
0,25<br />
0,44<br />
0,63<br />
0,38<br />
*sign.<br />
beibehalten<br />
(0.0)<br />
stärken<br />
(1.0)
3.2 Ausbildungselemente in geteilter Verantwortung von<br />
Landesinstitut und Ausbildungsschulen<br />
Ungeachtet konkreter Veranstaltungstypen kommen in der Ausbildung Formen von Anleitung und<br />
Beratung, von handlungsorientiertem Lernen, von Beobachtung und Reflexion zum Tragen. Einerseits<br />
sind sie Bestandteil der Veranstaltungen am Landesinstitut, andererseits sind sie Komponenten<br />
der Ausbildung an Ausbildungsschulen. Für deren Gewichtung und weitere Ausgestaltung<br />
<strong>im</strong> Rahmen einer Ausbildungsreform sind die Einschätzung des Status quo, aber auch die<br />
Vorstellungen zum künftigen Stellenwert von hohem Interesse. In der Befragung wurden den<br />
Referendarinnen und Referendaren, aber auch den Seminarleitungen insgesamt zwölf Elemente<br />
bezüglich ihrer Bedeutung für den Kompetenzaufbau und ihres künftigen Stellenwerts zur Diskussion<br />
gestellt. Das Antwortformat war wiederum vierstufig.<br />
Wie schätzen Sie die Bedeutung der einzelnen<br />
Elemente für den Aufbau professioneller<br />
Kompetenzen ein?<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Eigenverantwortlicher Unterricht<br />
Angeleiteter Unterricht<br />
Unterrichtsbesuche der MentorInnen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Hauptseminarleitungen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Fachseminarleitungen<br />
Beratung durch MentorInnen<br />
Beratung durch Hauptseminarleitungen<br />
Beratung durch Fachseminarleitungen<br />
Beratung <strong>im</strong> Lehrertraining<br />
Kleingruppenhospitationen/<br />
Unterrichtspraktische Übungen<br />
Portfolio<br />
Mitarbeit in schulischen Teams<br />
3,77<br />
3,28<br />
3,56<br />
3,68<br />
3,63<br />
3,75<br />
3,48<br />
3,70<br />
3,61<br />
3,86<br />
3,74<br />
3,77<br />
3,52<br />
3,68<br />
3,65<br />
3,87<br />
2,46<br />
2,77<br />
3,20<br />
3,74<br />
1,66<br />
2,52<br />
2,94<br />
2,93<br />
unwichtig<br />
(1.0)<br />
Abbildung 15: Bedeutung einzelner Ausbildungselemente für Kompetenzaufbau<br />
17<br />
eher unwichtig<br />
(2.0)<br />
eher wichtig<br />
(3.0)<br />
sehr wichtig<br />
(4.0)
An den Ergebnissen (Abb. 15) fällt auf, dass <strong>aus</strong> Referendarssicht dem eigenverantwortlichen<br />
Unterricht (der vielzitierten „Praxis“) höchste Bedeutung beigemessen wird. Beobachtendes und<br />
reflektierendes Lernen, wie es für Kleingruppenhospitationen und unterrichtspraktische Übungen,<br />
das Lehrertraining sowie das Portfolio charakteristisch ist, steht bei Referendarinnen und Referendaren<br />
<strong>im</strong> Vergleich mit Seminarleitungen weniger hoch <strong>im</strong> Kurs. Unterschiede zwischen den<br />
Lehrämtern sind nur in geringem Umfang vorhanden (Abb. 16).<br />
Wie schätzen Sie die Bedeutung der<br />
einzelnen Elemente für den Aufbau<br />
professioneller Kompetenzen ein?<br />
Eigenverantwortlicher Unterricht<br />
Angeleiteter Unterricht<br />
Unterrichtsbesuche der MentorInnen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Hauptseminarleitungen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Fachseminarleitungen<br />
Beratung durch MentorInnen<br />
Beratung durch Hauptseminarleitungen<br />
Beratung durch Fachseminarleitungen<br />
Beratung <strong>im</strong> Lehrertraining<br />
Kleingruppenhospitationen/Unterrichtspraktische<br />
Übungen<br />
Portfolio<br />
Mitarbeit in schulischen Teams<br />
3,83<br />
3,63<br />
3,87<br />
3,54<br />
3,62<br />
3,52<br />
3,64<br />
3,69<br />
3,53<br />
3,43<br />
3,57<br />
3,42<br />
3,63<br />
3,64<br />
3,53<br />
3,81<br />
3,73<br />
3,69<br />
3,45<br />
3,65<br />
3,44<br />
3,63<br />
3,72<br />
3,57<br />
2,65<br />
2,37<br />
2,33<br />
3,21<br />
3,02<br />
3,38<br />
1,68<br />
1,57<br />
1,74<br />
2,86<br />
2,91<br />
3,06<br />
unwichtig<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Abbildung 16: Lehramtsspezifische Einschätzung zur Bedeutung einzelner Ausbildungselemente<br />
18<br />
eher unwichtig<br />
(2.0)<br />
eher wichtig<br />
(3.0)<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
sehr wichtig<br />
(4.0)
Die Einschätzungen haben sich <strong>im</strong> Zeitverlauf – soweit die Frageitems in der <strong>Evaluation</strong> der Ausbildungsreform<br />
von 2006 einen Vergleich möglich machen – kaum geändert (Abb. 17). Auffallend<br />
ist, konform mit den bereits unter 3.1 berichteten Ergebnissen, dass dem Lehrertraining inzwischen<br />
eine geringere Bedeutung für den Kompetenzaufbau beigemessen wird als vor fünf Jahren.<br />
Wie schätzen Sie die Bedeutung der<br />
einzelnen Veranstaltungsformen für den<br />
Aufbau professioneller Kompetenzen ein?<br />
Hauptseminar<br />
Fachseminar<br />
Module<br />
Lehrertraining<br />
Angeleiteter Unterricht<br />
Eigenverantwortlicher Unterricht<br />
Kleingruppenhospitationen/Unterrichtspraktische<br />
Übungen<br />
3,14<br />
3,48<br />
3,71<br />
3,70<br />
2,44<br />
2,67<br />
2,90<br />
2,36<br />
3,69<br />
3,56<br />
3,68<br />
3,77<br />
3,48<br />
3,20<br />
unwichtig<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (2006, N=178, Arnold Befr. 4)<br />
ReferendarInnen (2011, N=256)<br />
Abbildung 17: Vergleich der Einschätzungen zur Bedeutung unterschiedlicher Veranstaltungsformen<br />
mit Arnold (2006)<br />
Danach befragt, wie sie die Gewichtung der Elemente des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es künftig<br />
verschieben würden, äußern beide Gruppen nur wenige Vorschläge zur Entlastung, allen voran<br />
den Wunsch zur Reduktion des eigenverantwortlichen Unterrichts (Abb. 18). Bei der Beratung <strong>im</strong><br />
Lehrertraining und be<strong>im</strong> Portfolio sehen Referendarinnen und Referendare wie auch<br />
Seminarleitungen „Einsparpotential“. Seminarleitungen sprechen sich – insbesondere <strong>im</strong><br />
Vergleich mit den Referendarinnen und Referendaren – für mehr Unterrichtsbesuche von<br />
Fachseminarleitungen und für mehr Kleingruppenhospitationen bzw. unterrichtspraktische<br />
Übungen <strong>aus</strong>.<br />
19<br />
eher unwichtig<br />
(2.0)<br />
eher wichtig<br />
(3.0)<br />
sehr wichtig<br />
(4.0)
Welchen Stellenwert würden Sie diesem Ausbildungselement für die künftige Gestaltung<br />
des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es zuweisen?<br />
Eigenverantwortlicher<br />
Unterricht<br />
Angeleiteter Unterricht<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
MentorInnen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Hauptseminarleitungen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Fachseminarleitungen<br />
Beratung durch<br />
MentorInnen<br />
Beratung durch<br />
Hauptseminarleitungen<br />
Beratung durch<br />
Fachseminarleitungen<br />
Beratung <strong>im</strong><br />
Lehrertraining<br />
Kleingruppenhospitationen/<br />
Unterrichtspraktische Übungen<br />
Portfolio<br />
Mitarbeit in schulischen<br />
Teams<br />
reduzieren<br />
(-1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Abbildung 18: Stellenwert unterschiedlicher Ausbildungselemente für zukünftige Gestaltung des<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong>es<br />
Zwischen den Lehrämtern bestehen insofern Unterschiede, als Referendarinnen und Referendare<br />
an beruflichen Schulen eher wenig Änderungsbedarf sehen, abgesehen davon, dass sie Einschnitte<br />
be<strong>im</strong> Lehrertraining und Portfolio begrüßen würden. Referendarinnen und Referendare<br />
an Gymnasien hingegen wünschen sich mehr fachliche Beratung als ihre Kolleginnen und Kollegen<br />
und sehen besonderen Bedarf bei der Reduktion des eigenverantwortlichen Unterrichts. Siehe<br />
Abb. 19.<br />
20<br />
-0,35<br />
-0,67<br />
-0,37<br />
-0,36<br />
-0,04<br />
-0,80<br />
-0,36<br />
-0,10<br />
0,23<br />
0,45<br />
0,30<br />
0,53<br />
0,08<br />
0,30<br />
0,19<br />
0,64<br />
0,50<br />
0,53<br />
0,27<br />
0,32<br />
0,35<br />
0,51<br />
0,45<br />
0,03<br />
beibehalten<br />
(0.0)<br />
stärken<br />
(1.0)
Welchen Stellenwert würden Sie<br />
diesem Ausbildungselement für die<br />
künftige Gestaltung des<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong>es zuweisen?<br />
Eigenverantwortlicher<br />
Unterricht<br />
Angeleiteter<br />
Unterricht<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
MentorInnen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Hauptseminarleitungen<br />
Unterrichtsbesuche der<br />
Fachseminarleitungen<br />
Beratung durch<br />
MentorInnen<br />
Beratung durch<br />
Hauptseminarleitungen<br />
Beratung durch<br />
Fachseminarleitungen<br />
Beratung <strong>im</strong><br />
Lehrertraining<br />
Kleingruppenhospitationen/<br />
Unterrichtspraktische Übungen<br />
Portfolio<br />
Mitarbeit in schulischen<br />
Teams<br />
reduzieren<br />
(-1.0)<br />
Abbildung 19: Lehramtsspezifische Einschätzung zu künftiger Gestaltung des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es<br />
Fazit zu den Ausbildungselementen<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Die Veränderungswünsche betreffen eher eine Stärkung als eine Schwächung der einzelnen<br />
Komponenten – Wünsche, die allerdings durch das enge Zeitbudget schwer erfüllbar sind. Besonderes<br />
Gewicht hat hier jedoch der Ruf nach weniger eigenverantwortlichem Unterricht, gilt er<br />
doch der Qualitätssicherung derjenigen Ausbildungskomponente, die als besonders wichtig für<br />
den Kompetenzaufbau angesehen wird. Bemerkenswert ist die geringe Akzeptanz des Portfolios,<br />
das – kaum eingeführt – von vielen schon wieder zur Disposition gestellt wird.<br />
21<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
-0,20<br />
-0,55<br />
-0,30<br />
-0,07<br />
0,30<br />
0,42<br />
0,30<br />
0,46<br />
0,10<br />
0,04<br />
0,18<br />
0,03<br />
-0,32<br />
-0,26<br />
-0,54<br />
-0,03<br />
-0,11<br />
-0,86<br />
-0,78<br />
-0,75<br />
0,11<br />
0,35<br />
0,11<br />
0,56<br />
0,64<br />
0,28<br />
0,22<br />
0,42<br />
0,17<br />
0,33<br />
0,48<br />
0,25<br />
0,05<br />
0,00<br />
0,02<br />
0,05<br />
beibehalten<br />
(0.0)<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
stärken<br />
(1.0)
3.3 Organisation des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es<br />
Das organisatorische Gelingen ist sowohl von Rahmenbedingungen abhängig, auf die die Ausbildungspartner<br />
nur geringen oder keinen Einfluss haben, wie auch von gestaltbaren Faktoren.<br />
Zu ersteren sind die Zeitstrukturen zu rechnen, zu letzteren die Formen der Kooperation. Beide<br />
Aspekte wurden in der Befragung in den Blick genommen. Des Weiteren galt das Interesse der<br />
Situation an den Ausbildungsschulen. Wie in den vorangegangenen Abschnitten werden die Befragungsergebnisse<br />
anhand von vierstufigen Antwortformaten berichtet, wo möglich <strong>im</strong> Vergleich<br />
mit der <strong>Evaluation</strong> von 2006.<br />
Wenig überraschend ist, dass allgemein über Zeitnot geklagt wird, wobei sich die beiden Gruppen<br />
nicht <strong>im</strong>mer über die Einschätzung der jeweils anderen Gruppe <strong>im</strong> Klaren zu sein scheinen<br />
(Abb. 20).<br />
Wie bewerten Sie die Zeitstrukturen des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es?<br />
Die für die Ausbildung zur Verfügung<br />
stehende Zeit wird effizient genutzt.<br />
Zur Bearbeitung der verbindlichen Inhalte in<br />
den Seminaren steht <strong>aus</strong>reichend Zeit zur<br />
Verfügung.<br />
ReferendarInnen haben genügend Zeit, sich<br />
auf den Unterricht vorzubereiten.<br />
ReferendarInnen haben genügend Zeit, sich<br />
auf die Seminarveranstaltungen<br />
vorzubereiten.<br />
ReferendarInnen haben genügend Zeit, sich<br />
auf die Prüfungen vorzubereiten.<br />
2,87<br />
2,89<br />
2,19<br />
1,45<br />
1,97<br />
1,82<br />
1,98<br />
1,99<br />
2,14<br />
2,86<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
Abbildung 20: Zeitstrukturen des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Die Beurteilung des Faktors Zeit ist weitgehend deckungsgleich mit den Ergebnissen der <strong>Evaluation</strong><br />
der Ausbildungsreform von 2006. Siehe Abb. 21. Erfreulich ist allerdings, dass die 2011 befragten<br />
Referendarinnen und Referendare – <strong>im</strong> Gegensatz zum Meinungsbild vor fünf Jahren –<br />
der Aussage, die zur Verfügung stehende Zeit werde effizient genutzt, in deutlich höherem Maße<br />
zust<strong>im</strong>men können.<br />
22<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Zeitstrukturen<br />
des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es?<br />
Die für die Ausbildung zur Verfügung<br />
stehende Zeit wird effizient genutzt.*<br />
ReferendarInnen haben genügend Zeit,<br />
sich auf den Unterricht vorzubereiten.<br />
ReferendarInnen haben genügend Zeit,<br />
sich auf die Seminarveranstaltungen<br />
vorzubereiten.<br />
ReferendarInnen haben genügend Zeit,<br />
sich auf die Prüfungen vorzubereiten.<br />
Abbildung 21: Bewertung der Zeitstrukturen des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es <strong>im</strong> Vergleich mit Arnold<br />
(2006) 4<br />
Kooperation als Gelingensbedingung in der Ausbildung hat viele Facetten, von der räumlichzeitlichen<br />
Koordination über die Vernetzung von Inhalten bis zu gemeinsamen professionellen<br />
Haltungen und Konfliktlösungsstrategien. Mit Hilfe von neun Frageitems, die in den folgenden<br />
Graphiken berichtet werden, sollten wichtige D<strong>im</strong>ensionen erfasst werden.<br />
Abb. 22 vergleicht die Einschätzungen von Referendarinnen und Referendaren sowie von Seminarleitungen,<br />
die überraschend nah beieinander liegen. Unter dem Mittelwert von 2,5 der vierstufigen<br />
Skala liegen die Antworten zu zwei Items, die die Zusammenarbeit von Seminarleitungen<br />
und Mentorinnen und Mentoren der Ausbildungsschulen sowie ihr Unterrichtsverständnis betreffen.<br />
Aus Sicht beider Gruppen lässt die Abst<strong>im</strong>mung der Ausbildungspartner Landesinstitut und<br />
Ausbildungsschule an dieser Stelle zu wünschen übrig.<br />
Wie Abb. 24 zeigt, ist das Problem seit fünf Jahren erkannt. Bei dem Item „Koordination der Arbeit<br />
der Seminarleitungen und MentorInnen“ zeigt sich aber möglicherweise tatsächlich ein erster<br />
Trend zur Verbesserung. Die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von gutem Unterricht<br />
braucht naturgemäß mehr Zeit.<br />
4 Das mit einem * markierte Item wurde mit N=178 ReferendarInnen bei Arnold (2006) nur in Befragung 4<br />
eingesetzt.<br />
2,18<br />
2,87<br />
1,87<br />
1,97<br />
1,87<br />
1,98<br />
2,08<br />
2,14<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (2004-2006, N=592, Arnold Befr. 1-4)<br />
ReferendarInnen (2011, N=256)<br />
23<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit <strong>im</strong> Landesinstitut und zwischen den Lernorten?<br />
Die Arbeit der Seminarleitungen <strong>im</strong><br />
Landesinstitut ist gut koordiniert.<br />
Die Seminarleitungen am Landesinstitut<br />
haben ein gemeinsames Grundverständnis<br />
davon, was guter Unterricht ist.<br />
Es gibt eine gute Koordination der Arbeit<br />
zwischen den Seminarleitungen am<br />
Landesinstitut und den MentorInnen.<br />
Die Seminarleitungen am Landesinstitut und<br />
die MentorInnen haben ein gemeinsames<br />
Grundverständnis davon, was guter<br />
Unterricht ist.<br />
Die Organisation der Ausbildungsangebote<br />
<strong>im</strong> Landesinstitut ist gut auf den Alltag der<br />
Ausbildungsschule abgest<strong>im</strong>mt.<br />
Es besteht <strong>aus</strong>reichend Möglichkeit für die<br />
ReferendarInnen, das <strong>im</strong> Landesinstitut<br />
Erarbeitete an der Schule bzw. <strong>im</strong> Unterricht<br />
<strong>aus</strong>zuprobieren.<br />
Fragen und Probleme, die in der Arbeit an<br />
der Schule auftreten, können in<br />
Veranstaltungen des Landesinstituts<br />
bearbeitet werden.<br />
Im Konfliktfall suchen die Seminarleitungen<br />
am Landesinstitut und die MentorInnen bzw.<br />
Schulleitungen gemeinsam nach Lösungen.<br />
Die SeminarleiterInnen sind für<br />
ReferendarInnen Vorbilder für den<br />
kompetenten Umgang mit den<br />
Anforderungen der Lehrertätigkeit.<br />
Abbildung 22: Zusammenarbeit <strong>im</strong> Landesinstitut und zwischen den Lernorten<br />
2,76<br />
2,53<br />
2,73<br />
3,01<br />
1,95<br />
2,00<br />
2,17<br />
2,12<br />
2,62<br />
2,69<br />
2,59<br />
2,72<br />
2,77<br />
2,99<br />
2,66<br />
2,97<br />
3,00<br />
3,30<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Zwischen den Lehrämtern zeigen sich erneut leichte Unterschiede. Referendarinnen und Referendare<br />
an beruflichen Schulen sind zufriedener als ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn es um<br />
die Koordination der Arbeit der Seminarleitungen sowie der Seminarleitungen und Mentorinnen<br />
und Mentoren geht und um die Vorbildfunktion der Seminarleitungen (Abb. 23).<br />
24<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit <strong>im</strong><br />
Landesinstitut und zwischen den<br />
Lernorten?<br />
Die Arbeit der Seminarleitungen <strong>im</strong><br />
Landesinstitut ist gut koordiniert.<br />
Die Seminarleitungen am Landesinstitut<br />
haben ein gemeinsames Grundverständnis<br />
davon, was guter Unterricht ist.<br />
Es gibt eine gute Koordination der Arbeit<br />
zwischen den Seminarleitungen am<br />
Landesinstitut und den MentorInnen.<br />
Die Seminarleitungen am Landesinstitut und<br />
die MentorInnen haben ein gemeinsames<br />
Grundverständnis davon, was guter<br />
Unterricht ist.<br />
Die Organisation der Ausbildungsangebote<br />
<strong>im</strong> Landesinstitut ist gut auf den Alltag der<br />
Ausbildungsschule (z.B. Unterrichtszeiten,<br />
Konferenzen usw.) abgest<strong>im</strong>mt.<br />
Es besteht <strong>aus</strong>reichend Möglichkeit für die<br />
ReferendarInnen, das <strong>im</strong> Landesinstitut<br />
Erarbeitete an der Schule bzw. <strong>im</strong> Unterricht<br />
<strong>aus</strong>zuprobieren.<br />
Fragen und Probleme, die in meiner Arbeit<br />
an der Schule auftreten, kann ich in<br />
Veranstaltungen des Landesinstituts<br />
bearbeiten.<br />
Im Konfliktfall suchen die Seminarleitungen<br />
am Landesinstitut und die MentorInnen bzw.<br />
Schulleitungen gemeinsam nach Lösungen.<br />
Meine SeminarleiterInnen sind für mich<br />
Vorbilder für den kompetenten Umgang mit<br />
den Anforderungen der Lehrertätigkeit.<br />
2,73<br />
2,64<br />
2,97<br />
2,69<br />
2,88<br />
2,62<br />
1,96<br />
1,78<br />
2,14<br />
2,19<br />
2,14<br />
2,17<br />
2,57<br />
2,73<br />
2,55<br />
2,63<br />
2,55<br />
2,57<br />
2,75<br />
2,71<br />
2,85<br />
2,63<br />
2,75<br />
2,62<br />
2,85<br />
2,99<br />
3,19<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Abbildung 23: Lehramtsspezifische Einschätzung zur Zusammenarbeit <strong>im</strong> Landesinstitut und zwischen<br />
den Lernorten<br />
Im Zeitverlauf (Abb. 24), d.h. <strong>im</strong> Vergleich mit der <strong>Evaluation</strong> der Ausbildungsreform 2006 durch<br />
Prof. Arnold, zeigen sich wenig Auffälligkeiten. Erfreulich ist der leicht positive Trend bei der Einschätzung<br />
der Koordination innerhalb des Landesinstituts und mit den Mentorinnen und Mentoren.<br />
25<br />
st<strong>im</strong>me eher nicht<br />
zu<br />
(2.0)<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me eher zu<br />
(3.0)<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me voll zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit<br />
<strong>im</strong> Landesinstitut und zwischen den<br />
Lernorten?<br />
Die Arbeit der Seminarleitungen <strong>im</strong><br />
Landesinstitut ist gut koordiniert.<br />
Die Seminarleitungen am Landesinstitut<br />
haben ein gemeinsames<br />
Grundverständnis davon, was guter<br />
Unterricht ist.<br />
Es gibt eine gute Koordination der Arbeit<br />
zwischen den Seminarleitungen am<br />
Landesinstitut und den MentorInnen.<br />
Die Seminarleitungen am Landesinstitut<br />
und die MentorInnen haben ein<br />
gemeinsames Grundverständnis davon,<br />
was guter Unterricht ist.<br />
Die Organisation der<br />
Ausbildungsangebote <strong>im</strong> Landesinstitut<br />
ist gut auf den Alltag der<br />
Ausbildungsschule abgest<strong>im</strong>mt.<br />
Es besteht <strong>aus</strong>reichend Möglichkeit für<br />
die ReferendarInnen, das <strong>im</strong><br />
Landesinstitut Erarbeitete an der Schule<br />
bzw. <strong>im</strong> Unterricht <strong>aus</strong>zuprobieren.<br />
Fragen und Probleme, die in der Arbeit an<br />
der Schule auftreten, können in<br />
Veranstaltungen des Landesinstituts<br />
bearbeitet werden.<br />
Im Konfliktfall suchen die<br />
Seminarleitungen am Landesinstitut und<br />
die MentorInnen bzw. Schulleitungen<br />
gemeinsam nach Lösungen.<br />
2,47<br />
2,76<br />
2,79<br />
2,73<br />
1,75<br />
1,95<br />
2,11<br />
2,17<br />
2,42<br />
2,62<br />
2,67<br />
2,59<br />
2,85<br />
2,77<br />
2,66<br />
2,66<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (2006, N=178, Arnold Befr. 4)<br />
ReferendarInnen (2011, N=256)<br />
Abbildung 24: Vergleich zur Einschätzung der Zusammenarbeit <strong>im</strong> Landesinstitut und zwischen<br />
den Lernorten mit Arnold (2006)<br />
Über die Situation an den Ausbildungsschulen gibt es bislang wenig systematische Informationen.<br />
Die Lücke sollte durch die Befragung geschlossen werden, wobei die Mehrzahl der Frageitems<br />
an die Referendarinnen und Referendare gerichtet war (Abb. 25). Eine Einschätzung zur<br />
Ausbildung und Vorbildfunktion von Mentorinnen und Mentoren sowie zur Gesamtsituation wurde<br />
auch von den Seminarleitungen erbeten. Letztere haben eine deutlich skeptischere Wahrnehmung<br />
als die Referendarinnen und Referendare, insbesondere was die Ausbildung der Mentorinnen<br />
und Mentoren anbelangt.<br />
26<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Situation an den Ausbildungsschulen?<br />
Die MentorInnen sind für die Tätigkeit<br />
hinreichend <strong>aus</strong>gebildet.<br />
Die MentorInnen sind für ReferendarInnen<br />
Vorbilder für den kompetenten Umgang mit<br />
den Anforderungen der Lehrertätigkeit.<br />
Die Ausbildungsschulen sorgen dafür, dass<br />
die MentorInnen mindestens einmal pro<br />
Woche den eigenverantwortlichen Unterricht<br />
besuchen.*<br />
Die MentorInnen stehen regelmäßig für<br />
Beratungen bzw. Entwicklungsgespräche zur<br />
Verfügung.*<br />
Die Ausbildungsschulen organisieren die<br />
Stundenpläne so, dass Besuche <strong>im</strong><br />
eigenverantwortlichen Unterricht und<br />
Beratungsgespräche vorgesehen sind.*<br />
Alles in allem werden die ReferendarInnen<br />
durch Organisationsstrukturen und Personen<br />
in ihrer Ausbildungsschule so gut wie<br />
möglich unterstützt.<br />
2,90<br />
2,16<br />
3,13<br />
2,88<br />
2,87<br />
3,37<br />
2,90<br />
3,18<br />
2,70<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
Abbildung 25: Situation an den Ausbildungsschulen 5<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Nicht zu übersehen sind deutliche Unterschiede zwischen den Lehrämtern. Referendarinnen und<br />
Referendare an Gymnasien fühlen sich seltener durch Besuche <strong>im</strong> eigenverantwortlichen Unterricht<br />
unterstützt als ihre Kolleginnen und Kollegen. Referendarinnen und Referendare an beruflichen<br />
Schulen sind tendenziell am zufriedensten mit ihrer Ausbildungsschule. Siehe Abb. 26.<br />
5 Die mit einem * markierten Items wurden nur den Referendarinnen und Referendaren gestellt.<br />
27<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Situation an<br />
den Ausbildungsschulen?<br />
Meine MentorInnen sind für die Tätigkeit<br />
hinreichend <strong>aus</strong>gebildet.<br />
Meine MentorInnen sind für mich Vorbilder<br />
für den kompetenten Umgang mit den<br />
Anforderungen der Lehrertätigkeit.<br />
Meine Ausbildungsschule sorgt dafür, dass<br />
mich mein(e) MentorIn mindestens einmal<br />
pro Woche <strong>im</strong> eigenverantwortlichen<br />
Unterricht besucht.<br />
Mein(e) MentorIn steht regelmäßig für<br />
Beratungen bzw. Entwicklungsgespräche zur<br />
Verfügung.<br />
Meine Ausbildungsschule organisiert die<br />
Stundenpläne so, dass Besuche <strong>im</strong><br />
eigenverantwortlichen Unterricht und<br />
Beratungsgespräche vorgesehen sind.<br />
Alles in allem werde ich durch<br />
Organisationsstrukturen und Personen in<br />
meiner Ausbildungsschule so gut wie<br />
möglich unterstützt.<br />
2,98<br />
2,74<br />
2,97<br />
3,10<br />
3,05<br />
3,26<br />
3,07<br />
2,32<br />
3,24<br />
3,41<br />
3,23<br />
3,47<br />
2,97<br />
2,51<br />
3,29<br />
3,16<br />
3,00<br />
3,40<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Abbildung 26: Lehramtsspezifische Einschätzung zur Situation an den Ausbildungsschulen<br />
Veränderungen in den zurückliegenden fünf Jahren sind nicht zu erkennen. Allerdings ist ein<br />
Vergleich nur anhand von zwei Frageitems möglich (Abb. 27).<br />
28<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie bewerten Sie die Situation an<br />
den Ausbildungsschulen?<br />
Die MentorInnen sind für die Tätigkeit<br />
hinreichend <strong>aus</strong>gebildet.<br />
Die MentorInnen sind für<br />
ReferendarInnen Vorbilder für den<br />
kompetenten Umgang mit den<br />
Anforderungen der Lehrertätigkeit.<br />
Abbildung 27: Vergleich der Einschätzung zur Situation an den Ausbildungsschulen mit Arnold<br />
(2006)<br />
Fazit zur Organisation des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es<br />
2,89<br />
2,90<br />
2,99<br />
3,13<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (2006, N=178, Arnold Befr. 4)<br />
ReferendarInnen (2011, N=256)<br />
Die Situation <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong> ist unverändert von Zeitnot gekennzeichnet, die Möglichkeiten<br />
zur Effizienzsteigerung scheinen jedoch in den zurückliegenden fünf Jahren genutzt worden<br />
zu sein. Die Koordination der Ausbildung am Landesinstitut selbst und mit den Ausbildungsschulen<br />
und die Kooperation der Partner werden von den Befragten nicht durchgängig positiv beurteilt.<br />
Bei der Abst<strong>im</strong>mung der Arbeit und des professionellen Verständnisses von Seminarleitungen<br />
und Mentorinnen und Mentoren besteht nach wie vor Entwicklungsbedarf. Referendarinnen<br />
und Referendare an beruflichen Schulen sind mit der Organisation und Kooperation <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong><br />
und der Situation an den Ausbildungsschulen zufriedener als ihre Kolleginnen und<br />
Kollegen. Es stellt sich die Frage, ob die dort bewährten Praktiken wenigstens teilweise auf andere<br />
Schulformen übertragbar sind.<br />
29<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
3.4 Leistungsbewertung und Prüfungen<br />
Ein wesentlicher Teil der bevorstehenden Reform des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es wird die Leistungsbewertung<br />
und das Prüfungswesen betreffen. In den Erhebungen nahmen deshalb Fragen zu<br />
diesen Themen einen größeren Raum ein. Abgesehen von einer allgemeinen Einschätzung zur<br />
Fairness und Einheitlichkeit der Beurteilung ging es um die Frage der Eignung verschiedener<br />
Prüfungsformate für die Kompetenzfeststellung und um Vorschläge für die künftige Gestaltung<br />
des Prüfungswesens.<br />
Auffallend ist, dass die Referendarinnen und Referendare Skepsis hinsichtlich der Einheitlichkeit<br />
von Bewertungskriterien zum Ausdruck bringen (mit einem Mittelwert von 2,47 „neigt“ sich das<br />
Meinungsbild eher in die Richtung einer nicht zust<strong>im</strong>menden Einschätzung). Selbst die Seminarleitungen<br />
sind sich wenig sicher, dass das Ziel der Einheitlichkeit erreicht wird. Uneins sind sich<br />
die Gruppen, wenn es um die Beurteilung durch die Mentorinnen und Mentoren geht. Die Referendarinnen<br />
und Referendare trauen ihnen – mehr als die Seminarleitungen – eine faire Beurteilung<br />
zu. Siehe Abb. 28.<br />
Wie stehen Sie <strong>im</strong> Allgemeinen zur Praxis der Beurteilung <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong>?<br />
Die Bewertung der ReferendarInnen folgt<br />
einheitlichen Kriterien.<br />
In den Hauptseminaren gelingt es,<br />
ReferendarInnen fair zu beurteilen.<br />
In den Fachseminaren gelingt es,<br />
ReferendarInnen fair zu beurteilen.<br />
MentorInnen in den Ausbildungsschulen<br />
gelingt es, ReferendarInnen fair zu<br />
beurteilen.<br />
2,47<br />
2,70<br />
3,37<br />
3,01<br />
3,23<br />
3,04<br />
3,46<br />
2,78<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
Abbildung 28: Beurteilungspraxis <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong><br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Die Unterschiede zwischen den Lehrämtern sind gering (Abb. 29). Die Bewertungen gelten <strong>im</strong><br />
Übrigen mehr den Individuen als den Veranstaltungsformaten. Ein Feedback an einzelne Personen<br />
konnte und wollte diese <strong>Evaluation</strong> jedoch nicht leisten. Überlegungen zu regelhaften Rückmeldungen<br />
an die Seminarleitungen werden unabhängig von der vorliegenden <strong>Evaluation</strong> angestellt.<br />
30<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie stehen Sie <strong>im</strong> Allgemeinen zur<br />
Praxis der Beurteilung <strong>im</strong><br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong>?<br />
Die Bewertung der ReferendarInnen folgt<br />
einheitlichen Kriterien.<br />
In meinem Hauptseminar fühle ich mich<br />
fair beurteilt.<br />
In meinen Fachseminaren fühle ich mich<br />
fair beurteilt.<br />
Von meinem/er MentorIn an der<br />
Ausbildungsschule fühle ich mich fair<br />
beurteilt.<br />
2,52<br />
2,48<br />
2,35<br />
3,21<br />
3,44<br />
3,50<br />
3,24<br />
3,10<br />
3,35<br />
3,44<br />
3,45<br />
3,49<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Abbildung 29: Lehramtsspezifische Einschätzung zur Beurteilungspraxis <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong><br />
Im Fokus der Erhebungen zu den Prüfungsformaten stand die Frage der Eignung für die Kompetenzfeststellung<br />
der künftigen Lehrkräfte. Dabei wurden Meinungsäußerungen von Referendarinnen<br />
und Referendaren sowie Seminarleitungen eingeholt zu Lehrproben, mündlichen Prüfungen<br />
und H<strong>aus</strong>arbeiten. Diesen Prüfungsformaten wurden insgesamt sechs Teilkompetenzen zugeordnet,<br />
die diese in unterschiedlicher Zusammensetzung abbilden sollen sowie die Funktion, die<br />
Eignung für den Beruf in globaler Form festzustellen.<br />
Die Ergebnisdarstellung erfolgt in zweifacher Weise, zunächst für die einzelnen Prüfungsformate<br />
und anschließend für folgende D<strong>im</strong>ensionen: Überprüfung der Reflexionskompetenz, der fachlichen<br />
Kompetenz, der fachdidaktischen Kompetenz, der erziehungswissenschaftlichen Kompetenz<br />
und der Eignung für den Lehrerberuf insgesamt.<br />
Abb. 30 stellt die Einschätzungen von Referendarinnen und Referendaren einerseits und Seminarleitungen<br />
andererseits zu der Frage gegenüber, wie gut sich ihrer Meinung nach Lehrproben<br />
für die Kompetenzfeststellung eignen. Dabei gibt es einen durchgängigen Unterschied zwischen<br />
den Gruppen hinsichtlich des Vertrauens in die Eignung von Lehrproben. Bei drei von fünf Items<br />
bleibt der Mittelwert der Gruppe der Referendarinnen und Referendare sogar unter dem Skalenmittelwert<br />
von 2,5. Das heißt, diese Gruppe st<strong>im</strong>mt der Position <strong>im</strong> Durchschnitt eher nicht zu,<br />
dass Lehrproben geeignet sind, die fachliche Kompetenz und die Kompetenz in der Unterrichts-<br />
und Lernprozessgestaltung und insbesondere die Eignung für den Beruf zu überprüfen.<br />
31<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie schätzen Sie Lehrproben als Instrument der Bewertung ein?<br />
Lehrproben eignen sich dafür...<br />
...die Kompetenz <strong>im</strong> Bereich Unterrichts- und<br />
Lernprozessgestaltung zu überprüfen.<br />
...die Qualität der Reflexion über Unterrichtsund<br />
Lernprozessgestaltung zu überprüfen.<br />
...die fachliche Kompetenz zu überprüfen.<br />
...die fachdidaktische Kompetenz zu<br />
überprüfen.<br />
...die Eignung von ReferendarInnen für den<br />
Lehrerberuf zu überprüfen.<br />
2,41<br />
3,08<br />
2,81<br />
3,22<br />
2,31<br />
2,82<br />
2,59<br />
3,09<br />
2,16<br />
2,68<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Abbildung 30: Eignung von Lehrproben als Bewertungsinstrument<br />
Zwischen den Lehrämtern bestehen leichte Differenzen (Abb. 31). Referendarinnen und Referendare<br />
an Gymnasien stellen die Eignung der Lehrproben für die Feststellung der fachlichen<br />
Kompetenz mehr als andere in Frage, die Kolleginnen und Kollegen an beruflichen Schulen wiederum<br />
haben tendenziell größeres Vertrauen in dieses Prüfungsformat.<br />
32<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie schätzen Sie Lehrproben als Instrument der Bewertung ein?<br />
Lehrproben eignen sich dafür...<br />
...die Kompetenz <strong>im</strong> Bereich Unterrichtsund<br />
Lernprozessgestaltung zu<br />
überprüfen.<br />
...die Qualität der Reflexion über<br />
Unterrichts- und Lernprozessgestaltung<br />
zu überprüfen.<br />
...die fachliche Kompetenz zu überprüfen.<br />
...die fachdidaktische Kompetenz zu<br />
überprüfen.<br />
...die Eignung von ReferendarInnen für<br />
den Lehrerberuf zu überprüfen.<br />
2,34<br />
2,29<br />
2,60<br />
2,80<br />
2,83<br />
2,84<br />
2,34<br />
2,13<br />
2,48<br />
2,58<br />
2,48<br />
2,69<br />
2,07<br />
2,06<br />
2,36<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Abbildung 31: Lehramtsspezifische Beurteilung der Eignung von Lehrproben als Bewertungsinstrument<br />
Mündliche Prüfungen (Abb. 32) und die H<strong>aus</strong>arbeit (Abb. 33) werden weniger kontrovers eingeschätzt<br />
als Lehrproben, sei es zwischen den Gruppen oder den Lehrämtern. Der Stellenwert der<br />
H<strong>aus</strong>arbeit wird von beiden Gruppen eher gering angesetzt. Mündlichen Prüfungen wie H<strong>aus</strong>arbeiten<br />
wird für die Berufseignungsfeststellung wenig Bedeutung beigemessen.<br />
33<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie schätzen Sie mündliche Prüfungen als Instrument der Bewertung ein?<br />
Mündliche Prüfungen eignen<br />
sich dafür...<br />
...die Reflexionskompetenz in den<br />
verschiedenen professionellen Feldern zu<br />
überprüfen.<br />
...die fachdidaktische Kompetenz zu<br />
überprüfen.<br />
...die erziehungswissenschaftliche<br />
Kompetenz zu überprüfen.<br />
...die Eignung von ReferendarInnen für den<br />
Lehrerberuf zu überprüfen.<br />
Abbildung 32: Eignung von mündlichen Prüfungen als Bewertungsinstrument<br />
Abbildung 33: Eignung von H<strong>aus</strong>arbeitsnoten als Bewertungsinstrument<br />
2,94<br />
3,00<br />
2,87<br />
2,97<br />
2,77<br />
2,66<br />
2,00<br />
2,35<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
2,35<br />
2,58<br />
2,44<br />
2,45<br />
2,48<br />
2,74<br />
2,21<br />
2,23<br />
1,59<br />
1,72<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
34<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
Wie schätzen Sie die H<strong>aus</strong>arbeitsnote als Instrument der Bewertung ein?<br />
Die H<strong>aus</strong>arbeitsnote eignet sich<br />
dafür...<br />
...die Reflexionskompetenz in den<br />
verschiedenen professionellen Feldern zu<br />
überprüfen.<br />
...die fachliche Kompetenz zu überprüfen.<br />
...die fachdidaktische Kompetenz zu<br />
überprüfen.<br />
...die erziehungswissenschaftliche<br />
Kompetenz zu überprüfen.<br />
...die Eignung von ReferendarInnen für den<br />
Lehrerberuf zu überprüfen.<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie sich <strong>aus</strong> dem Blickwinkel verschiedener Kompetenzd<strong>im</strong>ensionen die Eignung der<br />
Prüfungsformate <strong>im</strong> Lichte der Meinungen beider Gruppen darstellt, ist den Abbildungen 34 bis<br />
38 zu entnehmen.<br />
Zur Überprüfung der Reflexionskompetenz eignet /eignen sich...<br />
...die Lehrprobe<br />
...die mündliche Prüfungen<br />
...die H<strong>aus</strong>arbeitsnote<br />
2,81<br />
3,22<br />
2,94<br />
3,00<br />
2,35<br />
2,58<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
Abbildung 34: Eignung verschiedener Instrumente zur Erfassung der Reflexionskompetenz<br />
Zur Überprüfung der Fachlichen Kompetenz eignet sich...<br />
...die Lehrprobe<br />
...die H<strong>aus</strong>arbeitsnote<br />
2,31<br />
2,82<br />
2,44<br />
2,45<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
Abbildung 35: Eignung verschiedener Instrumente zur Erfassung der Fachlichen Kompetenz<br />
35<br />
st<strong>im</strong>me<br />
eher zu<br />
(3.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me<br />
eher zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me<br />
voll zu<br />
(4.0)<br />
st<strong>im</strong>me<br />
voll zu<br />
(4.0)
Zur Überprüfung der Fachdidaktischen Kompetenz eignet/ eignen<br />
sich...<br />
…die Lehrprobe<br />
…die mündlichen Prüfungen<br />
…die H<strong>aus</strong>arbeitsnote<br />
2,59<br />
3,09<br />
2,87<br />
2,97<br />
2,48<br />
2,74<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
Abbildung 36: Eignung verschiedener Instrumente zur Erfassung der Fachdidaktischen<br />
Kompetenz<br />
Abbildung 37: Eignung verschiedener Instrumente zur Erfassung der Erziehungswissenschaftlichen<br />
Kompetenz<br />
36<br />
st<strong>im</strong>me<br />
eher zu<br />
(3.0)<br />
Zur Überprüfung der Erziehungswissenschaftlichen Kompetenz<br />
eignet/ eignen sich...<br />
...die mündlichen Prüfungen<br />
...die H<strong>aus</strong>arbeitsnote<br />
2,77<br />
2,66<br />
2,21<br />
2,23<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me<br />
eher zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me<br />
voll zu<br />
(4.0)<br />
st<strong>im</strong>me<br />
voll zu<br />
(4.0)
Unter Einbeziehung der sog. „Bewährungsnote“ soll schließlich berichtet werden, wie die beiden<br />
Gruppen von Befragten zur Eignung der Prüfungsformate für die Feststellung der Berufseignung<br />
als Ganzes stehen. Danach wird von beiden Gruppen die „Bewährungsnote“ als der am ehesten<br />
geeignete Prädiktor für die Eignung für den Lehrerberuf angesehen. Bei den Referendarinnen<br />
und Referendaren tendieren die Einschätzungen aller drei Prüfungsformate zu „eher nicht geeignet“,<br />
die Seminarleitungen sehen am ehesten die Lehrproben als angemessenes Instrument an.<br />
Zur Überprüfung der Eignung für den Lehrerberuf eignet/eignen sich…<br />
...die Lehrproben<br />
...die mündlichen Prüfungen<br />
...die H<strong>aus</strong>arbeitsnote<br />
...die "Bewährungsnote"<br />
2,16<br />
2,68<br />
2,00<br />
2,35<br />
1,59<br />
1,72<br />
2,91<br />
3,24<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
Abbildung 38: Eignung verschiedener Instrumente zur Erfassung der Eignung für den Lehrerberuf<br />
Die vorliegenden Ergebnisse können Anhaltspunkte liefern für eine Neubewertung bestehender<br />
Beurteilungsverfahren und eine Reflexion über die Gewichtung von Kompetenzen. Im Vorfeld der<br />
Neugestaltung des Prüfungswesens werden jedoch auch neue Praktiken zur Diskussion gestellt.<br />
Um hierzu ein Meinungsbild zu gewinnen, wurden Referendarinnen und Referendare wie auch<br />
Seminarleitungen um eine Einschätzung zu verschiedenen Vorschlägen gebeten. Die Ergebnisse<br />
sind in Abb. 39 zusammengestellt.<br />
Im Einzelnen gehen die Ansichten der beiden Gruppen mehr oder weniger deutlich <strong>aus</strong>einander.<br />
Für eine Trennung von Beratung und Bewertung sprechen sich die Referendarinnen und Referendare<br />
<strong>aus</strong>, die Seminarleitungen sind hier offenbar skeptisch. Auch bei der Frage, ob die Ausbildungsschulen<br />
eine größere Rolle bei der Beurteilung spielen sollten, sind sich die Gruppen<br />
nicht einig. Mehr Flexibilität (Auswahl von Prüfungsleistungen, individuelle Zeitplanungen) würde<br />
von den Referendarinnen und Referendaren begrüßt, stößt aber auch bei den Seminarleitungen<br />
37<br />
st<strong>im</strong>me<br />
eher zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
auf Akzeptanz. Einig sind sich beide Gruppen darin, dass sie die Beibehaltung der Fremdbewertung<br />
nicht gutheißen.<br />
Wie stehen Sie zu folgenden Vorschlägen bezüglich einer künftigen Gestaltung<br />
von Prüfungen und Bewertungen?<br />
Die Gewichtung der Prüfungsteile sollte<br />
verändert werden.<br />
Bewertungen und Beratungen sollten strikt<br />
getrennt werden.<br />
Die H<strong>aus</strong>arbeit sollte durch andere Formate<br />
ersetzt werden.<br />
Projekte sollten Gegenstand der Bewertung<br />
werden.<br />
Teamleistungen sollten Gegenstand der<br />
Bewertung werden.<br />
Eine Auswahl unter Prüfungsleistungen (z.B.<br />
Projektpräsentation oder H<strong>aus</strong>arbeit) sollte<br />
möglich sein.<br />
Die Prüfungsleistungen sollten in einem<br />
abgeschichteten Verfahren erbracht werden<br />
können.<br />
Der Zeitpunkt der Prüfung sollte mit den<br />
ReferendarInnen individuell abgest<strong>im</strong>mt<br />
werden.<br />
Die Ausbildungsschulen sollten eine größere<br />
Rolle bei der Beurteilung spielen.<br />
Die Fremdbewertung in Lehrproben sollte<br />
beibehalten werden.<br />
3,14<br />
3,10<br />
3,36<br />
2,45<br />
3,32<br />
3,16<br />
2,89<br />
2,87<br />
2,85<br />
2,55<br />
3,49<br />
2,87<br />
3,23<br />
2,78<br />
3,31<br />
2,69<br />
3,29<br />
2,13<br />
1,83<br />
1,69<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
Abbildung 39: Vorschläge zur künftigen Gestaltung von Prüfungen und Bewertungen<br />
Zwischen den Lehrämtern bestehen geringe Unterschiede (Abb. 40). Referendarinnen und Referendare<br />
an Gymnasien halten offenbar weniger von Teamleistungen, ihre Kolleginnen und Kollegen<br />
an beruflichen Schulen wiederum stehen der Fremdbewertung etwas weniger ablehnend<br />
gegenüber.<br />
38<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Wie stehen Sie zu folgenden Vorschlägen<br />
bezüglich einer künftigen Gestaltung von<br />
Prüfungen und Bewertungen?<br />
Die Gewichtung der Prüfungsteile sollte<br />
verändert werden.<br />
Bewertungen und Beratungen sollten<br />
strikt getrennt werden.<br />
Die H<strong>aus</strong>arbeit sollte durch andere<br />
Formate ersetzt werden.<br />
Projekte sollten Gegenstand der<br />
Bewertung werden.<br />
Teamleistungen sollten Gegenstand der<br />
Bewertung werden.<br />
Eine Auswahl unter Prüfungsleistungen<br />
(z.B. Projektpräsentation oder<br />
H<strong>aus</strong>arbeit) sollte möglich sein.<br />
Die Prüfungsleistungen sollten in einem<br />
abgeschichteten Verfahren erbracht<br />
werden können.<br />
Der Zeitpunkt der Prüfung sollte mit den<br />
ReferendarInnen individuell abgest<strong>im</strong>mt<br />
werden.<br />
Die Ausbildungsschulen sollten eine<br />
größere Rolle bei der Beurteilung spielen.<br />
Die Fremdbewertung in Lehrproben sollte<br />
beibehalten werden.<br />
3,05<br />
3,08<br />
3,32<br />
3,48<br />
3,28<br />
3,29<br />
3,22<br />
3,34<br />
3,44<br />
2,99<br />
2,74<br />
2,92<br />
3,05<br />
2,54<br />
2,91<br />
3,56<br />
3,47<br />
3,42<br />
3,18<br />
3,26<br />
3,28<br />
3,38<br />
3,25<br />
3,31<br />
3,37<br />
3,12<br />
3,36<br />
1,96<br />
1,94<br />
1,58<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
Abbildung 40: Lehramtsspezifische Einschätzung zur künftigen Gestaltung von Prüfungen<br />
Fazit zu Leistungsbewertung und Prüfungen<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Erwartungsgemäß nehmen die Referendarinnen und Referendare zu verschiedenen Fragen eine<br />
eher kritische Haltung ein. Sie zweifeln an der Einheitlichkeit von Bewertungskriterien und hinterfragen<br />
die Eignung von H<strong>aus</strong>arbeit und Lehrproben für die Kompetenzfeststellung. Sie setzen<br />
vor allem auf die sog. „Bewährungsnote“ als Prädiktor für die Berufseignung, die auch bei den<br />
Seminarleitungen Vertrauen genießt. Bezüglich der Neugestaltung des Prüfungswesens besteht<br />
Einigkeit in der Ablehnung der Fremdbewertung. Neuerungen wie die Trennung von Beratung<br />
und Bewertung, die Beteiligung der Ausbildungsschulen an der Beurteilung und höhere Freiheitsgrade<br />
in den Prüfungskomponenten und zeitlichen Abläufen werden kontrovers bewertet.<br />
39<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
*sign.<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
3.5 Einschätzung der Seminarleitungen zum Kompetenzerwerb<br />
Im Laufe des Jahres 2011 wurde in der Abteilung Ausbildung des Landesinstituts ein Referenzrahmen<br />
entwickelt, der mit Bezug auf vier Handlungsfelder Kompetenzen und Anforderungen<br />
benennt und Richtschnur für alle Ausbildungskomponenten sein soll. Unter den Seminarleitungen<br />
und Lehrertrainern konnte der Referenzrahmen zum Zeitpunkt der Erhebungen für diese <strong>Evaluation</strong><br />
als <strong>aus</strong>reichend bekannt vor<strong>aus</strong>gesetzt werden. Es bot sich daher an, dieses Kompetenzraster<br />
für eine Einschätzung der Zielerreichung <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong> einzusetzen.<br />
Für die Onlinebefragung der Seminarleitungen wurden <strong>aus</strong> den vier Handlungsfeldern des Referenzrahmens<br />
vier Blöcke von drei bis fünf Frageitems abgeleitet. Die Items wurden in Inhalt und<br />
Zahl von den dort formulierten Teilkompetenzen übernommen. Im Gegensatz zum übrigen Fragebogen<br />
wurde eine fünfstufige Skala gewählt, um keine positive oder negative Richtung der<br />
Einschätzung zu erzwingen. Eine Tendenz zur Mitte sollte nicht gezielt verhindert werden.<br />
Abb. 41 bis 44 stellen für alle vier Handlungsfelder Item für Item die Antworten als Mittelwert mit<br />
Standardabweichung dar.<br />
Handlungsfeld Unterrichten(Lernprozessgestaltung)<br />
Wie kompetent sind Ihrer Meinung nach die ReferendarInnen am Ende des<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong>es, wenn es darum geht ...<br />
...Unterricht sach- und fachgerecht<br />
durchzuführen.<br />
...Lehr- und Lernprozesse an einzelnen<br />
SchülerInnen <strong>aus</strong>zurichten.<br />
...Inhalte und Prozesse lernförderlich zu<br />
steuern.<br />
...Reflexion und Metakognition anzuleiten.<br />
...ein konstruktives Lernkl<strong>im</strong>a herzustellen.<br />
3,86<br />
3,25<br />
3,69<br />
3,53<br />
4,00<br />
überhaupt nicht<br />
kompetent<br />
(1.0)<br />
eher nicht<br />
kompetent<br />
(2.0)<br />
Abbildung 41: Kompetenzerwerb <strong>im</strong> Handlungsfeld Unterrichten (Lernprozessgestaltung)<br />
Das Handlungsfeld Unterrichten (Lernprozessgestaltung) erweist sich in der Einschätzung der<br />
Seminarleitungen mit Mittelwerten deutlich über 3.0 auf der fünfstufigen Skala als solide <strong>aus</strong>gebildeter<br />
Kompetenzbereich. Etwas schwächer sind die Bewertungen in den übrigen Handlungsfeldern.<br />
Mit Ausnahme des Items „individuelle Lerndiagnostik“ wird jedoch durchgängig der Skalenmittelwert<br />
erreicht. Bei letzterem tendiert die Einschätzung in der Tat in eine negative Richtung.<br />
40<br />
teils/teils<br />
kompetent<br />
(3.0)<br />
kompetent<br />
(4.0)<br />
sehr<br />
kompetent<br />
(5.0)<br />
Seminarleitungen (N=79)
Handlungsfeld Erziehen und Beraten<br />
Wie kompetent sind Ihrer Meinung nach die ReferendarInnen am Ende des<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong>es, wenn es darum geht ...<br />
...die Ausbildung von Selbstkompetenzen in<br />
einer Kooperations- und Vertrauenskultur zu<br />
unterstützen.<br />
...geeignete Maßnahmen zur Entwicklung<br />
Einzelner und der Gruppe zu ergreifen.<br />
...in Person und Aktion demokratische Werte<br />
und Normen vorzuleben.<br />
...gemeinsam mit den Beteiligten<br />
Lösungsansätze <strong>im</strong> Rahmen eines<br />
abgest<strong>im</strong>mten Regelsystems zu entwickeln.<br />
...achtsam und rechtssicher mit<br />
Berücksichtigung sozialer und kultureller<br />
Bedingungen zu handeln.<br />
Abbildung 42: Kompetenzerwerb <strong>im</strong> Handlungsfeld Erziehen und Beraten<br />
3,39<br />
3,16<br />
3,58<br />
3,51<br />
3,32<br />
überhaupt nicht<br />
kompetent<br />
(1.0)<br />
eher nicht<br />
kompetent<br />
(2.0)<br />
Handlungsfeld Diagnostizieren, Beurteilen und Bewerten<br />
Wie kompetent sind Ihrer Meinung nach die ReferendarInnen am Ende des<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong>es, wenn es darum geht ...<br />
...eine individuelle Lerndiagnostik<br />
durchzuführen.<br />
...Leistungssituationen zu definieren.<br />
...Leistungsbeurteilung und<br />
Leistungsbewertung kompetenzorientiert zu<br />
gestalten und zu dokumentieren.<br />
...die Beurteiler-, Bewerter- und Beraterrolle<br />
<strong>aus</strong>zufüllen.<br />
2,72<br />
3,23<br />
3,14<br />
3,17<br />
überhaupt nicht<br />
kompetent<br />
(1.0)<br />
eher nicht<br />
kompetent<br />
(2.0)<br />
Abbildung 43: Kompetenzerwerb <strong>im</strong> Handlungsfeld Diagnostizieren, Beurteilen und Bewerten<br />
41<br />
teils/teils<br />
kompetent<br />
(3.0)<br />
teils/teils<br />
kompetent<br />
(3.0)<br />
kompetent<br />
(4.0)<br />
sehr<br />
kompetent<br />
(5.0)<br />
Seminarleitungen (N=79)<br />
kompetent<br />
(4.0)<br />
sehr<br />
kompetent<br />
(5.0)<br />
Seminarleitungen (N=79)
HandlungsfeldSchule entwickeln/ innovieren<br />
Wie kompetent sind Ihrer Meinung nach die ReferendarInnen am Ende des<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong>es bezüglich...<br />
... Kenntnissen des Systems Schule<br />
(Strukturen, Profil, Einrichtungen,<br />
Funktionen, Gremien).<br />
...einer Beteiligung an <strong>aus</strong>gewählten Schulund<br />
Unterrichtsentwicklungsprozessen.<br />
...der Reflexion eigener Vorstellungen von<br />
guter Schule mit dem Ziel, dar<strong>aus</strong><br />
Entwicklungsschritte für die eigene<br />
Professionalisierung abzuleiten.<br />
Abbildung 44: Kompetenzerwerb <strong>im</strong> Handlungsfeld Schule entwickeln/innovieren<br />
Die Befragung anhand der Kriterien des Referenzrahmens ermöglicht zunächst ein tentatives<br />
Stärken-Schwächen-Bild des Kompetenzerwerbs <strong>im</strong> <strong>Vorbereitungsdienst</strong> <strong>aus</strong> Sicht der Seminarleitungen.<br />
Gleichzeitig können die Ergebnisse zur empirischen Validierung des Referenzrahmens<br />
beitragen. In diesem Zusammenhang wurden für die vier Handlungsfelder aggregierte Kompetenzskalen<br />
berechnet. Dabei konnten eine gute interne Konsistenz der Skalen festgestellt und<br />
deren Eind<strong>im</strong>ensionalität per explorativer Faktorenanalyse bestätigt werden (Tabelle 4).<br />
Tabelle 3: Interne Konsistenzen und D<strong>im</strong>ensionalität der berechneten Kompetenzskalen (Aggregatvariablen)<br />
Skala Item-<br />
3,39<br />
3,08<br />
3,38<br />
überhaupt nicht<br />
kompetent<br />
(1.0)<br />
anzahl<br />
eher nicht<br />
kompetent<br />
(2.0)<br />
42<br />
teils/teils<br />
kompetent<br />
(3.0)<br />
Interne Konsistenz<br />
(Cronbachs α)<br />
kompetent<br />
(4.0)<br />
Unterricht & Lernprozessgestaltung 5 .82 bestätigt<br />
Erziehen & Beraten 5 .85 bestätigt<br />
Diagnostizieren, Beurteilen & Bewerten 4 .84 bestätigt<br />
Schule Entwickeln & Innovieren 3 .73 bestätigt<br />
sehr<br />
kompetent<br />
(5.0)<br />
Seminarleitungen (N=79)<br />
Eind<strong>im</strong>ensionalität<br />
Die Handlungsfelder des Referenzrahmens erweisen sich somit als Bündelungen von Teilkompetenzen,<br />
die in beträchtlichem Maße korrelieren.
Abb. 45 stellt die Einschätzungen der Seminarleitungen zum Kompetenzerwerb in aggregierter<br />
Form bezogen auf die vier Handlungsfelder dar. Unter der Vor<strong>aus</strong>setzung, dass allen Bereichen<br />
die gleiche Bedeutung zukommen soll (wozu der Referenzrahmen keine Aussagen macht), deutet<br />
sich an, dass die Ausbildungsziele möglicherweise nicht <strong>im</strong> gleichen Maße erreicht werden.<br />
Kompetenzerwerb der ReferendarInnen in den Handlungsfeldern...<br />
...Unterricht und Lernprozessgestaltung<br />
...Erziehen und Beraten<br />
...Diagnostizieren, Beurteilen und Bewerten<br />
...Schule entwicklen/ innovieren<br />
3,68<br />
3,39<br />
3,07<br />
3,28<br />
überhaupt nicht<br />
kompetent<br />
(1.0)<br />
Abbildung 45: Kompetenzerwerb der ReferendarInnen in den unterschiedlichen Handlungsfeldern<br />
(Aggregatvariablen)<br />
Von den Referendarinnen und Referendaren selbst liegen keine detaillierten Selbsteinschätzungen<br />
zum Kompetenzerwerb vor. Allerdings wurden diese wie auch die Seminarleitungen abschließend<br />
gefragt, in wie weit sie der Aussage zust<strong>im</strong>men, dass der <strong>Vorbereitungsdienst</strong> gut auf<br />
die Arbeit als Lehrkraft vorbereite. Beide Gruppen vertreten alles in allem in großer Einigkeit eine<br />
eher zust<strong>im</strong>mende Haltung (Abb. 46)<br />
Bitte geben Sie eine Gesamteinschätzung ab:<br />
Alles in allem bereitet der<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong> ReferendarInnen gut<br />
auf ihre Arbeit als Lehrkraft vor.<br />
2,93<br />
2,97<br />
st<strong>im</strong>me nicht<br />
zu<br />
(1.0)<br />
eher nicht<br />
kompetent<br />
(2.0)<br />
Abbildung 46: Gesamteinschätzung zum <strong>Vorbereitungsdienst</strong><br />
43<br />
teils/teils<br />
kompetent<br />
(3.0)<br />
kompetent<br />
(4.0)<br />
sehr<br />
kompetent<br />
(5.0)<br />
Seminarleitungen (N=79)<br />
ReferendarInnen (N=256) Seminarleitungen (N=79)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
Dabei erweisen sich die Referendarinnen und Referendare an beruflichen Schulen als tendenziell<br />
zuversichtlicher als ihre Kolleginnen und Kollegen (Abb. 47).<br />
Bitte geben Sie eine<br />
Gesamteinschätzung ab:<br />
Alles in allem hat mich der<br />
<strong>Vorbereitungsdienst</strong> gut auf meine Arbeit<br />
als Lehrkraft vorbereitet.<br />
Abbildung 47: Lehramtsspezifische Gesamteinschätzung zum <strong>Vorbereitungsdienst</strong><br />
Fazit zum Kompetenzerwerb<br />
2,90<br />
2,81<br />
3,08<br />
st<strong>im</strong>me<br />
nicht zu<br />
(1.0)<br />
ReferendarInnen Pr<strong>im</strong>arstufe/Sek1/Sonderschule (N=94)<br />
ReferendarInnen Gymnasien/Stadtteilschulen (N=84)<br />
ReferendarInnen Berufliche Schulen (N=77)<br />
Anhand des neugefassten Referenzrahmens zu den Anforderungen und Kompetenzzielen der<br />
zweiten Phase der Lehrer<strong>aus</strong>bildung konnte ein Meinungsbild der Seminarleitungen zu Stärken<br />
und Schwächen des Kompetenzerwerbs erhoben werden. Dabei schneidet das Handlungsfeld<br />
„Diagnostizieren, Beurteilen und Bewerten“ am schwächsten ab. Die Fähigkeit zu einer Individualisierung<br />
der Lern- und Entwicklungsprozesse wie auch der Diagnose und Bewertung wird durchgängig<br />
etwas ungünstiger eingeschätzt als andere Teilkompetenzen.<br />
44<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
nicht zu<br />
(2.0)<br />
st<strong>im</strong>me eher<br />
zu<br />
(3.0)<br />
*sign.<br />
st<strong>im</strong>me voll<br />
zu<br />
(4.0)
4 Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
An der Schwelle zur Neuordnung des <strong>Vorbereitungsdienst</strong>es <strong>im</strong> Rahmen des Projekts „Ausbildung<br />
2013“ sollten die hier berichteten Erhebungen über den gegenwärtigen Stand der <strong>Ausbildungsqualität</strong><br />
sowie über Entwicklungsbedarfe Aufschluss geben. Einbezogen wurden die Perspektiven<br />
der Referendarinnen und Referendare einerseits und der Seminarleitungen und Lehrertrainer<br />
andererseits, wobei allerdings bei Rücklaufquoten von nur 24 bzw. 42 Prozent die Repräsentativität<br />
eine gewisse Einschränkung erfährt.<br />
Gegenstand von Befragungen waren die Veranstaltungsformate am Landesinstitut, Ausbildungselemente<br />
an beiden Ausbildungsorten vom eigenverantwortlichen Unterricht über verschiedene<br />
Beratungssettings bis hin zum Portfolio, die Ausbildungsorganisation, Bewertungen und Prüfungen<br />
sowie – hier nur be<strong>im</strong> lehrenden Personal – der Kompetenzerwerb mit Bezug auf den soeben<br />
veröffentlichten Referenzrahmen.<br />
Unangefochten ist <strong>aus</strong> Sicht beider Gruppen die Bedeutung von Haupt- und Fachseminaren für<br />
den Kompetenzaufbau. Die Zufriedenheit damit ist <strong>im</strong> Großen und Ganzen hoch, es wird sogar<br />
für einen Ausbau dieser beiden Säulen der Ausbildung plädiert. Formate, die eine weniger lange<br />
Tradition haben – Lehrertraining, Module und selbst gesteuerte Gruppen – werden eher als nachrangig<br />
empfunden und kritischer beurteilt. Ihr Rückhalt ist bei den Referendarinnen und Referendaren<br />
eher geringer als bei den Seminarleitungen. Das Lehrertraining hat gegenüber der Beurteilung<br />
vor fünf Jahren (Arnold 2006) an Wertschätzung eingebüßt; Inhalte, Anforderungen und Arbeitsformen<br />
werden kritisch gesehen, Stärken bei der Individualisierung jedoch zugestanden. Die<br />
noch jungen Formate selbstgesteuerter Gruppen werden am ehesten von Referendarinnen und<br />
Referendaren an beruflichen Schulen geschätzt.<br />
Unter zwölf in der Befragung benannten Ausbildungselementen am Landesinstitut und an den<br />
Ausbildungsschulen trifft das eher kritische Urteil eine weitere noch wenig etablierte Komponente,<br />
das Portfolio. Einigkeit besteht unter beiden Gruppen von Befragten in der Notwendigkeit, den<br />
eigenverantwortlichen Unterricht zu reduzieren. Der Wunsch, verschiedene Ausbildungselemente<br />
wie Unterrichtsbesuche und Beratung zu stärken, steht allerdings <strong>im</strong> Widerspruch zu der allgemein<br />
beklagten Zeitnot.<br />
Entwicklungsbedarfe werden in der Organisation der Ausbildung gesehen, insbesondere was die<br />
Kohärenz der Ausbildung am Landesinstitut sowie die Abst<strong>im</strong>mung von Arbeit und professionellem<br />
Verständnis von Seminarleitungen und Mentorinnen und Mentoren betrifft. Hier weisen nur<br />
wenige Bewertungen <strong>im</strong> Vergleich mit der <strong>Evaluation</strong> von Prof. Arnold 2006 auf einen leichten<br />
Aufwärtstrend hin. Schulformabhängig ist die Situation an den Ausbildungsschulen verbesserungswürdig.<br />
Bezüglich Bewertung und Prüfungswesen sind sich die beiden Gruppen vor allem darin einig,<br />
dass die sog. Bewährungsnote einen Prädiktor für die Berufseignung darstellt und dass sie die<br />
Fremdbewertung in Lehrproben ablehnen. Weniger Konsens besteht hinsichtlich verschiedener<br />
aktuell diskutierter möglicher Neuerungen wie der Flexibilisierung von Prüfungsleistungen und<br />
zeitlichen Abläufen oder der Trennung von Bewertung und Beratung. H<strong>aus</strong>arbeit und Lehrproben<br />
werden für die Kompetenzfeststellung als unterschiedlich geeignet angesehen.<br />
45
Zwischen den Lehrämtern kristallisieren sich eine Reihe von Divergenzen her<strong>aus</strong>. Referendarinnen<br />
und Referendare an beruflichen Schulen waren der Befragung gegenüber aufgeschlossener<br />
(Rücklaufquote 42 Prozent gegenüber 24 Prozent <strong>im</strong> Durchschnitt). Sie äußern sich zufriedener<br />
zu Haupt- und Fachseminaren, plädieren aber eher für eine Reduktion des Lehrertrainings, während<br />
sie selbstgesteuerten Gruppen mehr abgewinnen können als ihre Kolleginnen und Kollegen.<br />
Mit der Koordination der Ausbildung am Landesinstitut, der Kooperation der Lernorte und der<br />
Situation an den Ausbildungsschulen sind sie überdurchschnittlich zufrieden. Lehrproben und der<br />
Fremdbewertung stehen sie weniger kritisch gegenüber als andere Referendarinnen und Referendare.<br />
Referendarinnen und Referendare an Gymnasien wiederum sind tendenziell mit den<br />
Fachseminaren weniger zufrieden und würden gerne Haupt- und Fachseminare zu Lasten anderer<br />
Formate gestärkt sehen. Der Umfang des eigenverantwortlichen Unterrichts scheint sie eher<br />
zu belasten, Beratung und Unterrichtsbesuche durch Fachleitungen scheinen eher ihren Bedarf<br />
nicht zu decken. Die Situation an den Ausbildungsschulen erleben sie als unbefriedigender als<br />
ihre Kolleginnen und Kollegen. Die Erhebungen lassen leider keine Anhaltspunkte dafür zu, ob<br />
die Unterschiede durch den Habitus der Personen oder durch strukturelle Faktoren am Landesinstitut<br />
oder in den jeweiligen Schulformen bedingt sind.<br />
Die Befragung der Seminarleitungen zum Kompetenzerwerb anhand des neugefassten Referenzrahmens<br />
ergab ein tentatives Profil von Stärken und Schwächen in der Ausbildung, wobei<br />
das Handlungsfeld „Diagnostizieren, Beurteilen und Bewerten“ hinter den übrigen zurückzubleiben<br />
scheint. Für die Zukunft stellt sich die Aufgabe, das Erreichen der Kompetenzziele mit geeigneten<br />
Instrumenten zu überprüfen.<br />
46