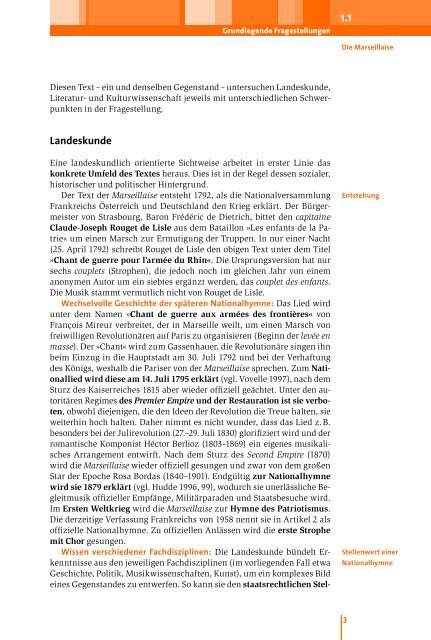1. Grundlegende Frage- stellungen - J. B. Metzler Verlag
1. Grundlegende Frage- stellungen - J. B. Metzler Verlag
1. Grundlegende Frage- stellungen - J. B. Metzler Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Grundlegende</strong> <strong>Frage</strong> <strong>stellungen</strong><br />
Diesen Text – ein und denselben Gegenstand – untersuchen Landeskunde,<br />
Literatur- und Kulturwissenschaft jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten<br />
in der <strong>Frage</strong>stellung.<br />
Landeskunde<br />
Eine landeskundlich orientierte Sichtweise arbeitet in erster Linie das<br />
konkrete Umfeld des Textes heraus. Dies ist in der Regel dessen sozialer,<br />
historischer und politischer Hintergrund.<br />
Der Text der Marseillaise entsteht 1792, als die Nationalversammlung<br />
Frankreichs Österreich und Deutschland den Krieg erklärt. Der Bürgermeister<br />
von Strasbourg, Baron Frédéric de Dietrich, bittet den capitaine<br />
Claude-Joseph Rouget de Lisle aus dem Bataillon »Les enfants de la Patrie«<br />
um einen Marsch zur Ermutigung der Truppen. In nur einer Nacht<br />
(25. April 1792) schreibt Rouget de Lisle den obigen Text unter dem Titel<br />
»Chant de guerre pour l’armée du Rhin«. Die Ursprungsversion hat nur<br />
sechs couplets (Strophen), die jedoch noch im gleichen Jahr von einem<br />
anonymen Autor um ein siebtes ergänzt werden, das couplet des enfants.<br />
Die Musik stammt vermutlich nicht von Rouget de Lisle.<br />
Wechselvolle Geschichte der späteren Nationalhymne: Das Lied wird<br />
unter dem Namen »Chant de guerre aux armées des frontières« von<br />
François Mireur verbreitet, der in Mar seille weilt, um einen Marsch von<br />
freiwilligen Revolutionä ren auf Paris zu organisie ren (Beginn der levée en<br />
masse). Der »Chant« wird zum Gassenhauer, die Revolutionäre singen ihn<br />
beim Einzug in die Hauptstadt am 30. Juli 1792 und bei der Verhaftung<br />
des Königs, weshalb die Pariser von der Marseil lai se sprechen. Zum Nationallied<br />
wird diese am 14. Juli 1795 erklärt (vgl. Vovelle 1997), nach dem<br />
Sturz des Kaiserreiches 1815 aber wieder offi ziell geächtet. Unter den autoritären<br />
Regimes des Premier Empire und der Restauration ist sie verboten,<br />
obwohl diejenigen, die den Ideen der Revolution die Treue halten, sie<br />
weiterhin hoch halten. Daher nimmt es nicht wunder, dass das Lied z. B.<br />
besonders bei der Julirevolution (27.–29. Juli 1830) glorifi ziert wird und der<br />
romantische Komponist Héctor Berlioz (1803–1869) ein eigenes musikalisches<br />
Arrangement entwirft. Nach dem Sturz des Second Empire (1870)<br />
wird die Marseillaise wieder offi ziell gesungen und zwar von dem großen<br />
Star der Epoche Rosa Bordas (1840–1901). Endgültig zur Nationalhymne<br />
wird sie 1879 erklärt (vgl. Hudde 1996, 99), wodurch sie unerlässliche Begleitmusik<br />
offi zieller Empfänge, Militärparaden und Staatsbesuche wird.<br />
Im Ersten Weltkrieg wird die Marseillaise zur Hymne des Patriotismus.<br />
Die derzeitige Verfassung Frankreichs von 1958 nennt sie in Artikel 2 als<br />
offi zielle Nationalhymne. Zu offi ziellen Anlässen wird die erste Strophe<br />
mit Chor gesungen.<br />
Wissen verschiedener Fachdisziplinen: Die Landeskunde bündelt Erkenntnisse<br />
aus den jeweiligen Fachdisziplinen (im vorliegenden Fall etwa<br />
Geschichte, Politik, Musikwissenschaften, Kunst), um ein komplexes Bild<br />
eines Gegenstandes zu entwerfen. So kann sie den staatsrechtlichen Stel-<br />
<strong>1.</strong>1<br />
Die Marseillaise<br />
Entstehung<br />
Stellenwert einer<br />
Nationalhymne<br />
3