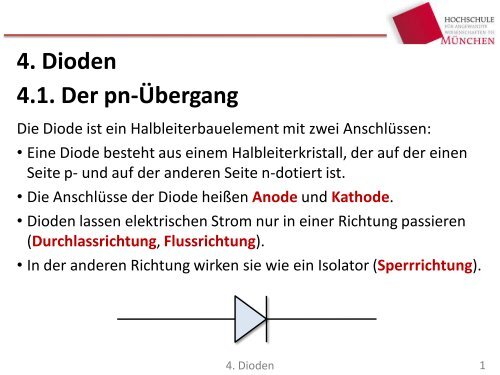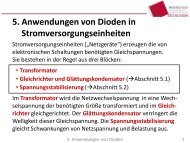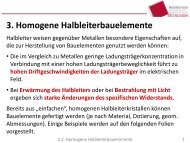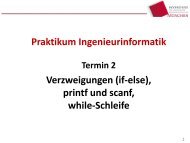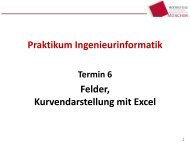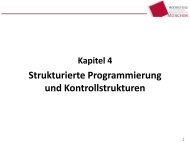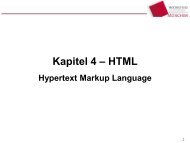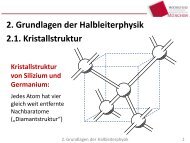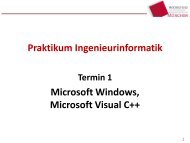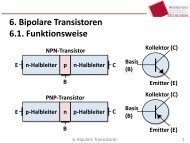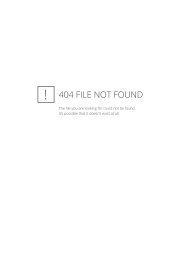Kapitel 4 - Diode, Zenerdiode
Kapitel 4 - Diode, Zenerdiode
Kapitel 4 - Diode, Zenerdiode
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4. <strong>Diode</strong>n<br />
4.1. Der pn-Übergang<br />
Die <strong>Diode</strong> ist ein Halbleiterbauelement mit zwei Anschlüssen:<br />
• Eine <strong>Diode</strong> besteht aus einem Halbleiterkristall, der auf der einen<br />
Seite p- und auf der anderen Seite n-dotiert ist.<br />
• Die Anschlüsse der <strong>Diode</strong> heißen Anode und Kathode.<br />
• <strong>Diode</strong>n lassen elektrischen Strom nur in einer Richtung passieren<br />
(Durchlassrichtung, Flussrichtung).<br />
• In der anderen Richtung wirken sie wie ein Isolator (Sperrrichtung).<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
1
+<br />
–<br />
pn-Übergang (a)<br />
p-Halbleiter n-Halbleiter<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
Loch (Majoritätsträger)<br />
Ortsfeste Akzeptor-Störstelle<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
Zwei getrennte Halbleiter (p- und n-Halbleiter) sind jeweils neutral.<br />
Die Ladungen der freien Ladungsträger (Löcher bzw. freie Elektronen)<br />
und der ortsfesten Störstellen-Ionen heben sich auf.<br />
–<br />
+<br />
Freies Elektron (Majoritätsträger)<br />
Ortsfeste Donator-Störstelle<br />
2
+<br />
–<br />
pn-Übergang (b)<br />
p-Halbleiter n-Halbleiter<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
Loch (Majoritätsträger)<br />
Ortsfeste Akzeptor-Störstelle<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
– – – – –<br />
+ + + + +<br />
Am pn-Übergang diffundieren die beweglichen Majoritätsträger in<br />
die benachbarte Zone (Diffusionsstrom). Die geladenen, ortsfesten<br />
Störstellen bewirken ein immer stärker werdendes elektrisches<br />
Feld. Schließlich stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein.<br />
–<br />
+<br />
Freies Elektron (Majoritätsträger)<br />
Ortsfeste Donator-Störstelle<br />
3
pn-Übergang (c)<br />
p-Halbleiter n-Halbleiter<br />
+ + + +<br />
– – – – –<br />
+ + +<br />
– – – – –<br />
+ + + +<br />
– – – – –<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
– – – –<br />
+ + + + +<br />
– – –<br />
+ + + + +<br />
– – – –<br />
+ + + + +<br />
p-Zone RL-Zone<br />
n-Zone<br />
Durch Rekombination der freien Ladungsträger (Löcher und Elektronen<br />
entsteht an der Grenzschicht eine Zone, die praktisch keine<br />
freien Ladungsträger enthält. In dieser Zone befinden sich nur noch<br />
die ortsfesten, negativen Akzeptor-Störstellen bzw. die positiven<br />
Donator-Störstellen („Raumladungszone“).<br />
4
pn-Übergang (d)<br />
+ + + +<br />
– – – – –<br />
+ + +<br />
– – – – –<br />
+ + + +<br />
– – – – –<br />
Anode Kathode<br />
p-Halbleiter n-Halbleiter<br />
+ –<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+ +<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
Bei Anlegen einer Spannung in Durchlassrichtung fließen Ladungsträger<br />
in die Raumladungszone und rekombinieren dort. Die Raumladungszone<br />
wird schmaler, es fließt Strom.<br />
5
pn-Übergang (e)<br />
p-Halbleiter n-Halbleiter<br />
+ +<br />
– – – – –<br />
+ +<br />
– – – – –<br />
+ +<br />
– –<br />
– – –<br />
– +<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
+ + +<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
+ +<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+ +<br />
+ + +<br />
–<br />
+<br />
–<br />
+<br />
Beim Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung fließen die Ladungsträger<br />
von der Raumladungszone weg. Die Raumladungszone verbreitert<br />
sich. Es fließt nur noch ein kleiner Sperrstrom, der von der<br />
thermischen Generation von Ladungsträgerpaaren im Bereich der<br />
Raumladungszone herrührt.<br />
6
<strong>Diode</strong>nkennlinie (a)<br />
Die <strong>Diode</strong>nkennlinie zeigt, dass der Durchlassstrom exponentiell<br />
zur <strong>Diode</strong>nspannung zunimmt. Zur einfacheren Berechnung wird<br />
oft eine idealisierte, lineare Kennlinie verwendet (nächste Folie).<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0<br />
-1 -0,5 0 0,5 1<br />
-0,1<br />
-0,2<br />
-0,3<br />
-0,4<br />
I / A<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
U / V<br />
7
Anode<br />
Kathode<br />
Lineares Ersatzschaltbild<br />
in Durchlassrichtung<br />
<strong>Diode</strong>nkennlinie (b)<br />
200 mA<br />
100 mA<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
I<br />
0,5 V<br />
U S<br />
1 V<br />
Schwellen-, Schleusenspannung:<br />
U<br />
8
Fotodiode<br />
Bei Fotodioden ist es möglich, die Sperrschicht mit Licht zu bestrahlen.<br />
Der Kennlinienverlauf ändert sich mit der Beleuchtungsstärke.<br />
I A<br />
U AK<br />
I A / µA<br />
-8 -6 -4 -2 1<br />
E = 200 lx<br />
400 lx<br />
600 lx<br />
800 lx<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
-50<br />
-100<br />
U AK / V<br />
9
Leuchtdiode, LED<br />
Eine <strong>Diode</strong> in Durchlassrichtung nimmt die Leistung P = U D ·I D auf<br />
(U D = <strong>Diode</strong>nspannung, I D = Durchlassstrom). Bei einer Leuchtdiode<br />
wird ein Teil dieser Leistung als Licht abgestrahlt.<br />
Leuchtdiode, Lumineszenzdiode,<br />
LED (Light Emitting <strong>Diode</strong>)<br />
Wirkungsgrad von Leuchtdioden und „konventionellen Lampen“:<br />
Halogenlampe 15 … 20 Lumen / Watt<br />
LED-Scheinwerfer (2008) 20 … 40 Lumen / Watt<br />
Leuchtstofflampe 50 … 90 Lumen / Watt<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
10
Übungsaufgabe 4.1<br />
An einer Batterie (U B = 9 V) sollen zwei<br />
blaue und eine rote LED betrieben werden.<br />
Die <strong>Diode</strong>n haben folgende Daten:<br />
Rote LED: U S = 1,5 V und r f = 10 Ω<br />
Blaue LED: U S = 2,7 V und r f = 35 Ω<br />
i) Welchen Wert muss der Widerstand<br />
R2 besitzen, damit durch die rote<br />
Leuchtdiode ein Strom von 20 mA<br />
fließt?<br />
ii) Welchen Wert muss der Widerstand<br />
R 1 besitzen, damit durch die blauen<br />
Leuchtdioden ein Strom von 20 mA<br />
fließt?<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
R 1<br />
blau<br />
blau<br />
iii) Wie groß sind die <strong>Diode</strong>nströme, falls die Batteriespannung<br />
(bei unveränderten Widerständen R 1 und R 2 ) auf U B = 7 V sinkt?<br />
U B<br />
R 2<br />
rot<br />
11
4.2. Die <strong>Zenerdiode</strong><br />
<strong>Zenerdiode</strong>n (Z-<strong>Diode</strong>n) sind <strong>Diode</strong>n, die speziell für den Betrieb im<br />
Durchbruchbereich entwickelt wurden:<br />
• In Durchlassrichtung verhält sich eine <strong>Zenerdiode</strong> wie eine<br />
herkömmliche Halbleiterdiode.<br />
• In Sperrrichtung beginnt ab einer genau definierten Sperrspannung<br />
(„Zenerspannung“) der Durchbruchbereich.<br />
• Im Gegensatz zu herkömmlichen Halbleiterdioden wird die <strong>Zenerdiode</strong><br />
durch den Betrieb im Durchbruchbereich nicht beschädigt,<br />
solange der Strom den zulässigen Maximalwert nicht überschreitet.<br />
• <strong>Zenerdiode</strong>n werden in der Praxis zur Spannungsstabilisierung<br />
sowie zum Schutz vor Überspannung eingesetzt.<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
12
-8V<br />
<strong>Zenerdiode</strong> (a)<br />
Kennlinien von <strong>Zenerdiode</strong>n unterschiedlicher Zenerspannungen:<br />
Durchlasskennlinie<br />
Sperrkennlinien:<br />
Z-<strong>Diode</strong> 2,7V<br />
Z-<strong>Diode</strong> 5,6V<br />
Z-<strong>Diode</strong> 8,2V<br />
-6V<br />
-4V<br />
-2V<br />
I<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
10mA<br />
-10mA<br />
0,7V<br />
U<br />
13
Lineares Ersatzschaltbild<br />
im Durchbruchbereich<br />
+<br />
–<br />
<strong>Zenerdiode</strong> (b)<br />
-U Z0<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
(Sperrrichtung)<br />
Idealisierte, lineare<br />
Kennlinie einer <strong>Zenerdiode</strong><br />
I<br />
(Durchlassrichtung)<br />
14<br />
U
Übungsaufgabe 4.2<br />
(WS 2002/03 – FA, Aufgabe 3)<br />
Eine <strong>Zenerdiode</strong> wird an einer Wechselspannung<br />
mit dem Effektivwert U e = 10 V<br />
betrieben. Die Werte der Z-<strong>Diode</strong> sind:<br />
Sperrrichtung: U Z0 = 5,1 V und r z = 2 Ω<br />
Durchlassrichtung: U f = 0,7 V und r f = 2 Ω<br />
Der Vorwiderstand beträgt R V = 10 Ω<br />
i) Bei welcher positiven Spannung u a + und bei<br />
welcher negativen Spannung u a – beginnt die<br />
Z-<strong>Diode</strong> gerade zu leiten bzw. zu sperren?<br />
ii) Welche max. Ausgangsspannung u amax und<br />
welche min. Ausgangsspannung u amin treten<br />
bei den Scheitelwerten der Wechselspg. auf?<br />
iii) Welche maximale Verlustleistung (Momentanwert) P vmax tritt an der<br />
<strong>Zenerdiode</strong> auf?<br />
4. <strong>Diode</strong>n<br />
~<br />
u e<br />
R V<br />
u a<br />
15