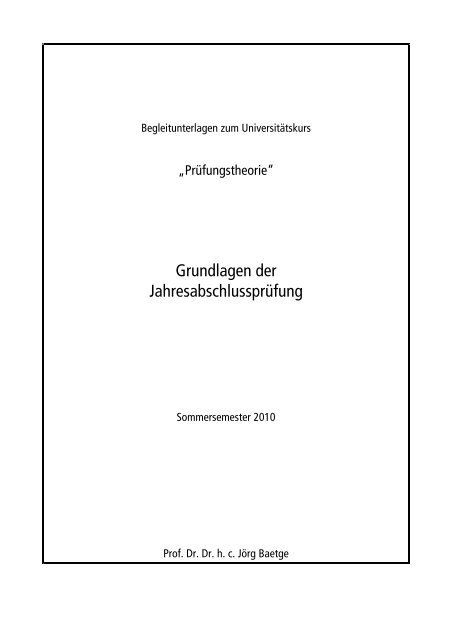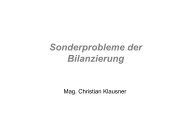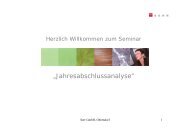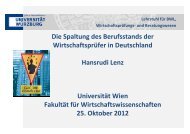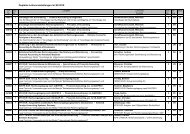Grundlagen der Jahresabschlussprüfung - Lehrstuhl für Externes ...
Grundlagen der Jahresabschlussprüfung - Lehrstuhl für Externes ...
Grundlagen der Jahresabschlussprüfung - Lehrstuhl für Externes ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Begleitunterlagen zum Universitätskurs<br />
„Prüfungstheorie“<br />
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />
Sommersemester 2010<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. Jörg Baetge
Anmerkung von Prof. Baetge:<br />
Das Skriptum basiert auf deutschem Recht. An den entsprechenden Stellen wird<br />
aber auf die österreichischen Vorschriften des UGB verwiesen. Für die Referate<br />
sind aber die (evtl. über die im Skriptum genannten, hinausgehenden)<br />
österreichischen Vorschriften inhaltlich zu berücksichtigen.
1 Prüfungsplanung<br />
INHALTSÜBERSICHT<br />
11 Prüfungsplanung als Bestandteil <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />
12 Ziele, Bedingungen und Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
13 Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
14 Planungsverfahren<br />
2 Prüfungstechnik<br />
21 Abgrenzung <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong><br />
22 Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
23 Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
24 Prüfungsinstrumente<br />
25 Netzplantechnik<br />
3 Risikoorientierte Prüfung<br />
31 Verpflichtung zur risikoorientierten Abschlussprüfung<br />
32 Die Risiken des Abschlussprüfers<br />
33 Das Prüfungsrisikomodell<br />
4 Überwachungstheorie<br />
41 Einführung<br />
42 Kriterien zur Beurteilung von Überwachungsmaßnahmen<br />
43 Organisationsmöglichkeiten <strong>für</strong> eine Überwachung betrieblicher Prozesse<br />
44 Bildung und Analyse von internen Überwachungssystemen<br />
45 Überwachungssysteme und Überwachungshierarchien<br />
I<br />
Stand: SoSe 2010
Prüfungstheorie<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
1 Prüfungsplanung 1<br />
11 Prüfungsplanung als Bestandteil <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong> 1<br />
12 Ziele, Bedingungen und Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungsplanung 2<br />
121. Grundbegriffe 2<br />
121.1 Der Begriff Planung 2<br />
121.2 Der Begriff Prüfungsplanung 3<br />
122. Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Prüfungsplanung 5<br />
123. Ziele <strong>der</strong> Prüfungsplanung 6<br />
123.1 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht externer Adressaten 8<br />
123.2 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht des zu prüfenden Unternehmens 8<br />
123.3 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Prüfungsorgane 8<br />
124. Anfor<strong>der</strong>ungen an die Prüfungsplanung 17<br />
125. Art und Umfang <strong>der</strong> Prüfungsplanung 19<br />
125.1 Entwicklung einer Prüfungsstrategie 19<br />
125.2 Erstellung eines Prüfungsprogramms 19<br />
125.21 Überblick 19<br />
125.22 Sachliche Planung 20<br />
125.23 Personalplanung 22<br />
125.24 Zeitplanung 23<br />
13 Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung 24<br />
131. Zielbildung 24<br />
132. Informationssuche 26<br />
133. Eventualplanung 30<br />
134. Entscheidung(en) <strong>für</strong> bestimmte Pläne 33<br />
135. Planvorgabe (Sollzahlen) 37<br />
136. Realisation <strong>der</strong> Planung 38<br />
137. Überwachung <strong>der</strong> Prüfungsplanung und -realisation 38<br />
138. Interdependenzen <strong>der</strong> Prüfungsplanungsschritte 40<br />
14 Planungsverfahren 41<br />
II
Prüfungstheorie<br />
2 Prüfungstechnik 42<br />
21 Abgrenzung <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong> 42<br />
22 Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen 50<br />
221. Prüfungsrichtung 50<br />
221.1 Progressive Prüfung 50<br />
221.2 Retrograde Prüfung 52<br />
221.3 Bidirektionale Prüfung 54<br />
222. Prüfungsinhalt 55<br />
222.1 Anfor<strong>der</strong>ungen des IDW 55<br />
222.2 Formelle Prüfungshandlungen 56<br />
222.3 Materielle Prüfungshandlungen 58<br />
223. Prüfungsgegenstand 59<br />
223.1 Prüfung des Erfassungs-, Verarbeitungs- und Kontrollsystems 59<br />
(Systemprüfung)<br />
223.2 Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen (Ergebnisprüfung) 69<br />
223.21 Vorbemerkung 69<br />
223.22 Analytische Prüfungshandlungen 69<br />
223.23 Prüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen 71<br />
23 Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen 72<br />
231. Determinanten des Prüfungsumfangs 72<br />
232. Vollprüfung 75<br />
233. Auswahlprüfung 76<br />
233.1 Überblick zu den Verfahren 76<br />
233.2 Bedeutung von Vorinformationen 78<br />
233.3 Systematisch gesteuerte Auswahlverfahren 81<br />
233.31 Auswahlkriterien und Prüfungsumfang 81<br />
233.311. Konzentrationsauswahl 81<br />
233.312. Auswahl typischer Elemente 85<br />
233.313. Detektivische Auswahl 86<br />
233.32 Beurteilung systematisch gesteuerter bewusster 88<br />
Auswahlverfahren<br />
233.4 Zufallsgesteuerte Auswahlverfahren 89<br />
233.41 <strong>Grundlagen</strong> 89<br />
233.411. Zufalls-(Urnen-) Modell 89<br />
233.412. Voraussetzungen <strong>für</strong> eine Stichprobenprüfung 91<br />
233.413. Verteilungsannahmen 93<br />
233.42 Arten <strong>der</strong> Stichprobenauswahl 95<br />
233.421. Einfache Stichprobenauswahl 95<br />
233.422. Geschichtete Auswahl 97<br />
233.423. Wertproportionale Auswahl 99<br />
233.424. Mehrstufige Stichprobenauswahl 101<br />
233.43 Fragestellungen bei Stichprobenprüfungen 104<br />
233.431 Überblick 104<br />
233.432 Die Schätzstichprobe bei heterogra<strong>der</strong> Fragestellung 107<br />
233.5 Vergleich <strong>der</strong> Auswahlverfahren 109<br />
233.6 Die Bedeutung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Auswahlprüfung <strong>für</strong> die Bildung 111<br />
des Gesamturteils<br />
III
Prüfungstheorie<br />
24 Prüfungsinstrumente 112<br />
241. Prüfungshandbücher 112<br />
241.1 Standardprüfprogramme 112<br />
241.2 Arbeitspapiere 113<br />
241.3 Fallsammlungen 116<br />
242. Computerprüfprogramme 117<br />
25 Netzplantechnik 118<br />
251. Gegenstand <strong>der</strong> Netzplantechnik 118<br />
252. Entwicklung <strong>der</strong> Netzplantechnik 119<br />
253. Netzplanelemente und Netzplantypen 119<br />
253.1 Netzplanelemente 119<br />
253.2 Netzplantypen 121<br />
253.3 Grundregeln <strong>für</strong> die Darstellung von Netzplänen 122<br />
254. Ablaufplanung und Zeitplanung mit Hilfe <strong>der</strong> Netzplantechnik 124<br />
254.1 Überblick 124<br />
254.2 Ablaufplanung <strong>für</strong> einen Auftrag 125<br />
254.3 Zeitplanung <strong>für</strong> einen Auftrag 127<br />
255. Beurteilung <strong>der</strong> Netzplantechnik 132<br />
3 Risikoorientierte Prüfung 133<br />
31 Verpflichtung zur risikoorientierten Abschlussprüfung 133<br />
32 Die Risiken des Abschlussprüfers 134<br />
321. Das allgemeine Geschäftsrisiko des Abschlussprüfers 134<br />
322. Das spezielle Auftragsrisiko des Abschlussprüfers 135<br />
323. Prüfungsrisiko 136<br />
323.1. Definition des Prüfungsrisikos 136<br />
323.2 Bestandteile des Prüfungsrisikos 138<br />
323.3 Fehlerrisiko 140<br />
323.31 Inhärentes Risiko 140<br />
323.32 Kontrollrisiko 142<br />
323.4. Entdeckungsrisiko 143<br />
323.41 Risiko analytischer Prüfungshandlungen 143<br />
323.42 Risiko detaillierter Prüfungshandlungen 144<br />
323.5 Risiko <strong>der</strong> künftigen Entwicklung 146<br />
323.51 Definition 146<br />
323.52 Instrumente zur Beurteilung <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit 147<br />
33 Das Prüfungsrisikomodell 151<br />
331. Aufbau des Prüfungsrisikomodells 151<br />
332. Kritische Würdigung des Prüfungsrisikomodells 154<br />
IV
Prüfungstheorie<br />
4 Überwachungstheorie 156<br />
41 Einführung 156<br />
411. Wirtschaftsprüfung als Überwachungstätigkeit 156<br />
412. Misstrauen als Motiv <strong>der</strong> Überwachung? 157<br />
413. Überwachungsadressaten 158<br />
414. Überwachungswirkungen 162<br />
415. Schritte <strong>der</strong> Überwachung 164<br />
416. Zur Darstellung von Überwachungsprozessen 165<br />
42 Kriterien zur Beurteilung von Überwachungsmaßnahmen 166<br />
43 Organisationsmöglichkeiten <strong>für</strong> eine Überwachung betrieblicher Prozesse 171<br />
431. Organisationsmaßnahmen zur unmittelbaren Effizienzsteigerung 171<br />
<strong>der</strong> Überwachung<br />
431.1 Überblick 171<br />
431.2 Aufgabenbildung und -glie<strong>der</strong>ung 173<br />
431.3 Aufgabenzuordnung 173<br />
431.31 Vertikale Aufgabentrennung 173<br />
431.32 Horizontale Aufgabentrennung 176<br />
431.33 Aufgabenvervielfachung 176<br />
431.4 Funktionsbildung und -glie<strong>der</strong>ung 178<br />
431.5 Funktionszuordnung 178<br />
431.51 Selbstüberwachung bzw. Funktionszusammenfassung 178<br />
431.52 Fremdüberwachung bzw. Funktionstrennung 179<br />
431.6 Kompetenzbildung, -glie<strong>der</strong>ung und -zuordnung 181<br />
431.7 Verantwortlichkeitsbildung, -glie<strong>der</strong>ung und -zuordnung 181<br />
432. Organisationsmöglichkeiten zur mittelbaren Effizienzsteigerung 181<br />
<strong>der</strong> Überwachung<br />
44 Bildung und Analyse von internen Überwachungssystemen 183<br />
441. Die Isolierung von Überwachungsschritten aus dem Arbeitsablauf 183<br />
442. Die Ermittlung von Zuverlässigkeiten <strong>für</strong> die verschiedenen Kopplungstypen 185<br />
442.1 Überblick 185<br />
442.2 Zusammenführung 186<br />
442.3 Reihenkopplung 186<br />
442.4 Parallelkopplung 187<br />
442.5 Rückkopplung 188<br />
443. Wirkung <strong>der</strong> Überwachung auf die Zuverlässigkeit von Routinetätigkeiten 191<br />
443.1 Wirkung <strong>der</strong> Selbstüberwachung 191<br />
443.2 Wirkung <strong>der</strong> Fremdüberwachung 192<br />
45. Überwachungssysteme und Überwachungshierarchien 193<br />
V
1 Prüfungsplanung<br />
Prüfungstheorie<br />
11 Prüfungsplanung als Bestandteil <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />
Aufgaben <strong>der</strong> handelsrechtlichen <strong>Jahresabschlussprüfung</strong>:<br />
Ermittlung und Mitteilung eines verlässlichen und sicheren Urteils über die Gesetz- und<br />
Satzungsmäßigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit <strong>der</strong> im Jahresabschluss und Lagebericht<br />
gegebenen Informationen.<br />
⇒ Bedingung: Systematische Prüfungsplanung!<br />
Prüfungsplanung ist Bestandteil <strong>der</strong> Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung<br />
(GoA); Kodifikation in IDW PS 240.<br />
Ziele <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
Sicherung <strong>der</strong> Urteilsqualität,<br />
Zeitgerechte Prüfungsdurchführung,<br />
Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Prüfungsdurchführung.<br />
Prüfungsplanung als komplexes Problem.<br />
1
Prüfungsplanung<br />
12 Ziele, Bedingungen und Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
121. Grundbegriffe<br />
121.1 Der Begriff Planung<br />
Definition von Planung nach Hax:<br />
versus<br />
"Gedankliche Vorwegnahme des künftigen Geschehens"<br />
Improvisation:<br />
Reaktion auf eine bereits eingetretene Situation.<br />
Vorausüberlegungen <strong>für</strong> die Planung:<br />
Entwicklung eines kompatiblen Zielsystems,<br />
Diagnose <strong>der</strong> Vorperiode,<br />
Prognose <strong>der</strong> künftigen Umweltbedingungen,<br />
Informationsbeschaffung über mögliche Handlungsalternativen,<br />
Bestimmung <strong>der</strong> Handlungskonsequenzen abhängig von <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Umweltsituation,<br />
Bewertung <strong>der</strong> Handlungskonsequenzen im Hinblick auf die angestrebten Ziele,<br />
Entscheidung <strong>für</strong> die optimale Handlungsalternative.<br />
2
121.2 Der Begriff Prüfungsplanung<br />
Definition Überwachung:<br />
Prüfungstheorie<br />
Vergleich <strong>der</strong> im Betrieb realisierten Istobjekte mit Vergleichsobjekten, und zwar entwe<strong>der</strong><br />
mit den Sollobjekten <strong>der</strong> Planung o<strong>der</strong> mit an<strong>der</strong>en geeigneten Istobjekten, mit dem Ziel<br />
1. festzustellen, ob zwischen den Objekten Übereinstimmungen o<strong>der</strong> Abweichungen<br />
bestehen und<br />
2. aus diesen Feststellungen Konsequenzen zu ziehen.<br />
⇒ Überwachung umfasst sowohl Kontrolle als auch Prüfung.<br />
Definition Kontrolle:<br />
Überwachungshandlungen sind fest in den betrieblichen Arbeitsablauf eingebaut, und/o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Überwacher ist <strong>für</strong> die Ergebnisse des (überwachten) Prozesses verantwortlich.<br />
Definition Prüfung:<br />
Überwachungshandlungen sind nicht fest in den Arbeitsablauf eingebaut, und <strong>der</strong><br />
Überwacher ist nicht <strong>für</strong> die Ergebnisse des (überwachten) Prozesses verantwortlich.<br />
⇒ Prozess zur Gewinnung eines vertrauenswürdigen Urteils über die richtige<br />
Abbildung <strong>der</strong> Lage, d. h. ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild<br />
<strong>der</strong> Sachverhalte in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht, durch<br />
Vergleich <strong>der</strong> vom Prüfer auszuwählenden Istobjekte mit Vergleichsobjekten mit<br />
dem Ziel, Abweichungen bzw. Übereinstimmungen zwischen diesen beiden<br />
Objektarten zu ermitteln und daraus ein Urteil zu bilden.<br />
Prüfungs- und Kontrollhandlungen bilden zusammen das in Abbildung 1 dargestellte<br />
Betriebswirtschaftliche Überwachungssystem.<br />
3
Manuelle<br />
Kontrolle<br />
Unternehmerische<br />
Überwachung<br />
Prüfungsplanung<br />
Kontrolle Revision<br />
+ Korrektur<br />
Automat.<br />
Kontrolle<br />
Internes Kontrollsystem-Element<br />
= IKSE<br />
Betriebswirtschaftliches<br />
Überwachungssystem<br />
Datenauswertung<br />
Internes Kontroll System (= IKS)<br />
Abb. 1: Betriebswirtschaftliches Überwachungssystem<br />
Definition Prüfungsplanung:<br />
Interne<br />
Revision<br />
+ Reaktionen<br />
Hoheitliche<br />
Überwachung<br />
Revisionssystem<br />
Externe<br />
Revision<br />
Zielgerichtete gedankliche Vorwegnahme <strong>der</strong> künftigen Beurteilungsprozesse von<br />
Prüfungsobjekten anhand vorgegebener Normen.<br />
Charakteristika <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
• Zukunftsbezogenheit,<br />
• Rationalität,<br />
• Gestaltungscharakter,<br />
• Prozessphänomen,<br />
• Informationeller Charakter.<br />
4
Prüfungstheorie<br />
122. Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
Einschränkung <strong>der</strong> Prüfungsplanung durch endogene und exogene Restriktionen:<br />
• Endogene Restriktionen:<br />
- Langfristige Planung umfasst die kurzfristige Planung;<br />
- Einengung <strong>der</strong> Dispositionsfreiheit nachgeordneter Instanzen durch Vorgaben<br />
übergeordneter Instanzen;<br />
- Zeitliche Vorgaben und Vorentscheidungen im Personalbereich begrenzen den<br />
Dispositionsspielraum im Sachbereich;<br />
- Sachliche und personelle Vorentscheidungen reduzieren die Freiheitsgrade <strong>der</strong><br />
Planung in zeitlicher Hinsicht;<br />
- Sachliche und zeitliche Vorentscheidungen limitieren Planungsmöglichkeiten in<br />
personeller Hinsicht.<br />
• Exogene Restriktionen:<br />
- Gesetzliche Vorschriften des dHGB bzw. UGB (§§ 316 – 324a dHGB bzw. §§<br />
268 - 276 UGB), die WPO sowie vertragliche Regelungen zwischen Prüfer und<br />
geprüftem Unternehmen;<br />
- Außergesetzliche Vorschriften <strong>der</strong> IDW Prüfungsstandards;<br />
- Sachliche Beschränkungen resultieren aus den Berufsgrundsätzen <strong>der</strong><br />
Unabhängigkeit und Unbefangenheit (§ 43 WPO);<br />
- Personelle Beschränkungen folgen aus dem Grundsatz <strong>der</strong> Eigenverantwortlichkeit;<br />
- Zeitliche Beschränkungen ergeben sich aus den gesetzlichen und vertraglichen<br />
Regelungen zwischen Prüfer und geprüftem Unternehmen.<br />
5
123. Ziele <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
Prüfungsplanung<br />
Rationale Prüfungsplanung hat sich an den Zielen <strong>der</strong> Prüfung zu orientieren.<br />
⇒ Notwendigkeit einer operationalen Zielvorschrift, d. h.<br />
• die Alternativen sind hinsichtlich Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug eindeutig<br />
festgelegt,<br />
• Kompatibilität <strong>der</strong> Einzelziele (i. S. einer lexikographischen Präferenzordnung o<strong>der</strong><br />
durch Substitutionsbeziehungen).<br />
Entwicklung einer operationalen Zielvorschrift<br />
• Prämissen:<br />
- Erwerbswirtschaftlich orientiertes Prüfungsunternehmen,<br />
- Oberziel: Langfristige Erzielung von maximalen Unternehmensgewinnen,<br />
- Sachlicher Bezug: Eine einzelne handelsrechtliche Pflichtprüfung.<br />
• Zielbildung ist abhängig von den verschiedenen Prüfungsadressaten<br />
• Kontroverse Diskussion um die Zielvorschrift im Schrifttum:<br />
SCHMALENBACH:<br />
"Die Wirtschaftsprüfung darf kein Geschäft sein, son<strong>der</strong>n sie (im Orig.: es) muß ein<br />
Amt im besten Sinne des Wortes werden."<br />
versus<br />
LOITLSBERGER:<br />
"Die Prüfung wird nicht um ihrer selbst willen durchgeführt; sie ist eine wirtschaftliche<br />
Veranstaltung und hat nur dann Sinn, wenn <strong>der</strong> durch sie gestiftete (in Geldeinheiten<br />
bewertete) Nutzen die Kosten ihrer Durchführung übersteigt."<br />
IDW for<strong>der</strong>t im IDW PS 240, Wirtschaftlichkeit und Termingerechtigkeit <strong>der</strong> Prüfung<br />
zu erreichen.<br />
6
Wirtschaftlichkeitsprinzip:<br />
Prüfungstheorie<br />
a) Wähle bei gegebenem Mitteleinsatz diejenige Handlungsalternative, welche zum<br />
höchsten Ergebnis führt (Maximierungspostulat) bzw.<br />
b) Wähle bei Vorgabe eines bestimmten zu erreichenden Ergebnisses diejenige<br />
Handlungsalternative, die den geringsten Mitteleinsatz erfor<strong>der</strong>t (Minimierungspostulat)!<br />
c) Generelles Extremierungspostulat: Wähle das optimale Verhältnis o<strong>der</strong> die größte<br />
Differenz zwischen bewertetem Ertrag und Aufwand, wenn we<strong>der</strong> Aufwand noch<br />
Ertrag von vornherein vorgegeben sind!<br />
⇒ Problem: Definition des Wirtschaftlichkeitsprinzips vernachlässigt, dass das<br />
Ergebnis bzw. <strong>der</strong> Mitteleinsatz des Handelns ex ante i. d. R. unsicher<br />
ist.<br />
Erweiterung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Risikokomponente:<br />
Wähle jene Handlungsalternative, die unter Einhaltung einer bestimmten Risikogrenze:<br />
a) ein vorgegebenes Ergebnis mit dem vermutlich geringsten Mitteleinsatz bzw.<br />
b) bei vorgegebenem Mitteleinsatz das vermutlich höchste Ergebnis verspricht bzw.<br />
c) ein optimales Verhältnis o<strong>der</strong> die größte Differenz zwischen bewertetem Ertrag<br />
und Mitteleinsatz vermuten lässt!<br />
⇒ Risikogrenze wird durch die Prüfungsadressaten (externe Adressaten,<br />
Auftraggeber, Prüfungsorgan) bestimmt.<br />
Eine sorgfältige Planung <strong>der</strong> Abschlussprüfung trägt dazu bei sicherzustellen, dass:<br />
• alle Bereiche des Prüfungsgegenstands eine angemessene Berücksichtigung finden,<br />
• mögliche Problemfel<strong>der</strong> erkannt werden,<br />
• <strong>der</strong> Prüfungsauftrag zeitgerecht bearbeitet werden kann,<br />
• <strong>der</strong> Mitarbeitereinsatz und die ggf. notwendige Zusammenarbeit mit an<strong>der</strong>en Prüfern<br />
o<strong>der</strong> Sachverständigen koordiniert und<br />
• <strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> AP beachtet wird.<br />
Neben <strong>der</strong> Planung zur Durchführung <strong>der</strong> Abschlussprüfung wird durch eine sachgerechte<br />
Gesamtplanung aller Aufträge einer WP-Praxis die Voraussetzung da<strong>für</strong> geschaffen, dass<br />
übernommene und erwartete Aufträge unter Beachtung <strong>der</strong> Berufsgrundsätze<br />
ordnungsgemäß durchgeführt und zeitgerecht abgeschlossen werden können (vgl. IDW PS<br />
240).<br />
7
Prüfungsplanung<br />
123.1 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht externer Adressaten<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Abschlussprüfung ist <strong>der</strong> vom externen Adressaten in Geldeinheiten veranschlagte<br />
Wert <strong>der</strong> Prüfung, vor allem <strong>der</strong> Wert des Testats.<br />
Um dieses Ergebnis zu erzielen, verzichtet er auf einen Teil seines ausschüttungsfähigen<br />
Jahreserfolges, denn das Prüfungshonorar wird zum Aufwand <strong>der</strong> geprüften Gesellschaft.<br />
123.2 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht des zu prüfenden Unternehmens<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Abschlussprüfung ist <strong>der</strong> vom zu prüfenden Unternehmen in Geldeinheiten<br />
veranschlagte Wert <strong>der</strong> Prüfungsurteile.<br />
Prüfungsurteile:<br />
- Testat,<br />
- Prüfungsbericht,<br />
- Informationen aus Prüfergesprächen,<br />
- Management Letter.<br />
Für die Prüfungsurteile entstehen dem zu prüfenden Unternehmen Kosten in Höhe des<br />
Prüferhonorars und Kosten <strong>für</strong> die Beschaffung und Bereitstellung <strong>der</strong> <strong>für</strong> die<br />
Abschlussprüfung notwendigen Informationen.<br />
123.3 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Prüfungsorgane<br />
Das Prüfungsorgan lehnt einen Prüfungsauftrag ab, wenn die Wahrscheinlichkeit zu groß<br />
ist,<br />
- dass <strong>der</strong> Kostenbetrag <strong>für</strong> die Prüfungsdurchführung über den geplanten (Höchst-)<br />
Betrag (Prüfungshonorar) steigt o<strong>der</strong><br />
- dass das Honorar unter den geplanten (Mindest-) Betrag (Prüfungshonorar) fällt.<br />
8
Prüfungstheorie<br />
In welchem Rahmen beeinflussen die an<strong>der</strong>en beiden Interessentengruppen die<br />
Ausprägung des Wirtschaftlichkeitsprinzips des Prüfungsorgans?<br />
Jede <strong>der</strong> drei Interessentengruppen kann grundsätzlich ihr eigenes gewünschtes<br />
Ergebnis und ihren eigenen Mitteleinsatz unter Beachtung des gesetzlich festgelegten<br />
Rahmens selbst bestimmen.<br />
- Auftragsvergabepflicht <strong>für</strong> den Auftraggeber (§ 316 Abs. 1 dHGB bzw.<br />
§ 268 Abs. 1 UGB),<br />
- Qualität <strong>der</strong> Endprodukte <strong>der</strong> Prüfung (Urteile) ist in § 317 Abs. 1 dHGB<br />
bzw. § 269 Abs. 1 UGB nur unzureichend fixiert,<br />
- außenstehende Gesellschafter können ihre Wünsche und Ansprüche nicht in<br />
die Auftragsverhandlungen einbringen,<br />
- keine endgültige Preisfestlegung <strong>für</strong> die Leistung vor Fertigstellung des<br />
Endprodukts.<br />
• Außenstehende Gesellschafter können nur sehr begrenzt Einfluss auf ihr<br />
gewünschtes "Ergebnis" und ihren "Mitteleinsatz" bei <strong>der</strong> Abschlussprüfung<br />
nehmen.<br />
• Einflussmöglichkeiten <strong>der</strong> Auftraggeber nur in sehr begrenztem Rahmen des<br />
§ 318 dHGB bzw. § 270 UGB möglich (aber Marktmacht!).<br />
• Prüfer hat wegen <strong>der</strong> Agency-Problematik den größten Spielraum, seine<br />
Vorstellung von <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Prüfung durchzusetzen; aber:<br />
- Mitteleinsatz wird durch:<br />
-- gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsumfang,<br />
-- berufsrechtlichen bzw. berufsethischen Verhaltenskodex<br />
begrenzt.<br />
- Ergebnis (Honorar) wird durch:<br />
-- Treuepflicht gegenüber Auftraggeber,<br />
-- Vorvereinbarung des Zeitbudgets und des Zeithonorarsatzes<br />
(unter Kautelen) begrenzt.<br />
9
Prüfungsplanung<br />
Grundsätzliches Verbot von Pauschalhonoraren durch Schreiben <strong>der</strong> WPK<br />
Begründung:<br />
Gefahr eines nicht hinreichend sicheren und genauen Urteils, wenn <strong>der</strong> tatsächliche<br />
Zeitbedarf größer ist als das vereinbarte Zeitbudget.<br />
Gegenargument:<br />
Für diesen Fall muss sich <strong>der</strong> Abschlussprüfer in den Prüfungsverträgen durch Kautelen<br />
absichern.<br />
Zusätzliche vertragliche Vereinbarung ist dahingehend möglich, dass<br />
• bei Planungsfehlern und Ineffizienzen <strong>der</strong> Prüfungsunternehmung eine Ausweitung<br />
<strong>der</strong> Prüfung zu ihren eigenen Lasten geht,<br />
• bei unerwarteten Schwierigkeiten, die die zu prüfende Unternehmung zu verantworten<br />
hat, eine zeitliche Ausweitung <strong>der</strong> Prüfung zu Lasten <strong>der</strong> zu prüfenden<br />
Unternehmung geht.<br />
Ergebnis:<br />
• ”Feste” Honorarvereinbarungen vor Auftragsvergabe sind nur akzeptabel, sofern<br />
eine zeitliche Ausdehnung <strong>der</strong> Prüfung, welche in den Verantwortungsbereich <strong>der</strong><br />
zu prüfenden Unternehmung fällt, auch zu <strong>der</strong>en Lasten geht.<br />
• Außerdem muss <strong>der</strong> Prüfer sein geplantes Zeitbudget zu seinen Lasten ausdehnen,<br />
wenn Vertrauenswürdigkeit des Urteils bei Einhaltung des Zeitbudgets nicht<br />
erreicht werden kann und die Gründe nicht beim zu prüfenden Unternehmen<br />
liegen, z. B. mangelnde Prüfungsplanung o<strong>der</strong> fehlerhafte Prüfungsausführung. In<br />
diesem Fall muss länger geprüft werden, ohne dass <strong>der</strong> Prüfer <strong>für</strong> die<br />
Budgetüberschreitung mehr Zeithonorar erhält.<br />
- Gründe <strong>für</strong> die Ausdehnung des Zeitbudgets zu Lasten <strong>der</strong> zu prüfenden<br />
Gesellschaft:<br />
-- Mangelnde Qualität des IKS,<br />
-- Fehlende Prüfungsbereitschaft des zu prüfenden Unternehmens,<br />
-- Erhebliche Fehler im Rechnungswesen.<br />
- Gründe <strong>für</strong> die Ausdehnung des Zeitbudgets zu Lasten des Prüfungsunternehmens:<br />
-- Mangelnde Effizienz <strong>der</strong> Prüfenden,<br />
-- Mangelnde Prüfungsplanung.<br />
• Bei Vereinbarung von Zeitbudget und Zeithonorarsatz ist eine Absicherung<br />
des Prüfers im Prüfungsvertrag durch Kautelen erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Das Honorar setzt sich aus einer Wertgebühr und einer Zeitgebühr zusammen:<br />
10
Prüfungstheorie<br />
• Wertgebühr richtet sich nach <strong>der</strong> Bilanzsumme des zu prüfenden Unternehmens.<br />
Sie ist nicht beeinflussbar bzw. sollte es nicht sein. In <strong>der</strong> Praxis wird zunehmend<br />
auf eine Wertgebühr verzichtet.<br />
• Zeitgebühr richtet sich nach <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> eingesetzten Prüfer, <strong>der</strong> Prüfungszeit je<br />
Prüfer, <strong>der</strong> Qualifikation <strong>der</strong> Prüfer und <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> jeweiligen Gebührensätze.<br />
Zwei Ansatzpunkte <strong>für</strong> Erlössteigerungen:<br />
1. Steigerung <strong>der</strong> Gebührensätze<br />
• Kaum möglich, da Gebührensätze durch frühere Verlautbarungen des<br />
IDW sowie Fortschreibung von Indexzuschlägen weitgehend standardisiert<br />
sind und da ein erheblicher Wettbewerb unter den Wirtschaftsprüfern<br />
bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften besteht.<br />
2. Ausdehnung <strong>der</strong> Prüfungsdauer<br />
• zum Zwecke <strong>der</strong> Honorarmaximierung Verstoß gegen die Berufsgrundsätze<br />
<strong>der</strong> Wirtschaftsprüfer (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 WPO)<br />
⇒ STOVFE (Sorgfalt, Treue, Objektivität, Verschwiegenheit, Freiberuflichkeit,<br />
Eigenverantwortlichkeit)<br />
und:<br />
langfristige Folge ist <strong>der</strong> Verlust des Prüfungsauftrages.<br />
11
Prüfungsplanung<br />
Entwicklung einer zweigeteilten, sequentiellen Zielvorschrift <strong>für</strong> den Prüfer<br />
(1) zur Akquisition (Erlangung) <strong>der</strong> Aufträge und<br />
(2) zur Erledigung <strong>der</strong> Aufträge.<br />
Zu (1): Eine Zielvorschrift zur Akquisition von Prüfungsaufträgen<br />
Bedingung:<br />
Gewährleistung einer Mindestqualität des Urteils durch den Prüfer!<br />
• Problem:<br />
Normierung <strong>der</strong> Höhe (des Zielausmaßes) des zu for<strong>der</strong>nden Qualitätsstandards<br />
⇒ Festlegung einer allgemeinen Norm <strong>für</strong> den Qualitätsstandard des Urteils:<br />
Jahresabschluss kann vom Prüfer als einwandfrei bezeichnet werden, wenn jede<br />
Prüfung eines Prüfungsfeldes den GoA genügt, die die Urteilsqualität determinieren.<br />
Relevante Einflussfaktoren <strong>für</strong> die Planung des Zeitbudgets:<br />
• Bekanntheitsgrad bzw. Kenntnis des Prüfungsobjekts (Erst- o<strong>der</strong> Folgeauftrag),<br />
• Prüfungsbereitschaft des zu prüfenden Unternehmens,<br />
• Umfang des Rechnungswesens,<br />
• Zahl/Größe <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong>,<br />
• Homogenität des Prüfungsstoffs,<br />
• Qualität des IKS,<br />
• Fehlererwartung,<br />
• Qualifikation, Zuverlässigkeit und Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter des zu prüfenden<br />
Unternehmens,<br />
12
Prüfungstheorie<br />
• Tätigkeit/Qualität <strong>der</strong> Internen Revision,<br />
• wirtschaftliche Lage des zu prüfenden Unternehmens.<br />
Einige <strong>der</strong> Einflussfaktoren sind bei den Vertragsverhandlungen noch nicht bekannt, daher<br />
sind Annahmen bzw. Bedingungen bzgl. dieser Einflussfaktoren als anzupassende<br />
Prämissen in den Vertrag aufzunehmen.<br />
Überlegungen bei <strong>der</strong> Akquisition<br />
• <strong>für</strong> einen potentiellen Prüfungsauftrag:<br />
Akquisiteur wird versuchen, ein möglichst hohes Honorar <strong>für</strong> den Auftrag zu erhalten,<br />
ihn aber nach Möglichkeit nicht durch zu hohe Honorarfor<strong>der</strong>ungen zu verlieren.<br />
Wichtig: Honorarvereinbarungen unter Kautelen.<br />
• <strong>für</strong> mehrere o<strong>der</strong> alle Prüfungsaufträge:<br />
Ergebnis:<br />
Akquisiteur wird strategischen Überlegungen den Vorrang geben (Marktanteil,<br />
kurz- und langfristige Kapazitätsauslastung, Wettbewerbsposition etc.).<br />
• Im Normalfall wird <strong>der</strong> Auftragsakquisiteur das Maximierungspostulat in Bezug<br />
auf das Zeithonorar <strong>für</strong> jeden Auftrag verfolgen.<br />
• Entgegengesetztes Streben des Auftraggebers und die Wettbewerbs- und Auslastungssituation<br />
des Akquisiteurs begrenzen das Maximierungsstreben.<br />
• Das Ergebnis <strong>der</strong> Auftragsverhandlungen sollte die Vereinbarung eines Zeit- und<br />
Werthonorars unter Einschluss <strong>der</strong> besprochenen Kautelen sein, wobei <strong>der</strong><br />
Auftragsakquisiteur bei <strong>der</strong> Ermittlung seiner gedanklichen Preisuntergrenze<br />
(Honoraruntergrenze) einen erfor<strong>der</strong>lichen Prüfungsumfang unterstellen muss, <strong>der</strong><br />
die GoA berücksichtigt.<br />
13
Prüfungsplanung<br />
Zu (2): Eine Zielvorschrift zur Erledigung von Prüfungsaufträgen<br />
Liegt <strong>der</strong> Auftrag mit unter Kautelen vereinbartem Honorar vor, dann sind folgende<br />
Zielkomponenten <strong>für</strong> die (Detail-)Planung, die Realisation und die Überwachung des<br />
Prüfungsauftrages zu berücksichtigen:<br />
a) die Kosten <strong>der</strong> Prüfungserledigung als Mitteleinsatz des Prüfungsunternehmens<br />
und<br />
b) die Urteilsqualität.<br />
Restriktion:<br />
Urteile des Prüfungsunternehmens müssen <strong>für</strong> Informationsadressaten vertrauenswürdig<br />
sein.<br />
• Wi<strong>der</strong>spruch zwischen Kostenminimierung und möglichst hoher Urteilsqualität,<br />
wenn beide Ziele gleichzeitig verfolgt werden sollen.<br />
• Lösung:<br />
Zielfunktion:<br />
Formulierung des Ziels "Qualität des Urteils" als Nebenbedingung, durch die eine<br />
bestimmte Mindestqualität erreicht werden soll<br />
⇒ kompatibles Zielsystem.<br />
Hierzu notwendig:<br />
Festlegung des zu for<strong>der</strong>nden Qualitätsstandards, d. h.<br />
- Sicherheit und<br />
- Genauigkeit des Urteils sind festzulegen.<br />
Ziel <strong>der</strong> Prüfung ist die Abgabe eines hinreichend vertrauenswürdigen Urteils <strong>für</strong> einen<br />
gegebenen Prüfungsauftrag (bei vor Prüfungsbeginn unter bestimmten Kautelen<br />
vereinbartem Prüfungshonorar) mit minimalen Kosten <strong>für</strong> das Prüfungsunternehmen.<br />
14
Prüfungstheorie<br />
Folgende Abbildung veranschaulicht die Metaebenen <strong>der</strong> Prüfung:<br />
Vom Prüfer gefälltes<br />
Urteil über Zuverlässigkeit<br />
und Genauigkeit<br />
des Jahresabschlusses<br />
und des<br />
Lageberichtes<br />
(uneingeschränkt, eingeschränkt,verweigert)<br />
Jahresabschluß<br />
Bilanz<br />
GuV<br />
Anhang<br />
Lagebericht<br />
Vertrauenswürdigkeit des Prüferurteils:<br />
Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Prüferurteils<br />
Abb. 2: Metaebenen im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />
Definitionen:<br />
Tatsächlich vom Ersteller<br />
erreichter Grad<br />
an Zuverlässigkeit<br />
und Genauigkeit <strong>der</strong><br />
Aussage des Jahresabschlusses<br />
und<br />
Lageberichtes<br />
• Genauigkeit ist ein Maß <strong>für</strong> die Exaktheit <strong>der</strong> Wert-, Mengen- und Fehler(anteils)angaben.<br />
Absolute Genauigkeit liegt bei Punktangaben vor. Geringere<br />
Genauigkeit liefern Intervallangaben. Die Genauigkeit nimmt mit zunehmen<strong>der</strong><br />
Intervallbreite ab.<br />
• Sicherheit ist die Wahrscheinlichkeit im Sinne relativer Häufigkeiten:<br />
Sicherheit =<br />
Zahl <strong>der</strong> beobachteten fehlerfreien<br />
Bearbeitungselemente<br />
Zahl <strong>der</strong> insgesamt untersuchten<br />
Bearbeitungselemente<br />
15
Maximaler Qualitätsstandard:<br />
Prüfungsplanung<br />
- 100 % Sicherheit,<br />
- absolute (punktuelle) Genauigkeit.<br />
• Aber § 317 dHGB ⇒ § 322 BV (bzw. § 321 PB) bzw. § 269 UGB ⇒ § 274 BV<br />
(bzw. § 273 PB) verlangen bzw. erfor<strong>der</strong>n:<br />
- verbale Formulierung des Urteils und<br />
- keine Angaben über Sicherheit und Genauigkeit.<br />
• Eine Quantifizierung <strong>der</strong> Sicherheit und Genauigkeit ist nur bei Stichprobenprüfungen<br />
möglich, nicht dagegen bei bewusst gesteuerten Auswahlverfahren.<br />
• Eine 100 %ige Sicherheit und Genauigkeit wäre auch nicht im Interesse <strong>der</strong><br />
beteiligten Gruppen.<br />
• Möglicher Kompromiss:<br />
- 95 % Sicherheit<br />
- 99 % Genauigkeit.<br />
Nebenbedingung "Qualität des Urteils" bedeutet:<br />
Gewinnmaximierung durch Kostenminimierung nur bei Gewährleistung <strong>der</strong> Abgabe<br />
hinreichend sicherer und genauer Urteile.<br />
• § 1 Abs. 2 WPO:<br />
- WP übt einen freien Beruf aus, kein Gewerbe;<br />
- Aufgaben: fachliche Leistung, nicht Erwerb;<br />
• Nebenbedingung unbedingt beachten!<br />
• Auch Gewinnstreben erfor<strong>der</strong>t Urteilsqualität, sonst:<br />
- Schadensersatzansprüche o<strong>der</strong><br />
- Verlust des Prüfungsauftrages.<br />
16
Prüfungstheorie<br />
Zielvorschrift bei mehreren Prüfungsaufträgen:<br />
Durch eine höhere Zahl von Prüfungsaufträgen pro Periode können die erzielbaren<br />
Werthonorare gesteigert werden.<br />
• Interesse des Prüfungsunternehmens:<br />
- Senkung <strong>der</strong> Prüfungszeit bei einzelnen Prüfungen (Rationalisierungspotential<br />
erschließen und ausschöpfen),<br />
- Steigerung <strong>der</strong> Auftragszahl pro Periode.<br />
• Restriktion:<br />
So würden Kosten <strong>für</strong> das geprüfte Unternehmen gesenkt und Wertgebühren<br />
<strong>für</strong> den Prüfer je Jahr gesteigert.<br />
Abgabe hinreichend sicherer und genauer Urteile.<br />
124. Anfor<strong>der</strong>ungen an die Prüfungsplanung<br />
(1) Vollständigkeit im Sinne des dHGB bzw. UGB und im Sinne <strong>der</strong> Statistik<br />
• § 317 dHGB bzw. § 269 UGB. Gegenstand und Umfang <strong>der</strong> Prüfung:<br />
Aussagen über den Prüfungsgegenstand (Buchführung, Jahresabschluss und<br />
Lagebericht).<br />
• § 320 dHGB bzw. § 272 UGB. Vorlagepflicht und Auskunftsrecht:<br />
"Sie (die gesetzlichen Vertreter) haben ihm (dem Prüfer) zu gestatten, die Bücher<br />
und Schriften zu prüfen." (Das sind alle Bücher und Schriften!) Der Prüfer "kann<br />
alle Aufklärungen und Nachweise verlangen."<br />
• Berücksichtigung aller <strong>für</strong> die Urteilsfindung wesentlichen Sachverhalte.<br />
• Verhin<strong>der</strong>ung unsachgemäßer Prüfung von Teilgebieten aufgrund Zeitdrucks.<br />
17
(2) Flexibilität<br />
Prüfungsplanung<br />
• Berücksichtigung <strong>der</strong> im Verlauf des Realisationsprozesses erhaltenen Informationen,<br />
• Möglichkeit <strong>der</strong> Anpassung an Datenän<strong>der</strong>ungen.<br />
⇒ Flexible Strategie!<br />
(3) Wirtschaftlichkeit<br />
• Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Kalkülen:<br />
Ertrag<br />
Aufwand<br />
o<strong>der</strong> Leistung<br />
Kosten<br />
> 1<br />
o<strong>der</strong>: Ertrag - Aufwand > 0<br />
⇒ Problem:<br />
Optimale Bestimmung des Detaillierungsgrades <strong>der</strong> Planung.<br />
18
125. Art und Umfang <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
125.1 Entwicklung einer Prüfungsstrategie<br />
Prüfungstheorie<br />
Die Prüfungsplanung umfasst die Entwicklung einer Prüfungsstrategie und einem darauf<br />
aufbauenden Prüfungsprogramm, in dem Art, Umfang und Zeitpunkt <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
im Einzelnen festgelegt werden.<br />
Die Entwicklung einer angemessenen risikoorientierten Prüfungsstrategie setzt voraus, dass<br />
<strong>der</strong> AP ausreichende Kenntnisse über das zu prüfende Unternehmen erwirbt (vgl. IDW PS<br />
230) und vor allem folgende Aspekte berücksichtigt werden:<br />
• Kenntnisse über das Unternehmen und seine Tätigkeit,<br />
• Verständnis <strong>für</strong> das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem,<br />
• Risiko- und Wesentlichkeitseinschätzungen.<br />
Kenntnisse über Geschäftstätigkeit und wirtschaftl./rechtl. Umfeld des Unternehmens hat <strong>der</strong><br />
AP durch analytische Prüfungshandlungen zu vertiefen. Er gewinnt so ebenfalls Hinweise auf<br />
Beson<strong>der</strong>heiten in zu prüfenden Prüfungsfel<strong>der</strong>n (vgl. IDW PS 312).<br />
125.2 Erstellung eines Prüfungsprogramms<br />
125.21 Überblick<br />
Zur Umsetzung <strong>der</strong> Prüfungsstrategie hat <strong>der</strong> AP ein Prüfungsprogramm zu erstellen, das<br />
einen ordnungsgemäßen Prüfungsablauf in sachlicher, personeller und zeitlicher Hinsicht<br />
gewährleisten soll.<br />
Sachliche<br />
Planung<br />
Art<br />
Umfang<br />
Reihenfolge<br />
Prüfungsprogrammplanung<br />
Personalplanung Zeitplanung<br />
<strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
Abb. 3: Teilbereiche <strong>der</strong> Prüfungsprogrammplanung<br />
19
Prüfungsplanung<br />
Zwischen den Teilbereichen <strong>der</strong> Prüfungsplanung bestehen enge Interdependenzen.<br />
• Simultane Planung unter gegenseitiger Abstimmung aller Variablen<br />
eigentlich erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Aber: Bisher wurde kein <strong>der</strong>artiges (notwendig komplexes) Planungsmodell in <strong>der</strong><br />
Theorie konzipiert.<br />
⇒ Reduzierung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung: Verzicht auf Simultanansatz!<br />
Aber: Planer muss versuchen, erkannte Interdependenzen zu berücksichtigen und die<br />
Planungsbereiche, soweit wie möglich, sukzessiv aufeinan<strong>der</strong> abzustimmen.<br />
125.22 Sachliche Planung<br />
Kernstück <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
In einem Prüfungsprogramm werden folgende Aspekte festgelegt:<br />
(a) Art,<br />
(b) Umfang und<br />
(c) Reihenfolge<br />
<strong>der</strong> vorzunehmenden Prüfungshandlungen.<br />
Zu (a): Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
Die Festlegung <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen geschieht in drei Schritten nach<br />
folgendem Ablauf:<br />
• Bildung von Prüfungsfel<strong>der</strong>n:<br />
Das gesamte Prüfungsobjekt (Prüfstoff) muss in abgegrenzte Teilobjekte strukturiert<br />
werden. Solche Teilobjekte sind Prüfungsfel<strong>der</strong>.<br />
• Bestimmung <strong>der</strong> Prüfungsmethode bzw. -verfahren:<br />
Eine Prüfungsmethode bzw. ein Prüfungsverfahren ist <strong>der</strong> Weg, auf dem Prüfungsinformationen<br />
durch Prüfungshandlungen gewonnen werden.<br />
Prüfungsmethoden bzw. -verfahren sind:<br />
*)<br />
Kriterien Prüfungsmethoden bzw. -verfahren<br />
Unmittelbarkeit <strong>der</strong> Prüfung,<br />
zeitliche und logische Distanz<br />
zum Prüfungsobjekt<br />
Systemprüfung<br />
⇒ indirekte Prüfung<br />
20<br />
Ergebnisprüfung<br />
(= Jahresabschlusszahlenprüfung)<br />
⇒ direkte Prüfung<br />
Richtung <strong>der</strong> Prüfung progressive, retrograde, bidirektionale Prüfung<br />
Umfang <strong>der</strong> Prüfung *)<br />
Vollprüfung Auswahlprüfung<br />
Vgl. dazu aber auch Punkt (b): Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen.
• Bestimmung <strong>der</strong> Prüfungshandlungen:<br />
Prüfungstheorie<br />
− Prüfungshandlungen sind so zu bestimmen, dass eine sichere und genaue, also eine<br />
vertrauenswürdige Beurteilung <strong>der</strong> Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit <strong>der</strong> Rechnungslegung<br />
möglich ist.<br />
− Prüfungshandlungen sind alle im Prüfungsprozess auszuführenden Handlungen, die<br />
dazu geeignet sind, dem Prüfer Informationen über sein Prüfungsobjekt zu liefern.<br />
− Kriterien <strong>für</strong> die Bestimmung <strong>der</strong> Prüfungshandlungen:<br />
− Organisatorische Gegebenheiten,<br />
− Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes,<br />
− Fehlerwahrscheinlichkeit.<br />
− Prüfungshandlungen werden zur Ermittlung und zum anschließenden Vergleich <strong>der</strong><br />
Soll- bzw. Vergleichs- und Istobjekte vorgenommen. Sie können bestehen in:<br />
Zu (b): Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
- Beobachtungen, - Vergleichen,<br />
- Einholen von Auskünften, - Abstimmen,<br />
- Nachvollziehen von Arbeits- - Interpretieren von Gesetzen,<br />
abläufen,<br />
- Urteilselemente formulieren,<br />
- Messen, - Istobjekte auswählen,<br />
- Zählen, - Addieren bzw. Nachrechnen,<br />
- Wiegen,<br />
- Schätzen,<br />
- Dokumentieren.<br />
Der notwendige Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen kann bei vorgegebenem Sicherheits-<br />
und Genauigkeitsgrad mittels <strong>der</strong> mathematischen Stichprobentheorie rechnerisch ermittelt<br />
werden, sofern die Bedingungen <strong>für</strong> die Anwendung von Stichprobenverfahren<br />
vorliegen.<br />
Zu (c): Reihenfolge <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
Stufengesetz <strong>der</strong> Prüfung (nach Zimmermann):<br />
Prüfungsfel<strong>der</strong> sind so nacheinan<strong>der</strong> bzw. nebeneinan<strong>der</strong> zu prüfen, dass ein Prüfungsfeld,<br />
dessen Bearbeitung die Kenntnis des Ergebnisses <strong>der</strong> Prüfung eines an<strong>der</strong>en Prüfungsfeldes<br />
zur Voraussetzung hat, auch erst dann geprüft wird, wenn diese Voraussetzungen gegeben<br />
sind.<br />
⇒ Berücksichtigung bei <strong>der</strong> Planung.<br />
21
125.23 Personalplanung<br />
Prüfungsplanung<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Personalplanung ist es, Prüferteams zu bilden und den Mitglie<strong>der</strong>n des Teams<br />
einzelne Aufgaben o<strong>der</strong> Aufgabengebiete zuzuordnen. Diese Zuordnung muss <strong>der</strong>gestalt<br />
vorgenommen werden, dass das Ziel <strong>der</strong> Prüfung, die Abgabe eines hinreichend sicheren<br />
und genauen Urteils bei minimalen Kosten, realisiert wird.<br />
Folgende Nebenbedingungen sind zu beachten:<br />
(1) Die Qualifikation <strong>der</strong> Prüfer muss dem Schwierigkeitsgrad <strong>der</strong> von ihnen zu<br />
lösenden Aufgaben angepasst sein.<br />
(2) Die Ausbildungsfunktion <strong>der</strong> Prüfung muss gewährleistet bzw. möglich sein.<br />
(3) Die Verfügbarkeit <strong>der</strong> Prüfer muss berücksichtigt werden.<br />
(4) Kontinuität und/o<strong>der</strong> Wechsel in <strong>der</strong> personellen Besetzung sind zu beachten.<br />
(5) Die Kompetenzen <strong>der</strong> einzelnen Mitarbeiter, auch im Hinblick auf<br />
Beaufsichtigung und Kontrollen innerhalb des Prüfungsteams, sind zu<br />
berücksichtigen.<br />
(6) Mögliche Interessenkollisionen müssen vermieden werden.<br />
(7) Gesamtverantwortung <strong>für</strong> Prüfung und Urteil bleibt trotz <strong>der</strong> Aufgabendelegation<br />
an die Mitglie<strong>der</strong> des Prüferteams beim Abschlussprüfer.<br />
Instrumente <strong>der</strong> Personalplanung sind Methoden des Operation Research:<br />
• Flood'sche Zurechnungstechnik<br />
(SEICHT, WPg 1965, S. 90-92; WEIRICH, WPg 1965, S. 93-96),<br />
• Vogel'sche Approximationsmethode<br />
(KRUG/KRANE, WPg 1968, S. 621-627),<br />
• Binäre Optimierung<br />
(BOLENZ/FRANK, ZfbF 1977, S. 427-447).<br />
Problem:<br />
• Teilweise mangelnde Realitätsnähe <strong>der</strong> Prämissen,<br />
• Quantifizierung <strong>der</strong> Einflussfaktoren.<br />
22
125.24 Zeitplanung<br />
Aufgaben und Teilaspekte:<br />
Prüfungstheorie<br />
• Zeitliche Abstimmung <strong>der</strong> durch den Prüfungsplaner während einer mehr o<strong>der</strong><br />
weniger langen Planungsperiode abzuwickelnden Aufträge;<br />
• Bestimmung <strong>der</strong> Zeiträume (Anfangs- und Endzeitpunkte), in denen die Mitarbeiter<br />
o<strong>der</strong> die einzelnen Teams <strong>für</strong> die Erledigung <strong>der</strong> Einzelaufträge zur Verfügung<br />
stehen sollen;<br />
• Bestimmung <strong>der</strong> Zeiträume (Anfangs- und Endzeitpunkte), in denen die Bearbeitung<br />
von einzelnen Prüfungsfel<strong>der</strong>n bzw. Prüfungsfel<strong>der</strong>gruppen im<br />
Rahmen <strong>der</strong> einzelnen Aufträge vorgenommen werden soll;<br />
• Berücksichtigung <strong>der</strong> Möglichkeit von Zwischenprüfungen (Vorprüfungen);<br />
• Berücksichtigung <strong>der</strong> Bildung von Prüfungsschwerpunkten bei mehrjähriger<br />
Prüfungsplanung;<br />
• Ergebnis <strong>der</strong> Zeitplanung muss eine fristgerechte Abgabe des Prüfungsurteils<br />
ermöglichen.<br />
Zweck <strong>der</strong> Zeitplanung:<br />
• Einhalten <strong>der</strong> Maximalprüfzeiten je Prüffeld;<br />
• Erkennen und Vermeiden von zeitlichen Unverträglichkeiten und damit<br />
• Einhalten des Abgabetermins <strong>für</strong> Prüfungsbericht und BV.<br />
• Netzplantechnik ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Lösung <strong>der</strong> Probleme<br />
<strong>der</strong> Zeitplanung.<br />
23
13. Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
131. Zielbildung<br />
Erster Schritt <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
Prüfungsplanung<br />
Zielbildung ist Ausgangspunkt des betrieblichen Entscheidungsprozesses.<br />
• Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
- orientieren sich an sachlogischen Merkmalen eines Planungs- und Entscheidungsprozesses;<br />
- orientieren sich nicht an <strong>der</strong> zeitlichen Abfolge, bedingt durch parallel verlaufende<br />
Prozesse und Rückkopplungen.<br />
24
Informationssuche<br />
Beschaffung von Informationen<br />
über:<br />
- die Art <strong>der</strong> Prüfung<br />
- die zu prüfende Unternehmung<br />
- die Prüfungsunternehmung<br />
- alle wesentlichen Einflußfaktoren<br />
auf die genannten<br />
Punkte<br />
Soll<br />
Planvorgabe<br />
(Anweisungen zur Durchsetzung<br />
des angestrebten<br />
Plans)<br />
- Prüfungsart<br />
- Prüfungsfel<strong>der</strong><br />
- Prüfungsrichtung<br />
- Prüfungsumfang<br />
- Systemprüfung<br />
- JA-Zahlenprüfung<br />
- Reihenfolge<br />
- Zeitbedarf<br />
- Erwartete Kosten<br />
- Prüferzuordnung<br />
- Flexibilität<br />
Prüfungstheorie<br />
Aufstellen von Arbeitshypothesen<br />
über wirtschaftliche Prüfungen:<br />
Beschaffung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Daten<br />
Hypothesentest<br />
Eventualplanung<br />
Zielbildung<br />
Aufstellen eines operationalen<br />
Zielsystems:<br />
Abgabe eines hinreichend sicheren<br />
und genauen Urteils <strong>für</strong> einen gegebenen<br />
Prüfungsauftrag (bei vor Prüfungsbeginn<br />
unter Kautelen vereinbartem<br />
Honorar) mit minimalen<br />
Kosten <strong>für</strong> die Prüfungsunternehmung<br />
Auftreten von Störgrößen<br />
Aufstellen konkreter Alternativpläne <strong>für</strong> eine<br />
wirtschaftliche Prüfung<br />
Entscheidung <strong>für</strong> einen bestimmten Plan<br />
- Entscheidung <strong>für</strong> einen Plan<br />
- Entwicklung von Sollwerten bzw. -angaben<br />
Soll<br />
Realisation<br />
- Durchführung des Prüfungsprozesses<br />
- Dokumentation von Teilergebnissen<br />
und Zeitbedarfe<br />
Verbessern<br />
<strong>der</strong> Arbeitshypothesen<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> verfahrens- und ergebnisorientierten Überwachung<br />
Abb. 4: Das Phasenschema <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />
25<br />
Ist<br />
Überwachung <strong>der</strong><br />
Prüfungsplanung<br />
und - realisation<br />
- Soll-Ist-Vergleich<br />
- Quality Control<br />
- Peer Review<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Dispositionsüberwachung
132. Informationssuche<br />
Zweiter Schritt <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
Beschaffung von Informationen<br />
• WITTMANN:<br />
Prüfungsplanung<br />
Information = zweckorientiertes Wissen<br />
• Verkürzung <strong>der</strong> "Informationssuche"<br />
• daher Exkurs: Informationstheorie<br />
Problem: Vermittlung von Fakten und Meinungen nur möglich,<br />
wenn Sen<strong>der</strong> und Empfänger (weitgehend) dasselbe Sprachrepertoire<br />
(Zeichenvorrat und Grammatik) kennen und verwenden.<br />
In <strong>der</strong> Informationstheorie unterscheidet man zur Analyse von Kommunikationsbeziehungen<br />
drei Ebenen. Diese Ebenen lassen sich durch folgendes Bild veranschaulichen:<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Ebene Mittel Ergebnis<br />
Pragmatische<br />
(obere) Ebene<br />
Semantische<br />
(m ittlere) Ebene<br />
Syntaktische<br />
(untere) Ebene<br />
Zweckorientierung<br />
Bedeutung<br />
Abb. 5: Signal-Nachricht-Information (Semiotik)<br />
Informationen<br />
Nachrichten<br />
M aterie Signale<br />
26
Prüfungstheorie<br />
Ebene Beispiel<br />
Syntaktik -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Semantik -<br />
Ziffern und Buchstaben und<br />
Kombinationen daraus<br />
Kombinationsregeln<br />
Glie<strong>der</strong>ungsschemata <strong>für</strong> Bilanz und GuV<br />
Kontenform/Staffelform<br />
Prinzip <strong>der</strong> Doppik<br />
Bedeutung/Aussagekraft von Art und Höhe bestimmter<br />
Bilanzpositionen <strong>für</strong> den tatsächlichen Erfolg<br />
des Unternehmens<br />
Pragmatik - Nutzen <strong>der</strong> Jahresabschlussinformationen <strong>für</strong> Kauf-<br />
und Verkaufentscheidung von Unternehmensanteilen<br />
Vermittlung von Fakten und Meinungen ist nur möglich, sofern Sen<strong>der</strong> und Empfänger<br />
(weitgehend) dasselbe Sprachrepertoire kennen und verwenden:<br />
Sen<strong>der</strong><br />
Zeichenvorrat<br />
des Sen<strong>der</strong>s<br />
Signale<br />
(Nachrichten, Informationen)<br />
Gemeinsamer<br />
Zeichenvorrat<br />
Empfänger<br />
Zeichenvorrat<br />
des Empfängers<br />
Abb. 6: Prinzip <strong>der</strong> Übertragung von Nachrichten über Fakten und Meinungen<br />
27
Prüfungsplanung<br />
Informationsmittel Sen<strong>der</strong> Empfänger<br />
Jahresabschluss Unternehmensleitung − Eigentümer<br />
− Gläubiger<br />
− Arbeitnehmer<br />
− Kunden<br />
− Lieferanten<br />
− Fiskus<br />
Bestätigungsvermerk Prüfer siehe bei Jahresabschluss<br />
Prüfungsbericht Prüfer − Aufsichtsrat<br />
− Unternehmensleitung<br />
− Fiskus<br />
− Evt. Kreditgeber<br />
Beschaffung von Informationen im Rahmen <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
• Planer benötigt Informationen über die Art <strong>der</strong> Prüfung:<br />
- zu prüfendes Unternehmen,<br />
- Prüfungsunternehmen,<br />
- alle wesentlichen Einflussgrößen.<br />
• Die Informationsbeschaffung geschieht laufend (während des gesamten Prüfungsprozesses).<br />
• Beginn: Vor Entscheidung über Annahme o<strong>der</strong> Ablehnung eines<br />
Prüfungsauftrags.<br />
• Vor Auftragsannahme muss sich <strong>der</strong> Prüfer über<br />
- Umfang <strong>der</strong> Prüfung,<br />
- Schwierigkeitsgrad/Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Prüfung,<br />
- vorhandene (potentiell verfügbare) Ressourcen informieren.<br />
• Je höher <strong>der</strong> Auftragsbestand ist, desto genauer müssen die Informationen sein, da<br />
<strong>der</strong> Spielraum bei unerwarteten Mehrbelastungen gering ist.<br />
28
Prüfungstheorie<br />
• Bei <strong>der</strong> Informationsbeschaffung ist zu unterscheiden zwischen:<br />
- Art und Umfang <strong>der</strong> notwendigen Informationen,<br />
- Quellen und Wegen <strong>der</strong> Informationsbeschaffung.<br />
• Informationen <strong>für</strong> den groben Überblick:<br />
- Größe des Unternehmens (Umsatz, Bilanzsumme, Zahl <strong>der</strong> Beschäftigten),<br />
- Zahl und Größe von Zweignie<strong>der</strong>lassungen,<br />
- Branchenzugehörigkeit,<br />
- Verflechtungen mit an<strong>der</strong>en Unternehmen,<br />
- Produktions- und Absatzprogramm,<br />
- Marktstellung,<br />
- wirtschaftliche Lage des Unternehmens / bilanzielles Standing.<br />
• Quellen <strong>für</strong> diese Informationen können sein:<br />
- in <strong>der</strong> WP-Praxis vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Unternehmen<br />
und <strong>der</strong> Branche,<br />
- Gespräche mit Personen innerhalb des Unternehmens<br />
- Berichte <strong>der</strong> Internen Revision des Unternehmens,<br />
- Presseberichte,<br />
- Hauptversammlungsprotokolle,<br />
- Geschäftsberichte,<br />
- Nachschlagewerke,<br />
- Handelsregisterauszüge,<br />
- Grundbuchauszüge,<br />
- Bilanz Rating des Vorjahres bzw. <strong>der</strong> Vorjahre o<strong>der</strong> des vom zu prüfenden Unternehmen<br />
vorgelegten vorläufigen und zu prüfenden Jahresabschlusses.<br />
⇒ vgl. auch IDW PS 230 „Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche<br />
und rechtliche Umfeld des zu prüfenden Unternehmens im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Abschlußprüfung“<br />
29
Prüfungsplanung<br />
• Wichtige Informationen <strong>für</strong> die erste Strukturierung des Prüfungsplanes:<br />
- Zahl <strong>der</strong> Kunden und Lieferanten,<br />
- Auslandsaktivitäten,<br />
- Art <strong>der</strong> Datenerfassung und -verarbeitung,<br />
- Aufbau- und Ablauforganisation, vor allem des Rechnungswesens und des IÜS<br />
(= Internes Kontrollsystem IKS + Interne Revision IR),<br />
- Zahl <strong>der</strong> Konten und Buchungen (Kontenplan).<br />
• Quellen <strong>für</strong> diese Informationen:<br />
- Auskünfte <strong>der</strong> Unternehmensleitung des zu prüfenden Unternehmens bzw. <strong>der</strong><br />
von ihr benannten Personen,<br />
- Auskünfte und Berichte <strong>der</strong> Innenrevision,<br />
- Betriebsbesichtigungen,<br />
- Vorprüfungen,<br />
- Organisationspläne, Arbeitsablaufpläne, Stellenbeschreibungen,<br />
- Verträge, Satzung(en), Gesellschaftsvertrag.<br />
• Zusätzliche Informationsquellen bei Wie<strong>der</strong>holungsprüfungen:<br />
- Prüfungsberichte <strong>der</strong> Vorjahre,<br />
- Arbeitspapiere aus früheren Prüfungen,<br />
- Dauerakte,<br />
- interne Unterlagen des Prüfungsunternehmens.<br />
133. Eventualplanung<br />
Aufgabe des Eventualplanungsprozesses:<br />
Bestimmung <strong>der</strong><br />
- alternativen Ausführungsmöglichkeiten <strong>für</strong> bestimmte Aufgaben,<br />
- Kosten <strong>für</strong> diese Möglichkeiten.<br />
Um alternative Handlungsmöglichkeiten aufstellen zu können, benötigt <strong>der</strong> Planer ein<br />
Modell <strong>der</strong> Prüfungsrealität, das Zusammenhänge möglichst realistisch abbildet.<br />
30
• Vorgehen in zwei Schritten:<br />
Prüfungstheorie<br />
a) Bildung von Arbeitshypothesen,<br />
b) Aufstellen konkreter Alternativpläne.<br />
Zu a) Bildung von Arbeitshypothesen<br />
Hypothesen sind versuchsweise Behauptungen über die wirtschaftliche Wirklichkeit<br />
in "Wenn ..., dann ..." - Form.<br />
• Ein Modell besteht aus:<br />
- allgemeinen,<br />
- abstrahierenden,<br />
- wi<strong>der</strong>spruchsfreien Aussagen über die Struktur <strong>der</strong> Realität.<br />
• Elemente eines Modells (Arbeitshypothesen):<br />
(1) Verhaltensrelationen,<br />
z. B. Preis-Absatz-Funktionen<br />
Wenn IKS-/IÜS-Prüfung ergibt: Starkes IKS !<br />
⇒ wenige Fehler bei JA-Zahlen-Prüfung zu erwarten<br />
(2) Technologische Relationen,<br />
z. B. Produktionsfunktionen; auch bei <strong>der</strong> Prüfung (als Produktionsprozess)<br />
(3) Institutionelle Relationen,<br />
z. B. Ursache-Wirkungs-Beziehung durch die Rechts- und Wirtschaftsordnung<br />
und durch Verträge<br />
(4) Definitorische Relationen,<br />
d. h. Identitäten, die keine Aussagen über die Struktur von Modellen enthalten<br />
• Verhaltens- und technologische Relationen bezeichnen wir als Hypothesen.<br />
31
• Aufgabe <strong>der</strong> Prüfungstheorie:<br />
Prüfungsplanung<br />
- Entwicklung von Hypothesen über wirtschaftliche Prüfungen,<br />
- Testen <strong>der</strong> Hypothesen,<br />
- Verbessern <strong>der</strong> Hypothesen.<br />
Zu b) Aufstellen konkreter Alternativpläne<br />
• Prozessschritte:<br />
- Bildung eines Modells <strong>der</strong> Prüfungsrealität,<br />
- Aufstellen <strong>der</strong> konkreten Alternativpläne.<br />
• Bisherige Modelle bilden nur Teilbereiche <strong>der</strong> Realität ab (Partialpläne)<br />
⇒ Partialpläne müssen koordiniert werden<br />
• Partialpläne <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
- Zeitpläne,<br />
- Reihenfolgepläne,<br />
- Kostenpläne,<br />
- Zuordnungspläne,<br />
- Programmpläne.<br />
• Aus alternativen Teilplänen müssen alternative Gesamtpläne (Summe <strong>der</strong> Teilpläne)<br />
entwickelt werden.<br />
Methoden zur Koordination von Partialplänen:<br />
• Prinzip <strong>der</strong> Pretialen Lenkung (E. Schmalenbach):<br />
⇒ innerbetriebliche Verrechnungspreise <strong>für</strong> die Zuteilung von Prüfungspersonal<br />
• Prinzip des "management by objectives":<br />
⇒ Zuordnung eines eindeutig abgegrenzten und definierten Aufgabengebiets<br />
32
• Methode <strong>der</strong> Stufenplanung:<br />
Prüfungstheorie<br />
⇒ Sukzessive Planung einzelner Teilbereiche, beginnend mit dem Bereich, in dem<br />
die meisten Restriktionen vorliegen<br />
(Bsp.: Ansatz von BOLENZ/FRANK; ZfbF 1977, S. 427-447)<br />
134. Entscheidung(en) <strong>für</strong> bestimmte Pläne<br />
Entscheidungsphase: Ermittlung <strong>der</strong> optimalen, aufeinan<strong>der</strong> abgestimmten Partialpläne.<br />
• Bei <strong>der</strong> Bestimmung des Gesamtplanes sind neben<br />
- Optimierungskalkülen<br />
auch<br />
- subjektive Bewertungskriterien<br />
zu berücksichtigen.<br />
Grund: Verwendung von Schätzungen, Vereinfachungen und Annahmen<br />
bei <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> alternativen Partialpläne.<br />
Die Entscheidung <strong>für</strong> einen bestimmten Plan verursacht das eigentliche unternehmerische<br />
Risiko, da hierdurch Ziele und Verfahren festgelegt und später nur schwer<br />
o<strong>der</strong> gar nicht abstoppbare Kostenströme in Gang gesetzt werden.<br />
⇒ Kapazitäts- und Personalplanung können beson<strong>der</strong>e Risiken enthalten.<br />
In <strong>der</strong> Theorie wird häufig von den individuellen Zielen und Bedürfnissen/Wünschen<br />
sowie den Kapazitätsgrenzen <strong>der</strong> Informationsverarbeitung des Entscheidungsträgers<br />
abstrahiert.<br />
• Prämisse: Ein Entschei<strong>der</strong> hat alle notwendigen Informationen und entscheidet<br />
ausschließlich anhand betrieblicher Zielsetzungen.<br />
33
Prüfungsplanung<br />
• An <strong>der</strong> Planung sind indes zumindest in größeren Prüfungsunternehmen mehrere<br />
Personen<br />
- unterschiedlicher Stellung,<br />
- mit verschiedenen Aufgabengebieten,<br />
- mit voneinan<strong>der</strong> abweichenden Informationen und Interessen sowie<br />
- mit Entscheidungskompetenz <strong>für</strong> unterschiedliche Sachverhalte<br />
beteiligt.<br />
• An <strong>der</strong> Entscheidung über einen bestimmten Sachverhalt können mehrere Personen<br />
beteiligt sein.<br />
• Eine Gruppenentscheidung wird an<strong>der</strong>s ausfallen als eine Einzelentscheidung.<br />
Gründe:<br />
Entscheidungsträger haben<br />
(1) unterschiedliche Informationsaufnahme- und Informationsverarbeitungsfähigkeiten,<br />
(2) unterschiedlichen Informationsstand,<br />
(3) neben den vorgegebenen Unternehmenszielen davon abweichende, unterschiedliche<br />
persönliche Ziele.<br />
• Da in Modellen die Realität nicht vollständig und exakt abgebildet werden kann,<br />
arbeiten wir mit folgenden Vereinfachungen:<br />
(1) die wichtigsten Informationen sind vorhanden,<br />
(2) es gibt nur einen Entscheidungsträger ("Prüfungsplaner") und<br />
(3) nur eine betriebliche Zielvorstellung.<br />
34
Prüfungstheorie<br />
• Verfahren zur Berücksichtigung <strong>der</strong> Unsicherheit in <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
(1) Reserveplanung,<br />
(2) sukzessive Entscheidungen,<br />
(3) überlappende Planung,<br />
(4) Schubladenplanung,<br />
(5) flexible Planung.<br />
Zu (1): Reserveplanung<br />
Im Prüfungsplan werden Reserven vorgesehen, die bei Eintritt einer unerwarteten<br />
ungünstigen Umweltsituation, z. B. eines schwachen IKS, erlauben,<br />
die entstandenen Planungslücken zu schließen.<br />
Zu (2): Sukzessive Entscheidungen<br />
Ein Plan wird erst dann endgültig festgelegt, wenn die Entscheidung<br />
nicht mehr weiter hinausgezögert werden kann.<br />
Nachteil: Verfahren kann zu verpassten Chancen führen.<br />
Vorteil: Planer kann während des Wartens Informationen erhalten,<br />
die ihm aufgrund <strong>der</strong> vermin<strong>der</strong>ten Unsicherheit bessere Entscheidungen<br />
ermöglichen.<br />
Zu (3): Überlappende Planung<br />
Der Planungshorizont ist zeitlich länger als <strong>der</strong> Zeitraum <strong>der</strong> Revision <strong>der</strong><br />
Pläne. Auf diese Weise überschneiden sich die Planungszeiträume. Die<br />
sich überlappenden Planungszeiträume werden so doppelt o<strong>der</strong> mehrfach<br />
geplant, wobei <strong>der</strong> zweite Plan <strong>für</strong> den gleichen Zeitabschnitt i. d. R. besser<br />
ist als <strong>der</strong> erste, da<br />
a) bessere Informationen vorliegen,<br />
b) Planungsfehler weitgehend reduziert werden.<br />
35
Zu (4): Schubladenplanung<br />
Prüfungsplanung<br />
Für die wichtigsten erwarteten Datensituationen wird ein vollständiger<br />
Plan ausgearbeitet. Bei Eintritt einer bestimmten Situation o<strong>der</strong> nach<br />
dem Auftreten von Indizien <strong>für</strong> eine bestimmte Situation wird <strong>der</strong> zugehörige<br />
Schubladenplan zum Soll <strong>für</strong> die Planperiode.<br />
Vorteil: Schutz gegen mangelnde Prognosegewissheit.<br />
Nachteil: Sehr aufwendiges Verfahren, da<br />
Zu (5): Flexible Planung<br />
- <strong>für</strong> die wichtigsten Datensituationen vollständige<br />
Pläne aufgestellt werden müssen,<br />
- durch die während <strong>der</strong> Prüfung gewonnenen Informationen<br />
eine kontinuierliche Plananpassung erfor<strong>der</strong>lich<br />
ist,<br />
- <strong>für</strong> jeden Entscheidungszeitpunkt alternative Schubladenpläne<br />
entwickelt werden müssen.<br />
Beson<strong>der</strong>s geeignetes Verfahren zur Berücksichtigung <strong>der</strong> Unsicherheit in<br />
<strong>der</strong> Prüfungsplanung.<br />
36
135. Planvorgabe (Sollzahlen)<br />
Prüfungstheorie<br />
Gesamtkostenbudget des kostenminimalen Plans reicht als Sollwertvorgabe nicht aus,<br />
weil die Realisation <strong>der</strong> Gesamtplanung des Prüfungsunternehmens u. U. nicht gewährleistet<br />
ist.<br />
• Mehr o<strong>der</strong> weniger detaillierte Vorgabe <strong>der</strong> einzelnen Sollzahlen, auf denen das<br />
Kostenbudget basiert:<br />
a) Prüfungshandlungen (Art und Umfang),<br />
b) in <strong>der</strong> vorgegebenen Reihenfolge,<br />
c) mit dem erwarteten Zeitbedarf <strong>für</strong> jede Art von Prüfungshandlungen,<br />
d) den erwarteten Kosten und<br />
e) <strong>der</strong> Prüferzuordnung zu den Prüfungsaufgaben.<br />
Detaillierte Planvorgabe erfor<strong>der</strong>t sehr ausführliche Informationen:<br />
• Liegen bei Erstprüfungen meist nicht vor.<br />
• Bei Folgeprüfungen können Erfahrungen verwertet werden.<br />
• Detaillierungsgrad <strong>der</strong> Planvorgaben nimmt mit <strong>der</strong> zeitlichen Distanz vom Planungszeitpunkt<br />
zwangsläufig ab.<br />
• Detaillierungsgrad hängt von <strong>der</strong> Qualifikation <strong>der</strong> Prüfer ab:<br />
(1) Bei erfahrenem Prüfungsleiter: Verzicht auf starke Detaillierung.<br />
• Detaillierte Planvorgabe verleitet sonst zum Prüfen nach Plan ohne Mitdenken.<br />
(2) Bei neuem Prüfungsassistenten: Ausarbeitung eines detaillierten Plans.<br />
• Detaillierte Planvorgabe gewährleistet systematisches und vollständiges<br />
Prüfen.<br />
• Mögliche Lösung:<br />
- Vorgabe von Eckwerten <strong>der</strong> Planung <strong>für</strong> erfahrene Prüfer,<br />
- Prüfungsleiter kann Vorgaben <strong>für</strong> jüngere Mitarbeiter verfeinern,<br />
37
aber:<br />
Prüfungsplanung<br />
- detaillierte Planvorgabe ist gutes Mittel zur Realisation <strong>der</strong> Termin- und<br />
Kostenplanung;<br />
dennoch:<br />
- Praxis scheut häufig hohen Informations- und Planungsaufwand.<br />
136. Realisation <strong>der</strong> Planung<br />
Darunter kann sowohl Planungsdurchführung als auch Prüfungsdurchführung verstanden<br />
werden.<br />
⇒ hier: - Durchführung des Prüfungsprozesses,<br />
- gehört im engeren Sinne nicht mehr zur Planung;<br />
aber: Ergebnisse <strong>der</strong> Realisation liegen als Grundlage <strong>für</strong> weitere detaillierte Planungsüberlegungen<br />
zugrunde, <strong>der</strong>en Entscheidungen dann wie<strong>der</strong>um in <strong>der</strong><br />
weiteren Realisation umzusetzen sind.<br />
137. Überwachung <strong>der</strong> Prüfungsplanung und -realisation<br />
Festgestellte Abweichungen <strong>der</strong> Istwerte <strong>der</strong> Prüfung von den Sollwerten des Prüfungsplanes<br />
sind zu analysieren und zu berücksichtigen:<br />
• bei <strong>der</strong> Planung <strong>der</strong> laufenden Prüfung und<br />
• bei <strong>der</strong> Prüfungsplanung <strong>der</strong> Folgejahre.<br />
Dies gilt vor allem <strong>für</strong> den Prüfungsumfang, die Prüfungszeit und den Fehleranteil (homograde<br />
Fragestellung).<br />
Soll-Ist-Abweichungen sind in den Arbeitspapieren zu dokumentieren!<br />
38
• Prüfungsumfang:<br />
Prüfungstheorie<br />
Bei zu gering geplantem Umfang muss<br />
- im gleichen Jahr <strong>der</strong> Prüfungsumfang erhöht werden,<br />
- in Folgejahren diese Information berücksichtigt werden.<br />
• Prüfungszeit:<br />
Bei Gefährdung des Endtermins sind sofortige Plankorrekturen erfor<strong>der</strong>lich.<br />
• Fehleranteil(-höhe):<br />
Falsche Hypothesen über Fehleranteil müssen in Folgejahren berücksichtigt werden:<br />
P * Pˆ <<br />
⇒ =><br />
n!<br />
P = Tatsächlicher Fehleranteil in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
P*<br />
= Maximal tolerierbarer Fehleranteil in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
∃P = Geschätzter Fehleranteil in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
n = Stichprobenumfang<br />
Ursachen <strong>der</strong> Soll-Ist-Abweichungen:<br />
• Strukturwandel bei Prüfungsunternehmen o<strong>der</strong> zu prüfendem Unternehmen (im<br />
Voraus i. d. R. nicht erkennbar),<br />
• mangelnde Planungsgenauigkeit (Soll I -Soll II -Vergleich),<br />
• mangelnde Prüfungsrealisation (Soll I -Ist-Vergleich),<br />
• erhebliches Absinken des bilanziellen Standings.<br />
39
Prüfungsplanung<br />
138. Interdependenzen <strong>der</strong> Prüfungsplanungsschritte<br />
Abhängigkeiten bestehen zwischen:<br />
• den einzelnen Alternativplänen (Programm-, Personal-, Zeitplan) und<br />
• den einzelnen Prüfungsplanungsschritten.<br />
Wir unterscheiden:<br />
• formale Interdependenzen und<br />
• inhaltliche Interdependenzen.<br />
• Formale Interdependenzen<br />
Prozessschema ist nach sachlogischen Kriterien geglie<strong>der</strong>t. Im zeitlichen Ablauf sind<br />
die Phasen teils parallel, teils nacheinan<strong>der</strong>, teils durch Rückkopplungsschleifen<br />
miteinan<strong>der</strong> verknüpft.<br />
Beispiel:<br />
Informations-, Eventualplanungs- und Entscheidungsprozess<br />
Beispiel <strong>für</strong> rückgekoppelte Abläufe im Phasenschema:<br />
Überwachungsphase<br />
Wird auch nach mehrfacher Rückkopplung keine befriedigende Zielerreichung realisiert,<br />
so müssen die evtl. unrealistischen Zielgrößen überdacht und ggf. umformuliert<br />
werden.<br />
40
• Inhaltliche Interdependenzen<br />
Prüfungstheorie<br />
Zwischen den Programm-, Personal- und Zeitplänen bestehen zeitlich horizontale<br />
und zeitlich vertikale Interdependenzen.<br />
- Zeitlich horizontale Interdependenzen<br />
Abhängigkeiten, die zu einem Zeitpunkt zwischen den abzustimmenden Variablen<br />
bestehen.<br />
Beispiel: Zeitplanung ist abhängig von Prüferzuordnung und umgekehrt.<br />
- Zeitlich vertikale Interdependenzen<br />
Abhängigkeiten, die im Zeitablauf vorhanden sind o<strong>der</strong> entstehen.<br />
Beispiel: Bilanzielles Standing (Rating) beeinflusst Schätzung des inhärenten<br />
Risikos <strong>für</strong> den risikoorientierten Prüfungsansatz.<br />
Aufgabe des Prüfungsplaners:<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> wichtigsten Interdependenzen. Ein geeignetes Verfahren hierzu ist<br />
die flexible Planung.<br />
14 Planungsverfahren<br />
Literaturhinweise:<br />
ADAM, DIETRICH, Planung und Entscheidung: Modelle - Ziele - Methoden, 4., vollst.<br />
überarb. und wesentlich erw. Aufl., Wiesbaden 1996.<br />
BAETGE, JÖRG, MEYER ZU LÖSEBECK, HEINER, ”Starre o<strong>der</strong> flexible Prüfungsplanung?”, in:<br />
Management und Kontrolle, Festgabe <strong>für</strong> Erich Loitlsberger zum 60. Geburtstag, hrsg.<br />
von Gerhard Seicht, Berlin 1981, S. 121 - 171.<br />
41
2 Prüfungstechnik<br />
21 Abgrenzung <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong><br />
Definitionen:<br />
Prüfungstechnik<br />
• Prüfungsfeld =<br />
nach bestimmten Kriterien abgegrenztes Teilobjekt des gesamten Prüfungsobjekts.<br />
• Prüfungsfel<strong>der</strong>gruppe =<br />
nach sachlogischen Kriterien zusammengefasste Prüfungsfel<strong>der</strong>.<br />
Über Prüfungsfel<strong>der</strong> werden Teilurteile gebildet, die in einem zweiten Schritt zu<br />
einem Gesamturteil aggregiert werden.<br />
• Zielfunktion: Abgabe eines hinreichend sicheren und genauen Urteils <strong>für</strong> einen<br />
gegebenen Prüfungsauftrag (bei vor Prüfungsbeginn unter bestimmten<br />
Annahmen und Bedingungen (Kautelen) vereinbartem<br />
Prüfungshonorar) mit minimalen Kosten <strong>für</strong> die Prüfungsunternehmung.<br />
⇒ Gesamten Prüfungsstoff in Prüfungsfel<strong>der</strong> glie<strong>der</strong>n und zu jedem Prüfungsfeld<br />
Teilurteil abgeben.<br />
Aus <strong>der</strong> Zielvorschrift deduzierte Gründe <strong>für</strong> eine Strukturierung des Prüfungsstoffes:<br />
(1) Zielerreichung erfor<strong>der</strong>t sorgfältige Planung:<br />
• Planung = Gedankliche Vorwegnahme künftigen Geschehens,<br />
• nur möglich, wenn komplexer Prüfungsstoff strukturiert wird,<br />
• Simultanmodell ist nicht möglich ⇒ Partialmodelle.<br />
42
Prüfungstheorie<br />
(2) Hinreichend sicheres und genaues Urteil:<br />
• Problem: Absolute Vollständigkeit <strong>der</strong> Prüfung nicht möglich!<br />
• "Grundsatz des repräsentativen Urteils":<br />
- Prüfung aller wesentlichen Sachverhaltsgruppen;<br />
- Alle wesentlichen Einzelfeststellungen müssen in das Urteil Eingang<br />
finden.<br />
(3) Ziel: Minimierung <strong>der</strong> Kosten <strong>für</strong> das Prüfungsunternehmen:<br />
• Prüfungsfel<strong>der</strong>bildung kann Kosten senken, da<br />
- Grundsatz <strong>der</strong> Spezialisierung anwendbar,<br />
- bessere Erfüllung <strong>der</strong> Ausbildungsfunktion möglich,<br />
- Doppelarbeit durch Verantwortungsübertragung vermieden wird<br />
und<br />
- einfachere Terminplanung.<br />
Empfehlung zur Prüfungsfel<strong>der</strong>bildung in IDW PS 240 Tz. 19:<br />
"Zur Erstellung des Prüfungsprogramms werden die Prüfungsgebiete in Teilbereiche<br />
aufgeteilt, die einheitlich zu prüfen sind (Prüffel<strong>der</strong>). ... Für jedes Prüffeld sind Art und<br />
Umfang <strong>der</strong> zur Umsetzung <strong>der</strong> Prüfungsstrategie erfor<strong>der</strong>lichen Prüfungshandlungen<br />
sowie ihr zeitlicher Ablauf festzusetzen.”<br />
Kriterien <strong>für</strong> die Abgrenzung von Prüfungsfel<strong>der</strong>n:<br />
1. Homogenität <strong>der</strong> zu prüfenden Sachverhalte,<br />
2. Homogenität <strong>der</strong> gesuchten Fehler,<br />
3. Homogenität in bezug auf die anzuwendenden Prüfungsmethoden,<br />
4. Homogenität <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen an den Prüfer,<br />
5. Berücksichtigung <strong>der</strong> individuellen Struktur des Prüfungsobjektes,<br />
6. Berücksichtigung bestehen<strong>der</strong> Interdependenzen zwischen Prüfungssachverhalten.<br />
43
Prüfungstechnik<br />
Zu 1.: Homogenität <strong>der</strong> zu prüfenden Sachverhalte<br />
= Gleichartigkeit <strong>der</strong> Geschäftsvorfälle<br />
(Bsp.: Verkaufsgeschäfte, die zu For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
FoLL führen)<br />
• Zusammenfassung kann erhebliche Rationalisierungseffekte mit sich bringen.<br />
• Ähnliche Sollobjektbildung.<br />
- Klumpeneffekt<br />
- Degressionseffekt<br />
- Erfahrungseffekt<br />
- Schichtungseffekt<br />
aber: Der Jahresabschluss selbst ist sehr inhomogen.<br />
- Bildung vieler kleiner homogener Prüfungsfel<strong>der</strong> und damit starke Zerschneidung<br />
von Interdependenzen.<br />
- Zusammenfassung von vielen Teilurteilen notwendig!<br />
Problem: Zwei gegenläufige Tendenzen: Hierbei besteht das Erfor<strong>der</strong>nis <strong>der</strong><br />
Optimierung.<br />
Zu 2.: Homogenität <strong>der</strong> gesuchten Fehler<br />
• Prüfungsfel<strong>der</strong> können nach <strong>der</strong> Gleichartigkeit <strong>der</strong> gesuchten Fehler gebildet werden:<br />
- Technische Buchungsfehler,<br />
- Über-/Unterbewertungen,<br />
- Ausweisfehler, etc.<br />
• Diese Art <strong>der</strong> Homogenität ist Voraussetzung <strong>für</strong>:<br />
- Stichprobenhochrechnung,<br />
- Schichtenbildung.<br />
44
Prüfungstheorie<br />
Zu 3.: Homogenität in Bezug auf die anzuwendenden Prüfungsmethoden<br />
• Sachverhalte, die sich <strong>für</strong> die Anwendung bestimmter Prüfungsmethoden eignen,<br />
können zu einem Prüfungsfeld zusammengefasst werden.<br />
Beispiele: - Stichprobenprüfung ist <strong>für</strong> Konten, auf denen eine große<br />
Zahl von - jeweils <strong>für</strong> sich genommen unbedeutenden -<br />
Transaktionen abgewickelt werden, wie FoLL und VerbLL,<br />
sehr geeignet.<br />
Zu 4.: Homogenität <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen an den Prüfer<br />
- Saldenbestätigungen/Transaktionsbestätigungen.<br />
• Sachverhalte können nach dem Schwierigkeitsgrad, den sie <strong>für</strong> den Prüfer besitzen,<br />
zusammengefasst werden. Die Anfor<strong>der</strong>ungen an den Prüfer werden nach dem<br />
Schwierigkeitsgrad bestimmt.<br />
aber: Ein Mangel an ausreichend qualifizierten Prüfern darf nicht dazu führen,<br />
dass schwierige Sachverhalte gar nicht erst geprüft werden.<br />
• Drei Effekte sind zu beachten:<br />
- Rationalisierungseffekt,<br />
- Ausbildungseffekt,<br />
- u. U. Beschleunigungseffekt (bei Zeitrestriktionen).<br />
Zu 5.: Individuelle Struktur des Prüfobjektes<br />
• Vorhandene individuelle Strukturen des Prüfungsobjekts, z. B. Bilanz, GuV, Buchführung,<br />
Anhang und Lagebericht, aber auch Sparten, Profit Centers etc., können<br />
bei <strong>der</strong> Bildung von Prüfungsfel<strong>der</strong>n genutzt werden.<br />
45
Prüfungstechnik<br />
Zu 6.: Berücksichtigung von Interdependenzen zwischen Prüfungssachverhalten<br />
• Zwischen Einzelsachverhalten bestehen häufig (a) zeitlich horizontale und (b) zeitlich<br />
vertikale Interdependenzen. Das Gesamturteil muss Interdependenzen berücksichtigen.<br />
(a) Zeitlich horizontale Interdependenzen:<br />
= Abhängigkeiten zwischen Variablen, die zu einem Zeitpunkt bestehen.<br />
Bsp.: - Abschreibungen auf AV und Bestand des AV,<br />
- Bewertung nach <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>stwertvorschrift (§ 253 dHGB<br />
bzw. §§ 204, 207 UGB),<br />
- Bewertung nach dem Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4<br />
dHGB bzw. § 201 Abs. 2 Nr. 4 UGB),<br />
- Rückstellungsbildung nach § 249 Abs. 1 Satz 1 dHGB bzw.<br />
§ 198 Abs. 8 Nr. 1 1. HS UGB: "Rückstellung <strong>für</strong> drohende<br />
Verluste aus schwebenden Geschäften".<br />
(b) Zeitlich vertikale Interdependenzen:<br />
= Abhängigkeiten, die im Zeitablauf vorhanden sind o<strong>der</strong> entstehen.<br />
Bsp.: - Vorratsvermögen mit Inventur,<br />
- Bestandsfortführung mit Ermittlung des Endbestandes.<br />
• Systemprüfung ⇔ Jahresabschlusszahlenprüfung<br />
• Prüfungsfel<strong>der</strong> müssen so gebildet werden, dass alle Sachverhalte, zwischen denen<br />
Abhängigkeiten bestehen, zu jeweils einem Prüfungsfeld zusammengefasst werden.<br />
• gesamter Prüfungsstoff = ein Prüfungsfeld<br />
daher: Zerschneidung von möglichst wenigen und unbedeutsamen Interdependenzen!<br />
46
Konzepte zur Prüfungsfel<strong>der</strong>bildung:<br />
Prüfungstheorie<br />
In <strong>der</strong> Prüfungspraxis existieren vor allem zwei Konzepte:<br />
1. Glie<strong>der</strong>ung nach handelsrechtlichem Glie<strong>der</strong>ungsschema des JA bzw. <strong>der</strong> Bilanz<br />
2. Glie<strong>der</strong>ung nach Geschäftszyklen<br />
Zu 1.: Glie<strong>der</strong>ung nach handelsrechtlichem Glie<strong>der</strong>ungsschema des JA bzw. <strong>der</strong> Bilanz<br />
• Prüfungsfel<strong>der</strong>bildung in Anlehnung an die Positionen des handelsrechtlichen<br />
Glie<strong>der</strong>ungsschemas. Um horizontale Interdependenzen zu berücksichtigen, werden<br />
den Bilanzpositionen die jeweils korrespondierenden GuV-Positionen zugeordnet.<br />
Ermöglicht Schwerpunktbildung mit Hilfe <strong>der</strong> individuellen Sensitivitätsanalyse<br />
des Moody‘s RiskCalc.<br />
• Prüfungsfel<strong>der</strong>, die durch Bilanz- und GuV-Positionen nicht abgedeckt werden,<br />
sind:<br />
- Prüfung des Anhangs/Lageberichts,<br />
- Kostenrechnung,<br />
- rechtliche Verhältnisse einschließlich Verträge und laufen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> drohen<strong>der</strong><br />
Prozesse,<br />
- Systemprüfung,<br />
- Prüfung des Risikomanagementsystems.<br />
Zu 2.: Glie<strong>der</strong>ung nach Geschäftszyklen<br />
• Abgrenzung des Unternehmensgeschehens in mehrere Arbeitsabläufe, die in sich<br />
geschlossen sind und abgrenzbare Teilbereiche <strong>der</strong> Unternehmung beschreiben:<br />
= Geschäftszyklen, business cycles, transaction cycles<br />
- Systemprüfung<br />
- Gemeinschaftskontenrahmen <strong>der</strong> Industrie (GKR)<br />
- Prozessglie<strong>der</strong>ungsprinzip<br />
47
Prüfungstechnik<br />
• Aufteilung muss sich an individueller Struktur des Unternehmens orientieren und<br />
unterscheidet sich deshalb von Unternehmen zu Unternehmen. Folgende Geschäftszyklen<br />
sind jedoch typisch:<br />
1. Beschaffungszyklus:<br />
Transaktionen, die bei <strong>der</strong> Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen im<br />
Austausch zu Zahlungen auftreten.<br />
2. Verkaufszyklus:<br />
Transaktionen, die im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Erzielung von Einnahmen auftreten.<br />
3. Produktionszyklus:<br />
Transaktionen, die bei <strong>der</strong> Produktion von Gütern <strong>für</strong> den Wie<strong>der</strong>verkauf auftreten.<br />
4. Lohn- und Gehaltszyklus:<br />
Transaktionen, die bei <strong>der</strong> Erfassung und Zahlung von Löhnen und Gehältern<br />
auftreten.<br />
Prinzipielles Vorgehen:<br />
• Inhaltlich zusammenhängende und aufeinan<strong>der</strong>folgende Teilschritte werden zu<br />
Prüfungsfel<strong>der</strong>n zusammengefasst.<br />
⇒ Die wichtigsten Interdependenzen können berücksichtigt werden.<br />
48
Prüfungstheorie<br />
Praxis: Verbindung bei<strong>der</strong> Glie<strong>der</strong>ungskonzepte<br />
Kriterien Konzepte<br />
49<br />
Glie<strong>der</strong>ungsschema<br />
Geschäftszyklen<br />
1. Homogenität <strong>der</strong> zu prüfenden Sachverhalte ++ +<br />
2. Homogenität <strong>der</strong> gesuchten Fehler + -<br />
3. Homogenität in Bezug auf anzuwendende<br />
Prüfungsmethoden<br />
4. Homogenität <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen an den Prüfer<br />
5. Berücksichtigung <strong>der</strong> individuellen Struktur<br />
des Prüfobjekts<br />
6. Berücksichtigung bestehen<strong>der</strong><br />
Interdependenzen<br />
Legende: ++ sehr gut - schlecht<br />
+ befriedigend -- sehr schlecht<br />
+ -<br />
+ -/+<br />
-- ++<br />
- ++<br />
Ergebnis: Beide Lösungsvorschläge können nicht alle Kriterien erfüllen. Wünschenswert<br />
ist im konkreten Einzelfall zumindest eine befriedigende Erfüllung aller Kriterien.
22 Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
221. Prüfungsrichtung<br />
221.1 Progressive Prüfung<br />
Fall<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)<br />
(f)<br />
Realer<br />
Sachverhalt<br />
Legende:<br />
Abb. 7: Progressive Prüfung<br />
Prüfungstechnik<br />
Urbeleg Grundbuch Hauptbuch<br />
Geprüfte und fehlerfreie Geschäftsvorfälle<br />
Entdeckte Fehler in Geschäftsvorfällen<br />
Progressive Prüfung<br />
Nicht entdeckte Fehler in Geschäftsvorfällen<br />
Jahresabschluß<br />
• Vorgehen:<br />
Ausgehend vom realen Sachverhalt o<strong>der</strong> von ersten Dokumenten wird <strong>der</strong> Verarbeitungsablauf<br />
des Zahlenmaterials über Grundbuch (= Journal) und Hauptbuch<br />
bis zur Verarbeitung im Jahresabschluss verfolgt.<br />
50
Prüfungstheorie<br />
• Durch progressive Prüfung werden Geschäftsvorfälle entdeckt, die real vorhanden<br />
sind, sich aber nicht im Jahresabschluss nie<strong>der</strong>geschlagen haben (sog. Schwarzgeschäfte).<br />
Ausnahme: "Schwarzgeschäfte" werden nicht entdeckt, wenn <strong>der</strong> Prüfer keine<br />
Kenntnis von den realen Sachverhalten erlangt und die Sachverhalte<br />
sich selbst nicht in den Urbelegen nie<strong>der</strong>schlagen.<br />
Nachteil: Nicht entdecken kann <strong>der</strong> Prüfer sogenannte "Luftbuchungen", d.<br />
h. Buchungen, denen keine realen Sachverhalte zugrunde liegen,<br />
weil häufig auch bei progressiver Prüfung <strong>der</strong> reale Sachverhalt<br />
schon abgewickelt worden ist und <strong>der</strong> Prüfer bei seiner Prüfung<br />
nur auf den Belegen aufsetzen kann. Der reale Sachverhalt ist dann<br />
nicht (mehr) beobachtbar (prüfbar).<br />
Erläuterungen <strong>der</strong> Fälle (a) - (f) bei progressiver Prüfung (Abb. 7):<br />
(a) Realer Sachverhalt hat sich im Urbeleg, Grundbuch, Hauptbuch und JA richtig<br />
nie<strong>der</strong>geschlagen.<br />
(b) Für realen Sachverhalt gibt es keinen Beleg und auch keine Buchung irgendeiner<br />
Art.<br />
(c) Der Prüfer ist zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Sachverhaltsabwicklung nicht anwesend und<br />
findet nur den Urbeleg vor und von diesem ausgehend prüft er progressiv. Falls<br />
<strong>der</strong> im Urbeleg angegebene reale Sachverhalt tatsächlich vorliegt und <strong>der</strong> Beleg<br />
richtig bis in den JA weiterverarbeitet wurde, liegt kein Fehler vor; an<strong>der</strong>enfalls<br />
Fehler. Fraglich ist, ob <strong>der</strong> Prüfer die Chance hat, das Fehlen des Sachverhalts<br />
aufzudecken.<br />
(d) Sachverhalt und Urbeleg vorhanden aber nicht weiterverarbeitet, also: Fehler.<br />
(e) Sachverhalt, Urbeleg, Buchung bis ins Hauptbuch liegen vor, aber im JA nicht<br />
berücksichtigt: Fehler.<br />
(f) Kein realer Sachverhalt, kein Urbeleg, Falschbuchung ohne Beleg erst im<br />
Hauptbuch. Bei rein progressiver Buchung (vom Urbeleg an) keine Entdeckungschance.<br />
51
221.2 Retrograde Prüfung<br />
Prüfungstechnik<br />
Realer<br />
Sachverhalt Urbeleg Grundbuch Hauptbuch<br />
Legende:<br />
Geprüfte und fehlerfreie Geschäftsvorfälle<br />
Entdeckte Fehler in Geschäftsvorfällen<br />
Nicht entdeckte Fehler in Geschäftsvorfällen<br />
Abb. 8: Retrograde Prüfung<br />
Retrograde Prüfung<br />
Jahresabschluß<br />
• Vorgehen:<br />
Ausgehend von den Zahlen von Bilanz, GuV und Anhang, ggf. Lagebericht, wird<br />
rückwärtsschreitend die Verarbeitungskette bis zum realen Sachverhalt verfolgt.<br />
• Durch retrograde Prüfung können Luftbuchungen, <strong>für</strong> die keine Belege bzw. keine<br />
Geschäftsvorfälle vorhanden sind, entdeckt werden, die dann aus dem Jahresabschluss<br />
eliminiert werden müssen.<br />
Ausnahme: Luftbuchungen werden dann nicht entdeckt, wenn die Verarbeitungskette<br />
vom Jahresabschluss bis zum Urbeleg vollständig fingiert<br />
ist und <strong>der</strong> reale Sachverhalt selbst nicht überprüft werden<br />
kann.<br />
52<br />
Fall<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)
Prüfungstheorie<br />
• "Schwarzgeschäfte" können durch retrograde Prüfung nicht entdeckt werden.<br />
• Retrograde Prüfung ist zeitlich schneller auszuführen und in diesem Sinne günstiger<br />
als progressive Prüfung.<br />
Erläuterungen <strong>der</strong> Fälle (a) bis (e) bei retrogra<strong>der</strong> Prüfung (Abb. 8):<br />
(a) JA-Posten lässt sich bis zum realen Sachverhalt fehlerfrei zurückverfolgen.<br />
(b) JA-Posten lässt sich bis zum Urbeleg verfolgen. Frage: Entspricht Urbeleg realem<br />
Sachverhalt?<br />
(c) Nicht gebuchter Urbeleg lässt sich bei retrogra<strong>der</strong> Prüfung nicht finden.<br />
(d) Gebuchter aber nicht in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung abgeschlossener<br />
Sachverhalt lässt sich bei retrogra<strong>der</strong> Prüfung (aufsetzend beim JA) nicht<br />
finden.<br />
(e) JA-Posten noch im Hauptbuch, dann aber nicht mehr zu finden: Fehler.<br />
53
221.3 Bidirektionale Prüfung<br />
Fall<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)<br />
(f)<br />
Prüfungstechnik<br />
• Vorgehen: Der Prüfer muss hierbei bewusst mitten im Verarbeitungsprozess, also<br />
z. B. im Grund- und/o<strong>der</strong> Hauptbuch, ansetzen und dann von dort aus in beide<br />
Richtungen prüfen.<br />
Realer<br />
Sachverhalt<br />
Legende:<br />
Urbeleg Grundbuch Hauptbuch<br />
Geprüfte und fehlerfreie Geschäftsvorfälle<br />
Entdeckte Fehler in Geschäftsvorfällen<br />
Nicht entdeckte Fehler in Geschäftsvorfällen<br />
Abb. 9: Bidirektionale Prüfung<br />
Bidirektionale Prüfung<br />
Jahresabschluß<br />
• Beurteilung: Hohe Präventivwirkung bzgl. Schwarzgeschäften bzw. Luftbuchungen<br />
• Sinnvolles Anwendung sowohl <strong>der</strong> progressiven als auch <strong>der</strong> re-<br />
Vorgehen: trograden Prüfung i. V. m. bidirektionaler Prüfung.<br />
aber: Progressive Prüfung ist in <strong>der</strong> Regel aufwendiger als die retrograde<br />
Prüfung. Bidirektionale Prüfung ist evtl. noch aufwendiger als die<br />
retrograde Prüfung.<br />
54
Prüfungstheorie<br />
Erläuterungen <strong>der</strong> Fälle (a) bis (f) bei bidirektionaler Prüfung (Abb. 9):<br />
(a) Grundbuch-Buchung lässt sich bis zum JA-Posten und realen Sachverhalt fehlerfrei<br />
verfolgen.<br />
(b) Wie Fall (a), aber nur Urbeleg ist auszumachen, nicht dagegen realer Sachverhalt<br />
(<strong>der</strong> so nicht vorliegen möge). Prüfer kann aber realen Sachverhalt nicht<br />
(mehr) beobachten. Fehler ist nicht entdeckbar.<br />
(c) Wie Fall (a), aber Ansatzpunkt: Hauptbuch.<br />
(d) Wie Fall (b), aber (1) realer Sachverhalt ist durch Alternativprüfung, z. B.<br />
Transaktionsbestätigung, zu bestätigen: Kein Fehler o<strong>der</strong> (2) realer Sachverhalt<br />
wird als nicht vorhanden vom Prüfer identifiziert.<br />
(e) Kein Nie<strong>der</strong>schlag im JA: Fehler!<br />
(f) Sachverhalt ohne Beleg auch durch bidirektionale Prüfung nicht feststellbar.<br />
222 Prüfungsinhalt<br />
222.1 Anfor<strong>der</strong>ungen des IDW<br />
• Art und Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen „sind vom Abschlußprüfer mit dem<br />
erfor<strong>der</strong>lichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, daß unter Beachtung des Grundsatzes<br />
<strong>der</strong> Wesentlichkeit die gefor<strong>der</strong>ten Prüfungsaussagen möglich werden. In diesem<br />
Rahmen ist auch <strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Abschlußprüfung zu<br />
beachten” (IDW PS 200 Tz. 21).<br />
• Im FG 1/1988 Abschn. D. II werden folgende Arten von Prüfungshandlungen unterschieden:<br />
− "System- und Funktionsprüfungen des IKS"<br />
− "Einzelfallprüfungen", Jahresabschlusszahlenprüfung<br />
-- Plausibilitätsbeurteilungen<br />
-- Prüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen<br />
• Anfor<strong>der</strong>ungen an diese Prüfungshandlungen:<br />
"Prüfungshandlungen werden i. d. R. festgelegt auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
− <strong>der</strong> Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche<br />
Umfeld <strong>der</strong> Gesellschaft ...,<br />
− <strong>der</strong> Erwartungen über mögliche Fehler,<br />
− <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen<br />
Kontrollsystems.” (IDW PS 200 Tz. 20).<br />
55
222.2 Formelle Prüfungshandlungen<br />
Prüfungstechnik<br />
• Sachverhalte formeller Prüfungshandlungen:<br />
- Äußere Ordnungsmäßigkeit und<br />
- rechnerische Richtigkeit.<br />
• Merkmale äußerer Ordnungsmäßigkeit:<br />
1. Ordnungsmäßige Erfassung sämtlicher Geschäftsvorfälle<br />
(Geschäftsvorfall ⇒ Beleg),<br />
2. Richtige Verarbeitung des Zahlenmaterials<br />
(Beleg ⇒ Buchung ⇒ JA ⇒ LB),<br />
3. Beachtung formaler Ordnungsprinzipien<br />
(⇒ Dokumentationsgrundsätze).<br />
• Formelle Prüfungshandlungen sind:<br />
(1) Abstimmungsprüfung,<br />
(2) Übertragungsprüfung,<br />
(3) Rechnerische Prüfung,<br />
(4) Belegprüfung.<br />
Zu (1): Abstimmungsprüfung (Ist-Ist-Vergleich)<br />
Vergleich von Zahlen, die in buchhaltungstechnischem Zusammenhang stehen und<br />
nach dem System <strong>der</strong> Doppik notwendigerweise übereinstimmen müssen.<br />
Folgende Fehler können mit Abstimmungsprüfung nicht aufgedeckt werden:<br />
- Buchung falscher Beträge auf beiden Konten,<br />
- Buchung auf falschen Konten,<br />
- Fehler, die sich gegenseitig aufheben,<br />
- Buchung von Fiktivgeschäften,<br />
- Auslassungen (= "Schwarzgeschäfte").<br />
56
Zu (2): Übertragungsprüfung<br />
Prüfungstheorie<br />
Aufdeckung von Fehlern, die durch Übertragung falscher Zahlen (Drehfehler) o<strong>der</strong><br />
richtiger Zahlen auf ein falsches Konto entstehen.<br />
Wichtigste Übertragungsprüfung:<br />
- Feststellung <strong>der</strong> formellen Bilanzkontinuität, § 252 Abs. 1 Nr. 1 dHGB bzw.<br />
§ 201 Abs. 2 Nr. 6 UGB.<br />
Zu (3): Rechnerische Prüfung<br />
Nachvollziehen von Rechnungen, bei denen durch manuelle Tätigkeiten Fehler<br />
auftreten können:<br />
- Berechnungen auf Belegen,<br />
- Aufbereiten von Inventurlisten,<br />
- Prüfung <strong>der</strong> fünf systematischen Summen (Belegsummen; Grundbuch-<br />
Kontensummen: Soll und Haben; Hauptbuch-Kontensummen: Soll und Haben).<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> eine rechnerische Prüfung von Teilbereichen ist die zeitliche und<br />
sachliche Fehlerfeldteilung.<br />
Zu(4): Belegprüfung<br />
- Abstimmung <strong>der</strong> Belege mit den Eintragungen in den Büchern,<br />
- Prüfung des Beleginhalts (⇒ materielle Prüfung),<br />
- Belegtext muss klar sein und Geschäftsvorfall hinreichend klären:<br />
-- Interne Belege müssen abgezeichnet werden,<br />
-- Beleg-Nummern-System ist erfor<strong>der</strong>lich,<br />
-- Beleg muss Ausstellungs- o<strong>der</strong> Eingabedatum enthalten,<br />
-- Verweis auf erkannte bzw. angesprochene Konten ist erfor<strong>der</strong>lich (Soll-<br />
und Habenkontierung!).<br />
57
222.3 Materielle Prüfungshandlungen<br />
Prüfungstechnik<br />
Ausgangspunkt: Bilanzielles Standing des Unternehmens (Moody‘s RiskCalc); konkrete<br />
Ansatzpunkte durch die individuelle Sensitivitätsanalyse (INSA).<br />
Prüfung auf inhaltliche Richtigkeit und wirtschaftliche Berechtigung des vorhandenen<br />
Zahlenmaterials, d. h. ob <strong>der</strong> reale Sachverhalt richtig im Zahlenwerk des Rechnungswesens<br />
abgebildet ist.<br />
Arten von materiellen Prüfungshandlungen:<br />
• Prüfung <strong>der</strong> Bilanzierungsfähigkeit und -pflicht,<br />
• Prüfung des Mengengerüsts einer Jahresabschlussposition,<br />
• Prüfung <strong>der</strong> Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie<br />
• Prüfung <strong>der</strong> Bewertung, d. h. <strong>der</strong> Anwendung von:<br />
- Imparitäts- und Vorsichtsprinzip,<br />
- Nie<strong>der</strong>stwertvorschriften <strong>für</strong> Anlagevermögen (gemil<strong>der</strong>t) und Umlaufvermögen<br />
(streng),<br />
• Prüfung des Ausweises im Jahresabschluss, unter dem Bilanzstrich o<strong>der</strong> im Lagebericht.<br />
58
223. Prüfungsgegenstand<br />
Prüfungstheorie<br />
223.1 Prüfung des Erfassungs-, Verarbeitungs- und Kontrollsystems (Systemprüfung)<br />
Die Abgrenzung von Systemprüfung und Jahresabschlusszahlen- bzw. Ergebnisprüfung:<br />
• Aufgabe des Abschlussprüfers:<br />
Beurteilung <strong>der</strong> Ordnungsmäßigkeit <strong>der</strong> Buchführung, des Jahresabschlusses und<br />
des Lageberichts.<br />
Die Beurteilungsobjekte entstehen durch komplexe Erfassungs-, Verarbeitungs-<br />
und Überwachungsprozesse.<br />
• Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, ein Urteil zu bilden:<br />
1. Prüfung des Systemoutputs, also <strong>der</strong> Verarbeitungsergebnisse: Prüfer prüft formelle<br />
Aspekte, außerdem konstruiert er <strong>für</strong> jeden zu prüfenden Geschäftsvorfall,<br />
Beleg, Kontierung und Erst-, Zwischen- und Abschlussbuchung ein Sollobjekt<br />
und vergleicht es mit vorgefundenem Istobjekt.<br />
− "Kontenprüfung", "Ergebnisprüfung" o<strong>der</strong><br />
"Jahresabschlusszahlenprüfung"<br />
⇒ deshalb auch: "direkte Prüfung".<br />
2. Prüfung <strong>der</strong> Regeln und Verfahren, nach denen die Geschäftsvorfälle erfasst<br />
werden sollen. Da die Gesamtheit aller Regeln und Verfahren ein System bildet,<br />
spricht man von "Systemprüfung".<br />
Bei Systemprüfung kann nur mittelbar auf die Richtigkeit des Systemoutputs<br />
geschlossen werden, denn das System muss geeignet sein,<br />
− Geschäftsvorfälle richtig zu bearbeiten,<br />
− während des gesamten Beurteilungszeitraums anwendbar zu sein<br />
⇒ deshalb auch: "indirekte Prüfung".<br />
• System- und Jahresabschlusszahlenprüfung sind keine Alternativen, son<strong>der</strong>n beide<br />
sind <strong>für</strong> eine wirtschaftliche und zuverlässige Urteilsbildung notwendig.<br />
59
Prüfungstechnik<br />
Begriff und Aufgaben des Erfassungs-, Verarbeitungs- und Internen Kontroll- (Überwachungs-)systems:<br />
Bei <strong>Jahresabschlussprüfung</strong> werden untersucht:<br />
(1) das Erfassungs- und Verarbeitungssystem und<br />
(2) das Interne Kontrollsystem (IKS).<br />
Zu (1): Erfassungs- und Verarbeitungssystem<br />
Alle Regelungen und Anweisungen, um Erfassungs- und Verarbeitungsprozesse<br />
nicht zufällig, son<strong>der</strong>n nach einer bestimmten, möglichst zwangsläufigen Ordnung<br />
ablaufen zu lassen, z. B. doppelte Buchführung, Kontenplan, Inventurverfahren<br />
etc.<br />
Zu (2): Internes Kontrollsystem<br />
Alle Regelungen und Verfahren, die die Richtigkeit <strong>der</strong> Erfassung und Verarbeitung<br />
<strong>der</strong> anfallenden Geschäftsvorfälle sichern sollen.<br />
• Internes Überwachungssystem (IÜS)<br />
= Internes Kontrollsystem und interne Prüfung durch Innenrevision<br />
- Für Prüfer ist nur <strong>der</strong> Teil des IÜS relevant, <strong>der</strong> im Rechnungswesen<br />
<strong>für</strong> Richtigkeit <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen sorgen soll.<br />
- Schwerpunkt <strong>der</strong> Systemprüfung liegt auf IKS, also den fest eingebauten<br />
Überwachungen.<br />
- Wirksames IKS erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass keine wesentlichen<br />
Fehler entstehen bzw. verbleiben.<br />
60
Prüfungstheorie<br />
- Qualität des IKS beeinflusst Fehlerrisiko und Fehlererwartung.<br />
Schwächen o<strong>der</strong> Lücken im IKS führen zu erheblichen Fehlermöglichkeiten.<br />
- Die Prüfung des IKS ist Element <strong>der</strong> GoA und als solches bei Abschlussprüfungen<br />
zwingend vorgeschrieben:<br />
"Bei <strong>der</strong> Abschlußprüfung hat <strong>der</strong> Abschlußprüfer System- und<br />
Funktionsprüfungen des internen Kontrollsystems und Einzelprüfungen<br />
durchzuführen" (FG 1/1988 Abschn. D II).<br />
”Der Abschlussprüfer muss ein Verständnis von dem internen<br />
Kontrollsystem insoweit entwickeln, als es <strong>für</strong> die Feststellung und<br />
Beurteilung <strong>der</strong> Fehlerrisiken sowie <strong>der</strong> prüferischen Reaktionen<br />
auf die beurteilten Fehlerrisiken erfor<strong>der</strong>lich ist.” (IDW PS 261<br />
(35)).<br />
• Trennung von Erfassungs-, Verarbeitungs- und Kontrollsystem in praxi nicht möglich,<br />
weil:<br />
- Erfassungs-, Verarbeitungs- und Kontrollhandlungen wechseln im Bearbeitungsprozess<br />
einan<strong>der</strong> ab.<br />
- Einzelne Erfassungs- und Verarbeitungsschritte besitzen gleichzeitig Kontrollaspekte<br />
(Bsp.: Bei anschließenden Ist-Ist-Vergleichen!).<br />
- IKS ohne Erfassungs- und Verarbeitungssystem undenkbar.<br />
Risikomanagementsystem (RMS)<br />
• Bei einer Aktiengesellschaft, die Aktien mit amtlicher Notierung ausgegeben hat,<br />
ist vom Abschlussprüfer im Rahmen <strong>der</strong> Prüfung zu beurteilen, ob <strong>der</strong> Vorstand<br />
ein geeignetes Überwachungssystem i. S. d. § 91 AktG eingerichtet hat und ob<br />
das eingerichtete System seine Aufgaben erfüllen kann (§ 317 dHGB).<br />
• Das Risikomanagementsystem (RMS) hat die Aufgabe, unternehmensrelevante<br />
Risiken zu identifizieren, zu erfassen und spätestens dann, wenn sie<br />
<strong>für</strong> das Unternehmen wesentlich werden bzw. sie Unternehmen in seinem<br />
Fortbestand gefährden könnten, zu kanalisieren bzw. abzuwehren.<br />
• Das RMS ist integraler Bestandteil des Internen Überwachungssystem.<br />
• Hinsichtlich <strong>der</strong> Prüfung des RMS sind die Grundsätze <strong>der</strong> Systemprüfung zu<br />
beachten (vgl. IDW PS 340).<br />
61
Ablauf <strong>der</strong> Systemprüfung:<br />
1. Systemerfassung,<br />
2. Systemdokumentation,<br />
3. Systemtests,<br />
4. Systembeurteilung.<br />
Zu 1.: Systemerfassung<br />
Prüfungstechnik<br />
• Für Beurteilung ist notwendig: Die Kenntnis des Systems, d. h. die Systemerfassung<br />
ist die Ermittlung <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> einzelnen Bearbeitungsvorgänge, <strong>der</strong> zugehörigen<br />
Kontroll- und Korrekturhandlungen sowie <strong>der</strong> Anordnung <strong>der</strong> einzelnen Bearbeitungs-,<br />
Kontroll- und Korrekturhandlungen sowie <strong>der</strong> personellen Zuordnung.<br />
• Das IKS-gestützte Erfassungs-, Verarbeitungs- und Auswertungssystem wird vor<br />
allem im Hinblick auf seine<br />
- Aufgabentrennungen,<br />
- Funktionstrennungen,<br />
- Kompetenzbündelungen,<br />
- Aufgabenvervielfachungen und<br />
- organisatorischen Rahmenbedingungen<br />
geprüft.<br />
Aufgaben Funktionen<br />
Bildung Glie<strong>der</strong>ung Trennung<br />
Maßnahmen <strong>der</strong> formalen<br />
Strukturierung<br />
Gestaltungselemente <strong>der</strong> Aufbau- und Ablauforganisation<br />
Kompetenzen<br />
Bündelung<br />
Maßnahmen <strong>der</strong> Zuweisung an<br />
einen Mitarbeiter<br />
Verantwortlichkeiten<br />
Zusammenfassung<br />
mehrere<br />
Mitarbeiter<br />
gemeinsam<br />
Abb. 10: Möglichkeiten zuverlässigkeitssteigern<strong>der</strong> Organisationsmaßnahmen<br />
62
Prüfungstheorie<br />
• Die tatsächlichen Kopplungsbeziehungen im Rechnungswesen des zu prüfenden<br />
Unternehmens sind auf ihre Zuverlässigkeitswirkungen zu analysieren.<br />
Hier<strong>für</strong> hat sich <strong>der</strong> Prüfer Soll-Vorstellungen zu bilden:<br />
a) über die erfor<strong>der</strong>lichen organisatorischen Maßnahmen <strong>für</strong> ein funktionierendes<br />
IKS und<br />
b) über den vom IKS insgesamt zu for<strong>der</strong>nden Zuverlässigkeitsgrad.<br />
• Vier Möglichkeiten <strong>der</strong> Systemerfassung:<br />
1. Systemerfassung durch eigene Beobachtungen <strong>der</strong> zu erfassenden Abläufe.<br />
• Beurteilung:<br />
- Sehr zuverlässige und vollständige Informationen (allerdings Fehlbeurteilungsgefahr<br />
durch "Hawthorne-Effekte"),<br />
- sehr aufwendig, vor allem wenn bereits vollzogene Abläufe bei Anwesenheit<br />
des Prüfers wie<strong>der</strong>holt werden.<br />
2. Auswertung vorhandener Unterlagen <strong>der</strong> zu prüfenden Unternehmung wie<br />
Organisationspläne, Stellenbeschreibungen o<strong>der</strong> durch Innenrevision erstellte<br />
Systemdokumentationen.<br />
• Beurteilung:<br />
- Abweichung des in den Unterlagen dokumentierten vom tatsächlich<br />
realisierten IKS möglich,<br />
- Än<strong>der</strong>ung des Systems im Laufe des Geschäftsjahres (vor Erscheinen<br />
des Prüfers) möglich<br />
⇒ Folgende Informationen sind dann notwendig:<br />
-- Wann ist das System geän<strong>der</strong>t worden?<br />
-- Sind alle Fälle vom "neuen" System erfasst worden?<br />
63
3. Fragebogentechnik<br />
Prüfungstechnik<br />
• Mit Hilfe meist standardisierter Fragebögen wird erfragt, wie das System<br />
arbeitet bzw. arbeiten soll.<br />
⇒ Fixierung <strong>der</strong> Antworten ergibt ein Bild des geplanten Systems.<br />
• Arten von Fragebogen:<br />
- Fragen in geschlossener Form:<br />
-- Nur Ja-/Nein-Antworten möglich, wobei Ja-Antworten Systemstärken,<br />
Nein-Antworten Systemschwächen kennzeichnen.<br />
-- Beurteilung:<br />
Hoher Rationalisierungseffekt, aber sehr starr und befragte<br />
Personen wissen schnell, was und wie sie antworten müssen,<br />
um eine ”gute” Beurteilung zu erhalten. Dadurch ist eine<br />
Fehlbeurteilung möglich.<br />
- Fragen in offener Form:<br />
-- Antwort unter näherer Darstellung des Sachverhalts.<br />
-- Beurteilung:<br />
Geringerer Rationalisierungseffekt, aber flexible Antworten<br />
möglich, dadurch geringere Gefahr <strong>der</strong> Fehlbeurteilung.<br />
⇒ Kombination bei<strong>der</strong> Fragebogentechniken!<br />
• Beispielfragen zur Prüfung des IKS <strong>für</strong> den Bereich <strong>der</strong> Verbindlichkeiten:<br />
- Liegt ein Organisationsplan und ein Verzeichnis aller Mitarbeiter<br />
<strong>der</strong> Buchführung vor?<br />
- Sind die Aufgabenbereiche <strong>der</strong> Mitarbeiter beschrieben und klar<br />
abgegrenzt?<br />
- Welche Bücher werden im einzelnen geführt?<br />
- Erfüllen Art und Anzahl <strong>der</strong> Bücher die gesetzlichen Vorschriften?<br />
- Sind auf den Konten Datum, Belegnummer, Buchungstext und<br />
Gegenkonto angegeben?<br />
- In welchen Abständen werden Abstimmungen vorgenommen und<br />
liegen über die Ergebnisse schriftliche Unterlagen vor?<br />
64
Prüfungstheorie<br />
- Wie werden Falschbuchungen behandelt?<br />
- Ist die Prüfspur gesichert, auch wenn <strong>der</strong> Buchungsstoff gruppenweise<br />
gebucht worden ist, im Journal und auf den Sachkonten?<br />
4. Erfassung des Systems durch Ziehung von Wurzelstichproben (= bidirektionale<br />
Systemprüfung)<br />
Zu 2.: Systemdokumentation<br />
• Systemdokumentation kann gleichzeitig mit Erfassung z. B. durch ausführliches<br />
Aufschreiben <strong>der</strong> Antworten auf den Fragenkatalog erfolgen.<br />
• Darstellungstechniken:<br />
- Ablaufdiagramme,<br />
- Flow Charts.<br />
• Für die Technik <strong>der</strong> Systemdokumentation ist entscheidend,<br />
Zu 3.: Systemtests<br />
- ob das Prüfungsunternehmen einen Fragebogen besitzt,<br />
- ob sich das jeweilige IKS des zu prüfenden Unternehmens durch einen standardisierten<br />
und deshalb relativ starren Fragenkatalog adäquat erfassen lässt.<br />
Ziel: Abbildung eines vollständigen und genauen Bildes des konzipierten IKS.<br />
• Das realisierte IKS kann von dem geplanten bzw. konzipierten IKS aufgrund formeller<br />
und informeller Regelungen abweichen.<br />
Bsp.: Zwei Mitarbeiter, die sich gegenseitig kontrollieren sollen, sprechen sich<br />
untereinan<strong>der</strong> ab, diese Kontrollen zu unterlassen, aber sich gegenseitig<br />
die Belege abzuzeichnen:<br />
65
Prüfungstechnik<br />
- Kontrollen sind faktisch außer Kraft gesetzt,<br />
- schlägt sich in Systemerfassung i. d. R. nicht nie<strong>der</strong>.<br />
• Überprüfung anhand einiger Geschäftsvorfälle, ob vorgesehene Kontrollen auch<br />
durchgeführt wurden.<br />
Wenn ein sichtbarer Kontrollpfad vorhanden ist (z. B. Namenszeichen), dann<br />
ist dieses ein Indiz da<strong>für</strong>, dass Kontrollhandlungen ausgeführt wurden. Ein Indiz<br />
ist aber kein Beweis!<br />
• Feststellung <strong>der</strong> Existenz und Wirksamkeit von Kontrollen durch die Eingabe<br />
falscher fiktiver Daten in das System durch den Prüfer und Ermittlung, ob und<br />
wie das IKS die Fehler aufdeckt.<br />
• Beurteilung:<br />
- Sehr aufwendig, fiktive Geschäftsvorfälle nach Tests aus Datenmaterial zu<br />
eliminieren.<br />
• Weicht geplantes vom realisierten System ab ⇒ Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Systemdokumentation.<br />
• Um zu beurteilen, ob ein System wie geplant funktioniert und mit welcher Zuverlässigkeit<br />
Fehler entdeckt und korrigiert werden, muss <strong>der</strong> Prüfer Stichproben<br />
aus dem Datenstrom ziehen und aus dem Ergebnis auf die Wirksamkeit aller<br />
Kontrollen schließen.<br />
• Unzuverlässige Kontrollen sind als Systemschwächen zu kennzeichnen.<br />
• Problem: Die Funktionsfähigkeit eines Systems ist nicht nur zu einem Zeitpunkt,<br />
son<strong>der</strong>n während des relevanten Prüfungszeitraums, also<br />
des gesamten GJ zu beurteilen.<br />
⇒ - Die Systemtests haben sich auf Geschäftsvorfälle zu erstrecken, die aus<br />
dem gesamten zu beurteilenden Zeitraum ausgewählt werden.<br />
- Wenn keine Systemtests <strong>für</strong> den gesamten Zeitraum möglich sind, dann<br />
ist eine umfangreichere Jahresabschlusszahlenprüfung erfor<strong>der</strong>lich.<br />
• Erfolgen Systemprüfungen während einer Zwischenprüfung im laufenden Geschäftsjahr,<br />
muss bei <strong>der</strong> Hauptprüfung nach Abschluss des Geschäftsjahres<br />
festgestellt werden, ob das System auch in <strong>der</strong> Zwischenzeit einwandfrei gearbeitet<br />
hat.<br />
66
Zu 4.: Systembeurteilung<br />
Prüfungstheorie<br />
• Vergleich des vom Prüfer festgestellten Ist-Systems mit einem von ihm gedanklich<br />
gebildeten Soll-System (vgl. Block 5 in Abb. 11).<br />
• Fehlende o<strong>der</strong> mangelhafte Kontrollen müssen als Schwachstellen gekennzeichnet<br />
werden, da dort erhöhte Gefahr besteht, dass Fehler entstehen und nicht entdeckt<br />
werden.<br />
• Fehlererwartungen determinieren weitere Prüfungshandlungen. (Vgl. Anschlussstellen<br />
zwischen "Systemprüfung" und "Jahresabschlusszahlenprüfung": Abb. 11<br />
und Abb. 12).<br />
• Bei <strong>der</strong> Systembeurteilung muss <strong>der</strong> Prüfer nicht nur einzelne Kontrollen, son<strong>der</strong>n<br />
auch die Systemabläufe im Zusammenhang beurteilen.<br />
• Aufbauend auf <strong>der</strong> Systemprüfung muss <strong>der</strong> Prüfer bei nachfolgen<strong>der</strong> Ergebnisprüfung<br />
(d. h. Jahresabschlusszahlenprüfung) feststellen, ob tatsächlich wesentliche<br />
Fehler an Schwachstellen entstanden sind.<br />
• Der Prüfer hat durch IKS-Analyse Informationen darüber,<br />
- welche Fehlerarten er an<br />
- welchen Stellen im Erfassungs-, Verarbeitungs- und Kontrollsystem<br />
- in welchen Zeiträumen<br />
- in welchem Ausmaß (Unzuverlässigkeit des Teilsystems) erwarten kann.<br />
• Gezielte Festlegung <strong>der</strong> weiteren Prüfungshandlungen nach Art, Umfang und Zeitpunkt<br />
möglich.<br />
67
Prüfer wählt aus allen<br />
Normen die <strong>für</strong> sein<br />
Prüfungsobjekt relevanten<br />
Normen aus<br />
(b) Zuverlässigkeit<br />
Relevante Normen<br />
<strong>für</strong> Prüfungsobjekt<br />
1<br />
3<br />
Prüfer bildet sich<br />
Sollvorstellungen<br />
nach Gesetz, Satzung<br />
GoB, GoA und an<strong>der</strong>en<br />
Normen über die an<br />
das Prüfungsobjekt<br />
zu stellenden Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
im Hinblick<br />
auf :<br />
(a) Funktions- und<br />
Aufgabentrennungen<br />
sowie Kompetenzbündelungen,Aufgabenvervielfachungen<br />
und organisatorische<br />
Rahmenbedingungen<br />
Interdependenzen<br />
Soll-Or-<br />
ganisation<br />
Soll-Zuver-<br />
lässigkeit<br />
Vorinformationen<br />
über Stärken und<br />
Schwächen des<br />
Systems<br />
(Urteil über das Erfassungs-/Verarbeitungs-/Überwachungssystem)<br />
Start<br />
Prüfungstechnik<br />
Normen: GoB, Gesetz, Satzung, GoA, Auftrag<br />
2<br />
(1) Prüfer wählt<br />
aus dem Rechnungswesen<br />
bzw. dem Internen<br />
Erf.-, Verarb.- und<br />
Überwachungssystem<br />
Unterlagen zur flächendeckendenErmittlung<br />
<strong>der</strong> Ablauforganisation<br />
des Systems<br />
(2)Test des erm. Systems<br />
anhand von abgewickeltenGeschäftsvorfällen<br />
Prüfer ermittelt die 4<br />
angewandten Aufgabenund<br />
Funktionstrennungen,<br />
die Kompetenzbündelungen,<br />
Aufgabenvervielfachungen<br />
und die organisatorischen<br />
Rahmenbedingungen des<br />
Systems anhand <strong>der</strong><br />
flächendeckenden<br />
Unterlagen<br />
Ist-Organisation<br />
5<br />
Prüfer vergleicht<br />
Ist-(I) Ablauforganisation<br />
und Soll-(S)<br />
Ablauforganisation<br />
S-I-Abweichung<br />
Prüfer vergleicht<br />
Ist-Zuverlässigkeit<br />
mit Soll-Zuverlässigkeit<br />
S-I-Zuverlässigkeitsabweichung<br />
8<br />
Prüfer beurteilt S-I-<br />
Abweichung bezüglich<br />
Zuverlässigkeit<br />
Information über ausgewählte<br />
Bereiche<br />
und Geschäftsvorfälle<br />
und (spätere) Rückgabe<br />
<strong>der</strong> Unterlagen<br />
Erhalt <strong>der</strong> Unterlagen<br />
Prüfer urteilt 6<br />
über organisatorische<br />
Systemstärken und<br />
-schwächen und Aufgrund des Ur-<br />
Prüfer ermittelt anteils zur Korrekhand<br />
<strong>der</strong> zufällig ausgewähltenTest-Getur<br />
durch das<br />
schäftsvorfälle die Unternehmen<br />
tatsächlich erreichte<br />
Zuverlässigkeit<br />
Ist-Zuverlässigkeit<br />
7<br />
Vorinformationen<br />
bzgl. Zuverlässigkeit<br />
etc. <strong>für</strong> die Jahresabschlußzahlenprüfung<br />
Aufgrund des<br />
Urteils zur<br />
Korrektur<br />
durch das<br />
Unternehmen<br />
Normen <strong>für</strong> Sollobjekte<br />
Rechtliche <strong>Grundlagen</strong><br />
und Informationen<br />
über:<br />
Geschäftsvorfälle<br />
Belegerstellung<br />
Kontierung<br />
Buchung<br />
Kontenabschluß<br />
Hauptabschlußübersicht<br />
Jahresabschluß<br />
System- o<strong>der</strong><br />
Ergebnis-<br />
Korrektur durch<br />
das Unternehmen<br />
Istobjekte <strong>der</strong> Jahresabschlußzahlenprüfung<br />
zur Korrektur durch<br />
das Unternehmen<br />
0<br />
Erfassungs-, Verarbeitungs- und Überwachungssysteme des Rechnungswesens <strong>der</strong> zu prüfenden Unternehmung<br />
Informationen<br />
über ausgewählte<br />
und erhaltene<br />
Istobjekte<br />
1 3 2 4 5<br />
Abb. 11: Blockdiagramm über den Ablauf <strong>der</strong> Systemprüfung<br />
68
Prüfungstheorie<br />
223.2 Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen (Ergebnisprüfung)<br />
223.21 Vorbemerkung<br />
Jahresabschlusszahlenprüfung:<br />
Prüfung <strong>der</strong> realitätsgerechten Abbildung einzelner Geschäftsvorfälle; richtet sich auf<br />
die in Konten dokumentierten Verarbeitungsergebnisse.<br />
Notwendigkeit <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlenprüfung:<br />
1. Der Prüfer muss sich davon überzeugen, ob Schwächen im IÜS tatsächlich zu<br />
Fehlern geführt haben.<br />
2. Auch wenn ein wirksam konzipiertes und zuverlässig arbeitendes IÜS die Wahrscheinlichkeit<br />
von Fehlern min<strong>der</strong>t, kann die Existenz von Fehlern niemals ganz<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Ursachen von Fehlern bei einem guten IÜS:<br />
a) Ein IKS arbeitet nie mit 100%iger Zuverlässigkeit, son<strong>der</strong>n es verbleibt<br />
stets ein bestimmter Unzuverlässigkeitsbereich.<br />
b) Die Umgehung von Kontrollmaßnahmen ist möglich.<br />
c) Fehler können oberhalb <strong>der</strong> Ebene des IÜS entstehen. Hierzu zählen vor<br />
allem über Bilanzpolitik hinausgehende (= manipulierende) Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> Unternehmensleitung.<br />
⇒ Fehler, die trotz IÜS auftreten, können nur durch detaillierte Prüfung <strong>der</strong><br />
Jahresabschlusszahlen entdeckt werden. Eine Systemprüfung muss immer<br />
durch die Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen ergänzt werden.<br />
223.22 Analytische Prüfungshandlungen<br />
Anwendungsbereich, Gegenstand und Umfang analytischer Prüfungshandlungen ist<br />
geregelt in IDW PS 312.<br />
Analytische Prüfungshandlungen spielen <strong>für</strong> die Wirtschaftlichkeit, aber auch <strong>für</strong> die<br />
Effektivität einer Abschlussprüfung eine bedeutende Rolle, da durch sie die aussagebezogenen<br />
Einzelfallprüfungen und damit <strong>der</strong> Prüfungsumfang insgesamt zur Gewinnung<br />
eines hinreichend sicheren Prüfungsurteils reduziert werden.<br />
Analytische Prüfungshandlungen sind Plausibilitätsbeurteilungen von Verhältniszahlen<br />
und Trends, mit <strong>der</strong>en Hilfe auffällige Abweichungen aufgezeigt werden sollen.<br />
69
Prüfungstechnik<br />
Bei einer Plausibilitätsbeurteilung handelt es sich somit um eine indirekte Prüfungsmethode,<br />
die im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs nicht eine exakte Gleichheit zwischen<br />
Soll-Objekt und Ist-Objekt, son<strong>der</strong>n eine sachlogische Übereinstimmung (Plausibilität)<br />
feststellt.<br />
Es werden nur Gruppenergebnisse d.h. verdichtete Jahresabschlussinformationen und<br />
nicht einzelne Geschäftsvorfälle o<strong>der</strong> Bestände miteinan<strong>der</strong> verglichen.<br />
Analytische Prüfungshandlungen bestehen grundsätzlich aus drei Komponenten:<br />
• Prognose (des Soll-Objektes),<br />
• Vergleich (des Ist-Objektes mit dem Soll-Objekt),<br />
• Beurteilung (<strong>der</strong> Soll-Ist-Differenz).<br />
Analytische Prüfungshandlungen umfassen beispielsweise Vergleiche zu beurteilen<strong>der</strong><br />
Daten mit:<br />
• Informationen aus Vorjahren (innerbetriebliche Vergleiche),<br />
• Vom Unternehmen erwarteten Ergebnissen (Budgetierung und Prognosen),<br />
• Erwartungen des AP über die Fortentwicklung im Unternehmen,<br />
• Branchenspezifischen Kennzahlen, wie das Verhältnis von Umsätzen zu den For<strong>der</strong>ungen<br />
des Unternehmens verglichen mit Branchendurchschnittszahlen o<strong>der</strong> verglichen<br />
mit an<strong>der</strong>en Unternehmen vergleichbarer Größe in <strong>der</strong>selben Branche (zwischenbetriebliche<br />
Vergleiche).<br />
Des Weiteren beinhalten analytische Prüfungshandlungen auch die Beurteilung von<br />
Zusammenhängen:<br />
• zwischen einzelnen finanziellen Informationen, die nach den Erfahrungen des Unternehmens<br />
erwartungsgemäß einem vorhersehbaren Muster entsprechen, wie die Bruttogewinnspannen,<br />
• zwischen finanziellen und wichtigen nicht-finanziellen Informationen, wie das Verhältnis<br />
von Lohn- und Gehaltskosten zu <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Arbeitnehmer.<br />
Voraussetzung aussagefähiger analytischer Prüfungshandlungen ist grundsätzlich die<br />
Zuverlässigkeit des zur Verfügung gestellten Datenmaterials sowie eine stetige Bilanzierung.<br />
Bei wesentlichen Posten darf <strong>der</strong> AP das Prüfungsurteil nicht ausschließlich auf die<br />
Ergebnisse analytischer Prüfungshandlungen stützen. Hier ist eine detaillierte Prüfung<br />
von Geschäftsvorfällen und/o<strong>der</strong> Beständen erfor<strong>der</strong>lich.<br />
70
Prüfungstheorie<br />
223.23 Prüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen<br />
1 3 2 4 5<br />
Allgemeine<br />
Normen<br />
Prüfer erstellt Sollobjekte<br />
zu den ausgewählten<br />
Istobjekten<br />
Prüfer vergleicht<br />
Soll- und Istobjekte<br />
in <strong>der</strong> Jahresabschlußzahlenprüfung<br />
Prüfer beurteilt<br />
S-I-Abweichungen<br />
Prüfer bildet sich ein<br />
Urteil aus <strong>der</strong><br />
Jahresabschlußzahlenprüfung<br />
Prüfer vergleicht<br />
Zuverlässigkeit aus<br />
Systemprüfung mit<br />
<strong>der</strong> aus Jahresabschlußzahlenprüfung<br />
Zuverlässigkeit<br />
aus<br />
Systemprüfung<br />
größer?<br />
Nein<br />
9<br />
Sollobjekte<br />
11<br />
S-I-Abweichungen<br />
12<br />
15<br />
Istobjekte<br />
Vorinformationen<br />
bzgl. Zuverlässigkeit<br />
etc. <strong>für</strong> die<br />
Jahresabschlußzahlenprüfung<br />
Interdependenzen<br />
Schwere <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Jahresabschlußzahlenprüfung<br />
entdeckten<br />
Fehler<br />
13<br />
Ja<br />
Vorinformationen über Stärken<br />
und Schwächen des Systems<br />
10<br />
Prüfer wählt Ist-<br />
Objekte aus dem Rechnungswesen<br />
<strong>der</strong> zu<br />
prüfenden Unternehmung<br />
<strong>für</strong> die verschiedenenAuswahlprüfungen<br />
aus<br />
Istobjekte zur Korrektur durch das<br />
Unternehmen, Information an Vorstand<br />
Rückgabe <strong>der</strong> Istobjekte an das Unternehmen<br />
(u. U. Vorstand)<br />
Prüfer faßt Ergebnisse<br />
aus SystemundJahresabschlußzahlenprüfung<br />
zusammen<br />
Urteil wird den Adressaten<br />
mitgeteilt<br />
Informationen<br />
über ausgewählte<br />
und erhaltene Istobjekte<br />
14<br />
Prüfungsergebnis<br />
16<br />
Adressateninformationen<br />
(Bestätigungsvermerk nach § 322 HGB<br />
und Prüfungsbericht nach § 321 HGB)<br />
Abb. 12: Blockdiagramm über den Ablauf <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlenprüfung<br />
71<br />
Rückgabe<br />
von Istobjekten<br />
zur<br />
Korrektur<br />
Rückgabe<br />
von Istobjekten<br />
ohne<br />
Korrektur
23 Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />
Prüfungstechnik<br />
231. Determinanten des Prüfungsumfangs<br />
§ 317 dHGB bzw. § 269 UGB regelt Gegenstand und Umfang <strong>der</strong> Prüfung <strong>für</strong> Einzel-<br />
und Konzernabschluss.<br />
• Der Prüfungsumfang ist im Gesetz nicht eindeutig festgelegt.<br />
• Das Gesetz nennt aber die Determinanten des Prüfungsumfangs:<br />
1. Den Prüfungsgegenstand, denn Zahl und Komplexität <strong>der</strong> vom Abschlussprüfer<br />
zu beurteilenden Elemente des Prüfungsgegenstands bestimmen wesentlich<br />
den Umfang <strong>der</strong> Prüfung.<br />
2. Die vom Prüfer gefor<strong>der</strong>ten Aussagen über den Prüfungsgegenstand:<br />
- Der Prüfer muss so prüfen, dass er beurteilen kann, ob:<br />
-- <strong>der</strong> Jahresabschluss den "gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden<br />
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Satzung"<br />
(§ 317 Abs. 1 Satz 2 dHGB bzw. § 269 Abs. 1 Satz 2 UGB) entspricht<br />
und<br />
-- "<strong>der</strong> Lagebericht mit dem Jahresabschluß ... mit den bei <strong>der</strong> Prüfung<br />
gewonnenen Erkenntnissen des Abschlußprüfers in Einklang“<br />
steht und, „ob <strong>der</strong> Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung<br />
von <strong>der</strong> Lage des Unternehmens ... vermittelt.“ (§ 317 Abs. 2<br />
Satz 1 dHGB) bzw. „<strong>der</strong> Lagebericht mit dem Jahresabschluß ... in<br />
Einklang“ steht und, „ob die sonstigen Angaben im Lagebericht<br />
nicht eine falsche Vorstellung von <strong>der</strong> Lage des Unternehmens ...<br />
erwecken“ (§ 269 Abs. 1 Satz 3 UGB)<br />
-- ”die Chancen und Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung zutreffend<br />
dargestellt sind“ (§ 317 Abs. 2 Satz 2 dHGB).<br />
-- ”<strong>der</strong> Vorstand die ihm nach § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes obliegenden<br />
Maßnahmen in einer geeigneten Form getroffen hat und<br />
ob das danach einzurichtende Überwachungssystem seine Aufgaben<br />
erfüllen kann.” (§ 317 Abs. 4 dHGB) Diese Regelung ist indes<br />
nur zwingend auf Aktiengesellschaften anzuwenden, die Aktien mit<br />
amtlicher Notierung ausgegeben haben.<br />
• Die gesetzlichen Vorschriften setzten lediglich Rahmenbedingungen, innerhalb<br />
<strong>der</strong>er es dem Abschlussprüfer obliegt ”Art und Umfang <strong>der</strong> im Einzelfall erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Prüfungshandlungen im Rahmen <strong>der</strong> Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem<br />
Ermessen zu bestimmen.” (IDW PS 200 Tz. 18)<br />
72
Prüfungstheorie<br />
Die GoA konkretisieren den Prüfungsumfang:<br />
• Ein vertrauenswürdiges Urteil muss ein hohes Maß an Genauigkeit und Sicherheit<br />
aufweisen.<br />
• Sicherheit kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit/Zuverlässigkeit, mit <strong>der</strong> ein Urteil<br />
zutrifft. Genauigkeit ist ein Maß <strong>für</strong> die Exaktheit eines Urteils.<br />
• Aufgabe <strong>der</strong> GoA ist es, diejenigen Sicherheits- und Genauigkeitsgrade festzulegen,<br />
die <strong>für</strong> eine konkrete Prüfungsaufgabe angemessen sind.<br />
• Bei Schätzungen stehen Sicherheit und Genauigkeit in einem Spannungsverhältnis.<br />
Bei gegebenem Stichprobenumfang steigt die Sicherheit, wenn die Genauigkeit abnimmt,<br />
wenn also das Intervall vergrößert wird:<br />
100% Sicherheit<br />
0% Sicherheit<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
W<br />
0<br />
absolute (100 %)<br />
Genauigkeit<br />
1 2<br />
U<br />
Ungenauigkeit,<br />
Breite des<br />
Schätzintervalls<br />
Abb. 13: Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Genauigkeit des Prüfungsurteils<br />
73
Prüfungstechnik<br />
• Der HFA des IdW legt die Vorgabe des erfor<strong>der</strong>lichen Sicherheits- und Genauigkeitsgrades<br />
weitgehend in das Ermessen des verantwortlichen Abschlussprüfers.<br />
• Zum erfor<strong>der</strong>lichen Sicherheitsgrad sagt <strong>der</strong> HFA:<br />
"Bei <strong>der</strong> Festlegung des erfor<strong>der</strong>lichen Sicherheitsgrades <strong>für</strong> eine statistische Aussage muß<br />
<strong>der</strong> Prüfer gewissenhaft abwägen, ob das bei je<strong>der</strong> Stichprobenprüfung in Kauf zu nehmende<br />
Risiko eines unzutreffenden Urteils über das untersuchte Prüfgebiet im Rahmen<br />
des Gesamturteils seiner Prüfung noch vertretbar ist." (HFA, Stellungnahme 1/1988,<br />
Abschn. D III 2 b)).<br />
• Im Zweifel sollten die Teilurteile mit mindestens 95%iger Sicherheit abgegeben<br />
werden, um die Vertrauenswürdigkeit des Urteils je<strong>der</strong>zeit zu gewährleisten.<br />
• Den Genauigkeitsgrad, d. h. die Breite des Toleranzbereichs muss <strong>der</strong> Prüfer:<br />
"Nach <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> im Prüfgebiet festgestellten Fehler und nach ihren möglichen Auswirkungen<br />
auf die Rechnungslegung ... von Fall zu Fall festlegen." (HFA, Stellungnahme<br />
1/1988, Abschn. D III 2 c)).<br />
• Als Kriterien <strong>für</strong> den Genauigkeitsgrad nennt <strong>der</strong> HFA:<br />
- Die Bedeutung im Prüfgebiet festgestellter Fehler <strong>für</strong> das Gesamturteil,<br />
- <strong>der</strong> erwartete Fehleranteil sporadisch im Prüfgebiet auftreten<strong>der</strong> Fehler,<br />
- <strong>der</strong> Anfall systematischer o<strong>der</strong> bewusster Fehler im Prüfgebiet und<br />
- die Bedeutung des einzelnen Teilgebietes im Rahmen <strong>der</strong> Gesamtprüfung.<br />
• Im Zweifel ist ein Genauigkeitsgrad von 99 % grundsätzlich ausreichend.<br />
• Bei bewusst gesteuerten Auswahlverfahren lassen sich keine objektiv feststellbaren<br />
Sicherheits- und Genauigkeitsgrade angeben.<br />
74
232. Vollprüfung<br />
Prüfungstheorie<br />
Bei einer Vollprüfung wird das Urteil erst dann gefällt, wenn sämtliche Elemente eines<br />
Prüffeldes auf ihre urteilsrelevanten Merkmale untersucht worden sind.<br />
Das Urteil kann mit einer sehr hohen Sicherheit und Genauigkeit abgegeben werden<br />
(theoretisch sogar mit je 100%iger Sicherheit und Genauigkeit).<br />
Aber:<br />
- Eine Vollprüfung verbraucht viel Zeit und verursacht hohe Kosten.<br />
- Die Realisierung maximaler Urteilsqualität ohne Rücksicht auf die Kosten wi<strong>der</strong>spricht<br />
den Zielen <strong>der</strong> Urteilsadressaten.<br />
- Auch bei einer Vollprüfung sind Fehler des Prüfers durch Ermüdung und Irrtümer<br />
möglich (und damit auch keine 100%ige Sicherheit und Genauigkeit).<br />
- Auch Auswahlverfahren bieten hohes Maß an Sicherheit und Genauigkeit.<br />
- Der Grundsatz <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit ist als GoA allgemein anerkannt. Der<br />
Prüfer muss die erfor<strong>der</strong>liche Qualität seines Urteils deshalb mit möglichst geringem<br />
Aufwand erzielen.<br />
Deshalb:<br />
Vollprüfung nur bei Prüfungsfel<strong>der</strong>n mit hoher Bedeutung, z. B. Prozessrückstellungen.<br />
Vollprüfung kommt vor allem dann und bei Prüfungsfel<strong>der</strong>n in Betracht, wenn die<br />
Risiken aus <strong>der</strong> individuellen Sensitivitätsanalyse (INSA) bei Moody‘s RiskCalc einen<br />
sehr hohen Einfluss auf eine deutliche Risikoerhöhung <strong>für</strong> den Fortbestand des<br />
Unternehmens signalisieren.<br />
75
233. Auswahlprüfung<br />
233.1 Überblick zu den Verfahren<br />
Prüfungstechnik<br />
Anwendung <strong>der</strong> Auswahlprüfung, wenn eine vollkommene Sicherheit bei verlangter<br />
Mindestgenauigkeit des Gesamturteils über einen Prüfungskomplex nicht verlangt wird<br />
(und das ist <strong>der</strong> Regelfall).<br />
• Auswahlprüfung = Prüfung einer möglichst repräsentativen Auswahl von Ist-<br />
Objekten (= Stichprobenelemente, n) aus <strong>der</strong> Menge des<br />
Prüfungskomplexes (= Grundgesamtheit, N). Vom Ergebnis<br />
<strong>der</strong> Auswahlprüfung wird dann auf alle, auch auf<br />
die nicht geprüften Sachverhalte geschlossen und ein Prüfungsurteil<br />
gebildet.<br />
• Zweck <strong>der</strong> Auswahlprüfung: Reduzierung des Prüfungsumfangs und <strong>der</strong> Prüfungszeit,<br />
d. h. kostengünstigere Durchführung von Prüfungen.<br />
Aber: Unentdeckte Fehler müssen in Kauf genommen werden.<br />
• Stellungnahme HFA 1/1988, Abschn. A:<br />
"Der Abschlußprüfer (hat) Art und Umfang seiner Prüfungshandlungen gewissenhaft<br />
und mit berufsüblicher Sorgfalt ... zu bestimmen, so daß ihm unter Beachtung <strong>der</strong> Wesentlichkeit<br />
die gefor<strong>der</strong>te sichere (und genaue) [Ergänzungen in runden Klammern<br />
durch den Verfasser] Beurteilung <strong>der</strong> Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit <strong>der</strong> Rechnungslegung<br />
möglich ist. Um diese Zielsetzung <strong>der</strong> Abschlußprüfung im Rahmen <strong>der</strong> gebotenen<br />
Wirtschaftlichkeit und Termingerechtigkeit <strong>der</strong> Prüfung zu erreichen, ist im allgemeinen<br />
<strong>der</strong> Einsatz stichprobengestützter Prüfungsmethoden (zufallsgesteuerter Auswahlverfahren)<br />
erfor<strong>der</strong>lich, aber auch ausreichend."<br />
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die möglichen Verfahren <strong>der</strong> Auswahlprüfung:<br />
76
Auswahlverfahren<br />
Zufallsgesteuerte<br />
Auswahl<br />
Systematisch gesteuerte<br />
Auswahl<br />
Mit ergebnisabhängigem<br />
Stichprobenumfang<br />
Mit vorgegebenem<br />
Stichprobenumfang<br />
Auswahl <strong>der</strong> Prüfungsgegenstände<br />
nach dem<br />
Fehlerrisiko<br />
Auswahl nach <strong>der</strong><br />
Bedeutung <strong>der</strong><br />
Prüfungsgegenstände<br />
Abb. 14: Verfahren <strong>der</strong> Auswahlprüfung<br />
Prüfungstheorie<br />
Detektivische<br />
Auswahl<br />
Auswahl typischer<br />
Elemente<br />
Konzentrationsauswahl<br />
77<br />
Mit unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten<br />
Mit gleichen Auswahlwahrscheinlichkeiten<br />
Sequentialtestverfahren<br />
Wertproportionale<br />
Auswahl<br />
(BPA) *)<br />
Geschichtete<br />
Auswahl<br />
"Unechte"<br />
o<strong>der</strong><br />
"systematische"<br />
Zufallsauswahl<br />
"Echte"<br />
Zufallsauswahl<br />
*) BPA = Betragsproportionale<br />
Auswahl
233.2 Bedeutung von Vorinformationen<br />
Prüfungstechnik<br />
Die Verlässlichkeit des Prüferurteils, d. h. <strong>der</strong> Grad an Sicherheit und Genauigkeit des Urteils,<br />
ist abhängig von:<br />
• <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> untersuchten Elemente (n) im Verhältnis zur Zahl aller Elemente (N),<br />
• <strong>der</strong> sachgerechten Anwendung <strong>der</strong> Verfahren und<br />
• dem Grad <strong>der</strong> Zuverlässigkeit <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Anwendung <strong>der</strong> Verfahren benutzten Informationen<br />
über das Prüfungsgebiet (Vorinformationen) zur Auswahl <strong>der</strong> Elemente.<br />
Nützliche Informationen sind bspw. Angaben über<br />
• den absoluten und relativen Wert einzelner Geschäftsvorfälle,<br />
• die Bedeutung eines Prüffeldes <strong>für</strong> das Gesamturteil,<br />
• die wirtschaftliche Lage des zu prüfenden Unternehmens,<br />
• den Schwierigkeitsgrad <strong>der</strong> Buchungsvorgänge,<br />
• die Qualifikation des Buchhaltungs- bzw. Rechnungswesenpersonals,<br />
• die Kenntnis von Vorjahresfehlern.<br />
Das IDW (FG 1/1977 und 1/1988 sowie HFA 1/1988) verpflichtet den Prüfer, vor Anwendung<br />
eines Auswahlverfahrens solche Informationen zu beschaffen und auszuwerten:<br />
• "Unter Berücksichtigung des Grundsatzes <strong>der</strong> Wesentlichkeit und des Fehlerrisikos wird <strong>der</strong><br />
Abschlußprüfer seine Prüfungshandlungen auf <strong>der</strong> Grundlage von Stichproben (gemeint sind<br />
Auswahlverfahren) vornehmen". (FG 1/1988, Abschn. D II 1. Anm. 1).<br />
• Prüffel<strong>der</strong> sind im Hinblick auf die Bedeutung (Wesentlichkeit) <strong>der</strong> im Prüffeld<br />
enthaltenen Elemente, gemessen an ihrem absoluten o<strong>der</strong> relativen Wert <strong>für</strong> das<br />
Prüfungsurteil, zu analysieren.<br />
• Prüfer benötigt Vorinformationen, die ihm gestatten, das Fehlerrisiko, d. h. die<br />
Wahrscheinlichkeit von Fehlern o<strong>der</strong> von Verstößen gegen die Rechnungslegungsvorschriften,<br />
abzuschätzen.<br />
- FG 1/1977: "Das Fehlerrisiko im Rahmen <strong>der</strong> Rechnungslegung hängt<br />
u. a. ab von Art, Größe und wirtschaftlicher Lage des zu prüfenden<br />
Unternehmens sowie von Verwertbarkeit und Art <strong>der</strong><br />
Vermögensgegenstände bzw. Schulden. Bei <strong>der</strong> Abschätzung<br />
des Fehlerrisikos ist <strong>der</strong> Stand des internen Kontrollsystems<br />
von Bedeutung."<br />
- Bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> wirtschaftlichen Lage resultierenden Fehlerrisiken<br />
sind grundsätzlich zwei Gruppen von Risikofaktoren zu unterscheiden:<br />
(1) Risiken aus dem Gesundheitszustand/Bestandsfestigkeit des Unternehmens<br />
und<br />
78
Quellen <strong>für</strong> Vorinformationen:<br />
Wirtschaftsprüfung I<br />
(2) Risiken aus dem Lebenswandel des Unternehmens (=künftige Geschäftsrisiken<br />
als kumulierte Gewinne/ Verluste).<br />
Beide Risikogruppen ergeben gemeinsam das Risiko des Unternehmens.<br />
Beispiel (1): Ein Unternehmen mit hoher Bestandsfestigkeit (Wi<strong>der</strong>standskraft)<br />
kann auch riskante Geschäfte eingehen. Es wird<br />
durch Verluste nicht gleich im Bestand gefährdet, son<strong>der</strong>n fe<strong>der</strong>t<br />
diese ab.<br />
Beispiel (2): Ein Unternehmen mit sehr geringer Bestandsfestigkeit wird<br />
u. U. schon bei einer Geschäftstätigkeit in einem Zweig mit<br />
geringem Son<strong>der</strong>risiko scheitern, wenn durch schwache Konjunktur<br />
eine kurzfristige Kaufzurückhaltung <strong>der</strong> Kunden ausgelöst<br />
wird.<br />
• Stand des internen Kontrollsystems/IÜS bzw. des RMS,<br />
• Betriebsbegehungen,<br />
• Analyse <strong>der</strong> Aufbau- und Ablauforganisation mit Urlaubsvertretungsregelungen,<br />
• Studium von Fehlerprotokollen,<br />
• Reklamationen von Kunden und Lieferanten,<br />
• Abstimmungsprüfungen,<br />
• Vorstichproben o<strong>der</strong> die Analyse <strong>der</strong> wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse des<br />
Unternehmens,<br />
• Ermittlung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Lage mit Hilfe <strong>der</strong> Bilanzbonitätsprüfung <strong>der</strong> letzten<br />
fünf Jahre sowie des vorläufigen und später des endgültigen JA sowie <strong>der</strong> dem Bilanzstichtag<br />
folgenden zwei Jahre,<br />
• ”Qualitative Bonität” mit KNNA auf <strong>der</strong> Basis von Auskünften.<br />
79
Prüfungstechnik<br />
Beispiele <strong>für</strong> bei <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlenprüfung benötigte Vorinformationen bei alternativen<br />
Auswahlverfahren (Übersicht aus: Baetge, J., Auswahlprüfungen auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Systemprüfung):<br />
Benötigte Vorinformationen über<br />
Höhe des Wertes (EUR-Betrags) absolut<br />
Höhe des Wertes (EUR-Betrags) relativ<br />
Ergebnis <strong>der</strong> ABC-Analyse<br />
Fehleranfälligkeit<br />
wegen Bearbeiter<br />
(mangelnde Kenntnisse)<br />
wegen fehlen<strong>der</strong> Kontrolle<br />
wegen Komplexität des Falles<br />
wegen Komplexität <strong>der</strong> Bearbeitung (o<strong>der</strong> Mängel des Prozessablaufs)<br />
wegen Indizien <strong>für</strong> Fehler (Radierung/Rasur/Verheimlichung)<br />
wegen fehlen<strong>der</strong> Funktions- bzw. Aufgabentrennung<br />
wegen Son<strong>der</strong>fall (keine generelle Regelung)<br />
Routinefall<br />
Gleichartige Fehlerursachen bzw. -möglichkeiten<br />
"Lage" <strong>der</strong> Geschäftsvorfälle<br />
Aus <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> ausgewählten Fälle genutzte Informationen über<br />
Weiterauswahl<br />
Ende <strong>der</strong> Auswahl<br />
Ausreißerfreiheit<br />
(Mindest)größe <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
Zufallszahlen-Tabelle o<strong>der</strong> -generator o<strong>der</strong> Ersatz<br />
Gewünschter Sicherheits- und Genauigkeitsgrad<br />
Zulässiger Fehler 1. und/o<strong>der</strong> 2. Art<br />
Maximal tolerabler Fehleranteil bzw. -wert<br />
Prognostizierter Fehleranteil bzw. -wert<br />
Angewendetes Auswahlverfahren ? Bewusste Auswahlverfahren Zufallsgesteuerte Auswahlverfahren<br />
Auswahl<br />
nach absoluter<br />
o<strong>der</strong><br />
relativer Bedeutung<br />
des<br />
Geschäftsvorfalls<br />
x<br />
x<br />
x<br />
DetektivischeAuswahl<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
(x)<br />
(x)<br />
x<br />
80<br />
Typische<br />
Auswahl<br />
x<br />
x<br />
(x)<br />
Einfache<br />
Zufallsauswahl<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Einstufige Auswahlverfahren<br />
Komplexe Zufallsauswahl<br />
GeschichteteZufallsauswahl<br />
(x)<br />
(x)<br />
(x)<br />
(x)<br />
(x)<br />
(x)<br />
(x)<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Klumpenauswahl<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Mehrstufige<br />
Zufalllsauswahl,<br />
z.B.<br />
Sequentialtestverfahren<br />
x<br />
x<br />
(x)<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x
Wirtschaftsprüfung I<br />
233.3 Systematisch gesteuerte Auswahlverfahren<br />
233.31 Auswahlkriterien und Prüfungsumfang<br />
Die Stellungnahme 1/1988 des HFA des IDW nennt in Übereinstimmung mit <strong>der</strong> Prüfungspraxis<br />
als Kriterien <strong>für</strong> die bewusstgesteuerte (=systematische) Auswahl:<br />
• Die relative und absolute Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstands innerhalb<br />
<strong>der</strong> Gesamtprüfung,<br />
• die Auswahl nach "typischen Fällen" und<br />
• das "Fehlerrisiko".<br />
233.311. Konzentrationsauswahl<br />
Definition:<br />
Bei diesem Auswahlverfahren werden diejenigen Elemente ausgesucht und geprüft, die wegen<br />
ihres relativen o<strong>der</strong> absoluten Gewichts im Prüfungsfeld das Urteil über das Prüfgebiet<br />
entscheidend beeinflussen können.<br />
Synonyme Begriffe: Konzentrationsauswahl, Auswahl nach dem Konzentrationsprinzip<br />
(cut-off-Verfahren).<br />
Konzentrationsprinzip: Bei bestimmten Elementen beeinträchtigen Fehler wesentlich<br />
die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses und damit<br />
das Gesamturteil des Abschlussprüfers.<br />
• Je bedeuten<strong>der</strong> ein Prüffeld vom Umfang/Wert (relativ zu allen an<strong>der</strong>en) ist, desto<br />
höher ist unter sonst gleichen Bedingungen <strong>der</strong> Prüfungsumfang anzusetzen, denn<br />
mit jedem zusätzlich untersuchten Prüfungselement sinkt das Risiko des Prüfers, ein<br />
falsches Urteil über das Prüffeld abzugeben.<br />
• Von dem Ergebnis <strong>der</strong> untersuchten Geschäftsvorfälle kann <strong>der</strong> Prüfer nicht auf die<br />
Fehlerhaftigkeit o<strong>der</strong> Fehlerfreiheit im nicht geprüften Teil <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
schließen, aber er kann sicher sein, dass die nicht entdeckten Fehler nur bei Prüfungsobjekten<br />
auftreten können, die von geringerer Bedeutung sind (subjektive Repräsentativität).<br />
81
Prüfungstechnik<br />
Beispiel <strong>für</strong> die Auswahl nach <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong> Prüfungsgegenstände mittels ABC-<br />
Analyse:<br />
• Ausgangsdaten <strong>für</strong> ein Beispiel<br />
- Prüfungsfeld: For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen,<br />
- Gesamtwert <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen: 60 Mio. EUR,<br />
- 10.000 verschiedene Einzelfor<strong>der</strong>ungen.<br />
• Vorgehen in zwei Schritten:<br />
1. Einteilung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen in Klassen:<br />
A-For<strong>der</strong>ungen: Relativ wenige große Geschäftsvorfälle, die einen relativ<br />
großen Anteil des Wertes des gesamten For<strong>der</strong>ungsbestandes<br />
ausmachen.<br />
B-For<strong>der</strong>ungen: Mittelwertige For<strong>der</strong>ungen, die i. d. R. in größerer Zahl<br />
vorkommen.<br />
C-For<strong>der</strong>ungen: For<strong>der</strong>ungen, die einen relativ geringen Wert im Verhältnis<br />
zum Wert des gesamten For<strong>der</strong>ungsbestandes aufweisen, indes<br />
in sehr großer Zahl im Bestand enthalten sind.<br />
82
Wirtschaftsprüfung I<br />
2. Verteilung <strong>der</strong> einzelnen For<strong>der</strong>ungen in die definierten Klassen:<br />
a) Computergestützt werden die For<strong>der</strong>ungen nach ihrer Höhe (nach Wert) ab-<br />
/aufsteigend sortiert. Folgende Tabelle zeigt eine mögliche Verteilung:<br />
(1) (2) (3) (4) (5) (6)<br />
For<strong>der</strong>ungs-<br />
Nr.<br />
nach Werthöhe<br />
fallend<br />
1<br />
.<br />
.<br />
2.000<br />
.<br />
.<br />
3.000<br />
.<br />
.<br />
10.000<br />
Buchungs-<br />
Nr.<br />
06.754<br />
.<br />
.<br />
02.678<br />
.<br />
.<br />
09.234<br />
.<br />
.<br />
05.899<br />
Kumulierter<br />
Mengenanteil<br />
(%)<br />
0,01<br />
.<br />
.<br />
20<br />
.<br />
.<br />
30<br />
.<br />
.<br />
100<br />
83<br />
Betrag <strong>der</strong><br />
Einzelfor<strong>der</strong>ung<br />
(EUR)<br />
1,5 Mio<br />
.<br />
.<br />
50.000<br />
.<br />
.<br />
5.000<br />
.<br />
.<br />
100<br />
Wertanteil<br />
<strong>der</strong><br />
Einzelfor<strong>der</strong>ung<br />
(%)<br />
2,5<br />
.<br />
.<br />
0,083<br />
.<br />
.<br />
0,0083<br />
.<br />
.<br />
0,00017<br />
Kumulierter<br />
Wertanteil<br />
(%)<br />
2,5<br />
.<br />
.<br />
80<br />
.<br />
.<br />
95<br />
.<br />
.<br />
100
Prüfungstechnik<br />
b) Abbildung des kumulativen Mengen- und Wertanteils <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen in<br />
einer Verteilungskurve (Lorenzkurve):<br />
Wertanteil in Prozent<br />
100<br />
95<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
5<br />
A<br />
B<br />
C<br />
10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />
Abb. 15: ABC-Analyse<br />
• Beurteilung <strong>der</strong> ABC-Analyse:<br />
Mengenanteil in Prozent<br />
- Anwendung <strong>der</strong> ABC-Analyse trägt erheblich zur Rationalisierung <strong>der</strong> Prüfung<br />
von For<strong>der</strong>ungen (und Verbindlichkeiten) bei.<br />
- Muss im Verbund mit weiteren Kriterien betrachtet werden: Vorinformationen,<br />
z. B. Informationen über notleidende Debitoren, liefern Anhaltspunkte<br />
<strong>für</strong> eine detektivische Auswahl, welche For<strong>der</strong>ungen bzw. zugehörige<br />
Geschäftsvorfälle betreffen können, die jenseits des mittels einer ABC-<br />
Analyse bewusst ausgewählten For<strong>der</strong>ungsbestandes liegen können.<br />
- Die ABC-Analyse als Auswahlkriterium findet ihre Grenze dort, wo die Konzentrationskurve<br />
nahe <strong>der</strong> 45 ° -Linie verläuft und deshalb die Prüfung eines geringen<br />
Mengenanteils nicht zur Prüfung eines hohen Wertanteils führen kann.<br />
84<br />
100
233.312. Auswahl typischer Elemente<br />
Definition:<br />
Wirtschaftsprüfung I<br />
Die Prüfungshandlungen konzentrieren sich auf solche Geschäftsvorfälle, die im Prüfgebiet<br />
jeweils in gleicher Weise o<strong>der</strong> von den gleichen Personen verarbeitet werden und bei denen<br />
Fehler deshalb als typisch <strong>für</strong> den jeweiligen Verarbeitungsgang angesehen werden können.<br />
Ziel des Verfahrens:<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Prüfung von wenigen, ausgewählten Geschäftsvorfällen ein möglichst <strong>für</strong> das<br />
gesamte Prüffeld subjektiv repräsentatives Urteil zu gewinnen.<br />
Anwendungsbereiche:<br />
• Systemprüfungen<br />
• Entdecken systematischer Fehler, die u. U. wie<strong>der</strong>um auf Fehlerquellen (i. S. v. Fehlerursachen)<br />
hinweisen können.<br />
• Gewinnung wertvoller Aufschlüsse über mögliche Fehler, wenn keine an<strong>der</strong>en Vorinformationen<br />
vorliegen.<br />
• Grundlage von Wurzelstichproben (retrograde Prüfung).<br />
Anwendungsgrenzen:<br />
• Die zu prüfenden Objekte müssen auf ähnliche Weise erstellt worden sein. Ansonsten<br />
werden systematisch auftretende Fehler nicht als solche erkannt.<br />
85
233.313. Detektivische Auswahl<br />
Definition:<br />
Prüfungstechnik<br />
Der Prüfer wählt aufgrund seines Spürsinns und seiner Erfahrung solche Sachverhalte aus,<br />
bei denen er am ehesten Fehler vermutet.<br />
• Prüffel<strong>der</strong>, in denen ein hoher Fehleranteil erwartet wird, werden intensiver geprüft<br />
als Prüffel<strong>der</strong>, bei denen ein geringer Fehleranteil vermutet wird, d. h. je höher das<br />
Fehlerrisiko ist, desto größer muss <strong>der</strong> Stichprobenumfang sein.<br />
Beim risikoorientierten Ansatz kann <strong>der</strong> Prüfer aber auch versuchen, jene Prüfungsfel<strong>der</strong> zu<br />
identifizieren, bei denen ein hohes inhärentes Risiko (IR) besteht. Hierbei kann ihm z. B.<br />
die Bilanzbonitätsprüfung mit einem Bilanzrating helfen. Dabei ist <strong>der</strong> Pyramideneffekt zu<br />
beachten.<br />
Ziel des risikoorientierten Verfahrens:<br />
Minimierung des Prüfungsrisikos <strong>für</strong> einen α-Fehler.<br />
Zweckgerichtete Auswahl von Vorinformationen als Auswahlkriterium <strong>für</strong> die Stichprobe:<br />
• Will <strong>der</strong> Abschlussprüfer unbeabsichtigte Fehler aufspüren, dann sind:<br />
- Grad <strong>der</strong> Komplexität <strong>der</strong> Organisation des Rechnungswesens,<br />
- Schwierigkeitsgrad <strong>der</strong> Verarbeitung von Geschäftsvorfällen und<br />
- Qualifikation <strong>der</strong> jeweiligen Mitarbeiter im Rechnungswesen zu berücksichtigen.<br />
• Will <strong>der</strong> Abschlussprüfer beabsichtigte Fehler aufspüren:<br />
- Vorläufige Einschätzung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Lage des Unternehmens anhand <strong>der</strong><br />
noch ungeprüften Jahresabschlusszahlen mit einem Bilanzrating.<br />
⇒ Bei Unterschlagungsprüfungen sind Spürsinn und Erfahrung des Prüfers beson<strong>der</strong>s<br />
wichtig!<br />
86
Wirtschaftsprüfung I<br />
Mögliche Fehlerquellen lassen sich generell nach den folgenden Kriterien aufspüren:<br />
• Sachliche Auswahlkriterien<br />
⇒ Z. B. außergewöhnliche Schadenfälle (hohe Beträge) im Versicherungswesen,<br />
Schwierigkeitsgrad <strong>der</strong> Bearbeitung, sichtbare Korrekturen<br />
• Personelle Auswahlkriterien<br />
⇒ Z. B. Ausbildungsstand, Erfahrung <strong>der</strong> Mitarbeiter des Rechnungswesens<br />
• Zeitliche Auswahlkriterien<br />
⇒ Z. B. Zeiträume mit hoher Arbeitsbelastung, Vertretungszeiten<br />
• Räumliche Auswahlkriterien<br />
⇒ Z. B. erhöhte Gefahr von Diebstahl aufgrund des wenig gesicherten Lagerortes<br />
Beurteilung:<br />
• Erfahrungen und Vorinformationen des Prüfers können explizit berücksichtigt werden<br />
(Erfahrungseffekt).<br />
• Bei Wie<strong>der</strong>holungsprüfungen besteht die Gefahr, dass die Auswahlkriterien des Prüfers<br />
durchschaut werden bzw. einige Teile des Prüfungsstoffes nie geprüft werden und damit<br />
ein Bereich <strong>für</strong> beabsichtigte Unregelmäßigkeiten entsteht. Dabei werden <strong>für</strong> den Prüfer<br />
sogenannte Soll-Bruchstellen vorbereitet.<br />
• Präventionsstrategie: Kombination von Auswahlkriterien.<br />
Stellungsnahme HFA 1/1988, Abschn. C II 2.:<br />
"Es kann zweckmäßig sein, die Auswahl nach dem Fehlerrisiko mit <strong>der</strong> Auswahl nach<br />
<strong>der</strong> Bedeutung des Prüfungsgegenstandes zu verbinden und z. B. zunächst nach dem Fehlerrisiko<br />
auszuwählen und daran anschließend auf die Bedeutung <strong>der</strong> verbleibenden<br />
Elemente des Prüfgebiets abzustellen."<br />
87
Prüfungstechnik<br />
233.32 Beurteilung systematisch gesteuerter (bewusster) Auswahlverfahren<br />
Vorteil:<br />
• Die bewusste Auswahl bietet dem Prüfer vor allem den Vorteil, aufgrund seines Sachverstandes<br />
gezielt nach fehlerhaften Prüfungselementen suchen zu können. Die Methoden<br />
<strong>der</strong> bewussten Auswahl führen dann zum Erfolg, wenn vom Prüfer bei <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong><br />
Stichprobenelemente möglichst sämtliche verfügbaren Vorinformationen über die mutmaßliche<br />
Qualität des in Auswahl zu prüfenden Prüfungskomplexes berücksichtigt werden.<br />
Nachteile:<br />
Fazit:<br />
• Eine generelle Gefahr <strong>der</strong> bewussten Auswahlprüfung ist, dass das zu prüfende Unternehmen<br />
die Auswahlkriterien aufgrund von Erfahrungen aus vorangegangenen Prüfungen<br />
voraussieht und daher bewusste Fehler einfacher verdecken kann o<strong>der</strong> sogenannte<br />
Soll-Bruchstellen vorbereitet.<br />
• Gefahren birgt die bewusste Auswahlprüfung insoweit, als <strong>der</strong> Prüfer:<br />
1. z. B. nicht genügend Vorinformationen über die mutmaßliche Qualität des zu prüfenden<br />
Komplexes erlangt, o<strong>der</strong><br />
2. ein unpassendes Auswahlkriterium heranzieht und dadurch zu verzerrten Ergebnissen<br />
kommt, o<strong>der</strong><br />
3. zu viele o<strong>der</strong> zu wenige Elemente in die Prüfung einbezieht.<br />
Der Einsatz eines bewussten Auswahlverfahrens ist fallweise zu entscheiden. Anhaltspunkte<br />
geben die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen (GoA).<br />
88
Prüfungstheorie<br />
233.4 Zufallsgesteuerte Auswahlverfahren<br />
233.41 <strong>Grundlagen</strong><br />
233.411. Zufalls-(Urnen-) Modell<br />
Ausschließlich <strong>der</strong> Zufall entscheidet darüber, welche Untersuchungseinheiten in die Auswahl<br />
gelangen.<br />
Definitionen:<br />
Urnenmodell<br />
Zufallsauswahl: Jede Einheit <strong>der</strong> Grundgesamtheit hat die gleiche o<strong>der</strong> eine<br />
bestimmte berechenbare Chance, in die Stichprobe zu gelangen.<br />
Stichprobe: Menge <strong>der</strong> zufällig aus <strong>der</strong> Grundgesamtheit entnommenen<br />
Elemente.<br />
Stichprobenfehler: Differenz zwischen dem Kennwert einer Stichprobe und dem<br />
"tatsächlichen Wert" <strong>der</strong> Grundgesamtheit, aus <strong>der</strong> die<br />
Stichprobe gezogen wurde.<br />
Versuchsanordnung:<br />
- Eine Urne ist mit N gleich großen, gleich schweren idealen Kugeln gefüllt.<br />
- Die Kugeln unterscheiden sich lediglich durch äußerliche Merkmalsausprägungen:<br />
-- Unterschiedliche Farbaufdrucke (schwarz bzw. rot)<br />
⇒ qualitative Merkmalsausprägungen<br />
(Fehleranteilsstatistik/homograde Fragestellung)<br />
-- Aufgebrachte Zahlen<br />
⇒ quantitative Merkmalsunterschiede<br />
(Fehlerwertstatistik/heterograde Fragestellung)<br />
Übertragung auf ein Beispiel <strong>der</strong> Buchführung (entnommen aus: BUCHNER, R.,<br />
Stichprobenprüfung, Zufallsauswahl, in: HwRev 1992, Sp. 1897 f.):<br />
89
Prüfungstechnik<br />
Die Urne enthält die prüfungspflichtigen Geschäftsvorfälle (Belege) eines bestimmten<br />
Prüffeldes (z. B. For<strong>der</strong>ungen) mit N Belegen, von denen M Belege mit 0
Prüfungstheorie<br />
233.412. Voraussetzungen <strong>für</strong> eine Stichprobenprüfung<br />
Für die Anwendung stichprobengestützter Prüfungsmethoden nennt <strong>der</strong> HFA in<br />
Übereinstimmung mit <strong>der</strong> Prüfungsliteratur folgende Bedingungen:<br />
(Stellungnahme HFA 1/1988, Abschn. D II/III 1.b)/IV 3.)<br />
(1) Bestimmte Anfor<strong>der</strong>ungen an die Prüfbereitschaft des zu prüfenden Unternehmens,<br />
(2) hinreichend große Prüffel<strong>der</strong>,<br />
(3) homogene Prüffel<strong>der</strong> in Bezug auf die Fehler sowie<br />
(4) vorliegen von Informationen über das Prüfgebiet (in Bezug auf die Struktur und einzelne<br />
Parameter).<br />
Zu (1) Anfor<strong>der</strong>ungen an die Prüfbereitschaft<br />
Sachgerechte strukturelle Aufbereitung des Prüfgebiets und Abgrenzung <strong>der</strong><br />
Grundgesamtheit:<br />
Merkmale, die entwe<strong>der</strong> als Auswahlkriterien in Betracht kommen o<strong>der</strong> die selbst<br />
Prüfungsgegenstand sein können, müssen lückenlos und vollständig erfasst werden,<br />
Zweckmäßig gestaltetes und wirksames IKS erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Zugriffsbereitschaft <strong>der</strong> Daten<br />
Zu (2) Hinreichend große Prüffel<strong>der</strong><br />
Ein nicht entdeckter Fehler verliert <strong>für</strong> das Prüferurteil umso mehr an Gewicht, je<br />
umfangreicher das Prüffeld ist.<br />
⇒ Degressionseffekt!<br />
Der Prüfer kann den Umfang <strong>der</strong> Prüffel<strong>der</strong> nur teilweise beeinflussen:<br />
⇒ Unternehmensspezifische Faktoren (z. B. Größe, Branchenzugehörigkeit etc.)<br />
bestimmen die Prüffeldabgrenzung.<br />
Konten mit Massenverkehr (z. B. Konten des Zahlungs- und Warenverkehrs) eignen sich<br />
beson<strong>der</strong>s <strong>für</strong> Stichprobenprüfungen.<br />
91
Zu (3) Homogene Prüffel<strong>der</strong><br />
Prüfungstechnik<br />
Prüffeld muss in sachlicher, zeitlicher, personeller und örtlicher Hinsicht eindeutig<br />
abgegrenzt sein, damit ein objektiv repräsentatives Urteil über das gesamte Prüffeld aufgrund<br />
<strong>der</strong> Stichprobenergebnisse gefällt werden kann.<br />
Die Homogenitätsbedingung bezieht sich auf die gesuchten Fehler. Die Fehler in einem<br />
Prüffeld müssen von gleicher Art sein (gleiche Bedeutung <strong>für</strong> das Urteil des Prüfers).<br />
For<strong>der</strong>ung nach "Ausreißerfreiheit":<br />
"Vor Beginn <strong>der</strong> Stichprobenziehung sollte die Grundgesamtheit auf ihre Homogenität (in bezug<br />
auf die Fehler) [Ergänzung in runden Klammern durch den Verfasser] und auf Ausreißer hin<br />
untersucht werden." (Stellungnahme HFA, 1/1988, Abschn. D III 1. b))<br />
Zu (4) Informationen über das Prüfgebiet<br />
Der Einsatz statistischer Methoden setzt stets Vorkenntnisse über das Prüfgebiet voraus:<br />
Informationen über einzelne Parameter (z. B. erwarteter Fehleranteil) o<strong>der</strong> die Struktur<br />
des Prüfgebiets<br />
⇒ Voraussetzung <strong>für</strong> Wahl eines zweckmäßigen und wirtschaftlichen stichprobengestützten<br />
Prüfverfahrens<br />
Ohne konkrete Informationen kein Testverfahren anwendbar<br />
Quantifizierbare Vorinformationen erfor<strong>der</strong>lich<br />
Das Prüffeld kann Fehler enthalten:<br />
Häufigkeitsfehler:<br />
- Erfahrungsgemäß häufig auftretende Fehler mit relativ geringem Gewicht <strong>für</strong> das<br />
Prüferurteil,<br />
- Treten mit erwarteter Sicherheit auf und führen erst von einem bestimmten Umfang<br />
an zur Ablehnung <strong>der</strong> Ordnungsmäßigkeit des Prüffeldes.<br />
Stichprobenprüfungen sind anwendbar!<br />
92
Möglichkeitsfehler:<br />
Prüfungstheorie<br />
- Selten auftretende, gravierende Fehler,<br />
- Vorhandensein kann nicht mit quantifizierbarer Sicherheit angegeben werden,<br />
- Ermittlungspflicht (wegen großer Bedeutung).<br />
⇒ Bei Erwartung von Möglichkeitsfehlern: Vollprüfung erfor<strong>der</strong>lich!<br />
233.413. Verteilungsannahmen<br />
Annahme des Entnahmemodells "Ziehen ohne Zurücklegen" bei betriebswirtschaftlichen<br />
Prüfungen sinnvoll.<br />
Hypergeometrische Verteilung <strong>der</strong> Stichprobenfehleranteile<br />
Formel <strong>für</strong> die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Zahl fehlerhafter Elemente zu<br />
entdecken:<br />
W(m/P) =<br />
⎛ ⎞ ⎛ ⎞<br />
⎜ M ⎟ •⎜<br />
N - M ⎟<br />
⎜ ⎟ ⎜ ⎟<br />
⎝ m⎠<br />
⎝ n - m⎠<br />
, (m = 0,1,...n)<br />
⎛ ⎞<br />
⎜ N ⎟<br />
⎜ ⎟<br />
⎝ n⎠<br />
mit<br />
W = Wahrscheinlichkeit<br />
N = Umfang <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
n = Umfang <strong>der</strong> Stichprobe<br />
M = Anzahl <strong>der</strong> fehlerhaften Elemente in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
m = Anzahl <strong>der</strong> fehlerhaften Elemente in <strong>der</strong> Stichprobe<br />
P = M/N = Fehleranteil in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
Nachteil: großer Rechenaufwand<br />
Ohne EDV: Approximation <strong>der</strong> hypergeometrischen Verteilung durch an<strong>der</strong>e, einfacher<br />
zu handhabende Verteilungen<br />
⇒ Aber: Approximationsfehler!<br />
93
Prüfungstechnik<br />
Bestimmung <strong>der</strong> oberen Schätz- o<strong>der</strong> Vertrauensgrenze dominiert bei prüferischen<br />
Fragestellungen.<br />
Es wird <strong>der</strong> (obere) Fehleranteil im Prüffeld angegeben, <strong>der</strong> mit einer bestimmten<br />
Wahrscheinlichkeit (z. B. 95%iger Sicherheit) nicht überschritten wird. Der Prüfer<br />
betrachtet also primär die ungünstigen Fälle.<br />
Die folgende Übersicht aus v. Wysocki, <strong>Grundlagen</strong> des betriebswirtschaftlichen<br />
Prüfungswesens, 3. Aufl., 1988, S. 191 zeigt die in Kauf zu nehmenden<br />
Fehlschätzungen bei Verwendung unterschiedlicher Verteilungen.<br />
"Als Maßstab <strong>für</strong> die Bestimmung <strong>der</strong> jeweiligen Fehlschätzungen dienen dabei die auf<br />
<strong>der</strong> Grundlage des Modells <strong>der</strong> hypergeometrischen Verteilung gewonnenen<br />
Schätzergebnisse <strong>für</strong> die obere Schätzgrenze."<br />
Fall I Fall II Fall III Fall IV Fall V Fall VI Fall VII<br />
(1) Grundgesamtheit (N) 800 800 800 800 10.000 10.000 10.000<br />
(2) Stichprobenumfang (n) 200 100 100 100 200 100 100<br />
(3) Fehlerzahl in <strong>der</strong> Stichprobe (m) 1 1 5 10 1 1 5<br />
(4) Fehleranteil in <strong>der</strong> Stichprobe (p = m/n) 0,005 0,01 0,05 0,10 0,005 0,01 0,05<br />
(5) Auswahlsatz (n/N) 0,25 0,125 0,125 0,125 0,02 0,01 0,01<br />
(6) Obere Schätzgrenze (%)<br />
hypergeometrische Verteilung<br />
(7) Obere Schätzgrenze (%)<br />
Normalverteilung (t = 1,645)<br />
2,1100<br />
1,211<br />
4,4266<br />
2,532<br />
94<br />
9,8972<br />
8,356<br />
15,9733<br />
14,619<br />
2,3314<br />
1,312<br />
4,6379<br />
2,629<br />
10,1997<br />
(8) Relative Fehlschätzung -42,61% -42,80% -15,57% -8,48% -43,72% -43,31% -16,01%<br />
(9) Obere Schätzgrenze (%)<br />
Millot'sches Verfahren<br />
1,863<br />
4,027<br />
9,519<br />
15,585<br />
(10) Relative Fehlschätzung -10,76% -9,03% -3,82% -2,43% -6,37% -6,60% -3,09%<br />
(11) Obere Schätzgrenze (%)<br />
Poisson-Verteilung<br />
2,372<br />
4,744<br />
10,513<br />
16,962<br />
2,183<br />
2,372<br />
4,332<br />
4,744<br />
8,567<br />
9,885<br />
10,513<br />
(12) Relative Fehlschätzung +12,42 +7,17% +6,22% +6,19% +1,74% +2,2% +3,07%<br />
(13) Obere Schätzgrenze<br />
Binominalverteilung o. Endlichkeitskorr.<br />
2,350<br />
4,656<br />
10,225<br />
16,372<br />
2,350<br />
4,656<br />
10,225<br />
(14) Relative Fehlschätzung +11,37 +5,18% +3,31% +2,50% +0,80% +0,39% +0,25%<br />
(15) Obere Schätzgrenze<br />
Binominalverteilung m. Endlichkeitskorr.<br />
2,103<br />
4,422<br />
9,891<br />
15,964<br />
2,331<br />
4,637<br />
10,199<br />
(16) Relative Fehlschätzung -0,33% -0,10% -0,06% -0,06% -0,02% -0,02% -0,01%
Prüfungstheorie<br />
Beson<strong>der</strong>heit im Bereich des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens: Nur sehr geringe<br />
noch tolerable Fehleranteile!<br />
⇒ Konsequenzen <strong>für</strong> die anwendbaren Wahrscheinlichkeitsverteilungen:<br />
Binomialverteilung:<br />
⇒ rechnerisch aufwendig<br />
Normalverteilung:<br />
⇒ Scheidet i. d. R. aus, da nicht o<strong>der</strong> nur bei einem unverhältnismäßig<br />
großen Stichprobenumfang vertretbar (da in praxi mit verhältnismäßig<br />
geringen Fehleranteilswerten gerechnet werden muss)<br />
⇒ Approximationsbedingungen:<br />
n P (1-P) > 9; N > 2n<br />
Poisson-Verteilung:<br />
⇒ Entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten bei Buchprüfungen am<br />
besten.<br />
⇒ Approximationsbedingungen:<br />
n > 10; P < 0,05 und n/N < 0,05<br />
In <strong>der</strong> Praxis i. d. R. erfüllt<br />
große Bedeutung<br />
233.42 Arten <strong>der</strong> Stichprobenauswahl<br />
233.421. Einfache Stichprobenauswahl<br />
Jedes Element hat die gleiche Chance, in die Stichprobe zu gelangen<br />
⇒ "Zufallsauswahl mit gleichen Auswahlwahrscheinlichkeiten"<br />
Techniken <strong>der</strong> einfachen Stichprobenauswahl:<br />
Es wird zwischen <strong>der</strong> „echten“ und <strong>der</strong> „unechten“ Zufallsauswahl unterschieden:<br />
"Echte Zufallsauswahl": Sämtliche Stichprobenelemente werden durch Los aus <strong>der</strong><br />
Grundgesamtheit gezogen (vgl. Urnenmodell).<br />
⇒ da Losverfahren sehr aufwendig, Auswahl mittels Zufallszahlentabellen/-<br />
Zufallszahlengenerator.<br />
95
Prüfungstechnik<br />
Beispiel <strong>für</strong> die Auswahl mit Hilfe einer Zufallszahlentabelle:<br />
Aus einer Grundgesamtheit von 9.000 fortlaufend (bei 1 beginnend) numerierten<br />
Belegen sollen 75 Belege zufällig ausgewählt werden.<br />
Auszug aus einer Zufallszahlentabelle:<br />
........<br />
Spalte →<br />
Zeile ↓<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(20) 75480 41978 6739 89183 47745 44222 59689<br />
(21) 53196 50587 16244 67041 48115 95420 896<br />
(22) 15210 67526 96801 59503 95869 75112 52992<br />
(23) 99051 89444 10550 36940 35347 65787 66015<br />
(24) 47594 88275 92401 34942 46830 16831 57209<br />
(25) 13012 99382 40172 66854 415 24965 98700<br />
(26) 75675 40253 30372 48467 94443 50351 67878<br />
(27) 13347 26623 1555 76820 31467 64988 91442<br />
(28) 51144 60320 52156 81094 13480 72198 20980<br />
(29) 27743 17266 34551 5765 54542 86301 45472<br />
(30) 85760 28078 31699 62333 54691 58938 58996<br />
(31) 78144 56872 47198 19352 5752 93543 48753<br />
(32) 99127 3092 36116 20140 24253 83450 34831<br />
(33) 38312 71241 34490 31423 31944 98899 46290<br />
(34) 41883 36422 88713 22431 61871 87530 55611<br />
(35) 63794 27511 97056 30662 4360 62053 84777<br />
1. Schritt: Die zu prüfenden Belege sind fortlaufend zu numerieren.<br />
96<br />
(4)<br />
2. Schritt: An einer beliebigen Stelle in <strong>der</strong> Tabelle mit Zufallsauswahl beginnen (z. B.<br />
Zeile 22, Spalte 1: 15210).<br />
3. Schritt: In horizontaler Richtung nach rechts o<strong>der</strong> in vertikaler Richtung nach unten<br />
z. B. jeweils die vier rechtsstehenden Ziffern notieren:<br />
- bei horizontalem Vorgehen:<br />
5210, 7526, 6801, X, 5869, 5112, 2992, ...<br />
- bei vertikalem Vorgehen:<br />
5210, X, 7594, 3012, 5675, 3347, ...<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)
Prüfungstheorie<br />
- Ziffern, die nicht in den Auswahlbereich 1 bis 9.000 fallen, bleiben<br />
unberücksichtigt (=X).<br />
4. Schritt: Ausgewählte Ziffern in aufsteigen<strong>der</strong> Reihenfolge sortieren.<br />
"Unechte Zufallsauswahl": Nur das erste Element <strong>der</strong> Stichprobe wird streng<br />
zufällig ausgewählt, die weiteren n-1<br />
Stichprobenelemente werden systematisch abhängig<br />
von <strong>der</strong> ersten Auswahleinheit gezogen.<br />
Mögliche Verfahren:<br />
- Einbeziehung jedes x-ten Elements mit x = N/n,<br />
- Schlussziffernverfahren,<br />
- Auswahl nach Anfangsbuchstaben und<br />
- Auswahl nach Geburtstagen.<br />
Nur anwendbar, wenn mit Sicherheit kein Zusammenhang zwischen Auswahlkriterium<br />
und zu prüfenden Untersuchungsmerkmalen besteht.<br />
233.422. Geschichtete Auswahl<br />
Bei nicht erfüllter Homogenitätsbedingung bezüglich <strong>der</strong> Fehleranfälligkeit <strong>der</strong><br />
Prüfelemente in einem Prüffeld:<br />
Zerlegung des Prüffelds in homogenere Teilmengen (sog. Schichten), Anwendung <strong>der</strong><br />
Stichprobenverfahren jeweils auf diese Schichten.<br />
Urnenmodell: mehrere Urnen<br />
Elemente werden nicht mehr mit den gleichen, aber immer noch mit berechenbaren<br />
Wahrscheinlichkeiten geprüft.<br />
"Zufallsauswahl mit ungleichen Auswahlwahrscheinlichkeiten"<br />
Schichtungseffekt <strong>der</strong> Prüfung:<br />
Positiver Schichtungseffekt: Erfor<strong>der</strong>licher (Gesamt-) Stichprobenumfang wird<br />
bei gleicher Urteilsqualität kleiner.<br />
97
Prüfungstechnik<br />
Negativer Schichtungseffekt: Mehrarbeit durch die Schichtenbildung<br />
Probleme, die einen erhöhten Planungsaufwand verursachen:<br />
1. Wahl geeigneter Schichtungsmerkmale,<br />
2. Bestimmung <strong>der</strong> Zahl zu bilden<strong>der</strong> Schichten und<br />
3. Zuteilung <strong>der</strong> Elemente zu den gebildeten Schichten.<br />
Zu 1. Wahl geeigneter Schichtungsmerkmale<br />
- (Gesamt-) Stichprobenumfang wird bei gleicher Urteilsqualität umso kleiner,<br />
-- je homogener die Untersuchungselemente innerhalb einer Schicht und<br />
-- je heterogener die Schichten zueinan<strong>der</strong> sind.<br />
⇒ Auswahl von Untersuchungsmerkmalen, die gleiche Fehlerhäufigkeiten<br />
erwarten lassen.<br />
- Beispiele <strong>für</strong> geeignete Untersuchungsmerkmale:<br />
-- Zeitraum <strong>der</strong> Belegerstellung,<br />
-- Höhe <strong>der</strong> Belegsumme o<strong>der</strong><br />
-- möglicher Manipulationsspielraum.<br />
Zu 2. Zahl zu bilden<strong>der</strong> Schichten<br />
Aufteilung in möglichst wenige (i. d. R. drei o<strong>der</strong> vier) Schichten, denn<br />
- überproportionaler Anstieg <strong>der</strong> Mehrarbeit <strong>für</strong> den Prüfer mit je<strong>der</strong> zusätzlichen<br />
Schicht,<br />
- nur unwesentliche Abnahme des erfor<strong>der</strong>lichen Stichprobenumfangs mit<br />
steigen<strong>der</strong> Schichtenzahl.<br />
Zu 3. Zuteilung <strong>der</strong> Elemente zu den gebildeten Schichten<br />
- Jedes Element ist nach seiner betreffenden Merkmalsausprägung einer <strong>der</strong><br />
Schichten zuzuordnen.<br />
98
Prüfungstheorie<br />
Alternative zur geschichteten Auswahl: Klumpenauswahl<br />
Die Grundgesamtheit wird so in Teilmengen (Klumpen) zerlegt, dass <strong>der</strong> Prüfungsstoff<br />
innerhalb jedes Klumpens hinsichtlich des erwarteten Fehleranteils möglichst repräsentativ<br />
<strong>für</strong> die Grundgesamtheit ist.<br />
"Benachbarte" Geschäftsvorfälle, z. B. alle Vorgänge eines Tages o<strong>der</strong> alle<br />
Rechnungen eines Verkaufsbezirks, werden zu Klumpen zusammengefasst.<br />
Klumpen müssen in sich möglichst heterogen, untereinan<strong>der</strong> dagegen möglichst<br />
homogen sein.<br />
Klumpeneffekt <strong>der</strong> Prüfung:<br />
- Positiver Klumpeneffekt:<br />
Nur geringe Auswahlkosten, da Auswahl <strong>der</strong> einzelnen Prüfungselemente sehr einfach<br />
und bequem.<br />
- Negativer Klumpeneffekt:<br />
I. d. R. größere Zahl zu prüfen<strong>der</strong> Untersuchungseinheiten, d. h. höhere Kosten <strong>der</strong><br />
Prüfung. Die Abgrenzung homogener Klumpen bereitet große Schwierigkeiten.<br />
Klumpenauswahl erfor<strong>der</strong>t sorgfältige Planung!<br />
233.423. Wertproportionale Auswahl<br />
Verfeinerung <strong>der</strong> einfachen Stichprobenauswahl, bei <strong>der</strong> Auswahleinheit und<br />
Untersuchungseinheit nicht übereinstimmen.<br />
Annahme: Positionen mit hohem Buchwert enthalten tendenziell auch höhere Fehler.<br />
⇒ Betrags- bzw. wertproportionale Auswahlwahrscheinlichkeit <strong>der</strong> Stichprobenelemente trägt<br />
<strong>der</strong> großen Bedeutung hoher Beträge <strong>für</strong> das Prüferurteil Rechnung.<br />
99
Prüfungstechnik<br />
"Sampling with Probability Proportional to Size" = "PPS"<br />
Verfahren innerhalb des PPS-Sampling:<br />
"Dollar-Unit Sampling" (DUS) o<strong>der</strong> "Monetary-Unit Sampling" (MUS):<br />
Als Elemente <strong>der</strong> Grundgesamtheit werden die einzelnen Dollar-(o<strong>der</strong> EUR-) Einheiten<br />
des kumulierten Gesamtbetrages einer For<strong>der</strong>ung betrachtet.<br />
⇒ Beispiel:<br />
Eine 1.000 EUR-For<strong>der</strong>ung ist in 1.000 Ein-EUR-Beträge als Auswahleinheiten<br />
aufzuteilen. Eine For<strong>der</strong>ung von 10.000 EUR ist in 10.000 Ein-EUR-<br />
Beträge aufzuteilen und besitzt im Vergleich zu einer For<strong>der</strong>ung über 1.000<br />
EUR die 10-fache Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe zu gelangen.<br />
⇒ "Große" Beträge:<br />
Vollerhebung aller „A-Fälle“ (Konzentrationsauswahl nach ABC-Analyse)<br />
⇒ "Normale" Beträge:<br />
Teilerhebung mittels DUS<br />
Problem bei <strong>der</strong> betragsproportionalen Auswahl:<br />
Betragsproportionalität zum Buchwert<br />
- Bei überbewerteten Positionen: Die zu hoch bewerteten Werte haben fälschlich eine<br />
höhere Auswahlwahrscheinlichkeit als die richtig bewerteten. Das Stichprobenurteil<br />
überschätzt den tatsächlichen Fehler.<br />
- Bei unterbewerteten Positionen: Die zu niedrig bewerteten Werte haben fälschlich<br />
eine geringere Chance als die richtig bewerteten Posten, ausgewertet zu werden. Das<br />
Stichprobenurteil unterschätzt den tatsächlichen Fehler.<br />
Anwendung des DUS, wenn <strong>der</strong> Prüfer eher überbewertete Buchwerte erwarten<br />
muss.<br />
Gefahr: Wesentliche Unterbewertungen von Beständen bleiben im Rahmen <strong>der</strong><br />
Prüfung unentdeckt. Daher evtl. vorher Prüfung/Beurteilung <strong>der</strong><br />
wirtschaftlichen Lage und Vorstichprobe bzgl. Über-/Unterbewertung.<br />
100
Prüfungstheorie<br />
233.424. Mehrstufige Stichprobenauswahl<br />
Stichprobenumfang ergibt sich erst aufgrund <strong>der</strong> Prüfungsergebnisse.<br />
Oft reicht die Ziehung weniger Elemente bereits <strong>für</strong> ein Urteil über die Einhaltung <strong>der</strong><br />
zulässigen Fehlerrisiken aus, z. B. wenn die ersten gezogenen Stichprobenelemente<br />
bereits überwiegend fehlerhaft sind.<br />
Vorteil: I. d. R. geringerer Stichprobenumfang erfor<strong>der</strong>lich als bei den Verfahren mit<br />
vorgegebenem Stichprobenumfang (ASN-Curve).<br />
Hierbei Unterscheidung in:<br />
Offene Verfahren<br />
⇒ Maximaler Prüfungsumfang ist nicht bekannt.<br />
Geschlossene Verfahren<br />
⇒ Es ist bekannt, nach wie vielen Prüfelementen spätestens ein Urteil vorliegen<br />
wird.<br />
Das offene Sequentialtestverfahren geht auf Abraham Wald zurück und wird hier kurz<br />
erläutert. Die folgende Abbildung ist entnommen aus LEFFSON/LIPPMANN/BAETGE, S.<br />
63:<br />
x<br />
FehlerhafteStichprobenelemente<br />
+ 3,3759<br />
- 4,0856<br />
0<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
I Rückweisungs- o<strong>der</strong><br />
Ablehnungsbereich<br />
II Weiterprüfungsbereich<br />
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150<br />
Zahl <strong>der</strong> gezogenen<br />
Stichprobenelemente<br />
x c = - 4,0856 + 0,0328 n<br />
x r = 3,3759 + 0,0328 n<br />
Abb. 17: Graphik eines sequentiellen offenen Stichprobenplans<br />
101<br />
III Annahmebereich<br />
n
Prüfungstechnik<br />
Parameter zur Berechnung <strong>der</strong> Annahme- und Ablehnungsgeraden:<br />
P 0 = Fehleranteil, bei dem das Prüffeld uneingeschränkt als ordnungsmäßig<br />
angesehen werden kann,<br />
P 1 = Fehleranteil, von dem ab die Ordnungsmäßigkeit des Prüffeldes zu verneinen<br />
ist,<br />
β = Zulässiges Auftraggeberrisiko,<br />
α = Zulässiges Prüferrisiko.<br />
Annahme- und Ablehnungsgeraden werden durch folgende Gleichungen definiert:<br />
x r = h 1 +sn<br />
x c = -h 0 + sn<br />
mit: x r = Ablehnungskennzahl<br />
x c = Annahmekennzahl<br />
Bei genügend großer Grundgesamtheit lässt sich <strong>der</strong> Bestimmung <strong>der</strong> Werte <strong>für</strong> s, h 0<br />
und h 1 die Binomialverteilung zugrunde legen, so dass sich folgende Ausdrücke<br />
ergeben:<br />
s =<br />
h 0 =<br />
h 1 =<br />
1- P<br />
1- P<br />
P<br />
P -<br />
0<br />
log<br />
1<br />
1 1- P<br />
log log<br />
0 1- P<br />
1-<br />
P<br />
P -<br />
α<br />
log<br />
β<br />
1 1- P<br />
log log<br />
0 1- P<br />
1-<br />
P<br />
P -<br />
α<br />
log<br />
β<br />
1 1- P<br />
log log<br />
0 1- P<br />
102<br />
1<br />
0<br />
1<br />
0<br />
1<br />
0
Vorgehensweise:<br />
Prüfungstheorie<br />
Berechnung <strong>der</strong> Annahme- und <strong>der</strong> Ablehnungsgeraden aus den vier genannten<br />
Parametern<br />
Ziehen und Auswerten kleiner Gruppen von Stichprobenelementen<br />
Überprüfung nach je<strong>der</strong> Ziehung, ob das insoweit erreichte Ergebnis schon ein<br />
Prüfurteil zulässt:<br />
- Stichprobenpunkt liegt mit dem bisherigen Stichprobenumfang innerhalb des<br />
Bereichs <strong>der</strong> beiden Geraden (Weiterprüfungsbereich)<br />
Ziehen eines weiteren Stichprobenloses<br />
- Stichprobenpunkt liegt außerhalb des Weiterprüfungsbereichs<br />
Praxis: Formeln zu kompliziert<br />
Prüffeld wird als ordnungsmäßig o<strong>der</strong> materiell fehlerhaft betrachtet<br />
Tabellen mit Annahme- und Ablehnungszahlen<br />
Zahl <strong>der</strong> <strong>für</strong> eine Annahme o<strong>der</strong> Ablehnung des Prüfungsfeldes notwendigen fehlerhaften Elemente<br />
mit den Testhypothesen: mit den vorgegebenen Risiken:<br />
p 0 = 0,02; p 1 = 0,05 p 0 = 0,02; p 1 = 0,04<br />
Stichprobenumfang<br />
n<br />
25<br />
50<br />
75<br />
100<br />
125<br />
150<br />
175<br />
.<br />
.<br />
.<br />
475<br />
500<br />
Annahmekennzahl<br />
x c<br />
0,01<br />
0,83<br />
1,65<br />
.<br />
.<br />
.<br />
11,50<br />
12,32<br />
103<br />
Ablehnungskennzahl<br />
x r<br />
4,19<br />
5,01<br />
5,83<br />
6,65<br />
7,47<br />
8,29<br />
9,11<br />
.<br />
.<br />
.<br />
18,96<br />
19,78
Prüfungstechnik<br />
Je mehr <strong>der</strong> Fehleranteil eines Prüffeldes von dem <strong>für</strong> ein ordnungsmäßiges bzw. nicht<br />
ordnungsmäßiges Prüffeld relevanten Fehleranteil abweicht, desto leichter ist die<br />
Einordnung möglich.<br />
Beim offenen Sequentialtest: Eventuell sehr großer Prüfungsumfang, wenn Stichprobenpunkte<br />
Weiterprüfungsbereich nicht verlassen.<br />
⇒ Einführung eines zusätzlichen Abbruchkriteriums, z. B. maximal so viele Elemente<br />
wie beim nicht-sequentiellen Verfahren.<br />
233.43 Fragestellungen bei Stichprobenprüfungen<br />
233.431. Überblick<br />
Homograde Fragestellung:<br />
Schätzung von Fehleranteilen steht bei <strong>der</strong> IKS/IÜS-Prüfung im Mittelpunkt<br />
(Fehleranteils-Statistik).<br />
Elemente <strong>der</strong> gesamten Untersuchungsmasse werden nur danach beurteilt, ob sie<br />
eine bestimmte Eigenschaft (Fehler) besitzen o<strong>der</strong> nicht.<br />
⇒ Basis zur Schätzung des Fehleranteils: Zahl <strong>der</strong> gefundenen fehlerhaften im<br />
Verhältnis zur Zahl aller Elemente.<br />
Beurteilung durch den Prüfer i. d. R. unproblematisch.<br />
Heterograde Fragestellung:<br />
Schätzung von Durchschnittswerten <strong>der</strong> Elemente <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
(Fehlerwert-Statistik).<br />
Anwendungsfälle z. B.:<br />
- Nachprüfen von Beständen,<br />
- Ermittlung des Grades von Soll-Ist-Abweichungen.<br />
104
Prüfungstheorie<br />
Bedeutung homogra<strong>der</strong>/heterogra<strong>der</strong> Fragestellungen <strong>für</strong> den Prüfer:<br />
Beide Fragestellungen sind gleich wichtig.<br />
Systemprüfung:<br />
⇒ Homograde Fragestellung!<br />
Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen (Ergebnisprüfung):<br />
⇒ Heterograde Fragestellung!<br />
Unterscheidung <strong>der</strong> Stichproben nach den aus den Stichprobenergebnissen zu<br />
ziehenden Schlüssen:<br />
Schätzstichprobe:<br />
- Schätzung <strong>der</strong> Ausprägungen einzelner urteilsrelevanter Merkmale des<br />
Prüffeldes.<br />
- Liefert keine Entscheidungsregel, son<strong>der</strong>n Informationen als Grundlage <strong>für</strong><br />
komplexere Urteilsbildung.<br />
- Typische Fälle:<br />
-- Rückschluss von dem in einer Stichprobe vorgefundenen Anteil<br />
fehlerhafter Elemente auf den Anteil fehlerhafter Elemente in <strong>der</strong><br />
Grundgesamtheit (homograde Frage = Fehleranteil?).<br />
-- Rückschluss von <strong>der</strong> Zahl und <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> in einer Stichprobe<br />
gefundenen Abweichungen (Fehler) auf die entsprechenden Fehler-<br />
Durchschnittswerte (heterograde Frage = Fehlerwert?).<br />
Annahmestichprobe (Hypothesentest):<br />
- Unmittelbare Entscheidung über Annahme o<strong>der</strong> Ablehnung des Prüffeldes<br />
anhand <strong>der</strong> Stichprobe.<br />
- Vorgabe bestimmter Hypothesen über die Fehlerbehaftung des Prüfungsfeldes,<br />
Stichprobenergebnis dient <strong>der</strong> Ermittlung einer diesbzgl. Entscheidungsregel!<br />
⇒ Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk.<br />
105
Entdeckungsstichprobe:<br />
Prüfungstechnik<br />
- Berechnung <strong>der</strong> Entdeckungswahrscheinlichkeiten von fehlerhaften Elementen<br />
in <strong>der</strong> Grundgesamtheit.<br />
⇒ Unterschlagungsprüfung.<br />
Die folgende Tabelle zeigt mögliche Kombinationen von Fragestellungen:<br />
Nach Fehleranteil<br />
o<strong>der</strong><br />
Fehlerwert<br />
↓<br />
Homograde<br />
Heterograde<br />
Nach <strong>der</strong> Auswertung<br />
des<br />
Stichprobenergebnisses<br />
→<br />
Schätzstichprobe Annahmestich-<br />
probe<br />
Wie groß ist <strong>der</strong><br />
Fehleranteil in <strong>der</strong><br />
Grundgesamtheit,<br />
wenn in <strong>der</strong> Stichprobe<br />
ein bestimmter<br />
Anteil gefunden<br />
wird?<br />
Welche Höhe hat <strong>der</strong><br />
durchschnittliche<br />
Wertansatz des Prüffeldes,<br />
wenn ein bestimmter<br />
Mittelwert<br />
in <strong>der</strong> Stichprobe gefunden<br />
wurde?<br />
106<br />
Nach welchen Kriterien<br />
kann <strong>der</strong> Prüfer aufgrund<br />
<strong>der</strong> Auswertung<br />
<strong>der</strong> Fehleranteile einer<br />
Stichprobe das Prüffeld<br />
a) akzeptieren,<br />
b) ablehnen?<br />
Nach welchen Kriterien<br />
kann <strong>der</strong> Prüfer aufgrund<br />
<strong>der</strong> Auswertung<br />
<strong>der</strong> Wertansätze einer<br />
Stichprobe das Prüffeld<br />
a) akzeptieren,<br />
b) ablehnen?<br />
Entdeckungsstichprobe<br />
Mit welcher Wahrscheinlichkeit<br />
wird<br />
<strong>der</strong> Prüfer ein (kein)<br />
fehlerhaftes Element<br />
in <strong>der</strong> Stichprobe<br />
finden?
Prüfungstheorie<br />
233.432. Die Schätzstichprobe bei heterogra<strong>der</strong> Fragestellung<br />
Typische Anwendungsfälle heterogra<strong>der</strong> Schätzstichproben sind z. B.<br />
- Schätzung des Ausfallrisikos von For<strong>der</strong>ungen,<br />
- Schätzung <strong>der</strong> Risikovorsorge <strong>für</strong> Kredite im Massenkreditgeschäft,<br />
- Stichprobeninventur nach § 241 Abs. 1 dHGB bzw. § 192 Abs. 4 UGB.<br />
Der Gesamtwert kann mit einer Mittelwertschätzung geschätzt werden.<br />
Darstellung <strong>der</strong> einfachen Mittelwertschätzung:<br />
Das arithmetische Mittel <strong>der</strong> Stichprobe (x) dient als Schätzwert <strong>für</strong> den Mittelwert <strong>der</strong><br />
Grundgesamtheit (μ). Der Schätzfehler (e) kann unter bestimmten Voraussetzungen<br />
berechnet werden. Der Vertrauensbereich (Konfidenzintervall) <strong>der</strong> Schätzung ergibt<br />
sich zu:<br />
μ = x ± e<br />
Bei normalverteilter Grundgesamtheit bzw. genügend großem Stichprobenumfang<br />
n (Faustregel: n > 30) können wir den Stichprobenfehler (e) wie folgt berechnen:<br />
e = t⋅<br />
Legende:<br />
∃ σ ∃<br />
x σ x<br />
s N−n ; mit =<br />
n n − 1<br />
t Vielfaches <strong>der</strong> Standardabweichung (abhängig von<br />
<strong>der</strong> gewünschten Sicherheit <strong>der</strong> Aussage)<br />
s Standardabweichung <strong>der</strong> Stichprobe<br />
N Umfang <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
σ Standardabweichung <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />
n Umfang <strong>der</strong> Stichprobe<br />
e Schätzfehler<br />
^<br />
σ -x Geschätzte Standardabweichung <strong>der</strong> Grundgesamtheit auf<br />
Basis <strong>der</strong> Standardabweichung <strong>der</strong> Stichprobe<br />
107
Prüfungstechnik<br />
Die Wahrscheinlichkeit <strong>für</strong> das Konfidenzintervall <strong>für</strong> das arithmetische Mittel <strong>der</strong><br />
Grundgesamtheit ergibt sich als:<br />
Legende:<br />
Wx ( −t∃ σ x ≤ μ ≤ + t∃<br />
σ x)<br />
= ( 1 − α)<br />
W Wahrscheinlichkeit bzw. Aussagesicherheit<br />
(1-α) Sicherheitsgrad<br />
Da die Standardabweichung <strong>der</strong> Grundgesamtheit (σ) unbekannt ist, muss σ<br />
geschätzt werden. Als Schätzwert <strong>für</strong> σ verwenden wir die Standardabweichung <strong>der</strong><br />
Stichprobe (s).<br />
Der Korrekturfaktor <strong>für</strong> endliche Gesamtheiten kann weggelassen werden, wenn<br />
n/N < 0,05.<br />
Einer Wahrscheinlichkeit bzw. einem Sicherheitsgrad von 95 % entspricht das<br />
folgende Konfidenzintervall:<br />
Beispiel (entnommen aus V. WYSOCKI, <strong>Grundlagen</strong> des betriebswirtschaftlichen<br />
Prüfungswesens, 3. Aufl., 1988, S. 227):<br />
W (x - 1, 96 s<br />
n<br />
≤ ≤ μ<br />
s<br />
x + 1,96 ) = 95 %<br />
n<br />
Aus einer Grundgesamtheit von N = 4.000 Elementen wird eine Stichprobe mit einem<br />
Umfang von n = 100 Elementen zufällig ausgewählt. In <strong>der</strong> Stichprobe werden die<br />
folgenden Merkmalswerte festgestellt:<br />
Merkmalswerte 40 50 55 60 65 70 75<br />
Häufigkeiten 5 10 20 30 15 15 5<br />
Für das arithmetische Mittel und die Varianz dieser Stichprobe erhalten wir:<br />
2<br />
x = 60 und s = 65.<br />
108
Prüfungstheorie<br />
Da n/N = 0,025 < 0,05 und n > 30, können wir die Normalverteilung anwenden und<br />
den Korrekturfaktor vernachlässigen.<br />
Wir erhalten <strong>für</strong> eine Aussagesicherheit von 95 % einen Stichprobenfehler von e =<br />
1,58.<br />
e = 1,96 s<br />
2<br />
n<br />
= 1,96 65<br />
100<br />
109<br />
= 1,96 × 0,806 = 1,58.<br />
Für den Gesamtwert <strong>der</strong> Grundgesamtheit erhalten wir:<br />
W [(60 - 1, 58) 4.000 ≤ μ N ≤ (60 + 1, 58) 4.000] = 95 %<br />
W [ 233.680 ≤ μN<br />
≤ 246.320 ] = 95 %.<br />
Interpretation: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % liegt <strong>der</strong> Wert <strong>der</strong> Elemente<br />
in <strong>der</strong> Grundgesamtheit zwischen 233.680 und 246.320.<br />
233.5 Vergleich <strong>der</strong> Auswahlverfahren<br />
Vorzüge und Nachteile <strong>der</strong> systematisch gesteuerten und <strong>der</strong> zufallsgesteuerten<br />
Auswahlverfahren liegen auf so unterschiedlichen Ebenen, dass eine Beurteilung ihrer<br />
Zweckmäßigkeit nur nach Maßgabe <strong>der</strong> jeweiligen Prüfungssituation erfolgen kann.<br />
Beurteilung <strong>der</strong> Verfahren:<br />
Vorliegen von Vorinformationen:<br />
- Systematisch gesteuerte Auswahlverfahren können explizit die Vorinformationen<br />
nutzen,<br />
- zufallsgesteuerte Auswahlverfahren können die Vorinformationen nur begrenzt<br />
einbinden (Schichtenbildung).<br />
Repräsentanz <strong>der</strong> Stichprobe:<br />
- Bei systematisch gesteuerten Auswahlverfahren ist die Auswahl <strong>der</strong> Elemente<br />
nach Art und Umfang bewusst so anzulegen, dass möglichst sämtliche in dem<br />
Prüfgebiet vorhandenen wesentlichen Fehler bzw. sämtliche <strong>für</strong> das Prüfungsurteil<br />
wesentlichen Elemente in die Auswahl gelangen.<br />
⇒ Subjektive Repräsentanz, d. h. keine Quantifizierung <strong>der</strong> erreichten<br />
Sicherheit und Genauigkeit des Urteils möglich.
Prüfungstechnik<br />
- Bei Anwendung <strong>der</strong> Verfahren <strong>der</strong> zufallsgesteuerten Auswahl werden die<br />
Elemente nach Art und Umfang unbewusst (zufällig) ausgewählt.<br />
Objektive Repräsentanz, d. h. eine Quantifizierung <strong>der</strong> erreichten<br />
Sicherheit und Genauigkeit des Urteils ist möglich.<br />
Problem: Nicht in die Zufallsstichprobe gelangte fehlerhafte Elemente<br />
müssen zunächst unkorrigiert bleiben, da sie mit Hilfe des<br />
Zufallsauswahlverfahrens nicht gezielt lokalisiert werden<br />
können. Falls Vorwissen über einzelne fehlerhafte Elemente<br />
vorliegt, darf es nicht <strong>für</strong> die Zufallsauswahl verwandt<br />
werden. Vorwissen über das Prüffeld ist <strong>für</strong> die Berechnung<br />
des erfor<strong>der</strong>lichen Stichprobenumfanges heranzuziehen.<br />
Für alle Verfahren gilt als Voraussetzung <strong>der</strong> Anwendung: Dokumentation <strong>der</strong><br />
Argumentation <strong>für</strong> jeweilige Verfahren.<br />
Zusammenfassung<br />
Die systematische Auswahl typischer Fälle hat sich bei Systemprüfungen bewährt;<br />
bei Verdacht auf systematische Fehler ist gezielt nach weiteren Fehlern zu suchen.<br />
Die systematische Auswahl kommt vor allem auch <strong>für</strong> Prüfgebiete in Betracht, die<br />
überschaubar sind und bei denen deshalb mögliche Quellen wesentlicher Fehler<br />
o<strong>der</strong> die <strong>für</strong> das Prüfungsurteil bedeutsamen Prüffälle gezielt untersucht werden<br />
können.<br />
Die Zufallsauswahl erweist dann ihre Vorzüge, wenn es an geeigneten Vorinformationen<br />
<strong>für</strong> eine subjektive Auswahl fehlt und wenn es sich bei dem<br />
Prüfgebiet um relativ homogene Massenvorgänge handelt; sie führt zu einer Objektivierung<br />
des Stichprobenergebnisses.<br />
110
Prüfungstheorie<br />
233.6 Die Bedeutung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Auswahlprüfung <strong>für</strong> die Bildung des Gesamturteils<br />
Planung und Durchführung <strong>der</strong> Abschlussprüfung einschließlich <strong>der</strong> Auswahlprüfung<br />
ist ein kontinuierlicher und interdependenter Prozess.<br />
Ziele des planmäßigen Prüfungsvorgehens sind:<br />
Die Ermöglichung einer sicheren Beurteilung <strong>der</strong> Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit<br />
<strong>der</strong> Rechnungslegung und<br />
die Aufdeckung und damit das Ausschließen von Fehlern von wesentlicher<br />
Bedeutung <strong>für</strong> das Gesamturteil.<br />
Determinanten des Fehlerrisikos:<br />
Inhärentes Risiko,<br />
Internes Kontrollsystem des geprüften Unternehmens zur Begrenzung des Fehlerrisikos<br />
(Kontrollrisiko),<br />
IKS-Prüfung und -Beurteilung bestimmen die Zielrichtung und den Umfang weiterer<br />
Prüfungshandlungen,<br />
Globale analytische Untersuchungen können Hinweise auf wesentliche Fehlermöglichkeiten<br />
ergeben.<br />
⇒ Ergebnis: Vorkenntnisse <strong>für</strong> die Einzelfallprüfung.<br />
Mit Einzelfallprüfungen kann das Risiko, dass durch Kontrollmaßnahmen nicht<br />
verhin<strong>der</strong>te Fehler von wesentlicher Bedeutung unentdeckt bleiben, mit einer hohen<br />
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.<br />
Aber: Absolute Sicherheit ist bei den im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong> erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Auswahlprüfungen nicht zu erreichen.<br />
Zur Bildung des Gesamturteils über den Jahresabschluss (Bestätigungsvermerk) hat <strong>der</strong><br />
Abschlussprüfer die Einzelergebnisse seiner Prüfungshandlungen in ihrer absoluten und<br />
relativen Bedeutung sachgerecht zu würdigen (subjektive Urteilsbildung).<br />
111
24 Prüfungsinstrumente<br />
241. Prüfungshandbücher<br />
Prüfungstechnik<br />
Prüfungshandbücher sind alle Aufzeichnungen, die dazu dienen, den Prüfungsprozess zu<br />
planen, zu realisieren und zu dokumentieren bzw. Hilfestellung bei fachlichen<br />
Fragestellungen zu geben.<br />
Inhalt <strong>der</strong> Prüfungshandbücher:<br />
• Standardprüfprogramme,<br />
• Arbeitspapier-Formulare und<br />
• Verweise auf Fallsammlungen.<br />
241.1 Standardprüfprogramme<br />
Standardisierte Prüfprogramme sind <strong>für</strong> einen typischen Prüfungsauftrag entwickelte<br />
Prüfungsanweisungen, die eine genaue Beschreibung <strong>der</strong> jeweiligen<br />
(1) Prüfungsziele,<br />
(2) Prüfungsaufgaben und<br />
(3) Prüfungshandlungen<br />
enthalten.<br />
Ein standardisiertes Prüfprogramm muss von dem jeweiligen Prüfungsleiter auf die<br />
speziellen Bedingungen und Erfor<strong>der</strong>nisse des jeweiligen konkreten Prüfungsauftrages<br />
zugeschnitten werden.<br />
Beurteilung von Standardprüfprogrammen:<br />
Vorteil: Kostendegression bei häufiger Verwendung des standardisierten Prüfprogramms<br />
(SPP).<br />
Nachteil: Beson<strong>der</strong>heiten des Auftrages und des Prüfungsteams könnten vom Planer<br />
evtl. nicht genügend berücksichtigt werden.<br />
⇒ Erfor<strong>der</strong>nis von Kontrollen.<br />
112
241.2 Arbeitspapiere<br />
Prüfungstheorie<br />
”Arbeitspapiere sind alle Aufzeichnungen und Unterlagen, die <strong>der</strong> Abschlußprüfer im<br />
Zusammenhang mit <strong>der</strong> Abschlußprüfung selbst erstellt, sowie alle Schriftstücke und<br />
Unterlagen, die er von dem geprüften Unternehmen o<strong>der</strong> von Dritten als Ergänzung seiner<br />
eigenen Unterlagen zum Verbleib erhält. Da sie internen Zwecken des Abschlußprüfers<br />
dienen, sind sie nicht zur Weitergabe bestimmt.” (IDW PS 460 Tz. 1).<br />
Zweck <strong>der</strong> Arbeitspapiere:<br />
• Dokumentation <strong>der</strong> Prüfungsplanung, <strong>der</strong> Prüfungsdurchführung und <strong>der</strong><br />
Prüfungsfeststellungen,<br />
• laufende Überwachung des Prüfungsprozesses,<br />
• Herleitung <strong>der</strong> Prüfungsergebnisse,<br />
• Nachweis <strong>der</strong> Prüfungsqualität (⇒ Peer Review und Quality Control),<br />
• Vorbereitung und Unterstützung von Folgeprüfungen.<br />
Notwendigkeit <strong>der</strong> Dokumentation und Rechenschaft:<br />
1. Komplexität des Prüfungsstoffes und des Prüfungsurteils,<br />
2. Nachprüfbarkeitspostulat (und Nachweis <strong>der</strong> Befolgung <strong>der</strong> GoA),<br />
3. Flexibilität bei Prüfungsausführung ist Voraussetzung <strong>für</strong> flexible Planung.<br />
⇒ Kommunikation und Koordination von Prüfungsmitarbeitern.<br />
Arbeitspapiere sind ein wichtiges Instrument zur Realisation <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />
(a) Rationalisierungseffekte durch Arbeitspapiere,<br />
(b) Auswertbarkeit <strong>der</strong> Arbeitspapiere bei <strong>der</strong> Planung von Folgeprüfungen.<br />
113
Prüfungstechnik<br />
Zu (a): Rationalisierungseffekte durch Arbeitspapiere (AP)<br />
• Rationalisierungseffekte durch generelle Regelungen <strong>für</strong> die Erstellung von Arbeitspapieren:<br />
- AP-Formulare,<br />
- Art <strong>der</strong> Kennzeichnung <strong>der</strong> AP,<br />
- Technik <strong>der</strong> Dokumentation von Prüfungshandlungen,<br />
- Verweissystematik in AP,<br />
- Verwendung von Formularen <strong>für</strong> bestimmte Prüfungsfel<strong>der</strong> usw.<br />
Zu (b): Auswertbarkeit <strong>der</strong> Arbeitspapiere bei <strong>der</strong> Planung von Folgeprüfungen<br />
Auswertung <strong>der</strong> Arbeitspapiere <strong>der</strong> Vorjahresprüfung liefert wichtige Informationen<br />
<strong>für</strong> die Planung <strong>der</strong> laufenden Prüfung.<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen an Arbeitspapiere (= Dokumentations- und Rahmengrundsätze):<br />
AP müssen<br />
• systematisch zusammengestellt und aufbewahrt werden.<br />
Beispiel <strong>für</strong> System bei AP:<br />
-- eine chronologische Dokumentation,<br />
-- eine sachlich geordnete Dokumentation und<br />
-- entsprechende Verweissystematik.<br />
(⇒ Analogie zur Buchhaltungssystematik mit Grundbuch und Hauptbuch)<br />
• vollständig sein,<br />
• klar und verständlich angelegt werden,<br />
• richtig (zweckentsprechend) und<br />
• wirtschaftlich sein.<br />
114
Glie<strong>der</strong>ung und Inhalt <strong>der</strong> AP<br />
1. Dauerakte<br />
2. Einzelakte(n)<br />
Zu 1.: Dokumente <strong>der</strong> Dauerakte:<br />
Prüfungstheorie<br />
In <strong>der</strong> Dauerakte werden diejenigen Unterlagen systematisch abgelegt, die <strong>für</strong> den<br />
Abschlussprüfer über einen Zeitraum von mehreren Jahren von Bedeutung sind. Die<br />
Dauerakte ermöglicht dem Abschlussprüfer, einen schnellen Überblick über das zu prüfende<br />
Unternehmen.<br />
a) Unternehmensspezifische, nur selten verän<strong>der</strong>liche Sachverhalte:<br />
- Rechtsverhältnisse, Unternehmensform, Verflechtungen, Satzung/Statut, Vorstands-<br />
und Aufsichtsratmitglie<strong>der</strong>,<br />
- Handelsregisterauszüge,<br />
- Organisationsstrukturplan,<br />
- Buchführungssystem,<br />
- Bewertungsrichtlinien,<br />
- "Geschäftsberichte" <strong>der</strong> Vorjahre i. w. S.,<br />
- langjährig wirksame Verträge (wichtige Anstellungsverträge, Miet- und Pachtverträge,<br />
langfristige Kaufverträge),<br />
- Bilanzbonitätsrating aller Vorjahre.<br />
b) Prüferische Maßnahmen in Vorjahren:<br />
- Än<strong>der</strong>ungsvorschläge <strong>für</strong> die Organisation (insbes. IKS),<br />
- Prüfungsprogramme <strong>der</strong> Vorjahre mit Zeitprotokollen,<br />
- Prüfungsschwerpunkte (z. B. aufgrund <strong>der</strong> INSA des Moody’s RiscCalc),<br />
- Kopien <strong>der</strong> Prüfungsberichte <strong>der</strong> Vorjahre,<br />
- Hinweise und Vormerkungen <strong>der</strong> Vorjahresprüfungen.<br />
115
Zu 2.: Einzelakte(n)<br />
Prüfungstechnik<br />
Die Einzelakte enthält die <strong>für</strong> das Prüfungsergebnis einer Prüfung relevanten Unterlagen.<br />
Die Einzelakte wird <strong>für</strong> jede Abschlussprüfung neu angelegt.<br />
a) Nachweis:<br />
- Mitglie<strong>der</strong> des Prüfungsteams,<br />
- einzelne ausgeführte Tätigkeiten,<br />
- angewandte Prüfungsmethoden,<br />
- Prüfungsumfang,<br />
- Prüfungszeit,<br />
- <strong>der</strong> Einzelfeststellungen.<br />
b) Unterlagen <strong>für</strong> die Urteilsbildung (Hinweise auf die Urteilskriterien),<br />
c) Teilurteile über Prüfungsfel<strong>der</strong>,<br />
d) Hinweise auf Tatbestände, die in den Prüfungsbericht o<strong>der</strong> den Management-Letter<br />
aufgenommen werden sollen.<br />
241.3 Fallsammlungen<br />
Große Prüfungsgesellschaften prüfen weltweit nach einheitlichen Grundsätzen:<br />
⇒ Gleiche Sachverhalte werden gleich geprüft und beurteilt.<br />
Instrument:<br />
Umfangreiche Fallsammlungen mit typischen Bilanzierungsfragen und Entscheidungen.<br />
⇒ Durch Orientierung an einmal getroffenen Entscheidungen entsteht ein hohes Maß an<br />
Einheitlichkeit und Kontinuität <strong>der</strong> Entscheidungen.<br />
Fallsammlungen (Firm-and-Sec-Accounting Series Releases) können als<br />
- Loseblattsammlungen o<strong>der</strong><br />
- CD-ROM<br />
organisiert sein.<br />
116
242. Computerprüfprogramme<br />
Prüfungstheorie<br />
Da ein großer Teil <strong>der</strong> zu prüfenden Daten in DV-Anlagen gespeichert ist, wird <strong>der</strong><br />
Computer häufig auch zur Prüfung eingesetzt. Die Programme, die zur Prüfung verwendet<br />
werden, sind sog. Computerprüfprogramme.<br />
Arten von Computerprüfprogrammen:<br />
• Spezielle Prüfprogramme<br />
- Für einen konkreten Anwen<strong>der</strong> entwickelt,<br />
- können beson<strong>der</strong>e Fragestellungen des Prüfungsunternehmens berücksichtigen,<br />
- aufwendige Entwicklung,<br />
- rentieren sich nur bei sehr großen Prüfungsunternehmen.<br />
• Generelle Prüfprogramme<br />
- Bei ähnlichen Fragestellungen wie<strong>der</strong>verwendbar;<br />
- Programme müssen an vorhandene Datenorganisation jeweils angepasst werden;<br />
- sehr anwen<strong>der</strong>freundlich programmiert;<br />
- automatischer Prüfungsberichtsgenerator (z. B. Audit Agent);<br />
- Entwicklung rentiert sich wegen <strong>der</strong> generellen Verwendbarkeit eher als bei speziellen<br />
Prüfprogrammen, die nur <strong>für</strong> einen bestimmten Anwen<strong>der</strong> entwickelt<br />
werden;<br />
- Programme bestehen aus Subroutines, d. h. Unterprogrammen, die bestimmte Prüfungshandlungen<br />
ausführen bzw. vorbereiten;<br />
- Prüfer wählt Subroutines aus.<br />
117
25 Netzplantechnik<br />
251. Gegenstand <strong>der</strong> Netzplantechnik<br />
Prüfungstechnik<br />
Die Verfahren <strong>der</strong> Netzplantechnik sind ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Lösung <strong>der</strong> Probleme<br />
<strong>der</strong> Zeitplanung.<br />
Einsatz <strong>der</strong> Netzplantechnik bei <strong>der</strong> Zeitplanung:<br />
(1) Zeitliche Abstimmung <strong>der</strong> durch den Prüfungsplaner während einer Planungsperiode<br />
abzuwickelnden Aufträge;<br />
(2) Bestimmung <strong>der</strong> Zeiten (Anfangs- und Endzeitpunkte), während <strong>der</strong>er die Mitarbeiter o<strong>der</strong> die<br />
einzelnen Teams <strong>für</strong> die Erledigung <strong>der</strong> Einzelaufträge zur Verfügung stehen sollen;<br />
(3) Bestimmung <strong>der</strong> Zeiten (Anfangs- und Endzeitpunkte), während <strong>der</strong>er die Bearbeitung von einzelnen<br />
Prüffel<strong>der</strong>n bzw. Prüffel<strong>der</strong>gruppen im Rahmen <strong>der</strong> einzelnen Aufträge vorgenommen<br />
werden soll;<br />
Zwecke <strong>der</strong> Netzplantechnik:<br />
• Einhalten <strong>der</strong> Maximalzeiten je Prüffeld; <strong>der</strong> Abgabe des Urteils im Prüfungsbericht und<br />
Bestätigungsvermerks;<br />
• Erkennen und Vermeiden von zeitlichen Unverträglichkeiten.<br />
Definition Netzpläne<br />
In Netzplänen werden Abläufe und ihre Abhängigkeiten graphisch dargestellt. Die Netzplantechnik<br />
dient auch <strong>der</strong> Projektsteuerung, indem Termine ermittelt werden und die Projektdurchführung<br />
daraufhin veranlasst werden kann. Ferner dient sie zur Projektüberwachung sowie zur Sicherung <strong>der</strong><br />
Projektdurchführung hinsichtlich Terminen, Qualitäten, Quantitäten und Kosten.<br />
Abb. 18: Beispiel zur graphischen Darstellung von abhängigen Abläufen<br />
Prüfung <strong>der</strong><br />
Anlagenabgänge<br />
Prüfung <strong>der</strong> a. o.<br />
Erträge aus Anlagenabgängen<br />
Prüfung <strong>der</strong><br />
Verluste aus Anlagenabgängen<br />
Prüfung <strong>der</strong><br />
Zuschreibungen<br />
Prüfung <strong>der</strong><br />
Umbuchungen<br />
118<br />
Prüfung <strong>der</strong><br />
Anlagenendbestände<br />
Abstimmung<br />
von Bilanz- und<br />
GuV-Ausweis
252. Entwicklung <strong>der</strong> Netzplantechnik<br />
Prüfungstheorie<br />
Grundlage <strong>der</strong> Netzplantechnik ist die Graphentheorie, die sich auf den ungarischen<br />
Mathematiker KÖNIG zurückführen lässt (1935).<br />
Vorgangspfeilnetzplan-Methode ("Critical Path Method" CPM):<br />
1957 entwickelte duPont de Nemours & Company gemeinsam mit <strong>der</strong> Remington Rand<br />
Univac eine Methode, um kostspielige Wartungs- und Umstellungsarbeiten bei Großanlagen<br />
in <strong>der</strong> Chemie zu rationalisieren.<br />
Ereignisknotennetzplan-Methode ("Program Evaluation and Review Technique" PERT):<br />
1958 entwickelte die US-Marine mit einer Beratungsfirma und Lockheed PERT zur<br />
Koordination beim Aufbau des Polaris-Raketen-Systems. Wird heute noch angewandt<br />
(Voraussetzung zur Erlangung von US-Regierungsaufträgen).<br />
Vorgangsknotennetzplan-Methode ("Metra-Potential Method" MPM):<br />
1958 im Auftrag <strong>der</strong> Electricité de France zur Terminplanung beim Atomkraftwerkbau<br />
entwickelt.<br />
253. Netzplanelemente und Netzplantypen<br />
253.1 Netzplanelemente<br />
(1) Funktionale Elemente:<br />
Begriff Definition<br />
Vorgang<br />
Ereignis<br />
Anordnungs-<br />
beziehung AOB<br />
Zeitbeanspruchende Ablaufschritte (Teilarbeiten, Handlungen, Tätigkeiten)<br />
mit definiertem Anfang und Ende, z. B. "Endfassung des<br />
Jahresabschlussberichts herstellen", "Schaden feststellen", "Genehmigung<br />
einholen".<br />
Eintretensmomente definierter Zustände im Projektablauf. Je<strong>der</strong> Vorgang<br />
beginnt mit einem Anfangsereignis und endet mit einem En<strong>der</strong>eignis.<br />
Der Vorgang "Endfassung des Jahresabschlussberichts herstellen"<br />
beginnt z. B. mit dem Anfangsereignis "Manuskript an Sekretärin<br />
übergeben" und endet mit dem En<strong>der</strong>eignis "Jahresabschlussbericht<br />
an Wirtschaftsprüfer übergeben".<br />
Abhängigkeit (Aufeinan<strong>der</strong>folge) zwischen den Vorgängen bzw. Ereignissen.<br />
Die funktionalen Elemente stehen in folgen<strong>der</strong> Beziehung zueinan<strong>der</strong>:<br />
119
Vorgang 1<br />
Prüfungsplan<br />
erstellen<br />
Auftrag angenommen<br />
Prüfungstechnik<br />
AOB<br />
Prüfungsplan erstellt<br />
und <strong>für</strong> das Prüfungsteam<br />
kopiert<br />
Ereignis<br />
Abb. 19: Beziehungen zwischen funktionalen Netzplanelementen<br />
(2) Formale Elemente:<br />
Die beiden formalen Elemente sind:<br />
Knoten<br />
Pfeil<br />
(gerichtete Kanten)<br />
Abb. 20: Formale Elemente eines Netzplans<br />
120<br />
Prüfungsbeginn<br />
Vorgang 2<br />
Kasse<br />
prüfen<br />
Arbeitspapier<br />
Kassenprüfung<br />
ist erstellt
253.2 Netzplantypen<br />
Netzplantypen<br />
Vorgangsorientiert Ereignisorientiert<br />
Ereignisknotennetzplan<br />
Vorgangknotennetzplan<br />
Vorgangpfeilnetzplan<br />
Abb. 21: Übersicht über die drei Netzplantypen<br />
Prüfungstheorie<br />
Ereignisse werden als<br />
Knoten, Vorgänge werden<br />
nicht dargestellt<br />
Vorgänge werden als Knoten,<br />
Ereignisse werden nicht<br />
dargestellt<br />
Vorgänge werden als<br />
Pfeile, Ereignisse als Knoten<br />
dargestellt<br />
121<br />
AOB<br />
AOB<br />
AOB<br />
Vorgang<br />
Ereignis Ereignis<br />
Vorgang Vorgang<br />
Ereignis Ereignis<br />
Typisches Verfahren:<br />
PERT<br />
Typische Verfahren:<br />
BKN, HMN, MPM, PD,<br />
PCS, PMS, PPS, SINETIK<br />
Typisches Verfahren: CPM
Prüfungstechnik<br />
253.3 Grundregeln <strong>für</strong> die Darstellung von Netzplänen<br />
(1) Der Vorgang wird durch einen Knoten dargestellt und durch Pfeile zu an<strong>der</strong>en<br />
Vorgängen in Beziehung gesetzt, d. h. mit diesen verbunden. Je<strong>der</strong> Vorgang beginnt<br />
und endet mit einem Ereignis. Das En<strong>der</strong>eignis eines Vorganges ist gleichzeitig das<br />
Anfangsereignis seines Nachfolgers. Daraus folgt, dass ein Vorgang beendet sein muss,<br />
wenn <strong>der</strong> Nachfolger (nachfolgen<strong>der</strong> Vorgang) beginnt.<br />
A B C<br />
(2) Wenn mehrere Vorgänge beendet sein müssen, bevor ein neuer Vorgang beginnt, wird<br />
je<strong>der</strong> von ihnen mit dem Nachfolger durch einen Pfeil verbunden.<br />
A<br />
B<br />
C<br />
122<br />
D
Prüfungstheorie<br />
(3) Ebenso gilt die Umkehrung, dass mehrere Vorgänge mit einem Vorgänger durch Pfeile<br />
verbunden werden, wenn sie erst nach dessen Ende beginnen können.<br />
A<br />
(4) Laufen zwei Vorgänge parallel (gemeinsamer Vorgänger und Nachfolger), werden beide<br />
durch Pfeile mit ihren Vorgängern und Nachfolgern verbunden.<br />
B<br />
B<br />
C<br />
D<br />
A D<br />
(5) Es dürfen keine Schleifen entstehen, denn <strong>der</strong> zeitliche Ablauf kann nur fortschreiten.<br />
Falsche Darstellung:<br />
Richtige Darstellung:<br />
C<br />
A B<br />
A1 B1 A2 B2<br />
123
Prüfungstechnik<br />
254. Ablaufplanung und Zeitplanung mit Hilfe <strong>der</strong> Netzplantechnik<br />
254.1 Überblick<br />
Ablaufplanung<br />
1 Vorbereitende Maßnahmen durchführen<br />
(Strukturanalyse) 2 Projektstrukturplan erstellen<br />
Zeitplanung<br />
(Zeitanalyse)<br />
3 Vorgänge erfassen und Vorgangsliste<br />
erstellen<br />
4 Netzplan zeichnen<br />
Abb. 22: Ablaufschritte <strong>der</strong> Netzplantechnik<br />
5 Vorgangsdauern ermitteln<br />
6 Zeitpunkte, Pufferzeiten und kritischen<br />
Weg ermitteln<br />
7 Vorgangstermine und Projekttermin<br />
ermitteln<br />
8 Überwachung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
124<br />
Projektplanung<br />
Projektsteuerung
254.2 Ablaufplanung <strong>für</strong> einen Auftrag<br />
Prüfungstheorie<br />
Schritt 1: Vorbereitende Maßnahmen durchführen<br />
Festlegung des Projektziels,<br />
Projektgruppe und <strong>der</strong>en Leiter bestimmen,<br />
Entscheiden, ob neben <strong>der</strong> Terminplanung und -steuerung auch eine Kosten- bzw.<br />
Ausgaben- sowie Kapazitätsplanung und -steuerung durchzuführen ist,<br />
Datenrückmeldung sichern, um später eine Projektsteuerung gewährleisten zu können,<br />
Entscheiden, ob <strong>der</strong> Netzplan manuell o<strong>der</strong> mit Hilfe eines rechnergestützten Programms<br />
ermittelt und aktualisiert werden soll.<br />
Schritt 2: Projektstrukturplan erstellen<br />
Hierarchisch über verschiedene Organisationsebenen aufgebaute Projektdarstellung<br />
Aufgabe: Komplexes Projekt in mehreren Ebenen soweit zu glie<strong>der</strong>n, bis es übersichtlich<br />
dargestellt ist.<br />
⇒ Schützt davor, bei <strong>der</strong> Zeichnung des Netzplans etwas zu vergessen.<br />
Bei kleinen Projekten kann auf Projektstrukturplan verzichtet werden.<br />
Schritt 3: Vorgänge erfassen und Vorgangsliste erstellen<br />
Die Vorgänge sollen so gewählt werden, dass die Zeiteinheit zwischen 0,2 % und 2 % <strong>der</strong><br />
Projektdauer beträgt. Somit wird man im Allgemeinen folgende Zeiteinheiten/Projektdauerrelationen<br />
wählen:<br />
Projektdauer Zeiteinheit<br />
> 5 Jahre<br />
1/2 bis 5 Jahre<br />
bis 1/2 Jahr<br />
Woche<br />
Tag<br />
125<br />
Monat<br />
Woche<br />
Tag<br />
Stunde<br />
Minute
Daten <strong>der</strong> Vorgangsliste:<br />
Prüfungstechnik<br />
(1) Vorgangs-Nr.,<br />
(2) Vorgangs-Bezeichnung,<br />
(3) Vorgangs-Dauer,<br />
(4) Vorgänge, die unmittelbar vorher beendet sein müssen (Vorgänger), damit <strong>der</strong><br />
entsprechende Vorgang beginnen kann.<br />
Beispiel: Vorgangsliste zur Prüfung des Anlagevermögens<br />
Vorgang<br />
Nr.<br />
Vorgangs-Bezeichnung Dauer in<br />
Tagen<br />
126<br />
Vorgänger-Nr.<br />
1 Besichtigung <strong>der</strong> Anlagen 4 ?<br />
2 Stichprobenweise Abstimmung <strong>der</strong> Anlagenkartei 5 1<br />
3 Prüfung <strong>der</strong> Anlagenzugänge 20 2<br />
4 Prüfung <strong>der</strong> Anlagenabgänge 14 2<br />
5 Prüfung <strong>der</strong> außerordentlichen Erträge aus Anlagenabgängen<br />
3 4<br />
6 Prüfung <strong>der</strong> Verluste aus Anlagenabgängen 3 4<br />
7 Prüfung <strong>der</strong> Abschreibungen 15 3; 8<br />
8 Prüfung <strong>der</strong> Zuschreibungen 5 4<br />
9 Prüfung <strong>der</strong> Umbuchungen 4 5; 6; 7<br />
10 Abstimmung von Bilanz- und GuV-Ausweis 4 9<br />
Schritt 4: Netzplan zeichnen<br />
Das Zeichnen des Netzplans besteht im Aneinan<strong>der</strong>setzen von Knoten und Pfeilen. Der<br />
erste Knoten in einem Netzplan heißt Startknoten (DIN 69 900: Knoten, in den kein Pfeil<br />
einmündet); <strong>der</strong> letzte Knoten heißt Zielknoten (DIN 69 900: Knoten, von dem kein Pfeil<br />
ausgeht).
Start<br />
1 2<br />
Abb. 23: Netzplanentwurf<br />
254.3 Zeitplanung <strong>für</strong> einen Auftrag<br />
Inhalt <strong>der</strong> Zeitplanung:<br />
3<br />
Prüfungstheorie<br />
8<br />
4 5<br />
6<br />
Bei <strong>der</strong> Zeitplanung werden nun die Vorgangsdauern bestimmt und die Vorgangs- und Projekttermine<br />
sowie die kritischen Vorgänge und Pufferzeiten ermittelt.<br />
Schritt 5: Vorgangsdauern ermitteln<br />
Die Vorgangsdauern werden mit Hilfe vorhandener Planzeiten o<strong>der</strong> durch Befragen bzw.<br />
Vergleichen und Schätzen bestimmt.<br />
127<br />
7<br />
9<br />
10<br />
Ziel
Prüfungstechnik<br />
Schritt 6: Zeitpunkte, Pufferzeiten und kritischen Weg ermitteln<br />
Aus <strong>der</strong> Vorgangsliste werden die Vorgangsdauern in den Netzplan übertragen:<br />
Prinzip<br />
Vorgang Nr. i<br />
Vorgangs-Bezeichnung<br />
D(i)<br />
D(i) = Dauer des Vorgangs i<br />
Dann werden die Anfangs- und Endzeitpunkte in den Knoten eingetragen:<br />
Prinzip<br />
Vorgang Nr. i<br />
Vorgangs-Bezeichnung<br />
FAZ(i) D(i) FEZ(i)<br />
SAZ(i) GP(i) SEZ(i)<br />
FAZ(i) = Frühestmöglicher Anfangszeitpunkt des<br />
Vorgangs i<br />
SAZ(i) = Spätesterlaubter Anfangszeitpunkt des<br />
Vorgangs i<br />
FEZ(i) = Frühestmöglicher Endzeitpunkt des<br />
Vorgangs i<br />
SEZ(i) = Spätesterlaubter Endzeitpunkt des<br />
Vorgangs i<br />
GP(i) = Gesamtpufferzeit des Vorgangs i<br />
128
Berechnung <strong>der</strong> Zeitpunkte:<br />
(1) Vorwärtsrechnung<br />
Prüfungstheorie<br />
Der Startknoten erhält den FAZ = 0, und <strong>der</strong> früheste Endzeitpunkt FEZ wird aus<br />
0 + Vorgangsdauer D(1) ermittelt:<br />
FAZ(j) = FEZ(i)<br />
FEZ(j) = FAZ(j) + D(j)<br />
Bei Nachfolgern mit mehreren parallelen Vorgängern (z. B. Vorgang 9) werden,<br />
ausgehend von allen Vorgängern (i), alle möglichen FEZ(i) errechnet und das<br />
Maximum <strong>der</strong> so errechneten Zeitpunkte verwendet, so dass die vorstehende<br />
Formel dann wie folgt zu modifizieren ist:<br />
FAZ(j) = Max {FEZ(i)}<br />
i<br />
FEZ(j) = FAZ(j) + D(j)<br />
Beispiel: FAZ(9) = Max {FEZ(5); FEZ(6); FEZ(7)}<br />
= Max {26; 26; 44}<br />
= 44<br />
(Vgl. nachstehenden Netzplan mit kritischem Pfad)<br />
(2) Rückwärtsrechnung<br />
Die spätesten Anfangszeitpunkte SAZ(i) und die spätesten Endzeitpunkte SEZ(i)<br />
werden wie folgt eingetragen:<br />
Im rechten unteren Feld des Endknotens 10 wird <strong>der</strong> SEZ (10) = 52 eingetragen.<br />
SAZ(10) wird aus SEZ(10) - D(10), also 52 - 4 = 48, errechnet und in das linke<br />
untere Feld eingetragen. Die SEZ(i) und SAZ(i) aller weiteren Vorgänge i werden<br />
wie folgt ermittelt:<br />
SEZ(i) = SAZ(j)<br />
SAZ(i) = SEZ(i) - D(i)<br />
Bei Vorgängen i mit mehreren parallelen Nachfolgern j gilt:<br />
SEZ(i) = Min {SAZ(j)}<br />
j<br />
SAZ(i) = SEZ(i) ? D(i)<br />
Beispiel: SEZ(4) = Min {SAZ(8); SAZ(5); SAZ(6)}<br />
= Min {24; 41; 41}<br />
= 24<br />
(Vgl. nachstehenden Netzplan mit kritischem Pfad)<br />
129
(3) Pufferzeiten und kritischer Weg<br />
Prüfungstechnik<br />
Gesamte Pufferzeit GP<br />
Zeitspanne zwischen frühestmöglicher und<br />
spätesterlaubter Lage eines Vorgangs.<br />
Freie Pufferzeit<br />
Freie Vorwärtspufferzeit:<br />
Zeitspanne, um die ein Vorgang gegenüber seiner frühestmöglichen<br />
Lage verschoben werden kann, ohne die<br />
frühestmögliche Lage an<strong>der</strong>er Vorgänge zu verän<strong>der</strong>n.<br />
Freie Rückwärtspufferzeit:<br />
Zeitspanne, um die ein Vorgang gegenüber seiner spätestmöglichen<br />
Lage verschoben werden kann, ohne die<br />
spätestmögliche Lage an<strong>der</strong>er Vorgänge zu verän<strong>der</strong>n.<br />
Unabhängige Pufferzeit<br />
Zeitspanne, um die ein Vorgang verschoben werden<br />
kann, wenn seine Vorgänger spätesterlaubt und seine<br />
Nachfolger frühestmöglich fertig sein sollen.<br />
• Bei Kenntnis <strong>der</strong> Pufferzeiten aller Ereignisse kann <strong>der</strong> kritische Weg bestimmt<br />
werden, <strong>der</strong> aus den (kritischen) Vorgängen besteht, <strong>der</strong>en gesamte Pufferzeiten<br />
GP Null ist.<br />
Schritt 7: Vorgangstermine und Projekttermin ermitteln<br />
Die Projektplanung ist beendet, wenn die kritischen Vorgänge und die Pufferzeiten <strong>der</strong><br />
nichtkritischen Vorgänge ermittelt sind. Deshalb folgt als letzter Schritt die Terminermittlung,<br />
also <strong>der</strong> Übergang von <strong>der</strong> fristenbezogenen Projektplanung zur terminbezogenen<br />
Projektsteuerung.<br />
130
Start<br />
000000<br />
000000<br />
1 2<br />
000404<br />
000004<br />
040509<br />
040009<br />
3<br />
092029<br />
090029<br />
Prüfungstheorie<br />
8<br />
230528<br />
240129<br />
4 5<br />
091423<br />
100124<br />
Abb. 24: Netzplan mit kritischem Pfad<br />
Zusammenfassung:<br />
230326<br />
411844<br />
6<br />
230326<br />
411844<br />
7<br />
291544<br />
290044<br />
FEZ(i) = FAZ(i) + D(i)<br />
FAZ(i) = Maximum <strong>der</strong> FEZ aller direkten Vorgänger j<br />
KW = Kritischer Weg: alle Vorgänge mit GP(i) = 0<br />
GP(i) = SAZ(i) - FAZ(i) bzw.<br />
= SEZ(i) - FEZ(i)<br />
SAZ(i) = SEZ(i) - D(i)<br />
SEZ(i) = Minimum <strong>der</strong> SAZ aller direkten Nachfolger j<br />
131<br />
9<br />
440448<br />
440048<br />
10<br />
480452<br />
480052<br />
Ziel<br />
520052<br />
520052
255. Beurteilung <strong>der</strong> Netzplantechnik<br />
Prüfungstechnik<br />
(1) Die genaue Analyse eines Projekts sowie das daraus resultierende Termingerüst lassen<br />
drohende Engpässe und Verzögerungen bereits im Ansatz erkennen und ermöglichen<br />
rechtzeitige Gegenmaßnahmen.<br />
(2) Die übersichtliche, <strong>für</strong> jedes Verfahren <strong>der</strong> Netzplantechnik bis ins Detail einheitlich<br />
festgelegte Darstellungsweise ermöglicht eine zweifelsfreie Verständigung zwischen allen<br />
Beteiligten.<br />
(3) Der Netzplan liefert in je<strong>der</strong> Phase des Projekts einen raschen, allgemein verständlichen<br />
Überblick über den Projektstand und lässt Engpässe und mögliche Störungsquellen<br />
frühzeitig erkennen.<br />
(4) Ein weiterer Nutzen <strong>der</strong> Netzplantechnik wird schließlich darin gesehen, dass in <strong>der</strong><br />
Planungsphase eines Projekts <strong>der</strong> Zwang besteht, Aufgaben, Kompetenzen und<br />
Verantwortung aller Projektbeteiligten klären zu müssen.<br />
(5) Die Nutzung von Netzplan-Software ermöglicht eine schnelle und effiziente zeitliche<br />
Überwachung auch von großen Projekten/Prüfungen.<br />
132
3 Risikoorientierte Prüfung<br />
Prüfungstheorie<br />
31 Verpflichtung zur risikoorientierten Abschlussprüfung<br />
Ziel <strong>der</strong> risikoorientierten Abschlussprüfung ist die Optimierung des Prüfungsprozesses<br />
durch eine möglichst frühzeitige Erfassung <strong>der</strong> wesentlichen Prüfungsrisiken (Fehlerrisiko (=<br />
Inhärentes Risiko mal Kontrollrisiko), Entdeckungsrisiko und Risiko <strong>der</strong> künftigen Entwicklung).<br />
Neue Prüfungsstandards und berufsständische Verlautbarungen schreiben eine Risikobeurteilung<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Prüfungsplanung verbindlich vor. Der IDW PS 240 und die VO<br />
1/1995 <strong>der</strong> WPK und des IDW enthalten die aus SAS No. 47 1 sowie die aus den ISA 300 -<br />
400 2 übernommene Verpflichtung zur risikoorientierten Abschlussprüfung.<br />
Im Rahmen einer Untersuchung von 500 Abschlussprüfungen in den USA, Großbritannien<br />
und Südafrika hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Haskins & Sells International<br />
festgestellt, dass 75 % <strong>der</strong> wesentlichen Risiken <strong>der</strong> Prüfungsaufträge bereits in <strong>der</strong> Planungsphase<br />
hätten erkannt werden können. Die wesentlichen Risiken wurden nach dieser<br />
Untersuchung folgen<strong>der</strong>maßen unterschieden:<br />
• Ähnliche Fehler sind in den Vorjahren aufgetreten (38 %),<br />
• Branche ist risikobehaftet (12 %),<br />
• zu prüfendes Unternehmen ist risikobehaftet (9 %),<br />
• sonstige vorab erkennbare Risiken (16 %) sowie<br />
• Risiken, die in <strong>der</strong> Planungsphase nicht zu erkennen waren (25 %).<br />
1 Statement on Auditing Standard (SAS). Die SAS sind vom Auditing Standards Board (ASB) des American<br />
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) herausgegebene Interpretationen allgemein anerkannter Prüfungsrichtlinien.<br />
Das AICPA ist die Berufsorganisation <strong>der</strong> amerikanischen Wirtschaftsprüfer. Eine Aufgabe des<br />
AICPA ist die Herausgabe von Prüfungsrichtlinien. Diese Prüfungsrichtlinien sind <strong>für</strong> amerikanische Wirtschaftsprüfer<br />
verbindlich.<br />
2<br />
International Standard on Auditing (ISA). Bei den International Standards on Auditing handelt es sich um<br />
internationale Prüfungsstandards, die vom IAPC <strong>der</strong> IFAC entwickelt werden. Die nationalen Mitgliedsorganisationen<br />
des IFAC, zu denen <strong>für</strong> Deutschland das IDW und die WPK gehören, haben sich zur Umsetzung <strong>der</strong><br />
internationalen Prüfungsstandards in Deutschland verpflichtet.<br />
International Fe<strong>der</strong>ation of Accountants (IFAC): Hauptaufgabe <strong>der</strong> IFAC ist, den Berufsstand <strong>der</strong><br />
”Accountants” auf internationaler Ebene fortzuentwickeln, vor allem im Hinblick auf die Qualitätssicherung<br />
<strong>der</strong> Berufsausübung.<br />
International Auditing Practices Committee (IAPC): Das IAPC ist ein Unterausschuss <strong>der</strong> IFAC, <strong>der</strong> sich mit<br />
Fragen <strong>der</strong> internationalen Harmonisierung von Regeln <strong>der</strong> ordnungsmäßigen Durchführung von Abschlussprüfungen<br />
sowie mit Form und Inhalt <strong>der</strong> Prüfung beschäftigt.<br />
133
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Die Studie zeigt, dass sowohl eine sorgfältige risikoorientierte Prüfungsplanung als auch die<br />
Kenntnis des Geschäfts und <strong>der</strong> Branche des zu prüfenden Unternehmens notwendige Voraussetzungen<br />
<strong>für</strong> eine ordnungsmäßige Abschlussprüfung sind.<br />
Die Risikosituation des Abschlussprüfers kann folgen<strong>der</strong>maßen strukturiert werden:<br />
Das allgemeine<br />
Geschäftsrisiko<br />
des Abschlußprüfers<br />
Abb. 25: Risiken des Abschlussprüfers<br />
32 Die Risiken des Abschlussprüfers<br />
Prüfungsrisiko<br />
321. Das allgemeine Geschäftsrisiko des Abschlussprüfers<br />
Das spezielle<br />
Auftragsrisiko<br />
des Abschlußprüfers<br />
Das allgemeine Geschäftsrisiko des Abschlussprüfers umfasst neben dem allgemeinen Unternehmerrisiko,<br />
dem jedes Unternehmen ausgesetzt ist, Konsequenzen, die vor allem aus<br />
Fehlurteilen o<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Mißachtung von Berufspflichten resultieren:<br />
- Haftung <strong>für</strong> entstandene Schäden (z. B. gegenüber Aktionären, Banken);<br />
- berufsgerichtliche Maßnahmen bei Verstößen gegen die Berufssatzung;<br />
- strafrechtliche Sanktionen (z. B. Beihilfe zur Steuerhinterziehung) sowie<br />
- Beeinträchtigung o<strong>der</strong> Verlust <strong>der</strong> beruflichen Reputation.<br />
Das allgemeine Geschäftsrisiko des Abschlussprüfers kann auch aus einer verfehlten Unternehmenspolitik<br />
des Abschlussprüfers resultieren, wenn er seine Absatzmärkte und/o<strong>der</strong><br />
Wettbewerber falsch einschätzt.<br />
134
Prüfungstheorie<br />
322. Das spezielle Auftragsrisiko des Abschlussprüfers<br />
Das spezielle Auftragsrisiko des Abschlussprüfers betrifft den einzelnen Prüfungsauftrag. Es<br />
resultiert aus den speziellen Gegebenheiten des zu prüfenden Unternehmens, wie dessen<br />
Sitz, Branchenzugehörigkeit, Wettbewerbslage, Management und auch aus dem Fortbestandsrisiko<br />
des zu prüfenden Unternehmens.<br />
Das spezielle Auftragsrisiko korrespondiert in starkem Maße mit <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit des<br />
zu prüfenden Unternehmens. So kann eine schlechte wirtschaftliche Lage des zu prüfenden<br />
Unternehmens dazu führen, dass das Unternehmen das vereinbarte Honorar nicht begleichen<br />
o<strong>der</strong> dass die Abschlussprüfung nicht GoA-konform durchgeführt werden kann.<br />
Schlimmer ist, wenn das Bestandsrisiko des zu prüfenden Unternehmens wegen Ängsten vor<br />
<strong>der</strong> sich selbst erfüllenden Prophezeiung o<strong>der</strong> vor Auftragsverlust vom Prüfer verschwiegen<br />
wird und es zu einem Scheitern des zu prüfenden Unternehmens kommt, ohne dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
ein Signal gegeben hat.<br />
Das Auftragsrisiko umfasst wie das Geschäftsrisiko Konsequenzen, die eine Existenzgefährdung<br />
des Abschlussprüfers zur Folge haben können. Die Kontrolle des speziellen Auftragsrisikos<br />
kann durch eine risikoorientierte Auswahl <strong>der</strong> Prüfungsaufträge erfolgen. Hilfsmittel<br />
hier<strong>für</strong> sind Checklisten zur Identifikation von Unternehmen mit außergewöhnlichen Risiken<br />
und die Beurteilung <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit des zu prüfenden Unternehmens vor Auftragsannahme<br />
o<strong>der</strong> Auftragsfortführung.<br />
Das spezielle Auftragsrisikos ist von zentraler Bedeutung <strong>für</strong> die Entscheidung über die Annahme<br />
o<strong>der</strong> Ablehnung eines Prüfungsauftrages. Die Beurteilung durch den Abschlussprüfer<br />
erfolgt stets unter <strong>der</strong> Abwägung möglicher Auftragschancen.<br />
Der Grundsatz <strong>der</strong> Gewissenhaftigkeit (§ 43 Abs. 1 WPO) verlangt, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
mögliche Ausschließungsgründe <strong>für</strong> einen speziellen Prüfungsauftrag im Vorfeld <strong>der</strong> Auftragsannahme<br />
analysiert. Eine nachträgliche Kündigung ist nach § 318 Abs. 6 dHGB bzw. §<br />
270 Abs. 6 UGB nur aus wichtigem Grund zulässig.<br />
135
323. Prüfungsrisiko<br />
323.1 Definition des Prüfungsrisikos<br />
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Prüfungsrisiko: Gefahr, einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk <strong>für</strong> einen Jahresabschluss<br />
zu erteilen, <strong>der</strong> wesentliche Fehler aufweist, bzw. einen Bestätigungsvermerk nur eingeschränkt<br />
zu erteilen o<strong>der</strong> zu verweigern, obwohl <strong>der</strong> Jahresabschluss keine wesentlichen<br />
Fehler enthält. Durch das KonTraG hat sich das Prüfungsrisiko darüber hinaus um die Gefahr<br />
erweitert, wesentliche Fortbestandsrisiken nicht zu erkennen bzw. nicht anzugeben,<br />
obwohl sie im Prüfungsbericht und eventuell im Bestätigungsvermerk angegeben werden<br />
müssen.<br />
Laut Leffson ist <strong>der</strong> gesetzliche Prüfungsauftrag ausdrücklich ein Mißtrauensauftrag: ”Der<br />
Abschlußprüfer darf niemals darauf vertrauen, daß die Buchführung in Ordnung ist o<strong>der</strong><br />
daß die Unternehmensleitung den Jahresabschluß normengerecht aufgestellt hat.”<br />
Aus dem Mißtrauensauftrag folgt nach Leffson, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer das unbekannte<br />
Prüfungsobjekt solange als nicht ordnungsmäßig vermutet, bis er sich vom Gegenteil überzeugen<br />
konnte.<br />
Je nachdem, welche konkreten Ergebnisse die Prüfung liefert, muss <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
seine Ausgangshypothese beibehalten o<strong>der</strong> er muss sie revidieren. Da dem Abschlussprüfer<br />
bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> Ordnungsmäßigkeit des Prüfungsobjektes und <strong>der</strong> Fortbestandsrisiken<br />
Fehler unterlaufen können, kann die Ablehnung <strong>der</strong> Ausgangshypothese entwe<strong>der</strong> die<br />
richtige o<strong>der</strong> die falsche Entscheidung sein.<br />
Ausgangshypothese: Der Jahresabschluss ist nicht i.O. bzw. das Unternehmen ist insolvenzgefährdet.<br />
Entscheidung<br />
des Prüfers<br />
aufgrund von<br />
Urteilsbildungsbeiträgen<br />
Hypothese<br />
wird<br />
beibehalten<br />
Hypothese<br />
wird<br />
revidiert<br />
Hypothese<br />
trifft zu<br />
korrekte<br />
Entscheidung<br />
α-Fehler<br />
Wahrer Zustand<br />
Abb. 26: Qualität <strong>der</strong> Entscheidung des Abschlussprüfers<br />
136<br />
Hypothese trifft<br />
nicht zu<br />
β-Fehler<br />
korrekte<br />
Entscheidung
Prüfungstheorie<br />
Die ungerechtfertigte Ablehnung eines Jahresabschlusses, <strong>der</strong> keine wesentlichen Fehler enthält,<br />
wird als β-Fehler bezeichnet. Vom α-Fehler wird gesprochen, wenn <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
den Bestätigungsvermerk erteilt, obwohl <strong>der</strong> Jahresabschluss wesentliche Fehler enthält. 3<br />
α-Fehler und β-Fehler unterscheiden sich durch die Konsequenzen, die mit den Fehlentscheidungen<br />
verbunden sind:<br />
Bei einem β-Fehler wird das geprüfte Unternehmen seinerseits das Urteil des Abschlussprüfers<br />
prüfen. Da keine wesentlichen Fehler vorhanden sind, wird es den Abschlussprüfer zu<br />
einer Überprüfung und Korrektur seines Urteils drängen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein<br />
β-Fehler unentdeckt bleibt, kann daher als gering eingestuft werden. Die erneute Prüfung<br />
verursacht zusätzliche Kosten und führt neben dem Reputationsverlust <strong>für</strong> den Prüfer möglicherweise<br />
zum Verlust des Prüfungsauftrags im folgenden Jahr.<br />
Unterläuft dem Abschlussprüfer ein α-Fehler, so führt dies in aller Regel zu einem endgültigen<br />
Fehlurteil, da das ”geprüfte” Unternehmen mit dem positiven Urteil zufrieden sein<br />
wird: Das Unternehmen wird den erteilten Bestätigungsvermerk nicht in Frage stellen. Allerdings<br />
ist im Fall von vom Abschlussprüfer im Prüfungsbericht bzw. im Bestätigungsvermerk<br />
nicht vermerkten bestandsgefährdenden Tatsachen, die im Folgejahr offenbar werden,<br />
ein noch stärkerer Reputationsverlust <strong>für</strong> den Abschlussprüfer zu erwarten als im Falle des β-<br />
Fehlers.<br />
Allerdings ist nicht jedes Fehlurteil mit Konsequenzen <strong>für</strong> den Abschlussprüfer verbunden.<br />
Fehlurteile werden oft erst aufgedeckt, wenn Dritten daraus ein (finanzieller) Schaden entsteht.<br />
Die Qualität eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks ist nachträglich stark anzuzweifeln,<br />
wenn das geprüfte Unternehmen im Folgejahr erhebliche Verluste verkraften<br />
muss, bestandsgefährdet o<strong>der</strong> insolvent wird.<br />
3 Beachte: Die Definitionen von α-Fehler und β-Fehler sind in <strong>der</strong> Literatur nicht einheitlich.<br />
Sie hängen von <strong>der</strong> Formulierung <strong>der</strong> sogenannten Nullhypothese ab.<br />
137
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Der Abschlussprüfer kann aber nicht <strong>für</strong> jedes Fehlurteil zur Verantwortung gezogen werden.<br />
Der Abschlussprüfer muss nur eine Mindestqualität des Prüfungsurteils garantieren,<br />
nämlich von ca. 95 % Sicherheit bei 2 % Ungenauigkeit. Qualitativ lässt sich das Ziel <strong>der</strong><br />
Prüfung wie folgt formulieren:<br />
”Das Ziel <strong>der</strong> Prüfung ist die Abgabe eines hinreichend sicheren und genauen Urteils mit<br />
minimalen Kosten <strong>für</strong> das Prüfungsunternehmen.”<br />
Dies bedeutet, dass ein bestimmtes verbleibendes Prüfungsrisiko (≤ 5 %), also eine geringe<br />
Unsicherheit, zulässig und unausweichlich ist, denn die Prüfung darf (und kann) nicht zur<br />
Vollprüfung ausgeweitet werden. Das wäre den zu prüfenden Unternehmen in <strong>der</strong> Regel zu<br />
teuer und wi<strong>der</strong>spräche den GoA.<br />
Der α-Fehler wird hier mit dem eigentlichen Prüfungsrisiko gleichgesetzt, da die Wahrscheinlichkeit<br />
des Auftretens eines β-Fehlers aus den oben genannten Gründen als gering<br />
einzustufen ist.<br />
Die verwendete Definition des Prüfungsrisikos unterstellt, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> Beurteilung des Jahresabschlusses vor einer ”Entwe<strong>der</strong>-o<strong>der</strong>-Entscheidung” steht.<br />
Dabei handelt sich aber um eine Vereinfachung <strong>der</strong> viel komplexeren Entscheidungssituation<br />
des Abschlussprüfers. Der Abschlussprüfer kann den Bestätigungsvermerk nicht nur verweigern,<br />
son<strong>der</strong>n nach dem KonTraG gemäß § 322 Abs. 4 dHGB (§ 274 Abs. 3 UGB) einschränken<br />
und um ergänzende Beurteilungen erweitern (Bestätigungsbericht). Aus Vereinfachungsgründen<br />
wird im folgenden nur die ”Entwe<strong>der</strong>-o<strong>der</strong>-Entscheidungssituation” betrachtet.<br />
Bestätigungsvermerk WP IV<br />
323.2 Bestandteile des Prüfungsrisikos<br />
Die Möglichkeit des Auftretens eines Prüfungsfehlers setzt entwe<strong>der</strong> voraus, dass wesentliche<br />
Inkorrektheiten im Jahresabschluss enthalten sind (Fehlerrisiko) und dass diese im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Prüfung nicht erkannt werden (Entdeckungsrisiko) o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
erkennt aus den ihm vorliegenden Prüfungsunterlagen nicht, dass eine potentielle Bestandsgefährdung<br />
(Risiko <strong>der</strong> künftigen Entwicklung) vorliegt, die er im Prüfungsbericht und<br />
eventuell auch im Bestätigungsvermerk angeben müsste.<br />
138
Inhärentes<br />
Risiko<br />
Prüfungstheorie<br />
Prüfungsrisiko<br />
Fehlerrisiko Entdeckungsrisiko<br />
Kontrollrisiko<br />
Risiko<br />
analytischer<br />
Prüfungshandlungen<br />
Abb. 27: Bestandteile des Prüfungsrisikos<br />
Risiko<br />
detaillierter<br />
Prüfungshandlungen<br />
Risiko <strong>der</strong><br />
künftigen Entwicklung<br />
Das Fehlerrisiko gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass in einem Prüfungsobjekt wesentliche<br />
Fehler enthalten sind. Dem Fehlerrisiko ist <strong>der</strong> Abschlussprüfer mit Beginn <strong>der</strong> Prüfung<br />
ausgesetzt. Die Ursachen liegen zum einen in den dem Prüffeld innewohnenden Risiken<br />
(Inhärente Risiken) und zum an<strong>der</strong>en in <strong>der</strong> Fähigkeit des Unternehmens durch ein wirksames<br />
Internes Kontrollsystem (IKS) den Inhärenten Risiken zu begegnen (Kontrollrisiko).<br />
Das Fehlerrisiko ist vom Abschlussprüfer kurzfristig nicht beeinflussbar. Seine Aufgabe ist,<br />
das Fehlerrisiko zu analysieren, zu beurteilen und bei <strong>der</strong> Prüfungsplanung und -<br />
durchführung durch die Wahl eines entsprechend großen Prüfungsumfangs zu berücksichtigen.<br />
Mittelfristig wird <strong>der</strong> Abschlussprüfer versuchen, Fehlerrisiken zu verringern, indem er<br />
sie dem zu prüfenden Unternehmen bewusst macht (Management Letter).<br />
Das Entdeckungsrisiko kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass trotz <strong>der</strong> angewandten<br />
Prüfungshandlungen wesentliche Fehler unentdeckt bleiben.<br />
Das Entdeckungsrisiko wird durch Art, Umfang und Effektivität <strong>der</strong> formellen und materiellen<br />
Prüfungshandlungen bestimmt. Bei konstantem Prüfungsrisiko und erhöhtem Fehlerrisiko<br />
muss <strong>der</strong> Abschlussprüfer seine Prüfungshandlungen so gestalten, dass das Risiko<br />
sinkt, wesentliche Fehler nicht zu entdecken.<br />
Die Differenzierung des Prüfungsrisikos in Fehler- und Entdeckungsrisiko betrifft nicht<br />
nur den Jahresabschluss insgesamt, son<strong>der</strong>n jedes Prüffeld. Die Notwendigkeit, das Prüfungsrisiko<br />
auf Prüffeldebene zu untersuchen, resultiert zum einen aus <strong>der</strong> Gefahr, dass aufgrund<br />
<strong>der</strong> Komplexität des gesamten Prüfungsobjektes wesentliche Sachverhalte übersehen<br />
werden könnten und zum an<strong>der</strong>en aus dem Ziel, das gefor<strong>der</strong>te hinreichend sichere und genaue<br />
Prüfungsurteil mit minimalen Kosten zu erreichen.<br />
139
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Ziel <strong>der</strong> risikoorientierten Abschlussprüfung ist es, die Kosten <strong>der</strong> Prüfung bei gegebenem<br />
Prüfungsrisiko durch eine umfassende Risikoeinschätzung über die Reduktion des Fehlerrisikos<br />
und dadurch bedingte Erhöhung des akzeptablen Entdeckungsrisikos zu minimieren.<br />
Der Grundsatz <strong>der</strong> Eigenverantwortlichkeit (§ 43 Abs. 1 WPO) verlangt, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
seine Entscheidungen selbst trifft. Der Abschlussprüfer ist daher stets<br />
- ungeachtet <strong>der</strong> Reduktion des Fehlerrisikos - verpflichtet, ein Minimum an detaillierten<br />
Prüfungshandlungen durchzuführen, um sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Er darf<br />
sich also auch nicht allein auf das BBR stützen!<br />
Durch das KonTraG erweitert sich das Prüfungsrisiko des Abschlussprüfers um das Risiko<br />
<strong>der</strong> künftigen Entwicklung. Gemäß § 317 Abs. 2 Satz 2 dHGB muss <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
prüfen, ob die Chancen und Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung und evtl. Bestandsgefährdungen<br />
im Lagebericht zutreffend dargestellt sind. Darüber hinaus ist <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
verpflichtet, sowohl im Prüfungsbericht nach § 321 Abs. 1 dHGB (§ 273 Abs. 2 UGB) als<br />
auch im Bestätigungsvermerk gemäß § 322 Abs. 2 Satz 2 dHGB mögliche Fortbestandsrisiken<br />
geson<strong>der</strong>t anzugeben. Hier besteht das Prüfungsrisiko des Abschlussprüfers darin, dass<br />
er Hinweise auf wesentliche Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung nicht erkennt und/o<strong>der</strong> die<br />
wirtschaftliche Lage (Bestandsfestigkeit) des zu prüfenden Unternehmens falsch einschätzt.<br />
Hier könnte ein Instrument wie das BBR unterstützen.<br />
323.3 Fehlerrisiko<br />
323.31 Inhärentes Risiko<br />
Inhärentes Risiko: Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlern in einem Prüffeld, die<br />
alleine o<strong>der</strong> zusammen mit Fehlern in an<strong>der</strong>en Prüffel<strong>der</strong>n wesentlich sind.<br />
Das Inhärente Risiko umfasst die eigentlichen Ursachen <strong>für</strong> Fehler. Sie liegen zum einem im<br />
Prüfungsobjekt/-feld selbst (Charakteristik des Prüffeldes) und zum an<strong>der</strong>en in den äußeren<br />
Bedingungen des Prüfungsobjektes. Die äußeren Bedingungen beeinflussen die Fehleranfälligkeit<br />
des gesamten Rechenwerks des zu prüfenden Unternehmens.<br />
140
Prüfungstheorie<br />
Die beiden Komponenten des Inhärenten Risikos sind:<br />
(a) Die Bedingungen des Inhärenten Risikos:<br />
• makroökonomische Bedingungen<br />
(konjunkturelle Entwicklung, konjunkturpolitische Maßnahmen, gesellschaftspolitische<br />
Ereignisse),<br />
• Branchenbedingungen<br />
(Branchenkonjunktur, Branchenstruktur, Position des Unternehmens innerhalb <strong>der</strong><br />
Branche),<br />
• Unternehmensbedingungen<br />
(wirtschaftliche Lage, Insolvenzwahrscheinlichkeit, Lebensalter des Unternehmens,<br />
Rechtsform, Größe, Qualifikation des Managements).<br />
(b) Die Charakteristika des Inhärenten Risikos:<br />
• Manipulationsanfälligkeit eines Prüffeldes,<br />
• Umfang, Häufigkeit und Komplexität <strong>der</strong> Verarbeitungsprozesse,<br />
• Ausmaß von Nicht-Routinetransaktionen und Schätzungen beim Ansatz und bei <strong>der</strong><br />
Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden,<br />
• Abhängig von Fortbestandsrisiken,<br />
• Umfang <strong>der</strong> Teilschritte <strong>der</strong> Bewertung.<br />
Die Charakteristika des Inhärenten Risikos unterliegen in <strong>der</strong> Regel keinen Verän<strong>der</strong>ungen,<br />
da sie mit dem Geschäft des zu prüfenden Unternehmens und/o<strong>der</strong> den<br />
speziellen Eigenschaften eines Prüffeldes eng verbunden sind.<br />
Die Beurteilung des Inhärenten Risikos durch den Abschlussprüfer erfolgt durch eine umfassende<br />
Risikoanalyse im Rahmen <strong>der</strong> Prüfungsplanung und zu Beginn <strong>der</strong> Prüfung.<br />
Bei <strong>der</strong> Beurteilung des Inhärenten Risikos kann sich <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
• auf Erkenntnisse aus Vorjahresprüfungen und <strong>der</strong> Vorprüfung,<br />
• seiner Kenntnis <strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichen Situation und <strong>der</strong> Branche sowie<br />
• auf Urteile über die Bestandsfestigkeit des zu prüfenden Unternehmens, vor allem in<br />
Form von Branchen- und Zeitvergleichen, stützen.<br />
141
323.32 Kontrollrisiko<br />
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Kontrollrisiko: Wahrscheinlichkeit, dass Fehler in einem Prüffeld durch das IKS des Unternehmens<br />
nicht verhin<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> nicht entdeckt und korrigiert werden. Darüber hinaus ist<br />
nach KonTraG unter dem Kontrollrisiko auch die Gefahr zu subsumieren, dass das von <strong>der</strong><br />
Unternehmensleitung installierte Risikomanagementsystem nicht angemessen ist. Das heißt,<br />
die Unternehmensleitung wird nicht rechtzeitig auf Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung o<strong>der</strong><br />
Fortbestandsrisiken hingewiesen.<br />
Das Kontrollrisiko ist ein Maß <strong>der</strong> Qualität bzw. <strong>der</strong> Effektivität des im Unternehmen installierten<br />
Internen Kontrollsystems (IKS) 4 und des Risikomanagementsystems.<br />
Das IKS ist vornehmlich darauf gerichtet, Fehler zu vermeiden, aufzudecken und zu beheben,<br />
die aus <strong>der</strong> Charakteristik des Inhärenten Risikos resultieren. Vom IKS ist das Risikomanagementsystem<br />
(nach § 91 Abs. 2 AktG) abzugrenzen. Das Risikomanagementsystem<br />
eines Unternehmens übernimmt die Funktionen <strong>der</strong> Erfassung, Messung und Steuerung <strong>der</strong><br />
relevanten Risiken und Risikopotentiale sowie die Überwachung <strong>der</strong> einzelnen Risiken und<br />
des kumulativen Unternehmensrisikos.<br />
Die Beurteilung des IKS erfolgt im Rahmen <strong>der</strong> Systemprüfung, die Teil <strong>der</strong> Vorprüfung<br />
ist. Ergebnis <strong>der</strong> Systemprüfung muss eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit sein, mit<br />
<strong>der</strong> das IKS potentielle wesentliche Fehler nicht verhin<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> nicht entdeckt und korrigiert.<br />
Bei Erstprüfungen erfor<strong>der</strong>t die Einschätzung des Kontrollrisikos eine vollständige Erfassung<br />
und Analyse des IKS. Bei Folgeprüfungen kann <strong>der</strong> Abschlussprüfer auf Erkenntnisse aus<br />
vorangegangenen Prüfungen zurückgreifen. Während <strong>der</strong> Prüfungsdurchführung muss <strong>der</strong><br />
Abschlussprüfer sich stets davon überzeugen, dass das IKS in <strong>der</strong> dokumentierten Form<br />
noch vorhanden ist und über den gesamten Beurteilungszeitraum angewandt wurde.<br />
Jedes Unternehmen benötigt ein Risikomanagementsystem damit die Unternehmensleitung<br />
frühzeitig auf Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung o<strong>der</strong> im schlimmsten Fall Fortbestandsrisiken<br />
reagieren kann. Bei Aktiengesellschaften, die Aktien mit amtlicher Notierung ausgegeben<br />
haben, ist <strong>der</strong> Abschlussprüfer nach § 317 Abs. 4 dHGB verpflichtet zu prüfen, ob <strong>der</strong><br />
Vorstand die ihm nach § 91 Abs. 2 dAktG obliegenden Maßnahmen zur Errichtung eines<br />
Risikomanagementsystems getroffen hat und ob das System seine Aufgabe erfüllt.<br />
Ist ein Risikomanagementsystem fest implementiert, sollte dessen Ausgestaltung in <strong>der</strong> Vorprüfung<br />
aufgenommen und beurteilt werden, soweit dies möglich ist. Der Abschlussprüfer<br />
wird dabei mit dem Problem konfrontiert, dass das Kontrollrisiko eines Risikomanagementsystems<br />
statistisch nicht gemessen werden kann. Zum einen liefert ein Risikomanagementsystem<br />
prognostische Aussagen und zum an<strong>der</strong>en kann aufgrund <strong>der</strong> Ungewissheit <strong>der</strong><br />
künftigen Entwicklung kein Sollobjekt bestimmt werden.<br />
4<br />
Das IKS ist die Summe <strong>der</strong> Regeln und Verfahren, die die Richtigkeit <strong>der</strong> Erfassung und Verarbeitung <strong>der</strong> in<br />
einem Unternehmen anfallenden Geschäftsvorfälle sichern sollen.<br />
142
Prüfungstheorie<br />
Das Kontrollrisiko kann entwe<strong>der</strong> aus fehlenden o<strong>der</strong> mangelhaften Kontrollelementen des<br />
IKS resultieren, o<strong>der</strong> vorgesehene Kontrollen werden nicht ausgeführt o<strong>der</strong> funktionieren<br />
nicht wie geplant. Das Kontrollrisiko kann nie gleich Null sein. Interne Kontrollen können<br />
z. B. durch mangelnde Sorgfalt zeitweise unwirksam werden. Des Weiteren besteht stets die<br />
Möglichkeit, dass sich das Management über bestehende und funktionierende Kontrollen<br />
hinwegsetzt (Management Override).<br />
Das Kontrollrisiko wie das Inhärente Risiko sind <strong>für</strong> den aktuellen Prüfungsauftrag ein Datum.<br />
Beide Größen liegen in <strong>der</strong> Verantwortung des zu prüfenden Unternehmens.<br />
323.4 Entdeckungsrisiko<br />
323.41 Risiko analytischer Prüfungshandlungen<br />
Risiko analytischer Prüfungshandlungen: Wahrscheinlichkeit, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer aufgetretene<br />
und durch das IKS nicht beseitigte wesentliche Fehler durch analytische Prüfungshandlungen<br />
ebenfalls nicht entdeckt.<br />
Exkurs: Analytische Prüfungshandlungen (vgl. IDW PS 312).<br />
Analytische Prüfungshandlungen werden unterteilt in<br />
a) Vergleichszahlen- und Kennzahlenanalyse und<br />
b) Analyse mit Hilfe wirtschaftlich orientierter Kontrollrechnungen.<br />
ad a) Vergleichszahlen und Kennzahlenanalyse<br />
Bei <strong>der</strong> Vergleichszahlenanalyse werden Jahresabschlusszahlen durch Zeit- und Betriebsvergleiche<br />
auf absolute Än<strong>der</strong>ungen untersucht. Sind die festgestellten Verän<strong>der</strong>ungen<br />
nicht erklärbar, können sie Hinweise auf Fehler im Prüfungsfeld geben.<br />
Bei <strong>der</strong> Prüfung mit Kennzahlen greift <strong>der</strong> Abschlussprüfer auf Verhältniszahlen zurück<br />
(z. B.: Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquote, statischer Verschuldungsgrad).<br />
Die ermittelten Kennzahlen können Vorjahres- o<strong>der</strong> Branchenwerten gegenübergestellt<br />
werden. Auch hier können nicht erklärbare Abweichungen Hinweise auf Fehler<br />
geben.<br />
Will <strong>der</strong> Abschlussprüfer zu einem umfassenden Bild <strong>der</strong> wirtschaftlichen Lage des<br />
zu prüfenden Unternehmens gelangen, wird er Kennzahlenkataloge heranziehen, die<br />
alle Informationsbereiche des Jahresabschlusses und damit die wirtschaftliche Lage<br />
des Unternehmens wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
ad b) Analyse mit Hilfe wirtschaftlich orientierter Kontrollrechnungen:<br />
Mit Hilfe wirtschaftlicher Kontrollrechnungen versucht <strong>der</strong> Abschlussprüfer, die<br />
Daten <strong>der</strong> Finanzbuchhaltung durch unabhängige Aufzeichnungen auf ihre Richtig-<br />
143
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
keit zu überprüfen. Diese Kontrollrechnungen werden vor allem bei <strong>der</strong> Prüfung von<br />
GuV-Posten angewandt.<br />
Bei einem Fertigungsbetrieb kann von den zugekauften und verbrauchten Rohstoffen<br />
und Waren auf die Menge <strong>der</strong> hergestellten Erzeugnisse geschlossen werden, sofern<br />
diese in einem festen Verhältnis zueinan<strong>der</strong> stehen. Die Personalkosten können<br />
anhand von Personalstatistiken unter <strong>der</strong> Berücksichtigung von Tarifän<strong>der</strong>ungen<br />
plausibilisiert werden.<br />
Beurteilung analytischer Prüfungshandlungen:<br />
Die Qualität analytischer Prüfungshandlungen hängt von <strong>der</strong> Zuverlässigkeit des zur<br />
Verfügung stehenden Datenmaterials ab. Es besteht stets die Gefahr, dass das zu<br />
Vergleichszwecken herangezogene Datenmaterial fehlerhaft ist.<br />
Vor <strong>der</strong> Anwendung analytischer Prüfungshandlungen ist zu klären, ob die Bildung<br />
bestimmter Verhältniszahlen betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Darüber hinaus können<br />
Kennzahlen durch bilanzielle Ansatz- und Bewertungswahlrechte, Ermessensspielräume<br />
sowie Sachverhaltsgestaltungen verzerrt werden. Der Abschlussprüfer<br />
sollte solche Zusammenhänge erkennen und bei seinen Schlussfolgerungen berücksichtigen.<br />
Bei stark aggregierten Daten besteht die Möglichkeit, dass wesentliche Fehler saldiert<br />
und verdeckt werden.<br />
Analytische Prüfungshandlungen sind zur abschließenden Beurteilung eines kritischen<br />
Prüfungsfeldes nicht ausreichend. In <strong>der</strong> Praxis werden analytische Prüfungshandlungen<br />
daher stets mit detaillierten Prüfungshandlungen kombiniert.<br />
323.42 Risiko detaillierter Prüfungshandlungen<br />
Risiko detaillierter Prüfungshandlungen: Wahrscheinlichkeit, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer aufgetretene<br />
und we<strong>der</strong> durch das IKS noch aufgrund analytischer Prüfungshandlungen entdeckte<br />
wesentliche Fehler mit Hilfe detaillierter ergebnisorientierter Prüfungshandlungen<br />
ebenfalls nicht entdeckt.<br />
Das Risiko detaillierter Prüfungshandlungen wird in das Auswahlrisiko und das Prüferrisiko<br />
unterteilt:<br />
(a) Auswahlrisiko (Sampling Risk)<br />
• Nur in Ausnahmefällen wird <strong>der</strong> Abschlussprüfer eine Vollprüfung vornehmen, da<br />
eine lückenlose Prüfung i.d.R. nicht wirtschaftlich ist und gegen die Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung verstoßen würde.<br />
• Bei den Verfahren <strong>der</strong> Auswahlprüfung müssen indes unentdeckte Fehler in Kauf<br />
genommen werden. Auswahlrisiko<br />
144
(b) Prüferrisiko (Non Sampling Risk)<br />
Das Prüferrisiko kann in das:<br />
Prüfungstheorie<br />
1. Wirksamkeitsrisiko,<br />
2. Anwendungsrisiko und<br />
3. Interpretationsrisiko unterteilt werden.<br />
Zu 1.: Das Wirksamkeitsrisiko kennzeichnet die Gefahr, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer eine Prüfungshandlung<br />
auswählt, die nicht auf die Erfor<strong>der</strong>nisse des zu prüfenden Sachverhalts<br />
abgestimmt ist. So kann bspw. die Vollständigkeit des ausgewiesenen Bestandes<br />
an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nicht durch eine retrograde<br />
Prüfung überprüft werden.<br />
Zu 2.: Das Anwendungsrisiko tritt im Prüfungsprozess auf, wenn Prüfungshandlungen nicht<br />
adäquat angewandt werden. Für die Anwendung mathematisch-statistischer Methoden<br />
müssen bestimmte Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sein.<br />
(Vgl.: Kap. 233.412.)<br />
Zu 3.: Das Risiko, eine Prüfungsfeststellung falsch zu interpretieren, kann z. B. aus mangelnden<br />
Rechnungslegungskenntnissen, mangeln<strong>der</strong> Sorgfalt des Abschlussprüfers resultieren.<br />
Die Ursachen des Prüferrisikos liegen in einer unzureichenden Planung und Überwachung<br />
<strong>der</strong> Prüfung, mangeln<strong>der</strong> Qualifikation und im schlimmsten Fall in mangeln<strong>der</strong> Integrität<br />
des Abschlussprüfers.<br />
Wird ein Fehlurteil aufgedeckt, ist <strong>der</strong> Abschlussprüfer zur Verantwortung zu ziehen. Der<br />
Abschlussprüfer kann sich indes exkulpieren, wenn er die Mindesturteilssicherheit eingehalten<br />
und dies in seinen Arbeitspapieren dokumentiert hat.<br />
Im Falle einer Vollerhebung eines Prüffeldes strebt das Auswahlrisiko gegen Null und es<br />
verbleibt nur das Prüferrisiko.<br />
145
323.5 Risiko <strong>der</strong> künftigen Entwicklung<br />
323.51 Definition<br />
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Gefahr, dass <strong>der</strong> Abschlussprüfer in den ihm vorliegenden Unterlagen und im Prüfungsprozess<br />
Hinweise auf wesentliche Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung nicht erkennt und/o<strong>der</strong><br />
die wirtschaftliche Lage (Bestandsfestigkeit) des zu prüfenden Unternehmens falsch, d. h. zu<br />
positiv, einschätzt.<br />
Das Risiko <strong>der</strong> künftigen Entwicklung ist nach KonTraG die Gefahr einer möglichen künftigen<br />
Nettovermögensmin<strong>der</strong>ung <strong>für</strong> das zu prüfende Unternehmen. Diese mögliche Nettovermögensmin<strong>der</strong>ung<br />
resultiert aus einer eventuellen negativen Abweichung <strong>der</strong> künftig tatsächlich<br />
realisierten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von den zum Bilanzstichtag geplanten<br />
Werten <strong>der</strong> Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.<br />
Für den Abschlussprüfer sind nicht sämtliche negativen Planabweichungen und damit alle<br />
Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung relevant, son<strong>der</strong>n nur die wesentlichen:<br />
• Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachteilig beeinflussen<br />
könnten und<br />
• bestandsgefährdende Risiken (Insolvenzgefahr) bzw. die Gefahr eines künftigen Scheiterns<br />
des Unternehmens (Non Going Concern).<br />
Neben gewichtigen Einzelrisiken können auch immer eine große Zahl an einzeln betrachtet<br />
unbedeutenden Risiken gemeinsam zu wesentlichen negativen Abweichungen von <strong>der</strong> erwarteten<br />
wirtschaftlichen Lage o<strong>der</strong> zu einer Bestandsgefährdung führen.<br />
Die Ursachen <strong>für</strong> Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung sind vielfältig und finden sich auf allen<br />
Unternehmensebenen. Sie resultieren aus:<br />
• Än<strong>der</strong>ungen von politischen o<strong>der</strong> ökonomischen Faktoren (Wechselkurse, Inflationsraten,<br />
Zölle etc.),<br />
• Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Branchenstruktur durch neue Wettbewerber und/o<strong>der</strong> neue Technologien,<br />
• Grad <strong>der</strong> Akzeptanz <strong>der</strong> Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sowie<br />
• Rechtsstreitigkeiten, Reklamationen o<strong>der</strong> Klagen.<br />
Nach dem KonTraG ist es nicht die Aufgabe des Abschlussprüfers, eine eigene Prognose<br />
bezüglich <strong>der</strong> Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung zu erstellen. Der Abschlussprüfer ist auf<br />
die Risikoprognose des Unternehmens angewiesen und soll überprüfen, ob die vorgenommene<br />
Inventur <strong>der</strong> Risiken sachgerecht durchgeführt wurde und mit den Erkenntnissen seiner<br />
Prüfung übereinstimmt.<br />
Der Abschlussprüfer muss aber aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen, die wirtschaftliche<br />
Lage, die Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung und Fortbestandsgefährdungen ermitteln,<br />
soweit das möglich ist und diese sowohl im Prüfungsbericht als auch gegebenenfalls<br />
im Bestätigungsvermerk berichten.<br />
146
Prüfungstheorie<br />
Die Inventur <strong>der</strong> Risiken durch das zu prüfende Unternehmen muss gewährleisten, dass<br />
sämtliche drohenden und möglichen Nettovermögensmin<strong>der</strong>ungen erfasst werden. Die Inventur<br />
<strong>der</strong> Risiken erstreckt sich daher auf:<br />
• Geschäfte, die mit <strong>der</strong> Beschaffung von Beständen eingeleitet worden sind,<br />
• Geschäfte, die mit Abschluss von (Beschaffungs- bzw.) Absatzverträgen eingeleitet<br />
worden sind und auf<br />
• Geschäfte, die am Abschlussstichtag noch nicht abgeschlossen sind, <strong>der</strong>en Abschluss<br />
aber mit einer erheblichen, nicht unbedingt überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu<br />
erwarten ist.<br />
Unabdingbare Voraussetzung <strong>für</strong> eine dem Grundsatz <strong>der</strong> Vollständigkeit genügende Inventur<br />
<strong>der</strong> Risiken ist ein funktionsfähiges Risikomanagementsystem des zu prüfenden Unternehmens.<br />
Die vom zu prüfenden Unternehmen ermittelten Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung sind<br />
vom Abschlussprüfer dahingehend zu beurteilen, ob die Risiken einzeln o<strong>der</strong> kumulativ wesentlich<br />
und berichtspflichtig sind.<br />
Diese Aufgabe kann <strong>der</strong> Abschlussprüfer nur dann sachgerecht erfüllen und das Risiko einer<br />
Fehleinschätzung minimieren, wenn er über eine genaue Kenntnis <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit des<br />
zu prüfenden Unternehmens zum Bilanzstichtag verfügt. Das heißt letztendlich, <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
muss sich ein eigenes Urteil bzgl. <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit bzw. Bestandsgefährdung<br />
des zu prüfenden Unternehmens bilden.<br />
323.52 Instrumente zur Beurteilung <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit<br />
Ausgehend von den Jahresabschlüssen des zu prüfenden Unternehmens lässt sich mit Hilfe<br />
mo<strong>der</strong>ner Verfahren <strong>der</strong> Jahresabschlussanalyse die Bestandsfestigkeit objektiv beurteilen.<br />
Bei mo<strong>der</strong>nen empirischen Verfahren <strong>der</strong> Jahresabschlussanalyse werden auf <strong>der</strong> Basis einer<br />
hinreichend großen Zahl von solventen und insolventen Unternehmen mit Hilfe mathematisch-statischer<br />
Verfahren die relevanten Kennzahlen zur Beurteilung <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit<br />
eines Unternehmens objektiv ausgewählt und zu einem Gesamtrisikoindex verdichtet.<br />
Am Institut <strong>für</strong> Revisionswesen wurde in Zusammenarbeit mit Baetge & Partner mittels <strong>der</strong><br />
Künstlichen Neuronalen Netz-Analyse (KNNA) ein Klassifikator entwickelt, mit dem <strong>der</strong><br />
Abschlussprüfer die Bestandsfestigkeit des zu prüfenden Unternehmens in Form einer Aposteriori-Insolvenzwahrscheinlichkeit<br />
beurteilen kann. Der zur Zeit leistungsfähigste Klassifikator<br />
ist das Bilanzbonitätsrating BP-14 (Backpropagation-Netz mit 14 Kennzahlen), das<br />
sog. BBR-Baetge-Bilanzbonitäts-Rating Die Kennzahlen des BBR erfassen alle relevanten<br />
Kennzahlen <strong>der</strong> Vermögens-, Finanz- und Ertragslage so, dass ein umfassendes Urteil über<br />
die Bestandsfestigkeit des zu prüfenden Unternehmens gewährleistet ist. Zudem handelt es<br />
sich um ”intelligente” Kennzahlen, die die vom zu prüfenden Unternehmen eventuell vorgenommenen<br />
bilanzpolitischen und sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen konterkarieren.<br />
147
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Ein Bilanz-Rating des zu prüfenden Unternehmens ermöglicht dem Abschlussprüfer, die<br />
Bestandsfestigkeit des zu prüfenden Unternehmens zur Abwehr <strong>der</strong> Risiken <strong>der</strong> künftigen<br />
Entwicklung am Bilanzstichtag zu messen. Mit diesem Wissen ist <strong>der</strong> Abschlussprüfer in <strong>der</strong><br />
Lage, die Risiken aus den eingeleiteten Geschäften und den geplanten wirtschaftlichen Aktivitäten<br />
angemessen zu werten: Ein Unternehmen mit hoher Bestandsfestigkeit ist in <strong>der</strong> Lage,<br />
Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung abzufe<strong>der</strong>n, ohne dass die wirtschaftliche Lage o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Fortbestand des Unternehmens gefährdet wird. Demgegenüber kann <strong>für</strong> ein Unternehmen<br />
mit geringer Bestandskraft unter Umständen bereits aus einer künftigen Geschäftstätigkeit<br />
mit geringem Risiko die Gefahr des Scheiterns resultieren.<br />
Durch die Anfor<strong>der</strong>ung eines Bilanzbonitätsratings seines zu prüfenden Unternehmens<br />
kann <strong>der</strong> Abschlussprüfer Unternehmensschieflagen frühzeitig erkennen und darüber berichten.<br />
Das zu prüfende Unternehmen kann rechtzeitig Maßnahmen zur Abwendung <strong>der</strong><br />
drohenden Gefahren treffen.<br />
Darüber hinaus erlaubt das Bilanzbonitätsrating dem Abschlussprüfer, Prüfungsschwerpunkte<br />
festzulegen. Kennzahlen des BBR, die im Vergleich zu an<strong>der</strong>en Unternehmen o<strong>der</strong><br />
im Zeitvergleich eine negative Entwicklung zeigen, sind <strong>für</strong> den Abschlussprüfer ein wichtiges<br />
Indiz <strong>für</strong> kritische Prüfungsfel<strong>der</strong>. Der Abschlussprüfer kann diese Information nutzen,<br />
um seine Prüfungsintensität entsprechend anzupassen und damit die Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong><br />
Prüfung verbessern.<br />
Zusätzlich zum Einsatz des BBR muss <strong>der</strong> Abschlussprüfer qualitative Unternehmensmerkmale<br />
analysieren, die Hinweise auf mögliche Fortbestandsrisiken liefern könnten. Damit<br />
keine Negativmerkmale übersehen werden, sollte <strong>der</strong> Abschlussprüfer eine auf das zu prüfende<br />
Unternehmen abgestimmte Checkliste einsetzen.<br />
148
Beurteilung <strong>der</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ung des Wortst-<br />
Case-<br />
Fortbestandsrisikos:<br />
Beurteilung des<br />
Lebenswandels (Worst-<br />
Case-Planabschluß)<br />
des Mandanten:<br />
Beurteilung des<br />
Gesundheitszustandes<br />
(IST-Abschluß)<br />
des Mandanten:<br />
Beurteilung mit einer<br />
Risiko- bzw.<br />
Fortbestands-Checkliste<br />
(Inventur <strong>der</strong> Risiken):<br />
Fehlbericht o<strong>der</strong> besser:<br />
Angabe <strong>der</strong><br />
Bestandsfestigkeit (1-<br />
Fortbestandsrisiko)<br />
Worst-Case-Planabschluß wird mit dem<br />
Baetge-Bilanz-Rating beurteilt.<br />
Unternehmensbonität wird mit<br />
dem Baetge-Bilanz-Rating<br />
beurteilt<br />
WP beurteilt das Unternehmen anhand einer<br />
Risiko- bzw. Fortbestands-Checkliste . Dabei sind<br />
alle Kriterien zu berücksichtigen, die einen dauerhaften<br />
Fortbestand (Going-Concern) des Unternehmens zweifelhaft<br />
erscheinen lassen. Ferner sind Vorgänge von beson<strong>der</strong>er<br />
Bedeutung nach dem Abschlußstichtag zu berücksichtigen.<br />
Hat sich das Worst-<br />
Case-Plan-Bilanz-Rating<br />
Nein Nein<br />
gegenüber dem Ist-Abschluß<br />
verschlechtert?<br />
Ergebnis des<br />
Baetge-Bilanz-Ratings<br />
des Worst-Case-Plan-<br />
Abschlusses: "Insolvenzgefährdung"?<br />
Nein<br />
Ergebnis des<br />
Bilanz-Ratings des<br />
Ist-Abschlusses: "Insolvenzgefährdung"?<br />
Prüfungstheorie<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
WP prüft die Verschlechterung<br />
Nein des Bilanz-Ratings<br />
WP prüft Urteil des Worst-Case-<br />
Plan-Bilanz-Ratings<br />
WP prüft Urteil des<br />
Bilanz-Ratings.<br />
Nein<br />
Zeigt die Risiko- bzw. Fortbestands-<br />
Checkliste Zweifel am Going<br />
Concern?<br />
Ja<br />
Nein<br />
Ist die Worst-Case-<br />
Güteklasse gegenüber<br />
dem Ist-Abschluß<br />
schlechter?<br />
Nein<br />
Ist das Urteil des WP:<br />
"Insolvenzgefährdung"?<br />
Nein<br />
Ist das Urteil des WP:<br />
"Insolvenzgefährdung"?<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Angabe <strong>der</strong> Erhöhung des<br />
Worst-Case-Fortbestandsrisikos<br />
Angabe <strong>der</strong> künftigen<br />
Bestandsgefährdung durch Nennung<br />
des künftigen Fortbestandsrisikos im<br />
Prüfungsbericht (und<br />
Bestätigungsvermerk)<br />
Angabe <strong>der</strong> Bestandsgefährdung<br />
durch Nennung<br />
des Fortbestandsrisikos im<br />
Prüfungsbericht (und<br />
Bestätigungsvermerk).<br />
Angabe von Fortbestandsrisiken im<br />
Prüfungsbericht und gegebenenfalls im<br />
Bestätigungsvermerk.<br />
Beurteilung, ob die Risiken <strong>der</strong> künftigen<br />
Entwicklung im Lagebericht zutreffend<br />
dargestellt sind.<br />
Abb. 28: Entscheidungsprozess bzgl. <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit eines Unternehmens bei Einsatz des BBR<br />
149
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Eine solche Checkliste sollte u. a. folgende Aspekte berücksichtigen:<br />
Wirtschaftliche Negativmerkmale<br />
− im globalen Umfeld, d. h. im gesamtwirtschaftlichen, rechtlich-politischen, wissenschaftlich-technischen<br />
sowie ökologischen Umfeld als Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Unternehmenstätigkeit.<br />
− im Unternehmensumfeld, d. h. in <strong>der</strong> Branchenentwicklung, den Marktbedingungen<br />
auf Absatz- und Beschaffungsmärkten sowie den Wettbewerbsverhältnissen.<br />
− im Unternehmen, d. h. in <strong>der</strong> Leistungs- und Produktpalette, <strong>der</strong> Beschaffungs- und<br />
Absatzpolitik, <strong>der</strong> strategischen Ausrichtung des Unternehmens, in den Finanzierungsstrategien,<br />
in <strong>der</strong> Innovationspolitik etc.<br />
Negativmerkmale im Management z. B.:<br />
− Verwicklung in strafbare Handlungen/schwerwiegende Rechtsverstöße.<br />
− Große persönliche Probleme <strong>der</strong> Unternehmensleitung.<br />
− Unzuverlässigkeit des Managements.<br />
Negativmerkmale in Unternehmensbereichen:<br />
− Information, Planung, Organisation und Kontrolle.<br />
− Beschaffung, Lagerhaltung.<br />
− Branchenabhängigkeit.<br />
Negativmerkmale in <strong>der</strong> Kontoführung:<br />
− Dauerhaftes Überschreiten von Kreditlinien.<br />
− Keine Skonto-Inanspruchnahme.<br />
− Steigende Gesamtverschuldung.<br />
− Kurzfristige Fremdfinanzierung.<br />
Spezielle Negativmerkmale:<br />
− Einschränkung/Verweigerung des Bestätigungsvermerks im Vorjahr.<br />
− Risiken aus laufenden Gerichtsprozessen.<br />
− Übernahme von hohen Eventualrisiken.<br />
− Mängel im Risikomanagementsystem.<br />
− Abhängigkeit des Unternehmens von wenigen o<strong>der</strong> nur einem einzigen Lieferanten,<br />
Abnehmer(n), Produkt(en), Geldgeber(n) o<strong>der</strong> Rohstoff(en).<br />
− Beson<strong>der</strong>e (wertbegründende) Vorfälle nach dem Bilanzstichtag.<br />
Die Bestandsfestigkeit des zu prüfenden Unternehmens hat eine große Bedeutung <strong>für</strong> das<br />
Inhärente Risiko. Unternehmen in einer schlechten wirtschaftlichen Verfassung werden<br />
häufig versuchen, sich durch z. B. Überbewertungen des Vorratsvermögens o<strong>der</strong> unzulässige<br />
Aktivierung von Aufwendungen besser darzustellen, als es den tatsächlichen Gegebenheiten<br />
entspricht.<br />
Das BBR liefert hinsichtlich <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit des zu prüfenden Unternehmens statistisch<br />
abgesicherte und zu einem Gesamtrisikoindex (N-Wert) verdichtete Informationen.<br />
Dieser N-Wert ermöglicht dem Abschlussprüfer, das Risiko einer Fehleinschätzung des Risikos<br />
<strong>der</strong> künftigen Entwicklung zu minimieren. Dieses Risiko <strong>der</strong> Fehleinschätzung wird<br />
weiter reduziert, wenn <strong>der</strong> Abschlussprüfer die qualitativen Negativmerkmale des zu prüfen-<br />
150
Prüfungstheorie<br />
den Unternehmens umfassend analysiert und vor dem Hintergrund <strong>der</strong> ermittelten Bestandsfestigkeit<br />
bewerten kann.<br />
33 Das Prüfungsrisikomodell<br />
331. Aufbau des Prüfungsrisikomodells<br />
Eine Möglichkeit, die Risikosituation des Abschlussprüfers darzustellen, besteht in <strong>der</strong> Abbildung<br />
des Prüfungsrisikos und dessen Bestandteilen in einem Risikomodell:<br />
Prüfungsrisiko = Fehlerrisiko x Entdeckungsrisiko<br />
PR = (IR x KR) x (RaP x RdP)<br />
mit<br />
PR = Prüfungsrisiko<br />
IR = Inhärentes Risiko<br />
KR = Kontrollrisiko<br />
RaP = Risiko analytischer Prüfungshandlungen<br />
RdP = Risiko detaillierter Prüfungshandlungen<br />
Das Prüfungsrisikomodell ist ein vereinfachtes Abbild <strong>der</strong> Risikosituation des Abschlussprüfers.<br />
Sein Zweck ist das Offenlegen <strong>der</strong> Beziehungen zwischen Fehlerrisiko und Entdeckungsrisiko,<br />
um die Prüfungsplanung nachhaltig zu verbessern und Hinweise auf die Bestimmung<br />
<strong>der</strong> Art und des Umfangs <strong>der</strong> Prüfungshandlungen zu gewinnen.<br />
Im Prüfungsrisikomodell werden allerdings nur Prüfungsrisiken erfasst, die in <strong>der</strong> vergangenheitsorientierten<br />
Rechnungslegung des zu prüfenden Unternehmens enthalten sind. Das<br />
Risiko <strong>der</strong> künftigen Entwicklung, die Gefahr wesentliche Risiken <strong>der</strong> künftigen Entwicklung<br />
nicht zu erkennen und/o<strong>der</strong> die Bestandsfestigkeit falsch einzuschätzen, wird im Prüfungsrisikomodell<br />
nicht abgebildet. Dieses Prüfungsrisiko wird maßgeblich durch die künftigen<br />
Geschäfte des zu prüfenden Unternehmens beeinflusst, die allerdings zum großen Teil<br />
erst nach Abschluss <strong>der</strong> Prüfung realisiert werden.<br />
151
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
Das Prüfungsmodell lässt sich durch die Regenwolkenanalogie veranschaulichen:<br />
Internes Jahresabschlußprüfung<br />
Kontrollsystem<br />
Abb. 29: Regenwolkenanalogie<br />
Prüfungsrisiko<br />
IKS/IÜS/RMS<br />
Die Möglichkeit, dass in einem Prüffeld wesentliche Fehler auftreten (Inhärentes Risiko),<br />
wird durch den Regen dargestellt. Die aufgespannten (löchrigen?) Schirme sind Maßnahmen<br />
des zu prüfenden Unternehmens und des Abschlussprüfers, wesentliche Fehler zu verhin<strong>der</strong>n.<br />
152
Prüfungstheorie<br />
Zunächst kann das zu prüfende Unternehmen ein IKS installieren, durch das Fehler verhin<strong>der</strong>t<br />
o<strong>der</strong> entdeckt und korrigiert werden kann. Es besteht indes die Gefahr, dass wesentliche<br />
Fehler durch das IKS we<strong>der</strong> verhin<strong>der</strong>t noch aufgedeckt und korrigiert werden o<strong>der</strong> dass wesentliche<br />
Fehler das IKS umgehen (Kontrollrisiko).<br />
Durch seine analytischen und detaillierten Prüfungshandlungen spannt <strong>der</strong> Abschlussprüfer<br />
im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong> einen weiteren Schirm auf. Einige Regentropfen indes<br />
passieren (Prüferrisiko) o<strong>der</strong> umgehen (Auswahlrisiko) auch diesen Schirm. Die verbleibenden<br />
Regentropfen, die den Boden (Jahresabschluss) erreichen, stellen das Prüfungsrisiko<br />
des Abschlussprüfers dar.<br />
Ziel des Abschlussprüfers ist, seinen Schirm unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Qualität des IKS des<br />
zu prüfenden Unternehmens durch eine effektive Kombination von analytischen und detaillierten<br />
Prüfungshandlungen so weit aufzuspannen, dass er trotz <strong>der</strong> verbleibenden Regentropfen<br />
ein hinreichend sicheres und genaues Urteil abgeben kann (Mindestqualität des Urteils).<br />
Je löchriger und kleiner <strong>der</strong> Schirm (IKS) des zu prüfenden Unternehmens ist, desto weiter<br />
muss <strong>der</strong> Abschlussprüfer seinen Schirm durch die Auswahl effektiver Prüfungshandlungen<br />
und die Bestimmung des Prüfungsumfangs aufspannen.<br />
Aus <strong>der</strong> Mindestqualität des Prüfungsurteils resultiert <strong>für</strong> den Abschlussprüfer ein maximal<br />
zulässiges Prüfungsrisiko von 5 %. 5 Der Abschlussprüfer muss das Inhärente Risiko und das<br />
Kontrollrisiko analysieren und beurteilen. Durch Umformen <strong>der</strong> Gleichung des Prüfungsrisikomodells<br />
kann das Entdeckungsrisiko ermittelt werden:<br />
5<br />
Entdeckungsrisiko (RaP x RdP) =<br />
Prüfungsrisiko (PR)<br />
Inhärentes Risiko (IR) x Kontrollrisiko (KR)<br />
Das Entdeckungsrisiko kann durch die Gestaltung des Prüfungsprogramms beeinflusst werden.<br />
Ein niedriges Entdeckungsrisiko erfor<strong>der</strong>t zuverlässigere Prüfungshandlungen und erhöhte<br />
Stichprobenumfänge.<br />
”Ziel <strong>der</strong> Prüfung ist die Abgabe eines hinreichend vertrauenswürdigen Urteils ... mit minimalen Kosten <strong>für</strong> die<br />
Prüfungsunternehmung.”<br />
Die Abgabe eines hinreichend vertrauenswürdigen Urteils erfor<strong>der</strong>t eine Prüfungssicherheit von 95% und eine<br />
Prüfungsgenauigkeit von 99%. Die Mindestqualität des Urteils kann somit nur bei einem Prüfungsfehler von ≤<br />
5% erreicht werden.<br />
153
Risikoorientierte Abschlußprüfung<br />
332. Kritische Würdigung des Prüfungsrisikomodells<br />
(a) Nutzen des Prüfungsrisikomodells<br />
• Im Prüfungsprozess gewonnene Informationen können mit dem Prüfungsrisikomodell<br />
systematisiert und hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Prüfungsrisiko beurteilt<br />
werden.<br />
• Das Prüfungsrisikomodell för<strong>der</strong>t die isolierte Betrachtung einzelner unternehmensspezifischer<br />
Risikokomponenten.<br />
• Die Zerlegung des Prüfungsrisikos zwingt den Abschlussprüfer, sich umfassend mit<br />
dem Prüfungsobjekt zu beschäftigen und explizit Informationen zu analysieren, die<br />
er bei einem lediglich globalen Ansatz übersehen könnte.<br />
• Bei Prüffel<strong>der</strong>n, die auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren geprüft werden,<br />
besteht die Möglichkeit, das berechnete Risiko detaillierter Prüfungen direkt in die<br />
Bestimmungsgleichung des Stichprobenumfangs zu integrieren.<br />
• Der Abschlussprüfer muss die Höhe des Inhärenten Risikos, des Kontrollrisikos und<br />
des Risikos analytischer Prüfungshandlungen subjektiv schätzen. Dies ist nur möglich,<br />
wenn er sich mit dem Prüfungsfeld intensiv auseinan<strong>der</strong>setzt. Seine Entscheidung<br />
hat er zu begründen und in den Arbeitspapieren zu dokumentieren.<br />
(b) Kritik am Prüfungsrisikomodell<br />
• Mangelnde Unabhängigkeit:<br />
Die Anwendung des Multiplikationssatzes <strong>für</strong> die Wahrscheinlichkeitsrechnung, <strong>der</strong><br />
z.B. <strong>für</strong> drei unabhängige Ereignisse<br />
P (A ∩ A ∩ A ) = P(A ) x P(A ) x P(A )<br />
1 2 3 1 2 3<br />
lautet, verlangt, dass die einzelnen Teilrisiken unabhängig voneinan<strong>der</strong> sind, was<br />
nicht <strong>der</strong> Realität entspricht.<br />
Das Inhärente Risiko wird durch das Kontrollrisiko beeinflusst. Ein schwaches IKS<br />
kann zu einer sorgloseren Einstellung bei <strong>der</strong> Aufgabenerfüllung führen; Konsequenz:<br />
Das Inhärente Risiko nimmt zu.<br />
154
Prüfungstheorie<br />
• Mangelnde Objektivität<br />
Die meisten Komponenten des Risikomodells müssen vom Prüfer subjektiv geschätzt<br />
werden. Für das Inhärente Risiko und das Kontrollrisiko liegen keine objektiven<br />
Wahrscheinlichkeiten vor.<br />
• Mangelnde Gewichtung<br />
Die Teilrisiken sind gleichgewichtet.<br />
Das zulässige Niveau des Prüfungsrisikos lässt sich durch verschiedene Kombinationen<br />
aus Inhärentem Risiko, Kontrollrisiko und Entdeckungsrisiko einhalten, d. h.,<br />
eine wechselseitige Kompensation <strong>der</strong> Risikokomponenten ist zulässig. Daraus folgt,<br />
dass das Risikomodell in bestimmten Situationen einen vollständigen Verzicht auf<br />
ergebnisorientierte Prüfungshandlungen signalisiert:<br />
(c) Fazit<br />
Prüfungsrisiko 5%,<br />
Inhärentes Risiko 50%<br />
Kontrollrisiko 10%<br />
Entdeckungsrisiko =<br />
0,05<br />
= 1<br />
0,5 x 0,1<br />
Das Entdeckungsrisiko kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass trotz <strong>der</strong> angewandten<br />
Prüfungshandlungen zur Fehleraufdeckung wesentliche Fehler unentdeckt<br />
bleiben.<br />
Für die Abgabe eines hinreichend sicheren und genauen Urteils ist nach den Berufsgrundsätzen<br />
ein Prüfungsrisiko i.H.v. 5% akzeptabel. Ist nun ein Prüffeld durch ein<br />
Inhärentes Risiko i.H.v. 50% und ein Kontrollrisiko i.H.v. 10% gekennzeichnet,<br />
könnte <strong>der</strong> Abschlussprüfer theoretisch auf eigene Prüfungshandlungen verzichten,<br />
da bei dieser Datenkonstellation ein Entdeckungsrisiko von 100% zulässig wäre.<br />
Solch ein Ergebnis wi<strong>der</strong>spricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung.<br />
Der Grundsatz <strong>der</strong> Eigenverantwortlichkeit verlangt, dass sich <strong>der</strong> Abschlussprüfer sein<br />
Urteil selbst bildet und seine Entscheidungen in eigener Verantwortung bestimmt. Der<br />
Abschlussprüfer hat daher stets ein Minimum an detaillierten Prüfungshandlungen vorzunehmen.<br />
Der Zweck des Prüfungsrisikomodells ist, die Beziehungen zwischen den vorgestellten<br />
Risikoarten offenzulegen und ihre Wirkungen auf die Qualität des Prüfungsurteils<br />
darzustellen. Der Abschlussprüfer kann daraus Konsequenzen <strong>für</strong> die Bestimmung<br />
von Art und Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen ableiten und auf diese Weise<br />
die Prüfungsplanung nachhaltig verbessern.<br />
155
4 Überwachungstheorie<br />
41 Einführung<br />
Überwachungstheorie<br />
411. Wirtschaftsprüfung als Überwachungstätigkeit<br />
Überwachung:<br />
• ist - zumindest gedanklich - nach Planung und Realisation die dritte Phase des<br />
betrieblichen Geschehens;<br />
• ist <strong>der</strong> Vergleich von Objekten mit dem Ziel, Abweichungen bzw. Übereinstimmungen<br />
festzustellen und die aus dem Vergleich gewonnenen Informationen <strong>für</strong><br />
entsprechende Konsequenzen zu nutzen.<br />
Kontrolle:<br />
Überwachungshandlung ist fest in den betrieblichen Arbeitsablauf eingebaut und/<br />
o<strong>der</strong> Überwacher ist <strong>für</strong> die Ergebnisse des überwachten Prozesses verantwortlich.<br />
Prüfung:<br />
Überwachungshandlung ist nicht fest in den betrieblichen Ablauf eingebaut und <strong>der</strong><br />
Überwacher ist nicht <strong>für</strong> die Ergebnisse des überwachten Prozesses verantwortlich.<br />
Aber:<br />
Überwacher (Kontrolleur und Prüfer) ist immer <strong>für</strong> die eigenen Überwachungshandlungen<br />
verantwortlich.<br />
Generelle Regelung:<br />
Überwachung ist fest in den<br />
betrieblichen Arbeitsablauf<br />
eingebaut<br />
"Kontrolle"<br />
Überwachung<br />
Abb. 30: Überwachung, Kontrolle, Prüfung<br />
interne Prüfung<br />
= interne Revision<br />
156<br />
Fallweise Regelung:<br />
Überwachung ist nicht fest in<br />
den betrieblichen Arbeitsablauf<br />
eingebaut<br />
"Prüfung" (Revision)<br />
externe Prüfung<br />
= Wirtschaftsprüfung
Prüfungstheorie<br />
IV. "Quality Control" o<strong>der</strong> "Peer Review"<br />
III. Prüfung durch externen JA-Prüfer (= Wirtschaftsprüfung i.e.S.)<br />
II. Prüfung durch Innenrevision<br />
I. Kontrollierte Finanzbuchführung<br />
(Abteilungsleiter als Supervisor)<br />
Abb. 31: Einordnung <strong>der</strong> Wirtschaftsprüfung in die Überwachungstheorie<br />
412. Misstrauen als Motiv <strong>der</strong> Überwachung?<br />
Be<strong>für</strong>worter und Kritiker einer strengen Überwachung konstruieren das Gegensatz-Paar:<br />
Vertrauen o<strong>der</strong> Überwachung.<br />
Be<strong>für</strong>worter: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!"<br />
Kritiker: "Vertrauen ist grundsätzlich besser als Kontrolle."<br />
"Die Nachbarskin<strong>der</strong>"<br />
Wer an<strong>der</strong>n gar zuwenig traut,<br />
Hat Angst an allen Ecken;<br />
Wer gar zuviel auf andre baut,<br />
Erwacht mit Schrecken.<br />
Es trennt sie nur ein leichter Zaun,<br />
Die beiden Sorgengrün<strong>der</strong>;<br />
Zuwenig und zuviel Vertrauen<br />
sind Nachbarskin<strong>der</strong>.<br />
157<br />
Wilhelm Busch
Vertrauen<br />
Keine<br />
Überwachung<br />
Abb. 32: Misstrauen als Motiv <strong>der</strong> Überwachung<br />
Überwachungstheorie<br />
Mißtrauen<br />
Starke<br />
Überwachung<br />
Vernachlässigt wird:<br />
⇒ Sicherheitsstreben bei<strong>der</strong> Beteiligten,<br />
⇒ Sinnvolle und sachbezogene Überwachung kann Vertrauensverhältnis begründen<br />
o<strong>der</strong> festigen.<br />
(aber: schlechte Ergebnisse können auch Misstrauensverhältnisse begründen!)<br />
413. Überwachungsadressaten<br />
Ziel-<br />
vorgabe<br />
Sollwerte<br />
Planung Realisation<br />
Sollwerte Istwerte<br />
Rückgabe bei nicht akzeptierten Abweichungen<br />
Abb. 33: Die Überwachung im betrieblichen Prozess<br />
158<br />
Überwachung<br />
(Soll-Isto<strong>der</strong><br />
Ist-Ist-<br />
Vergleich<br />
Evtl. an<strong>der</strong>e<br />
Vergleichswerte<br />
Weitergabe<br />
bei Akzeptanz<br />
Evtl. Ausson<strong>der</strong>ung<br />
nicht akzeptierter<br />
Istobjekte
Prüfungstheorie<br />
Wichtigstes Kennzeichen je<strong>der</strong> Überwachung:<br />
(1) Vergleich von Objekten;<br />
(2) Rückgabemöglichkeit zur Korrektur.<br />
Durch Überwachung soll:<br />
Grad <strong>der</strong> Übereinstimmung zwischen Planung und Realisation<br />
festgestellt und ggf. verbessert werden, um eine hohe Bearbeitungsqualität bei <strong>der</strong> Realisation<br />
und <strong>der</strong> Planung zu erreichen.<br />
Überwachung dient<br />
<strong>der</strong> Planung und <strong>der</strong> Realisation<br />
Dispositionsüberwachung Objektüberwachung<br />
Adressat: dispositiver Faktor Adressat: Faktor objektbezogene<br />
Arbeit<br />
Unterscheidungskriterien:<br />
keine Überschneidungsfreiheit<br />
• Adressaten <strong>der</strong> Überwachungsinformation bzgl. <strong>der</strong> Abweichung und ihrer<br />
eventuellen Ursachen;<br />
• Überwachungsfrequenz.<br />
159
Abb. 34: Überwachung im betrieblichen Prozess<br />
Überwachungstheorie<br />
160
Dispositionsüberwachung:<br />
Prüfungstheorie<br />
• Unsicherheit <strong>der</strong> Zukunft lässt nur sehr große Bandbreiten als Sollwerte zu;<br />
• Fehlermeldung seltener als bei Objektüberwachung;<br />
• weniger Impulse <strong>für</strong> eine präventive und/o<strong>der</strong> korrektive Wirkung als bei <strong>der</strong> Objektüberwachung;<br />
• Abweichungsinformation wird in größeren Abständen zurückgemeldet (zumindest<br />
diskret: wöchentlich, monatlich, evtl. nur jährlich o<strong>der</strong> je Projekt);<br />
• Adressat: dispositiver Faktor;<br />
• kann evtl. auch an objektbezogenen Faktor zurückgekoppelt werden;<br />
• liefert Informationen über Qualität <strong>der</strong> Planung und Realisation;<br />
• erfolgt häufig mit Hilfe von Kennzahlen.<br />
Objektüberwachung:<br />
• geschieht i. d. R. laufend (tendenziell kontinuierlich);<br />
• Adressat: Mitarbeiter, die objektbezogene Arbeit ausführen;<br />
• Ziel: Gewährleistung möglichst richtiger Arbeitsergebnisse.<br />
Objektüberwachungen<br />
ergebnisorientierte verfahrensorientierte<br />
dienen <strong>der</strong> Ergebnisberichtigung<br />
161<br />
dienen <strong>der</strong> Verhaltensbeeinflussung<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter o<strong>der</strong><br />
einer Methodenän<strong>der</strong>ung bei<br />
Anlagen bzw. Verfahren
414. Überwachungswirkungen<br />
Präventivwirkung<br />
Überwachungstheorie<br />
Überwachungswirkungen<br />
Korrekturwirkung<br />
Lernwirkung<br />
Sicherheitswirkung<br />
dysfunktionale Wirkung<br />
Informationswirkung<br />
Die Präventivwirkung tritt ein, wenn sich die Mitarbeiter bewusst sind, dass sie überwacht<br />
werden und sie daher ihre Aufgaben mit größerer Sorgfalt erledigen, als wenn sie<br />
sich nicht überwacht fühlen.<br />
Durch die Überwachung können sie veranlasst werden,<br />
• bewusste Fehler zu unterlassen und<br />
• unbewusste Fehler zu vermeiden.<br />
Dysfunktionale Wirkung <strong>der</strong> Überwachung:<br />
Zu strenge Überwachung kann demotivierend wirken:<br />
⇒ Rückdelegation <strong>der</strong> Verantwortung <strong>für</strong> die Arbeit;<br />
⇒ Anstieg <strong>der</strong> Fehlerhäufigkeit;<br />
⇒ Zum Abbau <strong>der</strong> dysfunktionalen Wirkungen sollte die Überwachung<br />
- ein neutraler<br />
- nicht personenbezogener<br />
Vorgang sein.<br />
162
Fehlervermeidung bei <strong>der</strong><br />
ursprünglichen Bearbeitung<br />
Abb. 35: Präventivwirkung <strong>der</strong> Überwachung<br />
Prüfungstheorie<br />
Überwachungsintensität,<br />
Stärke <strong>der</strong> Sanktionen<br />
bei Abweichungen<br />
Die Korrekturwirkung <strong>der</strong> Überwachung bezieht sich auf die trotz <strong>der</strong> Präventivwirkung<br />
verbliebenen Fehler.<br />
Entdeckte Fehler führen:<br />
a) zu einer Korrektur o<strong>der</strong> Ausson<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> fehlerhaften Elemente und<br />
b) zu einer Abstellung <strong>der</strong> Fehlerursachen.<br />
Nicht akzeptable Abweichungen führen zur "Rückgabe“ zum Bearbeitungsschritt<br />
⇒ Rückkopplung<br />
(unabhängig davon, an welche Person zu welcher Zeit <strong>der</strong> Fehler gemeldet wird und<br />
welche ihn zu welcher Zeit korrigiert).<br />
Lassen sich systematische Fehlerursachen durch eine Überwachung erkennen und abstellen,<br />
so liegt über die Korrekturwirkung hinaus eine Lernwirkung vor.<br />
Überwachung sollte eine zweifache Sicherheitswirkung besitzen:<br />
• Überwacher kennt die Bearbeitungsqualität;<br />
• Überwachter hat Sicherheit, dass seine Bearbeitungsqualität bekannt ist und die<br />
Überwachenden damit zufrieden sind.<br />
Überwachung hat auch bei eher fehlerhafter Bearbeitung eine Informationswirkung <strong>für</strong><br />
Überwacher und Überwachten.<br />
163
415. Schritte <strong>der</strong> Überwachung<br />
Schrifttum: Soll - Ist - Vergleich<br />
hier: Soll - Ist - Vergleich<br />
Ist - Ist - Vergleich<br />
Überwachungstheorie<br />
Kernstück <strong>der</strong> Überwachung:<br />
Vergleich eines Istobjektes mit einem Vergleichsobjekt.<br />
Wenn:<br />
Vergleichsobjekt = Sollobjekt<br />
dann besitzt Vergleichen<strong>der</strong> Norm, nach <strong>der</strong> er entscheidet, ob das Istobjekt "richtig"<br />
o<strong>der</strong> "falsch" ist.<br />
Festlegung des Soll-Vergleichsobjekts durch:<br />
• Planungsüberlegungen (müssen sich auf wirtschaftliche Ziele sowie auf technische<br />
und rechtliche Nebenbedingungen stützen),<br />
• rechtliche Regelungen (Gesetze, Satzungen, Verträge).<br />
Wenn:<br />
Vergleichsobjekt = Istobjekt<br />
dann erlaubt Abweichung keine Entscheidung darüber, welches Ist-Objekt "richtig" und<br />
welches "falsch" ist.<br />
⇒ Weitere Überwachungsmaßnahmen sind notwendig.<br />
⇒ Bei Übereinstimmung: Beide Objekte werden als "richtig" angesehen (Vereinfachung!).<br />
Die Überwachung (Kontrolle, Prüfung) in allgemeiner Form umfasst folgende sechs<br />
Schritte:<br />
(1) Auswahl o<strong>der</strong> Feststellung o<strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong> zu überwachenden Istobjekte,<br />
(2) Auswahl o<strong>der</strong> Feststellung o<strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong> zugehörigen Vergleichsobjekte,<br />
(3) Vergleich <strong>der</strong> Objekt-Paare,<br />
(4) Beurteilung <strong>der</strong> Abweichungen, d. h. Entscheidung über Istobjekte<br />
(a) ob Freigabe bzw. Akzeptanz des Istobjektes o<strong>der</strong><br />
(b) ob Abweichungsfeststellung.<br />
Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden:<br />
1. Bei einem Ist-Ist-Vergleich ist keine Fehlerzuordnung möglich. Daher ist<br />
entwe<strong>der</strong> die Neubearbeitung bei<strong>der</strong> Objekte erfor<strong>der</strong>lich o<strong>der</strong> es ist ein<br />
Sollobjekt zu ermitteln mit anschließendem Soll-Ist-Vergleich gem. (4) (b)<br />
2.<br />
164
Prüfungstheorie<br />
2. Bei einem Soll-Ist-Vergleich wird ein Fehler beim Istobjekt festgestellt.<br />
Auch hier sind zwei Fälle zu unterscheiden:<br />
- Die fehlerhaften Istobjekte werden<br />
-- korrigiert o<strong>der</strong><br />
-- ausgeson<strong>der</strong>t o<strong>der</strong><br />
-- vernichtet und/o<strong>der</strong><br />
- Die Fehlerursachen werden beseitigt.<br />
(5) Zusammenfassung aller Teilurteile zu einem Gesamturteil,<br />
(6) Urteilsmitteilung an die Adressaten.<br />
416. Zur Darstellung von Überwachungsprozessen<br />
Literaturhinweise:<br />
BAETGE, JÖRG, ”Überwachungstheorie, Kybernetische”, in: Handwörterbuch <strong>der</strong> Revision, hrsg.<br />
von Adolf G. Coenenberg und Klaus von Wysocki, Stuttgart 1983, Sp. 1556 - 1569.<br />
BAETGE, JÖRG, Überwachung, in: Vahlens Kompendium <strong>der</strong> BWL, Bd. 2, hrg. von Bitz, M., 3.<br />
Aufl. München 1993, S. 175-218.<br />
165
Überwachungstheorie<br />
42. Kriterien zur Beurteilung von Überwachungsmaßnahmen<br />
Überwachung ist als "wirtschaftliche Veranstaltung" nur sinnvoll, wenn <strong>der</strong> durch sie<br />
gestiftete (bewertete; J.B.) Nutzen die Kosten ihrer Durchführung übersteigt".<br />
(LOITLSBERGER, E., S. 84)<br />
Bei Wirtschaftlichkeit müssen die zu erwartenden Leistungen von Überwachungssystemen<br />
höher als <strong>der</strong>en Kosten sein.<br />
Überwachung soll:<br />
• Präventivwirkung,<br />
• Korrekturwirkung (Lernwirkung),<br />
• Vertrauenswirkung (Sicherheits- resp. Informationswirkung)<br />
haben.<br />
Das heißt, es soll die<br />
• Zuverlässigkeit und<br />
• Wirtschaftlichkeit<br />
<strong>der</strong> betrieblichen Prozesse gesteigert werden.<br />
Überwachungen müssen mit diesen beiden Kriterien beurteilt werden.<br />
Zur Ermittlung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit sind zu bestimmen:<br />
• die durch die Überwachung verursachten Kosten:<br />
-- Kosten <strong>der</strong> Überwachung i.e.S.,<br />
-- Kosten <strong>der</strong> Korrektur,<br />
• Überwachungsleistung (L)<br />
= Einsparungen aufgrund von vermiedenen und korrigierten Fehlern,<br />
= Reduzierung <strong>der</strong> Kosten <strong>für</strong> verbliebene Fehler (K VF ).<br />
166
Prüfungstheorie<br />
Steigerung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit von Überwachung bedeutet: Reduzierung <strong>der</strong> Gesamtkosten<br />
<strong>der</strong> Überwachung.<br />
Abb. 36: Optimale Überwachungsintensität<br />
167
Überwachungstheorie<br />
GK(x) = K (x)+K = 100<br />
-1<br />
VF Ü +(20+ 5x) = 100(x +1) +(20+5x)<br />
x+1<br />
d[K (x)+K (x)]<br />
dx<br />
VF Ü -2<br />
= - 100(x +1) +5 = 0<br />
2<br />
5(x +1) = 100<br />
x opt = + 20-1<br />
x opt = 3, 472<br />
⇒ Bei x opt = 3,472 liegt das Minimum <strong>der</strong> gesamten Überwachungskosten.<br />
Ziel: Maximierung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit (WI)<br />
WI = (L - K ) → max!<br />
K Ü = 20+ 5x<br />
K = 100<br />
VF<br />
x +1<br />
ö<br />
L = 100 - 100<br />
x +1<br />
Problem:<br />
Überwachungsleistung ist schwer zu ermitteln, da zu den Einsparungen aufgrund <strong>der</strong><br />
korrigierten Fehler auch die Präventivwirkung <strong>der</strong> Überwachung einfließen müsste.<br />
⇒ Ansatz ist nur <strong>für</strong> Korrekturwirkung geeignet, da Kosten verbliebener Fehler<br />
(K VF ) schwierig zu messen sind;<br />
⇒ Reduktion <strong>der</strong> Messung auf (die noch zu definierende) Zuverlässigkeit!<br />
168
Ermittlungsprobleme:<br />
Prüfungstheorie<br />
• Kosten verbleiben<strong>der</strong> Fehler<br />
• Präventivwirkung <strong>der</strong> Überwachung.<br />
Ersatzkriterien <strong>für</strong> die Wirtschaftlichkeit:<br />
(1) Ergebnis-Zuverlässigkeit<br />
Ermittlung <strong>der</strong> Ergebnis-Zuverlässigkeit setzt voraus:<br />
- Kenntnis <strong>der</strong> Teilzuverlässigkeiten;<br />
- Beachtung <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Rechenregeln;<br />
- Kenntnis <strong>der</strong> organisatorischen Verknüpfungen von Ablaufschritten.<br />
(2) Überwachungskosten<br />
Bestimmtes Budget <strong>für</strong> die Überwachungs- (i.e.S.) und Korrekturkosten mit<br />
max. Zuverlässigkeit o<strong>der</strong> vorgegebene Zuverlässigkeit mit min. Kosten.<br />
Lösungsversuch:<br />
Effizienz <strong>der</strong> Überwachung wird hilfsweise mit <strong>der</strong> erreichten Zuverlässigkeit (Z) ermittelt.<br />
Zahl <strong>der</strong> fehlerfreien untersuchten Bearbeitungsvorgänge<br />
Z = ------------------------------------------------------------------------------------<br />
Zahl <strong>der</strong> insgesamt an einer Systemstelle untersuchten Vorgänge<br />
n ⇒ unendlich<br />
Zuverlässigkeit = Wahrscheinlichkeit <strong>für</strong> die Fehlerfreiheit des untersuchten<br />
Arbeitsmaterials<br />
Abschätzen <strong>der</strong> Zuverlässigkeit eines Gesamtsystems o<strong>der</strong> von Systemteilen:<br />
• Fehlerarten festlegen (o<strong>der</strong> Katalog erweitern);<br />
• Untersuchung <strong>der</strong> bearbeiteten Vorgänge auf die Fehlerarten;<br />
• Berechnung von Z (bei gleichgewichteten Fehlerarten);<br />
• Die Verwendung <strong>der</strong> Elementarsysteme ermöglicht eine Berechnung <strong>der</strong> Gesamtzuverlässigkeit,<br />
wenn die Teilzuverlässigkeiten bekannt sind;<br />
• Darstellung <strong>der</strong> Organisationsalternativen <strong>der</strong> Überwachung mit Hilfe <strong>der</strong> Elementarsysteme;<br />
• Beurteilung <strong>der</strong> Organisationsalternativen anhand <strong>der</strong> Zuverlässigkeit und Ermittlung<br />
<strong>der</strong> verursachten Kosten.<br />
169
Bedeutung <strong>der</strong> Zuverlässigkeitsanalyse:<br />
Überwachungstheorie<br />
1. Maß <strong>für</strong> Bearbeitungsqualität;<br />
2. Beschreibung des Mengengerüstes <strong>der</strong> Fehlerkosten <strong>für</strong> die Wirtschaftlichkeitsanalyse.<br />
Mögliche Kriterien <strong>für</strong> die Auswahl <strong>der</strong> "optimalen" Überwachungssystem-Alternative:<br />
• Zuverlässigkeit;<br />
• Determinanten <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit;<br />
• nicht quantifizierbare Kriterien.<br />
170
Prüfungstheorie<br />
43 Organisationsmöglichkeiten <strong>für</strong> eine Überwachung betrieblicher Prozesse<br />
431. Organisationsmaßnahmen zur unmittelbaren Effizienzsteigerung <strong>der</strong> Überwachung<br />
431.1 Überblick<br />
Maßnahmen, die unmittelbar <strong>der</strong> Effizienzsteigerung <strong>der</strong> Überwachung dienen:<br />
• Aufgabenbildung,<br />
• Aufgabenglie<strong>der</strong>ung,<br />
• Aufgabentrennung,<br />
• Aufgabenvervielfachung,<br />
• Aufgabenwie<strong>der</strong>holung,<br />
• vollständige Funktionsausübung,<br />
• Funktionstrennung,<br />
• Kompetenzbündelung.<br />
171
Aufgaben Funktionen<br />
Überwachungstheorie<br />
Bildung Glie<strong>der</strong>ung Trennung<br />
Maßnahmen <strong>der</strong> formalen<br />
Strukturierung<br />
Gestaltungselemente <strong>der</strong> Aufbau- und Ablauforganisation<br />
Kompetenzen<br />
Bündelung<br />
Maßnahmen <strong>der</strong> Zuweisung an<br />
einen Mitarbeiter<br />
Abb. 37: Festlegung und Zuweisung von Aufgaben, Funktionen, Kompetenzen<br />
und Verantwortlichkeiten<br />
Verantwortlichkeiten<br />
Zusammenfassung<br />
mehrere<br />
Mitarbeiter<br />
gemeinsam<br />
Aufgaben sind die auf das Ziel <strong>der</strong> Unternehmung gerichteten Gesamt- und Teiltätigkeiten<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter, wie Buchführen, Belegerstellen, Kontieren.<br />
Als Funktionen sind die dispositiven, ausführenden, im eigentlichen Sinne überwachenden<br />
und korrigierenden Teiltätigkeiten zur Erfüllung einer Aufgabe o<strong>der</strong><br />
Teilaufgabe definiert.<br />
Die Wirkung <strong>der</strong> Überwachung (Präventiv-, Korrektur- und Sicherheitswirkung) sind<br />
nur erzielbar, wenn die Funktionen<br />
• Bearbeitung,<br />
• Überwachung i. e. S. und<br />
• Korrektur<br />
erfüllt sind.<br />
172
431.2 Aufgabenbildung und -glie<strong>der</strong>ung<br />
Aufgabenbildung:<br />
Aufgaben werden nach den Kriterien<br />
• Objekt und<br />
• Verrichtung<br />
formuliert.<br />
⇒ Beispiel: Beleg kontieren.<br />
Prüfungstheorie<br />
Durch eine Aufgabenglie<strong>der</strong>ung entsteht eine logische und systematische Aufeinan<strong>der</strong>folge<br />
von Tätigkeiten.<br />
Informationen<br />
über<br />
Geschätsvorfälle<br />
Kontieren Buchen<br />
Mitarbeiter (MA) erledigt<br />
Buchführung mit<br />
Konten<br />
abschließen<br />
Abb. 38: Aufgabenglie<strong>der</strong>ung in <strong>der</strong> Buchführung<br />
431.3 Aufgabenzuordnung<br />
431.31 Vertikale Aufgabentrennung<br />
Hauptabschlußübersicht<br />
(=HAÜ)<br />
erstellen<br />
Aufgabentrennung:<br />
Teilaufgaben werden auf mehrere Mitarbeiter verteilt.<br />
Vertikale Aufgabentrennung:<br />
Aufgaben werden zwischen Arbeitsablaufschritten getrennt.<br />
173<br />
Jahres<br />
abschluß<br />
(=JA)<br />
erstellen<br />
Informationen<br />
aus dem<br />
Jahresabschluß
Überwachungstheorie<br />
⇒ Beispiel: Trennung von Kontierung und Buchung.<br />
Informationen<br />
über Geschäftsvorfälle<br />
1. MA 2. MA<br />
Kontieren<br />
Buchen<br />
3. MA<br />
Konten<br />
abschließen<br />
4. MA<br />
HAÜ<br />
erstellen<br />
Abb. 39: Vertikale Aufgabentrennung innerhalb <strong>der</strong> Buchführung<br />
Informationen<br />
über Geschäftsvorfälle<br />
Belege<br />
erstellen<br />
Kontieren<br />
Kontenabschließen<br />
Rückkopplungen<br />
HAÜ<br />
erstellen<br />
5. MA<br />
JA<br />
erstellen<br />
Gesetze und Grundsäze ordnungsmäßiger Buchführung<br />
Normen <strong>für</strong> Sollobjekte<br />
Buchen<br />
JA erstellen<br />
Informationen<br />
aus<br />
dem Jahresabschluß<br />
Informationen<br />
aus<br />
dem Jahresabschluß<br />
Abb. 40: Vertikale Aufgabentrennung in <strong>der</strong> Finanzbuchhaltung als Kombination von Reihenkopplung<br />
und Rückkopplung(smöglichkeiten)<br />
174
Prüfungstheorie<br />
Wirkungen <strong>der</strong> vertikalen Aufgabentrennung (Arbeitsteilung) ohne Rückkopplungsmöglichkeit:<br />
• Primär: Produktivitätssteigerung bei Teilaufgaben;<br />
• Aber auch: Präventivwirkung und fallweise Korrekturwirkung,<br />
da die Bearbeitung vertikal getrennter Teilaufgaben einen impliziten Soll-Ist-Vergleich<br />
voraussetzt.<br />
Vertikale Aufgabentrennung (= Arbeitsteilung) vor allem wirksam, wenn<br />
• Abwicklung von Geschäftsvorfällen,<br />
• Verwaltung von Geld,<br />
• Verwaltung sonstiger Vermögensgegenstände,<br />
• manuelle, mechanische o<strong>der</strong> elektronische Erstellung von Aufzeichnungen,<br />
voneinan<strong>der</strong> personell getrennt sind.<br />
Bei manueller Erstellung von Aufzeichnungen:<br />
• Belegerstellung,<br />
• Kontierung,<br />
• Buchung,<br />
• Abschluss <strong>der</strong> Konten,<br />
• Erstellung des Jahresabschlusses.<br />
Bei mechanischer und elektronischer Erstellung von Aufzeichnungen:<br />
• Erstellung von Eingabe-Belegen,<br />
• Dateneingabe, -umwandlung,<br />
• Programmerstellung,<br />
• Erstellung von Test- und Prüfprogrammen,<br />
• Maschinenbedienung,<br />
• Verwahrung von Datenträgern und Programmen,<br />
• Erstellung von Auswertungen.<br />
175
431.32 Horizontale Aufgabentrennung<br />
Überwachungstheorie<br />
Horizontale Aufgabentrennung:<br />
Eine Aufgabe wird innerhalb eines Arbeitsablaufschrittes <strong>der</strong>art getrennt, dass eine Ergebnisabstimmung<br />
zwischen den getrennten Aufgaben möglich ist.<br />
⇒ Beispiel: Trennung <strong>der</strong> Debitorenbuchführung von <strong>der</strong> Führung des Sachkontos<br />
"For<strong>der</strong>ungen".<br />
Abb. 41: Beispiel einer horizontalen Aufgabentrennung<br />
431.33 Aufgabenvervielfachung<br />
Aufgabenvervielfachung:<br />
Eine Aufgabe wird in gleicher o<strong>der</strong> ähnlicher Weise mehrfach erfüllt, um <strong>für</strong> die<br />
Überwachung des Ergebnisses <strong>der</strong> ersten Aufgabenerfüllung ein Vergleichsobjekt zu<br />
haben. Häufigste Form <strong>der</strong> Aufgabenvervielfachung ist die Aufgabendopplung. ⇒<br />
Beispiel: doppelte Buchführung<br />
176
Prüfungstheorie<br />
Abb. 42: Ist-Ist-Vergleich als Parallelkopplung mit anschließendem Soll-Ist-Vergleich <strong>für</strong> Ist-Ist-<br />
Abweichungen und anschließen<strong>der</strong> Rückkopplung <strong>für</strong> alle Soll-Ist-Abweichungen<br />
Ist-Vergleichsobjekte lassen sich heranziehen, wenn<br />
(1) bereits mindestens ein Ist-Vergleichsobjekt vorliegt, weil<br />
(a) eine identische Aufgabe mehrfach ausgeführt worden ist,<br />
(b) eine komplementäre Aufgabe mehrfach ausgeführt worden ist;<br />
(2) ein identisches o<strong>der</strong> komplementäres Ist-Vergleichsobjekt zum Zwecke des Vergleichs<br />
erstellt werden muss o<strong>der</strong> kann und dieses Vergleichsobjekt billiger als<br />
ein entsprechendes Sollobjekt erstellt werden kann.<br />
Aufgabenvervielfachung:<br />
Identische o<strong>der</strong> komplementäre Aufgaben werden einmal o<strong>der</strong> mehrere Male wie<strong>der</strong>holt.<br />
177
431.4 Funktionsbildung und -glie<strong>der</strong>ung<br />
Überwachungstheorie<br />
Funktionsbildung:<br />
Einzelne Funktionen werden <strong>für</strong> jede Teilaufgabe konkretisiert.<br />
Erst eine explizite Funktionsbildung schafft ein ausgeprägtes Überwachungs- (bzw.<br />
Kontroll-) Bewusstsein bei den Mitarbeitern, das die gewünschten Wirkungen hervorruft.<br />
Implizite Funktionsbildung bei <strong>der</strong> Aufgabenglie<strong>der</strong>ung und -trennung:<br />
Objektüber wachung<br />
431.5 Funktionszuordnung<br />
⎧ Bearbeitung <strong>der</strong> Aufgabe<br />
⎪<br />
⎪ Überwachung i. e.S<br />
⎨<br />
⎪(Vergleich<br />
mit anschließen<strong>der</strong> Beurteilung)<br />
⎪<br />
⎩<br />
⎪<br />
Korrektur<br />
431.51 Selbstüberwachung bzw. Funktionszusammenfassung<br />
Selbstüberwachung:<br />
Vergleich wird von <strong>der</strong>selben Person ausgeführt, die auch die Aufgabe ausgeführt hat<br />
und die auch eventuell vorzunehmende Korrekturen und an<strong>der</strong>e Teilfunktionen ausführt.<br />
⇒ Selbstüberwachung ist eine gute Voraussetzung <strong>für</strong> fehlerarme Leistungen und<br />
Lernverhalten!<br />
⇒ Selbst- und Fremdüberwachung sind keine Alternativen son<strong>der</strong>n Komplemente!<br />
Form und Intensität <strong>der</strong> Fremdüberwachung ist abhängig von Intensität und Effektivität<br />
<strong>der</strong> Selbstüberwachung (vgl. <strong>Jahresabschlussprüfung</strong>).<br />
Selbstüberwachung:<br />
Ausweitung <strong>der</strong> Verantwortungs- und Kompetenzbereiche<br />
⇒ führt zur Erhöhung des Selbstwertgefühls und <strong>der</strong> Identifikation mit <strong>der</strong> Aufgabe<br />
(beson<strong>der</strong>s bei intrinsisch motivierten Mitarbeitern)<br />
⇒ unter <strong>der</strong> Grundvoraussetzung, dass <strong>der</strong> Mitarbeiter die Fähigkeit und den Willen<br />
besitzt, die Aufgabe zu erfüllen.<br />
178
Prüfungstheorie<br />
Vorteile <strong>der</strong> Selbstüberwachung:<br />
• Vermeidung langer Wartezeiten,<br />
• keine Transportkosten,<br />
• Kenntnis <strong>der</strong> Materie,<br />
• Motivationsför<strong>der</strong>ung (Erhöhung <strong>der</strong> Zuverlässigkeit vor <strong>der</strong> Fremdüberwachung).<br />
Nachteile <strong>der</strong> Selbstüberwachung:<br />
• Aufdeckung bewusster Fehler nicht möglich,<br />
• kein Ausgleich <strong>für</strong> mangelnde Fähigkeiten und Fertigkeiten möglich,<br />
• Ausführung und Effizienz kaum feststellbar, sofern Selbstüberwachung nicht dokumentiert<br />
wird (bei Dokumentation ließe sich an<strong>der</strong>erseits die positive Motivationswirkung<br />
nicht realisieren),<br />
• u. U. keine Entdeckung von Flüchtigkeitsfehlern, die sowohl bei <strong>der</strong> Erstellung<br />
des Istobjekts als auch bei <strong>der</strong> Bildung des Vergleichsobjekts begangen werden.<br />
431.52 Fremdüberwachung bzw. Funktionstrennung<br />
Funktionstrennung:<br />
Zuordnung verschiedener Funktionen zu verschiedenen Mitarbeitern.<br />
Fremdüberwachung:<br />
Funktionen "Bearbeitung" und "Überwachung i.e.S." sind voneinan<strong>der</strong> getrennt<br />
(Funktionstrennung).<br />
Fremdüberwachung ist nur notwendig, wenn (externe) Überwachungsadressaten ein<br />
vertrauenswürdiges Urteil über den Sachverhalt benötigen (z. B. <strong>Jahresabschlussprüfung</strong>).<br />
Fremdüberwachung ist angebracht:<br />
• <strong>für</strong> überwiegend extrinsisch Motivierte,<br />
• bei unzureichend befähigten Mitarbeitern (bzgl. <strong>der</strong> Bearbeitung),<br />
• zur Aufdeckung bewusster Fehler,<br />
• bei Routinearbeiten (Vier- o<strong>der</strong> Sechs-Augen-Prinzip),<br />
• wenn eine Dokumentation <strong>der</strong> erreichten Zuverlässigkeit notwendig ist.<br />
Bei Fremdüberwachung kann die Korrektur:<br />
(1) vom Bearbeiter,<br />
(2) von einem Dritten o<strong>der</strong><br />
(3) vom Überwacher i.e.S.<br />
ausgeführt werden.<br />
179
zu (1) Korrektur durch Bearbeiter<br />
Überwachungstheorie<br />
Vorteile:<br />
- Beseitigung systematischer Fehlerursachen durch den Bearbeiter selbst (-> Lernwirkung).<br />
- Gegenkontrolle (Kontrolle des Überwachers i.e.S. durch den Bearbeiter/Korrektor).<br />
Nachteil:<br />
- Schwierige Fälle, die <strong>der</strong> Korrektor nicht beherrscht, können auch bei Korrektur<br />
nicht richtig gestellt werden.<br />
zu (2) Korrektur durch den Dritten<br />
Vorteil:<br />
- richtige Bearbeitung schwieriger Fälle, sofern Dritter guter Fachmann ist.<br />
Nachteil:<br />
- Vorteile <strong>der</strong> Korrektur durch den Bearbeiter entfallen.<br />
zu (3) Korrektur durch Überwacher (i.e.S.)<br />
Vorteil:<br />
- nur wenn Überwacher zuverlässiger arbeitet als Bearbeiter.<br />
Nachteil:<br />
- demotivierend <strong>für</strong> Bearbeiter.<br />
Fremdüberwachung:<br />
Korrektur durch den ursprünglichen Bearbeiter am sinnvollsten.<br />
⇒"Harzburger Modell":<br />
• Bearbeitung und Korrektur in einer Hand,<br />
• Rückdelegation unmöglich.<br />
180
Prüfungstheorie<br />
431.6 Kompetenzbildung, -glie<strong>der</strong>ung und -zuordnung<br />
Kompetenzbildung:<br />
Schaffung von Kompetenzbereichen.<br />
Kompetenzglie<strong>der</strong>ung:<br />
Zerlegung <strong>der</strong> Kompetenzbereiche in Teilbereiche.<br />
Kompetenzzusammenfassung (-bündelung):<br />
• Notwendiges Komplement zur Aufgaben- und Funktionstrennung: mehrere<br />
Mitarbeiter erhalten nur gemeinsam die Kompetenz, eine bestimmte Aufgabe<br />
o<strong>der</strong> eine Funktion innerhalb einer Aufgabe wahrzunehmen.<br />
• Durch Kompetenzzusammenfassung werden partielle Arbeitsergebnisse verschiedener<br />
Mitarbeiter wie<strong>der</strong> zusammengefasst und miteinan<strong>der</strong> abgestimmt.<br />
• Ist-Ist-Vergleich.<br />
431.7 Verantwortlichkeitsbildung, -glie<strong>der</strong>ung und -zuordnung<br />
Verantwortlichkeit als Kriterium <strong>für</strong> die Bereichsbildung.<br />
Bereichsbildung erfolgt analog zu 431.6 Kompetenzbildung, -glie<strong>der</strong>ung und -zuordnung,<br />
denn es gilt <strong>der</strong> Grundsatz:<br />
Kongruenz von Kompetenz und Verantwortung!<br />
432. Organisationsmöglichkeiten zur mittelbaren Effizienzsteigerung <strong>der</strong> Überwachung<br />
Wirksamkeit <strong>der</strong> Überwachung hängt auch von<br />
• personellen,<br />
• sachlichen und<br />
• finanziellen<br />
Voraussetzungen ab.<br />
⇒ Flankierende Organisationsmaßnahmen sind notwendig!<br />
Flankierende Maßnahmen:<br />
Organisatorische Maßnahmen, die den Arbeitsablauf und die Aufbauorganisation festlegen.<br />
Wirkungen <strong>der</strong> flankierenden Maßnahmen:<br />
• Wahrscheinlichkeit <strong>für</strong> richtige Ist-Objekte wird erhöht,<br />
• Ist-Objekt wird leichter überwachbar (durch größere Einheitlichkeit).<br />
181
Überwachungstheorie<br />
Beispiele <strong>für</strong> generelle Regelungen im Bereich Rechnungswesen:<br />
• Bilanzierungshandbücher,<br />
• Kontenpläne,<br />
• Belegorganisation und Formular- und Belegnummern-System,<br />
• Arbeitsplatzbeschreibungen,<br />
• Arbeitsablaufdiagramme,<br />
• Organigramme,<br />
• Aufgaben- und Kompetenzverteilung,<br />
• Stellvertreterregelungen,<br />
• Zugangsbeschränkungen,<br />
• Zugriffs- und Entnahmesicherungen,<br />
• separate Verwaltung und Verwahrung von Geld,<br />
• motivationale Maßnahmen.<br />
Personelle Voraussetzungen<br />
Arbeitsplatzbeschreibungen,<br />
Arbeitsablaufdia- und<br />
Organigramme<br />
Funktionstrennung<br />
Reihenkopplung<br />
Datensicherung<br />
und Belegorganisation<br />
Sicherungen und<br />
Zugangsbeschränkungen<br />
Vertikale<br />
Aufgabentrennung<br />
Reihenkopplung<br />
mit Rückkopplungsmöglichkeit<br />
Parallelkopplung<br />
Kompetenzbündelung<br />
Sachliche Voraussetzungen<br />
Parallelkopplung<br />
Generelle Regelungen, Gewährung<br />
von Anreizen,<br />
Stellvertreterregelungen<br />
Horizontale Aufgabentrennung<br />
und Aufgabenvervielfachung<br />
Separate Verwaltung<br />
und Aufbewahrung von<br />
Geld und an<strong>der</strong>en Vermögensteilen<br />
Abb. 43: Die Effizienz <strong>der</strong> Überwachung beeinflussende Faktoren und zugrundeliegende Kopplungsbeziehungen<br />
182<br />
Finanzielle Voraussetzungen
Prüfungstheorie<br />
44. Bildung und Analyse von internen Überwachungssystemen<br />
441. Die Isolierung von Überwachungsschritten aus dem Arbeitsablauf<br />
Abb. 44: Die Analyse <strong>der</strong> Kopplungen in einem Arbeitsablauf durch Disaggregation<br />
183
Überwachungstheorie<br />
Abb. 45: Aufgaben- und Funktionstrennung am Beispiel eines Ausschnitts <strong>der</strong> Finanzbuchführung<br />
184
Prüfungstheorie<br />
442. Die Ermittlung von Zuverlässigkeiten <strong>für</strong> die verschiedenen Kopplungstypen<br />
442.1 Überblick<br />
Abb. 46: Empirische Ermittlung von Teilzuverlässigkeiten einzelner Systemelemente<br />
Abb. 47: Die Ermittlung <strong>der</strong> Zuverlässigkeit des Ausgangsmaterials bei einstufiger Bearbeitung<br />
ohne Überwachung<br />
185
442.2 Zusammenführung<br />
W[R1] = 0,9375<br />
Überwachungstheorie<br />
Kanal 1 mit + +<br />
m Elementen W[R2] = 0,75<br />
[ A]<br />
[ RA]<br />
[ 1] [ 2]<br />
Kanal 2 mit<br />
n Elementen<br />
m<br />
Anteil <strong>der</strong>Vorgänge aus Kanal<br />
m+ n<br />
n<br />
Anteil <strong>der</strong> Vorgänge aus Kanal 2<br />
m n =<br />
+ =<br />
1<br />
m = 800<br />
n = 200<br />
W R<br />
W<br />
W R ⋅ m+ W R ⋅n<br />
=<br />
m+ n<br />
0, 9375⋅ 800 + 0, 75⋅200 900<br />
=<br />
= = 09 ,<br />
800 + 200 1000<br />
Abb. 48: Zuverlässigkeit bei einer Zusammenführung<br />
442.3 Reihenkopplung<br />
W[RE] = 1,0<br />
W [RA]<br />
W[R1] = 0,949 W[R2] = 0,949<br />
W[RA] = 0,9<br />
Abb. 49: Teilzuverlässigkeiten bei einer Reihenkopplung = Steuerung vom Typ A<br />
Für die Reihenkopplung gilt die Multiplikationsregel:<br />
[ A] = [ E] ⋅ [ 1]<br />
⋅ [ 2]<br />
[ A]<br />
= ⋅ ⋅ ≅<br />
W R W R W R W R<br />
W R 1,0 0,949 0,949 0,9<br />
186<br />
W[RA] = 0,900601
442.4 Parallelkopplung<br />
W [RE] = 1,0<br />
W [R1] = 0,75<br />
W[R2] = 0,75<br />
Prüfungstheorie<br />
Ist-Ist-Vergleich und Beurteilung<br />
+<br />
-<br />
Abweichung<br />
= 0<br />
?<br />
Ausson<strong>der</strong>ung<br />
(37,5% des<br />
Eingangsmaterials)<br />
JA! Freigabe<br />
W [RA] = 0,9<br />
Abb. 50: Teilzuverlässigkeiten bei einer Parallelkopplung mit Ausson<strong>der</strong>ung von ungleichen<br />
Bearbeitungselementen<br />
W [R1]<br />
0,75<br />
ausgeson<strong>der</strong>t<br />
freigegeben<br />
und<br />
richtig<br />
0,75<br />
freigegeben<br />
und<br />
falsch<br />
ausgeson<strong>der</strong>t<br />
1,0 W[R2]<br />
Abb. 51: Darstellung <strong>der</strong> Zuverlässigkeit bei einer Parallelkopplung mit Ausson<strong>der</strong>ung voneinan<strong>der</strong><br />
abweichen<strong>der</strong> Bearbeitungsergebnisse<br />
[ ]<br />
W[ R1] ⋅W[<br />
R2]<br />
[ 1] ⋅ [ 2] + ( 1− [ 1] ) ⋅( 1−<br />
[ 2]<br />
)<br />
W RA<br />
=<br />
W R W R W R W R<br />
187<br />
075 , ⋅075<br />
,<br />
=<br />
≅ 09 ,<br />
075075 , ⋅ , + 025025 , ⋅ ,
Überwachungstheorie<br />
Abb. 52: Parallelkopplung im Stellvertreter-Fall (BAETGE, 1980, Sp. 1097 f.)<br />
442.5 Rückkopplung<br />
Abb. 53: Bedingte Wahrscheinlichkeiten <strong>für</strong> Bearbeitung, Sollobjekterstellung, Überwachung<br />
i.e.S. und Korrektur<br />
188
Prüfungstheorie<br />
Abb. 54: Ein Überwachungssystem-Element am Beispiel des Kontierens bei einmaliger Rückkopplung<br />
Abb. 55: Übergangsgraph <strong>für</strong> ein Überwachungssystem-Element (=ÜSE)<br />
189
Anfangszuverlässigkeit<br />
(hier 100 %)<br />
W(R)<br />
1-W(R)<br />
Überwachungstheorie<br />
Bearbeitung Kontrolle Korrektur<br />
W(R/R)<br />
1-W(R/R)1-W(R/F R)<br />
W(F/F)<br />
1-W(F/F)<br />
W(R/F R)<br />
W(R/F F)<br />
1-W(R/F F)<br />
WErg (R) = W(R) W(R/R) + W(R) (1-W(R/R)) W(R/F R)<br />
+ (1-W(R)) W(F/F) 1-W(R/F F)<br />
1-WErg (R) = W(R) (1-W(R/R)) (1-W(R/F R)) + (1-W(R)) W(F/F) (1-W(R/F F))<br />
+ (1-W(R)) (1-W(F/F))<br />
Zustand <strong>der</strong> Istobjekte<br />
nach den Tätigkeiten<br />
R F<br />
Ergebnis<br />
zuverlässigkeit<br />
W Erg (R)<br />
Ergebnisunzuverlässigkeit<br />
1-W Erg (R)<br />
Abb. 56: Wahrscheinlichkeitsbaum zur Berechnung <strong>der</strong> Ergebniszuverlässigkeit eines IKSE<br />
UMP =<br />
⎡ 1 0 0 0<br />
~<br />
~<br />
⎤<br />
⎢ ~ W<br />
[ ]<br />
[ F / R]<br />
W [ F / R]<br />
⎥<br />
⎢W<br />
R / R ~<br />
~ 0 ⎥<br />
⎢ ⋅WR/F [ ∩R] ⋅WF/F [ ∩R]<br />
⎥<br />
⎢<br />
~<br />
~<br />
⎥<br />
⎢<br />
WF/F [ ] WF/F [ ] ~ ⎥<br />
⎢<br />
0<br />
~<br />
~ W<br />
[ ] [ ]<br />
[ R / F]<br />
⋅WR/F∩F⋅WF/F∩F ⎥<br />
⎢<br />
⎥<br />
⎣⎢<br />
0 0 0 1 ⎦⎥<br />
Abb. 57: Das ÜSE als Markov-Prozeß in Matrizenschreibweise<br />
190
Prüfungstheorie<br />
443. Wirkung <strong>der</strong> Überwachung auf die Zuverlässigkeit von Routinetätigkeiten<br />
443.1 Wirkung <strong>der</strong> Selbstüberwachung<br />
Abb. 58: Ergebniszuverlässigkeit mit und ohne Selbstüberwachung<br />
191
442.2 Wirkung <strong>der</strong> Fremdüberwachung<br />
Abb. 59: Ergebnisse <strong>der</strong> Computersimulation<br />
Überwachungstheorie<br />
192
Wirtschaftsprüfung I<br />
45. Überwachungssysteme und Überwachungshierarchien<br />
Normen<br />
des Gesetzgebers<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>erNormgeber,<br />
z. B.:<br />
Gesetz,<br />
Satzung,<br />
GoB,<br />
Auftrag.<br />
Ausgewählte<br />
Ist-<br />
Objekte<br />
Normen<br />
Ausgewählte Ist-Objekte<br />
Normen<br />
Ausgewählte<br />
Ist-<br />
Objekte<br />
Normen<br />
Ausgewählte Ist-Objekte<br />
Informationen<br />
zu Sollobjektbildungen<br />
(Normen)<br />
Ist<br />
korrigiertes<br />
Ist<br />
Ist<br />
Sollobjektbildung und<br />
Soll-Ist-Vergleich<br />
durch eigene o<strong>der</strong> fremde<br />
Wirtschaftprüfer<br />
iV. Interne und externe Überwachungen<br />
<strong>der</strong> Abschlußprüfung, z. B.:<br />
"Quality Control" o<strong>der</strong><br />
"Peer Review"<br />
Sollobjektbildung<br />
und Soll-Ist-Vergleich<br />
durch Abschlußprüfer<br />
III. Die kontrollierte und geprüfte Finanzbuchführung<br />
als Prüfungsgegenstand <strong>der</strong><br />
externen Jahresabschlußprüfung<br />
Sollobjektbildung<br />
und Soll-Ist-Vergleich<br />
durch die Innenrevision<br />
bwz. den Vorstand<br />
II. Die kontrollierte Finanzbuchführung<br />
<strong>der</strong> Unternehmung als<br />
Prüfungsobjekt <strong>der</strong><br />
Innenrevision bzw.<br />
des Vorstandes<br />
Sollobjektbildung<br />
und Kontrolle<br />
durch Abteilungsleiter<br />
(Supervisor)<br />
I. Kontrollierte Finanzbuchführung<br />
Korrektur<br />
Finanzbuchführung<br />
Abb. 60: Hierarchie von Überwachungs-Regelkreisen<br />
193<br />
"richtig"<br />
Freigabe<br />
I<br />
"falsch"<br />
Rückgabe<br />
Istobjekte mit<br />
Informationen<br />
über Soll-Ist-<br />
Abweichungen<br />
II<br />
Informationen über Soll-Ist-Abweichungen<br />
III<br />
Informationen über Soll-Ist-<br />
Abweichungen<br />
Eingabe: Geschäftsvorfälle<br />
START<br />
IV<br />
Berichterstattung<br />
und<br />
ggfs.<br />
Freigabe<br />
zur<br />
weiteren<br />
Bearbeitung
Überwachungstheorie<br />
Die oberste Kontrollinstanz entzieht sich im zweifachen Sinne <strong>der</strong> Kontrolle:<br />
(1) Für die Zeit einer unverän<strong>der</strong>ten Kontrollhierarchie: Treten folgenschwere Fehler<br />
auf, so wird häufig eine zusätzliche, höhere Kontrollebene gefor<strong>der</strong>t.<br />
(2) Die Effizienz einer zusätzlichen (oberen) Kontrollinstanz kann nicht beurteilt<br />
werden.<br />
Die Schaffung neuer Kontrollhierarchien ist letztlich ein unendlicher Prozess. Einem<br />
ständigen Anwachsen <strong>der</strong> Kontrollhierarchie kann durch das Prinzip <strong>der</strong> Gegenkontrolle<br />
begegnet werden. D. h. die oberste Kontrollinstanz meldet alle festgestellten<br />
Fehler <strong>der</strong> darunter liegenden Ebene, so dass diese erneut eine Kontrolle (Vergleich<br />
und Beurteilung) durchführen kann. Bei einer Rückgabe zur Korrektur sollte die Gegenkontrolle<br />
zumindest immer stattfinden.<br />
⇒ Offene Fragen:<br />
• Was geschieht bei abweichen<strong>der</strong> Beurteilung durch die Gegenkontrolle?<br />
• Was geschieht bei vorhandenen, aber nicht festgestellten Fehlern?<br />
194