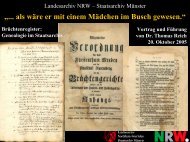Der Archivar, Heft 4, Nov. 2002 - Archive in Nordrhein-Westfalen
Der Archivar, Heft 4, Nov. 2002 - Archive in Nordrhein-Westfalen
Der Archivar, Heft 4, Nov. 2002 - Archive in Nordrhein-Westfalen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sich auf Herrscher, den Adel, die M<strong>in</strong>isterialen sowie Städte und<br />
e<strong>in</strong>zelne Bürger.<br />
Fuhrmann setzt sich zu Beg<strong>in</strong>n grundsätzlich <strong>in</strong> kritischen<br />
Anmerkungen mit der Anwendung der klassischen Methoden<br />
der Diplomatik, dem Schrift- und Diktatvergleich, ause<strong>in</strong>ander.<br />
In den vergleichbaren Untersuchungen von Urkunden des Frühund<br />
Hochmittelalters gilt der Schriftvergleich als die Methode zur<br />
näheren Bestimmung der verschiedenen Schreiber. <strong>Der</strong> Gesamte<strong>in</strong>druck<br />
der Schrift und die Hervorhebung <strong>in</strong>dividueller Schriftelemente<br />
dienen als Kriterien für die Zuweisung der Urkunden<br />
zu e<strong>in</strong>zelnen Schreibern. Für die Urkunden des beg<strong>in</strong>nenden<br />
Spätmittelalters bedeutet die Bewertung des Schriftvergleichs,<br />
dass bei der Feststellung von Übere<strong>in</strong>stimmungen im Gesamte<strong>in</strong>druck<br />
von Schriftgruppen die übere<strong>in</strong>stimmenden Schriftmerkmale<br />
höher bewertet werden als <strong>in</strong>dividuelle Merkmale, um die<br />
Zuweisungen zu e<strong>in</strong>zelnen Schreibern gesichert zu treffen. Hilfreich<br />
für die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse s<strong>in</strong>d die Def<strong>in</strong>itionen<br />
der Begriffe „der Kanzlei- und Empfängerausfertigungen<br />
sowie der Ausfertigung der Dritten und der unbestimmbaren<br />
Hand“ (S. 59 f.).<br />
Das Ziel des Schrift- und Diktatvergleiches besteht dar<strong>in</strong>, die<br />
Kanzleiausfertigungen von den Empfängerausfertigungen, den<br />
Ausfertigungen von unbestimmbarer Hand, der dritten Hand<br />
sowie den Fälschungen zu unterscheiden; diese Arbeit wird im<br />
historisch-chronologischen Teil (S. 73–299) geleistet. Im systematischen<br />
Teil (S. 299–403) werden ferner die <strong>in</strong>neren und äußeren<br />
Merkmale der Urkunden, die Urkundenarten, die Entstehung der<br />
Urkunden sowie die Beteiligung Dritter an der Beurkundung dargestellt.<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf das untersuchte umfangreiche Material von<br />
ca. 1300 Urkunden s<strong>in</strong>d folgende Ergebnisse festzuhalten:<br />
1) Unter Erzbischof Konrad von Hochstaden s<strong>in</strong>d 21 erzbischöfliche<br />
Schreiber mit 183 Urkunden <strong>in</strong> 189 Ausfertigungen nachweisbar,<br />
36 Empfängerschreiber mit 93 Urkunden, 156 unbestimmbare<br />
Hände, die 194 Urkunden <strong>in</strong> 217 Ausfertigungen mundierten.<br />
2) Unter Erzbischof Engelbert von Falkenburg werden acht Kanzleischreiber,<br />
von denen drei bereits unter se<strong>in</strong>em Vorgänger tätig<br />
waren, sieben Empfängerhände mit neun Urkunden <strong>in</strong> zwölf<br />
Ausfertigungen und 29 Urkunden <strong>in</strong> 31 Ausfertigungen durch die<br />
unbestimmbare Hand nachweisbar. 3) Im Laufe des Pontifikats<br />
des Erzbischofs Siegfried von Westerburg steigt die Urkundenausstellung<br />
wieder an; 13 Kanzleihände mit 125 Urkunden <strong>in</strong> 131<br />
Ausfertigungen stehen 11 Empfängerhände <strong>in</strong> 33 Ausfertigungen<br />
und 88 unbestimmbare Hände mit 94 Urkunden <strong>in</strong> 98 Ausfertigungen<br />
gegenüber.<br />
In Anlehnung an die heute übliche Konvention <strong>in</strong> der Term<strong>in</strong>ologie<br />
der diplomatischen Forschung wird auch die Kanzlei der<br />
Erzbischöfe von Köln als „die Gesamtheit der Ausstellerschreiber“<br />
(S. 54) bezeichnet; unter dem Begriff „Kanzlei“ wird also auch im<br />
13. Jahrhundert ke<strong>in</strong>e <strong>in</strong>stitutionalisierte Verwaltungse<strong>in</strong>heit subsumiert.<br />
<strong>Der</strong> Amtstitel e<strong>in</strong>es erzbischöflichen „notarius“ ist nachweisbar,<br />
ohne jedoch die genauen Kompetenzen und Funktionen<br />
se<strong>in</strong>es Amtes def<strong>in</strong>ieren zu können (S. 406). Dem Ergebnis des<br />
Diktatvergleichs kommt vergleichsweise e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Verwertbarkeit<br />
zu, die auf die starke Straffung des Formulars im Laufe des<br />
13. Jahrhunderts zurückzuführen ist. In zwei Anhängen werden<br />
detailliert <strong>in</strong> Formularlisten die verschiedenen Wortlaute des klassischen<br />
Urkundenformulars aufgeführt und <strong>in</strong> anschließenden<br />
Formulartabellen die e<strong>in</strong>zelnen Bestandteile von der Invocatio bis<br />
h<strong>in</strong> zur Corroboratio und Datierung den e<strong>in</strong>zelnen Schreibern<br />
zugeordnet. E<strong>in</strong> Orts- und Personen<strong>in</strong>dex schließt die Arbeit ab,<br />
die als grundlegende Aufarbeitung der Kanzleigeschichte der Erzbischöfe<br />
von Köln im 13. Jahrhundert zu gelten hat.<br />
Pulheim Hans Budde<br />
<strong>Der</strong> furnehmbste Schatz. Ortsgeschichtliche<br />
Quellen <strong>in</strong> <strong>Archive</strong>n. Vorträge e<strong>in</strong>es quellenkundlichen<br />
Kolloquiums im Rahmen der Heimattage Baden-<br />
Württemberg am 23. Oktober 1999 <strong>in</strong> Pfull<strong>in</strong>gen. Hrsg.<br />
von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg.<br />
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2001. 99 S. mit 10 Abb.,<br />
geh. 10,– C.<br />
Seit e<strong>in</strong>igen Jahren nutzt die Landesarchivdirektion das Forum<br />
der Baden-Württembergischen Heimattage erfolgreich, um <strong>in</strong><br />
Kooperation mit den <strong>Archive</strong>n vor Ort die angestammte Klientel,<br />
also Ortshistoriker und heimatkundlich Interessierte aber auch<br />
das breitere Publikum auf archivische Problemfelder aufmerksam<br />
zu machen und über archivische Nutzungsmöglichkeiten zu<br />
unterrichten. Geme<strong>in</strong>sam mit dem Staatsarchiv Sigmar<strong>in</strong>gen und<br />
dem Kreisarchiv Reutl<strong>in</strong>gen veranstaltet, galt die Tagung 1999 <strong>in</strong><br />
Pfull<strong>in</strong>gen ortsgeschichtlichen Quellen <strong>in</strong> den unterschiedlichen<br />
Archivtypen.<br />
In zwei e<strong>in</strong>leitenden Referaten werden zunächst die jüngeren<br />
Tendenzen <strong>in</strong> der ortsgeschichtlichen Forschung <strong>in</strong> Baden-Württemberg<br />
(Andreas Schmauder), namentlich auch die Darstellung<br />
der Zeit des „Dritten Reiches“ (Benigna Schönhagen)<br />
beleuchtet. Mit der seit Anfang des 19. Jahrhunderts bestehenden<br />
amtlichen Kreisbeschreibung und der heute noch <strong>in</strong> Deutschland<br />
e<strong>in</strong>zigartigen amtlich-<strong>in</strong>stitutionalisierten „Landesbeschreibung“<br />
hat die Ortsgeschichte hier e<strong>in</strong>e bedeutende Tradition,<br />
deren Existenz unter f<strong>in</strong>anzpolitischem Druck immer e<strong>in</strong>mal wieder<br />
– glücklicherweise erfolglos – zur Disposition gestellt wird.<br />
Mit der wissenschaftlichen Akzeptanz der Sozial- und Mikrogeschichte<br />
ist seit den späten 70er Jahren e<strong>in</strong> wahrer Boom ortsgeschichtlicher<br />
Literatur zu verzeichnen, 40 bis 50 neue Titel pro<br />
Jahr: von der immer stärker arbeitsteilig und <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är<br />
angelegten wissenschaftlichen Ortsgeschichte über das „Heimatlob“<br />
älterer Prägung aus e<strong>in</strong>er Hand, bis h<strong>in</strong> zu der <strong>in</strong>sbesondere<br />
von e<strong>in</strong>igen kommunalen <strong>Archive</strong>n wie Stuttgart und Heilbronn<br />
gepflegten und nicht ganz unumstrittenen Chronik-Form.<br />
Am Beispiel des Fürstlich Thurn- und Taxischen Depositums<br />
Obermarchtal im Staatsarchiv Sigmar<strong>in</strong>gen stellt Annegret<br />
Wenz-Haubfleisch die Aussagekraft von Privatarchiven zur<br />
Grundherrschaft dar. Anhand des Salemschen Lehengutes Kernen<br />
<strong>in</strong> Spöck führt sie zunächst dessen vielfältigen dokumentarischen<br />
Niederschlag <strong>in</strong> den verschiedenen Quellentypen beispielhaft<br />
für das Jahr 1725 vor: Lehensbrief bzw. -revers, Verhörbücher,<br />
Urbare, Parzellenkarten und Rechnungen, um dann die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Quellentypen mit ihrer Entstehungsgeschichte, Aussagekraft und<br />
Problematik e<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong>en kritischen Würdigung zu unterziehen.<br />
Visitationsprotokollen, also dem schriftlichen Niederschlag<br />
sozialdiszipl<strong>in</strong>ierender kirchlicher Aufsichtstätigkeit, widmet<br />
sich Irmtraud Betz-Wischnath, denn „anders als die Quellen<br />
normativen Charakters unterrichten diese über den tatsächlichen<br />
Zustand des Kirchenwesens“. Neben der Kirchengeschichte<br />
selbst s<strong>in</strong>d es eben gerade die Orts- und Regionalgeschichte, die<br />
nachhaltig von diesen Quellen zehren, gewähren diese doch (fast)<br />
ungeschönt „E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die <strong>in</strong>neren Verhältnisse der Pfarreien,<br />
der Städte und Dörfer“, <strong>in</strong>sbesondere dann, wenn, wie im Herzogtum<br />
Württemberg, jährlich und tatsächlich vor Ort visitiert<br />
wurde.<br />
E<strong>in</strong> bisher nicht annähernd gehobener Schatz s<strong>in</strong>d die für das<br />
Herzogtum Württemberg eigentümlichen sogenannten „Inventuren<br />
und Teilungen“, amtlich aufgenommene Inventarverzeichnisse<br />
der Mobilien und Immobilien e<strong>in</strong>es jedes Bürgers anlässlich<br />
von Eheschließung und Tod, die e<strong>in</strong>geführt wurden, um Erbause<strong>in</strong>andersetzungen<br />
vorzubeugen. Rolf Bidl<strong>in</strong>gmaier stellt diese<br />
für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die Lokalgeschichte,<br />
die Entwicklung der Sachkultur oder die schwäbische Mentalität<br />
ganz allgeme<strong>in</strong> unvergleichlichen Quellen kundig und mit Verweis<br />
auf die reichlich vorhandene zeitgenössische Verwaltungsliteratur<br />
vor. Die Inventarpflicht wurde 1555 gesetzlich e<strong>in</strong>geführt<br />
und blieb bis zur E<strong>in</strong>führung des BGB am 1. 1. 1900 akribisch<br />
geübte Praxis. Tausende solcher überaus detailreicher Inventare<br />
lagern <strong>in</strong> jedem württembergischen Kommunalarchiv; Bidl<strong>in</strong>gmaier<br />
rechnet hoch, dass landesweit etwa 4 Mio. solcher Inventare<br />
auf Auswertung warten. Und es ist diese Fülle, an der bisher alle<br />
Forschungsprojekte gescheitert s<strong>in</strong>d.<br />
Norbert Hoffmann schließlich gibt vor dem H<strong>in</strong>tergrund der<br />
jeweiligen Behördengeschichte e<strong>in</strong>en Überblick über die „alles<br />
andere als homogene“ Überlieferung der württembergischen Prov<strong>in</strong>zialbehörden<br />
des 19. Jahrhunderts, also Kreisgerichtshöfe,<br />
Kreisregierungen, Kreisf<strong>in</strong>anzkammern, und rundet damit das<br />
ansprechend aufgemachte Bändchen ab, das jedem an lokal- oder<br />
358 <strong>Der</strong> <strong>Archivar</strong>, Jg. 55, <strong>2002</strong>, H. 4