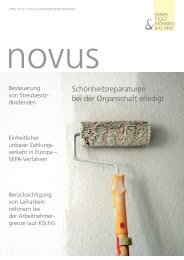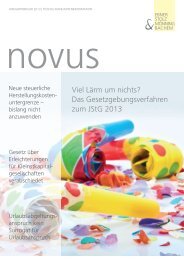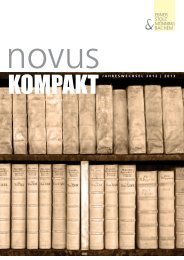01-2010 - Ebner Stolz Mönning Bachem
01-2010 - Ebner Stolz Mönning Bachem
01-2010 - Ebner Stolz Mönning Bachem
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ARBEITSRECHT NEWSLETTER I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
INHALT<br />
Gleichbehandlung beim Abschluss von Aufhebungsverträgen<br />
Seite<br />
2<br />
Beseitigung einer betrieblichen Übung 3<br />
Sonderzuwendungen unter Freiwilligkeitsvorbehalt 5<br />
Sonderzahlungen zum Zwecke der Standortsicherung 6<br />
Betriebsveräußerung ins Ausland 7<br />
„Director“ einer Komplementär-Limited ist kein Arbeitnehmer 9<br />
www.ebnerstolz.de
ARBEITSVERTRAGSRECHT<br />
Gleichbehandlung beim Abschluss von<br />
Aufhebungsverträgen<br />
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17.12.2009, 6 AZR 242/09 -<br />
Sachverhalt: In einem Unternehmen der Versicherungsbranche wurde in den Jahren<br />
2006 und 2007 mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung der Vertrieb neuorganisiert.<br />
Die Neuorganisation verlief dabei in mehreren Schritten. U. a. wurde Mitarbeitern angeboten,<br />
gegen Zahlung einer Abfindung aus dem Unternehmen auszuscheiden. Ein Mitarbeiter,<br />
der ebenfalls daran interessiert war, gegen Zahlung einer Abfindung das Unternehmen<br />
zu verlassen, erhob, nachdem das Unternehmen es ablehnte, auch mit ihm einen<br />
Aufhebungsvertrag zu schließen, Klage auf Abschluss eines solchen Vertrags und Zahlung<br />
einer Abfindung. Sein Begehren stützte er dabei auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.<br />
Das Begehren hatte in keiner Instanz Erfolg.<br />
Entscheidung: Die Anwendung des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes<br />
knüpft – so führte das Bundesarbeitsgericht aus – an eine verteilende Entscheidung des<br />
Arbeitgebers an. Er gebietet dem Arbeitgeber, seine Arbeitnehmer oder Gruppen seiner<br />
Arbeitnehmer, die sich in vergleichbarer Lage befinden, bei Anwendung einer selbst gesetzten<br />
Regelung gleich zu behandeln.<br />
Im Bereich der Arbeitsvergütung ist der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz<br />
trotz des Vorrangs der Vertragsfreiheit anwendbar, wenn der Arbeitgeber Leistungen nach<br />
einem bestimmten erkennbaren und generalisierenden Prinzip gewährt, indem er bestimmte<br />
Voraussetzungen oder einen bestimmten Zweck festlegt. Nicht anwendbar ist der<br />
arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz dagegen, wenn Leistungen oder Vergünstigungen<br />
individuell vereinbart werden. Dies beruht darauf, dass die Vertragsfreiheit Vorrang<br />
vor dem Gleichbehandlungsgrundsatz genießt.<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
2
Das Bundesarbeitsgericht gelangte so zum Ergebnis, dass das Begehren des Mitarbeiters<br />
keinen Erfolg haben konnte. Das Unternehmen war nach dem Prinzip der Abschlussfreiheit<br />
in seiner Entscheidung frei, welchen Mitarbeitern es die Aufhebung ihrer Arbeitsverhältnisse<br />
anbot.<br />
Für die Praxis: Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz findet keine Anwendung,<br />
wenn ein Arbeitgeber mit Arbeitnehmern individuelle Vereinbarungen über die Begründung<br />
oder die Aufhebung eines Arbeitsverhältnisses trifft und Abfindungen zahlt.<br />
ARBEITSVERTRAGSRECHT<br />
Beseitigung einer betrieblichen Übung<br />
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25.11.2009, 10 AZR 779/08 -<br />
Sachverhalt: Ein Unternehmen zahlte jahrelang seinen Mitarbeitern ab dem 20. Dienstjahr<br />
ein sog. Treuegeld. Im Jahr 2004 wurden die Zahlungen allerdings eingestellt. Dagegen<br />
wandte sich – im Jahr 2007 – ein Mitarbeiter, der seit 1985 im Unternehmen angestellt<br />
ist. Er vertrat vor Gericht die Auffassung, er habe einen Anspruch aus betrieblicher<br />
Übung. Das Unternehmen war demgegenüber der Ansicht, der Mitarbeiter habe keinen<br />
Zahlungsanspruch. Denn er habe in den Jahren 2004 bis 2006 kein Treuegeld geltend<br />
gemacht. Dadurch sei eine gegenläufige betriebliche Übung entstanden, die dazu geführt<br />
habe, dass eine etwaige Verpflichtung zur Zahlung des Treuegeldes (aus betrieblicher<br />
Übung) entfallen sei. Das Bundesarbeitsgericht schloss sich dieser Ansicht nicht an. Die<br />
Klage des Mitarbeiters hatte so in allen Instanzen Erfolg.<br />
Entscheidung: Durch eine betriebliche Übung – so führte das Bundesarbeitsgericht aus –<br />
erwerben Arbeitnehmer vertragliche Ansprüche auf die üblich gewordenen Leistungen.<br />
Der so entstandene Rechtsanspruch ist kein vertraglicher Anspruch minderer Rechtsbeständigkeit.<br />
Der Arbeitgeber kann ihn daher genauso wenig wie einen durch ausdrückli-<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
3
che arbeitsvertragliche Abrede begründeten Anspruch des Arbeitnehmers unter erleichterten<br />
Voraussetzungen zu Fall bringen.<br />
Gewährt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern jahrelang vorbehaltlos eine Sonderzuwendung,<br />
kann der Anspruch der Mitarbeiter auf diese Sonderzuwendung (aus betrieblicher<br />
Übung) nicht dadurch aufgehoben werden, dass der Arbeitgeber die Leistungsgewährung<br />
schlicht einstellt und die Mitarbeiter der neuen Handhabung über einen Zeitraum von drei<br />
Jahren hinweg nicht widersprechen. Dies folgt aus den gesetzlichen Vorschriften zu Allgemeinen<br />
Geschäftsbedingungen (AGB), die seit <strong>01</strong>.<strong>01</strong>.2002 auch auf Arbeitsverträge<br />
– unter angemessener Berücksichtigung der im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten –<br />
anzuwenden sind.<br />
Für die Praxis: Das Bundesarbeitsgericht hatte bereits mit Urteil vom 18.03.2009, 10 AZR<br />
281/08 seine bisherige Rechtsprechung zur sog. gegenläufigen betrieblichen Übung aufgegeben.<br />
Mit der vorliegenden Entscheidung hält das Bundesarbeitsgericht an dieser neuen<br />
Rechtsprechung fest. Die alte Rechtsprechung, wonach eine betriebliche Übung abgeändert<br />
bzw. sogar beseitigt werden konnte, wenn der Arbeitnehmer einer geänderten<br />
Handhabung über einen Zeitraum von drei Jahren nicht widersprochen hatte, ist hinfällig.<br />
Es ist daher heute umso wichtiger schon dem Entstehen einer betrieblichen Übung entgegenzuwirken,<br />
etwa durch Leistungsgewährung unter Freiwilligkeitsvorbehalt.<br />
ARBEITSVERTRAGSRECHT<br />
Sonderzuwendungen unter Freiwilligkeitsvorbehalt<br />
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>0, 10 AZR 914/08 -<br />
Sachverhalt (vereinfacht): Eine Arbeitnehmerin, die von Beruf Altenpflegerin ist, verklagte<br />
ihren Arbeitgeber, einen gemeinnützigen Verein, der Pflegeheime betreibt, auf<br />
Zahlung einer Sonderzuwendung. Im Rahmen des Rechtsstreits vertrat der Arbeitgeber die<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
4
Auffassung, er sei zur Zahlung einer Sonderzuwendung nicht verpflichtet. Sämtliche Sonderzuwendungen<br />
seien in der Vergangenheit unter Freiwilligkeitsvorbehalt geleistet worden.<br />
Er sei deshalb nicht gehindert, zukünftig keine Sonderzuwendung mehr zu erbringen.<br />
Der verwendete Freiwilligkeitsvorbehalt lautete: „Sämtliche Sonderzahlungen sind<br />
freiwillige Zuwendungen, für die kein Rechtsanspruch besteht (z. B. Weihnachtsgratifikation<br />
und Urlaubsgeld richten sich nach den Bestimmungen des BAT).“ Die Klage der Arbeitnehmerin<br />
war letztinstanzlich erfolgreich.<br />
Entscheidung: Das Bundesarbeitsgericht wies zu Beginn seiner Entscheidung darauf hin,<br />
dass die Verwendung von Freiwilligkeitsvorbehalten, die einen Anspruch des Arbeitnehmers<br />
auf eine Sonderzahlung selbst bei wiederholter Zahlung nicht entstehen lassen,<br />
grundsätzlich zulässig ist.<br />
Es stellte sodann allerdings fest, dass der vorliegend verwendete Freiwilligkeitsvorbehalt<br />
inhaltlich widersprüchlich ist: Der Widerspruch besteht zwischen dem eigentlichen Freiwilligkeitsvorbehalt<br />
(„sämtliche Sonderzahlungen sind freiwillige Zuwendungen, für die kein<br />
Rechtsanspruch besteht“) und dem Klammerzusatz („z. B. Weihnachtsgratifikation und<br />
Urlaubsgeld richten sich nach den Bestimmungen des BAT“). Denn der Klammerzusatz<br />
(„richten sich“) formuliert einen Rechtsanspruch des Mitarbeiters.<br />
Nach § 305c Abs. 2 BGB gehen Zweifel bei der Auslegung einer Bestimmung zulasten des<br />
Arbeitgebers als Verwender der Vorbehaltsregelung. Die Norm kommt dann zur Anwendung,<br />
wenn die Auslegung einer einzelnen Klausel ein mehrdeutiges Ergebnis liefert. Das<br />
Bundesarbeitsgericht ging daher zugunsten der Mitarbeiterin davon aus, dass die Mitarbeiterin<br />
eine Weihnachtsgratifikation beanspruchen konnte.<br />
Für die Praxis: § 305c Abs. 2 BGB hat die Funktion, bei mehrdeutigen Klauseln eine Auslegungshilfe<br />
zu geben, und in diesem Fall die Interessen des Arbeitgebers hinter denjenigen<br />
des Mitarbeiters zurücktreten zu lassen. Arbeitgeber haben daher bei der Vertragsgestaltung<br />
darauf zu achten, sich klar und unmissverständlich auszudrücken. Denn alle Unklarheiten<br />
gehen zu ihren Lasten.<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
5
ARBEITSVERTRAGSRECHT<br />
Sonderzahlungen zum Zwecke der Standortsicherung<br />
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 05.08.2009, 10 AZR 666/08 -<br />
Sachverhalt: Ein Unternehmen erstellte im Frühjahr 2005 ein Standortsicherungskonzept.<br />
Danach sollte die Wochenarbeitszeit erhöht, aber auf eine Erhöhung der Arbeitsvergütung<br />
seitens der Belegschaft verzichtet werden. Zur Umsetzung dieses Konzepts bot das Unternehmen<br />
seinen Beschäftigten Änderungsverträge an, die jedoch nur von einem Teil der<br />
Belegschaft akzeptiert wurden. Ende des Jahres 2005 gewährte der Arbeitgeber diesem<br />
Teil der Belegschaft eine Sonderzahlung, um ihnen für ihre Leistungsbereitschaft zu danken<br />
und sie für die Zukunft zu motivieren. Der Belegschaft wurde mitgeteilt, dass „alle<br />
Mitarbeiter, die die veränderten Bedingungen im Zusatz zum Arbeitsvertrag vereinbart<br />
haben, eine Sonderzahlung erhalten“ mit Ausnahme derjenigen Mitarbeiter, die sich am<br />
31.12.05 nicht „in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden“. Ein Mitarbeiter, der<br />
das Änderungsangebot mit für ihn schlechteren Arbeitsbedingungen abgelehnt hatte,<br />
klagte daraufhin auf Zahlung der Sonderzuwendung. Er vertrat die Auffassung, die selektive<br />
Zahlungsweise des Arbeitgebers verstoße gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.<br />
Die Klage hatte Erfolg.<br />
Entscheidung: Es steht dem Arbeitgeber frei, an einzelne Mitarbeiter eine Sonderzahlung<br />
zu erbringen, die einen Beitrag zur Standortsicherung leisten. Ein Arbeitgeber darf<br />
bei Sonderzahlungen – grundsätzlich ohne Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz<br />
– unterschiedliche Arbeitsbedingungen berücksichtigen und eine<br />
geringere laufende Arbeitsvergütung einer Arbeitnehmergruppe durch eine Sonderzahlung<br />
teilweise oder vollständig kompensieren.<br />
Vorliegend hatte die Klage des Mitarbeiters aber dennoch Erfolg, da dem Unternehmen<br />
bei der Formulierung ein „Fehler“ unterlaufen war. Das BAG sah mit der Ausnahmeregelung<br />
zum Ausdruck gebracht, dass die Sonderzahlung nicht nur der Honorierung der<br />
Leistungsbereitschaft und zur Motivation der Belegschaft diente, sondern auch der Förderung<br />
der Betriebstreue. Erschöpft sich der Zweck einer Sonderzahlung aber nicht in der<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
6
Kompensation geringerer laufender Arbeitsvergütung, sondern verfolgt der Arbeitgeber<br />
mit dieser Leistung noch andere Ziele, stellt es einen Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen<br />
Gleichbehandlungsgrundsatz dar, Arbeitnehmer von der Sonderzahlung auszunehmen,<br />
die Änderungsangebote des Arbeitgebers mit für sie ungünstigeren Arbeitsbedingungen<br />
ablehnen, die Voraussetzung der Betriebstreue jedoch erfüllen.<br />
Für die Praxis: Es ist durchaus rechtlich möglich, lediglich solchen Mitarbeitern eine Sonderzahlung<br />
zu gewähren, die auch bereit sind, zur Standortsicherung beizutragen.<br />
KÜNDIGUNGSSCHUTZ<br />
Betriebsveräußerung ins Ausland<br />
- LArbG Baden-Württemberg, Urteil vom 15.12.2009, 22 Sa 45/09 -<br />
(nicht rechtskräftig)<br />
Sachverhalt: Ein Schweizer Konzern der Pharma- und Chemieindustrie beschloss im<br />
Herbst 2008 seinen Standort in Deutschland zu schließen. Die Tätigkeit des Konzerns sollte<br />
in der Schweiz konzentriert werden. Kunden und Lieferanten des deutschen Tochterunternehmens<br />
wurden in der Folgezeit dahingehend informiert, dass alle bestehenden Verträge<br />
nahtlos von einem Schweizer Tochterunternehmen übernommen würden. Weiter<br />
wurden sämtliche Anlagen, Maschinen und Werkzeuge sowie das Lager durch dieses<br />
Tochterunternehmen aufgekauft, laufende Projekte übertragen. Alle Beschäftigten in<br />
Deutschland wurden gekündigt. Elf Beschäftigte erhielten allerdings mit der Kündigung<br />
ein Arbeitsvertragsangebot für die Schweiz. Unter diesen elf Beschäftigten befand sich<br />
auch der Kläger, der jedoch das Arbeitsvertragsangebot ablehnte und in der Folgezeit<br />
Kündigungsschutzklage gegen das deutsche Unternehmen erhob. Er ist der Auffassung,<br />
die Kündigung sei unwirksam. Dieser Auffassung hat sich das Landesarbeitsgericht BW<br />
angeschlossen. Die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) ist noch anhängig.<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
7
Entscheidung: Das LArbG hält die Kündigung für unwirksam. Eine betriebsbedingte<br />
Kündigung wegen Fortfall der Beschäftigungsmöglichkeit infolge Betriebsstilllegung – wie<br />
von der Beklagten behauptet – kommt vorliegend nicht in Betracht. Unter Betriebsstilllegung<br />
ist die Auflösung der zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehenden Betriebs-<br />
oder Produktionsgemeinschaft zu verstehen; das Unternehmen muss die bisherige<br />
wirtschaftliche Betätigung in der ernstlichen Absicht einstellen, die Verfolgung des bisherigen<br />
Betriebszwecks dauernd nicht weiter zu verfolgen. Nach dem eigenen Vorbringen<br />
der Beklagten war die behauptete unternehmerische Entscheidung jedoch nicht lediglich<br />
darauf gerichtet, die Produktion und den Betrieb ersatzlos einzustellen und sämtliches<br />
Personal zu entlassen. Teil des Plans war auch den Betrieb in die Schweiz zu veräußern.<br />
Die Veräußerung des Betriebs ist allerdings gerade keine Stilllegung. Betriebsveräußerung<br />
und Betriebsstilllegung schließen sich systematisch aus.<br />
Durch die Betriebsveräußerung sind die Arbeitsverhältnisse auf den Betriebserwerber von<br />
Gesetzes wegen (§ 613a BGB) übergegangen. § 613a BGB gilt grundsätzlich auch bei<br />
Betriebsveräußerungen ins Ausland. Bei der normalerweise gegebenen Sachverhaltskonstellation,<br />
dass auf die Arbeitsverhältnisse der in einem deutschen Betrieb tätigen Arbeitnehmer<br />
deutsches Recht Anwendung findet, ist § 613a BGB zu beachten. – Nach alledem<br />
konnte eine Kündigung wegen Betriebsstilllegung nicht wirksam ausgesprochen werden.<br />
Für die Praxis: Die Ausführungen des LArbG zur Abgrenzung von Betriebsstilllegung und<br />
Betriebsveräußerung entsprechen der Auffassung des Bundesarbeitsgerichts. Insoweit<br />
bringt die Entscheidung nichts Neues. Das LArbG vertritt in der vorliegenden Entscheidung<br />
allerdings die Auffassung, dass § 613a BGB auch bei Betriebsveräußerungen ins Ausland<br />
zu beachten sei. Dies ist abzulehnen. Eine deutsche Norm kann grundsätzlich nur im deutschen<br />
Staatsgebiet Geltung beanspruchen. Es ist auch kaum anzunehmen, dass im Falle<br />
einer Klage des Arbeitnehmers gegen das Schweizer Tochterunternehmen ein Schweizer<br />
Gericht § 613a BGB anwenden würde. Bis zur Entscheidung des BAG ist die Entscheidung<br />
des LArbG allerdings – zumindest in Baden-Württemberg – bei Betriebsveräußerungen ins<br />
Ausland zu beachten.<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
8
PROZESSRECHT<br />
„Director“ einer Komplementär-Limited ist kein<br />
Arbeitnehmer<br />
- LArbG Baden-Württemberg, Beschluss vom 12.02.2<strong>01</strong>0, 6 Ta 11/09 -<br />
Sachverhalt: Ein bundesweit tätiges Unternehmen, das in der Rechtsform der Limited &<br />
Co. KG betrieben wird, schloss mit einem der beiden „Directors“ der Komplementär-<br />
Limited Ende 2008 einen „Dienstvertrag“. Aus dem Dienstvertrag wird ersichtlich, dass<br />
der Geschäftsführer (Director) gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem<br />
Prokuristen die Limited vertritt. Mitte 2009 kündigte die vorbezeichnete KG den Dienstvertrag<br />
ordentlich zum 31.03.2<strong>01</strong>0. Dagegen erhob der „Director“ Kündigungsschutzklage<br />
beim Arbeitsgericht. Das Arbeitsgericht hat den Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten verneint.<br />
Das hiergegen eingelegte Rechtsmittel hatte keinen Erfolg.<br />
Entscheidung: Die Arbeitsgerichte sind ausschließlich zuständig für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten<br />
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis und<br />
über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 a, b<br />
ArbGG). Bei Kapitalgesellschaften wie der AG oder der GmbH haben zwar auch der Vorstand<br />
und der Geschäftsführer bisweilen einen Arbeitnehmer-Status, allerdings ist diese<br />
Personengruppe kraft Gesetzes (§ 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG) ausgenommen. Die Arbeitsgerichte<br />
sind daher nicht zuständig für Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und ihrem<br />
Vorstand oder Geschäftsführer. Hintergrund ist, dass Vorstand wie Geschäftsführer innerhalb<br />
der Gesellschaft die Arbeitgeberfunktion gegenüber den übrigen Angestellten wahrnehmen,<br />
und der Gesetzgeber nicht wollte, dass die Arbeitsgerichte auch für „Hausstreitigkeiten“<br />
im Arbeitgeberbereich zuständig sind.<br />
Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts erfasst die maßgebliche Norm, § 5 Abs. 1 Satz<br />
3 ArbGG, auch Geschäftsführer der Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG, deren<br />
Dienstvertrag mit der KG abgeschlossen wurde. Denn der Geschäftsführer einer Komplementär-GmbH<br />
vertritt als Organ der Gesellschaft nicht nur die GmbH, sondern auch die<br />
KG. Dies ist Folge der gesetzlichen Vertretungsregelungen, wonach die KG durch die<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
9
Komplementär-GmbH vertreten wird und diese wiederum durch ihren Geschäftsführer. Es<br />
spielt daher keine Rolle, ob im Falle einer GmbH & Co. KG der Geschäftsführer einen Anstellungsvertrag<br />
bei der GmbH oder der KG erhält. In beiden Fällen ist er eine arbeitgebergleiche<br />
Person und die Arbeitsgerichte sind für Streitigkeiten zwischen ihm und der Gesellschaft<br />
nicht zuständig. Entsprechendes hat das LArbG in der vorliegenden Entscheidung<br />
für den „Director“ bei einer Limited & Co. KG angenommen: Die Limited ist die gesetzliche<br />
Vertreterin der KG und wird ihrerseits vertreten durch die „Directors“.<br />
Für die Praxis: Es spielt keine Rolle, ob der Vertrag mit einem Geschäftsführer oder sonstigen<br />
organschaftlichen Vertretern der Komplementär-GmbH unmittelbar mit dieser oder<br />
mit der KG abgeschlossen wird. In beiden Fällen sind die ordentlichen Gerichte, nicht die<br />
Arbeitsgerichte, für Streitigkeiten zuständig.<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
10
Arbeitsrecht Competence Center<br />
Stuttgart<br />
Dr. Rolf Kußmaul<br />
rolf.kussmaul@ebnerstolz.de<br />
Roland Hoch<br />
roland.hoch@ebnerstolz.de<br />
Impressum:<br />
Herausgeber<br />
<strong>Ebner</strong> <strong>Stolz</strong> <strong>Mönning</strong> <strong>Bachem</strong><br />
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte<br />
Partnerschaft<br />
NEWSLETTER ARBEITSRECHT I APRIL 2<strong>01</strong>0<br />
Hamburg<br />
Michael Huth<br />
michael.huth@ebnerstolz.de<br />
Dr. Evelyn Nau<br />
evelyn.nau@ebnerstolz.de<br />
Kiel<br />
Kronenstr. 30, 7<strong>01</strong>74 Stuttgart<br />
Tel: +49 711 2049-0<br />
Fax: +49 711 2049-1333<br />
www.ebnerstolz.de<br />
Redaktion:<br />
Arbeitsrecht Competence Center<br />
RA StB Dr. Rolf Kußmaul, Tel: +49 711 2049-1176, E-Mail: rolf.kussmaul@ebnerstolz.de<br />
Eckart Bröcker<br />
eckart.broecker@ebnerstolz.de<br />
Kerrin Anhut<br />
kerrin.anhut@ebnerstolz.de<br />
Die einzelnen Beiträge enthalten nur allgemeine Informationen über bestimmte Themen.<br />
Sie sind in keinem Fall als Entscheidungsgrundlage geeignet und können daher eine individuelle Beratung im Einzelfall<br />
nicht ersetzen. Bitte sprechen Sie uns an.<br />
<strong>Ebner</strong> <strong>Stolz</strong> <strong>Mönning</strong> <strong>Bachem</strong> bietet Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung<br />
aus einer Hand. Als unabhängige Beratungsgesellschaft gehören wir mit rund 750 Mitarbeitern zu den zehn großen, etablierten<br />
Unternehmen der Branche in Deutschland. Wir sind Mitglied bei NEXIA International.<br />
Berlin I Bonn I Düsseldorf I Frankfurt I Hamburg I Hannover I Kiel I Köln I Leipzig I München I Reutlingen I Solingen I Stuttgart<br />
11