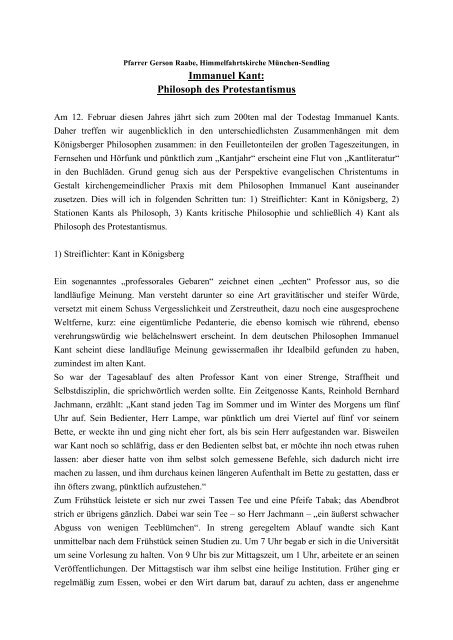Immanuel Kant: Philosoph des Protestantismus
Immanuel Kant: Philosoph des Protestantismus
Immanuel Kant: Philosoph des Protestantismus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Pfarrer Gerson Raabe, Himmelfahrtskirche München-Sendling<br />
<strong>Immanuel</strong> <strong>Kant</strong>:<br />
<strong>Philosoph</strong> <strong>des</strong> <strong>Protestantismus</strong><br />
Am 12. Februar diesen Jahres jährt sich zum 200ten mal der To<strong>des</strong>tag <strong>Immanuel</strong> <strong>Kant</strong>s.<br />
Daher treffen wir augenblicklich in den unterschiedlichsten Zusammenhängen mit dem<br />
Königsberger <strong>Philosoph</strong>en zusammen: in den Feuilletonteilen der großen Tageszeitungen, in<br />
Fernsehen und Hörfunk und pünktlich zum „<strong>Kant</strong>jahr“ erscheint eine Flut von „<strong>Kant</strong>literatur“<br />
in den Buchläden. Grund genug sich aus der Perspektive evangelischen Christentums in<br />
Gestalt kirchengemeindlicher Praxis mit dem <strong>Philosoph</strong>en <strong>Immanuel</strong> <strong>Kant</strong> auseinander<br />
zusetzen. Dies will ich in folgenden Schritten tun: 1) Streiflichter: <strong>Kant</strong> in Königsberg, 2)<br />
Stationen <strong>Kant</strong>s als <strong>Philosoph</strong>, 3) <strong>Kant</strong>s kritische <strong>Philosoph</strong>ie und schließlich 4) <strong>Kant</strong> als<br />
<strong>Philosoph</strong> <strong>des</strong> <strong>Protestantismus</strong>.<br />
1) Streiflichter: <strong>Kant</strong> in Königsberg<br />
Ein sogenanntes „professorales Gebaren“ zeichnet einen „echten“ Professor aus, so die<br />
landläufige Meinung. Man versteht darunter so eine Art gravitätischer und steifer Würde,<br />
versetzt mit einem Schuss Vergesslichkeit und Zerstreutheit, dazu noch eine ausgesprochene<br />
Weltferne, kurz: eine eigentümliche Pedanterie, die ebenso komisch wie rührend, ebenso<br />
verehrungswürdig wie belächelnswert erscheint. In dem deutschen <strong>Philosoph</strong>en <strong>Immanuel</strong><br />
<strong>Kant</strong> scheint diese landläufige Meinung gewissermaßen ihr Idealbild gefunden zu haben,<br />
zumin<strong>des</strong>t im alten <strong>Kant</strong>.<br />
So war der Tagesablauf <strong>des</strong> alten Professor <strong>Kant</strong> von einer Strenge, Straffheit und<br />
Selbstdisziplin, die sprichwörtlich werden sollte. Ein Zeitgenosse <strong>Kant</strong>s, Reinhold Bernhard<br />
Jachmann, erzählt: „<strong>Kant</strong> stand jeden Tag im Sommer und im Winter <strong>des</strong> Morgens um fünf<br />
Uhr auf. Sein Bedienter, Herr Lampe, war pünktlich um drei Viertel auf fünf vor seinem<br />
Bette, er weckte ihn und ging nicht eher fort, als bis sein Herr aufgestanden war. Bisweilen<br />
war <strong>Kant</strong> noch so schläfrig, dass er den Bedienten selbst bat, er möchte ihn noch etwas ruhen<br />
lassen: aber dieser hatte von ihm selbst solch gemessene Befehle, sich dadurch nicht irre<br />
machen zu lassen, und ihm durchaus keinen längeren Aufenthalt im Bette zu gestatten, dass er<br />
ihn öfters zwang, pünktlich aufzustehen.“<br />
Zum Frühstück leistete er sich nur zwei Tassen Tee und eine Pfeife Tabak; das Abendbrot<br />
strich er übrigens gänzlich. Dabei war sein Tee – so Herr Jachmann – „ein äußerst schwacher<br />
Abguss von wenigen Teeblümchen“. In streng geregeltem Ablauf wandte sich <strong>Kant</strong><br />
unmittelbar nach dem Frühstück seinen Studien zu. Um 7 Uhr begab er sich in die Universität<br />
um seine Vorlesung zu halten. Von 9 Uhr bis zur Mittagszeit, um 1 Uhr, arbeitete er an seinen<br />
Veröffentlichungen. Der Mittagstisch war ihm selbst eine heilige Institution. Früher ging er<br />
regelmäßig zum Essen, wobei er den Wirt darum bat, darauf zu achten, dass er angenehme
2<br />
Gesprächspartner beim Essen habe. Dies geschah, und so waren es immer sehr ausgiebige und<br />
eben gesprächsreiche Mittagstafeln, die <strong>Kant</strong> wahrnahm. Jachmann schreibt: „<strong>Kant</strong> war jeder<br />
Mann aus jedem Stande, wenn er diesen Stande nur nicht merklich hervorhob, am Tisch ganz<br />
willkommen. - Auf die Wahl der Speisen musste Aufmerksamkeit verwandt werden. <strong>Kant</strong><br />
liebte nicht gerade sehr komponierte Schüsseln, aber er forderte, dass vor allen Dingen das<br />
Fleisch, welches es auch war, mürbe, und gutes Brot und guter Wein, in frühen Jahren roter,<br />
späterhin weißer, auf dem Tische sein musste. Das Eilen beim Essen, um nur bald<br />
aufzustehen, war ihm ein Dorn im Auge. Gerne, wenn das Essen ihm schmeckte, ließ er sich,<br />
auch in männlicher Gesellschaft, die Art der Zubereitung sagen. In früheren Jahren ging er<br />
nach dem Mittagessen in ein Kaffeehaus, trank dort eine Tasse Tee, unterhielt sich über die<br />
Ereignisse <strong>des</strong> Tages oder spielte eine Runde Billard. In späteren Jahren hielt er seinen<br />
eigenen Mittagstisch zuhause, zu dem er 3 bis 5, aber nie über 9 Freunde einlud. Nach dem<br />
Mittagessen folgte der Spaziergang.“<br />
Ein anderer Biograph berichtet: „<strong>Kant</strong>s Nachbarn wussten ganz genau, dass die Glocke halb<br />
vier sei, wenn <strong>Immanuel</strong> <strong>Kant</strong> in seinem grauen Leibrock, das spanische Röhrchen in der<br />
Hand, aus seiner Haustür trat und nach der kleinen Lindenallee wanderte, die man<br />
seinetwegen noch jetzt den <strong>Philosoph</strong>engang nennt. Achtmal spazierte er dort auf und ab, in<br />
jeder Jahreszeit, und wenn das Wetter trübe war oder die grauen Wolken einen Regen<br />
verkündeten, sah man seinen Diener, den alten Lampe, hinter ihm her drein wandeln mit<br />
einem großen Regenschirm unter dem Arm, wie ein Bild der Vorsehung“. Und Jachmann<br />
beschreibt den restlichen Tagesverlauf: "Dann begab sich <strong>Kant</strong>, nach getaner übrigen<br />
Tagesarbeit, ohne sich in späteren Jahren das min<strong>des</strong>te zum Abendgenus reichen zu lassen,<br />
um 10 Uhr pünktlich zur Bettruhe.“<br />
Diese Bettruhe war wie eine Zeremonie geregelt. Wieder ein anderer Zeitgenosse berichtet:<br />
„Durch vieljährige Gewohnheit hatte er eine besondere Fertigkeit erlangt, sich in die Decken<br />
einzuhüllen. Beim Schlafengehen setzte er sich erst ins Bett, schwang sich mit Leichtigkeit<br />
hinein, zog den einen Zipfel der Decke über die eine Schulter unter dem Rücken durch bis zur<br />
anderen und durch eine besondere Geschicklichkeit auch den anderen unter sich, und dann<br />
weiter bis auf den Leib. So emballiert und gleichsam wie ein Kokon eingesponnen erwartete<br />
er den Schlaf.“<br />
Wie der Tagesablauf <strong>Kant</strong>s, so musste auch seine Umwelt aufs genaueste geordnet sein.<br />
Wenn eine Schere oder ein Federmesser in ihrer gewohnten Richtung auch nur ein wenig<br />
verschoben waren, oder wenn gar ein Stuhl an eine andere Stelle im Zimmer gerückt ist, gerat<br />
er in Unruhe, ja Verzweiflung und stellte die vertraute Ordnung wieder her.<br />
Je<strong>des</strong> programmwidriger Ereignis wurde von ihm als nahezu persönliche Beleidigung<br />
empfunden. Noch schlimmer war es für ihn, wenn seine Umwelt sich durch allzu<br />
aufdringliche und dauerhafte störende Geräusche bemerkbar machte. Einmal ist es ein Hahn<br />
<strong>des</strong> Nachbarn, der <strong>Kant</strong> unglaublich störte. Daher beschließt er, dieses dem Denken so<br />
abträgliche Tier seinem Besitzer abzukaufen. Doch diesem war es ganz und gar nicht
3<br />
begreiflich, wie ein Hahn einen Weisen stören könne. So blieb <strong>Kant</strong> nichts anderes übrig, als<br />
die Wohnung zu wechseln, was er auch tat. Aber auch dies war leider ein vergebliches<br />
Unterfangen. Denn das neue Haus lag neben dem Stadtgefängnis, und der Brauch der<br />
damaligen Zeit will es, dass die Gefangenen zu ihrer Besserung geistliche Lieder singen<br />
müssen, was sie dann auch bei offenem Fenster und mit rohe, lauter Stimme taten. <strong>Kant</strong><br />
beschwerte sich beim Bürgermeister, und schrieb in seiner „Kritik der Urteilskraft“ - eines<br />
seiner drei kritischen Hauptwerke - in einer Anmerkung: „diejenigen, welche zu den<br />
häuslichen Andachtsübungen auch das Singen geistlicher Lieder empfohlen haben, bedachten<br />
nicht, dass sie dem Publikum durch solch eine lärmende (eben dadurch gemeiniglich<br />
pharisäische) Andacht eine große Beschwerde auflegen, indem sie die Nachbarschaft<br />
entweder mitzusingen oder ihr Gedankengeschäft niederzulegen nötigen.“<br />
2) Stationen <strong>Kant</strong>s als <strong>Philosoph</strong><br />
<strong>Immanuel</strong> <strong>Kant</strong> wurde am 22. April 1724 in Königsberg geboren. Es ist die Zeit, in die der<br />
Bau der Frauenkirche in Dresden, die Entstehung von Bachs Matthäuspassion und die<br />
Vertreibung der Protestanten aus Salzburg fällt. Königsberg war damals die Hauptstadt <strong>des</strong><br />
Herzogtums Preußen und war zur damaligen Zeit einer der bedeutenden Handelshäfen. <strong>Kant</strong><br />
hat Königsberg sein Leben lang nicht verlassen. Sein Vater war Johann Georg <strong>Kant</strong>, von<br />
Beruf Riemenmeister - heute würden wir sagen Sattlermeister -, er vermittelte <strong>Immanuel</strong> die<br />
Mentalität rechtschaffenden Handwerkertums und selbstbewussten Bürgertums. Eine<br />
profilierte Persönlichkeit gemäßigter pietistischer Prägung war die aus Nürnberg stammende<br />
Mutter.<br />
Mit 8 Jahren kam der junge <strong>Immanuel</strong> daher dann auch in ein pietistisches Internat, dass er bis<br />
zu seinem 16 Lebensjahr besuchte, um dann an die Universität zu gehen. Nach dem Studium<br />
übernahm er ein paar Jahre eine Verpflichtung als Hauslehrer bei einer adeligen Familie. Aber<br />
es zog <strong>Kant</strong> an die Universität zurück, und so wurde er dort mit 31 Jahren promoviert. Noch<br />
im gleichen Jahr begann er mit seiner Vorlesungstätigkeit. Trotz <strong>des</strong> großen Ansehens, dass er<br />
seit Anbeginn seiner akademischen Tätigkeit sowohl bei Kollegen als auch bei Schülern<br />
genoss, blieb er zunächst 15 Jahre lang Magister, also Dozent. In diese Zeit fallen<br />
Veröffentlichungen vor allem aus dem Bereich der Naturwissenschaften, etwa zur „Erdachse“<br />
oder eine „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie <strong>des</strong> Himmels“ oder Überlegungen zum<br />
Phänomen „Erdbeben“. Ab den 60er Jahren gibt <strong>Kant</strong> verschiedene psychologische,<br />
ästhetische und metaphysische Untersuchungen heraus: „Versuch einer Betrachtung über den<br />
Optimismus“, „Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration <strong>des</strong> Daseins<br />
Gottes“, „Beobachtungen über das Gefühl <strong>des</strong> Schönen und Erhabenen.“ Mit 42 Jahren, im<br />
Jahre 1766, nahm er die ohne sein Gesuch ihm angetragene zweite Aufseherstelle bei der<br />
Königlichen Bibliothek an. Erst 1770, mit 46, wird <strong>Kant</strong> Professor für <strong>Philosoph</strong>ie.
4<br />
Kurz darauf zieht <strong>Kant</strong> sich - freilich seinen akademischen Verpflichtungen nachkommenden<br />
- fast 10 Jahre aus der wissenschaftlichen Öffentlichkeit und deren Veröffentlichungen<br />
zurück. 1781, in dem Jahr, in dem Lessing, der große Dichter der deutschen Aufklärung und<br />
zugleich ihr bedeutenster Kritiker, die Augen schloss, erscheint dann jenes Werk, dass in der<br />
Geistesgeschichte <strong>des</strong> Abendlan<strong>des</strong> einen Meilenstein darstellt und zugleich einen<br />
Wendepunkt markierte, der seinesgleichen suchen dürfte, und das außerdem den Grundstein<br />
dafür legte, dass man heute die gesamte <strong>Philosoph</strong>iegeschichte in eine <strong>Philosoph</strong>ie vor <strong>Kant</strong><br />
und in eine <strong>Philosoph</strong>ie nach <strong>Kant</strong> unterteilen kann: "Die Kritik der reinen Vernunft". Zwei<br />
Jahre später schiebt <strong>Kant</strong> die „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als<br />
Wissenschaft wird auftreten können“ nach, weil er den Eindruck hatte, dass die erste Kritik<br />
auch auf viel Unverständnis gestoßen war. Die Prolegomena sind allerdings keineswegs eine<br />
nachgereichte Einführung, sondern selbst ein Buch mit extremen Anforderungen. So<br />
überarbeitet <strong>Kant</strong> seine erste Kritik und lässt 1787 eine zweite Auflage erscheinen. In <strong>Kant</strong>s<br />
kritischer <strong>Philosoph</strong>ie, die von ihm nach jahrzehnterlanger Arbeit als Forscher im durchaus<br />
schon fortgeschrittenen Alter von 57 Jahren vorgelegt wird, erreicht die abendländische<br />
<strong>Philosoph</strong>ie eine ihrer markantesten und einschneidensten Zäsuren, die von vielen - sowohl<br />
Freunden als auch Gegnern - als d e r Höhepunkt der abendländischen Geistesgeschichte<br />
verstanden wurde und wird. Einmalig ist diese Zäsur oder dieser Höhepunkt jedenfalls darin,<br />
dass er ausschließlich von der Gedankenarbeit eines einzigen Mannes bewirkt wurde. Neben<br />
der "Kritik der reinen Vernunft" zählen die "Kritik der praktischen Vernunft" (1788), die<br />
"Kritik der Urteilskraft" (1790), seine "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (1785) und<br />
die "Metaphysik der Sitten" (1797), sowie sein Buch "Die Religion innerhalb der Grenzen der<br />
bloßen Vernunft" (1793) zu seinen kritischen Hauptschriften.<br />
Über 40 Jahre lang hat <strong>Kant</strong> Vorlesungen gehalten, nicht nur über <strong>Philosoph</strong>ie, sonder auch<br />
über Logik, Metaphysik, mathematische Physik, Geographie, Anthropologie sowie über<br />
natürliche Theologie, Moral und Naturrecht. Er war ein äußerst beliebter und anregender<br />
Lehrer. Herder, der in <strong>Kant</strong>s ersten Dozentenjahren in Königsberg studierte, preist <strong>Kant</strong>s<br />
Vorzüge als Vortragender in einem Brief: „Er hat in seinen blühenden Jahren fast die<br />
fröhliche Munterkeit eines Jünglings, seine offene zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz<br />
unzerstörbarer Heiterkeit und Freude, die gedankenreichste Rede floss von seinen Lippen,<br />
Scherz und Witz und Laune standen ihm zu Gebote, und sein lehrender Vortrag war der<br />
unterhaltenste Umgang. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken...“ Ebenso<br />
anregend wie über philosophische Probleme wusste <strong>Kant</strong> in seinen geographischen Vorträgen<br />
über fremde Länder und Völker zu sprechen, obwohl er nie aus Königsberg hinausgekommen<br />
war.<br />
1794 - mit 70 Jahren - zog <strong>Kant</strong> sich allmählich von seiner Vorlesungstätigkeit zurück. Die<br />
letzten Jahre bieten das Bild eines mit Würde und Souveränität getragenen allmählichen<br />
Absterbens der geistigen und leiblichen Kräfte. Am 11. Februar 1804 sei sein letztes Wort zu<br />
hören gewesen: „Es ist gut.“ Von Heinrich Heine stammt das Wort: „Die Natur wollte wissen,
5<br />
wie sie aussieht, da erschuf sie Goethe.“ Man könnte dieses Urteil auf <strong>Kant</strong> bezogen so<br />
formulieren: "Die Natur wollte wissen, wie die Vernunft aussieht, da erschuf sie <strong>Kant</strong>."<br />
3) <strong>Kant</strong>s kritische <strong>Philosoph</strong>ie<br />
Doch worum geht es <strong>Kant</strong> nun in seinem <strong>Philosoph</strong>ieren?<br />
Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten; es gibt – so könnte man überspitzt sagen – fast<br />
ebenso viele verschiedene <strong>Kant</strong>-Deutungen, wie es Interpreten dieses <strong>Philosoph</strong>en gibt.<br />
Vielleicht kann man <strong>Kant</strong>s Anliegen am ehesten als den Versuch einer Bestimmung der<br />
Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Vernunft bezeichnen. So schreibt er in der<br />
"Kritik der reinen Vernunft": nachdem er das ‚Land’ <strong>des</strong> Verstan<strong>des</strong> ‚durchreist’ hat: „Dieses<br />
Land aber ist nur eine Insel, und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen<br />
eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit (ein reizender Name), umgeben von einem<br />
weiten und stürmischen Ozeane, dem eigentlichen Sitz <strong>des</strong> Scheins, wo manche Nebelbank,<br />
und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt, und indem es den auf<br />
Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht,<br />
ihn in Abenteuer verpflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu<br />
Ende bringen kann.“ [B 294] Es geht ihm also um unbedingte Gewissheit und absolute<br />
Deutlichkeit, um sicheres Wissen – ja man kann auch sagen: <strong>Kant</strong> hat die <strong>Philosoph</strong>ie<br />
eigentlich erst zur Wissenschaft im strengen Sinne <strong>des</strong> Wortes geführt; und nicht nur das: von<br />
„Naturwissenschaft“ etwa als strikter Wissenschaft kann ebenfalls erst seit <strong>Kant</strong> im<br />
eigentlichen Sinne <strong>des</strong> Wortes die Rede sein.<br />
Um dieses sichere Wissen zu ermitteln fragt <strong>Kant</strong> nach dem, was in der sichtbaren<br />
Wirklichkeit und hinter dieser das eigentlich Wirksame ist, nach dem Unbedingten in allem<br />
Bedingten und jenseits alles Bedingten. <strong>Kant</strong>s Denken richtet sich auf das, was seit<br />
Aristoteles als Metaphysik bezeichnet wurde: hinauszufragen über das unmittelbar Gegebene,<br />
hinabzufragen in die ersten und letzten Gründe der Wirklichkeit. Dabei verdeutlicht er das<br />
metaphysische Problem in dreifacher Hinsicht: er fragt nach dem Unbedingten im Menschen,<br />
nach dem Unbedingten in der Welt und nach dem Unbedingten schlechthin. Gibt es etwas im<br />
Menschen, dass sein bedingtes, endliches Sein überragt, so, dass es auch das Sterben<br />
überdauern kann? Über diese Problemstellung gelangt <strong>Kant</strong> zur Frage der „Unsterblichkeit<br />
der Seele“. Gibt es in der Welt nur die Kette der Bedingtheiten oder bietet sie auch Raum für<br />
unbedingtes Handeln? Aus dieser Problemstellung erhebt sich das Problem der „Freiheit“.<br />
Gibt es schließlich etwas, worin die Gesamtheit alles Bedingten, Welt und Mensch zumal,<br />
letztlich gründet? Über diese Frage stößt <strong>Kant</strong> auf die Frage nach „Gott“. Er bezeichnet daher<br />
auch die "unvermeidlichen Aufgaben" <strong>des</strong> metaphysischen Denkens als: "Gott, Freiheit und<br />
Unsterblichkeit". Seine Methode ist dabei die „Kritik“, wie auch die Titel der Hauptwerke<br />
sagen. „Kritik“ ist dabei im ursprünglichen Sinne <strong>des</strong> Wortes zu verstehen, nämlich der<br />
griechischen Wurzel entsprechend im Sinne von „Unterscheidung“.
6<br />
Über diese drei beschriebenen Problemkreise will <strong>Kant</strong> zur Gewissheit gelangen, sicheres<br />
Wissen erhalten. Nun zeigt sich aber bei seinen Untersuchungen: auf diesem Feld ist alles<br />
fragwürdig. Wenn dem aber so ist, dann kann man nicht unmittelbar mit metaphysischen<br />
Entwürfen beginnen. Dann muss vorher gefragt werden, woher denn diese Ungewissheit in<br />
der Metaphysik kommt und worin sie gründet. Diesem Problem wandte sich <strong>Kant</strong> in der<br />
ersten seiner drei großen "Kritiken", der "Kritik der reinen Vernunft" (1781/1787) zu. Ihr<br />
Thema ist das Drama der metaphysischen Erkenntnis <strong>des</strong> menschlichen Geistes. Die Akteure<br />
sind die zentralen Fragen der <strong>Philosoph</strong>ie, und die Handlung ist zunächst der unablässige<br />
Versuch, zur Gewissheit zu gelangen, sicheres Wissen zu erhalten, und schließlich das<br />
Scheitern dieses Versuches, der ohnmächtige Untergang aller Bemühungen. Dabei entdeckt<br />
<strong>Kant</strong>: dass man zu keiner gesicherten Antwort gelangen kann, liegt im Wesen der<br />
menschlichen Vernunft selbst begründet. Diese ist nämlich nicht imstande, hinter die<br />
sichtbare Wirklichkeit zurückzugehen und in deren Grund hinabzublicken. Das zeigt sich z.B.<br />
an dem Problem der Freiheit. Man kann ebenso überzeugende Gründe dafür aufbringen, dass<br />
der Mensch frei ist, wie dafür, dass er nicht frei ist. Ähnlich steht es mit der Frage der<br />
Unsterblichkeit und nach Gott. Auch sie lassen sich mit Hilfe der theoretischen Vernunft nicht<br />
beantworten. Die Vernunft verstrickt sich in der Beschäftigung mit diesen Themen<br />
unabwendbar immer tiefer in innere Wiedersprüche.<br />
Vor diesem Hintergrund unterzieht <strong>Kant</strong> klassische Teile der bisherigen metaphysischen<br />
Tradition der Kritik. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang seine Kritik der<br />
Gottesbeweise. Der <strong>Philosoph</strong> Moses Mendelsohn nannte <strong>Kant</strong> in diesem Zusammenhang den<br />
"Alleszermalmer". Denn es war <strong>Kant</strong>, der alle bis zu seiner Zeit ausgebildeten Gottesbeweise<br />
wiederlegte. Gott kann mit dem Instrumentarium der theoretischen Vernunft nicht zwingend<br />
bewiesen werden. In gewisser Hinsicht gilt dies seit <strong>Kant</strong> bis heute.<br />
An dieser Stelle ist das vorläufige Ergebnis von <strong>Kant</strong>s <strong>Philosoph</strong>ie ernüchternd: die Vernunft<br />
endet in ihrem theoretischen Gebrauch im Unwegsamen. <strong>Kant</strong> selbst findet dafür deutliche<br />
Worte; er spricht vom "Auftritt <strong>des</strong> Zwiespaltes und der Zerrüttung", von einem "Skandal",<br />
von einem ewigen Zirkel von "Zweideutigkeiten und Widersprüchen", ja von einem "wahren<br />
Abgrund für die menschliche Vernunft". Der Mensch geht also notwendig in die Irre, gerade<br />
da, wo es sich um die höchsten Interessen seines Geistes handelt: in der Frage nach Gott,<br />
Freiheit und Unsterblichkeit.<br />
Aber <strong>Kant</strong> überlässt sich damit nicht einer skeptischen Hoffnungslosigkeit. Er fordert eine<br />
Selbstbesinnung der menschlichen Vernunft. Diese muss deutlich werden lassen, wo ihr<br />
eigentümliches Feld und wo ihre Grenzen liegen. In dieser Absicht prüft die "Kritik der reinen<br />
Vernunft" das "sehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntnis". In den mühsamen<br />
Untersuchungen, die <strong>Kant</strong> zu diesem Zweck anstellt, bewährt sich seine Pedanterie als die<br />
Tugend der Gewissenhaftigkeit. Es gelingt ihm aufzuzeigen, dass die Wirklichkeit sich dem<br />
Menschen keineswegs so zeigt, wie sie an sich selber sein mag, sondern immer so, wie sie<br />
aufgrund der besonderen Art <strong>des</strong> menschlichen Erkenntnisvermögens erscheint. Grundlegend
7<br />
ist in diesem Zusammenhang die Einsicht in die „Zweistämmigkeit“ <strong>des</strong> Erkennens:<br />
„Sinnlichkeit“ und „Verstand“ sind die beiden Säulen <strong>des</strong> menschlichen<br />
Erkenntnisvermögens: „Alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht von da zum<br />
Verstande und endigt bei der Vernunft, über welche nichts Höheres in uns angetroffen wird.“<br />
[B 355].<br />
Am Ende der „Kritik der reinen Vernunft“ stehen drei Fragen, mit denen das gesamte<br />
Forschungsfeld von <strong>Kant</strong>s <strong>Philosoph</strong>ie beschrieben werden kann: Was kann ich wissen? Was<br />
soll ich tun? Was darf ich hoffen? Man kann sagen, dass die erste Kritik, die „Kritik der<br />
reinen Vernunft“ sich mit der ersten Frage befasst „Was kann ich wissen?“. „Die Kritik der<br />
praktischen Vernunft“ wendet sich der zweiten Frage zu „Was soll ich tun?“ und „Die Kritik<br />
der Urteilskraft“, sowie die „Religionsschrift“ haben es mit der Beantwortung der dritten<br />
Frage zu tun „Was darf ich hoffen?“. Damit entwirft <strong>Kant</strong> ein komplexes und differenziertes<br />
System von Wissen, Handeln und Glauben. Allen Hinsichten dieses Systems kommt<br />
gleichermaßen Bedeutung zu.<br />
Dabei ist es durchgehend <strong>Kant</strong>s Überzeugung, dass der Mensch vom Grunde seines Wesens<br />
dazu getrieben wird, über sich und die endliche Welt hinauszufragen; verzichtet der Mensch<br />
darauf, so wäre er nicht mehr Mensch und würde der „Barbarei“ verfallen. Entscheidend ist in<br />
diesem Zusammenhang, dass der Mensch nicht nur ein denken<strong>des</strong> Wesen ist, also nicht nur<br />
über einen theoretischen Gebrauch seiner Vernunft verfügt, sondern dass der Mensch eben<br />
auch ein handeln<strong>des</strong> Wesen ist, also auch einen praktischen Gebrauch von seiner Vernunft<br />
macht. Wie, wenn das, was dem bloßen Denken verschlossen bleibt, sich da offenbarte, wo<br />
der Mensch im Handeln steht und über sein Tun nachdenkt? Die Sicht auf den handelnden<br />
Menschen ist die entscheidende Wendung, die <strong>Kant</strong> der metaphysischen Problematik gibt.<br />
Deswegen kann <strong>Kant</strong> auch vom „Primat der praktischen Vernunft“ sprechen. Diese<br />
Zusammenhänge entfaltet er in seinen Schriften „Grundlegung der Metaphysik der Sitten“<br />
(1785) und in den bereits erwähnten Büchern „Die Kritik der praktischen Vernunft“ (1788)<br />
und die „Metaphysik der Sitten“ (1797).<br />
<strong>Kant</strong> zeigt dort, dass gerade im Gebiet <strong>des</strong> Praktischen das Unbedingte aufgewiesen werden<br />
kann, dass er im Feld <strong>des</strong> Theoretischen vergeblich suchte. Zu dieser Einsicht gelangt er<br />
durch die Tatsache, dass dem Menschen, wenn er ernstlich wissen will, wie er handeln soll,<br />
ein unbedingtes Gebot, ein kategorischer Imperativ entgegentritt. Dieses unbedingte Gebot,<br />
dieser Imperativ verhindert, dass menschliches Handeln nach Willkür oder Laune geschieht.<br />
Und so wird dem Menschen über alle rationalen Erwägungen hinaus gewiss: so und nicht<br />
anders musst du handeln. Hier also zeigt sich inmitten <strong>des</strong> bedingten Dasein <strong>des</strong> Menschen<br />
ein Unbedingtes: die Unbedingtheit <strong>des</strong> "Du sollst!".<br />
Nachdem <strong>Kant</strong> so den Überschritt in den Bereich <strong>des</strong> Unbedingten grundsätzlich getan hat,<br />
kann er nun auch jene, im Feld <strong>des</strong> theoretischen Ergrübelns unlösbaren Fragen nach Gott,<br />
Freiheit und Unsterblichkeit beantworten. Wenn ein Gebot an den Menschen ergeht, so weiß<br />
er sich damit in die Situation der Entscheidung gestellt; Entscheidung aber ist nur möglich,
8<br />
wenn es Freiheit gibt. So wird der Mensch, indem er das unbedingte Gebot vernimmt, seiner<br />
Freiheit gewiss. Weiterhin entdeckt der Mensch im Hören <strong>des</strong> unbedingten Gebotes und in<br />
seiner durch dieses gewährleisteten Freiheit, dass er im Wesentlichen einer anderen,<br />
übersinnlichen Ordnung angehört, und dass ihm dies eine eigentümliche Würde gibt, mag er<br />
auch noch so sehr seiner Endlichkeit verhaftet sein. Der Mensch ist für <strong>Kant</strong> ein Bürger<br />
zweier Welten. Von diesem Gedanken her versucht <strong>Kant</strong> dann auch die Unsterblichkeit der<br />
Seele und das Dasein Gottes als notwendige Postulate der sittlichen Existenz zu erweisen.<br />
Innerhalb seiner Religionsphilosophie „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen<br />
Vernunft“ (1793) geht <strong>Kant</strong> von einem möglichen Ineinander von Offenbarungs- und<br />
Vernunftreligion aus. Vernunft und Schrift sollen als nicht nur miteinander verträglich,<br />
sondern in einem bestimmten anzugebenden Umfang miteinander identisch dargestellt<br />
werden. Dies gilt <strong>Kant</strong> vor dem Hintergrund, dass die Moral das Ursprünglichere, die<br />
Religion das Hinzukommende ist. Die eigentümliche Leistung der Religion besteht darin,<br />
dass sie die Pflichten, die durch das Sittengesetz bereits feststehen, als von Gott in die<br />
Vernunft gelegte bestimmen. Die Religion umkleidet die Pflichten mit der Majestät <strong>des</strong><br />
göttlichen Willens. Oder anders herum gesagt: recht verstandene Religion ist nichts anderes<br />
als die Annerkennung der Heiligkeit der Sittlichkeit. Dabei ist die Religion grundsätzlich<br />
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft zu rekonstruieren. D.h. die in der "Kritik der<br />
reinen Vernunft" gezogenen Grenzen dürfen nicht überschritten werden.<br />
Innerhalb dieser Untersuchung gelangt <strong>Kant</strong> zu dem Ergebnis, dass das Christentum die<br />
einzig moralisch vollkommene Religion ist. In seiner Religionsschrift war es ihm eine Pflicht,<br />
"in der Schrift denjenigen Sinn zu suchen, der mit dem Heiligsten, was die Vernunft lehrt, in<br />
Harmonie steht." In diesem Sinne galt ihm das Christentum als die einzig wahre Religion, das<br />
auch allein die „wahre Morallehre“ enthält. Diese „Morallehre“ ist nicht heteronom (illegitim<br />
von außen bestimmend), weil sie uns gebietet, ohne Rücksicht auf göttliche Belohnung nach<br />
Heiligkeit zu streben. Und sie gründet die Erkenntnis <strong>des</strong>sen, was das Gesetz gebietet, nicht<br />
auf der Anerkennung irgendeines historischen Dogmas. So konnte <strong>Kant</strong> das Christentum als<br />
eine ebenso reine Lehre bezeichnen wie die Stoa. Allerdings beurteilte er das Christentum als<br />
wirklichkeitsnäher. Denn die christliche Überzeugung erlaubt es nicht, die Heiligkeit (oder<br />
Weisheit) für etwas dem Menschen ohne göttliche Gnade Erreichbares zu halten. Doch ohne<br />
dieses Eingeständnis der menschlichen Ohnmacht würde das moralische Ideal insgeheim auf<br />
eine dem natürlichen Menschen erreichbare Ebene herabgezogen und damit letztlich<br />
preisgegeben. Angesichts der Erhabenheit <strong>des</strong> moralischen Gesetzes ist in<strong>des</strong> nicht der Stolz<br />
<strong>des</strong> Stoikers, sondern Demut die einzig angemessene Haltung.<br />
Im einzelnen ergibt sich daraus für die Religionsschrift: Zunächst soll eine reine<br />
Religionstheorie den Begriff der Religion entfalten. Daneben kennt <strong>Kant</strong> einen legitimen<br />
religionsphilosophischen Versuch <strong>des</strong> kritischen Vergleichs einer positiv-historischen<br />
Religion mit dem normativ aufgestellten Religionsbegriff. Die Lehren der christlichen<br />
Dogmatik werden im Sinne einer Vernunftreligion dargestellt. So wird der Nachweis erbracht,
9<br />
dass das Christentum zugleich positive und moralische Religion ist. Historische und<br />
vernünftige Religion unterscheiden sich dann letztlich nur der Form, nicht aber dem Gehalt<br />
nach. Mit Recht kann gesagt werden, dass <strong>Kant</strong> die Religion wieder zu sich selbst befreit hat,<br />
indem er sie von Ethik, Ästhetik und Metaphysik abgrenzte.<br />
4) <strong>Kant</strong> als <strong>Philosoph</strong> <strong>des</strong> <strong>Protestantismus</strong><br />
Zunächst liegt auf der Hand, dass <strong>Kant</strong>s Ethik eine hohe Affinität zu Grundeinsichten <strong>des</strong><br />
<strong>Protestantismus</strong> hat. Lautete Luthers Entdeckung: "der einzelne kann in seinem Verhältnis zu<br />
Gott nicht entlastet werden", und: "dieses Verhältnis zu Gott ist ein unbedingtes<br />
Verpflichtungsverhältnis", so ist die Nähe zu <strong>Kant</strong>s Bestimmung von Religion unschwer<br />
einzusehen, denn <strong>Kant</strong> formuliert: "Religion ist die Erkenntnis aller meiner Pflichten als<br />
göttliche Gebote." Auch lässt sich in grundsätzlicher Weise sagen, dass <strong>Kant</strong> der <strong>Philosoph</strong><br />
ist, der die Ethik Jesu auf den „philosophischen Begriff“ gebracht hat. Denn Jesus war Gott<br />
das alleinige Gute und alles Handeln <strong>des</strong> Menschen galt Jesus als die Verwirklichung <strong>des</strong><br />
Willens Gottes, den er im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst sah. Auch Jesus deutete<br />
die Beziehung zwischen Gott und dem einzelnen als ein unbedingtes<br />
Verpflichtungsverhältnis, dass in der alltagspraktischen Realisierung der Grundnorm, wie sie<br />
im Doppelgebot der Liebe ihren Ausdruck fand, konkrete Lebensgestalt gewann.<br />
Zweitens kann die pointierte Stellung der „Freiheit“, die <strong>Kant</strong> innerhalb seiner praktischen<br />
<strong>Philosoph</strong>ie herausgearbeitet hat, als ein typisch protestantischer Wesenszug von <strong>Kant</strong>s<br />
<strong>Philosoph</strong>ie bezeichnet werden. Der protestantischen Deutung <strong>des</strong> Ethos engstens verwandt,<br />
weist <strong>Kant</strong> – in der Sprache der Religion gesagt – eine „geschöpfliche Anlage“ <strong>des</strong> Menschen<br />
zur Freiheit nach. Und wie innerhalb der Deutung <strong>des</strong> <strong>Protestantismus</strong> thematisiert er die<br />
Selbstverstrickung <strong>des</strong> Wollens in seiner Theorie <strong>des</strong> „radikalen Bösen“. Auch die<br />
schicksalhafte Unvermeidlichkeit dieser Verstrickung unter den Bedingungen <strong>des</strong><br />
kreatürlichen Daseins ist ihm Thema. Und schließlich entfaltet <strong>Kant</strong> die Erfüllung der<br />
geschöpflichen Telosbestimmung in der Ewigkeitsdimension <strong>des</strong> Gottesverhältnisses („Das<br />
Reich Gottes“).<br />
Ein dritter zentraler Punkt ist die Tatsache, dass <strong>Kant</strong> die Gottesvorstellung ganz aus der<br />
Analogie menschlich bekannter Beziehungsschematas löste. Damit öffnete er das Tor zu den<br />
„nichtgegenständlichen“ Glaubensinhalten, die jedenfalls in weiten Bereichen <strong>des</strong><br />
<strong>Protestantismus</strong> rasch Allgemeingut wurden. So wenig in diesem Zusammenhang die<br />
Problematik der Sprachfähigkeit <strong>des</strong> Glaubens übersehen werden darf, denn die zunehmende<br />
„Abstraktion“ von Glaubensinhalten führt zwangsläufig zu „Sprachschwierigkeiten“, so hoch<br />
ist die gewonnene Freiheit <strong>des</strong> Glaubens einzelner einzuschätzen. Sie findet ihren Ausdruck<br />
eben jeweils in den Gehalten, die diesem einzelnen einleuchten. Damit wird seit <strong>Kant</strong><br />
innerhalb <strong>des</strong> <strong>Protestantismus</strong> immer auch eine Unterscheidung „mitgedacht“. Der jeweilige<br />
Gehalt ist immer Träger eines bestimmten Inhaltes und niemals dieser Inhalt selbst. Es
10<br />
handelt sich vielmehr um „bildhafte Gehalte“, in denen sich der Glaube vorstellend<br />
objektiviert. Diese jeweilige „Objektivierung“ ist immer von der jeweiligen Zeit und dem<br />
geistigen Vermögen <strong>des</strong> einzelnen bestimmt und damit wandelbar. Diese Beschreibung<br />
fordert zwingend die Deutung der jeweiligen Gehalte, auch in der Predigt. Evangelischer<br />
Glaube ist so gesehen „Deutungskultur“ der eigenen Letztbezogenheit.<br />
Schließlich ist auf die Wirkungsgeschichte zu verweisen, die <strong>Kant</strong>s kritische <strong>Philosoph</strong>ie<br />
freigesetzt hat. Dabei hat nicht das von ihm entworfene „System“ Wirkung gezeigt, sondern<br />
das von ihm entwickelte „kritische Prinzip“. Klassik und Romantik sind ohne <strong>Kant</strong>s kritische<br />
<strong>Philosoph</strong>ie nicht zu denken. Der gesamte deutsche Idealismus wurde durch diese <strong>Philosoph</strong>ie<br />
ausgelöst. So verweisen Schleiermachers „Reden über die Religion“ mit ihrem Abweis der<br />
Metaphysik und der Moral („Religion ist nicht Metaphysik noch Moral, sie ist Sinn und<br />
Geschmack fürs Unendliche“) auf <strong>Kant</strong>s Befreiung der Religion zu sich selbst. Albrecht<br />
Ritschl hob dann später vor allem den reformatorischen Zug in <strong>Kant</strong>s Selbstbegrenzung der<br />
Vernunft hervor und unterstrich nochmals das Primat der Ethik. Auch Wilhelm Herrmanns<br />
und Ernst Troeltschs Arbeiten stehen in eindringlicher Weise unter den Vorgaben, die <strong>Kant</strong>s<br />
<strong>Philosoph</strong>ie darstellt. Bis heute lassen sich in protestantisch-theologischen Entwürfen<br />
wesentliche Anteile <strong>des</strong> Gedankengutes <strong>des</strong> Königsberger <strong>Philosoph</strong>en bestimmen (etwa W.<br />
Pannenberg, T. Rendtorff, F. Wagner, U. Barth).<br />
Entscheidend, auch für uns, dürfte allerdings die Tatsache sein, dass <strong>Kant</strong>s <strong>Philosoph</strong>ie eine<br />
Wegscheide markiert, vor der letztlich jede und jeder irgendwann steht. Das „natürlich-<br />
menschliche Wahrheitsbewusstsein“ hat in der <strong>Philosoph</strong>ie <strong>Kant</strong>s zu seinem Recht gefunden.<br />
Im steht das „christliche Wahrheitsbewusstsein“ gegenüber.<br />
Damit ergibt sich folgende Alternative: Entweder tritt eine christliche Überzeugung in ein<br />
polemisches Gegenüber zum natürlich-menschlichen Wahrheitsbewusstsein und <strong>des</strong>sen<br />
Lebensgestaltung. Dann aber würde sie sowohl dieses Wahrheitsbewusstsein als auch die<br />
entsprechende Lebensgestaltung noch tiefer in die Gefahr <strong>des</strong> Nihilismus stoßen. Allerdings<br />
würde das christliche Wahrheitsbewusstsein dadurch selbst zu einem Vernichter moralisch-<br />
religiös gegründeter idealer Humanität werden. Denn – dies hat <strong>Kant</strong> überzeugend entfaltet –<br />
das natürlich-menschliche Wahrheitsbewusstsein ist eine autonome und wahrhaftige<br />
Repräsentantin einer moralisch-religiösen idealen Humanität. Würde die christliche<br />
Überzeugung sich polemisch gegen dieses vollgültige natürlich-menschliche<br />
Wahrheitsbewusstsein wenden, dann würde das christliche Wahrheitsbewusstsein für sich<br />
freilich die Möglichkeit gewinnen, die alte christliche Lehre von der durch die Sünde dem<br />
Verfall preisgegebenen Welt als eigenen Legitimitäts- und Exklusivitätsanspruch<br />
gewissermaßen wie einen „basso ostinato“ in ungenießbarer penetranter Permanenz zu<br />
intonieren. Dieser christlichen Überzeugung ist – ja auch nachvollziehbar – die Verachtung<br />
<strong>des</strong> natürlichen Wahrheitsbewusstseins gewiss. Das Band zwischen idealer Humanität und<br />
christlichem Wahrheitsbewusstsein wäre zerrissen, irreparabel. Und manchmal kann man sich<br />
nur schwer <strong>des</strong> Eindrucks erwehren, dass manche das auch noch gut fänden.
11<br />
Oder die christliche Überzeugung sieht die Gefahr, dass sie über dieses Vorgehen selbst zu so<br />
etwas wie einer dämonischen Erscheinung wird, mit der man zwar die alte Lehre von der dem<br />
Verfall preisgegebenen Welt überzeugend belegen, und so vielleicht zu alten<br />
Hegemonieansprüchen zurückfinden könnte. Aber der Preis für solch niedere<br />
Begehrlichkeiten wäre hoch: die unversöhnlich Feindschaft zwischen natürlich-menschlicher<br />
und vermeindlich christlicher Humanität. Wird diese Gefahr allerdings erkannt, ergibt sich als<br />
Alternative der Weg dem natürlich-menschlichen Wahrheitsbewusstsein und <strong>des</strong>sen<br />
Lebensgestaltung anerkennend gegenüber zu treten um beide durch christliche<br />
Überzeugungen und christliche Lebensgestaltung noch weiter zu vertiefen. Dass und wie<br />
diese Vertiefung möglich ist bzw. geschehen kann, hat <strong>Kant</strong> in seiner <strong>Philosoph</strong>ie<br />
eindrucksvoll etnfaltet.<br />
Gerade die kirchengemeindlichen Konzepte, die an einer volkskirchlichen Perspektive<br />
orientiert sind, tragen zu jener Vertiefung natürlicher Humanität bei: im Gottesdienst, in den<br />
verschiedensten Gruppen und Kreisen, bei Gesprächsabenden und bei Festen. Umgekehrt ist<br />
zu würdigen, dass gerade kirchengemeindliche Praxis aus volkskirchlicher Perspektive immer<br />
und immer wieder von der natürlichen Humanität profitiert, ja geradezu auf sie angewiesen<br />
ist, etwa immer dann, wenn es darum geht Dinge vernünftig und menschlich zu handhaben<br />
(vor allem auch: ehrenamtliches Engagement!). Über die kirchengemeindlichen Bezüge<br />
hinaus und in die großen und universalen Zusammenhänge gestellt, dient diese Vertiefung der<br />
natürlichen Humanität dem Verständnis, der Toleranz und vor allem der Annerkennung der<br />
unveräußerlichen Würde <strong>des</strong> Menschen, kultur- und auch religionsübergreifend.<br />
Wenn der letzte der beiden beschriebenen Wege gewählt wird, dann wird für diesen Weg<br />
<strong>Kant</strong>s Überlegung wichtig, dass der Glaube an verpflichtende Ziele, an letzte Ideale immer<br />
schon den Glauben an Gott mit umschließt und einbezieht. Dieser zweite Weg fordert im<br />
Sinne der angesprochenen Deutungskultur die immer wieder zu leistende „Umformung“ der<br />
Grundeinsichten <strong>des</strong> christlichen Glaubens in die „Gehalte“ <strong>des</strong> natürlich-menschlichen<br />
Wahrheitsbewusstseins. Das bereitet natürlich Mühe. Doch der Lohn dürfte darin liegen, dass<br />
so die Grundeinsichten <strong>des</strong> christlichen Glaubens für die aller verschiedensten Menschen zu<br />
unterschiedlichen Zeiten wach gehalten werden. Denn ... – und auch das war wohl <strong>Kant</strong>s<br />
Überzeugung –, so würden wir heute sagen, ... denn in diesen Grundüberzeugungen und<br />
Grundeinsichten <strong>des</strong> christlichen Glaubens liegt für je<strong>des</strong> einzelne Leben Sinn, unbedingter<br />
Sinn für ein bedingtes, weil endliches, Leben.