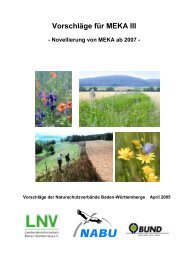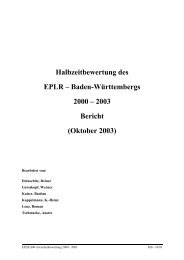Teil 7 - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
Teil 7 - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
Teil 7 - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
376<br />
10.3 Diversifizierung<br />
10.3.1 Darstellung der Förderhistorie<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Bei der <strong>Förderung</strong> einzelbetrieblicher Investitionen zur Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe handelt<br />
es sich um einen noch relativ jungen Bereich der Agrarstrukturpolitik. Erst im Zuge der Reform der Europäischen<br />
Strukturfonds im Jahr 1988 begann eine stärkere Akzentuierung der Investitionsförderung zu Gunsten<br />
der Erschließung neuer Einkommensquellen durch die Gründung selbständiger Zweitexistenzen. Gründe für<br />
diese Neuorientierung der Agrarstrukturpolitik waren u.a. hohe Belastungen der Agrarmärkte, unzureichende<br />
Agrareinkommen und Umweltprobleme durch intensive landwirtschaftliche Produktion:<br />
• Die einzelbetriebliche Investitionsförderung nach Ziel 5a im Rahmen der GAK (AFP, AKP) wurde um<br />
die Unterstützung neuer Unternehmertätigkeiten z.B. in den Bereichen Direktvermarktung und Tourismus<br />
erweitert. Die Diversifizierungsprojekte standen in diesem Fall jedoch in direkter Mittelkonkurrenz<br />
zur konventionellen landwirtschaftlichen Investitionsförderung. Angesichts begrenzter Fördermittel<br />
und hoher Nachfrage nach rein landwirtschaftlichen Investitionen konnten <strong>des</strong>halb nur wenige Diversifizierungen<br />
im Rahmen der Ziel 5a-<strong>Förderung</strong> unterstützt werden.<br />
• Im bayerischen Ziel 5b-Programm standen in der ersten Programmphase von 1989 <strong>bis</strong> 1993 rund<br />
41 Mio. € für die Erschließung neuer Einkommensquellen zur Verfügung, womit insgesamt 1.021 Vorhaben<br />
gefördert werden konnten. In der zweiten Programmperiode wurden angesichts steigender<br />
Nachfrage die Mittel zur Diversifizierungsförderung deutlich aufgestockt. Im Rahmen der 5b II-<br />
<strong>Förderung</strong> nahmen mehr als 2.600 landwirtschaftliche Betriebe Zuschüsse zur Erschließung außerlandwirtschaftlicher<br />
Einkommensquellen in Anspruch. Die öffentlichen Aufwendungen hierfür betrugen<br />
rund 120 Mio. € bzw. 20 Mio. € pro Jahr. Das waren knapp 9 % aller in dem betreffenden Zeitraum im<br />
bayerischen Agrarsektor ausgereichten einzelbetrieblichen Investitionshilfen.<br />
Die <strong>Förderung</strong> der Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Art. 33 kann zum <strong>Teil</strong> als<br />
Nachfolgeprogramm der Ziel 5a- und 5b-<strong>Förderung</strong> gesehen werden, wenngleich zu deutlich eingeschränkten<br />
Konditionen und veränderten Rahmenbedingungen (vgl. Abschn.10.3.3).<br />
10.3.2 Beschreibung <strong>des</strong> Förderprogramms<br />
Problemstellung<br />
Die land- und forstwirtschaftliche Bruttowertschöpfung lag in Bayern im Jahr 2001 mit 4,07 Mrd. € nominal<br />
nur geringfügig über dem Wert von 1991 (3,89 Mrd. €). Ursache hierfür ist in erster Linie das seit Beginn der<br />
90er Jahre gesunkene Erzeugerpreisniveau, das die Wirkungen <strong>des</strong> Produktivitätsfortschritts weitgehend<br />
kompensierte. Weil zugleich die übrigen Sektoren ihre Wertschöpfung erhöhten, sank der Anteil der Land-<br />
und Forstwirtschaft an der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche von 1,6 % auf 1,2 %. Mit dieser<br />
gesamtwirtschaftlichen Marginalisierung verbunden war ein Rückgang <strong>des</strong> landwirtschaftlichen Einkommensanteils<br />
am Gesamteinkommen der landwirtschaftlichen Haushalte. Diese mussten sich zunehmend<br />
außerlandwirtschaftliche Einkommensquellen erschließen, um an der allgemeinen Einkommensentwicklung<br />
teilhaben zu können. Unter anderem aus diesem Grund gaben seit 1991 jährlich gut 4 % der landwirtschaftlichen<br />
Unternehmer die Bewirtschaftung ganz auf; weitere ca. 2.000 Betriebe wechselten in der selben Zeit<br />
jährlich vom Haupt- in den Nebenerwerb, das entspricht rund 1 % aller landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern.<br />
215<br />
Die Möglichkeiten, das landwirtschaftliche Einkommen durch die Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung<br />
zu ergänzen, haben sich in den vergangenen Jahren allerdings zunehmend verschlechtert. Insbesondere<br />
215 Eigene Kalkulationen auf der Grundlage <strong>des</strong> Bayerischen Agrarberichts 2002, Übersicht 19.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
seit 1995 haben die ländlichen Räume spürbar an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verloren (vgl.<br />
Abschn. 4.1.1). Von der bevorstehenden Osterweiterung der Europäischen Union ist grundsätzlich eine weitere<br />
Verschärfung der Arbeitsmarktsituation zu erwarten, die vor allem die ländlichen Räume Nord- und Ostbayerns<br />
treffen dürfte. Nicht zuletzt aus diesen Gründen tendieren immer mehr landwirtschaftliche Haushalte<br />
dazu, sich durch die Gründung einer selbständigen außerlandwirtschaftlichen Zweitexistenz zusätzliches<br />
Einkommen zu erschließen. Das erlaubt ihnen, ihren Status als Unternehmer beizubehalten und vielfältige<br />
Synergien mit dem landwirtschaftlichen Betrieb zu nutzen.<br />
Förderstrategie<br />
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Gründung außerlandwirtschaftlicher Zweitexistenzen und die Erschließung<br />
neuer Einkommensquellen durch die Gewährung von Fördermitteln zu unterstützen. Auf diese Weise sollen<br />
vor allem für Angehörige land- und forstwirtschaftlicher Haushalte qualifizierte Arbeitsplätze im ländlichen<br />
Raum geschaffen und gesichert werden. Die Aufnahme zusätzlicher Unternehmertätigkeiten am Betriebsstandort<br />
ermöglicht es den Programmteilnehmern, die Landbewirtschaftung fortzuführen, betriebliche Ressourcen<br />
umfassender zu nutzen und so die Faktorproduktivität zu erhöhen. Auf diese Weise trägt das Programm<br />
auch Indirekt zur Sicherung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung bei.<br />
Förderinhalte<br />
Förderfähig sind Aktivitäten in folgenden Bereichen:<br />
• Investitionen von landwirtschaftlichen Unternehmern oder Kooperationen zur Diversifizierung der Produktion,<br />
die nicht im Rahmen anderer Fördermaßnahmen gefördert werden können. Der Investitionszuschuss<br />
beträgt i.d.R. 15 % der zuwendungsfähigen Kosten, in Ausnahmefällen <strong>bis</strong> zu 20 %. Er soll<br />
die Unternehmer zur aktiven Verbesserung ihrer Einkommenssituation durch Erschließung außerlandwirtschaftlicher<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten motivieren, das Risiko und die Kosten entsprechender<br />
Entwicklungsschritte reduzieren und zugleich neue Perspektiven für die landwirtschaftliche Betriebsentwicklung<br />
eröffnen.<br />
• Projekte vor allem im Marketingbereich von nicht-landwirtschaftlichen Trägern (z.B. Kommunen, Unternehmen<br />
<strong>des</strong> vor- und nachgelagerten Bereichs), welche die Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe<br />
indirekt unterstützen. Hierfür können neben Investitionen auch projektgebundene Personalkosten<br />
maximal 3 Jahre lang mit Fördersätzen von <strong>bis</strong> zu 60 % im 1. Jahr, <strong>bis</strong> zu 40 % im 2. Jahr und <strong>bis</strong><br />
zu 20 % im 3. Jahr bezuschusst werden. Die <strong>Förderung</strong> von Initiativen nicht-landwirtschaftlicher Träger<br />
soll dazu beitragen, die überbetrieblichen Strukturen z.B. im Bereich <strong>des</strong> Marketing zu verbessern<br />
und somit indirekt den Erfolg von Diversifizierungen zu erhöhen. Die Bezuschussung von Qualifizierungsmaßnahmen<br />
trägt dazu bei, landwirtschaftliche Haushaltsmitglieder auf die neuen Berufsanforderungen<br />
vorzubereiten. Durch gezielte Fortbildung werden wichtige Voraussetzungen für den Erfolg<br />
und die Stabilität der Diversifizierungsprojekte geschaffen.<br />
• Projektbezogene Qualifizierung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit mit einem Fördersatz von <strong>bis</strong> zu<br />
40 % zur fachlichen und persönlichen Vorbereitung der <strong>Teil</strong>nehmer auf die neue Tätigkeit. Landwirten<br />
werden die Aufwendungen (i.d.R. Kursgebühren) für die <strong>Teil</strong>nahme an solchen Veranstaltungen anteilig<br />
erstattet; die Planung und Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen selbst ist im Rahmen <strong>des</strong><br />
Diversifizierungsprogramms jedoch nicht förderfähig.<br />
Dieser Maßnahmenmix hat sich bereits im Rahmen <strong>des</strong> bayerischen 5b-Programms bewährt, sowohl was<br />
die Akzeptanz <strong>des</strong> Programms bei den potenziellen Fördermittelempfängern betrifft, als auch hinsichtlich der<br />
Förderwirkungen und Ergebnisse.<br />
377
378<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Kohärenz<br />
Das Programm zur <strong>Förderung</strong> der Diversifizierung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit leistet einen<br />
Beitrag vor allem zur Realisierung folgender Programmziele: 216<br />
• Ziel „Verbesserung der einzelbetrieblichen Wettbewerbsfähigkeit“: Die umfassendere Auslastung von<br />
Ressourcen <strong>des</strong> Betriebes und Haushalts durch Diversifizierung/Aufnahme einer zusätzlichen Unternehmertätigkeit<br />
führt i.d.R. zu einer Rationalisierung der landwirtschaftlichen Betriebsorganisation und<br />
einer grundlegenden Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch Kostensenkung<br />
und höhere Faktorentlohnung. Die teilweise Einkommensbildung auf nichtlandwirtschaftlichen Märkten<br />
erhöht die Unabhängigkeit der Betriebe von Entscheidungen der Agrarpolitik und vergrößert die individuelle<br />
Entscheidungsflexibilität.<br />
• Ziel „Erhaltung der Kulturlandschaft, Verbesserung der Agrarumwelt sowie Schonung der biotischen<br />
und abiotischen Ressourcen“: Die teilweise Verlagerung von Produktionsfaktoren in außerlandwirtschaftliche<br />
Verwendungsalternativen führt i.d.R. zu einer Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion<br />
mit positiven Wirkungen auf Ökologie und Kulturlandschaft. Die Ergänzung <strong>des</strong> Haushaltseinkommens<br />
durch selbständige außerlandwirtschaftliche Beschäftigung unterstützt zumin<strong>des</strong>t in den Anfangsjahren<br />
grundsätzlich die Beibehaltung der Landbewirtschaftung. Dies gilt insbesondere für landwirtschaftsnahe<br />
Diversifizierungstätigkeiten.<br />
• Ziel „Aufgreifen endogener Entwicklungspotenziale“: Dank der Beratung, Informations- und Qualifizierungsangebote<br />
folgen die Diversifizierungsvorhaben weitgehend den spezifischen Stärken und Potenzialen<br />
der Betriebe und Haushaltsmitglieder. Das Programm bietet die Möglichkeit, Begabungen<br />
und Interessen von Haushaltsmitgliedern außerhalb <strong>des</strong> engeren Agrarbereichs umfassender für die<br />
persönliche Entwicklung (individuelle Profilierung, Unabhängigkeit) und Einkommensbildung zu nutzen.<br />
Dabei werden notwendigerweise die lokalen und regionalen Marktverhältnisse berücksichtigt.<br />
• Ziel „Erhöhung der regionalen Wettbewerbschancen durch Verbesserung der Infrastrukturausstattung<br />
und beruflichen Qualifizierung“: Die <strong>Förderung</strong> der beruflichen Qualifizierung ist eine der drei Säulen<br />
<strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms. Dies gilt analog für die Unterstützung marktangepasster Marketingstrukturen.<br />
Die Umsetzung der übrigen Handlungsebenen <strong>des</strong> EPLR wird durch die Diversifizierungsprojekte teilweise<br />
indirekt unterstützt. Die Maßnahmen sind mit den anderen landwirtschaftlichen Förderprogrammen (innerhalb<br />
und außerhalb <strong>des</strong> EPLR) abgestimmt und wurden inhaltlich voneinander abgegrenzt. Negative Wirkungen<br />
im Sinne der Programmziele oder gegenüber anderen Fördermaßnahmen können ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Operationelle Ziele<br />
In Anlehnung an die Zwischenbewertung <strong>des</strong> Ziel 5b II-Programms formulierte das Bayerische Staatsministerium<br />
für Landwirtschaft und Forsten folgende Förderziele: 217<br />
• Förderumfang: 400 <strong>bis</strong> 600 Fälle;<br />
• 150 – 250 neu geschaffene Arbeitsplätze;<br />
• 250 – 400 gesicherte Arbeitsplätze;<br />
• Schaffung von zusätzlichem Einkommen in einer Höhe von 7.500 – 15.000 € je Arbeitsplatz und Jahr<br />
bzw. 3 Mio. € - 10 Mio. € pro Jahr insgesamt.<br />
216 Vgl. Plan zur <strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes in Bayern, S. 75.<br />
217 Vgl. Plan zur <strong>Förderung</strong> der Entwicklung…, a.a.O., S. 321 sowie Anlage 3.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
10.3.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext<br />
Nach Auslaufen der Ziel 5a- und 5b-<strong>Förderung</strong> wurde die einzelbetriebliche Diversifizierungsförderung im<br />
neuen Programmzeitraum 2000 <strong>bis</strong> 2006 inhaltlich auf mehrere Einzelmaßnahmen aufgeteilt:<br />
• Der Bereich „Gästebeherbergung im Bereich Urlaub auf dem Bauernhof, Freizeit und Erholung“ (GaB)<br />
wurde komplett dem Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) bzw. dem Agrarkreditprogramm (AKP)<br />
zugeordnet. Lediglich angebotsergänzende Maßnahmen können gefördert werden. Weil AFP und<br />
AKP nicht Bestandteil <strong>des</strong> Bayerischen EPLR sind, wird der Großteil der GaB-Maßnahmen in der<br />
Halbzeitbewertung nicht erfasst. 218<br />
• Die Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten wird nach der Richtlinie „<strong>Förderung</strong><br />
der Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte“ („Öko-<br />
Regio“-Programm) gefördert. Die Umsetzung dieser Richtlinie wird ausschließlich aus Lan<strong>des</strong>mitteln<br />
finanziert. 219<br />
• Nur wenn die Diversifizierungsinvestitionen keinem der beiden genannten Programme zugeordnet<br />
werden können, kommt eine <strong>Förderung</strong> gemäß Art. 33 Tiret 7 in Frage.<br />
Die Förderhöchstsätze und Zuwendungsarten differieren je nach Förderprogramm und somit auch nach der<br />
Diversifizierungsrichtung. Die Fördersätze <strong>des</strong> „Öko-Regio“-Programms (Investitionszuschuss) und <strong>des</strong><br />
AFP/AKP (Zinszuschuss) betragen <strong>bis</strong> zu 31 % 220 und liegen somit in etwa auf der Höhe <strong>des</strong> ehemaligen 5b<br />
II-Programms. Im Diversifizierungsprogramm unter Art. 33 werden hingegen maximal 15 % (bzw. in Ausnahmefällen<br />
<strong>bis</strong> zu 20 %) Investitionszuschuss gewährt, wenngleich über dieses Programm oftmals innovativere<br />
und risikoreichere Projekte gefördert werden als in den Bereichen Direktvermarktung und Urlaub auf<br />
dem Bauernhof, für die schon eine Vielzahl von Erfahrungen und Beispielen vorliegen. Die Fördergrenze von<br />
15 % wurde jedoch bewusst gewählt, um die Konditionen der Diversifizierungsförderung an die der gewerblichen<br />
Wirtschaftsförderung anzupassen und somit Wettbewerbsverzerrungen zwischen Landwirten und gewerblichen<br />
Investoren zu vermeiden.<br />
Das Diversifizierungsprogramm nach Art. 33 Tiret 7 kann gegebenenfalls durch andere Förderprogramme<br />
ergänzt werden:<br />
• Ein Großteil der Betriebe, die im Rahmen der Diversifizierungsförderung einen Zuschuss zur Errichtung<br />
einer Anlage zur Verfeuerung fester Biomasse oder zur Gewinnung und Nutzung von Biogas aus<br />
Biomasse erhielten, nahm zusätzlich ein zinsgünstiges Darlehen mit der Möglichkeit eines <strong>Teil</strong>schuldenerlasses<br />
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch; 221<br />
• <strong>Teil</strong>nehmer am Diversifizierungsprogramm können sich in Fortbildungsseminaren auf die außerlandwirtschaftliche<br />
Tätigkeit vorbereiten. Dieses Angebot ist bei den Fördermittelempfängern beliebt und<br />
stark nachgefragt. Die Finanzierung der Qualifizierungsprojekte stammt aus Lan<strong>des</strong>mitteln sowie aus<br />
ESF-Mitteln <strong>des</strong> bayerischen Ziel 3-Programms. Um die Erfolgsaussichten der Projekte zu erhöhen,<br />
218 Während zunächst vorgesehen war, „Urlauf auf dem Bauernhof, ..“ in die „Diversifizierungsförderung“ einzubeziehen, bestand die<br />
<strong>EU</strong>-Kommission auf einer eigenständigen Maßnahme mit eigener Finanzplanung. Dies erschien dem Programmverwalter, gemessen an<br />
den zu erwartenden Förderfällen, als zu verwaltungsaufwändig. Deshalb erfolgte die Zuordnung zu den allgemeinen Investitionsförderprogrammen.<br />
219 Maßgebend für diese Zuordnung war zum einen die Reaktion mit einem „Spezialprogramm“ auf die BSE-Krise; zum anderen verlangte<br />
die Kommission zur <strong>Förderung</strong> der Verarbeitung und Vermarktung von „Anhang 1-Produkten“ ebenfalls eine eigenständige Maßnahme<br />
– was vom Programmverwalter als zu aufwändig bewertet wurde.<br />
220 Vgl. Deutscher Bun<strong>des</strong>tag: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes" für<br />
den Zeitraum 2003 <strong>bis</strong> 2006. Berlin 2002, Abschn. 5.2.2 und 5.3.2. Angesichts niedriger Kapitalmarktzinsen wurden der maximal mögliche<br />
Zinszuschuss von 4 % und somit die maximalen Zuschussäquivalente im AFP/AKP in der ersten Programmhälfte jedoch nicht<br />
erreicht.<br />
221 Vgl. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Programm Nr. 128: Programm zur <strong>Förderung</strong> erneuerbarer Energien. Frankfurt 2003.<br />
379
380<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
wird den Fördermittelempfängern im Bewilligungsbescheid zumeist eine <strong>Teil</strong>nahme an vorbereitenden<br />
Qualifizierungsseminaren zur Auflage gemacht. Neben den handwerklichen, produktionstechnischen<br />
und betriebswirtschaftlichen Inhalten wird den landwirtschaftlichen Haushaltsmitgliedern auch Wissen<br />
in den Bereichen Existenzgründung, Psychologie und Organisation/Kommunikation vermittelt.<br />
Diese Kombinationen unterschiedlicher Förderprogramme und –instrumente führen zu Synergieeffekten. Sie<br />
unterstützen grundsätzlich den Erfolg der geförderten Projekte und die Effizienz <strong>des</strong> Förderprogramms.<br />
10.3.4 Methodischer Ansatz<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Programms zur Diversifizierung landwirtschaftlicher Tätigkeiten können neben land- und<br />
forstwirtschaftlichen Betrieben auch überbetriebliche Marketingkonzepte und Kooperationen gefördert werden.<br />
Bis auf wenige Ausnahmen beschränkte sich die <strong>Förderung</strong> <strong>bis</strong>her jedoch auf einzelbetriebliche Investitionsvorhaben<br />
(46 von insgesamt 52 Förderfällen). Die Halbzeitbewertung konzentriert sich <strong>des</strong>halb auch<br />
ausschließlich auf einzelbetriebliche Vorhaben, zumal gerade bei überbetrieblichen Vorhaben deren Wirkungen<br />
erst in einer längerfristigen Perspektive sichtbar werden.<br />
Datenquellen<br />
Die Beantwortung der Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren im Rahmen der Halbzeitbewertung der<br />
Maßnahme „Diversifizierung“ stützt sich auf folgende Informationsquellen:<br />
Datenart Datenquelle Grundgesamtheit Stichprobe<br />
Quantitative Daten<br />
Primärstatistiken Persönliche Befragung,<br />
standardisierter Fragebogen<br />
Sekundärstatistiken<br />
Begleitsystem <strong>des</strong> StMLF<br />
gemäß VO (EG) 1257/1999,<br />
Art. 48<br />
Alle 23 <strong>bis</strong> zum 15.10.2002<br />
weitgehend abgeschlossenen<br />
Fälle<br />
Alle 14 Fälle, für die <strong>bis</strong> Mai<br />
2003 Verwendungsnachweise<br />
vorlagen<br />
13 Förderfälle (57 %)<br />
14 Förderfälle (100 %)<br />
Förderstatistik <strong>des</strong> StMLF Alle 52 <strong>bis</strong> zum 31.12.2002 52 Förderfälle (100 %)<br />
bewilligten Fälle<br />
Modellkalkulationen zur Wirtschaftlichkeit von Erwerbskombinationen, Datensammlungen<br />
zur Planung landwirtschaftlicher und gewerblicher Tätigkeiten, Bewertungen vorangegangener<br />
Förderprogramme (5b I- und 5b II-Programm, LEADER-<strong>Förderung</strong>)<br />
Qualitative Daten<br />
Primärdaten Halbstandardisierter Fragebogen<br />
3 Abteilungsleiter an Landwirtschaftsämtern, 2 Mitarbeiter<br />
im StMLF<br />
Sekundärdaten Informationen aus diversen Studien zu Erfolgsfaktoren von selbständigen Erwerbskombinationen,<br />
Beweggründen und Hemmfaktoren für Diversifizierungsinvestitionen, betrieblichen<br />
Entwicklungsverläufen usw.<br />
Primärstatistiken:<br />
Alle Indikatoren, die nicht mit Hilfe bereits vorliegender Informationen beantwortet werden konnten, wurden<br />
im Rahmen einer standardisierten persönlichen Befragung von Fördermittelempfängern erhoben. Die Auswahl<br />
der Stichprobe erfolgte anhand der Förderstatistik mit dem Stand 15. Oktober 2002. Bis zu diesem<br />
Zeitpunkt lagen 47 Bewilligungen vor, von denen 11 Förderfälle bereits vollständig und 12 weitere teilweise<br />
abgeschlossen waren. Von diesen 23 Investitionsvorhaben wurden 13 (57 %) per Zufallsauswahl für Erhebungen<br />
ausgewählt und deren Betriebsleiter Frühjahr 2003 persönlich interviewt.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Sekundärstatistiken:<br />
Die Bewerter haben versucht, möglichst viele der auf die Maßnahme „Diversifizierung“ zutreffenden Indikatoren<br />
mit Hilfe von Sekundärdaten zu beantworten. Hierfür standen die Förderstatistik sowie das Begleitsystem<br />
gemäß VO (EG) 1257/1999, Art. 48 <strong>des</strong> StMLF zur Verfügung. Die Daten aus der Förderstatistik zur<br />
finanziellen Umsetzung <strong>des</strong> Programms liegen für alle 52 <strong>bis</strong> Ende 2002 bewilligten Projekte vor. Aus dem<br />
Begleitsystem stehen für 14 Förderfälle Angaben zur materiellen Umsetzung sowie zu ersten Förderwirkungen<br />
zur Verfügung. Diese Indikatoren wurden zusammen mit den Verwendungsnachweisen erhoben.<br />
Um vor allem die Einkommens- und Beschäftigungswirkungen der Diversifizierungsinvestitionen beurteilen<br />
zu können, erstellten die Bewerter Modellrechnungen auf der Grundlage der auf den Betrieben erhobenen<br />
Daten. Diese Kalkulationen basieren teilweise auf den Informationen und Daten früherer Untersuchungen.<br />
Qualitative Informationen:<br />
Die Beantwortung überwiegend qualitativer Fragestellungen z.B. zur Abwicklung und Akzeptanz <strong>des</strong> Programms<br />
erfolgte durch halbstandardisierte persönliche und telefonische Interviews mit Vertretern der Förderverwaltung<br />
und von Verbänden. Zudem flossen vor allem in die Erstellung der Fragebögen für die Primärdatenerhebung<br />
eine Reihe von Erfahrungen und qualitativen Daten aus früheren Studien mit ein. Diese<br />
Kontextinformationen bezogen sich vor allem auf einzelbetriebliche Erfolgsfaktoren und Entwicklungsverläufe<br />
sowie Hemmfaktoren und Beweggründe für die Aufnahme ergänzender selbständiger Tätigkeiten.<br />
Probleme und Grenzen der gewählten Methodik<br />
Aufgrund von Verzögerungen bei der Programmierung und Umsetzung <strong>des</strong> EPLR wurden im Bereich Diversifizierung<br />
die ersten Förderfälle erst im Mai 2002 bewilligt. Insgesamt waren zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung<br />
(Frühjahr 2003) erst 14 Projekte vollständig abgeschlossen (Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises).<br />
I.d.R. dauert es jedoch mehrere Jahre, <strong>bis</strong> alle Wirkungen von Diversifizierungsinvestitionen, wie z.B. Auslastung<br />
der geförderten Kapazitäten, Beschäftigungs- und Einkommenseffekte, Verlagerung von Faktoren<br />
aus der Landwirtschaft usw. vollständig eingetreten sind. Somit können momentan noch keine sicheren Aussagen<br />
zu den endgültigen Förderwirkungen getroffen werden. In der Halbzeitbewertung ist es lediglich möglich,<br />
die <strong>bis</strong>her eingetretenen und messbaren Wirkungen darzustellen und ggf. Schätzungen zu den noch zu<br />
erwartenden Anpassungsreaktionen und Fördereffekten zu formulieren. Eine Aktualisierung der Halbzeitbewertung<br />
im Jahr 2005 könnte dazu beitragen, die Wirkungen der geförderten Projekte und damit <strong>des</strong> Gesamtprogramms<br />
noch vor <strong>des</strong>sen Beendigung umfassender darzustellen.<br />
10.3.5 Finanzielle Umsetzung <strong>des</strong> Programms<br />
Die Umsetzung der Fördermaßnahme liegt deutlich unter den Planungen. Von den im EPLR veranschlagten<br />
400 <strong>bis</strong> 600 Projekten wurden <strong>bis</strong>her erst 52 bewilligt (vgl. Tabelle 139). Dementsprechend konnten in den<br />
ersten 3 Jahren nur knapp 31 % der für den selben Zeitraum reservierten EAGFL-Mittel gebunden und rund<br />
11 % an die Fördermittelempfänger ausgezahlt werden. Die Realisierungsgrade im Bezug auf die Mittel, die<br />
für den gesamten Programmzeitraum zur Verfügung stehen, betragen zwischen einem und vier Prozent.<br />
Angesichts dieser Abweichungen ist kaum davon auszugehen, dass die ursprünglichen Ziele (vgl. Abschnitte<br />
10.3.2 und 10.3.6) erreicht werden können.<br />
Für diese Unterschreitung der Planzahlen sind mehrere Gründe gleichzeitig verantwortlich:<br />
• Verzögerter Programmbeginn: Nach der Bekanntgabe der Fördermaßnahme durch das StMLF im<br />
April 2001 dauerte es über ein Jahr, <strong>bis</strong> im Mai 2002 die ersten Förderfälle bewilligt wurden. Dies hing<br />
damit zusammen, dass zur elektronischen Abwicklung der Diversifizierungsförderung ein spezielles<br />
Softwareprogramm entwickelt wurde, was länger dauerte als geplant.<br />
381
382<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• Im ersten Entwurf <strong>des</strong> OP waren die Fördermaßnahmen „Urlaub auf dem Bauernhof“ und „Verarbeitung<br />
und Vermarktung“ noch in der Maßnahme „Diversifizierung“ eingeplant, mussten dann jedoch auf<br />
Druck der <strong>EU</strong>-Kommission in andere Maßnahmen integriert werden. Damit fielen gerade die „erprobten“<br />
Diversifizierungsvorhaben aus der Diversifizierungsförderung heraus, die relativ rasch hätten umgesetzt<br />
werden können.<br />
• Angesichts der relativ günstigen Fördermöglichkeiten im 5b II-Programm nahmen zahlreiche Landwirte<br />
noch in der Schlussphase der 5b-<strong>Förderung</strong> die dortigen Förderangebote in Anspruch. Folglich war<br />
die Nachfrage nach Fördermitteln zur Diversifizierung unmittelbar nach Auslaufen <strong>des</strong> 5b II-<br />
Programms (2001 – 2002) zunächst relativ gering. Die Zurückhaltung der Landwirte wurde durch die<br />
im Diversifizierungsprogramm deutlich ungünstigeren Förderkonditionen zusätzlich verstärkt.<br />
• Von der <strong>Förderung</strong> sind Im EPLR alle Fälle ausgeschlossen, die im Rahmen <strong>des</strong> Agrarinvestitionsprogramms,<br />
<strong>des</strong> Agrarkreditprogramms oder <strong>des</strong> Öko-Regio-Programms gefördert werden können. 222<br />
Dies betrifft den Kernbereich der Projekte, die während der 5b II-Phase im Bereich Diversifizierung gefördert<br />
wurden.<br />
• In vielen Diversifizierungsbereichen ist zwischenzeitlich eine gewisse Marktsättigung eingetreten.<br />
Nach Angaben von Förderberatern steigen derzeit relativ wenige Landwirte neu in außerlandwirtschaftliche<br />
Betriebszweige ein. Der Schwerpunkt liegt in der Kapazitäts- und Sortimentserweiterung<br />
sowie Qualitätsverbesserung. Eine zentrale Voraussetzung für die <strong>Förderung</strong> über das Diversifizierungsprogramm<br />
nach Art. 33 ist jedoch der Neueinstieg in eine Diversifizierung. Für Erweiterungen<br />
und Verbesserungen bestehender Betriebszweige können keine Zuschüsse gewährt werden.<br />
Tabelle 139: Maßnahme Diversifizierung: Umfang und Realisierung im Verhältnis zu den Programmzielen<br />
Öffentliche Aufwendungen b davon <strong>EU</strong>-Beteiligung b<br />
Bewilligte<br />
Förderfälle bewilligt ausgezahlt bewilligt ausgezahlt<br />
Realisiert 52 1,46 Mio. € 0,40 Mio. € 0,58 Mio. € 0,20 Mio. €<br />
Plan (2000-2002) a 3,76 Mio. € 1,88 Mio. €<br />
Realisierungsgrad 38,8 % 10,6 % 30,9 % 10,6 %<br />
Plan (2000-2006) a 400 - 600 37,94 Mio. € 18,97 Mio. €<br />
Realisierungsgrad 8 % - 12 % 3,9 % 1,1 % 3,1 % 1,1 %<br />
a<br />
Gemäß 2. Antrag auf Änderung <strong>des</strong> Indikativen Gesamtfinanzierungsplan vom 25.1.2002<br />
b Stand: 31.12.2002<br />
Die für die Diversifizierung eingeplanten öffentlichen Aufwendungen stiegen von 0,7 Mio. € im Jahr 2000 auf<br />
über 12 Mio. € im Jahr 2006 an. 223 Ob dieses Mittelvolumen vollständig abgerufen werden kann, ist angesichts<br />
der sehr verhaltenen Nachfrage aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Um eine vollständige und<br />
kontinuierliche Umsetzung der vorgesehenen Finanzmittel zu gewährleisten, sollten die vergleichsweise<br />
ungünstigen Förderkonditionen überprüft und gegebenenfalls rasch entsprechende Mittelumschichtungen<br />
vorgeschlagen werden.<br />
10.3.6 Darstellung und Analyse <strong>des</strong> <strong>bis</strong>her erzielten Outputs<br />
Für alle 52 Förderfälle, die <strong>bis</strong> Ende 2002 bewilligt worden waren, liegen Informationen zum Zuwendungszweck<br />
vor. Demnach wurde in rund der Hälfte der Fälle die Errichtung privater Biogasanlagen gefördert (vgl.<br />
Tabelle 140), die Zusatzeinkommen durch Stromerzeugung erbringen sollen. Dafür sind primär zwei Gründe<br />
222 Vgl. Abschn. 10.3.3 sowie Plan zur <strong>Förderung</strong> der Entwicklung…, a.a.O., Abschn. 9.3.7.2, S. 323.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
verantwortlich: Einmal das gegenüber dem 5b II-Programm eingeschränkte Förderspektrum; zum anderen<br />
die Wirkungen <strong>des</strong> am 1. April 2000 in Kraft getretenen „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien“. Es<br />
garantiert den Betreibern von Anlagen <strong>bis</strong> 500 kW eine Min<strong>des</strong>tvergütung für aus Biomasse erzeugten<br />
Strom von 10,1 Cent pro Kilowattstunde für im Jahr 2002 neu in Betrieb genommene Anlagen. 224 Zudem<br />
besteht die Möglichkeit, parallel zur Diversifizierungsförderung nach Art. 33 von der Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
ein zinsgünstiges Darlehen und <strong>bis</strong> zu einer installierten elektrischen Leistung von 70 kW zusätzlich<br />
einen <strong>Teil</strong>schulderlass in Höhe von 15.000 € zu erhalten. 225<br />
Tabelle 140: Die <strong>bis</strong>her bewilligten Diversifizierungsfälle nach deren Zuwendungszweck<br />
Bereich Förderfälle Anteil<br />
Biogasanlagen 25 48 %<br />
Forstbereich (Holzernte, Holzbe- und Verarbeitung, auch im NawaRo-Bereich) 7 13 %<br />
Marketingmaßnahmen von Verbänden oder Gemeinden 6 11 %<br />
Pferdehaltung (Reithallen, Reitanlagen, Pferdeboxen, Stallanlagen) 3 6 %<br />
Brennereien 3 6 %<br />
Gäste auf dem Bauernhof (ergänzende Angebote) 2 4 %<br />
Gastronomie, SP Dienstleistung 2 4 %<br />
Soziale Dienstleistungen (Kranken- und Behindertenbetreuung) 2 4 %<br />
Kompostbereich (Kompostieranlagen, Lagerhallen) 2 4 %<br />
Summe 52 100%<br />
Mit 13 % aller Förderfälle kommt auch dem Forstbereich eine größere Bedeutung zu. Die einzelbetrieblichen<br />
Investitionen reichten von Erntemaschinen über Sägewerke und Holzpelletieranlagen <strong>bis</strong> zu mobilen Einrichtungen<br />
zur Herstellung von Hackschnitzeln zur Energiegewinnung aus Biomasse. Die insgesamt 6 Marketingmaßnahmen<br />
unterstützen einzelbetriebliche Diversifizierungsaktivitäten. Es handelt sich um überbetriebliche<br />
Marketingkonzepte, die entweder einen regionsspezifischen Ansatz (Bewerbung <strong>des</strong> Freizeitangebots<br />
bestimmter Regionen) oder leistungsspezifischen Ansatz (Werbung z.B. für Kneipp-Bauernhöfe, familiengerechten<br />
Urlaub auf dem Bauernhof) verfolgen. Die sonstigen Fördervorhaben verteilen sich mit jeweils 2<br />
Förderfällen auf das gesamte Förderspektrum.<br />
Regionale Verteilung<br />
Die Förderfälle konzentrieren sich weitgehend auf den nordbayerischen Raum. Mit 42 der 52 <strong>bis</strong>her geförderten<br />
Vorhaben entfallen rund 80 % der Fördermittel auf die Regierungsbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken<br />
sowie Oberpfalz. Ein wesentlicher Grund hierfür dürften die vergleichsweise ungünstigeren naturräumlichen<br />
Voraussetzungen und die im Durchschnitt kleineren Betriebsgrößen in diesen <strong>Teil</strong>räumen Bayerns<br />
sein. Diese Rahmenbedingungen führen zu einem erhöhten Anpassungsdruck und einem relativ hohen<br />
Anteil von Betrieben mit Einkommenskombination (vgl. Abschnitt 4). Die Verteilung der Diversifizierungsfälle<br />
verläuft <strong>des</strong>halb auch relativ parallel zum Anteil der Nebenerwerbsbetriebe in den Regierungsbezirken.<br />
Erreichung der gesetzten Ziele<br />
Ebenso wie die Finanzdaten belegen auch die materiellen Indikatoren eine noch sehr geringe Umsetzung<br />
<strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms. Neben den in Abschn. 10.3.5 bereits genannten Gründen spielen dabei<br />
auch Verzögerungen beim Eintreten von Beschäftigungs- und Einkommenseffekten eine Rolle, die vor allem<br />
für Existenzgründungen charakteristisch sind. So wurden die Umsetzungsindikatoren in Tabelle 141 von den<br />
Landwirtschaftsämtern zwar in einem Abstand von 6 Monaten nach Beendigung der Investitionen im Rahmen<br />
der Prüfung der Verwendungsnachweise erhoben. Bei den daraus errechneten Realisierungsgraden<br />
223 Vgl. 2. Antrag auf Änderung <strong>des</strong> Indikativen Gesamtfinanzierungsplan, Anlage 2.<br />
224 Vgl. Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), § 5, Abs. 1 und 2.<br />
225 Vgl. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Programm Nr. 128: Programm zur <strong>Förderung</strong> erneuerbarer Energien. Frankfurt 2003.<br />
383
384<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
handelt es sich jedoch nur um vorläufige Ergebnisse, die sich im weiteren Verlauf der geförderten Investitionen<br />
und <strong>des</strong> Gesamtprogramms noch deutlich verbessern dürften.<br />
Tabelle 141: Maßnahme Diversifizierung - Erreichung der im Entwicklungsplan formulierten Ziele<br />
Indikator Entwicklungsplan a Bisher realisiert Zielerreichungsgrad<br />
Anzahl Förderfälle insgesamt 400 – 600 52 9 - 13 %<br />
Beschäftigungseffekte b<br />
- geschaffene Arbeitsplätze (FTE)<br />
- gesicherte Arbeitsplätze (FTE)<br />
Einkommenseffekte (pro Jahr)<br />
- Zusatzeinkommen je gesichertem<br />
oder geschaffenem Arbeitsplatz b<br />
- Zusatzeinkommen insgesamt<br />
150 – 250<br />
250 – 400<br />
23,6<br />
.<br />
9 - 16 %<br />
.<br />
7.500 – 15.000 €<br />
30.126 €<br />
201 - 402 %<br />
3 Mio. € - 10 Mio. €<br />
712.247 €<br />
7 - 24 %<br />
a<br />
Vgl. Plan zur <strong>Förderung</strong> der Entwicklung…, a.a.O., S. 321 sowie Anlage 3.<br />
b<br />
Aus methodischen Gründen beschränkt sich die Beantwortung dieses Indikators ausschließlich auf die im Rahmen der<br />
<strong>Förderung</strong> neu geschaffenen Arbeitsplätze (FTE).<br />
Sollten die angestrebten 400 <strong>bis</strong> 600 Förderfälle nicht erreicht und das vorgesehene Fördervolumen nicht<br />
vollständig ausgeschöpft werden, dürften sich auch die Zielvorgaben von 150 <strong>bis</strong> 250 geschaffenen und 250<br />
<strong>bis</strong> 400 gesicherten Arbeitsplätzen sowie einem zusätzlich geschaffenen Einkommenspotenzial von rund 3<br />
<strong>bis</strong> 10 Mio. € nicht realisieren lassen.<br />
10.3.7 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung<br />
Publizität der Fördermöglichkeiten<br />
Das Diversifizierungsprogramm wurde zusammen mit den anderen strukturpolitischen Förderprogrammen in<br />
der Broschüre „Programm 2000 - Leistungen für Land und Leute“ vorgestellt. 226 Die Informationsschrift enthält<br />
eine Übersicht über Ziele, Voraussetzung, Förderinhalte und Förderhöchstbeträge. Sie liegt an den<br />
Landwirtschaftsämtern aus und kann zudem über das Internet bezogen werden.<br />
Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung, Mittelauszahlung<br />
Für die Abwicklung der Fördermaßnahme ist das Bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten<br />
mit seinen nachgeordneten Behörden zuständig. Hierzu wurden die im Rahmen <strong>des</strong> 5b-Programms geschaffenen<br />
Ländlichen Entwicklungsgruppen (5b-Stellen) 9 ausgewählten Landwirtschaftsämtern angegliedert.<br />
Sie sind für die Beratung, Entgegennahme und Bearbeitung der Förderanträge und die Vorbereitung<br />
der Bewilligungen zuständig. Die endgültige Bewilligung erfolgt durch die 9 ausgewählten Landwirtschaftsämter<br />
und die Bezirksregierungen, die Auszahlung der Fördermittel zentral über das StMLF.<br />
Tabelle 142: Maßnahme Diversifizierung: Ablauf der <strong>Förderung</strong><br />
Schritt Zuständige Behörde<br />
Erstellung von Publikationen StMLF, Referate Öffentlichkeitsarbeit und Agrarförderung<br />
Publikation der Fördermöglichkeiten Landwirtschaftsamt, SG 3.3<br />
Beratung potenzieller Antragsteller Landwirtschaftsamt, SG 3.3<br />
Antragsbearbeitung Landwirtschaftsamt, SG 3.3<br />
Bewilligung Landw.-Amt, Abt. 3, mit Bezirksregierung, SG 3.3<br />
Prüfung der Verwendungsnachweise Örtliche Landw.-Ämter, Bezirksregierungen (SG 710)<br />
Auszahlung Fördermittel StMLF, Staatsoberkasse München<br />
226 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten: Programm 2000 - Leistungen für Land und Leute, S. 14.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Kriterien der Zuschussfähigkeit<br />
Um unrentable Vorhaben von einer <strong>Förderung</strong> auszuschließen, müssen die Antragsteller mit dem Förderantrag<br />
verschiedene Nachweise erbringen (z.B. Finanzierungs- und Liquiditätsnachweis, Investitionskonzept<br />
bzw. Wirtschaftlichkeitsrechnung, Kostenvoranschläge usw.), aus denen die mittelfristige Tragfähigkeit der<br />
Investitionsvorhaben hervorgeht. Den Investitionsplan erstellen die Antragsteller in Zusammenarbeit mit den<br />
zuständigen Mitarbeitern <strong>des</strong> Landwirtschaftsamtes oder mit einer anderen fachlich qualifizierten Stelle (z.B.<br />
Steuer- oder Unternehmensberater). Vorhaben, für die unter Einrechnung der <strong>Förderung</strong> kein wirtschaftlich<br />
tragfähiger Betrieb nachgewiesen werden kann, werden nicht gefördert.<br />
Mitnahmeeffekte<br />
36 % der befragten Unternehmer hätten ohne <strong>Förderung</strong> keine Diversifizierungsentscheidung getroffen. Dies<br />
betraf in allen Fällen Biogasanlagen, die nach Aussagen der betroffenen Landwirte erst durch die <strong>Förderung</strong><br />
einen wirtschaftlichen Betrieb erlauben. Weitere 18 % der Geförderten hätten ohne <strong>Förderung</strong> entweder erst<br />
später oder nur in geringerem Umfang investiert.<br />
Auf der anderen Seite gaben 45 % der befragten Landwirte an, dass sie die Investition voraussichtlich auch<br />
ohne Diversifizierungsförderung im selben Umfang durchgeführt hätten. Hauptursache dieser offensichtlich<br />
umfangreichen Mitnahmeeffekte dürfte der relativ niedrige Fördersatz von 15 % sein. Diese geringe Unterstützung<br />
reicht offensichtlich nicht als Anreiz aus, um noch gezielter Landwirte, die ohne <strong>Förderung</strong> nicht<br />
investiert hätten, zu einer Diversifizierungsentscheidung zu bewegen.<br />
Koordination mit anderen Förderbereichen<br />
Seit der Auflösung der ehemaligen 5b-Stellen sind die Sachgebiete 3.3 der 9 Schwerpunkt-Landwirtschaftsämter<br />
für den gesamten Bereich der Diversifizierungsinvestitionen zuständig. Deren Mitarbeiter führen die<br />
Erstberatung von potenziellen Fördermittelempfängern durch und entscheiden, über welches Programm das<br />
jeweilige Vorhaben gefördert wird. So ist sichergestellt, dass die Landwirte einen umfassenden Überblick<br />
über das Maßnahmenangebot und die für sie günstigste Fördermöglichkeit erhalten. Zugleich werden der<br />
Verwaltungs- und Koordinationsaufwand für die Abwicklung der Programme minimiert und Mehrfachförderung<br />
sowie Mehrfachberatungen durch unterschiedliche Stellen vermieden. Der Verwaltungsaufwand für die<br />
Abwicklung der Diversifizierungsförderung ließe sich durch die Bündelung <strong>des</strong> gesamten Bereichs in einem<br />
Förderprogramm voraussichtlich noch weiter reduzieren.<br />
Kontrolle<br />
Die 9 ausgewählten Landwirtschaftsämter als Bewilligungsbehörden prüfen die Förderanträge auf Vollständigkeit<br />
und Erfüllung der Beihilfevoraussetzungen. Die Prüfung der Verwendungsnachweise erfolgt bei allen<br />
Begünstigten vor Ort, um eine korrekte Verwendung der Fördermittel sicherzustellen (standardisierter Fragebogen,<br />
Inaugenscheinnahme). Diese Prüfung übernehmen die örtlichen Landwirtschaftsämter. Zusätzlich<br />
erfolgen Betriebsprüfungen nach Art. 61 der VO 445/2002 bei min<strong>des</strong>tens 5 % der Begünstigten. 227<br />
Bei Verstößen gegen Förderauflagen und Beihilfebestimmungen können Beihilfen einschließlich Verzinsung<br />
teilweise oder vollständig zurückgefordert werden. Zudem können die Begünstigten in Fällen grober Fahrlässigkeit<br />
von der weiteren Gewährung von Beihilfen im jeweiligen Kalenderjahr und bei vorsätzlich falschen<br />
Angaben auch für das darauf folgende Kalenderjahr ausgeschlossen werden. Bei begründetem Verdacht<br />
eines (versuchten oder vollzogenen) Subventionsbetruges wird gemäß § 6 <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>subventionsgesetzes<br />
die zuständige Staatsanwaltschaft eingeschaltet.<br />
Neben den obligatorischen Kontrollen der Bewilligungsbehörden kann die Umsetzung <strong>des</strong> Förderprogramms<br />
durch folgende Behörden überprüft werden:<br />
• Innenrevision <strong>des</strong> StMLF als Zahlstelle;<br />
• Bezirksregierungen als Fachaufsichtsbehörde;<br />
227 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 445/2002 der Kommission vom 26. Februar 2002, Art. 61.<br />
385
386<br />
• Lan<strong>des</strong>- und Bun<strong>des</strong>rechnungshof;<br />
• Europäischer Rechnungshof sowie<br />
• Europäische Kommission.<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Programmbegleitung<br />
Das für die Diversifizierungsförderung zuständige Fachreferat im StMLF hat in einer frühen Phase der Programmumsetzung<br />
mit dem Halbzeitbewerter die Auswahl der Begleitindikatoren 228 abgestimmt. Diese Indikatoren<br />
werden von den für die Förderabwicklung zuständigen Landwirtschaftsämtern bzw. von den Bezirkregierungen<br />
als deren Fachaufsichtsbehörde regelmäßig geliefert und gehen in eine Datenbank ein, die von<br />
den Evaluatoren genutzt werden kann.<br />
Verwaltungsaufwand und Aufwand für die Letztempfänger<br />
Das in Übersicht 5 von Anlage 20 <strong>des</strong> EPLR beschriebene Schema zur Abwicklung der Maßnahme Diversifizierung<br />
wurde in der selben Form auch bereits bei vorangegangenen Förderprogrammen angewendet. Es<br />
handelt sich um eingespielte Verfahrensabläufe, die eine zügige und rationelle Abwicklung <strong>des</strong> Förderprogramms<br />
ermöglichen. Der kurze Zeitraum zwischen Antragstellung, Bewilligung und Auszahlung der Mittel<br />
sowie die unkomplizierte Beantragung der Zuschüsse wurden von Seiten der befragten Fördermittelempfänger<br />
mehrmals hervorgehoben. Auch der Aufwand für die Schaffung der ländlichen Entwicklungsgruppen an<br />
den 9 ausgewählten Landwirtschaftsämtern dürfte in einem vertretbaren Rahmen geblieben sein, da diese<br />
zum einen in ähnlicher Form vor dem Programm bereits existierten, und sie zudem von den bestehenden<br />
Strukturen in den Ämtern profitieren können.<br />
Den Anträgen müssen eine Reihe von Unterlagen und Nachweisen beigefügt werden:<br />
• Steuerbescheide/NV-Bescheinigung;<br />
• Kostenvoranschläge bzw. Angebote;<br />
• genehmigter Bauplan;<br />
• amtlicher Lageplan und Skizze;<br />
• Finanzierungs- und Liquiditätsnachweise;<br />
• Buchführungsabschlüsse;<br />
• Investitionskonzept bzw. Wirtschaftlichkeitsberechnung und Konzeptbeschreibung;<br />
• „De-minimis“-Bescheinigung;<br />
• ggf. Gesellschaftsvertrag und Pachtverträge.<br />
Dieser Aufwand für die Antragsteller scheint vertretbar, da sie die meisten Dokumente ohnehin entweder<br />
vorliegen haben oder im Rahmen der Genehmigung und Durchführung der Investition – unabhängig von<br />
einer <strong>Förderung</strong> - beschaffen müssen. <strong>Teil</strong>e der Unterlagen sind zudem nötig, um die Förderwürdigkeit und<br />
wirtschaftliche Tragfähigkeit der Investition prüfen zu können.<br />
Die relativ späte Bewilligung der ersten Fördermaßnahmen im Mai 2002 ist in erheblichem Umfang auf Verzögerungen<br />
in der Schaffung geeigneter behördeninterner Strukturen wie z.B. die Anpassung von EDV-<br />
Programmen, Förderbescheiden und Verwendungsnachweisen zurückzuführen. Dies hat bei einzelnen Antragstellern<br />
zu zusätzlichem Aufwand und Verzögerungen in der Umsetzung ihrer Projekte geführt.<br />
228 Vgl. Plan zur <strong>Förderung</strong> der Entwicklung..., a.a.O., S. 325.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
10.3.8 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der relevanten Bewertungsfragen<br />
10.3.8.1 Plausibilitätsprüfung <strong>des</strong> Bewertungskonzeptes sowie der gemeinsamen kapitelspezifischen<br />
Bewertungsfragen<br />
Alle fünf in Dokument VI/12004/00, Abschnitt 9 formulierten gemeinsamen Bewertungsfragen treffen auf die<br />
Maßnahme Diversifizierung zu. Sie thematisieren die wesentlichen Wirkungsbereiche <strong>des</strong> Programms und<br />
ermöglichen eine umfassende Bewertung der Fördereffekte. Angesichts <strong>des</strong> engen zeitlichen Abstan<strong>des</strong><br />
zwischen dem Bewilligungsbeginn (Mai 2002), der Fertigstellung der ersten Projekte im Herbst 2002 und der<br />
Datenerhebungen im Rahmen der Halbzeitbewertung im Frühjahr 2003 liefern vor allem die Indikatoren zu<br />
den Bereichen Einkommen und Beschäftigung jedoch nur vorläufige Ergebnisse.<br />
10.3.8.2 Hinzufügen von Kriterien und Indikatoren<br />
Die im Katalog der gemeinsamen Bewertungsfragen (Dokument VI/12004/00, <strong>Teil</strong> B und <strong>Teil</strong> D) beschriebenen<br />
Indikatoren ermöglichen aus Sicht der Bewerter nicht immer eine umfassende Beantwortung der fünf<br />
Bewertungsfragen und somit auch keine vollständige Evaluierung der einzelnen Förderprogramme. Aus<br />
diesem Grund wurden zu manchen Bewertungsfragen zusätzliche Indikatoren definiert. In den folgenden<br />
fünf Abschnitten werden die fünf Fragen zur Evaluierung der Diversifizierungsförderung nach Art. 33 getrennt<br />
diskutiert. Eine Tabelle zu Beginn eines je<strong>des</strong> Abschnitts zeigt, welche Kriterien oder Indikatoren nicht<br />
beantwortet werden konnten oder neu definiert werden mussten, um eine umfassendere Bewertung sicher<br />
zu stellen.<br />
10.3.8.3 Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der ländlichen Bevölkerung<br />
(Frage IX.1)<br />
Kriterium<br />
Indikator<br />
Kriterium/Indikator Beantwortet<br />
Nicht beantwortet<br />
a<br />
IX.1-1. Erhaltung/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens aus landwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.1-1.1. Anteil <strong>des</strong> auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkommens<br />
der landwirtschaftlichen Bevölkerung<br />
(€/Begünstigter, Anzahl der betreffenden Personen)<br />
X<br />
IX.1-1.2. Verhältnis von {Kosten} zu {Umsatzerlösen} der geförderten,<br />
mit den landwirtschaftlichen Betrieben in Zusammenhang stehenden<br />
Tätigkeiten (wobei Kosten = eingesetzte Produktionsmittel<br />
insgesamt)<br />
X<br />
IX.1-1.3. (n) Erhalt/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der landwirtschaftlichen<br />
Bevölkerung als indirekte Wirkung von Investitionen in ländliche<br />
Infrastruktur (Beschreibung)<br />
IX.1-2. Erhaltung/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens aus nichtlandwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.1-2.1. Anteil <strong>des</strong> auf Grund der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens<br />
von nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen Begünstigten<br />
(€/Begünstigter, Anzahl der betreffenden Personen)<br />
X<br />
IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung, die<br />
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen<br />
bezieht, welche auf Grund von Beihilfen in nichtlandwirtschaftlichen<br />
Sektoren getätigt wurden bzw. entstanden sind (in %)<br />
X<br />
IX.1-2.3 (n) Erhalt/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der nicht-landwirtschaftlichen<br />
Bevölkerung als indirekte Wirkung von Investitionen<br />
in ländliche Infrastruktur (Beschreibung)<br />
IX.1-2.4 (n) Erhalt/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens im ländlichen Raum in<br />
der Planungs- und Realisierungsphase von Projekten<br />
X<br />
a<br />
Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
387<br />
Nicht zutreffend<br />
X<br />
X
388<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Die Steigerung <strong>des</strong> Einkommens vor allem landwirtschaftlicher Haushalte ist ein zentrales Ziel der Diversifizierungsförderung.<br />
Die Erschließung außerlandwirtschaftlicher Erwerbsalternativen wirkt sich in vielen Fällen<br />
auch auf die Struktur <strong>des</strong> landwirtschaftlichen Betriebes sowie auf andere Einkommensquellen und Betätigungsfelder<br />
der Haushaltsmitglieder aus. Diese Veränderungen in der Höhe und Zusammensetzung der<br />
Haushaltseinkommen sind eine direkte Folge der geförderten Diversifizierungsinvestitionen und müssen<br />
somit bei der Bewertung <strong>des</strong> Netto-Einkommenseffektes berücksichtigt werden.<br />
Da sich die Diversifizierungsförderung auf den Neueinstieg in Erwerbskombinationen beschränkt, kann im<br />
geförderten Betriebszweig zwar Einkommen neu bzw. zusätzlich geschaffen, jedoch nicht unmittelbar<br />
erhalten werden. Eine Sicherung von Einkommen in anderen, nicht geförderten Betriebszweigen (z.B. Landwirtschaft)<br />
durch die <strong>Teil</strong>nahme am Diversifizierungsprogramm ist zwar generell denkbar. Voraussetzung für<br />
eine Quantifizierung solcher Effekte wären jedoch Informationen über die Entwicklung der anderen Betriebszweige<br />
ohne eine <strong>Teil</strong>nahme an der Diversifizierungsförderung. Solche Informationen sind äußerst unsicher,<br />
da die alternativen Entwicklungsverläufe (ohne <strong>Teil</strong>nahme am Förderprogramm) von vielen weiteren internen<br />
und externen Faktoren beeinflusst werden, die ex ante von den Betriebsleitern nur sehr ungenau abgeschätzt<br />
werden können. Deshalb beschränkt sich die Quantifizierung von direkten Einkommenswirkungen<br />
ausschließlich auf das in den geförderten Betriebszweigen zusätzlich geschaffene Netto-Einkommen.<br />
Erhaltung und Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens landwirtschaftlicher Haushalte (Kriterium IX.1-1.)<br />
Trotz <strong>des</strong> noch geringen Abstan<strong>des</strong> zwischen Inbetriebnahme der geförderten Investitionen und dem Zeitpunkt<br />
der Halbzeitbewertung von ca. einem halben Jahr konnten die geförderten landwirtschaftlichen Haushalte<br />
ihr Einkommen bereits deutlich steigern. Im Durchschnitt der 10 untersuchten Förderfälle, für die vollständige<br />
Informationen über die Einkommenswirkungen der bezuschussten Diversifizierungsinvestitionen<br />
vorliegen, nahm das Gesamteinkommen um knapp 11.000 € pro Jahr zu (vgl. Indikator IX.1-1.1. in Tabelle<br />
143). 229 Dieser Entwicklung liegen zwei gegenläufige Trends zu Grunde:<br />
• Die geförderten Diversifizierungen erbrachten einen positiven Einkommensbeitrag von rund 14.000 €<br />
pro Jahr;<br />
• Der Gewinn im landwirtschaftlichen Betrieb nahm im Durchschnitt aller 10 untersuchten Betriebe um<br />
3.000 € ab.<br />
Demnach konnten die geförderten Betriebe bereits in einer frühen Investitionsphase ein Zusatzeinkommen<br />
erwirtschaften, welches in etwa der Hälfte <strong>des</strong> durchschnittlichen außerbetrieblichen Erwerbseinkommens<br />
bayerischer Nebenerwerbsbetriebe entspricht. 230 Zu diesem Ergebnis trugen vor allem die geförderten Biogasanlagen<br />
bei, die aufgrund kurzer Bau- und Anlaufzeiten sowie festgeschriebener Konditionen (garantierte<br />
Abnahme <strong>des</strong> erzeugten Stroms zu einem Festpreis von 10,1 Cent) innerhalb weniger Monate wirtschaftlich<br />
betrieben werden konnten. Wenn die geförderten Diversifizierungen ihre volle Auslastung und Marktperformance<br />
erreicht haben, dürften die durchschnittlichen Einkommensbeiträge noch deutlich günstiger ausfallen.<br />
Das Förderprogramm zielt durch die Schaffung ergänzender Erwerbsmöglichkeiten indirekt auch auf die<br />
Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung und somit auf die Stabilisierung <strong>des</strong> landwirtschaftlichen Einkommens<br />
ab. Dieses Ziel wurde angesichts eines nur geringen Einkommensrückgangs im landwirtschaftlichen<br />
Bereich von 3.000 € pro Förderfall und Jahr erreicht. Dieser Einkommensrückgang ist in erster Linie<br />
auf die Reduzierung von Marktfrucht-Anbauflächen zu Gunsten der Biomasseproduktion für den Betrieb der<br />
Biogasanlagen zurückzuführen. Bisher wurde in keinem der untersuchten Fälle die landwirtschaftliche Produktion<br />
durch Flächenabstockung reduziert. Sollten die Diversifizierungen langfristig rentabel betrieben werden<br />
können, planen die meisten Haushalte lediglich eine Extensivierung der pflanzlichen Produktion oder<br />
eine Umstellung auf arbeitsextensive Produktionsverfahren im tierischen Bereich.<br />
229 Einkommensdaten, die nur für die ersten Monate vorlagen, wurden auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.<br />
230 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten: Bayerischer Agrarbericht 2002, S. 54.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 143: Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens aus landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten (Indikator IX.1-1.1. und IX.1-2.1.)<br />
Anteil <strong>des</strong> auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkommens …<br />
Je Betrieb a Hochgerechnet auf alle 52<br />
geförderten Betriebe b<br />
Einkommen<br />
(€)<br />
… der landwirtschaftlichen Bevölkerung (Indikator IX.1-1.1.)<br />
insgesamt<br />
- dav. Bruttoeinkommen der landw. Betriebe<br />
(Anteil in %)<br />
- dav. Einkommen aus Diversifizierung<br />
(Anteil in %)<br />
10.579<br />
-3.315<br />
-31 %<br />
13.894<br />
131 %<br />
… der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung (Indikator IX.1-2.1.)<br />
insgesamt<br />
- dav. im Sektor Fremdenverkehr erzielt<br />
- dav. aus Handwerk/lokalen Produkten<br />
3.118<br />
0<br />
0<br />
Begünstigte<br />
1,6<br />
1,6<br />
-<br />
1,6<br />
-<br />
0,4<br />
0<br />
0<br />
Einkommen<br />
(€)<br />
550.094<br />
-172.401<br />
-31 %<br />
722.495<br />
131 %<br />
162.153<br />
0<br />
0<br />
Begünstigte<br />
83,2<br />
83,2<br />
-<br />
83,2<br />
-<br />
20,8<br />
0<br />
0<br />
389<br />
Einkommen<br />
je<br />
Begünstigtem<br />
(€)<br />
6.624<br />
-2.072<br />
-<br />
8.684<br />
-<br />
7.796<br />
0<br />
0<br />
… der Gesamtbevölkerung<br />
Insgesamt 13.697 2,0 712.247 104 6.849<br />
a n = 10 Betriebe.<br />
b Stand: 31.12.2002.<br />
Die geförderten Betriebe erzielten einen Umsatz von rund 62.000 € pro Jahr bei 48.000 € Kosten (vgl.<br />
Tabelle 144). Die Gewinnrate der untersuchten Investitionen von 22 % und dementsprechend das Verhältnis<br />
zwischen Kosten und Umsatz (Indikator IX.1-1.2.) von 0,78 in Tabelle 144 liegen in etwa auf dem Niveau,<br />
das auch bereits länger existierende Diversifizierungsbetriebe in den Bereichen Direktvermarktung und Biogas<br />
aufweisen. 231 Dies zeigt, dass ein großer <strong>Teil</strong> der geförderten Betriebe keine für Existenzgründungen<br />
typischen Anlaufverluste mehr aufweist und bereits ausreichende Umsätze für einen stabilen und rentablen<br />
Betrieb der Diversifizierung erzielt.<br />
Tabelle 144: Ausgewählte Ergebnisse der geförderten Diversifizierungsinvestitionen<br />
Umsatz<br />
Kosten<br />
Gewinn<br />
Investitionssumme<br />
Förderzuschuss<br />
Gewinnrate<br />
Kosten : Umsatzerlöse (Indikator IX.1-1.2.)<br />
Gewinn in % <strong>des</strong> Förderzuschusses<br />
a<br />
n = 10 Betriebe.<br />
b<br />
Stand: 31.12.2002.<br />
Je Betrieb a Hochgerechnet auf alle 52<br />
geförderten Betriebe b<br />
62.043 €<br />
48.149 €<br />
13.894 €<br />
256.538 €<br />
29.914 €<br />
22 %<br />
0,78<br />
46 %<br />
3,2 Mio. €<br />
2,5 Mio. €<br />
0,7 Mio. €<br />
13,3 Mio. €<br />
1,6 Mio. €<br />
Einschließlich der nicht förderfähigen Kostenanteile investierten die Unternehmer im Schnitt 257.000 € in<br />
den neuen Erwerbszweig. Der effektive Fördersatz betrug bei einem Zuschuss von rd. 30.000 € pro Betrieb<br />
11,7 % und der Gewinn aus der neuen Aktivität - den vorläufigen Ergebnissen zufolge – rund 46 % <strong>des</strong> Förderzuschusses.<br />
Sollten diese günstigen Relationen längerfristig Bestand haben, dürften die Fördermittel in<br />
wenigen Jahren bereits durch das Aufkommen an zusätzlichen direkten Steuern weitgehend wieder refinan-<br />
231 Quelle: Goergens, M.: Kosten der Direktvermarktung. Skript für das Bun<strong>des</strong>kernobstseminar 2001 an der Obstbauversuchsanstalt<br />
Jork der Landwirtschaftskammer Hannover. Hannover 2001 sowie eigene Wirtschaftlichkeitsberechnungen älterer Biogasanlagen.
390<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
ziert worden sein. Dies hängt allerdings auch davon ab, in welchem Umfang die Haushalte den Gewinn aus<br />
der Diversifizierung für ihren privaten Konsum verwenden, sparen oder wieder reinvestieren. Hierzu liegen<br />
jedoch keine Informationen vor.<br />
Erhaltung und Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens von nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen<br />
Personen (Kriterium IX.1-2.)<br />
Mit durchschnittlich ca. 3.100 € je Förderfall bzw. 7.800 € je Person (Indikator IX.1-2.1.) profitierte die nicht<br />
landwirtschaftliche Bevölkerung <strong>bis</strong>her kaum von den geförderten Diversifizierungsprojekten (vgl. Tabelle<br />
143). Dies erklärt sich daraus, dass in den Haushalten zumeist ausreichend Familien-Arbeitskräfte verfügbar<br />
sind, um das neue Erwerbsfeld aufzubauen und <strong>des</strong>halb kaum Bedarf an Fremd-Arbeitskräften auftritt. Zudem<br />
erledigen erfahrungsgemäß landwirtschaftliche Haushalte vor allem in der Anlaufphase einen Großteil<br />
der Arbeiten auch unter Inkaufnahme kurzfristiger Arbeitsüberlastungen selber, um Kosten zu sparen und<br />
das finanzielle Risiko der Unternehmensgründung gering zu halten. Erst nach einer Stabilisierung <strong>des</strong> neuen<br />
Betriebszweiges werden in einer späteren Phase einzelne Aufgaben an Fremd-Arbeitskräfte delegiert. Hierzu<br />
können jedoch aufgrund <strong>des</strong> geringen zeitlichen Abstan<strong>des</strong> zum Beginn der Tätigkeiten noch keine Angaben<br />
gemacht werden.<br />
Je Betrieb wurden im Rahmen der geförderten Investition im Schnitt 0,4 haushaltsfremde Personen zusätzlich<br />
beschäftigt. Hochgerechnet auf alle <strong>bis</strong> Ende 2002 bewilligten Fälle konnten somit <strong>bis</strong>her insgesamt 21<br />
Fremd-Arbeitskräfte (zusätzliches) Einkommen aus den geförderten Projekten beziehen. Dies entspricht in<br />
etwa 0,0007 % der ländlichen Bevölkerung, die nicht in der Landwirtschaft tätig ist (Indikator IX.1-2.2.).<br />
10.3.8.4 Beitrag zum Erhalt der Lebensbedingungen und <strong>des</strong> Wohlergehens der ländlichen Bevölkerung<br />
als Ergebnis der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeitangebote<br />
oder durch Verringerung der Abgelegenheit (Frage IX.2)<br />
Kriterium/<br />
Indikator Nr.<br />
Kriterium/Indikator Beantwortet<br />
Nicht beantwortet<br />
a<br />
Nicht zutreffend<br />
IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit X<br />
IX.2-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte/ Unternehmen,<br />
die Zugang zu geförderten Telekommunikationseinrichtungen/diensten<br />
haben (Anz., %)<br />
X<br />
IX.2-1.2. Transporte/Wege, die auf Grund von Fördermaßnahmen erleichtert<br />
oder unnötig wurden<br />
X<br />
IX.2-1.3. Hinweise auf wirtschaftliche Tätigkeiten, die sich aus der geförderten,<br />
verbesserten Telekommunikations- oder Transporteinrichtungen<br />
ergeben haben<br />
X<br />
IX.2-2. Erhaltung/Verbesserung der sozialen und kulturellen Einrichtungen,<br />
insbesondere für Jugendliche und junge Familien<br />
X<br />
IX.2-2.1. (g) Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozialen/ kulturellen/sportlichen<br />
und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von<br />
geförderten Einrichtungen abhängen (in %)<br />
X<br />
IX.2-2.2. (n) Hinweise auf Projekte, die im Besonderen die Bedürfnisse von<br />
Jugendlichen und älteren Menschen berücksichtigen (Beschreibung)<br />
X<br />
IX.2-3. Erhaltung/Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen in der<br />
unmittelbaren Umgebung, Erhaltung/Verbesserung der Wohnbedingungen<br />
X<br />
IX.2-3.1. (g) Anteil geförderter Wander- und Radwege, die einen Beitrag zur<br />
Verbesserung der Freizeitaktivitäten leisten (km, %)<br />
X<br />
IX.2-3.2. (g) Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, die<br />
auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert<br />
haben (Anz., %)<br />
X<br />
IX.2-3.3. (n) Hinweise auf die Verbesserung <strong>des</strong> Wohnumfel<strong>des</strong> bzw. der<br />
Wohnstandortqualität und der Lebensbedingungen<br />
X<br />
IX.2-4. (n) Schutz von Leib und Leben sowie von Hab und Gut durch die X
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Abwehr von Gefahren, die durch Hochwasser verursacht werden<br />
IX.2-4.1. (n) Anzahl der Einwohner, die direkt von Sicherungsmaßnahmen <strong>des</strong><br />
Siedlungsraumes profitieren (Anzahl)<br />
IX.2-4.2. (n) Gesicherte Infrastruktureinrichtungen X<br />
IX.2-4.3. (n) Herstellung von Retentionsraum (in m³) X<br />
IX.2-4.4. (n) Erweiterung <strong>des</strong> Durchflussquerschnitts (in m²) X<br />
a Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
Verringerung der Abgelegenheit (Kriterium IX.2-1.)<br />
Die Verringerung der Abgelegenheit ist weder Ziel <strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms nach Art. 33, noch ließen<br />
sich anhand der Analyse <strong>des</strong> <strong>bis</strong>herigen Outputs Nebenwirkungen in diese Richtung erkennen. Deshalb wird<br />
dieses Kriterium nebst den zugehörigen Indikatoren an dieser Stelle nicht weiter behandelt.<br />
Erhaltung/Verbesserung der sozialen, kulturellen, sportlichen und freizeitbezogenen Einrichtungen<br />
(Kriterium IX.2-2.)<br />
Bei 3 der 10 untersuchten Fälle handelt es sich um Freizeiteinrichtungen, von denen eine auch touristisch<br />
genutzt werden kann. Kulturelle, soziale und sportliche Einrichtungen wurden zwar im Rahmen <strong>des</strong> Programms<br />
gefördert (vgl. Abschn. 10.3.6), der Umsetzungsstand ließ jedoch noch keine Wirkungen erkennen.<br />
Grundsätzlich hat die gesamte Bevölkerung Zugang zu den 3 geförderten Angeboten. Für eine konkrete<br />
Nutzung kommt jedoch in der Praxis nur eine abgegrenzte Zielgruppe im näheren Umkreis der geförderten<br />
Einrichtungen in Frage. Deshalb wurde die Gesamtbevölkerung der zugehörigen Gemeinden als Zielgruppe<br />
bzw. potenzieller Nutzerkreis <strong>des</strong> Diversifizierungsprojektes definiert. Unter dieser Annahme beträgt der<br />
Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu den sozialen, kulturellen, sportlichen und freizeitbezogenen<br />
Aktivitäten hat, die von geförderten Einrichtungen abhängen, 0,21 % der Gesamtbevölkerung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Raumes (Indikator IX.2-2.1.). Bisher wurden im Rahmen <strong>des</strong> Diversifizierungsprogramm noch keine<br />
Projekte gefördert, die im besonderen die Bedürfnisse von Jugendlichen und älteren Menschen berücksichtigen<br />
(Indikator IX.2-2.2.).<br />
Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen und der Wohnbedingungen (Kriterium IX.2-3.)<br />
Wie die Beschreibung der 52 <strong>bis</strong> Ende 2002 bewilligten Förderfälle in Abschnitt 10.3.6 zeigt, wurde auch die<br />
Schaffung bzw. Verbesserung von Wander- und Radwegen (Indikator IX.2-3.1.) sowie Unterbringungsmöglichkeiten<br />
(Indikator IX.2-3.2) gefördert. Aufgrund der langen Realisierungszeit dieser Erst ab Mitte 2002<br />
begonnenen Projekte liegen hierfür noch keine Ergebnisse vor.<br />
Die Verbesserung <strong>des</strong> Wohnumfel<strong>des</strong> bzw. der Wohnstandortqualität und der Lebensbedingungen (Indikator<br />
IX.2-3.3.) ist keine Zielsetzung der Diversifizierungsförderung unter Art. 33. Deshalb können aus der Umsetzung<br />
<strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms keine Hinweise zur Beantwortung dieses Indikators abgeleitet werden.<br />
10.3.8.5 Beitrag zum Erhalt von Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten (Frage IX.3)<br />
Kriterium/<br />
Kriterium/Indikator Beant-<br />
Indikator Nr.<br />
wortet<br />
IX.3-1. Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für<br />
die landwirtschaftliche Bevölkerung<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch<br />
Fördermaßnahmen geschaffen/erhalten wurden (vollzeitäquivalente<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten [FTE], Anz. der Betriebe)<br />
X<br />
Nicht beantwortet<br />
a<br />
X<br />
391<br />
Nicht zutreffend
392<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
IX.3-1.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die landwirtschaftliche Bevölkerung<br />
erhalten/geschaffen wurde (<strong>EU</strong>R/VE)<br />
X<br />
IX.3-1.3. (n) Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die<br />
landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der <strong>Förderung</strong><br />
ländlicher Infrastruktur (FTE, Beschreibung)<br />
X<br />
IX.3-1.4. (n) Kosten pro indirekt geschaffenem oder erhaltenem Arbeitsplatz<br />
(€/Arbeitsplatz)<br />
X<br />
IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten konnten<br />
wirksamer ausgeglichen werden<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.3-2.1. (g) Neu geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten während <strong>des</strong><br />
Zeitraums mit geringer landwirtschaftlicher Aktivität (FTE)<br />
X<br />
IX.3-2.2. Verlängerung der Fremdenverkehrssaison (Tage/Jahr) X<br />
IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt zur Verbesserung der<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche<br />
Bevölkerung bei.<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft<br />
tätig sind (VE, Anz. der betreffenden Personen)<br />
X<br />
IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft<br />
tätigen Personen erhalten/geschaffen wurde (€/FTE)<br />
X<br />
IX.3-3.3. (n) Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die<br />
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der<br />
<strong>Förderung</strong> ländlicher Infrastruktur (FTE, Beschreibung)<br />
X<br />
IX.3-3.4. (n) Kosten pro indirekt geschaffenem oder erhaltenem Arbeitsplatz<br />
(€/Arbeitsplatz)<br />
X<br />
IX.3-3.5. (n) Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisierungsphase<br />
von Projekten (in Beschäftigtenjahren)<br />
X<br />
a<br />
Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
Analog zu den Einkommenswirkungen (vgl. Abschn. 7.3.7.7) beschränken die Bewerter auch die Diskussion<br />
der Beschäftigungseffekte auf die Neuschaffung von Arbeitsplätzen. Im Rahmen <strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms<br />
konnten direkt keine außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze gesichert bzw. erhalten werden, da<br />
nur der Neueinstieg in eine Diversifizierung förderfähig ist. In anderen Betriebszweigen wurde durch die <strong>Förderung</strong><br />
indirekt ein Beitrag zur Erhaltung von Beschäftigung geleistet, z.B. durch die Stabilisierung <strong>des</strong> landwirtschaftlichen<br />
Betriebes im Rahmen der Diversifizierung oder mit Hilfe von Synergieeffekte zwischen beiden<br />
Bereichen. Diese erhaltenen Beschäftigungsverhältnisse lassen sich jedoch nur sehr schwer und ungenau<br />
von den Arbeitsplätzen trennen, die auch ohne <strong>Förderung</strong> weiter bestanden hätten. Grund hierfür ist<br />
u.a., dass die Betriebsleiter im Rahmen der Befragung die Betriebsentwicklung, die ohne <strong>Förderung</strong> eingetreten<br />
wäre, sowie deren Folgen auf Beschäftigung und Einkommen nicht spontan abschätzen konnten.<br />
Deshalb wurde auf die Erstellung einer notgedrungen unsicheren Beschäftigungsprognosen verzichtet.<br />
Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung<br />
(Kriterium IX.3-1.)<br />
Für Angehörige landwirtschaftlicher Haushalte entstand durch die Diversifizierungsförderung zusätzliche<br />
Beschäftigung im Umfang von ca. 500 Akh je Förderfall, das entspricht 0,28 Vollzeitäquivalenten (FTE) (vgl.<br />
Tabelle 145). Hochgerechnet auf die 52 <strong>bis</strong> Ende 2002 geförderten Betriebe ergeben sich hieraus 14,5 zusätzliche<br />
Jahres-Arbeitseinheiten (Indikator IX.3-1.1.). Dieser Nettoeffekt setzt sich aus zwei gegenläufigen<br />
Entwicklungen zusammen:<br />
• In der geförderten Diversifizierung wurden je Förderfall 0,4 bzw. insgesamt knapp 21 FTE neu geschaffen;<br />
• Als Folge innerbetrieblicher Umstellungen reduzierte sich zugleich der Einsatz von Familien-AK in der<br />
Landwirtschaft um 0,12 FTE je Betrieb; dies ergibt in der Summe eine Abnahme um gut 6 FTE.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Knapp ein Drittel der für Haushaltsmitglieder geschaffenen Arbeitsplätze wurden mit Personen unter 30 Jahren<br />
besetzt. Jüngere Personen konnten folglich überdurchschnittlich von der <strong>Förderung</strong> profitieren. 232 Auch<br />
wenn in zwei Drittel der Fälle die älteren Familien-Arbeitskräfte den Großteil der Arbeit im neuen Erwerbszweig<br />
verrichten, ist es in den meisten Fällen doch die jüngere Generation, welche die Entscheidung für den<br />
Einstieg in die Diversifizierung trifft und die Verantwortung dafür übernimmt. Angesichts begrenzter Wachstumsmöglichkeiten<br />
in der Agrarproduktion versuchen die Hofnachfolger auf diese Weise, das Einkommens-<br />
und Beschäftigungspotenzial <strong>des</strong> Betriebes so zu erweitern, dass es zumin<strong>des</strong>t zeitweise für beide erwerbsfähigen<br />
Generationen ausreicht. Sie schaffen damit die Voraussetzung für günstigere Perspektiven der Ressourcennutzung<br />
und Einkommensbildung in der Zukunft.<br />
Tabelle 145: Beschäftigungsmöglichkeiten für Mitglieder landwirtschaftlicher Haushalte, die durch<br />
die Diversifizierungsförderung geschaffen wurden (Indikator IX.3-1.1.)<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten insgesamt<br />
- dav. aus verbesserten landw. Tätigkeiten<br />
- dav. aus Diversifizierung<br />
- dav. für Personen unter 30 Jahren<br />
- dav. für Frauen<br />
AKh<br />
je<br />
Förderfall a<br />
500<br />
-215<br />
715<br />
162<br />
87<br />
AKh<br />
Insgesamt b<br />
26.020<br />
-11.154<br />
37.174<br />
8.441<br />
4.524<br />
FTE c<br />
je<br />
Förderfall a<br />
0,28<br />
-0,12<br />
0,40<br />
0,09<br />
0,05<br />
FTE c<br />
Insgesamt b<br />
14,46<br />
-6,20<br />
20,65<br />
4,69<br />
2,51<br />
393<br />
Anteil an<br />
allen Akh<br />
bzw. FTE<br />
100 %<br />
-43 %<br />
143 %<br />
32 %<br />
17 %<br />
a n = 10 Betriebe.<br />
b Bezogen auf alle 52 <strong>bis</strong> zum 31.12.2002 geförderten Betriebe.<br />
c Die Berechnung der „Full Time Equivalent“ (FTE) orientiert sich an der von <strong>EU</strong>ROSTAT verwendeten Methodik. Demnach<br />
entsprechen 1.800 Arbeitsstunden pro Jahr (AKh) einer Jahresarbeitseinheit (JAE) bzw. einem FTE. Vgl. Charlier,<br />
Hubert in: <strong>EU</strong>ROSTAT: Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der <strong>EU</strong>. Wichtigste Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung<br />
1999-2000. Brüssel 2002, S. 6<br />
Mit nur 17 % aller im Haushalt geschaffenen FTE profitierten Frauen nur unterdurchschnittlich von der <strong>Förderung</strong>.<br />
Dies liegt vor allem an der traditionellen Arbeitsteilung in landwirtschaftlichen Haushalten, der zufolge<br />
Frauen in erster Linie hofgebundene Tätigkeiten in der Landwirtschaft sowie im Haushalt ausüben. Der<br />
Betrieb einer Biogasanlage mit hohem Technikbezug ist hingegen eher „Männersache“.<br />
Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung (Kriterium<br />
IX.3-3.)<br />
Analog zur Einkommensverteilung profitierten auch bei der Besetzung neu geschaffener Arbeitsplätze die<br />
familieneigenen AK deutlich mehr von der <strong>Förderung</strong> als Fremd-Arbeitskräfte (vgl. Abschn. 7.3.7.7). Die Zahl<br />
der durch die <strong>Förderung</strong> neu entstandenen Arbeitsplätze für Fremd-AK entspricht nur etwa zwei Drittel der<br />
induzierten Beschäftigung von haushaltseigenen Arbeitkräften. Im Durchschnitt wurden jährlich rund 318<br />
Fremd-AKh je Förderfall gebunden, das entspricht hochgerechnet auf alle 52 geförderten Betriebe rund 9<br />
FTE (vgl. Tabelle 146). Zwei Drittel dieser Arbeitsplätze entstand im Rahmen der Diversifizierung, das restliche<br />
Drittel im land- und hauswirtschaftlichen Bereich. Es handelt sich dabei vorwiegend um Tätigkeiten, die<br />
aus dem Haushalt ausgelagert und an Fremd-Arbeitskräfte delegiert wurden, um so bei den Familien-<br />
Arbeitskräften Kapazitäten für den Einstieg in die Diversifizierung zu schaffen. Frauen und Personen unter<br />
30 Jahren spielten bei der Einstellung von Fremd-Arbeitskräften keine Rolle.<br />
232<br />
Im Jahr 2002 betrug der Anteil der 18 <strong>bis</strong> unter 30-jährigen an allen Personen im erwerbsfähigen Alter in Bayern rund 22%. Vgl.<br />
hierzu Regionalanalyse in Abschnitt 4.
394<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 146: Durch die Diversifizierungsförderung geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten für<br />
Personen, die nicht in landwirtschaftlichen Haushalten leben (Indikator IX.3-3.1.)<br />
Insgesamt<br />
- dav. im Bereich Landwirtschaft<br />
- dav. im Bereich Diversifizierung<br />
- dav. im Sektor Fremdenverkehr<br />
- dav. aus Handwerk/lokalen Produkten<br />
- dav. aus Verarbeitung/Vermarktung<br />
- dav. für Personen unter 30 Jahren<br />
- dav. für Frauen<br />
AKh<br />
je<br />
Förderfall a<br />
318<br />
104<br />
214<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
a<br />
n = 10 Betriebe.<br />
b<br />
Bezogen auf alle 52 <strong>bis</strong> zum 31.12.2002 geförderten Betriebe.<br />
c<br />
Siehe Fußnote c in Tabelle 145.<br />
AKh<br />
Insgesamt b<br />
16.536<br />
5.408<br />
11.128<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
FTE c<br />
je<br />
Förderfall a<br />
0,18<br />
0,06<br />
0,12<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Kosten pro erhaltenem/geschaffenen Arbeitsplatz (Indikator IX.3-1.2. und IX.3-3.2.)<br />
FTE c<br />
Insgesamt b<br />
9,19<br />
3,00<br />
6,18<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Anteil an<br />
allen AKh<br />
bzw. FTE<br />
100 %<br />
33 %<br />
67 %<br />
0 %<br />
0 %<br />
0 %<br />
0 %<br />
0 %<br />
Die Indikatoren IX.3-1.2. „Kosten pro Arbeitsplatz, der für die landwirtschaftliche Bevölkerung erhalten/geschaffen<br />
wurde“ und IX.3-3.2. „Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft tätigen<br />
Personen erhalten/geschaffen wurde“ können nicht getrennt beantwortet werden, da keine objektive Aufteilung<br />
der Kosten (Fördersumme) auf diese beiden Bereiche möglich ist. Zudem lässt sich die Zahl der im<br />
Rahmen der Maßnahme erhaltenen Arbeitsplätze nicht quantifizieren (s.o.). Aus diesem Grund bezieht<br />
sich die Diskussion der beiden Indikatoren IX.3-1.2. und IX.3-3.2. auf alle neu geschaffenen Arbeitsplätze.<br />
Demnach wurden in den <strong>bis</strong>her bewilligten 52 Projekten insgesamt 23,7 Vollzeit-Arbeitsplätze geschaffen,<br />
davon 14,5 FTE für die landwirtschaftliche Bevölkerung und 9,2 FTE für nicht in der Landwirtschaft tätige<br />
Personen. Bei einer Fördersumme von insgesamt 1,6 Mio. € ergibt dies Kosten von 65.800 € je FTE. Dieser<br />
Wert liegt zwar deutlich über den Vergleichswerten, die bei der Ex post-Evaluierung <strong>des</strong> 5b II-Programms<br />
ermittelt wurden – hier lagen die Kosten vergleichbarer Vorhaben bei rd. 36.000 € pro neu geschaffenem<br />
Vollzeit-Arbeitsplatz; 233 Bei diesem Vergleich muss jedoch berücksichtigt werden, dass im Rahmen <strong>des</strong> 5b II-<br />
Programms auch bereits existierende Diversifizierungen gefördert werden konnten. Das laufende Programm<br />
beschränkt die <strong>Förderung</strong> hingegen nur auf Neueinsteiger, was insbesondere vor dem Hintergrund <strong>des</strong> noch<br />
kurzen Abstan<strong>des</strong> zwischen <strong>Förderung</strong> und Evaluierung (volle Kosten, nur teilweise Arbeitsplatzwirkungen)<br />
zu niedrigen Effizienzwerten führt. Zudem erhöht der ausgeprägte Technikbezug bei der Mehrzahl der Investitionen<br />
(Biogas, Holzbe- und Verarbeitung, Kompostieranlagen) die Projektkosten.<br />
Zusätzliches Einkommen je neu geschaffenem Arbeitsplatz<br />
Die im Bereich der Diversifizierung zusätzlich geleistete Arbeitszeit der Familien-AK wird deutlich höher entlohnt<br />
als die parallel dazu neu eingestellten Fremd-AK. So beträgt der Arbeitsertrag je zusätzlicher haushaltseigener<br />
FTE mit 34.270 € in etwa das Doppelte <strong>des</strong> Einkommens der Fremd-FTE (vgl. Tabelle 147).<br />
Diese Disparität lässt sich folgendermaßen erklären: Das Einkommen der Fremd-AK in Höhe von<br />
17.651 €/FTE orientiert sich an den Tarifen für Beschäftigte im Bereich Landwirtschaft 234 und dient ausschließlich<br />
der Entlohnung der geleisteten Arbeit. Dagegen richtet sich die Entlohnung der familieneigenen<br />
Arbeitskräfte nach dem erzielten Unternehmensgewinn. Der höhere Einkommensbeitrag für die haushaltsei-<br />
233<br />
Bezogen auf die Maßnahmen 1 „Diversifizierung, Dienstleistung und Innovation im bäuerlichen Bereich“ sowie Maßnahme 4 „Qualitätsprodukte,<br />
Regionale Vermarktung“. Vgl. Vgl. Seibert, O., Geißendörfer, M. et al.: Ex post-Bewertung <strong>des</strong> Ziel 5b II-Programms Bayern.<br />
Triesdorf 2002, S. 64 und S. 92.<br />
234<br />
Vgl. Tarifarchiv <strong>des</strong> Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung unter<br />
http://www.tarifarchiv.de.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
genen AK dient über die Entlohnung <strong>des</strong> Arbeitsinputs hinaus auch als Gegenleistung für das Risiko, das die<br />
haushaltseigenen Arbeitskräfte als Investoren eingegangen sind. Zudem verfügen vor allem die Betriebsleiter<br />
i.d.R. über mehr Erfahrungen und Qualifikationen, was grundsätzlich eine höhere Entlohnung rechtfertigt<br />
(„Unternehmereinkommen“).<br />
Tabelle 147: Entlohnung der im Rahmen der <strong>Förderung</strong> neu geschaffenen Arbeitsplätze<br />
Entlohnung der haushaltseigenen Arbeitskräfte Entlohnung der Fremd-Arbeitskräfte<br />
Überschuss je Betrieb 10.579 €<br />
- Zinsansatz für zusätzliches Eigenkapital<br />
(58.456 € je Betrieb zu 3 %)<br />
1.052 €<br />
= Arbeitsertrag der Diversifizierungsinvestition<br />
: Zusätzliche haushaltseigene Arbeitskräfte<br />
(FTE) je Betrieb<br />
= Einkommen je zusätzlicher haushaltseigener<br />
FTE<br />
9.527 € Einkommensanteil<br />
Fremd-AK je Betrieb<br />
der<br />
0,28 FTE : Zusätzlicher Einsatz an<br />
Fremd-AK je Betrieb<br />
34.270 €/FTE = Einkommen je zusätzlicher<br />
Fremd-FTE<br />
395<br />
3.118 €<br />
0,18 FTE<br />
17.651 €/FTE<br />
Ausgleich jahreszeitlicher Schwankungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten durch die Diversifizierungsförderung<br />
(Kriterium IX.3-2.)<br />
Ein Ziel <strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms ist es, Ressourcen landwirtschaftlicher Haushalte durch den Einstieg<br />
in einen außerlandwirtschaftlichen Betriebszweig besser zu verwerten. Eine unterdurchschnittliche<br />
Auslastung der verfügbaren Arbeitskräfte besteht am ehesten in der vegetationsarmen Zeit zwischen November<br />
und Februar. Sofern das neue Erwerbsfeld <strong>des</strong>halb vor allem im Winter zusätzlichen Arbeitsinput<br />
erfordert, könnte ein besserer Ausgleich saisonal unterschiedlicher Belastungen und eine insgesamt höhere<br />
Auslastung <strong>des</strong> familieneigenen Arbeitskräftepotenzials erreicht werden.<br />
Die Auswertung der 10 abgerechneten Förderfälle ergab, dass mit 10.300 AKh bzw. 5,7 FTE rund 40 % <strong>des</strong><br />
Arbeitsinputs der Haushalte für das neue Erwerbsfeld in den Monaten November <strong>bis</strong> Februar geleistet wird<br />
(Indikator IX.3-2.1. - verändert). Folglich entfallen überdurchschnittlich viele Arbeiten im Diversifizierungsbereich<br />
auf den Zeitraum mit geringerer landwirtschaftlicher Arbeitsbelastung. Die <strong>Förderung</strong> trägt somit tendenziell<br />
zum Ausgleich saisonaler Schwankungen in der Auslastung der familieneigenen Arbeitskräfte bei.<br />
10.3.8.6 Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung von Strukturmerkmalen der Wirtschaft im<br />
ländlichen Raum (Frage IX.4)<br />
Kriterium/<br />
Indikator Nr.<br />
Kriterium/Indikator Beant-ortet Nicht beantwortet<br />
a<br />
Nicht zutreffend<br />
IX.4-1. Erhaltung/Verbesserung der mit der Landwirtschaft in Zusammenhang<br />
stehenden Produktionsstrukturen<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.4-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich auf<br />
Grund der Fördermaßnahmen Verbesserungen ergeben haben<br />
(Anz. und % der Betriebe und der ha)<br />
X<br />
IX.4-1.2. Geförderte neue/verbesserte Tätigkeiten, die mit der landwirtschaftlichen<br />
Erzeugung einschließlich der Vermarktung von<br />
landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen in Zusammenhang<br />
stehen (Beschreibung)<br />
X<br />
IX.4-1.3. Nutzung von Kapazitäten für geförderte nichtlandwirtschaftliche<br />
Einrichtungen (%)<br />
X<br />
IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspotenzial ist vor Naturkatastrophen<br />
geschützt bzw. nach Schädigung hierdurch wieder<br />
aufgebaut worden<br />
X<br />
IX.4-2.1. Anteil bedrohter Flächen, die auf Grund von Fördermaßnah- X
396<br />
men geschützt werden konnten (ha, %)<br />
IX.4-2.2. Anteil geschädigter Flächen, die auf Grund von Fördermaß-<br />
nahmen wieder regeneriert werden konnten (ha, %)<br />
IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum ist<br />
gefördert und das Potenzial für eine endogene Entwicklung im<br />
ländlichen Raum ist aktiviert worden.<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
IX.4-3.1. Hinweise auf eine verstärkte Dynamik/ein verbessertes Potenzial<br />
auf Grund der Fördermaßnahmen (Beschreibung, z. B.<br />
wichtige Netze, Finanzierungstechniken …)<br />
X<br />
IX.4-4. (n) Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten<br />
IX.4-4.1. (n) Hinweise auf Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen<br />
Gebieten (Beschreibung)<br />
a<br />
Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
Erhaltung/Verbesserung der mit der Landwirtschaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstrukturen<br />
(Kriterium IX.4-1)<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms konnten keine Investitionen im Bereich der landwirtschaftlichen<br />
Urproduktion gefördert werden. Auch indirekte Strukturwirkungen waren eher gering, mit Ausnahme der<br />
erweiterten Produktion von Biomasse zu Lasten der Marktfruchtproduktion. Da Strukturveränderungen selten<br />
monokausal zu erklären sind, wird der Einfluss der Diversifizierungsförderung auf die Produktionsstruktur<br />
frühestens zum Ende <strong>des</strong> Förderzeitraums abzuschätzen sein (Indikator IX.4-1.1.).<br />
Das zentrale Instrument <strong>des</strong> Förderprogramms ist die <strong>Förderung</strong> von nicht landwirtschaftlichen Tätigkeiten,<br />
die i.d.R. mit der landwirtschaftlichen Erzeugung in Zusammenhang stehen. Dementsprechend lassen sich<br />
auch aus den 13 im Rahmen der Intensivanalyse untersuchten Betätigungsfeldern entsprechende Zusammenhänge<br />
und Synergien erkennen (Indikator IX.4-1.2.):<br />
• Die geförderten Biogasanlagen werden ausschließlich mit Stoffen betrieben, die in landwirtschaftlichen<br />
Betrieben als Reststoffe anfallen (z.B. tierische Ausscheidungen, nicht verwertbare Futtermittelreste,<br />
Schnittgut aus Landschaftspflege) oder gezielt für die Biogasanlagen erzeugt werden (z.B. Silomais,<br />
Ganzpflanzensilage).<br />
• Ein fester Bestandteil der geförderten Pferdepensionen ist die Versorgung der Pensionstiere mit<br />
Grund- und Kraftfutter und die Entsorgung der anfallenden Reststoffe (Dünger). Bei<strong>des</strong> erfolgt über<br />
die angelagerten landwirtschaftlichen Betriebe.<br />
• In den Kompostierungsanlagen können einerseits landwirtschaftliche Reststoffe (z.B. Schnittgut aus<br />
Landschaftspflege) entsorgt werden; andererseits dienen die Flächen der landwirtschaftlichen Betriebe<br />
zur Verwertung <strong>des</strong> Komposts, falls er nicht anderweitig abgesetzt werden kann. Dies führt wiederum<br />
zu positiven Wirkungen auf den Nährstoffhaushalt und die Bodenstruktur.<br />
• Die geförderten Einrichtungen zur Holzbe- und -verarbeitung ermöglichen eine Erhöhung der Wertschöpfung<br />
aus der Holzverwertung; das Holz stammte überwiegend aus dem eigenen Betrieb.<br />
Die geförderte Diversifizierung leistet somit einen Beitrag zur Steigerung <strong>des</strong> Gewinns in den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben und aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen den Betriebszweigen auch zur Stabilisierung<br />
der Landbewirtschaftung. Dies geschieht einerseits durch Kosteneinsparungen aufgrund günstiger Entsorgungs-<br />
und Verwertungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Abfall- oder Restprodukte; andererseits lässt<br />
sich durch Diversifizierungen die Wertschöpfung aus land- und forstwirtschaftlichen Produkten und somit der<br />
Umsatz erhöhen, indem die Weiterverarbeitung und Vermarktung zumin<strong>des</strong>t <strong>bis</strong> zu einem bestimmten Grad<br />
in den eigenen Haushalt verlagert wird.<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Die 13 im Rahmen der Intensivanalyse näher untersuchten Einrichtungen waren zum Zeitpunkt der Befragung<br />
im Durchschnitt zu 55 % ausgelastet (Indikator IX.4-1.3.), wobei die Nutzungsgrade in einer Bandbreite<br />
von 10 % <strong>bis</strong> 100 % variieren. Diese noch relativ niedrige Nutzung zeigt, dass die Einkommens- und Beschäftigungspotenziale<br />
der geförderten Projekte bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Angesichts der<br />
absehbaren Steigerung der Auslastung werden künftig höhere Effizienzgrade erwartet.<br />
<strong>Förderung</strong> der Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum und Aktivierung <strong>des</strong> Potenzials<br />
für eine endogene Entwicklung (Kriterium IX.4-3)<br />
In 89 % der <strong>bis</strong>her begonnenen Förderfälle stand die <strong>Förderung</strong> einzelner landwirtschaftlicher Haushalte zur<br />
Erweiterung der Einkommensgrundlage im Vordergrund. Angesichts dieser stark einzelbetrieblich ausgerichteten<br />
Diversifizierungsförderung sind die Auswirkungen auf die regionale Wirtschaftsdynamik und die Aktivierung<br />
endogener Potenziale im ländlichen Raum eher gering. Aus den persönlichen Befragungen konnten<br />
hierzu dennoch einzelne Hinweise abgeleitet werden (Indikator IX.4-3.1). Diese überbetrieblichen Wirkungen<br />
ergeben sich in erster Linie aus Wirtschaftsbeziehungen mit anderen regionalen Akteuren und weniger aus<br />
der Einsatz integrativer oder innovativer Förderansätze oder Kommunikationsstrukturen:<br />
• Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Grüngutverwertung (Spezialhäcksler, Kompostieranlagen)<br />
arbeiten i.d.R. intensiv mit Kommunen, Landwirten und gewerblichen Unternehmen (vor allem<br />
aus den Bereich Landschaftsbau und Gärtnerei) zusammen, oftmals in Verbindung mit langfristigen<br />
Liefer- und Abnahmeverträgen;<br />
• In einem Fall führte die enge Zusammenarbeit eines geförderten mobilen Sägewerks mit anderen<br />
Sägewerken sowie einer Möbelfabrik zu einer Ausweitung der regionalen Holzverarbeitung und somit<br />
zu einer Stärkung <strong>des</strong> regionalen Wirtschaftskreislaufs;<br />
• Ein geförderter Gastronomiebetrieb kooperiert eng mit Zulieferern aus der näheren Umgebung und<br />
bildet zudem eine Station an einem 130 km langen Radwanderweg durch die Region;<br />
• Die <strong>Förderung</strong> einer Reithalle führte zu einer engen Kooperation mit einer Reitlehrerin, die zwischenzeitlich<br />
in der Halle hauptberuflich Unterricht gibt und hierfür vom Fördermittelempfänger feste Kapazitäten<br />
(Pferdeboxen, Hallennutzung) angemietet hat.<br />
Bei 6 der 52 <strong>bis</strong>her bewilligten Fälle (11 %) handelt es sich um betriebsübergreifende Projekte, an denen<br />
entweder mehrere Landwirte oder Landwirte zusammen mit Kommunen beteiligt sind. Auch diese Projekte<br />
sind primär auf die Erschließung von Einkommenspotenzialen ausgerichtet, z.B. durch Investitionen in ergänzende<br />
Fremdenverkehrangebote oder Marketingkonzepte und weniger auf die Erschließung endogener<br />
Potenziale oder integrative/innovative Entwicklungsansätze, wie sie z.B. im LEADER-Programm oder teilweise<br />
in der Dorferneuerung angewendet werden. Dennoch bilden sie Ansätze zur Aktivierung von Wirtschaftsteilnehmern<br />
und zur <strong>Förderung</strong> der regionalen Dynamik. Allerdings konnte <strong>bis</strong>her von den 6 Förderfällen<br />
noch keiner abgeschlossen werden, so dass derzeit noch keine Wirkungen nachweisbar sind.<br />
10.3.8.7 Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung der Umwelt (Frage IX.5)<br />
Kriterium.<br />
Kriterium/Indikator Beantwor- Nicht<br />
Indikator<br />
tet zutreffend<br />
IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft haben Umweltvorteile bewirkt <strong>Teil</strong>w.<br />
IX.5-1.1. Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde, insbesondere<br />
durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung<br />
der Bodenerosion (ha, %)<br />
X<br />
IX.5-1.2. Verringerte Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen auf Grund der X<br />
397
398<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Beihilfe<br />
IX.5-1.3. Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit den Bewirtschaftungsmethoden<br />
und -praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur<br />
oder der Bodennutzung in Zusammenhang stehen und auf Fördermaßnahmen<br />
zurückzuführen sind (Beschreibung)<br />
IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzung/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad<br />
von natürlichen/nicht erneuerbaren Ressourcen<br />
IX.5-2.1. Abfälle/Abwasser, die auf Grund von Fördermaßnahmen gesammelt/behandelt<br />
wurden (in % der Abfälle/Abwasser und in % der teilnehmenden<br />
landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte)<br />
IX.5-2.2. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte, die auf Grund von Fördermaßnahmen<br />
Zugang zu erneuerbaren Energien haben (%)<br />
IX.5-2.3. (n) Bessere Nutzung oder Einsparung nichterneuerbarer Ressourcen (Anzahl<br />
und Art der Projekte, die hierzu beigetragen haben, Umfang, Beschreibung)<br />
IX.5-2.4. (n) Durch die <strong>Förderung</strong> veränderter Ausstoß an CO2, NH3 und CH4 X<br />
IX.5-3. Erhaltung/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer<br />
Vielfalt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen<br />
IX.5-3.1. (n) <strong>bis</strong> Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick auf Arten-<br />
IX.5-3.5. (n) vielfalt, Landschaften, Wasser, Boden, Klima/Luft (ha)<br />
IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und -lösungen im ländlichen<br />
Raum bzw. größeres Bewusstsein hierfür<br />
IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Informationsaustausch<br />
oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätigkeiten<br />
auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können (Anz., %)<br />
Umweltvorteile durch Verbesserungen in der Landwirtschaft (Kriterium IX.5-1.)<br />
Der Einstieg in die Diversifizierung hat nur zu geringen Veränderungen in der Intensität der Landbewirtschaftung<br />
und Organisation der Betriebe geführt. Folglich lassen sich auch kaum zurechenbare Umweltwirkungen<br />
erkennen.<br />
Die Bereiche „Bodenschutz“ und „Bewässerungsinfrastrukturen“ wurden von der Diversifizierungsförderung<br />
weder direkt noch indirekt berührt, die beiden dazu gehörigen Indikatoren IX.5-1.1. und IX.5-1.2. sind <strong>des</strong>halb<br />
nicht relevant. Was Veränderungen in den Bewirtschaftungsmethoden und -praktiken sowie der ökologischen<br />
Infrastruktur oder der Bodennutzung betrifft, so lassen sich aus der <strong>bis</strong>herigen Umsetzung <strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms<br />
folgende ökologischen Effekte ableiten (Indikator IX.5-1.3.):<br />
• Der Einstieg in die Diversifizierung hat nur in einem der 10 untersuchten Fälle zu einer Reduzierung<br />
<strong>des</strong> Einsatzes an Mineraldünger geführt. Die übrigen Betriebe wirtschafteten in der Pflanzenproduktion<br />
kurzfristig auch nach der Aufnahme einer ergänzenden Unternehmertätigkeit mit unveränderter Intensität<br />
weiter.<br />
• Die Diversifizierung hat <strong>bis</strong>her nur in geringem Umfang Veränderungen in der Tierhaltung ausgelöst.<br />
Nur in einem Milchviehbetrieb wurde zu Gunsten der Biogasanlage die weibliche Nachzucht aufgegeben<br />
(Abnahme um ca. 20 GV). Da alle Betreiber von geförderten Biogasanlagen bereits vor den Investitionen<br />
über ausreichende Tierbestände oder externe Substratquellen zur vollständigen Auslastung<br />
der Anlagen verfügten, wurde die Tierhaltung nicht aufgestockt.<br />
• Ausgerichtet auf die Biogasproduktion fanden allerdings Änderungen in der Anbaustruktur statt. Um<br />
ausreichend Pflanzenmaterial mit entsprechendem Energiegehalt zu erhalten, stockten 4 Betriebe ihre<br />
Silomaisfläche um insgesamt 57 ha auf und reduzierten dafür die Getreidefläche. Welche Umweltwirkungen<br />
hiervon ausgehen, hängt von den regionalen Produktionsbedingungen ab, insbesondere von<br />
den Bodenverhältnissen, der Topographie und dem bereits erreichten Maisanteil in der Fruchtfolge.<br />
Grundsätzlich ist die Ausweitung <strong>des</strong> Silomaisanbaus als neutral <strong>bis</strong> leicht negativ einzustufen, weil<br />
eine erhöhte Gefährdung durch Bodenerosion und Stickstoffauswaschung kaum zu verhindern ist.<br />
X<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Aufbauend auf den Erfahrungen aus der 5b II-<strong>Förderung</strong> ist davon auszugehen, dass bei längerfristiger Betrachtung<br />
der Einstieg in die Diversifizierung 235 tendenziell eine Extensivierung der Landbewirtschaftung zur<br />
Folge hat und damit grundsätzlich positive ökologische Wirkungen auslöst. Dies trifft vor allem für außerlandwirtschaftliche<br />
Unternehmertätigkeiten zu, die keine direkte Verknüpfung mit der Landwirtschaft (z.B. in<br />
Form von Güterströmen) aufweisen, bei denen die Landwirtschaft vielmehr kaum oder nur qualitativ zum<br />
Gelingen der Erwerbskombination beiträgt (z.B. durch die Bereitstellung eines bäuerlichen Ambientes im<br />
Bereich „Gäste auf dem Bauernhof“). So konnte in einer früheren Untersuchung bei rund der Hälfte aller<br />
Diversifizierer mittelfristig eine Reduzierung der Agrarproduktion <strong>bis</strong> hin zur Marginalisierung festgestellt<br />
werden, was i.d.R. mit einem starken Rückgang <strong>des</strong> Einsatzes an Vorleistungen (Düngemittel, Pflanzenschutzmittel)<br />
einher ging. 236<br />
Wegen der kurzen Zeitspanne seit Beginn der Diversifizierungsförderung lassen sich ähnliche Effekte derzeit<br />
noch nicht nachweisen. Gerde in der Anlaufphase der geförderten Investitionen sind Änderungen im landwirtschaftlichen<br />
Bereich allerdings auch eher unwahrscheinlich, weil<br />
• die Landwirtschaft wegen möglicherweise auftretender Startprobleme beim Aufbau einer ergänzenden<br />
Unternehmertätigkeit zunächst der Einkommenssicherung dient;<br />
• die Haushalte die Stabilisierung bzw. einen nachhaltigen Erfolg der Diversifizierung abwarten, bevor<br />
einkommensrelevante Veränderungen der Landbewirtschaftung realisiert werden. Erst der erfolgreiche<br />
Verlauf der Diversifizierung führt dann zu deutlicheren Umschichtungen von Ressourcen aus der<br />
Landwirtschaft.<br />
Vermeidung von Verschmutzung/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürlichen/nicht erneuerbaren<br />
Ressourcen (Kriterium IX.5-2.)<br />
Die 25 geförderten Biogasanlagen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von Verschmutzungen<br />
und Emissionen sowie zur Substitution nicht erneuerbarer Ressourcen. Damit führt knapp die Hälfte der<br />
über das Diversifizierungsprogramm unterstützten Projekte zu positiven Umwelteffekten. Den übrigen Fördervorhaben<br />
ließen sich keine emissionsbezogenen Wirkungen zuordnen; sie wurden <strong>des</strong>halb als „umweltneutral“<br />
eingestuft. Folglich konzentriert sich die weitere Diskussion nur auf die geförderten Biogasanlagen.<br />
Die Intensivanalyse von 5 Biogasanlagen (persönliche Befragungen) hat ergeben, dass eine Anlage im<br />
Durchschnitt die Ausscheidungen von 122 Großvieheinheiten (GV) verarbeitet, das entspricht etwa 1.700 m³<br />
Gülle und 272 t Mist je Förderfall. Hochgerechnet auf die 25 <strong>bis</strong> Ende 2002 geförderten Biogasanlagen werden<br />
somit pro Jahr 42.000 m³ Gülle und 6.800 t Mist behandelt (Indikator IX.5-2.1.). Die Vergärung dieser<br />
tierischen Ausscheidungen zusammen mit pflanzlichen Substraten in Biogasanlagen trägt wesentlich dazu<br />
bei, umweltschädliche Emissionen in die Luft- und Wassersysteme zu vermeiden:<br />
• Die Erzeugung von Wärme und Strom in Biogasanlagen dient u.a. der Substitution von fossilen<br />
Energieträgern und hilft somit, die Freisetzung <strong>des</strong> klimaschädlichen fossil gebundenen CO2 sowie<br />
weiterer Schadstoffe (z.B. SO2, CxHy, Staub, NO, CO) zu reduzieren (Indikator IX.5-2.3. und IX.5-2.4.);<br />
• Bei offener Lagerung von Stallmist oder Gülle entweicht Stickstoff als Lachgas (N2O) und Ammoniak<br />
(NH3) sowie Methan (CH4), was durch die Speicherung und Verarbeitung der Gülle in luftdicht abgeschlossenen<br />
Biogasanlagen vollständig vermieden werden kann (Indikator IX.5-2.4.);<br />
• Die Gülle verliert durch die Behandlung in den Biogasanlagen organische Masse und wird somit dünnflüssiger,<br />
so dass sie nach der Ausbringung schneller einsickert und somit N-Verluste bei der Ausbringung<br />
und durch Abtrag im Oberflächenwasser reduziert werden;<br />
235 Bezogen auf das gesamte Spektrum der Diversifizierung, nicht allein auf die Biogasproduktion.<br />
236 Vgl. Thomas, M., Seibert, O., Geißendörfer, M.: Diversifizierung, Dienstleistung und Innovation im bäuerlichen Bereich: Entwicklungsverläufe,<br />
Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen für eine gezielte Flankierung. Triesdorf 2001, S. 27f.<br />
399
400<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• Die Vergärung tierischer Abfälle in einer Biogasanlage führt zu einer deutlichen Reduzierung der Geruchsbelastung<br />
bei deren späteren Ausbringung.<br />
Bessere Nutzung oder Einsparung nicht erneuerbarer Ressourcen (Indikator IX.5-2.3.)<br />
Die fünf intensiv untersuchten Biogasanlagen erzeugten im Durchschnitt rund 800.000 kWh Strom pro Jahr<br />
(netto). Hochgerechnet auf die <strong>bis</strong> Ende 2002 bewilligten 25 Anlagen ergibt dies nach Abschluss aller geförderten<br />
Projekte eine zusätzliche Energiemenge von min<strong>des</strong>tens 20 Mio. kWh/Jahr. 237 Dies entspricht etwa<br />
0,024 % der gesamten bayerischen Stromproduktion im Jahr 2000. Ausgehend von einem durchschnittlichen<br />
Wirkungsgrad von 35 % bei der Stromproduktion im Blockheizkraftwerk einer Biogasanlagen erzeugen<br />
die 25 Anlagen jährlich eine Brutto-Energiemenge von 57 Mio. kWh. Diese stammt zu rund 11 % aus Erdöl<br />
(6 Mio. kWh), das zugegeben werden muss, um die nötige Hitze zur Verbrennung <strong>des</strong> im Biogas enthaltenen<br />
Methan zu erzeugen (sogen. Zündöl). Die restlichen 89 % bzw. 51 Mio. kWh der eingesetzten Brutto-<br />
Energiemenge liefert die Biogasanlage in Form von Methangas. Unter der Annahme, dass diese Brutto-<br />
Energie von 51 Mio. kWh in voller Höhe zur Substitution von Steinkohle, Braunkohle, Heizöl und Erdgas bei<br />
der Stromerzeugung eingesetzt wird, ergäben sich folgende Veränderungen im Bedarf an fossilen Energieträgern<br />
(Indikator IX.5-2.3., vgl. Tabelle 148): 238<br />
• - 2.794 t Steinkohle<br />
• - 2.235 t Braunkohle<br />
• - 1.129.320 m³ Erdgas<br />
• + 311.071 Liter Heizöl.<br />
Insgesamt lassen sich somit durch die Stromlieferung der geförderten Biogasanlagen rund 42 Mio. kWh<br />
Energie aus fossilen Energieträgern einsparen. Die Aufteilung <strong>des</strong> Substitutionspotenzials auf die vier unterschiedenen<br />
fossilen Energiequellen entspricht deren tatsächlichem Anteil an der bayerischen Stromerzeugung<br />
in öffentlichen Kraftwerken im Jahr 2000. 239 Dies führt trotz <strong>des</strong> (über alle 4 substituierten Energieträger<br />
betrachteten) Netto-Einsparpotenzials von über 42 Mio. kWh dazu, dass im Rahmen der Modellrechnung<br />
gegenüber der Situation ohne Biogasproduktion 311.071 Liter Heizöl zusätzlich eingesetzt werden müssten.<br />
Grund hierfür ist der niedrige Erdöleinsatz in der bayerischen Stromproduktion von nur 5 % (bezogen auf alle<br />
fossilen Energieträger), der dazu führt, dass in der Modellrechnung die Menge <strong>des</strong> benötigten Zündöls deutlich<br />
über dem anteiligen Substitutionspotenzial <strong>des</strong> Erdöls liegt. In der Kalkulation wird zudem unterstellt,<br />
dass nur fossile Energieträger durch Biogas substituiert werden, nicht jedoch Kernenergie. Maßgebend dafür<br />
ist die Annahme, dass Atomkraftwerke, die in Bayern ca. 65 % <strong>des</strong> Strombedarfs decken, aus technischökonomischen<br />
Gründen möglichst hoch ausgelastet werden und somit in diesem Bereich eine Substitution<br />
durch alternative Energieträger eher unwahrscheinlich ist.<br />
237<br />
Die drei Anlagen zur Aufarbeitung von Holz als regenerativer Brennstoff wurden in der Kalkulation nicht berücksichtigt, da sie das<br />
Holz zwar für eine entsprechende Nutzung aufbereiten; die tatsächliche Substitution fossiler Energieträger können sie jedoch nicht<br />
unmittelbar beeinflussen. Sie schaffen nur die Voraussetzungen für eine mögliche Substitution fossiler Energieträger in der Zukunft.<br />
238<br />
Berechnet auf der Basis der Input-Struktur fossiler Energieträger zur Stromproduktion im Jahr 2000 in Bayern. Ohne Berücksichtigung<br />
der Stromproduktion aus Kernkraft.<br />
239<br />
Vgl. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Statistik und Datenverarbeitung: Statistisches Jahrbuch für Bayern 2001. München 2001, S. 226.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 148: Ermittlung <strong>des</strong> Einsparpotenzials an fossilen Energieträgern und Kohlendioxid durch<br />
die geförderten Biogasanlagen<br />
Substituierter Energieträger Steinkohle Braunkohle Heizöl Erdgas Summe<br />
Anteil an der Stromerzeugung aus fossilen<br />
Energieträgern<br />
Substitutionspotenzial (Nettoenergie)<br />
50% 24% 5% 21% 100%<br />
a<br />
(kWh) 10.038.125 4.775.361 1.004.710 4.181.805 20.000.000<br />
Durchschnittlicher Wirkungsgrad der<br />
Kraftwerke<br />
Substitutionspotenzial I (Bruttoenergie)<br />
43% 39% 35% 42%<br />
a<br />
(kWh)<br />
Abzüglich Zündölbedarf der Biogasanlage<br />
23.382.280 12.165.188 2.870.599 9.955.584 48.373.651<br />
(kWh) 6.120.000<br />
Substitutionspotenzial II (Bruttoenergie) a<br />
(kWh)<br />
23.382.280 12.165.188 -3.249.401 9.955.584 42.253.651<br />
Rohstoffmenge je kWh (brutto) 0,120 kg/kWh 0,184 kg/kWh 0,096 l/kWh 0,113 m³/kWh<br />
Einsparpotenzial 2.794.602 kg 2.234.878 kg -311.071 Liter 1.129.320 m³<br />
CO2-Gehalt je kWh (kg) 0,342 0,396 0,288 0,198<br />
CO2-Einsparpotenzial (kg) 7.990.348 4.813.564 -935.079 1.969.630 13.838.462<br />
a Bezogen auf 20 Mio. kWh erzeugten Strom.<br />
Quellen: Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Statistik und Datenverarbeitung: Statistisches Jahrbuch für Bayern 2001. München<br />
2001, S. 226, Tabelle 8; Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre" <strong>des</strong> Deutschen Bun<strong>des</strong>tages: Schlussbericht.<br />
Bonn 1994; Energiebericht 2001. Stuttgart 2001, S. 66.<br />
Durch die <strong>Förderung</strong> veränderter Ausstoß an CO2, NH3 und CH4 (Indikator IX.5-2.4.)<br />
Durch die anteilige Substitution der fossilen Energieträger Steinkohle, Braunkohle und Erdgas durch Methan<br />
aus Biogasanlagen zuzüglich geringer Mengen an Erdöl (Zündöl) kann theoretisch die Freisetzung von<br />
13.800 t klimaschädlichem (da fossil gebundenem) CO2 vermieden werden (vgl. Tabelle 10). Bei der üblicherweise<br />
offenen Lagerung von Stallmist oder Gülle entweichen zudem Stickstoff als Lachgas und Ammoniak<br />
(NH3) sowie das ebenfalls klimaschädliche Methan (CH4). Dies wird durch die Speicherung und Verarbeitung<br />
der tierischen Ausscheidungen in zwangsweise luftdicht abgeschlossenen Biogasanlagen deutlich<br />
reduziert. Damit leisten die 25 geförderten Biogasanlagen folgenden Beitrag zur Verringerung von Emissionen<br />
an NH3 und CH4 (Indikator IX.5-2.4.):<br />
• Die Stickstoffverluste bei der offenen Lagerung und Fermentierung von Gülle und Mist betragen erfahrungsgemäß<br />
rund 30 % <strong>des</strong> gesamten N-Gehaltes. Angesichts der Menge von 14 t N je Betrieb bzw.<br />
344 t N (Reinnährstoff) bezogen auf alle 25 geförderten Betriebe, welche in Form von tierischen Ausscheidungen<br />
in die Biogasanlagen eingebracht werden, lassen sich auf diese Weise insgesamt Stickstoffverluste<br />
in Höhe von ca. 100 t N in Form von NH3 und klimaschädlichem N2O vermeiden.<br />
• In den landwirtschaftlichen Betrieben mit Biogasanlagen werden die tierischen Ausscheidungen i.d.R.<br />
unmittelbar den luftdicht abgeschlossenen Biogasanlagen zugeführt und im Anschluss wird der Methananteil<br />
der Wirtschaftsdünger vollständig zu CO2 verbrannt. Die Betriebe geben damit deutlich weniger<br />
Methan aus Wirtschaftsdüngern an die Atmosphäre ab. Die Emissionen von CH4 aus Wirtschaftsdüngern<br />
(Gülle, Mist) betrugen in Bayern im Jahr 1999 rund 48.400 t 240 . Bei 3,8 Mio. in Bayern<br />
im Jahr 1999 gehaltenen Großvieheinheiten 241 entspricht dies einem Methanausstoß von rund 13 kg<br />
240 Vgl. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL): Abschlussbericht zum Projekt „Anpassung der deutschen<br />
Methodik zur rechnerischen Emissionsermittlung an internationale Richtlinien. Oktober 2001, S. E14, Tabelle 100400.2.<br />
241 Vgl. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Statistik und Datenverarbeitung: Statistisches Jahrbuch für Bayern 2001. München 2001, S. 184 und<br />
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL): Betriebsplanung Landwirtschaft 2002/2003. Darmstadt 2002, S.<br />
263.<br />
401
402<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
je GV. Da auf den untersuchten Biogasbetrieben im Schnitt die Ausscheidungen von 122 GV verarbeitet<br />
wurden, ergeben sich hieraus vermiedene Emissionen von 1,6 t klimaschädlichem CH4 je Betrieb<br />
bzw. insgesamt rund 39 t CH4, hochgerechnet auf alle 25 Biogasanlagen (insgesamt 3.042 GV).<br />
10.3.9 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen<br />
10.3.9.1 Zusammenfassung der erzielten Wirkungen<br />
Zur Halbzeitbewertung kann fest gehalten werden, dass die Diversifizierungsförderung nach Art. 33<br />
• einerseits sehr erfolgreich gewirkt und auf allen Zielebenen positive Zielbeiträge erzeugt hat,<br />
• andererseits weit weniger in Anspruch genommen wurde, als dies zu Beginn der Förderperiode geplant<br />
war.<br />
Deshalb ist kritisch zu prüfen, wie möglichst rasch eine höhere Akzeptanz geschaffen werden kann, um die<br />
positiven Programmwirkungen im ländlichen Raum vervielfältigen zu können.<br />
Soweit die wenigen Förderfälle bereits eine verlässliche Aussage zulassen, können dem Diversifizierungsprogramm<br />
positive Wirkungen auf folgenden Ebenen zugeordnet werden:<br />
(1) Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen für Mitglieder landwirtschaftlicher Haushalte und<br />
in begrenztem Umfang auch für nicht in der Landwirtschaft tätige Personen:<br />
Die geförderten Haushalte verzeichneten bereits im ersten Jahr nach Aufnahme einer ergänzenden selbständigen<br />
Beschäftigung einen Einkommenszuwachs um durchschnittlich 11.000 € pro Jahr. Darin eingerechnet<br />
ist ein leichter Rückgang <strong>des</strong> landwirtschaftlichen Einkommens. Die positiven Einkommenswirkungen<br />
der Diversifizierung dürften sich weiter erhöhen, wenn die Investitionen von der Start- in die Konsolidierungsphase<br />
übergehen. Aus regionaler Sicht wesentlich ist die Tatsache, dass auch die nicht landwirtschaftliche<br />
Bevölkerung von der <strong>Förderung</strong> profitieren konnte. Über die Beschäftigung zusätzlicher Fremdarbeitskräfte<br />
entstanden Lohneinkommen von rd. 3.000 € pro Förderfall. Folglich betrug die Einkommenswirkung<br />
der Diversifizierungsvorhaben insgesamt etwa 14.000 € pro Förderfall und Jahr.<br />
(2) Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze:<br />
Pro Förderfall wurden in unerwartet hohem Maße zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen:<br />
• im Umfang von 500 AKh bzw. 0,28 FTE für Familien-Arbeitskräfte,<br />
• im Umfang von 318 Akh (0,18 FTE) für Fremd-Arbeitskräfte.<br />
Die Beschäftigungswirkung der Diversifizierungsinvestitionen summiert sich damit auf knapp eine halbe Vollzeitstelle<br />
je Förderfall. Hochgerechnet auf alle <strong>bis</strong> Ende 2002 bewilligten Projekte entspricht dies 24 zusätzlichen<br />
Vollzeit-Arbeitsplatzäquivalenten im ländlichen Raum.<br />
(3) Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen:<br />
Trotz <strong>des</strong> Einstiegs in eine zusätzliche außerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit und der damit verbundenen<br />
Verlagerung von Ressourcen – insbesondere von Arbeitskapazität – blieb der Einkommensbeitrag der<br />
Landwirtschaft relativ stabil. Der Rückgang im ersten Jahr nach Aufnahme der Diversifizierung beziffert sich<br />
auf rd. 3.000 € und ist primär Folge der Substitution von Marktfruchtanbau durch Anbau von Biomasse für<br />
den Betrieb der Biogasanlagen. Gerade in den Betrieben mit Biogasanlagen sind größere Veränderungen im<br />
landwirtschaftlichen Betriebszweig kaum zu erwarten, weil die Landbewirtschaftung mit ihrer Stofflieferung<br />
die zentrale Basis für den Betrieb der Anlagen liefert. In den anderen Fällen dürfte dagegen die Bedeutung<br />
<strong>des</strong> landwirtschaftlichen Einkommensbeitrages längerfristig weiter zurückgehen, sofern sich die Diversifizierungstätigkeiten<br />
am Markt behaupten.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
(4) Aufrechterhaltung einer Flächen deckenden Landbewirtschaftung und Erhaltung der Kulturlandschaft:<br />
Die Ergänzung <strong>des</strong> landwirtschaftlichen Einkommensbeitrages um zusätzliches Einkommen aus Diversifizierungstätigkeiten<br />
am Betriebsstandort hat einen stabilisierenden Effekt auf die Landbewirtschaftung der geförderten<br />
Betriebe. Das gilt in besonderem Maße für die Fälle, in denen enge Synergien zwischen Landbewirtschaftung<br />
und Diversifizierungstätigkeit bestehen. Das betrifft einmal die Betriebe mit Biogasanlagen, die<br />
sowohl auf Stofflieferungen aus der Landwirtschaft als auch auf die Ausbringung der Reststoffe auf landwirtschaftlichen<br />
Flächen angewiesen sind. Es betrifft z.B. aber auch Betriebe mit Angeboten im Bereich Tourismus,<br />
Vermarktung eigener Produkte oder kommunaler Dienstleistungen. In der großen Mehrzahl der analysierten<br />
Förderfälle bildet der landwirtschaftliche Betriebszweig einen zentralen Erfolgsfaktor für die Diversifizierung,<br />
was ein wichtiges Argument für die Beibehaltung der Landbewirtschaftung darstellt.<br />
(5) Aktivierung <strong>des</strong> endogenen Potenzials im ländlichen Raum:<br />
Ein wesentliches Instrument <strong>des</strong> Diversifizierungsprogramms ist die Unterstützung der Gründung von Zweitexistenzen<br />
durch landwirtschaftliche Haushalte. Im Zuge der Planung einer Diversifizierung und der Erstellung<br />
<strong>des</strong> Business-Planes lokalisieren die Programmteilnehmer – in der Regel zusammen mit der Fachberatung<br />
- die im Haushalt, auf dem Betrieb und in der Region vorhandenen Stärken, Schwächen und Potenziale<br />
und bauen darauf ihre Geschäftsidee auf. In der anschließenden Umsetzung bilden sich neue Marktbeziehungen<br />
über den Bezug von Vorleistungen und den Absatz der Produkte. Den Erfahrungen aus der 5b II-<br />
<strong>Förderung</strong> zufolge entstehen dabei gerade im Dienstleistungsbereich (z.B. Tourismus) häufig neuartige Verflechtungen<br />
und Netzwerke mit anderen Marktteilnehmern innerhalb und außerhalb der Region. In diesem<br />
Sinne hat die Diversifizierungsförderung nicht nur die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, sondern<br />
teilweise auch die Aktivierung von Stadt-Land-Partnerschaften unterstützt und dazu beigetragen, regionale<br />
Potenziale umfassender für die Entwicklung der ländlichen Räume zu nutzen.<br />
(6) Schutz und Sicherung der Umwelt:<br />
Positive Umweltwirkungen können vor allem den geförderten Biogasanlagen zugeordnet werden: Die 25<br />
<strong>bis</strong>her geförderten Anlagen verarbeiten nach deren vollständiger Inbetriebnahme schätzungsweise<br />
42.000 m³ Gülle und 6.800 t Mist pro Jahr. Dadurch werden Emissionen im Umfang von ca. 100 t N in Form<br />
von NH3 und klimaschädlichem N2O sowie von 58.600 m³ bzw. 39 t <strong>des</strong> ebenfalls ozonschädigenden Methan<br />
(CH4) in die Atmosphäre vermieden. Die Biogaskraftwerke erzeugen zusammen ca. 20 Mio. kWh<br />
Strom, wodurch 42 Mio. kWh an konventionellen Energieträgern substituiert werden können, die bekanntlich<br />
mit individuellen Umweltproblemen behaftet sind (CO2-Freisetzung fossiler Energieträger, Sicherheits- und<br />
Entsorgungsprobleme bei Kernkraftwerken). Das Einsparpotenzial der Biogasanlagen entspricht somit umgerechnet<br />
in etwa einer Menge von 5.000 t Steinkohle, 7.800 t Braunkohle oder 4 Mio. Liter Erdöl. Würde<br />
man die zur Zeit für die Stromerzeugung in Bayern verwendeten fossilen Energieträger anteilig durch den<br />
Biogasstrom ersetzen, könnten durch die in Biogasanlagen erzeugten 51 Mio. kWh Strom rund 13.800 t bzw.<br />
7,6 Mio. m³ an CO2-Ausstoß vermieden werden. Probleme <strong>des</strong> Bodenschutzes entstehen dabei nicht, weil<br />
der Einsatz potenziell gefährdender Stoffe in Biogasanlagen (z.B. aus Fettabscheidern) untersagt ist.<br />
10.3.9.2 Empfehlungen zur Anpassung der Förderprogramms<br />
Damit die Diversifizierungsförderung nach Art. 33 vor allem unter den Aspekten „<strong>Teil</strong>nahme/Akzeptanz“ sowie<br />
„Effizienz der Umsetzung“ noch wirksamer werden kann, empfehlen die Bewerter folgende Anpassungen<br />
<strong>des</strong> Förderprogramms:<br />
(1) Bündelung von Fördermaßnahmen: Zur Zeit verteilen sich die Möglichkeiten der Investitionsförderung<br />
zur Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe auf drei Programme mit unterschiedlichen Richtlinien, Konditionen<br />
und Fördersätzen:<br />
• Investitionen im Bereich „Direktvermarktung“ müssen zum größten <strong>Teil</strong> über das Öko-Regio-<br />
Programm abgewickelt werden,<br />
403
404<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• Diversifizierungen im Tourismussektor laufen über das AFP/AKP und<br />
• nur die Investitionen, die nicht über diese beiden Bereiche gefördert werden können, kommen für die<br />
Diversifizierungsförderung nach Art. 33 in Betracht.<br />
Die Förderbereiche bzw. Programmteile sollten zu einem umfassenden Diversifizierungsprogramm zusammen<br />
gefasst werden, so wie dies im ursprünglichen Programmentwurf <strong>des</strong> Landwirtschaftsministeriums geplant<br />
war. Die Maßgabe der <strong>EU</strong>-Kommission, für jeden Spiegelstrich in Art. 33 der VO 1257/99 eine eigene<br />
Fördermaßnahme mit allen damit verbundenen Konsequenzen zu formulieren, führt zu einer kaum vertretbaren<br />
Erhöhung <strong>des</strong> Verwaltungsaufwan<strong>des</strong>. Durch Bündelung aller Fördertatbestände in nur einer Maßnahme<br />
ließen sich außerdem die Vorteile der Diversifizierung in Bezug auf Akzeptanz und Effizienz der <strong>Förderung</strong><br />
besser heraus stellen:<br />
• Höhere Transparenz der Fördermöglichkeiten und Förderkonditionen;<br />
• Vermeidung von nur schwer vermittelbaren Unterschieden in den Fördervoraussetzungen, Auflagen<br />
und Fördersätzen zwischen den <strong>Teil</strong>programmen bzw. Diversifizierungsrichtungen, somit Gewährleistung<br />
von mehr „Fördergerechtigkeit“;<br />
• Vermeidung der Gefahr von Programmüberschneidungen und<br />
• Reduzierung <strong>des</strong> aufgrund der Aufsplitterung auf drei Programme relativ hohen Verwaltungsaufwan<strong>des</strong><br />
für die Umsetzung der Fördermaßnahmen.<br />
(2) Anpassung der Fördersätze: Zur Erhöhung der Akzeptanz <strong>des</strong> Förderprogramms bei den Landwirten<br />
wird vorgeschlagen, den maximalen Fördersatz von 15 % auf 25 % der förderfähigen Gesamtkosten zu erhöhen.<br />
Wie die <strong>bis</strong>herige Inanspruchnahme <strong>des</strong> Programms zeigt und die Aussagen von potenziellen Programmteilnehmern<br />
bestätigen, reicht der Zuschuss von 15 % offensichtlich nicht in allen Fällen aus, um das<br />
mit dem Einstieg in eine Diversifizierung verbundene Risiko sowie den einzelbetrieblichen Aufwand für die<br />
<strong>Teil</strong>nahme an dem Förderprogramm auszugleichen. Zudem würde eine Angleichung an die Konditionen der<br />
landwirtschaftlichen Investitionsförderung (AFP/AKP) zu mehr Fördergerechtigkeit führen. Wie die Evaluierung<br />
der Diversifizierungsförderung gezeigt hat, leistet die Erschließung betriebsgebundener außerlandwirtschaftlicher<br />
Einkommensquellen u.a. deutliche Beschäftigungs-, Einkommens- und Umwelteffekte. Insbesondere<br />
die Wirkungen auf die regionale Beschäftigung, die Mobilisierung regionaler Potenziale und die Entlastung<br />
der Umwelt dürften umfassender sein als im Durchschnitt traditioneller Agrarinvestitionsfördermaßnahmen<br />
und rechtfertigen eine fördermäßige Gleichstellung der Diversifizierungsförderung. Wettbewerbsverzerrende<br />
Wirkungen im Vergleich zu gewerblichen Anbietern können dabei weitgehend ausgeschlossen<br />
werden, weil insbesondere die stark betrieblich gebundenen Diversifizierungstätigkeiten selten mit<br />
gewerblichen Angeboten konkurrieren.<br />
(3) Verzicht auf <strong>Förderung</strong> von Personalkosten: Bei kooperativen Vorhaben können zur Erleichterung<br />
der Startphase projektbezogene Personalkosten <strong>bis</strong> zu 3 Jahre lang degressiv gefördert werden. Dabei ist<br />
der Förderhöchstbetrag sowohl auf 30 % <strong>des</strong> gesamten Projekt-Fördervolumens als auch gleichzeitig auf<br />
maximal 102.200 € beschränkt.<br />
Aufgrund der Anwendung der de minimis-Regel durch die <strong>EU</strong>-Kommission wurde der Zuschussbetrag für<br />
je<strong>des</strong> Projekt – auch kooperative Vorhaben – auf maximal 100.000 € innerhalb von 3 Jahren begrenzt. Eine<br />
wirksame <strong>Förderung</strong> kommt somit kaum zustande, weil<br />
• vom maximalen Zuschussbetrag (100.000 €) maximal 30.000 € (30 %) für Personalkosten ausgereicht<br />
werden dürfen;<br />
• durch die Behandlung von Kooperationen wie Einzelbetriebe die ursprüngliche Förderzielsetzung<br />
konterkariert wird.<br />
(4) Differenzierung von Förderkonditionen für Biogasanlagen: Bei der Planung und Bewilligung von<br />
Biogasanlagen sollte die verwendete Motorentechnik stärker berücksichtigt werden. Aktuell bieten Zündstrahlmotoren<br />
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und werden <strong>des</strong>halb überwiegend eingesetzt.<br />
Die Motoren dieses Typs sind jedoch auf die Zugabe von Erdöl als Zündöl in Höhe von rund 10 % der<br />
Brutto-Energie angewiesen, was die ökologischen Effekte der Biogasproduktion deutlich schmälert.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Gasmotoren, die das im Biogas enthaltene Methan ohne Zündöl verbrennen, sind zwar verfügbar, haben<br />
jedoch einen um ca. 5 % niedrigeren Wirkungsgrad. Um diesen Nachteil auszugleichen wäre zu prüfen,<br />
ob der Einbau von Gasmotoren durch einen höheren Fördersatz angeregt werden könnte, um auf diese<br />
Weise das ökologische Potenzial der Biogasproduktion noch umfassender auszuschöpfen.<br />
(5) Mobilisierung: Als Maßnahme gegen den globalen anthropogenen Treibhauseffekt beschloss die Bun<strong>des</strong>regierung<br />
Ende der 80er Jahre, einer Empfehlung der Enquetekommission "Schutz der Erdatmosphäre"<br />
<strong>des</strong> Deutschen Bun<strong>des</strong>tages folgend, die nationalen CO2-Emissionen <strong>bis</strong> zum Jahr 2005 um<br />
mehr als 25 % zu senken. Die Landwirtschaft bietet angesichts vielfältiger Synergien auf stofflicher, organisatorischer<br />
und räumlicher Ebene sehr günstige Voraussetzungen für den Betrieb von Biogasanlagen<br />
und könnte zur Erreichung dieses Ziels noch deutlicher als <strong>bis</strong>her beitragen. Mit einem Min<strong>des</strong>t-<br />
Viehbestand von 100 GV kommen in Bayern rund 500 landwirtschaftliche Betriebe für eine rentable Biogas-Produktion<br />
in Betracht, die Zahl potenzieller Kooperationen kleinerer Betriebe beträgt ein Vielfaches.<br />
Durch die Schaffung von Pilotanlagen für die überbetriebliche Nutzung von Biogasanlagen, die Verbesserung<br />
technischer Serviceangebote („Coaching“ zu Projektbeginn) und eine noch umfassendere Information<br />
und Mobilisierung von Landwirten ließen sich die im Rahmen der Halbzeitbewertung aufgezeigten<br />
Einkommens-, Beschäftigung- und Umweltwirkungen um ein Vielfaches steigern.<br />
405
406<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
10.4 Schutz der Umwelt, Naturschutz und Landschaftspflege zur Sicherung <strong>des</strong> ländlichen Raumes<br />
10.4.1 Darstellung der Förderhistorie<br />
Seit 1987 werden von der EG umweltbezogene Beihilfen kofinanziert. Im Rahmen <strong>des</strong> EG-Extensivierungsprogramms<br />
gemäß VO (EWG) 4115/88 wurden zwischen 1989 und 1992 Extensivierungsverträge mit<br />
fünfjähriger Laufzeit geschlossen. Im Rahmen der Agrarreform von 1992 wurden Agrarumweltprogramme als<br />
flankierende Maßnahmen eingeführt, in der Agenda 2000 die Umweltorientierung weiter verstärkt.<br />
10.4.2 Beschreibung <strong>des</strong> Förderprogramms<br />
Problemstellung<br />
Im ländlichen Raum finden sich noch zahlreiche ökologisch wertvolle Lebensräume. Der Anteil der Naturschutzgebiete<br />
an der Lan<strong>des</strong>fläche beträgt 2,7%. Trotz vieler Initiativen, beispielsweise im Rahmen der<br />
5b-<strong>Förderung</strong> oder von LEADER II, konnte der Rückgang gefährdeter heimischer Tier- und Pflanzenarten<br />
sowie ihrer Lebensräume nur verlangsamt werden. Eine Trendumkehr ist <strong>bis</strong>her nur in Einzelfällen erreicht<br />
worden. Besonders in intensiv genutzten <strong>Teil</strong>räumen Bayerns ist der Schutz der Biodiversität weiterhin unzureichend.<br />
Das Bun<strong>des</strong>naturschutzgesetz und das Bayerische Naturschutzkonzept formulieren Ziele, Verfahren und<br />
Maßnahmen zum Naturschutz und zur Lan<strong>des</strong>pflege. Für die Umsetzung der Ziele liegen Programme und<br />
Konzepte vor. So wurde das Arten– und Biotopschutzprogramm (ABSP) Bayern fertig gestellt, das Landkreis<br />
bezogen eine Gesamtschau der Ziele und Maßnahmen <strong>des</strong> Arten- und Biotopschutzes, deren Umsetzung<br />
für die Erhaltung der Artenvielfalt notwendig ist, aufzeigt. Mit dem Landschaftspflegekonzept Bayern wurde<br />
eine umfassende Zusammenschau wesentlicher Erkenntnisse zur Pflege und Entwicklung ökologisch wertvoller<br />
Lebensräume vorgelegt. Es bildet die Grundlage zur Umsetzung <strong>des</strong> ABSP. Weitere Fachkonzepte<br />
sind die Pflege- und Entwicklungspläne für Naturschutzgebiete sowie die kommunalen Landschaftspläne.<br />
Ziele und Maßnahmen der Fachkonzepte lassen sich erfolgreich umsetzen, wenn die von den Grundstückseigentümern,<br />
Naturschutz- und Landschaftspflegeverbänden erbrachten Leistungen angemessen honoriert<br />
werden. Dazu stehen Fördermöglichkeiten der Naturschutz-. und Landwirtschaftsverwaltung zur Verfügung.<br />
Es sind dies:<br />
• das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm (VNP);<br />
• der Erschwernisausgleich;<br />
• das Landschaftspflegeprogramm;<br />
• das Programm zur <strong>Förderung</strong> der Naturparke;<br />
• die Stiftung Bayerischer Naturschutzfonds;<br />
• das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (Kulap).<br />
Durch den Einsatz von Naturschutzfördermitteln sollen im Interesse <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege<br />
die Leistungen der Landwirte angemessen honoriert werden.<br />
Förderstrategie<br />
Maßnahmen <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege tragen zur biologischen Diversität bei und sind in<br />
intensiv genutzten Agrargebieten für die ökologische Stabilität unverzichtbar. Mit der Ausführung der Maßnahmen<br />
sollen nach Möglichkeit landwirtschaftliche Betriebe beauftragt werden. Dies schafft zusätzliche<br />
Erwerbsmöglichkeiten für Landwirte in der Landschaftspflege. Zudem kann die Attraktivität der Landschaft<br />
verbessert werden. Dies wirkt sich indirekt positiv auf weitere Zuerwerbsquellen aus, z.B. im Bereich Urlaub<br />
auf dem Bauernhof. Ferner ist damit ein erheblicher Imagegewinn für die Landwirtschaft verbunden.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Förderinhalte<br />
Die nachhaltige Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raums ist an einen intakten Naturhaushalt und ein intaktes<br />
Landschaftsbild gebunden. Förderfähig sind Maßnahmen, die folgende Zielrichtungen verfolgen:<br />
• Aufbau <strong>des</strong> Biotopverbunds Bayern;<br />
• Stabilisierung <strong>des</strong> Naturhaushauhaltes insbesondere in Gebieten mit intensiver landwirtschaftlicher<br />
Nutzung durch landschaftspflegerische Maßnahmen zur Erhaltung und Neuschaffung von Lebensräumen;<br />
• Sicherung traditioneller Landschaftsbilder;<br />
• Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten für Land- und Forstwirte im Bereich<br />
<strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege;<br />
• Erarbeitung und Umsetzung von Entwicklungsplänen, Landschaftsplänen sowie Fachkonzepten,<br />
durch welche die Attraktivität <strong>des</strong> ländlichen Raumes gestärkt und die Umweltbedingungen im Interesse<br />
einer nachhaltigen Entwicklung verbessert werden.<br />
Umsetzungsvorhaben mit investivem Charakter werden nach den Landschaftspflege-Richtlinien, Naturpark-<br />
Richtlinien und den Bayerischen Naturschutzfond-Richtlinien gefördert. Der Fördersatz beträgt <strong>bis</strong> zu 70%<br />
der förderfähigen Gesamtkosten und in begründeten Ausnahmefällen <strong>bis</strong> zu 90%. In die <strong>Förderung</strong> mit einbezogen<br />
werden auch die Kosten zur Vorbereitung, Betreuung und Abwicklung der Maßnahmen.<br />
Förderfähige Maßnahmen nach den Landschaftspflege-Richtlinien 242 und Naturpark-Richtlinien 243 sind:<br />
• Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Lebensräumen und Standortbedingungen gefährdeter<br />
Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensgemeinschaften sowie sonstiger ökologisch wertvoller<br />
Bereiche;<br />
• Maßnahmen zum Erhalt von Standorten geschützter Pflanzenarten und von Lebensräumen geschützter<br />
Tierarten;<br />
• Maßnahmen zum Erhalt <strong>des</strong> Landschaftsbil<strong>des</strong>;<br />
• Anlage von Schutz und Sicherungseinrichtungen;<br />
• Anlage von Nist-, Brut- und Laichplätzen sowie von Wohn- und Zufluchtstätten für geschützte Tierarten;<br />
• Anlage von Landschaftsbestandteilen in ökologisch verarmten Gebieten;<br />
• Renaturierung von ursprünglich wertvollen Lebensräumen;<br />
• Grunderwerb für die Anlage von Landschaftsbestandteilen in ökologisch verarmten Gebieten;<br />
• naturschutzfachliche Planungen und Konzepte zur Entwicklung ökologisch wertvoller Gebiete und zur<br />
Sicherung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.<br />
Förderfähige Maßnahmen nach den Richtlinien <strong>des</strong> Bayerischen Naturschutzfonds 244 sind:<br />
• Maßnahmen für den Aufbau <strong>des</strong> lan<strong>des</strong>weiten Biotopverbun<strong>des</strong>, beispielsweise Erwerb und Pacht<br />
von Flächen;<br />
• Projektbezogene Naturschutzmaßnahmen, beispielsweise Renaturierung von Gewässern von gestörten<br />
schutzwürdigen Lebensräumen und Neuschaffung überörtlich bedeutsamer Lebensräume;<br />
• Betreuungs- und Managementaufgaben bei der Umsetzung der Managementpläne in ökologisch<br />
hochrangigen Gebieten (Anschubfinanzierung);<br />
• Evaluation, Effizienzkontrollen, Fachplanungen und Konzepte mit lan<strong>des</strong>weiten Bezug;<br />
• Maßnahmen zur <strong>Förderung</strong> der Akzeptanz von Naturschutzprojekten.<br />
242<br />
Bekanntmachung <strong>des</strong> Bayerischen Staatsministeriums für Lan<strong>des</strong>entwicklung und Umweltfragen vom 23. März 1983 Nr. 7311-95-<br />
4565.<br />
243<br />
Bekanntmachung <strong>des</strong> Bayerischen Staatsministeriums für Lan<strong>des</strong>entwicklung und Umweltfragen vom 18. Dezember 1981 Nr. 7441-<br />
933-845.<br />
244<br />
Förderrichtlinien <strong>des</strong> Bayerischen Naturschutzfonds vom 01. Juli 1999.<br />
407
408<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Kohärenz<br />
Der Programmteil „Schutz der Umwelt, Naturschutz und Landschaftspflege“ leistet einen Beitrag zur Realisierung<br />
der allgemeinen Zielen der EAGFL-Verordnung:<br />
• Erhaltung der Kulturlandschaft: Es werden Maßnahmen, die zum Erhalt charakteristischer Elemente<br />
der Kulturlandschaft beitragen, gefördert, beispielsweise durch die Entbuschung von Trockenrasen;<br />
• Die Maßnahmen fördern Flächen mit extensiver Bewirtschaftung. Dies schont die biotischen und abiotischen<br />
Ressourcen.<br />
• Durch den Erhalt und die Neuschaffung ökologisch wertvoller Landschaftsbestandteile wird die Strukturdiversität<br />
der Landschaft gefördert. Diese Aufwertung <strong>des</strong> Landschaftsbil<strong>des</strong> fördert die Nutzung<br />
endogener Entwicklungspotenziale, z.B. über den Landtourismus.<br />
• Verbesserung der ökologischen Tragfähigkeit: Die geförderten Maßnahmen können zum Erhalt der<br />
Biodiversität beitragen.<br />
• Verbesserung der ökonomischen Tragfähigkeit: Die Landwirte werden für landschaftspflegerische<br />
Maßnahmen entlohnt.<br />
Operationelle Ziele<br />
Gemäß Anlage 3 zur VO 1257/99 wird die Neuschaffung und Verbesserung von Lebensräumen für gefährdete<br />
Tier- und Pflanzenarten in rund 3.000 Biotopen pro Jahr angestrebt. Weiterführende Zielsetzungen<br />
werden im EPLR nicht genannt.<br />
10.4.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext<br />
Beziehungen bestehen zu den nach Art. 16 der VO 1257/99 geförderten Gebieten mit umweltspezifischen<br />
Einschränkungen (Natura 2000-Gebiete) und den Agrarumweltmaßnahmen nach Art. 22 – 24 (Bayerisches<br />
Kulturlandschaftsprogramm und Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm). Eine Überlappung mit diesen<br />
Maßnahmen ist jedoch ausgeschlossen, da im Rahmen der genannten Maßnahmen jährlich wiederkehrende,<br />
flächenbezogene Prämien geleistet werden, während die <strong>Förderung</strong> von Maßnahmen zum Schutz der<br />
Umwelt, <strong>des</strong> Naturschutz und der Landschaftspflege in der Regel einmalige Biotop-neuschaffende oder<br />
erhaltende Maßnahmen mit investivem Charakter betrifft. Allerdings kann und sollte die (spätere) nachhaltige<br />
Pflege und Erhaltung der nach Art. 33 Tiret 11 geschaffenen Biotope mit Maßnahmen nach Art. 16 oder<br />
Art. 22 – 24 durchgeführt werden.<br />
Eine Kombination mit anderen Förderprogrammen fand nicht statt.<br />
10.4.4 Methodischer Ansatz<br />
10.4.4.1 Auswahl der Zufallsstichprobe<br />
Grundgesamtheit für die Datenerhebung bilden die Auszahlungslisten, welche die Höheren Naturschutzbehörden<br />
(HNB) an die Bayerische Staatsregierung melden. Sie umfassten zum Stichtag 31.12.2002 insgesamt<br />
847 Fördervorhaben. Die Listen enthalten Angaben zur Art der Maßnahme, zum Träger, zur Gesamtauszahlungssumme<br />
und zum <strong>EU</strong>-Kofinanzierungsanteil an der Gesamtauszahlungssumme.<br />
Aus der Gesamtzahl der 847 Maßnahmen wurde ein Zufallsstichprobe von 155 Maßnahmen (18,3 %) gezogen.<br />
Dabei erfolgte ein Schichtung nach Regierungsbezirken, nach dem EAGFL-Anteil an der Auszahlungssumme<br />
und nach der Art der Maßnahmen. Anders als im ursprünglichen Konzept vorgesehen, wurde die<br />
Stichprobe nicht nach Landkreisen stratifiziert. Zum einen ist nicht in allen Regierungsbezirken aus den Auszahlungslisten<br />
der Landkreis ersichtlich, zum anderen gibt es auch, vor allem bei der Naturparkförderung,<br />
landkreisübergreifende Maßnahmen. Da alle relevanten Akten zur Beurteilung <strong>des</strong> Programms zumin<strong>des</strong>t in
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Kopie auch an den Höheren Naturschutzbehörden der Bezirksregierungen vorliegen, war diese Auswahl<br />
nach Landkreisen nicht mehr notwendig. Durch die zentrale Datenhaltung konnten auch so alle Landkreise<br />
in die Evaluierung einfließen.<br />
10.4.4.2 Analyse der Daten<br />
Die Fragen zur finanziellen Umsetzung <strong>des</strong> Programms können aus der Gesamtzahl der Fälle in den Auszahlungslisten<br />
der Bayerischen Staatsregierung beantwortet werden. Für die anderen Fragen wurde ein<br />
Fragebogen entwickelt, in dem weitere Daten zu den Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren erhoben<br />
wurden. Diese Fragebögen wurden vom Bewerter an den 7 Höheren Naturschutzbehörden nach Einsicht in<br />
die Akten <strong>des</strong> Vorgangs ausgefüllt.<br />
Anders als im ursprünglichen Konzept vorgesehen, wurden Fragen, die sich nicht aus den Akten an den<br />
HNB beantworten ließen, nicht über weitere Fragebögen, sondern durch Telefoninterviews mit den Ansprechpartnern<br />
der jeweiligen Maßnahme bei den Trägern beantwortet. Diese Ansprechpartner sind durchweg<br />
in den Akten bei den HNB verzeichnet. Durch die Telefoninterviews erübrigte sich eine weitere Qualitätskontrolle<br />
der Fragebögen durch persönliche Gespräche mit Vertretern der Maßnahmenträger, die ursprünglich<br />
zur Absicherung der schriftlichen Erhebungen vorgesehen war.<br />
Fragen, die sich nicht aus den Akten an den HNB beantworten ließen, betrafen vor allem Angaben zur Alters-<br />
und Geschlechtsstruktur der Begünstigten. Diese sind zum <strong>Teil</strong> auch nicht auf einzelne Maßnahmen<br />
bezogen zu beantworten, wenn diese z.B. von einem Maschinenring durchgeführt wurden. Welche Person<br />
die Maßnahme durchgeführt hat, ist in solchen Fällen oft nicht mehr zu recherchieren. Daher werden die<br />
Fragen zur Alters- und Geschlechtsstruktur aufgrund der Interviews mit den Ansprechpartnern der Träger<br />
(meist Landschaftspflegeverband und Untere Naturschutzbehörde) beantwortet.<br />
10.4.4.3 Indirekte Erfassung von Daten<br />
Die Angaben in den Zuwendungsbescheiden und Verwendungsnachweisen der einzelnen Maßnahmen sind<br />
sehr unterschiedlich. Nicht immer sind Umsatzanteile, Arbeitsstunden und betroffene Flächengrößen für<br />
einzelne <strong>Teil</strong>arbeiten angegeben. Zum <strong>Teil</strong> werden beispielsweise nur Pauschalsumme und Beschreibungen<br />
der einzelnen <strong>Teil</strong>arbeiten ohne Angaben von Umsatzanteilen angegeben. In diesen Fällen wurde versucht,<br />
aus den vorhandenen Daten und ortsüblichen Pauschalsätzen die fehlenden Daten zu schätzen. Wenn beispielsweise<br />
für die Erstmahd einer Wiesenbrache nur der Gesamtbetrag, nicht aber die Größe der betroffenen<br />
Fläche zur Verfügung stand, wurde die Fläche aus dem Gesamtbetrag mit Hilfe der Pauschalsätze je ha<br />
geschätzt. Auf dem gleiche Weg kann aus der bearbeiteten Fläche die Arbeitszeit abgeleitet werden.<br />
Für den Einzelfall führt diese Schätzung zwar zu Abweichungen von den tatsächlichen Werten, da es einfacher<br />
und schwieriger zu bearbeitende Flächen gibt. Für die vorliegende Bewertung ist jedoch nur ein Mittelwert<br />
für ganz Bayern relevant, der auf dem beschriebenen Weg erhalten werden kann. Grundlage für diese<br />
ergänzenden Kalkulationen bilden die „Kostendatei für Maßnahmen <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege“<br />
<strong>des</strong> Bayerischen LfU (1998), die „Verrechnungssätze für Landschaftspflegearbeiten“ <strong>des</strong><br />
Landschaftspflegeverbands Mittelfranken sowie die aus den Akten erhobenen Daten.<br />
In vereinzelten Fällen ist die eben beschriebene Umrechnung und Vervollständigung der Daten allerdings<br />
nicht möglich, da die Maßnahmen mitunter sehr heterogen sind und in den Förderakten keine Aufschlüsselung<br />
in Honorar- und Sachumsatzanteile erfolgt. Bei der Beantwortung einzelner Bewertungsfragen wird<br />
<strong>des</strong>halb nicht immer der volle Stichprobenumfang von 155 Fällen erreicht. Der tatsächliche Stichprobenumfang<br />
entspricht der Zahl der für jede Bewertungsfrage vorliegenden validen Datensätze.<br />
409
410<br />
10.4.5 Finanzielle Umsetzung <strong>des</strong> Programms<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Zum Stichtag 31.10.2002 (Ende <strong>EU</strong>-Haushaltsjahr 2002) hinkte die Realisierung der Maßnahme weit hinter<br />
dem ursprünglichen Plan hinterher. Nachdem im Jahr 2000 nur 31% und im Jahr 2001 sogar nur 24% der<br />
ursprünglich geplanten Mittel ausbezahlt wurden, erfolgte im Rahmen <strong>des</strong> zweiten Antrags auf Änderung<br />
<strong>des</strong> Indikativen Gesamtfinanzierungsplans vom 25.1.2002 eine rückwirkende Anpassung der Planwerte an<br />
die Ist-Werte für den Zeitraum 2000-2001. Im Gegenzug wurden die Planwerte für den Zeitraum von 2003<br />
<strong>bis</strong> 2006 leicht angehoben. Die Planwerte für 2002 blieben unverändert, weil zum Zeitpunkt <strong>des</strong> Änderungsantrages<br />
deren Realisierung für grundsätzlich möglich eingeschätzt wurde. Tatsächlich konnte das Ausgaben-Soll<br />
<strong>bis</strong> Ende <strong>des</strong> Jahres 2002 jedoch nur zu 58% erreicht werden. Hauptgrund für die schleppende<br />
Umsetzung ist zur Zeit die angespannte Haushaltslage vieler Kommunen, die es ihnen schwer macht, den<br />
Eigenanteil von i.d.R. 30% der Gesamtsumme zu tragen. Diese Situation war 1999 nicht vorhersehbar. Es<br />
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Situation noch weiter verschärfen wird.<br />
Als Folge der Änderungen <strong>des</strong> Finanzierungsplans reduzieren sich die geplanten Ausgaben im Bereich<br />
„Umwelt, Naturschutz und Landschaftspflege“ (Art. 33 Tiret 11) von ursprünglich 130,90 Mio.€ auf<br />
111,80 Mio.€.<br />
Tabelle 149: Maßnahme „Umwelt, Naturschutz- und Landschaftspflege“ (Art. 33 Tiret 11): Umfang<br />
und Realisierung im Verhältnis zu den Programmzielen<br />
Öffentliche Ausgaben davon <strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Zeitraum Plan ausbezahlt % Plan ausbezahlt %<br />
2000 16,88 5,30 31% 8,44 2,65 31%<br />
2001 17,90 4,38 24% 8,95 2,19 24%<br />
2002 18,40 10,71 58% 9,20 5,26 57%<br />
2000-2002 53,18 20,39 38% 26,59 10,10 38%<br />
2003 19,92 9,96<br />
2004 20,12 10,06<br />
2005 21,34 10,67<br />
2006 22,34 11,17<br />
2000-2006 136,90 20,39 15% 68,45 10,10 15%<br />
Für die zunächst nur zögerliche Programmumsetzung waren mehrere Gründe verantwortlich, die sich auf<br />
Landkreisebene unterscheiden:<br />
• Anfangsschwierigkeiten bei der Umsetzung eines neuen Programms führen häufig zu verzögerter<br />
Umsetzung, da das Programm erst publik gemacht werden muss und die Verfahrensabläufe optimiert<br />
werden müssen. So ist man dazu übergegangen, statt der Bearbeitung von Einzelanträgen Sammelanträge<br />
zusammen gehörender Einzelmaßnahmen zu bearbeiten und zu bewilligen, was die Abwicklung<br />
deutlich beschleunigt.<br />
• Aufgrund aktueller Schadensereignisse wurde der präventive Hochwasserschutz vor allem im Jahr<br />
2001 mit Mitteln der Maßnahme „Naturschutz und Landschaftspflege“ verstärkt; entsprechend weniger<br />
Mittel standen für die eigentlichen Programmzwecke zur Verfügung. Der Umfang der Mittelumschichtungen<br />
betrug etwa 10 Mio. €.<br />
• Viele Landschaftspflegemaßnahmen, für die ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt und genehmigt<br />
wurde, konnten witterungsbedingt noch nicht umgesetzt werden.<br />
• Vereinzelt wurden Maßnahmen wegen schleppend eingereichter Verwendungsnachweise der Landschaftspflegeverbände<br />
noch nicht abgerechnet.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• <strong>Teil</strong>weise wurde zu wenig dazu angeregt, von der angebotenen <strong>Förderung</strong> Gebrauch zu machen.<br />
Abbildung 57: Zeitliche Entwicklung der finanziellen Umsetzung <strong>des</strong> Programms a<br />
Mio. €<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
2000 2001 2002 00-02 2003 2004 2005 2006<br />
Plan 16,88 17,90 18,40 53,18 19,92 20,12 21,34 22,34<br />
Ist 5,30 4,38 10,71 20,39<br />
Jahr<br />
a Plan 2000 und 2001 gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999 vom 7. Mai 1999. Der Plan wurde gemäß 2. Antrag auf Änderung<br />
<strong>des</strong> Indikativen Gesamtfinanzierungsplan vom 25.1.2002 auf die Ist-Werte korrigiert und die Planwerte für 2003 <strong>bis</strong> 2006<br />
wurden leicht angehoben. Die Planwerte für 2003 <strong>bis</strong> 2006 entsprechen dem 2. Antrag auf Änderung <strong>des</strong> Indikativen<br />
Gesamtfinanzierungsplan vom 25.1.2002. Das Gesamtfördervolumen wurde durch diesen Antrag von 130,90 Mio.€ auf<br />
111,80 Mio.€ reduziert<br />
• Aufgrund der prekären Haushaltssituation, insbesondere der Kommunen, werden Anträge nicht gestellt,<br />
wenn die nationale Kofinanzierung nicht gesichert ist. Aber auch die Bezirksregierungen sind<br />
momentan teilweise nicht in der Lage, bewilligte und bereits abgeschlossene und abgerechnete Vorhaben<br />
an die Landschaftspflegeverbände auszuzahlen. Diese müssen, um ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtungen<br />
an die Endbegünstigten nachkommen zu können, die ausstehenden Beträge<br />
teilweise mit Krediten zwischenfinanzieren.<br />
• Der Verwaltungs- und Kontrollaufwand bei <strong>EU</strong>-kofinanzierten Projekten ist verhältnismäßig hoch. Dadurch<br />
werden potenzielle Antragsteller wenig motiviert, sich um die Mittel zu bemühen. Es sollte darauf<br />
hin gewirkt werden, dass verstärkt und bevorzugt größere Projekte abgewickelt werden, bei denen<br />
der Verwaltungsaufwand im Verhältnis zur <strong>Förderung</strong> deutlich geringer ist. Die Bagatellgrenze der<br />
Landschaftspflege-Richtlinie von 500 DM (ca. 250 €) bzw. 3.000 DM (ca. 1.500 €) bei kommunalen<br />
Körperschaften ist hier recht niedrig angesetzt. Allerdings kann die Anhebung der Bagatellgrenzen<br />
zum Rückgang wichtiger Kleinmaßnahmen oder zur Kostensteigerung führen. Es wäre angemessen<br />
den Verwaltungsaufwand für kleine Strukturen zu erniedrigen.<br />
10.4.6 Darstellung und Analyse <strong>des</strong> <strong>bis</strong>her erzielten Outputs<br />
Die durchgeführten Maßnahmen können fünf Oberzielen zugeordnet werden (vgl. Tabelle 150). Der Hauptanteil<br />
der Maßnahmen diente dem Ziel der Pflege und <strong>des</strong> Erhalts bestehender Biotope, gefolgt von der<br />
411
412<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Biotop-Neuanlage. Den geringsten Anteil haben Maßnahmen, die allein den Erhalt <strong>des</strong> charakteristischen<br />
Landschaftsbil<strong>des</strong> zum Ziel haben. Die Ausarbeitung naturschutzfachlicher Planungen und Konzepte zur<br />
Vorbereitung von Landschaftspflegemaßnahmen, die verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und<br />
-lösungen liefern sollen, umfassen 12% der Maßnahmen.<br />
Tabelle 150: Ziel der Maßnahmen<br />
Maßnahmenziel Anteil (%)<br />
A Pflege, Erhaltung und Entwicklung naturnaher Lebensräume 42<br />
B Schaffung ökologisch wertvoller Bereiche, insbesondere in ökologisch veramten Gebieten 32<br />
C Renaturierung ursprünglich ökologisch wertvoller Lebensräume (z.B. begradigte Gewässer,<br />
abgebaute Moore) 10<br />
D Erhalt <strong>des</strong> charakteristischen Landschaftsbil<strong>des</strong> 3<br />
E Ausarbeitung naturschutzfachlicher Planungen und Konzepte zur Vorbereitung von Landschaftspflegemaßnahmen<br />
12<br />
Die Art der durchgeführten Maßnahmen lässt sich in 7 Kategorien zusammen fassen (vgl. Tabelle 151). Am<br />
häufigsten wurden Entbuschungen und Freistellungen zum Erhalt brach gefallener Trockenrasen oder Moorflächen<br />
durchgeführt. Die Pflanzung von Bäumen und Gehölzen steht an 2. Stelle. Erdarbeiten zur Schaffung<br />
neuer Biotope (Streuobstwiesen, Hecken, Feuchtbiotope) nehmen den dritten Rang ein.<br />
Tabelle 151: Art der Maßnahmen<br />
Maßnahme Anteil (%) Maßnahme Anteil (%)<br />
Entbuschen/Freistellen 28<br />
Pflanzung von Bäumen/Gehölzen 21 Öffentlichkeitsarbeit 3<br />
Erdarbeiten 15 Sonstige 2<br />
Erstmahd einer Brache 10 Kauf Amphibienschutzzaun 2<br />
Gutachten 8 Grunderwerb 1<br />
Artenschutzmassnahme 8 Kauf Weidezaun 1<br />
Regionale Verteilung<br />
Die regionale Verteilung unterscheidet sich stark, je nachdem ob das Fördervolumen oder die Anzahl der<br />
durchgeführten Maßnahmen betrachtet wird (vgl. Abbildung 58). Das hängt damit zusammen, dass regional<br />
unterschiedliche Maßnahmen mit unterschiedlichem Mittelbedarf zur Anwendung kommen.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Abbildung 58: Regionale Verteilung der Fördermaßnahmen:<br />
… nach Fördervolumen …. nach der Anzahl der Maßnahmen<br />
Ofr<br />
Mf r<br />
Opf<br />
Uf r<br />
Sch<br />
Ndb<br />
Obb<br />
Gemessen am Fördervolumen floss das meiste Geld nach Niederbayern und Oberbayern. Diese Bezirke<br />
sind flächenmäßig die beiden größten in Bayern. Hier liegen auch die großen bayerischen Naturschutzgebiete<br />
und Nationalparks (71% der NSG und NP-Flächen). Bei der Anzahl der geförderten Fälle fällt Mittelfranken<br />
auf, wo im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln eine große Anzahl von Maßnahmen durchgeführt ist.<br />
In diesem Regierungsbezirk ist ein großer, zentraler Landschaftspflegeverband aktiv, anstelle von zahlreichen<br />
kleinen dezentralen Verbänden. Er führt überwiegend kleinere, weniger kostenintensive Maßnahmen<br />
durch.<br />
Abbildung 59: Nationalparks und Landschaftsschutzgebiete in Bayern<br />
Mf r<br />
Ufr<br />
Sch<br />
Ofr<br />
Obb<br />
Ndb<br />
413<br />
Schwaben hat, gemessen an beiden Indikatoren, einen<br />
relativ geringen Anteil an den <strong>bis</strong>her gebundenen Fördermitteln.<br />
In diesem Regierungsbezirk hat sich witterungsbedingt<br />
die Umsetzung <strong>des</strong> Programms verzögert.<br />
73 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von<br />
288.000 € sind dort zur Zeit beantragt, aber noch nicht<br />
ausbezahlt und <strong>des</strong>halb in den Auszahlungslisten noch<br />
nicht erfasst.<br />
Erreichung der gesetzten Ziele<br />
Angestrebt war die Neuschaffung und Verbesserung<br />
von Lebensräumen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten<br />
in rd. 3.000 Biotopen pro Jahr (vgl. Anlage 3 zum<br />
EPLR). Zur Überprüfung <strong>des</strong> Realisierungsgra<strong>des</strong> wurde<br />
die „Anzahl der pro Jahr geschaffenen bzw. erhaltenen<br />
Biotope“ als die „Anzahl der Maßnahmen<br />
(=Verträge) definiert, welche die Biotoppflege bzw.<br />
-erhaltung als Ziel haben“. Dies ist notwendig, da eine<br />
Definition über Einzelbiotope nicht ohne gewisse Willkürlichkeiten<br />
geschehen kann. Ist z.B. ein Röhricht mit<br />
Opf
414<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
angrenzender Nasswiese ein Biotop oder sind es zwei Biotope? Objektive Entscheidungskriterien kann es<br />
diesbezüglich nicht geben. Zudem lässt sich die Anzahl der Verträge relativ problemlos anhand der Auszahlungslisten<br />
(Förderstatistik) ermitteln.<br />
Nach der oben genannten Definition können alle durchgeführten Maßnahmen als neu geschaffenes oder<br />
verbessertes Biotop gezählt werden, da alle Maßnahmen nach der Lan<strong>des</strong>pflege- bzw. Naturschutzfonds-<br />
Richtlinie genehmigt wurden, die dies zum Ziel hat. Abweichungen wurden bei der Evaluierung in keinem<br />
Fall festgestellt.<br />
Realisiert wurden im Zeitraum 2000 <strong>bis</strong> 2002 allerdings nur durchschnittlich 1.300 Maßnahmen. Das entspricht<br />
rd. 44 % der Planvorgaben und größenordnungsmäßig auch dem finanziellen Umsetzungsgrad (vgl.<br />
Abschnitt 10.4.5).<br />
Es wäre zwar wünschenswert, statt der reinen Anzahl auch die Größe und Qualität der Biotope zu berücksichtigen.<br />
Dabei ergibt sich aber einerseits das Problem, dass Größe und Qualität miteinander verrechnet<br />
werden müssten, was ohne willkürlich festzulegende Umrechnungsfaktoren nicht möglich ist; andererseits<br />
sind die Angaben zu Größe und v.a. Qualität der Biotope nach Aktenlage nicht zu erheben. Eine vor Ort-<br />
Beurteilung ist bei der großen Anzahl der Einzelmaßnahmen aber nicht möglich.<br />
10.4.7 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung<br />
Publizität der Fördermöglichkeiten<br />
Das Programm „Umwelt, Naturschutz und Landschaftspflege wird zusammen mit den anderen strukturpolitischen<br />
Förderprogrammen in der Broschüre „Programm 2000 - Leistungen für Land und Leute“ vorgestellt. 245<br />
Die Informationsschrift enthält eine Übersicht über Ziele, Fördervoraussetzungen, Förderinhalte und Förderhöchstbeträge.<br />
Sie liegt an den Landwirtschaftsämtern aus und kann zudem über das Internet bezogen werden.<br />
Der weitaus größte <strong>Teil</strong> der Anträge wird von Landschaftspflegeverbänden (LPfV) und Naturparkverwaltungen<br />
(NP) gestellt (Abbildung 60). Die Verteilung der Mittel zeigt ein ganz ähnliches Bild. An zweiter Stelle<br />
folgen die Unteren Naturschutzbehörden (UNB).<br />
Vereine und Organisationen, die sich satzungemäß dem Naturschutz und der Landschaftspflege widmen,<br />
vor allem der Bund Naturschutz in Bayern e.V. und der Lan<strong>des</strong>bund für Vogelschutz e.V., erscheinen in dieser<br />
Auswertung optisch unterrepräsentiert, da sie meist (aus fördertechnischen Gründen) mit den Landschaftspflegeverbänden<br />
zusammen arbeiten und dann selbst nicht in der Statistik erscheinen. In Wirklichkeit<br />
sind sie an einer großen Zahl von Maßnahmen beteiligt.<br />
Nur vereinzelt haben Privatpersonen, die HNB und freiberufliche Gutachter von der Fördermöglichkeit direkt<br />
Gebrauch gemacht. Sie hatten zwar grundsätzlich den gleichen Zugang zur <strong>Förderung</strong> wie die anderen Träger<br />
auch, Hindernis ist hier aber vor allem der Eigenanteil von 30%, den der Träger selbst leisten muss. Da<br />
in der Regel kein Eigeninteresse an der Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen besteht, werden<br />
dann keine Anträge gestellt, wenn dem Antragsteller Kosten entstehen.<br />
245 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten: Programm 2000 - Leistungen für Land und Leute, S. 15.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Abbildung 60: Anteil der Trägertypen an der Gesamtzahl der Maßnahmen<br />
UNB<br />
Vereine<br />
priv<br />
HNB<br />
LPfV/NP<br />
Büro<br />
Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung<br />
Die Antragstellung erfolgt über die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) an die Höhere Naturschutzbehörde.<br />
Die Fachbearbeiter der UNB erstellen eine fachliche Stellungnahme über die naturschutzfachliche Einschätzung<br />
der Maßnahme. Die HNB prüft, ob die Maßnahme der Landschaftspflege-Richtlinie bzw. der Naturparkrichtlinie<br />
entspricht und stellt dann einen Vorläufigen Genehmigungsbescheid aus.<br />
Kriterien der Zuschussfähigkeit<br />
Die Anträge werden nach naturschutzfachlichen Kriterien gemäß der Landschaftspflege-Richtlinie und der<br />
Naturpark-Richtlinie beurteilt. Darüber hinaus gehen Kriterien wie Eigeninteresse und die Fördermöglichkeit<br />
aus anderen Programmen in die Beurteilung ein.<br />
Mitnahmeeffekte<br />
Die mit dem Programm finanzierten landschaftspflegerischen Maßnahmen sind wirtschaftlich unrentable<br />
Tätigkeiten, die ohne <strong>Förderung</strong> nicht durchgeführt würden. Mitnahmeeffekte treten höchstens in einem minimalen<br />
und zu vernachlässigenden Ausmaß auf. Sie sind grundsätzlich da denkbar, wo engagierte Bürger<br />
aus Idealismus Landschaftspflegemaßnahmen auch ohne <strong>Förderung</strong> durchgeführt hätten. Die aktuelle naturschutzfachliche<br />
Situation der Landschaft zeigt jedoch, dass ohne <strong>Förderung</strong> die Halbtrockenrasen verbuschen,<br />
Magerwiesen verbrachen und artenreiche Grenzertragsflächen aufgefichtet werden.<br />
Koordination mit anderen Förderbereichen<br />
Die nach Artikel 33 Tiret 11 geförderten Maßnahmen stellen überwiegend eine Erstpflege oder Schaffung<br />
wertvoller Biotopstrukturen dar. Für den dauerhaften Erhalt und die nachhaltige Wirkung der Fördermaßnahme<br />
ist eine langfristige und regelmäßige Pflege nötig. Diese kann u.a. über das Bayerische Vertragnaturschutzprogramm<br />
gefördert werden. Für beide Förderprogramme sind die Unteren und Höheren Naturschutzbehörden<br />
zuständig, sodass eine optimale Koordination der Programme erfolgen kann. In wie weit<br />
dies auch tatsächlich stattfindet bzw. welche Verbesserungen im Abstimmungsprozess denkbar wären, lässt<br />
sich an dieser Stelle nicht beantworten.<br />
Einbindung der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Umweltverbände<br />
Die Umweltverbände, vor allem der Bund Naturschutz in Bayern e.V. und der Lan<strong>des</strong>bund für Vogelschutz<br />
e.V., machen vom Programm regen Gebrauch, um satzungemäße Ziele <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege<br />
umzusetzen. Dabei treten sie häufig nicht selbst als Antragsteller auf, sondern beantragen die<br />
Mittel über die örtlichen Landschaftspflegeverbände, weil sich dadurch der verwaltungsmäßige Aufwand<br />
reduzieren lässt.<br />
415
416<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Kontrolle<br />
Die Auszahlung der Mittel erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme, der Maßnahmenkontrolle durch die<br />
UNB sowie Vorlage und Prüfung <strong>des</strong> Verwendungsnachweises durch die HNB. Das heißt, dass alle durchgeführten<br />
Maßnahmen vor Auszahlung der Mittel kontrolliert werden. „Sanktionen“ bei Vertragsverletzungen<br />
sind nicht erforderlich, da nur ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahmen zu Auszahlung kommen.<br />
Verwaltungsaufwand und Aufwand für die Letztempfänger<br />
Anträge werden über die Kreisverwaltungsbehörde (UNB) bei der Bewilligungsbehörde eingereicht. Die Antragsteller<br />
erhalten dort Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der Antragsunterlagen. Der Aufwand<br />
für den Letztempfänger hält sich dabei in einem akzeptablen, für die Beurteilung der Zuschussfähigkeit aber<br />
erforderlichen Rahmen.<br />
Die Landschaftspflege-Richtlinien sehen eine Bagatellgrenze von 500 DM (256 €) bei Vereinen/Verbänden<br />
und Eigentümern oder Besitzern der von den Maßnahmen betroffenen Grundstücke bzw. 3.000 DM<br />
(1.534 €) bei kommunalen Körperschaften sowie deren Zusammenschlüssen vor. Angesichts <strong>des</strong> Aufwan<strong>des</strong><br />
für die Verwaltung <strong>des</strong> Zuschusses (fachliche Beurteilung durch die UNB, fachliche und rechtliche Beurteilung<br />
an der HNB (2 Referate), Erstellung eines vorläufigen Bescheids, Maßnahmenkontrolle durch die<br />
UNB vor Ort, Prüfung <strong>des</strong> Verwendungsnachweises durch HNB, Auszahlungsanweisung) erscheint diese<br />
Grenze jedoch zu niedrig angesetzt. Anders ausgedrückt: Der administrative Aufwand für kleinere Vorhaben<br />
liegt höher als die ausgereichten Fördermittel.<br />
10.4.8 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der relevanten Bewertungsfragen<br />
10.4.8.1 Plausibilitätsprüfung <strong>des</strong> Bewertungskonzeptes sowie der gemeinsamen kapitelspezifischen<br />
Bewertungsfragen<br />
Die nach Art. 33 der VO 1257/1999 geförderten Maßnahmen dienen überwiegend der Verbesserung der<br />
landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen. Dies trifft jedoch mittelbar nicht auf die nach Art. 33 Tiret 11<br />
geförderten investiven Maßnahmen der Landschaftspflege zu. Sie haben eine Verbessung der Umweltsituation<br />
im ländlichen Raum zum Ziel. In der Zielsetzung entsprechen sie daher den Art. nach 22 – 24 geförderten<br />
Agrarumweltmaßnahmen. Für die Ex post-Bewertung wird vorgeschlagen, die nach Art. 33 Tiret 11 geförderten<br />
Maßnahmen nach den für die Agrarumweltmaßnahmen vorgeschlagenen Fragen zu bewerten. 246<br />
In welchem Umfang ist das Einkommen der ländlichen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden?<br />
(Frage IX.1)<br />
Im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege finden einmalige Maßnahmen statt. Eine Einkommenswirkung<br />
entsteht nur durch Realisierung der Maßnahme, nicht aus wirtschaftlichen Folgeeffekten<br />
heraus. Eine dauerhafte Einkommensverbesserung durch einmalige Fördermaßnahmen wird <strong>des</strong>halb nicht<br />
ausgelöst. Die Einkommenseffekte beschränken sich auf die mit der Maßnahmenumsetzung Beauftragten.<br />
Das sind in praktisch allen Fällen Landwirte. Eine längerfristige Einkommenswirkung wäre nur zu erwarten,<br />
wenn entsprechende Fördermaßnahmen jährlich neu und in einem nennenswerten Umfang in Auftrag gegeben<br />
würden (z.B. regelmäßige Pflegemaßnahmen). Bei wie vielen Landwirten während der Programmlaufzeit<br />
in welcher Höhe zusätzliche Brutto-Einkommen erzeugt wurden, lässt sich aus den Bewertungsunterlagen<br />
ermitteln. Nicht feststellen lässt sich die relative Einkommenswirkung, weil keine Angaben über die Einkommensverhältnisse<br />
der landwirtschaftlichen Haushalte vorliegen. Die Brutto-Einkommenswirkung dürfte<br />
mit der Netto-Wirkung weitgehend identisch sein, weil wegen der überwiegend kleineren Umweltschutz- und<br />
Pflegeaufträge an die Landwirte kaum Verdrängungseffekte zu erwarten sind.<br />
246 Vgl. <strong>EU</strong>-Dokument VI/12004/00, <strong>Teil</strong> B, Abschn. 6
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung<br />
als Ergebnis der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeitangebote oder durch die<br />
Verringerung der Abgelegenheit erhalten worden? (Frage IX.2.)<br />
Infrastrukturverbesserungen werden durch die Maßnahmen Art. 33 Tiret 11 der VO (<strong>EU</strong>) 1257/1999 nicht<br />
gefördert. Die Frage ist unzutreffend.<br />
In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden?<br />
(Frage IX.3.)<br />
Die Durchführung der Maßnahmen durch landwirtschaftliche Arbeitskräfte gegen Entgelt stellt eine Beschäftigungsmöglichkeit<br />
dar, die evaluiert werden kann. Die überwiegend geringen Einsatzumfänge lassen sich zu<br />
Vollzeit-Beschäftigungsäquivalenten aggregieren. Allerdings werden keine neuen dauerhaften Arbeitsplätze<br />
durch die einmaligen Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege geschaffen.<br />
Vorhandene Arbeitskapazität wird vielmehr umfassender ausgelastet. Insofern erübrigt sich die Frage<br />
nach den Kosten neu geschaffener Arbeitsplätze (IX.3-1.4) ebenso wie die Frage IX.3-2.1 nach den saisonalen<br />
Zusammenhängen. Auch ein Bezug zur Verbesserung der Infrastruktur im touristischen Bereich besteht<br />
nicht, der Indikator IX.3-2.2 trifft <strong>des</strong>halb nicht zu.<br />
In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert<br />
worden? (Frage IX.3.)<br />
Die Frage trifft nicht zu, da die Maßnahmen auf Verbesserungen im Bereich <strong>des</strong> Umwelt- und <strong>Naturschutzes</strong><br />
sowie der Landschaftspflege abzielen und keine Verbindung zur Verbesserung der ländlichen Wirtschaftstruktur<br />
hergestellt werden kann. Die landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen sind grundsätzlich nicht<br />
betroffen, weil sich die Fördermaßnahmen nicht auf landwirtschaftlich genutzte Flächen beziehen (Indikator<br />
IX.4.1.1). Mit den investiven Maßnamen der Landschaftspflege werden Landschaftsbestandteile geschaffen<br />
oder wiederhergestellt, die naturschutzfachlichen Zielen dienen.<br />
Eine Beziehung zwischen der Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen und der Aufnahme bzw.<br />
Ausweitung landwirtschaftsnaher Tätigkeiten im Bereich der Qualitätsproduktion und Vermarktung (Indikator<br />
IX.4-1.2) ist grundsätzlich denkbar, wie existierende Projekte der Lammfleischvermarktung in ausgewählten<br />
Landschaftsschutzgebieten zeigen (z.B. Hesselberg-Lamm, Altmühl-Lamm). Solche Entwicklungen stellen<br />
sich jedoch nicht kurzfristig ein und ließen sich erwartungsgemäß in der Halbzeitbewertung auch noch nicht<br />
erkennen. Ihre Identifizierung und wirtschaftliche Bewertung – auch im Hinblick auf positive Impulse auf die<br />
regionale Wirtschaftsentwicklung (Indikator IX.4-3), erfordert darüber hinaus tiefergehende einzelbetriebliche<br />
Analysen, die frühestens in der Ex post-Evaluierung durchgeführt werden könnten.<br />
In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen Raum erhalten oder verbessert worden? (Frage<br />
IX.5.)<br />
Diese Frage zielt auf das zentrale Anliegen der investiven Maßnahmen der Landschaftspflege. Das Kriterium<br />
IX.5-1 wird aufgrund der Indikatoren IX.5-1.1 und IX.5-1.3 bewertet. Der Indikator IX.5-1.2. „Verringerte<br />
Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen“ wird nicht evaluiert, da Bewässerungskulturen in Bayern<br />
nur eine geringe Bedeutung haben.<br />
Das Kriterium IX.5-2. „Vermeidung von Verschmutzung/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürlichen/nicht<br />
erneuerbaren Ressourcen“ wird nicht bearbeitet, da es der Intension der Maßnahmen im Bereich<br />
Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege nicht entspricht.<br />
Die Kriterien IX.5-3 und IX.5-4 werden mit den vorgeschlagenen Indikatoren bewertet.<br />
417
418<br />
10.4.8.2 Hinzufügen von Kriterien und Indikatoren<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Im Interesse einer <strong>EU</strong>-weiten Vergleichbarkeit der Evaluation sollte mit dem Hinzufügen neuer Indikatoren<br />
zurückhaltend umgegangen werden. Für die Bewertung der Naturschutzmaßnahmen wurde es nicht als<br />
dringend angesehen, den Indikatorenkatalog durch zusätzliche Kennwerte zu erweitern.<br />
10.4.8.3 In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten<br />
worden? (Frage IX.3)<br />
Obwohl das primäre Ziel der Fördermaßnahmen nach Art. 33 Tiret 11 die Erhaltung, Schaffung und Verbesserung<br />
ökologischer Lebensräume ist, wird als Nebeneffekt die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
in den ländlichen Gebieten angestrebt. Zur Beantwortung dieser Frage werden 3 Kriterien herangezogen:<br />
• Kriterium IX.3-1: Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche<br />
Bevölkerung (gl. Tabelle 152);<br />
• Kriterium IX.3-2: Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen<br />
werden (vgl. Tabelle 153);<br />
• Kriterium IX.3-3: Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung bei (vgl. Tabelle 155).<br />
Durch die Tätigkeiten zur Erhaltung, Schaffung und Verbesserung ökologischer Lebensräume entstand zusätzliche<br />
Beschäftigung im Umfang von 49 FTE. Das Beschäftigungsprofil umfasst Tätigkeiten, wie sie üblicherweise<br />
von Landwirten mit landwirtschaftlichen Geräten erledigt werden können, z.B. das Mähen oder<br />
Entbuschen von Flächen. Die Landwirte führen diese Tätigkeiten in Kombination mit ihrer Landbewirtschaftung<br />
aus und erwirtschaften so ergänzende Einkommen. Insofern ist davon auszugehen, dass weniger zusätzliche<br />
Arbeitsplätze neu geschaffen als vielmehr bestehende landwirtschaftliche Arbeitsplätze durch die<br />
Möglichkeit der Einkommenskombination gefestigt und möglicherweise erhalten wurden.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 152: Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche<br />
Bevölkerung (Kriterium IX.3-1)<br />
Indikatoren: Pflege, Erhaltung und Entwick-<br />
IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft,<br />
die durch Fördermaßnahmen geschaffen/erhalten wurden<br />
(FTE, Anzahl der betreffenden Betriebe)<br />
a) davon Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch verbesserte<br />
landwirtschaftliche Tätigkeiten oder durch Transaktionen<br />
ergeben haben, die wiederum das Ergebnis geförderter nicht-<br />
33 6 9 1 49<br />
landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (in %)<br />
b) davon Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten<br />
ergeben haben, die wiederum das Ergebnis<br />
100% 100% 100% 100% 100%<br />
geförderter nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (in %) 0% 0% 0% 0% 0%<br />
c) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche<br />
Bevölkerung, die jünger als 30 Jahre ist (in %)<br />
d) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen (in %)<br />
lung naturnaher<br />
Lebensräume<br />
Schaffung ökologisch wertvoller<br />
Bereiche<br />
Renaturierung ursprünglich ökologisch<br />
wertvoller Lebensräume<br />
siehe unten.<br />
Altersstruktur, Geschlechterverhältnis<br />
Angaben zum Alter und zur Geschlechterstruktur der beteiligten Akteure wurden über telefonischen Rückfragen<br />
bei den Trägern der Maßnahmen ermittelt. Dabei wurden nur Personen aus dem landwirtschaftlichen<br />
Bereich berücksichtigt. Für insgesamt 21 Maßnahmen konnte entsprechende Daten gewonnen werden. Sie<br />
zeigen folgende Zusammenhänge:<br />
• 7% der Akteure waren maximal 30 Jahre alt; zwei Drittel davon waren Männer, ein Drittel Frauen;<br />
• 93 % der Akteure waren älter als 30; hier lag das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei 9:1.<br />
Eine ergänzende Befragung der Maßnahmenträger nach ihrer allgemeinen Einschätzung der Alters- und<br />
Geschlechterverteilung war in 8 Fällen möglich. Weil es sich um durchweg größere Träger handelte, die<br />
meist über 100 Landwirte/Personen beschäftigten, vermitteln die Angaben ein relativ verlässliches Bild der<br />
sozialen Struktur der eingesetzten Beschäftigten. Folgende Einschätzungen wurden gegeben:<br />
• „Die Altersstruktur ist gemischt, die Mehrzahl der Beschäftigten eher älter; der Frauenanteil liegt unter<br />
10%“ (Nennungen von 2 Trägern);<br />
• „Die beteiligten Landwirte sind zu 100 % über 30 Jahre alt; der Frauenanteil liegt bei 4,5 %“ (Nennungen<br />
von 6 Trägern).<br />
Im Einzelnen lassen sich folgende Zusammenhänge ableiten:<br />
• Ältere Landwirte bewirtschaften häufiger kleinere Betriebe, sind öfter nebenberuflich in der Landwirtschaft<br />
tätig und bessern ihr Einkommen durch Landschaftspflege gerne auf.<br />
• Betriebe mit älteren Landwirten besitzen häufiger leichtere Maschinen und Geräte, die sich für den<br />
Einsatz in der Landschaftspflege besser eignen als moderne Großmaschinen.<br />
• Ältere Landwirte sind außerdem eher bereit, Handarbeit und überhaupt harte körperliche Arbeit zu<br />
leisten.<br />
Erhalt <strong>des</strong> charakteristischen<br />
Landschaftsbil<strong>des</strong><br />
Summe / Durchschnitt<br />
419
420<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• Großmaschinen finden sich dagegen häufiger auf Betrieben mit jüngeren Bewirtschaftern; dies erschwert<br />
grundsätzlich deren Einsatz in der Landschaftspflege.<br />
• Die jüngeren Landwirte sind zudem häufiger im Vollerwerb tätig und verfügen tendenziell über wenig<br />
freie Arbeitskapazität, die sie in der Landschaftspflege einsetzen könnten.<br />
• Bewirtschafter mittleren Alters mit zweckmäßiger Maschinenausstattung wählen die Landschaftspflege<br />
teilweise gezielt als zusätzlichen Erwerbszweig (Diversifizierung).<br />
Vor dem Hintergrund dieser Einschätzungen äußerten <strong>des</strong>halb auch einige Träger die Befürchtung, dass es<br />
bei weiterem Wachstum der landwirtschaftlichen Betriebe und der hohen Arbeitsbelastung der jüngeren<br />
Landwirte künftig schwierig werden könnte, Landschaftspflegearbeiten auch weiterhin von Landwirten ausführen<br />
zu lassen. Dem wurde von einem Träger entgegen gehalten, dass die Bereitschaft zur Übernahme<br />
solcher Arbeiten mehr von der persönlichen Motivation als von der Arbeitszeitbelastung und vom Einkommensbedarf<br />
bestimmt werde.<br />
Die geringe Beteiligung von Frauen an Umweltschutz- und Landschaftspflegearbeiten wird von den befragten<br />
Maßnahmenträgern folgendermaßen erklärt:<br />
• Schwer vereinbar mit der traditionellen Rolle der Frau in Haus und Hof;<br />
• körperliche Arbeit oft zu schwer;<br />
• Frauen führen eher leichtere Arbeiten wie Pflanzaktionen und Zusammenrechen der Gehölze nach<br />
der Entbuschung durch;<br />
• Gewisse Zurückhaltung beim umfassenderen Einsatz von Technik, insbesondere in schwierigen Geländelagen.<br />
Zusammenfassend: Landschaftspflegearbeiten werden überwiegend von älteren Nebenerwerbslandwirten<br />
ausgeführt. Im mittleren Altersabschnitt sind auch Haupterwerbslandwirte beteiligt, die dann die Landschaftspflege<br />
teilweise gezielt als zweites Standbein ausbauen und dazu sogar Investitionen tätigen. Jüngere<br />
Haupterwerbslandwirte sind eher selten vertreten, ebenso wenig Frauen; deren Anteil liegt zwischen 5<br />
und 10%.<br />
Tabelle 153: Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen<br />
werden (Kriterium IX.3-2:)<br />
Indikatoren: Pflege, Erhaltung und Entwick-<br />
IX.3-2.1. Arbeitnehmer, die auf Grund der Beihilfe während der<br />
Zeiträume mit geringer landwirtschaftlicher Aktivität eine Beschäftigung<br />
fanden (VE, Anzahl der betreffenden Personen) 367 499 79 26 971<br />
Ein Großteil der Arbeiten zur Erhaltung, Schaffung und Verbesserung ökologischer Lebensräume kann in<br />
der für die Landwirtschaft arbeitsärmeren Winterperiode ausgeführt werden. Knapp 1.000 Personen haben<br />
im Berichtszeitraum 2000-2002 davon profitiert. Die Naturschutz- und Pflegearbeiten haben damit in spürbarem<br />
Umfang nicht nur ergänzen<strong>des</strong> Einkommen für Landwirte geschaffen, sondern auch für eine produktive-<br />
lung naturnaher<br />
Lebensräume<br />
Schaffung ökologisch wertvoller<br />
Bereiche,<br />
Renaturierung ursprünglich ökologisch<br />
wertvoller Lebensräume<br />
Erhalt <strong>des</strong> charakteristischen<br />
Landschaftsbil<strong>des</strong><br />
Summe / Durchschnitt
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
re Nutzung von zeitweise unterbeschäftigten Faktoren gesorgt. Die umfangreichsten Effekte ergaben sich –<br />
der Zahl der Maßnahmen folgend – in Mittelfranken und Unterfranken (vgl. Tabelle 154).<br />
Tabelle 154: Arbeitnehmer, die auf Grund der Beihilfe während der Zeiträume mit geringer landwirtschaftlicher<br />
Aktivität eine Beschäftigung fanden nach Regierungsbezirken<br />
Regierungsbezirke Arbeitnehmer (Anz) Regierungsbezirke Arbeitnehmer (Anz)<br />
Oberfranken 157 Niederbayern 157<br />
Mittelfranken 289 Oberbayern 0<br />
Unterfranken 184 Schwaben 52<br />
Oberpfalz 131<br />
Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind, entsprechen im<br />
Bereich Pflege, Schaffung und Renaturierung von Lebensräumen ca. 17 FTE. Sie fallen zum großen <strong>Teil</strong> für<br />
Erdbewegungen an (Schaffen von Feuchtbiotopen, Entlanden von Weihern etc.), die von örtlichen Bau- und<br />
Fuhrunternehmern wahrgenommen werden.<br />
Die Planung und Betreuung der Maßnahmen hat Beschäftigungsmöglichkeiten im Umfang von ca. 6 FTE<br />
geschaffen, die zum größten <strong>Teil</strong> von freiberuflichen Gutachtern durchgeführt wurden. Weitere ca. 5 FTE<br />
sind bei den Landschaftspflegeverbänden für die Verwaltung der Maßnahmen entstanden. Sie erhalten<br />
meist 15% <strong>des</strong> Fördervolumen als Aufwandsentschädigung.<br />
Tabelle 155: Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung<br />
(Kriterium IX.3-3)<br />
Indikatoren: Pflege, Erhaltung und Entwick-<br />
IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für Begünstigte, die nicht in der<br />
Landwirtschaft tätig sind (FTE, Anzahl der betreffenden Personen)<br />
a) davon Beschäftigungsmöglichkeiten im Sektor Fremdenver-<br />
446 630 184 0 1260<br />
kehr (in %)<br />
b) davon Beschäftigungsmöglichkeiten im Sektor Handwerk<br />
0% 0% 0% 0% 0%<br />
und lokale Produktion (in %)<br />
c) davon Beschäftigungsmöglichkeiten im Sektor Agribusiness<br />
100% 100% 100% 100% 100%<br />
(in %)<br />
d) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für Personen, die jün-<br />
0% 0% 0% 0% 0%<br />
ger als 30 Jahre sind (in %)<br />
e) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen (in %)<br />
Siehe unten<br />
Alterstruktur und Geschlechterverhältnis<br />
Die Beschäftigungsmöglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung betreffen neben der einschlägigen<br />
Verwaltung vor allem ortsansässige Betriebe aus dem Baubereich. Wegen der Auftragsvergabe an<br />
Baufirmen lassen sich die Personen, die letztlich die Arbeiten durchgeführt haben, nicht feststellen. Ange-<br />
lung naturnaher<br />
Lebensräume<br />
Schaffung ökologisch wertvoller<br />
Bereiche,<br />
Renaturierung ursprünglich ökologisch<br />
wertvoller Lebensräume<br />
Erhalt <strong>des</strong> charakteristischen<br />
Landschaftsbil<strong>des</strong><br />
Summe / Durchschnitt<br />
421
422<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
sichts der Art der Arbeiten – der Großteil der Arbeiten betrifft Erdbewegungen mit Bagger und Lastkraftwagen<br />
– ist jedoch davon auszugehen, dass praktisch nur Männer davon betroffen waren.<br />
Innerhalb der Verwaltung dürfte der Anteil von Männern und Frauen den regionstypischen Durchschnitten –<br />
Frauenanteil von ca. 20 % - entsprechen.<br />
10.4.8.4 In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen Raum erhalten oder verbessert worden?<br />
(Frage IX.5)<br />
Verbesserungen in der Landwirtschaft haben Umweltvorteile bewirkt (Kriterium IX.5-1)<br />
Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde, insbesondere durch eine auf<br />
Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung der Bodenerosion (in Hektar und %) (Indikator<br />
IX.5-1.1)<br />
Die Verringerung der Bodenerosion war in keinem der untersuchten Fälle primäres Ziel der Maßnahme. 21%<br />
der Maßnahmen umfassen jedoch die Pflanzung von Bäumen und Gehölzen. Diese haben, insbesondere<br />
wenn es sich um die Umwandlung von Ackerland handelt, eine Verbessung <strong>des</strong> Bodenschutzes zur Folge.<br />
Eine Abschätzung der betroffenen Fläche ist jedoch nicht möglich, da<br />
• bei der Anlage von Hecken nicht nur die betroffene Fläche selbst sondern u.U. der gesamte Hang<br />
oberhalb davon betroffen ist;<br />
• bei der Anlage von Streuobstwiesen meist nach der Anzahl gepflanzter Bäume abgerechnet wird und<br />
eine Recherche der betroffenen Fläche im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich ist.<br />
Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit den Bewirtschaftungsmethoden und<br />
-praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur oder der Bodennutzung in Zusammenhang stehen<br />
und auf Fördermaßnahmen zurückzuführen sind (Indikator IX.5-1.3.)<br />
Die evaluierten Maßnahmen haben alle das Ziel, positive Entwicklungen im Umweltbereich zu bewirken und<br />
können naturschutzfachlich begründbar als positiv eingestuft werden. Ob das Ziel erreicht wird, kann jedoch<br />
nur durch einen objektiven Vergleich und eine objektive Bewertung <strong>des</strong> Zustan<strong>des</strong> vor der Maßnahme und<br />
nach der Maßnahme festgestellt werden.<br />
Anhand der durchgeführten Maßnahmen besteht potenziell die Möglichkeit einer Verbesserung. Ob diese<br />
tatsächlich eintritt oder nicht, hängt von den individuellen Bedingungen am Standort der Maßnahme ab.<br />
Erhaltung/Verbesserung nicht landwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer Vielfalt, Landschaften<br />
oder natürlichen Ressourcen (Kriterium IX.5-3.)<br />
Hinweise auf Verbesserungen der nichtlandwirtschaftlichen Flächen im Sinne von biologischer Vielfalt/Landschaften/natürlichen<br />
Ressourcen, die auf die Beihilfe zurückzuführen sind (Indikator IX.5-3.1), wurden<br />
in keinem Fall gefunden.<br />
Verbesserte Kenntnisse/größere Sensibilität im Zusammenhang mit Umweltproblemen und -lösungen<br />
im ländlichen Raum (Kriterium IX.5-4.)<br />
Nur ein geringer Anteil der Maßnahmen hatte verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und –lösungen<br />
zum Ziel. Hierunter fielen vor allem Gutachten und Kartierungen zum Schutz gefährdeter Tiere und Pflanzen<br />
nach der FFH-Richtlinie, von denen meist ortsansässige, freiberufliche Gutachter profitierten. Auch Informa-
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
tionstafeln zur Aufklärung der Bevölkerung und zum Schutz der Lebensräume durch Besucherlenkung wurden<br />
realisiert (vgl. Tabelle 156).<br />
Tabelle 156: Verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und -lösungen im ländlichen Raum<br />
bzw. größeres Bewusstsein hierfür (Kriterium IX.5-4)<br />
Indikator:<br />
IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Informationsaustausch oder<br />
den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätigkeiten auf Grund von Fördermaßnahmen<br />
verbessern können (Anzahl, %)<br />
a) davon Informationen über landwirtschaftliche Methoden/Praktiken/Systeme (Anzahl und %)<br />
5,5%<br />
b) davon Informationen über nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten (Anzahl und %) 33%<br />
10.4.9 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahme hinsichtlich Inanspruchnahme und erzielten<br />
Wirkungen<br />
Die Inanspruchnahme <strong>des</strong> Programms hinkt deutlich hinter den Erwartungen hinterher. Nur 38 % der ursprünglich<br />
geplanten Mittel wurden im Zeitraum 2000 <strong>bis</strong> 2002 abgerufen. Allerdings ist eine deutliche Zunahme<br />
im Jahr 2002 zu beobachten.<br />
Um das Ziel <strong>bis</strong> 2006 noch zu erreichen, ist für die nächsten Jahre eine drastische Steigerung in der Umsetzung<br />
erforderlich. Gegebenenfalls sollte in einer separaten Studie geprüft werden, welche Faktoren eine<br />
umfassendere Umsetzung behindern und wie deren Einfluss zurück genommen werden könnte. Aus der<br />
eingeschränkten Sicht der Halbzeitbewertung sind u.a. folgende Gründe dafür maßgebend gewesen:<br />
• prekäre Situation der kommunalen Haushalte;<br />
• hoher Verwaltungs- und Kontrollaufwand bei <strong>EU</strong>-kofinanzierten Projekten;<br />
• zu geringe Publizität <strong>des</strong> Programms.<br />
Unabhängig vom Realisierungsgrad war die Maßnahme aus fachlicher Sicht ein voller Erfolg. Aufgrund der<br />
guten naturschutzfachlich Betreuung <strong>des</strong> Programms an den Unteren und Höheren Naturschutzbehörden<br />
wurden die Mittel durchweg im Sinne der Ziele <strong>des</strong> Art. 33 Tiret 11 eingesetzt.<br />
Aufgrund der zögerlichen Inanspruchnahme zeigt die quantitative Wirkung <strong>des</strong> Programms deutliche Defizite:<br />
Nur 44% der angestrebten 3000 neu geschaffenen oder verbesserten Biotope pro Jahr konnten realisiert<br />
werden.<br />
10.4.10 Schlussfolgerungen und Empfehlungen<br />
Erste Beurteilung der Kohärenz zwischen den verschiedenen Maßnahmen<br />
In qualitativer Hinsicht entsprechen die durchgeführten Maßnahmen voll und ganz den angestrebten Zielen<br />
<strong>des</strong> Programms. Die quantitativen Ziele sind jedoch bei weitem noch nicht erreicht (Realisierungsgrad nur<br />
44%). In der verbleibenden Laufzeit <strong>des</strong> Programms kann dies aber durchaus noch aufgeholt werden, wenn<br />
• in der Öffentlichkeit und bei den Unteren Naturschutzbehörden stärker dazu angeregt wird, die <strong>Förderung</strong><br />
nach Art. 33 Tiret 11 der VO 1257/1999 zu nutzen. Hierzu sind kurzfristig umsetzbare Maßnahmen<br />
erforderlich, wie Presseerklärungen und Anzeigen in einschlägigen Zeitungen;<br />
• die laut Nr. 9.3.7.3.4 der VO (EG) 1257/1999 bereitgestellten Haushaltsmittel für die nationale Kofinanzierung<br />
den Höheren und Unteren Naturschutzbehörden tatsächlich zur Verfügung gestellt werden;<br />
423<br />
472<br />
12%
424<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• bei der <strong>Förderung</strong> Großprojekte bevorzugt behandelt werden, die einen im Verhältnis zum Mitteleinsatz<br />
geringeren Verwaltungsaufwand verursachen;<br />
• in einer begleitenden Untersuchung geprüft wird, welche Wirkungen die eingeleiteten Maßnahmen<br />
tatsächlich zeigen. Die könnte durch eine jährliche statistische Auswertung der Auszahlungslisten und<br />
Interviews der Sachbearbeiter an den Höheren Naturschutzbehören erfolgen.<br />
In welchem Umfang hat die Beihilfe zum Erreichen der Ziele <strong>des</strong> spezifischen Programms für die<br />
Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raums und der allgemeinen Ziele der Verordnung <strong>des</strong> Rates über die<br />
Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raums beigetragen?<br />
Durch das Programm wurden jährlich 1.300 Biotope erhalten, verbessert oder neu angelegt und so wertvoller<br />
Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen geschaffen. Dadurch wurde die Qualität der Umwelt im<br />
ländlichen Raum deutlich verbessert. Als Nebeneffekt entstanden zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
sowohl für landwirtschaftliche als auch für nicht landwirtschaftliche Arbeitskräfte.<br />
Empfehlungen, die sich aus der Analyse und den Schlussfolgerungen ergeben, für die Fortführung<br />
<strong>des</strong> Programms bzw. konkrete Vorschläge für Programmänderungen<br />
Im einer tiefer gehenden Analyse sollte untersucht werden, welche Faktoren eine intensivere Inanspruchnahme<br />
<strong>des</strong> Förderprogramms hemmen und wie diese <strong>bis</strong> zum Ende der Programmlaufzeit abgebaut werden<br />
könnten.<br />
Für den dauerhaften Erhalt der Lebensräume und die nachhaltige Wirkung der Fördermaßnahme ist eine<br />
langfristige, regelmäßige Pflege nötig. Diese kann u.a. über das Bayerische Vertragnaturschutzprogramm<br />
gefördert werden. Für beide Förderprogramme sind die Unteren und Höheren Naturschutzbehörden zuständig,<br />
sodass eine optimale Koordination der Programme erfolgen kann.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
10.5 Vorbeugender Hochwasserschutz<br />
10.5.1 Anlässe für verstärkten Hochwasserschutz, Förderhistorie<br />
Hochwasser haben primär natürliche Ursachen. Klimatische und geographische Bedingungen führen zu<br />
nicht vorhersehbaren Entwässerungsspitzen, die immer wieder auch für einen längeren Zeitraum Bereiche<br />
beeinträchtigen, die üblicherweise nicht von Hochwasser beeinflusst werden. Hinzu treten anthropogene<br />
Faktoren, die nicht direkt für die Katastrophen verantwortlich sind, aber zur Erhöhung <strong>des</strong> Hochwasserrisikos<br />
und Schadenspotenzials führen. Sie veranlassen regelmäßig zur Forderung nach einer Verstärkung <strong>des</strong><br />
Hochwasserschutzes – allerdings meistens zu einem Zeitpunkt, wenn nur noch Schäden zu beheben sind.<br />
Hier setzt der vorbeugende Hochwasserschutz an, der an erkennbar problematischen Stellen entlang von<br />
Gewässern im Voraus dazu beitragen soll, Schäden zu verhindern und den potenziell Betroffenen ihre Ängste<br />
und Sorgen zu nehmen. Darüber hinaus gilt der vorbeugende Hochwasserschutz im Bayerischen EPLR<br />
als förderfähiges Ziel zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Erhaltung der Kulturlandschaft.<br />
Die Nutzung von Talauen und die Zunahme der Abflussgeschwindigkeit haben dazu geführt, dass heute<br />
Siedlungs- und Anbauflächen zunehmend von Hochwasser bedroht werden. Sicher wäre die Aufgabe von<br />
Nutzungen im Einflussbereich der Hochwässer die nachhaltigste Lösung und sollte auch für weitere Ansiedlungen<br />
die Maxime sein; doch haben sich gerade dort im Laufe der Geschichte städtebauliche, gewerbliche<br />
und landwirtschaftliche Zentren gebildet, die es nun zu schützen gilt. Aktuelle Ereignisse wie die Hochwasserkatastrophen<br />
an Pfingsten 1999, im August 2002 in Bayern und an der Elbe, im Januar 2003 in Franken<br />
und der Oberpfalz sowie fast jährlich am Unterrhein verdeutlichen die Gefahren und teilweise Existenz bedrohenden<br />
Auswirkungen <strong>des</strong> Hochwassers. 247 Die durch das Augusthochwasser im Jahr 2002 entstandenen<br />
Schäden werden allein in Bayern auf 200 Mio € geschätzt.<br />
Eine wesentliche Ursache der gehäuft auftretenden Hochwässer gehen auf die Veränderung natürlicher<br />
Faktoren zurück. Auf der Basis von Klimamodellrechnungen kommt das Bayerische Klimaforschungsprogramm<br />
1999 zu folgenden Aussagen zur Veränderungen der Niederschlagsverhältnisse <strong>bis</strong> zur Mitte <strong>des</strong> 21.<br />
Jahrhunderts in Bayern:<br />
• Zunahme der Winter- und Abnahme der Sommerniederschläge im Südwesten Bayerns;<br />
• Entsprechend Zunahme <strong>des</strong> Winterabflusses und Verminderung <strong>des</strong> Sommerabflusses;<br />
• Abnahme der Niederschläge im Norden Bayerns und im Bayerischen Wald;<br />
• Zunahme von Hochwasserrisiken im Winter bei gleichzeitiger Ausdehnung von Trockenperioden im<br />
Sommer. 248<br />
Zur Verschärfung der Gefahrenlage tragen in erheblichem Umfang anthropogene Einflüsse bei. Die intensivere<br />
Nutzung von Rückhalteflächen, Begradigungen von Gewässerläufen, Deichneubauten (z.B. Eindeichung<br />
von Gewerbegebieten und Siedlungsflächen) und die Anlage von Staustufen haben zu einer Verringerung<br />
der natürlichen Überschwemmungsgebiete 249 geführt und den Wasserabfluss beschleunigt. 250 Nach<br />
Schätzungen <strong>des</strong> WWF-Aueninstituts stehen heute für Überschwemmungen nur noch 20% <strong>des</strong> ursprünglichen<br />
Auengebietes zur Verfügung. Zunehmende bauliche Nutzung führt außerdem zu einer Reduzierung<br />
der Speicherfunktion der Vegetation und <strong>des</strong> Bodens für den Niederschlag. Hinzu kommt der beschleunigte<br />
Abfluss auf den versiegelten Flächen.<br />
247 Eine ausführliche Darstellung der Hochwasserschäden wird im Jahresbericht für das Ziel-2-Programm Bayern 2000-2006 <strong>des</strong> Bayerischen<br />
Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie wiedergegeben. Vgl. Jahresbericht 2002 vom 26.06.2003 <strong>des</strong> Referats<br />
III/1 S. 10 ff.<br />
248 Bayerischer Klimaforschungsverbund (BayFORKLIM) 1999: Klimaänderungen in Bayern und ihre Auswirkungen. Abschlussbericht<br />
<strong>des</strong> Bayerischen Klimaforschungsbun<strong>des</strong>. München. S. 37 f.<br />
249 Bun<strong>des</strong>amt für Bauwesen und Raumordnung 1998: Leitfibel vorbeugender Hochwasserschutz. Modellvorhaben zum vorbeugenden<br />
Hochwasserschutz Rhein-Maas im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit in der Raumordnung (INTERREG IIC). Bonn, S.4.<br />
250 Weiger, H. 2003: Mehr Überflutungsflächen und keine Staustufen an der Donau. Internet:<br />
www.bundnaturschutz.de/projekte/donau/donauhochwasser.html.<br />
425
426<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Die Maßnahmen <strong>des</strong> vorbeugenden Hochwasserschutzes sollen dazu beitragen, dass die Flüsse (wieder)<br />
genügend Raum erhalten und bei Hochwasser ausreichend Retentionsflächen vorhanden sind, um Schäden<br />
möglichst vermeiden zu können.<br />
Eine direkte <strong>Förderung</strong> von Maßnahmen <strong>des</strong> Hochwasserschutzes aus <strong>EU</strong>-Mitteln bestand <strong>bis</strong>her nicht.<br />
Bislang wurden Projekte zum Schutz gegen Hochwasser ausschließlich aus nationalen Mitteln finanziert.<br />
Beispiele hierfür sind:<br />
• Bayerisches Programm zur Auensanierung seit 1995;<br />
• Erarbeitung einer Arbeitshilfe zum Thema „Fach- und sachgerechte Fachbeiträge zum Einbringen der<br />
Belange <strong>des</strong> vorbeugenden Hochwasserschutzes in die Regionalplanung” durch das Bayerische<br />
Staatsministerium für Lan<strong>des</strong>entwicklung und Umweltfragen im Jahr 1999;<br />
• Bündelung von Aktivitäten im Bereich Hochwasserschutz im “Deichnachrüstungsprogramm Bayern”<br />
nach dem Pfingsthochwasser 1999.<br />
Die Gewässerentwicklungspläne der Wasserwirtschaftsämter für alle größeren Flüsse in Bayern gelten heute<br />
als wichtigstes Instrument für die Reaktivierung und Neuschaffung von Retentionsräumen der Gewässer.<br />
Auch die standortgemäße Aufforstung mit heimischen Arten im Auenbereich als Maßnahme der Forstverwaltung<br />
zur Extensivierung von Tallagen und die Entwicklung von Auwäldern ist eine Maßnahme, um das<br />
Rückhaltevermögen von Niederschlagswasser zu erhöhen.<br />
10.5.2 Beschreibung <strong>des</strong> Förderprogramms<br />
Zukunftweisender Hochwasserschutz, wie er in den Leitlinien der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 251<br />
beschrieben wird, legt die Richtlinien für die bayerische Hochwasserschutz-Strategie fest. Es geht dabei um<br />
den natürlichen Rückhalt, den technischen Hochwasserschutz und die weitergehende Hochwasservorsorge<br />
– jeweils mit der Absicht, vorausschauend das Schadenspotenzial zu minimieren. Als vorrangige Ziele werden<br />
genannt:<br />
• Optimierung der Flusseigenschaften,<br />
• Vernetzung von Fluss und Aue,<br />
• Stärkung der Biotopstruktur.<br />
Die Maßnahmen sollen außerdem dazu beitragen, die ländlichen Strukturen zu fördern und Naherholungskonzepte<br />
in Hochwasserschutzstrategien zu integrieren und zu fördern.<br />
Die <strong>Förderung</strong> soll in erster Linie jenen Bereichen zugute kommen, die den größten Wirkungsgrad erwarten<br />
lassen. Hierbei wurde die in den bayerischen wasserrechtlichen Vorgaben definierte Einteilung der Fließgewässer<br />
in 3 Klassen genutzt. Je nach dem Einfluss und der Auswirkung <strong>des</strong> Gewässers gibt es auch unterschiedliche<br />
Zuständigkeiten der Ausbau- und Unterhaltungsverpflichtung:<br />
• Gewässer I. Ordnung: große Gewässer (zuständig: Freistaat Bayern);<br />
• Gewässer II. Ordnung: Gewässer mittlerer Länge und Umfang (zuständig die Regierungsbezirke);<br />
• Gewässer III. Ordnung: kleine Gewässer (zuständig die jeweilige Stadt oder Gemeinde).<br />
Bei der Planungsvorgabe für die Nutzung der EAGFL-Mittel wurde beschlossen, in erster Linie die Gewässer<br />
I. Ordnung und nachrangig Maßnahmen der Gewässer II. Ordnung zu bedienen. Eine Anwendung der Fördermittel<br />
für die Gewässer 3. Ordnung ist nicht vorgesehen.<br />
Insbesondere sind Maßnahmen zu berücksichtigen, die folgende Zielsetzungen haben:<br />
• Nachrüstung <strong>des</strong> Deichsystems,
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• Bau von Deichverteidigungswegen und deren Anbindung an das öffentliche Wegenetz,<br />
• Herstellung eines HQ100-Schutzes 252 für Siedlungsgebiete,<br />
• Schaffung von Rückhalteräumen.<br />
Bei wasserbaulichen Maßnahmen dieser Art geht es vorrangig um die Verminderung <strong>des</strong> Wasserabflusses.<br />
Dies soll erreicht werden durch:<br />
• Aufweitung <strong>des</strong> Gewässerbettes,<br />
• Abflachung der Ufer,<br />
• Verlängerung der Gewässerläufe durch Wiederherstellung der einstigen Flussschlingen,<br />
• Rückverlegung der Deiche.<br />
10.5.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext<br />
Als vorrangige Aufgabe <strong>des</strong> Programms „Vorbeugender Hochwasserschutz“ wird die Reduzierung <strong>des</strong><br />
Schadenspotenzials gesehen. Vorbeugend wirken in der Regel auch alle Maßnahmen, bei denen die Extensivierung<br />
von Nutzungen ein Ziel darstellt. In diese Richtung wirken auch verschiedene Maßnahmen <strong>des</strong><br />
Kulturlandschaftsprogramms, <strong>des</strong> Vertragsnaturschutzprogramms und <strong>des</strong> waldbaulichen Förderprogramms.<br />
In der Landwirtschaft hat beispielsweise die Vermeidung von Schwarzbrache, der Zwischenfruchtanbau, der<br />
Verzicht auf Grünlandumbruch, ein späterer Grünlandschnitt, aber etwa auch die Herausnahme von Feuchtgebieten<br />
aus der Nutzung eine Rückhaltefunktion für Niederschläge. Diese Maßnahmen haben einen verzögerten<br />
Abfluss zur Folge, wodurch Hochwasserspitzen gebremst werden können. Des weiteren sind alle<br />
Formen von Entsiegelungsmaßnahmen der Wasserrückhaltung dienlich. Derartige Maßnahmen werden<br />
beispielsweise auch im Rahmen <strong>des</strong> Dorferneuerungsprogramms gefördert.<br />
In der <strong>Teil</strong>maßnahme 1.1.c “Projekte <strong>des</strong> technischen Hochwasserschutzes” <strong>des</strong> Ziel 2-Programms–Bayern<br />
(2000-2006) wurden drei Projekte im Ziel-2-Gebiet und 27 Projekte im Phasing-Out-Gebiet genehmigt. 253<br />
Neben dem direkten Schutz von Gewerbegebieten, der nur durch Deiche, Mauern und Absperrbecken erreicht<br />
werden konnte, wird großer Wert auf die Anlage von Flutmulden und Rückhaltebecken sowie die Entwicklung<br />
von Poldern gelegt. 254<br />
Mit einem Zeithorizont von 20 Jahren und einem gesamten Mittelvolumen von 2,3 Mrd. € hat das Bayerische<br />
Staatsministerium für Lan<strong>des</strong>entwicklung und Umweltfragen das Programm “Nachhaltiger Hochwasserschutz<br />
in Bayern - Aktionsprogramm 2020 für Donau und Maingebiet” 255 aufgelegt. Als wesentliche Ziele<br />
werden hierbei genannt:<br />
• die Reduktion <strong>des</strong> Schadenspotenzials und<br />
• die Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.<br />
Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist es hierbei, ein Überschwemmungsflächen-Management zu entwickeln,<br />
welches in den Überschwemmungsgebieten dafür Sorge trägt, dass die Flächen freigehalten werden,<br />
eine angepasste Nutzung erfolgt und Hochwasserwellen gedämpft werden. Der nachhaltige Hochwasserschutz<br />
basiert dabei auf der bayerischen Drei-Säulen-Strategie:<br />
• Natürlicher Rückhalt - vorbeugender Hochwasserschutz,<br />
• Technischer Hochwasserschutz und<br />
251<br />
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 1995: Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz, Stuttgart. Im Internet als Download<br />
unter www.lawa.de<br />
252<br />
Vorkehrungen, die für ein hundertjähriges Hochwasserereignis ausreichend Schutz bietet.<br />
253<br />
Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie: Jahresbericht 2002 für das Ziel-2-Programm Bayern<br />
2000-2006 vom 26.06.2003.<br />
254<br />
vgl. ebenda.<br />
255<br />
Bayerisches Staatsministerium für Lan<strong>des</strong>entwicklung und Umweltfragen: Nachhaltiger Hochwasserschutz in Bayern - Aktionsprogramm<br />
2020 für Donau- und Maingebiet. Internet: www.umweltministerium.bayern.de/bereiche/wasser/speicher/strategie.html (Juli<br />
2003).<br />
427
428<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• weitergehende Hochwasservorsorge (Maßnahmen der Flächen-, Bau- Verhaltens- und Risikovorsorge).<br />
Mit diesem Programm sollen jährlich folgende Mittel zur Verfügung stehen:<br />
• 50 Millionen € Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern I. Ordnung,<br />
• 20 Millionen € Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern II./III. Ordnung,<br />
• 20 Millionen € Hochwasserschutzmaßnahmen an Wildbächen,<br />
• 20 Millionen € Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen,<br />
• 5 Millionen € für staatliche Hochwasserschutzspeicher.<br />
10.5.4 Methodischer Ansatz<br />
Die Maßnahmen <strong>des</strong> vorbeugenden Hochwasserschutzes laufen regelmäßig über mehrere Jahre. Deshalb<br />
werden üblicherweise zu Beginn einer Förderphase relativ viele Projekte beantragt. Bis zum Beginn der Erhebungen<br />
Ende 2002 wurden bereits insgesamt 101 Förderfälle registriert. Wegen dieser überschaubaren<br />
Anzahl wurde eine Totalerhebung aller Fördervorhaben angestrebt, wobei die Wasserwirtschaftsämter als<br />
ausführende Stellen die Ansprechpartner waren.<br />
Datenquellen<br />
Als Datenquellen dienten die Förderunterlagen bei den bayerischen Wasserwirtschaftsämtern. 22 der 24<br />
Ämter beteiligten sich <strong>bis</strong>her am Förderprogramm. Zur Überprüfung <strong>des</strong> Rücklaufs diente die Liste der Gesamtprojekte,<br />
die von der Bewilligungsstelle, dem Bayerischen Staatsministerium für Lan<strong>des</strong>entwicklung und<br />
Umweltfragen geführt wird.<br />
Tabelle 157: Datengrundlage und Anzahl der Rückläufe<br />
Datenart Datenquelle Grundgesamtheit Rücklauf<br />
Quantitative Daten<br />
Primärstatistiken<br />
Sekundärstatistiken,<br />
Datenabgleich<br />
Qualitative Daten<br />
Primärdaten<br />
Sekundärdaten/<br />
Datenabgleich<br />
Angaben der<br />
Wasserwirtschaftsämter,<br />
Fragebögen<br />
StMLU<br />
Fragebögen, Befragung<br />
von Mitarbeitern der<br />
WWA/Expertengespräche<br />
101 Projekte<br />
Wasserwirtschaftsämter 101 Projekte<br />
StMLU<br />
74 Projekte (Fragebögen),<br />
29 abgeschlossene<br />
Vorhaben<br />
74 Projekte, 29 abgeschlossene<br />
Vorhaben<br />
Probleme und Grenzen der gewählten Methodik<br />
Eine Totalerfassung war nicht möglich, weil trotz telefonischer Nachfragen zu einigen Projekten keine Angaben<br />
gemacht wurden. 256 Insgesamt flossen jedoch 73 % der ausgegebenen Fragebögen zurück, die damit<br />
256 Gründe für die Nichtabgabe: Personeller Engpass, Urlaub, Außendienstarbeiten.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
eine sehr breite und zuverlässige Bewertungsbasis bilden. 257 Der hohe Rücklauf wurde dadurch mit begünstigt,<br />
dass die Wasserwirtschaftsämter von der Bewilligungsstelle ausdrücklich zur Mitwirkung aufgefordert<br />
wurden.<br />
Für einzelne Fragestellungen, insbesondere bei der Beantwortung der Querschnittsfragen, wird auf jene 29<br />
Maßnahmen zurückgegriffen, die von den Wasserwirtschaftsämtern als abgeschlossen gemeldet wurden.<br />
10.5.5 Maßnahme Hochwasserschutz - Finanzielle Umsetzung<br />
Die Angaben zur finanziellen Umsetzung sind den Jahresberichten 2000 <strong>bis</strong> 2002 entnommen. Hierbei ist zu<br />
beachten, dass das <strong>EU</strong>-Haushaltsjahr von den Zeitvorgaben <strong>des</strong> indikativen Gesamtfinanzierungsplans (Kalenderjahr)<br />
abweicht.<br />
Die finanzielle Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgt grundsätzlich auf dem Wege der Vorfinanzierung<br />
durch den Freistaat und eine regelmäßige Anforderung der Förderbeträge bei der <strong>EU</strong>. Die <strong>EU</strong>-<br />
Beteiligung beträgt maximal 50% der öffentlichen Ausgaben. Es wurden zwischen 2000 und 2002 mehr<br />
Aufwendungen bewilligt und ausgezahlt, als ursprünglich geplant waren (vgl. Tabelle 158). Wie im Folgenden<br />
dargestellt, liegt die finanzielle Beteiligung der <strong>EU</strong> schon über den Vorgaben für die Jahre 2000-2002 als<br />
auch der Gesamtplanung. Der Förderanteil liegt jedoch bei den ausgezahlten Mitteln von 57,5 Millionen €<br />
nur bei 43 statt bei 50%. Dies hängt maßgeblich mit den Anfangsprojekten zusammen. Denn nach dem<br />
Pfingsthochwasser von 1999 wurden zahlreiche Maßnahmen gestartet, die in den Förderzeitraum hineinreichen,<br />
jedoch nur zum <strong>Teil</strong> auch über die Fördermaßnahme nach VO 1257/99 abgerechnet werden können –<br />
sei es wegen <strong>des</strong> früheren Maßnahmenbeginns oder wegen fehlender Förderfähigkeit aus fachlicher Sicht.<br />
Nach Angaben <strong>des</strong> StMLU ist die hohe Mittelbindung darauf zurückzuführen, dass sich die meisten Projekte<br />
über mehrere Jahre erstrecken und die beantragten Fördermittel bereits gebunden werden, bevor ein Projektabschluss<br />
prognostiziert werden kann. Hinzu kommt, dass aus Gründen, die mit den benötigten<br />
Grundstücken zusammen hängen, in der Regel nicht alle Projekte umgesetzt werden. Trotzdem hat die Auszahlung<br />
mittlerweile für die ersten drei Jahre schon 80% der Gesamtplanung erreicht. Die ausgezahlte <strong>EU</strong>-<br />
Beteilung liegt, bezogen auf die Gesamtplanung, bereits bei 69%.<br />
Tabelle 158: Maßnahme Hochwasserschutz - Finanzielle Umsetzung 2000-2002<br />
Bewilligte<br />
Förderfälle<br />
Öffentliche Aufwendungen davon <strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
bewilligt ausgezahlt bewilligt ausgezahlt<br />
Realisiert 106 126,6 Mio. € 57,5Mio. € 57,5 Mio. € 24,6 Mio. €<br />
Plan (2000 –2002) a<br />
100 347 Mio. € 16,4 Mio. €<br />
Realisierungsgrad 106% 387% 176% 351% 150%<br />
Plan (2000 – 2006) a<br />
71,6 Mio. € 35,8 Mio. €<br />
Realisierungsgrad 177% 80 % 161% 69 %<br />
a Gemäß 2. Antrag auf Änderung <strong>des</strong> Indikativen Gesamtfinanzierungsplan vom 25.1.2002<br />
Stand: 31.12.2002<br />
257<br />
Um eine vergleichbare Datenqualität zu erreichen, waren allerdings umfangreiche Nacherhebungen und Präzisierungen von Angaben<br />
erforderlich.<br />
429
430<br />
10.5.6 Darstellung und Analyse <strong>des</strong> <strong>bis</strong>her erzielten Outputs<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Von den 22 Wasserwirtschaftsämtern, die sich <strong>bis</strong> Ende 2002 am Förderprogramm beteiligten, wurden 74<br />
Projekte über die Fragebögen gemeldet. Sie ließen sich folgenden Kategorien zuordnen:<br />
• Deicherneuerung und –sanierung,<br />
• Retentionsraumschaffung,<br />
• Ökoausbau,<br />
• vorbereitende Maßnahme/Grunderwerb,<br />
• Sonstiges.<br />
Bei einigen Maßnahmen wurden zu dieser Fragestellung mehrere Begriffe angekreuzt, was zu einer Grundlage<br />
von 105 Nennungen führte.<br />
Tabelle 159: Fördermaßnahmen nach Projekttypen<br />
Projektkategorien<br />
Nennungen<br />
Anzahl %<br />
Deicherneuerung/-sanierung 21 20<br />
Retentionsraumschaffung 32 30<br />
Ökoausbau 17 16<br />
Vorbereit. Maßnahmen/Grunderwerb 31 30<br />
Sonstiges 4 4<br />
Insgesamt 105 100<br />
Regionale Verteilung<br />
Die Darstellung der regionalen Verteilung der Maßnahmen und Projekte erscheint angesichts der Aufgabenstellung<br />
„Hochwasserschutz“ als nicht sehr sinnvoll, da die Verteilung der Gewässer und die damit einhergehenden<br />
Probleme keiner regionalen Gleichverteilung folgen. Allein schon aufgrund der unterschiedlichen<br />
Fließdynamik der Gewässer in Nord- und Südbayern sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich, die sich<br />
auch in den eingesetzten Kosten widerspiegeln. So werden beispielsweise in Nordbayern kaum Deiche erstellt,<br />
dafür wird aber um so mehr in Retentionsräume investiert.<br />
Erreichung der gesetzten Ziele<br />
Bei der Erfassung der quantifizierten Ziele der Fördermaßnahmen zum Hochwasserschutz 258 wurden neben<br />
den von der <strong>EU</strong>-Kommission vorgegebenen Zielen (Bau von Deichhinterwegen, Bau von ortsnahen Deichen<br />
und Schaffung von abflusshemmenden Strukturen) zwei Ziele neu aufgenommen. Als viertes Ziel wurde die<br />
„geschaffene Retentionsfläche“ berücksichtigt, um so den Erfolg vorbeugender Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
besser beurteilen zu können. Weil zudem zu dem Ziel “Bau von ortsnahen Deichen” nur subjektive<br />
Aussagen hinsichtlich dem Wert möglich sind, den die Maßnahme für die Bevölkerung hat, wurde ergänzend<br />
das Ziel „Anzahl der Personen, die direkt vom Deichbau profitieren“ eingeführt.<br />
Bei den Hinterdeichwegen und der Retentionsraumschaffung wurde eine ca. dreifache Erfüllung der Zielwerte<br />
erreicht. Abflusshemmende Strukturen wurden etwa doppelt so häufig realisiert wie ursprünglich geplant<br />
(vgl. Tabelle 160). Dieser hohe Realisierungsgrad dürfte auf zwei Ursachen zurück gehen:<br />
• Zum einen wurden die Zielvorgaben auf der Grundlage <strong>bis</strong>heriger Fördererfahrungen formuliert;<br />
• Zum anderen bestand zu Programmbeginn und angesichts der zuvor erlebten Hochwässer ein Stau<br />
von Projekten, der nun rasch abgebaut werden konnte. Insgesamt entspricht es der Strategie <strong>des</strong><br />
Programms, vorrangig besonders wirkungsvolle Maßnahmen zu realisieren.<br />
258 Vgl. dazu den 1. Zwischenbericht <strong>des</strong> Bewertungsteams.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 160: Bewertungsindikatoren für Maßnahmen <strong>des</strong> Hochwasserschutzes<br />
Indikator<br />
Zielwerte Realisation<br />
2000 <strong>bis</strong> 2002<br />
1. Bau von Deichhinterwegen 10 km /Jahr<br />
88,51 km<br />
(29,5 km/J)<br />
2. Bau ortsnaher Deiche 5km/Jahr<br />
2. Ersatz<br />
3.<br />
Anzahl von Personen, die direkt von<br />
Maßnahmen profitieren<br />
Schaffung von abflusshemmenden<br />
Strukturen<br />
100.000 m²/Jahr<br />
4. Zusatz Schaffung von Retentionsraum 1-2 Mio m³/Jahr<br />
156.512 Personen<br />
(52.000 Pers./J)<br />
624.000 m²<br />
(208.000 m²/J)<br />
13,6 Mio m³<br />
(4,5 Mio m³/J)<br />
Einsatz der Mittel<br />
Die Verteilung der Fördermittel auf die einzelnen Maßnahmen gibt Tabelle 161 wieder. Bei Projekten mit<br />
kombinierten Maßnahmen sind, wenn keine Differenzierung der Mittelansätze erfolgte, die Mittel zu gleichen<br />
<strong>Teil</strong>en auf die Einzelmaßnahmen verteilt worden. Obwohl nur 20% der Projektnennungen auf Deicherneuerung<br />
entfallen, wurden hierfür mehr als die Hälfte der Mittel eingesetzt. Dies ergibt sich aus der Notwendigkeit<br />
zur Ausführung umfangreicher Tiefbaumaßnahmen mit kostenintensivem Einsatz von Maschinen und<br />
Personal.<br />
32 % der in den Fragebögen angegeben Projekttypen beschäftigten sich mit der Schaffung oder der Bereitstellung<br />
von Retentionsraum. Der Anteil der <strong>bis</strong>her dafür verbrauchten Mittel war im Verhältnis dazu mit 9%<br />
relativ gering. Noch weniger Mittel beanspruchten die Vorhaben mit dem Schwerpunkt „Ökoausbau“, weil<br />
hierzu i.d.R. keine größeren technischen und personellen Aufwendungen anfallen. Es handelte sich außerdem,<br />
verglichen etwa mit den Deichbaumaßnahmen, um relativ kleine Projekte. Zu berücksichtigen ist aber<br />
auch, dass die kostenintensiven Deichbaumaßnahmen zumeist in kleinerem Umfang auch <strong>Teil</strong>-Maßnahmen<br />
<strong>des</strong> Ökoausbaus einschließen, auch wenn dies nicht explizit so erfasst wird.<br />
Weil als Folge <strong>des</strong> Pfingsthochwassers 1999 etliche Schutzmaßnahmen bereits vor dem offiziellen Start <strong>des</strong><br />
Förderprogramms begonnen wurden und <strong>des</strong>halb nicht anteilig über <strong>EU</strong>-Fördermittel abgerechnet werden<br />
konnten, liegt der Förderanteil <strong>des</strong> EAGFL an den gesamten öffentlichen Aufwendungen für den Hochwasserschutz,<br />
bezogen auf die 29 als abgeschlossen dargestellten Projekte, <strong>bis</strong>her nur bei ca. 24 %.<br />
Tabelle 161: Hochwasserschutzmaßnahmen nach Projektkategorien und Mitteleinsatz<br />
Projektkategorien<br />
Projekte Mitteleinsatz (1000 €)<br />
Anz. % Insgesamt %<br />
Deicherneuerung/-sanierung 21 20 19.213 57<br />
Retentionsraumschaffung 32 30 3.125 9<br />
Ökoausbau 17 16 1.274 4<br />
Vorbereit. Maßnahmen/Grunderwerb 31 30 9.964 29<br />
Sonstiges 4 4 257 1<br />
Insgesamt 105 100 33.834 100<br />
431
432<br />
10.5.7 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Publizitätsmaßnahmen<br />
Da durch die Begrenzung der Fördermaßnahmen auf Gewässer I. und II. Ordnung grundsätzlich die Wasserwirtschaftsämter<br />
für die Umsetzung zuständig sind, ist eine weitergehende Veröffentlichung der Fördermöglichkeiten<br />
nicht erfolgt. Das StMLU informierte die Wasserwirtschaftsämter als Letztempfänger auf dem<br />
Dienstweg über die Fördermöglichkeiten. Ergänzend wurde in der Broschüre <strong>des</strong> Bayerischen Landwirtschaftsministeriums<br />
„Programm 2000 – Leistungen für Land und Leute“ auch auf die Fördermaßnahme „vorbeugender<br />
Hochwasserschutz“ hingewiesen.<br />
Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung<br />
Die Durchführung von Maßnahmen, die durch Zuschüsse aus dem EPLR gefördert werden, folgt einem Verfahrensablauf,<br />
der bei allen Vorhaben angewandt wird Tabelle 162). Das Verfahren zur Antragstellung, Bearbeitung<br />
und Bewilligung wird sowohl im Programmdokument als auch in der Verfahrensbeschreibung <strong>des</strong><br />
StMLU dargestellt.<br />
Tabelle 162: Verfahrensschritte bei Maßnahmen <strong>des</strong> vorbeugenden Hochwasserschutzes<br />
Aufstellung eines Bauentwurfs und Eingabe der Daten<br />
↓<br />
Prüfung <strong>des</strong> Bauentwurfs (Verwaltungskontrolle)<br />
↓<br />
Fachtechnische und haushaltstechnische Genehmigung<br />
und Finanzierung<br />
↓<br />
Vergaberechtliches Verfahren<br />
↓<br />
Durchführung der Baumaßnahme<br />
↓<br />
Abschluss der Baumaßnahme<br />
↓<br />
Fortdauernde Verpflichtungen, Kontrollen<br />
Gelegentlich wurden komplexere Projekte auch auf <strong>Teil</strong>projekte aufgeteilt. Dies ist beispielsweise dann vorgenommen<br />
worden, wenn erwartet wurde,<br />
• dass das gesamte Vorhaben nicht innerhalb <strong>des</strong> Förderzeitraumes abzuschließen sein wird;<br />
• dass bautechnische Trennungen hinsichtlich der Förderfähigkeit notwendig waren oder<br />
• unterschiedliche Finanzierungskonzepte angewandt wurden.<br />
Der Umfang und die Dauer machten es zuweilen erforderlich, Projekte in mehrere Realisierungsphasen zu<br />
gliedern. So wurden z.B. vorbereitende Maßnahme wie Grunderwerb teilweise als eigene Vorhaben geführt,<br />
bevor auf den neu erworbenen Flächen zu einem späteren Zeitpunkt Baumaßnahmen erfolgten.<br />
Ein von der Genehmigungsstelle entwickelter Laufzettel 259 ist von den Letztempfängern für je<strong>des</strong> Projekt<br />
anzulegen. Die Inhalte folgen den festgelegten Verfahrensschritten. Dies gilt insbesondere für die Prüfung<br />
<strong>des</strong> Bauentwurfs, welcher in einer baufachlichen Stellungnahme behandelt wird:<br />
• Unterlagen sind vollständig;<br />
• Angaben sind plausibel;<br />
259 Vgl. Laufzettel 1 – Genehmigung EAGFL, Abteilung Garantie. Interne Arbeitunterlage <strong>des</strong> StMLU, Stand: 09.04.2003.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• unter Beachtung der baufachlichen Stellungnahme ist das Projekt technisch sinnvoll, wirtschaftlich<br />
und sparsam ausgerichtet;<br />
• Erläuterungsbericht stellt ausreichenden Bezug zum <strong>EU</strong>-Programm her (Ziel, Maßnahme, Begründung);<br />
• zuschussfähige Kosten nach VO (EG) 1685/2000 wurden überprüft und festgelegt;<br />
• Projekt stimmt mit den Gemeinschaftspolitiken (Schutz und Verbesserung der Umwelt, Gleichberechtigung<br />
von Männern und Frauen) überein bzw. ist in seiner Wirkung neutral;<br />
• Gegenkontrolle: Das Vorhaben wird aus keinem anderen <strong>EU</strong>-Programm gefördert.<br />
Kriterien der Zuschussfähigkeit<br />
Als Kriterien dienen die von der Länderarbeitsgemeinschaft -LAWA- aufgestellten Leitlinien 260 für einen zukunftsweisenden<br />
Hochwasserschutz. Sie enthalten detaillierte Vorgaben für die Vorhabenskategorien:<br />
• natürlicher Rückhalt,<br />
• technischer Hochwasserschutz,<br />
• weitergehende Hochwasservorsorge.<br />
Mitnahmeeffekte<br />
Dadurch, dass überwiegend gängige Maßnahmen realisiert werden, für die früher keine <strong>EU</strong>-Mittel verfügbar<br />
waren, sind gewisse Mitnahmeeffekte kaum zu vermeiden. Auf der anderen Seite erlaubt das erweiterte<br />
Finanzvolumen sowohl die Realisierung von mehr Projekten als auch das Vorziehen besonders wirkungsvoller<br />
Schutzmaßnahmen. Insofern ist von einer grundsätzlich additionalen Mittelverwendung auszugehen. Dies<br />
um so mehr, als der Hochwasserschutz seit den Überschwemmungen der letzten Jahre hohe politische Priorität<br />
genießt und eine Einschränkung nationaler bzw. regionaler Mittel unter das frühere Niveau nicht anzunehmen<br />
ist.<br />
Nach Angaben aus dem StMLU betrug in den Jahren vor 1999 die jährlichen Aufwendungen an den Gewässern<br />
I. und II. Ordnung für Hochwasserschutz und deren Unterhaltung rund 78 Millionen Euro. Im Jahre 1999<br />
wurden diese Mittel auf 92 Millionen € aufgestockt. Mit Beginn der Kofinanzierung durch die Europäischen<br />
Gemeinschaft (EAGFL und EFRE) wird mit einem durchschnittlichen jährlichem Mitteleinsatz von 115 Mio. €<br />
<strong>bis</strong> zum Jahr 2020 gerechnet.<br />
Koordination mit anderen Förderbereichen<br />
Vorschläge für die Art der <strong>Förderung</strong> von Projekten entlang der Gewässer werden von den Wasserwirtschaftsämtern<br />
entwickelt; die Entscheidung darüber fällt das StMLU in Abstimmung mit der jeweiligen Bezirksregierung.<br />
Insofern ist auf der Entscheidungsebene eine ausreichende Koordination sicher gestellt.<br />
Eine andere Fördermöglichkeit für Maßnahmen, die der Sicherung von Flächen entlang der Fließgewässer<br />
dienen, besteht im Rahmen <strong>des</strong> Ziel 2-Programms unter der Verantwortung <strong>des</strong> Bayerischen Wirtschaftsministeriums.<br />
Hier können im Schwerpunkt 1 grundsätzlich EFRE-Mittel für Projekte <strong>des</strong> technischen Hochwasserschutzes<br />
eingesetzt werden. Diese Vorhaben zielen jedoch in erster Linie auf den Schutz von Gebieten<br />
mit überwiegend gewerblicher Nutzung und stehen damit nicht in direkter Konkurrenz zu den Fördermaßnahmen<br />
im EPLR. Eine inhaltliche Abstimmung zwischen den Förderbereichen erfolgt über die Bezirksregierungen.<br />
Einbindung der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Umweltverbände<br />
Da jede Maßnahme, die Veränderungen am Gewässerkörper oder an den angrenzenden Grundstücken zur<br />
Folge hat, ein Planfeststellungsverfahren benötigt, sind im Rahmen <strong>des</strong> wasserrechtlichen Verfahrens Gebietskörperschaften,<br />
Interessenverbände und Vertreter von sonstigen Trägern öffentlicher Belange automatisch<br />
beteiligt worden. Eine Reihe von öffentlichen Institutionen (insbesondere Gebietskörperschaften) hat<br />
260 vgl.: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 1995: Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz.<br />
433
434<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
sich zudem aktiv durch Entwicklung von Konzepten und Projekten gegen Hochwasser in den Verfahrensablauf<br />
eingeschaltet. Dieses Engagement wird von den Wasserwirtschaftsämtern sehr geschätzt.<br />
Programmbegleitung<br />
Mit der Wasserwirtschaftlichen Vorhabens- und Leistungsdatei (WAL) werden alle Projekte begleitet. Dies<br />
beginnt mit der Eingabe der Vorhabens- und Planungsdaten <strong>des</strong> Bauentwurfs. Nach der Prüfung <strong>des</strong> Bauentwurfs<br />
werden die Daten in der WAL ergänzt und angepasst. Der nächste Schritt ist die Darstellung der<br />
Finanzierung gemäß Finanzplan. In der WAL wird das Jahresbauprogramm bzw. der Förderumfang festgelegt.<br />
Während der Bauphase werden in der WAL die Projektausgaben geführt und mit dem Bayerischen<br />
Mittelbewirtschaftungssystem bzw. der Staatsoberkasse abgeglichen. Nach Abschluss der Baumaßnahme<br />
wird der geprüfte und genehmigte Schlussbericht bzw. Verwendungsnachweis in die WAL aufgenommen.<br />
Der hauptsächlich auf Finanzdaten aufgebaute Bericht ist zwar auch mit Angaben zu Zielen versehen. Eine<br />
Basis für ein erfolgsorientiertes jährliches Monitoring bietet er jedoch nicht.<br />
Der Schlussbericht und der Verwendungsnachweis könnten für die Evaluation einzelner Projekte eine gute<br />
Grundlage darstellen. Weil diese Berichte allerdings erst zum Abschluss der Projekte zur Verfügung stehen,<br />
bieten sie wenig Informationsgehalt während der Projektlaufzeit.<br />
Zu den abgeschlossenen Projekten an Gewässern II. Ordnung lagen die Verwendungsnachweise fast vollständig<br />
vor. Zu den Maßnahmen an Gewässern I. Ordnung existierte dagegen <strong>bis</strong> Ende 2002 erst ein<br />
Schlussbericht, obwohl die Wasserwirtschaftsämter bei der Befragung bereits 14 Vorhaben als „abgeschlossen“<br />
einstuften.<br />
Kontrolle<br />
Neben der internen Kontrolle, die alle Maßnahmen gemäß der Verfahrensbeschreibung 261 permanent begleitet,<br />
wurden folgende Prüfungen durchgeführt:<br />
• Prüfung von jeweils 4 Vorhaben durch das Referat Finanzkontrolle <strong>des</strong> StMLU in den Haushaltsjahren<br />
2001 und 2002;<br />
• Prüfung von je 3 Vorhaben durch die bescheinigende Stelle im Staatsministerium der Finanzen im<br />
gleichen Zeitraum;<br />
• Prüfung von 4 Vorhaben <strong>des</strong> Prüfdienst Buchprüfung nach Auswahl durch das Hauptzollamt Hamburg-Jonas<br />
- Zentrale Betrugsbekämpfungsstelle - für das Haushaltsjahr 2000; dieses Prüfung erfolgt<br />
nach der EG-Verordnung 4045/89 und wurde von einem Mitarbeiter der Regierung der Oberpfalz<br />
durchgeführt.<br />
Diese Kontrollen dienen der ständigen Verbesserung <strong>des</strong> Verfahrensablaufs und haben zur Transparenz der<br />
Vorhaben beigetragen. Unter anderem haben sie zu einer Verbesserung und Standardisierung der Prüfverfahren<br />
geführt. Aufgrund der nachträglichen Konkretisierung der Bewilligungskriterien kam es in acht Fällen<br />
zu Rückzahlungen von Fördermitteln.<br />
Verwaltungsaufwand und Aufwand für die Letztempfänger<br />
Jede Maßnahme <strong>des</strong> vorbeugenden Hochwasserschutzes verursacht einen spezifischen Zeit- und Personalbedarf.<br />
Nicht zuletzt sind externe Faktoren (Witterung) und die Notwendigkeit zu eigentumsrechtlichen<br />
Regelungen mit dafür verantwortlich, wie rasch ein Vorhaben umgesetzt werden kann. So lassen sich z.B.<br />
Vorhaben mit vorbereitender Wirkung zumeist in einer kürzeren Zeit durchführen als die eigentlichen „Kernprojekte“.<br />
Für die eigentumsrechtliche Übertragung eines Grundstücks mit willigem Besitzer sind im Mittel 4<br />
<strong>bis</strong> 10 Tage zu veranschlagen. Fehlende Bereitschaft zur Eigentumsübertragung kann Projekte stark verzö-<br />
261 Verfahrensbeschreibung für Maßnahmen <strong>des</strong> staatlichen Wasserbaus - Gewässer erster Ordnung - gefördert durch den “Plan zur<br />
<strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes” EAGFL, Abteilung Garantie, interne Arbeitunterlage <strong>des</strong> StMLU mit dem Stand vom<br />
08.04.2003
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
gern. Dies ist grundsätzlich nicht auszuschließen, wenn z.B. bei einer Deichbaumaßnahme eine Vielzahl von<br />
Grundstücken entlang eines Gewässerlaufes betroffen sind.<br />
Für Maßnahmen <strong>des</strong> Ökoausbaus und der Herstellung von Retentionsflächen wurde von den Wasserwirtschaftsämtern<br />
ein Zeitbedarf von 3 <strong>bis</strong> 9 Monaten angegeben. Eine Verallgemeinerung verbietet sich aber<br />
auch hier. Dies gilt analog für Deichbaumaßnahmen. Sie sind die umfangreichsten und zugleich personalintensivsten<br />
Projekte mit einer Min<strong>des</strong>t-Umsetzungszeit von 9 <strong>bis</strong> 18 Monaten.<br />
Bei den Wasserwirtschaftsämtern werden die Projekte in der Regel von mehreren Mitarbeitern begleitet, um<br />
je nach Entwicklungsfortschritt unterschiedlichen Sachverstand einsetzen zu können. Bei den Baumaßnahmen<br />
vor Ort ist das WWA für die Bauleitung verantwortlich. Externe Ingenieurbüros werden unter anderem in<br />
Entwurfsplanungen und Vermessungen eingebunden.<br />
10.5.8 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der relevanten Bewertungsfragen<br />
10.5.8.1 Plausibilitätsprüfung, Hinzufügen von Kriterien und Indikatoren<br />
Die im Katalog der gemeinsamen Bewertungsfragen (Dok. VI/12004/00) formulierten Fragen, Kriterien und<br />
Indikatoren ermöglichen nur eine eingeschränkte Evaluierung der Maßnahmen im Bereich <strong>des</strong> präventiven<br />
Hochwasserschutzes. Deshalb wurden entsprechend den Zielsetzungen <strong>des</strong> Programms folgende Kriterien<br />
und Indikatoren zusätzlich definiert:<br />
Kriterium IX.2-4.: Schutz von Leib und Leben sowie von Hab und Gut durch die Abwehr von Gefahren,<br />
die durch Hochwasser verursacht werden;<br />
Der präventive Hochwasserschutz dient in erster Linie der Abwehr von Gefahren durch Hochwasser. Dies<br />
geschieht hauptsächlich durch den Bau von Deichen und die Optimierung der Fließeigenschaften und Gewässer.<br />
Um die Wirkungen <strong>des</strong> Programms ausreichend erfassen und bewerten zu können, wurde das Kriterium<br />
IX.2-4. mit folgenden zusätzlichen Indikatoren neu definiert:<br />
• Indikator IX.2-4.1.: Anzahl der Einwohner, die direkt von der Sicherungsmaßnahme <strong>des</strong> Siedlungsraumes<br />
profitieren (Anzahl);<br />
• Indikator IX.2-4.2.: Gesicherte Infrastruktureinrichtungen (Beschreibung);<br />
• Indikator IX.2-4.3.: Herstellung von Retentionsraum (in m³);<br />
• a) davon geschaffene Flächen mit auetypischen Strukturen (in m²);<br />
• Indikator IX.2-4.4.: Erweiterung <strong>des</strong> Durchflussquerschnitts (in m²).<br />
10.5.8.2 Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der ländlichen Bevölkerung<br />
(Frage IX.1)<br />
Grundsätzlich stehen Einkommenswirkungen nicht im Vordergrund <strong>des</strong> Interesses an Schutzmaßnahmen<br />
gegen Hochwasser. Sie lassen sich zudem wegen <strong>des</strong> vorsorgenden Charakters der Schutzmaßnahmen<br />
auch kaum quantifizieren. Dazu müsste ein Mit-Ohne-Vergleich angestellt werden können und zugleich eine<br />
Aussage über die Wahrscheinlichkeit von Hochwasserschäden und deren Höhe möglich sein. Weil dies<br />
problematisch ist, kann die Mehrzahl der in Tabelle 163 aufgeführten Kriterien und Indikatoren nicht behandelt<br />
werden.<br />
435
436<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 163: Kriterien und Indikatoren zur Bewertung von Einkommenswirkungen<br />
Kriterium<br />
Indikator<br />
Kriterium/Indikator Beantwortet<br />
IX.1-1. Erhaltung/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens aus landwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten<br />
IX.1-1.1. Anteil <strong>des</strong> auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkommens<br />
der landwirtschaftlichen Bevölkerung<br />
(€/Begünstigter, Anzahl der betreffenden Personen)<br />
IX.1-1.2. Verhältnis von {Kosten} zu {Umsatzerlösen} der geförderten,<br />
mit den landwirtschaftlichen Betrieben in Zusammenhang ste-<br />
IX.1-1.3.<br />
(n)<br />
henden Tätigkeiten<br />
Erhalt/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der landwirtschaftlichen<br />
Bevölkerung als indirekte Wirkung von Investitionen in ländliche<br />
Infrastruktur (Beschreibung)<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
(X)<br />
Nicht<br />
beantwortet<br />
a<br />
Nicht<br />
zutreffend<br />
IX.1-2. Erhaltung/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens aus nichtlandwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.1-2.1. Anteil <strong>des</strong> auf Grund der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens<br />
von nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen Begünstigten<br />
(€/Begünstigter, Anzahl der betreffenden Personen)<br />
(X)<br />
IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung, die<br />
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen<br />
bezieht, welche auf Grund von Beihilfen in nichtlandwirtschaftlichen<br />
Sektoren getätigt wurden bzw. entstanden sind (in %)<br />
(X)<br />
IX.1-2.3 Erhalt/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der nichtlandwirt-<br />
X<br />
(n) schaftlichen Bevölkerung als indirekte Wirkung von Investitionen<br />
in ländliche Infrastruktur (Beschreibung)<br />
IX.1-2.4 Erhalt/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens im ländlichen Raum in<br />
X<br />
(n) der Planungs- und Realisierungsphase von Projekten<br />
a<br />
Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
Einkommensverbesserungen für die Landwirtschaft (Kriterium IX.1-1)<br />
Auf Grund <strong>des</strong> Vergabeverfahrens besteht grundsätzlich keine Möglichkeit, dass beim Ausbau oder der<br />
Entwicklung von Hochwasserschutzprojekten Landwirte direkt von den durchgeführten Maßnahmen profitieren.<br />
Einkommenswirkungen bei Landwirten sind nur als indirekte Wirkungen grob erfassbar:<br />
• in Form von Zusatzeinkommen aus der Pflege und dem Erhalt (nicht Bau) von Einrichtungen <strong>des</strong> vorbeugenden<br />
Hochwasserschutzes; diese sind teilweise mit Maßnahmen <strong>des</strong> pflegenden <strong>Naturschutzes</strong><br />
(Landschaftspflege) vergleichbar 262 sowie<br />
• durch Stabilisierung von Erträgen und/oder Verminderung von Bewirtschaftungsaufwendungen als<br />
Folge von Hochwasserschutzmaßnahmen.<br />
Erhalt/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der landwirtschaftlichen Bevölkerung als indirekte Wirkung<br />
von Investitionen in ländliche Infrastruktur (Beschreibung, Indikator IX.1-1.3)<br />
In 42 der 74 zurück gesandten Fragebögen wurde von den Wasserwirtschaftsämtern angegeben, dass<br />
landwirtschaftliche Betriebe von den Maßnahmen betroffen seien. Dabei sei davon auszugehen, dass in 20<br />
Fällen (27 % der Grundgesamtheit) eine positive Einkommenswirkung durch die Sicherung von insgesamt<br />
2.506 ha Grünland und 2.443 ha Ackerland erreicht werden konnte. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl aller<br />
101 Verfahren dürften demnach<br />
262<br />
Die Maßnahmen werden im Rahmen <strong>des</strong> Pflege- und Unterhaltungsprogramm vergeben. Häufige Auftragnehmer sind nach Aussagen<br />
der Wasserwirtschaftsverwaltung die Maschinenringe.<br />
X<br />
X
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• ca. 3.400 ha Grünland und<br />
• ca. 3.300 ha Ackerfläche<br />
nachhaltig vor Überschwemmungsschäden geschützt werden. Welche Einkommensvorteile damit zusammen<br />
hängen, ist schwer abzuschätzen, weil von den potenziell begünstigten Betrieben keine Informationen<br />
zur Produktionsstruktur und Bewirtschaftungsintensität ihrer Betriebe vorliegen.<br />
Soweit landwirtschaftliche Flächen für Deichbauvorhaben beansprucht wurden, erfolgte jeweils eine Kompensation<br />
<strong>des</strong> Substanzverlustes – in der Mehrzahl der Fälle monetär zum Verkehrswert, in wenigen Fällen<br />
auch durch Bereitstellung von Ersatzland. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 67 ha Grünland und 112<br />
ha Ackerland über die Wasserwirtschaftsämter aufgekauft. Die Bereitschaft zum Verkauf von Grundstücken<br />
für Zwecke <strong>des</strong> Hochwasserschutzes war nach Aussagen der zuständigen Bearbeiter in den Ämtern unterschiedlich.<br />
Von weniger gut zu nutzenden Flächen in potenziellen Überschwemmungsbereichen sich zu<br />
trennen, fiel den Landwirten sichtlich leichter.<br />
Relativ unbedeutend war im Berichtszeitraum die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen als<br />
Retentionsraum ohne Eigentumsübergang. Dafür wurden überwiegend Flächen herangezogen, die keiner<br />
landwirtschaftlichen Nutzung unterlagen.<br />
Tabelle 164: Für Hochwasserschutzmaßnahmen beanspruchte landwirtschaftliche Flächen<br />
Art der Flächenbeanspruchung<br />
Nennungen Grünland Ackerland<br />
Anzahl % (ha)<br />
(ha)<br />
Sicherung von Anbauflächen durch Hochwasserschutz 20 27 2.506 2.443<br />
Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen zu Retentionsraum<br />
26 35 219 520<br />
Flächeninanspruchnahme Kauf 25 34 67 112<br />
durch Tausch 5 7 3,8 8<br />
Nutzungsausfall wird im Ereignisfall entschädigt<br />
(z.B. Retentionsflächen)<br />
7 9 314 536<br />
Erhaltung und Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens von nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen<br />
Personen (Kriterium IX.1-2.)<br />
Die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung kann in zweifacher Weise Einkommenswirkungen von Maßnahmen<br />
<strong>des</strong> Hochwasserschutzes erwarten. Sie werden nachstehend in allgemeiner Form beschrieben, weil die in<br />
Tabelle 163 aufgeführten Indikatoren nicht in der gewünschten Detailliertheit beantwortet werden können.<br />
(1) Einkommenswirkungen durch die Vergabe von Aufträgen für die Anlage von Hochwasserschutz-<br />
Einrichtungen; dies betrifft in erster Linie regionale Bau- und Handwerksunternehmen. Unter der Annahmen,<br />
dass die Bauleistungen für vorbeugenden Hochwasserschutz von regionalen Unternehmen<br />
erbracht wurden und im bayerischen Bauhauptgewerbe im Schnitt 25,5 % <strong>des</strong> Umsatzes in Form von<br />
Bruttolöhnen der Entlohnung der Angestellten dienen, 263 wären bei einem Bauvolumen von 23,5 Mio €<br />
Brutto-Einkommen von 6 Mio. € über die Maßnahmen <strong>des</strong> Hochwasserschutzes gebildet worden. Ob<br />
es sich dabei um eine längerfristige Einkommenssicherung handelt, hängt vom weiteren Verlauf der<br />
Hochwassergefährdung und den dadurch ausgelösten Finanzmittelströmen ab.<br />
Auch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe an Standorten, die früher hochwassergefährdet und für<br />
eine Bebauung nicht zugelassen waren, dürfte mittelfristig zu positiven Einkommenseffekten führen.<br />
437
438<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Von den Wasserwirtschaftsämtern wurde diesbezüglich auf acht Fälle (von 74, = 11 %) mit entsprechenden<br />
Effekten verwiesen. Welche regionalen Einkommenswirkungen dadurch ausgelöst wurden,<br />
lässt sich zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung nicht abschätzen.<br />
(2) Weitere indirekte Wirkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen können sich z.B. in einer Erhöhung<br />
regionaler Potenziale ausdrücken, deren Nutzung eine künftig höhere regionale Wertschöpfung und<br />
Einkommensbildung ermöglicht. Beispiele wären etwa der Ausbau touristischer Infrastruktur im Zusammenhang<br />
mit Deichbaumaßnahmen oder die allgemeine Erhöhung der Attraktivität von Gemeinden<br />
als Wohnstandort.<br />
Von den Wasserwirtschaftsämtern wurde bei den Befragungen für 26 Vorhaben eine Synergie zwischen<br />
Hochwasserschutzmaßnahmen und der Entwicklung <strong>des</strong> Tourismus genannt. Die häufigsten<br />
Antworten waren: Schaffung von (mehr) Rad- und Wanderwegen (22), Aufwertung <strong>des</strong> Landschaftsbil<strong>des</strong><br />
(8), neue Angebote für Angler (5) und Erhöhung der allgemeinen Anreize für den Fremdenverkehr.<br />
Vor allem die Attraktivität der Auebereiche für Zwecke der Naherholung konnte durch die<br />
Schutzmaßnahmen erhöht werden.<br />
Welche Einkommenswirkungen hiervon im Einzelnen ausgingen, kann frühestens in einer späteren Ex post-<br />
Evaluierung quantifiziert werden, wenn die geschaffenen touristischen “Nebenleistungen“ umfassender genutzt<br />
werden.<br />
10.5.8.3 Beitrag zum Erhalt der Lebensbedingungen und <strong>des</strong> Wohlergehens der ländlichen Bevölkerung<br />
als Ergebnis der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeitangebote<br />
oder durch Verringerung der Abgelegenheit (Frage IX.2)<br />
Tabelle 165: Kriterien und Indikatoren zur Bearteilung von Fördereinflüssen auf die regionalen<br />
Lebensbedingungen<br />
Kriterium<br />
Indikator<br />
Kriterium/Indikator Beantwortet<br />
Nicht beantwortet<br />
a<br />
Nicht<br />
zutreffend<br />
IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit X<br />
IX.2-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte/ Unternehmen,<br />
die Zugang zu geförderten Telekommunikationseinrichtungen/-diensten<br />
haben (in %, Anzahl)<br />
X<br />
IX.2-1.2. Transporte/Wege, die auf Grund von Fördermaßnahmen erleichtert<br />
oder unnötig wurden<br />
X<br />
IX.2-1.3. Hinweise auf wirtschaftliche Tätigkeiten, die sich aus der geförderten,<br />
verbesserten Telekommunikations- oder Transporteinrichtungen<br />
ergeben haben (Beschreibung)<br />
X<br />
IX.2-2. Erhaltung/Verbesserung der sozialen und kulturellen Einrichtungen,<br />
insbesondere für Jugendliche und junge Familien<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.2-2.1. (g) Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozialen/<br />
kulturellen/sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die<br />
von geförderten Einrichtungen abhängen (in %)<br />
X<br />
IX.2-2.2. (n) Anteil der Einrichtungen, die in Tourismusregionen liegen und<br />
soziale/kulturelle/sportliche und freizeitbezogene Aktivitäten<br />
anbieten (in %)<br />
(X)<br />
IX.2-2.3. (n) Hinweise auf Projekte, die im Besonderen die Bedürfnisse von<br />
Jugendlichen und älteren Menschen berücksichtigen (Beschreibung)<br />
X<br />
IX.2-3. Erhaltung/Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen in der<br />
unmittelbaren Umgebung, Erhaltung/Verbesserung der Wohnbedingungen<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
263<br />
Vgl. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Statistik und Datenverarbeitung: Statistische Berichte E2110J 200200: Bauhauptgewerbe in Bayern<br />
im Jahre 2002. München 2003, Tabellen 4a und 4c.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
IX.2-3.1. (g) Anteil geförderter Wander- und Radwege*, die einen Beitrag zur<br />
Verbesserung der Freizeitaktivitäten leisten (km, %)<br />
IX.2-3.2. (g) Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum,<br />
die auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert<br />
haben (Anzahl und %)<br />
IX.2-3.3. (n) Hinweise auf die Verbesserung <strong>des</strong> Wohnumfel<strong>des</strong> bzw. der<br />
Wohnstandortqualität und der Lebensbedingungen (Beschreibung)<br />
(X)<br />
IX.2-4. (n) Schutz von Leib und Leben sowie von Hab und Gut durch die<br />
Abwehr von Gefahren, die durch Hochwasser verursacht werden<br />
X<br />
IX.2-4.1. (n) Anzahl der Einwohner, die direkt von Sicherungsmaßnahmen<br />
<strong>des</strong> Siedlungsraumes profitieren (Anzahl)<br />
X<br />
IX.2-4.2. (n) Gesicherte Infrastruktureinrichtungen (Beschreibung) X<br />
IX.2-4.3. (n) Herstellung von Retentionsraum (in m³)<br />
a) davon geschaffene Flächen mit abflusshemmenden Strukturen<br />
X<br />
IX.2-4.4. (n) Erweiterung <strong>des</strong> Durchflussquerschnitts (in m²) X<br />
a Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
* Hier handelt sich um Deich- und Deichhinterwege, die als Wander- und Radwege genutzt werden.<br />
Kriterium IX.2-2.: Erhaltung/Verbesserung der sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie<br />
Kriterium IX.2-3.: Erhaltung und Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen in der unmittelbaren<br />
Umgebung, Erhaltung/Verbesserung der Wohnbedingungen<br />
Beide Kriterien beziehen sich auf sehr gleichartige Sachverhalte und werden <strong>des</strong>halb gemeinsam behandelt.<br />
Dabei ist es lediglich möglich, Veränderungen im Angebot an lokalen Infrastruktureinrichtungen, nicht jedoch<br />
deren Nutzung (Nachfrage) zu beschreiben. Dazu wäre es erforderlich gewesen, im Einzelfall die ländliche<br />
Bevölkerung zu bestimmen, die von den erhaltenen bzw. neu geschaffenen Einrichtungen profitiert hat.<br />
Kapazitive Auswirkungen auf die lokale Infrastruktur ergeben sich primär im Bereich <strong>des</strong> Wegebaus und <strong>des</strong><br />
Erhalts bzw. Ausbaus von lokalen Naherholungsrichtungen.<br />
Einrichtungen für soziale, kulturelle/sportliche und freizeitbezogene Aktivitäten in Tourismusregionen<br />
(Indikator IX.2-2.2)<br />
Gewässer mit ihrem Ufer sind immer eine Gelegenheit zur Naherholung. Das Bedürfnis, sich entlang von<br />
Flüssen und Bächen aufzuhalten, durch Angebote zu steuern, ist zum einen ein wichtiges Instrument zum<br />
Erhalt von naturschutzwürdigen Lebensräumen, zum anderen aber auch maßgeblich für die Sicherung von<br />
Einrichtungen <strong>des</strong> Hochwasserschutzes.<br />
Auf die Frage nach einer indirekten <strong>Förderung</strong> von Naherholungseinrichtungen durch die Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
ergaben sich Antworten in 37 der 74 Fragebögen. Durch Mehrfachnennungen wurden<br />
insgesamt 89 Angaben erfasst.<br />
X<br />
X<br />
439
440<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 166: Erhaltung bzw. Schaffung von Naherholungseinrichtungen im Rahmen <strong>des</strong> vorbeugenden<br />
Hochwasserschutzes (n = 37 von 74)<br />
Touristisch nutzbare Einrichtungen<br />
Erhalten Neu erstellt<br />
Bezogen<br />
auf 101<br />
Projekte<br />
Parkplatz - 3 4<br />
Badeweiher 1 3 4<br />
Aussichtsmöglichkeiten 1 8 11<br />
Angelweiher 2 8 11<br />
Sonstiges - 9 12<br />
Wanderwege - 9 12<br />
Lehrpfade 1 9 12<br />
Zugang zum Gewässer 5 30 41<br />
In den 10 Fällen, in denen bestehende Einrichtungen erhalten wurden, handelte es sich um Vorhaben <strong>des</strong><br />
Bestandsschutzes; dabei wurden Weiher, Lehrpfade oder Zugangsmöglichkeiten zu Gewässern im Rahmen<br />
der Hochwasserschutzmaßnahmen verlegt oder umgestaltet und so längerfristig gesichert.<br />
Bei der Herstellung neuer Naherholungseinrichtungen stand die Schaffung geregelter Zugänge zum Gewässer<br />
in 30 Vorhaben im Vordergrund. Diese Erschließung hat natürlich in erster Linie eine Schutzfunktion –<br />
die schnelle Erreichbarkeit z.B. von Deichen und begleitenden Einrichtungen; sie kann aber zugleich auch<br />
eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau <strong>des</strong> ländlichen Tourismus darstellen. Dies gilt ebenso für die<br />
relativ hohe Zahl von Fällen, in denen Weiher neu angelegt wurden.<br />
Die Anlage von Wanderwegen und Lehrpfaden wurde bei jeweils 9 Projekten durchgeführt. Aufklärung und<br />
Information über Inhalte und Bedeutung der Gewässer mit ihren Schutzvorkehrungen erhöhen die Akzeptanz<br />
und Einsicht von teilweise sehr umfangreichen Baumaßnahmen und auch Einschränkungen. Diese<br />
Form der Aufklärung vor Ort ist eine Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Hochwasser“.<br />
Geförderte Wander- und Radwege zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur (Indikator IX.2-<br />
3.1)<br />
In 29 der 74 erhobenen Fälle wurden Wander- und Radwege in Verbindung mit Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
gebaut. Fast alle (87,7 von 88,5 km) Hinterdeichwege, die angelegt wurden, sind als Rad- oder<br />
Wanderwege nutzbar. Auch die Deichwege sind zum größten <strong>Teil</strong> (93% oder 53,5 km von 57,6 km) so entwickelt,<br />
dass sie Wanderern und Radfahrern dienen können. Bei Ortsterminen konnte stichprobenhaft festgestellt<br />
werden, dass diese Wege in die regionalen Radwegenetze mit Hinweistafeln und Markierungen integriert<br />
worden sind. Hochgerechnet auf alle 101 Förderfälle (<strong>bis</strong> 31.12.2002) ist davon auszugehen, dass im<br />
Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
• ca. 120 km Deichhinterwege, die als Rad- und Wanderwege genutzt werden können sowie<br />
• weitere ca. 75 km potenzielle Wander- und Radwege auf den Deichkronen neu entstanden sind.<br />
Verteidigungswege sind in der Regel Zufahrten zu den Deichen, die durch landwirtschaftliche Nutzflächen<br />
führen. Diese Wege müssen so ausgestattet sein, dass sie auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen<br />
von schweren Fahrzeugen genutzt werden können. Der Ausbau und die Herstellung dieser Wege hat neben<br />
der Hinführung von Radfahrern und Wanderern zu den gewässerbegleitenden Wegen eine verbesserte Erschließung<br />
für landwirtschaftliche Zwecke zur Folge. In den 29 untersuchten Förderfällen wurden Verteidigungswege<br />
bzw. Zufahrten in einer Länge von 103 km erstellt. Hochgerechnet auf alle Förderfälle ergibt sich<br />
eine Weglänge von gut 140 km, die der landwirtschaftlichen Nutzung, grundsätzlich aber auch dem Rad-<br />
und Wandertourismus, zur Verfügung stehen.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Kriterium IX.2-4.: Schutz von Leib und Leben sowie von Hab und Gut durch die Abwehr von Gefahren,<br />
die durch Hochwasser verursacht werden<br />
Die Sicherung von Leib und Leben sowie Hab und Gut steht im Mittelpunkt dieser Maßnahme. Neben den<br />
direkt erfassbaren Auswirkungen im näheren Umfeld darf man nicht vergessen, dass der Nutzen dieser Projekte<br />
auch weiter flussabwärts gesehen werden sollte. In insgesamt 50 Fällen wurden Angaben zu diesen<br />
Fragestellungen abgegeben.<br />
Anzahl der Einwohner, die direkt von Sicherungsmaßnahmen profitieren (Indikator IX.2-4.1)<br />
In 24 Fällen (von insgesamt 74 Fördervorhaben) wurde angegeben, dass durch die Hochwasserschutzmaßnahme<br />
Siedlungsbereiche nachhaltig gesichert werden. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass etwa<br />
156.000 Personen direkt von dieser Maßnahme profitieren. Hochgerechnet auf alle 101 Förderfälle wäre von<br />
etwa 213.000 Begünstigten auszugehen.<br />
Bezogen auf die Ziele <strong>des</strong> “Aktionsprogramm 2020 für Donau- und Maingebiet“ <strong>des</strong> StMLU, das einen ausreichenden<br />
Schutz für 300.000 Einwohner anstrebt, stellen die <strong>bis</strong>herigen Maßnahmen innerhalb von drei<br />
Jahren einen hohen Beitrag dar. Sie unterstreichen die hohe Wertigkeit <strong>des</strong> Hochwasserschutzes in den<br />
Zielen der Lan<strong>des</strong>politik.<br />
Gesicherte Infrastruktureinrichtungen (Indikator IX.2-4.2 (n))<br />
In 28 von 74 Fällen wurden durch die Hochwasserschutzmaßnahmen öffentliche Infrastruktureinrichtungen<br />
gesichert. Dabei handelt es sich primär um Verkehrswege außerhalb und innerhalb von Ortschaften, um<br />
Schulen, Krankenhäuser sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen innerhalb von Siedlungen. Die Schutzmaßnahmen<br />
tragen dazu bei, die Funktion dieser Einrichtungen nachhaltig zu nutzen. Sie verringern mögliche<br />
Kostenbelastungen der öffentlichen Haushalte durch Hochwasser und fördern die Attraktivität der Gemeinden<br />
als Wohn- und Wirtschaftsstandort.<br />
Herstellung von Retentionsraum (Indikator IX.2-4.3 (n))<br />
In 36 der 74 erhobenen Fälle (49 %) umfassten die Maßnahmen zum Hochwasserschutz auch die Schaffung<br />
von Retentionsraum für künftige Hochwässer. In 30 % aller durchgeführten Maßnahmen bildete die Retentionsraumschaffung<br />
sogar das Hauptziel (vgl. Tabelle 159).<br />
Der mit Hilfe <strong>des</strong> Förderprogramms zusätzlich gewonnene Retentionsraum wurde für die 36 analysierten<br />
Fälle mit 13,6 Mio m³ angegeben. Hochgerechnet auf alle Förderfälle ist von einer Ausweitung der Wasserrückhalteflächen<br />
um ca. 18,5 Mio m³ auszugehen. Das im EPLR genannte Ziel der Schaffung von 1 <strong>bis</strong> 2<br />
Mio m³ Retentionsraum pro Jahr wurde damit um ein Mehrfaches überschritten. Darin kommt u.a. zum Ausdruck,<br />
dass die Wasserwirtschaftsverwaltung ihre Anstrengungen bei der Umsetzung <strong>des</strong> Förderprogramms<br />
gezielt auf die Realisierung möglichst wirkungsvoller Projekte konzentrierte.<br />
Herstellung von Flächen mit abflusshemmenden Strukturen (Indikator IX.2-4.3.a (n))<br />
Die Verminderung der Abflussgeschwindigkeit bildet auf der einen Seite ein Ziel der Hochwasserschutzpolitik,<br />
zugleich kann der Einbau abflusshemmender Strukturen in Fließgewässer aber auch als ein Indikator zur<br />
Überprüfung der Zielerreichung verwendet werden. Er beschreibt die „Rauhigkeit“ im Gewässerkörper, mit<br />
der die Abflussdynamik verringert wird. Als Maßnahmen kommen dafür in erster Linie Gehölzanpflanzungen<br />
und die Entwicklung von Röhricht in Frage; aber auch die Öffnung alter Flussschleifen und die Neuentwicklung<br />
von Mäandern wirken in die gleiche Richtung.<br />
441
442<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
In 29 der 74 Projekte wurden Maßnahmen dieser Art durchgeführt. Insgesamt wurden auf einer Fläche von<br />
62,4 ha (20,8 ha/Jahr) abflusshemmende Strukturen neu aufgebaut (z.B. Röhricht) oder wieder nutzbar gemacht<br />
(z.B. alte Flussarme). Hochgerechnet auf die Grundgesamtheit von 101 Förderfällen ergibt sich eine<br />
Maßnahmenfläche von 85 ha. Die als Ziel postulierte Schaffung von 10 ha pro Jahr wurde damit um knapp<br />
das Dreifache übertroffen. Von einer weiteren Expansion dieser Maßnahme ist auszugehen, denn zum<br />
31.12.2002 waren in den 74 analysierten Fällen weitere ca. 450 ha Flächen in Bearbeitung, auf denen abflusshemmende<br />
Strukturen geschaffen werden sollen.<br />
Erweiterung <strong>des</strong> Durchflussquerschnitts (Indikator IX.2-4.4 (n))<br />
Die Erweiterung <strong>des</strong> Durchflussquerschnitts kann als Kennwert für die Aufweitung <strong>des</strong> Flusskörpers herangezogen<br />
werden. Die Möglichkeit, einen Flusskörper aufzuweiten, findet ihre Grenzen in der geologischen<br />
und topografischen Besonderheit <strong>des</strong> Talraumes und <strong>des</strong>sen Nutzung. Neben Siedlungsgebieten und Verkehrswegen<br />
sind gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzungen limitierende Faktoren bei der Herstellung<br />
eines mit weiten Retentionsräumen versehenen Entwässerungssystems.<br />
Die in 34 Fragebögen dargestellten Angaben zum Durchflussquerschnitt müssen immer im Zusammenhang<br />
mit einem konkreten (räumlich begrenzten) Gewässerabschnitt gesehen werden (vgl. Tabelle 167). Die Angaben<br />
streuen zwischen 20 <strong>bis</strong> 880 m² Fläche, um die der Flusslauf in einem bestimmten Abschnitt erweitert<br />
wurde. Daraus ergibt sich beispielsweise für eine Erweiterung von 20 m² bei einer Gewässerbreite von 40 m<br />
eine Erhöhung <strong>des</strong> Abflussquerschnitts von 0,5 m. Die großen Werte der Erweiterung <strong>des</strong> Durchflussquerschnittes<br />
sind Hinweise auf entsprechende Rückverlegung der Deiche.<br />
In jeweils 18 Fällen wurde eine Erweiterung <strong>des</strong> Flussbetts durch die Rücknahme von Deichen bzw. durch<br />
die Absenkung der angrenzenden Flächen angegeben. In 12 Fällen wurde die Verbreiterung durch das Tieferlegen<br />
von Querriegeln, die Vertiefung der Flusssohle oder durch Aufweitung von Brückendurchlässen<br />
erreicht.<br />
Tabelle 167: Fließgewässer mit Angaben zur Erweiterung <strong>des</strong> Durchflussquerschnitts<br />
Gewässer<br />
Durchfluss-Querschnitt<br />
(m²) zusätzlich<br />
Gewässer Durchfluss-Querschnitt<br />
(m²) zusätzlich<br />
Altmühl Variabel, 25 Strogen 200<br />
Itz > 100 Sächsische Saale 20<br />
Rodach 20 – 50 Iller 150<br />
Main > 100 Donau 225<br />
Vils, Naab, Schwarzach 30 Naab, Vils 120<br />
Kinsach 100 Isen Variabel<br />
Isar/Amper 250 Fränkische Saale 30<br />
Isar 150 – 880 Salzach 50<br />
Mehrfachangaben bei einzelnen Flüssen, weil an unterschiedlichen Flussabschnitten Erweiterungen <strong>des</strong> Durchflussquerschnittes<br />
vorgenommen wurden. Die Einzelnennungen wurden in dieser Tabelle aggregiert.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
10.5.8.4 Beitrag zum Erhalt von Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten (Frage IX.3)<br />
Die Frage nach den durch die Hochwasserschutzmaßnahmen ausgelösten Beschäftigungswirkungen hat<br />
nur geringe Relevanz. Direkte und dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten können sich durch einmalige<br />
Maßnahmen nur bedingt entwickeln. Sofern andererseits davon ausgegangen werden kann, dass Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
künftig einen festen Bestandteil in ländlichen Entwicklungsprogrammen ausmachen,<br />
werden auch Beschäftigungswirkungen feststellbar sein. Sie ergeben sich aus der Ausführung von Baumaßnahmen<br />
sowie deren Planung, Kontrolle und Verwaltung. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte werden daran nur<br />
in geringem Umfang beteiligt sein.<br />
Indirekte Beschäftigungswirkungen können sich aus der verbesserten Nutzung lokaler oder regionaler Ressourcen<br />
ableiten. Sie gründen sich vor allem auf Vorteile in der Flächennutzung oder auf die synergetische<br />
Nutzung von Hochwasserschutzeinrichtungen z.B. für touristische Zwecke. Eine Quantifizierung dieser Effekte<br />
war zur Halbzeitbewertung nicht möglich. Sie hätte auf der lokalen Ebene einzelbetriebliche Analysen<br />
erfordert, deren Aufwand in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Erkenntnissen stehen dürfte.<br />
Tabelle 168: Kriterien und Indikatoren zur Bewertung von Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
Kriterium<br />
Indikator<br />
Kriterium/Indikator Beantwortet<br />
Nicht beantwortet<br />
a<br />
Nicht<br />
zutreffend<br />
IX.3-1. Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für<br />
die landwirtschaftliche Bevölkerung<br />
<strong>Teil</strong>w.<br />
IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch<br />
Fördermaßnahmen geschaffen/erhalten wurden (FTE, Anzahl<br />
Betriebe)<br />
X<br />
IX.3-1.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die landwirtschaftliche Bevölkerung<br />
erhalten/geschaffen wurde (<strong>EU</strong>R/VE)<br />
X<br />
IX.3-1.3. Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die Indirekt<br />
(n) landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der <strong>Förderung</strong><br />
ländlicher Infrastruktur (FTE, Beschreibung)<br />
IX.3-1.4. Kosten pro indirekt geschaffenem oder erhaltenem Arbeitsplatz<br />
X<br />
(n) (Euro je Arbeitsplatz)<br />
IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten konnten<br />
wirksamer ausgeglichen werden<br />
X<br />
IX.3-2.1. Neu geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten während <strong>des</strong><br />
X<br />
(g)<br />
Zeitraums mit geringer landwirtschaftlicher Aktivität (FTE)<br />
IX.3-2.2. Verlängerung der Fremdenverkehrssaison (Tage/Jahr) X<br />
IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt zur Verbesserung der<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche<br />
Bevölkerung bei.<br />
<strong>Teil</strong>w<br />
IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft<br />
tätig sind (VE, Anzahl Personen)<br />
X<br />
IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft<br />
tätigen Personen erhalten/geschaffen wurde (<strong>EU</strong>R/VE)<br />
X<br />
IX.3-3.3. Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die indirekt<br />
(n) nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der<br />
<strong>Förderung</strong> ländlicher Infrastruktur (FTE, Beschreibung)<br />
IX.3-3.4. Kosten pro indirekt geschaffenem oder erhaltenem Arbeitsplatz<br />
X<br />
(n) (€ je Arbeitsplatz)<br />
IX.3-3.5. Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisie-<br />
X<br />
(n) rungsphase von Projekten (in Beschäftigtenjahren)<br />
a<br />
Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
443
444<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung<br />
(Kriterium IX.3-1.)<br />
Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung<br />
als indirekte Wirkung der <strong>Förderung</strong> ländlicher Infrastruktur (Indikator IX.3-1.3.(n))<br />
Dank der Präventionsmaßnahmen gegen Hochwasser (vgl. Tabelle 7) wurden im Berichtszeitraum 2.506 ha<br />
Ackerland und 2.443 ha Grünland dauerhaft vor Überschwemmungen gesichert. Auf diesen Flächen wurden<br />
• dauerhaft höhere Erträge gesichert,<br />
• teilweise höherwertige Fruchtfolgen ermöglicht.<br />
Diese Wirkungen können sich auch in einer umfangreicheren bzw. intensiveren Tierhaltung niederschlagen.<br />
Damit verbunden sind allerdings primär Einkommenseffekte, weniger Beschäftigungswirkungen. Es ist davon<br />
auszugehen, dass die durch den Hochwasserschutz erreichte Verbesserung der Anbaubedingungen<br />
ohne nennenswerte Änderung in den landwirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen realisierbar ist. Das<br />
schließt nicht aus, dass in Einzelfällen die Landbewirtschaftung <strong>des</strong>halb nicht aufgegeben wird, weil die Bedrohung<br />
durch Hochwassergefahren und die Verstetigung von Flächenerträgen günstigere betriebliche Perspektiven<br />
eröffnet.<br />
Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung durch<br />
Diversifizierung (Kriterium IX.3-3.(n))<br />
Erhalt/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung<br />
durch <strong>Förderung</strong> der ländlichen Infrastruktur (Indikator IX.3-3.3(n))<br />
Die Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen erfordert den Einsatz von Bauunternehmen. Nach<br />
Angaben der Wasserwirtschaftsämter übernehmen nach erfolgter Ausschreibung zumeist Unternehmen aus<br />
der näheren Umgebung die Bauausführung. Der Umfang der dadurch ausgelösten Beschäftigungswirkungen<br />
kann näherungsweise über das Bauvolumen (Umsätze) geschätzt werden. Dabei werden folgende Ausgangsdaten<br />
angenommen (Zeitraum 2000 <strong>bis</strong> 2002):<br />
• Finanzmitteleinsatz für Deicherneuerung und –sanierung, Retentionsraumschaffung und Ökoausbau:<br />
23,5 Mio €;<br />
• Umsatz je Beschäftigtem im Bauhauptgewerbe in Bayern: 113 T€;<br />
Daraus leitet sich rechnerisch ein Beschäftigungspotenzial von 69 Vollzeit-Arbeitskräften (FTE) für den Untersuchungszeitraum<br />
ab. 264<br />
Hinzu kommen Beschäftigte im Bereich der Maßnahmenplanung, Umsetzungskontrolle und <strong>des</strong> administrativen<br />
Vollzugs der Fördermaßnahmen. Nach Aussagen der Wasserwirtschaftsverwaltung ist eine Quantifizierung<br />
der Personalbindung für einzelne Maßnahmen aufgrund der Vielschichtigkeit der Aufgaben nicht möglich.<br />
Anhaltspunkte liefern die Angaben über den Aufwand bei den einzelnen Maßnahmekategorien (Deichsanierung<br />
<strong>bis</strong> zu 18 Mann-Monate, Grundstücksübertragung ab einer Woche) sowie der Förderanteile bei<br />
dem jeweiligen Gesamtumfang eines Aufgabenbereich in den Ämtern.<br />
Sofern die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in touristische Nutzungskonzepte integriert werden, können<br />
sich indirekte Beschäftigungswirkungen z.B. aus einer intensiveren touristischen Nutzung der Fördergebiete<br />
ableiten. Wie beim Indikator IX.2-3.1 bereits ausgeführt wurde, schaffen die Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
zum <strong>Teil</strong> deutliche Attraktivitätsvorteile für die betroffenen ländlichen Gebiete, z.B. durch Erweiterung <strong>des</strong><br />
Rad- und Wanderwegenetzes, durch die Entwicklung naturnaher Auelandschaften oder die Mitnutzung von<br />
Wasserbaumaßnahmen für die Naherholung. Es dürfte sich in allen Fällen um komplementäre Potenziale<br />
264 Vgl. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Statistik und Datenverarbeitung: Statistische Berichte E2110J 200200..., a.a.O., Tab. 4a und 4c.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
handeln, die zusammen mit bereits vorhandenen Standortfaktoren genutzt werden, die jedoch nicht selbst<br />
neue Entwicklungsoptionen eröffnen. In welchem Umfang dadurch zusätzliche Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
geschaffen wurden, war zur Halbzeitbewertung nicht zu erfassen.<br />
10.5.8.5 Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung von Strukturmerkmalen der Wirtschaft im<br />
ländlichen Raum (Frage IX.4)<br />
Tabelle 169: Kriterien und Indikatoren zur Beurteilung von Wirkungen auf die Wirtschaftsstruktur<br />
Kriterium<br />
Indikator<br />
Kriterium/Indikator Beantwortet<br />
IX.4 -1. Erhaltung/Verbesserung der mit der Landwirtschaft in Zusammenhang<br />
stehenden Produktionsstrukturen<br />
IX.4 -1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich auf<br />
Grund der Fördermaßnahmen Verbesserungen ergeben haben<br />
(Anzahl und % der Betriebe sowie der ha)<br />
IX.4-1.2. Geförderte neue/verbesserte Tätigkeiten, die mit der landwirtschaftlichen<br />
Erzeugung einschließlich der Vermarktung von<br />
landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen in Zusammenhang<br />
stehen (Beschreibung)<br />
IX.4-1.3. Nutzung von Kapazitäten für geförderte nichtlandwirtschaftli-<br />
che Einrichtungen (in %)<br />
IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspotenzial ist vor Naturkatastrophen<br />
geschützt bzw. nach Schädigung hierdurch wieder<br />
aufgebaut worden<br />
IX.4-2.1. Anteil bedrohter Flächen, die auf Grund von Fördermaßnahmen<br />
geschützt werden konnten (in Hektar und %)<br />
IX.4-2.2. Anteil geschädigter Flächen, die auf Grund von Fördermaß-<br />
nahmen wieder regeneriert werden konnten (in ha und %)<br />
IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum ist<br />
gefördert und das Potenzial für eine endogene Entwicklung im<br />
ländlichen Raum ist aktiviert worden.<br />
X<br />
X<br />
Nicht<br />
beantwortet<br />
a<br />
Nicht<br />
zutreffend<br />
IX.4-3.1. Hinweise auf eine verstärkte Dynamik/ein verbessertes Potenzial<br />
auf Grund der Fördermaßnahmen (Beschreibung, z. B.<br />
wichtige Netze, Finanzierungstechniken …)<br />
X<br />
IX.4-4. (n) Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten<br />
X<br />
IX.4-4.1. Hinweise auf Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in<br />
X<br />
(n) ländlichen Gebieten (Beschreibung)<br />
a<br />
Z.B. aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit oder noch nicht eingetretenen oder messbaren Wirkungen.<br />
Erhaltung/Verbesserung der mit der Landwirtschaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstrukturen<br />
(Kriterium IX.4-1)<br />
Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich durch Hochwasserschutzmaßnahmen Verbesserungen<br />
ergeben haben (Indikator IX.4-1.1)<br />
Der Auswertung der 74 Fragebögen zufolge waren von den Schutzmaßnahmen ca. 400<br />
landwirtschaftliche Betriebe betroffen, häufig mit mehreren <strong>Teil</strong>flächen. Nach Schätzung durch die Wasserwirtschaftsverwaltung<br />
und Befragung in den Gemeindeverwaltungen betrafen die Schutzmaßnahmen in den<br />
betroffenen Gemeinde mitunter 100% aller dort aktiven Landwirte. Insofern ist davon auszugehen, dass die<br />
Vorhaben <strong>des</strong> Hochwasserschutzes auf breite Resonanz gestoßen sind, auch wenn im Einzelfall vielleicht<br />
nur kleinere Flächen direkt davon berührt wurden.<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
445
446<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Kriterium IX.4-2: Das landwirtschaftliche Produktpotenzial ist von Naturkatastrophen geschützt bzw.<br />
nach Schädigung hierdurch wieder aufgebaut worden<br />
Anteil bedrohter Flächen, die auf Grund von Fördermaßnahmen geschützt werden konnten (Indikator<br />
IX.4-2.1)<br />
Bei 20 der 74 analysierten Projekte wurden landwirtschaftliche Nutzflächen nachhaltig vor Hochwasser gesichert.<br />
Dabei handelte es sich um 2.506 ha Grünland und 2.443 ha Ackerfläche. Eine räumliche Bezugsgröße<br />
konnte leider nicht definiert werden, <strong>des</strong>halb ist kein prozentualer Anteil errechnet worden.<br />
Sofern für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz landwirtschaftliche Flächen benötigt wurden, erfolgte<br />
eine Entschädigung in Geld (insgesamt 179 ha) oder durch Bereitstellung von Ersatzflächen (insgesamt 11,8<br />
ha). Da nach Aussagen der Wasserwirtschaftsverwaltung kaum Probleme beim Landankauf auftraten – die<br />
Flächeneigentümer vielmehr bereitwillig verkauften – dürfte der Landverkauf kaum zu einzelbetrieblichen<br />
Entwicklungsengpässen geführt haben.<br />
10.5.8.6 Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung der Umwelt (Frage IX.5)<br />
Tabelle 170: Kriterien und Indikatoren für Bewertung von Umweltleistungen<br />
Kriterium<br />
Indikator<br />
Kriterium/Indikator Beantwortet<br />
Nicht<br />
zutreffend<br />
IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft haben Umweltvorteile bewirkt X<br />
IX.5-1.1. Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde, insbesondere<br />
durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung<br />
der Bodenerosion (in ha und %)<br />
X<br />
IX.5-1.2. Verringerte Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen auf Grund der<br />
Beihilfe (in ha und in m³/Tonnen pflanzlicher Erzeugnisse)<br />
X<br />
IX.5-1.3. Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit den Bewirtschaftungsmethoden<br />
und -praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur<br />
oder der Bodennutzung in Zusammenhang stehen und auf Fördermaßnahmen<br />
zurückzuführen sind (Beschreibung)<br />
X<br />
IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzung/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad<br />
von natürlichen/nicht erneuerbaren Ressourcen<br />
X<br />
IX.5-2.1. Abfälle/Abwasser, die auf Grund von Fördermaßnahmen gesammelt/ behandelt<br />
wurden<br />
X<br />
IX.5-2.2. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte, die auf Grund von Fördermaßnahmen<br />
Zugang zu erneuerbaren Energien haben (in %)<br />
X<br />
IX.5-2.3. Bessere Nutzung oder Einsparung nichterneuerbarer Ressourcen (Anzahl<br />
X<br />
(n) und Art der Projekte, die hierzu beigetragen haben, Umfang, Beschreibung)<br />
IX.5-2.4.<br />
(n)<br />
Durch die <strong>Förderung</strong> veränderter Ausstoß an CO2, NH3 und CH4 X<br />
IX.5-3. Erhaltung/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer<br />
Vielfalt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen<br />
X<br />
IX.5-3.1. Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick auf Arten- X<br />
(n) <strong>bis</strong><br />
IX.5-3.5.<br />
(n)<br />
vielfalt, Landschaften, Wasser, Boden, Klima/Luft (Beschreibung)<br />
IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und -lösungen im ländlichen<br />
Raum bzw. größeres Bewusstsein hierfür<br />
X<br />
IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Informationsaustausch<br />
oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätigkeiten<br />
auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können (Anzahl, %)<br />
X<br />
Kriterium IX.5-3: Erhaltung/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer<br />
Vielfalt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Erhaltung/Verbesserung nicht landwirtschaftlicher Flächen bezüglich Artenvielfalt, Landschaften,<br />
Wasser, Boden und Klima (Indikatoren IX.5-3.1 <strong>bis</strong> IX.3-5.5)<br />
Maßnahmen, die dazu führen, den Hochwasserabfluss durch Aufweitung der Flussquerschnitte, durch natürliche<br />
Retentionsräume und abflusshemmende Strukturen zu regulieren, dienen auch dazu, das Gewässer<br />
mit der Tallandschaft zu verbinden. Nicht nur der sogenannte „Ökoausbau“ kann für den Erhalt oder die Verbesserung<br />
im Sinne der biologischen Vielfalt förderlich sein, sondern auch technische Maßnahmen wie beispielsweise<br />
die Rückverlegung von Deichen, Aufweitung von Brückendurchlässen, Entfernung von Sohlschwellen,<br />
Anlage von Flutmulden, Mäanderneubildung und ähnliches.<br />
(1) Entwicklung von Aue-Strukturen<br />
Zu 47 der 74 analysierten Förderfälle wurden Angaben zur Entwicklung der Auenlandschaft gemacht. Sie<br />
bezogen sich jeweils auf Einzelprojekte, wobei insgesamt 74 Nennungen zustande kamen (vgl. Tabelle 171).<br />
Demnach wurde in 39 Projekten die Entwicklung eines Auwalds bzw. einer Weichholzaue vorrangig berücksichtigt.<br />
Altarmbiotope wurden in sieben Vorhaben neu gestaltet bzw. reaktiviert. Die Entstehung von Hochstaudenfluren<br />
betraf sechs Fälle, jeweils in 4 Fällen wurden Feuchtwiesen, Altwässer oder Röhrichtstandorte<br />
entwickelt. Weitere Vorhaben umfassten zumeist kleinflächige Gestaltungsmaßnahmen an Niedermooren,<br />
Brachflächen oder ausgewählten Gründlandflächen. Insgesamt macht die hohe Zahl der Nennungen deutlich,<br />
dass hier eine naturnahe Entwicklung der Auelandschaft angestrebt wird.<br />
Tabelle 171: Art der hergestellten Aue-Strukturen<br />
Aue-Strukturen Anz. % Aue-Strukturen Anz. %<br />
Auwald/Weichholzaue 39 53 Sukzession/Selbstentwicklung 3 4<br />
Altarmbiotope 7 10 Initialpflanzung 2 3<br />
Hochstaudenflur 6 8 Brache 2 3<br />
Feuchtwiesen 4 5 Ufergehölz 1 1<br />
Röhricht 4 5 Extensiv genutztes Grünland 1 1<br />
Altwasser 4 5 Niedermoor 1 1<br />
Summe 74 100<br />
(2) Schutzgebiete (Naturschutz, Wasserschutz, Trinkwasserschutz u.ä.)<br />
In 19 der 74 Fälle (26 %) wurden Schutzgebiete gefördert. Dies betraf die Erhaltung/Sicherung ebenso wie<br />
deren Erweiterung. Als Instrumente wurden dazu eingesetzt: Grunderwerb, Sanierung der Schutzgebiete,<br />
dauerhafte Sicherung <strong>des</strong> Schutzbereichs, Deichrückverlegung, Umwandlung von Ackerflächen zu Grünland<br />
und Reaktivierung der Flussaue. Um einen dauerhaften Schutz zu erreichen, wurden auch Vorhaben<br />
amtlich festgesetzt.<br />
(3) Verhinderung von Eingriffen in Schutzgebiete<br />
Durch gezielte Maßnahmen wurde in 13 Fällen ein drohender Eingriff in Schutzgebiete verhindert. Letztlich<br />
sollen auf diese Weise massive Maßnahmen <strong>des</strong> technischen Gewässerbaus (einschließlich Deichbau),<br />
Rodungen und regelmäßige Gewässerräumungen vermieden werden. Dies wurde u.a. durch folgende Maßnahmen<br />
erreicht bzw. gefördert:<br />
• Verbot ackerbaulicher Nutzung von <strong>Teil</strong>flächen oder Verpflichtung zur Verminderung der Bewirtschaftungsintensität<br />
zur Begrenzung der Bodenerosion und <strong>des</strong> Nährstoffeintrags in die Fließgewässer;<br />
• Rückverlegung der Deiche;<br />
• Unterstützung der Rückhaltekapazität von abflusshemmenden Strukturen.<br />
447
448<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
10.5.8.7 Gesamtbetrachtung der Fördermaßnahme hinsichtlich Inanspruchnahme und erzielten<br />
Wirkungen<br />
Maßnahmen <strong>des</strong> vorbeugende Hochwasserschutzes im Bereich der Gewässer I. und II. Ordnung sind regelmäßige<br />
Aufgaben der Wasserwirtschaftsämter. Das Programm mit seinen Zielsetzungen entspricht voll<br />
dem Aufgabenbereich dieser Behörde. Sie ist sowohl für die Planung, als auch für die Antragstellung und<br />
Durchführung der Fördermaßnahmen verantwortlich. Deshalb verwundert es nicht, dass fast „aus dem Stand<br />
heraus“ der größte <strong>Teil</strong> der insgesamt geplanten Projekte bereits <strong>bis</strong> zum Jahr 2002 in die Umsetzungsphase<br />
gegangen ist. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Projekte zumeist über einen längeren Zeitraum<br />
laufen, so dass ein rascher Start Vorteile bietet. Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass i.d.R. mehrere<br />
Haushaltsjahre von der Umsetzung betroffen sind, was die Begleitung und Bewertung der Vorhaben insofern<br />
erschweren kann, als der technische Realisierungsgrad nicht mit der finanziellen Abwicklung kongruent sein<br />
muss.<br />
Die Zahl der bewilligten Förderfälle liegt mit 106 etwas über den Planvorgaben (100). Deutlich überschritten<br />
wurden die ursprünglichen Förderziele für den Zeitraum 2000-2002 bei den bewilligten Gesamtaufwendungen<br />
(387% <strong>des</strong> Soll-Wertes); selbst wenn man den gesamten Umfang <strong>bis</strong> 2006 betrachtet liegen die jetzigen<br />
Bindungen bei 177%. Entsprechend hoch sind auch die Werte bei der <strong>EU</strong>-Beteiligung: <strong>bis</strong> 2002 bei 331%<br />
sowie <strong>bis</strong> 2006 bei 161%. Diese hohe Mittelbindungen bei den Zusagen werden jedoch in der Regel nicht<br />
ausgeschöpft. Bei einer Reihe von Projekten treten im Lauf der Umsetzung mitunter mehrjährige Verzögerungen<br />
auf, so dass ein planmäßiger Abruf der eingeplanten Fördermittel nicht eingehalten werden kann. Die<br />
Mittelüberbindungen dienen somit der Deckung dieser Lücken im Mittelabruf und sind Voraussetzung für die<br />
vollständige Ausschöpfung <strong>des</strong> im Programmplanungszeitraum zur Verfügung stehenden Finanzvolumens.<br />
Der häufigste Grund für diese Verzögerungen in der Projektumsetzung sind Probleme beim Ankauf von<br />
Grundstücken innerhalb der Planungsabschnitte.<br />
Die Grundlage der Erhebung zu den Indikatoren bilden einmal die 74 Rücklaufe von den zum Zeitpunkt der<br />
Befragung 106 bewilligten Fällen sowie daraus 29 Maßnahmen, die von den Wasserwirtschaftsämtern als<br />
„abgeschlossen“ gemeldet wurden.<br />
Die Mehrzahl der Projekte diente der Schaffung von Retentionsraum, wenngleich hierfür nur ein geringer<br />
Mittelanteil eingesetzt wurde. Dagegen entfielen auf die Sanierung von Deichen zwar 57 % der Mittel, jedoch<br />
nur 20 % der Projekte. Insgesamt wurden die quantifizierten Ziele der Fördermaßnahmen um mehr als das<br />
Doppelte erfüllt. Als wesentliche Ergebnisse sind fest zu halten:<br />
• Sicherung der Einwohner vor Hochwasser: 156.512 Personen;<br />
• Sicherung von landwirtschaftlichen Anbauflächen: 3.400 ha Grünland, 3.300 ha Ackerfläche;<br />
• Anlage von 200 km Wegen an/auf Deichen und Retentionsflächen, die nahezu umfassend auch als<br />
Wander- und Radwege genutzt werden und eine Erweiterung der touristischen Potenziale der Regionen<br />
darstellen;<br />
• Gezielte Besucherlenkung über die Anlage touristischer Einrichtungen, z.B. in Form von Lehrpfaden,<br />
Angel- oder Badeweiher.<br />
Mit Hilfe der <strong>EU</strong>-Fördermittel konnten nach Aussagen der Wasserwirtschaftsämter insgesamt mehr Projekte<br />
in Angriff genommen und zahlreiche Vorhaben zeitlich vorgezogen werden. Insofern ist grundsätzlich eine<br />
additionale Verwendung der Fördermittel anzunehmen.<br />
Die Sicherung von Anbau-, Siedlungs- und Gewerbeflächen hat einen direkten Einfluss auf die regionalen<br />
Lebensbedingungen sowie die Struktur und Entwicklungsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Indirekte Wirkungen<br />
ergeben sich durch die Verstärkung touristischer Attraktivitäten, die Sicherung von Nutzflächen und<br />
als Beschäftigungs- und Einkommenseffekte über die Planung und Umsetzung der Bauvorhaben.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Die Wiederherstellung einer intakten Tallandschaft mit dem Fluss und seiner Flussaue führt über die Aufweitung<br />
der Flussquerschnitte und der Inanspruchnahme natürlicher Retentionsräume zur Wiederherstellung<br />
von abflusshemmenden Strukturen. Im Rahmen der <strong>bis</strong>herigen Fördermaßnahmen <strong>des</strong> vorbeugenden<br />
Hochwasserschutzes sind unterschiedliche Aue-Lebensräume (Auwälder, Altarme, Hochstaudenflur) neu<br />
entstanden oder wieder hergestellt worden.<br />
Da der Verantwortungsbereich der Wasserwirtschaftsämter als verantwortliche Umsetzungsbehörde nur die<br />
Gewässer I. und II. Ordnung umfasst, bleibt auch das Programm <strong>des</strong> vorbeugenden Hochwasserschutzes<br />
nur auf diese Gewässerkategorien beschränkt. Grundsätzlich sollte <strong>des</strong>halb geprüft werden, ob nicht mit der<br />
Umsetzung einer größeren Zahl von Kleinprojekten an den Oberläufen (Gewässer III. Ordnung) eine Entschärfung<br />
der Hochwassersituation an den Unterläufen erreicht werden könnte. Dazu kämen etwa technische<br />
Rückhaltemaßnahmen oder der Ausweis von Retentionsflächen in Frage. Die weiträumige Umsetzung<br />
solcher Kleinmaßnahmen könnte die gleiche Wirkung entfalten wie wenige Großvorhaben an den Unterläufen,<br />
ohne in gleichem Maße Eingriffe in bestehende Nutzungen und Strukturen zu verursachen. Zudem wäre<br />
eine Inanspruchnahme von Flächen für die Wasserrückhaltung breiter gestreut.<br />
10.6 Kritische Wertung <strong>des</strong> vorgegebenen Bewertungsrasters und Überlegungen für die Ex post-<br />
Bewertung<br />
Die von der <strong>EU</strong>-Kommission vorgegebenen Bewertungsfragen, -kriterien und -indikatoren bilden grundsätzlich<br />
einen geeigneten und sinnvollen Leitfaden zur Bewertung der unter Art. 33 angebotenen Maßnahmen.<br />
Sie ermöglichen eine europaweit einheitliche Evaluierung der Maßnahmen zur <strong>Förderung</strong> der Anpassung<br />
und Entwicklung von ländlichen Gebieten, sowohl was die Vergleichbarkeit einzelner Ergebnisse betrifft als<br />
auch hinsichtlich der Erfassung zentraler Wirkungsbereiche. Dennoch erkannten die Bewerter im Lauf der<br />
Halbzeitbewertung, dass die Bewertung von Programmen zur ländlichen Entwicklung nach fest vorgegebenen<br />
Indikatoren an ihre Grenzen stößt und durch andere, qualitative Methoden flankiert werden sollte. Qualitative<br />
Ansätze schränken zwar die Vergleichbarkeit von Ergebnissen ein, mit ihrer Hilfe lassen sich jedoch<br />
multifaktorielle und komplexe Wirkungszusammenhänge besser beschreiben als durch Verwendung quantitativer<br />
Parameter.<br />
Vor allem angesichts <strong>des</strong> geringen Abstands zwischen dem Beginn <strong>des</strong> Förderzeitraums und der Evaluierung,<br />
jedoch auch aus grundsätzlichen methodischen Problemen heraus, konnten einzelne Indikatoren in<br />
den gewünschten Dimensionen und Untergliederungen nicht geliefert werden. Zudem wirkt sich die Vorgabe,<br />
bestimmte Indikatoren liefern zu müssen, zwangsläufig auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse<br />
aus. Die Komplexität der einzelbetrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge bzw.<br />
der Einfluss einer Vielzahl von externen Faktoren auf die begünstigten Akteure und sonstigen Ziele macht<br />
eine saubere und zuverlässige Quantifizierung von Netto-Effekten vor allem im Einkommens- und Beschäftigungsbereich,<br />
aber auch im Umweltsektor, nur eingeschränkt möglich. Viele Indikatoren lassen sich in der<br />
gewünschten Tiefe letztendlich nur mit Hilfe von Schätzmethoden oder makroökonomischen Modellen quantifizieren,<br />
deren Ergebnisse mit entsprechenden Fehlern behaftet sind. Der Zwang zur Quantifizierung konkreter<br />
Indikatoren kann insoweit zu Scheinergebnissen führen, die nicht der Realität entsprechen und auch<br />
für länderübergreifende Aussagen hinsichtlich der Förderwirkungen nur bedingt geeignet sind.<br />
Im Fall der vorliegenden Halbzeitbewertung konnten die fünf Bewertungsfragen und die dazu gehörigen<br />
Kriterien und Indikatoren das breite Wirkungsspektrum der fünf in Bayern unter Art. 33 angebotenen Maßnahmen<br />
nur bedingt darstellen. Vor allem für den Bereich Hochwasserschutz mussten zusätzliche Indikatoren<br />
definiert werden, um die Förderwirkungen erfassen zu können. Ein Großteil der Indikatoren traf auf diese<br />
Fördermaßnahme nicht zu. Auch zur Evaluierung der Maßnahme „Schutz der Umwelt, Naturschutz und<br />
Landschaftspflege zur Sicherung und Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes“ war das vorgegebenen Bewertungsraster<br />
ungeeignet. Hier wären verstärkt naturschutzfachliche Bewertungen mit Vor-Ort-Stichproben<br />
449
450<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
wünschenswert. Wie schon in Abschnitt 10.4.8.1 dargestellt, sollten die Maßnahmen nach Art. 33 Tiret 11<br />
besser mit den Fragen, die für die Agrarumweltmaßnahmen nach Art. 22 – 24 aufgestellt sind, bewertet werden.<br />
Da vor allem für den Art. 33 mit seinem breiten Spektrum an unterschiedlichen Strategien und Maßnahmen<br />
nicht für alle Bereiche ausreichend Indikatoren definiert werden können, sollte grundsätzlich überlegt werden,<br />
ob nicht die methodischen Vorgaben für eine eventuelle Fortschreibung der Halbzeitbewertung bzw. die<br />
Ex post-Bewertung <strong>des</strong> EPLR auf wenige zentrale Indikatoren beschränkt werden sollten, die für alle Maßnahmen<br />
<strong>des</strong> Förderspektrums <strong>des</strong> Art. 33 beantwortet werden können. Die weitere fachliche Bewertungsmethodik<br />
sollten die Evaluatoren selbst entwickeln, in Anlehnung auf die individuelle Umsetzung der Inhalte <strong>des</strong><br />
Art. 33 durch die Länderbehörde.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
11 Kapitelübergreifende Bewertungsfragen<br />
11.1 Methodischer Ansatz<br />
Die Beantwortung der kapitelübergreifenden Querschnittsfragen orientiert sich eng an der Vorgehensweise<br />
zur Evaluierung der einzelnen Fördermaßnahmen bzw. Kapitel der VO 1257/99. Aus diesem Grund werden<br />
im folgenden Abschnitt nur Änderungen und Ergänzungen der kapitelspezifischen Bewertungsansätze beschrieben.<br />
11.1.1 Skizzierung <strong>des</strong> Untersuchungs<strong>des</strong>igns<br />
Die Diskussion der Querschnittsfragen bezieht sich grundsätzlich auf alle <strong>bis</strong>her im Rahmen <strong>des</strong> EPLR<br />
durchgeführten Maßnahmen. Angesichts <strong>des</strong> geringen zeitlichen Abstan<strong>des</strong> zwischen Beginn <strong>des</strong> Förderzeitraumes<br />
und der Halbzeitbewertung konnten jedoch einzelne Kriterien und Indikatoren für manche Maßnahmen<br />
noch nicht beantwortet werden. Nicht in die Beantwortung der Querschnittsfragen einbezogen wurden<br />
das FFH-Programm (<strong>Förderung</strong> von Natura 2000-Gebieten) sowie der Vertragsnaturschutz im Wald, da<br />
beide Programme <strong>bis</strong>lang in Bayern noch nicht umgesetzt wurden.<br />
11.1.2 Datenerhebung und -auswertung<br />
Die Informationen zur Beantwortung der Querschnittsfragen lassen sich nach ihrer Herkunft in drei Gruppen<br />
gliedern:<br />
• Daten, die bereits zur Bearbeitung der kapitelspezifischen Bewertungsfragen dienten: Die Informationen<br />
wurden aus den jeweiligen Abschnitten entnommen und auf der Ebene <strong>des</strong> Gesamtprogramms<br />
zusammen gefasst;<br />
• Zusätzliche primärstatistische Daten, die über die kapitelspezifischen Bewertungsfragen hinaus<br />
gehen: Sie wurden durch schriftliche und persönliche Befragungen erhoben;<br />
• Sekundärdaten, die zusätzlich beschafft und aufbereitet wurden: Sie dienen vor allem dazu, eine<br />
Maßnahmen übergreifende Vergleichsbasis zu schaffen und entstammen Veröffentlichungen <strong>des</strong><br />
Bayerischen Lan<strong>des</strong>amtes für Statistik und Datenverarbeitung (Kreisdaten 2001, Landwirtschaftszählung<br />
1999), der laufenden Raumbeobachtung <strong>des</strong> StMLU sowie <strong>des</strong> StMLF (Agrarbericht, Buchführungsergebnisse).<br />
Auch die Ergebnisse der Regionalanalyse bieten eine Grundlage für die Diskussion<br />
der programmübergreifenden Wirkungen.<br />
11.2 Bewertungsfragen<br />
11.2.1 Querschnittsfrage 1 - Beitrag <strong>des</strong> Programms zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen<br />
auf dem Land<br />
Erhaltung/<strong>Förderung</strong> einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur durch die <strong>Förderung</strong> junger Menschen<br />
(Kriterium Q 1-1)<br />
Wie bereits in der Regionalanalyse in Abschnitt 4 dargestellt, leben mit einem Anteil von über 20 % zwar<br />
relativ viele Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum Bayerns; diese positive Entwicklung wird jedoch<br />
durch die Abwanderung junger Menschen auf der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wieder relativiert,<br />
so dass letztendlich die „produktive“ Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren mit einem Anteil von<br />
451
452<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
62,8 % im ländlichen Raum leicht unterrepräsentiert ist (bayerischer Durchschnitt: 64,3 %). Die gezielte <strong>Förderung</strong><br />
vor allem junger Landwirte und Arbeitnehmer könnte somit einen <strong>Teil</strong> dazu beitragen, um neue Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für junge Menschen zu schaffen und deren Abwanderung zu verhindern.<br />
Mit Ausnahme der Junglandwirteförderung, die jedoch nicht Bestandteil <strong>des</strong> EPLR und somit dieser Halbzeitbewertung<br />
ist, können alle in Bayern angebotenen landwirtschaftlichen Förderprogramme grundsätzlich<br />
unabhängig vom Alter und Geschlecht der Antragsteller in Anspruch genommen werden. Deshalb lassen<br />
sich auch keine direkten Effekte auf die Altersverteilung der Personen ableiten, die an den Programmen <strong>des</strong><br />
EPLR teilgenommen haben bzw. von diesen profitierten. Für einzelne Fördermaßnahmen konnte jedoch<br />
nachgewiesen werden, dass bestimmte Altersklassen sie von sich aus besonders häufig in Anspruch nahmen.<br />
Hierzu wurde die Altersverteilung von Personen oder Haushalten, die an den Agrarumweltprogrammen,<br />
an Maßnahmen im Bereich Forstwirtschaft sowie an der Diversifizierungsförderung teilgenommen haben,<br />
der Gesamtheit aller Betriebe im ländlichen Raum Bayerns gegenüber gestellt. 265<br />
Demnach profitierten überdurchschnittlich viele Personen unter 30 Jahren von den Maßnahmen im Agrarumweltbereich<br />
sowie der Diversifizierungsförderung. Während im Durchschnitt aller bayerischen Betriebe<br />
nur 15 % der Beschäftigten unter 30 Jahre alt sind, beträgt deren Anteil bei Betrieben, die<br />
• am Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutzprogramm teilnahmen, 17 % und<br />
• an der Diversifizierungsförderung nach Art. 33 teilnahmen, 21 % (vgl. Tabelle 172).<br />
Der forstwirtschaftliche Maßnahmenbereich 266 zeigt ein entgegengesetztes Bild: Nur 1 % der <strong>Teil</strong>nehmer war<br />
hier unter 30 Jahre alt.<br />
Tabelle 172: Verteilung der auf den geförderten Betrieben beschäftigten Personen nach Alter und<br />
Geschlecht<br />
Landwirtschaftliche Beschäftigte<br />
< 30 Jahre 30 <strong>bis</strong> 39 J 40 J. u. älter männlich weiblich<br />
Alle bayerischen Betriebe 15% 21% 65% 63% 37%<br />
<strong>Teil</strong>nehmer am KULAP und VNP 17% 22% 61% 61% 39%<br />
<strong>Teil</strong>nehmer an forstwirtschaftlichen<br />
Maßnahmen 1% 13% 86% 93% 7%<br />
<strong>Teil</strong>nehmer an der Diversifizierungsförderung<br />
21 % 14 % 64 % 68 % 32 %<br />
Der Anteil der Beschäftigten zwischen 30 und 39 Jahren lag bei den <strong>Teil</strong>nehmern an den Agrarumweltprogrammen<br />
in etwa auf dem Niveau <strong>des</strong> bayerischen Durchschnitts (21 %). Die Beschäftigten der geförderten<br />
Diversifizierungsbetriebe waren in dieser Gruppe mit 14 % unterdurchschnittlich vertreten. Dies liegt vor<br />
allem daran, dass zusätzliche Einkommensquellen bzw. ein zweites Standbein bevorzugt von Betrieben<br />
gesucht werden, auf denen zwei Generation im erwerbsfähigen Alter wirtschaften. Die Hofnachfolger sind<br />
dann i.d.R. unter 30 Jahre und die ältere Generation über 40 Jahre alt. Dies erklärt auch den entsprechend<br />
hohen Anteil an über 40jährigen Arbeitskräften bei den Diversifizierungsbetrieben. Deren Anteil ist bei den<br />
<strong>Teil</strong>nehmern an forstwirtschaftlichen Maßnahmen mit 86 % besonders hoch. Offensichtlich sind junge Menschen<br />
nur noch bedingt bereit, Betriebe mit forstwirtschaftlichem Schwerpunkt zu führen bzw. zu übernehmen.<br />
Ein Grund für den hohen Anteil älterer Arbeitskräfte dürfte jedoch auch der Mangel an außerlandwirtschaftlichen<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten sein, der in den waldreichen und überwiegend peripher gelegenen<br />
Mittelgebirgen Bayerns besonders ausgeprägt ist.<br />
265 An den Programmen Flurneuordnung und Dorferneuerung nehmen automatisch alle Haushalte und Betriebe eines Verfahrensgebietes<br />
teil, so dass sich keine Unterschiede zwischen der demographischen Zusammensetzung teilnehmender und nicht teilnehmender<br />
Haushalte ableiten lassen.<br />
266 Ohne Vertragsnaturschutz im Wald.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Abgesehen von den forstwirtschaftlichen Maßnahmen lassen sich aus der <strong>Förderung</strong> nach VO 1257/99 gewisse<br />
positive Effekte auf den Erhalt einer ausgewogenen Zusammensetzung der Bevölkerung im ländlichen<br />
Raum erkennen. Junge Betriebsleiter sind offensichtlich eher bereit, Ihre Betriebsorganisation an die Vorgaben<br />
und Anforderungen von Förderprogrammen nach dem EPLR anzupassen (KULAP, VNP) oder geförderte<br />
Investitionen zu tätigen (Diversifizierungsförderung). Vor allem bei den Diversifizierungsmaßnahmen<br />
konnte nachgewiesen werden, dass sie eine wichtige Hilfe zur Sicherung und Verbreiterung der Einkommensbasis<br />
darstellen, von der in erster Linie junge Hofnachfolger profitieren. Sie erhalten durch die <strong>Förderung</strong><br />
die Möglichkeit, am Wohn-/Betriebsstandort zusätzliches außerlandwirtschaftliches Einkommen zu<br />
erwirtschaften. Dies dürfte die Gefahr einer einkommens-/beschäftigungsbedingten Abwanderung deutlich<br />
reduzieren und sich somit auch positiv auf die Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung auswirken.<br />
Erhaltung/<strong>Förderung</strong> einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur durch die <strong>Förderung</strong> von Frauen<br />
(Kriterium Q 1-2)<br />
Erwerbstätige Frauen sind im landwirtschaftlichen Sektor generell unterrepräsentiert. Ihr Anteil an allen Beschäftigten<br />
in Land- und Forstwirtschaft beträgt 37 %, während über alle Sektoren betrachtet 44 % der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten in Bayern weiblich sind. Diese Ungleichverteilung im Agrarsektor liegt<br />
zum einen an traditionellen Rollenmustern, wonach Frauen in landwirtschaftlichen Haushalten eher Tätigkeiten<br />
im Haushalt erledigen, während sich Männer stärker auf die Landwirtschaft konzentrieren. Zum anderen<br />
sind Männer aufgrund der körperlichen Anforderungen für viele Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtwirtschaft<br />
besser geeignet. Deshalb sind auch fast alle Fremd-Arbeitskräfte in den Betrieben Männer.<br />
Die Verteilung der Beschäftigten nach Männern und Frauen weicht bei den nach VO 1257/99 geförderten<br />
Betrieben nur geringfügig vom Gesamtdurchschnitt aller bayerischen Betriebe ab, die im Rahmen der Stichprobe<br />
einen Frauenanteil von 37 % aufweisen. Der Frauenanteil, bezogen auf alle Beschäftigten, betrug<br />
• bei KULAP-/VNP-Betrieben 39 %,<br />
• bei <strong>Teil</strong>nehmern an forstwirtschaftlichen Maßnahmen 17 % und<br />
• in Diversifizierungsbetrieben 32 %.<br />
Somit ist der Beitrag der untersuchten Maßnahmen zur <strong>Förderung</strong> von Frauen im ländlichen Raum relativ<br />
gering. Das hängt primär damit zusammen, dass die Fördermaßnahmen grundsätzlich von allen Betrieben<br />
und Personen in Anspruch genommen werden können. Spezifische Maßnahmen, die sich direkt (z.B. durch<br />
Vorgaben in den Förderrichtlinien) oder indirekt (z.B. durch eine besondere Eignung oder Inanspruchnahme)<br />
an Frauen wenden, werden nicht angeboten.<br />
Einfluss <strong>des</strong> Programms auf die Abwanderung der Bevölkerung aus dem ländlichen Raum (Kriterium<br />
Q 1-3)<br />
Jede Form der <strong>Förderung</strong> im EPLR hat direkte oder indirekte Auswirkungen auf Einkommen, Beschäftigung<br />
sowie auf die Lebens- oder Umweltqualität. Grundsätzlich erhöht sich damit die Attraktivität <strong>des</strong> Fördergebietes.<br />
Durch die Standortbindung der landwirtschaftlichen Betriebe profitiert von deren <strong>Förderung</strong> grundsätzlich<br />
der gesamte ländliche Raum. Insofern ist davon auszugehen, dass die Fördermaßnahmen tendenziell<br />
der Abwanderung der Bevölkerung entgegen gewirkt haben. Diesbezüglich ist es wichtig, das sich die vom<br />
Finanzvolumen her bedeutendsten Fördermaßnahmen auf die Regionen mit besonders ausgeprägten strukturellen<br />
Problemen konzentrieren. Sie wirken somit einem weitergehenden Attraktivitäts- und Bevölkerungsverlust<br />
dieser Räume tendenziell entgegen:<br />
• Das Kulturlandschaftsprogramm wurde vor allem in den Regionen mit ungünstigeren Produktionsbedingungen<br />
in Anspruch genommen und trägt dort zur Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung,<br />
Gestaltung der Landschaft und Erhaltung der natürlichen Umwelt bei.<br />
453
454<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
• Bei der Umsetzung <strong>des</strong> waldbaulichen Förderprogramms lagen die Förderschwerpunkte in den<br />
strukturschwachen Räumen Ostbayerns und in Unterfranken. Vor allem in Verbindung mit der holzbe-<br />
und -verarbeitenden Industrie kommt der Forstwirtschaft in diesen Räumen eine wichtige Bedeutung<br />
zu;<br />
• Der Schwerpunkt sowohl der Flurneuordnung als auch der Dorferneuerung lag im strukturschwachen<br />
nord- und ostbayerischen Raum. Die in diesen Regionen bereit gestellten Mittel betragen in<br />
manchen Landkreisen ein Vielfaches <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>durchschnittes;<br />
• Rund 80 % der <strong>bis</strong>her für die Diversifizierungsförderung gebundenen Fördermittel kommen den<br />
strukturschwachen Regierungsbezirken Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie der Oberpfalz zu Gute.<br />
11.2.2 Querschnittsfrage 2 - Beitrag <strong>des</strong> Programms zur Sicherung der Beschäftigungslage<br />
Erhaltene oder geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten in den land-/forstwirtschaftlichen Betrieben<br />
(Q 2-1)<br />
Die Hinweise und Informationen zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung ermöglichen keine programmübergreifende<br />
Quantifizierung und Bewertung der Beschäftigungsmöglichkeiten, die direkt oder indirekt in geförderten<br />
land-/forstwirtschaftlichen Betrieben erhalten oder neu geschaffen wurden (Indikator Q 2-1.1). Lediglich<br />
bei den Maßnahmen Flurneuordnung, Dorferneuerung, Diversifizierung und Forstwirtschaft können der<br />
<strong>Förderung</strong> neu geschaffene bzw. abgebaute FTE zugeordnet werden. Eine umfassende Beschreibung der<br />
Beschäftigungseffekte war aus methodischen Gründen nicht möglich. Sie sollte schwerpunktmäßig in der<br />
Abschlussbewertung erfolgen.<br />
Wie Tabelle 173 zeigt, wurden im Rahmen der Umsetzung <strong>des</strong> EPLR insgesamt 45 FTE zusätzlich gebunden.<br />
Hierbei weist die Flurneuordnung einen negativen Beschäftigungssaldo auf (- 53 FTE). Dies liegt daran,<br />
dass dieses Programm die Rationalisierung von Betriebsabläufen mit dem Ziel einer effizienteren Verwertung<br />
von Produktionsfaktoren verfolgt, was zur Freisetzung von Arbeitskräften führen kann. Weiterhin wurde<br />
durch die Strukturförderung eine Vielzahl an Beschäftigungsverhältnissen in landwirtschaftlichen Betrieben<br />
gesichert, deren Anzahl zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht eindeutig quantifiziert werden kann.<br />
Tabelle 173: Auf geförderten land-/forstwirtschaftlichen Betrieben neu geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
(Indikator Q 2-1.1)<br />
FlurneuordnungDorferneuerungDiversifizierungForstwirtschaft<br />
Insgesamt<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten insgesamt (FTE) a<br />
- 53 FTE 0 FTE 24 FTE 74 FTE 45 FTE<br />
- dav. für Betriebsinhaber (Haushaltsmitglieder) (%)<br />
. 0 % 61 %<br />
.<br />
.<br />
- dav. für Nichtfamilienmitglieder (Nicht-HH-Mitgl.) (%)<br />
. 0 % 39 %<br />
.<br />
.<br />
- dav. für Frauen (%)<br />
. 0 %<br />
. 7%<br />
.<br />
- dav. auf Vollzeitstellen (%)<br />
. 0 %<br />
.<br />
.<br />
.<br />
- dav. in nicht-landwirtschaftlichen Erwerbszweigen (%)<br />
. 0 %<br />
.<br />
.<br />
.<br />
- dav. indirekt als Resultat von Angebotseffekten (%)<br />
. 0 %<br />
.<br />
.<br />
.<br />
a<br />
Die Berechnung der „Full Time Equivalents“ (FTE) orientiert sich an der von <strong>EU</strong>ROSTAT verwendeten Methodik. Demnach entsprechen<br />
1.800 Arbeitsstunden pro Jahr (AKh) einer Jahresarbeitseinheit (JAE) bzw. einem FTE. Vgl. Charlier, H. in: <strong>EU</strong>ROSTAT: Struktur<br />
der landwirtschaftlichen Betriebe in der <strong>EU</strong>. Wichtigste Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 1999-2000. Brüssel 2002, Seite 6.<br />
Erhaltene oder geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten in nicht landwirtschaftlichen Unternehmen<br />
im ländlichen Raum oder in Sektoren, die mit der Landwirtschaft in Zusammenhang stehen<br />
(Kriterium Q 2-2)
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Bis zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung wurden in nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen keine Arbeitsplätze<br />
durch die <strong>Förderung</strong> neu geschaffen. Die Maßnahmen Flurneuordnung, Dorferneuerung sowie Vorhaben<br />
im Bereich der Forstwirtschaft leisteten jedoch einen spürbaren Beitrag zur Sicherung außerlandwirtschaftlicher<br />
Beschäftigungsverhältnisse im ländlichen Raum. Bei den mit der Ausführung der Dorferneuerungs-<br />
und Flurneuordnungsmaßnahmen beauftragten Unternehmen konnten Arbeitsplätze in einem Umfang<br />
von 1.500 FTE dauerhaft gesichert werden (Indikator Q 2-2.1; vgl. Tabelle 174).<br />
Tabelle 174: Durch die <strong>Förderung</strong> erhaltene Beschäftigungsmöglichkeiten in nicht-landwirtschaftlichen<br />
Unternehmen (Indikator Q 2-2.1)<br />
FlurneuordnungDorferneuerungDiversifizierungForstwirtschaft<br />
Insgesamt<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten insgesamt (FTE) a<br />
451 843<br />
0 206 1.500<br />
- dav. für Frauen (%)<br />
.<br />
. 0 %<br />
.<br />
.<br />
- dav. für Personen unter 30 Jahren (%)<br />
.<br />
. 0 %<br />
.<br />
.<br />
- dav. für Nebenerwerbslandwirte (%)<br />
9 % 9 % 0 %<br />
. 9 %<br />
- dav. indirekt als Resultat von Angebotseffekten (%)<br />
.<br />
. 0 %<br />
.<br />
.<br />
a<br />
Die Berechnung der „Full Time Equivalents“ (FTE) orientiert sich an der von <strong>EU</strong>ROSTAT verwendeten Methodik. Demnach entsprechen<br />
1.800 Arbeitsstunden pro Jahr (AKh) einer Jahresarbeitseinheit (JAE) bzw. einem FTE. Vgl. Charlier, H. in: <strong>EU</strong>ROSTAT: Struktur<br />
der landwirtschaftlichen Betriebe in der <strong>EU</strong>. Wichtigste Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 1999-2000. Brüssel 2002, Seite 6.<br />
Einem gesicherten Arbeitsplatz entsprechen in diesem Fall rund 1.170 AKh bzw. 0,65 FTE.<br />
11.2.3 Querschnittsfrage 3 - Beitrag <strong>des</strong> Programms zum Erhalt oder zur Verbesserung <strong>des</strong><br />
Einkommensniveaus der ländlichen Bevölkerung<br />
Direkte oder indirekte Erhaltung/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der landwirtschaftlichen Bevölkerung<br />
(Kriterium Q 3-1)<br />
Im Rahmen der Halbzeitbewertung ließen sich für die Maßnahmen Flurneuordnung, Dorferneuerung, Diversifizierung<br />
und im Bereich Forstwirtschaft Einkommenseffekte quantifizieren. Demnach erzielten Haushaltsmitglieder<br />
durch die <strong>Förderung</strong> zusätzliche Einkommen in Höhe von 7,9 Mio. € (Indikator Q 3-1.1; vgl.<br />
Tabelle 175). Insgesamt 8.372 Angehörige landwirtschaftlicher Haushalte profitierten von der <strong>Förderung</strong> und<br />
erzielten einen durchschnittlichen Einkommensbeitrag von 949 € je Jahr. Hierzu zählen sowohl gesicherte<br />
Einkommen (indirekte Effekte aus der Umsetzung von Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen<br />
durch gewerbliche Unternehmen) als auch zusätzliche (direkte) Einkommenswirkungen z.B. aus Rationalisierungs-<br />
(Flurneuordnung) oder Wachstums- bzw. Umstrukturierungsinvestitionen (Diversifizierung). Die<br />
übrigen im EPLR angebotenen Programme leisten ebenfalls einen Beitrag zur Stabilisierung bzw. Steigerung<br />
vor allem der Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, überwiegend durch die Gewährung von Prämien<br />
(KULAP, VNP, Ausgleichszulage). Diese Effekte ließen sich jedoch zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung<br />
nicht quantifizieren.<br />
Tabelle 175: Durch die <strong>Förderung</strong> erhaltenes oder verbessertes Einkommen der landwirtschaftlichen<br />
Bevölkerung pro Jahr<br />
Einkommen<br />
- in € insgesamt<br />
- in € je Person<br />
- dav. Familienbetriebseinkommen (%)<br />
- dav. Einkommen von Fremd-Arbeitskräften (%)<br />
- dav. aus Diversifizierung (%)<br />
- dav. indir. als Resultat von Angebotseffekten (%)<br />
Flurneuordnung<br />
3.835.190<br />
509<br />
100 %<br />
0 %<br />
0 %<br />
.<br />
Dorferneuerung<br />
3.300.000<br />
28.696<br />
0 %<br />
0 %<br />
0 %<br />
.<br />
Diversifizierung<br />
550.094<br />
6.624<br />
.<br />
.<br />
131 %<br />
.<br />
Forstwirtschaft<br />
256.335<br />
401<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
455<br />
Insgesamt<br />
7.941.619<br />
949<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.
456<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Anzahl der Begünstigten 7.534 115 83 640 a 8.372<br />
a Anzahl der Anträge; die Anzahl der Begünstigten ist nicht ermittelbar.<br />
Direkte oder indirekte Erhaltung/Verbesserung <strong>des</strong> Einkommens der nicht landwirtschaftlichen<br />
Bevölkerung (Kriterium Q 3-2)<br />
Auch die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung konnte von den im EPLR angebotenen Fördermaßnahmen<br />
profitieren. Aus der Umsetzung von Maßnahmen der Flurneuordnung, Dorferneuerung, Diversifizierung und<br />
Forstwirtschaft ließen sich Einkommenseffekte für knapp 1.900 nicht landwirtschaftlich beschäftigte Personen<br />
ableiten. Sie konnten im Rahmen der <strong>Förderung</strong> Einkommen in einer Höhe von 71 Mio. € bzw. 27.670 €<br />
je Begünstigtem erzielen (Indikator Q 3-2.1; vgl. Tabelle 176). Bei dem begünstigten Personenkreis handelt<br />
es sich um Angestellte entweder von Unternehmen, die mit der Realisierung der Flurneuordnungs- und<br />
Dorferneuerungsmaßnahmen beauftragt wurden oder im Holz verarbeitenden Sektor. Zusätzliches Einkommen<br />
für Nichtlandwirte ermöglichte die Maßnahme Diversifizierung durch die Beschäftigung von 21 Fremd-<br />
Arbeitskräften. Die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung, die mit der Beratung von Förderinteressenten<br />
sowie der Planung, Umsetzung und Kontrolle von Fördervorhaben betraut sind, sind in dieser Rechnung<br />
nicht enthalten.<br />
Tabelle 176: Durch die <strong>Förderung</strong> erhaltenes oder verbessertes Einkommen der nicht landwirtschaftlichen<br />
Bevölkerung<br />
Einkommen<br />
- in 1000 € insgesamt<br />
- in € je Person<br />
- dav. Einkommen im Sektor Fremdenverkehr (%)<br />
- dav. Einkommen aus lokalen Handwerkstätigkeiten/Produkten<br />
(%)<br />
- dav. indir. als Resultat von Angebotseffekten (%)<br />
Flurneuordnung<br />
18.200<br />
28.798<br />
0 %<br />
0 %<br />
.<br />
Dorferneuerung<br />
34.100<br />
28.849<br />
0 %<br />
0 %<br />
.<br />
Diversifizierung<br />
162<br />
7.796<br />
0 %<br />
0 %<br />
.<br />
Forstwirtschaft<br />
18.537<br />
.<br />
0%<br />
0%<br />
.<br />
Insgesamt<br />
70.999<br />
27.670<br />
0 %<br />
Anzahl der Begünstigten 693 1.182 21 . 1.896<br />
11.2.4 Querschnittsfrage 4 - Beitrag <strong>des</strong> Programms zur Verbesserung der Marktposition für<br />
land-/forstwirtschaftliche Grunderzeugnisse<br />
Auf die Verbesserung der Marktposition richten sich vor allem zwei Maßnahmen:<br />
• Im forstlichen Förderprogramm besteht die Möglichkeit der <strong>Förderung</strong><br />
- von Holzaufbereitungs- und Lagerplätzen,<br />
- von Maschinen und Geräten zur Gewinnung und zum Transport von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen<br />
sowie<br />
- im Bereich Wegebau.<br />
Diese Maßnahmen führen zu einer Verbesserung der Marktposition der Forstwirte, da durch die Optimierung<br />
der Lager-, Verarbeitungs- und Transportkapazitäten höhere Holzpreise erzielt bzw. Kosten<br />
gesenkt werden können.<br />
• Die Maßnahme „Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“<br />
dient der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wertschöpfung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.<br />
Hierzu können Unternehmen, die landwirtschaftliche Erzeugnisse weiter verarbeiten, Investitionszuschüsse<br />
erhalten. Fördervoraussetzung ist eine vertragliche Bindung zwischen der Stufe der landwirtschaftlichen<br />
Erzeuger und den geförderten Verarbeitungs- und Vermarktungsbereichen. Auf diese<br />
0 %<br />
.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Weise wird gewährleistet, dass die Erzeuger an den aus der Investition resultierenden wirtschaftlichen<br />
Vorteilen teilhaben.<br />
Eine Quantifizierung von Wirkungen ist derzeit nicht möglich, weil zu der zuletzt genannten Maßnahme keine<br />
Beantwortung der kapitelübergreifenden Bewertungsfrage vorliegt.<br />
11.2.5 Querschnittsfrage 5 - Beitrag <strong>des</strong> Programms zum Schutz und zur Verbesserung der<br />
Umwelt<br />
Positive Umweltwirkungen als Folge der Kombination von Fördermaßnahmen<br />
Die Erhaltung und Verbesserung der Umweltsituation nahm sowohl in der Programmplanung als auch in der<br />
<strong>bis</strong>herigen Umsetzung einen zentralen Stellenwert ein. So verfolgten zwei Drittel der realisierten Maßnahmen<br />
bzw. die Hälfte der ausgereichten Fördermittel als Hauptziel den Schutz oder die Verbesserung der<br />
Umwelt (Indikator Q 5-1.1). Das KULAP, das VNP sowie der Umwelt- und Naturschutz nach Art. 33 sind<br />
aufgrund ihrer Programmkonzeption und Zielsetzung primär auf die Erhaltung und Verbesserung der Umweltbedingungen<br />
im ländlichen Raum ausgerichtet. Aber auch Einzelmaßnahmen im Rahmen der Programme<br />
Flurneuordnung, Dorferneuerung, Hochwasserschutz nach Art. 33 sowie im Forstbereich verfolgen vorrangig<br />
Umweltziele (vgl. Tabelle 177).<br />
457
458<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 177: Anteil der Förderprojekte und Fördermittel mit positiven Haupt- und Nebenwirkungen auf die Umwelt<br />
Öffentliche<br />
Aufwendungen<br />
Insgesamt Davon mit primärer Umweltzielsetzung<br />
Projekte Öffentliche<br />
Aufwendungen<br />
Projekte Öffentliche<br />
Aufwendungen<br />
insgesamt<br />
Davon mit positiven Nebenwirkungen auf die Umwelt<br />
Projekte Öffentliche<br />
Aufwendungen<br />
Dar.: aufgrund umweltfreundlicher<br />
Technologie<br />
Projekte Öffentliche<br />
Aufwendungen<br />
Dar.: aufgrund verbesserter<br />
landwirtschaftlicher<br />
Praktiken<br />
1000 € Anzahl % % % % % % % %<br />
Ausgleichszulage 347,423 80.806 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100%<br />
Natura 2000 a 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%<br />
KULAP + VNP 655,141 189.352 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%<br />
Marktstrukturförderung 23,798 43 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%<br />
Forstwirtschaft 31,242 16.372 1% 4% 38% 17% 76% 23% 24% 77%<br />
Flurneuordnung 174,370 54.340 4% 63% 3% 2% 0% 0% 0% 0%<br />
Dorferneuerung 116,732 10.958 2% 58% 11% 20% 0% 0% 0% 0%<br />
Diversifizierung 1,459 52 0% 0% 62% 62% 100% 100% 0% 0%<br />
Umweltschutz (Art. 33) 20,702 320 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%<br />
Hochwasserschutz 33,242 25 40% 72% 31% 20% 0% 0% 100% 100%<br />
VO 1257/99 insges. 1.378,612 352.268 51% 66% 28% 25% 3% 1% 93% 95%<br />
a Maßnahme wurde noch nicht angeboten bzw. umgesetzt.<br />
Projekte
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Von rund einem Viertel der <strong>bis</strong>her bewilligten Maßnahmen bzw. gebundenen Fördermittel konnten als Ergebnis<br />
der Halbzeitbewertung positive Nebenwirkungen auf die Umweltsituation im ländlichen Raum abgeleitet<br />
werden (Indikator Q 5-1.2; vgl. Tabelle 177). Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Ausgleichszulage.<br />
Dieses Programm dient zwar primär dem finanziellen Ausgleich natürlicher Standortnachteile. Es<br />
bewirkt jedoch aufgrund von Förderauflagen, wie z.B. dem Ausschluss intensiver Kulturen wie Mais, Weizen<br />
und Zuckerrüben, eine tendenzielle Extensivierung der landwirtschaftlicher Produktion sowie die Erweiterung<br />
der Fruchtfolgen. Zudem begünstigt die Ausgleichszulage die Aufrechterhaltung einer Flächen deckenden<br />
Landbewirtschaftung und erfüllt somit Ziele der Landschaftspflege. Daneben tragen auch folgende Maßnahmen,<br />
über ihre eigentliche Zielsetzung hinaus, zur Verbesserung der Umweltsituation im ländlichen<br />
Raum bei:<br />
• Flurneuordnung und Dorferneuerung: Sicherung, Anlage und Pflege von ökologisch bedeutenden<br />
Strukturen wie Biotopen, Feldgehölzem, Streuobstwiesen usw.;<br />
• Diversifizierung: Errichtung von Biogasanlagen und Möglichkeiten zur Nutzung und Verarbeitung<br />
nachwachsender Rohstoffe;<br />
• Hochwasserschutz: Anlage von seltenen, für die Artenvielfalt wertvollen Strukturen wie z.B. Auwäldern;<br />
Vermeidung der Überschwemmung und damit der Auswaschung von Nährstoffen aus landwirtschaftlichen<br />
Flächen;<br />
• Forstwirtschaft: Walderschließung und Naturverjüngung.<br />
Fördermaßnahmen mit spürbar negativen Auswirkungen auf die Umweltsituation im ländlichen Raum wurden<br />
im Rahmen <strong>des</strong> EPLR <strong>bis</strong>her nicht durchgeführt (Indikator Q 5-1.3). Umweltneutral verhielten sich 10 %<br />
der bewilligten Maßnahmen bzw. Projekte. Hierunter fallen der Bereich der Marktstrukturförderung sowie<br />
<strong>Teil</strong>e der Forstwirtschaft, Dorferneuerung, Flurneuordnung und Diversifizierungsförderung.<br />
Erhaltung der bestehenden oder Erreichung umweltfreundlicherer Bodennutzungsmuster (Kriterium<br />
Q 5-2)<br />
Mit Ausnahme der Marktstrukturförderung und der Diversifizierung trugen alle im EPLR angebotenen Programme<br />
dazu bei, die Art und Intensität der landwirtschaftlichen Bodennutzung zu stabilisieren oder führten<br />
zur Anwendung umweltgerechterer Bodennutzungsformen. Insgesamt wurde auf 1,9 Mio. ha bzw. 27 % der<br />
Lan<strong>des</strong>fläche die Bodennutzung stabilisiert oder (unter Umweltaspekten) positiv beeinflusst (Indikator Q 5-<br />
2.1; Tabelle 178). 267 Bei den Flächen handelte es sich<br />
• zu 66 % um Dauerkulturen (Grünland, Obstflächen, Wald);<br />
• zu 33 % um Ackerland und<br />
• nur in geringem Umfang um landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen.<br />
Vor allem die Agrar-Umweltprogramme bewirkten in größerem Umfang eine Erhaltung oder umweltfreundlichere<br />
Ausrichtung der Bodennutzung. Dies wurde einerseits durch Förderauflagen und die monetäre Entschädigung<br />
der dadurch bedingten höheren Aufwendungen erreicht (vgl. hierzu die Beschreibung der Maßnahmen<br />
und Förderauflagen <strong>des</strong> KULAP in Abschnitt 7). Die zweite Strategie zielt darauf ab, Flächen der<br />
landwirtschaftlichen Produktion zu entziehen und deren umweltgerechte Pflege (v.a. unter Artenschutzaspekten)<br />
durch Landwirte zu honorieren (VNP, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz nach Art. 33). Auch<br />
die Ausgleichszulage als vom Flächenumfang her größte Maßnahme führt durch den Ausschluss besonders<br />
Boden belastender Kulturen wie Weizen, Zuckerrüben und Mais zu einer Stabilisierung bzw. Verbesserung<br />
der Bodennutzung. 268 Darüber hinaus zeigen folgende Maßnahmen in begrenztem Umfang positive Nebenwirkungen<br />
auf die Bodennutzung:<br />
267 Aus methodischen Gründen sind Mehrfachzählungen einzelner Flächen möglich, die über mehrere Programme gefördert wurden.<br />
268 Die positive Wirkung der Ausgleichszulage auf die Bodennutzung wird möglicherweise überschätzt, weil voraussichtlich auch ohne<br />
Ausgleichszulage etliche Flächen in ähnlicher Weise bewirtschaftet würden.<br />
459
460<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Tabelle 178: Anteil der Flächen auf denen vorteilhafte Änderungen der Bodennutzung herbeigeführt<br />
oder negative Änderungen vermieden wurden<br />
Flächen mit<br />
positiven<br />
Wirkungen<br />
insgesamt (ha)<br />
Anteil am Programmgebiet<br />
a<br />
dav. Dauerkulturen(Grünland,Obstflächen<br />
usw.)<br />
dav.<br />
Ackerbau<br />
dav. Brachflächen<br />
Ausgleichszulage 1.492.771 21% 65% 36% 0%<br />
Natura 2000 (FFH-Richtlinie) 0 0% 0% 0% 0%<br />
Kulturlandschaftsprogramm b 337.196 5% 71% 29% 0%<br />
Vertragsnaturschutzprogramm 49.777 1% 96% 1% 0%<br />
Marktstrukturförderung 0 0% 0% 0% 0%<br />
Forstwirtschaft 4.862 0% 85% 0% 15%<br />
Flurneuordnung 1.462 0% 0% 0% 100%<br />
Dorferneuerung 1.069 0% 0% 0% 100%<br />
Diversifizierung 0 0% 0% 0% 0%<br />
Umwelt, Natur, Landschaft . . 0% 0% 100%<br />
Hochwasserschutz 2.506 0% . . .<br />
Summe 1.889.643 27% 66% 33% 0%<br />
a<br />
Bezogen auf die gesamte Fläche Bayerns im Jahr 1999 (7.054.782 ha).<br />
b Ohne Altverpflichtungen.<br />
• Forstwirtschaft: Umbau (338 ha), Naturverjüngung (2.793 ha), Waldlebensgemeinschaften (640 ha),<br />
Waldrandgestaltung (68,6 km) und Erstaufforstung (1.091 ha);<br />
• Flurneuordnung und Dorferneuerung: Die Überführung sensibler und wertvoller Flächen in Naturschutzprogramme<br />
sowie die Anlage von biotischen Strukturen führen zu Verbesserungen sowohl auf<br />
den direkt betroffenen Flächen als auch auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Feldern (Schutz<br />
vor Wind- und Wassererosion);<br />
• Hochwasserschutz: Schutz landwirtschaftlicher Flächen vor Überschwemmungen sowie Renaturierung<br />
einzelner Flächen bzw. Einstellung der landwirtschaftlichen Nutzung auf etwa 2.500 ha.<br />
Vermeidung der Verschmutzung natürlicher Ressourcen (Kriterium Q 5-3)<br />
Die Umsetzung der VO 1257 trägt dazu bei, die Verschmutzung von Wasser zu reduzieren bzw. zu vermeiden<br />
(Indikator Q 5-3.2). Diesbezüglich sind zwei Wirkungszusammenhänge wichtig: 269<br />
• Verschiedene Förderauflagen vor allem in den Agrarumweltprogrammen haben einen Rückgang <strong>des</strong><br />
Einsatzes an Pflanzenschutz- und Düngemitteln zur Folge. Auf diese Weise wird der Eintrag entsprechender<br />
Stoffe bzw. deren Abbauprodukte in das Grund- und Oberflächenwasser reduziert.<br />
• Die Maßnahmen im Bereich <strong>des</strong> Hochwasserschutzes sowie zur Vermeidung von Wassererosion im<br />
Rahmen der Flurneuordnung helfen, Überschwemmungen von landwirtschaftlich genutzten Flächen<br />
zu vermeiden und somit die Auswaschung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässer<br />
zu reduzieren.<br />
269 Eine exakte Quantifizierung der geschützten Wassermengen ist aus methodischen Gründen nicht möglich.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Auch die Emission von „Treibhausgasen“ in die Atmosphäre konnte durch die Maßnahmen <strong>des</strong> EPLR reduziert<br />
werden. Insgesamt wurde durch die <strong>Förderung</strong> der Ausstoß von 22.000 t CO2-Äquivalenten vermieden.<br />
Hierzu trugen die Diversifizierungsförderung nach Art. 33 (Substitution fossiler Energieträger durch geförderte<br />
Biogasanlagen) sowie die forstwirtschaftlichen Förderprogramme (Aufforstung von 1.091 ha) bei (vgl.<br />
Tabelle 179).<br />
Tabelle 179: Beitrag einzelner Förderprogramme zur Reduzierung <strong>des</strong> Ausstoßes an Treibhausgasen<br />
Programm<br />
Pro Jahr vermiedener Ausstoß an<br />
CO2 SOx CH4 CO2-Äquivalent<br />
Insgesamt<br />
Diversifizierungsförderung 13.800 t . 39 t 14.619 t<br />
Forstwirtschaft 7.333 t . . 7.333 t<br />
Summe 21.133 t . . 21.952 t<br />
Erhalt oder Verbesserung der Landschaften <strong>des</strong> ländlichen Raums (Kriterium Q 5-4)<br />
Alle flächenbezogenen Fördermaßnahmen, an denen landwirtschaftliche Betriebe partizipieren, haben Auswirkungen<br />
auf die Art und Intensität der Flächennutzung und somit auf das Erscheinungsbild der Kulturlandschaft:<br />
• Die Gewährung von Prämien (Ausgleichszulage, KULAP, VNP) unterstützt vor allem an Standorten<br />
mit ungünstigen natürlichen Voraussetzungen die Stabilisierung der Bewirtschaftung. Dies wirkt einer<br />
Verwilderung/Verbuschung von Grenzertragsflächen entgegen, die sich i.d.R. negativ auf das Landschaftsbild<br />
und - vor allem unter touristischen Aspekten - auf die Attraktivität der Region auswirkt.<br />
• Die Prämien sind an Förderauflagen gebunden, die tendenziell eine Erweiterung der Fruchtfolgen auf<br />
Ackerflächen sowie die Zunahme der Artendiversität auf Grünlandstandorten zur Folge haben.<br />
• Die Flurneuordnung führt durch die Zusammenlegung von Feldstücken zu einer Reduzierung der Vielfalt<br />
<strong>des</strong> Landschaftsbil<strong>des</strong>. Andererseits unterstützt sie eine längerfristige Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung<br />
vor allem in kleinstrukturierten Gebieten. Zudem wird im Rahmen der Verfahren eine<br />
große Zahl an Landschaftselementen wie Hecken, Grünstreifen, Biotope, Streuobstwiesen usw. neu<br />
geschaffen.<br />
Die Fläche, auf der vorteilhafte Änderungen der Landschaften herbeigeführt wurden, entspricht in etwa dem<br />
Umfang, auf dem die Bodennutzung stabilisiert oder positiv beeinflusst wurde. Somit trug das Programm auf<br />
rd. 1,9 Mio. ha bzw. 27 % der Gesamtfläche Bayerns zum Erhalt und zur Verbesserung <strong>des</strong> Landschaftsbil<strong>des</strong><br />
bei (Indikator Q 5-4.1; vgl. Tabelle 178). 270 Hierbei handelt es sich zu 66 % um Dauerkulturflächen<br />
(Grünland, Obstflächen, Wald).<br />
11.2.6 Querschnittsfrage 6 - Beitrag der Durchführungsbestimmungen zur Maximierung der<br />
beabsichtigten Auswirkungen <strong>des</strong> Programms<br />
Die Fördermaßnahmen wurden aufeinander abgestimmt und ergänzen einander, damit Synergieeffekte<br />
entstehen (Kriterium Q 6-1)<br />
270 Aus methodischen Gründen sind Mehrfachzählungen einzelner Flächen möglich, die über mehrere Programme gefördert wurden.<br />
461
462<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Bei den im EPLR enthaltenen Programmen handelt es sich zum größten <strong>Teil</strong> um erprobte Förderkonzepte,<br />
die in ähnlicher Form bereits früher angeboten wurden. Angesichts der langjährigen Erfahrungen mit der<br />
Umsetzung der Maßnahmen wurden diese sowohl untereinander als auch mit den anderen Programmen<br />
außerhalb <strong>des</strong> EPLR sowie mit den außerlandwirtschaftlichen Förderprogrammen abgestimmt.<br />
Da die Fördermaßnahmen unterschiedliche Förderinhalte vermitteln, an der Mehrzahl der untersuchten<br />
Maßnahmen jedoch grundsätzlich alle bayerischen Landwirte partizipieren können, ist es die Regel, dass<br />
Betriebe an mehreren Maßnahmen gleichzeitig teilnehmen. Die Landwirte wählen üblicherweise gezielt aus<br />
dem vorhandenen Angebot die für ihren Betrieb geeigneten Maßnahmen aus. Dabei kristallisiert sich neben<br />
der Verbesserung der Agrarproduktion der Umweltschutz bzw. die Landschaftspflege als zweites strategisches<br />
Handlungsfeld heraus. Die im EPLR angebotenen Programme verstärkten diesen Trend. Beispielhaft<br />
lassen sich vom KULAP erste Hinweise auf entsprechende Verhaltensmuster der Programmteilnehmer und<br />
auf Synergieeffekte ableiten (Tabelle 180):<br />
• In gut 10 % der Fälle wurden von den <strong>Teil</strong>nehmern am Kulturlandschaftsprogramm gleichzeitig auch<br />
investive Maßnahmen (Agrarinvestitionsprogramm, Junglandwirteförderung) in Anspruch genommen.<br />
Bei den nicht KULAP-geförderten Betrieben lag dieser Wert mit 17,3 % deutlich höher. Dies kann als<br />
Zeichen dafür gewertet werden, dass es sich bei dem KULAP-<strong>Teil</strong>nehmern in höherem Maße um extensiv<br />
wirtschaftende Landwirte handelt. Offensichtlich wird eine <strong>Teil</strong>nahme am KULAP von vielen<br />
Betrieben gezielt als Alternative zu betrieblichem Wachstum gewählt.<br />
• Mit knapp 70 % aller Betriebe nahmen deutlich mehr KULAP-<strong>Teil</strong>nehmer die Ausgleichszulage in Anspruch<br />
als nicht nach dem KULAP geförderte Landwirte (knapp 30 %). Dies dürfte vor allem daran liegen,<br />
dass die KULAP-Betriebe überwiegend in Regionen mit ungünstigeren natürlichen Standortbedingungen<br />
liegen. Das Programm trägt auf diese Weise einen <strong>Teil</strong> zur dortigen Aufrecherhaltung der<br />
Landbewirtschaftung bei;<br />
Tabelle 180: Häufigkeit der Kombination <strong>des</strong> Kulturlandschaftsprogramms mit anderen Maßnahmen<br />
Betriebe, die am Kulturlandschaftsprogramm …<br />
teilgenommen haben<br />
(n=135)<br />
nicht teilgenommen haben<br />
(n=75)<br />
Agrarinvestition 10,4% 17,3%<br />
Diversifizierung 0,0% 0,0%<br />
Junglandwirte 1,5% 2,7%<br />
Ausgleichszulage 69,6% 29,3%<br />
Flurbereinigung 15,6% 14,7%<br />
Dorferneuerung 11,9% 16,0%<br />
Forstwirtschaftliche Maßnahmen 0,0% 0,0%<br />
Öko-Regio 0,7% 0,0%<br />
Vertragsnaturschutz 14,1% 13,3%<br />
Quelle: Eigene Erhebungen.<br />
Das Programm wurde insbesondere von denjenigen in Anspruch genommen, die den größten Bedarf<br />
und/oder das größte Potenzial hierfür haben (Kriterium Q 6-2)<br />
Mit Ausnahme der Ausgleichszulage und einzelner <strong>Teil</strong>maßnahmen <strong>des</strong> KULAP können die im EPLR<br />
angebotenen Fördermaßnahmen grundsätzlich ohne regionale Beschränkungen in Anspruch genommen<br />
werden. Dennoch lassen sich für alle Maßnahmen regionale Unterschiede in der <strong>Teil</strong>nahme erkennen. Das
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
regionale Verteilungsmuster ist hauptsächlich dadurch bedingt, dass einzelne Maßnahmen auf bestimmte<br />
räumliche Problemlagen zugeschnitten sind und die Förderkonditionen einiger Programme räumlich differenziert<br />
werden (z.B. Ausgleichszulage, Dorferneuerung). Eine Rolle spielen aber auch interne Vereinbarungen<br />
der Förderverwaltung über räumliche Förderschwerpunkte (Flurneuordnung, Dorferneuerung). Im einzelnen<br />
lassen sich für die im EPLR umgesetzten Maßnahmen folgende räumliche Schwerpunkte feststellen,<br />
die im Einklang mit dem regionalen Bedarf stehen (Indikator Q 6-2.1):<br />
• Flurneuordnung, Dorferneuerung: Wie in den beiden Fachkapiteln bereits dargestellt wurde, konzentrieren<br />
sich beide Maßnahmen hauptsächlich auf den nord- und nordostbayerischen Raum. Dieser<br />
ist besonders von Strukturschwächen gekennzeichnet und hat den größten Bedarf an entsprechenden<br />
Maßnahmen (vgl. Abschn. 10.1 und 10.2);<br />
• Diversifizierung: 42 der 52 bewilligten Projekte liegen ebenfalls in den nordbayerischen Regierungsbezirken<br />
(Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie Oberpfalz) mit dem größten agrarstrukturellen<br />
Anpassungsbedarf (vgl. Abschn. 10.3);<br />
• Kulturlandschaftsprogramm: Auch für das KULAP konnten für einzelne Maßnahmen Hinweise darauf<br />
gefunden werden, dass das Programm in Regionen mit hohen Gefährdungspotenzialen für die<br />
einzelnen Schutzgüter überdurchschnittlich in Anspruch genommen wurde:<br />
- Die Maßnahme „Mulchsaat“ (zum Bodenschutz vor Erosion) wird überwiegend in den Gebieten<br />
nachgefragt, in denen auch ein erhöhtes Risiko für Bodenerosion festzustellen ist;<br />
- Die Maßnahmen K57, K48, K49, K90/K92-K95 wurden gezielt für gewässersensible Gebiete konzipiert<br />
und können auch nur dort in Anspruch genommen werden. Durch die Definition solcher Gebietskulissen<br />
wird weitgehend sichergestellt, dass die Maßnahmen gezielt dort durchgeführt werden,<br />
wo sie naturschutzfachlich auch sinnvoll sind.<br />
Die Ausrichtung der <strong>Förderung</strong> auf die Betriebe mit dem größten Bedarf/Potenzial wird bei der Diversifizierungsförderung<br />
nach Art. 33 vor allem durch eine intensive Beratung der potenziellen Fördermittelempfänger<br />
sowie mit Hilfe von Fördervoraussetzungen (z.B. Nachweis der Wirtschaftlichkeit) gewährleistet. Die<br />
forstwirtschaftlichen Maßnahmen wurden grundsätzlich von Betrieben aller Größenklassen und Besitzkategorien<br />
in Anspruch genommen. Der größte Förderanteil entfällt auf den Kleinprivatwald, der zumeist von<br />
gemischten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet wird. Da diese Betriebe den größten<br />
Förderbedarf aufweisen, kann die Förderpolitik als zielführend bezeichnet werden.<br />
Die Gespräche mit Vertretern der Förderverwaltungen sowie mit Begünstigten, aber auch die Analyse von<br />
Verfahrensabläufen haben ergeben, dass die im EPLR angebotenen Maßnahmen, bei deren Umsetzung auf<br />
langjährige Erfahrungen aufgebaut werden kann, relativ rationell abgewickelt werden (Indikator Q 6-2.2). Der<br />
Aufwand der Fördermittelempfänger wurde durchweg als gering bzw. vertretbar eingeschätzt. Die lokalen<br />
Verwaltungsstellen bieten Unterstützung in den Fällen an, in denen die Antragstellung individuelle Probleme<br />
verursacht.<br />
Verzögerungen in der Schaffung der administrativen Voraussetzungen für die Programmumsetzung, die<br />
auch auf die späte Genehmigung <strong>des</strong> EPLR durch die <strong>EU</strong>-Kommission zurück gehen, haben bei einigen<br />
Maßnahmen einen rascheren Programmstart und eine umfangreichere Bindung von Fördermitteln behindert.<br />
Bei der Diskussion der Qualität der Maßnahmenumsetzung in den Fachkapiteln (Abschn. 6 <strong>bis</strong> 10) konnten<br />
in Bezug auf die Umsetzungsprozeduren keine bedeutenden Mängel festgestellt werden. Gleichwohl wurden<br />
Unterschiede in der Intensität der Inanspruchnahme einzelner Maßnahmen erkennbar. Dies betrifft sowohl<br />
regionale Unterschiede in der Nachfrage als auch die Maßnahmen selbst. Um diese Zusammenhänge<br />
etwas weiter aufzuhellen, wurde eine Fallstudie zur Prüfung der „Akzeptanz und Umsetzung von Fördermaßnahmen“<br />
durchgeführt. Sie erfolgte exemplarisch zunächst für die Maßnahmen „Kulturlandschaftspro-<br />
463
464<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
gramm“ und „Diversifizierungsförderung“. Ausgewählte Ergebnisse werden in knapper Form im anschließenden<br />
Abschnitt 11.3 vorgestellt. Die ausführlichen Ergebnisse der Fallstudie, die über die Halbzeitbewertung<br />
hinaus gehen, werden Anfang 2004 in einem separaten Bericht zur Verfügung gestellt. Dort wird auch ausführlicher<br />
auf Möglichkeiten der Vereinfachung bzw. Optimierung einzelner Elemente der Agrarstrukturförderung<br />
eingegangen.<br />
Maximierung von Hebelwirkungen (Kriterium Q 6-3)<br />
Ziel investiver Fördermaßnahmen im privaten Bereich ist es in erster Linie, Investitionen auszulösen, die<br />
ohne <strong>Förderung</strong> in der selben Höhe und/oder zum selben Zeitpunkt nicht getätigt worden wären. Hierbei ist<br />
das Verhältnis zwischen den Gesamtausgaben der Begünstigten für die geförderte Investition und der Kofinanzierung<br />
der öffentlichen Hand bzw. dem Zuschuss („Hebelsatz“) ein zentrales Kriterium zur Beurteilung<br />
der Effizienz <strong>des</strong> Förderprogramms. Je niedriger der Fördersatz bzw. je höher die durch die <strong>Förderung</strong> ausgelösten<br />
privaten Investitionen sind, <strong>des</strong>to günstiger bzw. effizienter ist der Fördermitteleinsatz zu bewerten.<br />
Andererseits sinkt bei niedrigen Fördersätzen die Bereitschaft, an entsprechenden Programmen teilzunehmen.<br />
Die Halbzeitbewertung ergab bei den investiven Maßnahmen folgende Hebelwirkungen:<br />
• Marktstrukturförderung: In 43 Investitionsvorhaben wurden mit öffentlichen Fördermitteln in Höhe<br />
von 23,8 Mio. € Gesamtinvestitionen von 154,53 Mio. € angestoßen. Die Förderintensität lag somit bei<br />
rd. 17 %, der Hebelsatz entsprechend bei knapp 600 %;<br />
• Forstwirtschaftliche Maßnahmen: Der Anteil der Fördermittel an den Gesamtausgaben beträgt über<br />
alle Maßnahmen hinweg 65 % (Ergebnis der persönlichen und schriftlichen Befragungen), wobei es<br />
Unterschiede zwischen den verschiedenen Kategorien gibt. Bei Privatpersonen betrug der durchschnittliche<br />
Fördersatz 69 %, bei Kommunen 57 % und bei forstlichen Zusammenschlüssen 70 %;<br />
• Dorferneuerung: Zwischen 2000 und 2002 wurden mit Fördermitteln von 37,4 Mio. € Investitionen in<br />
einer Höhe von knapp 270 Mio. € ausgelöst. Dies entspricht einem Fördersatz von 14 % bzw. einem<br />
Hebelsatz von über 720 %;<br />
• Einschließlich der nicht förderfähigen Kostenanteile ergab die Evaluierung der Diversifizierungsförderung<br />
einen durchschnittlichen Fördersatz von 12 % bzw. einen Hebelsatz von 860 %:<br />
Die hohen Fördersätze im Bereich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen erklären sich aus den wirtschaftlichen<br />
Problemen in dem betreffenden Sektor. Entsprechende Investitionen wären ohne die <strong>Förderung</strong> in den<br />
meisten Fällen nicht getätigt worden. Die günstigen Förderkonditionen bildeten die Voraussetzung für eine<br />
Wirtschaftlichkeit der Investitionen. Die Bereiche Dorferneuerung und Diversifizierung weisen sehr positive<br />
Hebelwirkungen auf. Im Fall der Diversifizierung dürfte jedoch der relativ niedrige Fördersatz einen wesentlichen<br />
Grund für die niedrige <strong>Teil</strong>nahme am Programm darstellen.<br />
Vermeidung von Mitnahmeeffekten (Kriterium Q 6-4)<br />
Mitnahmeeffekte lassen sich grundsätzlich nicht ausschließen, ihr Nachweis ist jedoch nur eingeschränkt<br />
möglich. Vor allem bei größeren Investitionen können die Landwirte in vielen Fällen keine genauen Auskünfte<br />
darüber geben, wie sich der Betrieb ohne die <strong>Förderung</strong> entwickelt hätte. Zudem ist es durchaus möglich,<br />
dass Betroffene mitunter nicht zugeben wollen, dass sie Fördermittel nur „mitgenommen“ haben.<br />
Ebenso schwierig gestaltet sich der Schutz vor Mitnahmeeffekten bei der Formulierung der Förderkonditionen<br />
und der Auswahl der förderfähigen Projekte. Grundsätzlich ist es nicht möglich, den Antragstellern<br />
nachzuweisen, dass sie die Auflagen auch ohne <strong>Förderung</strong> eingehalten bzw. die Investitionen im gleichen<br />
Umfang und zum gleichen Zeitpunkt auch ohne Zuschüsse getätigt hätten. Bei der Gestaltung der Förder-
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
konditionen und Zuschusshöhe wurde jedoch versucht, Mitnahmeeffekte aufgrund zu hoher oder zu niedriger<br />
Fördersätze weitgehend zu vermeiden.<br />
Im einzelnen ergab die Halbzeitbewertung folgende Hinweise auf Mitnahmeeffekte bzw. deren Vermeidung:<br />
• Diversifizierungsförderung: 45 % der befragten Landwirte gaben an, dass sie die Investition voraussichtlich<br />
auch ohne Diversifizierungsförderung im selben Umfang durchgeführt hätten. Hauptursache<br />
dieser offensichtlich umfangreichen Mitnahmeeffekte dürfte der relativ niedrige Fördersatz von 15 %<br />
gewesen sein. Diese geringe Unterstützung reicht offensichtlich nicht als Anreiz aus, um noch gezielter<br />
Landwirte, die ohne <strong>Förderung</strong> nicht investiert hätten, zur Diversifizierung zu bewegen;<br />
• Flurneuordnung und Dorferneuerung: Angesichts der Finanzknappheit der Gemeinden besonders<br />
im ländlichen Raum können Mitnahmeeffekte im Bereich der öffentlichen bzw. gemeinschaftlichen<br />
Maßnahmen weitgehend ausgeschlossen werden. Die meisten Projekte hätten in Eigenregie der Gemeinden<br />
im selben Umfang nicht realisiert werden können. Im Bereich der privaten Dorferneuerungsmaßnahmen<br />
können jedoch u.a. angesichts der relativ niedrigen Fördersätze Mitnahmeeffekte nicht<br />
ausgeschlossen werden. Andererseits dient im privaten Bereich die <strong>Förderung</strong> teilweise auch dem<br />
Ausgleich der Mehrbelastungen, die durch Förderauflagen entstanden sind. Da die privaten Investoren<br />
diese Auflagen ohne <strong>Förderung</strong> i.d.R. nicht beachtet hätten, lässt sich somit von der Zuwendung<br />
auch dann ein positiver Effekt ableiten, wenn auch ohne sie die bauliche Maßnahme durchgeführt<br />
worden wäre.<br />
• Kulturlandschaftsprogramm und Vertragsnaturschutzprogramm: Bei den Agrarumweltprogrammen<br />
kann ein Mitnahmeeffekt dann ausgeschlossen werden, wenn eine Intensivierung der Bewirtschaftung<br />
verhindert oder eine Extensivierung erreicht wird, bzw. wenn eine Betriebsaufgabe, zumin<strong>des</strong>t<br />
vorerst, vermieden werden kann. Diese Aspekte lassen sich kaum nachweisen oder widerlegen.<br />
Durch die Programmteilnahme werden einzelne Flächen mit speziellen Bearbeitungs- oder Pflegeauflagen<br />
belegt, die i.d.R. eine produktive Nutzung erschweren. Die Höhe der Prämien entspricht einem<br />
durchschnittlichen monetären Verlust, der den Landwirten im Vergleich zu alternativen (produktiveren)<br />
Bewirtschaftungsformen entsteht, zuzüglich einem finanziellen Anreiz zur Programmteilnahme. Durch<br />
das flächendeckende Angebot <strong>des</strong> Programms können die finanziellen Aufwendungen bzw. Verluste,<br />
die durch die <strong>Teil</strong>nahme entstehen, regional differieren. Mitnahmeeffekte können nicht grundsätzlich<br />
ausgeschlossen werden.<br />
• Forstwirtschaft: Etwa zwei Drittel der Geförderten hätten die Maßnahmen grundsätzlich auch ohne<br />
Förderhilfen realisiert, jedoch zum großen <strong>Teil</strong> mit zeitlichen Verzögerungen, in geringerem Umfang<br />
oder in geringerer Qualität. Zwischen den Einzelmaßnahmen lassen sich deutliche Unterschiede<br />
erkennen:<br />
- Am stärksten war der Einfluss der <strong>Förderung</strong> auf Vorbau- und Umbaumaßnahmen, die ohne Beihilfe<br />
in 44% bzw. 38% der Fälle nicht ausgeführt worden wären;<br />
- Bei der Erstaufforstung hätten etwa zwei Drittel auch ohne <strong>Förderung</strong> die Maßnahme durchgeführt,<br />
allerdings hiervon nur knapp die Hälfte in der gleichen Qualität, wie es die Förderrichtlinien vorschreiben;<br />
- Ähnlich verhält es sich bei der Bestan<strong>des</strong>pflege, die zwar 70% der Befragten ohne <strong>Förderung</strong> durchgeführt<br />
hätten, aber nur ca. 30% in der gleichen Qualität, die übrigen Befragten entweder in einer geringeren<br />
Qualität, mit geringerem Flächenumfang oder zu einem späteren Zeitpunkt;<br />
- Bei der Wiederaufforstung von Waldflächen, zu der die Waldbesitzer gesetzlich verpflichtet sind, gaben<br />
ca. 70% der Befragten an, dass sie die Maßnahme nicht in der geforderten Qualität und in dem<br />
entsprechenden Umfang bzw. erst später durchgeführt hätten;<br />
- Vor allem beim forstlichen Wegebau scheint der Qualitätsaspekt eine große Rolle zu spielen. Fast alle<br />
dazu Befragten erkannten die Notwendigkeit einer Erschließung; sie hätten diese Maßnahme <strong>des</strong>-<br />
465
466<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
halb auch ohne <strong>Förderung</strong> ausgeführt, allerdings ausnahmslos in einem geringeren Qualitätsstandard.<br />
Im Bereich der Marktstrukturförderung konnten vom zuständigen Evaluierungsteam aus methodischen<br />
und zeitlichen Gründen kein Aussagen zu Mitnahmeeffekten getroffen werden (vgl. hierzu die Ausführungen<br />
in Abschnitt 8.1.2). Für die Ausgleichszulage lassen sich Mitnahmeeffekte nicht ausschließen (vgl. Fußnote<br />
268), ein exakte Quantifizierung erfolgte <strong>bis</strong>her jedoch noch nicht.<br />
Maximierung von vorteilhaften indirekten Auswirkungen (insbesondere auf der Angebotsseite) (Kriterium<br />
Q 6-5)<br />
Indirekte Auswirkungen ergeben sich in erster Linie aus Investitionen, die durch die <strong>Förderung</strong> ausgelöst<br />
wurden:<br />
• Die Maßnahmen im Bereich Forstwirtschaft haben folgende zusätzliche Umsätze bei Unternehmen im<br />
ländlichen Raum ausgelöst:<br />
- Forstbaumschulen: 5,6 Mio. € für Pflanzenmaterial;<br />
- Landschaftsplanungsbüros/Landschaftsarchitekten: 3,89 Mio. € (Standortkartierungen);<br />
- Unternehmen <strong>des</strong> Bauhauptgewerbes: 9,047 Mio. € für Walderschließung/forstlichen Wegebau.<br />
• Die Realisierung der Maßnahmen Flurneuordnung und Dorferneuerung ermöglichte Bauunternehmen<br />
im ländlichen Raum zusätzliche Einnahmen von über 225 Mio. €. Diese Umsätze flossen in Form von<br />
Vorleistungskäufen, Löhnen, Gehältern und Investitionen der Unternehmen zu einem großen <strong>Teil</strong> in<br />
die regionalen Wirtschaftskreisläufe und sorgten für eine indirekte Belebung der Wirtschaft im ländlichen<br />
Raum.<br />
• Auch die Diversifizierungsförderung hatte positive regionalwirtschaftliche Auswirkungen. Sie lassen<br />
sich jedoch angesichts der geringen Zahl von abgeschlossenen Förderfällen noch nicht quantifizieren.<br />
11.3 Fallstudie zur Akzeptanz und Umsetzung von Fördermaßnahmen<br />
Bestandteil der Halbzeitbewertung ist eine Fallstudie zur Akzeptanz und Umsetzung strukturpolitischer Förderprogramme.<br />
Hierbei wurde in erster Linie untersucht,<br />
- Art und Höhe <strong>des</strong> Aufwan<strong>des</strong> der Antragsteller und Bewilligungsbehörden für die Beantragung, Bewilligung<br />
und Abwicklung einzelner Förderprogramme;<br />
- Auswirkungen dieses Aufwan<strong>des</strong> auf die Akzeptanz und Effizienz von Förderprogrammen;<br />
- Möglichkeiten zur Vereinfachung der Förderabwicklung.<br />
Die Fallstudie wird in einem gesonderten Dokument veröffentlicht. Als Ergänzung zur Beantwortung <strong>des</strong><br />
Kriteriums Q 6-2 (Zusammenhang zwischen teilnehmenden Betrieben und deren Potenzial bzw. Bedarf)<br />
enthält der folgende Abschnitt ausgewählte Ergebnisse dieser Fallstudie für das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm<br />
sowie für die Diversifizierungsförderung gemäß Art. 33, Tiret 7.<br />
11.3.1 Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm<br />
Methodik<br />
Für die Fallstudie wurden 50 Betriebe, die bereits in die Halbzeitbewertung einbezogen waren, nochmals<br />
intensiv anhand eines strukturierten Fragebogens zu Akzeptanz, Antragsverfahren, Qualität der Beratung,<br />
Programmzielen und Wirkung interviewt. Die Auswahl der Agrargebiete und Gemeinden repräsentiert die
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
unterschiedlichen Produktionsstandorte in Bayern (vgl. Abschn. 7.2). Die Betriebe wurden nach Programmteilnahme,<br />
früherer <strong>Teil</strong>nahme, Betriebsgröße und Betriebsform ausgewählt (geschichtete Stichprobe).<br />
Beschreibung/Typisierung der direkt Begünstigten (Indikator Q 6.2.1)<br />
Vor allem Grünland-, Milchvieh- und extensive Ackerbaubetriebe zählen zu den Begünstigten <strong>des</strong> KULAP A,<br />
da die eingesetzten finanziellen Mittel zu 55% für die Grünlandprämie (K33/K34) und zu je 13% für die <strong>Förderung</strong><br />
der Maßnahmen „Ökologischer Landbau“ (K14) und „Extensive Fruchtfolge“ (K31) aufgewendet<br />
werden (vgl. Kapitel 7.3.4, Punkt: Inhaltliche Verteilung der Förderfälle).<br />
Die <strong>Teil</strong>nahmehäufigkeit an einzelnen Programmmaßnahmen wird deutlich von der jeweiligen Region und<br />
deren Strukturverhältnissen beeinflusst. So findet z. B. die „Extensive Fruchtfolge“ K31 hauptsächlich im<br />
Fränkischen Raum statt und die „Extensivierung von Wiesen mit Schnittzeitauflage“ K51 nimmt in Richtung<br />
Nordbayern zu (vgl. Kapitel 7.3.4, Punkt: Regionale Verteilung der <strong>Förderung</strong>). Dass 78 % der Kulap-<br />
<strong>Teil</strong>nehmer einen Gewinn von weniger als 25.000 € im Jahr erwirtschaften und dieser Anteil mit steigendem<br />
Gewinn sinkt ist ein Indiz dafür, dass sich vorrangig einkommensschwächere Betriebe in zumeist benachteiligter<br />
Lage an dieser Agrarumweltmaßnahme beteiligen.<br />
Das Programm dient dazu, Einkommenseinbußen auszugleichen, die durch eine Extensivierung der Bewirtschaftung<br />
bzw. durch die Vermeidung einer Intensivierung entstehen. Unter dem Vorbehalt, dass Mitnahmeeffekte<br />
nicht ganz auszuschließen sind, ist den teilnehmenden Landwirten ein Bedarf für einen Einkommensausgleich<br />
zu unterstellen.<br />
Aus naturschutzfachlicher Sicht wären die Maßnahmen vor allem in ökologischen „Problemgebieten“ durchzuführen.<br />
Primär aus ökonomischen Gründen sind diese „Problemgebiete“ jedoch nicht deckungsgleich mit<br />
der aktuellen regionalen Verteilung der Förderfälle. Insbesondere in intensiver bewirtschafteten Ackerlagen<br />
findet das Kulap wenig Zuspruch. In welchem Umfang das Programm in den stärker durch Grünland und<br />
ungünstigere natürliche Bedingungen charakterisierten Regionen den fachlichen Zielsetzungen gerecht wird,<br />
kann leider nicht eindeutig festgestellt werden, weil im Programm-Monitoring lediglich die <strong>Teil</strong>nahmen am<br />
Programm, nicht jedoch die Auswirkung dieser <strong>Teil</strong>nahme auf die Entwicklung von Natur und Umwelt erfasst<br />
werden. Als Folge der “Wahlfreiheit“ der Landwirte ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle gefährdeten<br />
Flächen auch aus ökologischer Sicht angemessen bewirtschaftet werden.<br />
Effektivität der Umsetzung (Indikator Q 6-2.2)<br />
Aufwand für den Fördermittelempfänger<br />
Der Zeitaufwand der Fördermittelempfänger für Antragstellung, betriebliche Verwaltung sowie für Kontrollen<br />
betrug in der überwiegenden Zahl (78 %) der befragten Landwirte weniger als 3 Stunden pro Antrag. Die<br />
zeitlichen und organisatorischen Belastungen für Kontrollen, die zusätzliche Dokumentation <strong>des</strong> Pflanzenschutzmittel-Einsatzes<br />
bzw. die Erstellung einer Nährstoffbilanz bei Wirtschaftsdüngern (Maßnahmen K10,<br />
K33 oder K34) wurden durchweg als gering eingestuft.<br />
Beratung<br />
Der überwiegende <strong>Teil</strong> der Landwirte (86%; 24 von 28 Antworten) war mit der Programm bezogenen Information<br />
und Beratung durch die staatlichen Verwaltungsstellen zufrieden. Nur vier Landwirte bedauerten,<br />
dass sie nicht noch offensiver und ausführlicher beraten wurden. Zu folgenden Themen wurden unzureichende<br />
Informations- oder Beratungsleistungen angemerkt: Programm- und Richtlinienänderungen, Auswirkungen<br />
<strong>des</strong> Programms auf Pflanzenbestand und Qualität <strong>des</strong> Futters sowie regelmäßige betriebsorganisatorische<br />
Beratung.<br />
Informationsmedien und Verständlichkeit<br />
Knapp die Hälfte der befragten Landwirte (46%) gab an, dass die Antragstellung und die Richtlinien <strong>des</strong><br />
KULAP A schwer verständlich seien. Dabei wurde die komplizierte Formulierung in den einzelnen Dokumen-<br />
467
468<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
ten (z.B. Richtlinien oder Merkblatt zum KULAP A) genannt und der häufige Wechsel von Maßnahmen, Vorraussetzungen<br />
und Auflagen. Für 54% war die Antragstellung problemlos verständlich.<br />
Hemmfaktoren für die <strong>Teil</strong>nahme<br />
Als wichtigste Gründe für die Nichtteilnahme am Programm wurden die spezifische Betriebsorganisation, die<br />
GV-Begrenzung bzw. die nicht ausreichende Flächenausstattung der Betriebe (Grundfutterknappheit) und<br />
der Verpflichtungszeitraum von 5 Jahren genannt. Die Prämienhöhe ist dagegen offensichtlich nicht ausschlaggebend<br />
für die Nichtteilnahme; lediglich bei der Maßnahme "Mulchsaat“ K32 könnte die Akzeptanz<br />
durch eine höhere Prämie verbessert werden.<br />
Verbesserung <strong>des</strong> Antragsverfahrens<br />
Die Komplexität <strong>des</strong> Programms bereitet, nicht zuletzt eine Folge der Maßnahmenvielfalt, durch häufige<br />
Programmänderungen und die unterschiedlichen Laufzeiten der einzelnen Maßnahmen vielfach Probleme in<br />
der Umsetzung. Hier ist u. a. der Umfang der Dokumente zu nennen und der bei den Landwirten entstehende<br />
Beratungsbedarf (s. o.). Eine Lösung wäre die Vereinfachung <strong>des</strong> Programms und ein Ausbau der Beratungs-<br />
und Informationsangebote für Landwirte und Berater. Auch wäre zu prüfen, ob die unterschiedlichen<br />
Laufzeiten der Verträge eines Landwirtes synchronisiert werden könnten. Dies hätte den Vorteil, dass für die<br />
Landwirte die Übersichtlichkeit und ein einfacheres Management <strong>des</strong> Programms erreicht würde.<br />
Die Maßnahmenvielfalt könnte durch Streichung oder Zusammenfassen einzelner Maßnahmen reduziert<br />
werden. So könnte z.B. ohne nennenswerte Nachteile die Maßnahme „Umweltorientiertes Betriebsmanagement“<br />
K10 ganz gestrichen oder in andere Maßnahmenblöcke integriert werden. Die „Grünlandprämien“ K33<br />
und K34 könnten zusammengefasst und eventuell sogar mit einer Schnittzeitpunktauflage versehen werden.<br />
Viele Landwirte stehen der Möglichkeit der „online–Antragstellung“, als Alternative zur herkömmlichen Antragstellung,<br />
positiv gegenüber. Momentan sind die Ämter und auch viele Landwirte dafür noch nicht ausreichend<br />
ausgestattet. Es liegen keine Erfahrungswerte vor, ob die „online-Antragstellung“ zu einer Entzerrung<br />
und Arbeitsentlastung bei der Bearbeitung an den Ämtern führen könnte.<br />
11.3.2 Diversifizierungsförderung<br />
Methodik<br />
Für die Fallstudie wurden 10 Betriebe, die an der Diversifizierungsförderung nach Art. 33 teilgenommen haben,<br />
zur Programmumsetzung und –abwicklung befragt. Es handelte es sich ausschließlich um Betriebe,<br />
die auch für die Beantwortung der kapitelspezifischen Bewertungsfragen interviewt wurden. Auf diese Weise<br />
konnten die zusätzlich gewonnenen Daten mit den vorhandenen Grundinformationen verschnitten und daraus<br />
Rückschlüsse gezogen werden.<br />
Beschreibung/Typisierung der direkt Begünstigten (Indikator Q 6.2.1)<br />
Bei der Charakterisierung der begünstigten Betriebe muss zwischen geförderten Biogasanlagen und sonstigen<br />
Diversifizierungsinvestitionen unterschieden werden. Da die Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage mit<br />
der Größe <strong>des</strong> landwirtschaftlichen Betriebes sowie der Anzahl der gehaltenen GV tendenziell zunimmt,<br />
investierten vor allem größere und intensiver wirtschaftende Haupterwerbsbetriebe in Biogasanlagen. Die<br />
Betreiber der untersuchten Anlagen hielten im Durchschnitt 122 GV und bewirtschafteten 93 ha LF. Dies<br />
gewährleistet eine ausreichende Versorgung mit kostengünstigem betriebseigenen Substrat und somit einen<br />
wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen.<br />
Die sonstigen <strong>Teil</strong>nehmer an der Diversifizierungsförderung bewirtschafteten mit im Schnitt 39 ha LF bzw. 26<br />
GV deutlich kleinere Betriebe. Angesichts begrenzter Wachstumsmöglichkeiten im landwirtschaftlichen Bereich<br />
versuchten diese Betriebe, durch die Aufnahme oder den Ausbau außerlandwirtschaftlicher betriebsgebundener<br />
Tätigkeiten ihre Einkommensbasis zu verbreitern. Sie verfügten in den meisten Fällen bereits
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
über gewisse Vorkenntnisse und Erfahrungen in außerlandwirtschaftlichen Erwerbsfeldern, einige waren<br />
zum Zeitpunkt der <strong>Förderung</strong> sogar schon in außerlandwirtschaftlichen Erwerbsfeldern aktiv. Die <strong>Förderung</strong><br />
konnte gemäß den Richtlinien zwar nicht zum Ausbau vorhandener Diversifizierungen verwendet werden;<br />
dennoch wurden in vielen Fällen existierende Erwerbszweige durch Investitionen in verwandte Bereiche<br />
indirekt unterstützt. Dies führte zu einer Professionalisierung der gesamten Diversifizierung <strong>des</strong> Betriebes<br />
sowie zu innerbetrieblichen Synergieeffekten.<br />
Die außerbetrieblichen Investitionen dienten hauptsächlich der Stabilisierung und Verbesserung der Haushaltseinkommen.<br />
Sie waren in vielen Betrieben nötig, weil die konventionelle Agrarproduktion längerfristig<br />
kein ausreichen<strong>des</strong> Einkommen liefern kann und/oder der Einkommensbedarf und das Arbeitskräftepotenzial<br />
der Haushalte durch den Eintritt einer neuen Generation in das Erwerbsleben angestiegen ist. Hier wirkt<br />
die Diversifizierung durch die Bereitstellung zusätzlicher Einkommen einem berufsbedingten Auspendeln<br />
oder der Abwanderung der Nachfolgegeneration grundsätzlich entgegen.<br />
Parallel zum Ausbau der Diversifizierung kristallisierten sich folgende Entwicklungsmuster heraus:<br />
• In der Mehrzahl der Fälle wurde die Landwirtschaft gezielt extensiviert bzw. reduziert, um sich stärker<br />
auf das zweite Standbein zu konzentrieren;<br />
• Die Diversifizierung ermöglichte zusammen mit der Umstrukturierung/Extensivierung der Landwirtschaft<br />
in Einzelfällen auch die Aufrechterhaltung der abhängigen Beschäftigung und der Landbewirtschaftung.<br />
Diese wäre andernfalls aufgrund <strong>des</strong> Ausscheidens der älteren Generation aus dem Erwerbsleben<br />
aufgegeben worden;<br />
• In einem Fall führte die Diversifizierung zur Aufgabe der abhängigen Beschäftigung sowohl <strong>des</strong> Betriebsleiters<br />
als auch der Betriebsleiterin, um sich voll auf die geförderte selbständige Tätigkeit<br />
konzentrieren zu können.<br />
Effektivität der Umsetzung (Indikator Q 6.2.2)<br />
Aufwand für den Fördermittelempfänger<br />
Der Zeitaufwand der Fördermittelempfänger für Antragstellung, betriebliche Verwaltung sowie für Kontrollen<br />
wurde von den befragten Betrieben als gering eingestuft. Der sechsseitige Förderantrag enthält allgemeine<br />
Angaben über den Betrieb und Haushalt sowie eine Beschreibung der geplanten Maßnahme incl. Kosten-<br />
und Finanzierungsplan. Dem Antrag müssen folgende Unterlagen und Nachweise beigelegt werden: 271<br />
• Steuerbescheide der beiden letzten Jahre;<br />
• Kostenvoranschläge/Angebote;<br />
• Genehmigter Bauplan;<br />
• Amtlicher Lageplan und Skizze;<br />
• Bargeldnachweise und Verbindlichkeiten;<br />
• Buchführungsabschlüsse;<br />
• Investitionskonzept und Wirtschaftlichkeitsberechnung;<br />
• Kreditbereitschaftserklärung;<br />
• Gesellschaftsvertrag;<br />
• Konzeptbeschreibung;<br />
• Pachtverträge und<br />
• „De-minimus“-Bescheinigung.<br />
Ein Großteil der geforderten Nachweise liegt den Landwirten ohnehin vor bzw. ist Voraussetzung für eine<br />
sachgerechte Planung der Investition, so dass sich der Aufwand zu deren Beschaffung in Grenzen hält.<br />
271 Abhängig vom Förderinhalt müssen nicht immer alle Unterlagen beigefügt werden.<br />
469
470<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Beratung, Informationsmedien und Verständlichkeit<br />
Die inhaltliche Umsetzung der Diversifizierungsförderung erfolgt über die „Ländlichen Entwicklungsgruppen“<br />
der Landwirtschaftsämter. Sie gewährleisten eine umfassende Begleitung der Landwirte bei der Planung,<br />
Kalkulation, Beantragung und Umsetzung der Maßnahmen. Die Fördermittelempfänger waren mit der<br />
Betreuung überwiegend zufrieden und fühlten sich auch durch die sonstigen Medien ausreichend und verständlich<br />
über die Fördermöglichkeit und die Konditionen informiert. Verständlicherweise können die Landwirtschaftsämter<br />
bzw. Ländlichen Entwicklungsgruppen nicht in allen Diversifizierungsbereichen das jeweils<br />
erforderliche Fachwissen vorhalten, was andererseits einige Antragsteller – unrealistischer Weise - erwarteten.<br />
Positiv wurde die umfassende Beratung und Betreuung bei den regenerativen Energien herausgehoben.<br />
Neben den Landwirtschaftsämtern existiert mittlerweile ein flächendecken<strong>des</strong> Netz an staatlichen und privaten<br />
Beratungsagenturen, welche Planung, Erstellung und Betrieb der Biogas- und Hackschnitzel-Anlagen<br />
begleiten.<br />
Hemmfaktoren für die <strong>Teil</strong>nahme<br />
Da im Rahmen der Fallstudie keine Betriebe befragt wurden, die gezielt nicht an der Diversifizierungsförderung<br />
teilgenommen haben, stützen sich die Aussagen ausschließlich auf Angaben von <strong>Teil</strong>nehmern. Diese<br />
nannten sowohl den relativ geringen Fördersatz von 15 % der förderfähigen Kosten als auch die niedrige<br />
Förderobergrenze von 51.000 € je Betrieb als hemmend für eine <strong>Teil</strong>nahme. Zudem stellt das Verbot der<br />
<strong>Förderung</strong> vorhandener Diversifizierungen, auch wenn hierdurch die Kapazitäten vergrößert oder Strukturen<br />
professionalisiert werden, ein im Sinne der Programmziele kontraproduktives Ausschlusskriterium dar. Viele<br />
Landwirte sammeln vor größeren Investitionen bzw. vor einem professionellen Einstieg gezielt Erfahrungen,<br />
um Risiken gering zu halten, Märkte zu testen, sich Fähigkeiten anzueignen usw. Somit steigen sie zum<br />
Zeitpunkt der <strong>Förderung</strong> nicht mehr neu in den Betriebszweig ein, was sie von einer Programmteilnahme<br />
grundsätzlich ausschließt.<br />
Auszahlung der Fördermittel<br />
U.a. wegen der relativ späten Genehmigung <strong>des</strong> Bayerischen Entwicklungsplans entstanden Verzögerungen<br />
in der verwaltungstechnischen Umsetzung der Diversifizierungsförderung. Dies führte dazu, dass in der<br />
zweiten Hälfte <strong>des</strong> Jahres 2001 zwar Projekte begonnen werden konnten (Genehmigung <strong>des</strong> vorzeitigen<br />
Baubeginns), die Fördermittel aufgrund noch nicht funktionierender verwaltungstechnischer Strukturen jedoch<br />
erst ab der zweiten Hälfte <strong>des</strong> Jahres 2002 ausgezahlt werden konnten. Dieser lange Zeitraum zwischen<br />
Investition/Baubeginn und der Auszahlung der Fördermittel führte bei den betroffenen Landwirten<br />
mitunter zu Unverständnis. Nach der Lösung dieser Anlaufprobleme im Jahr 2002 konnte der Zeitraum zwischen<br />
Abruf und Auszahlung der Fördermittel auf ein geringes Maß reduziert werden. Seither wird die finanztechnische<br />
Abwicklung der <strong>Förderung</strong> von den Landwirten durchweg positiv beurteilt.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
12 Literaturverzeichnis<br />
Abschnitt 6 (Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen)<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 074 vom 15.03.2002, VO (EG) Nr.<br />
445/2002 der Kommission vom 26. Februar 2002 mit Durchführungsvorschriften zur VO (EG) Nr. 1257/1999<br />
<strong>des</strong> Rates über die <strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs-<br />
und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), S. 1-34.<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 128 vom 19.05.1975, Richtlinie (EWG)<br />
268/1975 <strong>des</strong> Rates vom 28. April 1975 über die Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimmten benachteiligten<br />
Gebieten, S. 1-7.<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 142/1 vom 02.06.1997, Verordnung (EG)<br />
Nr. 950/97 <strong>des</strong> Rates vom 20.05.1997 zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 160 vom 26.06.1999, Verordnung (EG) Nr.<br />
1257/1999 <strong>des</strong> Rates vom 17. Mai 1999 über die <strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes durch<br />
den Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung<br />
bestimmter Verordnungen<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 161 vom 26.06.1999, VO (EG) Nr.<br />
1260/1999 <strong>des</strong> Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds S. 1-42.<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 193/5 vom 31.07.1993, Verordnung (EWG)<br />
Nr. 2081/93 <strong>des</strong> Rates vom 20.07.1993 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 über Aufgaben<br />
und Effizienz von Strukturfonds und über die Koordinierung ihrer Interventionen untereinander sowie mit<br />
denen der Europäischen Investitionsbank und der anderen vorhandenen Finanzinstrumente<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 218/1 vom 06.08.1991, Verordnung (EWG)<br />
Nr. 2328/91 <strong>des</strong> Rates vom 15.07.1991 zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur<br />
AMTSBLATT DER <strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Nr. L 273 vom 22. Oktober 1999 zur Änderung<br />
der Verordnung (EG) Nr. 1663/95 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 729/70<br />
<strong>des</strong> Rates bzgl. <strong>des</strong> Rechnungsabschlussverfahrens <strong>des</strong> EAGFL, Abteilung Garantie<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, 2000.<br />
Plan zur <strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländliches Raumes in Bayern 2000-2006 gemäß VO (EG)<br />
1257/1999, München<br />
BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG, Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise<br />
und Gemeinden, Ausgabe 1998, Band 1, Bonn 1998<br />
BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG: Raumordnungsbericht 2000. Band 7, Bonn 2000<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, versch. Jgg. Die Verbesserung<br />
der Agrarstruktur in der Bun<strong>des</strong>republik Deutschland – Bericht <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> und der Länder über<br />
den Vollzug der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“ (sog.<br />
Agrarstrukturbericht)<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, versch. Jgg. Agrarbericht<br />
der Bun<strong>des</strong>regierung, Bonn<br />
471
472<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
BURGATH A., DOLL H., FASTERDING F., GRENZEBACH M., KLARE K., PLANKL R., WARNEBOLDT S.:<br />
Ex-post-Evaluation von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 950/97 für den Förderzeitraum<br />
1994 <strong>bis</strong> 1999 in Deutschland. Braunschweig, November 2001 (unveröffentlichter Evaluationsbericht), 442 S<br />
+ Materialband ca. 1000 Tabellenseiten.<br />
DAX UND HELLEGERS, 2000. Policies for less favoured areas. in: CAP regimes and the European countryside:<br />
prospects for integration between agricultural, regional, and environmental policies/ ed. Floor Brouwer<br />
CABI Publikation. S.179-197<br />
D<strong>EU</strong>TSCHER BUNDESTAG (Hrsg.), versch. Jgg. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung<br />
der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“ für den Zeitraum 19.. <strong>bis</strong> 20.., Drucksache 14/1634, Bonn<br />
DITTES H., WINKLER-OTTO A., versch. Jgg. Die Finanzierungshilfen <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>, der Länder und der internationalen<br />
Institutionen, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Sonderausgabe, Heft 3, Frankfurt am<br />
Main<br />
<strong>EU</strong>ROPÄISCHE KOMMISSION, Dokument VI/12004/00 endg., Generaldirektion Landwirtschaft, Dezember<br />
2000.<br />
<strong>EU</strong>ROPÄISCHE KOMMISSION, Dokument VI/4351/02-DE, Generaldirektion Landwirtschaft, 2002.<br />
<strong>EU</strong>ROPÄISCHE KOMMISSION, Leitlinien für die Durchführung der Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen<br />
bei den Maßnahmen zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes gemäß der Verordnung (EG) Nr.<br />
1257/1999 <strong>des</strong> Rates – Aus dem EAGFL-Garantie finanzierten Maßnahmen, VI/10535/99 – DE Rev. 7 vom<br />
23.07.2002, S. 10.<br />
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, 2000, Entwicklungsplan<br />
für den ländlichen Raum im Land Hessen<br />
LANDESRECHNUNGSHOF SCHLESWIG-HOLSTEIN, 1996. Bericht zur Lan<strong>des</strong>haushaltsrechnung 1994,<br />
Kiel, 28. März 1996, S. 227-232.<br />
LANGENDORF U., 1982. Vergleichende Untersuchung der Wirkungen der Ausgleichszulage gemäß RL<br />
75/268/EWG, Titel II, in ausgewählten benachteiligten Gebieten der Europäischen Gemeinschaft. Bericht<br />
aus dem Institut für Strukturforschung im Auftrag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, S. 8 f.<br />
MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN DES LANDES SACHSEN-<br />
ANHALT, 2000. Plan <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Sachsen-Anhalt zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes für den Interventionsbereich<br />
<strong>des</strong> EAGFL-G im Förderzeitraum 2000-2006, Magdeburg<br />
MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN DES LANDES SACHSEN-<br />
ANHALT, 2000. Strukturförderung 2000-2006, Operationelles Programm Sachsen-Anhalt, Magdeburg<br />
MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND FISCHEREI MECKLENBURG-<br />
VORPOMMERN, 2000. Plan <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Mecklenburg-Vorpommern zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes<br />
2000-2006, Abteilung Garantie, Schwerin<br />
MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE RÄUME, LANDESPLANUNG, LANDWIRTSCHAFT UND TOURISMUS<br />
DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN, 2000. Plan <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein zur Entwicklung <strong>des</strong><br />
ländlichen Raumes, Kiel
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES<br />
BRANDENBURG, 2000. Entwicklungsplan für ländlichen Raum im Land Brandenburg bezogen auf die Flankierenden<br />
Maßnahmen <strong>des</strong> EAGFL, Abteilung Garantie gem. VO (EG) Nr. 1257/99 Art. 35 (1) Förderperiode<br />
2000-2006, Potsdam<br />
MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ<br />
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN, 2000. Plan <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung<br />
<strong>des</strong> ländlichen Raums<br />
MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM, 2000. Maßnahmen und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 2000-<br />
2006, Stuttgart<br />
PLANKL, R., 1989. Entwicklung der Ausgleichszulage in der Bun<strong>des</strong>republik: Ziele, Ausgestaltung und Mittelaufwand,<br />
Arbeitsbericht 2/1989, Institut für Strukturforschung Bun<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft, Braunschweig-Völkenrode<br />
PLANKL R., 1994 Zur Wirksamkeit der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten der Bun<strong>des</strong>republik<br />
Deutschland. Agrarwirtschaft Jg. 43, Juni 1994, S.236 – 243.<br />
REFARDT M., 1999. Betriebswirtschaftliche Auswertungen <strong>des</strong> BML-Jahresabschlusses. Schriftenreihe <strong>des</strong><br />
HLBS, H. 154, S. 257 ff.<br />
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (SMUL): Buchführungsergebnisse<br />
der Landwirtschaft im Freistaat Sachsen, Wirtschaftsjahr 1999/2000, Dresden, April 2001.<br />
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT, 2000. Entwicklungsplan<br />
für den ländlichen Raum <strong>des</strong> Mitgliedstaates der Europäischen Union Bun<strong>des</strong>republik Deutschland für den<br />
Freistaat Sachsen 2000-2006, Dresden<br />
SENATOR FÜR WIRTSCHAFT UND HÄFEN, 2000. Plan <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Bremen zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Raumes, Bremen<br />
SENATSVERWALTUNG FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE, 2000. Plan zur Entwicklung ländlicher<br />
Räume <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Berlin, Berlin<br />
STATISTISCHE ÄMTER DER LÄNDER UND DES BUNDES, Kreiszahlen – Ausgewählte Regionaldaten für<br />
Deutschland. Ausgabe 1999.<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT, 1999. Tabellenprogramm zur Landwirtschaftszählung 1999 (einschl. Agrarstrukturerhebung)<br />
– Arbeitsunterlage, S. 6, Wiesbaden<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT, 2000. Landwirtschaftszählung 1999 (<strong>bis</strong>her unveröffentlicht), Wiesbaden<br />
THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT, 2000. Entwicklungsplan<br />
für den ländlichen Raum 2000-2006, EAGFL – Abteilung Garantie, Erfurt<br />
THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT, 2000. Operationelles<br />
Programm <strong>des</strong> Freistaates Thüringen für den Einsatz der Europäischen Strukturfonds in der Periode<br />
von 2000-2006, Erfurt<br />
473
474<br />
Abschnitt 7.3 (Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm <strong>Teil</strong> A)<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
ALKEMEIER, F. (2002): Wiesenbrüterkartierung 2002 im Bereich Wiesmet (Altmühltal zwischen Muhr am<br />
See und Ornbau). Regierung von Mittelfranken, unveröffentlicht.<br />
AUERSWALD, K. (2002): Daten zur Erosionsgefährdung, mündl. Mitteilung.<br />
AUERSWALD, K. und F. SCHMIDT (1989): Atlas der Erosionsgefährdung in Bayern. Karten zum flächenhaften<br />
Bodenabtrag durch Regen. GLA Fachberichte 1. Bayerisches Geologisches Lan<strong>des</strong>amt, München<br />
BARBAND, D., T. V. ELSEN, R. OPPERMANN und S. HAACK (2003): Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen<br />
- eine ökologische Leistung? - Ein ergebnisorientierter Ansatz für die Praxis. Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung<br />
zum Ökologischen Landbau: Ökologischer Landbau der Zukunft, Wien.<br />
BASTIAN, O. und K.-F. SCHREIBER (1994): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Gustav<br />
Fischer Verlag, Stuttgart<br />
BAYLFSTAD (1999): Betriebsstruktur in der Landwirtschaft Bayerns 1999. Ausgewählte Ergebnisse für Gemeinden<br />
aus der Landwirtschaftszählung/Agrarstrukturerhebung 1999. Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft<br />
528<br />
BRANDHUBER, R., R. RIPPEL und J. KREITMAYR (2002): Bodenerosion und Gefahrenabwehr. Arbeitshilfen<br />
zur Umsetzung von § 8 BodSchV in Bayern. Bayerische Lan<strong>des</strong>anstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau.<br />
(http://www.lfl.bayern.de/).<br />
DORFNER, G. (1999): Wechselwirkungen zwischen dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm und dem<br />
landwirtschaftlichen Strukturwandel. Dissertation, Freising-Weihenstephan<br />
FREDE, H. G. (1986): Erosionsgefährdung in der Landwirtschaft. KTBL-Arbeitspapier. 104. 104, Kuratorium<br />
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL), Darmstadt<br />
GEIER, U. (2000): Anwendung der Ökobilanz-Methode in der Landwirtschaft - dargestellt am Beispiel einer<br />
Prozeß-Ökobilanz konventioneller und organischer Bewirtschaftung. P. D. U. K. (Hrsg.). Schriftenreihe Institut<br />
für organischen Landbau. 13. 13, Verlag Dr. Köster, Berlin<br />
GEIER, U., G. URFEI und J. WEIS (1996): Stand der Umsetzung einer umweltfreundlichen Bodennutzung in<br />
der Landwirtschaft. Analyse der Empfehlungen <strong>des</strong> Schwä<strong>bis</strong>ch Haller Agrarkolloquiums der Robert Bosch<br />
Stiftung. Verlag Dr. Köster, Berlin<br />
GEROWITT, B. und M. WILDENHAYN (1997): Ökologische und ökonomische Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen<br />
im Ackerbau. Ergebnisse <strong>des</strong> Göttinger INDEX-Projektes 1990-1994. BMU und Universität<br />
Göttingen,<br />
HEGE, U., FISCHER und OFFENBERGER (2003): Nährstoffsalden und Nitratgehalte <strong>des</strong> Sickerwassers in<br />
ökologisch und üblich bewirtschafteten Ackerflächen. Schriftenreihe 03/03.<br />
HEGE, U. und G. POMMER (1998): Auswirkungen unterschiedlicher Intensitäten im Ackerbau auf den Nitratgehalt<br />
<strong>des</strong> Sickerwassers. B. L. f. B. u. P. (LBP) (Hrsg.): Schriftenreihe der LBP. Freising-München.<br />
ISSELSTEIN, J., G. STIPPICH und W. WAHMHOFF (1991): Umweltwirkungen von Extensivierungsmaßnahmen<br />
im Ackerbau - Eine Übersicht. Berichte der Landwirtschaft 69. 379-413
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
KNAUER, N. (1993): Ökologie und Landwirtschaft, Situation, Konflikte, Lösungen. Eugen Ulmer Verlag,<br />
Stuttgart<br />
KNICKEL, K., B. JANSSEN, J. SCHRAMEK und K. KÄPPEL (2001): Naturschutz und Landwirtschaft: Kriterienkatalog<br />
zur "Guten fachlichen Praxis". Angewandte Landschaftsökologie Heft 41, Bun<strong>des</strong>amt für Naturschutz<br />
2001.<br />
KONOLD, W. und H.-G. WEHLING (1994): Naturlandschaft-Kulturlandschaft. Naturlandschaft - Kulturlandschaft.<br />
Der Bürger im Staat. Lan<strong>des</strong>zentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Heft 1 1<br />
KÖPKE, U. und B. FRIEBEN (1998): Untersuchungen zur <strong>Förderung</strong> Arten- und Biotopschutzgerechter Nutzung<br />
und ökologischer Strukturvielfalt im Ökologischen Landbau. Schriftenreihe Institut für organischen<br />
Landbau. 60<br />
KRIEGBAUM, H. (1999): Erfolgskontrollen <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> in Bayern - eine Übersicht <strong>bis</strong>heriger Ergebnisse.<br />
Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Umweltschutz (Hrsg.): Effizienzkontrollen im Naturschutz. Beiträge zum<br />
Artenschutz 22. Schriftenreihe Heft 150. Schriftenreihe Heft 150, Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Umweltschutz,<br />
Augsburg<br />
LBA (1999): Erläuterungen zur Landwirtschaftlichen Standortkartierung (LSK) in Bayern.<br />
LBA (2002): Buchführungsergebnisse <strong>des</strong> Wirtschaftsjahres 2001/2002. H. B. L. f. B. u. Agrarstruktur. München<br />
LEP (2002): Lan<strong>des</strong>entwicklungsprogramm Bayern 2002.<br />
LFW (2003): Berichtsentwurf "Grundwasserbeschaffenheit in Bayern 1998-2002" <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>amtes für Wasserwirtschaft.<br />
München.<br />
LINDENAU, G. (2001): Die Entwicklung der Agrarlandschaften in Südbayern und ihre Akzeptanz in der Bevölkerung.<br />
Dissertation zur Erlangung <strong>des</strong> Doktorgra<strong>des</strong> am Wissenschaftszentrum für Ernährung, Landnutzung<br />
und Umwelt der Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan.<br />
LSK (1982): Landwirtschaftliche Standortkartierung (LSK) in Bayern. H. B. L. f. B. u. P. s. f. B. u. Agrarstruktur.<br />
München 1982<br />
MAIDL, F.-X. und H. BRUNNER (1998): Strategien zur Umsetzung einer flächendeckend gewässerschonenden<br />
Landbewirtschaftung. Freising-Weihenstephan<br />
NIEBERG, H. (1995): Produktionstechnische und wirtschaftliche Folgen der Umstellung auf ökologischen<br />
Landbau - Ergebnisüberblick über die ersten vier Untersuchungsjahre der ökonomischen Begleitforschung<br />
zum EG-Extensivierungsprogramm. I. (Hrsg). Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-<br />
Völkenrode (FAL), Braunschweig-Völkenrode<br />
OSTERBURG, B., U. STRATMANN (2002): Die regionale Agrarumweltpolitik in Deutschland unter dem Einfluss<br />
der Förderangebote der Europäischen Union. Agrarwirtschaft 51. Heft 5 259-279<br />
PIORR, A. und W. WERNER (1998): Nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme im Vergleich: Bewertung<br />
anhand von Umweltindikatoren. Schriftenreihe Agrarspectrum. Band 28<br />
475
476<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
RAMSAUER, U. (1998): Landwirtschaft und Ökologie. Forum Umweltrecht. Band 28. Band 28, Nomos Verlagsgesellschaft,<br />
Baden-Baden<br />
RÖTZER, T., R. WÜRLÄNDER, H. HÄCKEL und U.A. (1997): Agrar- und Umweltklimatologische Atlas von<br />
Bayern (1961-1990). Deutscher Wetterdienst Weihenstephan.<br />
SCHWERTMANN, VOGL und KAINZ (1990): Bodenerosion durch Wasser. Vorhersage <strong>des</strong> Abtrags und<br />
Bewertung von Gegenmaßnahmen. 2. Auflage. 2. Auflage, Ulmer, Stuttgart<br />
SRU (2003): Für eine Stärkung und Neuorientierung <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong>. Natur und Landschaft. Heft 2, 72-76<br />
STACHOW, U., G. BERGER und A. WERNER (2002): Folgenabschätzung landwirtschaftlicher Produktionstechnik<br />
auf die Habitatqualität von Ackerflächen und Agrarlandschaften. Schriftenreiche <strong>des</strong> BMVEL, Heft<br />
494 "Biologische Vielfalt mit der Land- und Forstwirtschaft?" 120-126<br />
STMLF (2000): Programm 2000. Leistungen für Land und Leute. B. S. f. L. u. F. (Hrsg.). München<br />
STMLF (2002a): Bayerischer Agrarbericht 2002.<br />
STMLF (2002b): Daten aus dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS).<br />
STMLF (2002c): Land Bayern. Lagebericht gem. Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 445/2002 für den Plan zur<br />
<strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes in Bayern gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999.<br />
STMLF (2003): Förderdaten KULAP-A gem. VO (EG) 1257/99, ab Verpflichtungsbeginn 2000, Auszahlung<br />
2002.<br />
STMLU (2002): Förderdaten <strong>des</strong> Vertragsnaturschutzprogramms der Jahre 1996-2002 gem. VO (EG)<br />
1257/99.<br />
TISCHNER, H. und B. SCHENKEL (2002): Intensität <strong>des</strong> Pflanzenschutzmitteleinsatzes in landwirtschaftlichen<br />
Naturräumen. Schule und Beratung, 4/02. 8-14<br />
VOGL, W. (1995): Tolerierbare Bodenerosion - Grenzwerte für den Bodenschutz. www.uvm.badenwuerttemberg.de/bofaweb/berichte/mzb04/mzb0493.htm.<br />
WALDHARDT, R., D. SIMMERING, K. FUHR-BOßDORF und A. OTTE (2000): Beziehungen zwischen der<br />
Vielfalt von Flora und Vegetation und der Landnutzung in einer peripheren Kulturlandschaft. Korn, Horst und<br />
Ute Feit (Bearb.): Treffpunkt Biologische Vielfalt. Bun<strong>des</strong>amt für Naturschutz 2001. 221-227<br />
WELLER, F. (1992): Geschichte, Funktionen und künftige Entwicklungsmöglichkeiten <strong>des</strong> Streuobstbaues in<br />
Baden-Württemberg. Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-<br />
Württemberg, 66.<br />
WETTERICH, F. und G. HAAS (1999): Ökobilanz Allgäuer Grünlandbetriebe; Intensiv-Extensiv-Ökologisch.<br />
P. D. U. K. (Hrsg.). Schriftenreihe Institut für organischen Landbau. 12. 12, Verlag Dr. Köster, Berlin<br />
WISCHMEIER, W, und D. SMITH (1978): Predicting rainfall erosion losses – a guide to conservation planning.<br />
Agricultural Handbook No. 537. US Department of Agriculture. Washington D.C.
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
Abschnitt 7.5 (Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm)<br />
ACHTZIGER, R., H. NICKEL und R. SCHREIBER (1999): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen<br />
auf Zikaden, Wanzen, Heuschrecken und Tagfalter im Feuchtgrünland. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Umweltschutz.<br />
Effizienzkontrollen im Naturschutz. Schriftenreihe Heft 150.<br />
ALKEMEIER, F. (2002): Wiesenbrüterkartierung 2002 im Bereich Wiesmet (Altmühltal zwischen Muhr am<br />
See und Ornbau). Regierung von Mittelfranken, unveröffentlicht.<br />
BASTIAN, O. und K.-F. SCHREIBER (1994): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Stuttgart.<br />
Gustav Fischer Verlag.<br />
EBERHERR, T. (2003): mündliche Mitteilung, StMLU.<br />
FISCHER, H. S. (1999): Auswirkungen <strong>des</strong> Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms auf die Vegetationsentwicklung<br />
von Feuchtgrünland. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Umweltschutz. Effizienzkontrollen im Naturschutz.<br />
Schriftenreihe Heft 150.<br />
GEIER, U., G. URFEI und J. WEIS (1996): Stand der Umsetzung einer umweltfreundlichen Bodennutzung in<br />
der Landwirtschaft. Analyse der Empfehlungen <strong>des</strong> Schwä<strong>bis</strong>ch Haller Agrarkolloquiums der Robert Bosch<br />
Stiftung. Berlin. Verlag Dr. Köster.<br />
GÜTHLER, W., C. KRETSCHMAR und D. PASCH (2003): Vertragsnaturschutz in Deutschland: Verwaltungs-<br />
und Kontrollprobleme sowie mögliche Lösungsansätze. BfN-Skripten 86.<br />
ISSELSTEIN, J., G. STIPPICH und W. WAHMHOFF (1991): Umweltwirkungen von Extensivierungsmaßnahmen<br />
im Ackerbau - Eine Übersicht. Berichte der Landwirtschaft 69.: 379-413.<br />
KNAUER, N. (1993): Ökologie und Landwirtschaft, Situation, Konflikte, Lösungen. Stuttgart. Eugen Ulmer<br />
Verlag.<br />
KNICKEL, K., B. JANSSEN, J. SCHRAMEK und K. KÄPPEL (2001): Naturschutz und Landwirtschaft: Kriterienkatalog<br />
zur "Guten fachlichen Praxis". Angewandte Landschaftsökologie Heft 41, Bun<strong>des</strong>amt für Naturschutz<br />
2001.<br />
KRIEGBAUM, H. (1999): Erfolgskontrollen <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> in Bayern - eine Übersicht <strong>bis</strong>heriger Ergebnisse.<br />
Augsburg, Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Umweltschutz (Hrsg.): Effizienzkontrollen im Naturschutz. Beiträge<br />
zum Artenschutz 22. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Umweltschutz.<br />
LFU (1999): Effizienzkontrollen im Naturschutz. Bayerisches Lan<strong>des</strong>amt für Umweltschutz, Beiträge zum<br />
Artenschutz 22,.<br />
LINDENAU, G. (2001): Die Entwicklung der Agrarlandschaften in Südbayern und ihre Akzeptanz in der Bevölkerung.<br />
Dissertation zur Erlangung <strong>des</strong> Doktorgra<strong>des</strong> am Wissenschaftszentrum für Ernährung, Landnutzung<br />
und Umwelt der Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan.<br />
PIORR, A. und W. WERNER (1998): Nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme im Vergleich: Bewertung<br />
anhand von Umweltindikatoren. Schriftenreihe Agrarspectrum. Band 28.<br />
SCHWEPPE-KRAFT, B. (2003): Naturschutz durch Vermarktung naturverträglich erzeugter Güter und<br />
Dienstleistungen - ein Überblick zum vorliegenden Schwerpunktheft. Natur und Landschaft. Heft 7: 293-294.<br />
477
478<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
SRU (1996): Sondergutachten Landnutzung. Konzepte einer dauerhaften umweltgerechten Nutzung ländlicher<br />
Räume. http://www.umweltrat.de/son96kf.htm. Abrufdatum 6.05.2003.<br />
SRU (2003): Für eine Stärkung und Neuorientierung <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong>. Natur und Landschaft. Heft 2: 72-<br />
76.<br />
STMLF (2002a): Bayerischer Agrarbericht 2002.<br />
STMLF (2002b): Land Bayern. Lagebericht gem. Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 445/2002 für den Plan zur<br />
<strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes in Bayern gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999.<br />
STMLF (2002a): Land Bayern. Lagebericht gem. Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 445/2002 für den Plan zur<br />
<strong>Förderung</strong> der Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes in Bayern gem. Verordnung (EG) Nr. 1257/1999.<br />
WALDHARDT, R., D. SIMMERING, K. FUHR-BOßDORF und A. OTTE (2000): Beziehungen zwischen der<br />
Vielfalt von Flora und Vegetation und der Landnutzung in einer peripheren Kulturlandschaft. Korn, Horst und<br />
Ute Feit (Bearb.): Treffpunkt Biologische Vielfalt. Bun<strong>des</strong>amt für Naturschutz 2001. 221-227.<br />
Abschnitt 8 (Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse)<br />
ELF (2000): Bayerischer Agrarbericht 2000; Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Forsten. München<br />
ELF (2002): Bayerischer Agrarbericht 2002; Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Forsten. München<br />
LFE (2001): Vieh- und Fleischwirtschaft in Bayern 2001; Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft<br />
und Forsten. München<br />
LFE (2001): Statistik der Bayerischen Milchwirtschaft 2001; Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft<br />
und Forsten. München<br />
GRASER, S./HUBER, J. (2002): Das bayerische Ernährungsgewerbe im Jahr 2001; (LFE) Bayerische Lan<strong>des</strong>anstalt<br />
für Ernährung. München<br />
FAL 2002 : Ex-Post Bericht <strong>Teil</strong> Bayern<br />
Abschnitt 9 (Forstwirtschaftliche Maßnahmen)<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN: Bayerischer Agrarbericht<br />
1998. München 1999<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN: Bayerischer Agrarbericht<br />
2002 München 2003<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN: Jahresbericht der Bayerischen<br />
Staatsforstverwaltung 2001. München 2002
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN: Das potenzielle Rohholzaufkommen<br />
in Deutschland <strong>bis</strong> zum Jahr 2020. Bonn 1996<br />
BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG: Testbetriebsnetze der Forstwirtschaft in Baden-<br />
Württemberg. Heft 34. Freiburg 2001<br />
BÖSWALD, K. (1996): Zur Bedeutung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> und der Forstwirtschaft im Kohlenstoffhaushalt, eine Analyse<br />
am Beispiel <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>lan<strong>des</strong> Bayern. Forstliche Forschungsberichte. München 1996.<br />
INSTITUT DER D<strong>EU</strong>TSCHEN WIRTSCHAFT KÖLN (2003): Deutschland in Zahlen. Köln 2003.<br />
JENSSEN, M., HOFMANN, G. (2002): Pflanzenartenvielfalt, Naturnähe und ökologischer Waldumbau.<br />
AFZ/DerWald, Heft 8, 2002, S. 402 - 405<br />
OHRNER, G. (1999): Wie wirtschaftliche arbeiten Harvester? Forst und Holz, Heft 23, 1999, S. 727 – 732<br />
PERSCHL, H., BECK, R., OHRNER, G.: Welche Holzmengen kommen aus dem Kleinprivatwald Bayerns.<br />
LWFaktuell, Heft 36, 2002, S. 7 - 9<br />
RITTERSHOFER, F.(1994): Waldpflege und Waldbau. Rittershoferverlag Freising 1994.<br />
SCHAFFNER, S. (2001): Die Waldbesitzerlandschaft Ostbayerns heute und vor 20 Jahren. LWFaktuell, Heft<br />
32, 2001, S. 9 - 11<br />
THOMAS, F.: Die Rolle schnellwachsender Baumarten bei der CO2-Bindung und Klimaverbesserung.<br />
Forst und Holz Heft 3, 2001, S. 81 - 85<br />
VOGL, R. (2001): Waldpädagogische Angebote für Städte und Gemeinden. AFZ/Der Wald, Heft 8,<br />
2001, S. 415 - 416<br />
WALDGESETZ FÜR BAYERN (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August zuletzt<br />
geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 1997 (GVBl. S. 853, 856, 857)<br />
ZERLE, HEIN, BRINKMANN, FOERST, STÖCKEL (1974/2000): Forstrecht in Bayern. München 2000.<br />
Abschnitt 10 (<strong>Förderung</strong> der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten)<br />
AUTOBAHNDIREKTION SÜDBAYERN (1993): Loseblattsammlung Weinzierl „Entschädigungsbewertung<br />
bei Landentzug“, München<br />
BAYERISCHER KLIMAFORSCHUNGSVERBUND (BayFORKLIM) 1999: Klimaänderungen in Bayern und<br />
ihre Auswirkungen. Abschlussbericht <strong>des</strong> Bayerischen Klimaforschungsbun<strong>des</strong>. München.<br />
BAYERISCHER NATURSCHUTZFONDS (1999): Förderrichtlinien vom 01. Juli 1999.<br />
BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG (2001): Statistisches Jahrbuch<br />
für Bayern 2001, München<br />
BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG (2003): Statistische Berichte<br />
E2110J 200200: Bauhauptgewerbe in Bayern im Jahre 2002, München<br />
479
480<br />
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUMS FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (1981):<br />
Bekanntmachung vom 18. Dezember 1981 Nr. 7441-933-845.<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUMS FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (1983):<br />
Bekanntmachung vom 23. März 1983 Nr. 7311-95-4565.<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (2003):<br />
Nachhaltiger Hochwasserschutz in Bayern - Aktionsprogramm 2020 für Donau- und Maingebiet. Internetzugriff<br />
im Juli 2003: www.umweltministerium.bayern. de/bereiche/wasser/speicher/strategie.html<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1991): Beschäftigungseffekte<br />
durch Flurbereinigung und Dorferneuerung in Bayern. Ergebnisbericht zur Untersuchung <strong>des</strong><br />
ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. In: Materialien zur Ländlichen Neuordnung, Heft 24, München<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN: Der Einfluss der Flurbereinigung<br />
auf die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe in Bayern. Materialien zur Flurbereinigung<br />
– Heft 16.<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (2000): Programm 2000<br />
- Leistungen für Land und Leute<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (2002): Jahresbericht<br />
der Bayerischen Staatsforstverwaltung 2001, München<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND TECHNOLOGIE (2002):<br />
Jahresbericht 2002 vom 26.06.2003 <strong>des</strong> Referats III/1 S. 10 ff.<br />
BECKMANN, T. UND HUTH, E. (1983): Bestimmung der An- und Durchschneidungsschäden mit tatsächlichen<br />
Bewirtschaftungsdaten (Richtwerte). Schriftenreihe <strong>des</strong> HLBS, Heft 94, Bonn<br />
BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (1998): Leitfibel vorbeugender Hochwasserschutz.<br />
Modellvorhaben zum vorbeugenden Hochwasserschutz Rhein-Maas im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit<br />
in der Raumordnung (INTERREG IIC). Bonn,<br />
D<strong>EU</strong>TSCHER BUNDESTAG (2002): Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" für den Zeitraum 2003 <strong>bis</strong> 2006, Berlin<br />
Ebble für Windows, Version 4.1. Bedienungsanleitung Stand 12.04.2002. Erhältlich unter www.ebble.de.<br />
ENTSCHÄDIGUNGSRICHTLINIEN LANDWIRTSCHAFT – LandR 78 – i.d.F. vom 28.07.1978<br />
GEIßENDÖRFER, M., THOMAS, M., SEIBERT, O. (1999): Weitere wissenschaftliche Begleitung der Ziel 5b<br />
II-Strukturförderung in Bayern. Analyse <strong>des</strong> <strong>bis</strong>herigen Förderinstrumentariums zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Raumes mit Vorschlägen zu <strong>des</strong>sen Weiterentwicklung. Triesdorf<br />
GEIßENDÖRFER, M., THOMAS, M., SEIBERT, O. (2002): Ex post-Evaluierung <strong>des</strong> Ziel 5b II-Programms<br />
Bayern, Triesdorf<br />
GOERGENS, M. (2001): Kosten der Direktvermarktung. Skript für das Bun<strong>des</strong>kernobstseminar 2001 an der<br />
Obstbauversuchsanstalt Jork der Landwirtschaftskammer Hannover. Hannover
Halbzeitbewertung EPLR Bayern<br />
HANS-BÖCKLER-STIFTUNG: Tarifarchiv <strong>des</strong> Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) unter<br />
http://www.tarifarchiv.de<br />
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU KfW (2003): Programm Nr. 128: Programm zur <strong>Förderung</strong> erneuerbarer<br />
Energien, Frankfurt<br />
KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT(2001): Abschlussbericht<br />
zum Projekt „Anpassung der deutschen Methodik zur rechnerischen Emissionsermittlung an internationale<br />
Richtlinien.<br />
LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER 1995: Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz,<br />
Stuttgart. Im Internet als Download unter www.lawa.de<br />
WEIGER, H. (2003): Mehr Überflutungsflächen und keine Staustufen an der Donau. Internet:<br />
www.bundnaturschutz.de/projekte/donau/donauhochwasser.html.<br />
481