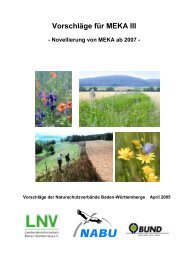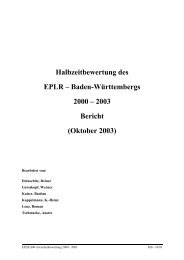Kiel , - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
Kiel , - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
Kiel , - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Stand: 16.07.03<br />
- B 1 -<br />
Zukunft auf dem Land<br />
TEIL B<br />
PROGRAMMPLANUNGSDOKUMENT<br />
FÜR DIE ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMES<br />
AUSSERHALB ZIEL 1 IN SCHLESWIG-HOLSTEIN<br />
(D<strong>EU</strong>TSCHLAND)<br />
2000 <strong>bis</strong> 2006<br />
nach der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
<strong>des</strong> Rates<br />
vom 17. Mai 1999<br />
IN DER VON DER KOMMISSION DER<br />
<strong>EU</strong>ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN<br />
MIT ENTSCHEIDUNG [K (2003) -2667] VOM 16.07.2003-<br />
GENEHMIGTEN FASSUNG<br />
Dieses Programmplanungsdokument wurde erstellt vom Ministerium für ländliche Räume,<br />
Lan<strong>des</strong>planung, Landwirtschaft und Tourismus <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein,<br />
Düsternbrooker Weg 104 in D-24105 <strong>Kiel</strong><br />
und ist autorisiert von der Lan<strong>des</strong>regierung Schleswig-Holstein<br />
durch Beschluss vom 23.11.1999 (Dringlichkeitsvorlage Nr. 293/1999)
Stand: 16.07.03<br />
- B 2 -<br />
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
4. FINANZPLÄNE....................................................................................... B 5<br />
4.1 Indikativer Finanzierungsplan zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes in Schleswig-<br />
Holstein.........................................................................................................................................B 5<br />
4.2 Indikativer Finanzierungsplan zur Verwendung der druch die Differenzierung<br />
freigewordenen Mittel (Modulation) .........................................................................................B 6<br />
5. BESCHREIBUNG DER ZUR DURCHFÜHRUNG DES PLANES<br />
ERWOGENEN MAßNAHMEN................................................................ B 7<br />
5.1 Schwerpunkt A - Produktionsstruktur (Titel II Kap. I - III und VII) ...................................B 9<br />
Maßnahme a 1: Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) (Titel II Kap. I und II)...............B 9<br />
Maßnahme c 1: Berufsbildung für Landwirte (Titel II Kap. III)...............................................B 16<br />
Maßnahme g 1: Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von<br />
landwirtschaftlichen Erzeugnissen (<strong>Förderung</strong> im Bereich der<br />
Marktstrukturverbesserung und auf Grund <strong>des</strong> Marktstrukturgesetzes)<br />
(Titel II Kap. VII)............................................................................................B 21<br />
Maßnahme g 2: <strong>Förderung</strong> der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional<br />
erzeugter landwirtschaftlicher Produkte (Titel II Kap. VII) ............................B 36<br />
5.2 Schwerpunkt B - Ländliche Entwicklung (Titel II Kap. IX)..................................................B 45<br />
Maßnahme k 1 : <strong>Förderung</strong> der Flurbereinigung(Titel II Kap. IX) ............................................B 45<br />
Maßnahme n 1: Ländliche Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung ländlicher<br />
Regionen (Dorferneuerung) (Titel II Kap. IX) ................................................B 52<br />
Maßnahme n2: Initiative ”Biomasse und Energie” (Titel II Kap. IX)......................................B 57<br />
Maßnahme o 1: Dorferneuerung - Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und<br />
Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes (Titel II Kap. IX) .................................B 67<br />
Maßnahme o 2: Lan<strong>des</strong>maßnahme Dorfentwicklung - Dorferneuerung und -entwicklung<br />
sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes (Titel II Kap. IX) .....B74<br />
Maßnahme o 3: <strong>Förderung</strong> wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen -<br />
Neubau von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen in ländlichen<br />
Gemeinden (Titel II Kap. IX)..........................................................................B 80<br />
Maßnahme p 1: Um- und Ausbaumaßnahmen von landwirtschaftlichen Gebäuden zur<br />
Schaffung neuer Erwerbsquellen für Landwirte (Dorferneuerung) (Titel II<br />
Kap. IX)...........................................................................................................B 86<br />
Maßnahme p 2: Um- und Ausbaumaßnahmen von landwirtschaftlichen Gebäuden zur<br />
Schaffung von Erwerbsquellen für Landwirte (Lan<strong>des</strong>maßnahme<br />
Dorfentwicklung) (Titel II Kap. IX)................................................................B 93
Stand: 16.07.03<br />
- B 3 -<br />
Maßnahme r 1: Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen und ländliche Struktur- und<br />
Entwicklungsanalysen (Dorferneuerung) (Titel II Kap. IX)............................B 99<br />
Maßnahme r 2: Ländlicher Wegebau (Titel II Kap. IX) .........................................................B 105<br />
Maßnahme s 1: Fremdenverkehrliche Maßnahmen innerhalb der dörflichen<br />
Siedlungsbereiche (Titel II Kap. IX) .............................................................B 111<br />
Maßnahme s 2: <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> ländlichen Fremdenverkehrs einschließlich Urlaub auf dem<br />
Bauernhof (Titel II Kap. IX) .........................................................................B 117<br />
Maßnahme t 1: Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern, Wiedervernässung von<br />
Niedermooren (Titel II Kap. IX) ...................................................................B 125<br />
Maßnahme t 2: Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen (Titel II Kap. IX) ...............B 132<br />
Maßnahme u 1: Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit an den Küsten der Nord- und<br />
Ostsee sowie an den fließenden oberirdischen Gewässern im Tidegebiet<br />
gegen Sturmfluten (Küstenschutz im ländlichen Raum) (Titel II Kap. IX) ... B 139<br />
Maßnahme u 2: Maßnahmen zur Verhütung von Hochwasserschäden (Titel II Kap. IX)......B 144<br />
5.3 Schwerpunkt C - Agrar-, Umwelt- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Forstwirtschaft<br />
(Titel II Kap. V, VI und VIII).................................................................................................B 150<br />
Maßnahme e 1: Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen (Titel II Kap. V) ............B 150<br />
Maßnahme e 2: <strong>Förderung</strong> landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten (Titel<br />
II Kap. V) ......................................................................................................B 157<br />
Maßnahme f 1: <strong>Förderung</strong> einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung<br />
(MSL) (Titel II Kap. VI) ...............................................................................B 162<br />
Maßnahme f 2: Vertrags-Naturschutz (Titel II Kap. VI) ........................................................B 169<br />
Maßnahme f 3: Halligprogramm (Titel II Kap. VI)................................................................B 209<br />
Maßnahme h 1: Aufforstungsprogramm (Titel II Kap. VIII) ..................................................B 225<br />
Maßnahme h 2: Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen durch Behörden (Titel II Kap.<br />
VIII)...............................................................................................................B 233<br />
Maßnahme i 1: Waldhilfsprogramm (Titel II (Kap. VIII) ......................................................B 239<br />
Maßnahme i 2: Maßnahmen zur ökologischen Stabilisierung der Wälder (Titel II Kap.<br />
VIII)...............................................................................................................B 247
Stand: 16.07.03<br />
- B 4 -<br />
VERZEICHNIS DER TABELLEN SEITE<br />
Tabelle 1: Struktur <strong>des</strong> verarbeitenden Gewerbes in Schleswig-Holstein 1,<br />
2) ................................................................................................... B 28<br />
Tabelle 2: Durch Kontrollstellen im Sinne der EG-Öko-VO kontrollierte <strong>EU</strong>-<br />
Öko-Betriebe in Schleswig-Holstein ............................................. B 39<br />
Tabelle 3: Ausschließlich nach den Richtlinien der AGÖL-Verbände<br />
wirtschaftende und durch die Verbände kontrollierte<br />
landwirtschaftliche Öko-Betriebe in Schleswig-Holstein............... B 39<br />
Tabelle 4: Höhe der Ausgleichszahlungen der einzelnen Vertragsmuster.. B 193
4. Finanzpläne<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 5 -<br />
4.1 INDIKATIVER FINANZIERUNGSPLAN ZUR ENTWICKLUNG DES<br />
Finanzplan:<br />
LÄNDLICHEN RAUMES IN SCHLESWIG-HOLSTEIN<br />
Artikel 43, Absatz 1, vierter Gedankenstrich der Verordnung (EG)<br />
Nr. 1257/1999
Stand: 16.07.03<br />
- B 6 -<br />
4.2 INDIKATIVER FINANZIERUNGSPLAN ZUR VERWENDUNG DER DURCH DIE DIFFERENZIERUNG<br />
FREIGEWORDENEN MITTEL (MODULATION)<br />
Finanzplan zur Verwendung der durch die Differenzierung freigewordenen Mittel<br />
Mio. € Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
2004 2005 2006 Insgesamt<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
f Agrarumweltmaßnahmen 0,00 0,00 6,00 3,00 6,00 3,00 12,00 6,00<br />
Modulation gesamt 0,00 0,00 6,00 3,00 6,00 3,00 12,00 6,00<br />
Zusammenfassung aller Agrarumweltmaßnahmen im EPLR SH<br />
Mio. €<br />
2004 2005 2006 Insgesamt<br />
2000 - 2006<br />
Öffentliche <strong>EU</strong>-Be- Öffentliche <strong>EU</strong>-Be- Öffentliche <strong>EU</strong>-Be- Öffentliche <strong>EU</strong>-Be-<br />
Ausgaben teiligung Ausgaben teiligung Ausgaben teiligung Ausgaben teiligung<br />
f Agrarumweltmaßnahmen/Modulation 0,00 0,00 6,00 3,00 6,00 3,00 12,00 6,00<br />
f Agrarumweltmaßnahmen 8,06 4,03 8,26 4,13 8,34 4,17 41,81 20,91<br />
f Agrarumweltmaßnahmen EPLR gesamt 8,06 4,03 14,26 7,13 14,34 7,17 53,81 26,91
- B 7 -<br />
5. Beschreibung der zur Durchführung <strong>des</strong> Planes erwoge-<br />
nen Maßnahmen<br />
Artikel 43 Absatz 1 fünfter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
Die Maßnahmen, die im indikativen Gesamtfinanzierungsplan unter Ziffer 4<br />
und hier in der Beschreibung der zur Durchführung <strong>des</strong> Planes erwogenen<br />
Maßnahmen darzustellen sind, werden wie folgt festgelegt:<br />
Schwerpunkt A - Produktionsstruktur (Titel II Kapitel I - III und VII)<br />
Maßnahme a) Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben(Titel II<br />
Kapitel I und II)<br />
Maßnahme c) Berufsbildung (Titel II Kapitel III)<br />
Maßnahme g) Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung<br />
(Titel II Kapitel VII)<br />
Schwerpunkt B - Ländliche Entwicklung (Titel II Kapitel IX)<br />
Maßnahme k) Flurbereinigung<br />
Maßnahme n) Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung<br />
für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung (Titel II<br />
Kapitel IX)<br />
Maßnahme o) Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und<br />
Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes (Titel II Kapitel<br />
IX)<br />
Maßnahme p) Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen<br />
und landwirtschaftsnahen Bereich, um zusätzliche<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative<br />
Einkommensquellen zu schaffen (Titel II Kapitel IX)<br />
Maßnahme r) Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung<br />
der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur<br />
(Titel II Kapitel IX)<br />
Maßnahme s) <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> Fremdenverkehrs u. Handwerk (Titel II<br />
Kapitel IX)<br />
Maßnahme t) Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Landund<br />
Forstwirtschaft, der Landschaftspflege und der<br />
Verbesserung <strong>des</strong> Tierschutzes (Titel II Kapitel IX)<br />
Maßnahme u) Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten<br />
landwirtschaftlichen Produktionspotenzi-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 8 -<br />
als sowie der Einführung geeigneter vorbeugender<br />
Instrumente (Titel II Kapitel IX)<br />
Schwerpunkt C - Agrar-, Umwelt- und Ausgleichsmaßnahmen sowie<br />
Forstwirtschaft (Titel II Kapitel V, VI und VIII) ggf. auch Kapitel IV!<br />
Maßnahme e) Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen<br />
Einschränkungen (Titel II Kapitel V)<br />
Maßnahme f) Agrarumweltmaßnahmen (Titel II Kapitel VI)<br />
Maßnahme h) Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen (Titel II Kapitel<br />
VIII)<br />
Maßnahme i sonst. forstwirtschaftl. Maßnahmen (Titel II Kapitel<br />
VIII)
Stand: 16.07.03<br />
- B 9 -<br />
5.1 SCHWERPUNKT A - PRODUKTIONSSTRUKTUR<br />
(TITEL II KAP. I - III UND VII)<br />
Maßnahme a 1:<br />
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 1<br />
(Titel II Kap. I und II)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 4 <strong>bis</strong> 7 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" nach dem Fördergrundsatz „Agrarinvestitionsförderungsprogramm“<br />
(AFP) durchgeführt. Gegenstand der <strong>Förderung</strong> sind in landwirtschaftlichen<br />
Unternehmen bauliche Investitionen einschließlich der technischen<br />
Ausrüstung, Investitionen im Bereich der Energieeinsparung und im Ausnahmefall<br />
der Kauf landwirtschaftlicher Nutzflächen, soweit hier ein öffentliches Interesse vorliegt.<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 43,32 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 105,84 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
41,46 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
1 Vorhaben <strong>des</strong> Schwerpunktes „Maßnahmen zur Anpassung an die Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Raumes“ können in den Geltungsbereich <strong>des</strong> Kapitel I der VO (EG) Nr. 1257/1999 fallen. In diesem<br />
Fall müssen die dort festgelegten Bedingungen eingehalten werden.
Beihilfeintensität<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 10 -<br />
Die zulässige Beteiligung <strong>des</strong> Strukturfonds wird nicht überschritten, da Schleswig-<br />
Holstein abweichend von den <strong>Förderung</strong>sgrundsätzen <strong>des</strong> AFP eine Eigenbeteiligung<br />
von min<strong>des</strong>tens 20 v.H. <strong>des</strong> förderungsfähigen Investitionsvolumens verlangt<br />
und eine Zinsverbilligung von 3,5 % (statt 5 v.H.) für bewilligte Kapitalmarktdarlehen<br />
gewährt. Die Beihilfeintensität beträgt maximal 30 v.H. <strong>des</strong> förderungsfähigen Investitionsvolumens.<br />
Von der Ausnahmemöglichkeit gemäß Artikel 51 (2) wird in Schleswig-Holstein<br />
kein Gebrauch gemacht.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Schleswig-Holstein beantragt keine Ausnahme nach Artikel 37 Absatz 3 der Verordnung<br />
(EG) 1257/99.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong>: Agrarinvestitionsförderungsprogramm<br />
(AFP) <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“<br />
Kriterien für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit<br />
Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist eine zentrale Voraussetzung für die Mitfinanzierung<br />
durch die öffentliche Hand. Dies liegt auch und gerade im Interesse eines<br />
nach unternehmerischen Grundsätzen geführten Betriebes. Da in der Mehrzahl der<br />
geförderten Objekte gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt werden (Einkommenserhöhung,<br />
Erhöhung der Arbeitsproduktivität, Verbesserung der Haltungsbedingungen für<br />
die Tiere, Humanisierung der Arbeitsplätze), erfolgt die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit<br />
unternehmensbezogen. In den Fällen, in denen die Zielsetzung sich überwiegend<br />
auf die Gewinnerhöhung konzentriert, wird zusätzlich eine betriebszweigbezogene<br />
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt.<br />
Kriterium für die Wirtschaftlichkeit sind die betriebswirtschaftlichen Erfolgsgrößen<br />
Gewinn und daraus abgeleitet eine ausreichende bereinigte Eigenkapitalbildung.<br />
Ausreichend ist die bereinigte Eigenkapitalbildung dann, wenn die Residualgröße<br />
Gewinn abzüglich der privaten Entnahme und Tilgung nachhaltig positiv ist. Die Höhe<br />
der bereinigten Eigenkapitalbildung lässt sich nicht absolut festlegen, sondern ist<br />
von den speziellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen <strong>des</strong> Betriebes abhängig.<br />
Grundlage für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit ist das Investitionskonzept. In dieses<br />
Konzept fließen die relevanten Daten der Buchführung aus den letzten drei Wirtschaftsjahren<br />
ein. Diese bilden die Basis für die Darstellung der wirtschaftlichen Lage<br />
<strong>des</strong> Unternehmens in der Ausgangsituation und den Nachweis einer erfolgreichen<br />
Bewirtschaftung in der Vergangenheit. Darüber hinaus sind diese Daten die Basis für<br />
den Nachweis der Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit der geplanten Investition.
Stand: 16.07.03<br />
- B 11 -<br />
Die Kriterien der Wirtschaftlichkeit entsprechen denen <strong>des</strong> Rahmenplanes für die<br />
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“.<br />
Min<strong>des</strong>tanforderungen in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz<br />
Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sind in Bezug auf Umweltschutz, Hygiene<br />
und Tierschutz in den entsprechenden nationalen bau-, umweltverträglichkeitsprüfungs-,<br />
hygiene- und tierschutzrechtlichen Regelungen umgesetzt worden.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> baurechtlichen Verfahrens prüft die zuständige Fachbehörde die<br />
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und führt die notwendigen Beteiligungsverfahren<br />
durch.<br />
Dagegen prüft die Bewilligungsbehörde in eigener Zuständigkeit die ausreichende<br />
Lagerkapazität für tierische Exkremente. Nach den Lan<strong>des</strong>richtlinien müssen Unternehmen,<br />
die für viehhaltungsbezogene Investitionen Fördermittel beantragen, nach<br />
Durchführung der Investition über eine Lagerkapazität für tierische Exkremente von<br />
min<strong>des</strong>tens 6 Monaten (bei Schweineställen 9 Monate) verfügen. Der Nachweis ist<br />
detailliert zu führen und ist Bestandteil der Förderantrages.<br />
In Kapitel 2.1.8.3.5 sind die Standards im Einzelnen aufgeführt.<br />
Erforderliche berufliche Qualifikation<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> Rahmenplans für die Gemeinschaftsaufgabe<br />
"Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes". Siehe<br />
dazu auch die Erläuterungen in Ziff. 2.2, Buchstabe E, letzter Absatz.<br />
hinreichende Beurteilung der normalen Absatzmöglichkeiten für die betreffenden<br />
Erzeugnisse gemäß Artikel 6 und 26 der Ratsverordnung<br />
Die Vorgaben <strong>des</strong> Artikels 6 der VO (EG) Nr. 1257/99 werden im AFP berücksichtigt.<br />
Nach Artikel 6 ist die Gewährung von investiven Beihilfen zu vermeiden, wenn durch<br />
damit verbundene Produktionssteigerungen Marktstörungen zu befürchten sind und<br />
<strong>des</strong>halb die Kohärenz der Struktur- mit dem Marktmaßnahmen gefährdet wäre. Das<br />
AFP schließt grundsätzlich keinen Sektor von der <strong>Förderung</strong> aus. Um die Vorgaben<br />
<strong>des</strong> Artikels 6 einzuhalten, wird die <strong>Förderung</strong> in einzelnen Sektoren jedoch an besondere<br />
Bedingungen geknüpft oder es gelten Förderbegrenzungen und –ausschlüsse<br />
wie sie in den notifizierten Fördergrundsätzen niedergelegt sind.<br />
Die <strong>Förderung</strong> der Schweinehaltung erfolgt nach den Kriterien, die die Kommission<br />
in ihrem Bericht über die Lage <strong>des</strong> Schweinefleischsektors in der <strong>EU</strong> (KOM 98 434,<br />
endg. Ratsdokument 11069/98) entwickelt hat. Hiernach wurde eine <strong>Förderung</strong> von<br />
Produktionsausweitungen konzediert, wenn<br />
die <strong>Förderung</strong> auf bestimmte Gebiete begrenzt wird, die Bedarf an verbesserten<br />
Produktionsstrukturen haben,<br />
keine Erhöhung der regionalen Produktionskapazität bewirkt wird und
Stand: 16.07.03<br />
- B 12 -<br />
die Umwelt- und Tiergesundheitssituation der betreffenden Region eine regionale<br />
Bestandsausweitung zulässt.<br />
D.h. neben der Marktlage sind auch Aspekte der Produktionsstrukturen sowie umwelt-<br />
und tiergesundheitliche bzw. tierschützerische Aspekte in die Betrachtung mit<br />
einzubeziehen. Unter der Beachtung <strong>des</strong> Subsidiaritätsprinzipes muss es demnach<br />
dem Land Schleswig-Holstein möglich sein, unter Beachtung der o.g. Kriterien, die<br />
vorhandenen Strukturprobleme (unwirtschaftlich kleine Tierbestände) mit investiven<br />
Hilfen zu begegnen.<br />
Gegenüber 1994 hat die Produktion, errechnet auf der Basis eines 3-jährigen Durchschnittes<br />
zur Ausschaltung der Zyklen, abgenommen. Betrug der Mastschweinebestand<br />
im Durchschnitt 1992/93/94 bei der Dezemberzählung 1,22 Mio. Tiere, so lag<br />
er 1996/97/98 im Durchschnitt bei 1,19 Mio. Tiere. Die Entwicklung bei den<br />
Zuchtsauen verlief analog. Im gleichen Zeitraum ging der Tierbestand von 131.000<br />
auf 121.000 Muttersauen zurück. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung bleibt es<br />
bei dem Ferkeldefizit im Lande in Höhe von rd. 0,5 Mio. Ferkel p.a.. Diese müssen<br />
außerhalb <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> zugekauft werden mit all den damit verbundenen hygienischen<br />
Risiken und Problemen im Bereich Tierschutz sowie Umweltbelastung.<br />
Die Aufstockungsförderung darf nicht zu einer regionalen Erhöhung der Produktionskapazitäten<br />
führen, d.h. die Aufstockung kompensiert maximal die im Rahmen <strong>des</strong><br />
Strukturwandels aus dem Markt ausgeschiedenen Kapazitäten. Für den Bereich<br />
Sauenhaltung beträgt dieser zurzeit 5 % <strong>des</strong> Bestan<strong>des</strong>.<br />
Die Kontrolle bei Investitionen mit Verbot der Kapazitätsaufstockung oder beschränkter<br />
Kapazitätsaufstockung erfolgt sowohl im Rahmen der Antragstellung<br />
(Verwaltungskontrolle) als auch nach Fertigstellung durch eine Vor-Ort-Kontrolle. Bei<br />
der Antragstellung sind die vorhandenen Produktionskapazitäten sowohl im Ausgangszustand,<br />
wie auch nach Durchführung der Investitionen darzulegen. Die Angaben<br />
werden durch die Daten der Buchführung plausibilisiert. Da es sich bei den in<br />
diesem Bereich geförderten Objekten ausschließlich um Wirtschaftsgebäude handelt,<br />
ergeben sich aus den Bauunterlagen der Umfang der neu zu errichteten Kapazitäten.<br />
Die Kapazitätsbeschränkung wird als Auflage im Bewilligungsbescheid aufgenommen.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Im vorangegangenen Planungszeitraum (1994-1999) wurden Beihilfen für Investitionen<br />
in landwirtschaftlichen Betrieben auf Grund von Bewilligungen nach den jeweils<br />
geltenden Richtlinien <strong>des</strong> Einzelbetrieblichen Investitionsförderungsprogrammes -<br />
EFP - (1994) und dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm -AFP - (1995-1999) auf<br />
der Basis von Artikel 5 <strong>bis</strong> 12 der Verordnung (EWG) Nr. 2328/ 91 <strong>des</strong> Rates (Effizienzverordnung)<br />
bzw. von Artikel 4 <strong>bis</strong> 12 der Verordnung (EG) Nr. 950/97 <strong>des</strong> Rates<br />
(Neufassung der Effizienzverordnung) gewährt. Die öffentlichen Aufwendungen<br />
hierfür beliefen sich auf die auf S. 72 <strong>des</strong> Planes genannten 100,5 Mio. <strong>EU</strong>RO. Auf<br />
den erstattungsfähigen Anteil dieser Aufwendungen ( der Anteil wird auf 90 % der<br />
Aufwendungen geschätzt) beträgt der Erstattungsanteil <strong>des</strong> EAGFL 25 %.
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 13 -<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die <strong>Förderung</strong> im Rahmen <strong>des</strong> AFP trägt ganz wesentlich zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der landwirtschaftlichen Unternehmen bei, indem bei Gebäudeund<br />
Ausrüstungsinvestitionen durch Kapitalsubvention die Finanzierungskosten der<br />
Unternehmen deutlich gesenkt werden. Wettbewerbsfähige Betriebe sichern Einkommen,<br />
sind aber auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die Landwirtschaftsbetriebe<br />
auf die Anforderungen einstellen können, welche die zukünftige Entwicklung<br />
ländlicher Räume an die Landwirtschaft stellt, z.B. als Teil der ländlichen<br />
Wirtschaft, zur Erhaltung der Kulturlandschaft durch umweltgerechte Bewirtschaftung.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
100,5 Mio. E getätigt.<br />
Das AFP ist ein wichtiger integraler Bestandteil <strong>des</strong> Förderinstrumentariums der<br />
Lan<strong>des</strong>regierung zur wirtschaftlichen Stärkung <strong>des</strong> ländlichen Raums. Mit dem AFP<br />
verfolgt die Lan<strong>des</strong>regierung primär das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen<br />
Unternehmen zu verbessern. Vor dem Hintergrund der Hinwendung <strong>des</strong><br />
Agrarsektors zum Markt nach dem Paradigmenwechsel der Europäischen Agrarpolitik<br />
im Jahre 1992 erhält dieses Ziel eine zusätzliche Bedeutung. Gefördert werden<br />
nicht nur Investitionen im klassischen Erzeugungsbereich, sondern auch solche für<br />
die Energieumstellung, für die Vermarktung <strong>bis</strong> hin zu Diversifikationsvorhaben wie<br />
z.B. für die Erzeugung von Heil- und Gewürzpflanzenanbau. Das Programm sichert<br />
damit nicht nur produktive Arbeitsplätze in den landwirtschaftlichen Unternehmen,<br />
sondern auch in den der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen.<br />
In dem Zeitraum lag der Schwerpunkt der <strong>Förderung</strong> bei dem Neu- und Umbau von<br />
Wirtschaftsgebäuden (Veredelungsbereich, Lager- und Kühlhallen). Daneben spielen<br />
aber auch Investitionen im Bereich Einkommenskombination eine Rolle.<br />
Wichtige Ergebnisse<br />
Der Förderschwerpunkt lag bei dem umfassenden Neu- bzw. Umbau von Wirtschaftsgebäuden.<br />
Die Hauptmotivation der Unternehmen für die Investitionsvorhaben<br />
war das langfristige Ziel, den Gewinn (längerfristig) zu erhöhen. Dies konnte in<br />
aller Regel durch die Ausweitung <strong>des</strong> Umsatzes, Verbesserung der Produktqualität,<br />
Erhöhung der Arbeitsproduktivität und Absenken der Produktionskosten erreicht<br />
werden. Aus Unternehmenssicht waren für ihre Weiterentwicklung die finanziellen<br />
Auswirkungen der Aufstockung der Milchquoten und im Schweinebereich bei der<br />
<strong>Förderung</strong> das Verbot der Kapazitätsausweitung hinderlich.
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 14 -<br />
Die Maßnahme wurde im Auftrage <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> in Abstimmung und mit Unterstützung<br />
der Länder durch ein Forschungsinstitut evaluiert. Der Gutachter kommt im<br />
Kern zu dem Ergebnis, dass die <strong>Förderung</strong> aus gesamtwirtschaftlichen Gründen<br />
kurz- und mittelfristig begründbar ist. Die <strong>Förderung</strong> hat dazu beigetragen, die erheblichen<br />
Anpassungserfordernisse der landwirtschaftlichen Unternehmen in Form von<br />
Investitionsvorhaben zu erleichtern. In dem Gutachten unterbreitet der Verfasser<br />
Verbesserungsvorschläge, deren wichtigste Punkte - soweit sie in der Kompetenz<br />
<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> und der Länder liegen - Eingang in die Fördergrundsätze für das Jahr<br />
2000 finden werden. Der Gutachter weist abschließend darauf hin, dass die Beschaffung<br />
belastbarer einzelbetrieblicher Daten objektiv ein erhebliches Problem<br />
darstellt.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Vor dem Hintergrund der komplexen Wirkungszusammenhänge, die innerhalb eines<br />
Unternehmens bestehen und die es schwierig machen, durch eindeutige Kriterien<br />
und Indikatoren die ursächlichen Folgen einer <strong>Förderung</strong> eindeutig zu isolieren und<br />
zu quantifizieren, besteht das Einvernehmen, die Entwicklung der geförderten Betriebe<br />
anhand einer Stichprobe zu verfolgen. Dabei muss diese Untersuchung mittelfristig<br />
angelegt sein, da auch die wirtschaftlichen Effekte einer <strong>Förderung</strong> in aller<br />
Regel erst mittelfristig eintreten. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei das<br />
Hauptziel Wettbewerbsfähigkeit. Entsprechend sind für die Evaluierung im Wesentlichen<br />
ökonomische Kriterien heranzuziehen. Hierbei sind die Entwicklung der Kenngrößen<br />
Gewinn, Eigenkapitalbildung und Einkommen die relevanten Kernparameter.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: "Grüne Investitionen" in % der vorgenommenen<br />
Investitionen<br />
Gesamtausgaben für zuschussfähige Investitionen<br />
Gesamtausgaben der vorgenommenen Investitionen<br />
Beihilfeintensität<br />
gesamte öffentliche Aufwendungen (mit<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
durchschnittliche Beihilfe je Begünstigten<br />
(davon: Zuschuss und Zinsverbilligung für<br />
Darlehen)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Begünstigten<br />
Gewinnentwicklung<br />
Eigenkapital<br />
Einkommen
3.3 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 15 -<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Die Indikatoren werden von den Bewilligungsbehörden erfasst und an das zuständige<br />
Fachreferat weitergeleitet. Dieses bereitet die Daten auf und leitet seinen Berichtsteil<br />
an den Koordinator weiter. Diese Daten dienen auch der bun<strong>des</strong>weit vorzunehmenden<br />
Evaluierung.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Der Hinweis auf die <strong>EU</strong>-Beteiligung findet sich in der Richtlinie und den jeweiligen<br />
Bewilligungsbescheiden.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Politik zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes ist auf die Wiederherstellung und<br />
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Räume ausgerichtet. Die mit dieser<br />
Maßnahme angestrebten Ziele entsprechen dieser Politik im besonderen Maße.<br />
Hierbei ist auch auf die Ausführungen zu Punkt 3.1 verwiesen.<br />
Die Verbesserung der Unternehmensstrukturen flankiert die anderen Instrumente der<br />
Gemeinsamen Agrarpolitik wie insbesondere die Preisausgleichszahlungen für bestimmte<br />
Kulturen sowie die für bestimmte Tieren und wie die Agrarumweltmaßnahmen.
Maßnahme c 1:<br />
Berufsbildung für Landwirte<br />
(Titel II Kap. III)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 16 -<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Berufsbildung<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1257/99<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 0,477 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 1,192 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von rd.<br />
1,67 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Beihilfeintensitäten und/oder -beträge und angewandte Differenzierungen können<br />
den beigefügten Haushaltserläuterungen entnommen werden bzw. sind unter<br />
Punkt 3 „Spezifische Informationen“ aufgeführt.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 17 -<br />
Für die angemeldete Fördermaßnahme existiert keine Förderrichtlinie. Es handelt<br />
sich bei dem Zuwendungsempfänger (Landwirtschaftskammer) um eine Institution,<br />
die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Die <strong>Förderung</strong> basiert auf den Erläuterungen<br />
im Haushaltsplan <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein zum Titel. Für die Bewilligung<br />
gelten die Vorschriften der Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Die Förderhöhe ergibt sich aus der Anzahl der durchgeführten Lehrgänge/Anzahl der<br />
Teilnehmer und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Laufende Verträge aus dem vorangegangenen Planungszeitraum ,die in die <strong>Förderung</strong><br />
einbezogen werden sollen, existieren nicht.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die Fördermaßnahme läuft bereits seit 1993 (als reine Lan<strong>des</strong>maßnahme).Nach wie<br />
vor trägt die berufliche Qualifizierung ganz entscheidend zur Sicherung <strong>des</strong> Arbeitsplatzes<br />
bei bzw. versetzt den Arbeitnehmer in die Lage, bei Arbeitslosigkeit leichter<br />
einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das Bildungsangebot ist breit gefächert und<br />
bietet Arbeitnehmern aller Fachrichtungen die Möglichkeit der Aus- und Fortbildung.<br />
Die Landwirtschaft und der ländliche Raum befinden sich in einer schwierigen Phase.<br />
Die steigende Arbeitsbelastung der landwirtschaftlichen Betriebsleiter sowie der<br />
Ehefrauen und der Mitarbeiter erlauben es vielfach nicht, sich das erforderliche Wissen<br />
anzueignen, das der technische und wissenschaftliche Fortschritt erfordert. Die<br />
Betriebsergebnisse bleiben vielfach auf Grund mangelnder Bildung hinter den tatsächlich<br />
möglichen zurück.<br />
Das Angebot an handwerklich-technischen, sowie umwelttechnischen Qualifizierungsmaßnahmen<br />
kann noch ausgebaut werden, umso die Anzahl der Teilnehmer<br />
zu erhöhen und einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 18 -<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
0.678 Mio. E getätigt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Es liegen keine Bewertungsergebnisse vor.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Zu quantifizieren ist der Zusammenhang zwischen Bildung und Betriebserfolg nicht.<br />
Die ständig steigenden Anforderungen an einen zukunftsfähigen landwirtschaftlichen<br />
Betrieb und seine landwirtschaftlichen Arbeitnehmer sind jedoch ohne weitere Bildungs-<br />
und Qualifizierungsmaßnahmen nicht umsetzbar.<br />
Daher soll das Angebot an Bildungsmaßnahmen ausgebaut und dadurch die Anzahl<br />
der Teilnehmer erhöht werden.<br />
Zielgrößen/Materielle Indikatoren:<br />
- Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen<br />
- Anzahl der Teilnehmer<br />
- Durchschnittliche Anzahl der Bildungstage pro Teilnehmer.<br />
Es sollen jährlich ca. 70-90 Lehrgänge mit einer durchschnittlichen Dauer von 1-10<br />
Tagen und 10-30 Teilnehmern durchgeführt werden.<br />
Die Maßnahmen wirken übergreifend auf alle Ziele ( entsprechend Art.9 der VO<br />
1257/99 ) und können daher nicht getrennt nach Zielen ausgewiesen werden<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Der Strukturwandel wird sich weiter beschleunigen. Durch die Abwanderung von Arbeitskräften<br />
wird sich die Produktivität der in der Landwirtschaft verbleibenden Arbeitskräfte<br />
erhöhen müssen. Daneben werden Einkommenskombinationen innerhalb<br />
<strong>des</strong> Agrarsektors zunehmen (Agrarproduktion in Kombination mit Dienstleistungen).<br />
Weiterhin erwartet die Gesellschaft mehr und mehr eine multifunktionale Landwirtschaft.<br />
Diese Aspekte erfordern einen hohen Bildungs- und Ausbildungsstand (Folgerungen<br />
aus der Agenda 2000).<br />
Durch die Berufsbildungsmaßnahmen werden Landwirte und Landwirtinnen sowie<br />
landwirtschaftliche Arbeitnehmer für weitere Tätigkeiten qualifiziert.<br />
Dies stärkt insbesondere den Wirtschaftsstandort ländlicher Raum in Schleswig-<br />
Holstein.<br />
Wirkungsindikatoren:<br />
Entwicklung der Bildungsnachfrage im Verhältnis zum Bildungsangebot ( Anzahl/Inhalt<br />
)<br />
Entwicklung der Teilnehmerzahl<br />
qualitative Bewertung der Maßnahmen durch die Teilnehmer<br />
Datenquelle:
Stand: 16.07.03<br />
- B 19 -<br />
Auswertung von Teilnehmerfragebögen<br />
Auswertung <strong>des</strong> Verwendungsnachweises<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Der Erfolg zwischen Bildung und Betriebserfolg ist nur sehr schwer messbar.<br />
Letztlich geht es um Qualifizierungsmaßnahmen, die zum Erhalt und zur Sicherung<br />
von Arbeitsplätzen sowie zur Besserung der Vermittelbarkeit und zur Vermeidung<br />
von Langzeitarbeitslosigkeit beitragen sollen.<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtaufwendungen an zuschussfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Ausbildungsmaßnahmen<br />
Anzahl der Teilnehmer<br />
durchschnittliche Anzahl an Ausbildungstagen<br />
pro Teilnehmer<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Fördermaßnahme und Begünstigte<br />
A. Land- und umwelttechnische Aus- und Fortbildung von Arbeitnehmern in den Agrarberufen<br />
durch die Deutsche Lehranstalt für Agrar- und Umwelttechnik<br />
(D<strong>EU</strong>LA) und andere Lehr- und Versuchsanstalten der Landwirtschaftskammer<br />
(LWK):<br />
Auf Antrag bewilligt das Land SH aus Mitteln <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>haushaltes einen jährlichen<br />
Zuschuss.<br />
Die Mittel sind zweckgebunden und als Anteilsfinanzierung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> ausschließlich<br />
bestimmt für die Ausbildung von Arbeitnehmern in Agrarberufen zu<br />
Facharbeitern, die Fortbildung von landwirtschaftlichen Arbeitnehmern, Landwirten<br />
und Gärtnern sowie für die überbetriebliche Ausbildung.<br />
Sicherstellung, dass keine normalen Ausbildungsprogramme oder -gänge<br />
für eine Finanzierung vorgeschlagen werden<br />
Die beantragten Maßnahmen umfassen keine Lehrgänge/Praktika, die Teil normaler<br />
Programme oder Ausbildungsgänge an land- und forstwirtschaftlichen Schulen <strong>des</strong><br />
Sekundar- oder Tertiärbereichs sind.<br />
Dies wird durch entsprechende Festlegungen im Bewilligungsbescheid sowie durch<br />
Überprüfung <strong>des</strong> vorgelegten Verwendungsnachweises am Jahresende sichergestellt.
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 20 -<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben angeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren werden von der für die Durchführung der Maßnahme verantwortlichen<br />
Stelle für jede geförderte einzelne Maßnahme erhoben. Das Ergebnis<br />
wird in eine - per EDV geführten - Liste eingearbeitet und an das fondsverwaltende<br />
Referat <strong>des</strong> MLR weitergeleitet. Die Liste wird über den gesamten Programmplanungszeitraum<br />
geführt, so dass die Entwicklungen jederzeit abgerufen und aufgezeigt<br />
werden können.<br />
Die Auswertung und Erfolgskontrolle der Bildungsmaßnahmen erfolgt durch :<br />
- statistische Auswertung und<br />
- Teilnehmerbefragung.<br />
Die Auswertung zur Qualitätssicherung erfolgt durch die Landwirtschaftskammer<br />
Schleswig-Holstein.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Durch die <strong>Förderung</strong> der Berufsbildungsmaßnahmen werden den Arbeitnehmern<br />
und Arbeitnehmerinnen in der Landwirtschaft neue und bessere Qualifizierungsmöglichkeiten<br />
geboten.<br />
Mit der Durchführung der Maßnahmen werden zudem oft auch Belange anderer Politikbereiche<br />
berücksichtigt. Zum Beispiel werden durch umwelttechnische Qualifizierungsmaßnahmen<br />
besonders umweltgerechte Produktionsverfahren vermittelt.
Stand: 16.07.03<br />
- B 21 -<br />
Maßnahme g 1:<br />
Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen<br />
(<strong>Förderung</strong> im Bereich der Marktstrukturverbesserung und auf<br />
Grund <strong>des</strong> Marktstrukturgesetzes)<br />
(Titel II Kap. VII)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.<br />
Es sind folgende Sektoren der landwirtschaftlichen Basiserzeugung betroffen:<br />
Obst und Gemüse<br />
Kartoffeln<br />
Blumen und Zierpflanzen<br />
Nachwachsende Rohstoffe<br />
Fleisch<br />
Milch<br />
Tierkörperbeseitigung<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 25 <strong>bis</strong> 28 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 9,38 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 23,49 Mio. E getätigt werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“<br />
Grundsätze für die <strong>Förderung</strong> im Bereich der Marktstrukturverbesserung<br />
Grundsätze für die <strong>Förderung</strong> auf Grund <strong>des</strong> Marktstrukturgesetzes, soweit sie Investitionsförderungen<br />
zulassen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 22 -<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Ausnahmen nach Art. 37 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1257/1999 werden nur für den Bereich<br />
Obst und Gemüse zur <strong>Förderung</strong> von angemessenen Aufwendungen für den<br />
Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich der technischen Einrichtungen beantragt:<br />
Für kapitalschwache, sich im Aufbau befindliche anerkannte Erzeugerorganisationen<br />
nach der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 sind Ausnahmen möglich. Auf Grund<br />
ihres in der Anlaufphase noch geringen Umsatzes stehen ihnen nur sehr begrenzte<br />
Mittel aus den Betriebsfonds zur Verfügung. Gerade in der Startphase ist<br />
der Kapitalbedarf jedoch besonders hoch.<br />
Weiterhin sind Ausnahmen für anerkannte Erzeugerorganisationen nach der Verordnung<br />
(EG) Nr. 2200/96 möglich, die außergewöhnlich große Investitionen tätigen<br />
möchten, die die in ihren Betriebsfonds zur Verfügung stehenden Mittel überschreiten<br />
und bei deren Realisierung die Gefahr besteht, dass die Erzeugerorganisation<br />
ihre sonstigen, nach der Marktorganisation vorgesehenen Aufgaben nicht<br />
mehr durchführen könnte.<br />
Unternehmen, die Mitglieder von anerkannten Erzeugerorganisationen nach der<br />
Verordnung (EG) Nr. 2200/96 sind, können ausnahmsweise gefördert werden,<br />
wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:<br />
- die Investitionen dürfen die Strategie der Erzeugergemeinschaften im Rahmen<br />
der GMO nicht unterlaufen oder ihr widersprechen,<br />
- die Investitionen dürfen nicht dazu führen, dass die Mitglieder von Erzeugerorganisationen<br />
ihre Mitgliedschaft in der Erzeugerorganisation aufgeben.<br />
Vorhandene oder neu zu schaffende Absatzeinrichtungen und Unternehmen <strong>des</strong><br />
Handels für landwirtschaftliche Erzeugnisse, deren Tätigkeit sich nicht gleichzeitig<br />
auf die Produktion landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse erstreckt, können gefördert<br />
werden, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:<br />
- die Investitionen dürfen die Strategie der Erzeugergemeinschaften im Rahmen<br />
der GMO nicht unterlaufen oder ihr widersprechen,<br />
- die Investitionen dürfen nicht dazu führen, dass Mitglieder von Erzeugerorganisationen<br />
ihre Mitgliedschaft in der Erzeugerorganisationen aufgeben.<br />
Die Abgrenzung der Begriffe „kapitalschwach“ und „außergewöhnlich große Investition“<br />
erfolgt in Abhängigkeit von der Höhe der jeweils verfügbaren Betriebsfondsmittel.<br />
So sollen Investitionsförderungen dann möglich sein, wenn das zu begünstigende<br />
Vorhaben zum Zeitpunkt der Förderentscheidung<br />
mehr als 20 % der verfügbaren Betriebsfondsmittel ausmacht oder<br />
das Investitionsvolumen höher als 250.000 E liegt.<br />
Das Land Schleswig-Holstein sichert die Erfüllung der oben genannten Bedingungen<br />
zu, wobei die Einhaltung jeweils durch die Antragsteller zu belegen ist.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
- B 23 -<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Grundsätze für die <strong>Förderung</strong> im Bereich der Marktstrukturverbesserung<br />
Grundsätze für die <strong>Förderung</strong> auf Grund <strong>des</strong> Marktstrukturgesetzes, soweit sie<br />
Investitionsförderungen zulassen.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Antragsverfahrens muss von den Antragstellern das Vorhandensein<br />
normaler Absatzmöglichkeiten für die jeweiligen Erzeugnisse, die Investitionsarten<br />
und im Vergleich von vorhandener und voraussichtlicher Kapazität dargestellt werden.<br />
Es wird zugesichert, dass kein Unternehmen Investitionsbeihilfen in dem Bereich<br />
Verarbeitung und Vermarktung erhält, das die Voraussetzungen der Definition <strong>des</strong><br />
Unternehmens in Schwierigkeiten nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche<br />
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten<br />
(ABl. EG 1999 Nr. C 288, S. 2) erfüllt. Im Rahmen der Bewilligung der Beihilfen stellt<br />
Schleswig-Holstein auf Grund vorzulegender Bilanzen sicher, dass nur wirtschaftlich<br />
lebensfähige Betriebe gefördert werden. Dies wird in der Regel anhand von entsprechenden<br />
Kriterien beurteilt. Dazu gehören beispielsweise Indikatoren wie die Entwicklung<br />
von Gewinn und Verlust, <strong>des</strong> cash-flow, der Gesamtkapitalverzinsung, der<br />
Eigenkapitalbildung und die Tragbarkeit <strong>des</strong> Kapitaldienstes.<br />
Min<strong>des</strong>tanforderungen in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz<br />
Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sind in Bezug auf Umweltschutz, Hygiene<br />
und Tierschutz in den entsprechenden nationalen bau-, immissions-, umweltverträglichkeits-prüfungs-,<br />
hygiene- und tierschutzrechtlichen Regelungen umgesetzt<br />
worden. Im Rahmen der bei Investitionsvorhaben notwendigen baurechtlichen, immissionsschutzrechtlichen<br />
und/oder gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren<br />
wird die Einhaltung dieser Vorschriften von den dafür zuständigen Behörden überprüft<br />
(siehe auch Tabelle 29). Im Übrigen unterliegen alle Unternehmen der allgemeinen<br />
Gewerbeaufsicht durch die zuständigen Stellen, die die Einhaltung dieser<br />
Vorschriften auch unabhängig von der Durchführung von Investitionsvorhaben überwachen.<br />
Hinreichende Beurteilung der normalen Absatzmöglichkeiten für die betroffenen<br />
Erzeugnisse<br />
Obst und Gemüse:<br />
Durch den <strong>bis</strong>herigen Sektorplan ist eine wichtige Strukturentwicklung im Bereich<br />
Obst und Gemüse initiiert worden. Die nun eingerichteten Verarbeitungs- und Vermarktungsschienen<br />
haben neue Märkte erschlossen, die weiter ausbaufähig sind.<br />
Der Obstbau konzentriert sich in Schleswig-Holstein mit insgesamt rd. 1.500 ha auf<br />
rd. 850 ha Baumobst und 650 ha Erdbeeren. Die Kern- und Steinobstflächen waren<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 24 -<br />
über die Jahre relativ konstant. Der Erdbeeranbau hat leicht zugenommen. Beim<br />
Kernobst werden rd. 60 % der Gesamterntemenge im für den Obstbau durch Boden<br />
und Klima begünstigten Naturraum „Elbmarsch“ erzeugt und zu einem hohen Anteil<br />
direkt vermarktet. Einzelne größere Obstbaubetriebe haben feste Vermarktungsschienen<br />
mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Erdbeeren werden zu einem Großteil<br />
vom Feld direkt vermarktet. Im Bereich der nicht direkt vermarktenden Betriebe sind<br />
zukünftig Maßnahmen zur Bündelung <strong>des</strong> Angebots und Qualitätsverbesserung vorgesehen,<br />
da von einem Nachfrageüberhang nach regionalen Produkten auszugehen<br />
ist.<br />
Kartoffeln:<br />
Nur ca. 35 % <strong>des</strong> Speisekartoffelbedarfs werden im Lande erzeugt. Die Verpackung<br />
und marktgerechte Aufbereitung der Speisekartoffeln erfolgt überwiegend außerhalb<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein. Aus Gründen der Wertschöpfung und <strong>des</strong> Umweltschutzes<br />
(Transport) sollen im Lande die Voraussetzungen geschaffen werden, den<br />
vorhandenen regionalen Markt in ausreichendem Maße zu bedienen.<br />
Blumen und Zierpflanzen:<br />
Im Sektor für Blumen- und Zierpflanzen zählt Schleswig-Holstein zu den größten<br />
Baumschulgebieten in Europa. Die Unternehmen der Baumschulwirtschaft erzielen<br />
auf 5000 ha etwa 240 Mio. E Produktionswert pro Jahr bei einem Gesamtproduktionswert<br />
der Blumen- und Zierpflanzenbranche von 320 Mio. E. Der Produktionsstandort<br />
ist durch Boden und Klima begünstigt. Der Absatz erfolgt zu 70 % überregional.<br />
Etwa 30 % aller Umsätze der Baumschul- und Zierpflanzenbranche in<br />
Deutschland stammen aus Schleswig-Holstein. Auf Grund der unzureichenden Logistik-<br />
und Vertriebsstruktur der Unternehmen kann der europäische Markt nicht hinreichend<br />
bedient werden.<br />
Nachwachsende Rohstoffe:<br />
Auf Grund allgemein gestiegenen Umweltbewusstseins ist eine verstärkte Nachfrage<br />
nach Produkten zu registrieren, die unter Verwendung von natürlichen bzw. Nachwachsenden<br />
Rohstoffen hergestellt werden. Nachwachsende Rohstoffe repräsentieren<br />
insofern einen zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt. In verschiedenen Bereichen<br />
zeichnen sich im Wettbewerb zu herkömmlichen (fossilen) Rohstoffen lukrative<br />
Marktpotenziale ab. Diese für die Landwirtschaft vielfach neuen Märkte werden von<br />
bestehenden Unternehmen, die ihre Produktpalette ökologisch diversifizieren, oder<br />
von neu zu gründenden Unternehmen in der Zukunft verstärkt erschlossen werden.<br />
Damit lässt sich auch der Absatz Nachwachsender Rohstoffe auf der landwirtschaftlichen<br />
Erzeugerseite weiter sichern und steigern.<br />
Es sollen nur Entwicklungen gefördert werden, für die sich mittelfristig ein ausreichen<strong>des</strong><br />
Marktpotenzial abzeichnet und Aussicht auf Wettbewerbsfähigkeit besteht.<br />
Im Rahmen der Bewilligung der Beihilfen wird sichergestellt, dass nur wirtschaftlich<br />
lebensfähige Betriebe gefördert werden. Die <strong>Förderung</strong> von Projekten zur Aufbereitung<br />
von nachwachsenden Rohstoffen zu Vor- und Endprodukten für industrielltechnische<br />
Verwendungen ist auch eine Grundvoraussetzung dafür, Absatzmärkte<br />
für diese Rohstoffe auf der landwirtschaftlichen Erzeugerseite zu erschließen und<br />
weiter auszubauen.<br />
Die Märkte für Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen befinden sich überwiegend<br />
noch in der Stufe der Marktentwicklung bzw. Markterschließung. Eine umfas-
Stand: 16.07.03<br />
- B 25 -<br />
sende Marktstudie zum künftigen Entwicklungspotenzial der verschiedenen Produktlinien<br />
existiert <strong>bis</strong>lang nicht.<br />
Fleisch:<br />
Schleswig-Holstein ist auf Grund der guten natürlichen Voraussetzungen (Boden,<br />
Klima, Besiedlungsdichte) ein traditioneller Agrarstandort, der auf übergebietlichen<br />
Absatz von Produkten tierischer Herkunft angewiesen ist. Um den zunehmenden<br />
Anforderungen der Nachfrageseite z.B. bzgl. Produktqualität und Logistik entsprechen<br />
zu können, sind kontinuierlich Investitionen erforderlich.<br />
Die Viehdichte in Schleswig-Holstein entspricht mit 1,09 Großvieheinheiten (GVE)<br />
je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) sowohl den Anforderungen an die gute<br />
landwirtschaftliche Praxis (2 GVE/ha LF) als auch den Anforderungen an extensiv<br />
betriebene Landwirtschaft (1,4 GVE/ha LF).<br />
Ein zunehmen<strong>des</strong> Absatzpotenzial wird im Conveniencebereich erwartet. Der Convenienceanteil<br />
liegt bei Schweinefleisch derzeit bei ca. 20 %. Rindfleisch kommt<br />
zwar lediglich auf 5 %, dennoch wird in diesem Bereich mittelfristig ein Anstieg zwischen<br />
8 und 12 % vorausgesagt.<br />
Schweinefleisch:<br />
Die Bruttoeigenerzeugung an Schweinefleisch blieb mit 3,5-3,7 Mio. t in den letzten<br />
5 Jahren in Deutschland in etwa konstant, ebenso der Pro-Kopf-Verbrauch bei 56 kg.<br />
Der langjährige Trend in Schleswig-Holstein in der Zahl der gehaltenen Schweine ist<br />
negativ. Von 1983 <strong>bis</strong> 1998 sank die Zahl aller Schweine von 1,733 Mio. auf<br />
1,348 Mio. (- 22 %). Im gleichen Zeitraum halbierte sich die geschlachtete Schweinefleischmenge<br />
von etwa 0,24 Mio. auf 0,12 Mio. t.<br />
Es besteht die Gefahr, dass die schleswig-holsteinische Schweineproduktion weiter<br />
wegbricht mit entsprechenden negativen Folgen für das Arbeitsplatzangebot im ländlichen<br />
Raum, wenn nicht ein Minimum an Infrastruktur im vor- und nachgelagerten<br />
Bereich erhalten werden kann.<br />
Deshalb sollen Modernisierungsinvestitionen gefördert werden, um den steigenden<br />
Marktansprüchen zu genügen, ohne die Schlachtkapazitäten zu erhöhen.<br />
Die Wünsche der Nachfrageseite sind vor allem auf kurze Transportwege zur Verbesserung<br />
der Fleischqualität gerichtet. Das Schlachten in der Region steht auch im<br />
Einklang mit einem wesentlichen Ziel der Tierschutzorganisationen. Außerdem steigen<br />
die Anforderungen an die Schlachtkörperzerlegung, da der Anteil der Außer-<br />
Haus-Verpflegung (40 %) sowie der Anteil der Single-Haushalte zunimmt.<br />
Rindfleisch<br />
Die Bruttoeigenerzeugung an Rindfleisch ist in den letzten 5 Jahren in Deutschland<br />
von 1,67 Mio. t auf 1,45 Mio. t zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum sank der Pro-<br />
Kopf-Verbrauch von 19,7 auf 15,0 kg und hat sich auf diesem Niveau stabilisiert.<br />
Die Zahl der Rinder sank in Schleswig-Holstein von 1983 <strong>bis</strong> 1998 von 1,62 Mio. auf<br />
1,34 Mio. (- 17 %). Die Ursache liegt vor allem in der rückläufigen Zahl an Milchkühen<br />
(- 31 %) auf Grund der Milchgarantiemengen-VO. Dementsprechend ist auch die<br />
Rindfleischschlachtmenge von 0,15 Mio. t auf 0,13 Mio. t (- 15 %) zurückgegangen.<br />
Der bestehende Investitionsbedarf für eine optimierte und tierschutzgerechte Nutzung<br />
der Schlachtkapazitäten ist u.a. begründet durch eine Umstellung von<br />
Schlachtvieh-Lebendexporten in Drittländer auf entsprechende Fleischexporte. Außerdem<br />
sind insbesondere Fleischreifungsräume zu schaffen, um die erhöhten Kundenansprüche<br />
an zartes Frischfleisch erfüllen zu können.
Stand: 16.07.03<br />
- B 26 -<br />
Milch:<br />
Auf Grund <strong>des</strong> hohen Grünlandanteils von etwa 42 % an der landwirtschaftlich genutzten<br />
Fläche ist Schleswig-Holstein ein traditionelles Milcherzeugerland. Die<br />
Milchwirtschaft zählt mit rund 1,4 Mrd. DM oder mehr als einem Drittel der Verkaufserlöse<br />
zu den wichtigsten Einkommensquellen der Landwirtschaft. Mit 2,3 Mio. t beträgt<br />
der Anteil der Milcherzeugung im Jahr 8,1 % der gesamten Milcherzeugung in<br />
Deutschland (28,5 Mio. t). Dagegen beträgt der Anteil an der Bevölkerung mit 2,7<br />
Mio. Einwohnern nur rund 3,3 % der Bevölkerung Deutschlands (87 Mio. Einwohner).<br />
Die Milchwirtschaft <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> ist daher ganz besonders auf den überregionalen<br />
Absatz von Milch und Milcherzeugnissen orientiert.<br />
Herstellung von Milcherzeugnissen:<br />
Auf Grund der marktfernen Lage Schleswig-Holsteins ist die Produktionsstruktur in<br />
der Milchwirtschaft seit Jahren durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an der<br />
Herstellung von Butter und Milchpulver gekennzeichnet. Bei einem Anteil an der<br />
Milchanlieferung in Deutschland von 8,1 % betragen die Herstellungsmengen bei<br />
den wichtigsten Milcherzeugnissen:<br />
Butter 12 %<br />
Milchpulver 13 %<br />
Schnitt-, Weichkäse 4 %<br />
Konsummilch 4 %<br />
Bei Jogurt, Desserts, Milchmischerzeugnissen und Frischkäse spielt die Erzeugung<br />
in Schleswig-Holstein derzeit nahezu keine Rolle.<br />
Gerade dieses Marktsegment ist von besonderem Interesse, wie eine aktuelle Untersuchung<br />
<strong>des</strong> Marktforschungsinstitutes Nielsen belegt, die z.B. bei Frischkäse mit<br />
Fruchtzusatz eine Steigerung von knapp 12% erwartet, bei Desserts um etwa 15%.<br />
Spitzenreiter sind demnach Fruchtjogurts mit einer prognostizierten Wachstumsrate<br />
von 34%.<br />
Dies macht einen Bedarf zur Neuorientierung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur<br />
deutlich. Die Interventionsprodukte Butter und Magermilchpulver wurden in<br />
den letzten Jahren zwar fast ausschließlich am Markt abgesetzt und nicht interveniert,<br />
die Erlöse hierbei sind aber sehr stark von der Interventionsverwertung abhängig.<br />
Um diese Abhängigkeit zu verringern und im Interesse der Milcherzeuger eine<br />
Verbesserung der Wertschöpfung durch Verarbeitung der übergebietlichen Versandmilch<br />
im Lande zu erzielen, ist eine noch deutlichere Abkehr von Interventionsprodukten<br />
hin zu Produkten mit hohem marktfähigem Nachfragepotenzial und zu<br />
innovativen Milcherzeugnissen vorgesehen. Möglichkeiten einer besseren Marktpräsenz<br />
sowie einer höheren Auslastung der Verarbeitungskapazitäten bestehen auch<br />
für die überwiegend mittelständisch strukturierten Käsereien <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>.<br />
Maßnahmen für Absatzsteigerungen und Erlösverbesserungen:<br />
Vorhandene Marktpotenziale lassen sich nur noch mit neuen Absatzstrategien realisieren<br />
oder mit neuen Produkten, die dem Verbraucher über den reinen Ernährungsaspekt<br />
hinaus einen zusätzlichen Nutzen bieten.<br />
Im Käsereibereich werden gute Vermarktungschancen in der Absatzsteigerung bei<br />
der Produktion der traditionellen Käsespezialitäten als auch bei Innovationen im Hinblick<br />
auf die Herstellung neuer Produkte oder neuer Angebotsformen gesehen, z.B.:
Stand: 16.07.03<br />
- B 27 -<br />
Herstellung <strong>des</strong> aus Italien stammenden Mozzarella oder anderer, erst durch den<br />
Tourismus bei uns bekannt und beliebt gewordener Erzeugnisse. Hier gibt es bereits<br />
konkrete Planungen für entsprechende Vorhaben.<br />
Verbesserung der Wertschöpfung durch den Einsatz weiterer Abpackanlagen,<br />
indem mehr verkaufsfertige Käseportionen angeboten werden.<br />
Dies trifft im Wesentlichen auch für alle anderen Milcherzeugnisse zu.<br />
Bei der gesamten Palette von Milcherzeugnissen ist außerdem eine Verbesserung<br />
der Marketing- und Verkaufsförderungsaktivitäten notwendig. Die Unternehmen flankieren<br />
daher die Investitionsvorhaben mit eigenen Absatzförderungsmaßnahmen,<br />
die nicht kofinanziert werden. Speziell für den Käsereibereich sind in dieser Hinsicht<br />
bereits Planungen in Vorbereitung, z. B.:<br />
Fortbildungsveranstaltungen für Käsefachverkäufer<br />
Durchführung von Seminaren und Ernährungsberatungen zum Thema Milcherzeugnisse<br />
und Käse<br />
Informations- und Erlebnistage zum Thema Milch und Käse für Schüler<br />
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsverbänden zur <strong>Förderung</strong><br />
<strong>des</strong> Absatzes regionaler Milch- und Käsespezialitäten<br />
Besichtigung von Käsereibetrieben mit Informationen zur Käseherstellung sowie<br />
Verkostung heimischer Spezialitäten, auch im Zusammenhang mit der neu ins<br />
Leben gerufenen „Schleswig-Holsteinischen Käsestraße“.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Der vorangegangene Planungszeitraum ist mit der Bewilligung der noch ausstehenden<br />
Mittel <strong>bis</strong> Ende 1999 abgeschlossen worden. Die Mittel werden <strong>bis</strong> Ende 2001<br />
ausgezahlt sein.<br />
Altverpflichtungen aus der Förderperiode 1994 <strong>bis</strong> 1999:<br />
Sektorplan „Obst und Gemüse“: 1.561.361,68 Euro<br />
Zahlungen 16.10. <strong>bis</strong> 31.12.1999:<br />
Sektorplan „Obst und Gemüse“: 171.975,96 Euro
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 28 -<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Tabelle 1: Struktur <strong>des</strong> verarbeitenden Gewerbes in Schleswig-Holstein<br />
Betriebe Beschäftigte Umsatz in Mio. DM<br />
(Mio. E)<br />
1993 1997 in 1993 1997 in 1993 1997 in<br />
%<br />
%<br />
%<br />
Ernährungwirtschaft insgesamt 293 256 - 13 24.007 19.346 - 19 10.893 9.426 - 13<br />
(5.570) (4.819)<br />
Schlachten und Fleischverar- 62 59 - 5 5.911 4.451 - 25 2.579 2.304 - 11<br />
beitung<br />
Fischverarbeitung<br />
(1.319) (1.178)<br />
3)<br />
26 21 - 19 1.816 1.780 - 2 573 669 + 17<br />
(293) (342)<br />
Obst- und Gemüseverarbeitung<br />
3)<br />
13 9 - 31 1.561 1.179 - 24 749<br />
(383)<br />
642<br />
(328)<br />
- 14<br />
Milchverarbeitung<br />
Mahl- und Schälmühlen, Her-<br />
20 15 - 25 1.603 1.193 - 26 1.752<br />
(896)<br />
stellung von Stärke und Stär- 7 7 + 0 1.003 873 - 13 317<br />
keerzeugnissen<br />
Herstellung von Futtermitteln<br />
(162)<br />
3) 20 12 - 40 1.002 579 - 42 821<br />
(420)<br />
Herstellung von Back- und 98 96 - 2 6.482 5.814 - 10 1.221<br />
Süßwaren<br />
(624)<br />
Getränkeherstellung 23 19 - 17 2.338 1.799 - 23 1.552<br />
(794)<br />
Herstellung von Spirituosen 3) 8 6 - 25 724 596 - 18 901<br />
(461)<br />
Mineralbrunnen, Herstellung<br />
von Erfrischungsgetränken 3)<br />
12 10 - 17 1.099 904 - 18 456<br />
(233)<br />
1, 2)<br />
1.271<br />
(650)<br />
277<br />
(142)<br />
672<br />
(344)<br />
1.373<br />
(702)<br />
1.425<br />
(729)<br />
931<br />
(476)<br />
375<br />
(192)<br />
Verarbeiten<strong>des</strong> Gewerbe 1.689 1.379 - 18 171.088 141.922 - 17 47.315 49.440<br />
insgesamt<br />
(24.192) (25.278)<br />
Anteil der Ernährungswirtschaft<br />
in %<br />
Früheres Bun<strong>des</strong>gebiet<br />
17,3 18,6 14,0 13,6 23,0 19,1<br />
Verarbeiten<strong>des</strong> Gewerbe 45.781 38.001 - 17 6.805.500 5.623.942<br />
insgesamt<br />
4)<br />
- 17 1.822.000 1.348.405<br />
Ernährungswirtschaft 4.448 4.055 - 9 490.000 440.645<br />
4)<br />
- 10<br />
(931.574)<br />
225.000<br />
(689.429)<br />
200.880<br />
(115.041) (102.708)<br />
Anteil der Ernährungswirtschaft<br />
in %<br />
Neue Bun<strong>des</strong>länder<br />
9,7 10,7 7,2 7,8 + 9 12,3 14,9<br />
Verarbeiten<strong>des</strong> Gewerbe 6.353 6.513 + 3 736.000 539.004 - 27 98.000 137.412<br />
insgesamt<br />
Ernährungsgewerbe 852 789 - 7 72.000 74.444<br />
4)<br />
+ 3<br />
(50.107)<br />
20.000<br />
(70.258)<br />
28.572<br />
(10.226) (14.609)<br />
Anteil der Ernährungswirtschaft<br />
in %<br />
13,4 12,1 9,8 13,8 20,4 20,8<br />
1) Durch eine Neuordnung der Wirtschaftszweigklassifikation ab Anfang 1995 ist die Vergleichbarkeit mit den davor liegenden<br />
Jahren eingeschränkt. Die „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)“ ersetzt die <strong>bis</strong> dahin geltende<br />
„Systematik der Wirtschaftszweige. Fassung für die Statistik im Produzierenden Gewerbe (SYPRO)“ und ist ab 1995 in allen<br />
<strong>EU</strong>-Mitgliedstaaten sowohl für die Erhebung als auch für die Darstellung der statistischen Daten anzuwenden.<br />
2) Industrie- und Handwerksbetriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten<br />
3) Erfassungsgrenze auf 10 und mehr Beschäftigte festgesetzt<br />
4) Durchschnitt errechnet aus Monatsangaben<br />
Quelle: Statistisches Lan<strong>des</strong>amt Schleswig-Holstein<br />
4)<br />
- 27<br />
- 13<br />
- 18<br />
+ 12<br />
- 8<br />
+ 3<br />
- 18<br />
+ 4<br />
- 26<br />
- 11<br />
+ 40<br />
+ 43
Stand: 16.07.03<br />
- B 29 -<br />
Für Schleswig-Holsteins Ernährungswirtschaft weist die Statistik bei den Merkmalen<br />
Umsatz sowie Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten im Vergleich mit den westlichen<br />
Bun<strong>des</strong>ländern signifikant höhere Anteile an der Gesamtwirtschaft aus. Bezieht<br />
man den äußerst beschäftigungsintensiven Sektor Blumen und Zierpflanzen<br />
(1993: 5.694 Beschäftigte) mit ein, wird diese Aussage zusätzlich gestützt. So sank<br />
zwar im Betrachtungszeitraum 1993-1997 die Anzahl der gärtnerischen Betriebe um<br />
13 % auf 976, der Produktionswert stieg jedoch um 19 % auf 320 Mio. E.<br />
Da die Unternehmen der Branche in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt agieren<br />
und gerade die in Schleswig-Holstein vorherrschenden mittelständischen Firmen<br />
kaum Preisüberwälzungsspielräume haben, müssen die Produktions-, Lager- und<br />
Transportkapazitäten besser genutzt und durch Kooperationen oder Zusammenschlüsse<br />
alle Synergiepotenziale ausgeschöpft werden. Nur so lässt sich der tiefgreifende<br />
Strukturwandel bewältigen, der bereits in 1997 dazu führte, dass Deutschland<br />
das Land in Europa mit den meisten Unternehmenskäufen bzw. -verkäufen in der<br />
Lebensmittelbranche war.<br />
Angesichts stagnierender Umsätze je Betrieb und ungenügender Produktivitätsentwicklung<br />
(Umsatz je Beschäftigter: + 7,4 % von 1993 <strong>bis</strong> 1997) in Schleswig-Holstein<br />
aber auch im gesamten früheren Bun<strong>des</strong>gebiet (Umsatz je Beschäftigter: - 0,7 %)<br />
wird deutlich, warum vielfach eine Strategie <strong>des</strong> externen Umsatzwachstums eingeschlagen<br />
wird. Mehr als 1/3 aller Investitionen in der Branche wurde zuletzt mit dem<br />
Ziel der Rationalisierung oder Umstrukturierung getätigt. An Bedeutung gewinnen<br />
zunehmend Entwicklungsvorhaben und Umweltschutzinvestitionen.<br />
Mit den geplanten Maßnahmen sollen die oben beschriebenen Entwicklungen aktiv<br />
begleitet werden, um die Wertschöpfung im Lande zu verbessern, strukturschwache<br />
Wirtschaftsstandorte zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und neu zu schaffen sowie<br />
die Agrarstrukturen im ländlichen Raum lebensfähig zu halten. Dazu soll die Verarbeitungsindustrie<br />
in die Lage versetzt werden, durch Modernisierung und Rationalisierung<br />
im Branchenwettbewerb zu bestehen und trotz der immer stärkeren Konzentration<br />
im Lebensmitteleinzelhandel ein ernst zu nehmender Marktpartner zu<br />
sein.<br />
In den Bereichen Obst und Gemüse ist Schleswig-Holstein durch eine leistungsfähige<br />
Produktionsstruktur gekennzeichnet. In dem strukturschwachen Gebiet, insbesondere<br />
an der Westküste konnten die Chancen der Vermarktung und Wertschöpfung<br />
<strong>bis</strong>her nur ansatzweise realisiert werden. Anschubfinanzierungen im Planungszeitraum<br />
1994 - 1999 führten dazu, dass Entwicklungen zur Verbesserung der Vermarktungssituation<br />
initiiert wurden.<br />
In Schleswig-Holstein werden ca. 5.000 ha Kartoffeln angebaut, davon 1.500 ha<br />
Pflanzkartoffeln. Nur 35 % <strong>des</strong> Kartoffelverbrauchs im Lande wird aus heimischer<br />
Produktion abgedeckt. Die Nachfrage nach in der Region erzeugten Kartoffeln wird<br />
als steigend beurteilt.<br />
Die Anbaufläche für Nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen beläuft<br />
sich in 1999 auf rund 17.500 ha. Die Erzeugung konzentriert sich gegenwärtig auf<br />
Pflanzenöl (Raps) und Pflanzenfasern (Flachs).
Stand: 16.07.03<br />
- B 30 -<br />
1998 wurde der Pilotanbau von Johanniskraut und Baldrian aufgenommen; die Kulturen<br />
finden als Rohstoff für medizinische Präparate Verwendung. Nach den <strong>bis</strong>herigen<br />
Erfahrungen muss insbesondere die Produktions- und Erntetechnik noch verbessert<br />
werden. Hier zeichnen sich wirksame Lösungen und Entwicklungsmöglichkeiten<br />
ab, um dauerhaft eine rentable Bewirtschaftung etablieren zu können.<br />
Von den in Schleswig-Holstein produzierten Schlachtschweinen werden etwa 0,8<br />
Mio. Schweine pro Jahr außerhalb <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> geschlachtet und 1,2 Mio. im Lande.<br />
Zur Vermeidung zusätzlicher Transporte ist insbesondere aus Umwelt- und Tierschutzgründen<br />
durch die bessere Nutzung vorhandener Schlachtkapazitäten eine<br />
Anpassung an die Marktbedürfnisse und Hygieneerfordernisse notwendig.<br />
Auf dem Rindfleischsektor kann die derzeitige Erzeugung von den bestehenden<br />
Schlachtstätten bewältigt werden. Modernisierungs- und Innovationsmaßnahmen<br />
sind jedoch künftig zur besseren Marktanpassung erforderlich.<br />
Die Milchverarbeitung in Schleswig-Holstein war <strong>bis</strong>her überwiegend gekennzeichnet<br />
durch die Erzeugung der Interventionsprodukte Butter und Magermilchpulver.<br />
Hier besteht ein erheblicher Nachholbedarf in Richtung Herstellung marktfähiger<br />
Produkte.<br />
Die Tierkörperbeseitigung ist infrastrukturelle Schnittstelle in den Bereichen Fütterung,<br />
sanitäre Flankierung der tierischen Veredelung und Nutzung von Schlachtnebenprodukten.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Durch den <strong>bis</strong>herigen Sektorplan Obst und Gemüse ist eine wichtige Strukturentwicklung<br />
in diesem Bereich initiiert worden. Die neu eingerichteten Vermarktungsund<br />
Verarbeitungsschienen erschließen einen Markt, der es ermöglicht die Wertschöpfung<br />
in der Region zu halten mit allen positiven Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort<br />
sowie die Arbeitsmarktsituation. Neue Wege der Verarbeitung sollen<br />
beschritten werden, wie z.B. die Frostung von biologisch angebautem Gemüse. Eine<br />
weitere Form der „Veredelung“ ist die Produktion von Fertigsalaten. Diese gerade<br />
begonnene Entwicklung soll fortgesetzt und ausgebaut werden, um vorhandene Potenziale<br />
zu nutzen und zu steigern. Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum<br />
sind mit 3,4 Mio. E aus dem EAGFL Investitionen in Höhe von 11,2 Mio. E in<br />
zwei Projekten unterstützt worden. Damit sind in einem strukturschwachen Gebiet 40<br />
Arbeitsplätze geschaffen worden.<br />
Im Sektor Blumen und Zierpflanzen wurden zur Installation einer EDV-gestützten<br />
Baumschulbörse 0,4 Mio. E investiert. Sie ist ein festes Instrument zur transparenten<br />
Markt- und Preisübersicht für die Produktionsbetriebe und den Handel geworden.<br />
Bestandsführung, Anfragen, Angebote, Käufe und Abrufe werden mit diesem System<br />
erledigt. Die Teilnehmerzahl der dieses System aktiv nutzenden Betriebe ist von<br />
Anfang 1998 mit 100 auf heute 162 Betriebe angestiegen.<br />
Für den Bereich Kartoffeln gab es im vorangegangenen Planungszeitraum wiederholt<br />
Ansätze für einzelne Maßnahmen, die damals noch nicht realisierungsfähig wa-
- B 31 -<br />
ren. Für den künftigen Planungszeitraum zeichnen sich konkrete Vorhaben ab, die<br />
ebenfalls zu den o.a. Ergebnissen führen.<br />
Eingesetzte Finanzmittel zur <strong>Förderung</strong> von Entwicklungsvorhaben im Bereich<br />
Nachwachsende Rohstoffe von 1994 - 1999: 0,065 Mio. E für 7 Projekte.<br />
Auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 866/90 wurde für die Länder Schleswig-<br />
Holstein und Hamburg ein Sektorplan für die Vermarktung von Schlachtvieh und<br />
Fleisch sowie für die Schlachtabfallverwertung erstellt.<br />
In den Jahren 1992 - 1995 sind Mittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der<br />
Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“ in Höhe von 1,2 Mio. E und EAGFL-Mittel in<br />
Höhe von 1,5 Mio. E in diesen Förderbereich geflossen.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Bewertungsergebnisse werden im Rahmen der Evaluierung <strong>des</strong> Sektorplans erstellt.<br />
Die Ausweitung <strong>des</strong> Anbauspektrums ist ebenso forciert worden wie die regionale<br />
Vermarktung.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Ziel der Maßnahmen ist es, den Anteil <strong>des</strong> Obst- und Gemüsebaus in der Region<br />
zu erhalten. Einerseits soll der Absatz über den Frischmarkt für Obst und Gemüse<br />
weiter verbessert und gesichert werden (Erhöhung der Qualität, Erweiterung der Angebotspalette),<br />
andererseits soll die Verarbeitung heimischer Produkte gefördert<br />
werden. Durch den Wegfall <strong>des</strong> Sauerkohlmarktes entstand ein zusätzlicher Druck<br />
auf dem Frischkohlmarkt, der durch eine Diversifizierung <strong>des</strong> Anbaus, qualifiziertere<br />
Vermarktung und durch Weiterverarbeitung/Veredlung von Frischgemüse zu Fertigsalaten<br />
oder Frostung bei gleichzeitig höherer Wertschöpfung aufgefangen werden<br />
soll.<br />
Der Bedarf an regional erzeugten Kartoffeln ist gegeben. Nur 35 % <strong>des</strong> Speisekartoffelbedarfs<br />
werden im Lande erzeugt. Die Verpackung und marktgerechte Aufbereitung<br />
der Speisekartoffeln erfolgt z.Zt. überwiegend außerhalb <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>. Durch<br />
entsprechende Maßnahmen sollen Abpack-, Lagerungs- und Aufbereitungsanlagen<br />
im Lande geschaffen werde, die sowohl den Frischmarkt als auch die verarbeitende<br />
Industrie ganzjährig mit gleichmäßigen Partien versorgen können.<br />
Aufbauend auf die EDV-Baumschulbörse wird für den Blumen und Zierpflanzensektor<br />
das Ziel angestrebt, die unzureichende Logistik- und Vertriebsstruktur der<br />
Unternehmen zu entwickeln. Dazu sind Verbesserungen der innerbetrieblichen Abläufe,<br />
der verbundübergreifenden Logistik und der Vertriebsstruktur notwendig.<br />
Durch Implementierung von Electronic Business-Anwendungen sollen die Kommunikation<br />
zwischen den Betrieben verbessert und neue Märkte erschlossen werden.<br />
Die Lan<strong>des</strong>regierung Schleswig-Holstein stärkt gezielt unternehmerische Aktivitäten,<br />
die ökologisch unbedenkliche Produkte und Herstellungsverfahren anstreben.<br />
Nachwachsende Rohstoffe spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.<br />
Ziel ist <strong>Förderung</strong> von Investitionsvorhaben zur Nutzung von Nachwachsenden Rohstoffen<br />
- vornehmlich auch solchen, die keiner Marktordnung unterliegen - aus der<br />
Land- und Forstwirtschaft, primär für industriell-technische Anwendungen.<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 32 -<br />
Begünstigte sind bestehende und neu zu gründende Unternehmen.<br />
In Zukunft sind in der Fleischverarbeitung Investitionen zur weiteren Anpassung an<br />
die Erfordernisse <strong>des</strong> Marktes notwendig. Darüber hinaus sollen aus Gründen <strong>des</strong><br />
Umwelt- und insbesondere <strong>des</strong> Tierschutzes durch die bessere Nutzung vorhandener<br />
Betriebsstätten Voraussetzungen geschaffen werden, um den Transport von lebenden<br />
Schlachttieren aus Schleswig-Holstein zu reduzieren und die Schlachtung<br />
und Verarbeitung im Lande sicherzustellen. Mit der damit verbundenen Wertschöpfung<br />
soll außerdem ein wichtiger Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen im strukturschwachen<br />
ländlichen Raum geleistet werden.<br />
Die bestehende Situation auf dem Schweinefleischsektor soll für die Schlachtung<br />
und Verarbeitung von Schweinefleisch durch die <strong>Förderung</strong> von Investitionen für die<br />
Tierannahme, Zerlegung, Kühlung und Verarbeitung zu Convenience-Produkten insbesondere<br />
in kleineren und mittelständischen Schlachtbetrieben verbessert werden.<br />
Durch verstärkte vertikale Integration wird auch eine Stabilisierung der seit Jahren<br />
rückläufigen Schweinefleischerzeugung in Schleswig-Holstein erwartet.<br />
Damit auf dem Rindfleischsektor künftige Anforderungen der Abnehmer an die<br />
tiergerechte Tierannahme, Kühlung für Fleischreifung sowie Zerlegung und Verarbeitung<br />
zu Convenience-Produkten erfüllt werden können, stehen Modernisierungsmaßnahmen<br />
sowohl in kleinen und mittleren als auch in großen Schlachtbetrieben<br />
an. Ansonsten wird der Lebendtiertransport in andere Regionen zunehmen.<br />
Auf dem Meiereisektor besteht ein erheblicher Nachholbedarf, um von der <strong>bis</strong>herigen<br />
Ausrichtung auf die Erzeugung der Interventionsprodukte Butter und Magermilchpulver<br />
wegzukommen und die verstärkte Erzeugung anderer marktfähiger Produkte<br />
aufzunehmen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Innovative<br />
Investitionen und Anwendung moderner Technik sollen die Anpassung an die<br />
Anforderungen <strong>des</strong> Marktes erleichtern. Marktchancen werden vor allem in verbrauchergerechter<br />
Verpackung von Käse, in der Herstellung von Baby- und Kindernährmitteln<br />
sowie bei innovativen Produkten gesehen. Daneben sind Investitionen insbesondere<br />
für Hygienemaßnahmen und zur betrieblichen Optimierung notwendig.<br />
Auf Grund <strong>des</strong> mit rund 90% hohen Anteils der von genossenschaftlichen Meiereien<br />
verarbeiteten Milch wird durch die vorgesehenen Maßnahmen ein unmittelbar positiver<br />
Effekt für die Erzeugererlöse erwartet.<br />
Technische und logistische Anpassungen der bestehenden Tierkörperbeseitigungsanstalten<br />
an die sich wandelnden rechtlichen Rahmenkonditionen der Gemeinschaft<br />
sind unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Standortentwicklung<br />
in den Sektoren tierische Veredelung und Ernährungswirtschaft. Durch die <strong>Förderung</strong><br />
von entsprechenden Neuinvestitionen werden die strukturellen Bedingungen<br />
dieser Erwerbszweige gefestigt. Die Tierkörperbeseitigungsanlagen müssen auf<br />
Grund neuer <strong>EU</strong>-Vorschriften seuchenhygienische Anpassungsinvestitionen vornehmen,<br />
insbesondere aber Komplementärinvestitionen zu den in Schleswig-<br />
Holstein tätigen Schlachtunternehmen.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung
Stand: 16.07.03<br />
- B 33 -<br />
Obst und Gemüse sowie Kartoffeln<br />
Produktions- und Standortsicherung<br />
Erhöhung der Wertschöpfung<br />
Reduzierung der Transportkosten<br />
Sicherstellung der sowohl acker- und pflanzenbaulich als auch ökologisch erwünschten<br />
Erweiterung der Fruchtfolge<br />
Erhaltung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen<br />
Blumen und Zierpflanzen<br />
Erhalt der Marktanteile<br />
Verbesserung der Vermarktungssituation der Betriebe und somit Erhöhung der<br />
Einkommenssituation sowie Existenzsicherung<br />
Erhalt von Arbeitsplätzen<br />
Nachwachsende Rohstoffe<br />
Erleichterung der Markteinführung bei der Nutzung Nachwachsender Rohstoffe,<br />
Schaffung neuer Absatzmärkte für die Land- und Forstwirtschaft,<br />
Schonung begrenzter fossiler Rohstoff- und Energieressourcen,<br />
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz (Reduzierung klimarelevanter Emissionen<br />
durch Verwendung natürlicher Rohstoffe, Stoffstrommanagement im Sinne<br />
einer Kreislaufwirtschaft),<br />
Sicherung bestehender Arbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft und<br />
Schaffung neuer Arbeitsplätze in Verarbeitungsbetrieben.<br />
Schweinefleisch, Rindfleisch und Milch<br />
Schonung der Umwelt durch geringere Tiertransporte,<br />
Geringere Belastung der Schlachttiere durch kürzere Transportwege,<br />
Erhöhung der Wertschöpfung im Lande,<br />
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen,<br />
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf Grund erhöhter Verarbeitungstiefe<br />
und durch Produktinnovation<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Alle Sektoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Ausgelöstes Gesamtinvestitionsvolumen<br />
Beihilfeintensität<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Arbeitsplatzentwicklung in den geförderten<br />
Unternehmen<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anteil und Umfang der „Grünen“ Investitionen<br />
Spezifische Sektoren
Obst/Gemüse/Kartoffeln<br />
Entwicklung der Anbaufläche<br />
Qualität (Handelsklassen)<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 34 -<br />
Blumen und Zierpflanzen<br />
Anzahl der Betriebe mit elektronischen Kommunikationssystemen<br />
Entwicklung <strong>des</strong> Produktionswertes<br />
Nachwachsende Rohstoffe<br />
Anbauentwicklung in der Land- und Forstwirtschaft<br />
zusätzliche Erlöse in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft<br />
Schweinefleisch, Rindfleisch und Milch<br />
Anzahl der überregional vermarkteten lebenden Schlachtschweine<br />
Rind- und Schweinefleischerzeugerpreis im Vergleich zum Bund<br />
Milchauszahlungspreis im Vergleich zum Bund<br />
Anteil der Butter- und Magermilchpulverproduktion an der verarbeiteten Milchmenge<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Sektoren landwirtschaftlicher Basiserzeugung<br />
Obst und Gemüse<br />
Kartoffeln<br />
Blumen und Zierpflanzen<br />
Nachwachsende Rohstoffe<br />
Fleisch<br />
Milch<br />
Tierkörperbeseitigung<br />
Kriterien für den Nachweis der wirtschaftlichen Vorteile für die Primärerzeuger<br />
Verpflichtung <strong>des</strong> Fördernehmers, 50 % der geförderten Kapazitäten durch Lieferverträge<br />
nachzuweisen.<br />
Produktionswert bei Blumen und Zierpflanzen<br />
zusätzliche Erlöse bei Nachwachsenden Rohstoffen<br />
Erzeugerpreise für Milch und Fleisch<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 35 -<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Sie werden aus den am Jahresende dem MLR vorzulegenden Unterlagen<br />
<strong>des</strong> Zuwendungsempfängers entnommen und an das fondsverwaltende Referat<br />
weitergeleitet.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Im Rahmen einer notifizierten Förderrichtlinie <strong>des</strong> MLR Schleswig-Holstein werden<br />
Entwicklungsvorhaben und Untersuchungen zur industriell-technischen Nutzung von<br />
Nachwachsenden Rohstoffen bezuschusst. In Anbetracht <strong>des</strong> geringen Haushaltsansatzes<br />
(51.000 E pro Jahr) beschränkt sich die <strong>Förderung</strong> allerdings nur auf kleinere<br />
Projekte. Gefördert werden neben Investitionsmaßnahmen auch Machbarkeitsstudien<br />
und Anbauversuche.
Stand: 16.07.03<br />
- B 36 -<br />
Maßnahme g 2:<br />
<strong>Förderung</strong> der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter<br />
landwirtschaftlicher Produkte<br />
(Titel II Kap. VII)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 25 <strong>bis</strong> 28, insbesondere Artikel 25 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 33 (4.<br />
Tiret) der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder einige Maßnahmen betreffen:<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 0,54 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 1,34 Mio. getätigt werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong> der Verarbeitung und<br />
Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte <strong>des</strong><br />
jeweiligen Rahmenplans nach der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Erzeugerzusammenschlüsse für ökologisch erzeugte Produkte, die ihre Vermarktung<br />
im Durchschnitt der letzten drei Jahre vor Antragstellung weit überwiegend auf Obst<br />
und Gemüse ausgerichtet haben, sind von der Investitionsförderung ausgeschlossen.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Ausnahmen werden nicht beantragt.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
- B 37 -<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes"<br />
Grundsätze für die <strong>Förderung</strong> der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder<br />
regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte<br />
Es wird zugesichert, dass kein Unternehmen Investitionsbeihilfen in dem Bereich<br />
Verarbeitung und Vermarktung erhält, das die Voraussetzungen der Definition <strong>des</strong><br />
Unternehmens in Schwierigkeiten nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche<br />
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten<br />
(ABl. EG 1999 Nr. C 288, S. 2) erfüllt. Im Rahmen der Bewilligung der Beihilfen stellt<br />
Schleswig-Holstein auf Grund vorzulegender Bilanzen sicher, dass nur wirtschaftlich<br />
lebensfähige Betriebe gefördert werden. Dies wird in der Regel anhand von entsprechenden<br />
Kriterien beurteilt. Dazu gehören beispielsweise Indikatoren wie die Entwicklung<br />
von Gewinn und Verlust, <strong>des</strong> cash-flow, der Gesamtkapitalverzinsung, der<br />
Eigenkapitalbildung und die Tragbarkeit <strong>des</strong> Kapitaldienstes.<br />
Min<strong>des</strong>tanforderungen in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz<br />
Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sind in Bezug auf Umweltschutz, Hygiene<br />
und Tierschutz in den entsprechenden nationalen bau-, immissions-, umweltverträglichkeitsprüfungs-,<br />
hygiene- und tierschutzrechtlichen Regelungen umgesetzt<br />
worden. Im Rahmen der bei Investitionsvorhaben notwendigen baurechtlichen, immissionsschutzrechtlichen<br />
und/oder gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren<br />
wird die Einhaltung dieser Vorschriften von den dafür zuständigen Behörden überprüft<br />
(siehe auch Tabelle 29). Im Übrigen unterliegen alle Unternehmen der allgemeinen<br />
Gewerbeaufsicht durch die zuständigen Stellen, die die Einhaltung dieser<br />
Vorschriften auch unabhängig von der Durchführung von Investitionsvorhaben überwachen.<br />
Hinreichende Beurteilung der normalen Absatzmöglichkeiten<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Antragsverfahrens muss von den Antragstellern das Vorhandensein<br />
normaler Absatzmöglichkeiten für die jeweiligen Erzeugnisse, die Investitionsarten<br />
und im Vergleich von vorhandener und voraussichtlicher Kapazität dargestellt werden.<br />
Eine Quantifizierung der Beurteilung der normalen Absatzwege im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplans für den Bereich Regionale Vermarktung ist wegen der unzureichenden<br />
Datengrundlage derzeit nur eingeschränkt möglich. In Schleswig-Holstein<br />
liegt der vermutete Erlös weit unter 5 % <strong>des</strong> landwirtschaftlichen Gesamtumsatzes.<br />
Daraus wird die <strong>bis</strong>her nur untergeordnete Bedeutung der regionalen Vermarktung<br />
deutlich. Gleichwohl werden hier Entwicklungspotenziale gesehen. Verbraucherinnen<br />
und Verbraucher messen beim Einkauf ihrer Nahrungsmittel der Herkunft eine zunehmend<br />
höhere Bedeutung bei. Es bestehen insbesondere Präferenzen für Nahrungsmittel<br />
aus der eigenen Region. Es wird erwartet, dass sich Schleswig-Holstein<br />
dem geschätzten Bun<strong>des</strong>durchschnitt von 8 <strong>bis</strong> 9 % Anteil der regionalen Vermarktung<br />
annähert. Auch bei den verschiedenen Wirtschaftsbeteiligten (z.B. Gastrono-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 38 -<br />
mie, Handwerk, Lebensmittelhandel) ist eine wachsende Bereitschaft im Hinblick auf<br />
die Verarbeitung/Vermarktung regionaler Erzeugnisse erkennbar. Die Regionale<br />
Vermarktung in ihren verschiedenen Dimensionen wird vom Land Schleswig-Holstein<br />
als ein wichtiger Faktor in der Vermarktung von Agrarprodukten und Lebensmitteln<br />
erachtet.<br />
Normale Absatzmöglichkeiten sind für Produkte aus dem ökologischen Landbau generell<br />
auf Grund der großen Nachfrage gewährleistet. In Schleswig-Holstein werden<br />
vornehmlich folgende Produkte aus dem ökologischen Anbau angeboten: Milch,<br />
Gemüse, Kartoffeln und Getreide sowie Veredelungsprodukte. Bei diesen ökologisch<br />
erzeugten Produkten kann die Nachfrage derzeit nicht gedeckt werden. Es wird eine<br />
weiterhin steigende Nachfrage erwartet. Für die Vermarktung allein dieser zusätzlichen<br />
Mengen ist ein marktorientierter Ausbau der betrieblichen Infrastruktur bei<br />
Unternehmen der Verarbeitung und <strong>des</strong> Handels erforderlich.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangenen<br />
Planungszeitraum<br />
Laufende Verträge aus dem vorangegangenen Planungszeitraum gibt es nicht.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die schleswig-holsteinische Landwirtschaft ist entscheidend in die Verantwortung für<br />
Boden, Wasser und Luft eingebunden. Der ökologische Landbau ist ein beispielhafter<br />
Weg, diesen Bemühungen um die Umwelt gerecht zu werden. Er ist von der integrierten<br />
Landbewirtschaftung zu unterscheiden und entspricht damit den steigenden<br />
Erwartungen an landwirtschaftliche Produktionsweisen ganz besonders. In<br />
Schleswig-Holstein sind fast alle „Öko-Betriebe“ auch Mitglied in einem Verband <strong>des</strong><br />
ökologischen Landbaus. Von den insgesamt neun in der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer<br />
Landbau e.V. (AGÖL) organisierten Öko-Verbänden in Deutschland agieren<br />
im Lande nur vier. Sie werden vertreten durch den Bioland Lan<strong>des</strong>verband<br />
Schleswig-Holstein e.V., den Naturland Regionalverband Nord-Ost e.V., die Bäuerliche<br />
Gesellschaft Nord-Westdeutschland e.V. (Demeter) und Biopark e.V..<br />
Anfang der 90er Jahre ist die Anzahl der Betriebe, die nach den Regelungen <strong>des</strong><br />
ökologischen Landbaus wirtschaften, stark angestiegen. Zur Anzahl der Öko-<br />
Betriebe in Schleswig-Holstein folgende zwei Übersichten - Stand jeweils<br />
31.12.1998; die Angaben in % geben die Veränderungen zum Vorjahr wieder:
Stand: 16.07.03<br />
- B 39 -<br />
Tabelle 2: Durch Kontrollstellen im Sinne der EG-Öko-VO kontrollierte <strong>EU</strong>-Öko-<br />
Betriebe in Schleswig-Holstein<br />
A AB B BC C ha LF<br />
A + AB<br />
244 20 81 13 2 15.192<br />
264 (+9%) 96 (+8%) (+9%)<br />
360<br />
A = landwirtschaftliche Betriebe B = verarbeitende Betriebe C = Importeure<br />
Tabelle 3: Ausschließlich nach den Richtlinien der AGÖL-Verbände wirtschaftende und<br />
durch die Verbände kontrollierte landwirtschaftliche Öko-Betriebe in<br />
Schleswig-Holstein<br />
Anzahl ha LF<br />
Bioland 30 681<br />
Biopark 0 0<br />
Demeter 5 34<br />
Naturland 2 25<br />
37 740<br />
Insgesamt sind dies 301 landwirtschaftliche Öko-Betriebe (+3%) mit 15.932 ha LF<br />
(+4%) und 96 (+8%) gewerbliche Betriebe, die Öko-Produkte ausschließlich verarbeiten<br />
oder einführen.<br />
Der Anteil der ökologisch wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe an der Gesamtzahl<br />
aller landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-Holstein liegt bei 1,3 Prozent,<br />
der Anteil ihrer Fläche an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche bei 1,5<br />
Prozent.<br />
Zur regionalen Vermarktung gehört u.a. die Direktvermarktung. Nach vorliegenden<br />
Schätzungen erzielen etwa 3 <strong>bis</strong> 4 % der landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-<br />
Holstein nennenswerte Erlöse aus dem Direktabsatz. Das sind ca. 800 <strong>bis</strong> 1.400<br />
Betriebe.<br />
Zwei Direktvermarktungstypen sind zu unterscheiden:<br />
Saisonabhängige Direktvermarkter, die i.d.R. nur zwei <strong>bis</strong> drei Monate im Jahr ihre<br />
Produkte anbieten und meist an viel befahrenen Bäder- und Urlauberstraßen liegen<br />
und<br />
saisonunabhängige Direktvermarkter (Jahresanbieter), die meist in der Nähe von<br />
Ballungsgebieten liegen. Diesen sollte zukünftig die besondere Aufmerksamkeit<br />
gelten.<br />
Die regionale Zuordnung weist eine stärkere Konzentration in der Nähe <strong>des</strong> Ballungsgebietes<br />
Hamburg aus, mit Abstand folgen dann die stark befahrenen Küstenstraßen<br />
zur Nord- und Ostsee.<br />
Der ökologische Landbau kann sich nur weiterentwickeln, wenn die Vermarktungsaktivitäten<br />
gleichermaßen steigen. Ziel ist es, die Vermarktung von ökologisch und<br />
regional erzeugten landwirtschaftlichen Produkten in Bezug auf Menge, Qualität und
- B 40 -<br />
Art <strong>des</strong> Angebotes an die Markterfordernisse anzupassen, denn regional erzeugte<br />
Agrarprodukte und Lebensmittel aus ökologischem Landbau finden beim Verbraucher<br />
immer mehr Anklang. Die Verbraucher wünschen generell eine möglichst vollständige<br />
Palette von qualitativ hochwertigen Erzeugnissen aus nachhaltiger, umweltund<br />
artgerechter Produktion. Dieser Trend schafft einen ständig wachsenden Markt<br />
für diese landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Deshalb sind die Fördermöglichkeiten für<br />
den Absatz von Ökoprodukten in den letzten Jahren in Schleswig-Holstein laufend<br />
verbessert worden. Durch die Ausdehnung der Absatz- und Vermarktungsförderung<br />
muss erreicht werden, dass die Nachfrage nach regional erzeugten Produkten aus<br />
dem ökologischen Landbau in Schleswig-Holstein erhöht wird, damit die Landwirte<br />
nach der Umstellung der Wirtschaftsweise auch die Chance bekommen, ihre Waren<br />
zu angemessenen Preisen möglichst ortsnah zu vermarkten und dadurch Einkommensbelastungen<br />
aus Transportkosten zu reduzieren.<br />
Schleswig-Holstein ist allgemein durch eine leistungsfähige Produktionsstruktur gekennzeichnet.<br />
In den strukturschwachen Gebieten, insbesondere an der Westküste<br />
konnten die Chancen der Vermarktung und Wertschöpfung <strong>bis</strong>her nur ansatzweise<br />
realisiert werden. Anschubfinanzierungen im Planungszeitraum 1994-1999 führten<br />
dazu, dass Entwicklungen zur Verbesserung der Vermarktungssituation initiiert worden<br />
sind. Mit den durchgeführten Maßnahmen sollen auch die Wertschöpfung im<br />
Lande verbessert, strukturschwache Wirtschaftsstandorte gestärkt, Arbeitsplätze<br />
gesichert und neu geschaffen werden sowie Agrarstrukturen in den ländlichen Räumen<br />
verbessert und somit gestärkt werden. Zum Erhalt der Arbeitsplätze in strukturschwachen<br />
Regionen soll die Verarbeitungsindustrie für Produkte aus dem ökologischen<br />
Landbau in die Lage versetzt werden, der immer stärkeren Konzentration im<br />
LEH durch Modernisierung und Rationalisierung der Anlagen zu begegnen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
0,287 Mio. E im Rahmen der Maßnahme „Zuschüsse für die Vermarktung nach besonderen<br />
Regeln erzeugter landwirtschaftlicher Produkte“ getätigt.<br />
Da ein Erzeugerzusammenschluss von fünf landwirtschaftlichen Betrieben erforderlich<br />
ist, hatte diese Maßnahme in den letzten Jahren einen schlechteren Zuspruch<br />
als die Maßnahme: „<strong>Förderung</strong> zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung<br />
ökologisch erzeugter landwirtschaftlicher Produkte“ als reine Lan<strong>des</strong>maßnahme. Zukünftig<br />
wird - durch die Ergänzungen der Fördergrundsätze bedingt - eine Ausschöpfung<br />
der bereitgestellten Haushaltsmittel erwartet.<br />
Die Direktvermarktung in Schleswig-Holstein war <strong>bis</strong>her überwiegend gekennzeichnet<br />
durch Aktivitäten einzelner Landwirte, weniger durch Erzeugerzusammenschlüsse<br />
o.a. Anbieter. Ein erster positiver Ansatz für das Gemeinschaftsmarketing wurde<br />
1997 initiiert von der Projektgesellschaft Westküste mit dem Projekt „Dithmarscher<br />
Spezialitätenversandhandel“. Ein wichtiger Ansatz dieser Projektidee war es, das<br />
Potenzial an Touristen auch in ihren Heimatorten für den Absatz von Dithmarscher<br />
Spezialitäten/Produkten zu nutzen. Das Projekt, das insgesamt 170 TDM (rd.<br />
87.000 E) kostete, ist mit 39.200,- DM (rd. 20.000 E) Leader II-Mitteln bezuschusst<br />
worden.<br />
Auch das Land Schleswig-Holstein hat sich schon vor Jahren der Direktvermarktung<br />
angenommen. Zu ihrer <strong>Förderung</strong> hat das MLR im Jahre 1989 Richtlinien erlassen,<br />
diese u.a. mit den Prämissen, dass<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 41 -<br />
a) nur Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher Betriebe gefördert werden dürfen<br />
und<br />
b) der Investitionszuschuss pro Zusammenschluss 25 TDM (rd. 13.000 E) nicht<br />
überschreiten darf.<br />
Insgesamt hat das MLR von 1989 <strong>bis</strong> 1998 rd. 360.000 E Lan<strong>des</strong>mittel für die Direktvermarktung<br />
bereitgestellt. Die beanspruchten Mittel flossen zum überwiegenden<br />
Teil kleineren bäuerlichen Zusammenschlüssen zu, die ihre Erzeugnisse meist im<br />
direkten Umfeld absetzten.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Es liegen noch keine konkreten Wirtschaftsergebnisse vor. Eine erste Bewertung der<br />
<strong>bis</strong>her durchgeführten Maßnahmen zeigt, dass die Abnehmerseite die Herkunft der<br />
ökologisch und regional erzeugten Produkte sehr wohl zu schätzen weiß und das<br />
auch in einem gewissen Maß honoriert. Andererseits liegen eindeutige Schwächen in<br />
den noch unzureichend erschlossenen Vermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen<br />
und in der räumlichen Entfernung zu aufnahmefähigen städtischen Ballungszentren,<br />
was gleichzeitig Anonymität bedeutet.<br />
Gerade die Direktvermarktung liegt oft im Aufgabenbereich der Bäuerinnen, die sich<br />
im Zeichen schwieriger werdender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein zusätzliches<br />
finanzielles Standbein schaffen.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Die Lan<strong>des</strong>regierung Schleswig-Holstein stärkt gezielt unternehmerische Aktivitäten,<br />
die ökologisch unbedenkliche Produkte und Herstellungsverfahren anstreben.<br />
Durch diese Maßnahme soll die Verarbeitung und Vermarktung von ökologisch oder<br />
regional erzeugten Produkten an die Erfordernisse <strong>des</strong> Marktes angepasst werden.<br />
Die Rationalisierung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse<br />
und die Wettbewerbsfähigkeit soll gesteigert werden und dadurch die Wertschöpfung<br />
landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessert werden.<br />
Bisher bestehen keine nennenswerten Verarbeitungskapazitäten für ökologisch<br />
und/oder regional erzeugte Produkte. Erfahrungen aus der Vergangenheit, chargenbezogen<br />
bestehende Produktionslinien zu nutzen, haben gezeigt, dass der für diese<br />
Verfahrensweise überproportionale Logistik- und Organisationsaufwand einen erheblichen<br />
Wettbewerbsnachteil darstellt. Dies führt für Schleswig-Holstein zu der<br />
Erkenntnis, dass spezialisierte und kostenoptimale Verarbeitungsmöglichkeiten für<br />
einen Markterfolg notwendig sind. Mittelfristig ist dann davon auszugehen, dass parallel<br />
zum Ausbau der landwirtschaftlichen Erzeugung in diesen Marksegmenten Kapazitäten<br />
von <strong>bis</strong> zu 5% bezogen auf die gesamte Branche - unter möglichst weitgehender<br />
unternehmerischer Einbindung der Produzenten - geschaffen werden, wobei<br />
ein Marktanteil von 10% für insgesamt realisierbar gehalten wird.<br />
Die Ausweitung der Direktvermarktung stößt allmählich auf Grenzen, so dass zukünftig<br />
verstärkt andere Wege in der Regionalvermarktung, z.B. Zusammenschlüsse<br />
von Erzeugern, beschritten werden müssen. Ziel der zukünftigen Bemühungen muss<br />
es <strong>des</strong>halb sein, das Schwergewicht der Marketingmaßnahmen auf die „Werbung<br />
mit der Region Schleswig-Holstein“ und nicht auf die „Werbung in der Region<br />
Schleswig-Holstein“ zu legen. Zusammengefasste Partien von ökologisch oder regi-
Stand: 16.07.03<br />
- B 42 -<br />
onal erzeugten Produkten müssen sich an den Verbrauchertrends ausrichten, um<br />
damit insbesondere Voraussetzungen für eine Nachfragebefriedigung nach diesen<br />
Produkten und Erlösvorteile für die Erzeuger zu schaffen.<br />
Weiterhin soll ein Anstieg der Anzahl der ökologisch bewirtschafteten Fläche im<br />
Lande erreicht werden. Dies verringert die Belastung der Umwelt.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel aus ökologischem Landbau finden beim<br />
Verbraucher immer mehr Anklang. Dies schafft einen neuen Markt für landwirtschaftliche<br />
Erzeugnisse. Der ökologische Landbau trägt zu mehr Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten und damit den Zielen der Verordnung (EG) Nr. 1257/99<br />
bei.<br />
Durch die letzten Änderungen der Fördergrundsätze wird die nun erweiterte Maßnahme<br />
mehr Zuspruch erhalten. Durch die Sicherung der Verarbeitung und Vermarktung<br />
in der Region wird der Standort gesichert und die Wertschöpfung im Lande<br />
erhöht. Eine Reduzierung der Transportwege führt sowohl zu geringeren Kosten als<br />
auch zu geringerer Umweltbelastung. Die sowohl acker- und pflanzenbaulich als<br />
auch ökologisch erwünschte Erweiterung der Fruchtfolgen wird sichergestellt.<br />
Durch Sicherung <strong>des</strong> Standortes werden Arbeitsplätze in der Region erhalten, neu<br />
geschaffen und der ländliche Raum als Arbeits- und Lebensraum erhalten.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: ausgelöstes Gesamtinvestitionsvolumen der<br />
Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen Kosten<br />
Beihilfeintensität<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen<br />
Anzahl der betroffenen Landwirte<br />
Größe der ökologisch bewirtschafteten Fläche<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Sektoren der landwirtschaftlichen Basiserzeugung<br />
Es sind alle Sektoren der landwirtschaftlichen Basiserzeugung betroffen.<br />
Kriterien für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit
Stand: 16.07.03<br />
- B 43 -<br />
Die Beihilfe wird Zusammenschlüssen von min<strong>des</strong>tens fünf Landwirten gewährt.<br />
Somit erhalten die Primärerzeuger die Vorteile <strong>des</strong> durch die Investition erreichten<br />
Ziels. Unternehmen <strong>des</strong> Handels dürfen nur gefördert werden, wenn sie sich durch<br />
Lieferverträge mit Landwirten binden.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Die zuständige Stelle wird von den Zuwendungsempfängern im Rahmen der Begleitung<br />
der Maßnahme über den jeweiligen Stand der Durchführung der genehmigten<br />
Maßnahmen informiert. Die Indikatoren: Anzahl der geförderten Einzelmaßnahmen<br />
sowie getätigtes Gesamtinvestitionsvolumen und Höhe der Zuwendungen der geförderten<br />
Einzelmaßnahmen werden insgesamt für das vorhergehende Kalenderjahr<br />
erfasst. Der Schwerpunkt der <strong>Förderung</strong> im vorhergehenden Kalenderjahr wird beschrieben.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch sind zusätzlich Veröffentlichungen in Fachzeitschriften vorgesehen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Die Politik zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes ist auf die Wiederherstellung und<br />
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Räume ausgerichtet. Die mit dieser
Stand: 16.07.03<br />
- B 44 -<br />
Maßnahme angestrebten Ziele entsprechen dieser Politik und bilden auch die<br />
Grundlage für eine weitere Entwicklung ländlicher Gemeinden.<br />
Es ist davon auszugehen, dass diese Politik mit Maßnahmen, die im Rahmen der<br />
gemeinsamen Marktorganisation durchgeführt werden, nicht konkurrieren, da sie die<br />
Marktpolitik flankieren und ergänzen soll. Das Programm zur <strong>Förderung</strong> der Verarbeitung<br />
und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher<br />
Produkte steht daher mit Maßnahmen der gemeinsamen Marktorganisation im Einklang<br />
und steht nicht in Widerspruch zu anderen Gemeinschaftspolitiken. Es ist nicht<br />
zu erkennen, dass durch die Durchführung <strong>des</strong> Programms ungerechtfertigte Wettbewerbsverzerrungen<br />
hervorgerufen werden.
Stand: 16.07.03<br />
- B 45 -<br />
5.2 SCHWERPUNKT B - LÄNDLICHE ENTWICKLUNG (TITEL II KAP. IX)<br />
Maßnahme k 1 :<br />
<strong>Förderung</strong> der Flurbereinigung(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Flurbereinigung<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 2. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 8,13 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen (GAK, Aufwendungen<br />
<strong>des</strong> öffentlich-rechtlichen Trägers) sollen im Rahmen <strong>des</strong> Entwicklungsplanes für<br />
diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe von 20,34 Mio. E getätigt<br />
werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich werden das Land und die öffentlich-rechtlichen Träger für diese<br />
Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage (s. Ziff. 11) nationale öffentliche Aufwendungen<br />
ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von 7,2 Mio. E tätigen.<br />
Die Durchführung und die Finanzierung der Maßnahmen innerhalb und außerhalb<br />
<strong>des</strong> ZAL geschieht für den Träger zu den gleichen Modalitäten und Bedingungen.<br />
Inhaltliche Unterschiede wird es nicht geben. Die Zuordnung der Flurbereinigungsverfahren<br />
zu den beiden Bereichen wird praktisch nur am Umfang <strong>des</strong> Finanzplanes<br />
lt. Entwicklungsplan orientiert sein.<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Beihilfeintensität ergibt sich aus den unter 2.2 genannten Rechtsgrundlagen. Sie<br />
beträgt 100 %, soweit die Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft <strong>des</strong> öffentlichen<br />
Rechts Träger der Maßnahme ist und 30 % bei privaten Trägern.
Stand: 16.07.03<br />
- B 46 -<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong> der Flurbereinigung<br />
und <strong>des</strong> ländlichen Wegebaus - Teil A Flurbereinigung - <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans<br />
nach der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong><br />
Küstenschutzes" (GAK).<br />
Abweichend von den Fördergrundsätzen wird für bestimmte Teilmaßnahmen die<br />
max. Beihilfenhöhe von 80 % nicht ausgeschöpft und ist gestaffelt. Dementsprechend<br />
wird eine höhere Eigenleistung als die Min<strong>des</strong>teigenleistung verlangt.<br />
Die Flurbereinigung dient der Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und der Gestaltung<br />
<strong>des</strong> ländlichen Raumes durch Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur<br />
einschließlich von Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltigen leistungsfähigen<br />
Naturhaushalts.<br />
Die Flurbereinigung fasst ein Bündel von Maßnahmen zusammen, die geeignet sind,<br />
die Lebensbedingungen in den ländlichen Räumen zu verbessern.<br />
Träger dieser Maßnahmen ist die Teilnehmergemeinschaft (Körperschaft <strong>des</strong> öffentlichen<br />
Rechts).<br />
Die wesentlichen Maßnahmen sind nachstehend in Ziffer 3.1 - Quantifizierte Ziele/<br />
Strategie - beschrieben.<br />
Zielsetzungen bei der Fortführung anhängiger und Durchführung einzuleitender Flurbereinigungsverfahren<br />
sind:<br />
die betriebliche sowie die überbetriebliche Verbesserung der Produktions- und<br />
Arbeitsbedingungen der bäuerlichen Betriebe unter ökologischen Gesichtspunkten,<br />
die Senkung der Betriebskosten sowie<br />
die Sicherung und Erweiterung der Vielfalt der Landschaft sowie der Verbesserung<br />
der Leistungsfähigkeit <strong>des</strong> Naturhaushaltes.<br />
Eine deutliche Abgrenzung der Interventionen aus dem EAGFL gemäß Artikel 33 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und dem EFRE in den Bereichen<br />
Dorferneuerung und Dorfentwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Kulturerbes<br />
Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen<br />
Bereich, um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative Einkommensquellen<br />
zu schaffen
Stand: 16.07.03<br />
- B 47 -<br />
Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen<br />
Infrastruktur<br />
wird gewährleistet.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Schleswig-Holstein verfügt über gute Voraussetzungen für eine leistungsfähige<br />
Landwirtschaft (Böden, Klima, Ertragsfähigkeit, Naturhaushalt, Betriebsgrößen etc.).<br />
Die Agrarstrukturen in Schleswig-Holstein sind in Teilbereichen unzureichend und<br />
müssen im Hinblick auf eine leistungs- und wettbewerbsfähige sowie umweltgerechte<br />
Landwirtschaft verbessert und weiterentwickelt werden, insbesondere die<br />
ländlichen Wegenetze, die Agrarstrukturen auf Grund von Besitzzersplitterung, Flächengröße,<br />
-formen sowie fehlende Landschaftselemente. Die Ergebnisse aus<br />
Siedlungs-, Verkehrsanlagen, Umweltvorhaben etc. bringen weitere Belastungen für<br />
die Agrarstruktur.<br />
Die Agrarstrukturen können im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren nachhaltig<br />
verbessert werden. Der integrale Ansatz führt zu einer umfassenden Entwicklung<br />
ländlicher Räume.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Für die Maßnahme k 1 und r 2 sind von 1994 <strong>bis</strong> 1999 öffentliche Aufwendungen in<br />
Höhe von rd. 69 Mio. E getätigt worden. (k 1 und r 2 waren lt. EPPD von 1994 in<br />
einem Finanzplan zusammengefasst.)<br />
Die Maßnahme wurde bereits in den vorangegangenen Förderperioden durchgeführt.<br />
Hierdurch wurde es ermöglicht, in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland,<br />
Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde (5b-Gebiet) Flurbereinigungsverfahren<br />
zu fördern. In der Periode 1994 - 1999 wurden in 88 Verfahren bedeutsamere<br />
Investitionen mitfinanziert und damit die Produktions-, Arbeits- sowie Umwelt- und<br />
Lebensbedingungen verbessert.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Auf die Evaluierung <strong>des</strong> vorangegangenen Ziel 5b-Programmes wird hingewiesen.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie
Stand: 16.07.03<br />
- B 48 -<br />
Die strategischen Ziele für eine nachhaltige Agrarstrukturverbesserung können am<br />
besten durch den Einsatz geeigneter Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz<br />
erreicht werden. Hierzu sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:<br />
Neugestaltung eines Wege- und Gewässernetzes insbesondere auch im Hinblick<br />
auf die Erfordernisse <strong>des</strong> Fremdenverkehrs, der Naherholung, der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung der Dörfer und zur Erhöhung <strong>des</strong> Wohnwertes ländlicher Regionen<br />
Zusammenlegung von landwirtschaftlich genutzten Besitzstücken nach neuzeitlichen<br />
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Senkung der Produktionskosten<br />
Anpassung von Grundstücksformen und -größen unter Beachtung vorhandener<br />
Landschaftsstrukturen<br />
Herausnahme von Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung für Zwecke <strong>des</strong><br />
<strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege, für die Waldbildung und für öffentliche<br />
Zwecke wie z.B. Freizeit und Erholung<br />
Sicherung und Erhaltung ökologisch wertvoller Einzelbiotope<br />
Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems durch Anlage und/oder Vernetzung<br />
von Knicks und Kleingewässern, Gräben und Uferrandstreifen, nicht oder<br />
nur extensiv genutzten Flächen, Rändern von Straßen und Wegen, Feldgehölzen<br />
und Wäldern<br />
Maßnahmen der Dorferneuerung<br />
Im Förderzeitraum werden die vorstehend beschriebenen Maßnahmen in den Flurneuordnungsverfahren<br />
durchgeführt.<br />
Gefördert werden bevorzugt die Gemeinden, in denen zugleich andere Vorhaben<br />
sowie andere Maßnahmen der Landentwicklung durchgeführt werden. Zur Stärkung<br />
der ländlichen Räume ist eine weitere <strong>Förderung</strong> der Flurneuordnungsmaßnahmen<br />
dringend erforderlich.<br />
Voraussichtlich werden 50 Flurbereinigungsverfahren mit größeren Investitionen gefördert.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Die Flurbereinigung wird entscheidend dazu beitragen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit<br />
<strong>des</strong> ländlichen Raumes zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und zu<br />
vermehren und den außerlandwirtschaftlichen gewerblichen und agrarstrukturellen<br />
Bereich stärken.<br />
Die Kosten senkenden Effekte aus den Maßnahmen der Flurbereinigung tragen wesentlich<br />
für die Existenzsicherung der Betriebe bei.<br />
Sie wird die Funktion und Verantwortung der Landwirtschaft für den Umweltschutz<br />
stärken und durch die vielfältigen Maßnahmen zur Landschaftsgestaltung einen aktiven<br />
Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz leisten.
Quantitative Indikatoren<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 49 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt ( davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Flurbereinigungsverfahren (größere<br />
Investitionen)<br />
<br />
ha bearbeitete Verfahrensfläche<br />
km Wegebau auf neuer Trasse<br />
km Befestigung vorhandener Wege<br />
km Wegebau mit Bindemittel (Beton, Bitumen)<br />
km Wegebau ohne Bindemittel<br />
ha Fläche landschaftspflegerischer Ausgleichsmaßnahmen<br />
Anzahl von Vorhaben der Dorferneuerung<br />
(öffentliche und private Maßnahmen)<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Neustrukturierung und der Ausbau der Wege erfolgt in einer Kooperation der<br />
zuständigen Stellen unter Beachtung umweltpolitischer Erfordernisse. Die Maßnahmen<br />
sind geeignet, Kosten senkende Effekte für die Landwirtschaft, ökologische<br />
Verbesserungen für den Landschaftshaushalt sowie Verbesserungen für die ländliche<br />
Infrastruktur auch im Hinblick auf Entwicklungsmöglichkeiten im Tourismus herbeizuführen.<br />
Bei allen Maßnahmen der Flurbereinigung werden die Vermeidungs- und Verminderungsstrategien<br />
für Umweltbeeinträchtigungen beachtet. Sofern im Einzelfall unvermeidbare<br />
Eingriffe notwendig werden, wird in enger Abstimmung mit den zuständigen<br />
Umweltbehörden der notwendige Ausgleich festgelegt und realisiert.<br />
Alle innerhalb eines Flurbereinigungsverfahrens durchzuführenden Maßnahmen einschließlich<br />
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden bereits in der Planungsphase<br />
mit den Trägern öffentlicher Belange insbesondere mit den zuständigen Umweltbehörden<br />
und mit den nach § 29 Bun<strong>des</strong>naturschutzgesetz anerkannten Verbänden<br />
abgestimmt. Dabei wird auch ihre Umweltverträglichkeit geprüft. Im Übrigen<br />
wird die Planung (§ 41 FlurbG) nach dem Lan<strong>des</strong>naturschutzgesetz nur im Einvernehmen<br />
mit der zuständigen Naturschutzbehörde genehmigt. Bei der Durchführung<br />
der Maßnahmen wird besonderer Wert auf die schonende Behandlung von Natur<br />
und Landschaft gelegt. Die Trägerschaft durch die beteiligten Grundstückseigentümer<br />
bewirkt Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger.
Stand: 16.07.03<br />
- B 50 -<br />
Die Durchführung der Flurbereinigung in Schleswig-Holstein entspricht den in den<br />
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft enthaltenen Umweltschutzvorschriften,<br />
insbesondere dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie <strong>des</strong> Rates vom<br />
27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen<br />
und privaten Projekten (85/337/EWG) vom 12. Februar 1990.<br />
Die Zielsetzungen und Bestimmungen aus „Natura 2000“ werden beachtet.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Die Maßnahmen werden jeweils von der Flurbereinigungsbehörde (Amt für ländliche<br />
Räume) geplant, mit anderen Vorhaben koordiniert und von der Teilnehmergemeinschaft<br />
(Zuwendungsempfänger) durchgeführt und finanziert.<br />
In den nationalen Aufwendungen sind die Eigenleistungen der Teilnehmergemeinschaft<br />
enthalten, da es sich um finanzielle Leistungen einer Körperschaft <strong>des</strong> öffentlichen<br />
Rechts handelt, die in Ausübung öffentlicher Belange verwendet werden.<br />
Sämtliche Mittel werden auf der Grundlage der Anordnung für das Kassen- und<br />
Rechnungswesen der Teilnehmergemeinschaften von Flurbereinigungen pp. durch<br />
die Investitionsbank gezahlt und verbucht. Die Zahlung der öffentlichen Mittel (Land,<br />
<strong>EU</strong>) geschieht im Wege <strong>des</strong> Abrufverfahrens durch Beauftragte bei den ÄLR als<br />
Zahlstelle.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Sie regelt durch Dienstanweisung, dass die umsetzenden Behörden (Ämter für ländliche<br />
Räume) die erforderlichen Informationen einschließlich der Indikatoren formund<br />
fristgerecht vorgelegt werden. Die zuständige Stelle fasst die gelieferten Daten<br />
in einem Lagebericht zusammen.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Zusätzlich wird die Öffentlichkeit maßnahmenspezifisch durch Presseinformationen<br />
und andere geeignete Maßnahmen über die Projekte unterrichtet.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37
Stand: 16.07.03<br />
- B 51 -<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben. Insbesondere ist die Berücksichtigung<br />
<strong>des</strong> Umweltschutzes durch das Beteiligungsverfahren bei der Aufstellung <strong>des</strong><br />
Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan sichergestellt.
Stand: 16.07.03<br />
- B 52 -<br />
n: Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die<br />
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung<br />
Maßnahme n 1:<br />
Ländliche Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung ländlicher Regionen<br />
(Dorferneuerung)<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft<br />
und Bevölkerung<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 5. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 14,05 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 35,13 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
14,82 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 53 -<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes"<br />
mit dem Gegenstand der <strong>Förderung</strong>:<br />
Kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung <strong>des</strong><br />
dörflichen Charakters; ausgenommen sind Wasserversorgungs- und Kanalisationsleitungen<br />
mit Nebenbauten in neuen oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten.<br />
Grundsätzlich können im Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes sowohl Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände als auch natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften<br />
<strong>des</strong> privaten Rechts, Kirchen und Verbände der Freien Wohlfahrtspflege<br />
gefördert werden. Für den Einsatz der <strong>EU</strong>-Mittel sind jedoch nur Maßnahmen<br />
in Trägerschaft von Gemeinden und Gemeindeverbänden vorgesehen. Aus diesem<br />
Grunde ist die Beihilfeintensität regelmäßig mit 100 % anzusetzen.<br />
Eine deutliche Abgrenzung der Interventionen aus dem EAGFL gemäß Artikel 33 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und dem EFRE wird gewährleistet.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen<br />
zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungseinrichtungen<br />
(z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen
- B 54 -<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem Wege<br />
lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen für die Maßnahme<br />
n 1 in Höhe von rd. 13,38 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> eingesetzt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Es handelt sich hierbei um eine erst im Jahre 1999 begonnene Maßnahme im Rahmen<br />
der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong>, für die zurzeit noch keine Bewertungsergebnisse vorliegen.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.<br />
Nach einem in der Regel ca. einjährigen Entwicklungsprozess im Rahmen einer LSE<br />
werden die abgestimmten Handlungsfelder und Projekte umgesetzt. Dies geschieht<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 55 -<br />
zum Teil in ortsbezogenen oder überörtlichen Dorfentwicklungsplanungen oder in der<br />
Umsetzung einzelner Leitprojekte.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Maßnahme soll bewirkt werden, dass ein größerer Teil der Wertschöpfung in<br />
den ländlichen Räumen erfolgt und möglichst viel Kaufkraft insbesondere auch durch<br />
Einsatz der I- und K-Technik in den ländlichen Räumen gebunden werden kann. Insbesondere<br />
sollen durch Einrichtungen zur Verbesserung der Grundversorgung die<br />
Anzahl der erforderlichen Fahrten, z.B. mit dem Pkw, in die Zentren minimiert werden.<br />
Dadurch ergibt sich ein erheblicher ökologischer Vorteil. Die neu zu schaffenden<br />
Dienstleistungseinrichtungen sind gleichzeitig Kommunikationsbereiche, die das<br />
Zusammenleben im Dorf für möglichst alle Bevölkerungsgruppen bereichern und die<br />
Lebensqualität nachhaltig verbessern.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der geschaffenen und gesicherten<br />
Arbeitsplätze<br />
Anzahl der geschaffenen Grundversorgungseinrichtungen<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen u.a. im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> ist davon<br />
auszugehen, dass im Bereich der finanziellen Indikatoren die öffentlichen Aufwendungen<br />
wie im Plan dargestellt erfolgen werden. Da ausschließlich Maßnahmen<br />
in kommunaler Trägerschaft kofinanziert werden, ist die Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten nahezu identisch mit den öffentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme<br />
der Kosten verursacht durch die Begünstigten dürfte in etwa 1,5 - 2 x so<br />
hoch sein wie die öffentlichen Aufwendungen insgesamt.<br />
Im Bereich der materiellen Indikatoren werden ca. 300 - 500 Arbeitsplätze gesichert<br />
bzw. geschaffen. Es werden ca. 50 - 100 Grundversorgungseinrichtungen geschaffen.<br />
Die Anzahl der Begünstigten wird mit ca. 80 geschätzt.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme
Stand: 16.07.03<br />
- B 56 -<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.
Maßnahme n2:<br />
Initiative ”Biomasse und Energie”<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 57 -<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und<br />
Bevölkerung<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 5. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 5,51 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von rd. 13,78 Mio. E getätigt werden.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2, erstes Tiret der VO<br />
(EG) Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Gefördert werden soll die Wärme- und Stromgewinnung aus landwirtschaftlicher<br />
Biomasse (nativ-organische Roh- und Reststoffe, insbesondere land- und forstwirtschaftliche<br />
Energieträger).<br />
Vorgesehene maximale Förderquote aus öffentlichen Mitteln: 40 % (Zuschüsse als<br />
Anteilfinanzierung).<br />
Gegenstand der <strong>Förderung</strong>:
Stand: 16.07.03<br />
- B 58 -<br />
Errichtung von Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse und von Biogas-Gemeinschaftsanlagen<br />
einschließlich der Peripherieaufwendungen (u.a. Lagerraum,<br />
Spezial- und Transportmaschinen, Pumplogistik bei Biogasanlagen);<br />
Maßnahmen und Vorhaben zur Brennstoffbeschaffung, -aufbereitung und<br />
-logistik;<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
Gemeinden, Gemeindeverbände (Ämter), Kreise und Zweckverbände,<br />
natürliche und juristische Personen <strong>des</strong> privaten Rechts.<br />
Von der <strong>Förderung</strong> ausgeschlossen sind Unternehmen, die nach Kapitel I der VO<br />
(EG) 1257/1999 förderfähig sind.<br />
Art, Umfang und Höhe der <strong>Förderung</strong>:<br />
Einmaliger, in der Regel nicht rückzahlbarer Zuschuss für Investitionsmaßnahmen<br />
<strong>bis</strong> zu 40 % der förderfähigen Kosten;<br />
Gemeinschaftsbeteiligung 40% der öffentlichen Aufwendungen (5,51 Mio €)<br />
Zuwendungsvoraussetzungen:<br />
Förderfähig grundsätzlich alle Investitionen und Aufwendungen, soweit zur Erreichung<br />
<strong>des</strong> Förderzweckes unmittelbar erforderlich;<br />
Nachweis der dauerhaften wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Energiegewinnungsanlage;<br />
Min<strong>des</strong>tanteil von 55% an landwirtschaftlicher Biomasse zur Wärme- und Stromerzeugung<br />
(im Mittel aller geförderten Anlagen);<br />
Beteiligung der Landwirtschaft (Biomasse-Lieferverträge, Dienstleistungen durch<br />
Landwirte bei Biomasseernte, -aufbereitung und -transport sowie beim Anlagenbetrieb);<br />
Begrenzung der Anlagengröße <strong>bis</strong> zu 5 MW thermische Leistung;<br />
Nutzungsverpflichtung bzw. Zweckbindung für geförderte technische Einrichtungen<br />
von 5 Jahren sowie für Bauten und bauliche Anlagen von 12 Jahren, anderenfalls<br />
ist Rückforderung der Zuschussmittel vorgesehen;<br />
Die Beihilfe wurde am 28.02.2001 von der Kommission genehmigt (Staatliche Beihilfe<br />
Nr. N 680/2000, SG (2001) D/286512).<br />
Eine Bezuschussung von Wärmenetzen inklusive Hausanschlussleitungen, Netzund<br />
Steuertechnik sowie Übergabestationen ist im Rahmen dieser Maßnahme ausgeschlossen.<br />
Eine Kofinanzierung aus EAGFL-Geldern ist insoweit nicht vorgesehen.<br />
Als Schnittstelle zwischen Wärmeerzeuger und Nah- bzw. Fernwärmenetz gilt<br />
die Netzabsperrarmatur im Vor- und Rücklauf der Nah-/Fernwärmeleitung.<br />
Nach Artikel 33, 5. Tiret der Verordnung (EG) 1257/1999, sollen aus der Maßnahme<br />
Investitionen zum Bau von mittleren und größeren Biomasseheiz(kraft)werken sowie<br />
von Biogas-Gemeinschaftsanlagen unterstützt werden. Die <strong>Förderung</strong> von einzelbetrieblichen<br />
Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben für Biomasse-Energieanlagen<br />
sowie für Maßnahmen der Brennstoffbeschaffung, -aufbereitung und -logistik,<br />
die nach Kapitel I der VO 1257/1999 möglich wäre, ist im Zuge der Biomasseinitiative<br />
ausgeschlossen. Damit ist eine eindeutige Abgrenzung zu den spezifischen<br />
Maßnahmen nach Kapitel I der VO (EG) 1257/1999 gewährleistet.
- B 59 -<br />
Darüber hinaus sollen Projekte zur Nutzung von Biomasse-Energien im Zuge folgender<br />
Maßnahmen und Richtlinien bezuschusst werden:<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Neben der Windkraft und Sonnenenergie will die Lan<strong>des</strong>regierung Schleswig-Holstein<br />
die Biomasse zur dritten Säule bei der Nutzung regenerativer Energien ausbauen.<br />
Dazu hat sie 1996 eine ressortübergreifende Initiative ”Biomasse und Energie”<br />
ins Leben gerufen. Diese Initiative orientiert sich an dem Energiekonzept <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein, wonach <strong>bis</strong> zum Jahr 2010 ein Biomasseanteil von etwa<br />
12% am Energiebedarf erreicht werden soll. Sie konzentriert sich auf die Energiegewinnung<br />
aus land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen (Holz, Biogas, Stroh) sowie<br />
aus sonstigen biogenen Reststoffen, z.B. aus dem Bereich von Ernährungsindustrie<br />
und -handwerk.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse:<br />
Aus dem Programm wurden in den letzten Jahren 30 Pilot- und Demonstrationsanlagen<br />
gefördert (18 Holzheiz- sowie Holzheizkraftwerke, 2 Strohheizanlagen, 10<br />
Biogasanlagen). Bis Ende 2000 wurden für diese Zwecke insgesamt. 7,35 Mio E an<br />
öffentlichen Fördermitteln eingesetzt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Eine detaillierte Evaluation der <strong>bis</strong>herigen Pilot- und Demonstrationsvorhaben liegt<br />
vor.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Schleswig-Holstein will die ursprünglich <strong>bis</strong> zum Jahr 2000 befristete Initiative<br />
”Biomasse und Energie” in den nachfolgenden Jahren fortsetzen und weiterentwickeln.<br />
Die Anschlussphase dieser Initiative soll folgende Förderschwerpunkte umfassen:<br />
Erleichterung der Markteinführung von Biomasse-Energien durch Anschubfinanzierungen<br />
bei der Errichtung von Biomasseheiz(kraft)werken,<br />
größere Verbreitung von Biogas-Gemeinschaftsanlagen,<br />
Etablierung einer Energieschiene über Biomassepellets,<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 60 -<br />
Einrichtung einer Biomasse-Börse,<br />
weitere Pilot- und Demonstrationsprojekte mit innovativem Charakter.<br />
Nach dem Energiekonzept der Lan<strong>des</strong>regierung Schleswig-Holstein besteht das Ziel,<br />
<strong>bis</strong> zum Jahr 2010 einen Biomasseanteil von etwa 12% an der Stromerzeugung zu<br />
erreichen und den Anteil der Wärmenutzung deutlich auszubauen.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der <strong>Förderung</strong> der Wärme- und Stromgewinnung aus Biomasse sind eine Reihe<br />
von positiven Effekten verbunden:<br />
wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von CO2- und anderen klimarelevanten Emissionen;<br />
wichtiges Element der regionalen Entwicklungspolitik zur Schaffung neuer Arbeitsplätze<br />
in ländlichen Räumen und zur Stärkung der Wirtschaft durch Weiterentwicklung<br />
von Energiegewinnungstechnologien; nach Modellrechnungen werden<br />
bei vorsichtigster Annahme für den Gesamtbereich der erneuerbaren Energieträger<br />
<strong>EU</strong>-weit 500.000 neue Arbeitsplätze prognostiziert, davon ein wesentlicher<br />
Anteil im Biomasse-Sektor;<br />
zusätzliche Einkommensperspektiven für die Land- und Forstwirtschaft durch Produktion<br />
bzw. Bereitstellung von Biomasserohstoffen;<br />
mögliche Verringerung der Importabhängigkeit bei fossilen Energierohstoffen und<br />
damit Erhöhung der Versorgungssicherheit innerhalb der Union vor dem Hintergrund<br />
eines weltweit steigenden Energiebedarfes.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der förderfähigen Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Projekte<br />
neu installierte thermische und elektrische<br />
Leistung<br />
erzielte CO2-Einsparungen<br />
Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze,<br />
Versorgungsanteil der Biomasse-Energie<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Mit der Maßnahme sollen agrar- , energie- und umweltpolitische Zielsetzungen verwirklicht<br />
werden, um der energetischen Nutzung von Biomasse durch gezielte An-
Stand: 16.07.03<br />
- B 61 -<br />
schubfinanzierungen zum Durchbruch zu verhelfen und den Anteil der Biomasse-<br />
Energie am Primärenergieverbrauch zu erhöhen.<br />
Gefördert werden sollen<br />
die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Biomasse und Biogas,<br />
Vorhaben zur Brennstoffbeschaffung, -aufbereitung und -logistik.<br />
Primäres Anliegen der Biomasseinitiative ist es, der Landwirtschaft für wegfallende<br />
Margen in der klassischen Urproduktion - bedingt durch Marktrestriktionen und Stilllegungsauflagen<br />
- alternative Einkommensperspektiven zu erschließen und die wirtschaftliche<br />
Ertragskraft der ländlichen Räume dadurch zu stärken. Große Chancen<br />
für die Landwirtschaft werden hierbei in ihrer Funktion als Biomasselieferant für die<br />
Wärme- und Stromgewinnung gesehen. Insbesondere die energetische Verwertung<br />
von ohnehin in der landwirtschaftlichen Produktion anfallenden Reststoffen - wie<br />
Knickholz, Gülle und Stroh - eröffnet neue Absatzmärkte für den ländlichen Raum.<br />
So wurden in einem Modellprojekt (Biomasseheizkraftwerk Domsland bei Eckernförde)<br />
die regionalen Landwirte als Brennstofflieferanten von Knickholz sowie ein landwirtschaftlicher<br />
Maschinenring als Produzent von daraus herzustellenden Hackschnitzeln<br />
eng und dauerhaft in das Konzept einer regenerativen Energieversorgung<br />
einbezogen. Die stärkere Einbindung bäuerlicher Betriebe in umweltverträgliche Energieversorgungskonzepte<br />
erhöht zudem die Akzeptanz der gesamten landwirtschaftlichen<br />
Produktion im Bewusstsein der Öffentlichkeit.<br />
Die dezentralisierte energetische Nutzung von Biomassebrennstoffen erhöht insbesondere<br />
die Wertschöpfung in ländlichen Regionen. Durch Bau, Wartung und Betrieb<br />
der entsprechenden Energieerzeugungsanlagen werden unmittelbar und dauerhaft<br />
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Dies trägt maßgeblich zur Stärkung der<br />
regionalen Infrastruktur bei.<br />
Neben der Gülleverwertung über Biogasanlagen erschließt das Knickholz in Schleswig-Holstein<br />
ein reichhaltiges und nachhaltiges Brennstoffpotenzial.<br />
In Norddeutschland stellt der Knick (Wallhecke), der die landwirtschaftlichen Nutzflächen<br />
umgibt, eine regionale Besonderheit dar. Der Knick dient als Wind- und Erosionsschutz<br />
und erfüllt darüber hinaus auch zahlreiche ökologische Funktionen (Biotopvernetzung,<br />
lebender Zaun, Lebensraum für Vögel). Das schleswig-holsteinische<br />
Knicknetz umfasst derzeit über 40000 Km. Zur Erhaltung ihrer Funktionalität müssen<br />
die Knicks regelmäßig gepflegt werden. Dazu muss der Holzbestand alle 10 - 15<br />
Jahre <strong>bis</strong> auf kurze Stümpfe gekürzt (”auf den Stock gesetzt”) werden. Die dabei<br />
anfallende Biomasse stellte <strong>bis</strong>lang für die Landwirtschaft hauptsächlich ein Entsorgungsproblem<br />
dar. Durch die Aufbereitung der Biomasse zu Holzhackschnitzeln wird<br />
zum einen eine sinnvolle energetische Verwertung erreicht und zum anderen zeichnen<br />
sich für die Landwirtschaft neue Einkommensquellen ab.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch auf eine Ankündigung der <strong>EU</strong>-Kommission zu<br />
verweisen, wonach künftig Hecken und andere traditionelle Landschaftsmerkmale<br />
<strong>bis</strong> zu einer Breite von zwei Metern als Teil der beihilfefähigen landwirtschaftlichen<br />
Fläche akzeptiert werden sollen. Voraussetzung dafür soll sein, dass auf diesen Flächenteilen<br />
gute landwirtschaftliche Nutzungspraktiken angewendet werden, was mit<br />
einer energetischen Verwertung <strong>des</strong> Knickholzes der Fall wäre.<br />
Finanzielle Vorteile aus der energetischen Nutzung von Gülle und Knickholz ergeben<br />
sich für die Landwirtschaft entweder durch direkte Erlöse oder in Form von Kosten-
Stand: 16.07.03<br />
- B 62 -<br />
ersparnissen. Beim Knickholz werden im Gegenzug für die Bereitstellung der Biomasse<br />
z.B. Kosten für die arbeitsintensive Knickpflege eingespart.<br />
Der nach der Güllevergärung und -entgasung an die Landwirte zurückgelieferte Sekundärrohstoff<br />
ist hinsichtlich seines Wirkungsgehaltes wesentlich wertvoller als die<br />
ursprüngliche Gülle und erspart somit den Zukauf zusätzlicher Mineraldünger. Die<br />
Verwendung <strong>des</strong> vergorenen Güllesubstrates hat zudem ökologische Vorteile und<br />
führt zu einer minimierten Geruchsbelästigung.<br />
Direkte Erlösmöglichkeiten ergeben sich auch durch die Einbindung bei der Brennstoffversorgung<br />
und bei der Betriebsführung von Anlagen über die direkte Kapitalbeteiligung<br />
von Landwirten an Betreibergesellschaften für Biomasse(heiz)kraftwerke.<br />
Außerdem bietet sich auch der landwirtschaftliche Anbau spezieller Energiepflanzen<br />
(z.B. Schnellwuchsgehölze) sowie die energetische Nutzung von Waldresthölzern<br />
aus Durchforstungsmaßnahmen an.<br />
Die unmittelbaren Effekte für die Landwirtschaft aus der Nutzung von Biomasse-<br />
Energien lassen sich insbesondere aus folgenden Indikatoren ableiten:<br />
- Biomasse-Lieferverträge mit Landwirten oder<br />
- Dienstleistungen durch Landwirte oder<br />
- organisatorische Zusammenschlüsse von Landwirten im Hinblick auf Biomassebergung,<br />
-aufbereitung und -transport sowie beim Anlagenbetrieb oder<br />
- Kapitalbeteiligungen aus der Landwirtschaft für den Betrieb einer Biomasse-<br />
Energiegewinnungsanlage.<br />
Im Rahmen der Maßnahme muss min<strong>des</strong>tens einer dieser Indikatoren als maßgebliche<br />
Voraussetzung für eine <strong>Förderung</strong> erfüllt werden.<br />
Das Förderprogramm ist mit der Erwartung verbunden, dass sich bei einer zunehmenden<br />
Etablierung von Energiegewinnungsanlagen auf Biomasse-/Biogasbasis<br />
eine deutliche Sogwirkung und Nachfragebelebung für landwirtschaftliche Energieträger<br />
einstellen wird.<br />
Neben den vorrangigen agrarpolitischen Effekten werden mit der Maßnahme auch<br />
energiepolitische Zielsetzungen - Ausbau regenerativer Energiequellen - und ökologische<br />
Vorteile - Reduzierung von CO2 - und anderen klimarelevanten Emissionen -<br />
realisiert.<br />
Gefördert werden Investitionen als Anschubfinanzierung, um die Markteinführung<br />
von biogenen Energieträgern zu erleichtern. Die dauerhafte wirtschaftliche Tragfähigkeit<br />
der Energiegewinnungsanlage muss als Voraussetzung für die Zuschussgewährung<br />
nachgewiesen sein. Eine Subventionierung <strong>des</strong> Anlagenbetriebes ist ausgeschlossen.<br />
Es sollen nur Anlagen <strong>bis</strong> zu einer Größe von 5 MWth gefördert werden.<br />
Die Programmabwicklung wird im Hinblick auf die Prüfung der Projektanträge sowie<br />
die Projektbewilligung und -kontrolle zentral durch die Investitionsbank Schleswig-<br />
Holstein erfolgen. Die Fördermodalitäten und die jeweils anwendbaren Fördermaß-
Stand: 16.07.03<br />
- B 63 -<br />
nahmen werden dabei von der Investitionsbank mit den beteiligten Lan<strong>des</strong>stellen in<br />
jedem Einzelfall gesondert abgestimmt.<br />
Einsatz landwirtschaftlicher Biomasse einschließlich Reststoffe:<br />
Die <strong>bis</strong>herigen Pilot- und Demonstrationsprojekte auf dem Bioenergiesektor haben<br />
zwar Kostensenkungspotenziale erschlossen und zu einer Optimierung der Anlagentechnologie<br />
geführt. Dennoch ist nach dem gegenwärtigen Stand der Technik<br />
festzustellen, dass die alleinige energetische Nutzung von landwirtschaftlicher Biomasse<br />
noch nicht einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb gewährleisten kann. Es ist<br />
daher notwendig, darüber hinaus auch andere Reststoffe und Biomassen als Brennstoffkomponenten<br />
einzusetzen.<br />
Als Biomasse im Sinne dieser Maßnahme und der Förderrichtlinie werden Energieträger<br />
aus Phyto- und Zoomasse verstanden. Hierzu gehören auch aus Phyto- und<br />
Zoomasse resultierende Folge- und Nebenprodukte sowie Rückstände und Reststoffe,<br />
deren Energiegehalt aus Phyto- und Zoomasse stammt. Dies umfasst insbesondere<br />
Pflanzen- und Pflanzenbestandteile und daraus hergestellte Energieträger<br />
sowie Reststoffe und Nebenprodukte pflanzlicher und tierischer Herkunft.<br />
Nicht als Biomasse gelten fossile Brennstoffe sowie daraus hergestellte Neben- und<br />
Folgeprodukte, Torf, gemischte Siedlungsabfälle, Papier, Pappe, Karton und Textilien.<br />
Soweit eine Wärme- und Stromerzeugung aus technischen Gründen nur durch eine<br />
Zünd- oder Stützfeuerung mit anderen Stoffen als Biomasse möglich ist, können<br />
auch solche Stoffe eingesetzt werden. Ebenso wird als Biomasse anerkannt, wenn<br />
maximal 10% Fremd- oder Störstoffe prozessbedingt enthalten sind (wie z.B. fossiles<br />
Methanol beim Rapsölmethylester) und nicht absichtlich beigemischt wurden. Die<br />
Vorhaltung von Spitzen- oder Reserveleistungsversorgungen auf Basis fossiler<br />
Brennstoffe steht einer <strong>Förderung</strong> der Biomasseanlage nicht entgegen.<br />
Die Verwertung landwirtschaftlicher Biomassen soll jedoch Vorrang haben; im Mittel<br />
aller Anlagen soll deren Anteil min<strong>des</strong>tens 55% betragen.<br />
Abgrenzung zum Aktionsplan:<br />
Die Biomasseinitiative will u.a. auch gezielt die Förderlücken schließen, die sich aus<br />
dem Marktanreizprogramm <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> zur <strong>Förderung</strong> von Maßnahmen zur Nutzung<br />
erneuerbare Energien ergeben. Nach dem Bun<strong>des</strong>programm ist eine <strong>Förderung</strong> von<br />
größeren Anlagen und von peripheren Komponenten (Lagerräume, Spezial- und<br />
Transportmaschinen, Pumplogistik bei Biomasseanlagen) ausgeschlossen; ferner<br />
sind Kommunen als Anlagenbetreiber nicht zuwendungsberechtigt.<br />
Die Fördertatbestände der Maßnahme sind für eine breite Ausschöpfung <strong>des</strong> Biomassepotenzials<br />
auf Grund der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Schleswig-Holsteins (hohe Anzahl landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetriebe im ländlichen<br />
Raum, kleine Gemeinden) und für die angestrebte dezentrale Energieversorgung<br />
in den ländlichen Regionen von großer Bedeutung. Die Biomasseinitiative ist<br />
insofern auf lan<strong>des</strong>spezifische Inhalte ausgerichtet.
Stand: 16.07.03<br />
- B 64 -<br />
Nach unserer Kenntnis verfolgen <strong>EU</strong>-Programme wie ALTENER II mit der <strong>Förderung</strong><br />
von z.B. Studien und Aktionen, JOULE-THERMIE mit der Auslegung auf Forschungs-<br />
und Demonstrationsanlagen, SAVE mit der <strong>Förderung</strong> von Projekten zur<br />
Informationsverbreitung und SYNERGY mit dem Schwerpunkt einer Zusammenarbeit<br />
mit Drittländern grundsätzlich andere Zielrichtungen. Sie können aber<br />
durchaus im Einzelfall das schleswig-holsteinische Programm wirksam ergänzen.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 <strong>des</strong> schleswig-holsteinischen Programms<br />
”Zukunft auf dem Land” in der genehmigten Fassung vom 25.07.2000 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Je<strong>des</strong> Projekt wird messtechnisch begleitet und einer ausführlichen Evaluation unterzogen.<br />
Bereits bei der Projektbeantragung ist ein entsprechen<strong>des</strong> Begleitkonzept mit<br />
einzureichen. Im Hinblick auf die Bewertung der Maßnahmen wird auf die oben aufgeführten<br />
Indikatoren verwiesen.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 <strong>des</strong> schleswig-holsteinischen Programms<br />
”Zukunft auf dem Land” in der genehmigten Fassung vom 25.07.2000 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 <strong>des</strong> schleswig-holsteinischen Programms<br />
”Zukunft auf dem Land” in der genehmigten Fassung vom 25.07.2000 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 <strong>des</strong><br />
schleswig-holsteinischen Programms ”Zukunft auf dem Land” in der genehmigten<br />
Fassung vom 25.07.2000 verwiesen.<br />
Es sind darüber hinaus keine maßnahmenspezifischen Regelungen vorgesehen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen
Stand: 16.07.03<br />
- B 65 -<br />
Die Initiative <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein korrespondiert mit gleichgelagerten Intentionen<br />
der <strong>EU</strong>-Kommission, wie sie in deren Weißbuch ”Energie für die Zukunft:<br />
Erneuerbare Energieträger” festgelegt sind - Mitteilung der Kommission KOM(97)<br />
599 endg. vom 26.11.1997. Danach zählt die Bioenergie zu den aussichtsreichsten<br />
und vielversprechendsten Teilbereichen, wobei vom Volumen her die Kraft-Wärme-<br />
Kopplung in biomassebefeuerten Anlagen unter allen erneuerbaren Energieträgern<br />
über das größte Potenzial verfügt. Die <strong>EU</strong> hat <strong>des</strong>halb im Rahmen einer Gemeinschaftsstrategie<br />
einen Aktionsplan zur <strong>Förderung</strong> und Unterstützung dezentraler Biokraftwerke<br />
verabschiedet. Im Zuge dieses Aktionsplanes soll <strong>bis</strong> zum Jahre 2010 die<br />
Neuinstallation von insgesamt 10000 MWth aus Biomasse-Anlagen <strong>EU</strong>-weit gefördert<br />
werden. Voraussetzung hierfür ist eine Kofinanzierung durch die Mitgliedstaaten.<br />
Die Kommission hat ihre Haltung und die politischen Notwendigkeiten zur Stützung<br />
erneuerbarer Energien in ihrem Arbeitsdokument über ”...Nachwachsende Rohstoffe<br />
im Rahmen der Agenda 2000” - SEK(1998) 2169 vom 11.12.98 - nochmals bekräftigt.<br />
Die Kommission hat wiederholt auf die enge Verzahnung der Nutzung von erneuerbaren<br />
Energien mit der Gemeinsamen Agrarpolitik und Erfordernissen zur<br />
Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes hingewiesen. In ihrem Weißbuch ”Energie für<br />
die Zukunft: Erneuerbare Energieträger” führt sie hierzu aus:<br />
„Die Landwirtschaft ist ein ausschlaggebender Sektor der europäischen Strategie zur<br />
Verdoppelung <strong>des</strong> Anteils erneuerbarer Energieträger an der Brutto-<br />
Energienachfrage in der Europäischen Union <strong>bis</strong> zum Jahre 2010. Neue Tätigkeiten<br />
und neue Einkommensquellen entstehen in und außerhalb der Landwirtschaft. Hier<br />
kann die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe für Non-food-Zwecke in Nischenmärkten<br />
und im Energiesektor der Land- und Forstwirtschaft neue Möglichkeiten eröffnen<br />
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum beitragen.<br />
In der Agenda 2000 wird Bezug genommen auf die <strong>Förderung</strong> erneuerbarer Energieträger.<br />
Vor allem die Biomasse sollte unter Einsatz aller politischen Instrumente<br />
(Agrar-, Steuer- und Industriepolitik) vollauf gefördert werden. In der künftigen GAP<br />
wird die alternative Nutzung landwirtschaftlicher Produkte eine wichtige Rolle spielen.<br />
Die Mitgliedstaaten sind zu ermutigen, erneuerbare Energieträger im Rahmen nationaler<br />
Beihilferegelungen zu fördern.<br />
Im Rahmen ihrer künftigen Politik zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes wird die<br />
Kommission die Mitgliedstaaten und Regionen ermutigen, Projekten zur <strong>Förderung</strong><br />
erneuerbarer Energieträger innerhalb ihrer Programme für den ländlichen Raum einen<br />
hohen Stellenwert einzuräumen. Die Regionen werden aber auch weiterhin ihre<br />
Verantwortung für die Auswahl der Projekte wahrnehmen müssen.<br />
Die Gemeinsame Agrarpolitik könnte durch <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> Bioenergiesektors auf<br />
verschiedene Weise dazu beitragen, den Lebensstandard und das Einkommensniveau<br />
anzuheben:<br />
Entwicklung von Energiepflanzen und Verwertung land- und forstwirtschaftlicher<br />
Abfälle als zuverlässige Rohstoffquelle im Rahmen der novellierten Gemeinsamen<br />
Agrarpolitik, ausgehandelt in Abstimmung mit der Agenda 2000, unter voller Nutzung<br />
der Ergebnisse der FuE-Politik,
Stand: 16.07.03<br />
- B 66 -<br />
<strong>Förderung</strong> biologischer erneuerbarer Energieträger im Rahmen der Politik zur<br />
<strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> ländlichen Raumes sowie weiterer laufender Programme ...”<br />
In ihrem kürzlich vorgelegten Grünbuch zur künftigen Energieversorgung in der Europäischen<br />
Union beanstandet die Kommission darüber hinaus, dass die erneuerbaren<br />
Energieträger im Unterschied zu den konventionellen Energien <strong>bis</strong>lang nicht<br />
konsequent bezuschusst worden seien.
Stand: 16.07.03<br />
- B 67 -<br />
o: Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung<br />
<strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes<br />
Maßnahme o 1:<br />
Dorferneuerung - Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung<br />
<strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Kulturerbes<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 6. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 21,35 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 53,38 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
13,09 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 68 -<br />
Die <strong>Förderung</strong> erfolgt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der<br />
Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes", hier nach den Fördergrundsätzen für die<br />
<strong>Förderung</strong> der Dorferneuerung und der Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher<br />
Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz mit dem Gegenstand der <strong>Förderung</strong>:<br />
Die Fördermittel können verwendet werden für die Finanzierung von Maßnahmen<br />
der Dorferneuerung zur umfassenden Verbesserung der Agrarstruktur<br />
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz.<br />
Zuwendungsfähig im Rahmen der Dorferneuerung sind die Aufwendungen für<br />
Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen)<br />
die Dorferneuerungsplanung; ausgenommen sind Aufwendungen für Pläne, die<br />
gesetzlich vorgeschrieben sind<br />
die Betreuung der Zuwendungsempfänger; ausgenommen ist die Betreuung durch<br />
Stellen der öffentlichen Verwaltung<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse; ausgenommen<br />
sind Aufwendungen in Neubau- und Gewerbegebieten<br />
Maßnahmen zur Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich und zur<br />
Sanierung innerörtlicher Gewässer unter Berücksichtigung der gesamten wasserwirtschaftlichen<br />
Planung<br />
kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung <strong>des</strong><br />
dörflichen Charakters; ausgenommen sind Wasserversorgungs- und Kanalisationsleitungen<br />
mit Nebenbauten in neuen oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten<br />
Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung land- und forstwirtschaftlicher oder<br />
ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzter Bausubstanz mit ortsbildprägendem<br />
Charakter einschließlich der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen<br />
Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche Bausubstanz einschließlich<br />
Hofräume und Nebengebäude an die Erfordernisse zeitgemäßen<br />
Wohnens und Arbeitens anzupassen, vor Einwirkungen von außen zu schützen<br />
oder in das Ortsbild und die Landschaft einzubinden<br />
den Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaftsanlagen<br />
den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich besonders<br />
begründeter Abbruchmaßnahmen im Zusammenhang mit bestimmten Maßnahmen<br />
Zuwendungsfähig im Rahmen der Umnutzung sind die Aufwendungen für:<br />
investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer<br />
Bausubstanz, insbesondere für Wohn-, Handels-, Gewerbe-, Dienstleistungs-,<br />
kulturelle, öffentliche und gemeinschaftliche Zwecke, die dazu dienen, Zusatzeinkommen<br />
zu erschließen<br />
Leistungen von Architekten, Ingenieuren und Betreuern in Verbindung mit den<br />
förderfähigen Maßnahmen
Stand: 16.07.03<br />
- B 69 -<br />
Hinsichtlich der Definition Dorf wird auf die zwischen dem BML und der <strong>EU</strong>-Kommission<br />
abgestimmte Definition im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung<br />
der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes verwiesen.<br />
Grundsätzlich können im Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes sowohl Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände als auch natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften<br />
<strong>des</strong> privaten Rechts land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach<br />
den Regelungen der Gemeinschaftsaufgabe als Zuwendungsempfänger fungieren.<br />
Für den Einsatz der <strong>EU</strong>-Mittel sind jedoch nur Maßnahmen in Trägerschaft von Gemeinden<br />
und Gemeindeverbänden vorgesehen. Aus diesem Grunde ist die Beihilfeintensität<br />
regelmäßig mit 100 % anzusetzen.<br />
Eine deutliche Abgrenzung der Interventionen aus dem EAGFL gemäß Artikel 33 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und dem EFRE in dem Bereich Dorferneuerung und<br />
Dorfentwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes wird gewährleistet.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen<br />
zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungseinrichtungen<br />
(z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und
Stand: 16.07.03<br />
- B 70 -<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem Wege<br />
lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen für die Maßnahme<br />
o 1 in Höhe von rd. 17,82 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> durchgeführt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Im Rahmen der Zwischenbewertung <strong>des</strong> Ziel 5b-Programms durch die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft (FAL), deren Wirkungsanalyse sich auf die Untersuchung<br />
der Beschäftigungseffekte der einzelnen Maßnahmen konzentrierte, wurde<br />
für die Dorfentwicklung folgende Feststellung getroffen: „Auf Grund der direkten Beschäftigungseffekte<br />
und der positiven Effekte auf die Beschäftigungssituation von<br />
Frauen sollte eine Verstärkung <strong>des</strong> Mitteleinsatzes im Bereich der Lan<strong>des</strong>dorferneuerung<br />
angestrebt werden, soweit eine Nachfrage besteht. Die Fallstudie ergab in<br />
diesem Bereich erhebliche positive Effekte auf die Situation ländlich geprägter Gemeinden,<br />
die durch kein anderes Instrument im Unterprogramm erreicht werden<br />
können.“<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 71 -<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen die Dörfer und ländlichen Regionen, deren<br />
Entwicklungspotenziale zurzeit nur unzureichend erschlossen sind, Rahmenbedingungen<br />
erhalten, die es den dort lebenden Menschen erlaubt, die auf Grund der naturräumlichen<br />
Ausstattung und der ökonomischen Faktoren möglichen Entwicklungschancen<br />
optimal zu nutzen.<br />
Es ist auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen zu erwarten, dass durch die Maßnahme<br />
Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes<br />
die vorhandene wertvolle Bausubstanz erhalten bleibt, dadurch die Dörfer ihre<br />
Identität wahren und so zu einer verbesserten Attraktivität insbesondere aus touristischer<br />
Sicht beigetragen wird.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der geschaffenen und gesicherten<br />
Arbeitsplätze<br />
Anzahl der geschaffenen Grundversorgungseinrichtungen<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen u.a. im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> ist davon<br />
auszugehen, dass im Bereich der finanziellen Indikatoren die öffentlichen Aufwendungen<br />
wie im Plan dargestellt erfolgen werden. Da ausschließlich Maßnahmen<br />
in kommunaler Trägerschaft kofinanziert werden, ist die Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten nahezu identisch mit den öffentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme<br />
der Kosten verursacht durch die Begünstigten dürfte in etwa 1,5 - 2 x so<br />
hoch sein wie die öffentlichen Aufwendungen insgesamt.<br />
Im Bereich der materiellen Indikatoren werden ca. 50 - 100 Arbeitsplätze gesichert<br />
bzw. geschaffen. Die Anzahl der Projekte dürfte eine Größenordnung von 1.500 erreichen.<br />
Die Anzahl der Begünstigten wird mit ca. 500 erwartet.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme
- B 72 -<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Auf Grund <strong>des</strong> gewählten integrierten Entwicklungsansatzes werden nicht nur Aussagen<br />
getroffen zum engeren Bereich der Dorfentwicklung/Dorferneuerung selbst,<br />
sondern auch zu anderen die ländliche Regionalentwicklung bestimmenden Berei-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 73 -<br />
chen wie z.B. Abwasserbeseitigung, Naturschutz, Landschaftspflege, Flurneuordnung,<br />
Wegebau etc.. Im Rahmen der Umsetzung der investiven Maßnahmen erfolgt<br />
eine regelmäßige Abstimmung (zeitlich und inhaltlich) mit den anderen Maßnahmen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 74 -<br />
Maßnahme o 2:<br />
Lan<strong>des</strong>maßnahme Dorfentwicklung - Dorferneuerung und -entwicklung sowie<br />
Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Kulturerbes<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 6. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 2,69 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 6,69 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
0,82 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 75 -<br />
2.2.1 Lan<strong>des</strong>mittel zur Dorfentwicklung<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der Vorschriften<br />
<strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Gefördert werden auf Grund der zugehörigen Zweckbestimmung im Lan<strong>des</strong>haushalt<br />
Maßnahmen mit dem Ziel, eine ganzheitliche Entwicklung ländlicher Räume sicherzustellen.<br />
Das geschieht u.a. durch<br />
Erhaltung und Gestaltung von dörflicher ortsbildprägender oder historisch bedeutender<br />
Bausubstanz durch Um- und Ausbaumaßnahmen außerhalb Landwirtschaft<br />
Sicherung und Weiterentwicklung dorfgemäßer Einrichtungen zur Verbesserung<br />
der Lebensverhältnisse der dörflichen Bevölkerung<br />
Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der dorfökologischen Verhältnisse<br />
Modellvorhaben insbesondere mit dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen für<br />
Frauen, soweit sie der Dorferneuerung und Dorfentwicklung sowie dem Schutz<br />
und der Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes dienen<br />
Erfolgskontrolle, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien zur <strong>Förderung</strong> der Dorfund<br />
ländlichen Regionalentwicklung vom 25. August 1995 (Amtsbl. S. 687), deren<br />
Neufassung derzeit unter der Beihilfe-Nr. N 326/99 der Kommission zur Notifizierung<br />
vorliegt.<br />
Als Zuwendungsempfänger kommen Gemeinden, Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaften<br />
nach dem Flurbereinigungsgesetz sowie Wasser- und Bodenverbände,<br />
natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften <strong>des</strong> privaten<br />
Rechts, Kirchen und Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts und Verbände<br />
der freien Wohlfahrtspflege in Frage. Die <strong>EU</strong>-Mittel werden ausschließlich<br />
eingesetzt bei Gemeinden und Gemeindeverbänden als Zuwendungsempfänger. Die<br />
Beihilfeintensität beträgt regelmäßig 100 %.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Ar-
Stand: 16.07.03<br />
- B 76 -<br />
beitsplätzen zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungseinrichtungen<br />
(z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem Wege<br />
lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von rd.<br />
4,44 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> durchgeführt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Im Rahmen der Zwischenbewertung <strong>des</strong> Ziel 5b-Programms durch die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft (FAL), deren Wirkungsanalyse sich auf die Untersuchung<br />
der Beschäftigungseffekte der einzelnen Maßnahmen konzentrierte, wurde<br />
für die Dorfentwicklung folgende Feststellung getroffen: „Auf Grund der direkten Beschäftigungseffekte<br />
und der positiven Effekte auf die Beschäftigungssituation von<br />
Frauen sollte eine Verstärkung <strong>des</strong> Mitteleinsatzes im Bereich der Lan<strong>des</strong>dorferneu-
Stand: 16.07.03<br />
- B 77 -<br />
erung angestrebt werden, soweit eine Nachfrage besteht. Die Fallstudie ergab in<br />
diesem Bereich erhebliche positive Effekte auf die Situation ländlich geprägter Gemeinden,<br />
die durch kein anderes Instrument im Unterprogramm erreicht werden<br />
können.“<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.<br />
Zur Erreichung dieser Ziele wird u.a. durch den Mitteleinsatz nach dem Fördergrundsatz<br />
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung in kommunaler Trägerschaft eine Ländliche<br />
Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) durchgeführt. Es handelt sich hierbei<br />
um einen integrierten, d.h. alle entwicklungsbestimmenden Bereiche umfassenden<br />
Ansatz (Ökonomie, Ökologie, Kultur/Soziales). Eine intensive Bürgermitwirkung ist<br />
hierbei von besonderer Bedeutung. Wesentlicher Inhalt der LSE ist die Auseinandersetzung<br />
der Akteure in der Region mit den jeweiligen Stärken und Schwächen, das<br />
Entwickeln von Leitbildern, das Erarbeiten von Entwicklungszielen und die interkommunale<br />
Abstimmung strukturverbessernder Leitprojekte.<br />
Nach einem in der Regel ca. einjährigen Entwicklungsprozess im Rahmen einer LSE<br />
werden die abgestimmten Handlungsfelder und Projekte umgesetzt. Dies geschieht<br />
zum Teil in ortsbezogenen oder überörtlichen Dorfentwicklungsplanungen oder in der<br />
Umsetzung einzelner Leitprojekte.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen die Dörfer und ländlichen Regionen, deren<br />
Entwicklungspotenziale zurzeit nur unzureichend erschlossen sind, Rahmenbedingungen<br />
erhalten, die es den dort lebenden Menschen erlaubt, die auf Grund der naturräumlichen<br />
Ausstattung und der ökonomischen Faktoren möglichen Entwicklungschancen<br />
optimal zu nutzen.
Quantitative Indikatoren<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 78 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der geschaffenen und gesicherten<br />
Arbeitsplätze<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen u.a. im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> ist davon<br />
auszugehen, dass im Bereich der finanziellen Indikatoren die öffentlichen Aufwendungen<br />
wie im Plan dargestellt erfolgen werden. Da ausschließlich Maßnahmen<br />
in kommunaler Trägerschaft kofinanziert werden, ist die Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten nahezu identisch mit den öffentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme<br />
der Kosten verursacht durch die Begünstigten dürfte in etwa 1,5 - 2 x so<br />
hoch sein wie die öffentlichen Aufwendungen insgesamt.<br />
Im Bereich der materiellen Indikatoren werden ca. 30 Arbeitsplätze gesichert bzw.<br />
geschaffen. Die Anzahl der Projekte dürfte eine Größenordnung von 100 erreichen.<br />
Die Anzahl der Begünstigten wird mit ca. 80 erwartet.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 79 -<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Maßnahme unterstützt die <strong>Förderung</strong> von Projekten, die in der Region als strukturverbessernd<br />
erkannt wurden, die in kommunaler Trägerschaft durchgeführt werden<br />
sollen, jedoch nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der<br />
Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes" förderungsfähig sind. So können auch solche<br />
Maßnahmen gefördert werden, die einer integrierten Dorfentwicklung dienen und als<br />
Teil <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes nicht aus der GAK gefördert werden können.<br />
Grundlage für die <strong>Förderung</strong> ist auch hier ein integrierter Entwicklungsansatz im<br />
Rahmen der Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalysen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 80 -<br />
Maßnahme o 3:<br />
<strong>Förderung</strong> wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen -<br />
Neubau von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen in ländlichen Gemeinden<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 6. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 9,77 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 24,43 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich werden im Rahmen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>programms für diese Maßnahme<br />
mit gleicher Rechtsgrundlage nationale öffentliche Aufwendungen von den Kommunen<br />
ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von 42,07 Mio. E getätigt (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong> wasserwirtschaftlicher<br />
und kulturbautechnischer Maßnahmen <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der Gemeinschaftsaufgabe<br />
"Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".
Stand: 16.07.03<br />
- B 81 -<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein gibt es noch viele Gemeinden, die nicht über eine öffentliche<br />
Abwasserbeseitigungsanlage verfügen. Statt <strong>des</strong>sen sind die einzelnen Gebäude mit<br />
nach heutigem Stand unzureichenden Einzelkläranlagen ausgestattet. Dies führt zu<br />
unzureichenden hygienischen Verhältnissen in der Gemeinde sowie zu einer starken<br />
Belastung der umliegenden Gewässer.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von rd.<br />
20,5 Mio. E getätigt. (Diese Angabe beinhaltet die <strong>bis</strong>herigen Bewilligungen sowie<br />
die Planung für 1999.)<br />
Hierfür wurden <strong>EU</strong>- Mittel und nationale Mittel bereitgestellt. Das Land stellte Mittel<br />
aus der Abwasserabgabe und der GA-Agrarstruktur zur Verfügung.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in 14 strukturschwachen<br />
Gemeinden eine zentrale Abwasserbeseitigung zu errichten, wodurch eine wichtige<br />
Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Gemeinden geschaffen wurde.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Eine Bewertung <strong>des</strong> vorangegangenen Programmplanungszeitraumes wird mittels<br />
materieller Indikatoren vorgenommen, welche denen unter Ziff. 3.2 entsprechen. Die<br />
Wirkung einer zentralen Ortsentwässerung ist jedoch nur langfristig messbar. Dies<br />
liegt zum einen daran, dass alleine der Bau der Abwasserbeseitigungsanlage mehrere<br />
Jahre in Anspruch nehmen kann, zum anderen werden die angestrebten Ziele<br />
(siehe unten) nicht sofort erreicht.<br />
Es kann z.B. mehrere Jahre dauern, <strong>bis</strong> sich der Schadstoffindex eines Gewässers<br />
durch eine zentrale Ortsentwässerung verbessert.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Da auch die weitere Entwicklung der betroffenen Gemeinden stark von der Qualität<br />
der Abwasserbeseitigung abhängt, ist es das Ziel der <strong>Förderung</strong>, die Verbesserung<br />
der Entwicklungsmöglichkeiten ländlicher Gemeinden durch die Schaffung infrastruktureller<br />
Voraussetzungen zu gewährleisten. Hierdurch wird auch die Entwicklung<br />
<strong>des</strong> Fremdenverkehrs und der Handwerkstätigkeit gefördert. Des Weiteren soll ein<br />
Schutz der Gewässer, wie auch die Sicherung bzw. Wiederherstellung ihrer vielfälti-
Stand: 16.07.03<br />
- B 82 -<br />
gen Funktionen im Naturhaushalt, z.B. als vielfältige Lebensräume für eine artenreiche<br />
Tier- und Pflanzenwelt, erreicht werden.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Förderprogramms zum Neubau zentraler öffentlicher Abwasserbeseitigungsanlagen<br />
in ländlichen Gemeinden stehen noch 65 Gemeinden an, in denen<br />
die Erstellung einer zentralen Abwasserbeseitigung erforderlich ist.<br />
Es wird angestrebt, den Schadstoffindex um folgende Werte zu reduzieren:<br />
CSB: Reduktion um ca. 80%<br />
BSB5: Reduktion um ca. 90%<br />
Pges : Reduktion um ca. 25%<br />
Die Werte beziehen sich auf die angeschlossenen Einwohnerwerte.<br />
Es ist geplant, im Programmplanungszeitraum rd. 40.000 Einwohner an die zentrale<br />
Abwasserbeseitigung anzuschließen.<br />
Für die Zahl neuer Baugrundstücke am Ort und die Zahl neuer Handwerks- und Gewerbebetriebe<br />
am Ort ist die angestrebte Maßnahmen nur eine von zahlreichen<br />
Grundlagen. Aus diesem Grunde können hier die Ziele nicht detailliert quantifiziert<br />
werden.<br />
Das Ergebnis der <strong>bis</strong>herigen <strong>Förderung</strong> hat gezeigt, dass eine zentrale Abwasserbeseitigung<br />
erheblich zur wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung ländlicher Gemeinden<br />
beiträgt. Die Entwicklung dörflicher Gemeinden erhält hierdurch eine Basis,<br />
auf der die weiteren Maßnahmen, wie Ausweisung von B-Gebieten, Gewerbegebieten,<br />
Ausbau von gewerblichen Einrichtungen fußen können, ohne Lebensqualität<br />
und Umwelt nachhaltig zu beeinträchtigen. Zudem trägt sie in großem Maße zum<br />
Schutz der Umwelt und <strong>des</strong> natürlichen Lebensraumes bei. Auch der Schutz natürlicher<br />
Ressourcen steht hierbei im Vordergrund.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Durch die <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> Neubaus zentraler öffentlicher Abwasserbeseitigungsanlagen<br />
soll für strukturschwache ländliche Gemeinden eine Basis für ihre weitere Entwicklung<br />
geschaffen werden.<br />
Schon durch den Bau zentraler Abwasserbeseitigungsanlagen kann direkt positiver<br />
Einfluss auf die Beschäftigungszahlen genommen werden, da durch die Bauarbeiten<br />
Aufträge an regionale Bauunternehmen vergeben werden und somit Arbeit geschaffen<br />
wird.<br />
Das Vorhandensein einer öffentlichen Ortsentwässerung steigert zudem die Attraktivität<br />
der jeweiligen Gemeinde als Standort für Gewerbe- und Handwerksbetriebe,<br />
deren Ansiedlung zur strukturellen Verbesserung einer Gemeinde gehört.<br />
Auch die Standortwahl bezüglich der Ausweitung von Wohngebieten geht mit einer<br />
leistungsfähigen Ortsentwässerung einher, so dass diese einen positiven Einflussfaktor<br />
auf die Ausweisung neuer Baugebiete hat.<br />
Zusätzlich werden die hygienischen Gegebenheiten in der Gemeinde verbessert,<br />
was zu einer Steigerung der Lebensqualität der Bewohner führt.
Stand: 16.07.03<br />
- B 83 -<br />
Um die Verbesserung der Gewässersituation in ländlichen Gebieten voranzutreiben,<br />
ist es erforderlich, den Schadstoffeintrag in diese Gewässer zu minimieren. Wo<br />
heute das Abwasser noch vorwiegend durch unzureichende Hauskläranlagen geklärt<br />
wird ist es erforderlich durch eine zentrale Abwasserbeseitigung eine bessere Reinigungsleistung<br />
für das Abwasser zu erzielen. Auf diese Weise soll die Erhaltung der<br />
Gewässer als Lebensraum für eine artenreiche Flora und Fauna erzielt werden.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten (Gesamtkosten)<br />
Gesamtsumme der förderfähigen Kosten<br />
Gesamtsumme der Unterstützung je Zuwendungsempfänger<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Projekte<br />
Reduzierung <strong>des</strong> Schadstoffindex<br />
Zahl neuer Baugrundstücke am Ort<br />
Zahl neuer Handwerks- und Gewerbebetriebe<br />
am Ort<br />
Zahl der angeschlossenen Einwohner<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Für den Neubau einer zentralen Ortsentwässerung sind folgende Teilbaumaßnahmen<br />
erforderlich:<br />
1.) Überörtlicher Teil<br />
- Bau einer Kläranlage<br />
- Transportleitung vom Ortsnetz zur Kläranlage<br />
- Bau eines Pumpwerkes um das Schmutzwasser vom Ortsnetz<br />
durch die Transportleitung zur Kläranlage zu drücken<br />
2.) Ortsnetz<br />
- Ausbau von Kanälen in den Straßenzügen der Gemeinde zur<br />
Sammlung <strong>des</strong> auf den Grundstücken anfallenden Schmutzwassers<br />
in unterschiedlichen technischen Verfahren<br />
- Bau von Anschlussleitungen an die Grundstücke<br />
Das Förderprogramm sieht folgende Finanzierung vor:<br />
Für den überörtlichen Teil ( Ziff. 1) der jeweiligen Gesamtmaßnahme werden <strong>bis</strong> zur<br />
vollen Höhe der förderungsfähigen Kosten Zuwendungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> gewährt. Hierzu<br />
wird eine 40%ige <strong>EU</strong>-<strong>Förderung</strong> beantragt.<br />
Den Bau <strong>des</strong> Ortsnetzes (Ziff. 2) finanziert der Maßnahmeträger als Eigenleistung.
Stand: 16.07.03<br />
- B 84 -<br />
Bezogen auf die Gesamtmaßnahme beträgt die Förderquote durchschnittlich 30%.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren sollen von den Staatlichen Umweltämtern für jede geförderte<br />
Maßnahme erhoben werden. Das Ergebnis wird an das MUNF gesendet, das<br />
die Daten in eine per EDV geführten Liste einarbeitet und an das fondsverwaltende<br />
Referat <strong>des</strong> MLR weiterleitet. Die Liste wird über den gesamten Programmplanungszeitraum<br />
geführt, so dass die Entwicklungen jederzeit abgerufen und aufgezeigt werden<br />
können.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Bezüglich der Kontrolle der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren sollen von den Staatlichen Umweltämtern und dem<br />
MUNF für jede geförderte Maßnahme erhoben werden. Die Ergebnisse werden im<br />
MUNF zusammengefasst, in per EDV geführte Listen eingearbeitet und an das<br />
fondsverwaltende Referat <strong>des</strong> MLR weitergeleitet. Die Listen werden über den gesamten<br />
Programmplanungszeitraum geführt, so dass die Entwicklungen jederzeit<br />
abgerufen und aufgezeigt werden können.<br />
Es werden bei mind. 5 % der Begünstigten, grundsätzlich jedoch bei allen Kontrollen<br />
vor Ort durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahme hat der Zuwendungsempfänger<br />
einen Verwendungsnachweis vorzulegen, der gemäß § 44 LHO und der VV zu §<br />
44 LHO geprüft wird. Dieser umfasst einen Sachbericht und einen rechnerischen<br />
Nachweis.<br />
Berücksichtigung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im Rahmen<br />
der Maßnahme<br />
Entfällt.<br />
Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 85 -<br />
Im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung wird unter anderem die zweckentsprechende,<br />
wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Fördermittel geprüft. Sollten<br />
die Fördermittel oder ein Teil der Fördermittel zweckwidrig verwendet worden sein,<br />
wird der Zuwendungsbescheid aufgehoben und die entsprechenden Fördermittel<br />
werden zurückgefordert. Der zu erstattende Betrag ist mit 3% über dem jeweiligen<br />
Basiszinssatz nach § 1 <strong>des</strong> Diskont-Überleitungsgesetzes jährlich zu verzinsen.<br />
Das Vorgehen richtet sich nach §§ 116,117 und 117a <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>verwaltungsgesetzes.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität auf Ebene <strong>des</strong> Entwicklungsplanes<br />
wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Die Politik zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes ist auf die Wiederherstellung und<br />
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Räume ausgerichtet.<br />
Die mit dieser Maßnahme angestrebten Ziele entsprechen dieser Politik und bilden<br />
auch die Grundlage für eine weitere Entwicklung ländlicher Gemeinden.<br />
Es ist davon auszugehen, dass diese Politik mit Maßnahmen, die im Rahmen der<br />
gemeinsamen Marktorganisation durchgeführt werden, nicht konkurrieren, da sie die<br />
Marktpolitik flankieren und ergänzen soll. Das Programm zum Neubau zentraler öffentlicher<br />
Abwasserbeseitigungsanlagen in ländlichen Gebieten steht daher mit<br />
Maßnahmen der gemeinsamen Marktorganisation im Einklang.<br />
Die reinen nationalen Maßnahmen, die nicht im Rahmen <strong>des</strong> Entwicklungsplanes<br />
durchgeführt werden, sind :<br />
a) Die <strong>Förderung</strong> zentraler Wasserversorgungsanlagen in ländlichen Gemeinden<br />
und die <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> Grundwasserschutzes, welche die Versorgung der Bevölkerung<br />
mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser, die Erhöhung der Lebensqualität<br />
der Bevölkerung in ländlichen Gebieten und die Verbesserung der Infrastruktur,<br />
<strong>des</strong> Weiteren die Sicherung der Grundwasserqualität im Rahmen der Daseinsvorsorge<br />
zum Ziel hat<br />
b) Die <strong>Förderung</strong> der Anpassung von Haus- und Kleinkläranlagen an die allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik, welche den Schutz der Gewässer und die<br />
Schaffung der Voraussetzung für eine Regeneration der Gewässer zum Ziel hat.<br />
Beide Maßnahmen entsprechen ebenfalls der Politik zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Raumes und stehen somit nicht in Widerspruch zu anderen Gemeinschaftspolitiken.<br />
Es ist nicht zu erkennen, dass durch die Durchführung der o.g. Programme ungerechtfertigte<br />
Wettbewerbsverzerrungen hervorgerufen werden.
Stand: 16.07.03<br />
- B 86 -<br />
p: Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und<br />
landwirtschaftsnahen Bereich, um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
oder alternative Einkommensquellen zu<br />
schaffen<br />
Maßnahme p 1:<br />
Um- und Ausbaumaßnahmen von landwirtschaftlichen Gebäuden zur Schaffung<br />
neuer Erwerbsquellen für Landwirte (Dorferneuerung) 1<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen<br />
Bereich, um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative Einkommensquellen<br />
zu schaffen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 7. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 9,37 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 24,42 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
9,87 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.<br />
1 Soweit Maßnahmen betroffen sind, die in den Geltungsbereich der Kapitel I und VII der VO (EG)<br />
Nr. 1257/1999 fallen, müssen die in diesen Kapiteln festgelegten Bedingungen eingehalten werden.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 87 -<br />
Die <strong>Förderung</strong> erfolgt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der<br />
Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes", hier nach den Fördergrundsätzen für die<br />
<strong>Förderung</strong> der Dorferneuerung und der Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher<br />
Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz mit dem Gegenstand der <strong>Förderung</strong>:<br />
Die Fördermittel können verwendet werden für die Finanzierung von Maßnahmen<br />
der Dorferneuerung zur umfassenden Verbesserung der Agrarstruktur<br />
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz.<br />
Zuwendungsfähig im Rahmen der Dorferneuerung sind die Aufwendungen für<br />
Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen)<br />
die Dorferneuerungsplanung; ausgenommen sind Aufwendungen für Pläne, die<br />
gesetzlich vorgeschrieben sind<br />
die Betreuung der Zuwendungsempfänger; ausgenommen ist die Betreuung durch<br />
Stellen der öffentlichen Verwaltung<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse; ausgenommen<br />
sind Aufwendungen in Neubau- und Gewerbegebieten<br />
Maßnahmen zur Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich und zur<br />
Sanierung innerörtlicher Gewässer unter Berücksichtigung der gesamten wasserwirtschaftlichen<br />
Planung<br />
kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung <strong>des</strong><br />
dörflichen Charakters; ausgenommen sind Wasserversorgungs- und Kanalisationsleitungen<br />
mit Nebenbauten in neuen oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten<br />
Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung land- und forstwirtschaftlicher oder<br />
ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzter Bausubstanz mit ortsbildprägendem<br />
Charakter einschließlich der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen<br />
Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche Bausubstanz einschließlich<br />
Hofräume und Nebengebäude an die Erfordernisse zeitgemäßen<br />
Wohnens und Arbeitens anzupassen, vor Einwirkungen von außen zu schützen<br />
oder in das Ortsbild und die Landschaft einzubinden<br />
den Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaftsanlagen<br />
den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich besonders<br />
begründeter Abbruchmaßnahmen im Zusammenhang mit bestimmten Maßnahmen<br />
Zuwendungsfähig im Rahmen der Umnutzung sind die Aufwendungen für:<br />
investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer<br />
Bausubstanz, insbesondere für Wohn-, Handels-, Gewerbe-, Dienstleistungs-,<br />
kulturelle, öffentliche und gemeinschaftliche Zwecke, die dazu dienen, Zusatzeinkommen<br />
zu erschließen<br />
Leistungen von Architekten, Ingenieuren und Betreuern in Verbindung mit den<br />
förderfähigen Maßnahmen
Stand: 16.07.03<br />
- B 88 -<br />
Grundsätzlich können im Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes sowohl Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände als auch natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften<br />
<strong>des</strong> privaten Rechts land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach<br />
den Regelungen der Gemeinschaftsaufgabe als Zuwendungsempfänger fungieren.<br />
Für den Einsatz der <strong>EU</strong>-Mittel sind jedoch nur Maßnahmen in Trägerschaft von Gemeinden<br />
und Gemeindeverbänden vorgesehen. Aus diesem Grunde ist die Beihilfeintensität<br />
regelmäßig mit 100 % anzusetzen.<br />
Eine deutliche Abgrenzung der Interventionen aus dem EAGFL gemäß Artikel 33 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und dem EFRE in dem Bereich Dorferneuerung und<br />
Dorfentwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes wird gewährleistet.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen<br />
zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungseinrichtungen<br />
(z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem Wege<br />
lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 89 -<br />
Eine besondere Chance, den negativen Entwicklungen entgegenzuwirken, bietet die<br />
gezielte <strong>Förderung</strong> zur Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und<br />
landwirtschaftsnahen Bereich, um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten oder<br />
alternative Einkommensquellen zu schaffen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von rd.<br />
8,94 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> durchgeführt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Im Rahmen der Zwischenbewertung <strong>des</strong> Ziel 5b-Programms durch die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft (FAL), deren Wirkungsanalyse sich auf die Untersuchung<br />
der Beschäftigungseffekte der einzelnen Maßnahmen konzentrierte, wurde<br />
für die Dorfentwicklung folgende Feststellung getroffen: „Auf Grund der direkten Beschäftigungseffekte<br />
und der positiven Effekte auf die Beschäftigungssituation von<br />
Frauen sollte eine Verstärkung <strong>des</strong> Mitteleinsatzes im Bereich der Lan<strong>des</strong>dorferneuerung<br />
angestrebt werden, soweit eine Nachfrage besteht. Die Fallstudie ergab in<br />
diesem Bereich erhebliche positive Effekte auf die Situation ländlich geprägter Gemeinden,<br />
die durch kein anderes Instrument im Unterprogramm erreicht werden<br />
können.“<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.
- B 90 -<br />
Zur Erreichung dieser Ziele wird u.a. durch den Mitteleinsatz nach dem Fördergrundsatz<br />
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung in kommunaler Trägerschaft eine Ländliche<br />
Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) durchgeführt. Es handelt sich hierbei<br />
um einen integrierten, d.h. alle entwicklungsbestimmenden Bereiche umfassenden<br />
Ansatz (Ökonomie, Ökologie, Kultur/Soziales). Eine intensive Bürgermitwirkung ist<br />
hierbei von besonderer Bedeutung. Wesentlicher Inhalt der LSE ist die Auseinandersetzung<br />
der Akteure in der Region mit den jeweiligen Stärken und Schwächen, das<br />
Entwickeln von Leitbildern, das Erarbeiten von Entwicklungszielen und die interkommunale<br />
Abstimmung strukturverbessernder Leitprojekte.<br />
Nach einem in der Regel ca. einjährigen Entwicklungsprozess im Rahmen einer LSE<br />
werden die abgestimmten Handlungsfelder und Projekte umgesetzt. Dies geschieht<br />
zum Teil in ortsbezogenen oder überörtlichen Dorfentwicklungsplanungen oder in der<br />
Umsetzung einzelner Leitprojekte.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen die Dörfer und ländlichen Regionen, deren<br />
Entwicklungspotenziale zurzeit nur unzureichend erschlossen sind, Rahmenbedingungen<br />
erhalten, die es den dort lebenden Menschen erlaubt, die auf Grund der naturräumlichen<br />
Ausstattung und der ökonomischen Faktoren möglichen Entwicklungschancen<br />
optimal zu nutzen.<br />
Durch die Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen<br />
Bereich werden landwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Arbeitsplätze<br />
gesichert und geschaffen. Der für viele ländliche Räume typische Charakter<br />
auf Grund der landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Aktivitäten kann auch<br />
zur Attraktivitätssteigerung aus touristischer Sicht beitragen.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der geschaffenen und gesicherten<br />
Arbeitsplätze<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen u.a. im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> ist davon<br />
auszugehen, dass im Bereich der finanziellen Indikatoren die öffentlichen Aufwendungen<br />
wie im Plan dargestellt erfolgen werden. Da ausschließlich Maßnahmen<br />
in kommunaler Trägerschaft kofinanziert werden, ist die Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten nahezu identisch mit den öffentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme<br />
der Kosten verursacht durch die Begünstigten dürfte in etwa 1,5 - 2 x so<br />
hoch sein wie die öffentlichen Aufwendungen insgesamt.<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 91 -<br />
Im Bereich der materiellen Indikatoren werden ca. 30 - 50 Arbeitsplätze gesichert<br />
bzw. geschaffen. Die Anzahl der Projekte dürfte eine Größenordnung von 50 erreichen.<br />
Die Anzahl der Begünstigten wird ebenfalls mit ca. 50 erwartet.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 92 -<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Auf Grund <strong>des</strong> gewählten integrierten Entwicklungsansatzes werden nicht nur Aussagen<br />
getroffen zum engeren Bereich der Dorfentwicklung/Dorferneuerung selbst,<br />
sondern auch zu anderen die ländliche Regionalentwicklung bestimmenden Bereichen<br />
wie z.B. Abwasserbeseitigung, Naturschutz, Landschaftspflege, Flurneuordnung,<br />
Wegebau etc.. Im Rahmen der Umsetzung der investiven Maßnahmen erfolgt<br />
eine regelmäßige Abstimmung (zeitlich und inhaltlich) mit den anderen Maßnahmen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 93 -<br />
Maßnahme p 2:<br />
Um- und Ausbaumaßnahmen von landwirtschaftlichen Gebäuden zur Schaffung<br />
von Erwerbsquellen für Landwirte (Lan<strong>des</strong>maßnahme Dorfentwicklung) 1<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen<br />
Bereich, um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative Einkommensquellen<br />
zu schaffen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 7. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 2,69 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 6,69 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
0,84 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.<br />
1 Soweit Maßnahmen betroffen sind, die in den Geltungsbereich der Kapitel I und VII der VO (EG)<br />
Nr. 1257/1999 fallen, müssen die in diesen Kapiteln festgelegten Bedingungen eingehalten werden.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
- B 94 -<br />
2.2.1 Lan<strong>des</strong>mittel zur Dorfentwicklung<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der Vorschriften<br />
<strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Gefördert werden auf Grund der zugehörigen Zweckbestimmung im Lan<strong>des</strong>haushalt<br />
Maßnahmen mit dem Ziel, eine ganzheitliche Entwicklung ländlicher Räume sicherzustellen.<br />
Das geschieht u.a. durch<br />
Erhaltung und Gestaltung von dörflicher ortsbildprägender oder historisch bedeutender<br />
Bausubstanz durch Um- und Ausbaumaßnahmen außerhalb Landwirtschaft<br />
Modellvorhaben insbesondere mit dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen für<br />
Frauen<br />
Erfolgskontrolle, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien zur <strong>Förderung</strong> der Dorfund<br />
ländlichen Regionalentwicklung vom 25. August 1995 (Amtsbl. S. 687), deren<br />
Neufassung derzeit unter der Beihilfe-Nr. N 326/99 der Kommission zur Notifizierung<br />
vorliegt.<br />
Als Zuwendungsempfänger kommen Gemeinden, Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaften<br />
nach dem Flurbereinigungsgesetz sowie Wasser- und Bodenverbände,<br />
natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften <strong>des</strong> privaten<br />
Rechts, Kirchen und Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts und Verbände<br />
der freien Wohlfahrtspflege in Frage. Die <strong>EU</strong>-Mittel werden ausschließlich<br />
eingesetzt bei Gemeinden und Gemeindeverbänden als Zuwendungsempfänger. Die<br />
Beihilfeintensität beträgt regelmäßig 100 %.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen<br />
zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungsein-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 95 -<br />
richtungen (z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem Wege<br />
lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von rd.<br />
4,44 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> durchgeführt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Im Rahmen der Zwischenbewertung <strong>des</strong> Ziel 5b-Programms durch die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft (FAL), deren Wirkungsanalyse sich auf die Untersuchung<br />
der Beschäftigungseffekte der einzelnen Maßnahmen konzentrierte, wurde<br />
für die Dorfentwicklung folgende Feststellung getroffen: „Auf Grund der direkten Beschäftigungseffekte<br />
und der positiven Effekte auf die Beschäftigungssituation von<br />
Frauen sollte eine Verstärkung <strong>des</strong> Mitteleinsatzes im Bereich der Lan<strong>des</strong>dorferneuerung<br />
angestrebt werden, soweit eine Nachfrage besteht. Die Fallstudie ergab in<br />
diesem Bereich erhebliche positive Effekte auf die Situation ländlich geprägter Gemeinden,<br />
die durch kein anderes Instrument im Unterprogramm erreicht werden<br />
können.“
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 96 -<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.<br />
Zur Erreichung dieser Ziele wird u.a. durch den Mitteleinsatz nach dem Fördergrundsatz<br />
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung in kommunaler Trägerschaft eine Ländliche<br />
Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) durchgeführt. Es handelt sich hierbei<br />
um einen integrierten, d.h. alle entwicklungsbestimmenden Bereiche umfassenden<br />
Ansatz (Ökonomie, Ökologie, Kultur/Soziales). Eine intensive Bürgermitwirkung ist<br />
hierbei von besonderer Bedeutung. Wesentlicher Inhalt der LSE ist die Auseinandersetzung<br />
der Akteure in der Region mit den jeweiligen Stärken und Schwächen, das<br />
Entwickeln von Leitbildern, das Erarbeiten von Entwicklungszielen und die interkommunale<br />
Abstimmung strukturverbessernder Leitprojekte.<br />
Nach einem in der Regel ca. einjährigen Entwicklungsprozess im Rahmen einer LSE<br />
werden die abgestimmten Handlungsfelder und Projekte umgesetzt. Dies geschieht<br />
zum Teil in ortsbezogenen oder überörtlichen Dorfentwicklungsplanungen oder in der<br />
Umsetzung einzelner Leitprojekte.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen die Dörfer und ländlichen Regionen, deren<br />
Entwicklungspotenziale zurzeit nur unzureichend erschlossen sind, Rahmenbedingungen<br />
erhalten, die es den dort lebenden Menschen erlaubt, die auf Grund der naturräumlichen<br />
Ausstattung und der ökonomischen Faktoren möglichen Entwicklungschancen<br />
optimal zu nutzen.<br />
Die Maßnahme trägt dazu bei, vorhandene Arbeitsplätze durch Diversifizierung der<br />
Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich zu unterstützen,<br />
soweit diese nicht aus Mitteln der GAK förderfähig sind.
Quantitative Indikatoren<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 97 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der geschaffenen und gesicherten<br />
Arbeitsplätze<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen u.a. im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> ist davon<br />
auszugehen, dass im Bereich der finanziellen Indikatoren die öffentlichen Aufwendungen<br />
wie im Plan dargestellt erfolgen werden. Da ausschließlich Maßnahmen<br />
in kommunaler Trägerschaft kofinanziert werden, ist die Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten nahezu identisch mit den öffentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme<br />
der Kosten verursacht durch die Begünstigten dürfte in etwa 1,5 - 2 x so<br />
hoch sein wie die öffentlichen Aufwendungen insgesamt.<br />
Im Bereich der materiellen Indikatoren werden ca. 30 Arbeitsplätze gesichert bzw.<br />
geschaffen. Die Anzahl der Projekte dürfte eine Größenordnung von 100 erreichen.<br />
Die Anzahl der Begünstigten wird mit ca. 80 erwartet.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).<br />
Im Rahmen dieser Maßnahme wird die Weiterbildung und Fortbildung, die Erarbeitung<br />
von Konzepten und die Durchführung von Investitionen gefördert, soweit sie in<br />
kommunaler Trägerschaft erfolgen. Dies dient in erster Linie dazu, vorhandene Arbeitsplätze<br />
zu sichern und insbesondere auch qualifizierte Arbeitsplätze im ländlichen<br />
Raum zu schaffen, um der Abwanderung von beruflich qualifizierten Bevölkerungsgruppen<br />
entgegenzuwirken.
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 98 -<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Diese Maßnahme unterstützt die Maßnahme p 1 bei den Projekten, die in der Region<br />
als strukturverbessernd erkannt wurden, die in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden sollen, jedoch nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung<br />
der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes" förderungsfähig sind.<br />
Grundlage für die <strong>Förderung</strong> ist auch hier ein integrierter Entwicklungsansatz im<br />
Rahmen der Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalysen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 99 -<br />
r: Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der<br />
Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur<br />
Maßnahme r 1:<br />
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen und ländliche Struktur- und Entwicklungsanalysen<br />
(Dorferneuerung)<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen<br />
Infrastruktur<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 9. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 2,35 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 5,85 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
2,47 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 100 -<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes"<br />
gemäß den „Grundsätzen für die <strong>Förderung</strong> der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung“<br />
insbesondere zur Erarbeitung Ländlicher Struktur- und Entwicklungsanalysen<br />
(LSE).<br />
Eine deutliche Abgrenzung der Interventionen aus dem EAGFL gemäß Artikel 33 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und dem EFRE in dem Bereich Entwicklung und<br />
Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur<br />
wird gewährleistet.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen<br />
zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungseinrichtungen<br />
(z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem We-
Stand: 16.07.03<br />
- B 101 -<br />
ge lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von rd.<br />
2,22 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> durchgeführt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens im Auftrage <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>ministeriums für<br />
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit dem Titel „Effizienz und Handlungsbedarf<br />
der <strong>Förderung</strong> der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP)“ wird durch die<br />
westfälische Wilhelms-Universität Münster Folgen<strong>des</strong> festgestellt: „Das Forschungsvorhaben<br />
hat die große Bedeutung der AEP für die integrierte Entwicklung ländlicher<br />
Räume unterstrichen und aufgezeigt, dass auch bei zukünftig zunehmendem Bedarf<br />
an raumbezogenen Strategien und Konzepten zur integrierten ländlichen Entwicklung<br />
dem Planungsinstrument grundsätzlich eine hohe Wertigkeit zugewiesen werden<br />
muss. Ihr Stellenwert erwächst aber aus ihren konkreten Raum- und Problembezügen,<br />
aus ihrer Querschnittorientierung und Flexibilität sowie nicht zuletzt aus<br />
den Möglichkeiten, in einem offenen Planungsprozess die „bottom up“-Strategien<br />
nachhaltige Entwicklung und Planung im eigenen Verfahren mit Leben zu füllen.“ Der<br />
zugehörige Endbericht ist erschienen im Februar 2000.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 102 -<br />
Zur Erreichung dieser Ziele wird u.a. durch den Mitteleinsatz nach dem Fördergrundsatz<br />
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung in kommunaler Trägerschaft eine Ländliche<br />
Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) durchgeführt. Es handelt sich hierbei<br />
um einen integrierten, d.h. alle entwicklungsbestimmenden Bereiche umfassenden<br />
Ansatz (Ökonomie, Ökologie, Kultur/Soziales). Eine intensive Bürgermitwirkung ist<br />
hierbei von besonderer Bedeutung. Wesentlicher Inhalt der LSE ist die Auseinandersetzung<br />
der Akteure in der Region mit den jeweiligen Stärken und Schwächen, das<br />
Entwickeln von Leitbildern, das Erarbeiten von Entwicklungszielen und die interkommunale<br />
Abstimmung strukturverbessernder Leitprojekte.<br />
Nach einem in der Regel ca. einjährigen Entwicklungsprozess im Rahmen einer LSE<br />
werden die abgestimmten Handlungsfelder und Projekte umgesetzt. Dies geschieht<br />
zum Teil in ortsbezogenen oder überörtlichen Dorfentwicklungsplanungen oder in der<br />
Umsetzung einzelner Leitprojekte.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Erarbeitung Ländlicher Struktur- und Entwicklungsanalysen wird eine von den<br />
Menschen in der jeweiligen Region entwickelte Grundlage geschaffen, um erarbeitete<br />
Entwicklungsziele durch geförderte und nicht geförderte Maßnahmen zu realisieren.<br />
Die eigentliche Wirkung im Hinblick auf eine nachhaltige Strukturverbesserung<br />
erfolgt durch die Kombination der anderen Maßnahmen im Rahmen der Dorf- und<br />
ländlichen Regionalentwicklung.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der Begünstigten<br />
Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen u.a. im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> ist davon<br />
auszugehen, dass im Bereich der finanziellen Indikatoren die öffentlichen Aufwendungen<br />
wie im Plan dargestellt erfolgen werden. Da ausschließlich Maßnahmen<br />
in kommunaler Trägerschaft kofinanziert werden, ist die Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten nahezu identisch mit den öffentlichen Aufwendungen.
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 103 -<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 104 -<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Auf Grund <strong>des</strong> gewählten integrierten Entwicklungsansatzes werden nicht nur Aussagen<br />
getroffen zum engeren Bereich der Dorfentwicklung/Dorferneuerung selbst,<br />
sondern auch zu anderen die ländliche Regionalentwicklung bestimmenden Bereichen<br />
wie z.B. Abwasserbeseitigung, Naturschutz, Landschaftspflege, Flurneuordnung,<br />
Wegebau etc..
Maßnahme r 2:<br />
Ländlicher Wegebau<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 105 -<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen<br />
Infrastruktur<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 9. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 4,08 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen (Aufwendungen <strong>des</strong> öffentlich-rechtlichen<br />
Trägers) sollen im Rahmen <strong>des</strong> Entwicklungsplanes für diese<br />
Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe von 10,22 Mio. E getätigt<br />
werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich werden das Land (GAK) und die öffentlich-rechtlichen Träger für<br />
diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage (s. Ziff. 11) nationale öffentliche<br />
Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von 32,4 Mio. E tätigen.<br />
Die Durchführung und die Finanzierung der Maßnahmen innerhalb und außerhalb<br />
<strong>des</strong> ZAL geschieht für den Träger zu den gleichen Modalitäten und Bedingungen.<br />
Inhaltliche Unterschiede wird es nicht geben. Die Zuordnung zu den beiden Bereichen<br />
wird nach kommunalen Gebietskörperschaften und nach dem Umfang <strong>des</strong> Finanzplanes<br />
lt. Entwicklungsplan vorgenommen werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Beihilfeintensität von 100 % ergibt sich aus den unter 2.2 genannten Rechtsgrundlagen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 106 -<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong> der Flurbereinigung<br />
und <strong>des</strong> ländlichen Wegebaus - Teil C Ländlicher Wegebau - <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans<br />
nach der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong><br />
Küstenschutzes" (GAK).<br />
Abweichend von den Fördergrundsätzen wird zurzeit die max. Beihilfenhöhe von<br />
60 % nur in Höhe von 40 % ausgeschöpft und eine Eigenleistung von 60 % verlangt.<br />
Die Maßnahme beinhaltet die Befestigung vorhandener, nicht oder nicht ausreichend<br />
befestigter landwirtschaftlicher Wege sowie die Randgestaltung durch Begleitgrün<br />
und die Durchführung erforderlicher landschaftspflegerischer Ausgleichsmaßnahmen.<br />
In Einzelfällen wird hierbei auch ein Neubau und Grunderwerb erforderlich<br />
sein.<br />
Im Förderzeitraum werden die landwirtschaftlichen Wege den heutigen Erfordernissen<br />
angepasst. Gefördert werden bevorzugt die Gemeinden, in denen zugleich andere<br />
Vorhaben sowie andere Maßnahmen zur Landentwicklung durchgeführt werden.<br />
Die Planung erfolgt durch die Kreise in Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden.<br />
Eine deutliche Abgrenzung der Interventionen aus dem EAGFL gemäß Artikel 33 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und dem EFRE in den Bereichen<br />
Dorferneuerung und Dorfentwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Kulturerbes<br />
Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen<br />
Bereich, um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative Einkommensquellen<br />
zu schaffen<br />
Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen<br />
Infrastruktur<br />
wird gewährleistet.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt.
3. Spezifische Informationen:<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 107 -<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In vielen Gemeinden in Schleswig-Holstein entspricht ein großer Teil der land- und<br />
forstwirtschaftlichen Wege, die in den 50er und 60er Jahren ausgebaut und befestigt<br />
wurden oder <strong>bis</strong>her unbefestigt geblieben sind, nicht den heutigen Verkehrsanforderungen.<br />
Durch die immer größeren und schwereren Maschinen werden die vorhandenen<br />
Wegebefestigungen zerstört. Sie können nicht mit normalem Unterhaltungsaufwand<br />
in einem verkehrsgerechten Zustand erhalten werden, weil die Tragfähigkeit im Unterbau<br />
nicht ausreicht.<br />
Schleswig-Holstein verfügt über eine leistungsfähige Landwirtschaft, die weitere<br />
Kosten senkende Effekte nur durch Rationalisierungen und überbetriebliche Maßnahmen<br />
zur Strukturverbesserung erhalten kann.<br />
Verbesserungen und Entwicklungsmöglichkeiten der ländlichen Räume ergeben sich<br />
aus einer Veränderung und Optimierung der Wegenetze. Dies führt auch langfristig<br />
zur Energieeinsparung.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Für die Maßnahme k 1 und r 2 sind von 1994 - 1999 öffentliche Aufwendungen in<br />
Höhe von rd. 69 Mio. E getätigt worden. (k 1 und r 2 waren lt. EPPD von 1994 in einem<br />
Finanzplan zusammengefasst.)<br />
Die Maßnahme war bereits Bestandteil der vorangegangenen Förderprogramme.<br />
Hierdurch wurde den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und<br />
Rendsburg-Eckernförde (5b-Gebiet) eine wesentliche Verbesserung ihres ländlichen<br />
Wegenetzes ermöglicht. In der Förderperiode 1994 - 1999 umfasste diese eine Länge<br />
von rd. 910 km.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Auf die Evaluierung <strong>des</strong> vorangegangenen Ziel 5b-Programmes wird hingewiesen.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Es ist dringend geboten, diese Wege zu verstärken und den heutigen Verkehrsbelastungen<br />
anzupassen. Dabei handelt es sich um die Befestigung vorhandener, <strong>bis</strong>her<br />
nicht oder nicht ausreichend befestigter Wege unter Berücksichtigung landschaftspflegerischer<br />
Gesichtspunkte, mit einer Länge von rd. 200 km.
Stand: 16.07.03<br />
- B 108 -<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Durch die Maßnahmen wird die Infrastruktur <strong>des</strong> ländlichen Raumes zu den Wohnund<br />
Betriebsstandorten und gewerblichen Einrichtungen sowie für den Naherholungs-<br />
und Fremdenverkehr verbessert. Um das Wegenetz an die heutigen Anforderungen<br />
anzupassen, ist eine weitere <strong>Förderung</strong> dieser Maßnahme dringend erforderlich.<br />
Verkehrslenkende und -sichernde Effekte werden herbeigeführt.<br />
Voraussetzung für eine rationelle Landbewirtschaftung der ländlichen Räume und für<br />
den Ver- und Entsorgungsverkehr zu Wohn- und landwirtschaftlichen Betriebsstandorten<br />
und gewerblichen Einrichtungen sowie als Erschließung für den Naherholungsund<br />
Fremdenverkehr ist ein leistungsfähiges und verkehrsgerecht ausgebautes Wegenetz,<br />
das unter Berücksichtigung landschaftspflegerischer Gesichtspunkte gestaltet<br />
wird.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: <br />
Anzahl der Begünstigten<br />
km Wegebau auf neuer Trasse<br />
km Befestigung vorhandener Wege<br />
km Wegebau mit Bindemitteln (Beton, Bitumen)<br />
km Wegebau ohne Bindemittel<br />
ha landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Neustrukturierung und der Ausbau der Wege erfolgt in enger Kooperation der<br />
zuständigen Stellen unter Beachtung umweltpolitischer Erfordernisse. Die Maßnahmen<br />
sind geeignet, Kosten senkende Effekte für die Landwirtschaft, ökologische<br />
Verbesserungen für den Landschaftshaushalt sowie Verbesserungen für die ländliche<br />
Infrastruktur auch im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten im Tourismus<br />
herbeizuführen.
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 109 -<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 (S. Fehler! Textmarke nicht definiert.)<br />
verwiesen.<br />
Die Maßnahmen werden von den Kreisen/Gemeinden (Zuwendungsempfänger) geplant,<br />
durchgeführt und finanziert. In den nationalen Aufwendungen sind die Eigenleistungen<br />
<strong>des</strong> Zuwendungsempfängers enthalten, da es sich um finanzielle Leistungen<br />
einer Körperschaft <strong>des</strong> öffentlichen Rechts handelt, die in Ausübung öffentlicher<br />
Belange verwendet werden.<br />
Zahlung durch Beauftragten der ÄLR als Zahlstelle.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Sie regelt durch Dienstanweisung, dass die umsetzenden Behörden (Ämter für ländliche<br />
Räume) die erforderlichen Informationen einschließlich der Indikatoren formund<br />
fristgerecht vorgelegt werden. Die zuständige Stelle fasst die gelieferten Daten<br />
in einem Lagebericht zusammen.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Zusätzlich wird die Öffentlichkeit maßnahmenspezifisch durch Presseinformationen<br />
und andere geeignete Maßnahmen über die Projekte unterrichtet.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben. Insbesondere ist die Berücksichtigung<br />
<strong>des</strong> Umweltschutzes sichergestellt, da die Kreise als Antragsteller zugleich<br />
„untere Naturschutzbehörden“ sind.
Stand: 16.07.03<br />
- B 110 -<br />
Die Wegebaumaßnahmen werden mit den zuständigen Stellen <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong><br />
abgestimmt und ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen festgelegt und durchgeführt.<br />
Die <strong>Förderung</strong> erfolgt nach den selben Bedingungen s. Nr. 2.2. Die Kontrolle<br />
erfolgt im Zuge <strong>des</strong> Verwendungsverfahrens.
Stand: 16.07.03<br />
- B 111 -<br />
s: <strong>Förderung</strong> von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten<br />
Maßnahme s 1:<br />
Fremdenverkehrliche Maßnahmen innerhalb der dörflichen Siedlungsbereiche<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
<strong>Förderung</strong> von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 10. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 2,33 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 5,85 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
2,47 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 112 -<br />
Die <strong>Förderung</strong> erfolgt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der<br />
Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes", hier nach den Fördergrundsätzen für die<br />
<strong>Förderung</strong> der Dorferneuerung und der Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher<br />
Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz mit dem Gegenstand der <strong>Förderung</strong>:<br />
Die Fördermittel können verwendet werden für die Finanzierung von Maßnahmen<br />
der Dorferneuerung zur umfassenden Verbesserung der Agrarstruktur<br />
Zuwendungsfähig im Rahmen der Dorferneuerung sind die Aufwendungen für<br />
Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen)<br />
kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung <strong>des</strong><br />
dörflichen Charakters; ausgenommen sind Wasserversorgungs- und Kanalisationsleitungen<br />
mit Nebenbauten in neuen oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten<br />
Zuwendungsfähig im Rahmen der Umnutzung sind die Aufwendungen für Leistungen<br />
von Architekten, Ingenieuren und Betreuern in Verbindung mit den förderfähigen<br />
Maßnahmen.<br />
Grundsätzlich können im Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes sowohl Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände als auch natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften<br />
<strong>des</strong> privaten Rechts land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach<br />
den Regelungen der Gemeinschaftsaufgabe als Zuwendungsempfänger fungieren.<br />
Für den Einsatz der <strong>EU</strong>-Mittel sind jedoch nur Maßnahmen in Trägerschaft von Gemeinden<br />
und Gemeindeverbänden vorgesehen. Aus diesem Grunde ist die Beihilfeintensität<br />
regelmäßig mit 100 % anzusetzen.<br />
Eine deutliche Abgrenzung der Interventionen aus dem EAGFL gemäß Artikel 33 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und dem EFRE in dem Bereich Dorferneuerung und<br />
Dorfentwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen Kulturerbes wird gewährleistet.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen<br />
zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.
Stand: 16.07.03<br />
- B 113 -<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungseinrichtungen<br />
(z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem Wege<br />
lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von rd.<br />
2,22 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> durchgeführt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Im Rahmen der Zwischenbewertung <strong>des</strong> Ziel 5b-Programms durch die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft (FAL), deren Wirkungsanalyse sich auf die Untersuchung<br />
der Beschäftigungseffekte der einzelnen Maßnahmen konzentrierte, wurde<br />
für die Dorfentwicklung folgende Feststellung getroffen: „Auf Grund der direkten Beschäftigungseffekte<br />
und der positiven Effekte auf die Beschäftigungssituation von<br />
Frauen sollte eine Verstärkung <strong>des</strong> Mitteleinsatzes im Bereich der Lan<strong>des</strong>dorferneuerung<br />
angestrebt werden, soweit eine Nachfrage besteht. Die Fallstudie ergab in<br />
diesem Bereich erhebliche positive Effekte auf die Situation ländlich geprägter Ge-
Stand: 16.07.03<br />
- B 114 -<br />
meinden, die durch kein anderes Instrument im Unterprogramm erreicht werden<br />
können.“<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.<br />
Zur Erreichung dieser Ziele wird u.a. durch den Mitteleinsatz nach dem Fördergrundsatz<br />
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung in kommunaler Trägerschaft eine Ländliche<br />
Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) durchgeführt. Es handelt sich hierbei<br />
um einen integrierten, d.h. alle entwicklungsbestimmenden Bereiche umfassenden<br />
Ansatz (Ökonomie, Ökologie, Kultur/Soziales). Eine intensive Bürgermitwirkung ist<br />
hierbei von besonderer Bedeutung. Wesentlicher Inhalt der LSE ist die Auseinandersetzung<br />
der Akteure in der Region mit den jeweiligen Stärken und Schwächen, das<br />
Entwickeln von Leitbildern, das Erarbeiten von Entwicklungszielen und die interkommunale<br />
Abstimmung strukturverbessernder Leitprojekte.<br />
Nach einem in der Regel ca. einjährigen Entwicklungsprozess im Rahmen einer LSE<br />
werden die abgestimmten Handlungsfelder und Projekte umgesetzt. Dies geschieht<br />
zum Teil in ortsbezogenen oder überörtlichen Dorfentwicklungsplanungen oder in der<br />
Umsetzung einzelner Leitprojekte.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen vorhandene Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten<br />
weiter entwickelt und verbessert und vorhandene Fremdenverkehrsund<br />
Handwerkstätigkeiten stabilisiert werden.<br />
Auf Grund <strong>des</strong> beschriebenen integrierten Entwicklungsansatzes ist zu erwarten,<br />
dass auf Grund der Vorarbeiten und der beabsichtigten geförderten Investitionen<br />
neue Kooperationen zwischen den verschiedenen privaten und öffentlichen Einrichtungen<br />
im Bereich von Fremdenverkehr und Handwerk entstehen. Dies führt zu einer<br />
Stabilisierung der Strukturen und stellt eine nachhaltige Effizienzverbesserung dar. In<br />
den Sektoren Fremdenverkehr und Handwerk können damit vorhandene Arbeitsplätze<br />
gesichert und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.<br />
Quantitative Indikatoren
Stand: 16.07.03<br />
- B 115 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der geschaffenen und gesicherten<br />
Arbeitsplätze<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen u.a. im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> ist davon<br />
auszugehen, dass im Bereich der finanziellen Indikatoren die öffentlichen Aufwendungen<br />
wie im Plan dargestellt erfolgen werden. Da ausschließlich Maßnahmen<br />
in kommunaler Trägerschaft kofinanziert werden, ist die Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten nahezu identisch mit den öffentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme<br />
der Kosten verursacht durch die Begünstigten dürfte in etwa 1,5 - 2 x so<br />
hoch sein wie die öffentlichen Aufwendungen insgesamt.<br />
Im Bereich der materiellen Indikatoren werden ca. 30 - 50 Arbeitsplätze gesichert<br />
bzw. geschaffen. Die Anzahl der Projekte dürfte eine Größenordnung von 30 erreichen.<br />
Die Anzahl der Begünstigten wird mit ca. 30 erwartet.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung
Stand: 16.07.03<br />
- B 116 -<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Auf Grund <strong>des</strong> gewählten integrierten Entwicklungsansatzes werden nicht nur Aussagen<br />
getroffen zum engeren Bereich der Dorfentwicklung/Dorferneuerung selbst,<br />
sondern auch zu anderen die ländliche Regionalentwicklung bestimmenden Bereichen<br />
wie z.B. Abwasserbeseitigung, Naturschutz, Landschaftspflege, Flurneuordnung,<br />
Wegebau etc.. Im Rahmen der Umsetzung der investiven Maßnahmen erfolgt<br />
eine regelmäßige Abstimmung (zeitlich und inhaltlich) mit den anderen Maßnahmen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 117 -<br />
Maßnahme s 2:<br />
<strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> ländlichen Fremdenverkehrs einschließlich Urlaub auf dem<br />
Bauernhof 1<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
<strong>Förderung</strong> von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 10. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 4,98 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 12,47 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
1,12 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Da die <strong>EU</strong>-Mittel ausschließlich für Projekte in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden, kommen Maßnahmen nicht in Betracht, die in den Geltungsbereich von<br />
Stützungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Marktorganisationen fallen.<br />
1 Soweit Maßnahmen betroffen sind, die in den Geltungsbereich der Kapitel I und VII der VO (EG)<br />
Nr. 1257/1999 fallen, müssen die in diesen Kapiteln festgelegten Bedingungen eingehalten werden.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 118 -<br />
2.2.1 Lan<strong>des</strong>mittel zur Dorfentwicklung<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der Vorschriften<br />
<strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Gefördert werden auf Grund der zugehörigen Zweckbestimmung im Lan<strong>des</strong>haushalt<br />
Maßnahmen mit dem Ziel, eine ganzheitliche Entwicklung ländlicher Räume sicherzustellen.<br />
Das geschieht u.a. durch<br />
Erhaltung und Gestaltung von dörflicher ortsbildprägender oder historisch bedeutender<br />
Bausubstanz durch Um- und Ausbaumaßnahmen außerhalb Landwirtschaft<br />
Sicherung und Weiterentwicklung dorfgemäßer Einrichtungen zur Verbesserung<br />
der Lebensverhältnisse der dörflichen Bevölkerung<br />
Modellvorhaben insbesondere mit dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen für<br />
Frauen<br />
Erfolgskontrolle, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien zur <strong>Förderung</strong> der Dorfund<br />
ländlichen Regionalentwicklung vom 25. August 1995 (Amtsbl. S. 687), deren<br />
Neufassung derzeit unter der Beihilfe-Nr. N 326/99 der Kommission zur Notifizierung<br />
vorliegt.<br />
Als Zuwendungsempfänger kommen ausschließlich Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
in Frage. Die Beihilfeintensität beträgt regelmäßig 100 %.<br />
2.2.2 Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof<br />
Es werden ausschließlich infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen gefördert gemäß<br />
der Zweckbestimmung im Lan<strong>des</strong>haushalt als:<br />
Kleinere fremdenverkehrliche Erschließungsmaßnahmen, soweit sie nicht aus anderen<br />
Förderprogrammen finanziert werden können.<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der Vorschriften<br />
<strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung. Als Zuwendungsempfänger kommen<br />
ausschließlich Gemeinden und Gemeindeverbände in Frage. Aus diesem Grunde ist<br />
die Beihilfeintensität regelmäßig mit 100 % anzusetzen.<br />
2.2.3 <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> Fremdenverkehrs im ländlichen Raum<br />
Gefördert werden Projekte aus solchen touristischen Marktsegmenten, die besonders<br />
für den ländlichen Raum geeignet sind (Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung<br />
von Konzepten für Fahrrad-, Wander-, Reit-, Angel- und Kanutourismus sowie<br />
von Kulturtourismus im ländlichen Raum; Aufbau leistungsfähiger Organisationsstrukturen<br />
für das touristische Marketing im ländlichen Raum).
Stand: 16.07.03<br />
- B 119 -<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt im Rahmen der Vorschriften <strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Als Zuwendungsempfänger kommen Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
sowie andere öffentlich-rechtliche Träger (z.B. Industrie- und Handelskammern)<br />
in Betracht. Aus diesem Grunde ist die Beihilfeintensität regelmäßig<br />
mit 100 % anzusetzen.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
In Schleswig-Holstein konnte das zentrale Anliegen der Lan<strong>des</strong>entwicklungspolitik,<br />
möglichst gleichwertige und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan<strong>des</strong>teilen<br />
zu schaffen, noch nicht verwirklicht werden. Bestehende Disparitäten hinsichtlich<br />
Arbeitsplatz- und Dienstleistungsangebot, öffentlicher Daseinsfürsorge sowie<br />
gesunder Umweltbedingungen konnten noch nicht ausgeglichen werden. Im<br />
ländlichen Raum führt das fehlende Angebot an qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen<br />
zur Abwanderung von jungen Menschen und führt zu einer nachteiligen<br />
Entwicklung der demografischen Situation.<br />
Daneben sind die ländlichen Räume gekennzeichnet durch den Rückgang landwirtschaftlicher<br />
Betriebe bei gleichzeitig fehlenden Ersatzarbeitsplätzen und den Rückzug<br />
von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen und Dienstleistungseinrichtungen<br />
(z.B. Post, Banken, Sparkassen etc.). Die Entwicklung der letzten Jahre<br />
hat dazu beigetragen, in vielen Gemeinden das Steueraufkommen weiter zu mindern<br />
und die Wirtschaftskraft zunehmend zu schwächen. Die Disparität gegenüber den<br />
Städten und Ballungszentren konnte nicht im wünschenswerten Umfang ausgeglichen<br />
werden. Zur Erschließung der im ländlichen Raum vorhandenen Entwicklungspotenziale<br />
bedarf es für die notwendige Anpassung und Umorientierung gezielter<br />
Hilfen mit Anstoßwirkung. Das Förderkonzept muss <strong>des</strong>halb in starkem Maße auf die<br />
Entwicklung der „endogenen“ Kräfte setzen. Ungenutzte Potenziale und Kapazitäten,<br />
brachliegende Fähigkeiten sowie wirtschaftliche, kulturelle und soziale Innovationen<br />
sind aufzugreifen und im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte in Handlungen<br />
umzusetzen. Dies erfordert Stärken-Schwächen-Analysen, die eine ganzheitliche<br />
Betrachtung der Region erlauben. Als geeignetes Förderinstrument hat sich die Dorfund<br />
ländliche Regionalentwicklung erwiesen. Sie kann in besonderem Maße Hilfestellung<br />
dafür sein, regionale und örtliche Eigenarten und die damit verbundenen<br />
wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten zu betonen und zur Entfaltung zu bringen und<br />
somit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum und das Verantwortungsgefühl<br />
für die Gestaltung zukünftiger Maßnahmen zu erhöhen. Auf diesem Wege<br />
lassen sich regionsspezifische Lösungen erzielen, die zu einem effizienten und<br />
effektiven Mitteleinsatz führen.<br />
Der Tourismus hat in Schleswig-Holstein eine enorm hohe wirtschaftliche Bedeutung:<br />
4,6 % <strong>des</strong> Volkseinkommens <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> werden im Tourismus erwirtschaftet.<br />
Gerade in den strukturschwachen ländlichen Regionen werden noch deutlich höhere<br />
Wertschöpfungseffekte erzielt.
Stand: 16.07.03<br />
- B 120 -<br />
Der Tourismus bietet besondere Entwicklungspotenziale für ländliche Regionen, die<br />
vom Strukturwandel in der Landwirtschaft betroffen sind. Diese Potenziale kommen<br />
vor allem der ortsansässigen Bevölkerung zugute (insbesondere auch Frauen).<br />
Der Tourismus befindet sich in Schleswig-Holstein derzeit in einer sehr schwierigen<br />
Lage durch rückläufige Übernachtungszahlen, schwierige Rahmenbedingungen für<br />
ein weiteres touristisches Wachstum und den anhaltenden Trend zum Auslandsurlaub.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von rd.<br />
5,94 Mio. E getätigt.<br />
Die vorgeschlagene Maßnahme wurde bereits in der Förderperiode 1994 - 1999 zum<br />
Teil im Rahmen der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> durchgeführt.<br />
Durch die Kofinanzierung der <strong>EU</strong> war es <strong>bis</strong>her möglich, in den vier nördlichen Kreisen<br />
Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde<br />
Dorfentwicklungsplanungen und einzelne Leitprojekte auf der Grundlage Ländlicher<br />
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen. Hierdurch konnte im nördlichen<br />
Lan<strong>des</strong>teil die interkommunale Zusammenarbeit nachhaltig verbessert sowie in einigen<br />
Gemeinden und Regionen dieses Lan<strong>des</strong>teils die Infrastruktur weiter entwickelt<br />
werden.<br />
Die Lan<strong>des</strong>regierung verfolgt seit 1990 eine systematische Tourismuskonzeption, in<br />
deren Mittelpunkt die Strategie eines sanften/nachhaltigen Tourismus steht; dabei<br />
sind Weiterentwicklungen <strong>des</strong> Tourismus gewünscht und notwendig, weil dieser<br />
Wirtschaftszweig eine große ökonomische Bedeutung für Schleswig-Holstein hat.<br />
Diese Tourismuskonzeption ist im weitgehenden Konsens mit allen tourismusrelevanten<br />
Organisationen und Institutionen (Tourismusverbände, Hotel- und Gaststättenverband,<br />
Industrie- und Handelskammern, kommunale Lan<strong>des</strong>verbände, Naturund<br />
Umweltschutzverbände, Verbraucherverbände, Kulturverbände, Jugendverbände,<br />
Kirchen etc.) erstellt worden.<br />
Die Tourismuskonzeption ist systematisch umgesetzt worden.<br />
Beispielhaft seien genannt: die Einleitung einer Qualitäts- und Dienstleistungsoffensive<br />
im Tourismus Schleswig-Holsteins; Qualitätsverbesserungen in der touristischen<br />
Infrastruktur; Unterstützung <strong>des</strong> Fahrradtourismus sowie weiterer spezieller Marktsegmente<br />
<strong>des</strong> Tourismus (Reittourismus, Kulturtourismus, Wohnmobiltourismus<br />
etc.); Touristische Verkehrskonzepte für Schleswig-Holstein zur Verminderung der<br />
Verkehrsbelastung in Urlaubsregionen.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Im Rahmen der Zwischenbewertung <strong>des</strong> Ziel 5b-Programms durch die Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft (FAL), deren Wirkungsanalyse sich auf die Untersuchung<br />
der Beschäftigungseffekte der einzelnen Maßnahmen konzentrierte, wurde<br />
für die Dorfentwicklung folgende Feststellung getroffen: „Auf Grund der direkten Be-
Stand: 16.07.03<br />
- B 121 -<br />
schäftigungseffekte und der positiven Effekte auf die Beschäftigungssituation von<br />
Frauen sollte eine Verstärkung <strong>des</strong> Mitteleinsatzes im Bereich der Lan<strong>des</strong>dorferneuerung<br />
angestrebt werden, soweit eine Nachfrage besteht. Die Fallstudie ergab in<br />
diesem Bereich erhebliche positive Effekte auf die Situation ländlich geprägter Gemeinden,<br />
die durch kein anderes Instrument im Unterprogramm erreicht werden<br />
können.“<br />
Da der Haushaltstitel <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> „Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
<strong>des</strong> Tourismus“ erst 1998 neu eingerichtet wurde, liegen noch keine Bewertungsergebnisse<br />
in diesem Bereich vor.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit dem Programm der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung wird in erster Linie<br />
das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu sichern bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus soll durch eine verbesserte<br />
Grundversorgung die Lebens- und Wohnqualität in den ländlichen Räumen nachhaltig<br />
verbessert werden. Auf Grund der kleinteiligen Gemein<strong>des</strong>truktur und der damit<br />
verbundenen relativ geringen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist es wichtig, im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Förderprogrammes Kooperationsprojekte sowohl der Gemeinden untereinander<br />
als auch zwischen Gemeinden und privaten Einrichtungen zu initiieren.<br />
Der Umfang der zur Erreichung dieser Ziele beteiligten Dörfer kann zurzeit nur geschätzt<br />
werden. Auf Grund der <strong>bis</strong>herigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass<br />
in ca. 50 ländlichen Regionen mit insgesamt 500 Dörfern Verbesserungsmaßnahmen<br />
erfolgen.<br />
Zur Erreichung dieser Ziele wird u.a. durch den Mitteleinsatz nach dem Fördergrundsatz<br />
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung in kommunaler Trägerschaft eine Ländliche<br />
Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) durchgeführt. Es handelt sich hierbei<br />
um einen integrierten, d.h. alle entwicklungsbestimmenden Bereiche umfassenden<br />
Ansatz (Ökonomie, Ökologie, Kultur/Soziales). Eine intensive Bürgermitwirkung ist<br />
hierbei von besonderer Bedeutung. Wesentlicher Inhalt der LSE ist die Auseinandersetzung<br />
der Akteure in der Region mit den jeweiligen Stärken und Schwächen, das<br />
Entwickeln von Leitbildern, das Erarbeiten von Entwicklungszielen und die interkommunale<br />
Abstimmung strukturverbessernder Leitprojekte.<br />
Nach einem in der Regel ca. einjährigen Entwicklungsprozess im Rahmen einer LSE<br />
werden die abgestimmten Handlungsfelder und Projekte umgesetzt. Dies geschieht<br />
zum Teil in ortsbezogenen oder überörtlichen Dorfentwicklungsplanungen oder in der<br />
Umsetzung einzelner Leitprojekte.<br />
Hinsichtlich der <strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> Fremdenverkehrs im ländlichen Raum ist das inhaltliche<br />
Ziel vor allem die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit <strong>des</strong> Tourismus im<br />
ländlichen Raum. Als Unterziele sind zu nennen: Verbesserung der Vermarktung;<br />
Erschließung spezieller Marktsegmente.
Stand: 16.07.03<br />
- B 122 -<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen die Dörfer und ländlichen Regionen, deren<br />
Entwicklungspotenziale zurzeit nur unzureichend erschlossen sind, Rahmenbedingungen<br />
erhalten, die es den dort lebenden Menschen erlaubt, die auf Grund der naturräumlichen<br />
Ausstattung und der ökonomischen Faktoren möglichen Entwicklungschancen<br />
optimal zu nutzen.<br />
Durch die <strong>Förderung</strong> von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten wird die Attraktivität<br />
aus touristischer Sicht und als Standortfaktor für Betriebsansiedlungen<br />
nachhaltig verbessert. Die für die Dörfer typischen Strukturen mit einer Mischung von<br />
Wohn- und Arbeitsfunktionen können erhalten bzw. wiederbelebt werden und führen<br />
damit zu einer verbesserten Lebensqualität und steigern die Attraktivität für Naherholungssuchende.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen<br />
Kosten<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt<br />
(davon EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren. Anzahl der geschaffenen und gesicherten<br />
Arbeitsplätze<br />
Anzahl der Projekte<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Höhe der Gäste- und Übernachtungszahlen<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Die Dorf- und ländliche Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch eine Entwicklungsstrategie<br />
von unten (bottom up). Die Initiative für die jeweilige Aktion geht<br />
grundsätzlich von den örtlichen Akteuren aus.<br />
Voraussetzung für investive <strong>Förderung</strong>en sind im Rahmen eines interkommunalen<br />
und integrierten Entwicklungsansatzes (LSE) abgestimmte Projekte.<br />
Die geltende Förderrichtlinie sieht eine Bündelung von insgesamt vier Bun<strong>des</strong>- und<br />
Lan<strong>des</strong>förderungen vor (GAK-Fördergrundsatz Dorferneuerung, GAK-<br />
Fördergrundsatz Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung, Lan<strong>des</strong>programm Dorfentwicklung<br />
und Infrastrukturmaßnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof).
- B 123 -<br />
Gefördert werden Konzepte, Machbarkeitsstudien, Angebote zur Weiterbildung und<br />
Fortbildung und bauliche Investitionen in kommunaler Trägerschaft in den Bereichen<br />
Fremdenverkehr und handwerkliche Entwicklung.<br />
Gefördert werden Projekte aus solchen touristischen Marktsegmenten, die besonders<br />
für den ländlichen Raum geeignet sind (Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung<br />
von Konzepten für Fahrrad-, Wander-, Reit-, Angel- und Kanutourismus sowie<br />
von Kulturtourismus im ländlichen Raum; Aufbau leistungsfähiger Organisationsstrukturen<br />
für das touristische Marketing im ländlichen Raum).<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Mit Vorlage <strong>des</strong> Verwendungsnachweises erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der<br />
finanziellen und materiellen Indikatoren. Die Ergebnisse werden am Jahresende<br />
durch die Ämter für ländliche Räume zusammengestellt und spätestens <strong>bis</strong> zum Ende<br />
Februar <strong>des</strong> darauf folgenden Jahres der o.a. zuständigen Stelle mitgeteilt. Diese<br />
fasst die Indikatoren und anderen abzugebenden Informationen zusammen und leitet<br />
sie dem fondsverwaltenden Referat zu.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Diese Maßnahme unterstützt die Maßnahme s 1 bei den Projekten, die in der Region<br />
als strukturverbessernd erkannt wurden, die in kommunaler Trägerschaft durchgeführt<br />
werden sollen, jedoch nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung<br />
der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes" förderungsfähig sind. So können<br />
beispielsweise als kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen Wanderwege im<br />
Dorf im Rahmen der GAK gefördert werden. Sinnvolle Ergänzungen in die freie<br />
Landschaft werden im Rahmen der Maßnahme s 2 gefördert.<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 124 -<br />
Grundlage für die <strong>Förderung</strong> ist auch hier ein integrierter Entwicklungsansatz im<br />
Rahmen der Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalysen.<br />
Mit der Durchführung der nicht investiven Tourismusprojekte werden zudem oft auch<br />
Belange anderer Politikbereiche berücksichtigt. Zum Beispiel werden mit dem Fahrrad-<br />
und dem Reittourismus besonders umweltfreundliche Tourismusformen gefördert.
Stand: 16.07.03<br />
- B 125 -<br />
t: Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und<br />
Forstwirtschaft, der Landschaftspflege und der Verbesserung<br />
<strong>des</strong> Tierschutzes<br />
Maßnahme t 1:<br />
Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern, Wiedervernässung von Niedermooren<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft, der Landschaftspflege<br />
und der Verbesserung <strong>des</strong> Tierschutzes<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 11. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 4,28 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 10,70 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
1,90 Mio. E tätigen. Hinzu kommt ein Kommunalanteil von 1,40 Mio. E (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 126 -<br />
Die Finanzierung <strong>des</strong> Programms erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie für die<br />
<strong>Förderung</strong> von Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern und<br />
zur Wiedervernässung von Niedermooren vom 21. Juni 1999 - X 405/5241-<br />
(Amtsbl. Schl.-H. 1999 S.338).<br />
Fördergegenstand: Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern<br />
und zur Wiedervernässung von Niedermooren.<br />
Eine detaillierte Aufstellung befindet sich unter Punkt 3.3.<br />
Zuwendungsempfänger: Zuwendungsempfänger können Wasser- und Bodenverbände<br />
sein. Daneben können Zuwendungsempfänger auch Gemeinden sein, sofern<br />
sie anstelle der Wasser- und Bodenverbände die Unterhaltungspflicht an Gewässern<br />
erfüllen und die zu fördernden Vorhaben mit denen der Verbände vergleichbar sind.<br />
<strong>Förderung</strong>svoraussetzungen:<br />
Gegenstände und Flächen, deren Beschaffung nach diesen Richtlinien gefördert<br />
wurde, sowie durch geförderte Maßnahmen hergestellte Zustände sind auf Dauer so<br />
zu erhalten, dass sie den Zuwendungszweck erfüllen. Eine nach dieser Richtlinie<br />
geförderte Flächenbereitstellung ohne Eigentumsübergang ist dauerhaft rechtlich zu<br />
sichern. Der Nachweis der rechtlichen Sicherung hat bei der Antragstellung zu erfolgen.<br />
<strong>Förderung</strong>sfähig sind nur die Kosten, die für eine sparsame, zweckmäßige und wirtschaftliche<br />
Erstellung der förderungsfähigen Vorhaben nach Abzug von maßnahmebezogenen<br />
Leistungen Dritter entstehen.<br />
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung:<br />
Die <strong>Förderung</strong>smittel werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den förderungsfähigen<br />
Kosten der Maßnahme im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung<br />
gewährt.<br />
Die Höhe der Zuschüsse beträgt für<br />
• vorbereitende Arbeiten (Ziff. 2.1) <strong>bis</strong> zu 90 v.H.,<br />
• die naturnahe Gestaltung von Fließgewässers (Ziff. 2.6) <strong>bis</strong> zu 90 v.H.,<br />
• Maßnahmen zur Wiedervernässung von Niedermooren (Ziff. 2.7) <strong>bis</strong> zu<br />
90 v.H.,<br />
• Grunderwerb und Flächenbereitstellung (Ziff. 2.8) <strong>bis</strong> zu 90 v.H. der<br />
förderungsfähigen Kosten.<br />
Notifizierung nicht erforderlich. Zuwendungsempfänger im Rahmen dieser Richtlinie<br />
können Wasser- und Bodenverbände sowie Gemeinden sein. Es handelt sich somit<br />
ausschließlich um öffentliche bzw. kommunale Körperschaften, nicht jedoch um Unternehmen.<br />
Somit finden die Vorschriften über die Notifizierung staatlicher Beihilfen<br />
auf dieses Förderprogramm keine Anwendung.
Stand: 16.07.03<br />
- B 127 -<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der Vorschriften<br />
<strong>des</strong><br />
§ 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Das ca. 28.000 km lange Netz der Gewässer und landwirtschaftlichen Entwässerungsanlagen<br />
ist in der Vergangenheit nahezu vollständig im Interesse der Nutzung<br />
angrenzender Flächen (Landwirtschaft, Siedlung, Gewerbe und Industrie) ausgebaut<br />
worden. Vordringlich als Folge dieser Ausbaumaßnahmen erfüllen die Gewässer ihre<br />
ökologischen Funktionen i.d.R. nicht mehr, da die für eine intakte Lebensgemeinschaft<br />
erforderlichen Gewässerstrukturen beim Ausbau beseitigt wurden.<br />
Die Durchgängigkeit für wassergebundene Arten (Fische u.a.) wird durch die Vielzahl<br />
vorhandener Querbauwerke unterbunden. Die bestehenden Defizite werden durch<br />
die regelmäßige Gewässerunterhaltung aufrechterhalten, deren Kosten zum weit<br />
überwiegenden Teil von der Landwirtschaft aufzubringen sind. Lediglich in einigen,<br />
nicht ausgebauten Quellbereichen sind Reste naturnaher Lebensgemeinschaften<br />
erhalten geblieben.<br />
Neben der Behebung der Strukturdefizite sind Maßnahmen zur Verringerung der<br />
Nährstoffeinträge besonders vordringlich. Durch eine an die ökologischen Funktionen<br />
angepasste Nutzung der relevanten Flächen soll einerseits die Voraussetzung<br />
für eine naturnähere Entwicklung besonders geeigneter und für verschiedene Landschaftsräume<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> repräsentativer Gewässer geschaffen werden, andererseits<br />
die Nährstoffausträge insbesondere aus der Mineralisation von Torfen verringert<br />
werden. Die hierauf abzielenden Maßnahmen (Reduzierung der Gewässerunterhaltung,<br />
Umgestaltung der Gewässerprofile, Anhebung der Wasserstände) setzen<br />
die Bereitstellung entsprechender Flächen (Grunderwerb, langfristige vertragliche<br />
Verpflichtung zur extensiven Nutzung) voraus. Die Planung und Umsetzung derartiger<br />
Maßnahmen vordringlich in der Trägerschaft von Wasser- und Bodenverbänden<br />
soll gefördert werden.<br />
Die Abwicklung erfolgt lan<strong>des</strong>intern über die Programme „Regeneration der Fließgewässer<br />
- Investitions- und Förderprogramm“ sowie „Wiedervernässung von Niedermooren“<br />
(in Bearbeitung) über die Förderrichtlinie zur „Naturnahen Entwicklung von<br />
Fließgewässern und zur Wiedervernässung von Niedermooren“.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
10,38 Mio. E getätigt.
- B 128 -<br />
Seit 1988 fördert das Land Schleswig - Holstein Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung<br />
von Fließgewässern. Damit wurden auf einer Strecke von ca. 150 km die<br />
Gewässerstrukturen und abschnittsweise die Passierbarkeit für wassergebundene<br />
Arten mit einem Investitionsaufwand von insgesamt ca. 25 Mio. DM (ca.<br />
12,77 Mio. E) (Lan<strong>des</strong>förderung 90 %) verbessert. Die Ausbreitung noch vorhandener<br />
naturnaher Artenbestände in ganzen Gewässern bzw. Gewässersystemen<br />
konnte allerdings noch nicht ermöglicht werden. Auch die international vereinbarten<br />
Reduktionsziele für die Nährstoffeinträge in die Küstengewässer und Randmeere<br />
konnten mit den <strong>bis</strong>herigen Maßnahmen nicht erreicht werden.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Ergebnisse einer externen Evaluierung liegen nicht vor, da das Programm erstmalig<br />
für eine <strong>EU</strong>-<strong>Förderung</strong> angemeldet wird. Zu den wichtigen Ergebnissen vgl. vorstehende<br />
Ausführungen.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Aufbauend auf den <strong>bis</strong>herigen positiven Erfahrungen sind vom Land die Programme<br />
zum „integrierten Fließgewässerschutz“ und zur „Wiedervernässung von Niedermooren“<br />
(noch in Bearbeitung) entwickelt worden, die auch den <strong>bis</strong>her nicht erreichten<br />
Zielen im erforderlichen Umfang Rechnung tragen. Mit den Programmen sollen örtliche<br />
Aktivitäten initiiert und finanziell gefördert werden. Die Umsetzung ist langfristig<br />
(ca. 20 Jahre) angelegt.<br />
Zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Nutzungsintensität in den Talräumen der Gewässer<br />
müssen jährlich ca. 30 Mio. DM (ca. 15,3 Mio. E) im Rahmen der Gewässerund<br />
Deichunterhaltung sowie <strong>des</strong> Schöpfwerkbetriebes vordringlich von der Landwirtschaft<br />
aufgebracht werden. Insbesondere Grenzertragsböden erfordern häufig<br />
einen überproportionalen Kapitaleinsatz. Die ökologischen Funktionen der Gewässer<br />
und angrenzender ehemaliger Feuchtgebiete werden hierdurch beeinträchtigt.<br />
Es ist geplant, im Programmplanungszeitraum ca. 10 Maßnahmen pro Jahr im Rahmen<br />
<strong>des</strong> Entwicklungsplanes durchzuführen.<br />
Es sollen Fließgewässer auf einer Länge von ca. 15 km pro Jahr in Bezug auf die<br />
Gewässergüte strukturell verbessert werden.<br />
Parallel dazu werden die Verbundstrukturen in der Agrarlandschaft in einer Größenordnung<br />
von rd. 10 ha pro Jahr verbessert.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Die Reduzierung bzw. Einstellung der Nutzung dieser Flächen führt zu einer Kostenentlastung<br />
bei der Landwirtschaft und ist Voraussetzung für naturnähere Gewässer,<br />
die das Landschaftsbild sowie die Erholungseignung der ländlichen Räume verbessern.<br />
Durch den ergänzend vorgesehenen Grunderwerb wird die Kapitalausstattung<br />
der Betriebe verbessert. Aus den notwendigen baulichen Maßnahmen an und in den<br />
Gewässern resultieren Aufträge an die regionale Bauwirtschaft, die Beschäftigung im<br />
ländlichen Raum sichert. Der aus der Umsetzung der Maßnahmen resultierende ver-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 129 -<br />
besserte Wasserrückhalt führt zu einer Absenkung der Hochwasserstände in den<br />
unterhalb liegenden Teileinzugsgebieten. Die finanziellen Aufwendungen für die Anpassung<br />
bzw. Herstellung von Hochwasserschutzsystemen werden dadurch verringert.<br />
Die Festlegung der Entwicklungsziele für die einzelnen Gewässersysteme erfordern<br />
eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen bestehender Nutzungen im Hinblick<br />
auf deren Dauerhaftigkeit. Mit den verringerten Nutzungsintensitäten und den damit<br />
einhergehenden reduzierten Nährstoffausträgen wird ein Beitrag zu den international<br />
vereinbarten Reduktionszielen (Helcom, Internationale Nordseeschutzkonferenzen,<br />
Nitratrichtlinie, OSPAR) geleistet.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Die Ergebnisse der Maßnahmen lassen sich anhand der Veränderung der Gewässerstrukturgüte<br />
ermitteln.<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der Kosten, verursacht<br />
durch die Begünstigten<br />
Gesamtsumme der förderfähigen Kosten<br />
Gesamtsumme der Unterstützung je Zuwendungsempfänger(Zuwendungsvolumen)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Projekte<br />
Länge der verbesserten Gewässer (Veränderung<br />
der Gewässerstrukturgüte)<br />
Größe der naturnahen Verbundstrukturen in<br />
der Agrarlandschaft<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Durch die naturnahe Entwicklung von Fließgewässern kann die Durchgängigkeit für<br />
wassergebundene Arten verbessert werden. Die Ausbreitung noch vorhandener naturnaher<br />
Artenbestände soll verbessert werden, diffuse Nährstoffeinträge sollen reduziert<br />
werden.<br />
Durch Anhebung von Wasserständen auf Niedermoorstandorten soll die Mineralisation<br />
von Torfböden verringert werden, wodurch gleichzeitig der Eintrag von Nährstoffen<br />
in Gewässer und von CO2 in die Atmosphäre verringert werden.<br />
Die hierfür notwendigen Maßnahmen (z.B. Veränderung der Abpumptiefe an<br />
Schöpfwerken, Wasserstandsanhebung in Grabensystemen) werden von Wasserund<br />
Bodenverbänden durchgeführt und vom Land Schleswig-Holstein gefördert.<br />
Im Einzelnen können im Rahmen dieses Programms folgende Maßnahmen gefördert<br />
werden:<br />
Vorbereitende Arbeiten
Stand: 16.07.03<br />
- B 130 -<br />
Planung und Baubetreuung<br />
Entwicklung im Rahmen der Gewässerunterhaltung<br />
Punktuelle bauliche Maßnahmen<br />
Beseitigung von Verrohrungen<br />
Naturnahe Gestaltung von Fließgewässern und<br />
Maßnahmen zur Wiedervernässung von Niedermooren<br />
Grunderwerb und Flächenbereitstellung<br />
Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen ist in der einschlägigen Richtlinie<br />
aufgeführt.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren sowie die weiter abzugebenden Informationen sollen von<br />
den Staatlichen Umweltämtern für jede geförderte Maßnahme erhoben werden. Das<br />
Ergebnis wird an das MUNF gesendet, das die Daten in eine per EDV geführten<br />
Liste einarbeitet und an das fondsverwaltende Referat <strong>des</strong> MLR weiterleitet. Die<br />
Liste wird über den gesamten Programmplanungszeitraum geführt, so dass die Entwicklungen<br />
jederzeit abgerufen und aufgezeigt werden können.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Bezüglich der Kontrolle der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren sollen von den Staatlichen Umweltämtern und dem<br />
MUNF für jede geförderte Maßnahme erhoben werden. Die Ergebnisse werden im<br />
MUNF zusammengefasst, in per EDV geführte Listen eingearbeitet und an das<br />
fondsverwaltende Referat <strong>des</strong> MLR weitergeleitet. Die Listen werden über den gesamten<br />
Programmplanungszeitraum geführt, so dass die Entwicklungen jederzeit<br />
abgerufen und aufgezeigt werden können.<br />
Es werden bei mind. 5 % der Begünstigten, grundsätzlich jedoch bei allen Kontrollen<br />
vor Ort durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahme hat der Zuwendungsempfänger<br />
einen Verwendungsnachweis vorzulegen, der gemäß § 44 LHO und der VV zu §<br />
44 LHO geprüft wird. Dieser umfasst einen Sachbericht und einen rechnerischen<br />
Nachweis.<br />
Vorschriften für die Sanktionen
Stand: 16.07.03<br />
- B 131 -<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung wird unter anderem die zweckentsprechende,<br />
wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Fördermittel geprüft. Sollten<br />
die Fördermittel oder ein Teil der Fördermittel zweckwidrig verwendet worden sein,<br />
wird der Zuwendungsbescheid aufgehoben und die entsprechenden Fördermittel<br />
werden zurückgefordert. Der zu erstattende Betrag ist mit 3% über dem jeweiligen<br />
Basiszinssatz nach § 1 <strong>des</strong> Diskont-Überleitungsgesetzes jährlich zu verzinsen.<br />
Das Vorgehen richtet sich nach §§ 116,117 und 117a <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>verwaltungsgesetzes.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität auf Ebene <strong>des</strong> Entwicklungsplanes<br />
wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Politik zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes ist auf die Wiederherstellung und<br />
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Räume ausgerichtet.<br />
Die mit dieser Maßnahme angestrebten Ziele entsprechen dieser Politik.<br />
Es ist davon auszugehen, dass diese Politik mit Maßnahmen, die im Rahmen der<br />
gemeinsamen Marktorganisation durchgeführt werden, nicht konkurrieren, da sie die<br />
Marktpolitik flankieren und ergänzen soll. Das Programm zur naturnahen Entwicklung<br />
von Fließgewässern, Wiedervernässung von Niedermooren steht daher mit<br />
Maßnahmen der gemeinsamen Marktorganisation im Einklang.<br />
Bezüglich der reinen nationalen Maßnahmen verweise ich auf die Ausführungen zu t<br />
1 - Neubau zentraler öffentlicher Abwasserbeseitigungsanlagen.<br />
Es ist nicht zu erkennen, dass durch die Durchführung der o.g. Programme ungerechtfertigte<br />
Wettbewerbsverzerrungen hervorgerufen werden.
Stand: 16.07.03<br />
- B 132 -<br />
Maßnahme t 2:<br />
Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft, der Landschaftspflege<br />
und der Verbesserung <strong>des</strong> Tierschutzes<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33, 11. Anstrich der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 9,02 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 22,55 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von 11,46<br />
Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Zuwendungsempfänger
Stand: 16.07.03<br />
- B 133 -<br />
Zuwendungsempfänger sind Körperschaften und Stiftungen <strong>des</strong> öffentlichen Rechts,<br />
als gemeinnützig anerkannte Vereine und Verbände.<br />
Zuwendungsvoraussetzungen<br />
Zuwendungen werden für Maßnahmen gewährt, die ausschließlich das Ziel haben,<br />
natürliche oder naturnahe Lebensräume für heimische Flora und Fauna dauerhaft zu<br />
schützen, zu pflegen, zu entwickeln oder zu schaffen. Derartige Maßnahmen dienen<br />
zugleich der funktionalen Verbesserung <strong>des</strong> Klima-, Wasser- und Bodenhaushalts<br />
sowie der Bereicherung <strong>des</strong> Landschaftsbil<strong>des</strong>.<br />
<strong>Förderung</strong>sfähig sind insbesondere die Schaffung, Wiederherstellung, Entwicklung<br />
und Vernetzung naturnaher Landschaftsbestandteile in der freien Landschaft durch<br />
Anlage von Feldgehölzen,<br />
Knicks, Hecken und Gebüschgruppen,<br />
Trockenrasen,<br />
Heiden,<br />
Feuchtgebieten durch gezielte Vernässung und Schaffung von Kleingewässern,<br />
Flächen für die natürliche Selbstentwicklung (Sukzession) sowie die Abwehr vorhandener<br />
oder vorhersehbarer Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft<br />
durch<br />
Errichtung von Schutzzäunen,<br />
besucherlenkende Maßnahmen und<br />
Maßnahmen zur Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts und<br />
der Grunderwerb für diese Zwecke.<br />
Art und Höhe der Zuwendungen<br />
Es werden jährliche Zuwendungen in Höhe von 80 <strong>bis</strong> 100 % der zuwendungsfähigen<br />
Kosten auf der Grundlage eines Bewilligungsbeschei<strong>des</strong> gewährt.<br />
Eine Notifizierung entfällt, da es sich nicht um staatliche Beihilfen handelt. Unternehmen<br />
zählen nicht zu den Zuwendungsempfängern.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Es existieren keine laufenden Verträge.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Für Schleswig-Holstein als attraktives Urlaubsland und seine Bürgerinnen und Bürger<br />
ist eine intakte Natur und Umwelt ein großes Kapital. Das Land ist mit natürlichen<br />
und naturnahen Landschaftselementen im Vergleich zu anderen Räumen in<br />
Deutschland noch relativ gut ausgestattet. Die Maßnahmen innerhalb dieses Programms<br />
sollen dazu beitragen, die natürliche Umwelt und Kulturlandschaft aktiv ökologisch<br />
zu gestalten und sie so nachhaltig zu schützen und zu entwickeln.
Stand: 16.07.03<br />
- B 134 -<br />
Derzeit dienen etwa 7 <strong>bis</strong> 8 Prozent der Lan<strong>des</strong>fläche Schleswig-Holsteins unmittelbar<br />
der Umsetzung flächenhafter Naturschutzkonzepte (ohne Nationalpark Schleswig-Holsteinisches<br />
Wattenmeer und sonstige Meeresflächen der Ostsee). Dieser<br />
Flächenanteil ergibt sich aus der Summe aller angekaufter und ökologisch wertvoller<br />
lan<strong>des</strong>eigener Liegenschaften, lan<strong>des</strong>eigener Wälder mit Vorrang für den Naturschutz,<br />
ausgewiesener Naturschutzgebiete und unmittelbar nach § 15 a <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>naturschutzgesetzes<br />
geschützter Biotope. Hierin sind die nach Art. 4 der Richtlinie<br />
79/409/EWG vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten<br />
und Art. 4 der Richtlinie 92/43/EWG vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen geschützten Gebiete weitestgehend<br />
enthalten.<br />
Für die Erhaltung und Schaffung ökologisch wertvoller Bereiche hat das Land<br />
Schleswig-Holstein zwischen 1988 und 1999 insgesamt ca. 320 Mio. DM insbesondere<br />
über verschiedene Förderprogramme ausgegeben. Hiermit wurden z.B.<br />
der Grunderwerb zum Zwecke <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong>,<br />
Biotopmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten<br />
Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten sowie<br />
der Vertragsnaturschutz gefördert.<br />
Positive Effekte zeigen sich insbesondere bei einigen Großtierarten (z.B. Kranich,<br />
Seeadler) und in dem höheren Strukturreichtum der Landschaft (vgl. auch Kapitel 1).<br />
Die Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen einschließlich <strong>des</strong> Grunderwerbs<br />
gliedern sich in folgende Maßnahmenschwerpunkte:<br />
Biotopgestaltende Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Flurbereinigungsverfahren<br />
Grunderwerb zum Zweck <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> innerhalb und außerhalb von Flurbereinigungsverfahren<br />
Maßnahmen in nach internationalem und nationalem Recht geschützten Gebieten<br />
bzw. vorgeschlagenen Schutzgebieten<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Durch die Maßnahmen konnte <strong>bis</strong>lang erreicht werden, dass die Ausstattung der<br />
Landschaft mit natürlichen <strong>bis</strong> naturnahen Strukturelementen in den jeweiligen Projektgebieten<br />
nachhaltig verbessert wurde. Der Schwerpunkt der <strong>Förderung</strong> entfiel auf<br />
die Naturschutzvorranggebiete. So wurden in den Jahren 1994 - 1999 in den Projektgebieten<br />
insgesamt:<br />
157 km Knicks und Reihenpflanzungen angelegt,<br />
112 ha wertvolle Landschaftsteile z.B. durch Anlage von Kleingewässern ökologisch<br />
aufgewertet,<br />
1553 ha Flächen zum Zwecke <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> erworben und so in der Folge<br />
teilweise die naturschutzrechtliche Sicherung vorbereitet, bzw. ermöglicht.
Stand: 16.07.03<br />
- B 135 -<br />
Hierfür wurden in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland<br />
und Rendsburg-Eckernförde insgesamt ca. 5,51 Mio. DM aus <strong>EU</strong>-Strukturmitteln<br />
eingesetzt.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Ziel der <strong>Förderung</strong> von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen ist im Wesentlichen,<br />
das im Lan<strong>des</strong>naturschutzgesetz <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein rechtlich<br />
verankerte und im Landschaftsprogramm Schleswig-Holsteins konkretisierte Ziel<br />
umzusetzen, für das Land ein Biotopverbundsystem zu entwickeln, in dem auf min<strong>des</strong>tens<br />
15 % der Lan<strong>des</strong>fläche ein Naturschutzvorrang begründet ist (vgl. auch Kapitel<br />
Nr. 1.1). Dieses Ziel soll durch Maßnahmen staatlicher Einrichtungen sowie<br />
Maßnahmen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Vereine und Verbände und privater<br />
Institutionen umgesetzt werden.<br />
Angestrebt ist ein Umsetzungszeitraum von ca. 20 Jahren. Neben den lan<strong>des</strong>spezifischen<br />
Zielen dienen diese Maßnahmen der nachhaltigen und umweltgerechten Entwicklung<br />
<strong>des</strong> ländlichen Raums, wie es in der auf der Umweltkonferenz der Vereinten<br />
Nationen beschlossenen AGENDA 21 verankert ist.<br />
Neben den ökologischen Zielen soll die <strong>Förderung</strong> einen Beitrag<br />
zur Verbesserung <strong>des</strong> Wohnwertes im ländlichen Raum und damit eine Attraktivitätssteigerung<br />
für die Ansiedlung von Dienstleistungsgewerbe sowie<br />
eine Stärkung der naturgebundenen Erholung und damit eine Stärkung dieses<br />
fremdenverkehrswirtschaftlichen Segments ermöglichen, mit all seinen positiven<br />
arbeitsmarktpolitischen Sekundäreffekten.<br />
Eine Quantifizierung der Ziele ist im Bereich der Maßnahme t2 problematisch. In<br />
Anlehnung an die im vorangegangenen Programmplanungszeitraum erzielten Ergebnisse<br />
lassen sich grobe Schätzungen für die kommende Förderperiode ermitteln.<br />
Es ist beabsichtigt, mit den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mitteln etwa<br />
200 km Knicks und Reihenpflanzungen anzulegen,<br />
400 ha wertvolle Landschaftsbestandteile, z.B. durch Anlage von Kleingewässern<br />
oder Schutz- und Pflegemaßnahmen, ökologisch aufzuwerten und<br />
2500 ha Flächen zum Zwecke <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> zu erwerben.<br />
Es wird angestrebt, etwa 20 Zuwendungen pro Jahr zu gewähren, wobei der Umfang<br />
der Fördersummen pro Aktion erfahrungsgemäß stark schwankt und sich im Rahmen<br />
von etwa 25.000 € <strong>bis</strong> 1.000.000 € bewegt.<br />
Insgesamt ist anzumerken, dass die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen<br />
im Bereich <strong>des</strong> Umwelt- und <strong>Naturschutzes</strong> sehr von den Bedürfnissen der Zuwendungsempfänger<br />
sowie anderen nicht kalkulierbaren Einflüssen abhängt und nur in<br />
begrenztem Maße von der bewilligenden Behörde zu steuern ist.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung
Stand: 16.07.03<br />
- B 136 -<br />
Biotopgestaltende Maßnahmen und Grunderwerb werden vor allem im Rahmen <strong>des</strong><br />
Aufbaus von Biotopverbundsystemen durchgeführt. Hierdurch wird eine Verbesserung<br />
der Landschaftsstruktur und Landschaftsästhetik bewirkt, die sich belebend auf<br />
die Attraktivität einer Landschaft und <strong>des</strong>halb auch positiv auf die Fremdenverkehrswirtschaft<br />
auswirkt. Darüber hinaus werden im Rahmen von Entwicklungskonzepten<br />
Maßnahmen in Naturschutzgebieten ermöglicht, die häufig direkte besucherlenkende<br />
Funktionen besitzen.<br />
Biotopgestaltende Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Flurbereinigungsverfahren<br />
Durch die gezielte Schaffung von natürlichen und naturnahen Landschaftsstrukturelementen<br />
wie Teichen, Tümpeln, Knicks oder Feldgehölzen, Maßnahmen zur<br />
Anhebung <strong>des</strong> Grundwasserstan<strong>des</strong> in potenziellen Niedermoorstandorten bzw.<br />
Einstauungsmaßnahmen im Rahmen der Hochmoorrenaturierung wird der Naturhaushalt<br />
gesichert und trägt zur Erhaltung, Entwicklung und Schaffung der auch<br />
nach europäischem Recht wertvollen Lebensraumtypen bei. Darüber hinaus wird<br />
der Erholungs- und Erlebniswert der Landschaft erhöht.<br />
Grunderwerb zum Zweck <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> innerhalb und außerhalb von Flurbereinigungsverfahren<br />
Der Grunderwerb hat eine zentrale Bedeutung, wenn bei naturnahen oder zu natürlichen<br />
Biotopen zu entwickelnden Flächen bestehende Nutzungen dauerhaft<br />
aufgegeben werden sollen, weil natürliche und naturnahe Biotoptypen auch durch<br />
eine extensive Landbewirtschaftung nicht zu erhalten und zu entwickeln sind.<br />
Der Flächenankauf ist darüber hinaus in Bereichen, in denen im Einzelfall erhebliche<br />
Nutzungseinschränkungen erforderlich sind, ein wichtiges Umsetzungsinstrument.<br />
Das Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem beinhaltet einen relativ hohen Anteil<br />
an Entwicklungsflächen, die im Regelfall landwirtschaftlich genutzt werden.<br />
Sofern die vorgeschlagenen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nicht über den<br />
Vertragsnaturschutz realisiert werden können, ist für die Durchführung der Maßnahmen<br />
hier der Flächenerwerb auf freiwilliger Basis anzustreben.<br />
Maßnahmen in nach internationalem und nationalem Recht geschützten Gebieten<br />
bzw. vorgeschlagenen Schutzgebieten<br />
Die Maßnahmen dienen in erster Linie der Erhaltung der geschützten Ökosysteme.<br />
Dies sind z.B.<br />
Maßnahmen zur Erhaltung nutzungsbedingter Kulturbiotope ( z.B. Pflege von<br />
Heiden) oder<br />
Maßnahmen zur Entwicklung schützenswerter Biotope (z.B. Hochmoore)<br />
sowie<br />
Maßnahmen zur Besucherlenkung in Schutzgebieten.<br />
Neben den positiven Effekten für den Natur- und Artenschutz werden durch die<br />
Maßnahmen auch positive Wirkungen für den Boden- und Wasserhaushalt dadurch<br />
erreicht, dass in ökologisch sensiblen Gebieten insbesondere der landwirtschaftliche<br />
Eintrag vor allem von Stickstoff und Pestziden dauerhaft erheblich reduziert wird.
Stand: 16.07.03<br />
- B 137 -<br />
Die Maßnahmen haben positive Wirkung auf die landschaftliche Attraktivität <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein vor allem im ländlichen Raum und damit unmittelbaren<br />
positiven Effekt für den Tourismus als einen der wesentlichen Wirtschaftszweige im<br />
Land (vgl. auch Kapitel 1).<br />
Die Maßnahmen sichern so direkt (unmittelbar durch die durchzuführenden Maßnahmen)<br />
und indirekt Arbeitsplätze, vorwiegend im ländlichen Raum. Darüber hinaus<br />
kann der Grunderwerb überwiegend landwirtschaftlich genutzter Flächen mit i.d.R.<br />
ungünstigen natürlichen Standortbedingungen (Feuchtgrünland, etc.) die Freisetzung<br />
investiver Mittel in den landwirtschaftlichen Betrieben bewirken.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Wirkungsindikatoren: Freisetzung privater Mittel für Investitionen<br />
Stärkung verschiedener Wirtschaftszweige<br />
Materielle Wirkungsindikatoren: angelegte Kilometer Knicks und Reihenpflanzungen<br />
ökologisch aufgewertete Hektar Landschaftsbestandteile,<br />
z.B. durch Anlage von<br />
Kleingewässern, Schutz- und Pflegemaßnahmen<br />
Flächenerwerb in Hektar zum Zwecke <strong>des</strong><br />
<strong>Naturschutzes</strong><br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Durch die <strong>Förderung</strong> von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen soll der<br />
Aufbau und der Erhalt <strong>des</strong> Biotopverbundsystems Schleswig-Holsteins umgesetzt<br />
werden, das im Wesentlichen die wichtigen naturschutzwürdigen Flächen einschließlich<br />
der europäischen Schutzgebiete umfasst. Dieses ist ein wichtiger Baustein, um<br />
dem im § 1 Abs. 2 Nr. 5 <strong>des</strong> schleswig-holsteinischen Lan<strong>des</strong>naturschutzgesetzes<br />
verankerten Ziel nachzukommen, auf<br />
15 % der Lan<strong>des</strong>fläche einen Vorrang für den Naturschutz zu begründen.<br />
Neben den positiven Wirkungen auf die Stabilität und die Entwicklung gefährdeter<br />
Tiere und Pflanzen werden insbesondere die die Standorte und Ökosysteme prägenden<br />
biologischen Funktionen, die Stoff- und Energieflüsse sowie die landschaftlichen<br />
Strukturen erhalten und entwickelt.<br />
Die Aktionen dieser Maßnahme unterscheiden sich von den Beihilfen im Rahmen<br />
der Kapitel I <strong>bis</strong> VIII, weil sie nicht auf die wirtschaftliche Unterstützung der einzelnen<br />
landwirtschaftlichen Betriebe ausgerichtet sind. Der Einfluss auf die Betriebe ist lediglich<br />
indirekt.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile
Definition der Finanztechnik<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 138 -<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Wegen der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen, Die Indikatoren sollen von den Staatlichen Umweltämtern, bzw. den Ämtern<br />
für ländliche Räume oder dem MUNF für jede geförderte Maßnahme erhoben<br />
werden. Die Ergebnisse werden im MUNF zusammengefasst, in per EDV geführte<br />
Listen eingearbeitet und an das fondsverwaltende Referat <strong>des</strong> MLR weitergeleitet.<br />
Die Listen werden über den gesamten Programmplanungszeitraum geführt, so dass<br />
die Entwicklungen jederzeit abgerufen und aufgezeigt werden können.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Eine Verwaltungsprüfung <strong>des</strong> Antrags wird zu 100 % vor Bewilligung durchgeführt.<br />
Es werden bei 5 % der Begünstigten Kontrollen vor Ort durchgeführt. Nach Abschluss<br />
der Maßnahme hat der Zuwendungsempfänger einen Verwendungsnachweis<br />
vorzulegen, der gemäß § 44 LHO und der VV zu § 44 LHO geprüft wird. Dieser<br />
umfasst einen Sachbericht und einen rechnerischen Nachweis.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung wird unter anderem die zweckentsprechende,<br />
wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Fördermittel geprüft. Sollten<br />
die Fördermittel oder ein Teil der Fördermittel zweckwidrig verwendet worden sein,<br />
wird der Zuwendungsbescheid aufgehoben und die entsprechenden Fördermittel<br />
werden zurückgefordert. Der zu erstattende Betrag ist mit 3% über dem jeweiligen<br />
Basiszinssatz nach § 1 <strong>des</strong> Diskont-Überleitungsgesetzes jährlich zu verzinsen.<br />
Das Vorgehen richtet sich nach §§ 116,117 und 117a <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>verwaltungsgesetzes.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität auf Ebene <strong>des</strong> Entwicklungsplans<br />
wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielsetzungen und Programmen der Lan<strong>des</strong>regierung<br />
(Lan<strong>des</strong>entwicklungsgrundsätze, Lan<strong>des</strong>raumordnungsplanung, Regionalpläne,<br />
Landschaftsprogramm). Eine Konkurrenz zu Maßnahmen, die im Rahmen<br />
der gemeinsamen Marktorganisation durchgeführt werden entsteht nicht.
Stand: 16.07.03<br />
- B 139 -<br />
u: Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten<br />
landwirtschaftlichen Produktionspotenzials sowie Einführung<br />
geeigneter vorbeugender Instrumente<br />
Maßnahme u 1:<br />
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit an den Küsten der Nord- und Ostsee<br />
sowie an den fließenden oberirdischen Gewässern im Tidegebiet gegen Sturmfluten<br />
(Küstenschutz im ländlichen Raum)<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen<br />
Produktionspotenzials sowie Einführung geeigneter vorbeugender Instrumente<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 12. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind rd. 42,50 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von rd. 106,27 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme im Rahmen der GAK nationale<br />
öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von 143,56 Mio. E<br />
tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 140 -<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Grundsätze für die <strong>Förderung</strong> von Küstenschutzmaßnahmen<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt, da nicht auf Vertragsbasis gearbeitet wird.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Schleswig-Holstein hat einschließlich der Inseln und Halligen sowie <strong>des</strong> Elbufers <strong>bis</strong><br />
zur Stadtgrenze nach Hamburg 1.100 km Küsten. Daher ist der Küstenschutz eine<br />
besonders wichtige Aufgabe der Lan<strong>des</strong>regierung. Für diese Aufgabe hat das Land<br />
Schleswig-Holstein seit 1962 rd. 1,34 Mrd. E im Rahmen der GAK investiert. Damit<br />
wurden nach den Grundsätzen <strong>des</strong> Generalplanes Küstenschutz 360 km Lan<strong>des</strong>schutzdeiche<br />
gebaut, die sandigen Küsten gesichert, die wellendämpfenden Vorländer<br />
erhalten und viele Küstenabschnitte gegen Abbruch geschützt. Zur Vollendung<br />
der Maßnahmen <strong>des</strong> Generalplanes Küstenschutz müssen noch rd. 47 km Lan<strong>des</strong>schutzdeiche<br />
an der Nord- und Ostsee überwiegend im ländlichen Raum mit einem<br />
Bauvolumen von rd. 120 Mio. E verstärkt werden. Hinzu kommen die Sicherungen<br />
der sandigen Küsten, Verstärkung sonstiger Deiche, Warfverstärkungen, Sicherungsdämme,<br />
Baumaßnahmen im Deichvorfeld und kleinere Maßnahmen in einer<br />
Größenordnung von rd. 276 Mio. E in den kommenden 15 Jahren.<br />
Durch das gestiegene Umweltbewusstsein der Bevölkerung, die Steigerung der Flächenansprüche<br />
<strong>des</strong> Tourismus einschließlich seiner Infrastruktur sowie durch einen<br />
möglichen Klimawandel negativ veränderte Tiden, Strömungen und Sturmfluten verdeutlichen,<br />
dass Küstenschutz in absehbarer Zeit nie „fertig gestellt“ werden kann.<br />
Vielmehr muss den in der Küstenregion lebenden Menschen auch unter den einschränkenden<br />
Rahmenbedingungen künftig ausreichender Küstenschutz gewährleistet<br />
werden.<br />
Hierzu sind ausreichende Finanzmittel bereitzustellen, einheitliche Schutzstrategien<br />
zu entwickeln und in einem Integrierten Küstenschutzmanagement umzusetzen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
200 Mio. E getätigt.
Stand: 16.07.03<br />
- B 141 -<br />
Hiervon entfielen auf die Erhaltung der Vorländer (Titel 0803-426 08, Titel 0803-<br />
425 08, Titel 0803-547 01) rund 80 Mio. E. Rund 120 Mio. E entfielen auf investive<br />
Maßnahmen (Titel 0803-755 01, Titel 0803-883 05, Titel 0803-887 07) im Rahmen<br />
von lan<strong>des</strong>eigenen Maßnahmen sowie im Zuwendungsbereich.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Auf die vorliegenden Ergebnisse der Zwischenbewertung der Ziel 5b-<strong>Förderung</strong> wird<br />
im Zusammenhang mit den 9 Warfverstärkungen verwiesen.<br />
Mit den im Förderzeitraum 1994 - 1999 eingesetzten Mitteln konnten 27 km Deichverstärkungen<br />
an Lan<strong>des</strong>schutzdeichen und Mitteldeichen an der Nord- und Ostsee,<br />
rd. 6.5 Mio. m 3 Sandvorspülungen und Arbeiten im gesamten Küstenvorfeld ausgeführt<br />
werden.<br />
Entsprechend der finanziellen Rahmenbedingungen konnten die angestrebten Ziele<br />
erreicht und der Schutz von Leben, Landflächen und Sachwerten vor Überflutungen<br />
durch Sturmfluten gewährleistet werden.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Mit den durchzuführenden Maßnahmen (Deichverstärkungen, Sandvorspülungen,<br />
Vorlandarbeiten, Warfverstärkungen, Deckwerksarbeiten u.a.) sollen die Küstengebiete<br />
Schleswig-Holsteins vor lebensbedrohenden Überflutungen durch Sturmfluten<br />
geschützt werden. Die Maßnahmen werden zum Schutze von Leben, Landflächen<br />
und Sachwerten ausgeführt und schaffen so eine wichtige Grundlage für die Vitalisierung<br />
der ländlichen Räume. Sie sichern das landwirtschaftliche Produktionspotenzial.<br />
Hierzu ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der verfügbaren Fördermittel u.a. etwa<br />
2 - 5 Deichverstärkungen (rd. 15 km), 4 - 6 Warfverstärkungen, Vorlandarbeiten<br />
auf einer Fläche von rd. 100 ha, 2 - 5 km Deckwerksbau sowie 1 - 5 Mio. m 3 Sandvorspülungen<br />
auszuführen.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Mit den durchzuführenden Maßnahmen werden sozio-ökonomische Nutzungen wie<br />
Besiedlung, Landwirtschaft, Tourismus oder industrielle Produktion in der Küstenregion<br />
langfristig gesichert. Dieses bedeutet gleichzeitig die Sicherung und Erweiterung<br />
der dortigen Arbeitsplätze, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, <strong>des</strong> Handwerkes<br />
und <strong>des</strong> Tourismus. Küstenschutzmaßnahmen an der Westküste von<br />
Schleswig-Holstein tragen darüber hinaus zur Sicherung <strong>des</strong> einzigartigen Naturraumes<br />
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer bei. Dieser hat durch seine besonders<br />
artenreiche Fauna und Flora für den Fremdenverkehr und die Fischerei, vor<br />
allem aber für den Naturschutz eine herausragende Bedeutung.
Quantitative Indikatoren<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 142 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Höhe der verausgabten Mittel bzw. gewährten<br />
Zuwendung<br />
Höhe <strong>des</strong> Gesamtinvestitionsvolumens<br />
Materielle Indikatoren: Veränderung der Deichabmessungen<br />
Länge <strong>des</strong> verstärkten Deiches<br />
Geschützte Fläche<br />
Fläche <strong>des</strong> verstärkten Deckwerkes<br />
Fläche <strong>des</strong> bearbeiteten Vorlan<strong>des</strong><br />
Menge <strong>des</strong> vorgespülten San<strong>des</strong><br />
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen jeder<br />
einzelnen Maßnahme<br />
Nach § 63 <strong>des</strong> Wassergesetzes <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein (LWG) ist der Bau<br />
und die Unterhaltung von Deichen und Dämmen, die im Interesse <strong>des</strong> Wohls der<br />
Allgemeinheit erforderlich sind, eine öffentliche Aufgabe. Diese obliegt hinsichtlich<br />
der Lan<strong>des</strong>schutzdeiche und der Überlaufdeiche auf den Halligen und Inseln dem<br />
Land. Dieses gilt auch für die Sicherung der Küsten sowie der Watt-, Insel- und Halligsockel<br />
sowie für das Vorland, soweit dies für die Erhaltung der Schutzfunktion der<br />
in der Unterhaltungspflicht <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> stehenden Deiche erforderlich ist.<br />
Für die Ausführung der beantragten Maßnahmen bildet der Generalplan „Deichverstärkung,<br />
Deichverkürzung und Küstenschutz in Schleswig-Holstein“ die grundlegende<br />
Richtlinie. Er enthält die technischen Standards der Küstenschutzanlagen, die<br />
Festlegung der Prioritäten und den Finanzrahmen.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Die Erfassung der Indikatoren erfolgt vor Ort über Baufortschrittskontrolllisten sowie<br />
Baustellenbücher. Diese können jederzeit nach Bedarf dem Fachreferat sowie dem<br />
fondsverwaltenden Referat vorgelegt werden.
Stand: 16.07.03<br />
- B 143 -<br />
Ergänzende Regelungen erfolgen über einzelfallbezogene Erlasse.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch ist zusätzlich geregelt, dass im Rahmen von Pressemitteilungen<br />
auf die Mitfinanzierung der <strong>EU</strong> hingewiesen wird.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Küstenschutzmaßnahmen schützen die Küstengebiete Schleswig-Holsteins vor lebensbedrohenden<br />
Überflutungen durch Sturmfluten.<br />
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Umweltpolitik und Sozialpolitik durch die<br />
Schaffung von Arbeitsplätzen und ermöglichen erst durch ihre Umsetzung die Erreichung<br />
der vorgenannten Ziele. Durch Küstenschutzmaßnahmen wird ein allgemeiner<br />
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung geleistet. Sie erhalten und sichern die durch<br />
andere Gemeinschaftspolitiken geschaffenen Werte.<br />
Die Küstenschutzmaßnahmen werden im Rahmen eines in Schleswig-Holstein im<br />
Aufbau befindlichen „Integrierten Küstenschutzmanagements“ (IKM) durchgeführt.<br />
Das IKM kann als Teilbereich eines „Integrierten Küstenzonenmanagements“ (IKZM)<br />
gelten. Das IKZM ist eine von mehreren Generaldirektionen gemeinschaftlich initiierte<br />
Strategie zur <strong>Förderung</strong> der nachhaltigen Entwicklung von Küstenzonen in der<br />
<strong>EU</strong>.
Stand: 16.07.03<br />
- B 144 -<br />
Maßnahme u 2:<br />
Maßnahmen zur Verhütung von Hochwasserschäden<br />
(Titel II Kap. IX)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
1.A. Wesentliche Merkmale der Fördermaßnahme<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen<br />
Produktionspotentials sowie Einführung geeigneter vorbeugender Instrumente<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, 12. Tiret<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.A. Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 40 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind rd. 1,72 Mio. €, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes und der GAK für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen<br />
in Höhe von rd. 4,29 Mio. € getätigt werden.<br />
Mit der Durchführung der Maßnahme innerhalb <strong>des</strong> Entwicklungsplanes soll im 4.<br />
Quartal 2002 begonnen werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Fördermittel werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den förderungsfähigen<br />
Kosten der Maßnahme im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung gewährt.<br />
Die Höhe der Zuwendung beträgt <strong>bis</strong> zu 70% der förderungsfähigen Kosten.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der<br />
VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.B. Sonstige Bestandteile<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 145 -<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Hiernach können die Fördermittel zur Finanzierung <strong>des</strong> Neubaus und der Erweiterung<br />
von Hochwasserschutzanlagen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> und der Körperschaften <strong>des</strong> öffentlichen<br />
Rechts verwendet werden.<br />
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien für die<br />
<strong>Förderung</strong> wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“.(vom<br />
30. Oktober 2000 –V 403 –0680 – Amtsbl.Schl.-H.2000 S. 702 ).<br />
Dieselben Richtlinien sind die Grundlage für die <strong>Förderung</strong> der Maßnahme o3 –<br />
Neubau zentraler Abwasserbeseitigungsanlagen im Rahmen von ZAL.<br />
Da diese Maßnahmen auch unter die Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“ fallen, ist die Notifizierung<br />
der Richtlinien damit erfolgt.<br />
A) Gegenstand der <strong>Förderung</strong> sind:<br />
die Rückverlegung, die Verstärkung und der Bau von Deichen und Dämmen,<br />
die Verstärkung und der Bau von Schöpfwerken,<br />
die Vergrößerung und der Bau von Hochwasserrückhalte- und Speicherbecken,<br />
die Anpassung der natürlichen und künstlichen Entwässerungseinrichtungen<br />
und<br />
der Grunderwerb zur Durchführung der o.g. Maßnahmen.<br />
B) Zuwendungsempfänger:<br />
Das Land und sonstige Körperschaften öffentlichen Rechts<br />
C) Art, Umfang und Höhe der Zuwendung:<br />
Die Fördermittel werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den förderungsfähigen<br />
Kosten der Maßnahme im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung<br />
gewährt.<br />
Die Höhe der Zuwendung beträgt <strong>bis</strong> zu 70% der förderungsfähigen Kosten.<br />
D) Zuwendungsvoraussetzungen:<br />
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien für<br />
die <strong>Förderung</strong> wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen als<br />
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“.(vom<br />
30. Oktober 2000 –V 403 –0680 – Amtsbl.Schl.-H.2000 S. 702 ).<br />
<strong>Förderung</strong>sfähig sind nur die Kosten, die für eine sparsame, zweckmäßige und<br />
wirtschaftliche Erstellung der förderungsfähigen Vorhaben nach Abzug von
- B 146 -<br />
maßnahmebezogenen Leistungen Dritter entstehen.<br />
E) Zusätzliche Informationen für die spezifische Maßnahme:<br />
Entfällt<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der<br />
Vorschriften <strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen<br />
Planungszeitraum<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.IX.A. Wesentliche Merkmale<br />
Beschreibung und Begründung der vorgeschlagenen Aktion im Rahmen<br />
jeder einzelnen Maßnahme<br />
Die Maßnahmen sind unerlässlicher Beitrag zur Sicherung der Strukturen und der<br />
Wirtschaftskraft in den durch ihre besondere Abhängigkeit von gesicherten Vorflutverhältnissen<br />
geprägten Niederungen im ländlichen Raum.<br />
Die Beschreibung und Begründung der Einzelmaßnahmen erfolgt im Rahmen der<br />
jeweiligen Antragstellung durch ihren Träger.<br />
Es ist beabsichtigt, jährlich 1 – 2 Maßnahmen mit einem Gesamtzuwendungsvolumen<br />
von 0,75 Mio. € zu fördern.<br />
Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Das Land Schleswig-Holstein ist durch eine Vielzahl von, meist großflächigen Niederungsgebieten<br />
im Einfluss von Nord- und Ostsee und der Elbe geprägt. Sie machen<br />
mit ca. 5.000 km² ein Drittel der Lan<strong>des</strong>fläche aus. Ca. 3.000 km², entsprechend einem<br />
Fünftel der Lan<strong>des</strong>fläche, liegen auf Höhe bzw. unterhalb <strong>des</strong> mittleren Meeresspiegelniveaus<br />
und bedürfen in der Regel einer künstlichen Entwässerung. Letztere<br />
leiden zunehmend als Folge <strong>des</strong> säkularen Meeresspiegelanstieges. Eine Anpassung<br />
der Hochwasserschutzanlagen und der natürlichen und künstlichen Entwässerungseinrichtungen<br />
ist zukünftig zwingend erforderlich.<br />
Extreme Niederschlagsereignisse im Juli 2002 haben in den betroffenen Niederungsgebieten<br />
zu teilweise erheblichen Überschwemmungen geführt, die erhebliche<br />
Schäden auf landwirtschaftlichen Produktionsflächen, der ländlichen Infrastruktur<br />
und in ländlichen Siedlungen verursacht haben.<br />
Nach Auffassung der Mehrzahl der Klimaforscher muß damit gerechnet werden,<br />
dass derartige Extremereignisse in der Zukunft vermehrt eintreten. Es ist daher erforderlich,<br />
auch im Binnenland den Hochwasserschutz und die Leistung der Entwässerungseinrichtungen<br />
partiell der sich zukünftig einstellenden verschärften Nieder-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 147 -<br />
schlags-/Abflusssituation anzupassen, um gravierende Schäden durch Überschwemmen<br />
zu verhindern.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Vergleichbare Maßnahmen wurden bereits in den vergangenen Jahren im Rahmen<br />
der o.g. Richtlinie gefördert.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Ergebnisse einer externen Evaluierung liegen nicht vor, da das Förderprogramm<br />
erstmalig für eine Gemeinschaftsbeteiligung angemeldet wird. Zu den wichtigsten<br />
Ergebnissen vgl. vorstehende Lagebeschreibung.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Auf der Grundlage von aktuellen Bestandserhebungen und –bewertungen sollen<br />
unter Berücksichtigung <strong>des</strong> Meeresspiegelanstieges und morphologischer Veränderungen<br />
die Vorflut von Niederungen mit künstlicher Vorflut gesichert werden. Dies<br />
soll, bei nicht mehr ausreichender Entwässerung durch Siele, durch die Errichtung<br />
von Schöpfwerken oder durch die Erhöhung der Leistung bestehender Schöpfwerke<br />
erreicht werden. In vielen Fällen ist es sinnvoll, die Leistungsfähigkeit von Schöpfwerken<br />
durch die Herstellung/Erweiterung von Speicherbecken zu optimieren. Durch<br />
die vorgesehenen Maßnahmen ist in der Regel die Anpassung der künstlichen und<br />
natürlichen Vorflut an die veränderten Anlagen erforderlich.<br />
Weiter sind an Fließgewässern Deiche und Dämme zu errichten, bestehende Deiche<br />
zu verlegen oder zu verstärken. Durch den Bau oder die Vergrößerung von Hochwasserrückhalte-<br />
und Speicherbecken sowie die Einrichtung von Überschwemmungsgebieten<br />
sollen in gefährdeten Niederungen oder Teilen davon extreme Niederschlags-/Abflussereignisse<br />
zukünftig ausreichend beherrscht werden können. Zu<br />
diesem Zweck ist auch in Einzelfällen die Errichtung oder Leistungserhöhung von<br />
Binnenschöpfwerken erforderlich, in jedem Fall aber die Anpassung der Vorflut an<br />
die neuen Verhältnisse.<br />
Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Durch die dargestellten Maßnahmen wird, auch in Zukunft, die landwirtschaftliche<br />
Nutzung von Niederungsflächen im <strong>bis</strong>herigem Umfang gesichert werden.<br />
Besiedelte Bereiche <strong>des</strong> überwiegend ländlichen Raumes und seine Infrastruktureinrichtungen<br />
werden vor Schäden, die durch Überschwemmungen, die ihre Ursache in<br />
extremen Niederschlagsereignissen haben, zukünftig geschützt.
Quantitative Indikatoren<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 148 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtsumme der förderungsfähigen<br />
Kosten<br />
Gesamtsumme der Unterstützung je<br />
Zuwendungsempfänger (Zuwendungsvolumen)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl und Leistung von Schöpfwerken<br />
Länge von Deichen<br />
Anzahl und Inhalt von Rückhalteund<br />
Speicherbecken<br />
Anzahl und Flächengröße von Überschwemmungsgebieten<br />
Anzahl und Flächengröße der durch<br />
die Maßnahmen geschützten Gebiete<br />
3.IX.B. Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren sowie die weiter abzugebenden Informationen sollen von<br />
den Staatlichen Umweltämtern für jede geförderte Maßnahme erhoben werden.<br />
Das Ergebnis wird an das MUNF gesendet, das die Daten in eine per EDV geführte<br />
Liste einarbeitet und an das fondsverwaltende Referat <strong>des</strong> MLR weiterleitet.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch ist zusätzlich geregelt, dass im Rahmen von Pressemitteilungen<br />
auf die Mitfinanzierung der <strong>EU</strong> hingewiesen wird.
Stand: 16.07.03<br />
- B 149 -<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen<br />
nach Artikel 37 Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Die Politik zur Entwicklung <strong>des</strong> ländlichen Raumes ist auf die Wiederherstellung und<br />
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Räume ausgerichtet.<br />
Die mit dieser Maßnahme angestrebten Ziele entsprechen dieser Politik.<br />
Es ist davon auszugehen, dass diese Politik mit Maßnahmen, die im Rahmen der<br />
gemeinsamen Marktorganisation durchgeführt werden, nicht konkurrieren, da sie die<br />
Marktpolitik flankieren und ergänzen soll. Das Programm zur Verhütung von Hochwasserschäden<br />
steht daher mit Maßnahmen der gemeinsamen Marktorganisation im<br />
Einklang.
Stand: 16.07.03<br />
- B 150 -<br />
5.3 SCHWERPUNKT C - AGRAR-, UMWELT- UND AUSGLEICHSMAßNAH-<br />
MEN SOWIE FORSTWIRTSCHAFT (TITEL II KAP. V, VI UND VIII)<br />
Maßnahme e 1:<br />
Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen<br />
(Titel II Kap. V)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 1,84 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 3,68 Mio. E getätigt werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Beihilfeintensitäten und/oder -beträge und angewandte Differenzierungen können<br />
den „Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen in Gebieten mit umweltspezifischen<br />
Einschränkungen - Programm zur Grünlanderhaltung“ entnommen werden<br />
bzw. sind unter Punkt 3 „Spezifische Informationen“ aufgeführt.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99:<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
- B 151 -<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen:<br />
Im Rahmen der „Richtlinien für die Gewährung von Ausgleichszahlungen in Gebieten<br />
mit umweltspezifischen Einschränkungen“ soll Landwirten, die über Grünlandflächen<br />
in den o.g. Gebieten (europäisches Schutzgebietsnetz NATURA 2000 einschließlich<br />
der bestehenden Naturschutzgebiete, die gemäß Art. 10 der Richtlinie 92/43/EWG<br />
zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz dieser Schutzgebiete beitragen) für<br />
den Erhalt dieser Grünlandflächen eine Zuwendung gewährt werden.<br />
Der Erhaltung von Grünland in diesen Gebieten ist entscheidend für die Erfüllung<br />
von Anforderungen, die sich aus dem Gemeinschaftsrecht der Richtlinie 92/32/EWG<br />
<strong>des</strong> Rates vom 21. Mai 1992 - so genannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - sowie<br />
der Richtlinie <strong>des</strong> Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung wildlebender Vogelarten<br />
zur Sicherung der Lebensräume dieser Gebiete ergeben.<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der Vorschriften<br />
<strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne<br />
Die gute landwirtschaftliche Praxis und die Erfordernisse <strong>des</strong> Umweltschutzes werden<br />
durch umfangreiche Fachgesetze, die straf- und bußgeldbewehrt sind, bestimmt.<br />
Die Kontrolle dieser Gesetze erfordert ein hohes Maß an einschlägigen Fachkenntnissen<br />
durch die kontrollierenden Fachbehörden. Entsprechend der fachlichen Notwendigkeit<br />
und Umweltrelevanz werden die Fachgesetze nach den länderspezifischen<br />
Regelungen durch die zuständigen Fachbehörden kontrolliert. Zur Definition<br />
und Kontrolle siehe Ziff. 7.3.2.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt, es handelt sich um eine neue Maßnahme.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die Maßnahme sieht die Gewährung von Zuwendungen als Ausgleich für Einschränkungen<br />
der Landwirtschaft hinsichtlich <strong>des</strong> Verbotes <strong>des</strong> Grünlandumbruchs, die in<br />
dem kohärenten Schutzgebietssystem der FFH-Richtlinie erfolgen, vor.<br />
Schleswig-Holstein trägt besondere Verantwortung für die natürlichen Lebensräume<br />
der Nord- und Ostseeküste mit den tidebeeinflussten Flussmündungen, Strandseen,<br />
Meeresbuchten, Salzwiesen, Watten- und Dünen, für seine großflächigen Niedermoorbereiche<br />
und für seine zahlreichen Binnenseen einschließlich ihrer schutzwürdigen<br />
Uferbereiche.<br />
Stand: 16.07.03
- B 152 -<br />
Daneben hat Schleswig-Holstein eine herausragende Bedeutung für die parlearktischen<br />
Watt- und Wasservögel, die viele Lebensräume <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> als wichtige Brut-,<br />
Rast- und Mausergebiete nutzen. Herausragende Rolle hierbei hat das Wattenmeer<br />
mit angrenzenden Grünlandbereichen, das für viele Vogelarten als wichtigstes Brutund<br />
Rastgebiet während ihres Jahreszyklus dient. Ebenfalls sind Grünlandgebiete in<br />
den Flussniederungen, entlang der Ostseeküste und an den Seen und Teichen <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> von ausschlaggebender Bedeutung für die Vogelwelt.<br />
Grünland ist daher in den meisten Gebieten <strong>des</strong> Schutzgebietsnetzes NATURA 2000<br />
von entscheidender Bedeutung für die Sicherung <strong>des</strong> jeweiligen Schutzzweckes.<br />
Nach Art. 6 der FFH-Richtlinie ist für ein generelles Verschlechterungsverbot Sorge<br />
zu tragen, um den günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und<br />
der gefährdeten wildlebenden Tier- und Pflanzenarten zu sichern.<br />
Eine Ackernutzung kann und wird in den meisten Fällen mit Blick auf die Zielsetzung<br />
im Vergleich zur Grünlanderhaltung i.d.R. eine Verschlechterung darstellen, da hierbei<br />
von einer damit verbundenen höheren Intensität der Nutzung ausgegangen werden<br />
kann, die ihrerseits wiederum zu einer höheren Belastung aller abiotischen und<br />
biotischen Parameter führt.<br />
Entsprechende Auswirkungen gelten auch für den Vogelschutz, wo keine Art auf Äcker<br />
angewiesen ist, auch wenn z.B. für Graugänse oder Schwäne hierzu eine große<br />
Toleranz besteht. Bei Pfeifenten und Meeresgänsen besteht dagegen eine engere<br />
Bindung an Grünland. Auch wenn der Umbruch einzelner Flächen noch keine erhebliche<br />
Beeinträchtigung der Schutzziele darstellt, so führt jedoch die Summe einzelner<br />
Grünlandumbrüche zu diesem Ergebnis.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Entfällt, da es sich um eine neue Maßnahme handelt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Entfällt, da es sich um eine neue Maßnahme handelt.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Ziel ist es, die Schutzwürdigkeit der FFH-Gebiete durch den Erhalt der Grünlandflächen<br />
zu sichern. Hierdurch wird dem in der FFH-Richtlinie geforderten generellem<br />
Verschlechterungsverbot Rechnung getragen.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Durch diese Maßnahme werden die wirtschaftlichen Nachteile, die durch den Aufbau<br />
eines europäischen Naturschutznetzes für den Einzelbetrieb entstehen, gemindert.<br />
Die Maßnahme trägt <strong>des</strong> Weiteren dazu bei, die Landwirtschaft in der Region zu er-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 153 -<br />
halten und den Schutz der natürlichen Ressourcen im internationalen Verbund zu<br />
fördern.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: durchschnittlicher Aufwand der Zahlungen<br />
(pro Betrieb, pro ha)<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Begünstigten<br />
Anzahl der entsprechenden begünstigten<br />
Flächen<br />
klassifizierte landwirtschaftliche Flächen (ha)<br />
entsprechender Anteil der begünstigten Flächen<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beihilfenhöhe<br />
Gem. Ziffer 9, V, Buchst. A, erstes Tiret, Ziffer 3 <strong>des</strong> Anhanges der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1750/1999 für Zahlungen gemäß Artikel 13 Buchst. B der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1257/1999 und Artikel 16 der Verordnung (EG)<br />
Nr. 1257/1999 detaillierte agronomische Berechnungen, aus denen Folgen<strong>des</strong><br />
hervorgeht: a) Einkommensverluste und Kosten infolge der umweltspezifischen<br />
Einschränkungen, b) als Bezugspunkt dienende agronomische<br />
Annahmen<br />
Im Rahmen der „Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen in Gebieten mit<br />
umweltspezifischen Einschränkungen - Programm zur Grünlanderhaltung“ wird eine<br />
Zuwendung für das Verbot <strong>des</strong> Grünlandumbruches für die in der Gebietskulisse<br />
liegenden Grünlandflächen eines Betriebes gewährt. Neben dem Verbot <strong>des</strong> Grünlandumbruches<br />
dürfen die Flächen nicht über die Neuanlage von Drainagen oder auf<br />
vergleichbare Weise entwässert werden. Ziel der Maßnahme ist die Erhaltung von<br />
Grünlandstandorten, deren Wasserstand nicht verändert wird.<br />
Berechnung der Zuwendungshöhe<br />
Auf Grund <strong>des</strong> Umbruchverbotes von Grünland stützt sich die Prämienberechnung<br />
auf die Pachtdifferenz zwischen Acker- und Grünlandflächen. Dies ist für den Landwirt<br />
einkommensrelevant, da ihm diesbezüglich eine Beschränkung auferlegt wird,<br />
sich an veränderte Marktlagen anzupassen.<br />
Die für die „Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen“ festgelegte Prämienhöhe<br />
von 150 DM/ha (rd. 77 °E/ha) lässt sich aus der Agrarstatistik Schleswig-<br />
Holstein 1999 über die hier für das Jahr 1998 genannten Pachtpreise und -flächen<br />
nach Naturräumen wie folgt darlegen:
Stand: 16.07.03<br />
- B 154 -<br />
Ackerland Grünland<br />
Naturraum Preis/ha in DM Fläche ha Preis/ha in DM Fläche ha<br />
Marsch 760 (rd. 388 °E) 854 547 (rd. 280 °E) 1.753<br />
Hohe Geest 549 (rd. 280 °E) 1.511 452 (rd. 231 °E) 2.382<br />
Vorgeest 479 (rd. 245 °E) 1.301 433 (rd. 221 °E) 1.332<br />
Hügelland 591 (rd. 302 °E) 4.925 349 (rd. 178 °E) 1.233<br />
Um zu einem gewogenen Mittel zu kommen, d.h. eine lan<strong>des</strong>einheitliche Prämienhöhe<br />
zu erhalten, wurde wie folgt vorgegangen:<br />
Marsch: 1. Differenz der Pachtpreise<br />
760 DM/ha (Ackerland) ./. 547 DM/ha (Grünland) = 213 DM/ha (rd. 109 °€/ha)<br />
2. Addition der insgesamt verfügbaren Pachtflächen<br />
854 ha (Ackerland) + 1.753 ha (Grünland) = 2.607 ha<br />
3. 213 DM/ha x 2.607 ha = 555.291 DM (rd. 283.916 °€)<br />
Hohe Geest: 1. Differenz der Pachtpreise<br />
549 DM/ha (Ackerland) ./. 452 DM/ha (Grünland) = 97 DM/ha (rd. 49 °€/ha)<br />
2. Addition der insgesamt verfügbaren Pachtflächen<br />
1.511 ha (Ackerland) + 2.382 ha (Grünland) = 3.893 ha<br />
3. 97 DM/ha x 3.893 ha = 377.621 DM (rd. 193.074 °€)<br />
Vorgeest: 1. Differenz der Pachtpreise<br />
479 DM/ha (Ackerland) ./. 433 DM/ha (Grünland) = 46 DM/ha (rd. 23 °€/ha)<br />
2. Addition der insgesamt verfügbaren Pachtflächen<br />
1.301 ha (Ackerland) + 1.332 ha (Grünland) = 2.633 ha<br />
3. 46 DM/ha x 2.633 ha = 121.118 DM (rd. 61.927 °€)<br />
Hügelland: 1. Differenz der Pachtpreise<br />
591 DM/ha (Ackerland) ./. 349 DM/ha (Grünland) = 242 DM/ha (rd. 124 °€/ha)<br />
2. Addition der insgesamt verfügbaren Pachtflächen<br />
4.925 ha (Ackerland) + 1.233 ha (Grünland) = 6.158 ha<br />
3. 242 DM/ha x 6.158 ha = 1.490.236 DM (rd. 761.945 °€)<br />
SUMME SUMME<br />
Naturraum Pachtpreise Pachtflächen Prämienhöhe<br />
Marsch 555.291 DM<br />
(rd. 283.916 °€)<br />
2.607 ha<br />
Hohe Geest 377.621 DM<br />
(rd. 193.074 °€)<br />
3.893 ha<br />
Vorgeest 121.118 DM<br />
(rd. 61.927 °€)<br />
2.633 ha<br />
Hügelland 1.490.236 DM<br />
(rd. 761.945 °€)<br />
2.544.266 DM<br />
6.158 ha<br />
ERGEBNIS<br />
(rd. 1.300.862 °€) 15.291 ha = 166 DM/ha<br />
geteilt durch<br />
(rd. 85 °€/ha)
Stand: 16.07.03<br />
- B 155 -<br />
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewichtung der Pachtdifferenz zwischen<br />
46 und 242 DM/ha und der jeweils verfügbaren Pachtflächen zwischen 2.607<br />
und 6.158 ha mit dem Ziel, eine lan<strong>des</strong>einheitliche Prämienhöhe festzulegen, ist der<br />
oben rechnerisch ermittelte Betrag in Höhe von 166 DM/ha auf 150 DM/ha (rd. 77<br />
°E/ha) abgerundet worden.<br />
Bezug zu Art. 31, Abs. 2, Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999<br />
Für Flächen in benachteiligten Gebieten, für die eine Ausgleichszulage nach den<br />
„Richtlinien für die <strong>Förderung</strong> landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten<br />
als Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“<br />
(e2) gewährt wird, kann grundsätzlich keine Zuwendung im Rahmen der<br />
„Richtlinien für die Gewährung von Ausgleichszahlungen in Gebieten mit umweltspezifischen<br />
Einschränkungen“ gewährt werden. Dies ist nur dann möglich, wenn die<br />
Landwirte an einer <strong>Förderung</strong> im Rahmen der „Richtlinien für die Gewährung eines<br />
erweiterten Pflegeentgeltes sowie einer Prämie für natürlich belassene Salzwiesen in<br />
Anlehnung an das Halligprogramm“ (f3) teilnehmen und gilt nur für den Flächenanteil,<br />
für den nach den erstgenannten Richtlinien keine Ausgleichszulage gewährt<br />
wird. Sollten sich vergleichbare Fälle auch in anderen benachteiligten Gebieten, d.h.<br />
außerhalb der Halligen, ergeben, kann hier ebenso verfahren werden.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Details der Zuwendungsvoraussetzungen betreffend:<br />
1. Festlegung der Min<strong>des</strong>tfläche<br />
2. die Beschreibung <strong>des</strong> angemessenen Umsetzungsverfahrens im Falle<br />
gemeinsamer Weidenutzung<br />
Die Min<strong>des</strong>tfläche beträgt 2 ha.<br />
Eine gemeinsame Weidenutzung findet in der Gebietskulisse nicht statt.<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren sowie die sonstigen abzugebenden Informationen werden<br />
durch das MUNF an das fondsverwaltende Referat <strong>des</strong> MLR weiterleitet. Die Ergebnisse<br />
werden über den gesamten Programmplanungszeitraum gesammelt, so dass<br />
Entwicklungen jederzeit aufgezeigt werden können.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten
Stand: 16.07.03<br />
- B 156 -<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch ist zusätzlich vorgesehen, die „Richtlinien für die Gewährung<br />
von Zuwendungen in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen - Programm<br />
zur Grünlanderhaltung“ nach Genehmigung <strong>des</strong> Entwicklungsplanes im<br />
Amtsblatt für Schleswig-Holstein zu veröffentlichen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Diese Maßnahme ist mit den anderen <strong>Förderung</strong>smöglichkeiten für die Landwirtschaft<br />
abgestimmt worden und somit integraler Teil <strong>des</strong> Gesamtprogrammes. Doppelförderungen<br />
sind ausgeschlossen.<br />
Eine Kumulation der Ausgleichszahlung gemäß Art. 16 der Verordnung (EG) Nr.<br />
1257/ 1999 mit den Ausgleichszahlungen <strong>des</strong> Vertrags-<strong>Naturschutzes</strong> (f2) im Grünlandbereich<br />
ist mit Ausnahme <strong>des</strong> Vertragsmusters „20-jährige Flächenstilllegung“<br />
möglich, da die Inhalte der Verpflichtungen und die gezahlten Entschädigungen jeweils<br />
unterschiedlich sind und sich daher ergänzen.<br />
Die Ausgleichszahlungen gemäß Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 beinhalten<br />
das Umbruchverbot von Grünland in Acker. Hieran errechnet sich die in diesem<br />
Zusammenhang gewährte Prämienhöhe. Sie beinhaltet aber keine weiteren<br />
Auflagen hinsichtlich der dabei einzuhaltenden Bewirtschaftungsweise. Die mit dem<br />
Vertrags-Naturschutz verbundenen Verpflichtungen fordern dagegen eine bestimmte<br />
Art der - extensiven - Grünlandnutzung. Die hierbei gewährten Ausgleichszahlungen<br />
basieren allein auf den mit diesen Einschränkungen verbundenen Einbußen im Vergleich<br />
zu anderen (intensiveren) Grünlandnutzungen und nicht auf einem Umbruchverbot.
Stand: 16.07.03<br />
- B 157 -<br />
Maßnahme e 2:<br />
<strong>Förderung</strong> landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten<br />
(Titel II Kap. V)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
<strong>Förderung</strong> landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 14 <strong>bis</strong> 15 und Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes“ nach dem <strong>Förderung</strong>sgrundsatz „<strong>Förderung</strong><br />
landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten“ durchgeführt.<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 6,26 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 12,52 Mio. E getätigt werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong> landwirtschaftlicher<br />
Betriebe in benachteiligten Gebieten <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der Gemeinschaftsaufgabe<br />
"Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99:<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen:
Stand: 16.07.03<br />
- B 158 -<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong> landwirtschaftlicher<br />
Betriebe in benachteiligten Gebieten <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der Gemeinschaftsaufgabe<br />
"Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne<br />
Die gute landwirtschaftliche Praxis und die Erfordernisse <strong>des</strong> Umweltschutzes werden<br />
durch umfangreiche Fachgesetze, die straf- und bußgeldbewehrt sind, bestimmt.<br />
Die Kontrolle dieser Gesetze erfordert ein hohes Maß an einschlägigen Fachkenntnissen<br />
durch die kontrollierenden Fachbehörden. Entsprechend der fachlichen Notwendigkeit<br />
und Umweltrelevanz werden die Fachgesetze nach den länderspezifischen<br />
Regelungen durch die zuständigen Fachbehörden kontrolliert. Zur Definition<br />
und Kontrolle siehe Ziff. 7.3.2.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt, da nicht auf Vertragsbasis gearbeitet wird.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die landwirtschaftliche Produktion innerhalb der geförderten Gebietskulisse in Größe<br />
von rd. 17.500 Hektar unterliegt schwierigen <strong>bis</strong> extremen natürlichen Bedingungen.<br />
Ausgehend von der agrarstrukturellen Entwicklung in dem Gebiet hat sich gezeigt,<br />
dass die Ausgleichszulage ein geeignetes Instrument ist, um die damit verfolgten<br />
Ziele zu realisieren.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
28,35 Mio. E getätigt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Eigene Überprüfungen, die auch durch eine Untersuchung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>rechnungshofs<br />
im Jahre 1995 unterstützt wurde, führten dazu, dass ab 1997 in der benachteiligten<br />
Agrarzone keine Ausgleichszulage mehr gewährt wurde: Diese Untersuchungen<br />
haben belegt, dass sich die wirtschaftliche Lage dieser Betriebe gegenüber der<br />
vergleichbarer Betriebe außerhalb <strong>des</strong> benachteiligten Gebietes angeglichen hat. Als<br />
Folge davon wurde die Gebietskulisse, in der eine Ausgleichszulage gewährt wurde,<br />
drastisch reduziert.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie
Stand: 16.07.03<br />
- B 159 -<br />
Ziel der <strong>Förderung</strong> bleibt es, hier eine standortgerechte Agrarstruktur zu schaffen<br />
und zu sichern, um über die Fortführung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit<br />
einen Beitrag zur Erhaltung eines Minimums an Bevölkerungsdichte zu leisten. Darüber<br />
hinaus dient die <strong>Förderung</strong> dem flächenhaften Küstenschutz und der touristischen<br />
Entwicklung <strong>des</strong> Raumes.<br />
3.2 Beschreibung der Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Die Ausgleichszulage trägt dazu bei, dass die landwirtschaftliche Nutzung in dem<br />
Gebiet beibehalten wird, indem die direkten einkommenswirksamen Transferzahlungen<br />
die hohen Produktionskosten und das sehr niedrige natürliche Ertragspotenzial<br />
teilweise kompensieren. Mit der Kopplung an das Halligprogramm ist sichergestellt,<br />
dass die Nutzung im Einklang mit den natürlichen Ressourcen und der natürlichen<br />
Vielfalt steht.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: durchschnittlicher Aufwand der Zahlungen (pro<br />
Betrieb, pro ha)<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon:<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Begünstigten für Kompensationszuschüsse<br />
Anzahl der entsprechenden begünstigten<br />
Flächen<br />
landwirtschaftliche Flächen (ha) nach Ackerund<br />
Grünlandnutzung<br />
entsprechender Anteil der begünstigten Flächen<br />
(davon: Berggebiete, andere benachteiligte<br />
Gebiete, Gebiete mit spezifischen Benachteiligungen,<br />
Gebiete mit Umweltrestriktionen)<br />
Bezüglich der halligtypischen Bewirtschaftung (Art und Umfang der Viehhaltung) wird<br />
auf die Indikatorenliste der Maßnahme f 3 verwiesen.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Beihilfenhöhe<br />
Gemäß Ziffer 9, V, A, erstes Tiret, Ziffer 1 <strong>des</strong> Anhanges der Verordnung (EG)<br />
Nr. 1750/1999 für Ausgleichszulagen gemäß Artikel 13 Buchst. a der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1257/1999: Begründung der Differenzierung <strong>des</strong> Beihilfebetrags<br />
anhand der in Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 festgelegten<br />
Kriterien:<br />
Die Differenzierung erfolgte unter Anwendung der in Art. 15 Abs. 2 der VO 1257/99<br />
genannten Kriterien wie folgt:
Stand: 16.07.03<br />
- B 160 -<br />
Halligen: Die natürliche Benachteiligung der Flächen ergibt sich aus der ertragsarmen<br />
Vegetation (Salzwiesen), der absoluten Grünlandnutzung, <strong>des</strong> fehlenden<br />
Hochwasserschutzes (auch im Sommer), <strong>des</strong> sehr begrenzten Einsatzes arbeitssparender<br />
Maschinen, der fehlenden festen Verbindung zum Festland und der hohen<br />
Kosten für die Wirtschaftsgebäude. Die typische Landbewirtschaftung ist die Rinderhaltung<br />
mit hohem Anteil von Pensionsvieh (vom Festland) während der Vegetationsperiode.<br />
Die Landwirtschaftaft wird fast ausnahmslos im Nebenerwerb betrieben.<br />
Die Einnahmen der Haushalte speisen sich meistens aus mehren Quellen.<br />
Insbesondere aus Gründen <strong>des</strong> Küstenschutze ist die Beibehaltung der Bewirtschaftung<br />
für den langfristigen Erhalt der Halligen notwendig, da sie eine feste Grasnarbe<br />
gewährleistet, die eine erhöhte Widerstandskraft gegen Sturmfluten schafft.<br />
Inseln: Die natürliche Benachteiligung für die landwirtschaftlichen Betriebe sind die<br />
fehlende feste Verbindung zum Festland. Neben den hohen Transportkosten dämpft<br />
diese auch die flächenmäßige Weiterentwicklung der (hauptberuflichen) Betriebe.<br />
Für die Betrebe mit Schwerpunkt Grünlandbewirtschaftung spielt die Milchviehhaltung<br />
eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Die Insellage verursacht deutliche Kosten bei<br />
der Erfassung und Verarbeitung der Milch mit entsprechenden Auswirkungen auf<br />
den Milchpreis. Deshalb ist die Höhe der Grünlandprämie über der für Ackerflächen<br />
festgelegt worden.<br />
Deiche, Vorländereien: Die natürlichen Erschwernisse sind die geringe Ertragskraft<br />
<strong>des</strong> Grünlan<strong>des</strong> und der fehlende Hochwasserschutz <strong>des</strong> Vorlan<strong>des</strong> auch im Sommer.<br />
Die Bewirtschaftung erfolgt auf Grund der natürlichen Verhältnisse und aus den<br />
Erfordernissen <strong>des</strong> Küstenschutzes allein durch die Schafhaltung, die überwiegend<br />
im Nebenberuf oder als ein Betriebszweig eines landwirtschaftlichen Betriebes betrieben<br />
wird. Die Bewirtschaftung insbesondere der Deichflächen ist aus Gründen<br />
<strong>des</strong> Küstenschutzes zwingend notwendig.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Details der Zuwendungsvoraussetzungen betreffend:<br />
1. Festlegung der Min<strong>des</strong>tfläche<br />
2. die Beschreibung <strong>des</strong> angemessenen Umsetzungsverfahrens im Falle<br />
gemeinsamer Weidenutzung<br />
Die Zuwendungsvoraussetzungen ergeben sich aus den Fördergrundsätzen <strong>des</strong> notifizierten<br />
Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Eine gemeinsame Weidenutzung findet in der Gebietskulisse nicht statt.<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung
Stand: 16.07.03<br />
- B 161 -<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Die Indikatoren werden von den Bewilligungsbehörden erfasst und an das zuständige<br />
Fachreferat weitergeleitet. Dieses bereitet die Daten auf und leitet seinen Berichtsteil<br />
an den Koordinator weiter. Diese Daten dienen auch der bun<strong>des</strong>weit vorzunehmenden<br />
Evaluierung.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Der Hinweis auf die <strong>EU</strong>-Beteiligung findet sich in der Richtlinie und den jeweiligen<br />
Bewilligungsbescheiden.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten der<br />
gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37 Absatz<br />
2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben. Für die Halligen besteht eine<br />
Verknüpfung mit dem Halligprogramm.
8.1 Maßnahmenbeschreibung f1<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 162 -<br />
Maßnahme f 1:<br />
<strong>Förderung</strong> einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung (MSL)<br />
(Titel II Kap. VI)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" nach dem Fördergrundsatz einer „markt- und<br />
standortangepassten Landbewirtschaftung“ (MSL) durchgeführt.<br />
Förderzweck ist die Einführung oder Beibehaltung extensiver und ressourcenschonender<br />
Produktionsverfahren.<br />
Die Fördergrundsätze beinhalten folgende wesentliche Maßnahmen:<br />
<strong>Förderung</strong> ökologischer Anbauverfahren<br />
<strong>Förderung</strong> extensiver Grünlandnutzung<br />
Im Rahmen der nationalen Modulation werden in Schleswig-Holstein folgende Maßnahmen<br />
angeboten und als Erweiterung in die MSL-Richtlinien aufgenommen:<br />
- Winterbegrünung (Einsaat von Zwischenfrüchten oder Beibehaltung von Untersaaten<br />
während <strong>des</strong> Winterhalbjahres)<br />
- Mulch- und Direkt sowie -pflanzverfahren (keine wendende Bodenbearbeitung, so<br />
dass Pflanzenreste der Vor- und Zwischenfrüchte oder Untersaaten auf der Bodenoberfläche<br />
verbleiben)<br />
- Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger mit besonders umweltfreundlichen<br />
Ausbringungsverfahren (Schleppschlauch – ,Schleppschuhsystem , Injektionsverfahren)<br />
- Anlage von Blühflächen auf Stilllegungsflächen sowie von Blühstreifen auf Ackerflächen<br />
(3 <strong>bis</strong> 25 m am Feldrand), bei Blühstreifen zusätzlich mit Knickpflege<br />
möglich,<br />
- <strong>Förderung</strong> extensiver Grünlandnutzung – einzelflächenbezogene Extensivierung<br />
Gemeinschaftsbeteiligung
Stand: 16.07.03<br />
- B 163 -<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 13,08 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 26,16 Mio. E getätigt werden. Ausgenommen hiervon sind die Mittel zur Finanzierung<br />
der Modulation. Hierzu wird auf den unter Ziffer 4.2 (Seite 6) stehenden Finanzplan<br />
verwiesen.<br />
Beihilfeintensität<br />
Die <strong>Förderung</strong> erfolgt zu 100 %. Die einzelnen Beihilfesätze halten sich an die Vorgaben<br />
<strong>des</strong> Rahmenplanes.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99:<br />
Es werden keine Ausnahmen zugelassen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze für die <strong>Förderung</strong> einer markt- und<br />
standortangepassten Landbewirtschaftung <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne<br />
Die gute landwirtschaftliche Praxis und die Erfordernisse <strong>des</strong> Umweltschutzes werden<br />
durch umfangreiche Fachgesetze, die straf- und bußgeldbewehrt sind, bestimmt.<br />
Die Kontrolle dieser Gesetze erfordert ein hohes Maß an einschlägigen Fachkenntnissen<br />
durch die kontrollierenden Fachbehörden. Entsprechend der fachlichen Notwendigkeit<br />
und Umweltrelevanz werden die Fachgesetze nach den länderspezifischen<br />
Regelungen durch die zuständigen Fachbehörden kontrolliert.. Siehe Konzeption<br />
zur „Guten landwirtschaftlichen Praxis“ im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/99 und<br />
deren Kontrolle. Zur Definition und Kontrolle siehe Ziff. 7.3.2.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Es handelt sich bei der MSL um eine Maßnahme die auf 5 Jahre bewilligt wird. Zur<br />
Zeit werden, wie unten aufgeführt, rund 459 Betriebe mit unterschiedlichen Laufzeiten<br />
zu unterschiedlichen Fördertatbeständen gefördert.<br />
Das Land hat <strong>bis</strong>lang folgende Förderalternativen angeboten:<br />
Einführung extensiver Produktionsverfahren im Ackerbau<br />
Einführung oder Beibehaltung einer extensiven Grünlandnutzung, Umwandlung<br />
von Acker in extensiv zu nutzen<strong>des</strong> Grünland<br />
Einführung oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren
Stand: 16.07.03<br />
- B 164 -<br />
Einführung extensiver Produktionsverfahren im Ackerbau<br />
Die wichtigsten Voraussetzungen sind:<br />
auf die Anwendung von chemisch-synthetischen Düngemitteln sowie von<br />
Pflanzenschutzmitteln (mit Ausnahme der in den Richtlinien genannten) im Betriebszweig<br />
Ackerbau zu verzichten,<br />
kein Dauergrünland in Ackerland umzuwandeln,<br />
im gesamten Betrieb einen Viehbesatz von 2,0 Großvieheinheiten (GVE) je ha<br />
landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) nicht zu überschreiten und höchstens<br />
den Wirtschaftsdünger auszubringen, der diesem Viehbesatz entspricht,<br />
bei Vergrößerung der Ackerfläche die zusätzlichen Ackerflächen entsprechend<br />
den eingegangenen Verpflichtungen zu bewirtschaften.<br />
Einführung oder Beibehaltung einer extensiven Grünlandnutzung, Umwandlung<br />
von Acker in extensiv zu nutzen<strong>des</strong> Grünland<br />
Die wichtigsten Voraussetzungen sind:<br />
auf dem Dauergrünland keine Umwandlung in Ackerland vorzunehmen, nicht<br />
mehr Wirtschaftsdünger auszubringen, als es dem Dunganfall <strong>des</strong> im Betrieb<br />
tatsächlich gehaltenen Tierbestan<strong>des</strong> entspricht (maximal dem Dunganfall eines<br />
Gesamtviehbesatzes von 1,4 GVE je ha LF), keine Pflanzenschutzmittel<br />
mit Ausnahme der in den Richtlinien genannten Präparate anzuwenden, keine<br />
Beregnung und/oder keine Meliorationsmaßnahmen durchzuführen und das<br />
Dauergrünland min<strong>des</strong>tens einmal jährlich zu nutzen,<br />
auf der Hauptfutterfläche eine Bewirtschaftung mit höchstens 1,4 raufutterfressenden<br />
Großvieheinheiten (RGV) je ha Hauptfutterfläche einzuhalten und einen<br />
Min<strong>des</strong>tbesatz von 0,3 RGV je ha nicht zu unterschreiten,<br />
zusätzlichen Flächen entsprechend den eingegangenen Verpflichtungen zu<br />
bewirtschaften.<br />
<strong>Förderung</strong> ökologischer Anbauverfahren<br />
Die wichtigsten Voraussetzungen sind:<br />
ein ökologisches Anbauverfahren für den gesamten Betrieb anzuwenden welches<br />
dem in den Richtlinien aufgeführten Kriterien entspricht,<br />
kein Dauergrünland in Ackerland umzuwandeln,<br />
zusätzlichen Flächen entsprechend den eingegangenen Verpflichtungen zu bewirtschaften.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die Maßnahme sieht die Gewährung gemeinschaftlicher Beihilfen vor, mit denen "für<br />
die Landwirte ein Anreiz geschaffen wird, sich freiwillig zu Produktionsverfahren zu<br />
verpflichten, die den erhöhten Belangen <strong>des</strong> Schutzes der Umwelt und der Erhaltung<br />
<strong>des</strong> natürlichen Lebensraum gerecht werden". Ziel der gemeinschaftlichen Beihilferegelung<br />
ist es u.a., den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln deutlich einzuschränken,<br />
die Anwendung von biologischen Anbauverfahren zu fördern, die Umwelt<br />
durch eine Begrenzung <strong>des</strong> Viehbestan<strong>des</strong> je Weideeinheit zu entlasten und<br />
seltene heimische Nutzpflanzen zur nachhaltigen Sicherung der landwirtschaftlichen<br />
Produktionsgrundlagen zu erhalten. Gleichzeitig tragen diese Maßnahmen und Ver-
- B 165 -<br />
fahren zu einer Produktionssenkung und zum Gleichgewicht auf den Agrarmärkten<br />
bei. Hierin liegen die Stärken <strong>des</strong> Programmes. Auf Grund der stringenten Vorgaben<br />
ist der Unternehmerische Entwicklungsspielraum derart eingeschränkt, dass das<br />
Programm nur zögerlich angenommen wird. Es fehlen flexible Anpassungsmöglichkeiten<br />
um den unternehmerischen Spielraum zu gewährleisten.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Das Fördervolumen für den Zeitraum 1994 - 2002 beläuft sich auf fast 13,8 Mio. E.<br />
Derzeit werden im Rahmen der MSL rund 459 Betriebe mit 21.100 Hektar gefördert.<br />
Die Fläche teilt sich zu zu 1/3 auf den Fördertatbestand der extensiven Grünlandnutzung<br />
und zu 2/3 auf den Fördertatbestand der ökologischen Anbauverfahren<br />
auf. Der Fördertatbestand der extensiven Produktionsverfahren im Ackerbau wird<br />
nicht mehr in Anspruch genommen. .<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Die Programme haben sich bewährt und die Nachfrage ist kontinuierlich gewachsen.<br />
Aus den bewilligten Neuanträgen <strong>des</strong> Jahres 2002 geht hervor, dass sich die Fläche<br />
im Jahr 2003 bei der extensiven Grünlandbewirtschaftung um rund 400 ha erhöht<br />
und sich die Fläche bei den ökologischen Anbauverfahren auf über 16.200 Hektar<br />
erhöhen wird.<br />
Weitere verfügbare Bewertungsergebnisse sind dem Evaluierungsbericht zu entnehmen.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Da es sich bei der MSL um eine freiwillige Maßnahme mit erheblichen Einschränkungen<br />
in der Produktion handelt, erwarten wir einen stetigen aber keine sprunghaften<br />
Flächenanstieg in der Maßnahme. Ziel ist es einen Flächenzuwachs pro Jahr<br />
von 300 - 400 Hektar zu erzielen.<br />
Der Fördertatbestand extensive Produktionsverfahren in Ackerbau wurde gestrichen.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Die <strong>Förderung</strong> verfolgt mit ihren Fördervarianten unterschiedliche Ziele, die durch<br />
unterschiedliche Fördervoraussetzungen erreicht werden sollen. Somit werden mit<br />
den einzelnen Varianten unterschiedliche Effekte erwartet.<br />
Die Maßnahmen und Verfahren tragen zu einer Produktionssenkung und zum<br />
Gleichgewicht auf den Agrarmärkten bei. Die gewährten Beihilfen sollen den Landwirten,<br />
die durch die Einführung solcher Verfahren entstehenden Einkommensverluste<br />
ausgleichen, die besonderen Leistungen für die Umwelt darstellen und den<br />
Beitrag zur Verbesserung der Umwelt im Agrarbereich durch eine Anreizkomponente<br />
honorieren. Auf der Grundlage <strong>des</strong> Agrarberichtes 1999 werden die Zahlen von<br />
Buchführungsdaten von ökologisch wirtschaftenden Betreiben mit denen von konventionell<br />
wirtschaftenden Betrieben verglichen. Im Durchschnitt lag der Gewinn der<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 166 -<br />
ökologisch wirtschaftenden Betriebe etwa 2 % über dem der konventionellen Vergleichsbetriebe<br />
und 8 % unter dem Durchschnitt aller Haupterwerbsbetriebe.<br />
Mit der <strong>Förderung</strong> umweltgerechter und den natürlichen Lebensraum schützender<br />
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren haben sich für das Land neue inhaltliche<br />
und finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten für die <strong>Förderung</strong> einer umweltgerechten<br />
und ressourcenschonenden Landbewirtschaftung eröffnet. Mit der Gewährung gemeinschaftlicher<br />
Beihilfen wurde für die Landwirte ein Anreiz geschaffen, sich freiwillig<br />
zu Produktionsverfahren zu verpflichten, die den erhöhten Belangen <strong>des</strong> Schutzes<br />
der Umwelt und der Erhaltung <strong>des</strong> natürlichen Lebensraumes gerecht werden.<br />
Ziel der Beihilferegelung ist es unter anderem, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln<br />
deutlich einzuschränken, die Anwendung von biologischen Anbauverfahren<br />
zu fördern und die Umwelt durch eine Begrenzung <strong>des</strong> Viehbestan<strong>des</strong> je<br />
Weideeinheit zu entlasten.<br />
Die Maßnahmen werden dazu beitragen, die landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer<br />
Faktorausstattung zu erhalten und zu stärken. Damit verbunden ist eine Sicherung<br />
der Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich und eine sozial verträgliche<br />
Begleitung <strong>des</strong> Strukturwandels in der Landwirtschaft.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
Höhe der gewährten Zuwendung<br />
Durchschnittliche Prämie pro Einheit der<br />
Zahlung<br />
öffentliche Ausgaben insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Zielsetzung der Maßnahme (Schutz der<br />
natürlichen Ressourcen, Biodiversität)<br />
umweltempfindliche Flächen: klassifizierte<br />
Flächen(davon % der Flächen, die mit Agrarumweltverträgen<br />
abgedeckt sind)<br />
Inanspruchnahme der Teilmaßnahmen<br />
Wirkungen auf Grund- und Trinkwasser<br />
(N-Bilanz in kg/ha)<br />
Oberflächengewässer (P-Saldo kg/ha AF<br />
bzw. LF)<br />
Boden (Anbau von Früchten mit hohem<br />
Deckungsgrad in % der AF)<br />
Landschaftsästhetische Ressourcen (Flächenanteile<br />
und Anordnung naturnaher<br />
Flächen wie Feldraine, Hecken, etc.; Anteil<br />
nicht genutzter Grünlandflächen, GL-<br />
Anteil in der Landschaft, differenziert nach<br />
Mähweide, Hutung, Wiese, Streuwiese)
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 167 -<br />
Eine Begründung der Verpflichtung anhand ihrer voraussichtlichen Auswirkungen<br />
Die Maßnahme ist mit Ihren Verpflichtungen im vorangegangenen Text beschrieben<br />
und hält sich an den Rahmenplan der GA.<br />
Präzise Angaben zu den Verpflichtungen für die Landwirte und sonstigen<br />
Bedingungen im Rahmen der Vereinbarung einschließlich der Möglichkeiten<br />
und Verfahren zur Anpassung von laufenden Verträgen<br />
Vgl. Fördergrundsatz <strong>des</strong> notifizierten Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe<br />
"Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Beschreibung <strong>des</strong> Anwendungsbereichs der Maßnahme, wobei anzugeben<br />
ist, inwieweit die Durchführung auf den Bedarf abgestimmt ist; Grad der<br />
Zielausrichtung hinsichtlich geografischer, sektoraler und sonstiger Ausrichtung<br />
Der Anwendungsbereich ist in den Richtlinien und im Rahmenplan der GA beschrieben.<br />
Bislang war die Maßnahme auf den Bedarf zugeschnitten, alle Antragsteller<br />
konnten gefördert werden. Der geografische Geltungsbereich <strong>des</strong> Planes erstreckt<br />
sich gemäß Artikel 41 (1) der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 auf das gesamte Land<br />
Schleswig-Holstein.<br />
detaillierte agronomische Berechnungen, aus denen Folgen<strong>des</strong> hervorgeht:<br />
a) Einkommensverluste und anfallende Kosten im Vergleich zur Anwendung<br />
der guten landwirtschaftlichen Praxis im üblichen Sinne, b) als Bezugspunkt<br />
dienende agronomische Annahmen, c) Höhe <strong>des</strong> Anreizes und Begründung<br />
<strong>des</strong> Anreizes anhand objektiver Kriterien<br />
Es wird auf die entsprechenden Berechnungen zum jeweils notifizierten Rahmenplan<br />
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“<br />
verwiesen.<br />
für die Agrarumweltverpflichtungen insgesamt: Angabe möglicher Kombinationen<br />
von Verpflichtungen und Sicherstellung der Kohärenz zwischen den Verpflichtungen<br />
Die Anforderungen und Zuwendungsvoraussetzungen innerhalb der einzelnen Fördertatbestände<br />
der MSL sind so stringent gehalten, dass gegensätzliche Kombinationen<br />
von Verpflichtungen ausgeschlossen sind.<br />
Abgleich über den Grundantrag.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik
Stand: 16.07.03<br />
- B 168 -<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die o.a Indikatoren verwiesen. Die<br />
Indikatoren sollen - soweit sie aus den Antragsunterlagen unter Datenschutzgesichtspunkten<br />
verfügbar sind - von den ÄLR erhoben und vom MUNL ausgewertet<br />
werden. Die Indikatoren sollen durch wissenschaftliche Untersuchungen begleitet<br />
und bewertet werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden an das MUNL<br />
weitergeleitet. Anhand dieser Ergebnisse kann die mit dem Programm angestrebte<br />
Entwicklung und Zielsetzung kontrolliert und überprüft werden. Das Ergebnis der<br />
Prüfung wird an die <strong>EU</strong> weitergeleitet.<br />
Der schleswig-holsteinische Evaluierungsbericht für die MSL liegt seit Beginn <strong>des</strong><br />
Jahres 2000 vor. Zwischen seinerzeitigen Häusern MLR und dem MUNF wurde ein<br />
gemeinsames Konzept erarbeitet, um in Teilbereichen nach einheitlichen Kriterien<br />
MSL-Flächen und Vertragsnaturschutzflächen zu bewerten. An der Christian-<br />
Albrechts-Universität zu <strong>Kiel</strong> laufen Untersuchungen und Forschungsvorhaben zu<br />
Detailfragen. Diese sollen ab 2000 weiter koordiniert und forciert werden, so dass bei<br />
neuen Programmen neben der Begleitung im Rahmen eines Monitorings zukünftig<br />
eine kontinuierliche Bewertung vorgenommen wird.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch sind zusätzlich Veröffentlichungen in Fachzeitschriften vorgesehen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten der<br />
gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37 Absatz<br />
2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Die Anforderungen und Zuwendungsvoraussetzungen innerhalb der einzelnen Fördertatbestände<br />
der MSL sind so stringent gehalten, dass gegensätzliche Kombinationen<br />
von Verpflichtungen ausgeschlossen sind.
Maßnahme f 2:<br />
Vertrags-Naturschutz<br />
(Titel II Kap. VI)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 169 -<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 22 <strong>bis</strong> 24 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 13,29 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von rd. 26,58 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
6,73 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Beihilfeintensitäten und/oder -beträge und angewandte Differenzierungen sind<br />
unter dem Punkt 3 „Spezifische Informationen“ aufgeführt.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 170 -<br />
Im Rahmen dieser Maßnahme werden Musterverträge auf Grundlage <strong>des</strong> notifizierten<br />
Programmes (Entscheidung der Kommission K (98) Nr. 3480 vom 18.12.98) geschlossen.<br />
Förderrichtlinien existieren nicht.<br />
Die <strong>Förderung</strong> beruht auf den Erläuterungen im jeweiligen Haushaltsplan zu den Titeln<br />
„Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen im Rahmen <strong>des</strong> Vertrags-<br />
<strong>Naturschutzes</strong>“ und „Entschädigungen für die Stilllegung von Acker- und Grünlandflächen<br />
zum Zwecke <strong>des</strong> Natur- und Umweltschutzes“. Danach werden Entschädigungen<br />
an Landwirte gewährt, die ihre landwirtschaftliche Nutzung aus Gründen <strong>des</strong><br />
Natur- und Umweltschutzes einschränken.<br />
Gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne<br />
Die gute landwirtschaftliche Praxis und die Erfordernisse <strong>des</strong> Umweltschutzes werden<br />
durch umfangreiche Fachgesetze, die straf- und bußgeldbewehrt sind, bestimmt.<br />
Die Kontrolle dieser Gesetze erfordert ein hohes Maß an einschlägigen Fachkenntnissen<br />
durch die kontrollierenden Fachbehörden. Entsprechend der fachlichen Notwendigkeit<br />
und Umweltrelevanz werden die Fachgesetze nach den länderspezifischen<br />
Regelungen durch die zuständigen Fachbehörden kontrolliert. Zur Definition<br />
und Kontrolle siehe Ziff. 7.3.2.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Verträge im Rahmen dieser Maßnahme werden seit dem 01.01.1999 geschlossen.<br />
Sie löst damit die <strong>bis</strong>her durchgeführten Maßnahmen „Biotop-Programme im Agrarbereich“<br />
und „Uferrandstreifenprogramm“ ab. Die bestehenden Verträge im Rahmen<br />
dieser Programme laufen <strong>bis</strong> zum Ende ihrer Vertragslaufzeit weiter.<br />
Die Verträge werden mit Ausnahme der „Zwanzigjährigen Flächenstilllegung“ jeweils<br />
für fünf Jahre geschlossen.<br />
Zur Zeit steht in rund 880 Verträgen eine Fläche von rund 6.000 ha unter Vertrag.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die Maßnahme sieht die Gewährung gemeinschaftlicher Beihilfen vor, mit denen für<br />
die Landwirte ein Anreiz geschaffen wird, sich auf freiwilliger Basis zu verpflichten,<br />
die Bewirtschaftung ihrer Flächen zu extensivieren und so den Belangen <strong>des</strong> Schutzes<br />
der Umwelt und der Erhaltung der natürlichen biologischen Vielfalt zu entsprechen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 171 -<br />
Ziel der gemeinschaftlichen Beihilferegelung ist es, umweltschädigende Auswirkungen<br />
einer intensiven Landwirtschaft durch zum Beispiel den Verzicht auf Dünge- und<br />
Pflanzenschutzmittel und die Begrenzung <strong>des</strong> Viehstan<strong>des</strong> je Weideeinheit zu vermindern.<br />
Gleichzeitig wird durch diese Maßnahme ein Beitrag zur Produktionssenkung<br />
und zum Gleichgewicht auf den Agrarmärkten geleistet. Hierin liegen die Stärken<br />
<strong>des</strong> Programmes. Auf Grund der stringenten Vorgaben ist der unternehmerische<br />
Entwicklungsspielraum eingeschränkt, so dass die Maßnahme nur begrenzt angenommen<br />
wird. Die Schwäche soll durch verstärkte Beratung der Landwirte gemindert<br />
werden.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
In den Jahren 1994-1998 wurden für den Vertrags-Naturschutz (einschließlich seiner<br />
Vorgängerprogramme Biotop-Programme im Agrarbereich/Uferrandstreifenprogramm)<br />
insgesamt rd. 13,2 Mio. E an Entschädigungszahlungen an Landwirte gewährt.<br />
Hiermit konnten im Durchschnitt jährlich rd. 8.000 ha gefördert werden. Für<br />
1999 sind rd. 1,78 Mio. E bereitgestellt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Um Aussagen über die Effektivität der Programme treffen zu können sind zwischen<br />
1986 und 1998 eine Vielzahl begleitender wissenschaftlicher Untersuchungen<br />
durchgeführt worden. Die Untersuchungen bezogen sich auf den Einfluss der speziellen<br />
Bewirtschaftungsverträge auf die Vogelwelt, auf die Vegetationsentwicklung<br />
und auf die Bestände von Amphibien und Wirbellosengruppen. Daneben wurden<br />
auch ökonomische Untersuchungen z. B. zu Boden- und Ertragsanalysen und Futterwertbestimmungen<br />
von extensiv genutzten Grünlandbeständen durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass die oben genannten Programme wesentlich<br />
zum Schutz und Erhalt der natürlichen Umwelt und hier besonders der artenreichen<br />
feuchten und trockenen Grünlandökosysteme und artenreicher Ackerflächen<br />
beitragen,<br />
der Erhaltung der biologischen Vielfalt,<br />
sowie die Möglichkeiten der Landwirtschaft zur Verbesserung ihrer Einkommensstruktur<br />
erweitern.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Ziel ist es, die zurzeit unter Vertrag stehende Gesamtfläche in ihrem Umfang zu vergrößern.<br />
Da es sich beim Vertrags-Naturschutz jedoch um eine freiwillige Maßnahme<br />
mit erheblichen Bewirtschaftungsbeschränkungen handelt, wird zwar ein stetiger aber<br />
kein sprunghafter Flächenanstieg in der Maßnahme erwartet. Eine entsprechende<br />
Beratung der Landwirte soll verstärkt werden.
Stand: 16.07.03<br />
- B 172 -<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Der Vertrags-Naturschutz fördert den Erhalt einer artenreichen Kulturlandschaft und<br />
den Schutz natürlicher Ressourcen in Kooperation mit der Landwirtschaft.<br />
Der Vertrags-Naturschutz trägt dazu bei, die Landwirtschaft in der Region zu stärken,<br />
indem Bewirtschaftungsweisen - landwirtschaftliche Produktionsverfahren - unterstützt<br />
werden, die den Schutz natürlicher Ressourcen besonders fördern. Der Vertrags-Naturschutz<br />
zählt zu den anerkannten Agrarumweltmaßnahmen der Gemeinschaft.<br />
Der Vertrags-Naturschutz trägt weiterhin dazu bei, die ländlichen Räume in ihrer natürlichen<br />
Strukturvielfalt zu erhalten und zu fördern und schafft somit positive Rahmenbedingungen<br />
für die wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Räume auch außerhalb<br />
der Landwirtschaft (zum Beispiel Erholung und Fremdenverkehr).<br />
Der Vertrags-Naturschutz ist ein beispielhaftes Modell für die nachhaltige Nutzung<br />
natürlicher Ressourcen.<br />
Durch die Mitfinanzierung aus Mitteln der Abwasserabgabe sowie der Grundwasserentnahmeabgabe<br />
und somit auch der inhaltlichen Ausrichtung der <strong>Förderung</strong> auf<br />
den flächenhaften Gewässerschutz ist der Vertrags-Naturschutz auch als ein integrieren<strong>des</strong><br />
Förderinstrument anzusehen, das sich neben seinen positiven Auswirkungen<br />
auf den flächenhaften Gewässerschutz ebenso nachhaltig auf den Boden- und<br />
Klimaschutz auswirkt.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: durchschnittliche Prämie pro Einheit der Zahlungen<br />
öffentliche Ausgaben insgesamt (davon EAGFL-<br />
Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Kodifikation der Verpflichtungen<br />
Zielsetzung der Maßnahme (Schutz der natürlichen<br />
Ressourcen, Biodiversifität und/oder Landschaftsschutz)<br />
mineralisches Düngungsniveau (davon N, P, K):<br />
festgesetztes Niveau im Rahmen der Verpflichtung<br />
(kg/ha) / Referenzniveau<br />
organische Düngung: festgesetzter Grenzwert im<br />
Rahmen der Verpflichtung (t/ha) / Referenzniveau<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
umweltempfindliche Flächen: ha der klassifizierten<br />
Flächen (davon: % der Flächen, die mit Agrarumweltverträgen<br />
abgedeckt sind)
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 173 -<br />
eine Begründung der Verpflichtung anhand ihrer voraussichtlichen Auswirkungen<br />
Der „Vertrags-Naturschutz“ dient der Erhaltung und Wiederherstellung einer möglichst<br />
hohen Vielfalt artenreicher Wiesen- und Weidenökosysteme, die durch landwirtschaftliche<br />
Nutzung entstanden sind und ermöglicht den Landwirten in Schleswig-Holstein<br />
zugleich eine Verbesserung ihrer Einkommensstruktur. Es werden umweltschädigende<br />
Auswirkungen einer intensiven Landwirtschaft gemindert und der<br />
immer stärkeren Nachfrage der Gesellschaft nach ökologischen Dienstleistungen<br />
Rechnung tragen. Hierzu sind für feuchte und nasse, nährstoffarme sowie nährstoffreiche<br />
und für trockene, arme Grünlandbereiche unterschiedliche, auf die besonderen<br />
natürlichen und betriebswirtschaftlichen Verhältnisse abgestimmte Vertragsmuster<br />
entwickelt worden.<br />
Vertragsmuster „Amphibienschutz“<br />
Über das Vertragsmuster „Amphibienschutz“ sollen mäßig feuchte, i.d.R. nährstoffreichere<br />
Grünlandstandorte gefördert werden, die schwerpunktmäßig in der Marsch,<br />
in den größeren Flussniederungen, aber auch in der Geest und im östlichen Hügelland<br />
liegen. Ziel <strong>des</strong> Amphibienschutzvertrages ist es, den Strukturreichtum der Flächen<br />
zu erhalten und ggf. zu erhöhen und die Gefährdung von Amphibien durch<br />
landwirtschaftliche Maschinen zu reduzieren. Der Vertrag soll daher die Beweidung<br />
fördern.<br />
Die relativ hohe Beweidungsdichte von <strong>bis</strong> zu 3 bzw. 4 Tieren/ha soll eine für Amphibien<br />
zu dichte Vegetation verhindern und ermöglichen, flexibel auf Wuchsbedingungen<br />
der einzelnen Flächen zu reagieren und somit auf die für Amphibien und viele<br />
Wirbellose schädliche Mahd zu verzichten.<br />
Maßgebend bei der Festsetzung der Besatzdichte mit <strong>bis</strong> zu 4 Tieren/ha ist, dass<br />
eine Nutzung <strong>des</strong> Aufwuchses über Beweidung erfolgt und auf eine Mahdnutzung<br />
bzw. Pflegemahd verzichtet werden kann. Es hat sich gezeigt, dass die geringe Besatzdichte<br />
<strong>des</strong> Vorläuferprogrammes (Biotop-Programme im Agrarbereich) mit 1,5<br />
Tieren/ha häufig nicht mit der Produktivität der Flächen Schritt halten konnte. Entsprechend<br />
wurden die Flächen entweder als Mähwiese genutzt oder ein Pflegeschnitt<br />
zwischengeschaltet.<br />
Die jeweils aufgetriebenen Tiere sind nicht mit 1 Tier = 1 GVE gleichzusetzen. Auf<br />
Grund der Bewirtschaftungseinschränkungen wie Düngerverbot und deutlich eingeschränkte<br />
Zeit der Bodenbearbeitung werden in erster Linie Jungtiere die Flächen<br />
beweiden, so dass in der Regel von max. 2,4 GVE/ha auszugehen ist.<br />
Mit dem Vertrags-Naturschutz werden innerhalb der ausgewiesenen Gebietskulisse<br />
jeweils nur einzelne Flächen eines landwirtschaftlichen Betriebes gefördert, nicht<br />
aber der gesamte Betrieb. Die o.g. Beweidungsdichte von 2,4 GVE/ha ist daher keine<br />
Größe, die für den gesamten Betrieb bzw. für die gesamten Futterflächen eines<br />
Betriebes gilt.<br />
Über die Verbote von Dünger und Pflanzenschutzmitteln und den Wasserstand zu<br />
senken, sollen insgesamt artenreiche feuchte Wiesen und Weiden erhalten bzw.
Stand: 16.07.03<br />
- B 174 -<br />
wieder hergestellt werden. Zugleich soll über die Vereinbarung biotopgestaltender<br />
Maßnahmen der Lebensraum für Amphibien durch die Anlage von Kleingewässern,<br />
Knicks etc. verbessert werden.<br />
Über die Verbote von Dünger und Pflanzenschutzmitteln und den Wasserstand zu<br />
senken, sollen insgesamt artenreiche feuchte Wiesen und Weiden erhalten bzw.<br />
wieder hergestellt werden. Zugleich soll über die Vereinbarung biotopgestaltender<br />
Maßnahmen der Lebensraum für Amphibien durch die Anlage von Kleingewässern,<br />
Knicks etc. verbessert werden.<br />
In Gebieten, in denen das Vertragsmuster „Amphibienschutz“ angeboten wird und<br />
die als Wiesenvogelbrutgebiet von Bedeutung sind, sollen zusätzlich für brütende<br />
Wiesenvögel geeignete Bedingungen für die Jungenaufzucht geschaffen werden.<br />
Hierzu sind die Beweidungsdichten zu Beginn <strong>des</strong> Jahres besonders eingeschränkt<br />
sowie spätere Mähtermine festgelegt worden.<br />
Vertragsmuster „Wiesenvogelschutz“<br />
In den großräumigen Niederungsbereichen der Marsch wie auch der Geest sowie<br />
zum Teil auch im östlichen soll durch bestimmte Bewirtschaftungsweisen der Lebensraum<br />
von Wiesenvögeln erhalten und gefördert werden. Hierbei ist es wichtig,<br />
dass die Flächen verhältnismäßig hohe Wasserstände aufweisen und während der<br />
Brutzeit relativ störungsarm sind. Mit diesem Vertragsmuster verbinden sich daher<br />
neben dem Verbot von Dünger und Pflanzenschutzmitteln Einschränkungen der Beweidungsdichte,<br />
der Beweidungszeiten und der Mähtermine sowie biotopgestaltende<br />
Maßnahmen, die verhältnismäßig hohe Wasserstände in den Flächen bewirken.<br />
Vertragsmuster „Trauerseeschwalben“<br />
Die an das Wattenmeer angrenzende Halbinsel Eiderstedt an der Westküste<br />
Schleswig-Holsteins weist auf Grund ihrer weitgehenden Grünlandbewirtschaftung<br />
einen Verbreitungsschwerpunkt der Trauerseeschwalbe aus. Die Trauerseeschwalbe<br />
ist auf die Erhaltung der Trinkkuhlen in den Viehweiden als Brutplatz und auf eine<br />
extensive Grünlandbewirtschaftung angewiesen. Die Verträge sehen die Nutzung als<br />
Dauergrünland sowie das Verbot von mineralischer Düngung und chemischen Pflanzenschutzmitteln<br />
bei gleichzeitiger Reduzierung der organischen Düngung vor. (Angestrebt<br />
wird ein Niveau von 80 kg N/ha. Da dieses Vertragsmuster für größere Vertragsabschlüsse<br />
gedacht ist, soll jedoch auch die Möglichkeit von <strong>bis</strong> zu 120 kg N/ha<br />
bei reduzierter Prämienhöhe gegeben sein.)<br />
Darüber hinaus werden Einschränkungen der Beweidungsdichte sowie biotopgestaltende<br />
Maßnahmen, die einen hohen Wasserstand in den anliegenden Gräben und<br />
die Schaffung zeitweise flach überstauter Grünlandbereiche bewirken, vereinbart.
Stand: 16.07.03<br />
- B 175 -<br />
Vertragsmuster„Sumpfdotterblumenwiesen“<br />
Als „Sumpfdotterblumenwiesen“ werden nährstoffreiche Nasswiesen gefördert, die<br />
bei einem niedrigen Viehbesatz und der Einschränkung der Beweidungsdauer bzw.<br />
der Festlegung eines späten Mähtermines, einem Verbot von Dünger und Pflanzenschutzmittel<br />
sowie einem Verbot, den Wasserstand zu senken, Lebensraum z.T.<br />
sehr selten gewordener Tier- und Pflanzenarten darstellen. Sie gehören zu den für<br />
den Naturschutz wertvollen Nasswiesen und kommen in Schleswig-Holstein innerhalb<br />
seiner naturräumlichen Gliederung nur noch kleinräumig insbesondere in der<br />
Geest und im Hügelland, aber auch in der Marsch vor.<br />
Vertragsmuster „Kleinseggenwiesen“<br />
Wiesenbereiche, die, bedingt durch ihre Nährstoffarmut und durch einen relativ hohen<br />
Wasserstand, durch das Vorkommen verschiedener Kleinseggen- und Orchideenarten<br />
gekennzeichnet sind, sollen durch das Vertragsmuster „Kleinseggenwiesen“<br />
gefördert werden. Sie gehören zu den Wiesengesellschaften, deren Arten -<br />
Tiere und Pflanzen - heute sehr selten geworden sind. Ihr Fortbestand ist an eine<br />
bestimmte, extensive Bewirtschaftungsweise gebunden, die neben dem Verbot von<br />
Dünger- und Pflanzenschutzmittel sowie dem Verbot, den Wasserstand zu senken,<br />
Beschränkungen der Beweidung (Viehbesatz, Beweidungsdauer) oder die Festlegung<br />
eines zeitlich verspäteten Mähtermins vorsieht.<br />
Vertragsmuster „Trockenes Magergrünland“<br />
Zu den wertvollen Grünlandökosystemen gehören solche, die auf trockenen, sandigen,<br />
armen Standorten zu finden sind und die auf eine extensive Art der Beweidung<br />
angewiesen sind. Sie gehören zu den artenreichsten Lebensgemeinschaften Mitteleuropas.<br />
Hierzu wurde das Vertragsmuster „Trockenes Magergrünland“ entwickelt,<br />
um diesen spezialisierten Arten der Magerstandorte entsprechende Lebensräume zu<br />
erhalten oder neu zu schaffen.<br />
Im Rahmen dieses Vertragsmusters wird das Verbot von Dünger und Pflanzenschutzmittel<br />
sowie das Verbot der Anhebung <strong>des</strong> Wasserstan<strong>des</strong> ausgesprochen<br />
und die Beweidung (Viehbesatz und Auftriebsdauer) stark eingeschränkt bzw. wahlweise<br />
ein später Mähtermin vereinbart. Die <strong>Förderung</strong>sgebiete für dieses Vertragsmuster<br />
liegen schwerpunktmäßig auf den Sanderflächen im Osten Schleswig-<br />
Holsteins, in der Probstei im Kreis Plön und auf bestimmten Geeststandorten im<br />
Kreis Nordfriesland.<br />
Vertragsmuster „Nahrungsgebiete für Gänse und Enten“<br />
Entlang der Westküste Schleswig-Holsteins sowie auf den Inseln liegen auf Grund<br />
der geografischen Lage und der Konzentrationswirkung <strong>des</strong> Wattenmeeres traditionell<br />
Gebiete für durchziehende und rastende Gänse und Enten. Um den Lebensraum<br />
von ziehenden pflanzenfressenden Gänsen und Enten attraktiv zu erhalten,<br />
soll im Rahmen dieses Vertragsmusters dafür Sorge getragen werden, dass diesen<br />
Arten durch bestimmte Bewirtschaftungsauflagen eiweißreiches, frisch nachwachsen<strong>des</strong><br />
Gras vorfinden. Eine Düngung der Flächen bleibt daher erlaubt. Die Beweidung<br />
endet, bevor die ersten Gänse und Enten zu erwarten sind.
Stand: 16.07.03<br />
- B 176 -<br />
Da diese Gebiete gleichzeitig für das Vorkommen für brütende Wiesenvögel von Bedeutung<br />
sind, werden mit diesem Vertragsmuster zusätzlich auch Bewirtschaftungsbeschränkungen<br />
ausgesprochen, um Gelege und Jungtiere vor Vertritt und zu früher<br />
Mahd zu schützen.<br />
Vertragsmuster „Rastplätze für wandernde Vogelarten“<br />
Wandernde Vogelarten stellen einen wesentlichen Bestandteil der biologischen<br />
Vielfalt dar, den es zu erhalten und zu fördern gilt.<br />
An der Westküste Schleswig-Holsteins befinden sich wichtige Rastplätze der Ringelund<br />
Nonnengänse (Meeresgänse) sowie Pfeifenten, für die das Land eine besondere<br />
Verantwortung trägt. Die in den Marschgebieten der schleswig-hosteinischen<br />
Westküste liegenden Ackerflächen, die heute in erster Linie zum Wintergetreideanbau<br />
genutzt werden, gewinnen für diese Vogelarten dabei während <strong>des</strong> Winterhalbjahres<br />
zunehmend an Bedeutung. In dieser Zeit halten sich die Gänse und Enten<br />
hier auf ihrem Weg zwischen ihren Brutgebieten und ihren eigentlichen Winterquartieren<br />
zum Rasten und zur Nahrungsaufnahme auf.<br />
Durch die Bestellung von Ackerflächen mit Winterweizen und Winterraps – ohne<br />
Düngung und Pflanzenschutzmittel – soll diesen Vogelarten die Möglichkeit gegeben<br />
werden, störungsfreie Rastplätze zur Nahrungsaufnahme vorzufinden. Die Landwirte<br />
verpflichten sich, die Enten und Gänse auf diesen Ackerkulturen zu dulden und die<br />
bestellten Winterfrüchte im Frühjahr als Gründüngung vor der Bestellung mit Sommerfrüchten<br />
in die Flächen einzuarbeiten.<br />
Vertragsmuster „20-jährige Flächenstillegung“<br />
Die Herausnahme von Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung für einen Zeitraum<br />
von min<strong>des</strong>tens 20 Jahren führt zu einer ungestörten Entwicklung natürlicher<br />
Lebensräume. Auch dienen derartige Verträge oft dem Gewässerschutz.<br />
Darüber hinaus können wertvolle Lebensräume durch derartige Pufferflächen nachhaltig<br />
geschützt werden.<br />
Es sollen daher in besonderen Fällen, <strong>bis</strong>her landwirtschaftlich genutzte Flächen in<br />
Form von Randstreifen aus Gründen <strong>des</strong> Gewässerschutzes und der Biotopvernetzung<br />
sowie ganze Flächen aus Gründen <strong>des</strong> flächenhaften Biotop- und Artenschutzes<br />
für min<strong>des</strong>tens 20 Jahre aus der Nutzung genommen werden. Für die einzelnen<br />
Flächen soll zuvor ein Konzept aufgestellt werden, das in besonderen Fällen auch<br />
Pflegemaßnahmen zulässt.<br />
Hinsichtlich der planzengenetischen Ressourcen, die von der genetischen<br />
Erosion bedroht sind: Beleg der genetischen Erosion auf der Grundlage<br />
wissenschaftlicher Ergebnisse und Indikatoren für das Vorkommen von<br />
Landrassen/einfachen (lokalen) Sorten, die Vielfalt der Population und die<br />
vorherrschende landwirtschaftliche Praxis auf lokaler Ebene<br />
Generell werden Wiesenökosysteme mit ihren pflanzengenetischen Ressourcen erhalten,<br />
die ohne Vertrags-Naturschutz verloren gehen. In diesem Zusammenhang
Stand: 16.07.03<br />
- B 177 -<br />
wird auf die „Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins (Schriftenreihe<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>amtes für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein,<br />
Heft 6 aus 1983) und die „Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Schleswig-<br />
Holstein (Herausgeber: Lan<strong>des</strong>amt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein,<br />
2. Fassung, Stand 1990) verwiesen.<br />
Präzise Angaben zu den Verpflichtungen für die Landwirte und sonstigen<br />
Bedingungen im Rahmen der Vereinbarung einschließlich der Möglichkeiten<br />
und Verfahren zur Anpassung von laufenden Verträgen<br />
Im Rahmen der nachfolgenden Vertragsmuster werden für folgende Bereiche der<br />
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung Regelungen der Einführung oder Beibehaltung<br />
getroffen:<br />
Einschränkung bzw. Verbot <strong>des</strong> Einsatzes von Dünger,<br />
Verbot <strong>des</strong> Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln,<br />
Verringerung der Besatzstärke bei der Beweidung,<br />
Verkürzung der zulässigen Bewirtschaftungszeit im Jahr,<br />
Festlegung jahreszeitlich später Mähtermine,<br />
Umwandlung von Ackerflächen in Grünland,<br />
Verpflichtung zur Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen zur<br />
langfristigen Verbesserung der ökologischen Biotopstruktur der Flächen,<br />
Bestellung der Flächen mit Wintergetreide/Winterraps ohne Düngung und Pflanzenschutzmittel<br />
zur Sicherung der Rastplätze für wandernde Vogelarten,<br />
Verzicht auf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen.<br />
Damit wird den in Artikel 22 genannte Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 <strong>des</strong><br />
Rates vom 17. Mai 1999 Rechnung getragen. Die o.g. Regelungen dienen dem Natur-<br />
und Umweltschutz insbesondere dazu,<br />
die natürliche Artenvielfalt (Tiere und Pflanzen) zu erhöhen und damit das genetische<br />
Potenzial der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt zu stärken,<br />
die natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft zu schonen und dabei insbesondere<br />
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu fördern sowie<br />
die Landschaft durch naturnahe und natürliche Biotope gesamtökologisch zu stärken<br />
und in ihrem Erscheinungsbild zu bereichern.<br />
Die Vertragsmuster beinhalten im Einzelnen folgende Verpflichtungen:<br />
Vertragsmuster „Amphibienschutz“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv zu bewirtschaften<strong>des</strong> Dauergrünland.<br />
Kein Absenken <strong>des</strong> Wasserstan<strong>des</strong>.<br />
Kein Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 25.03. <strong>bis</strong><br />
nach dem 1. Schnitt (bei Mahd) bzw. <strong>bis</strong> zum 31.10. (bei Beweidung).<br />
Kein Walzen der Flächen.
Keine Düngung der Flächen.<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 178 -<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 3 oder 4 Tieren *) /ha in der Zeit vom 01./10.05. - 31.10.<br />
(Standweide).<br />
Mahd in den ersten Jahren ohne terminliche Beschränkung.<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Vertragsmuster „Amphibienschutz in Wiesenvogelbrutgebieten“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland.<br />
Kein Absenken <strong>des</strong> Wasserstan<strong>des</strong>.<br />
Kein Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 25.03. -<br />
15.06./25.06. oder 05.07. (bei Mahd) bzw. <strong>bis</strong> zum 31.10. (bei Beweidung).<br />
Kein Walzen der Flächen.<br />
Keine Düngung der Flächen.<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 2 Tieren*)/ha in der Zeit vom 01./10.05. - 15.06./25.06. oder<br />
05.07. sowie von <strong>bis</strong> zu 4 Tieren*)/ha in der Zeit vom 15.06./25.06. oder 05.07. <strong>bis</strong><br />
31.10. (Standweide).<br />
Mahd ab 15.06./25.06. oder 05.07.<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Vertragsmuster „Wiesenvogelschutz“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland.<br />
Kein Absenken <strong>des</strong> Wasserstan<strong>des</strong>.<br />
Kein Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 25.03. -<br />
25.06./05.07. oder 31.07. (bei Mahd) bzw. <strong>bis</strong> zum 31.10. (bei Beweidung).<br />
Kein Walzen der Flächen.<br />
*) 1 Tier = 1 Rind oder 1 Pferd oder 3 Mutterschafe
Keine Düngung der Flächen.<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 179 -<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 2 Tieren/ha in der Zeit vom 10.05. - 25.06./05.07. oder 31.07.<br />
sowie von <strong>bis</strong> zu 4 Tieren*)/ha in der Zeit vom 25.06./05.07. oder 31.07. - 31.10.<br />
(Standweide).<br />
Mahd ab 25.06./05.07. oder 31.07.<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Vertragsmuster „Trauerseeschwalben“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland.<br />
Kein Absenken <strong>des</strong> Wasserstan<strong>des</strong>.<br />
Kein Walzen und Schleppen in der Zeit vom 01.04. - 20.06.<br />
Keine organische Düngung in der Zeit vom 20.04. - 20.06.<br />
Keine mineralische Düngung der Flächen.<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Organische Düngung mit <strong>bis</strong> zu 80 kg N/ha oder 120 kg N/ha.<br />
Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 3 Tieren/ha oder <strong>bis</strong> zu 4 Tieren/ha.<br />
Mahd ab 21.06.<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Duldung der Durchführung von Maßnahmen, die im Rahmen <strong>des</strong> Artenhilfsprogrammes<br />
für die Trauerseeschwalbe an den Brutkolonien durchgeführt<br />
werden.<br />
Vertragsmuster „Sumpfdotterblumenwiesen“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland.<br />
Kein Absenken <strong>des</strong> Wasserstan<strong>des</strong>.<br />
Kein Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 25.03. -<br />
15.06./01.07. (bei Mahd) bzw. <strong>bis</strong> zum 31.10. (bei Beweidung).<br />
Kein Walzen der Flächen.
Keine Düngung der Flächen.<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 180 -<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 2 Tieren *) /ha in der Zeit vom 15.06./01.07. - 31.10. oder Auftrieb<br />
von <strong>bis</strong> zu 1,5 Tieren*)/ha in der Zeit vom 01./10.05. - 30.06. sowie <strong>bis</strong> zu 2/3<br />
Tieren*)/ha in der Zeit vom 01.07. - 31.10. (Standweide).<br />
Mahd ab 15.06./01.07.<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Vertragsmuster „Kleinseggenwiesen“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland.<br />
Kein Absenken <strong>des</strong> Wasserstan<strong>des</strong>.<br />
Kein Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 25.03. - 15.08.<br />
(bei Mahd) bzw. <strong>bis</strong> zum 31.10. (bei Beweidung).<br />
Kein Walzen der Flächen.<br />
Keine Düngung der Flächen.<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 2 Tieren *) /ha in der Zeit vom 15.08. - 31.10. oder Auftrieb von<br />
<strong>bis</strong> zu 1 Tier*)/ha in der Zeit vom 01./10.05. - 31.10. (Standweide).<br />
Mahd ab 15.08.<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Vertragsmuster „Trockenes Magergrünland“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland.<br />
Keine Bewässerung.<br />
Kein Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom 25.03. - 31.08.<br />
Kein Walzen der Flächen.<br />
Keine Düngung der Flächen.<br />
*) 1 Tier = 1 Rind oder 1 Pferd oder 3 Mutterschafe
Stand: 16.07.03<br />
- B 181 -<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auftrieb - Tierzahl frei - in der Zeit vom 01.09. - 30.11. sowie in der Zeit vom<br />
15.04. - 14.05. oder Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 2 Tieren *) /ha in der Zeit vom 01.09. -<br />
14.05. oder Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 1 Tier*)/ha in der Zeit vom 01.08. - 14.05. (Standweide)<br />
oder Mahd ab 01.09.<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Vertragsmuster „Nahrungsgebiete für Gänse und Enten“<br />
Nutzung der Flächen als extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland.<br />
Kein Walzen, Schleppen sowie andere Bodenbearbeitungen in der Zeit vom<br />
15.10. <strong>bis</strong> zum 30.06..<br />
Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Auftrieb von <strong>bis</strong> zu 2 Tieren*)/ha in der Zeit vom 01.05. – 15.06./25.06. oder<br />
05.07. (Mahdtermin); nach Mahdtermin ist die Tierzahl nicht begrenzt (Standweide).<br />
Die Beweidungszeit endet am 15.10.<br />
oder<br />
Auftrieb von Tieren – Tierzahl nicht begrenzt – ohne Mahd vom 01.05. – 15.10.;<br />
bei reiner Schafbeweidung <strong>bis</strong> 30.09. (Standweide).<br />
Duldung der Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen.<br />
Vertragsmuster „Rastplätze für wandernde Vogelarten“<br />
- Bestellung der Flächen mit Winterweizen oder Winterraps ohne Düngung und<br />
Pflanzenschutzmittel.<br />
- Nach der Herbsteinsaat <strong>bis</strong> zum 31. März <strong>des</strong> Folgejahres sind sämtliche Bodenbearbeitungs-<br />
und Pflegemaßnahmen unzulässig.<br />
- Rastende und nahrungssuchende Gänse und Enten sind in der Zeit vom 1. September<br />
<strong>bis</strong> zum 31. März <strong>des</strong> Folgejahres auf den Flächen zu dulden.<br />
- Ab dem 1. April sind die angebauten Feldfrüchte als Gründüngung einzuarbeiten<br />
und die Flächen mit Sommerfrüchten zu bestellen.<br />
- Eine Rotation der Vertragsflächen innerhalb <strong>des</strong> fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
ist nicht zulässig.<br />
- Die geförderten Flächen sollen grundsätzlich zusammenhängend min<strong>des</strong>tens 5<br />
ha umfassen.<br />
Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung“<br />
*) 1 Tier = 1 Rind oder 1 Pferd oder 3 Mutterschafe
Stand: 16.07.03<br />
- B 182 -<br />
Die Flächen bleiben unbestellt und ungenutzt liegen.<br />
Kein Einsatz von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln.<br />
Durchführung von Pflegemaßnahmen ggf. möglich.<br />
Biotopgestaltende Maßnahmen<br />
Um eine nachhaltige ökologische Verbesserung der landwirtschaftlichen Flächen aus<br />
der Sicht <strong>des</strong> Natur- sowie auch aus der Sicht <strong>des</strong> Gewässerschutzes zu erreichen,<br />
werden alle Verträge mit der Verpflichtung <strong>des</strong> Eigentümers verbunden, die Durchführung<br />
biotopgestaltender Maßnahmen auf min<strong>des</strong>tens 2 % der Vertragsflächen zu<br />
dulden. Hierzu gehören die Einrichtung von Knicks oder Gehölzpflanzungen, von<br />
Kleingewässern oder brachfallenden Randstreifen. Bei höheren Flächenanteilen wird<br />
ein entsprechender Zuschlag gewährt.<br />
Umwandlung von Acker- in Grünland<br />
Die <strong>Förderung</strong> einer Umwandlung von Acker- in Grünland erfolgt nur im Zusammenhang<br />
mit einem gleichzeitigen Vertrag zur Extensivierung. Hierbei handelt es sich um<br />
die Vertragsmuster „Amphibienschutz“, „Trockenes Magergrünland“ oder „Nahrungsgebiete<br />
für Gänse und Enten“. Der Verpflichtungszeitraum zur Grünlandbewirtschaftung<br />
beträgt 5 Jahre.<br />
Vertragsdauer<br />
Die Verträge werden - mit Ausnahme der 20-jährigen Flächenstilllegung - für fünf<br />
Jahre geschlossen. Sie können verlängert werden, wenn der Schleswig-<br />
Holsteinische Landtag für den Neuabschluss von Verträgen ausreichend Haushaltsmittel<br />
zur Verfügung stellt. Vertragsbeginn ist jeweils der 1. Januar (Grünlandverträge)<br />
bzw. der<br />
1. September (20-jährige Stilllegung von Ackerflächen).<br />
Der Verpflichtungszeitraum für das Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung“<br />
beträgt 20 Jahre. Ziel <strong>des</strong> Vertragsmusters „20-jährige Flächenstilllegung“ ist es, bestimmte<br />
Flächenbereiche dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen und diese für den<br />
Artenschutz zu entwickeln. Es sollen ungestörte Lebensräume entstehen, die nachhaltig<br />
wirken und die nach Vertragsende i.d.R. nicht wieder in die Nutzung genommen<br />
werden. Dies setzt eine Längerfristigkeit der Vertragslaufzeit voraus. 5 oder 10jährige<br />
Verträge bergen die Gefahr in sich, dass nach Vertragsablauf keine Einigung<br />
über einen Fortbestand <strong>des</strong> Vertrages erreicht wird, die Flächen wieder in Nutzung<br />
genommen werden und damit das <strong>bis</strong> dahin Erreichte wieder hinfällig geworden ist.<br />
Die 20-jährige Dauer der Vertragslaufzeit ist daher notwendig, um die mit der Maßnahme<br />
verfolgten Ziele <strong>des</strong> Umwelt- und Artenschutzes, der <strong>Förderung</strong> der biologischen<br />
Vielfalt und der Minderung von Stoffeinträgen in Grund- und Oberflächengewässer<br />
langfristig zu verfolgen und dauerhaft zu sichern.<br />
Antragsteller
Stand: 16.07.03<br />
- B 183 -<br />
Antragsberechtigt sind selbstwirtschaftende Landwirte als Eigentümer oder Pächter,<br />
die im Sinne <strong>des</strong> § 1 Absatz 2 und 5 <strong>des</strong> Gesetzes über die Alterssicherung der<br />
Landwirte - ALG *) - zur Alterskasse beitragspflichtig sind sowie privatrechtliche landund<br />
forstwirtschaftliche Unternehmen, die unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder<br />
mildtätige Zwecke verfolgen, die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft erzielen<br />
und die die Kriterien <strong>des</strong> § 1 Abs. 2 und 5 <strong>des</strong> Gesetzes über die Alterssicherung der<br />
Landwirte (ALG) erfüllen.<br />
Die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 auf der Basis der Entscheidungen<br />
der Kommission vom 11.10.1994 - K (94) 2595 sowie vom 18.12.1998 - K (1998)<br />
3480 abgeschlossenen Verträge der Biotop-Programme im Agrarbereich sowie <strong>des</strong><br />
Vertrags-<strong>Naturschutzes</strong> werden gemäß den Bestimmungen aus der Verordnung<br />
(EWG) Nr. 2078/92 sowie der Verordnung (EG) Nr. 746/96 <strong>bis</strong> zum Ende deren<br />
Laufzeit fortgeführt.<br />
Beschreibung <strong>des</strong> Anwendungsbereichs der Maßnahme, wobei anzugeben<br />
ist, inwieweit die Durchführung auf den Bedarf abgestimmt ist; Grad der<br />
Zielausrichtung hinsichtlich geografischer, sektoraler und sonstiger<br />
Ausrichtung<br />
Die früheren landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweisen in Mitteleuropa ließen<br />
auch in Schleswig-Holstein artenreiche Kulturökosysteme insbesondere im Grünlandbereich<br />
entstehen. Durch die heutigen, intensiven Formen der landwirtschaftlichen<br />
Bodennutzungen sind diese Ökosysteme jedoch in ihrem Bestand gefährdet:<br />
1. Der naturnahe Biotopanteil in Schleswig-Holstein beträgt heute nur noch etwa 6<br />
% der Lan<strong>des</strong>fläche. Die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu<br />
Lasten nicht oder extensiv genutzter Landschaftsteile hat insbesondere in den<br />
letzten 40 - 50 Jahren zu einem hohen Verlust an natürlichen oder naturnahen<br />
Lebensräumen (Biotopen) geführt.<br />
2. Der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft belastet<br />
und gefährdet darüber hinaus die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser<br />
und Luft.<br />
3. Über 50 % der in den „Roten Listen“ als bedroht und in ihrem Bestand als gefährdet<br />
aufgeführten Pflanzen- und Tierarten lebten früher in naturnah - extensiv<br />
- genutzten Landschaften, die heute intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet<br />
werden.<br />
Der „Vertrags-Naturschutz“ dient daher der Erhaltung und der <strong>Förderung</strong> alter Kulturökosysteme,<br />
d.h. artenreicher Grünland- und Ackerökosysteme. Die im Rahmen<br />
dieses Programmes geförderten Kulturbiotope bedürfen - mit der Ausnahme der 20jährigen<br />
Flächenstilllegung - im Unterschied zu den natürlichen Biotoptypen der kontinuierlichen<br />
Pflege, die in dem vorliegenden Programm „Vertrags-Naturschutz“ im<br />
Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung vorgenommen wird.<br />
*) Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) i.d.F. <strong>des</strong> Gesetzes zur Reform der agrarsozialen<br />
Sicherung (Agrarsozialreformgesetz 1995 - ASRG 1995) vom 29. Juli 1994 (BGBl. I<br />
S. 1890) zuletzt geändert durch Artikel 14 <strong>des</strong> Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
(Rentenreformgesetz 1999 - RRG 1999) vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2998)
Stand: 16.07.03<br />
- B 184 -<br />
Es handelt sich hierbei um i.d.R. besonders feuchte, nährstoffarme oder nährstoffreiche,<br />
sowie trockene, magere Grünlandstandorte, die für die Landwirtschaft i.d.R.<br />
Problemstandorte darstellen. Sie liegen in unterschiedlicher Ausdehnung vereinzelt<br />
oder auch großräumig innerhalb der o.g. 3 Naturräume Schleswig-Holsteins.<br />
detaillierte agronomische Berechnungen, aus denen Folgen<strong>des</strong> hervorgeht:<br />
a) Einkommensverluste und anfallende Kosten im Vergleich zur Anwendung<br />
der guten landwirtschaftlichen Praxis im üblichen Sinne, b) als Bezugspunkt<br />
dienende agronomische Annahmen, c) Höhe <strong>des</strong> Anreizes und Begründung<br />
<strong>des</strong> Anreizes anhand objektiver Kriterien<br />
Höhe der Ausgleichszahlung<br />
Die nachfolgende Berechnung der Einkommensverluste basieren auf der gegenwärtigen<br />
allgemeinen betriebswirtschaftlichen Situation in der Landwirtschaft. Hierbei ist<br />
bereits vorausgesetzt, dass die gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne<br />
angewandt wird.<br />
Innerhalb der Vertragsmuster „Amphibienschutz“, „Wiesenvogelschutz“, „Trauerseeschwalben“,<br />
„Sumpfdotterblumenwiesen“, „Kleinseggenwiesen“, „Trockenes Magergrünland“<br />
und „Nahrungsgebiete für Gänse und Enten“ können die Landwirte zwischen<br />
verschiedenen Auftriebszeiten, Besatzstärken und Mähterminen frei wählen,<br />
wobei eine Beratung der Landwirte hinsichtlich der individuellen Ansprüche <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong><br />
bei Vertragsabschluss erfolgt.<br />
Auf Grund der unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten liegt die Höhe der Ausgleichszahlung<br />
beim Vertragsmuster „Amphibienschutz“ zwischen 260 € und 320 €/ha,<br />
beim Vertragsmuster „Wiesenvogelschutz“ zwischen 325 € und 350 €/ha,<br />
beim Vertragsmuster „Trauerseeschwalben“ zwischen 235 € und 270 €/ha,<br />
beim Vertragsmuster „Sumpfdotterblumenwiesen“ zwischen 305 € und 360 €/ha,<br />
beim Vertragsmuster „Kleinseggenwiesen“ zwischen 290 € und 365 €/ha,<br />
beim Vertragsmuster „Trockenes Magergrünland“ zwischen 325 € und 380 €/ha<br />
und<br />
beim Vertragsmuster „Nahrungsgebiete für Gänse und Enten“ zwischen 205 € und<br />
225 €/ha.<br />
Zu diesem Betrag können zusätzlich folgende Ausgleichszahlungen hinzukommen:<br />
Für die Bereitstellung von größeren Flächenanteilen für die Durchführung biotopgestaltender<br />
Maßnahmen:<br />
1-2 % 25 €/ha<br />
> 2-4 % 50 €/ha<br />
> 4-6 % 75 €/ha<br />
> 6 % 100 €/ha.<br />
150 €/ha bei der Umwandlung von Acker- in Grünland (Vertragsmuster „Amphibienschutz“<br />
„Trockenes Magergrünland“ und „Nahrungsgebiete für Gänse und
Stand: 16.07.03<br />
- B 185 -<br />
Enten“). Dieser Betrag wird beim ersten Anschlussvertrag noch einmal für 5 Jahre<br />
gewährt.<br />
10 €/ha bei der Verwendung eines Balkenmähers.<br />
Beim Vertragsmuster „Rastplätze für wandernde Vogelarten“ liegt die Ausgleichszahlung<br />
bei 410 €/ha.<br />
Für das Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung“ errechnet sich die Höhe der<br />
Ausgleichszahlung aus einem Sockelbetrag (360 €/ha bei Ackerflächen und 310 €/ha<br />
bei Grünlandflächen) und einem zusätzlichen, ertragsabhängigen Betrag je Bodenpunkt<br />
und Hektar (5 €/Bodenpunkt und Hektar im Fall von Ackerflächen sowie 25<br />
€/ha für Bodenpunkte zwischen 0 und 20,50 €/ha für Bodenpunkte zwischen 20 und<br />
40,75 €/ha für Bodenpunkte zwischen 40 und 60 und 100 €/ha für Bodenpunkte über<br />
60 im Fall von Grünflächen).<br />
Berechnung der Ausgleichszahlungen<br />
Vorbemerkung<br />
Die nachfolgende Berechnung der Einkommensverluste basieren auf der gegenwärtigen<br />
allgemeinen betriebswirtschaftlichen Situation in der Landwirtschaft. Hierbei ist<br />
bereits vorausgesetzt, dass die gute fachliche landwirtschaftliche Praxis im üblichen<br />
Sinne abgewandt wird.<br />
Auf Grund der Auflagen (Verzicht auf Dünger und Pflanzenschutzmittel, Einschränkungen<br />
der Bodenbearbeitung sowie eine extensive Beweidung bzw. eine spätere<br />
erste Mahd) reduziert sich die nutzbare Energieleistung auf den geförderten Grünlandflächen<br />
um 25.000 MJNEL/ha bei den Vertragsmustern „Amphibienschutz“,<br />
„Wiesenvogelschutz“ und „Sumpfdotterblumenwiesen“ bzw. um20.000 MJNEL/ha bei<br />
den Vertragsmustern „Kleinseggenwiesen“ und „Trockenes Magergrünland“. Hierbei<br />
haben die unterschiedlichen Ausgangssituationen (ertragsreichere bzw. ertragsschwächere<br />
Standorte) Berücksichtigung gefunden.<br />
Neben dem Verlust an reiner Energieleistung wirkt sich auf den Standorten der Vertragsmuster<br />
„Kleinseggenwiesen“ und „Trockenes Magergrünland“ der ungünstigere<br />
Standort zusätzlich auf die Verwertung <strong>des</strong> erzeugten Grundfutters aus.<br />
Im Einzelnen ergibt sich hieraus folgende Situation:<br />
Vertragsmuster „Amphibienschutz“ (Durchschnittsgrünland):<br />
vorher: 45.000 MJNEL/ha<br />
nachher: 20.000 MJNEL/ha<br />
VERLUST: 25.000 MJNEL/ha.<br />
Vertragsmuster „Wiesenvogelschutz“ (sehr feuchtes <strong>bis</strong> nasses Grünland):<br />
vorher: 35.000 MJNEL/ha<br />
nachher: 10.000 MJNEL/ha<br />
VERLUST: 25.000 MJNEL/ha.
Stand: 16.07.03<br />
- B 186 -<br />
Vertragsmuster „Sumpfdotterblumenwiesen“ (artenreiches, relativ nährstoffreiches<br />
Feuchtgrünland):<br />
vorher: 35.000 MJNEL/ha<br />
nachher: 10.000 MJNEL/ha<br />
VERLUST: 25.000 MJNEL/ha.<br />
Vertragsmuster „Kleinseggenwiesen“ (artenreiches, relativ nährstoffarmes Feuchtgrünland):<br />
vorher: 30.000 MJNEL/ha<br />
nachher: 10.000 MJNEL/ha mit ungünstiger Verwertung<br />
VERLUST: 20.000 MJNEL/ha.<br />
Vertragsmuster „Trockenes Magergrünland“ (relativ nährstoffarmes Grünland):<br />
vorher: 30.000 MJNEL/ha<br />
nachher: 10.000 MJNEL/ha mit ungünstiger Verwertung<br />
VERLUST: 20.000 MJNEL/ha.<br />
Finanzieller Ausgleich<br />
Verlust an Energieleistung<br />
Um den Verlust an Energieleistung auszugleichen, gibt es für die Landwirte folgende<br />
Möglichkeiten:<br />
Zupacht von Flächen,<br />
Umwandlung von Acker- in Grünland (für Futtererzeugung),<br />
Grundfutterzukauf,<br />
Kraftfutterzukauf.<br />
Diese Möglichkeiten können von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich zur Deckung <strong>des</strong><br />
Energieverlustes genutzt werden. Da eine einzelbetriebliche Differenzierung mit einem<br />
vertretbaren Verwaltungsaufwand nicht möglich ist, sind bei der Berechnung<br />
<strong>des</strong> finanziellen Ausgleiches diese Möglichkeiten prozentual auf Grund folgender<br />
Überlegungen zu Grunde gelegt worden:<br />
Zupacht von Flächen<br />
Rund 35.000 ha landwirtschaftlich genutzter Flächen stehen in Schleswig-Holstein<br />
z.Z. auf dem Pachtmarkt jährlich zur Verfügung. Dieses entspricht einem Anteil von<br />
rd. 3,3 % der insgesamt landwirtschaftlich genutzten Fläche <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>. Da es unter<br />
anderem die kostengünstigste Ausweichmöglichkeit darstellt, wurde dieser Alternative<br />
eine Größenordnung von 50 % eingeräumt.<br />
Im Falle <strong>des</strong> Vertragsmusters „Amphibienschutz“ wurde dieser Anteil mit 90 % angenommen,<br />
da davon auszugehen ist, dass dies unter Berücksichtigung der in das<br />
Programm einbezogenen Standorte und der mit diesem Vertragsmuster verbundenen<br />
Auflagen im Vergleich zu den Alternativen „Umwandlung von Acker- in Grünland<br />
(für Futtererzeugung)“ und „Grundfutterzukauf“ die wahrscheinlichste Alternative darstellt.
Stand: 16.07.03<br />
- B 187 -<br />
Umwandlung von Acker- in Grünland (für Futtererzeugung)<br />
Neben der Zupacht von Flächen kommt dieser Alternative die zweite Priorität zu. Sie<br />
ist daher mit einer Größenordnung von 30 % in die Berechnung eingegangen.<br />
Grundfutterzukauf<br />
Diese Alternative ist nur mit Schwierigkeiten realisierbar. Grundfutter ist kein marktgängiges<br />
Produkt und wird allgemein nur in günstigen Jahren in geringen Mengen<br />
angeboten. Dieser Alternative ist daher eine Größenordnung von 10 % zugemessen<br />
worden.<br />
Kraftfutterzukauf<br />
Diese Alternative ist mit den höchsten Kosten verbunden. Aus betriebswirtschaftlicher<br />
Sicht wird sie i.d.R. nur genutzt, um kurzfristig einen Futter(Energie-)mangel der<br />
Ernte auszugleichen. Auf Dauer stellt sie keine Alternative dar. Sie kann jedoch erforderlich<br />
werden. Ein Kraftfutterzukauf ist daher ebenfalls nur in der Größenordnung<br />
von 10 % in die Berechnung eingegangen.<br />
Zusammenfassend errechnet sich hieraus - bezogen auf den Ersatz einer Energieleistung<br />
von 25.000 MJNEL/ha - folgender, finanziell auszugleichenden Betrag:<br />
Kosten/10 MJNEL Anteil der Berechnung (Jahr/ha)<br />
(Euro) (Euro)<br />
Zupacht 0,086 50 %<br />
108,60<br />
Umwandlung<br />
0,097<br />
Acker- in Grünland<br />
(für Futtererzeugung)<br />
30 % 80,80<br />
Grundfutterzukauf - 0,097 10 %<br />
24,30<br />
Kraftfutterzukauf 0,123 10 %<br />
30,70<br />
100 %<br />
244,40<br />
Berechnung nach KTBL-Betriebsplanung (1997/98) und Kalkulationsdaten der<br />
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (2001).
Stand: 16.07.03<br />
- B 188 -<br />
Bezogen auf den Ersatz einer Energieleistung von 20.000 MJNEL/ha errechnet sich<br />
analog folgender, finanziell auszugleichender Betrag:<br />
Kosten/10 MJNEL Anteil der Berechnung (Jahr/ha)<br />
(Euro) (Euro)<br />
Zupacht 0,086 50 %<br />
86,90<br />
Umwandlung<br />
0,097<br />
Acker- in Grünland<br />
(für Futtererzeugung)<br />
30 % 64,90<br />
Grundfutterzukauf - 0,097 10 %<br />
19,50<br />
Kraftfutterzukauf 0,123 10 %<br />
24,50<br />
100 %<br />
195,80<br />
Berechnung nach KTBL-Betriebsplanung (1997/98) und Kalkulationsdaten der<br />
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (2001).<br />
Zusätzliche Einkommensminderungen<br />
Ungünstigere Verwertung <strong>des</strong> Aufwuchses<br />
Im Vergleich zu den Vertragsmustern „Amphibienschutz“und „Wiesenvogelschutz“<br />
ergibt sich bei den Vertragsmustern „Kleinseggenwiesen“, „Sumpfdotterblumenwiesen“<br />
und „Trockenes Magergrünland“ eine zusätzliche Einkommensminderung auf<br />
Grund der hohen Auflagen zur Bewirtschaftung durch die ungünstigere Verwertung<br />
<strong>des</strong> noch verbleibenden Aufwuchses. Ihr wird Rechnung getragen, indem die Nutzung<br />
durch Milchkühe (als vorherige Nutzung angenommen) mit der Nutzung durch<br />
Färsenaufzucht (als verbleibende Nutzung prognostiziert) verglichen wird. Hierbei<br />
ergibt sich eine Differenz von 0,30 E/10 MJNEL und Hektar. Unter der Annahme,<br />
dass ein Flächenanteil von 10 % für die Milchkuhleistung ursprünglich in Anspruch<br />
genommen worden ist, resultiert hieraus eine zusätzliche Einkommensminderung<br />
von 0,03 E/10 MJNEL und Hektar.<br />
Grundbetrag<br />
Aus den o.g. Alternativen zum Ersatz der mit den Vertragsauflagen reduzierten Energieleistung,<br />
auf Grund der für die Vertragsmuster „Kleinseggenwiesen“, „Sumpfdotterblumenwiesen“<br />
und „Trockenes Magergrünland“ darüber hinaus zu berücksichtigenden<br />
schlechteren Verwertungsmöglichkeiten <strong>des</strong> auf den geförderten Flächen<br />
noch erzeugten Grundfutters ergibt sich für die einzelnen Vertragsmuster folgende<br />
Grundbetragsberechnung:<br />
Amphibienschutz: - Zupacht (90 %) 195,60 €/ha<br />
(Verlust: 25.000 MJNEL/ha) - Kraftfutterzukauf (10 %) 30,70 €/ha<br />
226,30 €/ha
Stand: 16.07.03<br />
- B 189 -<br />
Wiesenvogelschutz: - Zupacht (50 %) 108,60 €/ha<br />
(Verlust: 25.000 MJNEL/ha) - Umwandlung von<br />
Acker- in Grünland (30 %) 80,80 €/ha<br />
- Grundfutterzukauf (10 %) 24,30 €/ha<br />
- Kraftfutterzukauf (10 %) 30,70 €/ha<br />
244,40 €/ha<br />
Sumpfdotterblumenwiesen: - Zupacht (50 %) 108,60 €/ha<br />
(Verlust: 25.000 MJNEL/ha) - Umwandlung von<br />
Acker- in Grünland (30 %) 80,80 €/ha<br />
- Grundfutterzukauf (10 %) 24,30 €/ha<br />
- Kraftfutterzukauf (10 %) 30,70 €/ha<br />
Einkommensminderung durch<br />
ungünstige Verwertung <strong>des</strong><br />
Aufwuchses (50 %) 30,70 €/ha<br />
275,10 €/ha<br />
Kleinseggenwiesen: - Zupacht (50 %) 86,90 €/ha<br />
(Verlust: 20.000 MJNEL/ha - Umwandlung von<br />
Acker- in Grünland (30 %) 64,90 €/ha<br />
- Grundfutterzukauf (10 %) 19,50 €/ha<br />
- Kraftfutterzukauf (10 %) 24,50 €/ha<br />
Einkommensminderung<br />
durch ungünstige Verwertung<br />
<strong>des</strong> Aufwuchses (50 %) 30,70 €/ha<br />
226,50 €/ha<br />
Trockenes Magergrünland: - Zupacht (50 %) 86,90 €/ha<br />
(Verlust: 20.000 MJNEL/ha - Umwandlung von<br />
Acker- in Grünland (30 %) 64,90 €/ha<br />
- Grundfutterzukauf (10 %) 19,50 €/ha<br />
- Kraftfutterzukauf (10 %) 24,50 €/ha<br />
Einkommensminderung<br />
durch ungünstige Verwertung<br />
<strong>des</strong> Aufwuchses (50 %) 30,70 €/ha<br />
226,50 €/ha<br />
Ausgleich für weitergehende Auflagen<br />
Innerhalb der einzelnen Vertragsmuster können die Landwirte vor Ort zwischen verschiedenen<br />
Schnittzeitpunkten, unterschiedlichen Beweidungszeiten und Besatzstärken<br />
wählen. Die Bewirtschaftungsauflagen in den o.g. Verträgen weisen somit<br />
eine hohe Flexibilität auf, die der Landwirt vor Ort in Anspruch nehmen kann. Die<br />
Berechnung <strong>des</strong> o.g. Grundbetrages beruht auf der in den Verträgen enthaltenen<br />
günstigsten Annahme der noch zugelassenen Bewirtschaftung. Um auch die anderen<br />
Vertragsmöglichkeiten finanziell zu berücksichtigen, sind weitere Berechnungen<br />
wie folgt vorgenommen worden und in die Gesamthöhe der Ausgleichszahlung mit<br />
eingeflossen:
Stand: 16.07.03<br />
- B 190 -<br />
Einkommensminderung durch verzögerten Schnittzeitpunkt<br />
In die Berechnung sind dann zusätzliche Einkommensminderungen durch späte<br />
erste Schnittzeitpunkte berücksichtigt worden, wenn diese nach dem 15. Juni liegen:<br />
Schnittzeitpunkt zwischen 15. und 20. Juni: 20,50 €/ha<br />
0,3 MJNEL unter Soll von 5,2 MJNEL/kg TS<br />
10.000 MJNEL/ha (50 % <strong>des</strong> Jahresaufwuchses) : 4,9 MJNEL/kg TS = 2.041 kg<br />
TS/ha<br />
2.041 kg TS/ha x 0,3 MJNEL/kg TS = 612 MJNEL/ha<br />
612 MJNEL/ha x Faktor 2 (Aufwertungszuschuss) = 1.224 MJNEL/ha Energiedefizit<br />
1.224 MJNEL/ha x 0,32 DM (rd. 0,18 E/10 MJNEL *) =<br />
20,50 €/ha Einkommensminderung<br />
Schnittzeitpunkt zwischen 20. und 30. Juni: 35,80 €/ha<br />
0,5 MJNEL unter Soll von 5,2 MJNEL/kg TS<br />
10.000 MJNEL/ha (50 % <strong>des</strong> Jahresaufwuchses) : 4,7 MJNEL/kg TS = 2.128 kg<br />
TS/ha<br />
2.128 kg TS/ha x 0,5 MJNEL/kg TS = 1.064 MJNEL/ha<br />
1.064 MJNEL/ha x Faktor 2 (Aufwertungszuschuss) = 2.128 MJNEL/ha Energiedefizit<br />
2.128 MJNEL/ha x 0,18 E/10 MJNEL*) =<br />
35,80 €/ha/Einkommensminderung<br />
Schnittzeitpunkt zwischen 30. Juni und 7. Juli: 48,50 €/ha<br />
0,6 MJNEL unter Soll von 5,2 MJNEL/kg TS<br />
11.000 MJNEL/ha (55 % <strong>des</strong> Jahresaufwuchses) : 4,6 MJNEL/kg TS = 2.391 kg<br />
TS/ha<br />
2.391 kg TS/ha x 0,6 MJNEL/kg TS = 1.435 MJNEL/ha<br />
1.435 MJNEL/ha x Faktor 2 (Aufwertungszuschuss) = 2.870 MJNEL/ha Energiedefizit<br />
2.870 MJNEL/ha x 0,18 E/10 MJNEL*) =<br />
48,50 €/ha Einkommensminderung<br />
Schnittzeitpunkt nach dem 7. Juli: 61,40 €/ha<br />
0,6 MJNEL unter Soll von 5,2 MJNEL/kg TS<br />
14.000 MJNEL/ha (70 % <strong>des</strong> Jahresaufwuchses) : 4,6 MJNEL/kg TS = 3.044 kg<br />
TS/ha<br />
3.044 kg TS/ha x 0,6 MJNEL/kg TS = 1.826 MJNEL/ha<br />
1.826 MJNEL/ha x Faktor 2 (Aufwertungszuschuss) = 3.652 MJNEL/ha Energiedefizit<br />
3.652 MJNEL/ha x 0,18 E/10 MJNEL*) =<br />
61,40 €/ha Einkommensminderung<br />
*)<br />
Differenz zwischen Kraftfutterpreis 0,27 E/10 MJNEL) und gewogenem Mittel der Kosten für fehlende<br />
Energie 0,09 E/10MJNEL)
Stand: 16.07.03<br />
- B 191 -<br />
Schnittzeitpunkt nach dem 15. August: 104,30 €/ha<br />
0,8 MJNEL unter Soll von 5,2 MJNEL/kg TS<br />
17.000 MJNEL/ha (85 % <strong>des</strong> Jahresaufwuchses) : 4,4 MJNEL/kg TS = 3.864 kg<br />
TS/ha<br />
3.864 TS/ha x 0,8 MJNEL/kg TS = 3.091 MJNEL/ha<br />
3.091 MJNEL/ha x Faktor 2 (Aufwertungszuschuss) = 6.182 MJNEL/ha Energiedefizit<br />
6.182 MJNEL/ha x 0,18 €/10 MJNEL * ) =<br />
104,30 €-/ha Einkommensminderung<br />
Schnittzeitpunkt nach dem 1. September: 127,30 €/ha<br />
0,9 MJNEL unter Soll von 5,2 MJNEL/kg TS<br />
18.000 MJNEL/ha (90 % <strong>des</strong> Jahresaufwuchses) : 4,3 MJNEL/kg TS = 4.186 kg<br />
TS/ha<br />
4.186 kg TS/ha x 0,9 MJNEL/kg TS = 3.767 MJNEL/ha<br />
3.767 MJNEL/ha x Faktor 2 (Aufwertungszuschuss) = 7.534MJNEL/ha Energiedefizit<br />
7.534 MJNEL/ha x 0,18 E/10 MJNEL* =<br />
127,30 €/ha Einkommensminderung<br />
Berechnung nach KTBL - Kalkulationsdaten für die Grünlandbewirtschaftung unter<br />
Naturschutzauflagen (A. MÄHRLEIN 1993) und Kalkulationsdaten der Landwirtschaftskammer<br />
(2001).<br />
Einkommensminderung durch reduzierte Weidetage<br />
Die Berechnung berücksichtigt zusätzliche Einkommensminderungen durch reduzierte<br />
Weidetage, wenn die Auftriebszeit nach dem 1. Mai liegt. Hierbei ist, den Vertragsmustern<br />
angepasst, von jeweils unterschiedlichen Besatzstärken ausgegangen<br />
worden:<br />
Amphibienschutz: 2, 3 bzw. 4 Tiere<br />
Wiesenvogelschutz: 2 bzw. 4 Tiere<br />
Sumpfdotterblumenwiesen: 0,5, 1 bzw. 2 Tiere<br />
Kleinseggenwiesen: 0,5 bzw. 1 Tier<br />
Trockenes Magergrünland: 0,5 bzw. 1 Tier.<br />
Berechnungsgrundlage ist: 1 Tier - Weidetag à. 0,60 E/Tag (Preis für Pensionstiere<br />
- 500 kg - an der Westküste Schleswig-Holsteins).<br />
Bei der Berechnung der Ausgleichszahlung für reduzierte Beweidung beim Vertragsmuster<br />
„Amphibienschutz“ wurde statt 1 Tier 0,5Tiere zu Grunde gelegt, da davon<br />
auszugehen ist, dass zur Ausnutzung <strong>des</strong> Aufwuchses statt leichter Jungtiere<br />
eher schwere Tiere aufgetrieben werden.<br />
*<br />
) Differenz zwischen Kraftfutterpreis (0,27 E/10 MJNEL) und gewogenem Mittel der Kosten für<br />
fehlende Energie (0,09 E/10 MJNEL)
Stand: 16.07.03<br />
- B 192 -<br />
Einkommensminderung durch die Anlage biotopgestaltender Maßnahmen<br />
Mit dem Vertragsabschluss verpflichten sich die Landwirte neben einer extensiven<br />
Bewirtschaftungsweise der Flächen, min<strong>des</strong>tens 2 % der Vertragsflächen dauerhaft<br />
für die Anlage einer biotopgestaltenden Maßnahme (Biotopfläche) aus der Nutzung<br />
zu nehmen.<br />
Bei einem Kaufpreis von durchschnittlich 8.750 €/ha<br />
verteilt auf 5 Jahre ergibt sich bei 200 m 2 ein Betrag von 35 E/ha).<br />
Anreiz<br />
Ziel <strong>des</strong> Vertrags-<strong>Naturschutzes</strong> ist es, möglichst langfristig eine extensive Bewirtschaftungsweise<br />
auf ein und derselben Fläche aufrechtzuerhalten. Daher soll bei<br />
einem sich unmittelbar anschließenden, neuen 5-jährigen Verpflichtungszeitraum ein<br />
um. 25 E/ha höherer Ausgleich (= Anreiz) gezahlt werden. Er liegt zwischen 7 und<br />
12,4 % unter Berücksichtigung der oben errechneten Ausgleichshöhe.<br />
Auf Grund der erschwerten Bewirtschaftungsverhältnisse auf Flächen der Vertragsmuster,<br />
„Kleinseggenwiesen“ und „Trockenes Magergrünland“ sowie auf Grund der<br />
Bemühung, im Rahmen <strong>des</strong> Vertragsmusters „Trauerseeschwalbe“ Grünland auf<br />
ackerfähigen Standorten zu erhalten, ist dieser Anreiz beim Vertragsmuster „Kleinseggenwiesen“<br />
für alle Vertragsvarianten, beim Vertragsmuster „Trockenes Magergründland“<br />
für die Vertragsvarianten „Beweidung“ sowie beim Vertragsmuster „Trauerseeschwalbe“<br />
für alle Vertragsvarianten von vornherein in die Ausgleichszahlung<br />
mit einbezogen worden.<br />
Bezug zu Art. 31, Abs. 2, Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999<br />
Die Vertragsmuster im Grünlandbereich beinhalten keine Ausgleichszahlungen pro<br />
Vieheinheit. Die gewährten Ausgleichszahlungen basieren auf einer durch Einschränkungen<br />
hinsichtlich der Düngung, der Bodenbearbeitung sowie der Beweidungszeit<br />
und <strong>des</strong> Schnittzeitpunktes eintretenden Reduzierung der nutzbaren Energieleistung<br />
auf einzelnen, ausgewählten Grünlandflächen eines Betriebes.<br />
Höhe der Ausgleichszahlungen der einzelnen Vertragsmuster<br />
Zusammenfassend ergeben sich die in der folgenden Übersicht dargestellten Entschädigungshöhen<br />
für die einzelnen Vertragsmuster:
Stand: 16.07.03<br />
- B 193 -<br />
Tabelle 4: Höhe der Ausgleichszahlungen der einzelnen Vertragsmuster<br />
Amphibienschutz<br />
Variante Entschädigung/Jahr während <strong>des</strong> ersten<br />
fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
Mahd/Beweidung<br />
1. Mai - 31. Oktober<br />
(4 Tiere)<br />
260 €/ha<br />
10. Mai - 31. Oktober<br />
(4 Tiere)<br />
280 €/ha<br />
1. Mai - 31. Oktober<br />
(3 Tiere)<br />
310 €/ha<br />
10. Mai - 31. Oktober<br />
(3 Tiere)<br />
320 €/ha<br />
1. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 15. Juni<br />
nach Mahd – 31. Oktober (4<br />
Tiere)<br />
280 €/ha<br />
10. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 15. Juni<br />
nach Mahd – 31. Oktober (4<br />
Tiere)<br />
261 €/ha<br />
für alle weiteren<br />
fünfjährigen<br />
Verpflichtungszeiträume<br />
Berechnung:<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha 285 €/ha<br />
281 €/ha<br />
Berechnung:<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
– Biotopfläche: 35 €/ha<br />
– verzögerter Weidegang: 20 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 Ex 9 Tage x 4 Tiere) 305 €/ha<br />
315 €/ha<br />
Berechnung:<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- reduzierte Beweidung: 54 €/ha<br />
1. Mai - 31. Oktober:<br />
(0,6 E x 180 Tage x 0,6 Tiere) 335 €/ha<br />
323 €/ha<br />
Berechnung:<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
– Biotopfläche: 35 €/ha<br />
– reduzierte Beweidung: 54 €/ha<br />
1. Mai - 31. Oktober:<br />
(0,6 E x 180 Tage x 0,6 Tiere)<br />
- verzögerter Weidegang: 8 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 E x 9 Tage x 1,5 Tiere) 345 €/ha<br />
281 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 20 €/ha 305 €/ha<br />
291 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 20 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 10 €/ha<br />
1. - 9. Mai:
Stand: 16.07.03<br />
- B 194 -<br />
290 €/ha (0,6 E x 9 Tage x 2 Tiere) 315 €/ha
1. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 25. Juni<br />
nach Mahd – 31. Oktober (4<br />
Tiere)<br />
295 €/ha<br />
10. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 25. Juni<br />
nach Mahd – 31. Oktober<br />
(4 Tiere)<br />
305 €/ha<br />
1. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 5. Juli<br />
nach Mahd – 31. Oktober (4<br />
Tiere)<br />
310 €/ha<br />
10. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 5. Juli<br />
nach Mahd – 31. Oktober<br />
(4 Tiere)<br />
320 €/ha<br />
Wiesenvogelschutz<br />
Stand: 16.07.03<br />
296 €/ha<br />
- B 195 -<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 35 €/ha 320 €/ha<br />
306 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 35 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 10 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 E x 9 Tage x 2 Tiere) 330 €/ha<br />
310 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 49 €/ha 335 €/ha<br />
320 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 226 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 49 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 10 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 E x 9 Tage x 2 Tiere) 345 €/ha<br />
Variante Entschädigung/Jahr während <strong>des</strong> ersten<br />
fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
Mahd/Beweidung<br />
10. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 25. Juni<br />
nach Mahd – 31. Oktober (4<br />
Tiere)<br />
325 €/ha<br />
10. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 5. Juli<br />
nach Mahd – 31. Oktober (4<br />
Tiere)<br />
325 €/ha<br />
für alle weiteren<br />
fünfjährigen<br />
Verpflichtungszeiträume<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 245 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 35 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 10 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 E x 9 Tage x 2 Tiere) 350 €/ha<br />
339 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 245 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 49 €/ha
340 €/ha<br />
10. Mai <strong>bis</strong> Mahd (2 Tiere)<br />
Mahd ab 31. Juli<br />
nach Mahd – 31. Oktober (4<br />
Tiere)<br />
350 €/ha<br />
Sumpfdotterblumenwiesen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 196 -<br />
- verzögerter Weidegang: 10 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 E x 9 Tage x 2 Tiere) 365 €/ha<br />
351 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 245 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt:61 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 10 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 E x 9 Tage x 2 Tiere) 375 €/ha<br />
Variante Entschädigung/Jahr während <strong>des</strong> ersten<br />
fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
Mahd<br />
Mahd ab 15. Juni<br />
330 €/ha<br />
Mahd ab 1. Juli<br />
360 €/ha<br />
Mahd/Beweidung<br />
Mahd ab 15. Juni<br />
nach Mahd – 31. Oktober (2<br />
Tiere)<br />
305 €/ha<br />
Mahd ab 1. Juli<br />
nach Mahd – 31. Oktober<br />
(2 Tiere)<br />
330 €/ha<br />
Beweidung<br />
1. Mai - 30. Juni (1,5 Tiere)<br />
1. Juli - 31. Oktober<br />
(2-3 Tiere)<br />
330 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 275 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 20 €/ha<br />
359 €/ha<br />
für alle weiteren<br />
fünfjährigen<br />
Verpflichtungszeiträume<br />
355 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 275 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt:49 €/ha 385 €/ha<br />
305 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 275 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 20 €/ha<br />
- zulässige Beweidung:<br />
pauschaler Abzug: ./. = 25 €/ha 335 €/ha<br />
334 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 275 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 49 €/ha<br />
- zulässige Beweidung:<br />
pauschaler Abzug: . = 25 €/ha 355 €/ha<br />
310 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 275 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha
Stand: 16.07.03<br />
- B 197 -<br />
310 €/ha 335 €/ha<br />
10. Mai - 30. Juni<br />
(1,5 Tiere)<br />
320 €/ha<br />
1. Juli - 31. Oktober<br />
Berechnung<br />
(2-3 Tiere)<br />
- Grundbetrag: 275 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 10 €/ha<br />
320 €/ha<br />
1. - 9. Mai: (0,6 E x 9 Tage x 1,5 Tiere) 345 €/ha<br />
Kleinseggenwiesen<br />
Variante Entschädigung/Jahr während <strong>des</strong> ersten<br />
fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
Mahd<br />
Mahd ab 15. August<br />
365 €/ha<br />
Mahd/Beweidung<br />
Mahd ab 15. August<br />
nach Mahd - 31. Oktober<br />
(2 Tiere)<br />
315 €/ha<br />
Beweidung<br />
1. Mai - 31. Oktober<br />
(1 Tier)<br />
290 €/ha<br />
10. Mai - 31. Oktober<br />
(1 Tier)<br />
295 €/ha<br />
Trockenes Magergrünland<br />
366 €/ha<br />
für alle weiteren<br />
fünfjährigen<br />
Verpflichtungszeiträume<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 104 €/ha 365 €/ha<br />
316 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 104 €/ha<br />
- ./.: 50 €/ha (pauschal)<br />
für nach Mahd zulässiger Beweidung 315 €/ha<br />
287 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- Anreiz: 25 €/ha 290 €/ha<br />
292 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang : 5 €/ha<br />
1. - 9. Mai:<br />
(0,6 E x 9 Tage x 1 Tier)<br />
- Anreiz: 25 €/ha 295 €/ha<br />
Variante Entschädigung/Jahr während <strong>des</strong> ersten<br />
fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
für alle weiteren<br />
fünfjährigen<br />
Verpflichtungszeiträume
Mahd<br />
Mahd ab 1. September<br />
325 €/ha<br />
Beweidung<br />
1. September -<br />
30. November<br />
(Tierzahl unbegrenzt)<br />
15. April - 14. Mai<br />
(Tierzahl unbegrenzt)<br />
355/ha<br />
1. September – 14. Mai<br />
(2 Tiere)<br />
355 €/ha<br />
1. August - 14. Mai<br />
(1 Tier)<br />
380 €/ha<br />
Stand: 16.07.03<br />
326 €/ha<br />
- B 198 -<br />
Berechnung<br />
– Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 64 €/ha<br />
(127 €/ha pauschal um 50 % gekürzt auf<br />
Grund der ertragsarmen Ausgangssituation)<br />
353 €/ha<br />
350 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 66 €/ha<br />
15. Mai - 31. August:<br />
(0,6 Ex 105 Tage x 1 Tier)<br />
- Anreiz: 25 €/ha 355/ha<br />
353 €/ha<br />
Vertragsmuster „Trauerseeschwalben“<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 66 €/ha<br />
15. Mai - 31. August:<br />
(0,6 E x 105 Tage x 1 Tier)<br />
- Anreiz: 25 €/ha 355 €/ha<br />
379 €/ha<br />
Berechnung<br />
- Grundbetrag: 227 €/ha<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
- verzögerter Weidegang: 92 €/ha<br />
15. Mai - 31. Juli:<br />
(0,6 E x 75 Tage x 2 Tiere)<br />
- Anreiz: 25 €/ha 380 €/ha<br />
Den Einkommensminderungen im Rahmen <strong>des</strong> Vertragsmusters „Trauerseeschwalben“<br />
liegt folgende Berechnung zu Grunde:<br />
1. Mähweide mit 1. Schnitt nach dem 20.06. (max. 120 kg/ha Gesamt -N; max. 4<br />
Tiere/ha)<br />
vorher: 170 kg N/ha = 49.000 MJNEL/ha Ertrag<br />
nachher: 96 kg N/ha 1) = 31.000 MJNEL/ha Ertrag<br />
Minderertrag = 18.000 MJNEL/ha<br />
Berechnung:<br />
18.000 MJNEL/ha x 0,10 E/10 MJNEL 2) = 175 €/ha Einkommensminderung.<br />
1) 80 % N-Ausnutzung im Anwendungsjahr bei regelmäßiger Gülleanwendung unterstellt
Stand: 16.07.03<br />
- B 199 -<br />
2) Kosten der fehlenden Energie bei Zupacht ( Ackergras/Silomais) aus<br />
Berechnungsgrundlagen der Landwirtschaftskammer zu Einkommensminderungen<br />
im Vertrags-Naturschutz (2001).<br />
2. Mähweide mit 1. Schnitt nach dem 20.06. (max. 80 kg/ha Gesamt -N; max. 4<br />
Tiere/ha)<br />
vorher: 170 kg N/ha = 49.000 MJNEL/ha Ertrag<br />
nachher: 64 kg N/ha 1) = 28.000 MJNEL/ha Ertrag<br />
Minderertrag = 21.000 MJNEL/ha<br />
Berechnung:<br />
21.000 MJNEL/ha x 0,10 E/10 MJNEL 2) = 204 €/ha Einkommensminderung.<br />
1) 80 % N-Ausnutzung im Anwendungsjahr bei regelmäßiger Gülleanwendung unterstellt<br />
2) Kosten der fehlenden Energie bei Zupacht ( Ackergras/Silomais) aus<br />
Berechnungsgrundlagen der Landwirtschaftskammer zu Einkommensminderungen<br />
im Vertrags-Naturschutz (2001).<br />
3. Standweide (max. 80 kg/ha Gesamt-N, max. 4 Tiere/ha)<br />
vorher: 166 kg N/ha = 33.500 MJNEL/ha Ertrag<br />
nachher: 64 kg N/ha 1) = 15.000 MJNEL/ha Ertrag<br />
Minderertrag = 18.500 MJNEL/ha<br />
Berechnung:<br />
18.500 MJNEL/ha x 0,10 E/10 MJNEL 2) = 180 €/ha Einkommensminderung.<br />
1) 80 % N-Ausnutzung im Anwendungsjahr bei regelmäßiger Gülleanwendung unterstellt<br />
2) Kosten der fehlenden Energie bei Zupacht ( Ackergras/Silomais) aus<br />
Berechnungsgrundlagen der Landwirtschaftskammer zu Einkommensminderungen<br />
im Vertrags-Naturschutz (2001).<br />
4. Standweide (max. 80 kg/ha Gesamt-N; max. 3 Tiere/ha)<br />
Durch die Reduzierung der Besatzdichte auf 3 Tiere/ha werden zusätzlich Futterverluste<br />
(überständiges Gras, schlechtere Qualität) in Höhe von 3.218 MJNEL/ha erwartet:<br />
vorher: 166 kg N/ha = 33.500 MJNEL/ha Ertrag<br />
nachher: 64 kg N/ha 1) = 12.000 MJNEL/ha Ertrag<br />
Minderertrag = 21.500 MJNEL/ha<br />
Berechnung:<br />
21.500 MJNEL/ha x 0,10 E/10 MJNEL 2) = 209 €/ha Einkommensminderung.<br />
1) 80 % N-Ausnutzung im Anwendungsjahr bei regelmäßiger Gülleanwendung unterstellt<br />
2) Kosten der fehlenden Energie bei Zupacht ( Ackergras/Silomais) aus<br />
Berechnungsgrundlagen der Landwirtschaftskammer zu Einkommensminderungen<br />
im Vertrags-Naturschutz (2001).<br />
Es ergeben sich somit folgende Ausgleichszahlungen:
Stand: 16.07.03<br />
- B 200 -<br />
Variante Entschädigung/Jahr während <strong>des</strong> ersten<br />
fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
Beweidung/Mahd<br />
01. Januar - 31. Dezember<br />
(4 Tiere)<br />
Mahd ab 20. Juni<br />
Düngung 80 kg N/ha<br />
260 €/ha<br />
01. Januar – 31. Dezember<br />
(4 Tiere)<br />
Mahd ab 20. Juni<br />
Düngung 120 kg N/ha<br />
235 €/ha<br />
Beweidung<br />
01. Januar - 31. Dezember<br />
(3 Tiere)<br />
Düngung 80 kg N/ha<br />
270 €/ha<br />
01. Januar – 30. April<br />
15. Mai - 31. Dezember<br />
(4 Tiere)<br />
Düngung 80 kg N/ha<br />
240 €/ha<br />
264 €/ha<br />
Berechnung<br />
Grundbetrag: 204 €/ha<br />
Biotopfläche: 35 €/ha<br />
Anreiz: 25 €/ha<br />
235 €/ha<br />
Berechnung<br />
Grundbetrag: 175 €/ha<br />
Biotopfläche: 35 €/ha<br />
Anreiz: 25 €/ha<br />
269 €/ha<br />
Berechnung<br />
Grundbetrag: 209 €/ha<br />
Biotopfläche: 35 €/ha<br />
Anreiz: 25 €/ha<br />
240 €/ha<br />
Berechnung<br />
Grundbetrag: 180 €/ha<br />
Biotopfläche: 35 €/ha<br />
Anreiz: 25 €/ha<br />
für alle weiteren<br />
fünfjährigen<br />
Verpflichtungszeiträume<br />
260 €/ha<br />
235 €/ha<br />
270 €/ha<br />
240 €/ha<br />
Da bei einer reinen Schafbeweidung die Vertrittschäden durch die höhere Anzahl<br />
von Tieren im Vergleich zu einer ausschließlichen Beweidung mit Rindern oder Rindern<br />
und Schafen wesentlich höher sind, sollten zum Schutz der Trauerseeschwalbe<br />
möglichst maximal die Hälfte der Tiere Schafe sein. Um diese zu erreichen, erfolgt<br />
bei einer reinen Schafbeweidung ein pauschaler Abzug von 50 €/ha.<br />
Vertragsmuster „Nahrungsgebiete für Gänse und Enten“<br />
Bei den innerhalb dieses Vertragsmusters geförderten Flächen handelt es sich um<br />
überdurchschnittlich ertragreiches Grünland (55.000 MJNEL), auf dem die Bewirtschaftung<br />
so ausgerichtet werden soll, dass Gänse und Enten während <strong>des</strong> Winterhalbjahres<br />
optimale Ernährungsmöglichkeiten vorfinden. Gleichzeitig dienen die<br />
Auflagen dem Schutz der hier vorkommenden Wiesenvögel.<br />
Die durch die verspäteten Schnittzeitpunkte (15. Juni/25. Juni und 5. Juli) angenommene<br />
Ertragsverluste errechnen sich wie folgt:<br />
Schnittzeitpunkt 15. Juni:<br />
55.000 MJNEL/ha x 40 % (1. Schnitt) x 20 % Ertragsverlust = 4.400 MJNEL/ha
Stand: 16.07.03<br />
- B 201 -<br />
4.400 MJNEL/ha x 0,24 E/10 MJNEL (Flächenzupacht Silomais/Ackergras in<br />
Ertragsstufe I)<br />
= 106 €/ha<br />
Schnittzeitpunkt 25. Juni:<br />
55.000 MJNEL/ha x 45 % (1. Schnitt) x 20 % Ertragsverlust = 4.950 MJNEL/ha<br />
4.950 MJNEL/ha x 0,24 E/10 MJNEL (Flächenzupacht Silomais/Ackergras in<br />
Ertragsstufe I)<br />
= 119 €/ha<br />
Schnittzeitpunkt 5. Juli:<br />
55.000 MJNEL/ha x 50 % (1. Schnitt) x 20 % Ertragsverlust = 5.500 MJNEL/ha<br />
5.500 MJNEL/ha x 0,24 E/10 MJNEL (Flächenzupacht Silomais/Ackergras in<br />
Ertragsstufe I)<br />
= 132 €/ha<br />
Der Ausgleichsberechnung wurde eine 2/3 Weide- und eine 1/3 Mähnutzung zu<br />
Grunde gelegt.<br />
Berechnung nach Kalkulationsdaten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein<br />
(2001).<br />
Es ergeben sich somit folgende Ausgleichszahlungen:<br />
Variante Entschädigung/Jahr während <strong>des</strong> ersten<br />
fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes<br />
Beweidung/Mahd<br />
1. Mai – 15. Juni (2 Tiere)<br />
Mahd ab 15. Juni<br />
15. Juni – 15. Oktober<br />
(Tierzahl unbegrenzt)<br />
205 €/ha<br />
1. Mai – 15. Juli (2 Tiere)<br />
Mahd ab 5. Juli<br />
5. Juli – 15. Oktober<br />
(Tierzahl unbegrenzt)<br />
208 €/ha<br />
Berechnung<br />
- reduzierter Weidegang: 138 €/ha<br />
1. Mai – 15. Juni:<br />
0,6 € x 45 Tage x 1 Tier<br />
zu 2/3 = 18 €/ha<br />
16. Oktober – 30. April<br />
0,6 € x 195 Tage x 1,5 Tiere<br />
zu 2/3 = 120 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 35 €/ha<br />
(106 €/ha zu 1/3)<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
225 €/ha<br />
Berechnung<br />
- reduzierter Weidegang: 146 €/ha<br />
1. Mai – 5. Juli:<br />
0,6 € x 65 Tage x 1 Tier<br />
zu 2/3 = 26 €/ha<br />
16. Oktober – 30. April:<br />
0,6 € x 195 Tage x 1,5 Tiere<br />
zu 2/3 = 120 €/ha<br />
- verzögerter Schnittpunkt: 44 €/ha<br />
(123 €/ha zu 1/3)<br />
für alle weiteren<br />
fünfjährigen<br />
Verpflichtungszeiträume<br />
205 €/ha
225 €/ha<br />
1. Mai – 25. Juni (2 Tiere)<br />
Mahd ab 25. Juni<br />
25. Juni – 15. Oktober<br />
(Tierzahl unbegrenzt)<br />
215 €/ha<br />
1. Mai – 15. Oktober<br />
(Tierzahl unbegrenzt)<br />
200 €/ha<br />
- B 202 -<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
217 €/ha<br />
Berechnung<br />
- reduzierter Weidegang: 142 €/ha<br />
16. Oktober – 30. April:<br />
0,6 € x 195 Tage x 1,5 Tiere<br />
zu 2/3 = 120 €/ha<br />
1. Mai – 25. Juni:<br />
0,6 € x 55 Tage x 1 Tier<br />
zu 2/3 = 22 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 40 €/ha<br />
(119 €/ha zu 1/3)<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
199 €/ha<br />
Berechnung<br />
- reduzierter Weidegang: 120 €/ha<br />
16. Oktober – 30. April:<br />
0,6 € x 195 Tage x 1,5 Tiere<br />
zu 2/3 = 120 €/ha<br />
- verzögerter Schnittzeitpunkt: 44 €/ha<br />
(132 €/ha zu 1/3)<br />
- Biotopfläche: 35 €/ha<br />
Bei diesem Vertragsmuster wird auf einen Anreiz verzichtet.<br />
Vertragsmuster „Rastplätze für wandernde Vogelarten“<br />
225 €/ha<br />
215 €/ha<br />
200 €/ha<br />
Die Höhe der Ausgleichszahlung beruht auf<br />
- den zusätzlichen Kosten für den Anbau der Winterfucht (Winterweizen/Winterraps)<br />
im Herbst und<br />
- der Deckungsbeitragsminderung durch die ertragsschwächere Sommerung.<br />
Unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der Marsch sind die nachfolgenden<br />
Leistungen und Kosten der verschiedenen Produktionsverfahren ermittelt<br />
worden. Hierbei wurden folgende Kalkulationshilfsmittel und Unterlagen verwendet:<br />
- Kalkulationsdaten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 2002<br />
- KTBL-Betriebsplanung 2002/03 und KTBL-Taschenbuch 2000/01<br />
- Ackerflächennutzung in der Marsch von 1996 – 2002 (Statistisches Lan<strong>des</strong>amt).<br />
1. Ermittlung der zusätzlichen Saatkosten für Winterweizen und Winterraps<br />
Berechnung:<br />
70 €/ha Weizen x 80 % = 56 €/ha + 50 €/ha Raps x 20 % = 10 €/ha<br />
Summe: 66 €/ha<br />
2. Ermittlung der zusätzlichen Maschinen- und Arbeitskosten für den Anbau von<br />
Winterweizen und Winterraps<br />
Stand: 16.07.03
- B 203 -<br />
Berechnung:<br />
1 x Scheibenegge:<br />
8,1 €/ha Scheibenegge + 6,3 €/ha Schlepper + 7,4 €/ha AK = 21,8 €/ha<br />
1 x Pflug/Packer:<br />
17,4 €/ha Pflug/Packer + 19,6 €/ha Schlepper + 21,0 €/ha AK = 58 €/ha<br />
1 x Kreiselegge/Drille:<br />
9,3 €/ha Kreisel./Drille + 8,8 €/ha Schlepper + 13,1 €/ha AK = 31,2 €/ha<br />
Summe: 111 €/ha<br />
Bei den Maschinenkosten wird eine Mechanisierung mit eigenen Maschinen auf 5<br />
ha-Schlägen unterstellt. Dabei wird eine Nutzung unter „AfA-Schwelle“ angenommen,<br />
d.h. für zusätzliche Maschinenarbeiten entstehen nur variable Kosten.<br />
3. Ermittlung der Deckungsbeitragsdifferenz Winterung/Sommerung<br />
Berechnung<br />
Frucht W-Weizen W-Raps S-Weizen S-Gerste<br />
Ertrag dt/ha 90 40 70 60<br />
Preis €/ha 11,50 25,00 11,50 10,50<br />
Leistung €/ha 1.235 1.000 805 630<br />
Prämie €/ha 408 408 408 408<br />
Leistung €/ha 1.443 1.408 1.213 1.038<br />
Saat- und Pflanzgut 70 60 70 55<br />
Stickstoff 130 87 87 62<br />
Phosphor 39 39 33 28<br />
Kalium 38 60 33 30<br />
Kalk, Magnesium 20 20 20 20<br />
Sa.Düngemittel 227 206 173 140<br />
Herbizide 50 90 45 35<br />
Fungizide 85 50 80 50<br />
Insektizide 10 30 10 10<br />
Wachstumsregler 20 10 20 15<br />
Sa.Pflanzenschutz 165 180 155 110<br />
var. Masch.-ko.Anbau 123 126 118 111<br />
var. Masch.-ko. Ernte 45 44 41 39<br />
Sa.var.Masch.-kosten 168 170 159 150<br />
Hagelversicherung 4 4 3 3<br />
Lohntrocknung (60 %) 70 47 55 47<br />
Zinsansatz UV (6 %) 23 26 14 12<br />
Lohnansatz (15 €/h) 114 113 108 104<br />
Sa.var.Kosten €/ha 856 796 737 620<br />
Deckungsbeitrag €/ha 587 612 476 418<br />
Anteil in der Marsch % 80 20 50 50<br />
DB-Anteil €/ha 469 122 238 209<br />
DB Wint./Somm. €/ha<br />
Stand: 16.07.03<br />
592 447
Stand: 16.07.03<br />
- B 204 -<br />
DB-Differenz €/ha 145<br />
4. Risikozuschlag<br />
Da eine Bestellung der Flächen mit Sommerfrüchten erst nach dem 31. März zulässig<br />
ist, ist dies aufgrund der besonderen (schweren) Böden der Marsch nicht in jedem<br />
Jahr termingerecht (zum 1. April) möglich, sondern kann sich über einen nicht<br />
unerheblichen Zeitraum verzögern. Es wird erwartet, dass hierdurch in jedem 3. Anbaujahr<br />
ein Minderertrag in Höhe von 25 dt/ha eintritt.<br />
Berechnung:<br />
25 dt/ha Minderertrag x 11 €/dt = 275 €/ha<br />
./. Einsparung Trocknungskosten (25 dt/ha x 60 % x 1,3 €/ha) = 20 €/ha<br />
= Minderertrag Deckungsbeitrag in 3 Jahren = 255 €/ha<br />
= 85 €/ha und Jahr<br />
5. Zusammenstellung der Einkommensminderung<br />
Saatgut 66 €/ha<br />
Maschinen- und Arbeitskosten 111 €/ha<br />
Minderung Deckungsbeitrag durch Sommerung 145 €/ha<br />
Risikozuschlag 85 €/ha<br />
407 €/ha<br />
Es ergibt sich somit eine Ausgleichszahlung in Höhe von 410 €/ha.<br />
Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung“<br />
Ackerflächen<br />
Die Höhe der Ausgleichszahlung für das Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung<br />
- Ackerflächen“ basiert auf einem durchschnittlichen Deckungsbeitrag in der<br />
Ertragsstufe I von rund 360 €/ha (WRo, WG, SG, Ha):<br />
Winterroggen<br />
Ertrag: 40 dt/ha<br />
Deckungsbeitrag: 478 E/ha abzüglich Zinskosten für das Umlaufvermögen (8 %)<br />
= 16 E/ha abzüglich Arbeitseinsatz (8,8 Stunden à 13 E<br />
= 112 E/ha<br />
= 350 E/ha.<br />
Wintergerste<br />
Ertrag: 50 dt/ha<br />
Deckungsbeitrag: 346 E/ha abzüglich Zinskosten für das Umlaufvermögen (8 %)<br />
= 18 E/ha abzüglich Arbeitseinsatz (9,4 Stunden à 13 E<br />
= 120 E/ha = 407 E/ha.<br />
Sommergerste (Futter)<br />
Ertrag: 35 dt/ha<br />
Deckungsbeitrag: 463 E/ha abzüglich Zinskosten für das Umlaufvermögen (8 %)<br />
= 10 E/ha abzüglich Arbeitseinsatz (8,1 Stunden à 13 E = 104 E/ha = 350 E/ha.
Stand: 16.07.03<br />
- B 205 -<br />
Hafer<br />
Ertrag: 35 dt/ha<br />
Deckungsbeitrag: 483 E/ha abzüglich Zinskosten für das Umlaufvermögen (8 %)<br />
= 10 E/ha abzüglich Arbeitseinsatz (7,8 Stunden à 13 E<br />
= 100 E/ha<br />
= 373 E/ha<br />
Zusammen: Winterroggen: 349 E/ha<br />
Wintergerste: 407 E/ha<br />
Sommergerste: 503 E/ha<br />
Hafer 373 E/ha<br />
Getreide 370 E/ha<br />
Zum Ausgleich unterschiedlich ertragreicher Standorte wird eine zusätzliche Staffelung<br />
nach Bodenpunkten vorgenommen. Es werden pro Bodenpunkt und Hektar zusätzlich<br />
5,0 E/ha gewährt. Bei einer Bodenpunktzahl von 50 ergibt sich somit ein<br />
Betrag in Höhe von 610 E/ha und Jahr.<br />
Grünlandflächen<br />
Die Höhe der Ausgleichszahlung für das Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung<br />
- Grünland“ basiert auf einem angenommenen Deckungsbeitrag von rd.<br />
310 E/ha:<br />
1.<br />
Deckungsbeitrag Kühe (6.500 kg) 1.100 E/Kuh<br />
./. Zinsansatz (8 %) 65 E/Kuh<br />
./. Arbeitsansatz (25 DM/h) 600 E/Kuh<br />
= Deckungsbeitrag ./. kalkulatorische Kosten 433 E/Kuh<br />
bei einem Hauptfutterflächenanspruch von 0,58 ha/Kuh = 850 E/Kuh<br />
2.<br />
Deckungsbeitrag Färsen (24 Monate) 274 E/Färse<br />
./. Zinsansatz (8 %) 67 E/Färse<br />
./. Arbeitsansatz (25 DM/h) 243 E/Färse<br />
= Deckungsbeitrag ./. kalkulatorische Kosten 36 E/Färse<br />
bei einem Hauptfutterflächenanspruch von 0,68 ha/Färse = 53 E/Färse<br />
3.<br />
Insgesamt:<br />
40 % - Anteil durch Milchviehnutzung = 340 E/ha<br />
60 % - Anteil durch Färsennutzung = ./. 32 E/ha<br />
= Deckungsbeitrag je ha Grünland 308 E/ha<br />
Um auch die unterschiedliche Bonität <strong>des</strong> Bodens mit zu berücksichtigen, wird ein<br />
bodenpunktabhängiger Zuschlag in folgender Abstufung zusätzlich gewährt:<br />
zwischen 0 - 20 Bodenpunkte 25 €/ha
Stand: 16.07.03<br />
- B 206 -<br />
zwischen 20 - 40 Bodenpunkte 50 €/ha<br />
zwischen 40 - 60 Bodenpunkte 75 €/ha<br />
über 60 Bodenpunkte 100 €/ha<br />
für die Agrarumweltverpflichtungen insgesamt: Angabe möglicher Kombinationen<br />
von Verpflichtungen und Sicherstellung der Kohärenz zwischen<br />
den Verpflichtungen<br />
Die gemäß Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 weiterhin angebotenen Maßnahme<br />
Halligprogramm<br />
und Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung<br />
sind mit den Beihilfen <strong>des</strong> „Vertrags-<strong>Naturschutzes</strong>“ nicht kumulierbar. Landwirte<br />
können dabei jedoch sowohl an einer Markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung<br />
sowie am Vertrags-Naturschutz gleichzeitig teilnehmen. Für diesen Fall<br />
müssen sie sich auf der Fläche für jeweils eine <strong>Förderung</strong> entscheiden.<br />
Eine Kumulation <strong>des</strong> Vertragsmusters „20-jährige Flächenstilllegung - Acker“ mit der<br />
konjunkturellen Flächenstilllegung soll dagegen erfolgen.<br />
Das Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung auf Ackerflächen“ geht in seinen<br />
Auflagen (Verbot jeglicher Nutzung, Zulassung der Selbstentwicklung der Flächen/Sukzession,<br />
Durchführung biotopgestaltender Maßnahmen) über die Verpflichtungen<br />
der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 hinaus.<br />
Die Landwirte können sich daher im Rahmen der Antragstellung in jedem Jahr für<br />
eine Anrechnung der Stilllegung aus diesem Vertragsmuster auf ihre Stilllegungsverpflichtungen<br />
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 entscheiden. In diesem Fall<br />
erfolgt eine Begrenzung der Ausgleichszahlung auf die im Rahmen der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1251/1999 gewährten Beihilfehöhe.<br />
Der Ausschluss einer Doppelförderung erfolgt über die Einbindung <strong>des</strong> Vertrags-<br />
<strong>Naturschutzes</strong> in den Grundantrag (Antrag auf Agrarförderung), der die Antragstellung<br />
im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 beinhaltet.<br />
Ebenso ist eine Kumulation der Beihilfegewährung <strong>des</strong> Vertrags-<strong>Naturschutzes</strong><br />
(Grünland) mit Ausnahme der Vertragsmuster „20-jährige Flächenstilllegung“ mit den<br />
Ausgleichszahlungen gemäß Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 möglich, da<br />
die Inhalte der Verpflichtungen und die jeweils gezahlten Entschädigungen unterschiedlich<br />
sind und sich ergänzen. Die Ausgleichszahlungen gemäß Art. 16 der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1257/1999 beinhalten das Umbruchverbot von Grünland in Acker.<br />
Hieran errechnet sich die in diesem Zusammenhang gewährte Prämienhöhe. Die mit<br />
dem Vertrags-Naturschutz verbundenen Verpflichtungen beinhalten dagegen eine<br />
bestimmte Art der Grünlandnutzung. Die hierbei gewährten Ausgleichszahlungen<br />
basieren auf den mit diesen Einschränkungen verbundenen Einbußen im Vergleich<br />
zu anderen (intensiven) Grünlandnutzungen.<br />
Der Ausschluss einer Doppelförderung im Falle <strong>des</strong> Vertragsmusters „20-jährige Flächenstilllegung“<br />
erfolgt auch hier über den Grundantrag (Antrag auf Agrarförderung),<br />
in dem nicht nur der Vertrags-Naturschutz enthalten ist, sondern auch die Aus-
Stand: 16.07.03<br />
- B 207 -<br />
gleichszahlung gemäß Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 eingebunden<br />
werden soll.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Das Programm wurde bzw. wird permanent durch ökologische und ökonomische<br />
Untersuchungen begleitet und bewertet. Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen<br />
Begleituntersuchungen waren jeweils Grundlage für eine Überarbeitung der Programme.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Das Ergebnis der Bewertungen wird durch das MUNF an das fondsverwaltende<br />
Referat <strong>des</strong> MLR weitergeleitet. Die Ergebnisse werden über den gesamten<br />
Programmplanungszeitraum gesammelt, so dass Entwicklungen jederzeit aufgezeigt<br />
werden können.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Als maßnahmenspezifische zusätzliche Regelungen werden nachfolgend benannt:<br />
Das Programm wurde im September 1998 durch den Minister für Umwelt, Natur und<br />
Forsten <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Schleswig-Holstein der Presse vorgestellt. Es wird im „Bauernblatt“,<br />
dem Mitteilungsblatt der Bauernverbände Schleswig-Holstein, Mecklenburg-<br />
Vorpommern und Hamburg (Organ der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein),<br />
durch ständige Mitteilungen begleitet und ist daher in allen Einzelheiten den Landwirten<br />
bekannt.<br />
Darüber hinaus wurde eine spezielle Broschüre erstellt. Auf Anfrage wird diese sowie<br />
Musterverträge und Einzelinformationen über die verschiedenen Vertragsmuster<br />
kostenlos von den beteiligten Behörden und Institutionen abgegeben. Auf die Finanzierungsbeteilung<br />
der <strong>EU</strong> wird bei jeglichen Veröffentlichungen hingewiesen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 208 -<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Der Vertrags-Naturschutz ist mit den anderen <strong>Förderung</strong>smöglichkeiten für die<br />
Landwirtschaft abgestimmt worden und somit integraler Teil <strong>des</strong> Gesamtprogrammes.<br />
Doppelförderungen werden ausgeschlossen.
Maßnahme f 3:<br />
Halligprogramm<br />
(Titel II Kap. VI)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 209 -<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 22 <strong>bis</strong> 24 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 0,6 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 1,2 Mio. E getätigt werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Beihilfeintensitäten und/oder -beträge und angewandte Differenzierungen sind<br />
unter Punkt 3 „Spezifische Informationen“ aufgeführt.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 210 -<br />
Die Finanzierung <strong>des</strong> Programms erfolgt auf der Grundlage der „Richtlinien für die<br />
Gewährung eines erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes im Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“.<br />
Die Bewilligung der Zuwendungen für das Programm erfolgt im Rahmen der Vorschriften<br />
<strong>des</strong> § 44 Lan<strong>des</strong>haushaltsordnung.<br />
Gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne<br />
Die gute landwirtschaftliche Praxis und die Erfordernisse <strong>des</strong> Umweltschutzes werden<br />
durch umfangreiche Fachgesetze, die straf- und bußgeldbewehrt sind, bestimmt.<br />
Die Kontrolle dieser Gesetze erfordert ein hohes Maß an einschlägigen Fachkenntnissen<br />
durch die kontrollierenden Fachbehörden. Entsprechend der fachlichen Notwendigkeit<br />
und Umweltrelevanz werden die Fachgesetze nach den länderspezifischen<br />
Regelungen durch die zuständigen Fachbehörden kontrolliert. Zur Definition<br />
und Kontrolle siehe Ziff. 7.3.2.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Beim Halligprogramm handelt es sich um eine Maßnahme, die auf fünf Jahre bewilligt<br />
wird. Zur Zeit werden 48 landwirtschaftliche Betriebe gefördert. Für sämtliche<br />
Flächen besteht ein einheitlicher Verpflichtungszeitraum, der am 31.12.2001 endet.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die Halligen sind als Lebens- und Arbeitsraum im Interesse eines großflächigen<br />
Küstenschutzes, <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege zu erhalten. Dazu ist<br />
es erforderlich, den Bewohnern der Halligen eine ausreichende Existenzgrundlage<br />
zu schaffen.<br />
Das Halligprogramm gewährt daher - im Rahmen 5-jähriger Verpflichtungen - Zuwendungen<br />
für eine extensive, an den Erfordernissen <strong>des</strong> besonderen Lebensraumes<br />
der Halligen ausgerichtete Landbewirtschaftung und sichert damit zugleich die<br />
landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit auf den Halligen.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Das Halligprogramm wird seit 1988 angeboten und durchgeführt und erfasst alle<br />
landwirtschaftlichen Flächen der Halligen (rd. 1.750 ha).
- B 211 -<br />
In den Jahren 1994 - 1998 wurden rund 1,38 Mio. E an Entschädigungszahlungen<br />
an Landwirte gewährt. In 1999 stehen finanzielle Mittel in Höhe von 270.000 Ezur<br />
Verfügung.<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
1,1 Mio. E getätigt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Seit 1991 werden in einem zweijährigen Rhythmus jeweils vergleichende Untersuchungen<br />
der Salzwiesengrünbrachen auf den Halligen durchgeführt. Ergänzend<br />
hierzu finden ab 1999 auch vergleichende Untersuchungen auf angrenzenden extensiv<br />
bewirtschafteten Salzwiesen statt. Anhand dieser Untersuchungsergebnisse,<br />
die <strong>bis</strong>her den erwarteten Zielen voll entsprechen, kann das Programm den Erfordernissen<br />
angepasst werden.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Das Halligprogramm fördert eine an den Erfordernissen der extremen Umweltbedingungen<br />
und <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> ausgerichtete - extensive - Landbewirtschaftung und<br />
trägt entscheidend zum Erhalt der Erwerbstätigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen<br />
auf den Halligen bei.<br />
Darüber hinaus dient es dem flächenhaften Küstenschutz und der touristischen Entwicklung<br />
<strong>des</strong> Raumes. Hier ist vor Ort über die Jahre ein vorbildhaftes Programm mit<br />
der Bevölkerung entstanden, das die ökologische und ökonomische Entwicklung eines<br />
besonderen regionalen Teiles <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> optimal miteinander verbindet und<br />
damit der Nachhaltigkeit in besonderem Maße dient.<br />
Das Halligprogramm bzw. die „Richtlinien für die Gewährung eines erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“ gewährt dabei gemäß<br />
Ziffer 1 dieser Richtlinien Landwirten, die auf den Halligen Rinder und/oder Schafe<br />
oder Pferde halten, Zuwendungen<br />
- als Vergütung der für den Naturschutz erbrachten Leistungen<br />
- als Ausgleich für vereinbarte Bewirtschaftungsauflagen sowie<br />
- als Ausgleich von Schäden, die durch die Ringelgans verursacht werden.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Das Halligprogramm fördert in Kooperation mit der Landwirtschaft den Erhalt der<br />
Halligen als Lebens- und Arbeitsraum im Interesse eines großflächigen Küstenschutzes,<br />
<strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege. Es handelt sich dabei um<br />
einen Lebensraum, der extremen Bedingungen unterliegt.<br />
Das Halligprogramm trägt damit dazu bei, die Landwirtschaft auf den Halligen zu erhalten<br />
und zu stärken, indem Bewirtschaftungsweisen - landwirtschaftliche Produktionsverfahren<br />
- unterstützt werden, die im Einklang mit dem Schutz natürlicher Res-<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 212 -<br />
sourcen und der biologischen Vielfalt stehen. Das Halligprogramm zählt zu den anerkannten<br />
Agrarumweltmaßnahmen der Gemeinschaft.<br />
Das Halligprogramm trägt weiterhin dazu bei, im Wattenmeergebiet die natürliche<br />
Strukturvielfalt zu erhalten und zu fördern und schafft somit positive Rahmenbedingungen<br />
für die wirtschaftliche Entwicklung dieses besonderen Lebensraumes auch<br />
außerhalb der Landwirtschaft.<br />
Das Halligprogramm ist ein herausragen<strong>des</strong> Beispiel für die nachhaltige Nutzung<br />
natürlicher Ressourcen.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: durchschnittliche Prämie pro Einheit der<br />
Zahlungen<br />
öffentliche Ausgaben insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Kodifikation der Verpflichtungen<br />
Zielsetzung der Maßnahme (Schutz der<br />
natürlichen Ressourcen, Biodiversifität<br />
und/oder Landschaftsschutz)<br />
mineralisches Düngungsniveau (davon N,):<br />
festgesetztes Niveau im Rahmen der Verpflichtung<br />
(kg/ha) / Referenzniveau<br />
<br />
Viehbestandsdichte: Obergrenze festgesetzt<br />
im Rahmen der Verpflichtung (GV/ha) / Referenzniveau<br />
Anzahl der Begünstigten<br />
umweltempfindliche Flächen: ha der klassifizierten<br />
Flächen (davon: % der Flächen, die<br />
mit Agrarumweltverträgen abgedeckt sind)<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
eine Begründung der Verpflichtung anhand ihrer voraussichtlichen Auswirkungen<br />
Die Halligen sind zusammen mit den umliegenden Watten, Außensänden, Prielen<br />
und Wattströmen sowie den Vorländern der Festlandküste Bestandteil <strong>des</strong> Ökosystems<br />
„Wattenmeer“, das in seiner Ausprägung einzigartig ist. Die Bedeutung der<br />
Halligen für den Naturschutz leitet sich aus ihrer Funktion innerhalb dieses Lebensraumes<br />
ab.<br />
Die Halligen sind dabei insbesondere:
Stand: 16.07.03<br />
- B 213 -<br />
Lebensraum für Pflanzen und Tiere der Salzwiesen<br />
(Insbesondere im Bereich der Wirbellosen gibt es eine sehr hohe Anzahl so genannter<br />
„endemischer“ Arten, d.h. von Arten, die nur hier vorkommen.)<br />
Brutplatz für zahlreiche Wat- und Wasservögel<br />
Rastplatz für durchziehende Vogelarten<br />
(Im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer rasten gleichzeitig <strong>bis</strong> zu 1,3 Mio. Vögel.)<br />
Nahrungsgebiet empfindlicher nordischer Meeresgänse und Pfeifenten.<br />
Die Salzwiesenbereiche auf den Halligen haben jedoch auch für die Erwerbstätigkeit<br />
der dort lebenden Menschen im Rahmen der Landwirtschaft eine hohe Bedeutung.<br />
Rd. 50 landwirtschaftliche Betriebe - davon 3 Vollerwerbsbetriebe - existieren auf<br />
den Halligen und bewirtschaften rd. 1.750 ha Grünland (Salzwiesen). Es handelt sich<br />
hierbei ausschließlich um Futterbaubetriebe, die mit eigenem Vieh Milchwirtschaft<br />
betreiben oder Pensionsvieh vom Festland halten. Die Zahl der Betriebe, die mit eigenen<br />
Kühen noch Milchwirtschaft betreiben, ist rückläufig. Entsprechend hat die<br />
Haltung von Pensionsvieh zugenommen.<br />
Die Zunahme von Pensionsvieh auf den Halligen führt in der Regel zu erhöhten Besatzstärken,<br />
teilweise auch zu Überbeweidungen der Flächen und zu einer starken<br />
Reduzierung der Mähflächen, da Winterfutter nicht mehr oder nur noch in einem geringem<br />
Maße benötigt wird (das Pensionsvieh ist nur während der Weidezeit auf den<br />
Halligen). Der typische Halligcharakter, der durch den ökologisch erwünschten<br />
Wechsel von Weide- und Mähflächen bestimmt wird, geht hierdurch verloren. Es<br />
kommt zu Beeinträchtigungen der Grasnarbe durch Überbeweidung, die aus der<br />
Sicht <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong>, aber auch aus Gründen <strong>des</strong> Küstenschutzes zu vermeiden<br />
sind.<br />
Im Frühjahr und auch im Herbst rasten zusätzlich rd. 50.000 Ringelgänse auf den<br />
Salzwiesenflächen der Halligen. Für rd. 50 % der Gesamtpopulation der Dunkelbäuchigen<br />
Ringelgans (Branta bernicula bernicula) ist das schleswig-holsteinische Wattenmeer<br />
traditionelles Hauptrastgebiet auf dem Weg zwischen der Arktis und Mitteleuropa.<br />
Hierdurch verstärkt sich insbesondere im Frühjahr der Nutzungsanspruch<br />
auf den Salzwiesen.<br />
Um den natürlichen und einzigartigen Lebensraum der Halligen zu schützen und für<br />
den Natur- und Küstenschutz zu erhalten sowie um den dort lebenden Menschen<br />
Einkommensmöglichkeiten im Bereich der Landwirtschaft zu sichern, hat das Land<br />
Schleswig-Holstein ein so genanntes „Halligprogramm“ (Programm zur Sicherung<br />
und Verbesserung der Erwerbsquellen der Halligbevölkerung im Rahmen der Landschaftspflege<br />
und Landwirtschaft, <strong>des</strong> Küstenschutzes und <strong>des</strong> Fremdenverkehres)<br />
beschlossen.<br />
Im Rahmen dieses Programmes wird über die „Richtlinien für die Gewährung eines<br />
erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes im Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“ für den<br />
Bereich der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> eine entsprechende<br />
<strong>Förderung</strong> vorgenommen.<br />
Die im Rahmen dieser Richtlinien gewährten Zuwendungen umfassen im Einzelnen:
Stand: 16.07.03<br />
- B 214 -<br />
a) ein Bewirtschaftungsentgelt<br />
b) einen Mähzuschuss<br />
c) eine Ringelgansentschädigung und<br />
d) einen Zuschuss für die Extensivierung der Beweidung,<br />
sowie<br />
e) eine Prämie für natürlich belassene Salzwiesen.<br />
Bewirtschaftungsentgelt<br />
Die landwirtschaftliche Nutzung der Halligflächen unter bestimmten Auflagen <strong>des</strong><br />
<strong>Naturschutzes</strong> ist aus Gründen <strong>des</strong> Küstenschutzes, der Einkommenssicherung der<br />
Bevölkerung und zur Erhaltung <strong>des</strong> natürlichen Lebensraumes erforderlich.<br />
Die meisten der Halligbetriebe nehmen die Ausgleichszulage in Anspruch. Eine Begrenzung<br />
der Besatzstärke ist damit nicht möglich. Sie ist jedoch notwendig, um eine<br />
Überbeweidung der Salzwiesen zu vermeiden. Deshalb wurden - unter naturschutzfachlichen<br />
Gesichtspunkten halligspezifische, d.h. für jede Hallig gesondert,<br />
maximal tragbare Besatzstärken ermittelt.<br />
Neben den maximalen Besatzstärken sind weitere Auflagen, die den Naturschutz auf<br />
den Flächen verbessern, wie kein Ausbringen von stickstoffhaltigem Dünger oder<br />
kein Schleppen und Walzen der Flächen, bei der Bewirtschaftung einzuhalten.<br />
Mähzuschuss<br />
Mit dem Mähzuschuss soll die Vielfalt auf den Halligen, die sich u.a. auch im Wechsel<br />
von Mäh- und Weideflächen ausdrückt, erhalten bzw. gefördert werden. Das ungestörte<br />
Aufwachsen der Salzwiesen <strong>bis</strong> zur Samenreife fördert artenreiche Pflanzenbestände,<br />
bereichert das Halligbild, schafft Lebensraum für viele Arten der Wirbellosenfauna,<br />
die auf die Blütenbildung der Pflanzen angewiesen sind, ermöglicht<br />
den Brutvögeln eine ungefährdete Brut und Jungenaufzucht und sichert langfristig<br />
die Ertragsfähigkeit der Salzwiesen.<br />
Auf Grund der Zunahme der Pensionsviehhaltung sind Mähflächen auf den Halligen<br />
derzeit jedoch kaum noch anzutreffen. Es wird daher ein Mähzuschuss gewährt. Es<br />
müssen terminliche Auflagen und besondere Schutzmaßnahmen für die Brutvögel<br />
beachtet und das Heu nach dem Trocknungsvorgang geborgen werden.<br />
Ringelgansentschädigung<br />
Die Dunkelbäuchige Ringelgans brütet in der Arktis und nutzt - bevorzugt im Frühjahr<br />
- die Salzwiesen der Halligen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer auf ihrem<br />
Rückweg von der westlichen Nordseeküste nach Sibirien. Auf den Halligen und<br />
Vorlandwiesen legt sie die für die Arterhaltung notwendigen Fettreserven an. Von<br />
April <strong>bis</strong> Ende Mai rasten auf den Halligen derzeit rd. 50.000 Exemplare.<br />
Durch die Nahrungsaufnahme auf den Salzwiesen verursachen die Ringelgänse jedoch<br />
Probleme, die von Jahr zu Jahr unterschiedlich sind. Fraßschäden durch Ringelgänse<br />
bedeuten für die Landwirte eine Reduzierung oder einen Verzicht auf Pensionsvieh,<br />
da die Gänse die Wiesen vorgenutzt haben. Der verspätete Aufwuchs<br />
lässt je nach der Anzahl der Gänse eine geringere Nutzung der Flächen zu.
Stand: 16.07.03<br />
- B 215 -<br />
Die Landwirte auf den Halligen erhalten daher eine Entschädigung der durch die<br />
Ringelgänse verursachten Fraßschäden in 3 Schadensstufen auf der Grundlage einer<br />
zuvor durchgeführten Kartierung.<br />
Zuschuss für die Extensivierung der Beweidung<br />
In Ergänzung <strong>des</strong> Bewirtschaftungsentgeltes, <strong>des</strong> Mähzuschusses und der Ringelgansentschädigung<br />
wird den Landwirten eine weitere, freiwillige Reduzierung der<br />
halligspezifischen maximalen Besatzstärke finanziell honoriert, um - unter Beibehaltung<br />
einer landwirtschaftlichen Nutzung - weitere Verbesserungen für den Naturschutz<br />
auf den Flächen zu erreichen.<br />
Prämie für natürlich belassene Salzwiesen<br />
Die nordfriesischen Halligen vor der Westküste Schleswig-Holsteins sind auf Grund<br />
ihrer Entstehungsgeschichte und als Standort typischer Salzwiesen für den Naturschutz<br />
von einzigartiger Bedeutung. Jede landwirtschaftliche Nutzung von Salzwiesen<br />
bedeutet jedoch einen Eingriff in diesen Lebensraum. Es soll daher auf begrenzten<br />
Flächen der Halligen (höchstens 33 % - wenn es aus Gründen <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong><br />
geboten ist höchstens 50 % - eines jeden Betriebes) durch die Herausnahme<br />
der landwirtschaftlichen Nutzung ein ungestörtes Aufwachsen der Halligflächen<br />
über natürlich belassene Salzwiesen gefördert werden.<br />
Hinsichtlich der planzengenetischen Ressourcen, die von der genetischen<br />
Erosion bedroht sind: Beleg der genetischen Erosion auf der Grundlage<br />
wissenschaftlicher Ergebnisse und Indikatoren für das Vorkommen von<br />
Landrassen/einfachen (lokalen) Sorten, die Vielfalt der Population und die<br />
vorherrschende landwirtschaftliche Praxis auf lokaler Ebene<br />
Durch das Programm werden die pflanzengenetischen Ressourcen eines Ökosystems<br />
erhalten, das extremen abiotischen Bedingungen unterliegt. In diesem Zusammenhang<br />
wird auf die „Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins<br />
(Schriftenreihe <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>amtes für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-<br />
Holstein, Heft 6 aus 1983) und die „Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Schleswig-Holstein<br />
(Herausgeber: Lan<strong>des</strong>amt für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Schleswig-Holstein, 2. Fassung, Stand 1990) verwiesen.<br />
Präzise Angaben zu den Verpflichtungen für die Landwirte und sonstigen<br />
Bedingungen im Rahmen der Vereinbarung einschließlich der Möglichkeiten<br />
und Verfahren zur Anpassung von laufenden Verträgen<br />
Im Rahmen der „Richtlinien für die Gewährung eines erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“ werden daher für folgende Bereiche der<br />
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung Regelungen der Einführung oder Beibehaltung<br />
getroffen:<br />
Verringerung der Besatzstärken bei der Beweidung,<br />
Festlegung eines jahreszeitlich späten Mähtermines unter besonderer Berücksichtigung<br />
<strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong>,
Stand: 16.07.03<br />
- B 216 -<br />
Verbot <strong>des</strong> Einsatzes stickstoffhaltigen Mineraldüngers/kein Ausbringen von<br />
Pflanzenschutzmitteln,<br />
kein Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln.<br />
Damit wird den in Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 <strong>des</strong> Rates vom 17.<br />
Mai 1999 Rechnung getragen.<br />
Die o.g. Regelungen helfen, die sich negativ auf den Naturhaushalt auswirkenden<br />
Folgen der landwirtschaftlichen Nutzung von Halligflächen zurückzunehmen, der<br />
immer stärkere Nachfrage der Gesellschaft nach ökologischen Dienstleistungen<br />
Rechnung zu tragen und den Landwirten der Halligen eine Einkommenssicherung zu<br />
geben.<br />
Sie dienen dabei gleichzeitig dem Natur- und Umweltschutz insbesondere dazu,<br />
die natürliche Artenvielfalt der Salzwiesen (Tiere und Pflanzen) zu erhöhen und<br />
damit das<br />
genetische Potenzial der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt zu stärken und<br />
den natürlichen Lebensraum einer einzigartigen Halligwelt für nachkommende<br />
Generationen zu sichern.<br />
Zuwendungsempfänger<br />
Zuwendungsempfänger sind landwirtschaftliche Unternehmerinnen oder Unternehmer<br />
auf den Halligen vor der Westküste Schleswig-Holsteins.<br />
Zuwendungsvoraussetzungen<br />
1. Bewirtschaftungsentgelt<br />
Zuwendungsempfänger erhalten ein Bewirtschaftungsentgelt, wenn sie sich für min<strong>des</strong>tens<br />
5 Jahre verpflichten, die Bewirtschaftung ihrer Flächen im Rahmen folgender<br />
Auflagen durchzuführen:<br />
Einhaltung der halligspezifischen maximalen Besatzstärke bei der Beweidung:<br />
Hallig Gröde 0,7 GV/ha<br />
Hallig Hooge 1,4 GV/ha<br />
Hallig Langeneß 1,1 GV/ha<br />
Hallig Nordstrandischmoor 0,9 GV/ha<br />
Hallig Oland 1,5 GV/ha<br />
Durchführung einer halligtypischen Entwässerung,<br />
keine Verfüllung von Bodensenken und Mäandern, es sei denn zum Zwecke <strong>des</strong><br />
Küstenschutzes,<br />
keine Ausbringung von stickstoffhaltigem Mineraldünger,<br />
keine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
Stand: 16.07.03<br />
- B 217 -<br />
kein Abschleppen und Walzen der Flächen,<br />
Auftrieb von Eigen-/Halligvieh ab 15. April*),<br />
Auftrieb von Pensionsvieh ab 1. Mai,<br />
keine Umstellung auf Flüssigmist bzw. Erweiterung über den derzeitigen Umfang<br />
hinaus,<br />
Durchführung von Pflegeschnitten nach Maßgabe der Empfehlungen der<br />
Ortskommission.<br />
*) Bei einem Auftriebstermin 15. April ist <strong>bis</strong> zum 1. Mai eine Obergrenze von<br />
0,5 GV/ha einzuhalten.<br />
2. Mähzuschuss<br />
Für das Mähen und Werben von Grundfutter wird unter Beachtung folgender Auflagen<br />
ein Mähzuschuss gewährt:<br />
<strong>bis</strong> zum 10. Juli dürfen nur 50 % der gesamten Mähfläche eines Jahres gemäht<br />
werden,<br />
das Mähen der einzelnen Flächen muss im jährlichen Wechsel vor bzw. nach dem<br />
10. Juli erfolgen,<br />
die erste Mahd darf frühestens am 1. Juli erfolgen,<br />
aus Gründen <strong>des</strong> Brutvogelschutzes ist nur tagsüber zu mähen; die Flächen sind<br />
vor dem Mähen abzulaufen und auf Brutgelege und Jungvögel zu prüfen; dort, wo<br />
es tatsächlich möglich ist, sollen die Flächen von innen nach außen gemäht werden,<br />
nach Beendigung <strong>des</strong> Trocknungsvorganges ist das Heu unverzüglich zu bergen<br />
und auf den Warften zu lagern.<br />
3. Ringelgansentschädigung<br />
Soweit das konzentrierte Auftreten von Ringelgänsen erheblichen Schaden verursacht,<br />
wird ein finanzieller Ausgleich gewährt. Die Höhe dieses Ausgleiches richtet<br />
sich nach dem Ausmaß <strong>des</strong> aufgetretenen Schadens. Zu diesem Zweck werden die<br />
Flächen jährlich nach folgenden Schadensstufen kartiert:<br />
Schadensstufe 1 (0 - 20 % Schädigung <strong>des</strong> Normalertrages),<br />
Schadensstufe 2 (20 - 80 % Schädigung <strong>des</strong> Normalertrages),<br />
Schadensstufe 3 (80 - 100 % Schädigung <strong>des</strong> Normalertrages).<br />
4. Zuschuss für die Extensivierung der Beweidung
Stand: 16.07.03<br />
- B 218 -<br />
Für die Verringerung der maximalen Besatzstärke um min<strong>des</strong>tens 30 %, höchstens<br />
jedoch um 70 %, auf den gesamten, auf den Halligen liegenden landwirtschaftlich<br />
genutzten Flächen eines Betriebes kann zusätzlich ein Zuschuss für die Extensivierung<br />
der Beweidung (freiwillige Reduzierung der Beweidung) gewährt werden. Sie<br />
kann für jeweils ein Jahr oder für 5 Jahre vereinbart werden.<br />
5. Prämie für natürlich belassene Salzwiesen<br />
Für die Herausnahme von Salzwiesen aus der landwirtschaftliche Nutzung wird eine<br />
Prämie gewährt. Die auf diese Art und Weise natürlich belassenen Salzwiesen sollen<br />
dazu beitragen, den natürlichen Charakter der Halligen soweit wie möglich wieder<br />
herzustellen.<br />
Auflagen:<br />
Die Flächen dürfen nicht gedüngt oder chemisch behandelt und weder landwirtschaftlich<br />
noch auf andere Weise genutzt werden.<br />
Es dürfen weder Pflanzenschutzmittel noch Gülle, Jauche, Stallmist oder andere<br />
Stoffe ausgebracht werden.<br />
Eine halligtypische Entwässerung bleibt erlaubt.<br />
Rastende und nahrungssuchende Gänse und Enten sind auf den Flächen zu dulden.<br />
Die Prämie soll grundsätzlich für 5 Jahre vereinbart werden. In Ausnahmefällen kann<br />
die Vereinbarung nach 2 Jahren aufgehoben oder im 2-jährigen Wechsel auf andere<br />
Flächen <strong>des</strong> Betriebes übertragen werden. Bei einer nur 2-jährigen Verpflichtung ist<br />
anschließend im Rahmen der 5-jährigen Gesamtverpflichtung zur Bewirtschaftung<br />
gemäß den Richtlinien min<strong>des</strong>tens die Bedingungen <strong>des</strong> Bewirtschaftungsentgeltes<br />
auf den Flächen einzuhalten.<br />
Die Prämie kann nur für höchstens 33 % - in Ausnahmefällen 50 % - der landwirtschaftlichen<br />
Nutzfläche eines Betriebes vereinbart werden.<br />
Durchführung der Richtlinien<br />
Für die Durchführung der „Richtlinien für die Gewährung eines erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“ ist das Amt für ländliche<br />
Räume Husum zuständig. Die Anträge sind spätestens <strong>bis</strong> zum 15. Mai <strong>des</strong> jeweiligen<br />
Jahres dort zu stellen.<br />
Zur Durchführung der o.g. Richtlinien setzt das Amt für ländliche Räume eine<br />
Ortskommission ein, die aus ortskundigen Landwirten, Vertretern <strong>des</strong> Bauernverban<strong>des</strong>,<br />
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, der unteren Naturschutzbehörde,<br />
dem Nationalparkamt „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ und den<br />
Bürgermeistern der Halligen besteht. Den Vorsitz führt das Amt für ländliche Räume.<br />
Die Ortskommission prüft in jährlichen Halligschauen, ob die Bewirtschaftung der<br />
Halligflächen nach Maßgabe der o.g. Richtlinien erfolgt. Nach Anhörung der
Stand: 16.07.03<br />
- B 219 -<br />
Ortskommission entscheidet das Amt für ländliche Räume über die Gewährung der<br />
Zuwendungen durch schriftlichen Bescheid.<br />
Weiterführung laufender Verpflichtungen<br />
Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2078/92 auf der Basis der Entscheidungen der<br />
Kommission vom 11.10.1994 - K (94) 2595 ausgesprochenen 5-jährigen Bewilligungen<br />
<strong>des</strong> Halligprogrammes werden gemäß den Bestimmungen aus der Verordnung<br />
(EWG) Nr. 2078/92 sowie der Verordnung (EG) Nr. 746/96 <strong>bis</strong> zum Ende <strong>des</strong> Bewilligungszeitraumes<br />
fortgeführt.<br />
Beschreibung <strong>des</strong> Anwendungsbereichs der Maßnahme, wobei anzugeben<br />
ist, inwieweit die Durchführung auf den Bedarf abgestimmt ist; Grad der<br />
Zielausrichtung hinsichtlich geografischer, sektoraler und sonstiger<br />
Ausrichtung<br />
Die Halligen sind als Lebens- und Arbeitsraum im Interesse eines großflächigen<br />
Küstenschutzes, <strong>des</strong> <strong>Naturschutzes</strong> und der Landschaftspflege zu erhalten. Dazu ist<br />
es erforderlich, den Bewohnern der Halligen eine ausreichende Existenzgrundlage<br />
zu schaffen. Daher wird seit 1985 das Halligprogramm auf den Halligen Langeneß,<br />
Oland, Gröde, Nordstrandischmoor, Süderoog und Südfall durchgeführt.<br />
Alle Halligflächen sind in einem einheitlichen Rhythmus in einem fünfjährigen Verpflichtungszeitraum<br />
erfasst. Der derzeitige Verpflichtungszeitraum endet am<br />
31.12.2001.<br />
detaillierte agronomische Berechnungen, aus denen Folgen<strong>des</strong> hervorgeht:<br />
a) Einkommensverluste und anfallende Kosten im Vergleich zur Anwendung<br />
der guten landwirtschaftlichen Praxis im üblichen Sinne, b) als Bezugpunkt<br />
dienende agronomische Annahmen, c) Höhe <strong>des</strong> Anreizes und Begründung<br />
<strong>des</strong> Anreizes anhand objektiver Kriterien<br />
Art der <strong>Förderung</strong><br />
Es werden jährliche Zuwendungen auf der Grundlage eines Bewilligungsbeschei<strong>des</strong><br />
gewährt.<br />
Höhe der Zuwendung/Berechnung der Zuwendungshöhe<br />
Die nachfolgenden Berechnungen haben die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen<br />
Praxis im üblichen Sinne als Voraussetzung zu Grunde gelegt.<br />
1. Bewirtschaftungsentgelt<br />
Die Berechnung <strong>des</strong> Bewirtschaftungsentgeltes basiert auf der Gegenüberstellung<br />
der Nutzung ohne Auflagen gegenüber einer Nutzung der Flächen mit Auflagen.<br />
Ohne Auflagen ist eine Nutzung der Flächen mit einer Ertragsleistung von 30.000<br />
MJNEL/ha und einer Besatzstärke von 3,0 RGV/ha möglich.
Stand: 16.07.03<br />
- B 220 -<br />
Mit Auflagen – Verbot von Düngung und Pflanzenschutzmitteln, Einschränkung der<br />
Besatzstärke – reduziert sich die Nutzung der Flächen auf eine Ertragsleistung von<br />
15.000 MJNEL/ha mit einer durchschnittlichen Besatzstärke von 1,2 GVE/ha (0,7 –<br />
1,5 GVE/ha).<br />
Um diesen Verlust auszugleichen, bieten sich folgende Anpassungsalternativen:<br />
1. Ankauf von Grundfutter (Heu).<br />
2. Flächenaufstockung durch Zupacht von landwirtschaftlich genutzten Flächen.<br />
3. Reduzierung der Pensionsviehhaltung.<br />
4. Reduzierung der Mutterkuhhaltung.<br />
Zu 1. Einkommensverluste bei Zukauf von Grundfutter (Heu)<br />
Heuzukauf (10 Großballen) - 230 €/ha<br />
Fähre - 75 €/ha<br />
Transportkosten zuzügl. Arbeit - 110 €/ha<br />
- 415 €/ha<br />
./. Minderkosten<br />
(eingesparte Düngungs- und Ausbringungskosten<br />
bei ursprünglich 130 kg N/ha) + 125 €/ha<br />
= Einkommensverlust - 290 €/ha<br />
(Heugroßballen mit 350 kg x 4,1 MJNEL/ha = 15.000 MJNEL/ha;<br />
2 Schlepperstunden x 30 €/ha; 4 Akh Fahrtzeit x 12,5 €/h)<br />
Zu 2. Einkommensverluste bei Flächenaufstockung durch Zupacht:<br />
Pacht (1 ha) - 150 €/ha<br />
Nebenkosten - 50 €/ha<br />
Mehrarbeit - 50 €/ha<br />
./. Minderkosten<br />
(eingesparte Düngungs- und Ausbringungskosten<br />
bei ursprünglich 130 kg N/ha) + 125 €/ha<br />
= Einkommensverlust - 125 €/ha<br />
Zu 3. Einkommensverluste bei Reduzierung der Pensionsviehhaltung<br />
Mindererlös - 192 €/ha<br />
(Reduzierung von 5 Jungrindern/ha<br />
auf 2 Rinder/ha bei einem Pensionsgeld von 64 €/Rind<br />
= 160 Weidetage x 0,50 €/Tag abzüglich<br />
Transportkosten von 16 €/Tier)<br />
./. Mindererlös<br />
(eingesparte Düngungs- und Ausbringungskosten<br />
bei ursprünglich 130 kg N/ha) + 125 €/ha<br />
= Einkommensverlust - 67 €/ha<br />
Zu 4. Einkommensverluste bei Reduzierung der Mutterkuhhaltung:
Stand: 16.07.03<br />
- B 221 -<br />
Mehrerlös<br />
(Extensivierungsprämie für 1 Mutterkuh) + 100 €/ha<br />
Mindererlös*)<br />
a) Deckungsbeitrag-Verlust von 2 Mutterkühen - 124 €/ha<br />
b) Prämienverlust von 0,8 Mutterkühen - 160 €/ha<br />
./. Minderkosten<br />
(eingesparte Düngungs- und Ausbringungskosten<br />
bei ursprünglich 130 kg N/ha) + 125 €/ha<br />
= Einkommensverlust - 69 €/ha<br />
*) Deckungsbeitrag-Rechnung für Mutterkuhhaltung:<br />
Erlöse: Kalb = 320 €; Altkuh = 370 € abzüglich 10 % Verluste = 333 €<br />
Kosten: Winterplatz 150 € + Bestandsergänzung: 75 € + Tierarzt 25 € + Transport<br />
16 € = 226 €<br />
Deckungsbeitrag = 67 €/Mutterkuh<br />
Reduzierung von 3 Mutterkühen/ha auf 1 Mutterkuh /ha;<br />
Ausgangssituation mit 1,8 Mutterkühen/ha (Obergrenze);<br />
nach Reduzierung auf 1,0 Mutterkuhprämie/ha zuzügl. Extensivierungsprämie.<br />
Die Eigenviehhalter werden bei gegebenem Viehbestand tendenziell die Anpassungsvarianten<br />
1 und 2 wählen, während die Sommergräser vornehmlich auf die<br />
Varianten 3 und 4 zurückgreifen werden. Vielfach werden die Betriebe jedoch nicht<br />
nur eine Anpassungsstrategie verfolgen, sondern verschiedene Varianten wählen,<br />
die wie folgt gewichtet sind:<br />
290 €/ha à 20 % = 58,00 €/ha<br />
125 €/ha à 20 % = 25,00 €/ha<br />
67 €/ha à 30 % = 20,10 €/ha<br />
69 €/ha à 30 % = 20,70 €/ha<br />
= 123,80 €/ha<br />
Das Bewirtschaftungsentgelt wird daher in Höhe von 120 €/ha festgesetzt.<br />
2. Mähzuschuss<br />
130 €/ha.<br />
Da auch bei einer Mähnutzung nach dem Schnitt die Fläche noch beweidet werden<br />
kann, entspricht es der Praxis, dass 1 ha Mähfläche etwa 0,75 ha Grasfläche bei<br />
Pensionsviehhaltung gleichzusetzen ist. Bei angestrebten durchschnittlichen Besatzstärken<br />
auf den Halligen von rd. 1,2 GV/ha entsprechen 0,75 ha bei einem Grasgeld<br />
von 64 €/Tier (bei angenommenen 5 Jungtieren von 0,6 GV/ha) einem Einkommensverlust<br />
von 96 €/ha. Hinzu kommt ein Mehraufwand für die Heuwerbung und das<br />
Risiko von Futterverlusten bei auftretenden Kantenfluten sowie die Festlegung <strong>des</strong><br />
ersten Mähtermins auf den 1. Juli, so dass bei einer Mähnutzung gegenüber der<br />
Pensionsviehhaltung Einnahmeverlust und Mehraufwand auf insgesamt 130 €/ha<br />
beziffert werden. Die Eigenviehhaltung ist durch die Beanspruchung zusätzlicher
Stand: 16.07.03<br />
- B 222 -<br />
Winterfutterflächen (Mähflächen) mit der Pensionsviehhaltung ohne den Mähzuschuss<br />
nicht konkurrenzfähig.<br />
3. Ringelgansentschädigung<br />
Anhand einer jährlich durchgeführten Schadenskartierung der Flächen werden folgende<br />
Entschädigungen gewährt:<br />
Schadensstufe 1: (0 - 20 % Schädigung): keine Entschädigung<br />
Schadensstufe 2: (20 - 80 % Schädigung): 40 €/ha<br />
Schadensstufe 3: (80 - 100 % Schädigung): 80 €/ha.<br />
4. Zuschuss für die Extensivierung der Beweidung<br />
60 €/GV.<br />
Gezahlt wird eine Prämie für die Reduzierung der Beweidung um min<strong>des</strong>tens 30 %<br />
auf der gesamten auf den Halligen liegenden landwirtschaftlich genutzten Fläche <strong>des</strong><br />
Betriebes gegenüber den auf den Halligen jeweils festgelegten Obergrenzen. Die<br />
Reduzierung darf jedoch 70 % nicht überschreiten, um eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung<br />
auf den Flächen weiterhin aufrechtzuerhalten.<br />
Bemessungsgrundlage der Entschädigung ist ein z.Z. im Durchschnitt gezahltes<br />
Grasgeld auf den Halligen für Pensionsvieh von 64 €/Tier.<br />
5. Prämie für natürlich belassene Salzwiesen<br />
280 €/ha.<br />
Die Höhe der Entschädigung unter Wegfall <strong>des</strong> Bewirtschaftungsentgeltes, <strong>des</strong><br />
Mähzuschusses, der Ringelgansentschädigung und ggf. eines Zuschusses für die<br />
Extensivierung der Beweidung ergibt sich aus folgenden Überlegungen:<br />
1.<br />
im Durchschnitt auf den Halligen gehaltene GV von 1,2 GV/ha<br />
im Durchschnitt gezahltes (derzeitiges) Grasgeld für Pensionsvieh von 64 € pro<br />
Tier bzw. pro 0,6 GV.<br />
2.<br />
Nach den „Richtlinien für die Gewährung eines erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“ ergeben sich folgende Zuwendungen bei einer<br />
Bewirtschaftung:<br />
Bewirtschaftungsentgelt 240 €/ha*)<br />
Ringelgansentschädigung (40 –80 €/ha) 60 €/ha<br />
Mähzuschuss<br />
(bei Eigenviehhaltung) 130 €/ha
Stand: 16.07.03<br />
- B 223 -<br />
oder<br />
Grasgeld (bei Pensionsvieh) 128 €/ha<br />
430 bzw. 428 €/ha<br />
Diesen Beträgen von 430 €/ha bei Eigenviehhaltung bzw. von 428 €/ha bei Pensionsviehhaltung<br />
sind Einsparungen von<br />
Zaun, Wasser, Schütthock 30 €/ha<br />
eingesparte Arbeitskraft(10 Akh) 120 €/ha<br />
150 €/ha<br />
gegenzurechnen. Somit ergibt sich ein Betrag in Höhe von 280 €/ha.<br />
*) Aufgrund der Nutzungsaufgabe ist der Betrag <strong>des</strong> Bewirtschaftungsentgeltes verdoppelt<br />
worden.<br />
Bezug zu Art. 35, Abs. 2, Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 445/2002<br />
Im Rahmen der „Richtlinien für die Gewährung eines erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“ erhalten die Landwirte für die Reduzierung<br />
der Besatzstärke gemessen an der pro Hallig festgelegten Obergenze pro verringerter<br />
Großvieheinheit 60 €. Dies stellt eine Prämie zur Reduzierung von Besatzstärken<br />
dar. Sie ist unabhängig von der Extensivierungsprämie gemäß Art. 13 der<br />
Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 zu sehen, da die Extensivierungsprämie eine Zahlung<br />
für die nach der Reduzierung noch im Betrieb verbliebenen Tiere darstellt. Eine<br />
Kumulation beider Maßnahmen ist daher möglich.<br />
für die Agrarumweltverpflichtungen insgesamt: Angabe möglicher Kombinationen<br />
von Verpflichtungen und Sicherstellung der Kohärenz zwischen<br />
den Verpflichtungen<br />
Die Zuwendungen aus dem Halligprogramm sind mit den Zuwendungen aus den<br />
„Richtlinien für die Gewährung von Ausgleichszahlungen in Gebieten mit umweltspezifischen<br />
Einschränkungen - Programm zur Grünlanderhaltung“ wie folgt kumulierbar:<br />
Übersteigt der Flächenanteil 56,16 ha, wird für diesen Anteil zusätzlich die Grünlanderhaltungsprämie<br />
der o.g. Richtlinie in Höhe von 77 €/ha gewährt.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung
Stand: 16.07.03<br />
- B 224 -<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Das Programm wurde bzw. wird kontinuierlich durch wissenschaftliche Untersuchungen<br />
begleitet und bewertet. Anhand dieser Untersuchungen kann die mit dem Programm<br />
angestrebte Zielsetzung permanent kontrolliert werden.<br />
Bezüglich der Bewertung der Maßnahme wird auf die oben aufgeführten Indikatoren<br />
verwiesen. Die Indikatoren sowie die sonstigen abzugebenden Informationen werden<br />
durch das MUNF an das fondsverwaltende Referat <strong>des</strong> MLR weitergeleitet. Die Ergebnisse<br />
werden über den gesamten Programmplanungszeitraum gesammelt, so<br />
dass Entwicklungen jederzeit aufgezeigt werden können.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Als maßnahmenspezifische zusätzliche Regelungen werden nachfolgend benannt:<br />
Die „Richtlinien für die Gewährung eines erweiterten Bewirtschaftungsentgeltes im<br />
Rahmen <strong>des</strong> Halligprogramms“ werden im Amtsblatt für Schleswig-Holstein veröffentlicht.<br />
Je<strong>des</strong> Jahr findet eine Bereisung der Halligen durch die Ortskommission statt, zu der<br />
auch Vertreter der örtlichen Landwirtschaft als Mitglieder gehören. Eine Unterrichtung<br />
der Landwirte ist damit sichergestellt.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Das Halligprogramm ist mit den anderen <strong>Förderung</strong>smöglichkeiten für die Landwirtschaft<br />
abgestimmt worden und somit integraler Teil <strong>des</strong> Gesamtprogrammes. Doppelförderungen<br />
sind ausgeschlossen.
Maßnahme h 1:<br />
Aufforstungsprogramm<br />
(Titel II Kap. VIII)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 225 -<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 31 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 6,88 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 13,76 Mio. E getätigt werden.<br />
Beihilfeintensität<br />
<strong>bis</strong> 85 % für Laubbaumkulturen<br />
<strong>bis</strong> 70 % für Nadel-Laubmischkulturen<br />
300 <strong>bis</strong> 1.400,-- DM/ha (<strong>bis</strong> zu 150 E für Nichtlandwirte, <strong>bis</strong> zu 715 E für Landwirte)<br />
Prämie für Erstaufforstungen (max. 20 Jahre)<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
- B 226 -<br />
Es gelten die Fördergrundsätze <strong>des</strong> notifizierten Rahmenplans „Verbesserung der<br />
Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes“.<br />
Es werden nur Beihilfen für Flächen privater oder kommunaler Waldbesitzer i.S. <strong>des</strong><br />
Art. 29 Abs. 3 (VO) EG 1257/1999 gewährt.<br />
„Die Teilmaßnahme h.1 Aufforstungsprogramm und i. 1 Waldhilfsprogramm stehen<br />
in gegenseitiger Abhängigkeit. Eine hohe Kalamitätsgefährdung der schleswigholsteinischen<br />
Forstwirtschaft durch Stürme und Folgeschäden (Käferbefall und<br />
Trocknis) und eine in Folge der peripheren Lage ausgeprägte Marktabhängigkeit der<br />
waldbaulichen Maßnahmen in Jungbeständen sowie eine schwankende Aufforstungsbereitschaft<br />
machen es erforderlich, ggf. Schwerpunktbildungen zu Gunsten<br />
einer Teilmaßnahme vornehmen zu können.<br />
Die vorgeschlagenen Maßnahmen tragen zur Erfüllung der auf der Ministerkonferenz<br />
über den Schutz der Wälder in Europa eingegangenen Verpflichtungen bei, insbesondere<br />
der Verpflichtung nach der Resolution H1 (Allgemeine Leitlinien für die<br />
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Europa) und der Resolution H 2 (Allgemeine<br />
Leitlinien für die Erhaltung der Biodiversität der europäischen Wälder).<br />
Die vorgeschlagenen Maßnahmen tragen überdies zur Erfüllung der Klimarahmenkonvention<br />
von Kyoto 1997 bei. Holzvorratserhöhungen infolge ordnungsgemäßer<br />
und naturnaher Waldbewirtschaftung führen zu nachhaltig wirksamen CO2-<br />
Bindungen.<br />
Die Maßnahmen dienen auch der im Lan<strong>des</strong>waldgesetz für Schleswig-Holstein vorgegebenen<br />
Verpflichtung, den Wald ordnungsgemäß und naturnah zu bewirtschaften<br />
(§8 <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>waldgesetzes).<br />
Die Maßnahmen stimmen überein mit den Grundsätzen <strong>des</strong> in arbeit befindlichen<br />
nationalen Forstprogramms (NFP) - insbesondere<br />
Konsistenz mit den konstitutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong><br />
Konsistenz mit den internationalen Vereinbarungen und Übereinkünften (insbesondere<br />
Rio, Helsinki, Lissabon) und<br />
langzeitlicher Planungs-, Implementierungs- und Überwachungsprozess.<br />
Im NFP werden u. a. folgende Bereiche behandelt:<br />
Wald und Biodiversität<br />
Beitrag von Forst- und Holzwirtschaft zur Entwicklung ländlicher und urbaner<br />
Räume<br />
Wald und Klima und<br />
Bedeutung <strong>des</strong> nachwachsenden Rohstoffes Holz.<br />
Gegenüber den Grundsätzen für die <strong>Förderung</strong> forstwirtschaftlicher Maßnahmen im<br />
Rahmenplan 2000-2003 bestehen in der schleswig-holsteinischen <strong>Förderung</strong> folgende<br />
Einschränkungen:<br />
Stand: 16.07.03
Stand: 16.07.03<br />
- B 227 -<br />
1. <strong>Förderung</strong> von Forstkulturen nur bei einem Min<strong>des</strong>tlaubbaumanteil von 40 %<br />
2. Verzicht auf die Bepflanzung von 10 - 30 % der Kulturflächen zu Gunsten natürlicher<br />
Waldentwicklung.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Es wurden 268 Verträge für rd. 1.640 ha über eine Prämie zum Ausgleich von Einkommensverlusten<br />
durch Aufforstung abgeschlossen. Die Verträge mit 20-jähriger<br />
Laufzeit enden erst nach dem Planungszeitraum 2000-2006. 258 Verträge sind kofinanzierungsfähig<br />
entsprechend der Ratsverordnung 2080/1992. Der <strong>EU</strong>- Kofinanzierungsanteil<br />
beträgt 50% der förderungsfähigen Kosten, mithin 245.000 E jährlich. Die<br />
Gesamtkosten betragen 564.000 E jährlich.<br />
Entsprechend der Ratsverordnung 2328/1991 liegen 27 Verträge mit einem Kofinanzierungsanteil<br />
von 25% mithin 4.200 E jährlich vor. 43 Verträge aus dem Jahr 1991<br />
mit einer Gesamtförderung von 38.000 E wurden nicht kofinanziert. Die Verträge<br />
laufen über den Planungszeitraum 2000-2006 hinaus.<br />
Die <strong>bis</strong>lang nicht bzw. nur beschränkt kofinanzierungsfähigen Verträge werden hinsichtlich<br />
einer zukünftigen Gemeinschaftsbeteiligung nach Artikel 31 der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1257/1999 überprüft.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Wälder haben in Schleswig-Holstein eine besondere Bedeutung für den Boden-,<br />
Wasser- und Klimaschutz, für die Erhaltung naturnaher Lebensräume und für den<br />
Tourismus. Die Holzerzeugung deckt den Bedarf im Lande nur zu etwa einem Fünftel.<br />
Schleswig-Holstein ist mit einem Waldanteil von nur 10 % das waldärmste Land<br />
in Deutschland. Die Wälder umfassen eine Fläche von rd. 155.000 Hektar und verteilen<br />
sich auf über 10.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Der Laubbaumanteil<br />
beträgt 53 %. Er muss zur Stabilisierung der Wälder auch durch die Neuwaldbildung<br />
erhöht werden.<br />
Leistungsfähige Forstverwaltungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> und der Landwirtschaftskammer (LK)<br />
- diese führt alle forstlichen Fördermaßnahmen im Auftrage <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> durch - sowie<br />
gut geführte private und kommunale Forstbetriebe und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse<br />
- von der LK beraten und betreut - ermöglichen eine ordnungsgemäße<br />
und naturnahe Forstwirtschaft.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
8,0 Mio. E getätigt.
Stand: 16.07.03<br />
- B 228 -<br />
Die Neuwaldbildung umfasste in den vergangenen fünf Jahren (1994 - 1998) insgesamt<br />
rund 2.600 Hektar, das sind 52 % <strong>des</strong> Planungsziels von 5.000 Hektar Neuwaldbildung.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Forstbericht der Lan<strong>des</strong>regierung an den Schleswig-Holsteinischen Landtag (1998).<br />
Jährliche forstwirtschaftliche Leistungsberichte der Lan<strong>des</strong>regierung.<br />
Jährliche Berichte der Landwirtschaftskammer über die Ergebnisse der <strong>Förderung</strong>.<br />
Die Maßnahmen dienen der naturnahen Entwicklung von Wäldern, der wirtschaftlichen<br />
Stabilisierung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und umweltverträglichen<br />
und nachhaltigen Nutzungen von Wäldern. Die Beihilfen leisten einen wirksamen<br />
Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der Infrastruktur im ländlichen Raum.<br />
Die Beihilfemaßnahmen tragen überdies dazu bei, das touristische Potenzial <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> zu vergrößern.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
1.000 Hektar Neuwald pro Jahr.<br />
Schleswig-Holstein verfolgt das Ziel, die Waldfläche im Lande um rund 30.000 ha zu<br />
vergrößern. Dies soll überwiegend durch private und kommunale Neuwaldbildung<br />
geschehen. Diese wird von Land, Bund und von der <strong>EU</strong> gefördert. Die private Nachfrage<br />
dieser Fördermaßnahmen ist z.Z. wegen der Förderdisparität Lw/Fw (Stilllegungs-/Aufforstungsprämie)<br />
sehr gering. Deshalb wird künftig die kommunale Neuwaldbildung<br />
verstärkt verfolgt.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Neuwaldbildung ist eine landschaftliche und ökologische Bereicherung für das<br />
waldarme Schleswig-Holstein. Die Neuwaldbildung trägt durch Diversifizierung landwirtschaftlichen<br />
Einkommens sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
und durch mit zunehmendem Alter der Wälder zunehmende wirtschaftliche Bedeutung<br />
maßgeblich zur Entwicklung der ländlichen Räume bei. Die Neuwaldbildung<br />
kann insbesondere in den wirtschaftlich schwachen Räumen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> zur Stärkung<br />
<strong>des</strong> Tourismus beitragen. In küstennahen Bereichen hilft sie bei der Verstetigung<br />
<strong>des</strong> touristischen Angebots.
Quantitative Indikatoren<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 229 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtkosten, verursacht pro Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
Gesamtaufwendungen an zuschussfähigen<br />
Kosten (davon: private/öffentliche)<br />
durchschnittliche Unterstützung je Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Begünstigten (davon: Private/<br />
Öffentliche)<br />
Anzahl der Einheiten, für die Unterstützung<br />
gewährt wird (davon: private/öffentliche)<br />
Vergrößerung der Waldfläche im Kreisgebiet<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Definition „landwirtschaftliche Fläche“ gemäß Artikel 25 (der vorliegenden)<br />
Verordnung (EG) Nr. 1750/1999<br />
Aufgeforstet werden Ackerflächen, Grünlandflächen, Dauerweiden und Flächen für<br />
den Anbau von Dauerkulturen, die <strong>bis</strong>her regelmäßig landwirtschaftlich bewirtschaftet<br />
wurden.<br />
Definition „Landwirt“<br />
Als Landwirt gemäß Artikel 26 der EAGFL-VO Nr. 1257/1999 gilt auch, wer min<strong>des</strong>tens<br />
25 % seiner Arbeitszeit landwirtschaftlichen Tätigkeiten widmet. Der prozentuale<br />
Einkommensanteil wird mit dem Anteil der landwirtschaftlichen Tätigkeiten<br />
gleichgesetzt. Der Nachweis erfolgt über den Einkommensteuerbescheid oder - soweit<br />
dieser nicht vorliegt - über andere geeignete Unterlagen.<br />
Vorschriften, die sicherstellen, dass solche Aktionen an lokale Bedingungen<br />
angepasst und umweltgerecht sind und gegebenenfalls auch ein Gleichgewicht<br />
zwischen Waldbau und Wildbestand wahren<br />
Förderfähig sind nur Erstaufforstungsmaßnahmen, die von der zuständigen Behörde<br />
(in der Regel Forstbehörde im Benehmen mit Naturschutzbehörde) genehmigt wurden.<br />
Im Genehmigungsverfahren nach § 10 Bun<strong>des</strong>waldgesetz wird u.a. die Umweltverträglichkeit<br />
geprüft.<br />
In der Richtlinie 87/11/EG <strong>des</strong> Rates vom 03.03.1997 zur Änderung der Richtlinie<br />
85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist die Erstaufforstung aufgeführt.<br />
Die Richtlinie ist in Deutschland unmittelbar wirksames Recht. Es erfolgen<br />
Vorprüfungen und ggf. Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 230 -<br />
Die ökologisch besonders wertvollen Laub- und Mischwälder werden durch höhere<br />
Fördersätze begünstigt.<br />
Bei der privaten Aufforstung müssen die Ziele und Grundsätze der „Richtlinie für die<br />
naturnahe Waldentwicklung in den schleswig-holsteinischen Lan<strong>des</strong>forsten“ (1999)<br />
beachtet werden. Diese Richtlinie wurde im Umweltministerium von Fachleuten der<br />
Lan<strong>des</strong>forst- und der Lan<strong>des</strong>naturschutzverwaltung erarbeitet.<br />
Die Richtlinie fordert die Beachtung folgender Kriterien:<br />
1. Einsatz vorrangig heimischer Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften<br />
2. Waldbodenschutz und Gewässerschutz<br />
3. Waldökologisch angepasste Wildbestände<br />
4. <strong>Förderung</strong> der ökologischen Vielfalt<br />
5. Biologischer Waldschutz<br />
Die Anpassung an lokale Bedingungen der Maßnahmen ist gewährleistet durch Berücksichtigung<br />
der Eigentümerzielsetzungen, der Ergebnisse der forstlichen Standortkartierung,<br />
durch die fachliche Beratung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer<br />
durch die Forstverwaltung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LK) und<br />
durch die Durchführung der Fördermaßnahmen durch die LK.<br />
Durch die Förderbedingungen und die Fachberatung der LK ist auch die Umweltverträglichkeit<br />
der Beihilfemaßnahmen gewährleistet.<br />
Im Hinblick auf Waldbrandrisiken sind Waldbrandversicherungen abzuschließen.<br />
Erfolgsgefährdungen von Beihilfemaßnahmen infolge überhöhter Wildbestände wird<br />
forstbehördlich entgegengewirkt.<br />
Vertragliche Vereinbarungen zwischen Regionen und möglichen Begünstigten<br />
hinsichtlich der Aktionen nach Artikel 32 der Ratsverordnung<br />
Entfällt, da sich die Maßnahmen nicht auf die ökologische Stabilisierung von Wäldern<br />
oder auf die Erhaltung von Brandschutzstreifen nach Artikel 32 der Ratsverordnung<br />
beziehen.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Beschreibung der förderfähigen Aktionen und Begünstigten<br />
Förderfähige Aktionen<br />
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen<br />
Unterhaltungskosten für die aufgeforsteten Flächen (<strong>bis</strong> zu fünf Jahre)<br />
Jährliche Hektarprämie zum Ausgleich von aufforstungsbegünstigten Einkommensverlusten<br />
(<strong>bis</strong> zu 20 Jahre) für Landwirte oder deren Vereinigungen, die<br />
die Flächen vor der Aufforstung bewirtschaftet haben oder für andere Personen<br />
<strong>des</strong> Privatrechtes<br />
Begünstigte<br />
Begünstigte sind - nach näherer Maßgabe <strong>des</strong> GA-Rahmenplans:<br />
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer
Stand: 16.07.03<br />
- B 231 -<br />
Inhaberinnen und Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe<br />
Juristische Personen<br />
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse<br />
Bund, Länder, nichtländliche Gemeinden und Landwirte, die Vorruhestandsbeihilfen<br />
in Anspruch nehmen, sind von der <strong>Förderung</strong> ausgeschlossen.<br />
Zusammenhang zwischen den geplanten Aktionen und den nationalen/subnationalen<br />
Forstprogrammen oder gleichwertigen Instrumenten<br />
Die geplanten Aktionen entsprechen voll dem nationalen Forstprogramm/GA-Rahmenplan.<br />
Das Vorhandensein von Waldschutzplänen gemäß dem Gemeinschaftsrecht<br />
für Gebiete mit hohem oder mittlerem Waldbrandrisiko und der Übereinstimmung<br />
der geplanten Maßnahmen mit diesen Schutzplänen<br />
Das Waldbrandrisiko ist in Schleswig-Holstein gering. Es wird durch die Erhöhung<br />
<strong>des</strong> Laubwaldanteils als Ergebnis der Fördermaßnahmen weiter verringert.<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Die o.a. zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass die Landwirtschaftskammer eine<br />
fortlaufende Liste führt, in der für die Maßnahme die oben angegebenen Indikatoren<br />
sowie die sonstigen abzugebenden Informationen aufgeführt sind. Sie stellt daraus<br />
den Beitrag für den Lagebericht zusammen und liefert ihn an das fondsverwaltende<br />
Referat im MLR.<br />
Die Landwirtschaftskammer übermittelt dem Forstministerium jährlich die Ergebnisse<br />
der Maßnahme, beurteilt diese fachlich und gibt eine Einschätzung der Wirksamkeit<br />
der finanziellen und wirtschaftlichen Indikatoren.<br />
Darüber hinaus wird eine Evaluierung von einer unabhängigen Stelle durchgeführt.<br />
Dies geschieht auf der Grundlage der <strong>EU</strong>-Vorgaben und der nationalen Rahmenvorgaben.<br />
Das Forstministerium erstellt einen Evaluierungsbericht für den Fondsverwalter mit<br />
Aussagen über Erfolg und Perspektive der Maßnahme. Dieser Bericht soll ggf. eine<br />
Umsteuerung der Maßnahmen auf der Grundlage objektivierbarer Sachverhalte ermöglichen.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten
Stand: 16.07.03<br />
- B 232 -<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch ist zusätzlich vorgesehen, die Landwirtschaftskammer (LK),<br />
den Waldbesitzerverband und die Konferenz forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse<br />
laufend über die <strong>Förderung</strong>en zu informieren.<br />
Die LK informiert die Lan<strong>des</strong>regierung jährlich über die Ergebnisse der <strong>Förderung</strong>;<br />
die Lan<strong>des</strong>regierung informiert das Lan<strong>des</strong>parlament alle vier Jahre im Forstbericht<br />
über Ziele, Art, Umfang und Ergebnisse der forstlichen <strong>Förderung</strong>. Die Kommission<br />
wird jährlich durch die Bun<strong>des</strong>regierung über die Durchführung der GA-Maßnahmen<br />
informiert. Schleswig-Holstein liefert hierfür die erforderlichen Daten.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Die vertragliche Konformität der Beihilfemaßnahmen ist gewährleistet. Alle GA-<br />
Maßnahmen in Schleswig-Holstein halten sich in dem von der Kommission genehmigten<br />
bun<strong>des</strong>einheitlichen GA-Förderrahmen.<br />
Alle Maßnahmen stehen somit im Einklang mit dem nationalen Forstprogramm. Sie<br />
stehen überdies im Einklang mit den Zielsetzungen der Lan<strong>des</strong>regierung (Lan<strong>des</strong>entwicklungsgrundsätze,<br />
Lan<strong>des</strong>raumordnungsplan, Regionalpläne) und mit den<br />
Zielen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>parlaments („Waldresolution“).<br />
Auch im Entwicklungsplan selbst ist die Kohärenz gegeben. Maßnahmen zur Mehrung<br />
<strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> schützen Luft, Boden, Wasser und Klima, erweitern das touristische<br />
Potenzial, erhöhen die natürliche Vielfalt und sichern nachwachsende Ressourcen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 233 -<br />
Maßnahme h 2:<br />
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen durch Behörden<br />
(Titel II Kap. VIII)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 1,25 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 2,50 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
0,48 Mio. E tätigen, i.d.R. Aufforstungen auf Flächen, die nicht landwirtschaftlich genutzt<br />
wurden und mit erworben wurden (vgl. Ziff. 11).<br />
Beihilfeintensität<br />
Die Gemeinschaftsbeteiligung beträgt 50 % der Nettokosten.<br />
Die Kosten der Anpflanzungen sind ohne Mehrwertsteuer sowie abzüglich evtl. gewährter<br />
Rabatte definiert.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 234 -<br />
Gefördert werden Erstaufforstungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>. Die Maßnahmen werden von der<br />
Lan<strong>des</strong>forstverwaltung durchgeführt.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Aus dem vorangegangenen Planungszeitraum gibt es keine laufenden, in den neuen<br />
Planungszeitraum hineinwirkenden Verträge.<br />
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Wälder haben in Schleswig-Holstein eine besondere Bedeutung für den Boden-,<br />
Wasser- und Klimaschutz, für die Erhaltung naturnaher Lebensräume und für den<br />
Tourismus. Die Holzerzeugung deckt den Bedarf im Lande nur zu etwa einem Fünftel.<br />
Schleswig-Holstein ist mit einem Waldanteil von nur 10 % das waldärmste Land<br />
in Deutschland. Die Wälder umfassen eine Fläche von rd. 155.000 Hektar und verteilen<br />
sich auf über 10.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Der Laubbaumanteil<br />
beträgt 53 %. Er muss zur Stabilisierung der Wälder auch durch die Neuwaldbildung<br />
erhöht werden.<br />
Aufforstungen landwirtschaftlicher Flächen durch das Land erfolgen, um Waldbildungen<br />
aus öffentlichem Interesse zu verwirklichen. Sie erfolgen dort, wo private<br />
Aufforstungen nicht oder nicht hinreichend erfolgen. Das Potenzial für weitere Aufforstungen<br />
landwirtschaftlicher Flächen ist in Schleswig-Holstein groß.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
6 Mio. E getätigt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Forstbericht der Lan<strong>des</strong>regierung an den Schleswig-Holsteinischen Landtag (1998).<br />
Jährliche Berichte der Landwirtschaftskammer über die Ergebnisse der <strong>Förderung</strong>.<br />
Die Maßnahmen dienen der naturnahen Entwicklung von Wäldern und umweltverträglichen<br />
und nachhaltigen Nutzungen von Wäldern. Die Beihilfen leisten einen<br />
wirksamen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der Infrastruktur im ländlichen<br />
Raum. Die Beihilfemaßnahmen tragen überdies dazu bei, das touristische Potenzial<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> zu vergrößern.
Stand: 16.07.03<br />
- B 235 -<br />
Die geförderten Aufforstungen der schleswig-holsteinischen Lan<strong>des</strong>forstverwaltungen<br />
(LFV) entsprechen den heutigen forstfachlichen, ökologischen, landschafts- und<br />
umweltpflegerischen Anforderungen. Sie werden z.Z. im Rahmen der Zertifizierung<br />
der LFV vom FSC zertifiziert.<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Die Aufforstung durch Behörden soll jährlich min<strong>des</strong>tens 200 Hektar umfassen.<br />
Schleswig-Holstein verfolgt das Ziel, die Waldfläche im Lande um rund 30.000 ha zu<br />
vergrößern. Dies soll überwiegend durch private und kommunale Neuwaldbildung<br />
geschehen. Diese wird von Land, Bund und von der <strong>EU</strong> gefördert. Die private Nachfrage<br />
dieser Fördermaßnahmen ist z.Z. wegen der Förderdisparität Lw/Fw (Stilllegungs-/Aufforstungsprämie)<br />
sehr gering. Deshalb wird künftig die kommunale Neuwaldbildung<br />
und die Neuwaldbildung durch Behörden verstärkt verfolgt.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Neuwaldbildung ist eine landschaftliche und ökologische Bereicherung für das<br />
waldarme Schleswig-Holstein. Die Neuwaldbildung trägt durch Diversifizierung landwirtschaftlichen<br />
Einkommens sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
und durch mit zunehmendem Alter der Wälder zunehmende wirtschaftliche Bedeutung<br />
maßgeblich zur Entwicklung der ländlichen Räume bei. Die Neuwaldbildung<br />
kann insbesondere in den wirtschaftlich schwachen Räumen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> zur Stärkung<br />
<strong>des</strong> Tourismus beitragen. In küstennahen Bereichen hilft sie bei der Verstetigung<br />
<strong>des</strong> touristischen Angebots.<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtkosten, verursacht pro Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
Gesamtaufwendungen an zuschussfähigen<br />
Kosten (davon: private/öffentliche)<br />
durchschnittliche Unterstützung je Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Begünstigten (davon: Private/<br />
Öffentliche)<br />
Anzahl der Einheiten, für die Unterstützung<br />
gewährt wird (davon: private/öffentliche)<br />
Beitrag zur Vergrößerung der Waldfläche<br />
im Kreisgebiet<br />
3.3 Wesentliche Merkmale
Stand: 16.07.03<br />
- B 236 -<br />
Definition „landwirtschaftliche Fläche“ gemäß Artikel 25 (der vorliegenden)<br />
Verordnung (EG) Nr. 1750/1999<br />
Aufgeforstet werden Ackerflächen, Grünlandflächen, Dauerweiden und Flächen von<br />
Dauerkulturen, die <strong>bis</strong>her regelmäßig landwirtschaftlich bewirtschaftet wurden.<br />
Definition „Landwirt“<br />
Entfällt, da die Maßnahme sich gemäß Artikel 31 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1257/1999<br />
auf die Aufforstung durch Behörden bezieht.<br />
Vorschriften, die sicherstellen, dass solche Aktionen an lokale Bedingungen<br />
angepasst und umweltgerecht sind und gegebenenfalls auch ein Gleichgewicht<br />
zwischen Waldbau und Wildbestand wahren<br />
Durchführung durch lokale Fachbehörden<br />
Berücksichtigung der Ergebnisse der forstlichen Standortkartierung<br />
Beachtung der „Richtlinie für die naturnahe Waldentwicklung in den schleswigholsteinischen<br />
Lan<strong>des</strong>forsten“<br />
Beachtung <strong>des</strong> „Konzeptes für eine naturnahe Bewirtschaftung der Wälder in<br />
Schleswig-Holstein.<br />
Vertragliche Vereinbarungen zwischen Regionen und möglichen Begünstigten<br />
hinsichtlich der Aktionen nach Artikel 32 der Ratsverordnung<br />
Entfällt, da sich die Maßnahme nicht auf die ökologische Stabilisierung von Wäldern<br />
oder auf die Erhaltung von Brandschutzstreifen nach Artikel 32 der Ratsverordnung<br />
bezieht.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Beschreibung der förderfähigen Aktionen und Begünstigten<br />
Gefördert werden nur die Anlegungskosten.<br />
Das Land wird mit eigenen Aufforstungen ergänzend tätig und dies insbesondere<br />
dort, wo die Neuwaldbildung besondere Beiträge zur Entwicklung der Schutz- und<br />
Erholungsfunktionen von Wäldern erbringen kann. Alle Aufforstungen nach h 2 tragen<br />
bei zu nachhaltig ökologisch orientierten forstlichen Nutzungen, zur Vergrößerung<br />
der Biodiversität, zur Sicherung <strong>des</strong> Boden- und Gewässerschutzes und zur<br />
Entwicklung <strong>des</strong> touristischen Potenzials.<br />
Die eigenen Aufforstungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> erfolgen dort, wo<br />
größenbedingt besondere Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung waldgebundener<br />
Schutz- und Erholungsfunktionen möglich sind (komplexe Neuwaldbildung)
Stand: 16.07.03<br />
- B 237 -<br />
lagebedingt besondere Beiträge für die Naherholung und für den Tourismus<br />
möglich sind<br />
(Ordnungsräume und Gestaltungsräume, Küstennähe)<br />
funktionsbedingt besondere Beiträge zum Erosions- und Wasserschutz möglich<br />
sind<br />
(Verhinderung von Sandverwehungen und Nährstoffeinträgen in die Nord- und<br />
Ostsee)<br />
Zusammenhang zwischen den geplanten Aktionen und den nationalen/subnationalen<br />
Forstprogrammen oder gleichwertigen Instrumenten<br />
Die geplanten Aktionen ergänzen das nationale GA-Aufforstungsprogramm.<br />
Das Vorhandensein von Waldschutzplänen gemäß dem Gemeinschaftsrecht<br />
für Gebiete mit hohem oder mittlerem Waldbrandrisiko und der Übereinstimmung<br />
der geplanten Maßnahmen mit diesen Schutzplänen<br />
Das Waldbrandrisiko ist in Schleswig-Holstein gering. Es wird durch die Erhöhung<br />
<strong>des</strong> Laubwaldanteils als Ergebnis der Fördermaßnahmen weiter verringert.<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Die Maßnahmen werden von den Forstämtern durchgeführt. Die Vorschriften über<br />
das Haushalts- und Kassenwesen sichern den ordnungsgemäßen Kostennachweis.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Sie trägt dafür Sorge, dass die für die Durchführung der Maßnahme zuständigen<br />
Forstämter die Indikatoren und sonstigen abzugebenden Informationen dem MUNF<br />
liefern. Daraus wird der Beitrag für den Lagebericht gefertigt und dem fondsverwaltenden<br />
Referat im MLR zeitgerecht zugeleitet.<br />
Das Forstministerium erstellt einen Evaluierungsbericht für den Fondsverwalter mit<br />
Aussagen über Erfolg und Perspektive der Maßnahme. Dieser Bericht soll ggf. eine<br />
Umsteuerung der Maßnahmen auf der Grundlage objektivierbarer Sachverhalte ermöglichen.<br />
Darüber hinaus wird eine Evaluierung von einer unabhängigen Stelle durchgeführt.<br />
Dies geschieht auf der Grundlage der <strong>EU</strong>-Vorgaben und der nationalen Rahmenvorgaben.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten
Stand: 16.07.03<br />
- B 238 -<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch macht die Lan<strong>des</strong>forstverwaltung zusätzlich durch Pressetermine<br />
und Veröffentlichungen auf die Gemeinschaftsbeteiligung aufmerksam.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Aufforstungen durch Behörden ergänzen die Aufforstungen nach dem Rahmenplan.<br />
Sie entsprechen <strong>des</strong>sen Rahmenvorgaben.<br />
Aufforstungen durch Behörden stehen im Einklang mit den Zielsetzungen der Lan<strong>des</strong>regierung<br />
(Lan<strong>des</strong>entwicklungsgrundsätze, Lan<strong>des</strong>raumordnungsplan, Regionalpläne,<br />
Landschaftsprogramm) und mit den Zielen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>parlaments („Waldresolution“).<br />
Auch im Entwicklungsplan selbst ist die Kohärenz gegeben. Maßnahmen zur Mehrung<br />
<strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> schützen Luft, Boden, Wasser und Klima, erweitern das touristische<br />
Potenzial, erhöhen die natürliche Vielfalt und sichern nachwachsende Ressourcen.
Maßnahme i 1:<br />
Waldhilfsprogramm<br />
(Titel II (Kap. VIII)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 239 -<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 4,13 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 8,26 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
12,20 Mio. E tätigen (vgl. Ziffer 11).<br />
Beihilfeintensität<br />
<strong>bis</strong> 85 % für Laubbaumkulturen<br />
<strong>bis</strong> 70 % für Nadel-Laubmischkulturen<br />
<strong>bis</strong> 60 % für Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen<br />
<strong>bis</strong> 40 % für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (Erstinvestitionen)<br />
bei neuartigen Waldschäden <strong>bis</strong> 80 % für Vorarbeiten und <strong>bis</strong> 90 % für Bodenschutzdüngungen<br />
<strong>bis</strong> zu 80 % für Vorarbeiten, die der Vorbereitung der Umstellung auf eine naturnahe<br />
Waldwirtschaft dienen<br />
<strong>bis</strong> zu 70 % für Gestaltung und Pflege naturnaher Waldaußenränder und Waldinnenränder
Stand: 16.07.03<br />
- B 240 -<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.<br />
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Es gelten die notifizierten Fördergrundsätze <strong>des</strong> jeweiligen Rahmenplans nach der<br />
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und <strong>des</strong> Küstenschutzes".<br />
Es werden nur Maßnahmen im Privat- und Kommunalwald i.S. <strong>des</strong> Art. 29 Absatz 3<br />
gefördert.<br />
Die Teilmaßnahme h.1 Aufforstungsprogramm und i. 1 Waldhilfsprogramm stehen in<br />
gegenseitiger Abhängigkeit. Eine hohe Kalamitätsgefährdung der schleswigholsteinischen<br />
Forstwirtschaft durch Stürme und Folgeschäden (Käferbefall und<br />
Trocknis) und eine in Folge der peripheren Lage ausgeprägte Marktabhängigkeit der<br />
waldbaulichen Maßnahmen in Jungbeständen sowie eine schwankende Aufforstungsbereitschaft<br />
machen es erforderlich, ggf. Schwerpunktbildungen zu Gunsten<br />
einer Teilmaßnahme vornehmen zu können.<br />
Die vorgeschlagenen Maßnahmen tragen zur Erfüllung der auf der Ministerkonferenz<br />
über den Schutz der Wälder in Europa eingegangenen Verpflichtungen bei, insbesondere<br />
der Verpflichtung nach der Resolution H1 (Allgemeine Leitlinien für die<br />
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Europa) und der Resolution H 2 (Allgemeine<br />
Leitlinien für die Erhaltung der Biodiversität der europäischen Wälder).<br />
Die vorgeschlagenen Maßnahmen tragen überdies zur Erfüllung der Klimarahmenkonvention<br />
von Kyoto 1997 bei. Holzvorratserhöhungen infolge ordnungsgemäßer<br />
und naturnaher Waldbewirtschaftung führen zu nachhaltig wirksamen CO2-<br />
Bindungen.<br />
Die Maßnahmen dienen auch der im Lan<strong>des</strong>waldgesetz für Schleswig-Holstein vorgegebenen<br />
Verpflichtung, den Wald ordnungsgemäß und naturnah zu bewirtschaften<br />
(§8 <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>waldgesetzes).<br />
Die Maßnahmen stimmen überein mit den Grundsätzen <strong>des</strong> in arbeit befindlichen<br />
nationalen Forstprogramms (NFP) - insbesondere<br />
Konsistenz mit den konstitutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong><br />
Konsistenz mit den internationalen Vereinbarungen und Übereinkünften (insbesondere<br />
Rio, Helsinki, Lissabon) und<br />
langzeitlicher Planungs-, Implementierungs- und Überwachungsprozess.
Stand: 16.07.03<br />
- B 241 -<br />
Im NFP werden u. a. folgende Bereiche behandelt:<br />
Wald und Biodiversität<br />
Beitrag von Forst- und Holzwirtschaft zur Entwicklung ländlicher und urbaner<br />
Räume<br />
Wald und Klima und<br />
Bedeutung <strong>des</strong> nachwachsenden Rohstoffes Holz.<br />
Gegenüber den Grundsätzen für die <strong>Förderung</strong> forstwirtschaftlicher Maßnahmen im<br />
Rahmenplan 2000-2003 bestehen in der schleswig-holsteinischen <strong>Förderung</strong> folgende<br />
Einschränkungen:<br />
1. <strong>Förderung</strong> von Forstkulturen nur bei einem Min<strong>des</strong>tlaubbaumanteil von 40 %<br />
2. Verzicht auf die Bepflanzung von 10 - 30 % der Kulturflächen zu Gunsten natürlicher<br />
Waldentwicklung.<br />
Die förderfähigen Maßnahmen sind:<br />
1. Maßnahmen zur Umstellung auf Naturnahe Waldwirtschaft (Überführung von Nadelbaumreinbeständen<br />
und Umbau nicht standortgerechter Bestände in standortgerechte<br />
und stabile Mischbestände aus heimischen und heute im Lande vorhandenen<br />
naturalisierten Baumarten, Weiterentwicklung und Wiederherstellung von<br />
naturnahen Waldgesellschaften).<br />
2. Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen<br />
(Läuterungen und Durchforstungen in <strong>bis</strong> zu 40-jährigen Nadelbaumbeständen<br />
und in <strong>bis</strong> zu 60-jährigen Laubbaumbeständen (außer Pappelbeständen)<br />
3. Erstinvestitionen forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse<br />
(Erstmalige Beschaffung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen sowie erstmalige<br />
Anlage von Holzlagerplätzen und Betriebsgebäuden)<br />
Laufende Kosten werden nicht gefördert.<br />
4. Maßnahmen auf Grund neuartiger Waldschäden<br />
(Bodenschutzdüngungen, Vor- und Unterbau einschl. Naturverjüngung, Wiederaufforstung<br />
sowie dazu erforderliche Vorarbeiten)<br />
5. Vorarbeiten, die der Vorbereitung der Umstellung auf eine naturnahe Waldwirtschaft<br />
dienen<br />
6. Gestaltung und Pflege naturnaher Waldaußenränder und Waldinnenränder<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Aus dem vorangegangenen Planungszeitraum gibt es keine laufenden, in den neuen<br />
Planungszeitraum hineinwirkenden Verträge.
3. Spezifische Informationen<br />
3.1 Ist-Analyse<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 242 -<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Wälder haben in Schleswig-Holstein eine besondere Bedeutung für den Boden-,<br />
Wasser- und Klimaschutz, für die Erhaltung naturnaher Lebensräume und für den<br />
Tourismus. Die Holzerzeugung deckt den Bedarf im Lande nur zu etwa einem Fünftel.<br />
Schleswig-Holstein ist mit einem Waldanteil von nur 10 % das waldärmste Land<br />
in Deutschland. Die Wälder umfassen eine Fläche von rd. 155.000 Hektar und verteilen<br />
sich auf über 10.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Der Laubbaumanteil<br />
beträgt 53 %. Er muss zur Stabilisierung der Wälder insbesondere in den Nadelwäldern<br />
erhöht werden.<br />
Leistungsfähige Forstverwaltungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> und der Landwirtschaftskammer (LK)<br />
- diese führt alle forstlichen Fördermaßnahmen im Auftrage <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> durch - sowie<br />
gut geführte private und kommunale Forstbetriebe und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse<br />
- von der LK beraten und betreut - ermöglichen eine ordnungsgemäße<br />
und naturnahe Forstwirtschaft.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden öffentliche Aufwendungen in Höhe von<br />
11,4. Mio. E getätigt.<br />
Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt bei Investitionen in Wälder. In den Jahren<br />
1994 <strong>bis</strong> 1997 wurden gefördert:<br />
rd. 1.250 Hektar Umbau in standortgerechten Mischwald<br />
rd. 350 Hektar Wiederaufforstung mit Laubmischwald<br />
rd. 6.700 Hektar Jungbestandspflege.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Forstbericht der Lan<strong>des</strong>regierung an den Schleswig-Holsteinischen Landtag (1998).<br />
Jährliche Berichte der Landwirtschaftskammer über die Ergebnisse der <strong>Förderung</strong>.<br />
Diese Investitionen haben sich als notwendig, zielführend und erfolgreich erwiesen.<br />
In Zukunft sind sie erforderlich, um die Forderungen der 3. Minister-Konferenz zum<br />
Schutz der Wälder in Europa (Resolution L 1 und L 2) vom 2. - 4. Juni 1998 in Lissabon<br />
erfüllen zu können.<br />
Alle Maßnahmen dienen der naturnahen Entwicklung von Wäldern, der wirtschaftlichen<br />
Stabilisierung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und umweltverträglichen<br />
und nachhaltigen Nutzungen von Wäldern. Die Beihilfen leisten einen wirksamen<br />
Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der Infrastruktur im ländlichen Raum.<br />
Die Beihilfemaßnahmen tragen überdies dazu bei, das touristische Potenzial <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> zu vergrößern.
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 243 -<br />
Die Lan<strong>des</strong>regierung verfolgt hinsichtlich <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> in Schleswig-Holstein zwei<br />
quantifizierte langfristige Ziele:<br />
1. Erhöhung <strong>des</strong> Waldanteils von 10 auf 12 %, das bedeutet eine Waldvermehrung<br />
um rd. 30.000 Hektar.<br />
2. Erhöhung <strong>des</strong> Laubbaumanteils <strong>bis</strong> zum Jahre 2010 von 53 auf 60 %.<br />
Als weitere Ziele werden verfolgt:<br />
Gesundung und ökologische Stabilisierung der Wälder<br />
Ökonomische Stabilisierung der Forstbetriebe<br />
Zur Realisierung dieser Ziele fördert die Lan<strong>des</strong>regierung Maßnahmen im Rahmen<br />
ihres Waldhilfsprogramms (Überführung von Reinbeständen, Umbau nicht standortgerechter<br />
Bestände, Weiterentwicklung und Wiederherstellung von naturnahen<br />
Waldgesellschaften, Gestaltung und Pflege naturnaher Waldränder, Nachbesserungen,<br />
Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen, Maßnahmen auf Grund neuartiger<br />
Waldschäden, Investitionen forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse, Vorarbeiten<br />
zur Vorbereitung der Umstellung auf eine naturnahe Waldwirtschaft) und die<br />
Neuwaldbildung (Aufforstung und natürliche Bewaldung, Aufforstungsprämie).<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Investitionen in Wälder sichern Arbeit und Einkommen in ländlichen Räumen (Forstbetriebe,<br />
Forstliche Lohnunternehmen, Landhandel, Forstbaumschulen), verbessern<br />
die Öko-/Energiebilanz und erhöhen die touristische Attraktivität <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Landschaftsbild,<br />
gepflegter, erschlossener und erholungsgeeigneter Wald mit Erholungsund<br />
Freizeitangeboten für Fußgänger, Sportler, Radfahrer, Reiter).<br />
Quantitative Indikatoren<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtkosten, verursacht pro Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
Gesamtaufwendungen an zuschussfähigen<br />
Kosten (davon: private/öffentliche)<br />
durchschnittliche Unterstützung je Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Begünstigten (davon: Private/<br />
Öffentliche)<br />
Anzahl der Einheiten, für die Unterstützung<br />
gewährt wird (davon: private/öffentliche)<br />
Vergrößerung <strong>des</strong> Laubwal<strong>des</strong> im Kreisgebiet
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 244 -<br />
Definition „landwirtschaftliche Fläche“ gemäß Artikel 25 (der vorliegenden)<br />
Verordnung (EG) Nr. 1750/1999<br />
Entfällt, da es sich um keine Maßnahme nach Artikel 31 VO (EG) Nr. 1257/1999<br />
handelt.<br />
Definition „Landwirt“<br />
Als Landwirt gemäß Artikel 26 der EAGFL-VO Nr. 1257/1999 gilt auch, wer min<strong>des</strong>tens<br />
25 % seiner Arbeitszeit landwirtschaftlichen Tätigkeiten widmet. Der prozentuale<br />
Einkommensanteil wird mit dem Anteil der landwirtschaftlichen Tätigkeiten gleichgesetzt.<br />
Der Nachweis erfolgt über den Einkommenssteuerbescheid oder - soweit dieser<br />
nicht vorliegt - über andere geeignete Unterlagen.<br />
Vorschriften, die sicherstellen, dass solche Aktionen an lokale Bedingungen<br />
angepasst und umweltgerecht sind und gegebenenfalls auch ein Gleichgewicht<br />
zwischen Waldbau und Wildbestand wahren<br />
Die Anpassung an lokale Bedingungen der Maßnahmen ist gewährleistet durch Berücksichtigung<br />
der Eigentümerzielsetzungen, der Ergebnisse der forstlichen Standortkartierung,<br />
durch die fachliche Beratung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer<br />
durch die Forstverwaltung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LK) und<br />
durch die Durchführung der Fördermaßnahmen durch die LK. Durch die Förderbedingungen<br />
und die Fachberatung der LK ist auch die Umweltverträglichkeit der Beihilfemaßnahmen<br />
gewährleistet. Im Hinblick auf Waldbrandrisiken sind Waldbrandversicherungen<br />
abzuschließen. Erfolgsgefährdungen von Beihilfemaßnahmen infolge<br />
überhöhter Wildbestände wird forstbehördlich entgegengewirkt.<br />
Vertragliche Vereinbarungen zwischen Regionen und möglichen Begünstigten<br />
hinsichtlich der Aktionen nach Artikel 32 der Ratsverordnung<br />
Entfällt, da sich die Maßnahmen nicht auf die ökologische Stabilisierung von Wäldern<br />
oder auf die Erhaltung von Brandschutzstreifen nach Artikel 32 der Ratsverordnung<br />
beziehen.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Beschreibung der förderfähigen Aktionen und Begünstigten<br />
Förderfähige Aktionen<br />
Überführung von Reinbeständen<br />
Umbau nicht standortgerechter Bestände<br />
Weiterentwicklung und Wiederherstellung von naturnahen Waldgesellschaften<br />
Nachbesserung<br />
Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen<br />
Maßnahmen auf Grund neuartiger Waldschäden<br />
Gestaltung und Pflege naturnaher Waldränder
Stand: 16.07.03<br />
- B 245 -<br />
Investitionen forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse<br />
Vorarbeiten zur Vorbereitung der Umstellung auf eine naturnahe Waldwirtschaft<br />
Begünstigte<br />
Begünstigte sind - nach näherer Maßgabe <strong>des</strong> GA-Rahmenplanes:<br />
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer<br />
Inhaberinnen und Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe<br />
Juristische Personen<br />
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse<br />
Bund, Länder und nichtländliche Gemeinden sind von der <strong>Förderung</strong> ausgeschlossen.<br />
Zusammenhang zwischen den geplanten Aktionen und den nationalen/subnationalen<br />
Forstprogrammen oder gleichwertigen Instrumenten<br />
Die geplanten Aktionen entsprechen voll dem nationalen Forstprogramm/GA-Rahmenplan.<br />
Das Vorhandensein von Waldschutzplänen gemäß dem Gemeinschaftsrecht<br />
für Gebiete mit hohem oder mittlerem Waldbrandrisiko und der Übereinstimmung<br />
der geplanten Maßnahmen mit diesen Schutzplänen<br />
Das Waldbrandrisiko ist in Schleswig-Holstein gering. Es wird durch die Erhöhung<br />
<strong>des</strong> Laubwaldanteils als Ergebnis der Fördermaßnahmen weiter verringert.<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Die o.a. zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass die Landwirtschaftskammer eine<br />
fortlaufende Liste führt, in der für die Maßnahme die oben angegebenen Indikatoren<br />
sowie die sonstigen abzugebenden Informationen aufgeführt sind. Sie stellt daraus<br />
den Beitrag für den Lagebericht zusammen und liefert ihn an das fondsverwaltende<br />
Referat im MLR.<br />
Die Landwirtschaftskammer übermittelt dem Forstministerium jährlich die Ergebnisse<br />
der forstlichen <strong>Förderung</strong>, beurteilt diese fachlich und gibt eine Einschätzung der<br />
Wirksamkeit der finanziellen und wirtschaftlichen Indikatoren.<br />
Darüber hinaus wird eine Evaluierung von einer unabhängigen Stelle durchgeführt.<br />
Dies geschieht auf der Grundlage der <strong>EU</strong>-Vorgaben und der nationalen Rahmenvorgaben.
Stand: 16.07.03<br />
- B 246 -<br />
Das Forstministerium erstellt einen Evaluierungsbericht für den Fondsverwalter mit<br />
Aussagen über Erfolg und Perspektive der Maßnahme. Dieser Bericht soll ggf. eine<br />
Umsteuerung der Maßnahmen auf der Grundlage objektivierbarer Sachverhalte ermöglichen.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
Maßnahmenspezifisch ist zusätzlich vorgesehen, die Landwirtschaftskammer (LK),<br />
den Waldbesitzerverband und die Konferenz forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse<br />
laufend über die <strong>Förderung</strong>en zu informieren.<br />
Die LK informiert die Lan<strong>des</strong>regierung jährlich über die Ergebnisse der <strong>Förderung</strong>;<br />
die Lan<strong>des</strong>regierung informiert das Lan<strong>des</strong>parlament alle vier Jahre im Forstbericht<br />
über Ziele, Art, Umfang und Ergebnisse der forstlichen <strong>Förderung</strong>. Die Kommission<br />
wird jährlich durch die Bun<strong>des</strong>regierung über die Durchführung der GA-Maßnahmen<br />
informiert. Schleswig-Holstein liefert hierfür die erforderlichen Daten.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Kohärenz mit den Gemeinschaftspolitiken und den sonstigen nationalen Fördermaßnahmen<br />
ist im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und <strong>des</strong> Küstenschutzes" (GAK) gegeben.<br />
Die vertragliche Konformität der Beihilfemaßnahmen ist gewährleistet. Alle GA-<br />
Maßnahmen in Schleswig-Holstein halten sich in dem von der Kommission genehmigten<br />
bun<strong>des</strong>einheitlichen GA-Förderrahmen.<br />
Alle Maßnahmen stehen somit im Einklang mit dem nationalen Forstprogramm. Sie<br />
stehen überdies im Einklang mit den Zielsetzungen der Lan<strong>des</strong>regierung (Lan<strong>des</strong>entwicklungsgrundsätze,<br />
Lan<strong>des</strong>raumordnungsplan, Regionalpläne) und mit den<br />
Zielen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>parlaments („Waldresolution“).<br />
Auch im Entwicklungsplan selbst ist die Kohärenz gegeben. Maßnahmen zur Gesundung<br />
der Wälder, zur <strong>Förderung</strong> der Stabilität, Vielfalt und Leistungsfähigkeit und<br />
Maßnahmen zur Mehrung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> schützen Luft, Boden, Wasser und Klima,<br />
erweitern das touristische Potenzial, erhöhen die natürliche Vielfalt und sichern<br />
nachwachsende Ressourcen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 247 -<br />
Maßnahme i 2:<br />
Maßnahmen zur ökologischen Stabilisierung der Wälder<br />
(Titel II Kap. VIII)<br />
1. Allgemeine Anforderungen<br />
Maßnahmenbeschreibung in der Reihenfolge der VO (EG) Nr. 1257/99<br />
Forstwirtschaft<br />
Rechtsgrundlage für Fördermaßnahmen<br />
Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999<br />
2. Anforderungen, die alle oder nur einige Maßnahmen betreffen<br />
2.1 Wesentliche Merkmale<br />
Gemeinschaftsbeteiligung<br />
Es wird eine Gemeinschaftsbeteiligung in Höhe von 50 % der öffentlichen Aufwendungen,<br />
das sind 1,11 Mio. E, beantragt.<br />
Zusammen mit den nationalen öffentlichen Aufwendungen sollen im Rahmen <strong>des</strong><br />
Entwicklungsplanes für diese Maßnahme öffentliche Gesamtaufwendungen in Höhe<br />
von 2,20 Mio. E getätigt werden.<br />
Hinweis: Zusätzlich wird das Land für diese Maßnahme mit gleicher Rechtsgrundlage<br />
nationale öffentliche Aufwendungen ohne <strong>EU</strong>-Kofinanzierung in Höhe von<br />
0,50 Mio. E tätigen (vgl. Ziff. 11).<br />
Beihilfeintensität<br />
Dafür wird eine Unterstützung gewährt. Die Zahlung liegt zwischen 40 und 120 E je<br />
Jahr und Hektar. Die Unterstützung übersteigt die ermittelten Kosten der Maßnahmen<br />
nicht. Bei Einzelmaßnahmen stellt die bewilligende Stelle die Kosten fest.<br />
Ausnahmen nach Artikel 37, Absatz 3, Unterabsatz 2 erstes Tiret der VO (EG)<br />
Nr. 1257/99<br />
Die Maßnahme unterliegt nicht den Stützungsregelungen gemeinsamer Marktordnungen.
2.2 Sonstige Bestandteile<br />
Einzelheiten der Förderbedingungen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 248 -<br />
Die Maßnahmen beschränken sich auf Privatwald im Sinne Art. 29 Abs. 3 der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1257/1999 und der dazu erlassenen Durchführungsvorschriften<br />
(EG) Nr. 1750/1999. Die Verträge werden auf der Grundlage der Ermächtigung <strong>des</strong><br />
Haushaltsgesetzes „Grundsätze für den Abschluss von Verträgen zur ökologischen<br />
Stabilisierung der Wälder“ abgeschlossen. Für Wälder, für die eine Beihilfe gemäß<br />
Art. 31 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 für die Aufforstung gewährt wurde, werden<br />
keine Zahlungen gewährt. Diese Flächen werden bei der Herleitung der Beträge<br />
nicht berücksichtigt.<br />
Das Land schließt mit Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern Verträge, in denen Natur-<br />
und Umweltschutzmaßnahmen vereinbart werden. Die Landwirtschaftskammer<br />
Schleswig-Holstein führt die <strong>Förderung</strong> entsprechend der Lan<strong>des</strong>verordnung zur Übertragung<br />
der Aufgaben auf die Landwirtschaftskammer vom 17. Januar 1996<br />
durch.<br />
Die Zahlungen an die Waldbesitzer werden auf der Grundlage der tatsächlichen<br />
Kosten hergeleitet. Sie richten sich nach den im Einzelnen festgelegten Maßnahmen.<br />
Für folgende Maßnahmen wird ein Grundbetrag <strong>bis</strong> zu 45 E/ha jährlich <strong>bis</strong> Ende<br />
der Programmlaufzeit gezahlt:<br />
Erhalt und Pflege vorhandener Waldbiotope<br />
Saat und Pflanzung nur mit heimischen Baum- und Straucharten<br />
Verzicht auf Biozide.<br />
Der Grundbetrag errechnet sich<br />
für Erhalt und Pflege vorhandener Waldbiotope :<br />
In der Lan<strong>des</strong>forstverwaltung wurden zwischen 1990 und 1996 im<br />
Schnitt jährlich DM 26/ha für Landschaftspflege und Erholungsmaßnahmen<br />
aufgewandt. Davon entfallen ca. 70 % auf Biotoppflegemaßnahmen<br />
DM 18/ha<br />
für Saat und Pflanzung nur mit heimischen Baum- und<br />
Straucharten :<br />
Die Mehrkosten für Laubbaumkulturen betragen ca.<br />
3.000 DM/ha. Bei 0,5 % jährlicher Verjüngungsfläche ergeben<br />
sich jährliche Mehrkosten von<br />
Die Verjüngungen sollen nur noch mit heimischen Herkünften<br />
erfolgen. Die Mehrkosten betragen je Pflanze ca. DM 0,10, bei<br />
5000 Pflanzen je ha DM 500.<br />
DM 500 mal 1 % jährliche Kulturfläche<br />
Durch den Verzicht auf Nadelbäume in Reinkultur oder als Beimischung<br />
in Laubbaumbeständen mindern sich die Ertragswerte<br />
der Wälder.<br />
Auf der Grundlage der Zuwachsdaten aus den Lan<strong>des</strong>forsten, die<br />
DM 15/ha<br />
DM 5/ha
Stand: 16.07.03<br />
- B 249 -<br />
sich als repräsentativ erwiesen haben, wurden folgende Differenzen<br />
der Bruttorenten hergeleitet.<br />
Die relativen Ertragsklassen sind bei den Baumarten ähnlich.<br />
Eiche 1,6; Buche 1,7; Esche 1,4; Fichte 1,7; Douglasie<br />
1,8; Lärche 2,1.<br />
Entsprechend der Richtlinien <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> für die Begründung von<br />
Nutzungsverhältnissen an Waldflächen (NV-Wald 17. März 1986<br />
Bun<strong>des</strong>anzeiger Nr. 182a vom 01.10.86) errechnen sich für die<br />
Baumartengruppen folgende Bodennettorenten<br />
Kiefer 10 DM/ha<br />
Fichte 118 DM/ha<br />
Buche 19 DM/ha<br />
Eiche 82 DM/ha<br />
Douglasie hat in Schleswig-Holstein einen um den Faktor 1,37<br />
höheren Zuwachs als Fichte. Die Bodenrente für Douglasie wird<br />
auf 320 DM/ha eingeschätzt.<br />
Aus der Standortverteilung in Schleswig-Holstein ist ein zukünftige<br />
Nadelwaldbestockung mit 10 % Kiefer/Lärche, 30 % Fichte,<br />
60 % Douglasie anzunehmen.<br />
Durchschnittliche Bodenrente<br />
0,6 mal 320<br />
0,3 mal 118<br />
0,1 mal 19<br />
229,30 DM/ha.<br />
Im Laubwald werden derzeit etwa 50 % mit Eichenmischwäldern<br />
und 50 % mit Buchenmischwäldern begründet. Die durchschnittliche<br />
Bodenrente beträgt<br />
0,5 mal 82,00 DM<br />
0,5 mal 19,00 DM<br />
50,50 DM/ha<br />
Die Differenz der Bodennettorenten Laubwald zu Nadelwald beträgt<br />
ca. 178,80 DM/ha jährlich. Der Kapitalwert der Rente beim<br />
Zinsfuß von 4 % beträgt 4.470 DM. Bezogen auf den Anteil der<br />
jährlichen Nadelwaldverjüngungsfläche von 0,5 % ergibt sich eine<br />
jährliche Ertragswertminderung für den Verzicht auf Nadelholzanbau<br />
von DM 22,30/ha<br />
für Verzicht auf Biozide :<br />
Die Lan<strong>des</strong>forstverwaltung Schleswig-Holstein wendet seit mehreren<br />
Jahren keine Insektizide zur Prävention und Bekämpfung<br />
ein. Rhodentizide wurden seit 2 Jahren nicht mehr eingesetzt. Für<br />
biologischen Forstschutz wurden in den Jahren 1990 <strong>bis</strong> 1996 im<br />
Mittel DM 29/Jahr und ha aufgewandt. Chemische Verfahren<br />
kosten in der Regel weniger als die Hälfte biologisch/ biotechnischer<br />
Verfahren.<br />
Die höheren Risikokosten auf Grund höherer Schäden bei Verzicht<br />
auf Biozide lassen sich nur näherungsweise aus den<br />
Schadflächen ableiten und werden für Insektenschäden daher<br />
nicht angegeben.<br />
DM 15/ha
Stand: 16.07.03<br />
- B 250 -<br />
Die Mehrkosten durch Biozidverzicht entstehen großteils bei Nadelwäldern.<br />
In Schleswig-Holstein fallen zwischen 15 und 20 %<br />
<strong>des</strong> Hiebsatzes als zufällige Nutzungen an, 80 <strong>bis</strong> 90 % sind davon<br />
Nadelholz. Das entspricht einem jährlichen Nadelschadholzanfall<br />
von 0,6 Festmeter je ha. Davon die Hälfte ist als stark borkenkäferbefallsgefährdet<br />
einzustufen. Handentrindung, mechanische<br />
Entseuchung oder sofortige Abfuhr aus dem Wald verursachen<br />
gegenüber einer chemischen Behandlung gegen Borkenkäfer<br />
Mehrkosten von ca. DM 8 je Festmeter. Dadurch entstehen<br />
Mehrkosten je ha von<br />
Mäuse sind ein wesentlicher Risikofaktor für Kulturen. Die<br />
Schadflächen nehmen zwischen 1 <strong>bis</strong> 5 % der Kulturflächen ein.<br />
Bei 1 % Kulturfläche und Kulturkosten für Wiederholungspflanzungen<br />
inklusive Pflege von DM 8.000 je ha werden die Risikokosten<br />
mit DM 2,80 bewertet.<br />
Die Durchführung der Maßnahmen erhöht den Dispositionsaufwand<br />
im Forstbetrieb. Er wird mit 10 % der Kosten der Naturschutzmaßnahmen<br />
eingeschätzt<br />
Die Kosten für die Standardschutzmaßnahmen betragen<br />
jährlich<br />
DM 2,40/ha<br />
DM 2,80/ha<br />
DM 8,10/ha<br />
DM 88,60/ha<br />
bzw.<br />
45,30 Euro/ha.<br />
In den Verträgen können<br />
Maßnahmen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt<br />
die Mehrung von Alt- und Totholz durch Nutzungsverzicht<br />
Verzicht auf bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Kahlschlag, ertragssteigernde<br />
Düngung usw.<br />
die <strong>Förderung</strong> heimischer Pflanzengesellschaften<br />
die Wiederherstellung <strong>des</strong> natürlichen Wasserhaushalts<br />
und Einzelmaßnahmen <strong>des</strong> Arten- und Biotopschutzes vereinbart werden.<br />
Zur Sicherstellung der langfristigen Wirksamkeit der Maßnahmen, können die Vertragsbindungen<br />
über den Zeitraum der Zahlungen hinaus eingegangen werden. (z.B.<br />
damit Altholz, auf <strong>des</strong>sen Einschlag verzichtet wurde, langfristig erhalten bleibt; Wälder<br />
nicht wieder entwässert werden).<br />
Die Ausgleichszahlungen werden nur für Maßnahmen gewährt, die über die allgemeine<br />
Pflicht zu einer ordnungsgemäßen und naturnahen Bewirtschaftung der Wälder<br />
hinausgehen. Maßnahmen, zu denen die Waldbesitzer auf Grund anderer Verträge<br />
oder Vorschriften verpflichtet sind, werden nicht gefördert. Es werden nur<br />
Maßnahmen gefördert, deren Kosten höher sind als die forstlichen Erträge bei nachhaltiger<br />
Bewirtschaftung. Die Feststellung der Ertragsfähigkeit erfolgt durch die<br />
Landwirtschaftkammer.<br />
Wälder mit Schutzfunktionen und ökologischen Funktionen von öffentlichem Interesse<br />
stocken überwiegend auf ertragsschwachen Standorten und sind überwiegend
3. Spezifische Informationen<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 251 -<br />
mit Laubbaumarten bestockt, die einen geringeren Zuwachs als Nadelbäume haben.<br />
Die durchschnittliche Ertragsfähigkeit (d.h. Bodenrente) dieser Wälder ist daher geringer<br />
als die mit 50,50 DM/ha errechnete durchschnittliche Bodenrente für Laubwälder<br />
in Schleswig-Holstein anzusetzen. Die nachhaltigen Erträge sind geringer als die<br />
Kosten für die Standardschutzmaßnahmen mit dem Grundbetrag von 45 €/ha.<br />
Im Kleinprivatwald unter 50 ha übersteigt auf Grund der allgemeinen strukturellen<br />
Nachteile der Betriebe die Kostenbelastung für Natur-, Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen<br />
die nachhaltige Ertragsfähigkeit der Betriebe.<br />
Einer Einzelfallprüfung für Flächen unter 50 ha bedarf es nicht. Bei größeren Flächen<br />
können die Ertragsschätzungen auf der Grundlage von Betriebsgutachten, steuerlichen<br />
Hiebsatzfeststellungen oder Waldstrukturdaten vorgenommen werden. Bei offensichtlichen<br />
Aufbaubetrieben bzw. Flächen mit unterdurchschnittlichen Holzvorräten<br />
genügt eine Erklärung der Landwirtschaftskammer zur Ertragsfähigkeit der Wälder.<br />
In die Verträge wird ein Rückzahlungsvorbehalt aufgenommen. Die Ausgleichszahlungen<br />
sind bei schweren Vertragsverletzungen vollständig zurückzuzahlen. Im Übrigen<br />
gelten die Sanktionen der Ratsverordnung 1750/1999 Art. 48 Abs. 3. Der Landwirtschaftskammer<br />
obliegt die Rückforderung.<br />
Die Maßnahme wird wie folgt in Schleswig-Holstein angewandt.<br />
Bei einem grundsätzlichen öffentlichen Interesse an der Erhaltung und Verbesserung<br />
der Schutzfunktionen und ökologischen Funktionen aller Wälder in Schleswig-<br />
Holstein sollen Prioritäten für die Vertragsangebote gebildet werden. Die Flächen, für<br />
die Verträge geschlossen werden, sollen bedeutende Anteile folgender Waldtypen<br />
enthalten:<br />
Wälder mit Lebensraumtypen, die in Anhang 1 der FFH-Richtlinie ausgewiesen<br />
sind bzw. die zu naturnahen Waldgesellschaften entwickelt werden können<br />
Wälder in oder angrenzend an Flächen und Entwicklungsachsen <strong>des</strong> schleswigholsteinischen<br />
Biotopverbundsystems<br />
Wälder mit historischen Waldnutzungsformen<br />
Wälder in oder an geschützten Landschaftsbestandteilen entsprechend dem Lan<strong>des</strong>naturschutzgesetz<br />
für Schleswig-Holstein<br />
Wälder in Wasserschutz- oder Wasserschongebieten<br />
Wälder, die in der Biotop-, Waldfunktionenkartierung oder in Landschaftsplänen<br />
mit besonderer Schutzwürdigkeit ausgewiesen werden.<br />
Die obere Naturschutzbehörde stimmt die Schwerpunkte, in denen Vertragsangebote<br />
unterbreitet werden, mit der Landwirtschaftskammer ab.<br />
Die betroffenen Waldflächen sollen min<strong>des</strong>tens 1 ha groß sein.<br />
Beschreibung sämtlicher laufender Verträge aus dem vorangegangen Planungszeitraum<br />
Entfällt, da das Förderinstrument neu ist. Vergleichbare Verträge wurden im vorherigen<br />
Planungszeitraum nicht geschlossen.
3.1 Ist-Analyse<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 252 -<br />
Lagebeschreibung (Stärken, Schwächen, Entwicklungsmöglichkeiten)<br />
Die Ertragslage der schleswig-holsteinischen Forstwirtschaft ist strukturbedingt<br />
schlecht. Erhebungen in Deutschland bei Kleinbetrieben unter 50 ha zeigen überwiegend<br />
negative Betriebsergebnisse. Zusätzliche Aufwendungen sind wirtschaftlich<br />
nicht zumutbar.<br />
Erfahrungen aus der vorangegangenen Programmplanung liegen nicht vor.<br />
Der ökologische Wert der Wälder in Schleswig-Holstein ist auf Grund der geringen<br />
Waldfläche, Streulage und ungünstigen Altersstruktur zu erhalten und zu steigern,<br />
um nachhaltig das heimische Arteninventar sichern zu können, sowie die Schutzfunktionen<br />
der Wälder für Klima, Boden, Wasser und gegen schädliche Umwelteinwirkungen<br />
(Lärm, Emissionen, Sicht) aufrecht zu erhalten. Insbesondere zur Vernetzung<br />
der Lebensräume ist eine Steigerung bzw. Erhaltung der Biodiversität aller<br />
Wälder von öffentlichem Interesse.<br />
Durch diese Maßnahme zur ökologischen Stabilisierung von Wäldern können deren<br />
Beiträge zur Arten- und Strukturvielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen<br />
lan<strong>des</strong>weit wirksam erhöht werden.<br />
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingesetzte Finanzmittel<br />
und wichtige Ergebnisse<br />
Im Förderzeitraum 1994 - 1999 wurden keine öffentliche Aufwendungen getätigt.<br />
Verfügbare Bewertungsergebnisse<br />
Forstbericht der Lan<strong>des</strong>regierung an den Schleswig-Holsteinischen Landtag (1998).<br />
Bun<strong>des</strong>waldinventur, Biotopkartierung, Landschaftsprogramm<br />
Quantifizierte Ziele/Strategie<br />
Die Lan<strong>des</strong>regierung verfolgt mit dieser Maßnahme die Strategie, im Privatwald lan<strong>des</strong>weit<br />
zusätzliche Beispiele für eine ökologisch anspruchsvolle Waldbewirtschaftung<br />
zu schaffen. Ca. 2.500 Hektar Privatwald sollen mit dieser Maßnahme ökologisch<br />
aufgewertet werden.<br />
3.2 Beschreibung der erwarteten Wirkungen und Indikatoren<br />
Erwartete Wirkung<br />
Die Biodiversität der Wälder wird erhöht.<br />
Die Attraktivität der Wälder für Erholung und Tourismus wird steigen.<br />
Die Forstbetriebe werden mit den Zahlungen wirtschaftlich in die Lage versetzt, die<br />
Schutzfunktionen zu erhalten und zu entwickeln.
Quantitative Indikatoren<br />
Stand: 16.07.03<br />
- B 253 -<br />
Finanzielle Indikatoren: Gesamtkosten, verursacht pro Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
Gesamtaufwendungen an zuschussfähigen<br />
Kosten (davon: private/öffentliche)<br />
durchschnittliche Unterstützung je Begünstigtem<br />
(davon: private/öffentliche)<br />
öffentliche Aufwendungen insgesamt (davon<br />
EAGFL-Beteiligung)<br />
Materielle Indikatoren: Anzahl der Begünstigten (davon: Private/<br />
Öffentliche)<br />
Anzahl der Einheiten, für die Unterstützung<br />
gewährt wird (davon: private/öffentliche)<br />
Waldökosysteme reagieren sehr langsam. Maßnahmen zur ökologischen Stabilisierung<br />
der Wälder wirken sich oft erst nach Jahrzehnten aus. Die damit verfolgten<br />
Ziele wie Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität, Erhaltung/Entwicklung bestimmter<br />
Lebensraumtypen im Wald und Erhaltung <strong>des</strong> ökologischen Gleichgewichts<br />
lassen sich mit vertretbarem wissenschaftlichen Aufwand am Einzelprojekt nicht<br />
quantifizieren. Der Programmzeitraum reicht nicht, um die im Arbeitsdokument VI<br />
12006/00 vorgeschlagenen Indikatoren bewerten zu können. Die materiellen Wirkungsindikatoren<br />
und deren Bewertungen werden daher anhand vergleichender<br />
Studien hergeleitet werden.<br />
Agrarstrukturelle Auswirkungen sind mit Ausnahme der Einkommensfunktion im<br />
ländlichen Raum nicht zu erwarten und bedürfen keiner weiteren Untersuchung.<br />
Auswirkungen auf Erholung und Tourismus sind einer Einzelmaßnahme nicht zuzuordnen.<br />
Sie sind im Verbund mit anderen Erholungs- und Tourismusfördermaßnahmen<br />
zu bewerten.<br />
3.3 Wesentliche Merkmale<br />
Definition „landwirtschaftliche Fläche“ gemäß Artikel 25 (der vorliegenden)<br />
Verordnung (EG) Nr. 1750/1999<br />
Entfällt, da es sich um eine Maßnahme nach Artikel 32 der Verordnung (EG)<br />
Nr. 1257/1999 handelt und nicht um eine Maßnahme nach Artikel 31 der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1257/1999.<br />
Definition „Landwirt“<br />
Für Maßnahmen nach Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 ist die Definition<br />
unerheblich.<br />
Vorschriften, die sicherstellen, dass solche Aktionen an lokale Bedingungen<br />
angepasst und umweltgerecht sind und gegebenenfalls auch ein Gleichgewicht<br />
zwischen Waldbau und Wildbestand wahren
Stand: 16.07.03<br />
- B 254 -<br />
Die Maßnahmen dienen dem Umwelt- und Naturschutz. Sie werden fachlich begleitet<br />
durch Lan<strong>des</strong>dienststellen und durch die Landwirtschaftskammer durchgeführt.<br />
Vertragliche Vereinbarungen zwischen Regionen und möglichen Begünstigten<br />
hinsichtlich der Aktionen nach Artikel 32 der Ratsverordnung<br />
Zu den Inhalten der vertraglichen Vereinbarungen wird auf Ziffer 2.2 verwiesen. Ein<br />
Anrtragsentwurf ist in der Anlage beigefügt.<br />
3.4 Sonstige Bestandteile<br />
Beschreibung der förderfähigen Aktionen und Begünstigten<br />
Förderfähige Aktionen und Bedingungen<br />
Grundbetrag für:<br />
Erhalt und Pflege vorhandener Waldbiotope:<br />
nicht heimische Baumarten werden in Wald-Biotopen nach § 15a Lan<strong>des</strong>naturschutzgesetz<br />
entnommen, Waldwiesen und Waldsäume werden offengehalten.<br />
Bei Pflanzungen und Saat werden nur Baumarten und Straucharten heimischer<br />
Art und Herkunft verwandt.<br />
Verzicht auf Biozide:<br />
Es werden bei der Waldbewirtschaftung keine Biozide eingesetzt. Zur Abwendung<br />
von existenziellen Waldgefährdungen kann die Forstbehörde Ausnahmen<br />
zulassen.<br />
Einzelfallregelung für:<br />
Maßnahmen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt<br />
Mehrung von Alt- und Totholz durch Nutzungsverzicht<br />
Verzicht auf bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen<br />
<strong>Förderung</strong> heimischer Pflanzengesellschaften<br />
Wiederherstellung <strong>des</strong> natürlichen Wasserhaushalts<br />
Einzelmaßnahmen <strong>des</strong> Arten- und Biotopschutzes<br />
Für Einzelmaßnahmen stellt die Landwirtschaftskammer die Kosten der Maßnahmen<br />
fest. Die Kosten der Maßnahmen errechnen sich aus<br />
den Ausgaben ohne Mehrwertsteuer<br />
Eigenleistungen in Höhe von 80% vergleichbarer Kosten bei Unternehmerleistungen<br />
Ertragseinbußen bei Nutzungsverzichten<br />
Bewirtschaftungserschwernissen<br />
Neben den für die jeweilige Vertragsfläche vereinbarten Bewirtschaftungsauflagen<br />
sollen aus ökologischen Gründen und zur leichteren Nachvollziehbarkeit Nutzungsverzichte<br />
(z.B. Altholzinseln) bzw. biotopgestaltende Maßnahmen wie z.B. Wiedervernässung<br />
eines Bruchstandortes auf geeigneten Teilflächen der Wälder durchgeführt<br />
werden. Die Kosten für diese Maßnahmen sind auf die ganze Fläche, für die<br />
der Vertrag geschlossen wurde, anzurechnen, soweit diese im ökologischen Zusammenhang<br />
stehen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 255 -<br />
Begünstigte:<br />
Private Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer hinsichtlich ihres Waldbesitzes in<br />
Schleswig-Holstein.<br />
Zusammenhang zwischen den geplanten Aktionen und den nationalen/subnationalen<br />
Forstprogrammen oder gleichwertigen Instrumenten<br />
Die Maßnahmen sollen der Umsetzung der Konvention über die Erhaltung der biologischen<br />
Vielfalt dienen.<br />
Alle Maßnahmen stehen im Einklang mit der Zielsetzung der Lan<strong>des</strong>regierung (Lan<strong>des</strong>raumordnungsplan,<br />
Lan<strong>des</strong>entwicklungsgrundsätze, Regionalpläne) sowie mit<br />
den in der Waldresolution <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>parlaments gesetzten Zielen. Mit den aus rein<br />
nationalen Mitteln finanzierten Maßnahmen werden die selben Ziele verfolgt. Die<br />
Maßnahmen dienen der Umsetzung der Strategie "Forstwirtschaft und Biologische<br />
Vielfalt" der Forstverwaltungen <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> und der Länder zur Erhaltung und nachhaltigen<br />
Nutzung der biologischen Vielfalt in den Wäldern Deutschlands. An der Erarbeitung<br />
der Strategie wurden die Naturschutzverbände beteiligt.<br />
Das Vorhandensein von Waldschutzplänen gemäß dem Gemeinschaftsrecht<br />
für Gebiete mit hohem oder mittlerem Waldbrandrisiko und der Übereinstimmung<br />
der geplanten Maßnahmen mit diesen Schutzplänen<br />
Nicht erforderlich, da Schleswig-Holstein nicht im Gebiet mit besonderem Waldbrandrisiko<br />
liegt und Brandschutz mit landwirtschaftlichen Methoden nicht gefördert<br />
werden soll.<br />
Definition der Finanztechnik<br />
Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1 verwiesen.<br />
Vorschriften für die Begleitung und Bewertung<br />
Die für die Durchführung dieser Maßnahme zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass<br />
die gegenüber der <strong>EU</strong>-Kommission abzugebenden Informationen für die jährlichen<br />
Lageberichte dem fondsverwaltenden Referat zeitgerecht vorliegen.<br />
Die o.a. zuständige Stelle trägt dafür Sorge, dass die Landwirtschaftskammer eine<br />
fortlaufende Liste führt, in der für die Maßnahme die oben angegebenen Indikatoren<br />
sowie die sonstigen abzugebenden Informationen aufgeführt sind. Sie stellt daraus<br />
den Beitrag für den Lagebericht zusammen und liefert ihn an das fondsverwaltende<br />
Referat im MLR.<br />
Das Forstministerium erstellt einen Evaluierungsbericht für den Fondsverwalter mit<br />
Aussagen über Erfolg und Perspektive der Maßnahme. Dieser Bericht soll ggf. eine<br />
Umsteuerung der Maßnahme auf der Grundlage objektivierbarer Sachverhalte ermöglichen.<br />
Vorschriften für die Kontrollmodalitäten<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.3 verwiesen.
Stand: 16.07.03<br />
- B 256 -<br />
Vorschriften für die Sanktionen<br />
Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.4 verwiesen.<br />
Regelungen für die angemessene Publizität<br />
Hinsichtlich der Regeln für die angemessene Publizität auf Ebene <strong>des</strong> Entwicklungsplanes<br />
wird auf Ziffer 7.5 verwiesen.<br />
In Formularen und Verträgen wird auf die Gemeinschaftsbeteiligung hingewiesen.<br />
Kohärenz mit anderen Gemeinschaftspolitiken und anderen Instrumenten<br />
der gemeinsamen Agrarpolitik (besonders die Ausnahmen nach Artikel 37<br />
Absatz 2) und sonstigen Fördermaßnahmen<br />
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielsetzungen und Programmen der Lan<strong>des</strong>regierung<br />
(Lan<strong>des</strong>entwicklungsgrundsätze, Lan<strong>des</strong>raumordnungsplan, Regionalpläne,<br />
Landschaftsprogramm) und mit den Zielen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>parlamentes (Waldresolution).<br />
Auch im Entwicklungsplan selbst ist die Kohärenz gegeben. Maßnahmen zur ökologischen<br />
Aufwertung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> erhöhen die natürliche Vielfalt, sichern die natürlichen<br />
Lebensgrundlagen und erweitern das touristische Potenzial <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>.
Finanzplan Schleswig-Holstein<br />
in Mio. <strong>EU</strong>RO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Insgesamt<br />
Schleswig-Holstein<br />
Stand: Januar 03<br />
Schwerpunkt A -Produktionsstruktur<br />
Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Be-teiligung Private* Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Be-teiligung Private* Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Be-teiligung Private* Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Private* Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Private* Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Private* Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Private*<br />
a Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 1,89 0,755714 0,00 0,35 0,138294 0,19 3,53 1,410717 1,94 4,75 1,90 2,61 5,50 2,20 3,03 6,50 2,60 3,58 7,75 3,10 4,26 # 30,27 12,10 15,61<br />
c Berufsbildung 0,13 0,050150 0,14 0,11 0,043492 0,00 0,14 0,056152 0,00 0,13 0,05 0,00 0,18 0,07 0,00 0,18 0,07 0,00 0,18 0,07 0,00 # 1,01 0,41 0,14<br />
g Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 0,70 0,280301 1,12 0,70 0,281306 2,65 3,10 1,241783 12,36 3,58 1,43 13,95 3,58 1,43 14,02 3,63 1,45 14,30 3,70 1,48 14,58 # 18,98 7,59 72,96<br />
Summe A<br />
Schwerpunkt B - Ländliche Entwicklung<br />
2,72 1,086165 1,26 1,16 0,463093 2,84 6,77 2,708652 14,30 8,46 3,38 16,56 9,26 3,70 17,05 10,31 4,12 17,87 11,63 4,65 18,84 # 50,26 20,11 88,71<br />
k<br />
Flurbereinigung 3,09 1,234486 0,00 4,34 1,736644 0,00 2,53 1,009392 0,00 2,59 1,03 0,00 2,63 1,05 0,00 2,71 1,08 0,00 2,75 1,10 0,00 # 20,64 8,26 0,00<br />
m1* Finanzmittel für Vermarktungskonzeptionen der Teilmaßnahme g1 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,20 0,05 0,02 0,20 0,05 0,02 0,20 0,05 0,02 0,20 # 0,20 0,08 0,80<br />
n<br />
Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und<br />
Bevölkerung 0,98 0,393361 0,00 0,96 0,382904 0,00 3,76 1,505656 0,00 6,99 2,79 0,00 7,85 3,14 0,00 7,93 3,17 0,00 6,74 2,69 0,00 # 35,18 14,07 0,00<br />
o<br />
Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und Erhaltung <strong>des</strong> ländlichen<br />
Kulturerbes 8,87 3,548848 0,00 12,31 4,925183 0,00 15,15 7,132772 0,00 23,78 9,51 0,00 23,67 9,47 0,00 24,31 9,72 0,00 24,32 9,73 0,00 # 135,10 54,04 0,00<br />
p<br />
Bereich, um zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative<br />
Einkommensquellen zu schaffen 0,54 0,215357 0,00 0,00 0,000000 0,00 4,74 1,311504 0,00 4,22 1,69 0,00 4,66 1,86 0,00 4,98 1,99 0,00 5,10 2,04 0,00 # 22,75 9,10 0,00<br />
r<br />
Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft<br />
verbundenen Infrastruktur 1,99 0,795218 0,00 3,95 1,578199 0,00 8,77 3,509427 0,00 5,18 2,08 0,00 1,89 0,75 0,00 1,96 0,78 0,00 2,00 0,80 0,00 # 25,74 10,30 0,00<br />
s<br />
<strong>Förderung</strong> <strong>des</strong> Fremdenverkehrs u. Handwerk 0,33 0,130893 0,00 0,80 0,320313 0,00 1,38 0,551771 0,00 2,74 1,09 0,00 2,50 1,00 0,00 2,38 0,95 0,00 2,26 0,90 0,00 # 12,37 4,95 0,00<br />
t<br />
Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft, der<br />
Landschaftspflege und der Verbesserung <strong>des</strong> Tierschutzes 5,10 2,041141 0,00 5,23 2,090675 0,00 4,90 1,965461 0,00 5,21 2,08 0,00 4,65 1,86 0,00 4,78 1,91 0,00 4,88 1,95 0,00 # 34,74 13,90 0,00<br />
u<br />
Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen<br />
Produktionspotentials sowie der Einführung geeigneter vorbeugender Instrumente 21,15 8,458984 0,00 18,44 7,377573 0,00 19,93 7,970012 0,00 15,90 6,36 0,00 15,20 6,08 0,00 14,75 5,90 0,00 15,51 6,20 0,00 # 120,89 48,36 0,00<br />
e<br />
f<br />
h<br />
i<br />
Summe B<br />
Schwerpunkt C - Agrarumwelt- und<br />
Ausgleichsmaßnahmen sowie Forstwirtschaft<br />
42,05 16,818288 0,00 46,03 18,411491 0,00 61,16 24,955995 0,00 66,66 26,65 0,20 63,10 25,24 0,20 63,85 25,53 0,20 63,61 25,44 0,20 # 407,62 163,05 0,80<br />
Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen 0,29 0,144643 0,00 1,77 0,884742 0,00 1,91 0,952710 0,00 1,80 0,90 0,00 2,36 1,18 0,00 2,40 1,20 0,00 2,46 1,23 0,00 # 12,98 6,49 0,00<br />
Agrarumweltmassnahmen 4,70 2,351023 0,00 3,29 1,646395 0,00 3,83 1,914482 0,00 5,33 2,66 0,00 8,06 4,03 0,00 8,26 4,13 0,00 8,34 4,17 0,00 # 41,81 20,90 0,00<br />
davon im Rahmen der VO (EG) 2078/92 genehmigte Maßnahmen 3,76 1,881309 0,00 1,71 0,852883 0,00 2,90 1,451320 0,00 2,36 1,18 0,00 0,48 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 11,21 5,61<br />
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen 1,83 0,888373 0,00 3,20 1,597613 0,00 2,01 1,004668 0,00 1,45 0,72 0,00 1,84 0,92 0,00 1,92 0,96 0,00 2,00 1,00 0,00 # 14,24 7,09 0,00<br />
davon im Rahmen der VO (EG) 2080/92 genehmigte Maßnahmen 0,59 0,265201 0,00 0,58 0,260261 0,00 0,50 0,224704 0,00 0,60 0,27 0,00 0,60 0,27 0,00 0,60 0,27 0,00 0,60 0,27 0,00 # 4,07 1,83<br />
sonst. forstwirtschaftl. Massnahmen 0,19 0,093572 0,00 0,30 0,150729 0,00 0,41 0,203276 0,00 1,48 0,74 0,00 1,40 0,70 0,00 1,32 0,66 0,00 1,22 0,61 0,00 # 9,42 3,16 0,00<br />
Summe C 7,01 3,477611 0,00 8,56 4,279479 0,00 8,15 4,075136 0,00 10,05 5,03 0,00 13,66 6,83 0,00 13,90 6,95 0,00 14,02 7,01 0,00 # 78,45 37,65 0,00<br />
Sonstige Aktionen<br />
Bewertung 0,00 0,000000 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,03 0,013716 0,00 0,10 0,04 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,20 0,00 # 0,71 0,28 0,00<br />
Rückforderungen/Wiedereinziehungen 0,00 0,003443 0,00 0,00 0,016622 0,00 0,00 0,032911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 0,00 0,05 0,00<br />
Durchführung 51,77 21,378621 1,26 55,75 23,137441 2,84 76,11 31,720588 14,30 85,27 35,10 16,76 86,10 35,80 17,25 88,06 36,60 18,07 89,76 37,30 19,04 # 537,044 221,037 89,52<br />
Über/Unterausschöpfung 0,00 8,921379 0,00 0,00 7,362559 0,00 0,00 1,779412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 0,00 18,06 0,00<br />
Planansatz 51,770 30,300000 1,26 55,75 30,500000 2,84 76,11 33,500000 14,30 85,27 35,10 16,76 86,10 35,80 17,25 88,06 36,60 18,07 89,76 37,30 19,04 # 537,04 239,100 89,52<br />
*: Private Beteiligungen sind z.T. Schätzwerte ** es handelt sich hier um keine eigene Massnahme i.S.der VO 1257/1999<br />
Öffentliche<br />
Ausgaben<br />
<strong>EU</strong>-Beteiligung<br />
Private*