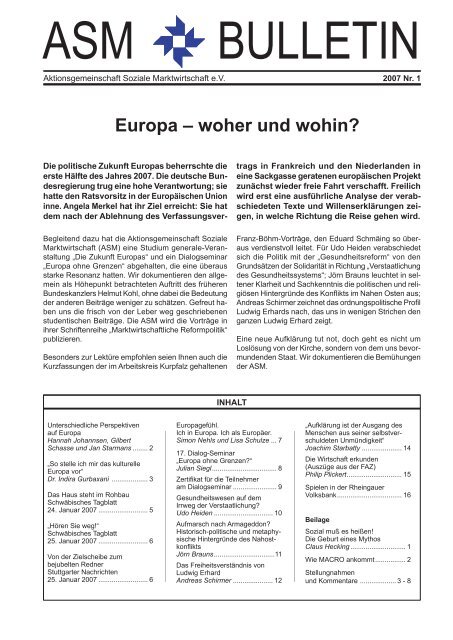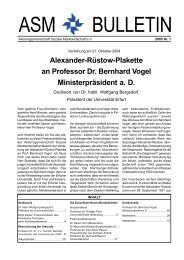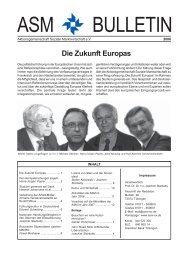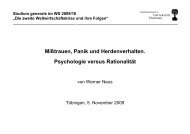Europa - Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft
Europa - Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft
Europa - Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ASM<br />
<strong>Aktionsgemeinschaft</strong> <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> e.V.<br />
Unterschiedliche Perspektiven<br />
auf <strong>Europa</strong><br />
Hannah Johannsen, Gilbert<br />
Schasse und Jan Starmans ........ 2<br />
„So stelle ich mir das kulturelle<br />
<strong>Europa</strong> vor“<br />
Dr. Indira Gurbaxani ................... 3<br />
Das Haus steht im Rohbau<br />
Schwäbisches Tagblatt<br />
24. Januar 2007 .......................... 5<br />
„Hören Sie weg!“<br />
Schwäbisches Tagblatt<br />
25. Januar 2007 .......................... 6<br />
Von der Zielscheibe zum<br />
bejubelten Redner<br />
Stuttgarter Nachrichten<br />
25. Januar 2007 .......................... 6<br />
BULLETIN<br />
<strong>Europa</strong> – woher und wohin?<br />
Die politische Zukunft <strong>Europa</strong>s beherrschte die<br />
erste Hälfte des Jahres 00 . Die deutsche Bundesregierung<br />
trug eine hohe Verantwortung; sie<br />
hatte den Ratsvorsitz in der Europäischen Union<br />
inne. Angela Merkel hat ihr Ziel erreicht: Sie hat<br />
dem nach der Ablehnung des Verfassungsver-<br />
Begleitend dazu hat die <strong>Aktionsgemeinschaft</strong> <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Marktwirtschaft</strong> (ASM) eine Studium generale-Veranstaltung<br />
„Die Zukunft <strong>Europa</strong>s“ und ein Dialogseminar<br />
„<strong>Europa</strong> ohne Grenzen“ abgehalten, die eine überaus<br />
starke Resonanz hatten. Wir dokumentieren den allgemein<br />
als Höhepunkt betrachteten Auftritt des früheren<br />
Bundeskanzlers Helmut Kohl, ohne dabei die Bedeutung<br />
der anderen Beiträge weniger zu schätzen. Gefreut haben<br />
uns die frisch von der Leber weg geschriebenen<br />
studentischen Beiträge. Die ASM wird die Vorträge in<br />
ihrer Schriftenreihe „<strong>Marktwirtschaft</strong>liche Reformpolitik“<br />
publizieren.<br />
Besonders zur Lektüre empfohlen seien Ihnen auch die<br />
Kurzfassungen der im Arbeitskreis Kurpfalz gehaltenen<br />
INHALT<br />
<strong>Europa</strong>gefühl.<br />
Ich in <strong>Europa</strong>. Ich als Europäer.<br />
Simon Nehls und Lisa Schulze ... 7<br />
17. Dialog-Seminar<br />
„<strong>Europa</strong> ohne Grenzen?“<br />
Julian Siegl .................................. 8<br />
Zertifi kat für die Teilnehmer<br />
am Dialogseminar ....................... 9<br />
Gesundheitswesen auf dem<br />
Irrweg der Verstaatlichung?<br />
Udo Heiden ............................... 10<br />
Aufmarsch nach Armageddon?<br />
Historisch-politische und metaphysische<br />
Hintergründe des Nahostkonfl<br />
ikts<br />
Jörn Brauns ................................11<br />
Das Freiheitsverständnis von<br />
Ludwig Erhard<br />
Andreas Schirmer ..................... 12<br />
00 Nr. 1<br />
trags in Frankreich und den Niederlanden in<br />
eine Sackgasse geratenen europäischen Projekt<br />
zunächst wieder freie Fahrt verschafft. Freilich<br />
wird erst eine ausführliche Analyse der verabschiedeten<br />
Texte und Willenserklärungen zeigen,<br />
in welche Richtung die Reise gehen wird.<br />
Franz-Böhm-Vorträge, den Eduard Schmäing so überaus<br />
verdienstvoll leitet. Für Udo Heiden verabschiedet<br />
sich die Politik mit der „Gesundheitsreform“ von den<br />
Grundsätzen der Solidarität in Richtung „Verstaatlichung<br />
des Gesundheitssystems“; Jörn Brauns leuchtet in seltener<br />
Klarheit und Sachkenntnis die politischen und religiösen<br />
Hintergründe des Konfl ikts im Nahen Osten aus;<br />
Andreas Schirmer zeichnet das ordnungspolitische Profi l<br />
Ludwig Erhards nach, das uns in wenigen Strichen den<br />
ganzen Ludwig Erhard zeigt.<br />
Eine neue Aufklärung tut not, doch geht es nicht um<br />
Loslösung von der Kirche, sondern von dem uns bevormundenden<br />
Staat. Wir dokumentieren die Bemühungen<br />
der ASM.<br />
„Aufklärung ist der Ausgang des<br />
Menschen aus seiner selbstverschuldeten<br />
Unmündigkeit“<br />
Joachim Starbatty ..................... 14<br />
Die Wirtschaft erkunden<br />
(Auszüge aus der FAZ)<br />
Philip Plickert ............................. 15<br />
Spielen in der Rheingauer<br />
Volksbank .................................. 16<br />
Beilage<br />
Sozial muß es heißen!<br />
Die Geburt eines Mythos<br />
Claus Hecking ............................. 1<br />
Wie MACRO ankommt ................ 2<br />
Stellungnahmen<br />
und Kommentare ................... 3 - 8
EUROPA<br />
Unterschiedliche Perspektiven auf <strong>Europa</strong><br />
Helmut Kohl befindet sich auf dem<br />
Weg nach Tübingen, um über die<br />
Zukunft <strong>Europa</strong>s zu sprechen. Es<br />
hat angefangen zu schneien, das<br />
erste Mal in diesem Jahr, und nun<br />
ausgerechnet an diesem Abend,<br />
dem Höhepunkt der Ringvorlesung<br />
„Die Zukunft <strong>Europa</strong>s“. In regelmäßigen<br />
Abständen wird das Eintreffen<br />
nach hinten verschoben. Langsam<br />
legt sich ein weißer Schleier auf<br />
Straßen und Autos.<br />
Im Kupferbau der Universität<br />
Tübingen hat sich<br />
eine große Menschenmenge<br />
angesammelt.<br />
Wahrscheinlich ist das<br />
Hörsaalzentrum nur alle<br />
paar Jahre so frequentiert.<br />
Während der Vorlesungszeiten<br />
herrscht zwar reges<br />
Treiben, aber eine solche<br />
Ansammlung von Menschen<br />
im ganzen Gebäude<br />
ist selten zu beobachten.<br />
Die Hörsäle sind bis auf<br />
den letzten Platz besetzt<br />
- nebst Kameras, Fotoapparaten,<br />
Journalisten,<br />
Polizei, Personenschutz. Selbst auf<br />
den Treppenaufgängen sitzen Menschen.<br />
Es herrscht eine gespannte,<br />
erwartungsvolle Stimmung.<br />
Kohl scheint noch immer eine starke<br />
Beachtung zu genießen. Die Perspektive<br />
ist dabei unterschiedlich.<br />
Viele ältere Jahrgänge kennen Kohl<br />
aus dem politischen Alltag, während<br />
er für die jüngeren eher eine historische<br />
Figur ist – gewissermaßen<br />
„Generation <strong>Europa</strong> eins“ und „Generation<br />
<strong>Europa</strong> zwei“.<br />
Es ist 20.15 Uhr. Die Zeit verrinnt.<br />
Joachim Starbatty vertröstet uns:<br />
Kohl wird kommen, aber später.<br />
Ungewissheit und angespannte<br />
Stimmung lösen sich in dem wundersamen<br />
Moment, als Helmut Kohl den<br />
Hannah Johannsen, Gilbert Schasse und Jan Starmans<br />
Hörsaal schließlich betritt. Der Begrüßungsapplaus<br />
klingt erleichtert.<br />
Manch einer würde wohl auch eine<br />
gewisse Ehrfurcht hineininterpretieren<br />
wollen.<br />
Den Vortrag Kohls dominiert ein Motiv,<br />
welches er immer wieder zur Erklärung<br />
des Phänomens <strong>Europa</strong> heranziehen<br />
wird: die Geschichte, das<br />
„Woher?“. Seine persönlichen Erinnerungen<br />
aus den letzten Kriegsjah-<br />
ren und den ersten Nachkriegsjahren<br />
stehen in einem gewissen Kontrast<br />
zu dem Bild, welches wir von dieser<br />
Zeit haben. Nicht inhaltlicher Natur<br />
ist dieser Kontrast. Für uns ist diese<br />
Zeit nur sehr weit weg, während<br />
Helmut Kohl gerade einige Meter<br />
entfernt über seine persönlichen Erfahrungen<br />
berichtet. Hier zeigen sich<br />
die unterschiedlichen Perspektiven<br />
auf unsere Geschichte.<br />
Ich frage mich, warum über diese<br />
grundsätzliche Differenz kaum<br />
gesprochen wird. Sprechen diese<br />
beiden Generationen überhaupt<br />
über das gleiche <strong>Europa</strong>, denken<br />
sie das gleiche <strong>Europa</strong>? Ich frage<br />
mich als junger Europäer: Woher<br />
kommt meine Motivation für <strong>Europa</strong>?<br />
Auch wenn mich die europäische<br />
Geschichte und vor allem die des<br />
Zweiten Weltkrieges immer wieder<br />
bewegt, gerade in Situationen wie<br />
diesen, wenn Menschen von ihren<br />
persönlichen Erlebnissen sprechen,<br />
so weiß ich doch, dass meine Begeisterung<br />
für <strong>Europa</strong> nur mittelbar<br />
daraus entspringt. Unmittelbar kann<br />
es nur meine eigene Geschichte<br />
sein. Doch entspringt aus ihr genug<br />
Antrieb für die Aufgaben, die wir Europäer<br />
zu meistern haben? Einen<br />
Moment lang überfordern<br />
mich die Gedanken zu <strong>Europa</strong>.<br />
„Kleine Nationen werden<br />
so viel wie große gelten<br />
und durch ihren Beitrag<br />
für die gemeinsame Sache<br />
Ruhm erringen können“,<br />
zitiert Kohl aus Churchills<br />
Rede an die Jugend <strong>Europa</strong>s,<br />
und betont: „<strong>Europa</strong><br />
braucht kein Direktorium“.<br />
<strong>Europa</strong> also nicht als Staat,<br />
nicht als homogenes Gebilde<br />
auf der Landkarte.<br />
Stattdessen 496 Millionen<br />
Menschen aus 27 Nationen, die in<br />
verschiedenen Regionen und Städten<br />
ihre Heimat haben. Kann man<br />
das nachvollziehen? Die Tatsache,<br />
dass all diese Menschen zu <strong>Europa</strong><br />
gehören und es mitgestalten,<br />
lässt mich zumindest erahnen, wie<br />
unvorstellbar einzigartig dieses Projekt<br />
ist.<br />
Blick ins Auditorium<br />
Der Vortrag ist zu Ende. Als ich das<br />
Hörsaalgebäude verlasse, liegen<br />
zwanzig Zentimeter Neuschnee,<br />
und es fallen immer noch dicke weiße<br />
Flocken vom Himmel. So, hier<br />
bin ich mitten in <strong>Europa</strong>. Vieles aus<br />
Kohls Rede schwirrt mir durch den<br />
Kopf. Gerade im Moment weiß ich<br />
nicht, wo ich anfangen soll. Aber es<br />
ist ein gutes Gefühl hier zu sein, mitten<br />
in <strong>Europa</strong>.
Wintereinbruch. Stau auf der Autobahn.<br />
Kommt Helmut Kohl noch? Per<br />
Funk gibt es Entwarnung: Er kommt!<br />
Der Seiteneingang des HS 25 öffnet<br />
sich, und Helmut Kohl betritt unter<br />
lautem Klatschen und – wie es an<br />
der Universität üblich ist – Klopfen<br />
den Hörsaal.<br />
Der Wert der deutschen Einheit<br />
Joachim Starbatty begrüßte Helmut<br />
Kohl mit den Worten: „Ich spreche<br />
hier auch als Vorsitzender<br />
der <strong>Aktionsgemeinschaft</strong><br />
<strong>Soziale</strong><br />
<strong>Marktwirtschaft</strong>. Sie ist<br />
Ihnen bekannt, Herr<br />
Bundeskanzler: Ludwig<br />
Erhard breitete auf den<br />
Foren der <strong>Aktionsgemeinschaft</strong><br />
seine Ideen<br />
aus, hier konnte er auf<br />
Anregungen und Beistand<br />
für seine marktwirtschaftliche<br />
Politik<br />
rechnen, auch auf Trost,<br />
wenn er gerade wegen<br />
der Europäischen Integration<br />
mit Bundeskanzler<br />
Adenauer im<br />
Streit lag.“ Professor<br />
Starbatty wandte sich<br />
mit persönlichen Worten an Kanzler<br />
a.D. Kohl: „Ich möchte Ihnen danken<br />
für das Werk der Deutschen Einheit.<br />
Ich glaube, ich darf das jetzt und hier<br />
ansprechen, denn einer Ihrer Kernsätze<br />
lautet: „Die deutsche Einheit<br />
und die europäische Einigung sind<br />
zwei Seiten ein- und derselben Medaille.“<br />
Starbatty sprach von der friedlichen<br />
Revolution. Helmut Kohl habe gesagt,<br />
dass „blühende Landschaften<br />
in der ehemaligen DDR“ entstehen<br />
würden. Dies sei ihm oft vorgeworfen<br />
worden. Aber nicht nur Städte<br />
wie Leipzig, Weimar oder Dresden<br />
seien „aufgeblüht“, sondern auch<br />
„So stelle ich mir<br />
das kulturelle <strong>Europa</strong> vor“<br />
Dr. Indira Gurbaxani<br />
viele kleine, weniger bekannte Städte.<br />
Starbatty schloss mit den Worten:<br />
„Für mich ist die Wiedervereinigung<br />
ein Geschenk. Dass dies ohne weltpolitische<br />
Verwerfungen und Erschütterungen<br />
möglich geworden<br />
ist – haben wir maßgeblich Ihnen zu<br />
verdanken, der Sie zupackend und<br />
behutsam zugleich den Mantel der<br />
Geschichte ergriffen haben. Dafür<br />
bin ich, dafür sind wir alle Ihnen zu<br />
Dank verpflichtet.“<br />
Helmut Kohl und Joachim Starbatty<br />
Auch Prorektor Herbert Müther, der<br />
für das Rektorat Helmut Kohl an<br />
der Universität herzlich willkommen<br />
hieß, hob die Verdienste Helmut<br />
Kohls um die deutsche Wiedervereinigung<br />
hervor, ohne die es das<br />
<strong>Europa</strong> von heute, das „<strong>Europa</strong> der<br />
27“, nicht geben würde.<br />
Nach Worten des Dankes an die<br />
Universität wandte sich Helmut Kohl<br />
bewusst an die zahlreich anwesenden<br />
Studierenden. Während seiner<br />
Jugend, vor allem aber auf dem langen<br />
Weg seines politischen Werdegangs,<br />
habe er immer Unterstützung<br />
erfahren. Davon wolle er viel an die<br />
Jüngeren zurückgeben. Er berichte-<br />
EUROPA<br />
te, dass sein Vater Finanzbeamter<br />
in Ludwigshafen gewesen sei. Das<br />
höchste der Gefühle wäre für diesen<br />
gewesen, wenn aus ihm vielleicht der<br />
Leiter des Finanzamtes in Ludwigshafen<br />
geworden wäre. Diesen Gefallen<br />
habe er seinem Vater nicht tun<br />
können, bemerkte Kohl mit leichter<br />
Ironie. Mit 15 Jahren sei er als Flakhelfer<br />
noch in den Krieg gezogen,<br />
bevor er 1950 sein Abitur machte. Es<br />
folgte das Studium der Rechts-, Sozial-<br />
und Staatswissenschaften sowie<br />
der Geschichte an den<br />
Universitäten Frankfurt/<br />
Main und Heidelberg<br />
mit Promotion im Fach<br />
Geschichte 1958.<br />
Bewegende Momente<br />
Die Mitarbeit am „Bau<br />
des Hauses <strong>Europa</strong>“<br />
habe er oft mit Bundeskanzler<br />
Kurt Georg<br />
Kiesinger diskutiert.<br />
Die Wiedervereinigung<br />
Deutschlands sei so<br />
möglich geworden, und<br />
es gebe heute ein <strong>Europa</strong><br />
der 27. Als einen<br />
der bewegendsten Momente<br />
seines Lebens<br />
beschrieb er, dass er nach der Wiedervereinigung<br />
mit dem inzwischen<br />
verstorbenen Papst Johannes Paul<br />
II. unter dem Brandenburger Tor<br />
stand und dieser sich freute, dass<br />
Deutschland wiedervereinigt sei und<br />
seine Heimat Polen nun in einem<br />
freien <strong>Europa</strong> zu Hause sei. Auch<br />
werde er nie vergessen, was ihm<br />
Anfang der 90er Jahre die drei Regierungschefs<br />
der baltischen Staaten<br />
bei einer Begegnung im Bonner<br />
Bundeskanzleramt gesagt hätten:<br />
„Herr Bundeskanzler, wir melden uns<br />
zurück in <strong>Europa</strong>.“ Er habe geantwortet:<br />
„Und wir heißen Sie herzlich<br />
willkommen“. Töne wie: „Was wollen<br />
die denn schon hier“, könne er nicht
EUROPA<br />
verstehen. Das alles sei doch auch<br />
eine Frage der Solidarität! Deutschland,<br />
so Kohl, sei das Land <strong>Europa</strong>s<br />
mit den längsten Grenzen und den<br />
meisten unmittelbaren Nachbarn.<br />
„Wir haben eine moralische Verpflichtung,<br />
dass die Länder Mittel-,<br />
Ost- und Südosteuropas in <strong>Europa</strong><br />
eine Chance bekommen.“ Zwei<br />
schreckliche Kriege seien von deutschem<br />
Boden ausgegangen. Es sei<br />
in unserem eigenen Interesse, dass<br />
es zwischen unseren Nachbarn und<br />
uns kein Wohlstandsgefälle gäbe,<br />
führte Helmut Kohl aus.<br />
Kohl bekannte, dass für ihn damit<br />
eine Vision in Erfüllung gegangen sei,<br />
die er bereits mit 17 gespürt habe,<br />
als er – gemeinsam mit jungen Franzosen<br />
– Grenzpfähle herausgerissen<br />
habe. In seiner Rede an die akademische<br />
Jugend im September 1946<br />
in Zürich habe Winston Churchill<br />
davon gesprochen, das „Haus <strong>Europa</strong>s<br />
aufzubauen“. Deutschland und<br />
Frankreich müssten zueinander finden.<br />
Die Bedeutung solcher Persönlichkeiten<br />
wie Schuman, Adenauer,<br />
Churchill oder de Gasperi lasse sich<br />
erst im Nachhinein ermessen. Ohne<br />
sie hätte es die Römischen Verträge<br />
nicht gegeben. Und Kohl erklärte<br />
weiter, dass das Haus <strong>Europa</strong> viele<br />
Gründe habe. Wichtiger als alle<br />
ökonomischen Gründe seien Frieden<br />
und Freiheit. Das einzig sichere<br />
Mittel dafür sei ein geeintes <strong>Europa</strong>.<br />
Hätte vor 20 Jahren jemand prophezeit,<br />
dass im Jahr 2007 Länder wie<br />
Polen, Tschechien oder Ungarn Mitglieder<br />
der EU sein würden, so hätte<br />
man ihn ausgelacht. Aber es sei<br />
sogar noch mehr geschehen: Man<br />
habe eine gemeinsame Währung<br />
geschaffen, den Euro. Dies betonte<br />
Kohl schmunzelnd – mit einem Seitenblick<br />
auf Joachim Starbatty, der<br />
einer der Kläger gegen den Euro im<br />
Jahr 1998 war. Und er prophezeite,<br />
dass in 10 bis 15 Jahren selbst die<br />
Briten mit dem Euro zahlen würden.<br />
Bereits heute seien es 2/3 der EU-<br />
Bevölkerung, die den Euro als Zahlungsmittel<br />
nutzten.<br />
Eines jedoch stellte Helmut Kohl<br />
klar: Die Türkei gehöre nicht in die<br />
EU. Die Kopenhagener Beschlüsse<br />
machten den Bewerbern klare Vorgaben:<br />
Die Menschen- und Bürgerrechte<br />
müßten eingehalten werden,<br />
und es müsse eine demokratische<br />
Verfassung gelten. Die Türkei sei<br />
noch nicht so weit. Er persönlich sei<br />
ein großer Freund der Türkei.<br />
<strong>Europa</strong> der Kulturen<br />
Das „Haus <strong>Europa</strong>“ steht zwar noch<br />
im Rohbau, aber es entwickele sich<br />
immer schneller. Es sei gewachsen<br />
aus den Quellen der Aufklärung und<br />
des Christentums. Die Zusammenarbeit<br />
zwischen den heute 27 Mitgliedern<br />
müsse, so Kohl, erst geregelt<br />
werden, bevor weitere Mitglieder<br />
aufgenommen werden könnten. Und<br />
dann, an die Studierenden gerichtet:<br />
„Von Adenauer habe ich eines gelernt,<br />
das Ihr Euch merken solltet:<br />
Unseren kleinsten Nachbar, Luxemburg,<br />
müssen wir gut behandeln.<br />
Wenn die Luxemburger gut über uns<br />
reden, reden alle gut über uns. Wenn<br />
sie schlecht von uns reden, dann<br />
sprechen alle schlecht von uns.“<br />
Die ASM dankt der<br />
Heinz Nixdorf Stiftung<br />
und ihrem Vorstand<br />
für die maßgebliche<br />
Unterstützung der<br />
Studium generale - Reihe<br />
„Die Zukunft <strong>Europa</strong>s“.<br />
Helmut Kohl erinnerte, dass Länder<br />
wie Indien oder China in einer<br />
multipolaren Welt immer wichtiger<br />
würden. Aber gerade die Deutschen<br />
dürften auch ihre amerikanischen<br />
Freunde nicht vergessen, denen<br />
man sehr viel zu verdanken habe.<br />
Immer wieder kam Helmut Kohl auf<br />
die Rede von Churchill zu sprechen,<br />
der damals gefordert habe, die „Vereinigten<br />
Staaten von <strong>Europa</strong>“ zu errichten.<br />
Dem wolle er insofern widersprechen,<br />
als aus den europäischen<br />
Staaten keine „Vereinigten Staa-<br />
ten“ wie die USA werden könnten,<br />
sondern Länder mit einer eigenen<br />
Identität blieben, die sich zusammengetan<br />
hätten, um gemeinsame<br />
Ziele zu verwirklichen. Und keiner<br />
habe das Recht, auf den anderen<br />
mit Herablassung zu reagieren,<br />
betonte Kohl. <strong>Europa</strong> brauche kein<br />
„Direktorium“. Es gelte das Prinzip<br />
der Subsidiarität. Zugleich betonte<br />
er, dass <strong>Europa</strong> vor allem ein <strong>Europa</strong><br />
der Kulturen und ein <strong>Europa</strong> der<br />
Jugend sei. Ein lebendiges Zeugnis<br />
dafür sei für ihn eine Begebenheit<br />
auf der Karlsbrücke in Prag. Dort träfen<br />
sich viele junge Leute aus <strong>Europa</strong>.<br />
„Und im Hintergrund hörte man<br />
das Murmeln des Flusses, die Moldau<br />
von Smetana. So stelle ich mir<br />
das kulturelle <strong>Europa</strong> vor.“ Bei allen<br />
Rückschlägen mache das Hoffnung.<br />
Was die Zukunft angehe, so sei das<br />
aber nicht mehr seine Sache: „Sie<br />
sind zwischen 20 und 25 Jahre alt.<br />
Das 21. Jahrhundert ist das Ihre. Die<br />
meisten von Ihnen werden das Jahr<br />
2050 erleben.“ Und so forderte Helmut<br />
Kohl die Studierenden auf, an<br />
einer friedvollen Entwicklung <strong>Europa</strong>s<br />
mitzuarbeiten. Die Zuhörer verabschiedeten<br />
Helmut Kohl mit einer<br />
stehenden Ovation.<br />
Beeindruckt von den Studierenden<br />
Nach der Veranstaltung erzählte<br />
Helmut Kohl bei einem Glas Tübinger<br />
Rotwein von seinen Begegnungen<br />
mit Regierungschefs und Staatsoberhäuptern<br />
aus aller Welt. Er berichtete<br />
von den gemeinsamen Spaziergängen<br />
mit Kurt Georg Kiesinger<br />
im Schönbuch. Von den Studierenden<br />
zeigte er sich beeindruckt. Bei<br />
solchen Studierenden brauche man<br />
sich um die Zukunft <strong>Europa</strong>s keine<br />
Sorgen zu machen, so die einhellige<br />
Meinung der Runde. Helmut Kohl<br />
plauderte bis kurz vor Mitternacht<br />
über seine Erlebnisse an deutschen<br />
Universitäten während seiner Kanzlerzeit.<br />
Voll seien die Hörsäle immer<br />
gewesen: „Aber so freundlich begrüßt<br />
und verabschiedet wurde ich<br />
damals nicht. Irgendetwas flog immer<br />
auf das Podium“, so dass seine<br />
Frau ihn gebeten habe: „Zieh bitte<br />
einen alten Anzug an.“
Schwäbisches Tagblatt, 24. Januar 2007<br />
EUROPA
EUROPA<br />
Reutlinger General Anzeiger, 25. Januar 2007<br />
Stuttgarter Nachrichten, 25. Januar 2007<br />
Von der Zielscheibe zum bejubelten Redner<br />
Beim Vortrag von Altkanzler Kohl in Tübingen reißen sich Studenten um die Plätze<br />
(...) Jetzt, da der „Rohbau“ abgeschlossen<br />
sei, müsse es an den<br />
„Innenausbau“ gehen. Danach ans<br />
„Generalreinemachen“. Dazu gehöre<br />
die sinnvolle Verteilung von<br />
Zuständigkeiten. „Wir brauchen<br />
ein Subsidiaritätsprinzip und keine<br />
Verfassung.“ Es könne nicht<br />
sein, dass alles in Brüssel entschieden<br />
werde. So werde <strong>Europa</strong><br />
„auf den Kopf gestellt“. Gerade<br />
durch die Osterweiterung böte sich<br />
die Chance für eine Neuordnung.<br />
Denn nur wenn wieder mehr auf regionaler<br />
Ebene entschieden werde,<br />
„kommt <strong>Europa</strong> auch in den Herzen<br />
an“. Dazu gehöre auch das „Festzurren<br />
der Grenzen“. Für die Türkei<br />
sieht er keinen festen Platz. Er plädiert<br />
für eine „Abmachung knapp unter<br />
der Schwelle des Beitritts“. Auch<br />
da sieht er die EU auf einem guten<br />
Weg. Seine Nachfolgerin und Ziehtochter<br />
werde das „nötige Verhand-<br />
lungsgeschick“ haben, ist er sicher.<br />
Am Schluss seiner Rede erntet Kohl<br />
lange Applaus. Es folgen höfliche<br />
Fragen („Herr Bundeskanzler“), ehe<br />
er staatsmännisch und unter standing<br />
ovations die Bühne verlässt.<br />
Auch die Rasta-Träger klatschen.<br />
Eier fliegen keine. Es scheint, als<br />
hätten sie Frieden geschlossen mit<br />
dem ersten Mann der Bonner Republik,<br />
der so lange Zielscheibe jugendlichen<br />
Protests war.
Um die Präsenz von „<strong>Europa</strong>“ im<br />
studentischen Denkhorizont aussagekräftig<br />
zu quantifizieren - wozu<br />
der Wirtschaftswissenschaftler ja<br />
immer tendiert - eignet sich die in<br />
letzter Zeit populär gewordene Internetplattform<br />
studivz.net: Studenten<br />
kommen virtuell zusammen, um sich<br />
über Themen, die sie verbinden, in<br />
Gruppen auszutauschen. Lassen<br />
sich viele Gruppen zu einem Thema<br />
finden, spricht das für eine große<br />
Relevanz.<br />
Möge das Spiel beginnen. Starten<br />
wir die Suchfunktion auf der Homepage<br />
und beginnen mit “Bundesregierung“:<br />
ein Treffer, also eine<br />
Gruppe zu diesem Thema. Unsere<br />
Kommilitonen interessieren sich<br />
wohl nur bedingt für Frau Merkel<br />
und ihre Kollegen. Okay, zweiter<br />
Versuch mit dem Schlagwort „Bier“,<br />
und siehe da: „Mehr als 300 Treffer“.<br />
Wir lernen: Studenten mögen<br />
Bier - welch’ eine Erkenntnis! Dritter<br />
Versuch: „<strong>Europa</strong>“. In dunkellila Lettern<br />
auf signalrotem Grund erscheint<br />
das Ergebnis „Mehr als 300 Treffer“!<br />
Gruppen zum Thema <strong>Europa</strong>,<br />
so weit das Auge reicht. Deren Titel<br />
erstrecken sich von „Helmut Kohl -<br />
Danke für die Einheit und <strong>Europa</strong>!“,<br />
den „<strong>Europa</strong>-Enthusiasten“, „Wir<br />
sind <strong>Europa</strong>“, „Baustelle <strong>Europa</strong>“,<br />
„Mein <strong>Europa</strong> 2015 - Tübinger Thesen“<br />
bis „Interrail - mit einem Ticket<br />
& auf zwei Schienen durch <strong>Europa</strong>!“,<br />
um nur einige zu nennen.<br />
Dieser Versuch erklärt jedoch nicht<br />
die Art der studentischen Faszination<br />
für <strong>Europa</strong> und die EU. Was ich<br />
beschreiben kann, ist mein eigenes<br />
Gefühl beim Stichwort „<strong>Europa</strong>“: So<br />
zum Beispiel die Reisefreiheit, für<br />
uns heute eine Alltäglichkeit, über<br />
die man sich eben noch Gedanken<br />
macht, wenn man gerade vor dem<br />
Grenzübergang Weil am Rhein in<br />
EUROPA<br />
<strong>Europa</strong>gefühl.<br />
Ich in <strong>Europa</strong>. Ich als Europäer.<br />
Simon Nehls und Lisa Schulze<br />
Richtung Schweiz im Stau steht.<br />
Das Gefühl der (fast) grenzenlosen<br />
Freiheit - zumindest soweit der Geldbeutel<br />
es hergibt - hat auch viel mit<br />
Bequemlichkeit zu tun. Insoweit ist<br />
<strong>Europa</strong>, man muss es so vielleicht<br />
so hart sagen, vor allem bequem für<br />
seine Bürger: Niemand muss mehr<br />
umrechnen von Lire oder Franc in<br />
DM, sondern kann ganz entspannt<br />
Preise vergleichen. Wahrscheinlich<br />
hat der Euro an der französischen<br />
Atlantikküste oder überall da, wo sich<br />
im Juli/August die Touristen stauen,<br />
deshalb zu einem Umsatzrückgang<br />
bei den Souvenirläden geführt. Man<br />
kann nicht nur vergleichen, man<br />
muss - und das bringt gerade im<br />
kostspieligen Frankreichurlaub heilsame<br />
Konsequenzen mit sich.<br />
In meiner Generation und in meinem<br />
Freundeskreis ist das Thema „<strong>Europa</strong>“<br />
oft Tischgespräch. Meist geht<br />
es dabei doch thesenartig zu: Demokratiedefizite,<br />
fehlende Bürgerbeteiligung<br />
und selbstverständlich<br />
der Dauerbrenner, die Verfassung.<br />
Auffällig ist jedoch bei diesen Gesprächen<br />
das Fehlen einer ganz<br />
bestimmten Sichtweise. Es fehlt der<br />
Ansatz, dass die nationalen Interessen<br />
der einzelnen Mitgliedstaaten im<br />
derzeitigen EU-Konstrukt wenig Beachtung<br />
finden. Dass viele ein Umdenken<br />
oder Reformbereitschaft fordern,<br />
war mir vorher nicht bewusst.<br />
Mit dieser Sichtweise wurde ich erst<br />
während der letzten Monaten in der<br />
Vorlesungsreihe des Studium Generale<br />
konfrontiert. So vertrat auch<br />
Helmut Kohl die Meinung, dass die<br />
nationalstaatlichen Interessen auf<br />
keinen Fall im europäischen Einheitsbrei<br />
aufgehen dürften.<br />
Viele Studenten scheint das hingegen<br />
eher weniger zu berühren.<br />
Warum sind gerade Studenten,<br />
mich eingeschlossen, so offen eu-<br />
ropabegeistert? Gewagte These<br />
meinerseits: Da Patriotismus unter<br />
Studenten allgemein eher unbeliebt<br />
ist, projizieren viele diese Gefühle<br />
auf <strong>Europa</strong>. Außerdem bedeutet,<br />
von <strong>Europa</strong> zu schwärmen, einen<br />
viel höheren Hipnessfaktor als die<br />
Betonung einer nationalen Identität.<br />
Ist zu hoffen, dass <strong>Europa</strong> auch<br />
für die nächsten Jahre ein studentisches<br />
„must“ bleibt. Im Gegensatz<br />
zu den Älteren glauben Studenten<br />
vielleicht daran, eines Tages aktiv<br />
an der Gestaltung der EU mitzuarbeiten.<br />
Sie haben noch lange nicht<br />
resigniert; schließlich liegt in unserer<br />
Generation das Potential, aktiv eigene<br />
Vorstellungen eines vereinten<br />
<strong>Europa</strong>s einzubringen und in die Realität<br />
umzusetzen.<br />
Aber bisher sehe ich in Deutschland<br />
und auch auf europäischer Ebene<br />
kaum eine politische Gruppierung,<br />
sei es Partei oder NGO, die dieses<br />
Potenzial für sich nutzt. Vielleicht<br />
liegt es an der stiefmütterlichen Behandlung<br />
der <strong>Europa</strong>wahlen, die von<br />
den etablierten Parteien mehr als<br />
lästige Pflicht gesehen wird. Doch<br />
gäbe es genau hier die Möglichkeit<br />
die Jugend „abzuholen“. Beispielsweise<br />
verstehen sich die „Newropeans“<br />
als die erste transeuropäische<br />
Bewegung und haben sich mit<br />
dem Ziel der Demokratisierung der<br />
EU 2004 gegründet. Leider sind Initiativen<br />
wie diese bisher nicht in den<br />
Fokus der Öffentlichkeit gerückt, und<br />
so wird sich zeigen, ob eine Partei,<br />
die sich ausschließlich europäischen<br />
Interessen verschreibt, 2009 Erfolg<br />
haben kann.<br />
Am Ende sind die Zukunft <strong>Europa</strong>s<br />
und die eigenen Perspektiven nämlich<br />
sehr eng miteinander verknüpft,<br />
und genau das macht einen Großteil<br />
unserer Motivation und Begeisterung<br />
aus.
EUROPA<br />
Grenzenloses <strong>Europa</strong>? Diese Frage<br />
bildete den Rahmen des 17. Dialogseminars<br />
im Januar 2007 in Blaubeuren.<br />
Dank der Förderung durch die<br />
Hanns Martin Schleyer-Stiftung und<br />
die STIHL Holding AG & Co. KG – in<br />
Verbindung mit der <strong>Aktionsgemeinschaft</strong><br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
– diskutierten<br />
interessierte Studierende<br />
mit Experten<br />
über den Stand und<br />
die Perspektiven des<br />
europäischen Integrationsprozesses.<br />
Das<br />
Seminar war Professor<br />
Norbert Kloten<br />
(†) gewidmet, der die<br />
Veranstaltungsreihe<br />
mitbegründete und<br />
sich mit großem Engagement<br />
beteiligte.<br />
Die verantwortlichen<br />
Professoren Bernhard<br />
Herz (Universität<br />
Bayreuth), Gunther<br />
Schnabl (Universität<br />
Leipzig) und Joachim Starbatty<br />
(Universität Tübingen) hatten namhafte<br />
Referenten aus den Bereichen<br />
Politik, Administration und Wirtschaft<br />
eingeladen. Die Schwerpunkte lagen<br />
auf den Grenzen der Vertiefung in<br />
der „Verfassungskrise“, den geographischen<br />
Grenzen der erweiterten<br />
Europäischen Union (EU) sowie<br />
den Entwicklungsmöglichkeiten und<br />
-grenzen einzelner Politikfelder.<br />
Die Auswahl an Vorträgen aus verschiedenen<br />
Fachrichtungen erwies<br />
sich als gewinnbringend. Nach der<br />
Ansicht von Thomas Oppermann<br />
(Rechtswissenschaft, Universität<br />
Tübingen) steht die EU nach der<br />
Verfassungskrise an einem Scheideweg:<br />
Nach Jahrzehnten einer „Erfolgsgeschichte“<br />
drohe die Gefahr<br />
einer Rückentwicklung zum nationalstaatlichen<br />
Handeln in einer geho-<br />
1 . Dialog-Seminar<br />
„<strong>Europa</strong> ohne Grenzen?“<br />
Julian Siegl<br />
benen Freihandelszone. Wolfgang<br />
Wessels (Politikwissenschaft, Universität<br />
Köln) hingegen betrachtet<br />
die gegenwärtige Auseinandersetzung<br />
um Form und Inhalt der Europäischen<br />
Integration als immer wiederkehrendes<br />
Element eines ergebnisoffenen<br />
Einigungsprozesses. Die<br />
bestehende Krise erlaube vielmehr<br />
eine Vielzahl möglicher Entwicklungsszenarien.<br />
Für Ingo Friedrich,<br />
stellvertretender CSU-Parteivorsitzender<br />
und Präsidiumsmitglied des<br />
Europäischen Parlaments, offenbart<br />
sich die angesprochene Krise in der<br />
Praxis als Häufung von Einzelproblemen.<br />
Dabei müssten Defizite bezüglich<br />
der Finalität, der Akzeptanz<br />
sowie der demokratischen Legitimierung<br />
<strong>Europa</strong>s einzeln angegangen<br />
und in einem langfristigen Entwicklungsprozess<br />
behoben werden.<br />
Weitgehende Einigkeit besteht hingegen<br />
bei der Einschätzung, eine<br />
fortschreitende Erweiterung verlange<br />
zwingend vorhergehende Reformen.<br />
Diese vorausgesetzt sieht<br />
Cem Özdemir, <strong>Europa</strong>abgeordneter<br />
von Bündnis 90/Die Grünen, einen<br />
EU-Beitritt der Türkei mit politischen<br />
und wirtschaftlichen Gewinnen für<br />
beide Seiten verbunden. Für Martin<br />
Seidel (Rechtswissenschaft, Universität<br />
Bonn), reichten jedoch institutionelle<br />
Reformen allein als Voraussetzung<br />
für die Erweiterung der EU<br />
nicht aus. Die sinkende Zustimmung<br />
zum gesamten Einigungsprojekt<br />
erfordere generell eine<br />
bessere Vermittlung der<br />
historischen Bedeutung<br />
bisheriger Integrationserfolge.<br />
Bei der Frage nach<br />
den Entwicklungsmöglichkeiten<br />
im Bereich<br />
der Wirtschaftspolitik<br />
begrüßt Werner Mussler,<br />
Korrespondent der<br />
Frankfurter Allgemeinen<br />
Zeitung in Brüssel,<br />
den Wettbewerb in den<br />
Politikfeldern Steuern,<br />
Energie, Industrie und<br />
<strong>Soziale</strong>s als Möglichkeit<br />
der Qualitätssteigerung,<br />
während die negativen<br />
Folgen fehlenden Wettbewerbs im<br />
Bereich der Agrarpolitik offensichtlich<br />
seien. Hans Tietmeyer, Präsident<br />
der Deutschen Bundesbank<br />
a.D., bezeichnet die Wirtschafts-<br />
und Währungsunion (WWU) zwar<br />
insgesamt als währungspolitischen<br />
Erfolg, der längerfristige Bewährungstest<br />
hingegen stehe noch<br />
aus. Wegen offener Fragen der<br />
wirtschafts- und fiskalpolitischen<br />
Zuständigkeiten müsse einer Erweiterung<br />
der WWU mit Vorsicht<br />
begegnet werden.<br />
Hans Tietmeyer<br />
Somit präsentiert sich die EU gegenwärtig<br />
keineswegs als Gemeinschaft<br />
ohne Grenzen. Der reformbedürftige<br />
Zustand der Union scheint ihrer Erweiterung<br />
deutliche Grenzen zu setzen.<br />
Begrenzt entwicklungsfähiges<br />
statt grenzenloses <strong>Europa</strong> könnte<br />
demnach ein Fazit lauten.
EUROPA
FRANZ-BÖHM-VORTRAG<br />
Gesundheitswesen auf dem Irrweg der<br />
Verstaatlichung?<br />
Der in der Gesundheitsreform 2006<br />
(Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs<br />
in den gesetzlichen Krankenversicherungen)<br />
geplante Gesundheitsfonds<br />
sieht eine staatliche bundeseinheitliche<br />
Beitragsfestsetzung<br />
per Rechtsverordnung vor. Ferner<br />
sollen die Mittel aus dem Fonds den<br />
GKV (gesetzlichen Krankenversicherungen)<br />
staatlich zugewiesen<br />
werden. Somit würde einer demokratisch<br />
legitimierten Selbstverwaltung<br />
die Finanzautonomie entzogen.<br />
Diese Änderung birgt hohe Risiken<br />
in sich. Die für die Versorgung zur<br />
Verfügung stehenden Finanzmittel<br />
würden dauerhaft Gegenstand der<br />
politischen Diskussion und wären<br />
ferner von der öffentlichen Haushaltslage<br />
abhängig. Das Geld der<br />
Versicherten drohe zur politischen<br />
Verfügungsmasse zu werden. Ferner<br />
würde sich die Höhe des staatlich<br />
festgelegten Beitrages für den<br />
Fonds weniger an wirtschaftlichen<br />
als an politischen Vorgaben orientieren.<br />
Bei einer Tendenz zur Unterfinanzierung<br />
bestünde das Risiko der<br />
Abkopplung der Versicherten vom<br />
medizinisch-technischen Fortschritt.<br />
Als Resultat würden Krankenkassen<br />
von selbständigen Sozialversicherungen<br />
zu nachgeordneten ausführenden<br />
Behörden degradiert.<br />
Das Gesetz stärkt nicht, wie sein<br />
Name vorgibt, den Wettbewerb zwischen<br />
Krankenkassen; denn mehr<br />
als 70% des Ausgabenvolumens soll<br />
einheitlich für alle Krankenkassen<br />
von einem neuen zentralen Dachverband<br />
durch entsprechende Verträge<br />
verantwortet werden. Regionale<br />
Besonderheiten könnten damit nicht<br />
mehr berücksichtigt werden, Pluralität<br />
und Versorgungsvielfalt werden<br />
aufgehoben. Vertragsfreiheit gibt es<br />
nur noch für zusätzliche Leistungen,<br />
die über Kollektivverträge hinausgehen.<br />
Damit entscheidet die Zusatz-<br />
10<br />
Udo Heiden<br />
prämie und nicht die Leistung über<br />
den Erfolg einzelner Krankenkassen.<br />
Der Wettbewerb wird sich über<br />
den Zusatzbeitrag auf die gesunden<br />
und einkommensstarken Versicherten<br />
konzentrieren.<br />
Udo Heiden<br />
Die strukturellen Änderungen betreffen<br />
den Gemeinsamen Bundesausschuss,<br />
der von einem Selbstverwaltungsgremium<br />
zu einer dem<br />
Bundesministerium für Gesundheit<br />
(BMG) nachgeordneten Behörde<br />
umgebaut werden soll. Das BMG<br />
würde damit seinen Einfluss auf<br />
den Gemeinsamen Bundesausschuss<br />
vergrößern, womit sich die<br />
Regierung direkten Einfluss auf den<br />
Leistungskatalog der GKV sichern<br />
möchte. Problematisch ist dabei,<br />
dass fiskalische und politische Erwägungen<br />
über den Leistungskatalog<br />
bestimmen und die Sachnähe der<br />
Entscheidungsprozesse zum Versorgungsgeschehen<br />
verloren geht.<br />
Der neue Dachverband soll die Entscheidungs-<br />
und Handlungsfähigkeit<br />
der Krankenkassen und Krankenkassenverbände<br />
bei gemeinsam<br />
und einheitlich zu erledigenden<br />
Aufgaben stärken. Derzeit wird bei<br />
Interessengegensätzen noch im<br />
Rahmen eines internen Meinungsbildungsprozesses<br />
der Verbände<br />
vermittelt, was Beschlüsse der GKV<br />
erleichtert.<br />
In Zukunft werden diese unterschiedlichen<br />
Interessen in einem<br />
Dachverband ausgetragen. Hierbei<br />
sind allerdings weder schnellere,<br />
transparentere Entscheidungen<br />
noch Verbesserungen in der Qualität<br />
und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung<br />
zu erwarten.<br />
Vorteile sieht die Regierung in der<br />
Umgestaltung der Durchgriffsrechte<br />
auf die Entscheidungen des Dachverbandes.<br />
Für das Ministerium gibt<br />
es damit nur noch einen Verhandlungspartner,<br />
der besser steuer- und<br />
lenkbar ist als die heutigen selbstverwalteten<br />
Verbände.<br />
Diese geplanten Reformen des<br />
Gesundheitssystems bedeuten die<br />
Festsetzung eines bundeseinheitlichen<br />
allgemeinen Beitragssatzes,<br />
die Ausgestaltung des Leistungskatalogs<br />
durch eine dem BMG nachgelagerte<br />
Behörde und die Steuerung<br />
der wichtigsten Preise und Vergütungssysteme<br />
durch einen der Bundesregierung<br />
nahe stehenden Spitzenverband<br />
der Krankenkassen auf<br />
Bundesebene. Dies wiederum hat<br />
Verstaatlichung und Zentralisierung<br />
des deutschen Gesundheitssystems<br />
zur Folge.<br />
Daher werden die Ankündigungen<br />
des Koalitionsvertrages, eine nachhaltige<br />
und gerechte Finanzierung<br />
der GKV zu sichern und ein leistungsfähiges<br />
solidarisches und demographiefestes<br />
Gesundheitswesen<br />
zu schaffen, nicht eingehalten.<br />
Fazit: Mit der Gesundheitsreform<br />
2006 verabschiedet sich die Politik<br />
von den Grundsätzen der Solidarität<br />
hin zu einer Verstaatlichung des<br />
Gesundheitssystems.
Aufmarsch nach Armageddon?<br />
Historisch-politische und metaphysische<br />
Hintergründe des Nahost-Konflikts<br />
Der Begriff Armageddon wird im säkularen<br />
<strong>Europa</strong> überwiegend für die<br />
Kennzeichnung einer globalen endzeitlichen<br />
Auseinandersetzung unter<br />
Einsatz nuklearer Waffensysteme<br />
gebraucht. Ursprünglich stammt er<br />
aus der Bibel und ist dort der Name<br />
des Schauplatzes der letzten Entscheidungsschlacht<br />
der Könige der<br />
Erde gegen Gott. In der Tat könnten<br />
die Kriege im Nahen und Mittleren<br />
Osten globales Ausmaß erreichen.<br />
Vorgeschichte<br />
Die Wurzeln des momentanen Konflikts<br />
zwischen dem Nahen Osten<br />
und der westlichen Welt gehen bereits<br />
auf die Zeit des Ersten Weltkrieges<br />
zurück, als Großbritannien<br />
und Frankreich 1916 ein Geheimabkommen<br />
geschlossen hatten,<br />
in dem die Aufteilung des Nahen<br />
Ostens festgelegt wurde und 1917<br />
der britische Außenminister Balfour<br />
den Juden die „Schaffung einer nationalen<br />
Heimatstätte“ in Palästina<br />
zugesichert hatte. Zu diesem Betrug<br />
an den Arabern kommen noch<br />
die Golfkriege hinzu, die zu einem<br />
ständig wachsenden antiwestlichen<br />
Zivilisationsbewusstsein unter den<br />
Muslimen geführt haben. Sie sind<br />
von der gesamten islamischen Gemeinschaft<br />
als „Kreuzzüge des Westens“<br />
gegen den Islam empfunden<br />
worden.<br />
Eine schiitische Schiene<br />
Bei dem Irak-Krieg ging es um Demokratie<br />
als Allheilmittel und die<br />
Neuordnung des Nahen Ostens,<br />
verbunden mit knallharten Wirtschaftsinteressen,<br />
gestützt von einer<br />
starken Lobby im Hintergrund,<br />
die damit die Bedrohung Israels verhindern<br />
will. Doch es war ein großer<br />
Fehler, das seit Jahrhunderten bestehende<br />
Ordnungssystem mit der<br />
Vorrangstellung der Sunniten zu zer-<br />
Jörn Brauns<br />
stören, die bestehenden Streit- und<br />
Polizeikräfte aufzulösen und den<br />
Staatsapparat zu de-baathisieren.<br />
Mit der Demokratisierung erhalten<br />
nun die Schiiten per Wahlurne die<br />
Macht, da sie die Mehrheit der Bevölkerung<br />
im Irak stellen. Ein zweiter<br />
schiitischer Gottesstaat droht zu entstehen.<br />
Damit wird eine schiitische<br />
Schiene vom künftigen Atomstaat<br />
Iran über den Irak über Syrien bis hin<br />
zum Libanon mit seinem wachsenden<br />
schiitischen Bevölkerungsteil mit<br />
der Stoßrichtung Israel gebaut. Der<br />
in Teheran geträumte Traum eines<br />
islamischen Großreiches könnte<br />
Realität werden, wenn der amerikanische<br />
Demokratisierungsversuch<br />
den Irak auseinanderbrechen läßt.<br />
Die westliche Debatte um Menschenrechte<br />
hat in islamischen<br />
Ländern keine geistesgeschichtliche<br />
Tradition. Allah und nicht der<br />
Mensch ist der Mittelpunkt der Welt.<br />
Die Menschen sind mehr an einer eigenen,<br />
ordnungstiftenden Regierung<br />
interessiert als an Selbstbestimmung.<br />
Die US-Streitkräfte sind mit<br />
der asymmetrischen Kriegsführung<br />
gänzlich überfordert. Die arabischen<br />
Nachbarstaaten hatten sich gegen<br />
einen amerikanischen Militärschlag<br />
ausgesprochen: Sie fürchteten zu<br />
Recht Staatszerfall und Anarchie<br />
im Irak. Darüber hinaus sehen sie<br />
in den Amerikanern keine Befreier,<br />
sondern „christliche Kreuzzügler“,<br />
die die islamische Welt erobern und<br />
ihr Öl erbeuten wollen. Und der Iran<br />
lernt daraus, dass atomar bewaffnete<br />
Staaten sicherer sind vor imperialen<br />
Gelüsten und demokratischen<br />
Missionsgedanken.<br />
Islamische Atommacht Iran<br />
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert<br />
lebt der Iran in der schiitischen<br />
Gottesstaatsorientierung. Er ist al-<br />
FRANZ-BÖHM-VORTRAG<br />
lerdings keine absolute Diktatur,<br />
sondern eine Theokratie mit verschiedenen<br />
Machtzentren, in denen<br />
viele Fragen durchaus kontrovers<br />
diskutiert werden. Aufgrund seiner<br />
enormen Gas- und Ölvorkommen ist<br />
der Iran wirtschaftlich in einer guten<br />
Ausgangslage. Nach dem Irak-Krieg<br />
unternimmt er große Anstrengungen,<br />
Atommacht zu werden, da er sich<br />
von vielen Seiten bedroht fühlt. Ein<br />
nuklearer Iran ist eine reale Option,<br />
die die strategische Lage in Nahost<br />
und für <strong>Europa</strong> von Grund auf verändern<br />
wird. Israel wird das als neue<br />
Bedrohung sehen und nicht hinnehmen<br />
können. Bisher bekämpfen die<br />
Iraner Israel durch Unterstützung<br />
von Terrorgruppen Israel bekämpfen,<br />
dann aber könnte nukleare<br />
Schlagkraft Israel auf Knopfdruck<br />
auslöschen.<br />
Eine Atommacht Iran wäre ohne<br />
Zweifel auch für <strong>Europa</strong> äußerst<br />
bedrohlich und würde es erpressbar<br />
machen, Deutschland besonders,<br />
da es noch nicht einmal in der<br />
Lage wäre, Vergeltungsschläge anzudrohen.<br />
Militärschläge von Israel<br />
und den USA sind daher denkbar,<br />
würden aber wiederum das gesamte<br />
iranische Volk und die islamische<br />
Welt auf allen Kontinenten solidarisieren<br />
und zu Terroranschlägen<br />
sowie bürgerkriegsähnlichen Unruhen<br />
führen. <strong>Europa</strong> und die USA<br />
sind ferner aufgrund des Öls in einer<br />
Abhängigkeitsrolle. Eine Geschlossenheit<br />
der Großmächte ist nicht zu<br />
erwarten, weil China und Russland<br />
ihre eigenen nationalen Interessen<br />
verfolgen.<br />
Die metaphysische Dimension<br />
Das Verhältnis von Judentum und Islam<br />
ist in seiner metaphysischen Dimension<br />
von Anfang an belastet. Es<br />
ist falsch zu glauben, dass mit der<br />
11
FRANZ-BÖHM-VORTRAG<br />
Errichtung eines Palästinenserstaates<br />
der Nahostkonflikt beendet wäre<br />
und Israel in Frieden und Sicherheit<br />
existieren könnte. Jedes Land, das<br />
einmal im Besitz der Muslime war,<br />
ist für immer muslimisch. Ein Friede<br />
mit Ungläubigen ist niemals möglich,<br />
jedoch ein Waffenstillstand, solange<br />
bis man überlegen ist. Dabei<br />
wird bei Übermacht des Feindes der<br />
Friede bzw. der Waffenstillstand aus<br />
taktischen Gründen und zeitlich begrenzt<br />
benutzt. Vorbild ist Mohammed,<br />
der diese Taktik nutzte, um 630<br />
die Qurais zu überlisten und nach<br />
Mekka einzumarschieren.<br />
Die Juden waren zwar einst Empfänger<br />
einer göttlichen Offenbarung und<br />
zu Beginn seiner Verkündigung hatte<br />
Mohammed erwartet, sie würden<br />
sich seiner Botschaft anschließen.<br />
Die Juden konnten jedoch Mohammed<br />
nicht als Propheten anerkennen,<br />
denn ein Prophet strebt nicht<br />
nach politischer Macht. Als sich herausstellte,<br />
dass sie aufgrund ihrer<br />
Schriftkenntnisse Mohammeds Anspruch<br />
in Frage stellten, wandelte<br />
sich das Verhältnis. Der Islam veränderte<br />
sich, und es kam zu Vertreibungen<br />
und Massenmorden an den<br />
Juden.<br />
Israel ist der ärgste Feind der Moslems,<br />
weil der Nahe Osten das Kernland<br />
des Islam ist. In seiner gesamten<br />
Geschichte war der Islam nie mit<br />
einem jüdischen Staat konfrontiert<br />
worden. Die Wiedererstehung eines<br />
jüdischen Staates im Jahre 1948 ist<br />
nun völlig konträr zur islamischen<br />
Lehre, da Allah mit dem jüdischen<br />
Volk abgeschlossen hatte.<br />
Der Konflikt hat eine metaphysische<br />
Dimension, die von <strong>Europa</strong>s und<br />
Amerikas Eliten aufgrund ihrer mangelnden<br />
geschichtlichen und religiösen<br />
Bildung nicht erfasst wird und<br />
dem mit militärischen Mitteln allein<br />
nicht beizukommen ist. Ein demokratisches<br />
Palästina ist eine Illusion<br />
der westlichen Mächte. Einen Feind<br />
zu lieben ist für Muslime, aber auch<br />
für Israelis, ein ganz abwegiger Gedanke,<br />
erst recht die Entfeindungslehre<br />
des Juden Jesus.<br />
1<br />
Das Freiheitsverständnis<br />
von Ludwig Erhard<br />
Ludwig Erhard hat <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
anders definiert, als es heute<br />
üblich ist. Ihm ging es um „die völlige<br />
Freiheit des Handelns und der<br />
Entscheidungen“, und zwar für alle<br />
wirtschaftenden Menschen, wo immer<br />
sie auch tätig sind.<br />
Erhard hat bis 1945 wissenschaftlich<br />
geforscht und gearbeitet (Institut für<br />
Wirtschaftsbeobachtung; ab 1942<br />
Institut für Industrieforschung) und<br />
dabei auch frühere Wirtschaftsordnungen<br />
untersucht und sie als „unternehmerische<br />
Planwirtschaften“<br />
erkannt, die Pfründen und Renten,<br />
ständestaatliche Verhältnisse,<br />
Machtpositionen und -missbrauch<br />
sowie Korruption förderten. Wirtschaftliche<br />
Fortschritte, die im<br />
Leistungswettbewerb an die Verbraucher<br />
weitergegeben werden<br />
und dadurch „Wohlstand für alle“<br />
bewirken konnten, blieben aus.<br />
In diesen „unternehmerischen Planwirtschaften“<br />
habe der Staat mehr<br />
und mehr Einfluss gewonnen. Dem<br />
Einzelnen wurde im Gegenzug Verantwortung<br />
abgenommen. Damit<br />
habe sich das <strong>Soziale</strong> gewandelt,<br />
denn: „Es war nur eine Selbstverständlichkeit,<br />
dass sich der Einzelne<br />
sagt: Wenn ich mich schon nicht<br />
frei entfalten kann, wenn ich schon<br />
nicht das tun und lassen kann, was<br />
ich für richtig halte und was ich für<br />
mein persönliches Wohlergehen<br />
für notwendig erachte, dann, lieber<br />
Staat, trage du auch bitte die Verantwortung<br />
für mein ökonomisches<br />
Schicksal“.<br />
Das Zitierte stammt aus dem Jahr<br />
1954, und Erhard hat damit die Zeit<br />
vor 1945 beschrieben. Seine Ausführungen<br />
klingen aber recht aktuell,<br />
denn entgegen Erhards Absicht<br />
ist im einstigen „Wirtschaftswunderland“<br />
der Staat inzwischen<br />
wieder fast allgegenwärtig.<br />
Andreas Schirmer<br />
Für Erhard stand außer Zweifel,<br />
dass sich der Staat aus dem Wirtschaftsalltag<br />
heraus hält. Der Staat<br />
setzt Rahmenbedingungen für wirtschaftliches<br />
Handeln, damit jeder<br />
aus eigener Kraft für sich sorgen<br />
kann und nicht auf Kosten anderer<br />
leben muss. Aus der Perspektive<br />
des <strong>Soziale</strong>n in einer <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
ist vorrangig, soziale Sicherheit für<br />
alle zu schaffen: für Eigentümer<br />
durch Schutz des Eigentums vor<br />
dem willkürlichen Zugriff des Staates<br />
und privater Dritter; für die, die ausschließlich<br />
vom Ertrag ihrer Arbeitskraft<br />
leben müssen, durch Sicherung<br />
des Zugangs zum Markt.<br />
Für Erhard bedeutete „sozial“ eben<br />
nicht, <strong>Marktwirtschaft</strong> mit möglichst<br />
viel Sozialpolitik zu verbinden. In<br />
seiner Vorstellung muss die Wirtschaftsverfassung<br />
zugleich eine soziale<br />
Funktion erfüllen: Die direkte<br />
Teilhabe aller an wirtschaftlichen<br />
Fortschritten und Zuwächsen, ohne<br />
Umwege über den Staat oder über<br />
quasi-staatliche Kassen der sozialen<br />
Hilfe – „Wohlstand für alle“ eben.<br />
Erhards <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> geht<br />
über das Ökonomische hinaus. Die<br />
Wirtschaft, zentraler Lebensbereich,<br />
muß angemessen geordnet sein, damit<br />
sich gesellschaftliche und soziale<br />
Verhältnisse zufriedenstellend entwickeln:<br />
„Wenn es viele Menschen in<br />
einem Staat gibt, die von der Sorge<br />
gequält sind, was morgen ihr Schicksal<br />
sein wird, so kann man nicht von<br />
Freiheit sprechen. Frei, wahrhaft frei<br />
als Persönlichkeit und wahrhaft frei<br />
gegenüber dem Staat und seinen<br />
Einrichtungen ist nur derjenige, der<br />
gewiss sein kann, kraft eigener Leistung<br />
und eigener Arbeit bestehen<br />
zu können, ohne Schutz, aber auch<br />
ohne Behinderung durch den Staat“<br />
(1954). Freiheit im Erhardschen Sinn<br />
braucht ebenfalls Grenzen, aber diese<br />
Grenzen dürfen aus seiner Sicht
nicht von Dritten gesetzt werden.<br />
Das kann nur jeder Einzelne selbst,<br />
und zwar freiwillig. In einer funktionierenden<br />
Gesellschaft werde jeder<br />
Einzelne – was immer er tue – nicht<br />
nur an sich denken; jeder habe auch<br />
das Wohl des anderen vor Augen.<br />
Erst durch die Fürsorglichkeit des<br />
Staates werde diese Orientierung<br />
gestört und, schlimmstenfalls, sogar<br />
zerstört.<br />
Erhard bezog die Begründungen<br />
seines Freiheits- und damit zugleich<br />
auch seines Sozialverständnisses<br />
aus den Werken der Ethik und der<br />
Sozialphilosophie. Für ihn war vor<br />
allem die „Theorie der ethischen<br />
Gefühle“ von Adam Smith grundlegend.<br />
Der Grundgedanke: Menschliches<br />
Handeln ist sozialer Kontrolle<br />
unterworfen, weil jeder Mensch für<br />
sein Tun die Anerkennung anderer<br />
sucht, weil er als nützliches Glied<br />
der Gesellschaft anerkannt werden<br />
will. Jeder möchte „sympathisch“ erscheinen:<br />
als Mensch, der „richtig“,<br />
der „ehrenhaft“ handelt. Deshalb zügelt<br />
jeder seinen Egoismus. In Erhards<br />
Worten: „Aus der Verdichtung<br />
dieser Beziehungen erwachsen jene<br />
kategorischen Imperative, die, nur<br />
zum geringsten Teil in Gesetzesform<br />
gekleidet, aus Gesinnung und Gesittung<br />
als gemeinverbindliche Verhaltensweisen<br />
anerkannt werden.“<br />
Eine der Freiheit verpfl ichtete Ordnungspolitik<br />
muß die grundsätzlich<br />
im Menschen wurzelnde soziale Orientierung<br />
aufrecht erhalten und alles<br />
vermeiden, was sie schwächt. Die soziale<br />
Orientierung sei eine natürliche<br />
Erscheinung, aber auch ein zartes<br />
Pfl änzchen, das ohne Pfl ege welke<br />
und eingehe. Menschen richten ihr<br />
Verhalten zwar am Nächsten aus,<br />
neigen aber ebenso dazu, aus der<br />
Verantwortung für sich und andere zu<br />
fl iehen, wenn die Umstände das zuließen.<br />
Freiheitliche Politik muss sich<br />
demnach darauf konzentrieren, die<br />
im Menschen vorhandene Orientierung<br />
zu erhalten und die Menschen in<br />
ihrer sozialen Haltung zu bestärken.<br />
Ohne diese Grundhaltung werde keine<br />
Gesellschaft überdauern, die sich<br />
als humane Gesellschaft verstehe.<br />
Das mit Erhards <strong>Soziale</strong>r <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
verbundene ethische Fundament<br />
von Freiheit und die mit ihr untrennbar<br />
verbundene Verantwortung<br />
mündet in eine Politik, die Freiheit<br />
sichert, indem sie zugleich darauf<br />
achtet, dass sich keiner der Verantwortung<br />
für sich (und andere) entzieht.<br />
Daher müssen die Prinzipien<br />
der Selbstverantwortung und der<br />
Subsidiarität betont werden.<br />
Andreas Schirmer<br />
Dass <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> heutzutage<br />
etwas anderes ist als die<br />
Konzeption von Erhard, liegt darin,<br />
dass im heutigen Verständnis<br />
von <strong>Soziale</strong>r <strong>Marktwirtschaft</strong> pseudofreiheitliches<br />
Denken vorherrscht:<br />
Es geht um eine vom Staat, von der<br />
Obrigkeit gewährte, um eine kon<br />
trollierte und regulierte Freiheit, um<br />
„Bewegungsspielräume“, die der<br />
Staat zuweist. Er schränkt einerseits<br />
mit seinen Regulierungen die<br />
Leistungsbereitschaft und das Lei<br />
stungsvermögen der Bürger ein, auf<br />
der anderen Seite beansprucht er<br />
immer mehr fi nanzielle Mittel. Er wird<br />
mächtiger und schwächer zugleich,<br />
während die Bürger verarmen: „So<br />
reiht sich schließlich ein Glied an<br />
das andere, bis sich das Individuum<br />
in den Ketten der Unfreiheit gefangen<br />
sieht und am Ende die Funktionäre<br />
über unsere Lebensordnung<br />
beschließen“ (1968). Der Bürger ist<br />
zum „sozialen Untertan“ geworden.<br />
Auch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen,<br />
die in den vergangenen<br />
Jahrzehnten unter dem Motto „Zurück<br />
zur <strong>Soziale</strong>n <strong>Marktwirtschaft</strong>“<br />
FRANZ-BÖHM-VORTRAG<br />
standen, widersprechen seinen<br />
Grundgedanken.<br />
Viele der bisher durchgeführten<br />
Reformen mit Berufung auf die <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Marktwirtschaft</strong> waren bestenfalls<br />
das Basteln an Symptomen.<br />
Oder, abschließend nochmal mit<br />
den Worten Erhards: „Was sind<br />
das für Reformen, die uns Wände<br />
voller neuer Gesetze, Novellen und<br />
Durchführungsbestimmungen bringen?<br />
Liberale Reformen sind es jedenfalls<br />
nicht! Es sind Reformen, die<br />
in immer ausgeklügelterer Form die<br />
Bürger in neue Abhängigkeiten von<br />
staatlichen Organen bringen, wenn<br />
nicht sogar zwingen“ (1974).<br />
Quellen<br />
(1954) Ludwig Erhard: „Die Prinzipien der<br />
deutschen Wirtschaftspolitik“. Vortrag vor der<br />
Deutsch-Belgisch-Luxemburgischen Handelskammer<br />
am 31. Mai 1954 in Antwerpen.<br />
(1968) Ludwig Erhard: „Freiheit und Dissens“.<br />
Vortrag vor der Mont Pelèrin Society am 1.<br />
Sept. 1968 in Aviemore (Schottland)<br />
(1970) Ludwig Erhard: „Freiheit in der Massengesellschaft“.<br />
Vortrag vor der Internationalen<br />
Akademie für wirtschaftliche Freiheit am<br />
12. Mai 1970 in Bonn.<br />
(1974) Ludwig Erhard: „Lebensordnung im<br />
Geiste der europäischen Freiheit“. Ansprache<br />
anlässlich der Verleihung des Freiherrvom-Stein-Preises<br />
1974 am 6. Nov. 1974 in<br />
Wahlscheid..<br />
Impressum<br />
Verantwortlich:<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Starbatty<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Mohlstr. 26<br />
72074 Tübingen<br />
Telefon 07071 - 550600<br />
Telefax 07071 - 550601<br />
E-Mail: mail@asm-ev.de<br />
Homepage: www.asm-ev.de<br />
Konto: 344 520 300<br />
BLZ: 640 800 14<br />
Dresdner Bank Tübingen<br />
1
FRANZ BÖHM VORTRAG<br />
„Aufklärung ist der Ausgang des<br />
Menschen aus seiner selbstverschuldeten<br />
Unmündigkeit“<br />
Was Immanuel Kant vor gut zweihundert<br />
Jahren über die Aufklärung<br />
und die Furcht der Menschen, sich<br />
selbst in die geistige Unabhängigkeit<br />
zu entlassen, geschrieben hat,<br />
gilt auch heute noch. Doch geht es<br />
inzwischen nicht um die Loslösung<br />
aus dem Schoß der Kirche, sondern<br />
um die Lösung aus der Obhut des<br />
uns umarmenden, erdrückenden<br />
und unwissend haltenden Staates.<br />
Das geschieht nicht aus bösem Willen,<br />
sondern in der guten Absicht,<br />
uns Bürger umfassend gegen die<br />
Fährnisse der Welt zu schützen.<br />
Und damit geraten wir in die soziale<br />
Abhängigkeit.<br />
Entmündigung des Bürgers<br />
Die Abhängigkeit ist inzwischen<br />
dermaßen gewachsen und die<br />
steuerlichen und sozialen Abgaben<br />
je Beschäftigten dermaßen<br />
gestiegen, dass ein Erwerbstätiger<br />
drei Stunden arbeiten muss, um ein<br />
Produkt zu kaufen, für das er selbst<br />
bloß eine Arbeitsstunde gebraucht<br />
hat. Das hat uns der unvergessene<br />
Tyll Necker, Träger der Alexander-<br />
Rüstow-Plakette der ASM, vor rund<br />
einem dutzend Jahren vorgerechnet.<br />
Und es ist seither nicht besser<br />
geworden. Die deutsche Bundesbank<br />
hat ausgerechnet, dass die<br />
jungen Leistungsträger, nicht die<br />
Vielverdiener, von 100 zusätzlich<br />
verdienten Euro 72 an Steuer- und<br />
Sozialabgaben zu entrichten haben,<br />
also eine Grenzprogression von 72<br />
% auf das Einkommen einschließlich<br />
Arbeitgeberanteile. Damit die<br />
Belastung am Arbeitsplatz und damit<br />
auch in der Lohntüte weniger<br />
spürbar wird, hat die große Koalition<br />
die Mehrwertsteuer um 3 %-<br />
Punkte erhöht (ohne Lebensmittel).<br />
So zahlt der Einzelne Sozialabgaben<br />
auch an der Ladenkasse. Ein<br />
1<br />
Joachim Starbatty<br />
Teil der Abgaben wird in Form von<br />
Sachleistungen – insbesondere in<br />
der ärztlichen Versorgung – an die<br />
Versicherten zurückgegeben. Der<br />
einzelne Bürger erfährt dann gar<br />
nicht mehr, wie das System funktioniert<br />
und wie teuer es in Wirklichkeit<br />
ist.<br />
Kant im Original (1784)<br />
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen<br />
aus seiner selbst verschuldeten<br />
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das<br />
Unvermögen, sich seines Verstandes<br />
ohne Leitung eines anderen zu bedienen.<br />
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit,<br />
wenn die Ursache derselben<br />
nicht am Mangel des Verstandes,<br />
sondern der Entschließung und des<br />
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung<br />
eines anderen zu bedienen.(...)<br />
Dass der bei weitem größte Teil der<br />
Menschen, darunter das ganz schöne<br />
Geschlecht (das gilt heute wohl nicht<br />
mehr ) den Schritt zur Mündigkeit,<br />
außer dem dass er beschwerlich<br />
ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür<br />
sorgen schon jene Vormünder, die die<br />
Oberaufsicht über sie gütigst auf sich<br />
genommen haben. Nachdem sie ihr<br />
Hausvieh zuerst dumm gemacht haben,<br />
und sorgfältig verhüteten, dass<br />
diese ruhigen Geschöpfe ja keinen<br />
Schritt außer dem Gängelwagen, darin<br />
sie sie einsperreten, wagen durften: so<br />
zeigen sie ihnen nachher die Gefahr,<br />
die ihnen drohet, wenn sie es wagen.<br />
Staatliches Deputatsystem<br />
Vor zweihundert Jahren war in der<br />
gewerblichen Wirtschaft das Deputatsystem<br />
üblich: Ein Teil des Lohns<br />
wurde als Sachleistungen ausbezahlt<br />
– u.a. deswegen, damit am<br />
Wochenende nicht der ganze Lohn<br />
„verjubelt“ werden konnte. Dieses<br />
System wurde abgeschafft, weil es<br />
nicht in eine Gesellschaft mündiger<br />
Staatsbürger paßte. Dass aber<br />
heute die Staatsbürger prozentual<br />
über weit weniger verfügen können<br />
als seinerzeit, gilt dagegen offensichtlich<br />
nicht als anstößig, weil es<br />
heute der Staat macht. Aber Unmündigkeit<br />
bleibt Unmündigkeit,<br />
egal wer dafür verantwortlich ist.<br />
Die Aufklärung über gesamtwirtschaftliche<br />
Zusammenhänge hat<br />
letztlich das Ziel, die Bürger zu<br />
selbständigem Denken auch in<br />
sozialen Verhältnissen zu befähigen<br />
und ihnen Mut zu machen,<br />
den Weg in die Freiheit zu wagen<br />
und die „komfortable Stallfütterung“<br />
(Wilhelm Röpke) zurückzuweisen.<br />
Aufklärung über gesamtwirtschaftliche<br />
Zusammenhänge leistet die<br />
ASM mit wachsendem Erfolg an<br />
weiterführenden Schulen. Wir wollen<br />
das ausbauen und einen Arbeitskreis<br />
aus Gymnasiallehrern,<br />
Hochschullehrern, Ministerialbeamten<br />
und versierten Medienleuten<br />
zusammenrufen, mit Hilfe dessen<br />
wir den Unterricht im Fach „Wirtschaft“<br />
ankurbeln und verbessern<br />
wollen. Das ist noch nicht genug,<br />
aber es ist ein Anfang.<br />
Ausweis sämtlicher Lohnbestandteile<br />
Ein weiterer Schritt in Richtung „Aufklärung“<br />
wäre, dass Unternehmen<br />
alle Lohnbestandteile einschließlich<br />
der Arbeitgeberanteile – die ja bloß<br />
so heißen, damit die Erwerbstätigen<br />
nicht merken, dass sie selbst<br />
diese Beiträge aufbringen – auf<br />
der Lohnabrechnung ausweisen<br />
und auch zeigen würden, wofür sie<br />
verwendet werden. Wenn die Bürger<br />
wissen, wie kostspielig unser<br />
derzeitiges System ist, dann beginnen<br />
sie auch, über Alternativen<br />
nachzudenken.
MACRO-PLANSPIEL<br />
Auszüge aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. Mai 2007, C4<br />
Wirtschaft ist spannend, macht aber<br />
auch viel Arbeit, hätte Karl Valentin<br />
vielleicht gesagt. Die Zusammenhänge<br />
der Ökonomie erscheinen<br />
äußerst komplex. Obwohl das Auf<br />
und Ab der Märkte jeden Einzelnen<br />
- direkt oder indirekt - betrifft, ist das<br />
Verständnis mangelhaft. Es fehlt<br />
gerade bei jungen Leuten am Basiswissen:<br />
Was etwa<br />
besagt das Prinzip von<br />
Angebot und Nachfrage?<br />
Eine repräsentative<br />
Umfrage im Auftrag<br />
des Bundesverbandes<br />
der deutschen Banken<br />
(BdB) ergab, dass gerade<br />
einmal 35 Prozent<br />
der 14- bis 24-Jährigen<br />
das simple Grundprinzip<br />
der <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
korrekt erklären konnten.<br />
65 Prozent wussten<br />
bei „Angebot und<br />
Nachfrage“ nicht Bescheid.<br />
Wie sich Preise bilden,<br />
was Lohnhöhe, Zinssatz<br />
oder Inflationsrate aussagen,<br />
„das hätte man eigentlich in der<br />
Schule lernen müssen, wie es in<br />
den angelsächsischen Ländern geschieht“,<br />
sagt Ifo-Präsident Hans-<br />
Werner Sinn. „Weil wir Ökonomen<br />
stets das Einmaleins unseres<br />
Faches neu erläutern müssen, um<br />
verstanden zu werden, kommen wir<br />
in der öffentlichen Diskussion nicht<br />
allzu weit. Dass selbst Akademiker<br />
meistens dieses Einmaleins nicht<br />
beherrschen, ist ein Armutszeugnis<br />
unseres Ausbildungssystems.“<br />
Auch der Wirtschaftspädagoge<br />
Hans Kaminski beklagt, deutsche<br />
Die Wirtschaft erkunden<br />
Philip Plickert<br />
Deutschlands Jugend versteht zu wenig von Wirtschaft,<br />
klagen Wissenschaftler und Unternehmen. Private Initiativen<br />
versuchen, mit Online-Bildung und Planspielen Abhilfe<br />
zu schaffen. Aber dauerhaft kann nur ein eigenes Schulfach<br />
„Wirtschaft“ das allgemeine Wissensniveau heben.<br />
Schüler erhielten Wissen über Wirtschaftsprozesse<br />
„nur in homöopathischen<br />
Dosen“ verabreicht.<br />
So gibt es bislang in keinem Bundesland<br />
ein eigenes Fach Wirtschaft.<br />
„Oft wird ökonomisches<br />
Wissen in Kombinationsfächer<br />
gepackt, aber das sind Kompro-<br />
Nicht nur etwas für Schüler: das MACRO-Planspiel<br />
misslösungen“, kritisiert die löB-<br />
Geschäftsführerin Kathrin Eggert.<br />
An bayerischen Gymnasien gibt es<br />
das Fach „Wirtschaft und Recht“, in<br />
Sachsen-Anhalt ein Wahlpflichtfach<br />
„Wirtschaftslehre“, in Niedersachsen<br />
heißt die vormalige politische<br />
Bildung jetzt „Politik-Wirtschaft“.<br />
Trotz der reflexartigen Ablehnung<br />
durch die Gewerkschaft Erziehung<br />
und Wissenschaft (GEW) habe sich<br />
das neue Fach so weit bewährt,<br />
sagt Eggert. Weitere Bundesländer<br />
planen, wirtschaftliche Themen in<br />
den Lehrplänen aller Schularten<br />
stärker zu verankern.<br />
Ein Gefühl für die Dynamik volkswirtschaftlicher<br />
Prozesse vermittelt das<br />
Planspiel „MACRO“, das die <strong>Aktionsgemeinschaft</strong><br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
(www.asm-ev.de) an Schulen<br />
und Fachhochschulen veranstaltet.<br />
Die Klassen werden in zwei Gruppen<br />
eingeteilt, die miteinander konkurrierende<br />
Länder darstellen. Zunächst<br />
sind es geschlossene Volkswirtschaften,<br />
in einer fortgeschrittenen<br />
Version werden auch die Bewegungen<br />
internationaler Güter-, Kapital-<br />
und Devisenmärkte simuliert.<br />
In jeder Nation gibt es Untergruppen:<br />
die Haushalte,<br />
die Unternehmen, die<br />
Regierung und die Notenbank.<br />
Sie treffen<br />
eigenständig Entscheidungen,<br />
der Computer<br />
berechnet dann die<br />
volkswirtschaftlichen<br />
Konsequenzen. Gewinner<br />
ist, wer seinen<br />
Wohlstand am meisten<br />
steigern kann. „Anfangs<br />
erscheint das<br />
MACRO-Planspiel sehr<br />
komplex“, sagt der<br />
ASM-Vorsitzende Joachim<br />
Starbatty von der<br />
Universität Tübingen.<br />
„Aber nach einem Tag<br />
sind die Schüler voll in<br />
der Materie drin.“ Inzwischen haben<br />
rund 200 Klassen mit dem vom baden-württembergischenKultusministerium<br />
geförderten MACRO-Spiel<br />
die logischen Zusammenhänge der<br />
Volkswirtschaftswelt erkundet.<br />
So löblich die privaten Initiativen<br />
sind: Sie allein werden kaum dem<br />
allgemeinen ökonomischen Bildungsnotstand<br />
abhelfen. Dazu bedürfte<br />
es eines eigenen Schulfachs,<br />
beharrt Wirtschaftspädagoge Kaminski.<br />
Ungebildete Bürger seien<br />
anfällig für Scheinargumente und<br />
Manipulation.<br />
1
MACRO-PLANSPIEL<br />
Rheingauer Bote<br />
1