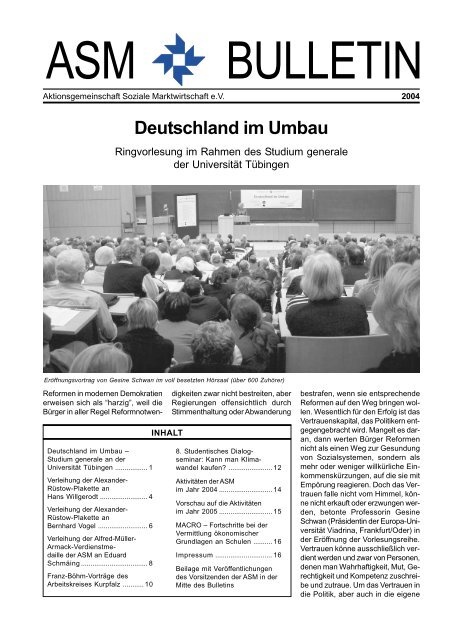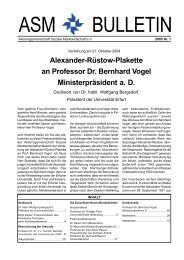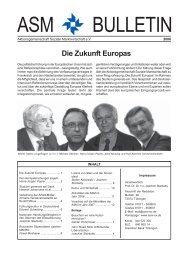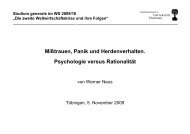Deutschland im Umbau - Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft
Deutschland im Umbau - Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft
Deutschland im Umbau - Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ASM BULLETIN<br />
<strong>Aktionsgemeinschaft</strong> <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> e.V. 2004<br />
Eröffnungsvortrag von Gesine Schwan <strong>im</strong> voll besetzten Hörsaal (über 600 Zuhörer)<br />
Reformen in modernen Demokratien<br />
erweisen sich als “harzig”, weil die<br />
Bürger in aller Regel Reformnotwen-<br />
<strong>Deutschland</strong> <strong>im</strong> <strong>Umbau</strong> –<br />
Studium generale an der<br />
Universität Tübingen ................. 1<br />
Verleihung der Alexander-<br />
Rüstow-Plakette an<br />
Hans Willgerodt ......................... 4<br />
Verleihung der Alexander-<br />
Rüstow-Plakette an<br />
Bernhard Vogel .......................... 6<br />
Verleihung der Alfred-Müller-<br />
Armack-Verdienstmedaille<br />
der ASM an Eduard<br />
Schmäing ................................... 8<br />
Franz-Böhm-Vorträge des<br />
Arbeitskreises Kurpfalz ........... 10<br />
<strong>Deutschland</strong> <strong>im</strong> <strong>Umbau</strong><br />
Ringvorlesung <strong>im</strong> Rahmen des Studium generale<br />
der Universität Tübingen<br />
INHALT<br />
digkeiten zwar nicht bestreiten, aber<br />
Regierungen offensichtlich durch<br />
St<strong>im</strong>menthaltung oder Abwanderung<br />
8. Studentisches Dialogseminar:<br />
Kann man Kl<strong>im</strong>awandel<br />
kaufen? ....................... 12<br />
Aktivitäten der ASM<br />
<strong>im</strong> Jahr 2004 ............................ 14<br />
Vorschau auf die Aktivitäten<br />
<strong>im</strong> Jahr 2005 ............................ 15<br />
MACRO – Fortschritte bei der<br />
Vermittlung ökonomischer<br />
Grundlagen an Schulen .......... 16<br />
Impressum .............................. 16<br />
Beilage mit Veröffentlichungen<br />
des Vorsitzenden der ASM in der<br />
Mitte des Bulletins<br />
bestrafen, wenn sie entsprechende<br />
Reformen auf den Weg bringen wollen.<br />
Wesentlich für den Erfolg ist das<br />
Vertrauenskapital, das Politikern entgegengebracht<br />
wird. Mangelt es daran,<br />
dann werten Bürger Reformen<br />
nicht als einen Weg zur Gesundung<br />
von Sozialsystemen, sondern als<br />
mehr oder weniger willkürliche Einkommenskürzungen,<br />
auf die sie mit<br />
Empörung reagieren. Doch das Vertrauen<br />
falle nicht vom H<strong>im</strong>mel, könne<br />
nicht erkauft oder erzwungen werden,<br />
betonte Professorin Gesine<br />
Schwan (Präsidentin der Europa-Universität<br />
Viadrina, Frankfurt/Oder) in<br />
der Eröffnung der Vorlesungsreihe.<br />
Vertrauen könne ausschließlich verdient<br />
werden und zwar von Personen,<br />
denen man Wahrhaftigkeit, Mut, Gerechtigkeit<br />
und Kompetenz zuschreibe<br />
und zutraue. Um das Vertrauen in<br />
die Politik, aber auch in die eigene
DEUTSCHLAND IM UMBAU<br />
Gesine Schwan weist den Weg<br />
Leistungsfähigkeit wieder aufzubauen,<br />
müsse der Grundkonsens über<br />
die <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> wieder<br />
gewonnen und das Grundvertrauen<br />
der Gesellschaft in gemeinsame<br />
Wertüberzeugungen und langfristige<br />
gemeinsame Interessen gestärkt<br />
werden.<br />
Nach diesen für die zukünftige politische<br />
Arbeit grundlegenden Erkenntnissen<br />
ging es in den folgenden drei<br />
Vorträgen darum, <strong>Deutschland</strong>s Einbettung<br />
in die internationale Politik<br />
und Weltwirtschaft zu analysieren.<br />
Die Podiumsdiskussion mit den Professoren<br />
Rolf Hasse, Martin Netteshe<strong>im</strong><br />
und Karl Albrecht Schachtschneider<br />
unter der Moderation von<br />
Professor Joach<strong>im</strong> Starbatty widmete<br />
sich der europäischen Integration.Im<br />
Zentrum der Diskussion stand<br />
der Entwurf eines Vertrags über eine<br />
Verfassung für Europa. Martin Netteshe<strong>im</strong><br />
(Tübingen) stellte fest, dass der<br />
Verfassungsentwurf bei Fragen der<br />
Transparenz und der Einbeziehung<br />
Karl Albrecht Schachtschneider, Joach<strong>im</strong> Starbatty,<br />
Martin Netteshe<strong>im</strong> und Rolf Hasse<br />
2<br />
der Bürger auf<br />
dem richtigen<br />
Weg sei. Er kritisierte<br />
jedoch die<br />
Tendenz einer zunehmendenSozialstaatlichkeit<br />
Europas. Insgesamt<br />
sei der Entwurf<br />
ambivalent<br />
zu bewerten; die<br />
Richtung, in die<br />
Europa in Zukunft<br />
gehen solle, sei<br />
nicht ausreichend<br />
festgelegt.<br />
Rolf Hasse (Leipzig) bemängelte,<br />
dass der Prozess <strong>im</strong> Europäischen<br />
Konvent demokratischen Grundsätzen<br />
nicht entspreche. Zudem sei der<br />
Entwurf in wirtschaftspolitischer Hinsicht<br />
mehr als bedenklich, da er<br />
marktwirtschaftliche Strukturen in vielen<br />
Bereichen verhindere und Interventionismus<br />
propagiere. Eine Ablehnung<br />
des Entwurfs würde er nicht verurteilen.<br />
Auch Karl Albrecht Schachtschneider<br />
(Erlangen-Nürnberg) verwies<br />
auf die mangelnde demokratische<br />
Legit<strong>im</strong>ation des Konvents. Zudem<br />
fehlten dem Entwurf in vielen<br />
Bereichen die grundlegenden demokratischen<br />
Werte Freiheit, Gleichheit<br />
und Brüderlichkeit. Eine Verfassung<br />
Europas könne nur dann in Kraft treten,<br />
wenn nicht nur die Länder, sondern<br />
auch die Bürger Europas dieser<br />
Verfassung zugest<strong>im</strong>mt hätten. Zudem<br />
sei zu klären welche weiteren<br />
Länder der Union zukünftig beitreten<br />
dürften und über welche Werte und<br />
Eigenschaften sich Europa definiere.<br />
Professor Thomas<br />
Straubhaar<br />
(Präsident des<br />
HWWA) befasste<br />
sich <strong>im</strong> dritten<br />
Vortrag mit Chancen<br />
und Problemen<br />
der Zuwanderung.<br />
Er stellte<br />
fest, dass nicht<br />
die Zuwanderung,<br />
sondern die Integration<br />
das spezifisch<br />
deutsche<br />
Problem sei. Um dieses zu lösen,<br />
müsse sich die sich als Abstammungs-<br />
und Kulturnation definierende<br />
Gesellschaft jedoch einigen, was<br />
„deutsch“ bedeute. Die Zuwanderung<br />
könne das demographische Problem<br />
und damit das Finanzierungsproblem<br />
der Sozialversicherung bei inflexiblem<br />
Arbeitsmarkt nicht lösen. Eine<br />
Verlängerung der Arbeitszeit sei vorzuziehen.<br />
Zuwanderung und Integration<br />
gehören zusammen<br />
Zwar könne Zuwanderung zur Lösung<br />
ökonomischer Probleme – bei einem<br />
flexiblen Arbeitsmarkt – beitragen,<br />
diese Auswirkungen würden jedoch in<br />
der Regel überschätzt. Um die Frage<br />
der Migration vor diesem ökonomi-<br />
Thomas Straubhaar wägt ab<br />
schem Hintergrund sinnvoll zu lösen,<br />
müsse sich die Gesellschaft klar werden,<br />
wieviele Personen zuwandern<br />
dürften, wie lange diese bleiben dürften<br />
und – ganz zentral – wer zuwandern<br />
dürfe. Hierfür sei ein transparentes<br />
System, beispielsweise ein<br />
Punktesystem, zu entwerfen.<br />
Der nationalen Handlungsfähigkeit<br />
bei Globalisierung widmete sich Joach<strong>im</strong><br />
Starbatty <strong>im</strong> vierten Vortrag. Bei<br />
Globalisierung verlören nationale Regierungen<br />
ihr ordnungspolitisches<br />
Monopol. Das bedeute aber nicht,<br />
dass sie nicht mehr in der Lage sei-
Hans D. Barbier in Aktion<br />
en, ihre Probleme anzupacken. Sie<br />
müssten vielmehr, um dem Konkurrenzdruck<br />
standzuhalten, in die Produktivität<br />
ihrer Standorte investieren.<br />
Eine notwendige Voraussetzung<br />
hierfür sei Flexibilität.<br />
Jeder müsse in der Lage<br />
sein, die Antwort zu finden, die<br />
für ihn adäquat erscheine.<br />
Kapitalbildung für<br />
zukünftige Arbeitsplätze<br />
Zudem müssten die Anreize zur<br />
Kapitalbildung verbessert werden;<br />
Kapitalbildung sei nichts<br />
anderes als die Schaffung zukünftiger<br />
Arbeitsplätze. Steuerund<br />
Sozialgesetzgebung müssten<br />
so gestaltet werden, dass es<br />
sich – sowohl für Inländer als<br />
auch für Ausländer – wieder lohne,<br />
bei uns zu investieren.<br />
Im fünften Vortrag stellte Hans<br />
D. Barbier (Vorsitzender der<br />
Ludwig-Erhard-Stiftung) die Leitlinien<br />
für die Umstrukturierung<br />
von Sozialsystemen vor. Dass<br />
der Mensch und damit die Gesellschaft<br />
solidarisch sei, ja sein<br />
müsse, stehe außer Frage. Es<br />
gebe aber keinen Grund, den<br />
Preis der Solidarität mit denjenigen,<br />
die Ihren Lebensunterhalt<br />
nicht aus eigener Kraft bestreiten<br />
könnten, zu verhe<strong>im</strong>lichen.<br />
Dies schaffe undurchsichtige<br />
Strukturen und Ineffizienzen, die<br />
Schwäbisches Tagblatt, 10. Dezember 2004, Seite 23<br />
DEUTSCHLAND IM UMBAU<br />
Wir danken der Stiftung Landesbank Baden-Württemberg<br />
für die Unterstützung der Vortragsreihe <strong>Deutschland</strong> <strong>im</strong> <strong>Umbau</strong>.<br />
die Ausnutzung der Systeme begünstigten.<br />
Solidarität setze vielmehr voraus,<br />
dass die Gesellschaft diese wirtschaftlich<br />
auch leisten könne. Sozialsysteme,<br />
die das ökonomische Fundament<br />
untergrüben und die Substanz<br />
eines Landes angriffen, seien<br />
daher alles andere als sozial. Genau<br />
so seien die sozialen Sicherungssysteme<br />
in <strong>Deutschland</strong> jedoch konstruiert.<br />
Eine Umstrukturierung könne<br />
nur funktionieren, wenn die Systeme<br />
auf die Leistungsfähigkeit der<br />
Wirtschaft aufbauten und diese nicht<br />
konterkarierten. Effizienz werde nur<br />
dann erreicht, wenn die Gesellschaft<br />
auch wisse, was ihre Solidarität koste.<br />
Oswald Metzger analysierte <strong>im</strong> sechsten<br />
Vortrag den Arbeitsmarkt. Die<br />
zentrale Möglichkeit, die Arbeitslosigkeit<br />
in <strong>Deutschland</strong> substanziell zu<br />
verringern, sei die Trennung von<br />
Sozialversicherungssystem und Arbeitsmarkt<br />
(s. Zeitungsartikel unten).<br />
Die alternde Gesellschaft, das Gesundheits-<br />
und das Steuersystem<br />
und die Universität von morgen sind<br />
die Themen der kommenden Abende.<br />
Wenn wir in den Vorträgen gelernt<br />
haben, was getan werden muss, diskutieren<br />
wir in der Schlussveranstaltung<br />
die Bedingungen für die Umsetzung<br />
von Reformen in modernen Demokratien.<br />
3
ALEXANDER-RÜSTOW-PLAKETTE<br />
Verleihung der Alexander-Rüstow-Plakette<br />
an Hans Willgerodt<br />
Ordnungspolitisches Gewissen der <strong>Soziale</strong>n <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
Am 2. April 2004 feierte Hans Willgerodt<br />
sein goldenes Doktorjubiläum<br />
und zugleich seinen 80. Geburtstag.<br />
Er hatte dazu seine Kollegen, Schüler,<br />
Doktoranden und Mitstreiter eingeladen.<br />
Der Vorstand der Aktionsgemeischaft<br />
überraschte ihn mit der<br />
Verleihung der Alexander-Rüstow-<br />
Plakette. Professor Dr. Rolf Hasse,<br />
stellvertretender Vorsitzender der<br />
ASM, hielt die Laudatio auf seinen<br />
Lehrer, Doktor- und Habilitationsvater.<br />
Hasse interpretierte zunächst die<br />
„breite Anwesenheit ehemaliger Mitarbeiter<br />
als definitiven Gegenbeweis,<br />
dass der Slogan ‘Willgerodt –<br />
Studententod’ ein Vorurteil all derjenigen<br />
gewesen ist, die den Jubilar<br />
nicht kannten oder nicht kennengelernt<br />
haben. Meine Gespräche haben<br />
ergeben, dass sich die Assistenten<br />
am Lehrstuhl wohl gefühlt haben,<br />
auch oder weil so viel am Seminar gearbeitet<br />
wurde.“ Als Beispiel für die<br />
beiderseitige Bereitschaft, intensiv<br />
und lang andauernd wissenschaftlich<br />
zu arbeiten, führte er die vom Jubilar<br />
so titulierten „Nacht- und Nebel-Dissertationen“<br />
an. Solche Aktionen seien<br />
von Willgerodt mit der Drohung an<br />
die nächste Generation von Assistenten<br />
– „Den nächsten lasse ich hängen!“<br />
– abgeschlossen worden. Der<br />
Gehalt dieser Drohung und Schlussfolgerung<br />
sei wohl eher als virtuell<br />
denn als real zu verstehen gewesen.<br />
Willgerodt habe zwar einerseits als<br />
bekennender Welfe ein zwiespältiges<br />
Verhältnis zu Preußen, trage aber<br />
andererseits den Beinamen „der letzte<br />
Preuße“, da er viele preußische<br />
Tugenden lebe. Preußisch sei auch,<br />
dass er Ehrungen – vor allem öffentliche<br />
– ernsthaft abwiegele. Trotz des<br />
Wissens um diese Zurückhaltung<br />
habe der Vorstand der ASM die Ehrung<br />
gewagt. Der Kreis der Anwesen-<br />
4<br />
den sei geeignet, ihn als nichtöffentlich<br />
zu definieren, um gegen dieses<br />
Prinzip des Jubilars zu verstoßen.<br />
Joach<strong>im</strong> Starbatty nahm anschließend<br />
die Ehrung vor. Willgerodt sei<br />
„das wortmächtige Gewissen der <strong>Soziale</strong>n<br />
<strong>Marktwirtschaft</strong>“. Er bewundere<br />
den Mut, mit dem er seine Meinung<br />
„vor Fürstenthronen und ablehnender<br />
Mehrheit“ vertrete. Willgerodt<br />
sei zwar <strong>im</strong> Alter milder geworden,<br />
trotzdem sage er <strong>im</strong>mer, wenn er etwas<br />
ökonomisch Unsinniges höre<br />
oder lese: „Das ist kein böser Wille,<br />
das ist Bildungsnotstand.“ In diesem<br />
Sinne wolle auch die ASM wirken und<br />
den Bildungsnotstand eingrenzen.<br />
Hans Willgerodt<br />
Lieber Herr Starbatty, 5. April 2004<br />
es wird Zeit, dass ich mich bei Ihnen melde und dafür Dank sage, daß Sie am 2. April<br />
meiner Einladung nach Bonn gefolgt sind und vor allem dafür, daß Sie zur Überreichung<br />
der Alexander-Rüstow-Plakette solche herzlichen Worte gefunden haben. Bitte übermitteln<br />
Sie dem Vorstand der <strong>Aktionsgemeinschaft</strong> <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> meinen herzlichen<br />
Dank für diese Ehrung, an die ich niemals gedacht hätte, da meine öffentliche Wirksamkeit,<br />
soweit sie überhaupt besteht, sich keinesfalls mit derjenigen der von Ihnen so<br />
tatkräftig fortentwickelten <strong>Aktionsgemeinschaft</strong> messen kann. Ich habe Alexander<br />
Rüstow noch persönlich gekannt, mit seiner umfassenden Gelehrsamkeit auf klassischen<br />
Gebieten, ohne deren Bewahrung die <strong>im</strong> weitesten Sinne europäische Kultur zum Untergang<br />
verurteilt wäre. Das Ersetzen dieses Erbes durch technologische Fertigkeiten und<br />
<strong>im</strong> kurzfristig engsten Sinne ökonomische Ertragserwägungen würde auch solche Erträge<br />
auf längere Sicht gefährden. Warum aber auf der anderen Seite die Kulturbedeutung der<br />
wirtschaftlichen Ordnung nicht mit aristokratischem Hochmut als unwichtig beiseite<br />
geschoben werden kann, hat Rüstow mit unübertrefflicher Klarheit dargestellt. Ihm ging<br />
es um die freiheitliche Ordnung <strong>im</strong> ganzen. Mit ungewöhnlichem Temperament hat er sich<br />
deswegen für die <strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> eingesetzt, unterstützt von dem unvergessenen<br />
Wolfgang Frickhöffer. Vor allem in der Zeit Ludwig Erhards, der selbst auch auf den<br />
Tagungen der <strong>Aktionsgemeinschaft</strong> das Wort ergriffen hat, war die Wirksamkeit Rüstows<br />
unverkennbar. Dazu hat wesentlich beigetragen, dass er die von ihm so beherrschte<br />
Gelehrtensprache gemieden hat, wenn es darum ging, eine breitere Öffentlichkeit zu<br />
erreichen. Die Richtigkeit der Aussagen wurde damit nicht beeinträchtigt...<br />
Wir sind uns wohl einig darin, daß Max Weber falsch verstanden wird, wenn ihm die<br />
Ansicht unterschoben wird, ein Professor dürfte nicht für Werte eintreten. Man muß<br />
gewiß fordern, daß bei der Analyse von Sachverhalten außer Betracht bleibt, ob dem<br />
Untersucher das Ergebnis gefällt oder nicht. Wenn aber Freiheit und Menschenwürde als<br />
Ziele anerkannt werden, ist es eine auch wissenschaftliche Aufgabe, nachzuweisen, was<br />
diesen Zielen entspricht und was nicht....
ALEXANDER-RÜSTOW-PLAKETTE<br />
5
ALEXANDER-RÜSTOW-PLAKETTE<br />
Verleihung der Alexander-Rüstow-Plakette<br />
an Bernhard Vogel<br />
Am 21. Oktober ehrte die<br />
ASM Professor Dr. Bernhard<br />
Vogel, Ministerpräsident<br />
a. D. des Landes<br />
Rheinland-Pfalz und des<br />
Freistaates Thüringen, mit<br />
der Alexander-Rüstow-Plakette<br />
für seine Verdienste<br />
um die gelebte <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Marktwirtschaft</strong>. Die Feierstunde<br />
fand <strong>im</strong> Auditorium<br />
max<strong>im</strong>um der Universität<br />
Erfurt statt. Neben der Würdigung<br />
der Verdienste Bernhard<br />
Vogels bot sie Gelegenheit,<br />
die Entwicklung in<br />
den neuen Bundesländern<br />
kritisch in einer Podiumsdiskussion<br />
zu reflektieren.<br />
Dr. habil. Wolfgang Bergsdorf, Präsident<br />
der Universität, begrüßte die Gäste.<br />
Vogel sei in Erfurt nicht nur Landesvater<br />
gewesen, sondern – nach<br />
Trier und Kaiserslautern – auch<br />
Gründungsvater der hiesigen Universität.<br />
Vor zehn Jahren habe er sie als<br />
eine geisteswissenschaftliche Reformuniversität,<br />
die nach neuen Lösungen<br />
für Studium und Lehre und<br />
Verwaltung suchen solle, ins Leben<br />
gerufen. Es sei ihm daher eine ganz<br />
besondere Ehre, an diesem Tage<br />
Gastgeber sein zu dürfen. Mit dem<br />
Zitat von Goethe: “Dümmer ist nichts<br />
zu ertragen, als wenn Dumme sagen<br />
den Weisen: dass sie sich in großen<br />
Tagen sollten bescheidendlich erweisen”,<br />
gratulierte Bergsdorf Bernhard<br />
Vogel zur Verleihung der Alexander-<br />
Rüstow-Plakette.<br />
Die Thüringer Finanzministerin Birgit<br />
Diezel gratulierte Bernhard Vogel <strong>im</strong><br />
Namen der Landesregierung. Sie best<strong>im</strong>mte<br />
in Analogie zu den „Drei<br />
Wurzeln der Politik“ Dolf Sternbergers<br />
die „drei Wurzeln des Bernhard Vogel“:<br />
die liberale Wurzel Vogels – das<br />
6<br />
Der Freiheit verpflichtet – den Menschen zugetan<br />
Bernhard Vogel und Joach<strong>im</strong> Starbatty<br />
Bekenntnis zu demokratischer Ordnung<br />
und Bürgergesellschaft, die<br />
christliche Wurzel – der Glaube als<br />
zentrales Wesensmerkmal Vogels<br />
und seiner Politik – sowie die Prägung<br />
durch die christliche Soziallehre.<br />
Alle drei Wurzeln hätten den<br />
jungen Politiker Vogel zu einer Politik<br />
geführt, die alle Menschen als<br />
gleichberechtigte Bürger anerkenne.<br />
Vogel habe es <strong>im</strong>mer verstanden, die<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> nicht nur als<br />
Wirtschafts-, sondern vielmehr als<br />
Gesellschaftsordnung darzustellen<br />
und für das „Konzept der sozial vernetzten<br />
Freiheiten“ leidenschaftlich<br />
geworben. Damit habe er allen Menschen<br />
in Thüringen Hoffnung und Zuversicht<br />
vermittelt.<br />
Professor Dr. Dr. h.c. Joach<strong>im</strong> Starbatty<br />
hielt die Laudatio: Der Freiheit<br />
verpflichtet – den Menschen zugetan.<br />
Freiheit bedeute Verantwortung für<br />
den eigenen Lebensentwurf, verbunden<br />
mit der Gefahr zu scheitern. Diese<br />
Angst treibe die Menschen in die<br />
sozialen Sicherungssysteme. Sie<br />
wollten abgesichert sein, ohne aber<br />
zu wissen, was das koste. Es sei<br />
Aufgabe der ASM, auf den Zusammenhang<br />
zwischen Freiheit und Ver-<br />
antwortung und zwischen<br />
kollektiver Sicherheit und<br />
Abhnahme persönlicher<br />
Freiheit hinzuweisen. Bernhard<br />
Vogel habe diese Interdependenz<br />
bei seinen Lehrern<br />
Alfred Weber, Alexander<br />
Rüstow und Dolf Sternberger<br />
– Vertretern der persönlichen<br />
und politischen<br />
Freiheit – gelernt. Was er<br />
nicht lernen musste, was er<br />
aus dem Elternhaus mitbekommen<br />
habe, sei, den<br />
Menschen zugetan zu sein.<br />
Obwohl Politik bisweilen<br />
hart machen könne, sei<br />
Bernhard Vogel mit der Zeit <strong>im</strong>mer<br />
verständnisvoller geworden.<br />
Professor Dr. Rüdiger Pohl, Präsident<br />
des Wirtschaftsforschungsinstitus<br />
Halle eröffnete die Podiumsdiskussion<br />
mit einem Impulsreferat.<br />
“Über die Zukunft der ostdeutschen<br />
Länder“. Unter der Leitung von Dr.<br />
Karen Horn, Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung, diskutierten erstrangige Experten<br />
und zugleich politisch Verantwortliche:<br />
Bundesminister a. D. Dr.<br />
Klaus von Dohnanyi, Professor Dr.<br />
Karlheinz Paqué, Finanzminister des<br />
Landes Sachsen-Anhalt, und Professor<br />
Dr. Gerhard Wegner, Uni Erfurt.<br />
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion<br />
dankte Bernhard Vogel in einer<br />
bewegenden Rede für die Ehrung. Die<br />
Feier, die außerordentlich informative<br />
Podiumsdiskussion und die Beiträge<br />
der anderen Redner zeigten,<br />
dass die Idee der <strong>Soziale</strong>n <strong>Marktwirtschaft</strong>,<br />
dass das Lebenswerk Ludwig<br />
Erhards, aber auch Alexander<br />
Rüstows sowie die Initiative der ASM<br />
voll lebendig seien und für die Zukunft<br />
etwas auszusagen hätten.<br />
(Die Veranstaltung wird in einem gesonderten<br />
Bulletin dokumentiert)
ALEXANDER-RÜSTOW-PLAKETTE<br />
7
Eduard Schmäing<br />
VERDIENSTMEDAILLE<br />
Verleihung der<br />
Alfred-Müller-Armack-Verdienstmedaille<br />
an Professor Dr. Eduard Schmäing<br />
Vor der Verleihung am 28. April 2004<br />
in der IHK für die Pfalz in Ludwigshafen<br />
hatte Professor Schmäing <strong>im</strong><br />
Rahmen des 28. Franz-Böhm-Vortrags<br />
(Thesen zur Ordnungspolitik)<br />
erläutert, wieso die Reformbemühungen<br />
der rot-grünen Koalition wenig<br />
erfolgreich seien. Die Bevölkerung<br />
gewinne den Eindruck, dass<br />
ständig reformiert werde und die betroffenen<br />
Bürger erhebliche Kosten<br />
zu tragen hätten, ohne dass sich die<br />
Entwicklung grundlegend zum Besseren<br />
wandle.<br />
Professor Schmäing erklärte das<br />
Reformdilemma damit, dass die bestehenden<br />
Sozialleistungssysteme<br />
abgeschlossene Regelkreise ohne<br />
eingebaute Korrektur seien und dass<br />
die beteiligten Bürger zu wenig Überblick<br />
und Anreiz hätten, durch eigene<br />
Anstrengungen zu deren Gesundung<br />
beizutragen. Bei geschlossenen<br />
Regelkreisen verstärkten aber<br />
punktuelle Eingriffe, wie sie derzeit<br />
Kanzler Schröder vornehme, bloß die<br />
Komplexität und würden damit den<br />
8<br />
Dieter Spiess, Eduard Schmäing, Joach<strong>im</strong> Starbatty und Erich Lange<br />
Frust der Bürger noch erhöhen. Solange<br />
sich die Politik nicht zum Übergang<br />
zu offenen Regelsysteme bereitfinde<br />
– Systeme, bei denen die<br />
Beteiligten über Rückkopplungsprozesse<br />
Fehlentwicklungen<br />
durch eigene Anstrengungen zu<br />
korrigieren versuchen –, werde<br />
jede Reform scheitern. Als Beispiel<br />
nannte er die PKW-Versicherung,<br />
zu der jeder PKW-Fahrer verpflichtet<br />
sei; durch korrektes Fahrverhalten<br />
trage er zu einer Minderung<br />
der Schadensfälle bei. Wenn dagegen<br />
für eigenes Fehlverhalten<br />
nicht der Verursacher, sondern die<br />
Gesamtheit der Versicherten hafte,<br />
würde jedes Sozialleistungssystem<br />
über kurz oder lang gegen<br />
die Wand gefahren.<br />
Der Vorsitzende des Vorstands<br />
der ASM, Professor Dr. Dr. h.c.<br />
Joach<strong>im</strong> Starbatty, dankte Eduard<br />
Schmäing für diesen erhellenden<br />
Vortrag, der auf wissenschaftlicher<br />
Basis konkrete Vorschläge zur Behandlung<br />
der deutschen Misere mache.<br />
Professor Schmäing habe als<br />
langjähriger Vorsitzender des ASM-<br />
Arbeitskreises Kurpfalz ein außerordentliches<br />
staatsbürgerliches Engagement<br />
bewiesen sowie durch eigene<br />
Vorträge und von ihm organisierte<br />
Vorträge und Podiumsdiskussionen<br />
zur Aufklärung der Bürger und zur<br />
Versachlichung der politischen Diskussion<br />
beigetragen. Eine Vortragsreihe<br />
wie die der Franz-Böhm-Vorträge<br />
suche in <strong>Deutschland</strong> ihresgleichen.<br />
Es sei bewundernswert, was<br />
Professor Schmäing für den Raum<br />
Mannhe<strong>im</strong>/Ludwigshafen bewirkt<br />
habe. Der Vorstand der ASM habe<br />
daraufhin beschlossen, eigens für<br />
diese Leistung die Alfred-Müller-<br />
Armack-Verdienstmedaille in Silber<br />
zu schaffen. Professor Schmäing sei<br />
der erste Preisträger. Das Auditorium<br />
würdigte und dankte Professor<br />
Schmäing durch langen, intensiven<br />
Beifall.
VERDIENSTMEDAILLE<br />
9
FRANZ-BÖHM-VORTRÄGE<br />
China am Scheideweg –<br />
Rückblick und Ausblick<br />
Dr. Volker Langbein – langjähriger<br />
Vice President der BASF East Asia,<br />
Hong Kong – analysierte die wirtschaftliche<br />
Situation Chinas mit Ihren<br />
Chancen, überging aber nicht die damit<br />
auch verbundenen Risiken.<br />
Wer China nicht kenne, verknüpfe mit<br />
dem Land automatisch auf fast alle<br />
verteilte Armut, graue Gebäude und<br />
fehlende persönliche Freiheiten nebst<br />
zugehöriger Bespitzelung. Dies treffe<br />
teilweise noch zu, es habe sich in<br />
den vergangenen Jahren aber Grundlegendes<br />
verändert. China sei ein<br />
staatskapitalistisches Land mit einer<br />
autokratischen Führung, die sich der<br />
Kommunistischen Partei Chinas als<br />
Mittel zum Machterhalt für eine sich<br />
selbst erneuernde Führungsclique<br />
bediene. Genau das begrenze die<br />
persönlichen Freiheiten der Bürger.<br />
Das heutige China müsse man mit<br />
dem völlig verarmten und in seinen<br />
Strukturen zerstörten China nach<br />
Mao Zedongs Tod <strong>im</strong> Jahr 1976 vergleichen.<br />
Die 1979 begonnenen wirtschaftlichen<br />
Reformen hätten China<br />
zu dem gemacht, was es heute sei.<br />
Natürlich gebe es noch viele Schwierigkeiten.<br />
Bürokratie und Korruption<br />
seien überall noch gewaltige Hemmnisse<br />
und von einer funktionierenden<br />
Durchsetzung der Gesetze durch unabhängige<br />
Gerichte sei das Land<br />
noch weit entfernt. Dem einzelnen<br />
Chinesen sei es jedoch zumindest in<br />
den letzen beiden Jahrhunderten wirtschaftlich<br />
noch nie so gut gegangen<br />
wie heute.<br />
Das größte Problem Chinas sei die<br />
große Bevölkerung. Von den annähernd<br />
1,3 Mrd. Chinesen lebten etwa<br />
400 Mio. <strong>im</strong> sogenannten “städtisch-<br />
10<br />
Franz-Böhm-Vorträge<br />
des Arbeitskreises Kurpfalz<br />
Volker Langbein<br />
industriellen Sektor”, in dem nach der<br />
Schließung oder Verkleinerung der<br />
Staatsunternehmen inzwischen eine<br />
Arbeitslosigkeit von offiziell 10 %, in<br />
Wirklichkeit aber eher 25 % zu verzeichnen<br />
sei. Die übrigen 900 Mio.<br />
Chinesen lebten auf dem Land. Da<br />
China aber seine Landwirtschaft leicht<br />
mit etwa 100 Mio. Menschen betreiben<br />
könne, habe die heutige Wirtschaft<br />
in China für etwa 800 bis 900<br />
Mio. Menschen keine Verwendung.<br />
Dies führe – erst recht vor dem Hintergrund<br />
noch nicht vorhandener<br />
Sozialsysteme – zu enormem sozialen<br />
Zündstoff.<br />
Der Beitritt zur WTO Ende 2001 berge<br />
für China große Chancen <strong>im</strong> internationalen<br />
Bereich, aber auch interne<br />
Risiken. Ziel sei es, durch weitere<br />
weltwirtschaftliche Öffnung den Zufluss<br />
ausländischer Investitionen zu<br />
sichern und intern durch verstärkten<br />
Wettbewerb die notwendige Reform<br />
der Staatsunternehmen zu beschleunigen.<br />
China sei bereits jetzt nach<br />
Japan die stärkste Wirtschaftsmacht<br />
Asiens und der größte Adressat aus-<br />
ländischer Direktinvestitionen in<br />
Asien. Das bloße Streben nach<br />
Wachstum müsse jedoch in eine<br />
Nachhaltigkeitspolitik übergehen, einerseits,<br />
um die Ressourcen Chinas<br />
zu schonen, aber auch um die verstärkten<br />
Diskrepanzen zwischen<br />
dem reichen Osten und dem armen<br />
Westen und die daraus folgenden<br />
sozialen Spannungen abzubauen.<br />
Einige Gedanken zur Stromenergiepolitik<br />
in <strong>Deutschland</strong><br />
Professor Dr.-Ing. Peter Martin, langjähriger<br />
Leiter des Bereichs Kraftwerke<br />
bei ALSTOM, vermittelte in seinem<br />
Vortrag einen Überblick über die<br />
Lage auf dem Energiesektor in<br />
<strong>Deutschland</strong>. Der Bruttostromverbrauch<br />
habe sich in den vergangenen<br />
dreißig Jahren mehr als verdoppelt.<br />
Der heute verbrauchte Strom würde<br />
zu ca. einem Drittel durch Kernkraftwerke<br />
und zu jeweils ca. einem Viertel<br />
von Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken<br />
erzeugt. Ca. zehn Prozent<br />
der Stromenergie entstünden<br />
durch die Nutzung von Erdgas, vier<br />
Prozent durch Wasserkraft, drei Prozent<br />
durch Wind, 0,8 Prozent durch<br />
Biomasse und nur 0,05 Prozent durch<br />
den Einsatz von Photovoltaik, d.h. die<br />
Nutzung von Sonnenenergie.<br />
Mit Kosten von ca. drei Cent pro KWh<br />
Stromenergie seien Kernkraft-, Braunkohle-<br />
und Steinkohlekraftwerke am<br />
günstigsten. Die Gewinnung regenerativer<br />
Energie durch Wasser und<br />
Biomasse sei mit gut drei Cent pro<br />
KWh ebenfalls günstig. Windenergie<br />
koste jedoch neun Cent und Strom<br />
aus Photovoltaik-Anlagen sogar 50<br />
Cent pro KWh. Durch den aktuellen<br />
Mix ergebe sich rechnerisch ein<br />
durchschnittlicher Erzeugungspreis<br />
von gut drei Cent pro KWh bzw. 15
Mrd. Euro Stromerzeugungskosten<br />
pro Jahr in <strong>Deutschland</strong>. Würde man<br />
die energiepolitischen Pläne der rotgrünen<br />
Regierung vollständig umsetzen,<br />
werde der Anteil des aus Kernkraft<br />
erzeugten Stroms wegfallen und<br />
der Anteil der Steinkohle sich halbieren.<br />
Um dies zu kompensieren<br />
müssten die Anteile von Erdgas auf<br />
15, Wind auf 25, Sonne auf zehn und<br />
Biomasse auf fünf Prozent steigen.<br />
Dieser Energiemix ergäbe jedoch Gesamtkosten<br />
für die Stromerzeugung in<br />
<strong>Deutschland</strong> von 45 Mrd. Euro (eine<br />
Verdreifachung!) und rechnerisch einen<br />
Preis von neun Cent pro KWh.<br />
Allein die Zahlen belegten bereits,<br />
dass die bisher verfolgte Energiepolitik<br />
nicht durchzusetzen sei. Kernenergie<br />
durch Windenergie zu ersetzen<br />
sei auch deswegen utopisch, weil die<br />
von Windkraftanlagen bereitgestellte<br />
Energie aufgrund der saisonalen und<br />
tageszeitlichen Schwankungen keine<br />
ausreichende Grundlast liefern könne.<br />
Peter Martin<br />
Wenn man den Ausstoß an Kohlenstoffdioxid<br />
verringern wolle, stelle<br />
eine Verlängerung der Laufzeiten der<br />
Kernkraftwerke die <strong>im</strong> Vergleich zur<br />
Wirkung günstigste Lösung dar. Begleitend<br />
dürfe sich <strong>Deutschland</strong> dann<br />
aber nicht länger aus der Forschung<br />
<strong>im</strong> Bereich der Transmutation (Vermeidung<br />
von Endlagerung durch Umwandlung<br />
von radioaktiver in nicht radioaktive<br />
Materie) ausklinken. Zudem<br />
müsse die Forschung <strong>im</strong> Bereich der<br />
<strong>im</strong> Vergleich zu herkömmlichen Kernkraftwerken<br />
wesentlich sichereren<br />
Kugelbettreaktoren intensiviert und<br />
schließlich auch deren Einsatz betrieben<br />
werden.<br />
Insgesamt bleibe festzuhalten, dass<br />
in <strong>Deutschland</strong> Sonnen- und Windanlagen<br />
nur durch Dauersubventionen<br />
(unwirtschaftliche Einspeisevergütungen)<br />
lebensfähig seien und auch der<br />
Rückgriff auf fossile Energieträger<br />
keine Lösung des Strom- und Energieproblems<br />
darstellen könne. Zielführend<br />
könne nur eine Energiepolitik<br />
sein, die die bisherigen Wege der<br />
Stromerzeugung in ein sinnvolles Verhältnis<br />
zueinander setze und keine<br />
ideologisch begründeten Versprechen<br />
mache, die weder technisch<br />
noch wirtschaftlich umsetzbar seien.<br />
Die Wirtschaftsverfassung –<br />
mehr Bürgerbeteiligung<br />
Ein System der Unselbständigkeit<br />
und der Subventionen sei zunächst<br />
bequem: Aus fremder Leute Tasche<br />
könne man gut leben, solange die<br />
Gesamtrechnung der Nation aufgehe.<br />
Diese Gesamtrechnung gehe aber –<br />
und das bereits seit sehr langer Zeit<br />
– nicht mehr auf, erklärte Herman Josef<br />
Werhahn.<br />
Die Gelehrten Altasiens verwiesen<br />
seit vielen Jahrtausenden auf Yin und<br />
Yang, die Antike auf Logos und Sophia,<br />
auf die Vita activa und die Vita<br />
contemplativa, die Kaufleute auf Aktiva<br />
und Passiva, Tatkraft und Besonnenheit<br />
und auf Angebot und Nachfrage.<br />
In der Politik unterscheide man<br />
Exekutive und Legislative – ein Kernstück<br />
unserer Verfassung.<br />
Solche “Charaktergespanne” müssten<br />
auch in der Wirtschafspolitik gelten.<br />
Das Charaktergespann aus Teilnehmern<br />
und Teilhabern – das Miteigentum<br />
der einzelnen Bürger an Produktionsmitteln<br />
– sei schon für Adenauer<br />
und Erhard ein hohes Ziel gewesen.<br />
Die Teilhabe der Gesellschaft<br />
versacke jedoch in der sogenannten<br />
Mitbest<strong>im</strong>mung für Experten und<br />
FRANZ-BÖHM-VORTRÄGE<br />
Hermann Josef Werhahn<br />
Funktionäre. Und die Charaktergespanne<br />
von Angebot und Nachfrage,<br />
von Teilnehmern und Teilhabern gerieten<br />
in Vergessenheit. Das Gleichgewicht<br />
zwischen Aufsichtsräten und<br />
Vorständen werde untergraben. Die<br />
Folgen seien verheerend: Das Fremdkapital,<br />
also Schulden, dominiere die<br />
Wirtschaft. Mittellose Starter, Jungunternehmer,<br />
geniale Forscher und<br />
Hoffnungsträger erreichten kaum den<br />
Status der Kreditwürdigkeit, weil das<br />
geltende Steuersystem die Bildung<br />
von Eigenkapital verhindere. Gewerkschaften,<br />
Banken und Wirtschaftsverbände<br />
hätten die Kapitalbewirtschaftung<br />
vermachtet, Wirtschaftsminister<br />
und Parlamente hätten die<br />
Macht der Ordnungspolitik und die<br />
Verantwortung der Steuerpolitik verkannt<br />
und die Sinnkompetenz der<br />
Teilhaber werde unterbewertet und<br />
benachteiligt.<br />
Nur eine Ordnungspolitik <strong>im</strong> Sinne<br />
von Erhard, eine verantwortungsbewusste<br />
Steuerpolitik sowie eine<br />
Politik zugunsten von Firmen als Gesellschaften<br />
für Gründer und Miteigentümer<br />
könnten aus dieser Situation<br />
herausführen. Die Balance von<br />
Aktiva und Passiva müsse auch für<br />
das Verhältnis von Kapitalnehmern<br />
und Kapitalgebern gewährleistet sein.<br />
Kluge Köpfe müssten auf beiden Seiten<br />
zusammenwirken, um dem Charaktergespann<br />
Richtigkeit und Einsicht<br />
Geltung zu verleihen.<br />
11
DIALOGSEMINAR<br />
12<br />
8. Studentisches Dialogseminar<br />
Kann man Kl<strong>im</strong>awandel kaufen?<br />
Die Vereinbarkeit globaler Umweltschutzabkommen mit <strong>Soziale</strong>r <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
in <strong>Deutschland</strong> und Russland<br />
Unter dem Titel „Kann man Kl<strong>im</strong>awandel<br />
kaufen?“ fand am 27. November<br />
das 8. studentische<br />
Dialogseminar der ASM und des<br />
dialog e.V. – Vereinigung deutscher<br />
und russischer Ökonomen –<br />
statt.<br />
Dieter Kern<br />
Prorektor Professor Dr. Dieter<br />
Kern begrüßte die Teilnehmer des 8.<br />
Dialogseminars an der Universität<br />
Tübingen. Diese Dialogseminare seien<br />
zu einer schönen Tradition geworden.<br />
Mit den beiden Vereinen gebe es<br />
in Tübingen zwei sehr aktive Gruppen,<br />
die mit ihren Seminaren den Studierenden<br />
eine Plattform böten, Einblicke<br />
in unterschiedliche Tätigkeitsfelder<br />
zu bekommen, von den Erfahrungen<br />
der Referenten zu lernen,<br />
Kontakte zu knüpfen sowie Ideen<br />
auszutauschen. Kern dankte den<br />
Verantwortlichen für die Organisation<br />
des Seminars und wünschte allen<br />
Teilnehmern viel Spaß.<br />
Professor Dr. Dr. h.c. Joach<strong>im</strong><br />
Starbatty begrüßte die Teilnehmer<br />
<strong>im</strong> Namen der ASM. Er bedankte sich<br />
be<strong>im</strong> Geschäftsführer des dialog e.V.,<br />
Michael Langenfeld, für die federführende<br />
Organisation sowie bei den beiden<br />
Geschäftsführern der ASM, Jens<br />
Brammen und Andreas Schneider.<br />
Der Umweltschutz sei ein zukunftsweisendes<br />
Thema. „Es ist leicht, Umweltschutz<br />
zu fordern, aber schwer,<br />
ihn zu praktizieren.“ Umweltschutz<br />
sei ein Kollektivgut, das nicht aus<br />
einzelwirtschaftlicher Aktivität erwartet<br />
werden könne. So bliebe<br />
nur der sanktionsbewehrte<br />
Regelmechanismus.<br />
David von Lingen, Vorsitzender<br />
des Vorstandes des<br />
dialog e.V., betonte die gute<br />
Zusammenarbeit von ASM<br />
und dialog e.V. sowie die<br />
thematische Ausrichtung<br />
an <strong>Deutschland</strong> und Russland.<br />
Es sei weiterhin nötig,<br />
die vielfach zu schlechte<br />
Presse über Russland zu<br />
revidieren, Gemeinsamkeiten<br />
hervorzuheben und die<br />
Chancen der deutsch-russischen<br />
Zusammenarbeit aufzuzeigen.<br />
Dies praktizieren ASM und dialog gleichermaßen<br />
mit Vortrags- und Seminarveranstaltungen<br />
in <strong>Deutschland</strong><br />
und Russland.<br />
Ralf Schmidt<br />
Ralf Schmidt, Mitgründer und -eigentümer<br />
der Firma Suntech GbR stellte<br />
die Chancen verschiedener Umweltschutzmaßnahmen<br />
dar, die diese für<br />
die Verringerung der Umweltbelastung<br />
und zur Erzielung unternehmerischer<br />
Gewinne böten. Er und seine<br />
drei Mitstreiter hätten sich damals<br />
zum Ziel gesetzt, private – umweltbewusste<br />
– Verhaltensweisen wirtschaftlich<br />
umzusetzen. Suntech biete<br />
ein breites Spektrum des aktiven<br />
Umweltschutzes. Als zweites Standbein<br />
diene ein Büro zur Planung von<br />
Ultra-Niedrig-Energiehäusern mit einem<br />
jährlichen Ölverbrauch von ca.<br />
einem Liter pro Quadratmeter.<br />
Für Solarzellen ergebe sich eine<br />
Ökobilanz aus einem energetischen<br />
Rücklauf in ein bis vier Jahren bei einer<br />
Nutzung von 25 Jahren. Saldo: 20<br />
Jahre „Erntezeit“. Die Ökotoxizität liefere<br />
in 25 Jahren einen „Gewinn“ von<br />
15 Jahren. Die Pelletheizung, in der<br />
Holz verheizt wird, sei ein CO 2 -neutrales<br />
Verfahren. Bei der Verbrennung<br />
würde genau soviel CO 2 freigesetzt,<br />
wie der Baum zu Lebzeiten absorbiert<br />
habe. Die Vorteile lägen in einem<br />
hohen Wirkungsgrad, einer guten<br />
Verfügbarkeit von Holz und stabilen<br />
Brennstoffpreisen. Außerdem habe<br />
die Holzverbrennung positive Effekte<br />
für die Aufforstung.<br />
Regenwassernutzung sei früher eine<br />
gute Möglichkeit für Haushalte gewesen,<br />
Kosten zu sparen. Heute werde<br />
Regenwasser aber mit Abwassergebühren<br />
belegt. Es bleibe aber das<br />
gute Gefühl, die Umwelt zu schonen<br />
und „da wird selbst Regenwetter zur<br />
Freude“. Durch die Warmwasseraufbereitung<br />
mit Sonnenkollektoren könne<br />
eine Familie mit zwei Kindern jedes<br />
Jahr gut eine Tonne CO 2 einsparen.<br />
Eine Amortisation sei nicht gegeben.<br />
Anders bei der Photovoltaik: Das
Projekt einer Großanlage bei Tübingen<br />
amortisiere sich nach spätestens<br />
15 Jahren und werfe danach<br />
Gewinne ab.<br />
Aus Unternehmersicht sei v.a. die<br />
mangelnde Beleihbarkeit von Vorprodukten<br />
problematisch. Die Bank sei<br />
oft nicht in der Lage, den Wert und die<br />
Verwertbarkeit z.B. von Solarzellen<br />
einzuschätzen und daraufhin Kredite<br />
zu vergeben. Jedoch steige die Akzeptanz<br />
in der Bevölkerung an. Hauptkunden<br />
seien Familien mit mittlerem<br />
Einkommen, die nicht in der Stadt<br />
wohnten. Die Konkurrenz unter den<br />
Anbietern nehme aber ebenso zu.<br />
Boris Palmer, umweltpolitischer<br />
Sprecher der Landtagsfraktion von<br />
Bündnis 90/Die Grünen in Stuttgart<br />
und Absolvent der Uni Tübingen, referierte<br />
zu den umweltpolitischen<br />
Möglichkeiten <strong>im</strong> Raum Tübingen.<br />
Dazu unterschied er, was die Menschen<br />
und was Gebietskörperschaften<br />
bewirken könnten. Insgesamt –<br />
so Palmer – werde zu wenig bewegt.<br />
Die finanzielle Situation der Kommunen<br />
sei dafür sicherlich mitverantwortlich.<br />
Großes Einsparpotential von Emissionen<br />
sieht Palmer be<strong>im</strong> Energieverbrauch<br />
in Altbauten. Ebenso sei dringend,<br />
dem stetigen Ausbau der<br />
Siedlungsfläche zu begegnen. Dieser<br />
Bereich zeige die stark begrenzten<br />
Restriktionsmöglichkeiten des Lan-<br />
Boris Palmer<br />
desrechts für die Kommunalpolitik.<br />
Bei der Mülltrennung und be<strong>im</strong> Gelben<br />
Sack gebe es weiteren Handlungsbedarf.<br />
Auch müsse Müll auf<br />
Schienen zur Verbrennung transportiert<br />
werden. Es gebe keinen Termindruck,<br />
Verderblichkeit oder andere<br />
Gründe für den Transport auf der Straße.<br />
Zur Energiegewinnung betrieben die<br />
Stadtwerke Tübingen Blockheizkraftwerke<br />
(60%) und Wasserkraftwerke<br />
(40%). Die Diskussion um Windenergie<br />
sei in Baden-Württemberg<br />
zugunsten des Landschaftsschutzes<br />
ideologisiert. Bundesweit würden<br />
13.000 Windräder die gleiche Leistung<br />
wie fünf Atomkraftwerke erbringen.<br />
Niedersachsen decke mehr als<br />
20% seines Energiebedarfs über<br />
Wind, Baden-Württemberg nicht einmal<br />
0,3%, sei dafür aber bei der Nutzung<br />
von Solarenergie weit vorne.<br />
Wasserkraft als noch größte regenerative<br />
Energiequelle sei wegen<br />
der Gefährdung der Durchlässigkeit<br />
der Gewässer ausgereizt; sie stehe<br />
kurz vor der Ablösung. Energie aus<br />
Biomasse hingegen sei ein sehr<br />
wachstumsträchtiger Bereich. Durch<br />
Fermentierung landwirtschaftlicher<br />
Abfälle würden verbrennbare Gase<br />
gewonnen. Geotermienutzung sei v.a.<br />
wegen der hohen Anfangsinvestitionen<br />
trotz Grundlastfähigkeit und geologischer<br />
Gegenbenheiten noch nicht<br />
realisierbar.<br />
Professor Dr. Dieter Cansier, Uni<br />
Tübingen, stellte die Kyoto-Vereinbarungen<br />
der Selbstverpflichtung einiger<br />
Industrienationen zur langfristigen<br />
Senkung der Treibhausgasemissionen<br />
dar. Die Ratifizierung durch<br />
Russland begründe nun das Inkrafttreten<br />
des Vertrages. Weltweit solle<br />
der CO 2 -Ausstoß um fünf Prozent<br />
gegenüber 1990 reduziert werden.<br />
Eine Studie des DIW aus dem Jahre<br />
2003 1 gebe die bis 2001 erreichten<br />
Reduktionsmengen an. Viele Länder<br />
schienen ihre ehrgeizigen Zeile nicht<br />
zu erreichen. Die Übererfüllung durch<br />
die Ukraine und Russland von gut<br />
50% und knapp 40% zeige zudem<br />
eine allgemeine Fehlkalkulation bei<br />
DIALOGSEMINAR<br />
13<br />
Dieter Cansier<br />
den Zielen. Diese berge die Gefahr<br />
der erneuten Ausweitung der CO 2 -<br />
Emissionen. Eine internationale<br />
Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen<br />
sei mangels geeigneter Gerichte oder<br />
eines Weltstaates nicht gegeben.<br />
Ab 2005 werde ein EU-weiter Handel<br />
mit Emissionszertifikaten zwischen<br />
Firmen eingeführt. Dazu wurden jeweils<br />
national Zertifikate an Emittenten<br />
vergeben, in <strong>Deutschland</strong> an<br />
2.400 Firmen. Basis für die Zuteilung<br />
von Emissionsrechten war der durchschnittliche<br />
Ausstoß in den Jahren<br />
2000 bis 2002. Emissionsrechtehandel<br />
mache ökonomisch nur Sinn,<br />
wenn man bei den Rechten Knappheit<br />
schaffe. Diese zwinge dann die Firmen<br />
zur CO 2 -Reduktion. Die Rechte<br />
wurden aber reichlich vergeben, was<br />
den Handel und die Anreize zur CO 2 -<br />
Reduktion begrenze.<br />
Weltweit sehe die Kl<strong>im</strong>arahmenkonvention<br />
eine Reduktion bis 2050<br />
von fünfzig Prozent vor. Sie sei nicht<br />
ohne China, Indien und die USA, den<br />
weltweit größten CO 2 -Emittenten, zu<br />
realisieren. Cansier hoffe, dass man<br />
weltweit weiterhin zuerst Maßnahmen<br />
zur Reduktion der Treibhausgase<br />
und danach erst Maßnahmen<br />
zum Umgang mit den Konsequenzen<br />
eines Kl<strong>im</strong>awandels ergreife. Die entscheidenden<br />
Anstrengungen stünden<br />
noch bevor.<br />
1 Vgl. DIW-Wochenbericht 39/2003, S. 577 ff.
AKTIVITÄTEN<br />
14<br />
Aktivitäten der ASM <strong>im</strong> Jahr 2004<br />
Wir danken der Heinz Nixdorf Stiftung und ihrem Vorsitzenden<br />
für die inhaltliche und finanzielle Unterstützung unserer Aktivitäten.<br />
2. April<br />
Verleihung der Alexander-Rüstow-Plakette an<br />
Hans Willgerodt in Bonn<br />
28. April<br />
Verleihung der Alfred-Müller-Armack-Verdienstmedaille<br />
der ASM an Eduard Schmäing<br />
in der IHK für die Pfalz in Ludwigshafen<br />
21. Oktober<br />
Verleihung der Alexander-Rüstow-Plakette an<br />
Bernhard Vogel <strong>im</strong> Aud<strong>im</strong>ax der Universität<br />
Erfurt<br />
27. November<br />
8. studentisches Dialogseminar in Zusammenarbeit<br />
mit dialog e.V. – Vereinigung<br />
deutscher und russischer Ökonomen: Kann<br />
man Kl<strong>im</strong>awandel kaufen? Die Vereinbarkeit<br />
globaler Umweltschutzabkommen mit <strong>Soziale</strong>r<br />
<strong>Marktwirtschaft</strong> in <strong>Deutschland</strong> und<br />
Russland.<br />
30. November<br />
Vorstandssitzung in den Räumen der Dresdner<br />
Bank in Frankfurt am Main<br />
9. Dezember<br />
Ordentliche Mitgliederversammlung in den<br />
Räumen der ASM in Tübingen<br />
Ringvorlesung – <strong>Deutschland</strong> <strong>im</strong> <strong>Umbau</strong><br />
3. November<br />
Prof. Dr. Gesine Schwan<br />
Die Bedeutung des Vertrauens für die Politik<br />
10. November<br />
Podium mit Prof. Dr. Rolf Hasse, Prof. Dr.<br />
Martin Netteshe<strong>im</strong>, Prof. Dr. Karl Albrecht<br />
Schachtschneider, Prof. Dr. Dr. h.c. Joach<strong>im</strong><br />
Starbatty (Moderation)<br />
Zur Finalität der Europäischen Union<br />
17. November<br />
Prof. Dr. Thomas Straubhaar<br />
Welche Probleme löst die Zuwanderung,<br />
welche neuen schafft sie?<br />
24. November<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Joach<strong>im</strong> Starbatty<br />
Nationale Handlungsfähigkeit bei<br />
Globalisierung<br />
1. Dezember<br />
Dr. Hans D. Barbier<br />
Gesellschaftliche Solidarität und ökonomische<br />
Effizienz – Leitlinien für die Umstrukturierung<br />
von Sozialsystemen<br />
8. Dezember<br />
Oswald Metzger<br />
Der Arbeitsmarkt – Was machen wir falsch,<br />
was machen die anderen besser?<br />
Arbeitskreis Kurpfalz<br />
19. Februar<br />
27. Franz-Böhm-Vortrag: Reform der Gesetzlichen<br />
Krankenversicherung<br />
Prof. Dr. Eduard Schmäing<br />
28. April<br />
28. Franz-Böhm-Vortrag: Thesen zur Wirtschaftsordnung<br />
Prof. Dr. Eduard Schmäing<br />
6. Mai<br />
29. Franz-Böhm-Vortrag: China am Scheideweg<br />
– Rückblick und Ausblick<br />
Dr. Volker Langbein<br />
12. August<br />
30. Franz-Böhm-Vortrag: Einige Gedanken<br />
zur Stromenergiepolitik in <strong>Deutschland</strong><br />
Prof. Dr.-Ing. Peter Martin<br />
25. November<br />
31. Franz-Böhm-Vortrag: Die Wirtschaftsverfassung<br />
Europas<br />
Hermann Josef Werhahn<br />
MACRO-Planspiel<br />
In zahlreichen Fortbildungen haben die Mitarbeiter<br />
der ASM Lehrerinnen und Lehrer und<br />
Referendarinnen und Referendare mit MACRO<br />
vertraut gemacht und die Grundlagen für den<br />
Einsatz des Planspiels in Schulen gelegt.<br />
Zudem hat die ASM <strong>im</strong> Laufe des Jahres in<br />
neun Schulklassen (über 200 Schülerinnen<br />
und Schüler) die Durchführung des Planspiels<br />
aktiv unterstützt. Weitere Informationen finden<br />
Sie <strong>im</strong> Artikel auf Seite 16.
Im Laufe des Jahres<br />
Symposion<br />
Schriftsteller und die Ökonomie<br />
30. Juni-1. Juli<br />
Organisatorische Beteiligung an den Hayek-<br />
Tagen 2005 in Tübingen<br />
2. Jahreshälfte<br />
Symposion/Dialogseminar<br />
Die Zukunft der <strong>Soziale</strong>n <strong>Marktwirtschaft</strong> als<br />
eine gesamteuropäische Ordnung soll mit<br />
europäischen Studierenden, Assistenten und<br />
Nachwuchswissenschaftlern an symbolträchtigen<br />
Orten (Kreisau und Breslau) erarbeitet<br />
werden. Dieses Symposion ist als Dialog<br />
gedacht, um Brücken begehbar zu machen.<br />
Wie viel hier noch aufzuarbeiten ist, zeigt die<br />
jüngste Diskussion.<br />
November<br />
Studentisches Dialogseminar: Fortsetzung<br />
der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem<br />
dialog e.V. Studierenden wird die Möglichkeit<br />
gegeben, mit Fachleuten aus Wissenschaft<br />
und Praxis über Themen der <strong>Soziale</strong>n <strong>Marktwirtschaft</strong><br />
in einen Dialog zu treten.<br />
Ringvorlesung – <strong>Deutschland</strong> <strong>im</strong> <strong>Umbau</strong><br />
12. Januar<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup<br />
Nachhaltige Sozialpolitik <strong>im</strong> alternden<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
19. Januar<br />
Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker<br />
Heilungschancen für das Gesundheitssystem<br />
AKTIVITÄTEN<br />
Vorschau auf die Aktivitäten <strong>im</strong> Jahr 2005<br />
Weihnachtsgrüße und Dank<br />
26. Januar<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Franz W. Wagner<br />
Steuervereinfachung: Ökonomischer Sachverstand<br />
gegen populistische Vers<strong>im</strong>pelung<br />
2. Februar<br />
Podium mit Prof. Dr. Dieter Kern, Prof. Dr.<br />
Volker Mosbrugger, Prof. Dr. Manfred Stadler,<br />
Minister a.D. Klaus von Trotha, Prof. Dr.<br />
Dr. h.c. Joach<strong>im</strong> Starbatty (Moderation)<br />
Die Universität von morgen oder wie kann<br />
man Universitäten effizienter machen?<br />
16. Februar<br />
Podium mit Bundesministerin a.D. Prof. Dr.<br />
Herta Däubler-Gmelin MdB, Boris Palmer<br />
MdL, OB Michael Theurer MdL, Prof. Dr.<br />
Dr. h.c.Joach<strong>im</strong> Starbatty (Moderation)<br />
Reformen in der Demokratie<br />
Franz-Böhm-Vorträge<br />
10. Februar<br />
32. Franz-Böhm-Vortrag: Stichworte zu einer<br />
freiheitlichen Wirtschaftspolitik, Robert Nef,<br />
Leiter des Liberalen Instituts, Zürich<br />
Im Laufe des Jahres<br />
Drei weitere Franz-Böhm-Vorträge werden <strong>im</strong><br />
Laufe des Jahres stattfinden. Über die<br />
Themen und Daten wird rechtzeitig <strong>im</strong><br />
Internet und per Post informiert.<br />
Verbesserung der ökonomischen Bildung<br />
– MACRO<br />
Schwerpunkte unserer Aktivitäten werden<br />
Lehrerfortbildungen, die Arbeit mit Schülern<br />
und die weitere Ausdehnung des Einsatzes<br />
vom MACRO sein. (Siehe Seite 16)<br />
Mit der Unterstützung durch unsere Mitglieder, Förderer und Freunde konnten wir <strong>im</strong><br />
Jahr 2004 wieder viele erfolgreiche Projekte durchführen. An der großen Resonanz unserer<br />
Veranstaltungen und der weiterhin starken Nachfrage nach dem MACRO-Planspiel<br />
können Sie erkennen, dass wir die zur Verfügung stehenden Mittel wichtigen Zwekken<br />
zugeführt haben. Zahlreiche Anregungen haben unsere Arbeit wesentlich bereichert.<br />
Hierfür und für Ihr finanzielles und ideelles Engagement bedanken wir uns herzlich. Wir<br />
wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest<br />
und ein erfolgreiches und friedvolles Jahr 2005.<br />
15
MACRO-PLANSPIEL<br />
MACRO – Fortschritte bei der Vermittlung<br />
ökonomischer Grundlagen an Schulen<br />
Aus der sektoralen Struktur und den Marktbetziehungen <strong>im</strong> Planspiel resultiert ein komplexes<br />
Beziehungsgeflecht. Es soll zeigen, dass MACRO in der Lage ist, die realen Beziehungen innerhalb<br />
einer Volkswirtschaft abzubilden.<br />
Das MACRO-Planspiel stellte auch<br />
in 2004 einen wesentlichen Teil der<br />
Arbeit der ASM dar. Erstmals überwogen<br />
Schulungen von Lehrern und<br />
Referendaren gegenüber der Durchführung<br />
von Spielveranstaltungen mit<br />
Schülern. MACRO ist mittlerweile an<br />
einigen Lehrerseminaren in Baden-<br />
Württemberg zu einem festen Bestandteil<br />
der Ausbildung geworden.<br />
Regelmäßig werden die Mitarbeiter<br />
der ASM in Fortbildungsakademien<br />
eingeladen, um als externe Referenten<br />
zu den Einsatzmöglichkeiten von<br />
MACRO Rede und Antwort zu stehen.<br />
Ebenso wird MACRO <strong>im</strong> Bereich des<br />
bundesweiten Projektes Ökonomische<br />
Bildung Online vom Ministerium<br />
für Kultus, Jugend und Sport des Landes<br />
Baden-Württemberg empfohlen<br />
und von uns auf breiter Basis vorgestellt.<br />
Die Idee, dass man mit Hilfe<br />
des Planspiels ökonomische Sachverhalte<br />
vermitteln kann, ist damit allgemein<br />
akzeptiert.<br />
16<br />
Die von der ASM für den Schulunterricht<br />
als relevant ausgewählten Inhalte<br />
sowie deren Darstellungsform<br />
scheinen ebenfalls gut anzukommen.<br />
So wird vermehrt auch die zu den Inhalten<br />
des didaktischen Leitfadens<br />
notwendige Unterweisung von Lehrern<br />
und Referendaren bei den Mitarbeitern<br />
der ASM nachgefragt. Die<br />
ASM darf sich also ein klein wenig<br />
auch als think tank der ökonomischen<br />
Bildung in Baden-Württemberg<br />
verstehen.<br />
Die Hauptaufgabe für die nahe Zukunft<br />
ist eine Erweiterung des bestehenden<br />
Spiels um grafische Darstellungen.<br />
Die einzelnen Spielverläufe sollen<br />
dadurch noch eingängiger für die<br />
Schüler aufbereitet und Entwicklungen<br />
visualisiert werden. Des weiteren<br />
wird die gesamte Menüführung von<br />
MACRO neu gestaltet. Diese Überarbeitung<br />
soll den Umgang mit dem<br />
Computer <strong>im</strong> Unterricht weiter erleichtern<br />
und die Funktionalität verbes-<br />
sern. Verbunden mit den o.g. Veränderung<br />
ist eine Überarbeitung der Dokumentationen<br />
und Handbücher für<br />
Schüler und Lehrer.<br />
Ein großes Ziel der ASM bleibt es,<br />
MACRO verstärkt auch den Lehrenden<br />
anderer Bundesländer zur Verfügung<br />
zu stellen. Hier gibt es hoffnungsvolle<br />
Ansätze.<br />
Impressum<br />
Bulletin der <strong>Aktionsgemeinschaft</strong><br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Marktwirtschaft</strong> e.V.<br />
Verantwortlich:<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Joach<strong>im</strong> Starbatty<br />
Anschrift der Redakton:<br />
Mohlstr. 26<br />
72074 Tübingen<br />
Telefon 07071 - 550600<br />
Telefax 07071 - 550601<br />
E-Mail mail@asm-ev.de<br />
Homepage www.asm-ev.de