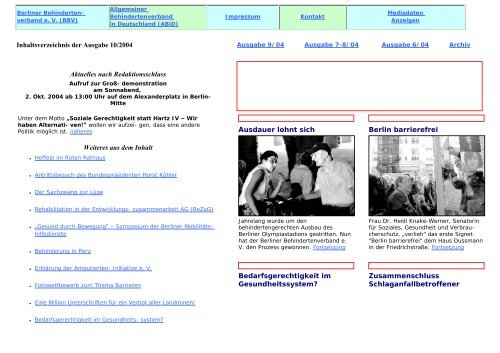Aktuelles nach Redaktionsschluss - Berliner Behindertenzeitung
Aktuelles nach Redaktionsschluss - Berliner Behindertenzeitung
Aktuelles nach Redaktionsschluss - Berliner Behindertenzeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Berliner</strong> Behinderten-<br />
verband e. V. (BBV)<br />
Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 10/2004<br />
Allgemeiner<br />
Behindertenverband<br />
in Deutschland (ABiD)<br />
<strong>Aktuelles</strong> <strong>nach</strong> <strong>Redaktionsschluss</strong><br />
Aufruf zur Groß- demonstration<br />
am Sonnabend,<br />
2. Okt. 2004 ab 13:00 Uhr auf dem Alexanderplatz in Berlin-<br />
Mitte<br />
Unter dem Motto „Soziale Gerechtigkeit statt Hartz IV – Wir<br />
haben Alternati- ven!“ wollen wir aufzei- gen, dass eine andere<br />
Politik möglich ist. näheres<br />
● Hoffest im Roten Rathaus<br />
Weiteres aus dem Inhalt<br />
● Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Horst Köhler<br />
● Der Sachzwang zur Lüge<br />
● Rehabilitation in der Entwicklungs- zusammenarbeit AG (ReZaG)<br />
● „Gesund durch Bewegung“ – Symposium der <strong>Berliner</strong> Mobilitäts-<br />
hilfedienste<br />
● Behinderung in Peru<br />
● Erklärung der Amputierten- Initiative e. V.<br />
● Fotowettbewerb zum Thema Barrieren<br />
● Eine Million Unterschriften für ein Verbot aller Landminen!<br />
● Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheits- system?<br />
Impressum Kontakt<br />
Mediadaten<br />
Anzeigen<br />
Ausgabe 9/04 Ausgabe 7-8/04 Ausgabe 6/04 Archiv<br />
Ausdauer lohnt sich Berlin barrierefrei<br />
Jahrelang wurde um den<br />
behindertengerechten Ausbau des<br />
<strong>Berliner</strong> Olympiastadions gestritten. Nun<br />
hat der <strong>Berliner</strong> Behindertenverband e.<br />
V. den Prozess gewonnen. Fortsetzung<br />
Bedarfsgerechtigkeit im<br />
Gesundheitssystem?<br />
Frau Dr. Heidi Knake-Werner, Senatorin<br />
für Soziales, Gesundheit und Verbrau-<br />
cherschutz, „verlieh" das erste Signet<br />
"Berlin barrierefrei" dem Haus Dussmann<br />
in der Friedrichstraße. Fortsetzung<br />
Zusammenschluss<br />
Schlaganfallbetroffener
● Zeitgewinnung zur Optimierung des Telebus-Betriebes<br />
● Informationen der BVG<br />
● Neues aus der Ludothek am Prenzlauer Berg<br />
● Integrationstag<br />
● Das neue Schulgesetz und die Rahmenbedingungen für die<br />
gemeinsame Erziehung<br />
● Auch in Berlin: Berufliche Integration für Menschen mit einer<br />
geistigen Behinderung!<br />
● Radfahren mit und ohne Handicap!<br />
● Tempelhof-Schöne- berg: ein Bezirk, der Kindern und<br />
Jugendlichen mit Behinderungen Ent- wicklungsmöglich- keiten<br />
anbietet?<br />
● Rollstuhl-Pannen-<br />
Hilfe zur Diskussion gestellt<br />
● GENERATION Interkultureller Pflegedienst ein gelungenes<br />
Konzept einer Pflegestation<br />
● Ewig im „Hotel Mama“ wohnen?<br />
● 8. Renntag „Bewegung Integrale“<br />
● Die Initiative „Jobs ohne Barrieren“<br />
● Internetshop für Menschen mit Behinderung<br />
● LICHTPAUSE – FÜHLEN UM ZU BEGREIFEN<br />
● Beruf: Behindert?<br />
● Rainer Fluck 20 Jahre Dienstjubiläum<br />
Das Institut Mensch, Ethik und<br />
Wissenschaft und der Katholischen<br />
Akademie in Berlin e. V. veranstaltete<br />
eine Tagung zum Thema zur Lage<br />
chronisch kranker und behinderter<br />
Menschen <strong>nach</strong> der Gesundheitsreform.<br />
Fortsetzung<br />
Seit 1991 besteht in Berlin der Landes-<br />
selbsthilfeverband Schlaganfall- und<br />
Aphasiebetroffener und gleichartig<br />
Behinderter Berlin e. V.<br />
Die selbstbetroffenen Gründer wurden<br />
als Patienten des Klinikums Buch und der<br />
Klinik Berlin durch die dortigen Ärzte zur<br />
Gründung angeregt und betraten damit<br />
Neuland. Fortsetzung<br />
Reha fair – Nachlese Bus und Bahn für alle<br />
Bei 164 Ausstellern – Hersteller,<br />
Fachhändler, Organisationen, Vereine<br />
und Verbände – konnten sich die 13.000<br />
Besucher der Reha fair über die Bereiche<br />
der Rehabilitation, Integration, Pflege<br />
und Mobilität informieren und beraten<br />
lassen. Fortsetzung<br />
Wichtig ist eine indivi- duelle<br />
Förderung der Kinder – auch<br />
in der Schule<br />
Am Anfang sei es ganz schwer gewe-<br />
sen: Für die aus der Türkei stammende<br />
Mutter habe ein erstes großes Problem<br />
<strong>nach</strong> der Geburt ihrer Tochter in den<br />
fehlenden Deutschkenntnissen bestan-<br />
den. Obwohl Aysel dann als ein so<br />
genanntes Integrationskind in einen Hort<br />
aufgenommen worden war, habe sich<br />
dort lange Zeit niemand gefunden, der<br />
bzw. die entsprechend aufmerksam und<br />
entsprechend kompetent für sie<br />
Der Landesbeauftragte für Behinderte<br />
bei der Senatsverwaltung für<br />
Gesundheit, Soziales und Verbrau-<br />
cherschutz, Martin Marquard, schreibt<br />
über seine Vorstellungen zur Nutzung<br />
des öffentlichen Personen-Nahverkehrs.<br />
Fortsetzung<br />
Ein Fotowettbewerb zum<br />
Thema Barrieren
● Zusammenschluss Schlaganfall- betroffener<br />
● Unterwegs mit Mobidat im Olympiastadion: Ein Stadion mit<br />
vielen Stationen<br />
● bfr-news 09/04<br />
● Leserbriefe<br />
"Spenden ohne Geld"<br />
Behinderter sammelt<br />
Briefmarken aller Art,<br />
besonders abgestempelte<br />
für behinderte Menschen in<br />
Bethel. Bitte helfen auch<br />
Sie!<br />
Stefan Fliß,<br />
Lechtenberg 4,<br />
48720 Rosendahl-Darfeld<br />
___________________<br />
barrierefrei planen<br />
Dipl.-Ing. Heino Marx (ehemals Movado)<br />
barrierefreie Gestaltung, Beratung und Planung<br />
Langhansstr 63,<br />
13086 Berlin,<br />
Telefon:<br />
0 30/4 71 51 45 o.<br />
0 30/47 1 30 22,<br />
Fax: 0 30/4 73 11 11<br />
***<br />
Unsere Linkliste<br />
***<br />
Impressum<br />
***<br />
Mediadaten und Anzeigen-Kontakte<br />
zuständig war. Fortsetzung<br />
Mit den Flügeln der<br />
Phantasie: die Gruppe<br />
Nebelhorn<br />
In einem leer stehenden Keller vom<br />
„Haus Kilian", einer Wohnstätte für<br />
Menschen mit Behinderung, hatte im<br />
Jahr 1995 die Gruppe Nebelhorn ein<br />
erstes Obdach gefunden. Dort konnten<br />
die Teilnehmer der Gruppe, Menschen<br />
mit und Menschen ohne Behinderung,<br />
damals mit der gemeinsamen Arbeit<br />
beginnen. Fortsetzung<br />
Es ist eine Reise mit dem Shongololo-<br />
Express in Südafrika (Foto) zu gewinnen.<br />
Fortsetzung<br />
Buchtipps für und über<br />
Kinder mit Handicap<br />
Auch Kinder und ihre Geschwister<br />
müssen mit einer angeborenen oder<br />
erworbenen Behinderung leben. Gute<br />
Büchern gehen dabei sowohl auf<br />
medizinische Erklärungen als auch auf<br />
Anstrengungen, Selbstzweifel,<br />
Mutlosigkeit, Bewältigung des Alltags<br />
und das Verantwortungsgefühl für das<br />
Geschwisterkind mit Behinderung ein.<br />
Gabriele Becker stellt Bücher zu dieser<br />
Problematik vor. Fortsetzung<br />
Reiseinformationen vom Netzwerk „barrierefrei reisen“ des<br />
Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e. V.,<br />
bfr-news 07-2004: Fortsetzung<br />
bfr-news 08-2004: Fortsetzung<br />
bfr-news 09-2004: Fortsetzung<br />
Unsere Zeitung erscheint im Druck schwarz/weiß auf schlichtem Papier. Als<br />
Zweitfarbe haben wir Rot.<br />
Wünschen Sie ein Probeexemplar?<br />
Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung
zurück<br />
zurück<br />
***<br />
Kontakt: Redaktion der <strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong><br />
c/o BBV e.V.<br />
Jägerstraße 63 D 10117 Berlin-Mitte<br />
Tel.: 030/65 88 03 41 Fax: 030/65 88 03 43<br />
E-Mail: berliner-behinderten<br />
zeitung@berlin.de<br />
***
Inhaltsverzeichnis der Ausgabe Oktober 2004<br />
<strong>Berliner</strong> Behinder-<br />
tenverband e. V.<br />
(BBV)<br />
Allgemeiner<br />
Behindertenverband<br />
in Deutschland<br />
(ABiD)<br />
Schnur, Ute Ausdauer lohnt sich<br />
Bauersfeld, Hannelore Berlin barrierefrei<br />
Bauersfeld, Hannelore Hoffest im Roten Rathaus<br />
Impressum Kontakte<br />
Bauersfeld, Hannelore Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Horst Köhler<br />
Schulze, Sabine Der Sachzwang zur Lüge<br />
Mediadaten<br />
Anzeigen<br />
BBZ Rehabilitation in der Entwicklungszusammenarbeit AG (ReZaG)<br />
Nielandt, Jörg<br />
Bauer, M. Behinderung in Peru<br />
❬Gesund durch Bewegung Symposium der <strong>Berliner</strong><br />
Mobilitätshilfedienste<br />
Gail, Dagmar Erklärung der Amputierten- Initiative e. V.<br />
Bauersfeld, Hannelore Reha fair Nachlese<br />
BBZ Fotowettbewerb zum Thema Barrieren<br />
Seifert, Ilja, Dr. Soziale Gerechtigkeit statt Hartz IV Wir haben Alternativen!<br />
BBZ Eine Million Unterschriften für ein Verbot aller Landminen!<br />
BBZ Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem?<br />
Marquard, Martin Bus und Bahn für alle Telebus für die, die ihn brauchen<br />
BBZ Zeitgewinnung zur Optimierung des Telebus-Betriebes<br />
BVG-Service-Team Informationen der BVG<br />
Steudel, Reimunde Neues aus der Ludothek am Prenzlauer Berg<br />
Bauersfeld, Hannelore Integrationstag<br />
Grund-Maharam, Ursula<br />
Sanner, Rainer<br />
Scheunemann, Angelika<br />
Das neue Schulgesetz und die Rahmenbedingungen für die<br />
gemeinsame Erziehung<br />
Wichtig ist eine individuelle Förderung der Kinder<br />
auch in der Schule!<br />
Auch in Berlin: Berufliche Integration für Menschen mit einer geistigen<br />
Behinderung!
Rad-AG Radfahren mit und ohne Handicap!<br />
BBZ<br />
Tempelhof-Schöneberg: ein Bezirk, der Kindern und Jugendlichen mit<br />
Behinderun-gen Entwicklungsmöglichkeiten anbietet?<br />
Bauersfeld, Hannelore Rollstuhl-Pannen-Hilfe zur Diskussion gestellt<br />
Golmohammadi, Jabrail<br />
GENERATION Interkultureller Pflegedienst ein gelungenes Konzept<br />
einer Pflegestation<br />
Bruster, Gabi Ewig im ❬Hotel Mama wohnen?<br />
Bauersfeld, Hannelore 8. Renntag ❬Bewegung Integrale<br />
Sanner, Rainer Die Initiative ❬Jobs ohne Barrieren<br />
BBZ Internetshop für Menschen mit Behinderung<br />
BBZ Ein Fotowettbewerb zum Thema Barrieren<br />
Bauersfeld, Hannelore LICHTPAUSE FÜHLEN UM ZU BEGREIFEN<br />
Grabenhorst, Antje Beruf: Behindert?<br />
Sanner, Rainer Mit den Flügeln der Phantasie: die Gruppe Nebelhorn<br />
Wigger, Karl-Heinz Rainer Fluck 20 Jahre Dienstjubiläum<br />
Littwin, Franziska Zusammenschluss Schlaganfallbetroffener<br />
Lajer, Gloria<br />
Unterwegs mit Mobidat im Olympiastadion: Ein Stadion mit vielen<br />
Stationen<br />
Becker, Gabriele Buchtipps für und über Kinder mit Handicap<br />
Smikac, Hartmut bfr-news 09/04<br />
verschiedene Leserbriefe<br />
Unsere Zeitung erscheint im Druck schwarz/weiß auf schlichtem Papier. Als Zweitfarbe haben wir Rot.<br />
Wünschen Sie ein Probeexemplar?<br />
Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung Impressum<br />
Kontakt: Redaktion der <strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong>, c/o BBV e.V.<br />
Jägerstraße 63 D, 10117 Berlin-Mitte<br />
Tel.: 030/ 65 88 03 41, 030/ Fax: 65 88 03 43<br />
E-Mail: berliner-behindertenzeitung@berlin.de<br />
<br />
Mediadaten und Anzeigen-Kontakte
<strong>Berliner</strong> Behinderten-<br />
verband e. V. (BBV)<br />
Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 9/2004<br />
● SGB IX umsetzen!<br />
Allgemeiner<br />
Behindertenverband<br />
in Deutschland (ABiD)<br />
● Persönlichkeitsschutz vor Fahndungs- interessen<br />
● Teuere Sozialtickets<br />
● Kostenfreier ÖPNV<br />
● Behinderte Menschen sollen immer mehr den ÖPNV<br />
nutzen?<br />
● Gebraucht wird eine bauliche Lösung!<br />
● Ins Stadion geschaut<br />
● Dokumentation der Tagung „Einstieg in den<br />
Durchblick“ ist erschienen<br />
● Erster <strong>Berliner</strong> Ehrenamtsbericht<br />
● Sexualpädagogische Beratung bei der Lebenshilfe<br />
gGmbH<br />
● Willkommen zur Reha fairBerlin 2004<br />
● Informationen für die Besucher der Reha fair Berlin<br />
2004<br />
Impressum Kontakt<br />
Mediadaten<br />
Anzeigen<br />
Ausgabe 7-8/04 Ausgabe 6/04 Ausgabe 5/04 Archiv<br />
Wir fordern: Olympia-<br />
stadion für alle!<br />
Das neue „Fünf-Sterne-Stadion" in Berlin<br />
hat Mängel. Es fehlen u. a. Hörschleifen<br />
für Hörbehinderte, Rollstuhlfahrerplätze<br />
mit freier Sicht auf das Spielfeld und<br />
gekennzeichnete Stufen für<br />
sehbehinderte Menschen. Fortsetzung<br />
Budgetverordnung lässt<br />
Fragen offen!<br />
Am 2. April 2004 hat der Bundesrat der<br />
sog. Budgetverordnung zugestimmt.<br />
Sie ist zum 1. Juli 2004 in Kraft<br />
getreten. Ziel dieser Verordnung ist es,<br />
den Anwendungsbereich und das<br />
Verfahren zur Erbringung persönlicher<br />
Budgets <strong>nach</strong> § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX<br />
festzulegen. Betrachtet man sich das<br />
Regelungswerk genauer, bleiben jedoch<br />
einige Fragen offen, die Rechtsanwalt<br />
Martin Theben näher betrachtet.<br />
Fortsetzung<br />
Behinderung und<br />
Entwicklungszusam-<br />
menarbeit e. V. (bezev)<br />
bezev macht es sich seit 1995 zur<br />
Aufgabe, durch Bildungs- und Öffent-<br />
lichkeitsarbeit die Lebensbedingungen<br />
von Menschen mit Behinderung in<br />
Entwicklungsländern <strong>nach</strong>haltig zu<br />
verbessern. Fortsetzung
● Fach- und Publi- kumsmesse unter dem Funkturm<br />
Reha fair Berlin 2004<br />
● Übersicht Rahmenprogramm Hauptbühne der Reha fair<br />
Berlin<br />
● Ihre Fahrverbindung zur Reha fair Berlin 2004<br />
● Digitale Gas-, Brems- und Lenksysteme<br />
● Excellent Rampen Systeme<br />
● Dienstleistungen rund um das ambulante Wohnen<br />
● Fotowettbewerb „Berlin durch die Hintertür“<br />
● Leserbriefe<br />
"Spenden ohne Geld"<br />
Behinderter sammelt<br />
Briefmarken aller Art,<br />
besonders abgestempelte<br />
für behinderte Menschen in<br />
Bethel. Bitte helfen auch<br />
Sie!<br />
Stefan Fliß,<br />
Lechtenberg 4,<br />
48720 Rosendahl-Darfeld<br />
___________________<br />
barrierefrei planen<br />
Dipl.-Ing. Heino Marx (ehemals Movado)<br />
barrierefreie Gestaltung, Beratung und Planung<br />
Langhansstr 63,<br />
13086 Berlin,<br />
Sozialsenatorin be- suchte<br />
Rumpelbasar<br />
Der Rumpelbasar<br />
Zehlendorf e.V.<br />
hatte eingeladen,<br />
der Verteilung von<br />
Spenden an sozi-<br />
ale Projekte u. a.<br />
beizuwohnen, die<br />
aus dem<br />
Verkaufs- erlös<br />
der Sach- spenden<br />
resultie- ren.<br />
Fortsetzung<br />
Multifunktionale Taxen ...<br />
Chancen für die Mobilität von<br />
Menschen mit Behinderung<br />
Multifunktionale Taxen sind behinder-<br />
tengerechte Taxen, die gehbehinderte<br />
Personen im Rollstuhl sicher befördern.<br />
Fortsetzung<br />
Mit Mobidat im Schloss<br />
Köpenick:<br />
Wenn Vergessenwerden<br />
tödlich ist<br />
Innerhalb von nur<br />
wenigen Tagen<br />
starben in diesem<br />
Jahr in Berlin zwei<br />
ältere Frauen, die<br />
eine Woche zuvor<br />
aus dem Kranken-<br />
haus wieder <strong>nach</strong><br />
Hause entlassen<br />
worden waren.<br />
Sie starben am<br />
Vergessenwerden.<br />
Fortsetzung<br />
Bleiben Menschen mit<br />
Behinderung beim „Projekt<br />
Kassenkoope- ration“ außen<br />
vor?<br />
Im Rathaus Berlin-<br />
Charlottenburg<br />
wurden die ersten<br />
Kassenautomaten<br />
im Rahmen des<br />
Projekts Kassen-<br />
kooperation instal-<br />
liert. 27 dieser<br />
Kassenautomaten<br />
sollen in 9 der 12<br />
<strong>Berliner</strong> Bezirke<br />
zum Einsatz kom-<br />
men. Aus dem<br />
Rollstuhl ist die<br />
Karteneingabe in<br />
Höhe von 1,40 m<br />
mit der Hand nicht<br />
zu erreichen.<br />
Zur Diskussion:<br />
„Freie Liebe“<br />
Auch die Hilfestellung<br />
für Menschen mit<br />
Sehbehinderung ist<br />
ungenügend.<br />
Fortsetzung
Telefon:<br />
0 30/4 71 51 45 o.<br />
0 30/47 1 30 22,<br />
Fax: 0 30/4 73 11 11<br />
***<br />
Unsere Linkliste<br />
***<br />
Impressum<br />
***<br />
Mediadaten und Anzeigen-Kontakte<br />
***<br />
Kontakt: Redaktion der <strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong><br />
c/o BBV e.V.<br />
Jägerstraße 63 D 10117 Berlin-Mitte<br />
Tel.: 030/65 88 03 41 Fax: 030/65 88 03 43<br />
E-Mail: berliner-behinderten<br />
zeitung@berlin.de<br />
***<br />
Das Schloss Köpenick ist ein Museum im<br />
Schloss. Nur der barocke Dachstuhl ist<br />
für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar.<br />
Fortsetzung<br />
VerFührungen im Naturpark<br />
Hoher Fläming<br />
Der Hohe Fläming ist ein Paradies für<br />
Stillesucher. Er ist beliebt wegen seiner<br />
vielfältigen Freizeitangebote.<br />
Es gibt geführte Touren zu den<br />
Schönheiten des Naturparks. Wir<br />
veröffentlichen die Angebote für diesen<br />
Herbst, von denen auch einige für<br />
Menschen mit Mobilitätsbehinderung<br />
geeignet sind.<br />
Fortsetzung<br />
Unser Leser Dirk G. schreibt: "Bis heute<br />
habe ich es schätzen gelernt, mich durch<br />
Prostituierte verwöhnen zu lassen. Da ich<br />
in keiner festen Beziehung lebe, habe ich<br />
doch die Möglichkeit meine Sexualität<br />
teilweise auszuleben." Fortsetzung<br />
Von Profis und privaten<br />
VÖGELEIN<br />
Hannelore Bauersfeld vergleicht das harte<br />
Brot des ordinären <strong>Berliner</strong> Spatzen mit<br />
dem dem wohl genährten Käfigvieh.<br />
Fortsetzung
zurück<br />
zurück<br />
Reiseinformationen vom Netzwerk „barrierefrei reisen“ des<br />
Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e. V.,<br />
bfr-news 06-2004: Fortsetzung<br />
bfr-news 07-2004: Fortsetzung<br />
bfr-news 08-2004: Fortsetzung<br />
Unsere Zeitung erscheint im Druck schwarz/weiß auf schlichtem Papier. Als<br />
Zweitfarbe haben wir Rot.<br />
Wünschen Sie ein Probeexemplar?<br />
Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Soziale Gerechtigkeit statt Hartz IV – Wir<br />
haben Alternativen!<br />
Zum Aufruf eines breiten Bündnisses sozialer Kräfte, am Sonnabend, dem 2. Oktober d. J., mit<br />
einer bundesweiten Groß-Demonstration in Berlin einen Politikwechsel hin zu sozialer<br />
Gerechtigkeit zu verlangen, erklärt der BBV-Vorsitzende, Dr. Ilja Seifert:<br />
Solidarität ist die Kraft der Schwachen. Menschen mit Behinderungen brauchen Solidarität.<br />
Und sie verhalten sich solidarisch mit anderen, die Hilfe benötigen. Wir sind Teil der<br />
Bevölkerung. Wir sind Teil der sozialen Bewegung. Also nehmen wir auch an den<br />
Montagsdemos in vielen Städten und an der Groß-Demo in Berlin teil.<br />
Der <strong>Berliner</strong> Behindertenverband e.V. „Für Selbstbestimmung und Würde" (BBV) unterstützt<br />
den Aufruf eines breiten Bündnisses sozialer Kräfte und ruft alle Menschen mit und ohne<br />
Behinderungen – weit über die Hauptstadtbewohner/<br />
-innen hinaus – auf, dabei zu sein:<br />
Sonnabend, 2. Okt. 2004,<br />
ab 13.00 Uhr<br />
auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte<br />
Eine andere Politik ist möglich. Wir setzen uns ein für:<br />
● Rücknahme der Hartz-IV-Gesetzgebung<br />
● Tarif- und Mindestlöhne gegen Niedriglohn- und Armutsarbeit<br />
● menschenwürdiges Grundeinkommen, ohne diskriminierende Bedürftigkeitsprüfung<br />
und Arbeitszwang<br />
● Arbeitszeitverkürzung statt Verlängerung<br />
● 60 Milliarden Euro sofort für Jobs zu existenzsichernden Löhnen in den Bereichen<br />
Gesundheit, Assistenz, Bildung, Soziales, Kultur, Umwelt und öffentlicher Verkehr<br />
statt Arbeitszwang für 1 EUR<br />
● angemessene Besteuerung großer Konzerne und Kapitalgesellschaften sowie der<br />
großen Vermögen<br />
● gleiche Rechte für alle hier lebenden Menschen statt Festung Europa.<br />
Die Grenze verläuft nicht zwischen Ost und West, nicht zwischen Nationen, nicht zwischen<br />
Menschen mit und ohne Behinderungen, sondern zwischen oben und unten. Unser Protest ist<br />
international.
zurück<br />
Wir stehen auf: Für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit in Europa<br />
und weltweit.<br />
Siehe auch:<br />
www.Zweiter-Oktober.de<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Hoffest im Roten Rathaus<br />
Den Kritikern sei versichert: Das Hoffest hat den <strong>Berliner</strong><br />
Landeshaushalt keinen Cent gekostet, denn die Firmen, die sich mit<br />
leckerem Essen und Getränken, aber auch viel, viel Werbung daran<br />
beteiligten, haben ihren jeweiligen Beitrag kostenlos – aber nicht<br />
umsonst – eingebracht, ein im Ausland schon lange geübter Brauch,<br />
den der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit gerne übernahm,<br />
wie er wissen ließ.<br />
Insider-Kritikern sei gesagt, dass die Eingänge zum Hoffest des<br />
Roten-Rathaus-Hofes und der Jüdenstraße mit Schrägen weitgehend<br />
barrierefrei ausgestattet waren.<br />
Wie gut die anderen Rollstuhlfahrer, die zu dem Fest gekommen<br />
waren, mit ihren niedrig gelegten „Faltern" über das<br />
Kopfsteinpflaster kamen und in der drangvollen Enge erkennen<br />
konnten, was auf den verschiedenen Bühnen stattfand, will ich lieber<br />
nicht kommentieren. Und auch „stille Örtlichkeiten" habe ich nicht<br />
aufgesucht, um darüber schreiben zu können.<br />
Gerne aber erstatte ich Bericht darüber, dass die strahlenden Damen<br />
an diesem unerwartet schönen Spät-Sommerabend im September<br />
viele bewundernde Blicke auf sich zogen, wie z. B. Monika Thiemen,<br />
die Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, oder<br />
Christina Weiss, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und<br />
Medien, mit der ich ein Gespräch über VSA arts of Germany,<br />
behinderten Künstlern aus den USA und Deutschland, führen konnte.<br />
„Unser Regierender" trompetete mir ein fröhliches „Aach, Sie kenne<br />
ich doch auch!" entgegen, als ich ihn abbildete. Und das war wohl<br />
eine der Kernfragen des Abends: „Wer erkennt wen?", warum ich<br />
mich seltener ins Gewimmel stürzte, sondern an einem strategisch<br />
übersichtlichen Platz das Kommen und Gehen der Prominenz aus<br />
allen Bereichen des <strong>Berliner</strong> Lebens beobachtete, Uralt-Bekannte<br />
wiedersah und neue Menschen kennen lernte.<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
***
zurück<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Horst<br />
Köhler<br />
Wenn ein neuer Bundespräsident sein Amt übernommen hat, gehört<br />
ein Antrittsbesuch in jedem Land der Bundesrepublik Deutschland zu<br />
seinen protokollarischen Pflichten.<br />
Der 31. August 2004 war der Tag, an dem Horst Köhler mit seiner<br />
First Lady Eva dem Land Berlin seine Aufwartung machte – ein Tag,<br />
der es in sich hatte, begann er doch im Roten Rathaus schon kurz<br />
<strong>nach</strong> neun Uhr mit Reden, Empfängen und der Eintragung ins<br />
Goldene Buch der Stadt, bevor der Regierende Bürgermeister Klaus<br />
Wowereit und die Stadtentwicklungssenatorin Junge-Reyer den<br />
Ehrengast des Tages durch die Stadt begleiteten.<br />
Das Bad in der Menge<br />
Mit leichter Verspätung kam der Konvoi am Brandenburger Tor an,<br />
und das war gut so, denn wenige Sekunden zuvor hatte es noch in<br />
Strömen gegossen.<br />
Eine wachsende Menschenmenge umringte den Bundespräsidenten<br />
beim Gang durch das Brandenburger Tor, so dass ich aus meiner<br />
Rollstuhlfahrersicht nur Schirme und Rücken sehen konnte, also gab<br />
ich meinem neuen „Easy Rider" die Sporen und „düste" gen<br />
Potsdamer Platz, wo mir ein erster Blick auf die Erste Dame des<br />
Landes gelang (siehe Bild unten links).<br />
Kaum war der Rundgang über den Potsdamer Platz abgeschlossen,<br />
krachte ein Regensturm vom feinsten herunter und fegte in<br />
Sekundenschnelle den Platz leer und mich in Richtung<br />
Abgeordnetenhaus, wo Walter Momper, der Parlamentspräsident,<br />
und ein kleiner roter Teppich vor dem hohen Haupteingang des<br />
Abgeordnetenhauses schon des „Stafettenwechsels" harrten.<br />
Die Absperrgitter hatten wohl eher symbolischen Wert, denn in die<br />
Bannmeile um das Abgeordnetenhaus wagten sich keine<br />
Menschenmassen – und auch das Häufchen der Bildjournalisten war<br />
auf ein paar wenige Hartnäckige zusammengeschrumpft. Die<br />
anderen mussten vermutlich die regennassen Linsen putzen.
zurück<br />
Nachdem sich der Regierende Bürgermeister und die Senatorin für<br />
Stadtentwicklung vom hohen Staatsbesuch verabschiedet hatten,<br />
begrüßte nicht nur das Ehepaar Momper, sondern auch strahlendster<br />
Sonnenschein das Bundespräsidentenpaar, das sich bei diesem<br />
Staatsakt (s. Bild oben rechts) auf so wenigen Zentimetern<br />
Entfernung von mir befand, dass ich es wagte, meine Frage zu<br />
stellen:<br />
DAS Gespräch:<br />
„Ähm, Entschuldigung, darf ich (Bundespräsident Köhler schenkte<br />
mir sein hinreißendes Lächeln und einen aufmerksamen Blick), darf<br />
ich – nein, nicht an Sie, Herr Bundespräsident – an die First Lady<br />
eine Frage stellen?" „Ja, bitte?", auch sie schenkte mir ein Lächeln,<br />
und ich fragte da<strong>nach</strong>, welchen karitativen Aufgaben sie sich, die<br />
Tradition der First Ladies fortsetzend, zu widmen entschlossen habe.<br />
Sie werde sich in erster Linie für UNICEF und das<br />
Müttergenesungswerk einsetzen, ließ Frau Eva Köhler mich wissen,<br />
doch auch eine große Zahl anderer Aufgaben habe sie sich<br />
vorgenommen, bat mich jedoch um Verständnis darum, dass sie<br />
diese noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt geben kann.<br />
„Sie möchte nicht zuletzt auch konkrete Hilfe leisten, wann immer<br />
das möglich ist", kann man – mit Blick auf die vielen an sie<br />
gerichteten Briefe – auf der Homepage des Bundespräsidenten<br />
<strong>nach</strong>lesen.<br />
Während ich Verständnis hatte, nahm das Protokoll seinen Fortgang<br />
und entführte den Bundespräsidenten zu politischen Gesprächen ins<br />
Abgeordnetenhaus. In dieser Zeit schauten sich Frau Momper und<br />
Frau Köhler im gegenüberliegenden Martin-Gropius-Bau die dort<br />
ausgestellten Kreml-Schätze an.<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Der Sachzwang zur Lüge<br />
„Der Wahrheit die Ehre" nennt Andreas Jürgens seinen Beitrag zur<br />
Hartz-IV-Debatte, auf die die kobinet-Nachrichten hinweisen. Diesen<br />
wollen wir nicht unkommentiert lassen.<br />
Wir können an dieser Stelle nicht auf alle Auswirkungen und Opfer<br />
von SGB II und SGB XII, die Gesetzeswerke hinter Hartz IV,<br />
eingehen.<br />
Hier ist auch nicht der Platz, näher darauf einzugehen, in welchem<br />
Rahmen Hartz IV zu betrachten ist. Zu Hartz IV gehören bekanntlich<br />
Hartz I bis III und die gesamte Agenda 2010, die Milliarden<br />
Ausgaben, damit Deutschland wieder groß und kriegsfähig wird, oder<br />
die gut 4 Milliarden €, die den ohnehin Reichen durch die Senkung<br />
des Spitzensteuersatzes hinterhergeworfen werden.<br />
Wir beschränken uns hier auf die Auswirkungen für behinderte<br />
Menschen, da Andreas Jürgens ja nicht nur Grüner<br />
Landtagsabgeordneter ist, sondern auch langjähriger Aktivist der<br />
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung.<br />
Andreas Jürgens führt als Verbesserung und als Grund, dass wir<br />
Hartz IV zustimmen sollen, auf, dass sich der Regelsatz auf 345 €<br />
erhöhen wird. Das ist noch nicht mal die halbe Wahrheit. Für die<br />
Menschen in Ostdeutschland erhöht sich der Regelsatz bei gleichen<br />
Lebenshaltungskosten wie im Westen nur auf 331 €. Bei allen<br />
Beziehern dieses Regelsatzes fallen gleichzeitig so gut wie alle<br />
Einmalleistungen weg, die sie vorher zum Sozialhilfesatz erhalten<br />
haben, so dass von dieser Erhöhung nichts mehr übrig bleiben wird.<br />
Andreas schreibt weiter, dass zu den Gewinnern von Hartz IV „die<br />
erwerbsfähigen Sozialhilfebezieher/-innen" zählen, da sie „erstmals<br />
Zugang zu allen Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit<br />
erhalten". Das ist zwar die Wahrheit, aber eine sehr bittere. Hartz IV<br />
schafft keinen einzigen Arbeitsplatz. Alle Gründe, die Unternehmer<br />
veranlassen, Arbeitsplätze wegzurationalisieren, bleiben <strong>nach</strong> wie<br />
vor bestehen. Der größte Teil der zukünftigen Arbeitslosengeld- II-<br />
Bezieher/-innen wird also nicht gefördert, um in den regulären<br />
Arbeitsmarkt zu gelangen, sondern wird in einen neuen, staatlich<br />
subventionierten Arbeitsmarkt aus 1- oder 2-Euro-Jobs
abgeschoben. Das Jubelgeschrei der großen Wohlfahrtsverbände<br />
über diese 1-Euro-Jobs lässt ahnen, wo diese neuen Jobs<br />
eingerichtet werden: in der Pflege, bei Haushaltshilfen und anderen<br />
sozialen Dienstleistungen für alte und behinderte Menschen. Und<br />
keine Arbeitslosengeld-II-empfänger/-in darf diese Jobs ablehnen.<br />
Tolle Aussichten für das selbstbestimmte Leben behinderter<br />
Menschen, die auf umfangreiche Assistenz angewiesen sind.!<br />
Dass Millionen Menschen ins System des Armenrechts gestoßen<br />
werden, mit all seinen Schikanen, Kontrollen und schrecklichen<br />
sozialpsychologischen Folgen, ist nur die eine Konsequenz aus Hartz<br />
IV, für behinderte Menschen gibt es noch eine zweite bedrohliche<br />
Auswirkung. Hartz IV verlangt, dass ziemlich willkürlich zwischen<br />
„erwerbsfähigen" und „nicht erwerbsfähigen" Personen<br />
unterschieden werden muss. Es ist zu befürchten, dass behinderte<br />
Menschen ratzfatz, viel schneller als durch die<br />
Rentenversicherungsträger, die bisher darüber zu entscheiden<br />
hatten, als „nicht erwerbsfähig" eingestuft werden. Sie werden in die<br />
Grundsicherung des SGB XII abgeschoben und niemand muss sich<br />
mehr Gedanken darüber machen, Arbeitsplätze für sie zu schaffen.<br />
Auch viele Bestimmungen des SGB XII, das ja in aller Eile mit dem<br />
SGB II verabschiedet wurde, das also Bestandteil von Hartz IV ist,<br />
haben zur Folge, dass behinderte Menschen aus dem regulären<br />
Arbeitsmarkt verdrängt werden. Die abgesenkten<br />
Einkommensgrenzen für Eingliederungshilfe und für Hilfe zur Pflege<br />
machen es für besser verdienende Schwerbehinderte kaum mehr<br />
lohnenswert, auf einer vollen Stelle zu arbeiten. Die Freibeträge, die<br />
behinderte und schwerbehinderte Menschen, die Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt erhalten, von ihrem Einkommen absetzen konnten,<br />
wurden ebenfalls gesenkt, so dass es sich für viele auch nicht mehr<br />
lohnt, geringfügige Nebenbeschäftigungen anzunehmen.<br />
Von der riesigen Schweinerei des SGB XII, das „Taschengeld",<br />
derjenigen Heim- und WohngruppenbewohnerInnen um ein Drittel<br />
zu kürzen, die mit ihren Werkstattlöhnen oder Renten zu den<br />
stationären Unterbringungskosten beitragen, wollen wir hier auch<br />
nicht schweigen.<br />
Andreas Jürgens versteckt sich aber nicht nur hinter dem<br />
vermeintlichen Sachzwang, die „Sozialleistungssysteme<br />
zukunftsfähig machen" zu müssen, und lügt sich und anderen Hartz<br />
IV schön.<br />
Er spricht in seinem Beitrag auch von den „Rattenfängern". Und hier
zurück<br />
hört der Spaß nun wirklich auf. Hunderttausende von Menschen<br />
gehen auf die Straße und wehren sich gegen Hartz IV und die damit<br />
einhergehende soziale Deklassierung, – mit gutem Recht und eher<br />
zu spät als zu früh. Wer diese Menschen als „Ratten" bezeichnet, und<br />
nichts anderes bedeutet es, wenn Andreas die politischen<br />
Unterstützer, Anmelder und Organisatoren dieser Proteste<br />
„Rattenfänger" nennt, der gehört nicht mehr zu uns.<br />
Der beteiligt sich an dem miesen Geschäft all derjenigen, die<br />
unliebsame Menschen als Unpersonen, als sozialen Ballast oder als<br />
nicht lebenswert bezeichnen.<br />
Sabine Schulze, Heike Lennartz, Gerlef Gleiss von Autonom Leben<br />
Hamburg<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Rehabilitation in der<br />
Entwicklungszusammenarbeit AG (ReZaG)<br />
Diesen Namen hat eine studentische Arbeitsgemeinschaft am Institut<br />
für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin<br />
gewählt. 1996 gegründet, verfolgte und verfolgt sie insbesondere<br />
das Ziel, auch im Hinblick auf sonderpädagogische Fragen über den<br />
Tellerrand zu schauen, d. h. diese nicht nur aus der Perspektive<br />
westlicher industrialisierter Gesellschaften zu diskutieren.<br />
Denn 80 Prozent der Menschen mit körperlichen, geistigen oder<br />
seelischen Beeinträchtigungen leben in Ländern der so genannten<br />
Dritten Welt. Deshalb beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft<br />
insbesondere mit Ursachen und Auswirkungen von Behinderungen in<br />
wirtschaftlich gering entwickelten Ländern.<br />
Ein Arbeitsschwerpunkt der AG ist immer wieder die<br />
Auseinandersetzung mit Ansätzen, welche die Teilhabe von<br />
Menschen mit Behinderung zum Ziel haben.<br />
In den vergangenen Semestern ging es um ein neues Bildungs- und<br />
Gesellschaftsmodell, das so genannte „Inclusion"-Konzept: „Im<br />
Gegensatz zur Integration, die eine Anpassung des Menschen mit<br />
Beeinträchtigung an eine Norm fordert, wird Inclusion als ein Modell<br />
verstanden, das dem Menschen unabhängig von seinen geistigen,<br />
körperlichen und seelischen Voraussetzungen ein optimales Leben<br />
inmitten der Gesellschaft ermöglicht. (...) Alle können in ihrem Alltag<br />
zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen, z. B. indem sie als Eltern<br />
darauf dringen, dass Leistung in der Schule nicht das<br />
ausschlaggebende Kriterium ist, sondern das soziale Miteinander."<br />
Im gegenwärtigen Semester ist es das Thema Empowerment, also<br />
Prozesse, innerhalb derer Menschen ermutigt werden, ihre<br />
Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen, dabei die eigenen<br />
Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und<br />
den Wert selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen.<br />
Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit setzt eine daran<br />
orientierte Arbeit – so die Auffassung der AG – einen Wertewandel<br />
bei den Professionellen voraus: „Die beruflichen Helfer müssen ihren<br />
Fokus von den Defiziten zu den Stärken der Menschen, mit denen sie
zurück<br />
arbeiten, verändern. Weiterhin sollten sie individuell fördernd<br />
wirken, indem sie die Stärkung der Individuen innerhalb von<br />
Gruppen und Netzwerken (z. B. Selbsthilfegruppen) unterstützen.<br />
Ein Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit ist eine derartige<br />
inhaltliche Auseinandersetzung im Themenbereich<br />
Entwicklungszusammenarbeit. Das übergeordnete Ziel dabei ist,<br />
dass solche Fragen verstärkt am Institut, aber auch über die<br />
universitären Grenzen hinaus hier in Berlin thematisiert werden.<br />
ReZaG ist im Internet präsent (www.rezag.de) oder per Mail<br />
erreichbar (kontakt@rezag.de), könnte auch Kontakte zu<br />
Behinderteninitiativen in Ländern der Dritten Welt vermitteln und ist<br />
selbst sehr an Kontakten zu hiesigen Initiativen interessiert.<br />
BBZ<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
„Gesund durch Bewegung“ – Symposium<br />
der <strong>Berliner</strong> Mobilitätshilfedienste<br />
Dass Gesundheit und Bewegungsfähigkeit einander wechselseitig<br />
bedingen, ist jedermanns Erfahrung. Ebenso leicht einsehbar bleibt<br />
die grundlegende gesellschaftliche und individuelle Bedeutung von<br />
Mobilität, d. h. die Fähigkeit zur Fortbewegung. Sich bewegen, sich<br />
von einem Ort zu einem anderen zu begeben, dabei andere<br />
Menschen aufzusuchen, neue Eindrücke zu gewinnen und Tätigkeiten<br />
auszuüben bleibt nur so lange eine Selbstverständlichkeit, wie die<br />
körperlichen Voraussetzungen dafür bestehen. Die gleichsam mit<br />
den Einschränkungen des Alters bzw. einer Behinderung stark – und<br />
bisweilen dramatisch - erhöhte individuelle Bedeutung von Mobilität<br />
für eine selbstständige Lebensführung erleben die <strong>Berliner</strong><br />
Mobilitätshilfedienste tagtäglich eindrucksvoll in ihrer Praxis.<br />
19 senatsgeförderte <strong>Berliner</strong> Mobilitätshilfedienste begleiten seit<br />
mehr als 15 Jahren in allen Bezirken von Berlin Menschen auf Wegen<br />
außerhalb ihrer Wohnung, die mobilitätsbeeinträchtigt aufgrund ihres<br />
Alters oder einer Behinderung dieses nicht mehr aus eigener Kraft<br />
schaffen könnten. Das Spektrum gebotener Mobilitätshilfen ist mit<br />
Begleitungen, Rollstuhlschieben, Treppenhilfen (für Rollstuhlfahrer)<br />
sowie Blindenführung weit gefasst. Eine Klientenbefragung aus dem<br />
Jahr 2003 verdeutlichte das hohe Ausmaß der Angewiesenheit von<br />
weit über 5000 Klienten auf das <strong>Berliner</strong> Mobilitätshilfesystem. Bis zu<br />
drei Viertel der Klienten gelangen da<strong>nach</strong> erst durch die<br />
Mobilitätshilfe wieder <strong>nach</strong> draußen, „an die frische Luft". Erheblich<br />
ist auch die stark psychosozial aktivierende Rolle von Mobilitätshilfen<br />
für eine weit über die Hälfte von Vereinsamung und Kontaktarmut<br />
betroffene, zumeist hochbetagte, Klientel. Diese schreibt den<br />
regelmäßigen, ein- bis zweimal wöchentlichen Mobilitätshilfen in<br />
hohem Maße eine außerordentlich lebensaktivierende Rolle zu.<br />
Hinsichtlich solcher Effekte von Mobilitätshilfen für Spaziergänge,<br />
Einkäufe, Frisör-, Arzt- oder Amtsbesuch sowie für weitere, andere<br />
Tätigkeiten verwundert es nicht, dass nahezu zwei Drittel der<br />
Klienten für sich einen positiven Zusammenhang zwischen<br />
Mobilitätshilfen und ihrem gesundheitlichem Wohlbefinden sehen.<br />
Diese Erfahrungen und Erkenntnisse veranlassten die <strong>Berliner</strong><br />
Mobilitätshilfedienste, ihr erstes Symposium zum Thema<br />
„Gesundheitsprophylaxe / Gesundheitsprävention durch Bewegung –
zurück<br />
Zur Erhaltung von Gesundheit und Lebensqualität im Alter und bei<br />
Behinderung" am 27. Oktober durchzuführen. Die Senatorin für<br />
Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Frau Dr. Knake-<br />
Werner, trägt die Schirmherrschaft. Inhaltlich werden mit einem<br />
großen Fachpublikum aus Wissenschaft und Praxis Fragen zu<br />
Zusammenhängen von Bewegung und Aktivität im Alter mit<br />
gesundheitlichem Wohlbefinden erörtert. Dabei sollen auch<br />
Schlussfolgerungen aus den aufgezeigten Erkenntnissen für die<br />
<strong>Berliner</strong> Mobilitätshilfen gezogen werden. Ein Ziel ist es, Anregungen<br />
und Hilfen zu gewinnen, die die gesundheitlich präventiven<br />
Wirkungen von Mobilitätshilfen noch besser erfass- und darstellbar<br />
machen könnten.<br />
Namenhafte Referenten stellen ihre neueren Forschungsergebnisse<br />
vor.<br />
(Das Symposium „Gesundheitsprophylaxe / Gesundheitsprävention<br />
durch Bewegung – Zur Erhaltung von Gesundheit und Lebensqualität<br />
im Alter und bei Behinderung" findet am 27.10.04 von 9.30–15.30<br />
Uhr im „Neuen Stadthaus", Parochialstr. 3, 10179 Berlin-Mitte statt.<br />
Auskunft/Anmeldung über die Koordinationsstelle der <strong>Berliner</strong><br />
Mobilitätshilfedienste:<br />
Tel. 0 30/7 88 68 36)<br />
Jörg Nielandt<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Behinderung in Peru<br />
Nicht nur in armen Familien ist Ausgrenzung ein weit<br />
verbreitetes Phänomen – Verein will Hilfe leisten<br />
In Peru ist die Situation der Menschen mit Behinderung besonders<br />
unter der armen Bevölkerung erschreckend, Scham und Unkenntnis<br />
über Fördermöglichkeiten belasten die Familien. „Behinderte<br />
Familienmitglieder werden versteckt, vorhandene Hilfsangebote sind<br />
häufig unzureichend und außerdem oft unerschwinglich", so die<br />
Vereinsvorsitzende von La Esperanza e.V., Yvonne Brauer.<br />
Neuerdings sei eine verstärkte staatliche Initiative festzustellen,<br />
dennoch sei Behinderung kaum ein Thema und Aufklärung<br />
vorrangige Aufgabe.<br />
„Hier wollen wir ansetzen, bestehende Angebote bekannt machen<br />
und Selbsthilfeprojekte anregen und unterstützen. Der Wunsch<br />
etwas zu tun, muss aber von den Familien ausgehen", so Brauer.<br />
Erste Schritte seien unternommen: der Verein wurde unter anderem<br />
bei einer Feier zum peruanischen Unabhängigkeitstag in Berlin<br />
vorgestellt. Es konnten bereits Kontakte in Peru und Deutschland<br />
geknüpft und gebrauchte Hilfsgeräte gesammelt werden. Für die<br />
Zukunft sei die Beobachtung der Entwicklung in Peru, die<br />
Vermittlung von Patenschaften, die Sammlung von Sach- und<br />
Geldspenden und vor allem der Wissensaustausch zwischen<br />
Betroffenen Ziel der Vereinsarbeit.<br />
M. Bauer<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Erklärung der Amputierten- Initiative e. V.<br />
Der gemeinnützige <strong>Berliner</strong> Verein Amputierten-Initiative e. V., der<br />
sich der Hilfe für Arm- und Beinamputierte verschrieben hat, sieht<br />
sich gelegentlich dem Vorwurf ausgesetzt, er vertrete die Interessen<br />
der Pharmaindustrie. Der Vorwurf beruht darauf, dass die<br />
Amputierten-Initiative ständig darauf drängt, dass vor jeder<br />
Amputation sorgfältig überprüft werden sollte, ob nicht eine<br />
medikamentöse Behandlungsform die schwerwiegende Amputation<br />
vermeidbar macht. In Deutschland ist bisher nur ein einziges<br />
Präparat dafür zugelassen, dessen Heilerfolge allerdings sehr<br />
ermutigend sind. Lediglich für die seltene Gefäßerkrankung<br />
Thrombangiitis obliterans ist in Deutschland noch ein Medikament<br />
von einem anderen Hersteller zugelassen.<br />
Dem Mitherausgeber des Arzneitelegramms, Prof. Dr. Schönhofer, ist<br />
jetzt gerichtlich auf dem Wege der einstweiligen Verfügung des<br />
Landgerichts Berlin untersagt worden, die Bemühungen der<br />
Amputierten-Initiative e. V. zum Anlass zu nehmen, den Verein<br />
öffentlich als von der Pharmaindustrie „aufgekauft" zu bezeichnen.<br />
Prof. Dr. Schönhofer hat auf den Rechtsbehelf des Widerspruchs<br />
verzichtet und die ergangene Entscheidung als endgültig<br />
hingenommen.<br />
Dagmar Gail<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Fotowettbewerb zum Thema Barrieren<br />
Noch bis zum 30. November 2004 besteht die Möglichkeit, sich am<br />
Fotowettbewerb der Mia Krone-Stiftung zu beteiligen. Ob physische,<br />
soziale oder Barrieren im Kopf aufgegriffen werden, liegt ganz beim<br />
Fotografen. Höhepunkt des Wettbewerbs wird die offizielle<br />
Preisverleihung und die Eröffnung der Ausstellung im Münchner<br />
Künstlerhaus am Lenbachplatz sein. Das Gewinnerfoto wird mit einer<br />
16-tägigen Reise für zwei Personen in das südliche Afrika belohnt<br />
(Wert EUR 4.580): Der nostalgische Safari-Zug des Shongololo-<br />
Expresses fährt zwischen Windhoek und Kapstadt und bietet so die<br />
schönsten Eindrücke von Namibia und dem Weinland Südafrika.<br />
Mit dem Thema des Fotowettbewerbs „Barrieren" möchte die Heinz<br />
und Mia Krone-Stiftung das Bewusstsein für die vielen Barrieren<br />
schärfen, an die wir alle stoßen – ob mit Behinderung oder ohne.<br />
Informationen und Unterlagen zum Wettbewerb finden alle<br />
Interessierte auf der Homepage der Heinz und Mia Krone-Stiftung<br />
www.krone-stiftung.org. Weitere Informationen bekommen Sie<br />
unter:<br />
Heinz und Mia Krone-Stiftung, Frau Carola Krone, Agnesstr. 1,<br />
80801 München,<br />
Tel: 089 – 28 67 31 02.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Eine Million Unterschriften für ein Verbot<br />
aller Landminen!<br />
Über 400 Millionen Landminen lauern schätzungsweise in den<br />
Minenfeldern dieser Welt auf ihre Opfer oder lagern in Militärdepots.<br />
Davon noch über eine Million in Deutschland. Seit 1999 sind<br />
Antipersonenminen international geächtet, während<br />
Antifahrzeugminen noch keinem eindeutigen Verbot unterliegen,<br />
obwohl auch sie von Personen ausgelöst werden können und jährlich<br />
Tausende von Opfern fordern. Diese Minen machen dabei keinen<br />
Unterschied zwischen einem Panzer, einem Schulbus, einem Fahrrad<br />
oder einem spielenden Kind.<br />
Im Juni 2002 hatte der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert,<br />
sich für ein umfassendes Verbot auch von Antifahrzeugminen<br />
einzusetzen und diese Minen schrittweise aus Bundeswehrbeständen<br />
zu entfernen (Drucksache 14/9438.)<br />
Bis heute haben 800.000 Bürgerinnen und Bürger die Forderung<br />
<strong>nach</strong> einem Verbot aller Minen im Rahmen unserer<br />
Unterschriftenaktion unterstützt. Um den Druck auf die politisch<br />
Verantwortlichen zu erhöhen, sollen insgesamt eine Million<br />
Unterschriften gesammelt werden. Bitte engagieren Sie sich mit uns<br />
und unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift.<br />
Unsere fünf Forderungen<br />
● Verbot aller Landminen und minenähnlichen Waffen (z.<br />
B. Streubomben)<br />
● Offenlegung aller Lagerbestände von Landminen<br />
● Vernichtung aller existierenden Minen<br />
● Umwidmung der Gelder für Landminen zugunsten der<br />
Minenopfer<br />
● Unterstützung der Minenräumung und umfassende Hilfe<br />
für Minenopfer
zurück<br />
Und verlangen Sie mit uns die Umsetzung der Parlamentsresolution<br />
vom Juni 2002.<br />
Deutscher Initiativkreis für das Verbot von Landminen<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem?<br />
Zur Lage chronisch kranker und behinderter Menschen <strong>nach</strong><br />
der Gesundheitsreform<br />
Das war das Thema einer Tagung, die am 07.09.2004 in Berlin<br />
stattfand, veranstaltet vom Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft<br />
und der Katholischen Akademie in Berlin e. V.<br />
In der Einladung zu dieser Tagung war die Sorge formuliert, dass<br />
eine auf Rationalisierung und Effizienz fokussierte Reform der<br />
Verteilung der Ressourcen im Gesundheitssystem den Anspruch<br />
verfehlen kann, den besonderen Belangen behinderter und chronisch<br />
kranker Menschen Rechnung zu tragen. Denn diese beiden Gruppen,<br />
die am stärksten und dauerhaft auf medizinische Versorgung<br />
angewiesen sind, sind am meisten betroffen, wenn bei einer Reform<br />
im Gesundheitswesen außerökonomische Gesichtspunkte nicht<br />
ausreichend berücksichtigt werden.<br />
Ethische statt ökonomische Gesichtspunkte<br />
Im einleitenden Vortrag von Professor Dr. Dietmar Mieth und der<br />
anschließenden Diskussion zu den ethischen Grundlagen einer<br />
gerechten und solidarischen Gesundheitsversorgung wurde unter<br />
anderem folgendes Problem angesprochen: Im Moment werde<br />
immer wieder außer Acht gelassen, dass Hilfspflichten nicht nur<br />
Tugendpflichten, sondern auch Rechtspflichten sind, dass sie eine<br />
wichtige Voraussetzung dafür bilden, Wechselseitigkeit und<br />
Chancengleichheit in der Gesellschaft erst herzustellen, so<br />
Ungleichheit in der Gesellschaft überhaupt erst verringern zu können.<br />
Thema war auch der Begriff der Standardisierung als ein<br />
Gegenbegriff zu dem der Individualisierung: Wenn jetzt nur noch<br />
Standards zuerkannt werden sollen, werde eben das Individuum und<br />
damit der individuelle Bedarf von einzelnen Patientinnen bzw.<br />
Patienten weitgehend ausgespart.<br />
Auswirkungen der Gesundheitsreform<br />
Eine der Arbeitsgruppen beschäftigte sich <strong>nach</strong> der Mittagspause mit
der Frage, wie die Instrumente der Gesundheitsreform auf Menschen<br />
mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen wirken.<br />
Barbara Stötzer-Manderscheid von der Interessenvertretung<br />
Selbstbestimmt Leben (ISL) rückte das<br />
Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) einleitend in den<br />
gegenwärtig stattfindenden Kontext der Umstrukturierung des<br />
Sozialstaats, wo den tiefgreifenden Sparprogrammen fragwürdige<br />
Ausgaben in Milliardenhöhe gegenüberstehen würden. Der Druck auf<br />
Patientinnen und Patienten wachse mit dem GMG stärker als der auf<br />
die Anbieter im Gesundheitswesen, münde für die ersteren in eine<br />
Einschränkung der Lebensqualität. Dabei setzen die mit dem GMG<br />
geschaffenen ökonomischen Instrumente ihres Erachtens in erster<br />
Linie bei den chronisch kranken Menschen und den Menschen mit<br />
Behinderungen an.<br />
Abschließend wies sie auf den § 2a des SGB V hin: „Den<br />
Bedürfnissen behinderter und chronisch kranker Menschen ist<br />
Rechnung zu tragen." Und dabei gehe es nicht um Heilung oder<br />
Gesundung, sondern eher um die Sicherung einer bestimmten<br />
Lebensqualität für die Betroffenen. Angesichts der mit dem GMG für<br />
diese beiden Gruppen entstandenen Einschränkungen müsse dies<br />
jetzt als ein Kampfauftrag für die Patientenvertreter wahrgenommen<br />
werden.<br />
Jens Kaffenberger vom Sozialverband VdK informierte über die neue<br />
Patientenbeteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss, in dem seit<br />
Anfang 2004 neben Funktionären der Kassen und der Ärzteschaft<br />
auch Patientenvertreter beteiligt sind. Diese haben allerdings nur<br />
Informations- und Anhörungsrechte und dürfen bei der Entscheidung<br />
über Richtlinien nicht mit abstimmen.<br />
Im Gemeinsamen Bundesausschuss fallen Entscheidungen wie die<br />
zur Frage der Definition schwerwiegender chronischer Krankheiten<br />
oder zur Verordnungsfähigkeit rezeptfreier Arzneimittel u. a.<br />
Ziel der Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschusses sei<br />
es gewesen, diesen transparenter zu machen, die Diskussion zu<br />
verbreitern und das Gesundheitssystem stärker am Bedarf zu<br />
orientieren.<br />
Eines der noch anstehenden Themen für den Gemeinsamen<br />
Bundesausschuss sei die Frage der Zuzahlungen für arme Menschen,<br />
speziell für die Bewohner von Heimen. Denn es sei Letzteren doch<br />
wohl nicht zuzumuten, die Hälfte oder mehr als die Hälfte ihres
zurück<br />
ohnehin knappen Taschengeldes für dringend benötigte<br />
Medikamente ausgeben zu müssen.<br />
Zu hören war auch, dass ein lange ignoriertes Thema endlich<br />
Aufmerksamkeit erhält: Die allzu seltene barrierefreie Erreichbarkeit<br />
von Arztpraxen sei – im Hinblick auf eine bundesweite Lösung – zum<br />
Thema geworden, unter Verbänden, beim kommenden Kongress<br />
„Armut und Gesundheit" in Berlin und auch in Gesprächen mit dem<br />
Bundesbehindertenbeauftragten. Eindeutige Kriterien für<br />
Barrierefreiheit im Gesundheitswesen müssten noch festgelegt<br />
werden, dann lasse sich auch die Barrierefreiheit als ein<br />
Qualitätskriterium benennen und mit einer dahingehenden<br />
Unterversorgung argumentieren.<br />
Auch die enormen Defizite im Hinblick auf eine (angemessene)<br />
Information für Menschen mit Sinnesbehinderungen oder<br />
Lernschwierigkeiten erhalten jetzt Aufmerksamkeit.<br />
Für konkrete Fragen zum GMG hier abschließend der Hinweis auf die<br />
informative Broschüre „ABC der Gesundheitsreform", die man gegen<br />
einen mit 1,44 Euro frankierten Rückumschlag beim Bundesverband<br />
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., Postfach 20, 74236 Krautheim<br />
bestellen kann.<br />
BBZ<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Ausdauer lohnt sich<br />
Jahrelang wurde um den behindertengerechten Ausbau des <strong>Berliner</strong><br />
Olympiastadions gestritten. Der <strong>Berliner</strong> Behindertenverband „Für<br />
Selbstbestimmung und Würde"<br />
e. V. hatte gegen das Land Berlin geklagt. Der Grund war: Das<br />
Olympiastadion wurde für viel Geld modernisiert und mit einer<br />
großen Eröffnungsveranstaltung und vielen prominenten Gästen<br />
eingeweiht, jedoch blieben Menschen mit Behinderungen auf der<br />
Strecke. Dieser Prozess habe gezeigt, das Verbandsklagerecht sei<br />
ein wirksames Mittel, die Rechte behinderter Menschen einzuklagen,<br />
wie die Anwältin Dr. Bettina Theben kommentierte.<br />
Nun hat sich das Land Berlin verpflichtet, bis Ende des Jahres durch<br />
die Errichtung von Podesten für Rollstuhlfahrer freie Sicht zu<br />
schaffen, für sehbehinderte Menschen die Stufen zu markieren und<br />
Geländer einzubauen.<br />
Dies sind zusätzliche Kosten für Berlin, die nicht sein müssten, hätte<br />
man bei der Sanierung des Stadions von vornherein an die Belange<br />
von Menschen mit Behinderungen gedacht. Immer wieder ignorierte<br />
die Senatsverwaltung in den vergangenen Jahren Einwände und gut<br />
gemeinte Vorschläge der Betroffenen. Man wisse, wie man bauen<br />
müsse. Dieser Prozess zeigte, dass es sehr wohl Sinn hat, die<br />
Einhaltung bestehender Gesetze – wie z. B. des<br />
Landesgleichberechtigungs- bzw. des Bundesgleichstellungsgesetzes<br />
– zu fordern. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht!<br />
Ute Schnur<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Berlin barrierefrei<br />
„Auf Initiative des Landesbeauftragten für Behinderte und in enger<br />
Zusammenarbeit mit den Bezirksbehindertenbeauftragten gibt es<br />
wieder ein Signet für barrierefreie Geschäfte, Gaststätten, Hotels,<br />
Sparkassen usw.<br />
Viele erinnern sich vielleicht noch an die ,Good-Will-Kommen-Aktion‘<br />
vor gut zehn Jahren, bei der mit einem Signet an der Eingangstür<br />
zum Ausdruck gebracht wurde, dass hier ein stufenloser Zugang<br />
besteht und Menschen mit Behinderung willkommen sind. Die Aktion<br />
war sehr erfolgreich, und es sind heute noch vereinzelt<br />
entsprechende Aufkleber an Geschäften zu finden.<br />
Während damals die barrierefreie Gestaltung von öffentlich<br />
zugänglichen Gebäuden noch auf völliger Freiwilligkeit beruhte,<br />
haben wir in der Zwischenzeit eine Reihe von gesetzlichen und<br />
anderen Vorschriften zur Herstellung von Barrierefreiheit, z. B. die ,<br />
Leitlinien zum Ausbau<br />
Berlins als behindertengerechte Stadt‘ von 1992, die novellierte<br />
Bauordnung von 1996 oder das Landesgleichberechtigungsgesetz<br />
von 1999. Dadurch hat sich das Gesicht Berlins in den letzten zehn<br />
bis zwölf Jahren grundlegend verändert.“ Soweit die Ausführungen<br />
auf der Homepage „www.berlin-barrierefrei.de“.<br />
In drei Diskussionsrunden beim Landesbehindertenbeauftragten<br />
wurde die Thematik zum Teil kontrovers diskutiert; ein Logo und der<br />
Kriterienkatalog wurden in zwei Arbeitsgruppen entwickelt.<br />
Am 11. September 2004 war es dann soweit: Frau Dr. Heidi Knake-<br />
Werner, Senatorin für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz,<br />
„verlieh“ das erste oben dargestellte gelb-weiß-schwarz-blaue Signet<br />
dem Haus Dussmann in der Friedrichstraße, wie wir hier „durch die<br />
Scheibe“ im Bild festhalten konnten.<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Zeitgewinnung zur Optimierung des Telebus-<br />
Betriebes<br />
In einer Drucksache der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales<br />
und Verbraucherschutz an das Abgeordnetenhaus wird ein Beschluss<br />
dieses Hauses vom 17. Juni 2004 wiedergegeben:<br />
„Der Senat wird aufgefordert, die Zusammenarbeit mit dem BZA bis<br />
zum 30.06.2005 zu verlängern und den ÖPNV-integrierten<br />
Sonderfahrdienst in dieser Zeit vorzubereiten. Dazu muss der<br />
Telebusbetrieb saniert werden, indem der BZA sich auf sein<br />
Kerngeschäft, die Durchführung von sogenannten Privatfahrten,<br />
konzentriert.<br />
Dafür müssen die sogenannten Kostenträgerfahrten bis zum<br />
31.12.2004 vollständig aus dem bisherigen System des<br />
Sonderfahrdienstes herausgenommen werden. Die<br />
Rechtsverordnung wird entsprechend geändert."<br />
In dem Schreiben wird darauf verwiesen, dass es entsprechend dem<br />
Hauptausschuss zum 31.03.2004 vorgelegten Konzept geplant sei,<br />
die Angebote zur Sicherung der Mobilität von Menschen mit<br />
Behinderungen effektiver zu organisieren und miteinander zu<br />
vernetzen.<br />
Weiter heißt es in der Drucksache: „Mit der Reduzierung auf das<br />
Kerngeschäft des <strong>Berliner</strong> Zentralausschusses für soziale Aufgaben e.<br />
V. (BZA), nämlich der Durchführung der sog. Privatfahrten zur<br />
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit<br />
Behinderungen, werden ab 01.01.2005 die Voraussetzungen zur<br />
Realisierung des neuen Konzepts geschaffen. Die sog. Arztfahrten<br />
wurden bereits zum 01.05.2004 aus dem System des<br />
Sonderfahrdienstes herausgelöst, die Rückführung der übrigen<br />
Kostenträgerfahrten bis zum 31.12.2004 an die jeweils originär<br />
zuständigen Stellen ist derzeit in Vorbereitung. Eine diesbezügliche<br />
Änderung der Verordnung über die Vorhaltung eines besonderen<br />
Fahrdienstes wurde von meiner Verwaltung vorbereitet und befindet<br />
sich derzeit in der Mitzeichnung."<br />
BBZ
zurück<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Informationen der BVG<br />
U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee eröffnet<br />
Eine erfreuliche Nachricht der BVG: Rollstuhlfahrer können ab 21.<br />
August einen weiteren <strong>Berliner</strong> U-Bahnhof nutzen. Gegen 13 Uhr<br />
geht <strong>nach</strong> rund siebenmonatiger Bauzeit der 79. Aufzug im <strong>Berliner</strong><br />
U-Bahn-Netz in Betrieb – auf dem U-Bahnhof Johannisthaler<br />
Chaussee (U7). Bereits im Frühjahr erhielt der Bahnsteig ein neues<br />
Blindenleitsystem. Das Besondere: für Aufzug und Blindenleitsystem<br />
wurden 145 000 Euro weniger ausgegeben als geplant. Die<br />
Gesamtkosten beliefen sich auf 814 000 Euro. Damit verfügen jetzt<br />
49 U-Bahnhöfe über einen Aufzug, zehn Stationen sind für<br />
mobilitätsbehinderte Fahrgäste über Rampen erreichbar.<br />
Der U-Bahnhof Alex wird „geliftet"<br />
Die Bauzäune den U-Bahnhof Alexanderplatz fallen: Am 18. Oktober<br />
2004, 10.00 Uhr, werden drei von insgesamt vier Aufzügen durch die<br />
BVG in Betrieb genommen. Barrierefrei kann dann umgestiegen<br />
zwischen den U-Bahnlinien U2, U5 und U8, Regionalbahn, S-Bahn,<br />
mehreren Straßenbahn- und Omnibuslinien.<br />
Die neuen Aufzüge bieten neben der attraktiven ÖPNV-Verknüpfung<br />
auch für viele Fahrgäste eine bessere Erreichbarkeit des östlichen<br />
Stadtzentrums.<br />
Über die Lage der Aufzüge und ihre Zugänglichkeit werden wir in der<br />
nächsten Ausgabe berichten.<br />
Ihr BVG-Service-Team<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Neues aus der Ludothek am Prenzlauer Berg<br />
Am Prenzlauer Berg eröffnete am 31. Oktober 2003 die Ludothek<br />
des Vereins Fördern durch Spielmittel. Die Spielzeugausleihe hält<br />
Spielmittel für behinderte und nicht behinderte Kinder bis zur<br />
Entwicklungsstufe von 6 Jahren zur Ausleihe bereit. Die Spielmittel<br />
stammen teilweise aus Projektarbeiten des Vereins. Dadurch ist die<br />
Ludothek neben konventionellem Spielzeug mit besonders<br />
individuellen Spielmitteln bestückt. Seit dem Eröffnungstag konnten<br />
mehr als 1000 Besucher begrüßt und über 100 Benutzerausweise<br />
ausgestellt werden.<br />
Die Nutzer sind bisher noch in erster Linie Privatpersonen und Kitas<br />
aus dem Kietz und Einzelfallhelfer/-innen aus ganz Berlin. Sie nutzen<br />
sowohl die Räume der Ludothek, um mit dem dort vorhandenen<br />
Spielzeug zu spielen und dieses auszuprobieren, als auch die<br />
Möglichkeit, die Spielmittel gegen eine geringe Ausleihgebühr für 14<br />
Tage auszuleihen. Aber auch Kindergeburtstage wurden in den<br />
Räumen der Ludothek schon gefeiert. Für einmalige Anlässe, wie z.<br />
B. Kindergeburtstage, stellt die Ludothek zu Sonderkonditionen eine<br />
Spielkiste zusammen.<br />
Regelmäßige Seminare der staatlich anerkannten Schule für<br />
Ergotherapie in der Besselstraße haben sich in den Räumen der<br />
Ludothek inzwischen etabliert. Anliegen der Seminare ist es, die<br />
Spielmittel noch einmal genauestens auf ihre Eignung unter<br />
therapeutischen Gesichtspunkten zu testen und zu analysieren.<br />
Die Öffnungszeiten haben sich geändert und lauten jetzt<br />
Dienstag 15.00–18.00 Uhr<br />
Mittwoch 15.00–18.00 Uhr<br />
Donnerstag 9.00–12.00 Uhr<br />
Freitag 15.00–18.00 Uhr<br />
Gruppen <strong>nach</strong> Vereinbarung<br />
Ab August gibt es regelmäßige Spielabende für Erwachsene. Hier<br />
kann jeder Teilnehmer sein Lieblingsspiel mitbringen, vorstellen und<br />
mit Gleichgesinnten spielen.
zurück<br />
Weitere Informationen erhalten sie in der Ludothek im Prenzlauer<br />
Berg, Immanuelkirchstr. 24, im 2. Hinterhof zu den o. g.<br />
Öffnungszeiten.<br />
Tel.: 44 04 32 69, Fax: 44 35 92 14<br />
E-Mail: ludothek@spielmittel.de<br />
Reimunde Steude<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Integrationstag<br />
Die Integrationspolitik in den Quartieren war der Schwerpunkt des<br />
<strong>Berliner</strong> Integrationstages am 13. September in der Werkstatt der<br />
Kulturen.<br />
Auf dem Integrationstag wurde erstmals eine von der<br />
Investitionsbank Berlin mit herausgegebene Studie der OECD<br />
vorgestellt, in der Handlungsstrategien für die <strong>Berliner</strong><br />
Innenstadtbezirke entwickelt wurden.<br />
Der <strong>Berliner</strong> Integrationsbeirat zog an diesem Tag eine erste Bilanz<br />
seiner Arbeit, mit der Berlin den Herausforderungen begegnen will.<br />
Der Integrationsbeauftragte des Senats, Günter Piening, hat sich für<br />
eine stärkere Konzentration der <strong>Berliner</strong> Integrationspolitik auf die<br />
Innenstadtbezirke mit hohem Migrantenanteil ausgesprochen.<br />
Die Senatorin für Stadtentwicklung Ingeborg Junge-Reyer forderte<br />
die Chancengleichheit für Migranten auf dem Arbeitsmarkt und im<br />
Schulwesen.<br />
Alternativlose Voraussetzung sei aber der Erwerb der deutschen<br />
Sprache, betonte sie mehrfach.<br />
In ihrer Rede zur Eröffnung des 1. <strong>Berliner</strong> Integrationstages macht<br />
die Staatssekretärin für Soziales und Vorsitzende des Landesbeirates<br />
für Integrations- und Migrationsfragen, Frau Dr. Petra Leuschner,<br />
darauf aufmerksam, dass der Integrationsbeauftragte einen<br />
Integrationspreis gestiftet hat, der vom Landesbeirat vergeben wird.<br />
„In diesem Jahr haben wir Initiativen gesucht, die sich für die Rechte<br />
von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund<br />
einsetzen."
Eine aus drei Fachfrauen bestehende Jury hat die Preisträgerinnen<br />
ermittelt; die beiden ersten Preise (2.000 Euro) gehen an:<br />
– RABIA e. V. – Interkulturell Feministisches Mädchenprojekt e. V.<br />
und<br />
– den Mädchennotdienst.<br />
Der Sonderpreis von 1.000 Euro erhielt DÜNA, ein Mädchen-Kultur-<br />
Treff aus der Jagowstr. 12.<br />
***<br />
Die von der Investitionsbank finanziell unterstützte OECD-Studie<br />
prangert nicht nur die Einsparungen von rd. 75 Millionen Euro bei<br />
den <strong>Berliner</strong> Universitäten an, sondern kritisiert auch, dass im<br />
Bereich Schule und vorschulische Erziehung eher abgebaut als<br />
investiert wird. Der Bildungsetat für <strong>Berliner</strong> Schulen ging von 1,847<br />
Milliarden Euro in diesem Jahr zurück auf 1,818 Milliarden Euro.<br />
Die Studie betrachtet den Entwicklungszeitraum seit dem Fall der<br />
Mauer und die zentrale Frage lautet: Wie kann mit wirtschaftlichen<br />
Mitteln Armut überwunden werden?<br />
Es wird kritisiert, dass der Senat auch im vorschulischen Bereich<br />
eher abgebaut als investiert hat, obwohl Schulsenator Böger<br />
erklärte, dass er erkannt habe, dass die Bildung bei den Kleinen<br />
beginne.<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------<br />
Integrationsschule<br />
Robert-Jungk-Oberschule Charlottenburg-Wilmersdorf<br />
„Eine Schule für alle!!!", deren Wahrzeichen ein Gingko-Blatt ist,<br />
eine UNESCO-Projekt-Schule mit den Schwerpunkten:<br />
Menschenrechte, Toleranz, Demokratie, Erwerb interkultureller<br />
Kompetenz und Solidarität.<br />
Eine „bunte" Schule, in der Schülerinnen und Schüler verschiedener<br />
Herkunft, unterschiedlicher Religionen und Sprachen gemeinsam
zurück<br />
lernen, die Freizeit miteinander verbringen und, wenn nötig, auch<br />
Hilfe erhalten, Konflikte zu bearbeiten.<br />
Von 6 Parallelklassen pro Jahrgang sind zwei Integrationsklassen, in<br />
denen eine zweite Lehrkraft die behinderten Schüler begleitet und<br />
ihnen bei Rückfragen zur Verfügung steht.<br />
Auf dem Hoffest des Regierenden Bürgermeisters kamen wir ins<br />
Gespräch. Die Direktorin der RJ-Oberschule lud mich spontan zu<br />
einem Besuch ihrer Integrationsklasse ein und ich folgte der<br />
Einladung gerne.<br />
Waren die Schüler anfänglich noch höflich-zurückhaltend im<br />
Gespräch, so tobte das Leben voller Fröhlichkeit in der Klasse, als ich<br />
<strong>nach</strong> einer Führung durch die Schule den Englisch-Unterricht störte,<br />
um für die BBZ-Leser noch ein Bild zu machen.<br />
Robert Jungk (1913–1994) war Wissenschaftsjournalist,<br />
Zukunftsforscher, Träger des alternativen Nobelpreises und<br />
Atombombengegner, der in der zerstörten Landschaft von Hiroshima<br />
auf einen Ginkgo-Baum stieß, der einzigen Pflanzenart, die die<br />
Atombombe überlebt hatte.<br />
Schüler einer Integrationsklasse der Robert-Jungk-Oberschule,<br />
Gesamtschule Berlin-Wilmersdorf (oben), und die stolze Direktorin,<br />
Frau Dr. Ruth Garska, im perfekt eingerichteten Filmstudio der<br />
Schule, in dem schon Bundesaußenminister Joschka Fischer und die<br />
Moderatorin Sabine Christiansen von Schülern interviewt wurden<br />
(unten).<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Das neue Schulgesetz und die<br />
Rahmenbedingungen für die gemeinsame<br />
Erziehung<br />
Rahmenbedingungen für die gemeinsame Erziehung<br />
Das neue Schulgesetz legt in § 4 den Vorrang der Integration<br />
erstmals fest: „Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit<br />
sonderpädagogischem Förderbedarf soll vorrangig im gemeinsamen<br />
Unterricht erfolgen."<br />
Damit könnten Eltern eines Kindes mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf entscheiden, ob sie die integrative Beschulung ihres<br />
Kindes in der zuständigen Grundschule oder die Beschulung in einer<br />
Schule mit dem entsprechenden sonderpädagogischen<br />
Förderschwerpunkt (Sonderschule) wünschen. Bis heute steht aber<br />
nur der Entscheidung der Eltern für eine Beschulung in einer<br />
Sonderschule nichts im Wege.<br />
Bei einer Entscheidung der Eltern für die Beschulung in der<br />
zuständigen Grundschule bleibt das Elternrecht durch den so<br />
genannten Haushaltsvorbehalt des § 37 Abs. 3 eingeschränkt: „Die<br />
Schulleiterin oder der Schulleiter der allgemeinen Schule darf eine<br />
angemeldete Schülerin oder einen angemeldeten Schüler mit<br />
sonderpädagogischem Förderbedarf nur abweisen, wenn für eine<br />
angemessene Förderung die personellen, sächlichen und<br />
organisatorischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Ist der<br />
Schulleiterin oder dem Schulleiter eine Aufnahme <strong>nach</strong> Satz 1 nicht<br />
möglich, so legt sie oder er den Antrag der Schulaufsichtsbehörde<br />
vor. Diese richtet zur Vorbereitung ihrer Entscheidung einen<br />
Ausschuss ein, der die Erziehungsberechtigten und die Schule<br />
anhört. Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet im Einvernehmen mit<br />
der zuständigen Schulbehörde abschließend auf der Grundlage einer<br />
Empfehlung des Ausschusses und unter Beachtung der personellen,<br />
sächlichen und organisatorischen Möglichkeiten über die Aufnahme
der Schülerin oder des Schülers in die gewählte allgemeine Schule,<br />
eine andere allgemeine Schule oder eine Schule mit<br />
sonderpädagogischem Förderschwerpunkt."<br />
Die neue Verordnung Sonderpädagogik, die die Einzelheiten des<br />
Verfahrens regelt, gibt es zurzeit nur als Entwurf.<br />
Frühere Einschulung und Feststellungsverfahren<br />
Mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 gelten die rechtlichen<br />
Bedingungen der neuen Schulanfangsphase. Das betrifft alle Kinder,<br />
die im Kalenderjahr 1999 geboren worden sind und die Kinder des<br />
zweiten Halbjahres 1998. Durch den um ein halbes Jahr<br />
vorgezogenen Schuleintritt werden im Schuljahr 2005/2006<br />
eineinhalb Jahrgänge eingeschult.<br />
Die schulärztliche Untersuchung vor der Einschulung bleibt auch<br />
weiterhin erhalten. Es werden aber keine Schulreifeuntersuchungen<br />
mehr durchgeführt.<br />
Der sonderpädagogische Förderbedarf soll künftig in einem<br />
Feststellungsverfahren ermittelt werden. Förderausschüsse, wie sie<br />
bis zum Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes am 01.02.2004 dafür<br />
eingerichtet wurden, werden nicht mehr einberufen.<br />
Die Schule kann vor jeder Antragstellung eine Schulhilfekonferenz<br />
durchführen, an der die Lehrer, Eltern, Sonderpädagogen und bei<br />
Bedarf andere Fachleute teilnehmen. Die Ergebnisse der Beratung<br />
werden dem Antrag als Empfehlung beigefügt.<br />
Nach der neuen Rechtslage können Anträge auf Feststellung<br />
sonderpädagogischen Förderbedarfs von den Eltern oder der Schule<br />
gestellt werden. Wobei Eltern ihren schriftlich begründeten Antrag in<br />
der zuständigen Schule abgeben, die ihn an die Schulaufsicht<br />
weiterleitet. Damit bleiben Eltern behinderter Kinder immer noch in<br />
der Bittstellerrolle, haben sie lediglich ein Antrags-, aber kein<br />
Wahlrecht. Denn die Schulaufsichtsbehörde entscheidet darüber, ob
und in welchem Umfang sonderpädagogischer Förderbedarf gegeben<br />
ist. Zur Entscheidungsfindung kann sie sich jederzeit und für alle<br />
sonderpädagogischen Förderschwerpunkte die Unterstützung des<br />
sonderpädagogischen Förderzentrums (Schule mit<br />
sonderpädagogischem Förderschwerpunkt) holen, das den<br />
Förderschwerpunkt für das Kind ermittelt. Und sie kann ein<br />
sonderpädagogisches Gutachten erstellen lassen. Das kann<br />
bedeuten, dass Sonderschullehrer/-innen Gutachten erstellen, die<br />
kaum oder keine Erfahrung mit integrativem Unterricht haben oder<br />
diesem sogar ablehnend gegenüber stehen können. Und auch die<br />
Schule, die das Kind aufnehmen soll, wird von der Schulaufsicht<br />
bestimmt. Damit verbleibt den Eltern nicht mehr viel Möglichkeit,<br />
eigene Wünsche anzumelden.<br />
Somit kann die Schulaufsichtsbehörde, auch gegen den Wunsch der<br />
Eltern, auf der Grundlage des so genannten Haushaltsvorbehaltes<br />
entscheiden, dass ein Kind nicht in der von den Eltern gewünschten<br />
Schule eingeschult wird und dass ein Kind gegebenenfalls nicht im<br />
gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und<br />
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet werden soll,<br />
sondern in einer Schule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt.<br />
Daher wird der Übergang aus der gemeinsamen Erziehung in der<br />
Grundschule in die Sekundarstufe I für Schüler mit dem<br />
Förderschwerpunkt „Geistige Behinderung„ oft zur Sackgasse, da die<br />
Anzahl der Förderstunden für Integration nicht im entsprechenden<br />
Umfang wächst wie die Zahl der Integrationsschüler/-innen.<br />
Integrationsanträge werden abgelehnt und die Eltern sehen sich<br />
<strong>nach</strong> erfolgreicher Integration in der Grundschule mit der Einweisung<br />
ihres Kindes in eine Schule mit sonderpädagogischem<br />
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung" konfrontiert.<br />
Förderbedarf für emotional-sozial- und<br />
lernbehinderte Kinder<br />
Für die sonderpädagogischen Förderschwerpunkte „Emotionale und<br />
soziale Entwicklung" sowie „Lernen" wird <strong>nach</strong> dem neuen<br />
Schulgesetz die Feststellung der Förderschwerpunkte nicht mehr vor<br />
der Einschulung durchgeführt. Diese Schülerinnen und Schüler<br />
werden künftig in der flexiblen Schulanfangsphase eine<br />
Beobachtungsphase/Vorklärungsphase durchlaufen. Das bedeutet:<br />
Die Lehrkräfte sind angehalten, alle Möglichkeiten
grundschulpädagogischer Fördermaßnahmen auszuschöpfen, sich<br />
mit den Eltern auszutauschen, Kontakt, wenn erforderlich, zum<br />
Schulpsychologischen Beratungszentrum oder der Jugendhilfe<br />
aufzunehmen. Am Ende dieser Beobachtungsphase, spätestens am<br />
Ende der 2. Jahrgangsstufe, sollte das Feststellungsverfahren des<br />
sonderpädagogischen Förderbedarfs, für das die Erstellung eines<br />
sonderpädagogischen Gutachtens verbindlich ist, abgeschlossen<br />
sein. Die Eltern werden dann informiert und sollen jetzt der ihnen<br />
zugegangenen Empfehlung folgen.<br />
Falls die Eltern sich gegen eine empfohlene Förderung ihres Kindes<br />
in einer Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt<br />
entscheiden und auf eine (weitere) integrative Beschulung ihres<br />
Kindes bestehen, bleibt ihnen in einem solchen Falle nur noch der<br />
Widerspruch und die Klage.<br />
Die neue Schulanfangsphase<br />
Was bringt die neue Schulanfangsphase für Kinder mit<br />
Behinderungen? In der Regel werden die<br />
Kinder die Schulanfangsphase in zwei Jahren durchlaufen. Kinder,<br />
die schnell lernen, können bereits <strong>nach</strong> einem Jahr in die 3. Klasse<br />
wechseln, andere ein drittes Jahr in der Schulanfangsphase bleiben,<br />
ohne dass dies auf die für alle Schülerinnen und Schüler geltende<br />
Schulbesuchsdauer von 10 Schuljahren angerechnet wird.<br />
Altersgemischter Unterricht wird ab dem Schuljahr 2006/2007<br />
vorbereitet. Dieser Jahrgang wird im Schuljahr 2007/2008 geteilt<br />
und nimmt die neuen Schulanfänger mit in seine Lerngruppe auf, so<br />
dass in diesem Schuljahr erstmals die altersgemischte<br />
Schulanfangsphase entsteht.<br />
Der Besuch dieser jahrgangsgemischten Schulanfangsphase ist für<br />
Kinder mit Behinderungen besonders interessant. So werden die<br />
positiven Auswirkungen der Zusammenarbeit von<br />
Vorklassenleiterinnen sowie Lehrerinnen und Lehrern für alle Kinder<br />
genutzt.
Schulen, die auf Grund ihrer besonderen Ausgangslage<br />
Zusatzstunden für die Förderung der Kinder mit<br />
sonderpädagogischem Förderbedarf und / oder von Kindern<br />
nichtdeutscher Herkunftssprache erhalten, können auch für die neue<br />
jahrgangsgemischte Schulanfangsphase bei entsprechender<br />
Förderkonzeption der Schule ein Zweilehrersystem (Regelschullehrer<br />
und Sonderpädagoge) oder temporäre Fördergruppen organisieren.<br />
Hier kann die Schule im Rahmen der Eigenverantwortung<br />
entscheiden, was für sie am günstigsten ist. Sinnvoll ist in jedem Fall<br />
der Einsatz einer weiteren Lehrkraft neben der Klassenlehrerin in der<br />
Schulanfangsphase, weil damit Kontinuität der individuellen<br />
Förderung aller Kinder gesichert werden kann.<br />
Zusätzliche Unterstützung durch Schulhelfer/-innen<br />
Manche Kinder haben neben oder statt des sonderpädagogischen<br />
Förderbedarfs einen besonderen Bedarf an Pflege und Hilfe. Seit dem<br />
Schuljahr 1993/1994 ist die Senatsbildungsverwaltung für die<br />
Finanzierung der schulischen Einzelfallhelfer/-innen, die nun<br />
Schulhelfer/-innen heißen, zuständig. Diese wiederum hat Träger<br />
damit beauftragt, die Schulhelfer/-innen anzustellen und<br />
einzusetzen. Wird von der Schulleitung festgestellt, dass ein Kind<br />
einen Schulhelfer benötigt, schickt sie über die bezirklichen<br />
Koordinatorren/-innen für Schulhelfer einen Antrag zum zuständigen<br />
Schulrat. Hat dieser zugestimmt, wird der Träger beauftragt, eine<br />
Schulhilfe für das betreffende Kind zu stellen. Das durch den so<br />
genannten Haushaltsvorbehalt begrenzte Budget für Schulhelfer<br />
reicht unter Umständen nicht für alle Anträge. In einem solchen Falle<br />
muss, <strong>nach</strong> § 40 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung, die<br />
Eingliederungshilfe greifen.<br />
Zusatzzumessung an Lehrerstunden für den<br />
gemeinsamen Unterricht<br />
Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf sieht das Gesetz für den gemeinsamen Unterricht eine<br />
Zusatzbemessung an Lehrerstunden vor.
Schulen mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten<br />
„Lernen" und „Emotionale und soziale Entwicklung" werden ab dem<br />
neuen Schuljahr erst ab der 3. Klasse eingerichtet. Die dort<br />
eingesparten Lehrerstunden der Sonderpädagogen/-innen sollen in<br />
der Schulanfangsphase eingesetzt werden. Geplant ist eine<br />
pauschale Grundausstattung aller Grundschulen mit<br />
Sonderpädagogen/-innen-Stunden, die von den Schulen<br />
eigenverantwortlich eingesetzt werden.<br />
Bei festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf der<br />
Förderschwerpunkte „Geistige Entwicklung" und „Autismus" werden<br />
für jeden Schüler zurzeit in der Regel 10 Lehrerstunden zur<br />
Verfügung gestellt, wovon 8,5 Stunden der individuellen Förderung<br />
vorbehalten sind.<br />
Für blinde und gehörlose Schüler werden zurzeit 7 Lehrerstunden pro<br />
Schüler zugemessen, wovon 5,5 für die individuelle<br />
sonderpädagogische Förderung des einzelnen Schülers vorzusehen<br />
sind.<br />
Für die Integration schwerstmehrfachbehinderter Schüler wird<br />
zurzeit bedarfsgerecht entsprechend der Stundentafel der Klasse<br />
eine pädagogische Unterrichtshilfe eingesetzt. Eine Ausweitung der<br />
Zahl der integrierten Schwerstmehrfachbehinderten ist nur im<br />
Rahmen der verfügbaren Stellen möglich.<br />
Neue Klassen <strong>nach</strong> dem Integrationsmodell „10 + 5" dürfen nur<br />
eingerichtet werden, wenn dies ausdrücklich genehmigt wird. Im<br />
Einzelfall kann die Anzahl der Schüler ohne sonderpädagogischen<br />
Förderbedarf um bis zu 3 Schüler erhöht werden.<br />
Verlässliche Halbtagsgrundschule<br />
Alle Grundschulen werden bis zum Schuljahr 2005/2006 zu
zurück<br />
verlässlichen Halbtagsgrundschulen ausgebaut. Die Schule kann<br />
Unterrichts- und Pausenzeiten selbstständig planen. Auf Wunsch der<br />
Eltern kann die verlässliche Betreuung des Kindes in einem Zeitraum<br />
von 7.30 bis 13.30 Uhr stattfinden, verbindlich sind jedoch nur die<br />
Unterrichtszeiten.<br />
Ursula Grund-Maharam<br />
Eltern für Integration e.V.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Auch in Berlin: Berufliche Integration für<br />
Menschen mit einer geistigen Behinderung!<br />
Nötig: Praktika und Arbeitsplätze<br />
„Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung" ist ein<br />
Elternverein. Unsere Ältesten sind mittlerweile zwischen 20 und 30<br />
Jahre alt, die meisten kommen aus der Integration. Das heißt, sie<br />
haben von Anfang an Inclusion erfahren – sie sind nicht ausgegrenzt<br />
worden. Ihre Eltern und Unterstüt-zer haben dies mit großem<br />
persönlichen Engagement geschafft. Zumindest in den ersten<br />
Jahren. Doch dann ist Schluss. Trotz neuer Gesetze (z. B. SGB IX)<br />
ist die Integration für Menschen mit Lernschwierigkeiten <strong>nach</strong> der<br />
Schule erst einmal beendet.<br />
Das hat viele Gründe. Stigmatisierende Folgewirkungen der<br />
Diagnose „Geistige Behinderung" erschweren die soziale<br />
Eingliederung. Wider bessere Erfahrung bleibt ein Vorurteil<br />
dominierend: Diesen Menschen wird jegliche Kompetenz<br />
abgesprochen. Defizitorientierte Tests und mangelnde<br />
<strong>nach</strong>schulische und berufliche Alternativen für Menschen, die<br />
ausschließlich praxisnah am Arbeitsplatz lernen können, sind weitere<br />
Gründe.<br />
Defizitorientierung heißt: Es wird <strong>nach</strong> überwiegend medizinischen<br />
Gesichtspunkten festgehalten, was die jungen Menschen nicht<br />
können, es wird aber nicht getestet, was sie (entwickeln) könnten,<br />
was sie wünschten unabhängig von gängigen schichtenspezifischen<br />
und kulturtechnikverhafteten Vorstellungen!<br />
Eltern, die dennoch die Inclusion weiterführen wollen, müssen<br />
arbeits- und trickreich vorgehen und Verbündete in den Behörden<br />
und Institutionen suchen, vor allem aber Arbeitsplätze akquirieren.<br />
Selbst bei vorhandenem Arbeitsplatz musste eine Familie zwei Jahre<br />
warten und das Bundesarbeitsministerium bemühen, bis die<br />
notwendige Assistenz durch Zuweisung von Lohnkostenzuschuss
durch das Arbeitsamt zu finanzieren war. Die zuständigen Behörden<br />
haben zwar den Auftrag, beratend und unterstützend tätig zu<br />
werden – doch nicht alle Mitarbeiter scheinen entsprechend<br />
sensibilisiert und geschult worden zu sein.<br />
Bisher: Kein öffentliches Interesse – auch nicht der<br />
fachlich Zuständigen<br />
Unser Verein arbeitet seit 5 Jahren zusammen mit Eltern, Fachleuten<br />
und anderen Vereinen im <strong>Berliner</strong> Arbeitskreis „Schule und was<br />
dann?". Vier größere Veranstaltungen wurden unter der<br />
Federführung der Lebenshilfe bereits durchgeführt, um auf die<br />
Situation dieser jungen Menschen aufmerksam zu machen. Die<br />
allgemeine Presse, eine breitere Öffentlichkeit zeigte sich nicht<br />
interessiert.<br />
Die letzte Veranstaltung im Juni 2004 zu – „Traum und Wirklichkeit<br />
2004" Berufliche Kompetenzen junger Menschen mit Geistiger<br />
Behinderung – fand keine Teilnahme unter den eingeladenen<br />
<strong>Berliner</strong> Arbeitsämtern. Selbst wenn wir berücksichtigen, dass die<br />
Arbeitsverwaltung viel mit sich selber zu tun hat, hätten wir hier ein<br />
gesetzlich vorgeschriebenes und aufgabenbedingtes Interesse<br />
erwartet.<br />
Die Rolle der Agentur für Arbeit<br />
Das „Nadelöhr" der Agentur für Arbeit müssen alle jungen Menschen<br />
mit einer Behinderung passieren. Es sollte eigentlich ihrer<br />
Unterstützung dienen, stellt sich aber in der Realität häufig als<br />
Verhinderung dar. Die jungen Menschen haben sich faktisch den<br />
Bedingungen der Berufsberatung anzupassen. Diese stellt die<br />
Weichen <strong>nach</strong> gängigen Schubladen.<br />
Wir haben erlebt, dass die Arbeitsverwaltung direkt mit einer<br />
Sonderschule für geistig Behinderte die Verteilung auf Werkstätten<br />
vornimmt. Eltern sind von der Schule kurzfristig über die<br />
Weichenstellung informiert, aber nicht zu den Gesprächen<br />
eingeladen und schon gar nicht über nicht-aussondernde berufliche<br />
Möglichkeiten aufgeklärt worden. Diesen Automatismus lehnen wir<br />
ab.
Wir Eltern erwarten umgekehrt von der Arbeitsverwaltung – und, wie<br />
deutlich, nicht nur von ihr! – gemäß den Forderungen des SGB IX<br />
eine grundlegende Umorientierung: Umschulung der Mitarbeiter/innen,<br />
neue Kriterien für die Bewertung der Kompetenzen von<br />
Menschen mit Lernschwierigkeiten. Wir erwarten die Einbeziehung<br />
derer, die die Jugendlichen am besten kennen, nämlich Eltern,<br />
Lehrer/-innen, Therapeuten/-innen und Einzelfallhelfer.<br />
Wir fordern Individualisierung auch für Menschen mit<br />
Lernschwierigkeiten. Schlichter formuliert: Wir fordern ein Denken<br />
und Handeln von den Bedürfnissen der Betroffenen her.<br />
Berufswünsche<br />
Der erwähnte <strong>Berliner</strong> Arbeitskreis „Schule und was dann?" hat im<br />
Jahr 2000 berufliche Wünsche aller Schulabgänger/-innen von<br />
Sonder- und Integrationsschulen erhoben. Viele finden sich heute in<br />
Angeboten der Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung<br />
wieder, die wir als Institution <strong>nach</strong> wie vor als wertvolle<br />
Errungenschaft ansehen. Für viele Menschen mit Lernschwierigkeiten<br />
kann die Werkstatt ein guter Ort sein. Es gibt jedoch – auch bedingt<br />
durch die schulische Integration – zunehmend Menschen, deren<br />
berufliche Wünsche sich hier nicht wiederfinden, die andere<br />
Arbeitszusammenhänge, andere Inhalte, normalere Umgebungen<br />
wünschen oder für ihre Entwicklung brauchen! Für diese müssen<br />
Möglichkeiten geschaffen werden, auch über Prüfungs-, Aus- und<br />
Weiterbildungsordnungen. Teilleistungsqualifikationen und -<br />
abschlüsse, Zeit für langsameres und anderes Lernen sollten endlich<br />
auch zugelassen werden.<br />
Aus der Erhebung der Berufswünsche der Schulabgänger/-innen geht<br />
hervor, dass die jungen Menschen sehr früh und wiederholt an<br />
unterschiedliche Praktika in unterschiedlichen Strukturen<br />
herangeführt werden sollten. Praktika bedeuten Lebenserfahrung<br />
und ermöglichen erst die Entwicklung von beruflichen Interessen.<br />
Dafür müssen die Agenturen auch Betriebe sensibilisieren und für die<br />
Berufswünsche von Menschen mit geistiger Behinderung öffnen, um<br />
vor Ort für sie zu werben.
Ansätze zu beruflicher Integration<br />
Ein überzeugendes Beispiel kennen wir von der Lebenshilfe Berlin.<br />
(Lebenshilfe Nachrichten 3/02). In einem Modellprojekt erhielten<br />
schwermehrfachbehinderte Menschen aus einer Tagesförderstätte<br />
Praktikumplätze in umliegenden Betrieben. Das Ergebnis war<br />
erfolgreich für alle Teilnehmenden. Die Menschen kamen raus aus<br />
der Isolation ihres Alltags, machten für sie wichtige Erfahrungen –<br />
die Betriebsangehörigen erlebten Menschen mit Schwierigkeiten und<br />
Stärken und verloren Berührungsängste. Wenn das nicht ein<br />
gesellschaftlicher Bildungsauftrag ist! Anregende vielfältige<br />
Erfahrungen sind für ALLE förderlich.<br />
Was für Folgen hat eigentlich ein erfolgreiches Modellprojekt? Wer<br />
setzt sich ein und interessiert sich für eine breite Umsetzung des<br />
Modells in den Alltag ?<br />
Ein Jugendlicher, der ein Praktikum außerhalb der Werkstatt machte,<br />
wollte dort bleiben und mit den ihn akzeptierenden türkischen<br />
Frauen weiterhin Putzarbeit leisten. Seine Eltern versuchen eine<br />
Werkstatt in der Nähe zu finden, die ihn als „ausgelagerten"<br />
Mitarbeiter weiterfördert.<br />
Ein weiterer junger Mann, der gerne Kinder betreut: – mit Mühe als<br />
„werkstattfähig" getestet –, führte ein Praktikum in einem Hort zu<br />
einem ausgelagerten Arbeitsplatz.<br />
Dies sind kleine alltägliche Beispiele für Praktika bzw. die<br />
Umwandlung von Praktika in Arbeitsplätze ... – und doch die<br />
absolute Ausnahme! Wir kennen viele junge Menschen, die ähnliche<br />
und weitergehende Chancen erträumen!<br />
Die Bereitschaft der Werkstatt, Arbeitsplätze auszulagern, ist
eispielhaft.<br />
Dennoch: Reguläre Arbeitsplätze könnten diese „ausgelagerten"<br />
werden, wenn die Jugendlichen die Werkstatt-Förderung flexibel<br />
handhaben und als persönliches Budget z. B. „mitnehmen" könnten.<br />
Anstrengung für berufliche Integration notwendig<br />
Mit dem Vorangegangenen möchte ich daraufhin weisen, dass auch<br />
in Berlin reguläre Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für<br />
Menschen mit geistiger Behinderung geschaffen werden sollten. Das<br />
fordert viel Problembewusstsein, guten Willen, Energie und<br />
Zusammenarbeit unterschiedlicher Partner.<br />
Um die Notwendigkeit dafür zu unterstreichen, folgt ein Beispiel<br />
einer solchen Beschäftigungsinitiative aus Köln. Hier wurde durch<br />
Zusammenarbeit von der Firma Rewe, der Arbeitsverwaltung, des<br />
Integrationsfachdienstes und des Integrationsamtes ein Modell<br />
durchgeführt, das Menschen mit Lernschwierigkeiten Praktika<br />
ermöglichte. (Zs für behinderte Menschen im Beruf, BAG der<br />
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, BIH in<br />
Zusammenwirken mit der Bundesagentur für Arbeit, Heft 1/2004).<br />
Eine kurzfassende Beurteilung im erschien im „echo Handelsjournal".<br />
Aus dem Ergebnisbericht einer Kölner<br />
Beschäftigungsinitiative<br />
„Alle Praktikanten werden ausnahmslos von der Marktleitung und<br />
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als hochmotiviert, engagiert<br />
und offen beschrieben. Sämtliche Bedenken im Vorfeld, etwa<br />
hinsichtlich mangelnder Auffassungsgabe, Behinderung oder Störung<br />
vom Tagesablauf und Belastung für Kollegen, wurden durch den<br />
Einsatz der Praktikanten widerlegt oder bei weitem kompensiert. Wie<br />
die ersten Erfahrungen zeigen, werden die Einschränkungen infolge<br />
der Behinderung etwa bei Arbeitsplanung, Konzentration,<br />
Merkfähigkeit wettgemacht durch Stärken in den Bereichen<br />
Motivation, Ausdauer, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Sozialverhalten."
zurück<br />
Aufruf zu einer <strong>Berliner</strong> Beschäftigungsinitiative<br />
Bedingung für den Erfolg dieses Vorhabens war die Kooperation der<br />
Partner. Nicht nur die Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen und<br />
sollen Neues erproben. Ebenso sind Firmen und Institutionen<br />
gefordert, mit neuen Initiativen neue Wege zur beruflichen<br />
Integration zu eröffnen.<br />
Nach § 83 SGB IX werden Integrationsvereinbarungen<br />
vorgeschlagen. Sie sollten allerdings ausdrücklich auch Menschen<br />
mit geistiger Behinderung einschließen. Insbesondere der öffentliche<br />
Dienst könnte hier Vorbildfunktion übernehmen.<br />
Die wachsende Zahl schulentlassener Integrationsschüler/-innen<br />
trägt ihren Wunsch <strong>nach</strong> Nicht-Aussonderung verstärkt an den<br />
Arbeitsbereich heran.<br />
Vielfältige Erfahrungen, Beispiele, Modelle für berufliche Integration<br />
dieser Menschen liegen vor.<br />
Wann finden sich hier Kooperationspartner zusammen? Wann<br />
beginnt eine Beschäftigungsinitiative in Berlin?<br />
Angelika Scheunemann<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Radfahren mit und ohne Handicap!<br />
Seit Herbst 2001 gibt es in der Biesalski- Schule am Hüttenweg in<br />
Zehlendorf eine Rad-AG, organisiert von der Schulstation. Ein Jahr<br />
zuvor hatte diese Schulstation ihre Arbeit an der Schule begonnen.<br />
An der Rad-AG haben bisher Schüler ab 14 Jahren teilgenommen.<br />
Sie treffen sich mit dem Anleiter der Gruppe, Herrn Robert Freimark,<br />
einmal pro Woche sowie zu außerordentlichen Terminen. Zu Beginn<br />
eines jeden Schuljahres beschäftigen sich die Schüler mit der<br />
Konstruktion eines Fahrrades, lernen die Verkehrsregeln und das<br />
richtige Verhalten im Straßenverkehr.<br />
Da<strong>nach</strong> steigen die Teilnehmer in die Fahrpraxis ein, üben z. B. <strong>nach</strong><br />
links abzubiegen und unternehmen kleine und größere Touren. Diese<br />
Touren sind die wichtigste gemeinsame, verbindende Erfahrung für<br />
die Gruppe. In jedem Jahr gibt es eine Urkunde oder Bestätigung für<br />
die Teilnahme und die erlernten und eingeübten Inhalte.<br />
Zum Abschluss unternehmen die Schüler jedes Jahr eine mehrtägige<br />
Fahrt: In diesem Jahr ging’s <strong>nach</strong> Mirow, in den Nationalpark der<br />
Mecklenburgischen Seenplatte. Wir unternahmen Fahrten durch die<br />
Moorlandschaft am Ostufer der Müritz, haben die Havelquellseen<br />
erkundet und den Teil des Nationalparks bei Neustrelitz. Die<br />
keineswegs besonders trainierten Schüler legten dabei täglich<br />
zwischen 80 und 90 Kilometer zurück, obwohl die Bedingungen<br />
durch schlechtes Wetter alles andere als gut waren.<br />
Die Idee ist nun, die Gruppe durch andere Interessenten außerhalb<br />
der Schule zu erweitern. Mit einem festen Programm soll sich dann<br />
das ganze Jahr hindurch (mit einer Pause von Ende November bis<br />
Mitte März) eine Radwandergruppe als Interessengemeinschaft<br />
zusammenfinden. Das begrüßen auch die ehemaligen Schüler der<br />
Schule, die immer noch an den Ausfahrten teilnehmen.<br />
Melden können sich Interessenten ab 14 Jahren, die ein eigenes<br />
Fahrrad und einen Helm besitzen!<br />
Als Kontaktmöglichkeit steht die Telefonnummer der Schulstation in<br />
der Biesalski-Schule, die 63 21-
zurück<br />
80 13 (Robert Freimark), zur Verfügung oder die E-Mail-Adresse:<br />
Schulstation_Bie_Tandem@gmx.net. Wir freuen uns auf rege<br />
Nachfragen und grüßen alle begeisterten Radfahrer.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Tempelhof-Schöneberg: ein Bezirk, der Kindern und<br />
Jugendlichen mit Behinderungen<br />
Entwicklungsmöglich- keiten anbietet?<br />
Das Ziel eines Forums, das am 4.9.2004 stattfand, war, einen<br />
Überblick über die in dem Bezirk vorhandenen Angebote für Kinder<br />
und Jugendliche mit Behinderungen im Alter von 9 bis 18 Jahren zu<br />
geben.<br />
In seiner Begrüßungsansprache legte der Behindertenbeauftragte<br />
des Bezirks, Herr Eckhard Haase, dar, dass es zu den<br />
vordringlichsten gesellschaftlichen Aufgaben gehört, Menschen mit<br />
Behinderung zu integrieren, und dass damit seines Erachtens nicht<br />
früh genug begonnen werden könne.<br />
Zahlreiche freie Träger der Eingliederungshilfe und andere<br />
Institutionen aus dem Bezirk informierten im Rudolph-Wilde-Park<br />
neben dem Rathaus Schöneberg über die von ihnen angebotenen<br />
Hilfen für junge Menschen mit Behinderung in unterschiedlichen<br />
Lebenslagen: Die thematischen Schwerpunkte waren „Integration in<br />
der Grundschule", „Integration und schulische Förderung",<br />
„Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe", „Einzel- und<br />
Familienhilfe", „Geschwister behinderter Kinder", „Ablösung vom<br />
Elternhaus" und „Berufliche Integration".<br />
Wer zwischen all diesen Informationen mal eine Pause machen<br />
wollte, konnte an der kleinen Bühne immer wieder den<br />
Ensemblemitgliedern des Theaters Thikwà zuschauen und -hören,<br />
die mit zahlreichen Auftritten und Umzügen sehr eindrucksvoll<br />
Theaterarbeit als „Enthinderung" erfahrbar machten.<br />
Eine andere interessante und ganz besondere Erfahrung bot sich für<br />
die Besucher bei einem Podiumsgespräch, bei dem nicht wie so oft<br />
von „Experten" stellvertretend die Situation junger Menschen mit<br />
Behinderung beurteilt wurde, sondern diese selbst die Möglichkeit<br />
hatten und nutzten, von ihren Erfahrungen auf dem Weg in die<br />
Arbeitswelt zu berichten.<br />
Dabei wurde deutlich, dass junge Menschen mit Behinderung auf<br />
dem Weg in die Arbeitswelt in der Regel eine Station mehr passieren<br />
müssen, eben die Phase der so genannten Berufsvorbereitung. Diese
zurück<br />
kann sicher oft zur beruflichen Orientierung beitragen, ist aber<br />
immer auch mit vielen Veränderungen und neuen<br />
Herausforderungen verbunden.<br />
Bemerkenswert ist wohl auch, wie erfolgreich es bei begleitender<br />
Unterstützung verlaufen kann, wenn Werkstattarbeitsplätze<br />
ausgelagert, d. h. die Beschäftigten an einem anderen Ort, z. B. in<br />
einem Schülerladen, tätig werden, neue Erfahrungen sammeln und<br />
sich bewähren können.<br />
Deutlich wurde zudem, dass gerade Betriebspraktika Jugendliche mit<br />
Behinderung sehr gut dabei unterstützen können, ihre<br />
Berufswünsche zu konkretisieren.<br />
BBZ<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Rollstuhl-Pannen-Hilfe zur Diskussion<br />
gestellt<br />
Die Überlegung<br />
Mit zunehmender Rollstuhlfreundlichkeit des öffentlichen<br />
Personennahverkehrs steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mal der<br />
eine oder andere Rollstuhl während des Ausfluges eines<br />
mobilitätsbehinderten Menschen eine Panne hat und er/sie<br />
beispielsweise mit dem E-Rollstuhl in einem Bahnhof oder auf der<br />
Straße „strandet".<br />
Rechtslage – aktuelle Situation<br />
Während alteingesessene Pannendienstleister, wie der ADAC u. Ä.,<br />
versicherungsähnlichen Schutz für Wagen, die für den<br />
Straßenverkehr zugelassen sind, anbieten und tätige (provisorische)<br />
Hilfe leisten, die den PKW/Rad-Fahrer in die Lage versetzen, bis <strong>nach</strong><br />
Hause oder zur nächsten Werkstatt zu fahren und dort selbst einen<br />
Reparaturauftrag zu vergeben, verbleiben Rollstühle im Eigentum<br />
der Krankenkassen, die somit auch bestimmen, welche Werkstatt am<br />
jeweiligen Gerät Reparaturen vornehmen darf.<br />
Dadurch besteht für Rollstuhlfahrer/-innen die nicht zu<br />
unterschätzende Gefahr, für die Gesamtkosten einer Reparatur<br />
aufkommen zu müssen, wenn ein in der Rollstuhltechnik unkundiger<br />
Helfer im Notfall am Rollstuhl „herumbastelt" und hierdurch mehr<br />
Schaden als Gutes angerichtet wird, so dass die Krankenkasse<br />
möglicherweise die Reparaturkostenübernahme ablehnt.<br />
Fazit<br />
Es scheint daher an der Zeit, eine Rollstuhl-Pannen-Hilfe zu
organisieren, die gestrandete Rollstuhlfahrer/-innen mit ihrem<br />
defekten Gerät vom Ort des Geschehens innerhalb von Berlin abholt<br />
und <strong>nach</strong> Hause fährt, von wo aus dann die Krankenkasse vom<br />
Betroffenen über den Schadenfall informiert werden kann.<br />
Das dachten wir uns und begannen eine Rundfrage bei Betroffenen<br />
und Firmen und nun auch hier.<br />
Für und Wider<br />
Die bisherige Umfrage bei Betroffenen, sprich: Rollstuhlfahrern und -<br />
innen, ergab, dass es so viele Lösungsmöglichkeiten zu geben<br />
scheint, eine Panne „zu beheben", wie Rollstuhlfahrer/-innen.<br />
Während die einen darauf vertrauen, dass die „zuständige<br />
Rollstuhlfirma" hilft, haben andere damit schlechte Erfahrungen<br />
gemacht und würden eine Pannen-Hilfe der beschriebenen Art<br />
begrüßen.<br />
Obwohl der ADAC zurzeit eine andere Auskunft erteilt, haben<br />
manche Rollstuhlfahrer/-innen schon vor längerem eine<br />
Fahrradversicherung dort abgeschlossen und erhalten Pannenhilfe<br />
über den ADAC. Hier versucht man sich mit einer Reparatur an Ort<br />
und Stelle.<br />
Andere Betroffene wenden sich vertrauensvoll an einen<br />
Rollstuhlpannendienst, der tätig hilft und Reparaturen an Ort und<br />
Stelle durchführt, der aber in weiten Kreisen einen zweifelhaften Ruf<br />
hat, weil er keine Zulassung zu Reparaturdiensten an Rollstühlen<br />
haben soll.<br />
Firmen, die Rollstühle verkaufen und in deren Zuständigkeitsbereich<br />
damit auch die Pannenhilfe fällt, wären zum Teil froh, wenn sie nicht<br />
zu jeder Tages- und Nachtzeit plötzlich aus dem Haus müssten, um<br />
einem gestrandeten Rollstuhlfahrer Hilfe leisten zu müssen.<br />
Aber da wir noch nicht alle Firmen angesprochen haben, würden wir<br />
uns hier noch über weitere Wortmeldungen bezüglich ihrer<br />
Sichtweise freuen.<br />
Wie es funktionieren soll
Nicht jeder hat z. B. stets ausreichend Geld bei sich, um im Falle<br />
einer Rollstuhlpanne den Rücktransport zur Wohnung im Notfall bar<br />
bezahlen zu können, wenn die zuständige Firma nicht so schnell<br />
kommen kann – besonders in Herbst und Winter. Und: Nicht jeder<br />
Rollstuhl passt in jeden Wagen.<br />
Daher haben sich Fahrer mit ihren entsprechenden Wagen und eine<br />
Telefonzentrale mit Hannelore Bauersfeld zusammengetan und<br />
wollen eine Rollstuhl-Pannen-Hilfe aufbauen, die im Notfall bei<br />
Anruf des Betroffenen in schnellstmöglicher Zeit „Abonnenten" der<br />
Pannen-Hilfe mit für den Transport jeder Art von Rollstühlen<br />
geeigneten Wagen abholen und <strong>nach</strong> Hause fahren wird.<br />
Der Abonnements-Preis wird, je mehr Abonnenten mitmachen, desto<br />
preisgünstiger werden und soll den schnellstmöglichen Transport<br />
eines Rollstuhlfahrers mit seinem defekten Rollstuhl von dem Ort, an<br />
dem der Rollstuhl kaputt ging, bis zur Wohnung beinhalten.<br />
Die Rollstuhl-Pannen-Hilfe wird ihre Tätigkeit aufnehmen, sobald<br />
genügend Abonnenten und Sponsoren gefunden wurden, um einen<br />
zuverlässigen Service gewährleisten zu können.<br />
Paten gesucht<br />
Da eine große Zahl von E-Rollstuhlfahrern/-innen<br />
Sozialhilfeempfänger und somit finanziell nicht in der Lage sind, die<br />
Gebühren für ein Pannen-Hilfe-Abonnement zu finanzieren, würden<br />
wir uns freuen, wenn der eine oder andere, der diese Zeilen liest,<br />
sich bereit erklären würde, eine Pannen-Hilfe-Patenschaft zu<br />
übernehmen.<br />
Ihre Meinung ist gefragt<br />
Wer uns seine Meinung zu diesem Thema mitteilen möchte, schreibe<br />
bitte an:<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
Fax: 040 36 03 44 70 50 (aol-Fax)<br />
E-Mail: RolliPannenHilfe@aol.com
zurück<br />
Unser Anliegen: Ihre Mobilität!<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
GENERATION Interkultureller Pflegedienst<br />
ein gelungenes Konzept einer Pflegestation<br />
Durch die Idee zur Gründung eines interkulturellen Pflegedienstes in<br />
Berlin wurde der Pflegedienst „Generation" Anfang 2001 ins Leben<br />
gerufen. Die Notwendigkeit der Gründung einer solchen Häuslichen<br />
Pflegestation wurde uns innerhalb von ca. drei Jahren Tätigkeit<br />
deutlich, da wir inzwischen mehr als 50 pflegebedürftige Patienten<br />
aus mehreren Kulturen und auch in verschiedenen Sprachen<br />
betreuen und pflegen.<br />
Diese pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen haben<br />
unsere Pflegestation und unser Pflegeteam deshalb ausgesucht, weil<br />
wir neben unseren Pflegearbeiten allen Patienten mit viel Liebe,<br />
Zuneigung und Respekt zu Seite stehen.<br />
Das gelang uns dank der multikulturellen Mentalität unseres<br />
Pflegeteams, das alle pflegebedürftigen Menschen akzeptiert wie sie<br />
sind, ihre Sprache sprechen und ihre Gewohnheiten, Denkweisen,<br />
ihren Glauben und ihre Wünsche wahrnehmen.<br />
Das zwischen unseren Pflegenden und den Patienten eine<br />
harmonische freundschaftliche Beziehung und Kontakte existieren,<br />
darauf sind wir sehr stolz.<br />
Gerade wegen dieser Pflegeeigenschaften und unserer<br />
vielsprachigen Mitarbeiter suchen uns nicht nur Patienten aus<br />
verschiedenen Kulturkreisen auf, sondern genauso auch immer<br />
mehr deutsche Pflegebedürftige.<br />
Wir bemühen uns selbstverständlich auf dem neuesten<br />
Pflegestandard zu bleiben, indem unsere Mitarbeiter an<br />
regelmäßigen Fortbildungen teilnehmen und Seminare und<br />
Veranstaltungen besuchen, wodurch unsere Pflegequalität verbessert<br />
und aktualisiert wird.<br />
Einer unserer besonderen Schwerpunkte in der Arbeit ist u. a.<br />
Informieren und Durchsetzen von Interessen und des Bedarfs
unserer Patienten gegenüber Gesetzgebern und Krankenkassen, d.<br />
h. wir können durch unser Fachpersonal den tatsächlichen<br />
Pflegebedarf ermitteln und Pflegestufen für die Pflegebedürftigen bei<br />
Kassen oder bei den sozialen Einrichtungen durchsetzen.<br />
Informationen unter:<br />
www.Pflegedienst-Generation.de,<br />
Tel.: 0 30/46 79 96 00<br />
Unsere Tätigkeitsbereiche umfassen:<br />
Behindertengerechte Pflege, medizinisch und fachspezifisch –<br />
Schwester Serife und ihr Pflegeteam beraten Sie gerne<br />
● Grundpflege: Körperpflege (waschen, duschen, baden), An-<br />
und Ausziehen, Lagern und Betten<br />
● Hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie: Einkaufen,<br />
Essenzubereitung, Reinigung der Wäsche, Reinigung der<br />
Wohnung<br />
● Begleitung bei Arzt- und Behördengängen<br />
● Pflegefachberatung im Rahmen der Pflegeversicherung<br />
● Psychosoziale Betreuung<br />
● Behandlungspflege: operative Nachsorge und Verbände,<br />
Injektionen, z. B. Insulin, Dekubitusversorgung,<br />
Medikamentengabe, Blutzucker- und Blutdruckkontrolle,<br />
Kompressionsverbände anlegen und vieles mehr<br />
● Familienpflege: in akuten Notsituationen und bei besonderen<br />
Belastungen Weiterführung des Haushaltes, Betreuung und<br />
Versorgung der Kinder<br />
● Beratung kostenlos und unverbindlich. Wir beraten Sie bei<br />
Fragen über Kostenklärung bzw. Kostenübernahme;<br />
● unterstützen Ihre Angehörigen und geben ihnen gerne Tipps<br />
für die Pflege;<br />
● informieren Sie über Pflegehilfsmittel und vermitteln Ihnen<br />
diese;<br />
● organisieren für Sie Tagespflegestätten oder<br />
Kurzzeitpflegeheime;<br />
● vermitteln für Sie fahrbaren Mittagstisch, Fußpflege,<br />
Mobilitätsdienst u. a. m.<br />
Die Finanzierung: Mögliche Kostenträger sind die Krankenkassen, die<br />
Pflegekassen, Bezirksämter, Privat.
zurück<br />
Jabrail Golmohammadi<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Ewig im „Hotel Mama“ wohnen?<br />
„Mein Name ist Raul, ich bin 24 Jahre, Student, habe Glasknochen<br />
und sitze im Rollstuhl. Meine Mobilität ist, wie bei vielen<br />
Rollstuhlfahrern, eingeschränkt. Nach dem Abitur kam die Frage: ,<br />
was nun?‘ Ewig im ,Hotel Mama‘ wohnen oder versuchen auf eigenen<br />
Beinen zu stehen?<br />
Mir war klar, dass ich, aufgrund mangelnder Kraft, nicht alleine<br />
wohnen kann. Zum Glück hatte ein guter (nicht behinderter) Freund<br />
von mir ebenfalls den Plan auszuziehen. Wir planten also eine<br />
Wohngemeinschaft …<br />
Was also tun? Wohnung und Mitbewohner hatte ich schon, aber wer<br />
pflegt mich?<br />
Ich fragte mich, ob mein Mitbewohner auch pflegerische Aufgaben<br />
übernehmen soll?<br />
Kann er jeden Morgen und Abend da sein, wenn ich ihn brauche?<br />
Würde das eine Freundschaft verkraften?<br />
Kann ich so etwas von einem Mitbewohner erwarten?<br />
Die Antwort lautete für mich ganz klar: ,Nein! Ein Mitbewohner ist<br />
‚nur’ ein Mitbewohner, idealerweise ein Freund, aber keine<br />
Pflegekraft‘.<br />
Meine Familie und ich gingen einige Modelle durch. Ambulante<br />
Dienste? Familienpflege? Oder Zivis? Die Wahl war schnell getroffen.<br />
Viele meiner Freunde suchten zu der Zeit gerade ihren<br />
Zivildienstplatz und so kam eines zum anderen. Sie bewarben sich<br />
bei der Sozialstation ,Die Brücke‘ für einen Zivildienstplatz bei der<br />
Individuellen Schwerbehindertenbetreuung (ISB). Die Sozialstation<br />
wiederum stellte sie ein und ließ sie bei mir arbeiten.<br />
Die Arbeiten sind vielfältig, aber keine große Belastung. Neben den<br />
pflegerischen Tätigkeiten begleiten mich Zivis einfach durch den<br />
Alltag wie Freunde. Wir gehen zur Uni, treffen uns mit
zurück<br />
(gemeinsamen) Freunden oder unternehmen auch mal einen<br />
Ausflug, eine Reise oder einen Kinobesuch. Mir ist klar, dass Zivis<br />
keine Dauerlösung sein können, weil 2008 der Zivildienst ja offiziell<br />
abgeschafft werden soll, aber sie sind eine gute Hilfe für die ersten<br />
Schritte in die Selbstständigkeit."<br />
Raul ist ein Beispiel dafür, wie die Zivildienstleistenden der<br />
Sozialstation „Die Brücke" schwerbehinderte Menschen in ihrem<br />
Alltag unterstützen können. Das Angebot richtet sich an<br />
Schwerbehinderte aller Altersstufen und kann zeitlich und inhaltlich<br />
flexibel gestaltet werden. Die Kosten dafür sind, je <strong>nach</strong><br />
Betreuungsdauer, gestaffelt.<br />
Interessenten können sich bei der Koordinatorin telefonisch<br />
informieren oder einen Beratungsbesuch vor Ort vereinbaren.<br />
Tel.: 0 30/61 39 04 97<br />
Gabi Bruster<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
8. Renntag „Bewegung Integrale“<br />
Während die einen stundenlang im Gulaschsuppenmief des<br />
Festzeltes auf der Trabrennbahn Karlshorst die Rennen auf<br />
Monitoren beobachteten, fachsimpelten und „zockten", wurden die<br />
Pferde mal von heftigem Regen, mal von der Dusche durchnässt,<br />
denen man ihre Freude am Laufen aber so richtig ansah, als sie dann<br />
endlich ins Rennen geschickt wurden. „Bewegung Integrale" heißt:<br />
„Integration statt Ausgrenzung" und ist ein Projekt des Behinderten-<br />
Sportverbandes Berlin, der es sich zum Ziel gesetzt hat, mittelfristig<br />
in allen <strong>Berliner</strong> Bezirken integrative Sportangebote unter dem Dach<br />
von „Bewegung Integrale" anbieten zu können. Höhepunkt ist seit<br />
1997 der „Renntag". „Bewegung Integrale" hilft Vorurteile<br />
abzubauen, Barrieren zu überwinden und Freundschaften zu<br />
schließen.<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Die Initiative „Jobs ohne Barrieren“<br />
Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit und<br />
Soziale Sicherung (www.bmgs. bund.de) sind jetzt unter anderem<br />
Informationen über die Initiative „Jobs ohne Barrieren" zu finden.<br />
Diese will auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erreichen, dass<br />
Menschen mit Behinderungen die Chance auf Teilhabe am<br />
Arbeitsleben besser realisieren können.<br />
Die gegenwärtige Situation wird dahingehend als „<strong>nach</strong> wie vor<br />
unbefriedigend" beurteilt: „Unbefriedigend nicht nur für die<br />
Betroffenen, sondern für uns alle. Auch in Anbetracht des<br />
demographischen Wandels und des sich bereits jetzt immer stärker<br />
abzeichnenden Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten,<br />
auf die Fähigkeiten und Erfahrungen von Menschen mit<br />
Behinderungen zu verzichten."<br />
Die Initiative „Jobs ohne Barrieren" entstand ausgehend von der<br />
Einschätzung, dass allein die Änderung von gesetzlichen Regelungen<br />
nicht ausreichend ist, um in diesem Bereich zufrieden stellende<br />
Verbesserungen herbeizuführen. Als notwendig wurde vielmehr ein<br />
Zusammenwirken all derer betrachtet, die Verantwortung für die<br />
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben tragen.<br />
In Betrieben und Dienststellen öffentlicher und privater Arbeitgeber<br />
sollen drei Ziele verfolgt werden:<br />
1. Die Ausbildung und Anstellung von Jugendlichen mit Behinderung<br />
soll mit dem Ziel gefördert werden, möglichst vielen<br />
ausbildungsplatzsuchenden jungen Menschen mit Behinderung einen<br />
Ausbildungsplatz anbieten zu können.<br />
2. Die Beschäftigungschancen von Menschen mit Behinderungen in<br />
kleinen und mittelständischen Betrieben sollen mit dem Ziel
zurück<br />
verbessert werden, dass möglichst alle beschäftigungspflichtigen<br />
Arbeitgeber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit<br />
Behinderung beschäftigen.<br />
3. Die betriebliche Prävention soll gestärkt werden, um die<br />
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten langfristig zu<br />
erhalten und zu fördern.<br />
Es wurden – bezogen auf diese drei Ziele – drei Arbeitsgruppen<br />
eingerichtet und außerdem ein Gremium gebildet, das insbesondere<br />
über die Förderung von Projekten entscheiden soll.<br />
In Kooperation mit Arbeitgebern bzw. Personalverantwortlichen in<br />
Betrieben und Interessenvertretungen der Beschäftigten soll die<br />
Ausbildungs- und Beschäftigungssituation von Menschen mit<br />
Behinderung und die betriebliche Prävention <strong>nach</strong>haltig verbessert<br />
werden.<br />
Auf den Internet-Seiten der Initiative sind zahlreiche Informationen<br />
gesammelt, z. B. viele Pressetexte, Materialien zur Gesetzeslage, zu<br />
diesbezüglichen Publikationen und Datenbanken, zur sozialen<br />
Flankierung des wirtschaftlichen Prozesses in Europa und vieles<br />
mehr. Auch alle teilnehmenden Institutionen und Initiativen sind<br />
vorgestellt und mit Links zu erreichen.<br />
Rainer Sanner<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
zurück<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Internetshop für Menschen mit Behinderung<br />
Das Internetportal www.handicap-network.de verfügt nun über einen<br />
neuen, komfortablen Shop: den Handicap Network Store (http://<br />
handicap-network.websale.biz). Es besteht die Möglichkeit, sich<br />
ausführlich über verschiedenste Behinderungen zu informieren, um<br />
dann mit einem Klick in den Shop zu gelangen, dessen<br />
Produktvielfalt sich an den Bedürfnissen von behinderten und<br />
kranken Menschen orientiert. Auch der Shop ist mit dem Portal<br />
verlinkt, sodass sich vor einer Produktauswahl noch zahlreiche<br />
Informationen kostenfrei und ohne Zeitdruck recherchieren lassen.<br />
Angeboten werden in der Rubrik Gesundheit & Wellness zahlreiche<br />
basische Produkte.<br />
Die weiteren Rubriken Sport & Freizeit, Pflegebedarf, Medizintechnik,<br />
Handicap A–Z, Hilfsmittel, … verfügen über zahlreiche Artikel und<br />
werden (auch gerne durch Anregung der User) ständig erweitert. Im<br />
Angebot sind auch eine Jobbörse, Reisetipps und rechtliche Infos.<br />
Zudem wird über viele Krankheiten und Behinderungen informiert.<br />
BBZ<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
LICHTPAUSE – FÜHLEN UM ZU BEGREIFEN<br />
Wer kennt es nicht, dieses: „Das Berühren der Figüren mit den<br />
Pfoten ist verboten!", das allgemein für Ausstellungen und in Museen<br />
gilt?<br />
Im Kleisthaus (Mauerstr. 53 in Berlin-Mitte) ist „Anfassen erwünscht"<br />
und zwar noch bis zum 18. Oktober 2004 montags bis freitags<br />
zwischen 9.00 und 18.00 Uhr; also:<br />
Hände waschen und nix wie hin!<br />
Lassen Sie mich schweigen über die offiziellen Begrüßungsreden des<br />
Hausherren K.H. Haack, MdB, und von Frau Helga Kühn-Mengel,<br />
MdB, und gleich vom Künstler-Duo Siegfried Saerberg und Thomas<br />
Zwerina schwärmen, deren individuelle Text-Kompositionen einen<br />
bemerkenswerten Vernissage-Abend eindrucksvoll eröffneten.<br />
Alles, was man sah, konnten die beiden auch zum Klingen bringen.<br />
So entstanden Klanginventionen mit eigenem Charakter, die Alltags-<br />
und Naturgegenstände – wie Plastikfolie oder Ziegelsteine – in den<br />
Mittelpunkt einer ungewohnten „Erhörung" rückten.<br />
Lachen und Staunen – Licht und Schatten – lagen eng beieinander<br />
und jeder Klangbeitrag hatte seine ganz eigene persönliche Note.<br />
Auf andere Art verblüffend dann die Ausstellung, deren Grundidee es<br />
war, Werke zu schaffen, die auch auf nicht-visuellem Wege zu<br />
begreifen und zu erfassen sind.<br />
Das Spektrum der Exponate reicht demzufolge von farbigen Bildern,<br />
bei denen Farbschichten und das Papiermaterial auch den taktilen<br />
Zugang ermöglichen, über klassische Skulpturen bis hin zu Objekten,<br />
die sowohl der abstrakten wie der gegenständlichen Moderne<br />
zuzurechnen sind.<br />
Faszination pur, die man nur begreift, wenn man begriffen, sprich:<br />
angefasst, hat.
zurück<br />
Am Donnerstag, dem 30. September, um 19 Uhr, findet zum<br />
Thema „Augenblick der Sinne" oder „Wie fühlt sich Japan an?" eine<br />
Lesung mit musikalischer Begleitung statt.<br />
Am Montag, dem 18. Oktober, um 19 Uhr, trägt das<br />
Kulturensemble des Deutschen Blinden- und<br />
Sehbehindertenverbandes Lieder zum Motto „Musik verbindet" vor.<br />
Man sieht sich im Kleisthaus!<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Beruf: Behindert?<br />
Beruf: Schauspieler<br />
Vor kurzem kündigte Theater Thikwà an, ab Mitte 2005 pro Jahr drei<br />
Wochen Betriebsferien zu machen. Eine solche Regelung bewährt<br />
sich auch bei anderen Theaterbetrieben. Es ist nämlich schwierig,<br />
Auftritte zu organisieren, wenn von 19 Schauspielern immer einige<br />
gerade Urlaub machen. Eine Wohn-Einrichtung, in der langjährige<br />
Ensemble-Mitglieder wohnen, zeigte Unverständnis. Sie erwog, ihre<br />
Bewohner in eine andere Werkstatt zu schicken. Dabei regte sich bei<br />
uns der Verdacht, dass die Behinderten und ihr Beruf von Seiten<br />
ihrer Wohn-Einrichtung nicht ernst genommen werden. Ersteres ist<br />
bedauerlich, denn wenn Behinderte ernst genommen würden,<br />
müssten sie ihre Gleichstellung nicht mühsam per Gesetz einfordern.<br />
Die Nicht-Akzeptanz ihres Berufes erscheint ungewöhnlich in einer<br />
Gesellschaft, deren Mitglieder sich gern über die Arbeit definieren,<br />
obwohl nur 40 Millionen von über 82,5 Millionen Einwohnern<br />
erwerbstätig sind.<br />
Beruf: Arbeiten oder arbeiten lassen<br />
Immerhin gehören Fragen wie „Und was machen Sie so beruflich?"<br />
hier zu Lande zur ersten Kontaktaufnahme. Wer einen Job hat, ist<br />
sich der Anerkennung seines Gegenübers meist sicher. Außen vor<br />
sind da nur die super Reichen. Sie können diskret oder vor den<br />
Augen der Regenbogenpresse ihre Zeit mit dem Ausgeben von Geld<br />
verbringen und andere für sich arbeiten lassen, ohne soziale<br />
Sanktionen zu befürchten.<br />
Beruf: Hilfsbedürftig<br />
Bei Leuten mit Behinderungen werden andere Schubladen der<br />
gesellschaftlichen Hierarchien bedient. Im Gespräch, das mitunter<br />
nicht mal mit ihnen, sondern über sie geführt wird, gilt die Frage der<br />
Behinderung. Da werden ein ausgeübter Beruf, eine ungelebte<br />
Berufung oder noch ungehobene Talente selten vermutet. Wer<br />
behindert ist, gilt erst mal als hilfsbedürftig und wird häufig
zurück<br />
verdächtigt, nichts zu können. Entsprechend niedrig ist die soziale<br />
Anerkennung. Dabei wird vergessen, dass so genannte<br />
Leistungsträger ohne Hilfe überhaupt nicht klarkommen. Viele<br />
männliche Führungskräfte in Industrie und Staat können weder ihre<br />
Termine organisieren noch eine Mahlzeit zubereiten, einen<br />
Staubsaugerbeutel wechseln, einen Klempner rufen oder eine<br />
Waschmaschine bedienen. Aber ihre Helfer heißen eben nicht<br />
„Betreuer", sondern Sekretär/-in, Referent/-in, Assistent/-in,<br />
Haushaltshilfe, Hausmeister, Hotelier, Personal Trainer, Analytiker,<br />
Coach oder (Ehe-) Partner/-in.<br />
Beruf: Auftraggeber<br />
Hoffen lässt das im Mai 2002 in Kraft getretene Behinderten-<br />
Gleichstellungs-Gesetz, denn es verspricht „eine selbstbestimmte<br />
Lebensführung zu ermöglichen". Und diese ist realisierbar, wenn<br />
persönliche Assistenz für Behinderte genauso selbstverständlich wird<br />
wie für Vorstandsvorsitzende. Und das heißt zweifellos, dass der<br />
jeweilige Auftraggeber darüber bestimmt, welchem Beruf er wo<br />
<strong>nach</strong>geht.<br />
Beruf: weniger arbeiten<br />
„Fehlen nur noch die passenden Arbeitsplätze für Menschen mit<br />
Behinderungen ...", möchte ich an dieser Stelle augenzwinkernd<br />
einen kobinet-Leser zitieren. Er kommentierte damit die frisch ins<br />
Netz gestellten barrierefreien Seiten der Bundesanstalt für Arbeit im<br />
Dezember 2003. Aber vielleicht geht Gleichstellung ja auch anders<br />
rum, denn unsere Kultur überhöht womöglich die Erwerbsarbeit.<br />
Antje Grabenhorst<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Rainer Fluck 20 Jahre Dienstjubiläum<br />
„Wir müssen auf die Menschen mit Behinderungen hören, welches<br />
ihre Bedürfnisse sind ... Wir begreifen uns nunmehr als Assistenten<br />
zur Begleitung des Lebensweges für diese Menschen ...Schluss mit<br />
der betreuten Passivität – wir brauchen einen Paradigmenwechsel in<br />
der Behindertenszene."<br />
Zitat Rainer Fluck, Geschäftsführer der Lebenswege gGmbH. Diese<br />
Worte sind Mittelpunkt seines Arbeitslebens – seit nunmehr zwei<br />
Jahrzehnten. Seine Biografie passt zu dem Credo des heute 52-<br />
Jährigen grauhaarigen hochgewachsenen Mannes mit den guten<br />
Augen.<br />
Geboren ist er in Konstanz. Er ist der Vierte von sechs Geschwistern,<br />
darf trotzdem das Gymnasium besuchen, macht ein gutes Abitur,<br />
nicht nur, weil er so wissensdurstig ist, sondern auch, weil er<br />
beweisen muss, dass er dem Vater zu Recht auf der Tasche liegt.<br />
Der nämlich ist sparsam und streng. Ein Arbeiter. Die Mutter ist<br />
natürlich – angesichts der Kinderschar – Hausfrau. Es geht nicht<br />
gerade großzügig zu im Hause Fluck.<br />
Das Studium der Erziehungswissenschaft mit den Fächern<br />
Psychologie und Soziologie an einer der progressivsten Hochschulen<br />
der damaligen Zeit, an der Reformuniversität in Konstanz, muss für<br />
den 19- Jährigen wie eine Befreiung gewesen sein. Ein Studienjahr<br />
lang genießt er die WG, genießt, dass er und seine Kommilitonen<br />
den gleichen Status wie die Professoren haben, dass die Vorlesungen<br />
in der Wohngemeinschaft stattfinden. Er engagiert sich politisch,<br />
lernt die Ausläufer der 68-er kennen, schließt Freundschaften, die bis<br />
auf den Tag dauern. Die anderen mögen den geselligen Badenser,<br />
der zu jedem Streit bereit ist, der aber auch jeden Streit schlichten<br />
kann, weil er offenbar imstande ist, Menschen zusammenzuführen.<br />
Doch dann kommt das zweite Jahr und mit ihm zwei seiner jüngeren<br />
Brüder. Von Stund an ist Bafög- Empfänger Rainer Fluck<br />
verantwortlich für die Geschwister, für ihren Unterhalt, den er neben<br />
dem Studium verdient. Der Vater kassiert das Lehrlingsgeld, erzählt<br />
Fluck auf mein Nachfragen nicht ohne Bitterkeit. Harte Zeiten, die<br />
den jungen Mann prägen.<br />
Dann Abschluss als Diplompädagoge und Arbeit in einem
zurück<br />
Auffanglager für verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche in<br />
Buxtehude. Er hat diejenigen unter seinen Fittichen, die woanders<br />
nicht mehr tragbar sind. Man könnte auch sagen – die Schlimmsten<br />
der Schlimmen – oder: die am meisten vom Leben gebeutelten.<br />
Kinder, junge Leute, vom Schicksal gezeichnete Menschen kreuzen<br />
immer wieder die Wege des Rainer Fluck.<br />
Er begegnet seiner ersten Liebe, folgt ihr <strong>nach</strong> Berlin. Nach<br />
verschiedenen Stationen bestimmt bald die Arbeit mit behinderten<br />
Menschen seinen Alltag. In den 90- er Jahren finden wir ihn in der<br />
Spastikerhilfe e.V. Er ist Leiter eines Wohnheimes mit<br />
Schwerstmehrfachbehinderten. Weiterbildung durch Hospitationen<br />
bei den progressivsten Organisationen sind für ihn genauso eine<br />
Selbstverständlichkeit wie das Umschauhalten in Ländern wie<br />
Schweden, wo es die modernsten Anschauungen über das Leben von<br />
Menschen mit Behinderungen gibt. Es ist kein Wunder, dass Rainer<br />
Fluck <strong>nach</strong> der deutschen Vereinigung auch für den Ostteil Berlins<br />
ähnliche Bedingungen für diese Menschen schaffen möchte wie im<br />
Westteil. Er baut mit seinem Freund Helmut Handke eine<br />
gemeinnützige GmbH auf. Der Name: Lebenswege. Mittlerweile sind<br />
dort 281 Menschen beschäftigt. Sie alle haben ein Ziel: Behinderten<br />
Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.<br />
Fragt man die Mitarbeiter, wie ist er denn so, dieser Fluck, lauten die<br />
Antworten: Beharrlich, charmant, impulsiv, manchmal poltrig,<br />
aufmerksam und – er nimmt sich immer Zeit für den anderen. Wir<br />
wünschen Glück auf allen Lebenswegen!<br />
Karl- Heinz Wigger<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Zusammenschluss Schlaganfallbetroffener<br />
Hättet Ihr es gewusst? – Seit 1991 besteht in Berlin der<br />
Landesselbsthilfeverband Schlaganfall- und Aphasiebetroffener und<br />
gleichartig Behinderter Berlin e. V.<br />
Die selbst betroffenen Gründer wurden als Patienten des Klinikums<br />
Buch und der Klinik Berlin durch die dortigen Ärzte zur Gründung<br />
angeregt und betraten damit Neuland. Weder in Berlin-West noch in<br />
Berlin-Ost gab es zuvor einen Zusammenschluss<br />
Schlaganfallbetroffener, der sich um die Prävention bemühte, über<br />
die neuesten Forschungsergebnisse Hand in Hand mit Ärzten<br />
informierte, Unternehmungen organisierte u. v. a. Vergleichbares<br />
gab es nur in Hessen. Durch die spätere Gründung der Stiftung<br />
Deutsche Schlaganfall-Hilfe erreichte das Thema „Schlaganfall"<br />
bundesweit jedoch mehr Aufmerksamkeit.<br />
Der <strong>Berliner</strong> Verband veranstaltet Informations<strong>nach</strong>mittage zu<br />
medizinischen, therapeutischen und sozialen Themen, etwa: die<br />
Fahrt mit dem Telebus, zur Kranken- und Pflegeversicherung und<br />
ihren Tücken. Die Vorträge und anschließenden Gesprächsrunden<br />
werden von kompetenten Referenten gehalten (Begegnungsstätte<br />
der Volkssolidarität, Torstr. 203). Die fast 280 Mitglieder des <strong>Berliner</strong><br />
Landesverbandes Schlaganfall und Aphasie haben in kleineren<br />
Selbsthilfegruppen die Möglichkeit, auch selbst aktiv zu werden und<br />
private Kontakte zu knüpfen. Lasst euch nicht täuschen, Schlaganfall<br />
ist zunehmend auch ein Problem der „Jungen", auch sie haben eine<br />
Gruppe. Jung und Alt treffen sich bei der Möglichkeit, sich gesund zu<br />
ernähren, in der Entspannungsgruppe, beim Wandern, Boccia,<br />
Kegeln oder bei einem der zahlreichen Ausflüge in Museen, den<br />
Friedrichstadtpalast oder Tagesausflügen in das Umland. Wichtig ist,<br />
dass bei vielen Unternehmungen Rücksicht auf die Rollstuhlfahrer<br />
genommen wird. Da Rehabilitation groß geschrieben wird, ist das<br />
Angebot mit Gymnastik, Therapie im Bewegungsbad, Reha-Sport<br />
und Schwimmen und für die Aphasiker durch computergestütztes<br />
Sprachtraining und Kommunikationsgruppen, alles durch geschulte<br />
Therapeuten, sehr vielfältig. Gedächtnistraining und<br />
Spiele<strong>nach</strong>mittage sollen hier ebenso Erwähnung finden.<br />
Jährlich erscheint das Informationsheft „Trotz Schlaganfall – sinnvoll<br />
leben" mit zahlreichen wissensreichen Artikeln, meist von Ärzten und
zurück<br />
Therapeuten geschrieben, zum Thema Schlaganfall.<br />
Jeweils Dienstag und Donnerstag besteht von 10.00 bis 14.00 Uhr<br />
die Möglichkeit, sich in der Geschäftsstelle, Turmstr. 21, 10559<br />
Berlin, telefonisch (Tel.-Nr. 0 30/39 74 70 97) über etwaige<br />
Adressen oder Therapie- und Rehabilitätsangebote zu informieren.<br />
Es wird aber auch über Prävention, Risikofaktoren und Warnzeichen<br />
eines Schlaganfalls informiert und weiterführende Literatur<br />
empfohlen. Wichtig ist auch die Auskunft über das Treffen von<br />
Angehörigengruppen, denn ihre richtige Mithilfe ist unerlässlich für<br />
den Alltag Betroffener.<br />
Natürlich ist der LVSB z. B. auch auf Messen oder Gesundheitstagen<br />
zu Gast. Das verschafft nicht nur neue Kontakte, sondern es geht<br />
auch um die Bitte um Mithilfe bei einer möglichst lebensnahen<br />
Umsetzung einiger sozialer Projekte. Abschließend sei noch die<br />
Kontoverbindung (<strong>Berliner</strong> Volksbank, Konto-Nr. 3266 784 014, BLZ<br />
100 900 00) genannt, denn auch beim LVSB freut man sich über<br />
jede Spende, aber auch über jeden „Betroffenen", der bei diesem<br />
Artikel aufmerksam wurde.<br />
Franziska Littwin<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Reha fair – Nachlese<br />
In der Zeit vom 2. bis 4. September 2004 fand in den Messehallen<br />
21 und 22 unter dem Funkturm die erste Reha fair statt, eine ernst<br />
zu nehmende Fachmesse und eine ein wenig weniger volkstümliche<br />
Publikumsmesse, wie es ähnliche Veranstaltungen in den<br />
vergangenen Jahren waren, obwohl das Rahmen- und<br />
Unterhaltungsprogramm nichts zu wünschen übrig ließ:<br />
Rollstuhltanz wechselte sich ab mit Sportvorführungen,<br />
Fachvorträgen und anderen Präsentationen.<br />
Bei 164 Ausstellern – Hersteller, Fachhändler, Organisationen,<br />
Vereine und Verbände – konnten sich die 13.000 Besucher der Reha<br />
fair über die Bereiche der Rehabilitation, Integration, Pflege und<br />
Mobilität informieren und beraten lassen.<br />
Die bekannten und bewährten Vereine und Verbände präsentierten<br />
ihre Vereinsarbeit; es wurden neueste Produkte vorgestellt und<br />
Firmen luden zum Ausprobieren verschiedenster Hilfsmittel ein.<br />
Die Organisatoren der ersten Reha fair Berlin, die BS Berlin Service<br />
GmbH, sind mit dem Ergebnis zufrieden: „Von den Besuchern und<br />
den Ausstellern haben wir viel positives Feedback bekommen, und<br />
das Team arbeitet schon heute daran, dass die nächste Reha fair<br />
Berlin noch größer und vielfältiger im Angebot sein wird", teilte<br />
Thomas Hartl, Geschäftsführer der Berlin Service GmbH, mit.<br />
Die Telebus-Fahrer fanden es nicht so prickelnd, dass sie keine<br />
Plakat- und Flyerwerbung für die Messe machen konnten; während<br />
verschiedene behinderte Menschen, denen ich begegnete,<br />
bemängelten, dass es so wenig Freikarten in diesem Jahr gab, da 6<br />
Euro Eintritt für manche doch eine sehr hohe Belastung sind.<br />
Da aber alle unisono daran interessiert sind, dass eine weitere Reha<br />
fair stattfinden wird, sei den „Freikarten-Bedürftigen" geraten, dass<br />
sie ihre Fachfirmen anregen sollten, bei der nächsten Reha fair<br />
auszustellen und ihre Kunden mit einer Freikarte zu einem Besuch<br />
der Messe einzuladen ...
zurück<br />
Das Team der <strong>Berliner</strong> Behinderten-Zeitung hielt am Messe-Samstag<br />
seine Redaktionsbesprechung am BBV-Stand ab. (Bild links)<br />
Nach der Messe ist vor der Messe, bitte notieren Sie daher:<br />
Die zweite Reha fair Berlin wird vom 07. bis 09. September<br />
2006 wieder in den Messehallen unter dem Funkturm<br />
stattfinden.<br />
Man sieht sich!<br />
Hannelore Bauersfeld<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Bus und Bahn für alle – Telebus für die, die<br />
ihn brauchen<br />
Mobilität ist ein hohes Gut. Wer Menschen Mobilität nimmt, sperrt sie<br />
ein und verletzt ihre grundlegenden Rechte. Mit dieser Erkenntnis<br />
haben wir 1987 eine breite Protestbewegung der<br />
Telebusberechtigten entfacht, als nämlich erstmals der seit 1979<br />
bestehende Fahrdienst drastisch eingeschränkt wurde. Es gab<br />
damals im Westberliner U- und S-Bahn-Netz keinen einzigen Aufzug<br />
und kein einziger Bus war rollstuhlzugänglich. Wir verlangten die<br />
Rücknahme der Kürzungen, stellten aber in den Vordergrund unserer<br />
Protestaktionen von Anfang an die Forderung: „Bus und Bahn für<br />
alle!" Der Sonderfahrdienst – das war uns plötzlich klar geworden –<br />
konnte nur eine Ersatzlösung für den für uns unerreichbaren ÖPNV<br />
sein. Es ging jetzt darum, unverzüglich mit der barrierefreien<br />
Umgestaltung des ÖPNV zu beginnen.<br />
Unser Kampf war erfolgreich. Wir fanden Verbündete in den<br />
Senatsverwaltungen und die Verkehrsträger mussten umdenken.<br />
Aus den Jahren 1989/90 stammen wichtige Senats- und<br />
Parlamentsbeschlüsse zum barrierefreien ÖPNV und 1992<br />
verabschiedete der Senat „Leitlinien zum Ausbau Berlins als<br />
behindertengerechte Stadt", an denen wir mitgewirkt haben. Der<br />
heutige Stand: Bei der U-Bahn sind 58 von 170 Bahnhöfen<br />
barrierefrei zugänglich, bei der S-Bahn mehr als 80 von 130 und bei<br />
der Busflotte liegt der Anteil an Niederflurbussen mit Einstieghilfe bei<br />
über 80 %. U- und S-Bahn stellen auf neue niveaugleiche Züge um.<br />
Es gibt wichtige Vereinbarungen wie das Vorhalten und Anlegen von<br />
Rampen bei U- und S-Bahn, Bedienung der Klapprampe und<br />
Hilfestellung durch Busfahrer oder eine tägliche Verkehrsmeldung<br />
über defekte Aufzüge oder andere Störungen im RBB 88,8<br />
Stadtradio.<br />
Trotz dieser eindrucksvollen Entwicklung und obwohl zahlreiche<br />
Rollstuhlfahrer/-innen bereits einen Großteil ihrer Fahrten mit dem<br />
ÖPNV unternehmen, finden immer noch ca. 95 % der Fahrten von<br />
Telebusberechtigten im Sonderfahrdienst und nur höchstens 5 % im
ÖPNV statt. Das ist ein ärgerliches Missverhältnis. Ich behaupte,<br />
dass viele Telebusberechtigte – nicht alle! – einen Großteil ihrer<br />
Fahrten – nicht alle! – sehr gut mit dem ÖPNV machen könnten, es<br />
aber leider nicht tun: Sie trauen sich nicht, sie glauben, sie könnten<br />
es nicht, sie haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder sie<br />
sind über das barrierefreie Angebot des ÖPNV nicht oder nicht<br />
ausreichend informiert ...<br />
Natürlich wird es immer Personen geben, die auf eine<br />
begleitete Tür-zu-Tür-Beförderung angewiesen sind und<br />
deshalb den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht<br />
nutzen können. Ebenso erfordern bestimmte Fahrtumstände<br />
– und das sicher noch auf lange Sicht – den Einsatz eines<br />
besonderen Fahrdienstes, z. B. bei notwendiger Treppenhilfe<br />
oder fehlendem barrierefreien ÖPNV-Angebot. Für diese<br />
Personen bzw. Fahrtumstände brauchen wir den Telebus –<br />
darüber gibt es überhaupt keine Diskussion!<br />
Gerade deshalb aber ist es legitim zu fordern, dass nur die Fahrten<br />
mit dem Telebus gemacht werden, für die es keine Alternative im<br />
ÖPNV gibt. Es ist ein Akt der Solidarität unter den Nutzern/-innen,<br />
den Fahrdienst zu entlasten und für die Berechtigten freizuhalten,<br />
die darauf wirklich angewiesen sind.<br />
Vor diesem Hintergrund müssen wir auch die mittelfristige<br />
Finanzplanung des Senats betrachten, <strong>nach</strong> der im Jahre 2006<br />
der derzeitige und auch noch 2005 zur Verfügung stehende<br />
Telebusetat von 12,1 Mio. Euro auf 9,1 Mio. und 2007 auf 7,1 Mio.<br />
gekürzt werden soll. So sehr die Kürzungspläne schockieren und<br />
verständlichen Widerstand herausfordern, so wird es doch<br />
zunehmend schwierig, die Aufrechterhaltung zweier voneinander<br />
unabhängiger Parallelsystem zu legitimieren. Mit dem weiteren<br />
barrierefreien Ausbau des ÖPNV muss es sukzessive zu einer<br />
Reduzierung des Fahrdienstes kommen. Ich bin nicht für die<br />
Kürzungen, jedoch realistisch genug zu sehen, dass wir sie nicht<br />
verhindern können. Ich behaupte sogar, dass der Weiterbestand des<br />
Telebusses akut gefährdet ist, wenn wir nicht jetzt die Weichen zu<br />
einem integrierten kostengünstigeren Mobilitätskonzept stellen.
Dieses erfordert jedoch grundlegende Änderungen sowohl auf Seiten<br />
der Verkehrsträger als auch im Verhalten der behinderten Fahrgäste.<br />
Die Verkehrsträger müssen sich als Mobilitätsdienstleister für<br />
alle – auch für behinderte Fahrgäste – verstehen und Vertrauen<br />
schaffen, indem sie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bieten: So<br />
müssen die Aufzüge besser gewartet und schneller repariert werden.<br />
Falls doch einmal jemand festsitzt, muss ein Notdienst die<br />
Weiterbeförderung übernehmen. Pendel- und Schienenersatzverkehr<br />
sind so zu organisieren, dass auch Fahrgäste im Rollstuhl<br />
weiterkommen. Die Hilfsbereitschaft von Busfahrern lässt manchmal<br />
zu wünschen übrig – das muss besser werden. Ganz wichtig ist die<br />
Information, die durch ein barrierefreies Online-Fahrinfo optimiert<br />
werden soll. Dieses wird – hoffentlich bald – allen Beratungsstellen,<br />
aber auch dem einzelnen Fahrgast an seinem PC zur Verfügung<br />
stehen und verlässliche barrierefreie Fahrverbindungen auswerfen.<br />
Mobilitätsdienstleister für alle heißt für die Verkehrsträger aber auch,<br />
den Gesamtkomplex der Behindertenbeförderung aus einer<br />
Hand zu organisieren. Die Beförderung von Rollstuhlfahrern/-innen<br />
muss zu einem selbstverständlichen Segment des ÖPNV werden,<br />
egal, ob im Linien- oder im Bedarfsverkehr.<br />
Verändern muss sich aber auch die Einstellung der<br />
Telebusberechtigten. Sie müssen sich – so gut sie es können – auf<br />
den ÖPNV einlassen, sich über Fahrmöglichkeiten informieren oder<br />
informieren lassen, an Übungsterminen zum Ein- und Aussteigen<br />
teilnehmen oder zusammen mit erfahrenen Nutzern/-innen das<br />
ÖPNV-Fahren trainieren. Von dem Ergebnis werden viele begeistert<br />
sein, wenn sie nämlich feststellen, wie viel mehr Freiheit und<br />
Unabhängigkeit ihnen der ÖPNV bietet.<br />
Noch ein Wort zur Eigenbeteiligung: Sie soll Steuerungswirkung<br />
haben und die Berechtigten animieren, möglichst häufig mit dem für<br />
sie (fast) kostenlosen ÖPNV zu fahren. Wer seine Telebusfahrten im
zurück<br />
Rahmen von bis zu 14 Einzelfahrten hält, für den würde sich bei der<br />
Zuzahlung nichts ändern. Taschengeldempfänger wären befreit. Über<br />
eine Härtefallregelung für „Vielfahrer" und Ehrenamtsfahrten muss<br />
weiter <strong>nach</strong>gedacht werden.<br />
Martin Marquard<br />
(Landesbeauftragte für Behinderte bei der Senatsverwaltung für<br />
Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz)<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Unterwegs mit Mobidat im Olympiastadion:<br />
Ein Stadion mit vielen Stationen<br />
Die Geschichte des heute denkmalgeschützten Olympiastadions<br />
beginnt mit einer Pferderennbahn 1907. Ein Stadion, das „Deutsche<br />
Stadion", wurde 1913 gebaut und war mit 30 000 Plätzen weltweit<br />
das größte. Berlins Bewerbung als Austragungsort der Olympiade<br />
1916 machte der Erste Weltkrieg zunichte, die Spiele fielen aus.<br />
1930 bewarb sich Berlin erneut um die Olympischen Spiele und<br />
diesmal fanden sie tatsächlich 1936 in Berlin statt.<br />
Aber zuvor kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Das Stadion<br />
wurde Besitz des Reichsinnenministeriums. Der Name der ganzen<br />
Anlage hieß jetzt „Reichssportfeld" und der „Reichsführerring für<br />
Leibesübungen" trieb hier Sport, sicher „Reichssport".<br />
Hitler befahl den völligen Neubau eines Großstadions, eine<br />
Neuanlage von Sport- und Kampfstätten mit einem Gelände für<br />
Massenaufmärsche.<br />
Unter der künstlerischen Oberleitung von Werner March und der<br />
möglicherweise unbedeutenden Mitwirkung eines Architekten, der<br />
damals mit meiner Mutter verlobt war, wurde das neue Stadion 1935<br />
fertig. Das Richtfest wurde übrigens von meinem Vater so ausgiebig<br />
gefeiert, dass er fast nicht mein Vater geworden wäre.<br />
Am 1. August 1936 war die Eröffnung der Olympischen Spiele und<br />
sie waren ein riesiger Erfolg für das damalige Deutschland.<br />
1945 – der Glockenturm war so beschädigt, dass die Briten, in deren<br />
Sektor jetzt das Stadion lag, ihn sprengen mussten, aber schon bald<br />
begannen die Instandsetzungsarbeiten, um das Stadion wieder zu<br />
nutzen. 1950 wurde es in „Olympiastadion" umbenannt, der<br />
Glockenturm wieder aufgebaut. Eine Flutlichtanlage bestimmte lange<br />
Zeit, vielleicht nicht besonders günstig, das Bild des inzwischen zum<br />
Baudenkmal erklärten Stadions. Flutlicht war damals eine Sensation.<br />
Zur Premiere spielte Manchester United, ich erinnere mich noch<br />
genau.
Als die Mauer fiel, bewarb sich Berlin erneut zur Olympiade. Pläne<br />
wurden geschmiedet, aber die Olympiade fand in Sydney statt. 1998<br />
beschloss der Senat, in Abstimmung mit dem Bund, das<br />
Olympiastadion zu sanieren, unter denkmalspezifischem Aspekt.<br />
Der Umbau dauerte vier Jahre, viel länger als der ursprüngliche Bau<br />
aus fränkischem Muschelkalk in den dreißiger Jahren. Eine<br />
aufwändige Sanierung – jede einzelne Platte wurde abgenommen<br />
und gereinigt, einige Muschelkalkplatten erneuert, die<br />
Stadioninnenfläche, internationalen Anforderungen entsprechend,<br />
ca. zweieinhalb Meter abgesenkt. Eine gelungene Überdachung, die<br />
über dem Stadion zu schweben scheint, schützt jetzt<br />
75 000 Zuschauer. Unter Berücksichtigung der alten Bausubstanz<br />
und der strengen Auflagen des Denkmalschutzes ist eines der<br />
modernsten Stadien Europas entstanden – dennoch gab es Kritik.<br />
Der Landesbehindertenbeauftragte Martin Marquard dokumentierte<br />
Fehler, Mängel für Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte und Schwerhörige.<br />
Seit 2000 erklärt er jährlich in einem ausführlichen Bericht Verstöße<br />
gegen die Regelungen zur Gleichstellung von Menschen mit<br />
Behinderungen beim Umbau des Olympiastadions. So schrieb er<br />
2002:<br />
„Die Kritik an der Um- und Neugestaltung des Olympiastadions, die<br />
der Landesbehindertenbeauftragte für Berlin in den beiden<br />
vorangegangenen Berichten sehr dezidiert vorgetragen hat, hat<br />
bisher in keinem Punkt zu akzeptablen Lösungen geführt."<br />
Auch der Vorsitzende des <strong>Berliner</strong> Behindertenverbandes, Dr. Ilja<br />
Seifert, und Horst Lemke, der stellvertretende Vorsitzende und<br />
Sprecher des Hertha-Rolli-Fanclubs, wiesen in den vier Jahren der<br />
Bauphase auf Fehler hin. Bei Herthaspielen können die<br />
Rollstuhlfahrer, die hinter den Fans in der Fankurve sitzen, nichts<br />
sehen. Die Fans stehen, schwenken Fahnen oder zeigen ihre<br />
Begeisterung durch Aufspringen, das gehört zum Fußball. Ein<br />
Beamter soll tatsächlich auf die Beschwerden der Rollifahrer<br />
geantwortet haben, dass die aufspringenden Fans sich eben nicht<br />
vorschriftsmäßig verhalten würden.<br />
Dem Behindertenverband von Berlin blieb nichts weiter übrig, als zu<br />
klagen. Ortstermin ist am 27. September in diesem Jahr, <strong>nach</strong> der<br />
Eröffnungsfeier. Nun verpflichtete sich das Land Berlin, <strong>nach</strong>träglich<br />
die Rollstuhlplätze mit einem Podest zu versehen und die Reihen<br />
davor zu sperren, weiter die Treppenstufen für Sehbehinderte zu<br />
markieren und Geländer für Gehbehinderte einzubauen.
zurück<br />
Rückblickend ist festzustellen:<br />
Es gab viel Ärger. Es kostete viel Zeit. Und nun kostet es auch noch<br />
zusätzliches Geld.<br />
Gloria Lajer<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
bfr-newsletter<br />
Ausgabe 09/2004<br />
Aktuelle Reiseinfos für mobilitätseingeschränkte Menschen vom<br />
Netzwerk barrierefrei reisen (bfr) beim Bundesverband Selbsthilfe<br />
Körperbehinderter e.V.<br />
Inhalt:<br />
1. Studie nun als Vollversion erhältlich<br />
2. Urlaub mit dem Rollstuhl in der Ostseeregion<br />
3. Kennen Sie Balatonmariafürdö wirklich noch nicht ?<br />
4. Schottland zugänglich<br />
5. Eine Ferienwohnung - besonders für Gehörlose<br />
6. Karlskrona - Stadt schwedischer Marinetradition<br />
7. Urlaub in Neuengland<br />
8. Bekanntschaft mit dem Fläming<br />
9. Zum Training <strong>nach</strong> Rheinsberg<br />
10.Dritte Auflage eines Stadtführer für Friedrichshafen<br />
11.Jugendherbergen im Rheinland<br />
1. Studie nun als Vollversion erhältlich<br />
Bereits die Kurzfassung der Studie `Ökonomische Impulse eines barrierefreien<br />
Tourismus für alle' hatte großes Interesse gefunden, lieferte sie doch erstmals<br />
verlässliche Daten zum Kundenpotenzial und Reiseverhalten der Zielgruppe<br />
eines barrierefreien Tourismus. Ende August wird nun auch die komplette<br />
Studie erhältlich sein. Gegenüber der Kurzfassung enthält die Langfassung<br />
eine ausführlichere Darstellung der Untersuchungsgebiete mit den Good -<br />
Practice - Beispielen sowie der vertiefenden Auswertung der Befragungen.<br />
Neben einem Vorwort des Staatssekretärs im BMWA sind auch die Statements<br />
aus dem Präsentations-Workshop in Berlin <strong>nach</strong>zulesen. Eine<br />
englischsprachige Zusammenfassung und weiteren Grafiken und Fotos runden<br />
den Inhalt der Studie als nützliches Arbeitsmaterial ab.<br />
Die Langfassung der Studie "Ökonomische Impulse eines barrierefreien<br />
Tourismus für alle" ist in der Reihe Münstersche Geographische Arbeiten als
Nummer 47 unter der ISBN: 3-9809592-1-X für 24 Euro im Buchhandel<br />
erhältlich oder für Abonnenten des bfr-newsletters zum Sonderpreis von 18<br />
Euro, plus Porto und Versand, zu bestellen bei:<br />
NEUMANNCONSULT - Bahnhofstr. 1-5 - 48143 Münster; Tel.: 0251 162 54-<br />
30 / E-Mail: info@neumann-consult.com (bitte als Stichwort "bfr - newsletter"<br />
angeben)<br />
zurück<br />
2. Urlaub mit dem Rollstuhl in der Ostseeregion<br />
Mobilitätseingeschränkte Liebhaber eines Urlaub im Ostsee-Raum erhalten mit<br />
der kürzlich erschienen Broschüre "Urlaub mit dem Rollstuhl in der<br />
Ostseeregion" ein nützliches Informationsmaterial zur Vorbereitung ihrer<br />
nächsten Urlaubsreise. Das 26 Seiten starke Heft enthält neben allgemeinen<br />
Hinweisen und vielen nützlichen Adressen zur individuellen Reisevorbereitung<br />
Angaben über Hotels sowie weitere Ferienunterkünfte und Freizeitangeboten<br />
in Mecklenburg-Vorpommern, der dänischen Region Lolland-Falster, dem<br />
Nordosten der schwedischen Provinz Skane und der polnischen<br />
Wojewodschaft Westpommern.<br />
Diese Broschüre ist erhältlich von:<br />
LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e.V.<br />
Griebnitzer Weg 2 - 18196 Dummersdorf<br />
Tel. 038208 60 672 / Fax 038208 60 673 / E-Mail: landurlaub.mv@t-online.de<br />
zurück<br />
3. Kennen Sie Balatonmariafürdö wirklich<br />
noch nicht ?<br />
Der BSK-Reiseservice bietet allen die Möglichkeit, diese beliebten Ferienorte<br />
am Südwestufer des Plattensees in Ungarn kennen zu lernen. Er bietet eine<br />
Sonderreise dorthin an und so die Chance, schöne Stunden an den flachen<br />
Stränden des See, bei einer Balatonrundfahrt sowie bei Besuchen am Heviz<br />
und in Budapest, in der Puszta oder bei einer Weinprobe zu verbringen.<br />
Weitere Auskünfte zu diesem Angebot erteilen Hanna Herbricht (Tel: 06294-<br />
428150) Margret Schelter (Tel: 06294-428151) oder Michael Geiss (Tel: 0711-<br />
2858202), beziehungsweise sind zu erhalten über:<br />
BSK-Reiseservice - Altkrautheimer Straße 20 - 74238 Krautheim<br />
Fax 06294 42 81 59 / E-Mail: reiseservice@bsk-ev.de<br />
zurück
4. Schottland zugänglich<br />
"Accessible Scotland" - der neue Führer des schottischen Tourismusbüro zu<br />
zugänglichen Unterkünften und Sehenswürdigkeiten für Besucher mit<br />
Körperbehinderungen gibt auf fast 90 Seiten viel Information über die Eignung<br />
von Unterkünften sowie über die Zugänglichkeit von Sehenswürdigkeiten in<br />
Schottland. Obwohl nur in englischer Sprache verfügbar ist diese Broschüre,<br />
dank ihrer klaren Gliederung und dem Einsatz von Piktogrammen, auch für<br />
jene ein interessanter Fundus zur Vorbereitung einer Reise <strong>nach</strong> Schottland,<br />
die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Entsprechende Information<br />
findet sich im Internet unter www.visitscotland.com . Die Broschüre kann<br />
bestellt werden bei:<br />
Scottish Borders Tourist Board - Customer Service Centre<br />
Shepherds Mill - Whinfield Road - Selkirk TD7 5DT<br />
Tel: 0044 870 6080404 / Fax: 0044 1750 21886 / Email: CSC@scot-borders.co.<br />
uk<br />
zurück<br />
5. Eine Ferienwohnung - besonders für Gehörlose<br />
Im Pfarrhaus in Thelkow, einem 300 jährigen, sanierten Fachwerkhaus, bieten<br />
Rosemarie und Jürgen Stegmann eine gemütliche Ferienwohnung. Da sich die<br />
Ferienwohnung in der ersten Etage befindet ist sie für Mobilitätseingeschränkte<br />
weniger geeignet. Besonders für Gehörlose dürfte der Urlaub hier jedoch zum<br />
Erlebnis werden, denn Rosemarie Stegmann ist Gehörlosenseelsorgerin im<br />
Ruhestand und beherrscht die Gebärdensprache. In der schönen Umgebung<br />
des Recknitztales, nur 40 Kilometer von der Ostsee entfernt bieten sich hier<br />
viele Möglichkeiten, einen erholsamen Urlaub zu verbringen. Die<br />
Ferienwohnung ist 30qm groß und besitzt eine extra Küche. Zusätzlich ist die<br />
Nutzung der Diele mit 20qm möglich. Ein zusätzlicher Stellplatz für ein oder<br />
mehre Zelte ist kostenlos möglich. Interessenten können sich unter www.fewostegmann.m-vp.de<br />
schon einmal ein Bild von dieser Ferienwohnung machen<br />
oder sich notwenige Information schicken lassen von:<br />
Rosemarie und Jürgen Stegmann - Unterdorf 01(Pfarrhaus) - 18195 Thelkow<br />
Tel. 038205 80 073 / Fax 038205 80 072 / E-Mail: stegmann-thelkow@t-online.<br />
de<br />
zurück<br />
6. Karlskrona - Stadt schwedischer Marinetradition
Im Jahre 1680 wurde mit dem Bau der schwedischen Marinebasis Karlskrona<br />
begonnen. Heute auch Zentrum schwedischer Informatik-Industrie erstreckt<br />
sich ihr Territorium über 33 Inseln und hat als Klein Stockholm auch dem<br />
Besucher mit Mobilitätseinschränkung viel zu bieten: Ein allgemein<br />
zugängliches Marinemuseum, das ebenerdig zugängliche Blekinge Museum<br />
und eine interessante Stadt mit modernen bauten und einem Stadtteil, das von<br />
den typisch schwedischen Holzhäusern gebildet wird. Weitere Information<br />
finden Interessenten für eine Besuch dieser Stadt im Internet unter www.<br />
karlskrona.se/turism oder erhalten diese von:<br />
Karlskrona Turistbyrå - Stortorget 2 - SE 371 21 Karlskrona<br />
Tel. 0046 455 30 34 90 / Fax 0046 455 30 34 94<br />
E-Mail: turistbyran@karlskrona.se<br />
zurück<br />
7. Urlaub in Neuengland<br />
Die Bundesstaaten an der Atlantikküste gehören zu den gefragtesten<br />
Reisezielen in den USA. Wer die USA in ihrer Ursprünglichkeit kennen lernen<br />
möchte, ist hier genau richtig. Einer der interessanten Plätze dieses<br />
Landstriches ist das am Kennebec River gelegene Bath. Hier bietet sich<br />
außerdem die "Inn at Bath", eines der gastfreundlichsten Bed and Breakfast -<br />
Unterkünfte in Maine, für einen erholsamen Urlaub an. Das Gasthaus verfügt<br />
über schöne und geräumige Gästezimmer mit separaten Bädern, Klimaanlage,<br />
Kabelfernsehen, Video- und Kassettenrekorder sowie Telefon. Das geräumige<br />
Gartenzimmer im ersten Stock ist mittels Rampe vom Gartentor her<br />
zugänglich. Weitere Information finden Interessenten auf der Website http://<br />
www.innatbath.com /oder erhalten diese telefonisch über 001 800-423-0964.<br />
zurück<br />
8. Bekanntschaft mit dem Fläming<br />
Am 2. und 3. Oktober lädt der Handwerkerhof im westbrandenburgischen<br />
Görzke alle ein, die den Fläming mit seiner hügligen Waldlandschaft, seinen<br />
traditionellen Handwerken und Produkten sowie seinen Menschen kennen<br />
lernen möchte. Entlang der "Straße des guten Geschmack" können Gebäck,<br />
edle Forellen und weitere wohlschmeckende Produkte der Region probiert<br />
werden. Der Handwerkerhof ist mit einen Rollstuhl gut zu befahren. Alle<br />
Gebäude sind im Erdgeschoss mittels Rollstuhl zugänglich. Eine<br />
entsprechende Toilette ist vorhanden. Rollstuhlnutzer können bis zum 10.<br />
September (Tel. 03848 60 001) bei Bedarf einen Shuttle zum Handwerkerhof<br />
anmelden. Weitere Information findet sich dazu im Internet unter www.flaeming.<br />
net und ist erhältlich von:
Naturparkzentrum Alte Brennerei Raben<br />
Brennereiweg 45 - 14823 Rabenstein / OT Raben<br />
Tel. 033848 60 004 / E-Mail: info@flaeming.net<br />
zurück<br />
9. Zum Training <strong>nach</strong> Rheinsberg<br />
Speziell günstige Angebote unterbreitet das "Haus Rheinsberg - Hotel am See"<br />
Sportgruppen, Sportvereinen oder Sportverbänden wenn sie in der Zeit von<br />
September bis Mitte Dezember 2004 in Gruppen ab zehn Personen an zwei<br />
oder sieben Tagen ihr Training im Hotel am See in Rheinsberg durchführen.<br />
Weitere Information gibt es darüber im Internet unter www.hausrheinsberg.de<br />
und ist erhältlich von:<br />
Haus Rheinsberg Hotel am See - Donnersmarckweg 1 - 16831 Rheinsberg<br />
Tel. 033931 34 40 / Fax 033931 34 45 55 / E-Mail: post@hausrheinsberg.de<br />
zurück<br />
10. Dritte Auflage eines Stadtführer für Friedrichshafen<br />
Wer als mobilitätseingeschränkter Reisender am Bodensee Urlaub macht, hat<br />
gewiss auch die Stadt Friedrichshafen besucht und konnte sich dort über das<br />
gute Angebot von Informationen für Besucher mit Behinderungen freuen. Die<br />
Ausgabe 2003 / 2004 der Broschüre "Mit dem Rollstuhl unterwegs in<br />
Friedrichshafen" ist die bereits dritte Auflage ihre Art. Auf rund 30 Seiten findet<br />
sich in der handlichen Broschüre alles was der körperbehinderte Besucher bei<br />
seinem Aufenthalt in Friedrichshafen an Grundinformation benötigt. Ein Plan<br />
der Innenstadt mit wichtigen Orientierungspunkten sowie einer Übersicht der<br />
Parkplätze und Toiletten für Menschen mit Behinderungen erleichtert dem<br />
ortsfremden Besucher die Orientierung. Diese Broschüre ist erhältlich bei:<br />
Tourist - Information Friedrichshafen<br />
Bahnhofsplatz 2 - 88045 Friedrichshafen<br />
Tel. 07541 30 010 / Fax 07541 725 88 / E-Mail: tourist-info@friedrichshafen.<br />
de<br />
zurück<br />
11. Jugendherbergen im Rheinland<br />
Einen Überblick der für Rollstuhlnutzer geeigneten Jugendherbergen im<br />
Rheinland vermittelt ein Faltblatt mit dem Titel "Mobil in Jugendherbergen".
zurück<br />
Dies ist erhältlich bei:<br />
DJH Service-Center Rheinland - Düsseldorfer Straße 1 - 40545<br />
Düsseldorf<br />
Tel. 0211 5 77 03 49 / Fax 0211 5 77 03 50<br />
E-Mail: service-center@djh-rheinland.de<br />
zurück<br />
Ansprechpartner für weitere Auskünfte:<br />
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. - Reiseservice,<br />
Frau Hanna Herbricht<br />
Altkrautheimer Straße 20 - Postfach 20 – 74236 Krautheim / Jagst<br />
Tel. 06294 42 81 50 / Fax 06294 42 81 59 - E-Mail:<br />
Reiseservice@bsk-ev.de<br />
Kontakt zum „Netzwerk barrierefrei reisen“ über das Internet auf:<br />
www.bsk-ev.de , die E-Mail-Adresse: nw-bfr@bsk-ev.de oder<br />
Hartmut Smikac (Tel. 03494 26228)<br />
Der Newsletter kann über die Adresse nw-bfr@bsk-ev.de bestellt<br />
oder abbestellt werden.<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Leserbriefe:<br />
● Hartz-Käse u. a.<br />
● Sieht so die Gesundheitsreform aus?<br />
● Warten auf Grundsicherung – schon seit über 1 ½ Jahren<br />
Hartz-Käse u. a.<br />
Da wir ja die Bundesrepublik Deutschland sind und nicht eine<br />
Reform- und Kommissionsrepublik sind ...?! Wir haben uns wohl<br />
rückblickend – und mit noch nicht überstandenen Pleiten – mit<br />
Gesundheitsreform, Hartz-Käse, Maut-Chaos, Tempodrom,<br />
Bankenskandal ... zu beschäftigen. Deshalb: Mein besonderer Dank<br />
für die harten kritischen Worte an: Herrn, Brinkmann, Herrn Gregor<br />
Gysi, Herrn „Mensch Meyer"<br />
Wolfgang Frost<br />
zurück<br />
Sieht so die Gesundheitsreform aus?<br />
Am 12. 7. 2004 wurde ich im VIVANTES Klinikum Auguste Viktoria in<br />
der Schöneberger Rubensstraße an den Hämorrhoiden operiert. Ich<br />
wählte diese Klinikum, weil ich es in 10 Minuten zu Fuß von meiner<br />
Wohnung erreichen kann.<br />
Am nächsten Morgen teilte mir der Stationsarzt mit, dass ich <strong>nach</strong><br />
Hause gehen soll! Ich sagte ihm, dass ich kein Wasser lassen kann.<br />
Er meinte nur: „Das kommt von der Narkose. Das gibt sich wieder!"<br />
Am Abend des 13. 7. schleppte ich mich unter starken Schmerzen<br />
zur ersten Hilfe des AVK. Dort erzählte ich die Vorgeschichte und<br />
bekam endlich einen Blasenkateter! Als ich dies am 15. 7. meinem<br />
Chirurgen erzählte, war er ganz entsetzt.<br />
Inzwischen bin ich (am 16. 8.) im Universitätsklinikum Benjamin<br />
Franklin erfolgreich an der Prostata operiert worden, und es geht mir<br />
wieder recht gut. Wenn ich das nächste Mal ins Krankenhaus<br />
müsste, wähle ich wieder das Universitätsklinikum Benjamin Franklin.
zurück<br />
Hans-Christian Arlt<br />
zurück<br />
Warten auf Grundsicherung – schon seit über 1 ½ Jahren<br />
Sicher teilen viele behinderte und ältere Menschen dieses Problem.<br />
Ich wohne in Marzahn-Hellersdorf.<br />
Es ist ja bekannt, dass die Ämter ohne zusätzliches Personal die<br />
Aufgabe übernehmen mussten und dass viele Anträge gestellt<br />
wurden. Da die Not eben groß ist, bei steigenden<br />
Lebenshaltungskosten!<br />
Man hört, dass es sich ohnehin sehr schwierig gestaltet, wenn man<br />
mit einem Partner zusammenlebt, auch wenn dieser nur von einem<br />
Minimum existiert und es ohne gegenseitige Unterstützung schon<br />
jetzt nicht mehr ginge. Und dies alles mit Blick auf Hartz IV! Zu<br />
guter Letzt behauptet auch noch ein Abgeordneter der CDU-Fraktion,<br />
dass erst seit Anfang 2004 ein Anspruch auf diese Leistung bestehe!<br />
Und auch vom „<strong>Berliner</strong> Kurier" kamen nur Empfehlungen statt<br />
aktiver Hilfe!<br />
Einmal habe ich in der langen Zeit des Wartens auf<br />
Grundsicherungsleistungen, d. h. auf fehlendes Geld, etwas<br />
Schriftliches in die Hand bekommen!<br />
K. Nawrotzky<br />
zurück<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Wichtig ist eine individuelle Förderung der<br />
Kinder<br />
– auch in der Schule!<br />
Am Anfang sei es ganz schwer gewesen: Für die aus der Türkei<br />
stammende Mutter habe ein erstes großes Problem <strong>nach</strong> der Geburt<br />
ihrer Tochter in den fehlenden Deutschkenntnissen bestanden. Da<br />
sich bei ihrer Tochter Aysel schon bald eine starke<br />
Entwicklungsverzögerung zeigte, wurde es nötig, sich gut zu<br />
informieren, auf dieser Grundlage eine fundierte Hilfe zu<br />
organisieren und sich in entstehenden Auseinandersetzungen auch<br />
durchsetzen zu können.<br />
Da aber auf den Ämtern im damaligen Bezirk Schöneberg keine<br />
türkischsprachigen Informationen – z. B. zur Möglichkeit der<br />
Einzelfallhilfe u. a. – erhältlich waren, hätten wirklich wichtige<br />
Informationen sie damals nur <strong>nach</strong> dem Prinzip Zufall erreicht.<br />
Schwierigkeiten seien auch mit der ärztlichen Diagnose entstanden,<br />
denn im Zusammenhang damit seien falsche Entscheidungen<br />
getroffen worden, sei z. B. lange Zeit eine unzureichend<br />
spezialisierte Logopädin zu Rat gezogen worden.<br />
Obwohl Aysel dann als ein so genanntes Integrationskind in einen<br />
Hort aufgenommen worden war, habe sich dort lange Zeit niemand<br />
gefunden, der bzw. die entsprechend aufmerksam und entsprechend<br />
kompetent für sie zuständig war.<br />
So sei sie dort – trotz entsprechender Hinweise der Mutter – anfangs<br />
mit ihren Ängsten nicht richtig ernst genommen worden: Im<br />
Zusammenhang mit einer Erkrankung der Kiefermuskulatur hat<br />
Aysel zum einen Schwierigkeiten beim Sprechen, zum anderen fällt<br />
ihr aber auch das Kauen, d. h. auch das Essen schwer. So habe sie<br />
den Mahlzeiten im Hort immer mit Ängsten entgegen gesehen,<br />
worauf aber von den im Hort Tätigen niemand entsprechend<br />
einfühlsam reagierte.<br />
Dieses Problem, mit ihren Erfahrungen und den darauf beruhenden<br />
Sorgen und auch Entscheidungen im Hinblick auf ihre Tochter nicht<br />
hinreichend ernst genommen zu werden, sei der Mutter in der
zurück<br />
Auseinandersetzung mit zahlreichen Institutionen und „Experten"<br />
immer wieder begegnet. Ein Problem, das sich im Hinblick auf ihre<br />
Tochter Aysel umso drängender stellt, als diese sich aufgrund ihrer<br />
Artikulationsschwierigkeiten und damit verbundener Ängste nicht<br />
hinreichend selbst vertreten kann.<br />
Auch in der Vorschule habe sie keine guten Erfahrungen gemacht:<br />
Die Erzieherinnen und Erzieher hätten für Aysel schließlich eine<br />
Schule für Kinder mit einer so genannten geistigen Behinderung<br />
empfohlen. In einer Integrationsschule wäre Aysel – so die damalige<br />
„Empfehlung" – wohl überfordert.<br />
Die Mutter sah sich daraufhin zu der Entscheidung veranlasst, ihre<br />
Tochter aus dieser Vorschule herauszunehmen; und es gelang ihr,<br />
für sie einen Platz in einer Integrationsschule zu finden, wo Aysel<br />
mittlerweile erfolgreich die 4. Klasse besucht.<br />
Auch diese Erfahrung kehrte – so die Mutter – öfters wieder, die<br />
Erfahrung, dass Aysel gleichsam abgestempelt wurde. Immer wieder<br />
sei sie als „geistig behindert" beurteilt worden, weshalb sie doch gar<br />
nicht in der Lage sei, z. B. das Lesen und das Schreiben zu lernen.<br />
Jetzt, in der 4. Klasse, scheint sich die Einschätzung der Mutter zu<br />
bestätigen, dass bei Aysel alles nur etwas später beginnt, dass es<br />
einfach um eine individuelle Förderung der Kinder gehen muss: Denn<br />
Aysel beginne jetzt erfolgreich zu lesen und zu schreiben, beginne<br />
auch schon, englische Wörter zu lernen.<br />
Rainer Sanner<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Ein Fotowettbewerb zum Thema Barrieren<br />
Anfang Juli fiel der Startschuss für den 1. Fotowettbewerb der Heinz<br />
und Mia Krone-Stiftung in Kooperation mit dem Diners Club Magazin.<br />
Mit dem Thema des Fotowettbewerbs „Barrieren" möchte die Heinz<br />
und Mia Krone-Stiftung das Bewusstsein für die vielen Barrieren<br />
schärfen, an die wir alle stoßen – ob mit Behinderung oder ohne.<br />
Doch natürlich haben gerade Menschen im Rollstuhl mit vielen<br />
Hindernissen zu kämpfen, deren sich andere oft nicht bewusst sind.<br />
„Je mehr Leute sich Gedanken machen und ihre Ideen in Bildern<br />
umsetzen, desto besser", meint Carola Krone, Mitglied des<br />
Vorstandes und Geschäftsführerin der Heinz und Mia Krone-Stiftung.<br />
Nun sind alle, die sich von dieser Thematik zu einer Fotoarbeit<br />
inspirieren lassen, aufgerufen, am Wettbewerb teil zu nehmen. Ob<br />
dabei physische, soziale oder Barrieren im Kopf aufgegriffen werden,<br />
liegt ganz beim Fotografen.<br />
„Wir freuen uns sehr, dass wir für den Gewinner unseres<br />
Fotowettbewerbs einen sehr exklusiven Preis finden konnten", sagt<br />
Carola Krone. So wird das Gewinnerbild mit einer 16-tägigen Reise<br />
für zwei Personen in das südliche Afrika belohnt (Wert EUR 4.580):<br />
Der nostalgische Safari-Zug des Shongololo-Expresses fährt<br />
zwischen Windhoek und Kapstadt und bietet so die schönsten<br />
Eindrücke von Namibia und dem Weinland Südafrika.<br />
Höhepunkt des Wettbewerbs wird die offizielle Preisverleihung und<br />
die Eröffnung der Ausstellung im Münchner Künstlerhaus am<br />
Lenbachplatz sein. „Die besten Bilder werden, natürlich mit Nennung<br />
der Fotografen, dort in einer zweiwöchigen Ausstellung der<br />
Öffentlichkeit präsentiert. Am 23. Februar 2005 werden wir diese<br />
Ausstellung glanzvoll eröffnen und den Preis verleihen", so Carola<br />
Krone. Auf dieser Veranstaltung wird unter anderem Frau Anita<br />
Knochner, Behindertenbeauftragte des Bayerischen<br />
Staatsministeriums, sprechen.
Informationen und Unterlagen zum Wettbewerb finden alle<br />
Interessierte auf der Homepage der Heinz und Mia Krone-Stiftung:<br />
www.krone-stiftung.org. Einsendeschluss ist der 30. November 2004.<br />
***<br />
Die Heinz und Mia Krone-Stiftung ist benannt <strong>nach</strong> dem<br />
Unternehmer Heinz Krone, der durch eine Krankheit auf den<br />
Rollstuhl angewiesen war, und seiner Frau Mia. Nach dem Tod ihres<br />
Mannes hat Mia Krone die Stiftung 1999 ins Leben gerufen. Heute<br />
koordiniert Tochter Carola Krone die Aktivitäten der als mildtätig<br />
anerkannten Stiftung: „Wir sind deutschlandweit tätig und haben es<br />
uns zur Aufgabe gemacht, Rollstuhlfahrer bei der<br />
Wiedereingliederung in das tägliche Leben zu unterstützen. Damit<br />
sind wir in Deutschland einzigartig." Ebenso ist es ihr ein wichtiges<br />
Anliegen, auf die Situation von Rollstuhlfahrern in Deutschland<br />
aufmerksam zu machen und gemeinsam in einem Netzwerk dafür<br />
einzutreten, dass Menschen mit einer körperlichen Behinderung<br />
dieselben Rechte und Möglichkeiten offen stehen wie allen anderen<br />
auch.<br />
Mit im Organisationsteam ist auch das Diners Club Magazin, das<br />
traditionsreichste Kreditkartenmagazin Europas. „Ich freue mich,<br />
dass wir hier zusammen mit der Heinz und Mia Krone-Stiftung auf<br />
diese Weise neue Anstöße geben können", meint auch Dr. Hans<br />
Christian Meiser, Herausgeber des Diners Club Magazins. „ Ich hoffe<br />
auf spannende Beiträge und möglichst viele Teilnehmer." Das Diners<br />
Club Magazin informiert monatlich die Besitzer der ersten Kreditkarte<br />
der Welt mit journalistischer Klasse und einer anregenden<br />
redaktionellen Mischung über Zeitgeist und Lebensgefühl rund um<br />
den Globus. Reportagen, Restaurantempfehlungen,<br />
außergewöhnliche Interviews und Tipps renommierter Fachleute<br />
machen das Monatsmagazin zu einem der anspruchsvollsten<br />
deutschen Lifestylemagazine.<br />
Weitere Informationen bekommen Sie unter: Heinz und Mia Krone-<br />
Stiftung, Frau Carola Krone<br />
Agnesstr. 1, 80801 München<br />
Tel.: 0 89/28 67 31-02, Fax: -06<br />
E-Mail: info@krone-stiftung.org
zurück<br />
Die Homepage vom Shongololo-Express: http://www.shongololo.<br />
com/<br />
BBZ<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Buchtipps für und über Kinder mit Handicap<br />
Auch Kinder und ihre Geschwister müssen mit einer angeborenen<br />
oder erworbenen Behinderung leben. Gute Büchern gehen dabei<br />
sowohl auf medizinische Erklärungen als auch auf Anstrengungen,<br />
Selbstzweifel, Mutlosigkeit, Bewältigung des Alltags und das<br />
Verantwortungsgefühl für das Geschwisterkind mit Behinderung ein.<br />
Empfehlenswerte Bilderbücher sind: „Florian lässt sich Zeit" (Tyrolia<br />
Verlag/ab 4 J.), weil er ein Kind mit Down-Syndrom ist. „Ich bin<br />
Laura" (Oetinger) ist ebenfalls betroffen. Dass auch diese Kinder<br />
besondere Entdeckungen machen, wird in „Sei nett zu<br />
Eddie" (Lappan/7 J.) gezeigt. „Meine Füße sind der<br />
Rollstuhl" (Beltz/5 J.) veranschaulicht, wie Rolli-Kinder Spaß haben.<br />
„Michael und Kerstin werden dicke Freunde" (Tyrolia/4 J.) zeigt<br />
anhand der von den Kindern eines integrierten Schülerhortes<br />
gemalten Bilder, wie Fußgänger und Rolli-Fahrerin unbefangen<br />
miteinander umgehen. „Max malt Gedanken" (Gabriel/5 J.) spiegelt<br />
den Alltag in einer integrativen Vorschulklasse. „Kathrin spricht mit<br />
den Augen" (Butzon & Bercker/5 J.), weil sie weder laufen noch<br />
sprechen kann, über ihre Freude am Leben.<br />
Schön sind zum Selberlesen: Der Klassiker<br />
„Vorstadtkrokodile" (Bertelsmann) zeigt die Integration eines Rolli-<br />
Kindes in die Gruppe. Um die Freundschaft zu einem spastisch<br />
gelähmten Mädchen geht es in „Die Rollstuhlprinzessin" (Altberliner).<br />
„Regenbogenkind" (Thienemann) berichtet über eine Schwester und<br />
„Paul ohne Jacob" (Sauerländer) über einen Bruder mit Down-<br />
Syndrom. „Alice im stummen Land" (Ueberreuter) erzählt, wie die<br />
17-Jährige ihre wahre Stimme findet. „Das Eigentor" (dgvt)<br />
thematisiert Epilepsie. „Wie Licht schmeckt" (Hanser) handelt von<br />
der Liebe des 14-jährigen zur blinden Sonja.<br />
„Tage mit Eddie" (dtv junior) filmt seine Schwester für eine<br />
Wettbewerb-Teilnahme. „Drachenflügel" (dtv junior) erzählt vom<br />
isolierten Leben mit einem behinderten Bruder. „Das Mädchen am<br />
Fenster" sitzt im Rolli, macht Beobachtungen und wird mit Gewalt
zurück<br />
konfrontiert.<br />
Trotz der angesprochenen Problematik sind diese Bücher<br />
unterhaltend und auch spannend zu lesen.<br />
© Gabriele Becker<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***
<strong>Berliner</strong> <strong>Behindertenzeitung</strong> Ausgabe Oktober 2004<br />
Mit den Flügeln der Phantasie: die Gruppe<br />
Nebelhorn<br />
In einem leer stehenden Keller vom „Haus Kilian", einer Wohnstätte<br />
für Menschen mit Behinderung, hatte im Jahr 1995 die Gruppe<br />
Nebelhorn ein erstes Obdach gefunden. Dort konnten die Teilnehmer<br />
der Gruppe, Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, damals<br />
mit der gemeinsamen Arbeit beginnen.<br />
Eine für viele und vieles offene Werkstatt<br />
In den überquellenden Atelierräumen wachsen manchmal Zweige<br />
aus einem Holzkreuz, entstehen Kaninchen und andere Objekte aus<br />
unterschiedlichsten Materialien, ein zum Himmel gerichteter,<br />
zurückgebogener kahler Frauenkopf, aus dessen weit geöffnetem<br />
Mund unhörbar, aber sichtbar ein Schrei dringt, oder ein riesiger<br />
Kopf, zusammengesetzt aus Hunderten zu Masken aus weißem Gips<br />
erstarrter Menschengesichter, einer unübersichtlichen Schar<br />
verschlossener Schicksale.<br />
Im November 1996 war ein Verein gegründet worden, um die Arbeit<br />
der Gruppe Nebelhorn finanziell abzusichern, und im September<br />
1997 hatte die Gruppe einen neuen, sehr abgelegenen Ort für ihr<br />
Atelier im Lühlerheim, einer Einrichtung für nicht sesshafte<br />
Menschen in Schermbeck, mitten im Weselerwald gefunden.<br />
Das Atelier der Gruppe Nebelhorn wurde an diesem abgeschiedenen<br />
Ort zu einer ‚offenen’ Werkstatt, wo an vier Tagen der Woche jeweils<br />
Bewohner des Hauses Kilian, des Lühlerheims, Teilnehmer aus<br />
umliegenden Werkstätten für Menschen mit Behinderung und<br />
Interessierte aus der näheren oder weiteren Umgebung die<br />
Möglichkeit fanden und finden, sich kreativ zu begegnen.<br />
Im Juni 2004 konnte dank praktischer und finanzieller Hilfe von<br />
vielen Seiten und <strong>nach</strong> schwerer Arbeit ein Erweiterungsbau für das<br />
alte Atelier eröffnet werden: 240 Quadratmeter Raum sind<br />
hinzugekommen, eine rollstuhlgerechte Rampe führt vom alten<br />
Atelier ins neue. Vor allem für Arbeiten an Plastiken und Skulpturen
soll das neue Atelier jetzt dienen, aber auch für die Arbeit an Foto-<br />
und Videokreationen. Auch mit solchen neuen Medien will die Gruppe<br />
Nebelhorn Erfahrungen sammeln und <strong>nach</strong> Möglichkeiten des<br />
Ausdrucks suchen. Doch vor allem soll das Atelier jetzt auch<br />
größeren Gruppen die Möglichkeit bieten, sich bei der kreativen<br />
Arbeit gegenseitig anzuregen, gemeinsam auch längerfristig<br />
projektbezogen zu arbeiten.<br />
Noch wie Schiffe im Nebel<br />
Gemeinsam versuchen hier Menschen mit und ohne Behinderung,<br />
Grenzen zu überwinden, nähern sich – daher auch der Name der<br />
Künstlergruppe – beim gemeinsamen schöpferischen Arbeiten<br />
einander an wie Schiffe im Nebel, die sich per Horn verständigen.<br />
Hier treffen sich Menschen mit körperlicher, mit geistiger oder<br />
psychischer Behinderung, nicht behinderte Teilnehmer, Menschen<br />
mit Suchtproblemen oder Obdachlose zwischen sieben und<br />
fünfundsiebzig Jahren. Heute schaffen sie es wohl noch nicht, die<br />
gesellschaftlichen Grenzen ganz zu überwinden, so<br />
Raoul Avellaneda, der künstlerische Leiter der Gruppe: „Aber<br />
vielleicht in dreißig Jahren." Trotzdem hält es sie zusammen. Was ist<br />
der Kitt, der sie verbindet? „Das aus dem Rahmen fallen dürfen."<br />
So hatte z. B. Ingeborg Veelmann in verschiedenen<br />
Volkshochschulkursen bereits gelernt, mit konventionellen<br />
Gestaltungsmitteln umzugehen. Trotz immer wieder gelingender<br />
Ergebnisse suchte sie <strong>nach</strong> neuen Herausforderungen. Als Malte<br />
Jokiel sie in der Gruppe Nebelhorn vor die Alternative stellte: „Du<br />
musst mich malen – eine halbe Stunde hast du Zeit, denn dann<br />
werde ich sterben", war sie ganz direkt herausgefordert, öffnete sie<br />
sich darüber für die spontane Porträtmalerei.<br />
Durch direkte und gefühlsbetonte Reaktionen der Teilnehmer mit<br />
Behinderung wurden die anderen immer wieder dazu angeregt,<br />
Dinge anders zu sehen, ihre bisherige Wahrnehmung zu<br />
hinterfragen. So wurden Türen aufgestoßen, um – gedanklich oder<br />
kreativ – auszubrechen. Über dieses gemeinsame kreative Gestalten<br />
sei gleichzeitig deutlich geworden, dass das „Behindert-sein" nur als<br />
eine andere Möglichkeit von „Sein", von Denken und Fühlen zu<br />
erfahren ist.<br />
Mehr Informationen zum Projekt der Gruppe Nebelhorn und eben
zahlreiche Abbildungen von entstandenen Arbeiten sind den zwei<br />
bisher veröffentlichten Katalogen zu entnehmen, die bei der unten<br />
genannten Adresse auch bestellt werden können. Der eine, zum<br />
‚Köpfe’-Projekt, kann mit der ISBN-Nummer 3-934380-68-6 auch im<br />
Buchhandel bestellt werden.<br />
Alltag unter dem Leuchtturm<br />
„Hier dürfen sich alle entblößen, ohne bestraft zu werden",<br />
beschreibt Raoul Avellaneda das Konzept der gemeinsamen Arbeit.<br />
Dabei gibt er, der im Jahre 1995 die Gruppe gründete, immer mal<br />
wieder ein wenig Hilfe, Tipps, was die Umsetzung der Ideen angeht:<br />
„Einige sind am Boden mit riesigen Zeichnungen beschäftigt, die sie<br />
mit feinen schwarzen Linienstrukturen bedecken, andere tragen<br />
gewichtige Sachen herein, um Metallskulpturen zu konstruieren, ein<br />
Grüppchen unterhält sich noch weiter bei einer Tasse Kaffee und<br />
unsere zahme Katze wird von jemandem unter dem Tisch mit Futter<br />
versorgt. Ich höre befreites Lachen, aber öfter auch traurige<br />
Stimmen, die von den Begebenheiten des Alltags draußen<br />
erzählen ..."<br />
„(...). Hin und wieder wird mein Name gerufen – da gibt es sicher<br />
ein ungelöstes Problem. Manchmal tauchen ungewisse Fragen auf,<br />
die schwierig zu beantworten sind; aber auch selbstbewusste<br />
Überlegungen werden angestellt: Wie kann ich in meinem Bild das<br />
Licht zum Leuchten bringen? Ist es wohl möglich, Schmerz<br />
darzustellen? (...) Ich möchte einen gigantischen Leuchtturm bauen,<br />
der die Farben des Prismas aufstrahlen lässt, um unseren ganzen<br />
Garten damit zu erhellen."<br />
Ja, als ob dieser Leuchtturm schon stehen und die an diesem<br />
abgeschiedenen Ort untergebrachten Ateliers mit der in ihnen<br />
stattfindenden Arbeit erhellen würde, wurde die Gruppe Nebelhorn<br />
im Jahre 2003 <strong>nach</strong> Beauvais bei Paris eingeladen, wo für das<br />
Europäische Jahr der Menschen mit Behinderung in Frankreich ein<br />
zentraler Veranstaltungsort war.<br />
Aber auch andernorts ist die Gruppe Nebelhorn mit ihren Arbeiten<br />
und eben als gemeinsam kreativ gestaltende Gruppe immer wieder<br />
zu Gast, z. B. alljährlich beim Jazz-Festival in Moers, und vielleicht<br />
auch bald, – wir hoffen sehr auf ein gutes Gelingen der schon<br />
begonnenen Planungen, – hier in Berlin.
zurück<br />
Die Adresse: Nebelhorn e. V., Marienthaler Str. 10, 46514<br />
Schermbeck, Tel.: 0 28 56 / 98 09 42<br />
Rainer Sanner<br />
zurück zum Inhaltsverzeichnis<br />
zurück zur Startseite<br />
***