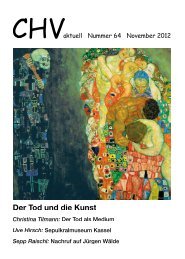PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.
PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.
PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
CHVaktuell Nummer 65 Mai 2013<br />
<strong>Hospiz</strong> für alle<br />
Angelika Westrich: <strong>Hospiz</strong> für alle?<br />
Michael de Ridder: Sterben gehört nicht ins Krankenhaus<br />
Ingrid Pfuner: Sterben im <strong>Hospiz</strong> – „all inclusive?”
Bewusste Auseinandersetzung<br />
mit dem Tod erfordert<br />
Verständnis und Offenheit.<br />
Denkbar persönlich.<br />
Karl Albert Denk,<br />
Bestattermeister<br />
Mit uns können Sie ganz<br />
offen über den Tod sprechen.<br />
Ihre Wünsche stehen im<br />
Mittelpunkt.<br />
München Telefon 089 – 64 24 86 80<br />
Grünwald, Tölzer Str. 37 Telefon 089 – 64 91 13 70<br />
Erding, Kirchgasse 2a Telefon 08122 – 22 70 60<br />
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 5 Telefon 08161 – 4 96 53 17<br />
Neufahrn, Echinger Str. 17 Telefon 08165 – 79 96 24<br />
Genaue Umsetzung getroffener<br />
<strong>Verein</strong>barungen<br />
Kreative und liebevolle<br />
Gestaltungsmöglichkeiten<br />
Begleitung der Angehörigen<br />
Hilfe vor, während und nach<br />
der Beisetzung<br />
www.karlalbertdenk.de
Editorial<br />
Liebe Mitglieder und Freunde des CHV,<br />
der Titel dieses Mitgliedermagazins lautet „<strong>Hospiz</strong> für<br />
alle“. Das drückt einen der Grundsätze der <strong>Hospiz</strong>bewegung<br />
aus: Jeder Mensch hat ein Recht auf ein<br />
Sterben unter würdigen Bedingungen.<br />
Die Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen<br />
in Deutschland hat in den vergangenen 25 Jahren<br />
erhebliche Fortschritte gemacht. Immer noch aber<br />
werden viele Menschen von entsprechenden ambulanten<br />
und stationären Angeboten nicht erreicht. Sie leiden<br />
unter Schmerzen und anderen belastenden Symptomen,<br />
wären lieber an einem vertrauten Ort und fühlen sich häufig an ihrem<br />
Lebensende alleingelassen.<br />
Das Thema Sterben gehört zum Leben, es darf nicht verdrängt oder ausgeklammert werden,<br />
sondern gehört in die Mitte der Gesellschaft. Trotz aller medizinischen Fortschritte<br />
und Aussichten, das Leben länger und besser zu gestalten, müssen wir uns auch vergegenwärtigen,<br />
dass in Deutschland über 800 000 Menschen jährlich sterben – und dies unter<br />
ganz unterschiedlichen Bedingungen. Weder in der Gesundheits- noch in der Sozialpolitik,<br />
weder bei den Bildungsausgaben noch in der öffentlichen Kommunikation wird ein<br />
Sterben in Würde, werden Tod und Trauer explizit bzw. angemessen berücksichtigt.<br />
Deshalb wurde vom Deutschen <strong>Hospiz</strong>- und PalliativVerband (DHPV) gemeinsam mit<br />
der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) und der Bundesärztekammer<br />
(BÄK) die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in<br />
Deutschland“ verabschiedet. Ziel dieser Charta ist die Verbesserung der Betreuung<br />
Schwerstkranker und Sterbender in Deutschland vor dem Hintergrund des demografischen<br />
Alterungsprozesses. Sie beinhaltet eine Standortbestimmung der <strong>Hospiz</strong>- und<br />
Palliativversorgung in Deutschland und formuliert Aufgaben, Ziele und weiteren<br />
Handlungsbedarf.<br />
Die Charta soll dazu beitragen, die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen<br />
Sterben und Sterbebegleitung zu fördern. Sie soll eine grundlegende Orientierung<br />
und ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung der <strong>Hospiz</strong>- und Palliativversorgung<br />
sein sowie insbesondere Bestrebungen nach einer Legalisierung der Tötung auf Verlangen<br />
eine Perspektive der Fürsorge und des menschlichen Miteinanders entgegensetzen.<br />
1
Die Charta fordert, die Rechte schwerstkranker und sterbender Menschen und ihre Bedürfnisse<br />
in den Mittelpunkt zu stellen. In einem Gesundheitssystem, das zunehmend<br />
von Wettbewerb und ökonomischen Interessen bestimmt wird, müssen dazu die notwendigen<br />
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Alle Menschen, die in dieser letzten<br />
Lebensphase einer hospizlich-palliativen Versorgung bedürfen, müssen Zugang zu ihr erhalten<br />
und müssen auf eine umfassende, menschenwürdige Begleitung und Betreuung<br />
vertrauen können, die ihrer individuellen Situation und ihren Wünschen Rechnung trägt<br />
und die auch die Angehörigen einbezieht.<br />
Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“<br />
hat seit ihrer Verabschiedung im Jahre 2010 bereits große Resonanz erfahren:<br />
Mehr als 600 Institutionen sowie mehr als 2100 Personen haben die Charta seither unterzeichnet.<br />
Ende letzten Jahres ist der Freistaat Bayern als erstes Bundesland der Charta<br />
beigetreten. Mit ihrer Unterzeichnung übernehmen die Institutionen auch die Selbstverpflichtung<br />
„sich im Sinne der Charta für die Verbesserung der Situation schwerstkranker<br />
und sterbender Menschen, ihrer Familien und der ihnen Nahestehenden einzusetzen und<br />
auf dieser Grundlage für die Einlösung ihrer Rechte einzutreten.“ Bis Dezember 2013<br />
sollen 5.000 Unterzeichner gewonnen werden.<br />
Falls Ihr Interesse geweckt sein sollte:<br />
Unter www.charta-zur-betreuung-sterbender.de<br />
können Sie die Charta bestellen oder herunter<strong>laden</strong> und unterschreiben.<br />
Ihr<br />
Geschäftsführer<br />
2
Inhalt<br />
<strong>Hospiz</strong> für alle?<br />
Nach dem Grundgesetz hat jeder Mensch das Recht auf ein<br />
gutes Leben, das Recht auf auf einen guten Tod ist nirgendwo<br />
verbrieft. Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und<br />
sterbender Menschen in Deutschland“ hat zum Ziel, die Betreuung<br />
Schwerstkranker und Sterbender zu verbessern und<br />
allen Menschen, die in der letzten Lebensphase einer hospizlich-palliativen<br />
Versorgung bedürfen, Zugang zu den entsprechenden<br />
Einrichtungen zu verschaffen.<br />
4 <strong>Hospiz</strong> für alle<br />
Ein Konzept, Sterben als Teil unseres Lebens<br />
zu begreifen und aktiv anzunehmen<br />
Angelika Westrich<br />
6 Den letzten Weg gemeinsam gehen<br />
Bei der Begleitung von Sterbenden mit<br />
mehrfacher Behinderung wird auch die<br />
Hilfestellung des CHV in Anspruch genommen<br />
Hans Steil<br />
10 Ein Kindertraum wird wahr<br />
Die Geschichte von Marcel Schwab, dessen<br />
Traum dank des CHV in die Tat umgesetzt<br />
werden konnte Irene Braun<br />
12 Sterben im <strong>Hospiz</strong><br />
– all inclusive? – Ingrid Pfuner<br />
16 Inschallah – Wenn Gott will<br />
Die Begleitung von Salih Güc, dessen<br />
Wunsch es war, in der alten Heimat sterben<br />
zu können Uve Hirsch<br />
20 Schalom – Jüdisches Altenheim<br />
Interview mit der Pflegedienstleiterin Dina<br />
Zenker – Die besondere Problematik von<br />
Holocaust- Überlebenden und Child Survivors<br />
Heinz Biersack<br />
24 Sterben gehört nicht ins Krankenhaus<br />
Interview mit Michael de Ridder<br />
Uve Hirsch<br />
27 John Green – „Das Schicksal ist ein<br />
mieser Verräter“<br />
Buchbesprechung von Julia Hagmeyer<br />
30 Das wird schon wieder<br />
Saloppe Sprüche dieser Art helfen nicht.<br />
Hinschauen und mitfühlen geht anders<br />
Susanne Breit-Keßler<br />
32 Schüler engagieren sich<br />
Bau eines Bilderwagens<br />
35 Vorstellung des neuen Mitarbeiters –<br />
Robert Milbradt<br />
34<br />
Rubriken<br />
Gedicht (weiteres auf Seite 37)<br />
38 Aus dem <strong>Verein</strong><br />
41 Stifterkreis <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
42 Termine<br />
44 Impressum<br />
Titelbild: Eingang an der Nordseite zur Allerheiligen-Hofkirche in München – Foto: Christiane Sarraj<br />
3
Unser Themenheft „<strong>Hospiz</strong> für alle“ soll<br />
deutlich machen, dass wir als <strong>Hospiz</strong>- und<br />
Palliativdienst jederzeit offen für alle Menschen<br />
und Situationen sind, in denen wir<br />
um hospizliche Unterstützung angefragt<br />
werden und niemanden ausgrenzen. Es<br />
spielt für uns keine Rolle, woher die Menschen<br />
kommen, welcher Nationalität sie<br />
angehören, ob sie arm oder reich sind,<br />
welchen familiären Hintergrund sie haben,<br />
älter oder jünger sind (mit Ausnahme von<br />
Kindern, die eine ganz spezifische und andere<br />
Unterstützung und Behandlung benötigen)<br />
oder welche weitere Erkrankungen<br />
bzw. zusätzlichen Beschwernisse sie<br />
tangieren.<br />
In jedem Einzelfall prüfen wir sorgfältig,<br />
wie und was wir für die schwerstkranken<br />
Menschen und ihre Angehörigen tun können,<br />
wenn sie sich bei uns melden. Für den<br />
Bereich des stationären <strong>Hospiz</strong>es erinnern<br />
wir dazu noch einmal an unser letztes<br />
CHV aktuell Nr. 64. Hier haben wir ausführlich<br />
die notwendigen gesetzlichen und<br />
krankenkassentechnischen Voraussetzungen<br />
für eine Aufnahme in ein stationäres<br />
<strong>Hospiz</strong> dargelegt. Wenn wir bei einem<br />
Erstkontakt feststellen, dass die an uns gerichtete<br />
Anfrage kein oder noch kein „Fall“<br />
für hospizliches Handeln ist, verweisen wir<br />
auf andere, geeignete Anlaufstellen, an die<br />
sich hilfebedürftigen Menschen wenden<br />
können.<br />
Um passgenau helfen zu können, ist es für<br />
unseren <strong>Verein</strong> sehr wichtig, eine gelebte<br />
Vernetzungsstruktur zu haben und diese<br />
4<br />
<strong>Hospiz</strong> für alle?<br />
Von Angelika Westrich<br />
zu pflegen. Das heißt, wir müssen medizinische,<br />
pflegerische und soziale Einrichtungen<br />
nicht nur kennen, sondern regelmäßig<br />
mit ihnen im Austausch sein,<br />
wissen, wie sie arbeiten und für welche<br />
Personengruppen sie zuständig sind.<br />
„Bitte bringen Sie mir ein kleines Stück<br />
Apfelstrudel zum Mittagessen – ich kann es<br />
nicht mehr schlucken, aber allein der Geruch<br />
erinnert mich an glückliche Kindertage.“<br />
<strong>Hospiz</strong> bedeutet zuvorderst Haltung. Einem<br />
Menschen vorurteilsfrei begegnen,<br />
ihn mit seinen Bedürfnissen ernst nehmen<br />
und ihm keine vorgefasste oder gar<br />
meine eigene Meinung überstülpen zu<br />
wollen, ist nicht leicht. Andere Sitten und<br />
Gebräuche anzuerkennen, Familienstrukturen,<br />
Lebensentwürfe und Lebensformen,<br />
die mit den unseren wenig oder<br />
nichts zu tun haben, nicht werten, sondern<br />
akzeptieren. Dazu gehört im stationären<br />
Bereich auch, eine fremdländische<br />
Esskultur wenigstens in Ansätzen zu ermöglichen.<br />
Ich erinnere mich an einen<br />
<strong>Hospiz</strong>-Bewohner, einen Schwarzafrikaner,<br />
der, so lange er es noch konnte, selbst<br />
für die Zubereitung seines Essens im<br />
<strong>Hospiz</strong> sorgen wollte. In einer kleinen<br />
Küche neben unserem Wohnzimmer<br />
kochte er in riesigen Töpfen Kutteln und<br />
andere Innereien, die, von Aussehen und<br />
Geruch her, an die Grenzen dessen gingen,<br />
was wir als essbar angesehen hätten.<br />
Ein anderes Mal kam die Mutter eines jungen<br />
Thailänders von weit her angereist und
kochte in dieser Gästeküche ihrem Sohn in<br />
seinen letzten Tagen im <strong>Hospiz</strong> ihm bekannte,<br />
landestypische Gerichte.<br />
Essen ist bis zum Ende eines Lebens ein<br />
zentraler und wichtiger Bestandteil von Lebensqualität.<br />
Es geht weniger darum, satt<br />
zu werden, sondern dass durch das Lieblingsessen,<br />
den vertrauten Geruch oder Geschmack,<br />
vielleicht sogar aus Kindertagen,<br />
bis zuletzt glückliche Momente und Erinnerungen<br />
hervorgerufen werden können.<br />
In einem weiteren Beitrag dieses Heftes –<br />
„Inschallah“ schildert Uve Hirsch eine<br />
lange und abenteuerliche Begleitung bei<br />
Menschen, die in einer ganz anderen,<br />
nicht westlich geprägten Kultur daheim<br />
sind. Auch sie ist ein Zeugnis für unsere<br />
Aussage:<br />
<strong>Hospiz</strong> ist für alle da.<br />
Mit der zunehmenden Bekanntheit von<br />
<strong>Hospiz</strong> und Palliative Care passiert das,<br />
was von Anfang an die Intention der<br />
<strong>Hospiz</strong>bewegung war, nämlich die Durchdringung<br />
dieser Idee, dieser Haltung hinein<br />
in die Gesellschaft. Nicht, dass nun an<br />
jeder Ecke ein <strong>Hospiz</strong>verein entstehen<br />
muss, aber es ist zu spüren, wie sich die<br />
Struktur der Betreuung und Pflege von<br />
sterbenden Menschen ändert, Bedürfnisse<br />
bewusster wahrgenommen werden und<br />
„Raum“ geschaffen wird, dieses Sterben<br />
achtsam zu begleiten. So entstehen in<br />
Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern,<br />
in Einrichtungen, in denen Menschen<br />
mit unterschiedlichsten Einschränkungen<br />
leben, Kooperationen mit <strong>Hospiz</strong>und<br />
Palliativdiensten zur Unterstützung<br />
und Implementierung dieser Idee in den<br />
jeweiligen Häusern. Mitarbeiterinnen, die<br />
hier arbeiten, werden von uns geschult<br />
und vorbereitet, um zusammen mit ihren<br />
Kolleginnen selbst für ein achtsames Klima<br />
in der Betreuung schwerstkranker und<br />
sterbender Menschen zu sorgen und ihren<br />
ganz besonderen Fokus darauf zu richten.<br />
Der Erfolg unseres palliativ-geriatrischen<br />
Beratungsdienstes, der inzwischen in 2/3<br />
aller Münchner Alten- und Pflegeheime<br />
regelmäßig zur Unterstützung gebeten<br />
wird, ist ein beredtes Zeugnis davon.<br />
Auch im privaten Bereich, in der eigenen<br />
Häuslichkeit, steigt die Bereitschaft,<br />
schwerstkranke Menschen möglichst bis<br />
zuletzt daheim zu versorgen. Zusammen<br />
mit einem Hausarzt und einem <strong>Hospiz</strong>und<br />
Palliativteam, die alle Beteiligten unterstützen,<br />
kann ein Sterben viel von seinem<br />
Schrecken verlieren. Oft hören wir<br />
die Aussage: „Mit ihrer Unterstützung<br />
traue ich mir zu, meinen Mann, meine<br />
Mutter daheim bis zuletzt zu begleiten“.<br />
Die dabei parallel ablaufende, bewusste<br />
Auseinandersetzung mit dem Sterben<br />
kann sogar helfen, die Trauerzeit nach dem<br />
Tod ertragbarer zu machen.<br />
<strong>Hospiz</strong> für alle – eine Idee, die uns in<br />
Deutschland seit knapp 30 Jahren begleitet.<br />
Nicht (nur) als Dienstleistungs-Angebot,<br />
sondern als eine Einstellung und ein<br />
Konzept, Sterben als Teil unseres Lebens<br />
zu begreifen; es nicht auszulagern an Fachdienste<br />
und Spezialeinrichtungen, sondern<br />
es aktiv anzunehmen und, zusammen und<br />
ergänzend, mit anderen bestehenden pflegerischen,<br />
medizinischen und therapeutischen<br />
Versorgungsstrukturen, integrativ in<br />
die Gesellschaft zu tragen.<br />
Angelika Westrich<br />
5
Hans Steil ist Palliativfachkraft im Palliativ-<br />
Geriatrischen Dienst. Er stellt die Besonderheiten<br />
dar, die sich im Umgang mit Menschen<br />
ergeben, die eine schwere Behinderung<br />
haben.<br />
Die Betreuerteams in Einrichtungen der<br />
Behindertenhilfe sehen sich mehr und<br />
mehr konfrontiert mit Alter, schwerer Erkrankung,<br />
Sterben und Tod. Die besondere<br />
Pflegebedürftigkeit älterer Menschen<br />
mit Behinderung stellt für die Betreuer<br />
nicht selten eine neue Herausforderung<br />
dar. Wie jeder unheilbar kranke Mensch<br />
wünschen sich gerade auch Menschen<br />
mit Behinderung in der vertrauten Umgebung<br />
sterben zu können, dennoch ster-<br />
6<br />
Den letzten Weg gemeinsam gehen<br />
<strong>Hospiz</strong>liche Begleitung von Menschen mit mehrfacher Behinderung<br />
Von Hans Steil<br />
ben sie häufiger im Krankenhaus als andere.<br />
Dies ist besonders problematisch, da<br />
das Krankenhauspersonal nicht mit der<br />
Betreuung und Pflege geistig behinderter<br />
Menschen vertraut ist.<br />
Bei der Begleitung von Sterbenden mit<br />
mehrfacher Behinderung wird seit geraumer<br />
Zeit auch die Hilfestellung von <strong>Hospiz</strong>vereinen<br />
in Anspruch genommen. Der<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> wird in regelmäßigen<br />
Abständen von drei verschiedenen<br />
Einrichtungen in München um<br />
hospizliche Begleitung gebeten. Der Beistand<br />
wird angefragt, wenn ein kranker<br />
Bewohner der Einrichtung weniger isst<br />
und trinkt, die Sondennahrung nicht<br />
mehr gut vertragen wird oder sich akute<br />
Nebenwirkungen wie Verschleimung,<br />
Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle oder<br />
Flüssigkeitseinlagerungen einstellen. Weitere<br />
Gründe hospizlicher Unterstützung<br />
können Unsicherheiten bei der Schmerzmedikation<br />
und ethisch rechtliche Fragen<br />
sein. Menschen mit starken kognitiven<br />
Einschränkungen können Schmerzen oft<br />
nicht verbal mitteilen. Dies kann zu einer<br />
medikamentösen Unterversorgung und<br />
damit zu einer starken Beeinträchtigung<br />
der Lebensqualität führen.<br />
Dem mutmaßlichen Willen Geltung<br />
verschaffen<br />
Die hospizliche und palliative Begleitung<br />
von Menschen mit Behinderung bewegt
sich stärker auf der emotionalen, als auf<br />
der kognitiven Ebene. Primär ist das<br />
Dasein, sekundär das Handeln. Eine<br />
wichtige Rolle können dabei körperlicher<br />
Kontakt und Berührungen spielen. Die<br />
Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen<br />
müssen erspürt werden. Nicht zuletzt<br />
wegen der dunklen Schatten des Dritten<br />
Reiches ist man in Deutschland geneigt,<br />
medizinisch mehr zu tun, als aus palliativer<br />
Sicht geboten wäre. Grundsätzlich ist<br />
es wichtig, den Willen bzw. den mutmaßlichen<br />
Willen des Menschen mit<br />
geistiger Behinderung zu erforschen und<br />
diesem in der entsprechenden Situation<br />
Geltung zu verschaffen. Welche lebensverlängernden<br />
Maßnahmen werden gewünscht<br />
bzw. ausgeschlossen? Diese<br />
Auseinandersetzung stellt für die rechtlichen<br />
Vertreter – meist die Eltern – und<br />
das Betreuerteam eine zweifellos große<br />
und schwierige Herausforderung dar.<br />
Die Betroffenen selbst spüren die<br />
Schwere ihrer Erkrankung, die Mitbewohner<br />
der Gruppe dagegen müssen<br />
offen darauf hingewiesen und auf den<br />
Sterbeprozess vorbereitet werden: „Der<br />
Peter ist ganz fest krank“. In diesem<br />
Prozess sind die Wünsche des Sterbenden<br />
vorrangig, die häufig nur intuitiv wahrgenommen<br />
werden können. Die Mitarbeiter,<br />
die in einer sehr engen Beziehung zu<br />
den Bewohnern stehen, erleben diese<br />
Situation als emotional sehr schwierig, ist<br />
die Wohngruppe doch ein Ort des Lebens<br />
und nicht des Sterbens. Das Thema Tod<br />
und Sterben ist, ohne die Initiierung<br />
durch die Erkrankung eines Bewohners,<br />
im Alltag der Wohnstätten nicht selten<br />
tabuisiert.<br />
Unterstützung durch den <strong>Hospiz</strong>-<br />
und Palliativberatungsdienst<br />
Alle am Prozess Beteiligten können Unterstützung<br />
durch den <strong>Hospiz</strong>- und Palliativberatungsdienst<br />
des <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s in Anspruch nehmen. Im<br />
Einzelfall kommen sogar Ärzte des spezialisierten<br />
Palliative-Care-Teams dazu.<br />
Nach dem Tod bietet es sich an, eine Abschiedsfeier<br />
für den Verstorbenen zu gestalten,<br />
dem die Bewohner, das Betreuungsteam<br />
und alle an der Begleitung<br />
beteiligten Personen beiwohnen. Wenn es<br />
gewünscht wird, bieten die Mitarbeiter<br />
des <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s die<br />
Möglichkeit einer Nachbesprechung mit<br />
dem Betreuungsteam an, um die Sterbebegleitung<br />
noch einmal zu reflektieren<br />
und zu verarbeiten. Durch diese Gespräche<br />
und den Erfahrungsaustausch kann<br />
sich eine Sterbekultur in der Einrichtung<br />
etablieren, die hilfreich ist, das Sterben<br />
von Menschen mit Behinderung in der<br />
vertrauten Umgebung immer öfter zu ermöglichen<br />
und die Lebensqualität bis<br />
zuletzt sicherzustellen.<br />
Dr. med. Jörg Augustin, niedergelassener<br />
Arzt und Palliativmediziner, zeichnet hier<br />
zusammen mit Hans Steil, Palliativfachkraft<br />
im <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V., anhand<br />
eines Fallbeispiels die palliative Versorgung<br />
eines Menschen mit Behinderung nach:<br />
Frau B. erlitt im ersten Lebensjahr (1967)<br />
eine traumatische Hirnschädigung. Diese<br />
hatte eine schwerste Intelligenzminde-<br />
7
ung und spastische Lähmung der Arme<br />
und Beine zur Folge. Frau B. kann nicht<br />
sprechen, das Sprachverständnis ist deutlich<br />
reduziert, Gehen oder Stehen ist<br />
nicht möglich. Mitteilungen weniger und<br />
einfacher Worte versteht sie. Aktiv kann<br />
sie über Gesten einfache Dinge mitteilen.<br />
Die Stimmungslage ist recht gut einschätzbar.<br />
Frau B. lebte bis zu ihrem 32.<br />
Geburtstag zu Hause bei den Eltern.<br />
Dann lebte sie sich in der Wohngruppe<br />
gut ein. Tagsüber besuchte sie die Förderstätte.<br />
Es bestand weiterhin ein sehr guter<br />
familiärer Kontakt. Nach dem Tod der<br />
Mutter kümmerten sich beide Brüder liebevoll<br />
um sie. Es besteht eine umfassende<br />
Betreuung, die einer der beiden Brüder<br />
innehat.<br />
Im November wurde die linke Niere wegen<br />
eines Nierenkarzinoms entfernt, im<br />
Juli bzw. September darauf wurden Lungenmetastasen<br />
links und rechts operiert.<br />
Im Januar wurden dann erneut Lungenmetastasen<br />
diagnostiziert, im Februar der<br />
Enddarm wegen eines Darmverschlusses<br />
entfernt. Ab März wurde eine medikamentöse<br />
Therapie mit dem Multikinase-<br />
Inhibitor Sorafenib begonnen. Ende Mai<br />
verschlechterte sich schließlich der Allgemeinzustand<br />
zunehmend, so dass Anfang<br />
Juni eine stationäre Einweisung erforderlich<br />
wurde. Es wurde die Diagnose einer<br />
Dickdarmentzündung mit Verdacht auf<br />
gedeckten Darmdurchbruch gestellt.<br />
Trotz Antibiotikatherapie und künstlicher<br />
Ernährung verstarb die Patientin<br />
zwei Wochen später in der chirurgischen<br />
Klinik.<br />
Anfangs bestand bei den Mitarbeitern der<br />
Wohngruppe eine große Unsicherheit, ob<br />
8<br />
man den Anforderungen der Betreuung<br />
von Frau B. gewachsen sei. Durch eine<br />
umgehende Besprechung und Therapieplanung<br />
im Großteam, sowie einen ausführlichen<br />
Medikamentenplan mit Angabe<br />
zur Indikation und Dosierung der<br />
Dauer- und Bedarfsmedikation konnten<br />
diese Bedenken weitgehend ausgeräumt<br />
werden. Erleichtert wurde dies auch<br />
durch die Hinzuziehung einer Palliativpflegefachkraft<br />
des <strong>Hospiz</strong>dienstes, zu der<br />
auch hausärztlicherseits ein guter Kontakt<br />
bestand. Zusätzlich zu den häufigen<br />
Hausbesuchen bestand eine hausärztliche<br />
24-Stunden-Erreichbarkeit. Die einzelnen<br />
Therapieschritte und diagnostischen<br />
Vorgehensweisen wurden mit den jeweiligen<br />
Mitarbeitern vor Ort eingehend besprochen.<br />
Leider hatten wir es versäumt,<br />
häufigere Großteam-Besprechungen im<br />
Beisein des Hausarztes durchzuführen.<br />
Hierdurch ergaben sich trotz einer über<br />
viele Jahre bestehenden äußerst vertrauensvollen<br />
Zusammenarbeit doch Kommunikationsprobleme<br />
durch mittelbare<br />
Weitergabe von Informationen.<br />
Auch die Brüder der Patientin hatten anfangs<br />
große Bedenken, ob in der Wohngruppe<br />
auch ausreichend kompetente Betreuung<br />
der Patientin gegeben sei. Abhilfe<br />
schuf hier ein ausführliches und konstruktives<br />
Gespräch zwischen beiden Brüdern,<br />
der Leiterin der Wohngruppen und<br />
dem Hausarzt. Frau B. sollte so lange wie<br />
irgend möglich in der Wohngruppe versorgt<br />
werden.<br />
Sehr hilfreich war drei Monate nach dem<br />
Tod eine Großteam-Besprechung im Beisein<br />
des Hausarztes und der ambulanten<br />
Palliativpflegefachkraft. Dies ist unver-
zichtbar, um eine Begleitung positiv abzuschließen,<br />
Mitarbeitern Überforderungsängste<br />
oder das unberechtigte Gefühl,<br />
Fehler gemacht zu haben, zu<br />
nehmen und um Konsequenzen für künftige<br />
schwierige Betreuungen zu ziehen.<br />
Die anderen Bewohner der Wohngruppe<br />
wurden schrittweise schonend und in einer<br />
für sie jeweils verständlichen Form<br />
über den Krankheitsverlauf informiert.<br />
Eine zusätzliche Betreuung fand durch<br />
die Seelsorgerin der Einrichtung statt.<br />
Die geführten Besprechungen waren insgesamt<br />
sehr zeitaufwändig. Dennoch ist<br />
dies auch bei häufig sehr langen Arbeitstagen<br />
eines Hausarztes letztlich möglich,<br />
wenn die Prioritäten entsprechend gesetzt<br />
werden, dass die höchst aufwändige Betreuung<br />
der Patientin nur durch die außergewöhnliche<br />
Einsatzbereitschaft aller<br />
Mitarbeiter der drei Wohngruppen möglich<br />
war sowie durch deren Bereitschaft,<br />
Aufgabenbereiche abzudecken, die weit<br />
über das eigentliche Arbeitsgebiet hinausgingen.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.lebenshilfe.de/de/themen-fachliches/<br />
artikel/In_Geborgenheit_gehen.php<br />
„Lebenswege am Lebensende“ Die <strong>Hospiz</strong>-Zeitschrift<br />
Ausgabe 49 2011/3<br />
Foto: Christiane Sarraj<br />
9
10<br />
Ein Kindertraum wird wahr<br />
Der fünfzehnjährige Marcel, ein aufgeschlossener<br />
und stets gut gelaunter junger<br />
Mann, interessiert sich – wie viele seiner<br />
Altersgenossen – leidenschaftlich für Fußball.<br />
Obwohl er in Koblenz lebt, ist er ein<br />
begeisterter Fan des FC Bayern München.<br />
In seinem rot-weißen Zimmer gibt es wenig<br />
Fläche, die nicht mit Autogrammkarten<br />
und Postern des <strong>Verein</strong>s beklebt wäre.<br />
Nahezu alle Spiele der Bayern verfolgt<br />
Marcel am Fernseher oder Laptop. Sein<br />
größter Wunsch war aber, einmal live im<br />
Stadion dabei sein zu können. Eigentlich<br />
ein Wunsch, der sich leicht realisieren ließe,<br />
würde Marcel nicht seit seiner Geburt<br />
an einer schweren Form der spinalen<br />
Muskeldystrophie leiden. Das bedeutet, er<br />
kann weder laufen, noch selbstständig sitzen.<br />
Da auch seine Atemmuskulatur betroffen<br />
ist, hat er seit dem Säuglingsalter<br />
eine Kanüle in seiner Luftröhre, damit er<br />
dauerhaft maschinell beatmet werden<br />
kann. Zum Glück ist es Marcel möglich<br />
Von Irene Braun<br />
die Finger leicht zu bewegen, er kann kauen<br />
und sprechen, ist kognitiv gesund und<br />
besucht das 9. Schuljahr der Hauptschule<br />
mit großem Erfolg. Wie es aussieht, wird<br />
er den Abschluss mit Bravour meistern.<br />
Sein größter Wunsch war natürlich kein<br />
Geheimnis. Und so überlegten seine Betreuerinnen<br />
vom Ambulanten Kinderkrankenpflegedienst<br />
Stiftmobil in Koblenz<br />
– ohne Marcel darüber in Kenntnis zu<br />
setzen – wie man seinen Herzenswunsch<br />
erfüllen könnte.<br />
Der Kinderkrankenpflegedienst „Stiftmobil“<br />
betreut schwerstbehinderte und kranke<br />
Kinder und unterstützt bzw. schult Eltern<br />
in der Pflege ihrer kranken Kinder. Mit ihrer<br />
Arbeit geben sie den Familien ein Stück<br />
Normalität zurück und helfen, eventuelle<br />
Krankenhausaufenthalte zu verkürzen.<br />
Das größte Problem bei der Organisation<br />
des Wochenendtrips nach München war<br />
es, eine geeignete Übernachtungsmöglichkeit<br />
für Marcel zu finden. Bei ihrer Recherche<br />
nahm das Betreuungsteam auch<br />
Kontakt mit dem <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
auf. Zweifellos muss eine solche Anfrage<br />
negativ beschieden werden, denn Marcel<br />
erfüllt in keiner Weise die Voraussetzungen<br />
einen <strong>Hospiz</strong>platz in Anspruch nehmen zu<br />
können und sei es auch nur temporär.<br />
Doch landete das Anliegen der Betreuerinnen<br />
bei Eliza Wolf vom Aufnahmeteam<br />
des Stationären <strong>Hospiz</strong>es, deren Herz<br />
ebenso heftig für die Fußballmannschaft<br />
aus München schlägt. Zusammen mit dem
Pflegedienstleiter Uli Heller und nach<br />
Rücksprache mit dem Geschäftsführer<br />
Leonhard Wagner, wurde rasch eine Lösung<br />
des Problems gefunden. Das Wohnzimmer<br />
im zweiten Stock des <strong>Christophorus</strong><br />
Hauses ist groß genug und stand für<br />
den angedachten Zeitraum auch zur Verfügung.<br />
Eliza Wolf und Uli Heller organisierten<br />
alle notwendigen Details und<br />
trafen sämtliche Vorbereitungen. Im<br />
Wohnzimmer wurden ein Bett für Marcel<br />
und zwei Gästebetten für die beiden Betreuerinnen<br />
aufgestellt. Für Beatmung und<br />
Geräte mussten genügend Steckdosen zur<br />
Verfügung stehen. Zu guter Letzt kam auf<br />
Marcels Schlafstatt ein FC Bayern-Fan-Bär<br />
und ein Fan-Schal aus dem privaten Fundus<br />
von Eliza Wolf. Für das leibliche Wohl<br />
der Gäste übernahmen Gaby Lenk und das<br />
Team der Hauswirtschaft die Verantwortung.<br />
An einem Freitag wurde der Krankenwagen<br />
aus Koblenz mit großer Anspannung<br />
und Vorfreude in der Effnerstraße erwartet.<br />
Als Marcel und seine beiden Betreuerinnen<br />
am späten Nachmittag eintrafen,<br />
waren Zeichen der Rührung über den gelungenen<br />
Coup bei allen Beteiligten zu<br />
spüren.<br />
Zum Programm des Traumwochenendes<br />
gehörte auch ein Ausflug nach Schwabing<br />
mit dem Besuch einer italienischen Eisdiele.<br />
Für eine Weiterfahrt zum Marienplatz<br />
mit dem berühmten Rathausbalkon, auf<br />
dem die Bayern schon so viele Siege feierten,<br />
wäre die Batterieversorgung zu unsicher<br />
gewesen. Trotzdem war dieser Teil des<br />
Programms für Marcel eine sensationelle<br />
Premiere, war er doch noch nie mit seinem<br />
Rollstuhl in öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
unterwegs gewesen. Außerdem war er auch<br />
erstmals ohne die Begleitung seiner Mutter<br />
auf Reisen. Zweifellos ein tolles Gefühl für<br />
einen jungen Mann seines Alters.<br />
Der Höhepunkt des Ausflugs nach München<br />
war fraglos der Besuch des Fußballspiels<br />
in der Allianz Arena. Marcels Traum<br />
wurde Wirklichkeit. Die Bayern spielten<br />
an diesem Tag gegen die Mannschaft von<br />
1899 Hoffenheim und gewannen souverän<br />
mit 2:0. Mann des Tages war Franck<br />
Ribéry, der mit seinem sechsten Bundesliga-Doppelpack<br />
(19. und 47. Minute) den<br />
Sieg gegen die Hoffenheimer sicherte. Das<br />
Glücksgefühl ist Marcel auf dem Foto, das<br />
in der Allianz Arena aufgenommen wurde,<br />
deutlich anzusehen – war doch sein sehnlicher<br />
Wunsch in Erfüllung gegangen. Die<br />
Rückreise nach Koblenz war – sieht man<br />
von dem einen oder anderen Verkehrsstau<br />
ab – problemlos, aber wahrscheinlich<br />
träumte Marcel ohnehin noch vom FCB.<br />
Damit ging ein rundum gelungener Ausflug<br />
nach München seinem Ende entgegen.<br />
Uns vom CHV hat es glücklich gemacht,<br />
dass wir durch die unkonventionelle Lösung<br />
des Problems einen entscheidenden<br />
Beitrag zum Gelingen des Wochenendes<br />
leisten konnten und im Sinne eines<br />
‚Hospitiums‘ Marcel und seinen beiden<br />
Betreuerinnen Gastfreundschaft und Herberge<br />
gewährten.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.stiftmobil.de/<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskeldystrophie<br />
11
Ein provokativer Gedanke? Wer der<br />
Grundidee des <strong>Hospiz</strong>-Gedankens folgt,<br />
der wird dieser Formulierung, auch wenn<br />
sie die <strong>Hospiz</strong>-Idee sehr salopp mit einem<br />
Slogan aus der Werbung umschreibt, zustimmen,<br />
ja von ganzem Herzen zustimmen<br />
wollen. Impliziert sie doch die Grundsehnsucht<br />
des Menschen, umsorgt zu<br />
werden, nicht mehr alles selbst in die Hand<br />
nehmen zu müssen, wenn man es nicht<br />
mehr kann.<br />
So wie das kleine Kind eine ‚Rumdumversorgung‘<br />
braucht, um gesund und ohne<br />
Schäden – körperlicher wie seelischer Art –<br />
in das Leben hinein zu kommen, so brauchen<br />
wir alle auch am Lebensende wieder<br />
Schutz und Hilfe auf medizinisch-pflegerischer<br />
und psychosozialer Ebene, um es<br />
wieder gut verlassen zu können.<br />
Das <strong>Hospiz</strong> (hospitium – die Herberge)<br />
war für den Reisenden – und wir Menschen<br />
sind in diesem Leben ja irgendwie<br />
auf der Durchreise – nicht nur ein Ort<br />
der Rast.<br />
12<br />
Sterben im <strong>Hospiz</strong> – ‚all inclusive‘?<br />
Ehemaliges <strong>Hospiz</strong> in Sterzing (Italien)<br />
Von Ingrid Pfuner<br />
Für schwer erkrankte Menschen in der letzten<br />
Lebensphase ist ein <strong>Hospiz</strong> eine Notwendigkeit,<br />
weil hier Fachkräfte erreichbar<br />
sind in dieser für den kranken und sterbenden<br />
Menschen und seine Angehörigen so<br />
schwierigen Zeit. Es ist ein Ort, an dem der<br />
Sterbende sich Menschen anvertrauen<br />
kann, die sich Zeit für ihn nehmen können,<br />
was in einem von schmalen Zeitfenstern<br />
bestimmten Klinik- und Pflegealltag<br />
meist nicht möglich ist.<br />
Was in dieser Situation nicht minder wichtig<br />
ist und oft unterschätzt wird: Auch Angehörige<br />
und Freunde werden mit einbezogen<br />
und fühlen sich unterstützt und<br />
getragen. Sie bekommen Hilfestellung für<br />
all ihre Sorgen und Nöte, für ihre Trauer<br />
während der Dauer des Sterbeprozesses<br />
und für die Bewältigung in der Trauerzeit<br />
nach dem Tod.<br />
Wenn keine Chance auf eine kurative<br />
Therapie mehr besteht und der Tod absehbar<br />
ist, steht die palliative Versorgung mit<br />
der Linderung der Symptome im Vordergrund.<br />
Der sterbende Mensch und seine<br />
ihm nahe stehenden Angehörigen und<br />
Freunde werden ermutigt, die eigenen Bedürfnisse<br />
zu formulieren oder zum Ausdruck<br />
zu bringen. Und so vielfältig und unterschiedlich<br />
wie der Mensch bei der<br />
Gestaltung seines Lebens vorgegangen ist,<br />
so verschieden sind auch die Wünsche und<br />
Bedürfnisse in dieser Lebensphase. Der eine<br />
wünscht sich einen Gesprächspartner,<br />
die andere möchte nicht alleine sein und<br />
freut sich, wenn jemand einfach nur da ist.
Die einen wollen noch ganz viel tun und<br />
aktiv sein, die anderen sehnen sich nach<br />
Ruhe. Um inneren Frieden zu finden, sicherlich<br />
eines der wichtigsten Bedürfnisse<br />
des Menschen am Lebensende, entsteht oft<br />
auch das Bedürfnis nach einer spirituellen<br />
Begleitung.<br />
Über die medizinische Symptom-Kontrolle<br />
hinaus steht im <strong>Hospiz</strong> mit seinem interdisziplinären<br />
Team unter Einbeziehung<br />
freiwilliger Helferinnen und Helfer immer<br />
der Mensch in seiner letzten Lebensphase<br />
im Vordergrund.<br />
Die lange Geschichte der <strong>Hospiz</strong>bewegung<br />
reicht zurück bis ins Jahr 1842, als<br />
Madame Jeanne Garnier in Lyon ein<br />
<strong>Hospiz</strong> einrichtete, das sich der Pflege<br />
Sterbender widmete und geht über das<br />
„Our Lady’s Hospice for the Care of the<br />
Dying“ in Dublin, das 1879 die irischen<br />
Schwestern der Nächstenliebe eröffneten,<br />
bis zum lebenslangen Engagement von<br />
Cicely Saunders für die Palliativmedizin<br />
und die <strong>Hospiz</strong>bewegung.<br />
Mit dem St. Christopher’s Hospice in Sydenham<br />
bei London, das 1967 gegründet<br />
wurde und von Anfang an multiprofessionell<br />
angelegt war, nahm die ursprünglich<br />
bürgerliche Bewegung ihren Anfang. Der<br />
erste deutsche <strong>Hospiz</strong>verein ist der <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>, der 1985 in München<br />
entstand.<br />
Das erste stationäre <strong>Hospiz</strong> in Deutschland,<br />
das Haus Hörn, wurde 1986 in<br />
Aachen gegründet.<br />
Heute gibt es in Deutschland 179 stationäre<br />
<strong>Hospiz</strong>e, Kinderhospiz, ein Jugendhos-<br />
piz eingeschlossen, über 1500 <strong>Hospiz</strong>-<br />
Dienste und über 80.000 <strong>Hospiz</strong>-Helfer.<br />
Das nachfolgende Beispiel aus dem <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> zeigt den für beide Seiten<br />
nicht immer einfachen und klaren Weg hin<br />
zu einer stationären Betreuung:<br />
Frau Z. ist 52 Jahre alt und leidet an einem<br />
Schilddrüsenkarzinom. Sie soll von der<br />
Palliativstation einer Klinik außerhalb<br />
Münchens entlassen werden. Ihre Tochter<br />
möchte sie nach München holen, da sie hier<br />
lebt. Die Tochter und der Ex-Ehemann, der<br />
sich um organisatorische sowie finanzielle<br />
Dinge kümmert, sind beide Bevollmächtigte,<br />
auch eine Patientenverfügung liegt vor, sodass<br />
mit beiden ein Gespräch im <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> vereinbart wird. In diesem<br />
Gespräch bringen die Angehörigen zum Ausdruck,<br />
dass sich Frau Z. ihrer Situation sehr<br />
klar bewusst sei und auch keine lebensverlängernden<br />
Maßnahmen für sie infrage kämen.<br />
Da sich eine Freundin gerne um sie kümmern<br />
möchte, sich das aber aufgrund des<br />
schwierigen Krankheitsbildes nicht zutraut,<br />
kommt eine Aufnahme ins <strong>Hospiz</strong> in Betracht<br />
und ein Gespräch mit der Ärztin wird<br />
vereinbart. In diesem Gespräch mit der Ärztin<br />
wird jedoch deutlich, dass die Patientin<br />
ihre Situation wohl doch anders einschätzt,<br />
als es die Angehörigen verstanden haben.<br />
Was der Einzug ins <strong>Hospiz</strong> bedeutet, ist Frau<br />
Z. nicht wirklich bewusst und so bittet die<br />
betreuende Sozialpädagogin im <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> im Gespräch mit der Ärztin darum,<br />
von Frau Z. angerufen zu werden, bevor<br />
über eine Aufnahme entschieden wird. Hier<br />
zeigt sich, wie schwierig es für das <strong>Hospiz</strong> ist,<br />
die Aussagen und Wünsche der Kranken zu<br />
respektieren und zu bewerten und mit der<br />
Interpretation der Angehörigen sowie den<br />
13
Aufnahmekriterien des <strong>Hospiz</strong>es in Einklang<br />
zu bringen. Die Situation spitzt sich zu, da<br />
Frau Z., die zwischenzeitlich in eine Klinik<br />
eingewiesen wurde und ihre Wohnung gekündigt<br />
hat, nun entlassen werden soll. Der<br />
Stationsarzt geht im Gespräch davon aus,<br />
dass die Patientin einen Platz im <strong>Hospiz</strong> bekommt.<br />
Beim Gespräch in der Klinik mit<br />
der Tochter und der Sozialpädagogin des<br />
<strong>Hospiz</strong>es sagt die Patientin aber deutlich,<br />
dass sie nicht sterben will und eine intensivmedizinische<br />
Behandlung haben möchte. Da<br />
ihr Kurzzeitgedächtnis sehr schlecht geworden<br />
ist, versteht sie, dass das <strong>Hospiz</strong> sie so<br />
nicht aufnehmen kann, vergisst es dann aber<br />
schnell wieder. Auch der Tochter ist nach diesem<br />
Gespräch klar, dass die Kriterien für eine<br />
<strong>Hospiz</strong>aufnahme der Mutter noch nicht<br />
erfüllt sind. Einen Monat später folgt ein erneuter<br />
Anruf aus dem Umfeld des Ex-Ehemannes<br />
und der Freundin mit der Bitte,<br />
Frau S. nun doch aufzunehmen, da es ihr<br />
sehr schlecht gehe. Sie wurde vom betreuten<br />
Wohnen in die Kurzzeitpflege verlegt und<br />
hat klargestellt, dass sie nicht in ein Krankenhaus<br />
will und auch keine Infusionen oder<br />
Blutübertragung mehr möchte – ein deutlich<br />
verändertes Bewusstsein zu der ersten Anfrage<br />
und ihrer damaligen Aussage. Das <strong>Hospiz</strong><br />
setzt sich nun mit dem <strong>Hospiz</strong>kreis außerhalb<br />
Münchens in Verbindung, der Frau Z.<br />
und die Angehörigen betreut.<br />
In dem Gespräch mit dem <strong>Hospiz</strong>kreis und<br />
einem nachfolgenden Gespräch mit dem<br />
Hausarzt wird deutlich, dass Frau Z. selbst<br />
den Wunsch äußert, ins <strong>Hospiz</strong> zu gehen und<br />
auch der Arzt infolge des Krankheitsbildes eine<br />
Aufnahme sehr unterstützt. Jetzt erst<br />
schließt sich der Kreis und einer Aufnahme<br />
steht nichts mehr entgegen. Die Erleichterung<br />
der Familie, dass sie nach dieser schwierigen<br />
14<br />
Zeit ihre Angehörige gut aufgehoben wissen<br />
und die Freudentränen von Frau Z., als sie<br />
erfährt, dass sie im <strong>Hospiz</strong> aufgenommen<br />
wird, unterstreichen, wie auch viele wissenschaftliche<br />
Studien mittlerweile belegen, dass<br />
die meisten Menschen am Ende ihres Lebens<br />
erkennen, worauf es wirklich ankommt und<br />
was ein <strong>Hospiz</strong> leistet: bei schwerster Erkrankung<br />
und begrenzter Lebenserwartung ‚in<br />
guten Händen zu sein‘.<br />
Um die <strong>Hospiz</strong>-Bewegung zu verbreiten,<br />
erarbeitete der DHPV (Deutscher <strong>Hospiz</strong>-<br />
und Palliativ Verband e.V.) zusammen<br />
mit der Deutschen Gesellschaft für<br />
Palliativmedizin (DGP) und der<br />
Bundesärztekammer im Jahr 2010 eine<br />
„Charta zur Betreuung schwerstkranker<br />
und sterbender Menschen“. Schon 1996<br />
wurde die Mitfinanzierung durch die<br />
Kranken- und Pflegekassen in § 39a des<br />
SGB V festgeschrieben. Der Deutschen<br />
Gesellschaft für Palliativmedizin gelang<br />
zusammen mit dem DHPV und der Patientenschutzorganisation<br />
„Deutsche<br />
<strong>Hospiz</strong> Stiftung“, eine gesetzliche Verankerung<br />
der Finanzierung der <strong>Hospiz</strong>arbeit.<br />
Seit dem 1. August 2009 tragen die<br />
Krankenkassen einen Teil des Pflegesatzes.<br />
Aber immer sind die <strong>Hospiz</strong>e verpflichtet,<br />
einen Teil des Pflegesatzes durch<br />
Spenden und ehrenamtliche Arbeit selbst<br />
aufzubringen.<br />
Da die Bezeichnung <strong>Hospiz</strong> bislang nicht<br />
explizit geschützt ist, befürworten die meisten<br />
Vertreter der <strong>Hospiz</strong>bewegung diese<br />
Aufteilung, um die Gründung gewinnorientierter<br />
Unternehmen zu unterbinden.<br />
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei<br />
der Fürsorgepflicht für Menschen in dieser<br />
Lebenssituation.
Neben der stationären Betreuung zeigt die<br />
Praxis im <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong>, dass es<br />
immer mehr Menschen gibt, die sich wünschen,<br />
in ihrer häuslichen Umgebung versorgt<br />
zu werden und auch dort im vertrauten<br />
Umfeld sterben möchten. Wie eine<br />
solche ambulante hospizliche Begleitung<br />
aussehen kann, zeigt sich beispielhaft an<br />
der Begleitung von Frau M. über einen<br />
Zeitraum von knapp zwei Jahren.<br />
Nach der Erkrankung an einem Lungentumor<br />
informiert sich Frau M. über die Möglichkeiten<br />
einer Unterstützung seitens des <strong>Hospiz</strong>es,<br />
da sie von ihrem Ehemann getrennt lebt<br />
und ihre Tochter weiter weg wohnt. Zu ihrem<br />
Verständnis eines selbstbestimmten Lebens gehörte<br />
die Ablehnung einer Chemotherapie<br />
ebenso wie die Offenheit gegenüber den verschiedensten<br />
Wegen jenseits der Schulmedizin.<br />
Sie sprach offen über ihr eigenes Sterben und<br />
hatte in diesem Sinne auch eine Patientenverfügung<br />
sowie eine Vollmacht für die Tochter.<br />
Sie wünschte sich eine <strong>Hospiz</strong>helferin als Begleitung<br />
und in den folgenden knapp zwei<br />
Jahren besuchte diese sie dann regelmäßig.<br />
Auch eine Mitarbeiterin des medizinisch-pflegerischen-Teams<br />
wurde eingeschaltet, aber anfangs<br />
nicht oft in Anspruch genommen. Es gelang<br />
Frau M. in dieser Zeit, in ihrer Wohnung<br />
weitestgehend selbstständig zu leben und auch<br />
ihre große Tierliebe weiter in ihren Alltag zu<br />
integrieren und sich diese Freude zu erhalten,<br />
in dem sie von Freunden und Bekannten in<br />
Urlaubszeiten deren Katzen bei sich aufnahm<br />
und diese versorgte. Als sie nach 22 Monaten<br />
der ambulanten Begleitung jedoch spürte, dass<br />
ihre Kraft, alleine zu leben, nicht mehr ausreichte,<br />
äußerte sie beim Hausbesuch der medizinisch-pflegerischen<br />
Mitarbeiterin ihren<br />
großen Wunsch, ins <strong>Hospiz</strong> zu ziehen. Zwei<br />
Tage später konnte diesem Wunsch entsprochen<br />
werden. Die aufmerksame und liebevolle<br />
Betreuung war ihr – nach kurzen Eingewöhnungsschwierigkeiten<br />
– sehr bewusst und<br />
sie genoss es – jetzt deutlich geschwächt – so<br />
verwöhnt zu werden und äußerte dies auch:<br />
„Dass man als kranker Mensch so lieb behandelt<br />
wird, ist mir noch nie passiert“. Im <strong>Hospiz</strong><br />
lebend wurde sie nach wie vor von ihrer<br />
vertrauten <strong>Hospiz</strong>helferin, dem Ehemann<br />
und von Freunden besucht. Eine Freundin<br />
brachte sogar ihre beiden Hunde mit, worüber<br />
sie sich sehr freute. Einen Monat nach ihrem<br />
Einzug verstarb Frau. M.<br />
Man muss gar nicht die sogenannte Alterspyramide<br />
bemühen oder die Schreckensszenarien<br />
einer alternden Gesellschaft an die<br />
Wand malen, um – wie in diesen zwei Beispielen<br />
– zu erkennen, dass wir in der<br />
Pflicht stehen, be- und geschützte Orte wie<br />
<strong>Hospiz</strong>e zu fördern. Es gilt, die <strong>Hospiz</strong>-Idee<br />
nicht nur in Bezug auf die neuesten medizinischen<br />
und wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />
zu betrachten, sondern auch den Raum<br />
dafür in unserer Gesellschaft zu schaffen.<br />
Der Kabarettist Jochen Busse hat es in einem<br />
Gespräch mit Andreas Bönte in der<br />
Nachtlinie des BR vom November letzten<br />
Jahres so formuliert:<br />
„In meinem Alter steht der Tod noch nicht vor<br />
der Tür, aber er sucht bereits einen Parkplatz“.<br />
Kann es etwas Besseres geben für uns alle<br />
als das Wissen, dass es einen gut angelegten<br />
‚Parkplatz‘, bereits gibt?!<br />
weitergehende Informationen:<br />
http://www.pflegewiki.de<br />
15
Über 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund<br />
lebten 2012 in Deutschland.<br />
Auf der Grundlage des am 30. Oktober<br />
1961 mit der Türkei geschlossenen<br />
Anwerbevertrages kamen mehr als 2,5<br />
Millionen Zuwanderer als „Gastarbeiter“<br />
in die Bundesrepublik. Sie sollten, so war<br />
es zunächst vorgesehen, ein bis zwei Jahre<br />
bleiben und dann in die Heimat zurückkehren.<br />
Doch das „Wirtschaftswunder“,<br />
der Wiederaufbauboom verlangte immer<br />
mehr Arbeitskräfte und so blieben die<br />
meisten von ihnen. Sie kamen aus einem<br />
armen, von Arbeitslosigkeit geprägten, politisch<br />
instabilen Land, in dem außerdem<br />
Minderheiten wie Armenier, Alewiten und<br />
Kurden unterdrückt und Repressalien ausgesetzt<br />
waren.<br />
„Gurbet“, türkisch das ferne Land, die<br />
Fremde, wurde zum Synonym für<br />
Deutschland, jenes ferne Land, in dem seit<br />
Beginn der Arbeitsmigration fast jeder<br />
Türke ein Familienmitglied hatte. Und ab<br />
1965 gewährte das Ausländergesetz auch<br />
die Möglichkeit, Ehefrauen, Söhne und<br />
Töchter in die Bundesrepublik nachzuholen.<br />
Als es in Folge der Ölkrise 1973 zu<br />
einer Rezession kam, wurde ein Anwerbestopp<br />
verhängt, doch die laufenden Arbeitsverträge<br />
blieben bestehen.<br />
Dursun Öztürk (Name geändert) gehörte<br />
mit zu den ersten türkischen Gastarbeitern,<br />
die 1964 nach München kamen.<br />
1968 folgte ihm seine Ehefrau und<br />
16<br />
Inschallah<br />
Wenn Gott will<br />
Von Uve Hirsch<br />
schließlich lebte ab 1971 die ganze Familie,<br />
vier Söhne und zwei Töchter in der<br />
bayerischen Landeshauptstadt. Aus ihrem<br />
Heimatdorf Erikbelen an der nordostanatolischen<br />
Schwarzmeerküste haben fast alle<br />
der 1000 Einwohner in den letzten 50<br />
Jahren Arbeit in München, Berlin, Hamburg<br />
und Linz oder zumindest Istanbul gesucht,<br />
um ihre wirtschaftlich schwere Situation<br />
zu verbessern. Die meisten<br />
Zuwanderer der zweiten und dritten Generation<br />
betrachten inzwischen Deutschland<br />
als ihre Heimat.<br />
Bevor die Söhne Salih und Rafed von<br />
Dursun Öztürk die Türkei verließen, wurden<br />
sie von ihren Eltern verheiratet. Hochzeiten,<br />
die für ihre Kinder, die seit ihrer<br />
Geburt in Deutschland leben, heute völlig<br />
undenkbar sind. Für Salih aber, damals 18<br />
Jahre alt, war als folgsamer Sohn nicht nur<br />
die arrangierte Heirat mit der von seiner<br />
Mutter für ihn ausgesuchten 17jährigen<br />
Saniye selbstverständlich, er bestimmte<br />
auch bis zu seinem Tod im Oktober 2012<br />
das Leben seiner Familie. Das traditionelle<br />
Männlichkeitsbild, die herausgehobene<br />
Rolle des Vaters und Ernährers, prägt bis<br />
heute die türkische Gesellschaft. Im Islam,<br />
im gesamten Nahen Osten, haben Ehe<br />
und Familie einen weitaus höheren Stellenwert<br />
als im europäischen Westen. Rollen<br />
und Pflichten, die Stellung des Einzelnen<br />
in der Familienhierarchie, haben auch<br />
in der „Fremde“, in Deutschland, für die ja<br />
meist aus ländlichen Gebieten, aber auch
Salih Öztürk und seine Familie im Krankenhaus<br />
aus „einfachen“ Verhältnissen stammenden<br />
türkischen Mitbürger ihre Gültigkeit<br />
behalten. Die Familie sorgt für ihre einzelnen<br />
Mitglieder mit einer oft beispiellosen<br />
Solidarität und steht für sie ein.<br />
Als <strong>Hospiz</strong>helfer bei einer türkischen<br />
Familie<br />
Es war eine ungewöhnliche Erfahrung, einen<br />
todkranken Türken als <strong>Hospiz</strong>helfer<br />
zu begleiten. Salih Öztürk, 59 Jahre alt,<br />
seit zwei Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs<br />
erkrankt, war nach mehreren Operationen<br />
und Chemotherapien nach Hause<br />
entlassen worden. Der Sozialdienst des<br />
Krankenhauses hatte der Familie die ambulante<br />
Palliativversorgung des <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong>es empfohlen. Gleich bei<br />
meinem ersten Besuch erlebte ich, wie liebevoll<br />
und selbstverständlich eine türkische<br />
Großfamilie auch in schwierigen Situationen<br />
zusammenhält. Innerhalb von<br />
zwei Stunden lernte ich fast 20 Geschwister,<br />
Nichten, Neffen und Enkel, aber auch<br />
Schwiegersöhne und Cousinen kennen,<br />
die sich nach Salihs Befinden erkundigten,<br />
seiner Frau Saniye ihren Beistand versicherten<br />
und sich darüber freuten, dass<br />
durch mich als <strong>Hospiz</strong>helfer ein wenig Abwechslung<br />
in sein Leben gebracht würde.<br />
Mehr als 30 Jahre hatte er als Lagerarbeiter<br />
– meist nachts – Supermärkte mit Lebens-<br />
17
mitteln beliefert, für seine Frau und drei<br />
Kinder gesorgt und von seinen Ersparnissen<br />
ein kleines Haus in Istanbul gebaut.<br />
Dort und in ihrem Heimatdorf Erikbelen<br />
wollten sie ihren Lebensabend verbringen.<br />
Salih Öztürk war nie ein besonders frommer<br />
Muslim. Aber als Angehöriger der<br />
Alewiten, der liberalsten Glaubensgemeinschaft<br />
des schiitischen Islam, sah er<br />
seine Krankheit zwar als gottgegeben, „inschallah“,<br />
doch auch die Verpflichtung,<br />
alles zu tun, seinen Gesundheitszustand<br />
zu verbessern. Denn nach islamischem<br />
Glauben hat der Mensch eine hohe Eigenverantwortung<br />
und muss im Jenseits<br />
Rechenschaft darüber ablegen, wie er mit<br />
seinem Körper umgegangen ist. Fast ein<br />
Abschied in München<br />
Wunder, wie lange Salih mit dem schnell<br />
wuchernden Tumor, den Metastasen in<br />
mehreren Organen, vor allem in der Lunge,<br />
durchgehalten hat. Die damit verbundene<br />
Atemnot führte bei der geringsten<br />
Aufregung zu Panikattacken. Nicht nur<br />
18<br />
Saniye, seine Ehefrau, die rund um die<br />
Uhr seine Angst und Schmerzzustände zu<br />
lindern versuchte, auch die beiden Töchter<br />
verbrachten, – oft mit ihren Kindern –<br />
mehr als zwei Jahre lang jede freie Minute<br />
und jedes Wochenende am Krankenbett<br />
ihres Vaters. Mit mir spielte Salih Karten<br />
und erzählte viel aus seiner Jugend in der<br />
rauen Landschaft seiner Heimat. Seine<br />
Mutter war beim Waschen im Fluss ertrunken,<br />
als er neun Jahre alt war. Sein<br />
Vater hatte bis kurz vor seinem Tod in<br />
München gelebt, war in Erikbelen gestorben<br />
und dort auch begraben. „Wenn es<br />
mir besser geht, will ich nach Hause,<br />
kommst du mit?“ fragte er mich immer<br />
wieder. Ich spürte, wie ihn diese Idee beflügelte<br />
und gemeinsam schmiedeten wir<br />
Pläne.<br />
Reise in die Heimat<br />
Doch sein Zustand verschlechterte sich<br />
zusehends. Nicht mehr transportfähig,<br />
lautete die Diagnose nach einem letzten<br />
Krankenhausaufenthalt. Damit war auch<br />
die Flugreise, auf die er und die Familie<br />
gehofft hatten, unmöglich geworden.<br />
„Dann fahren wir eben mit dem Auto“,<br />
wurde beschlossen. Schwiegersohn Ali<br />
richtete seinen Geländewagen so ein, dass<br />
Salih darin liegen konnte. Dann machten<br />
sich seine Ehefrau Saniye, sein Sohn Sedat<br />
und Ali mit dem sterbenskranken<br />
Salih auf den Weg ins 2100 Kilometer<br />
entfernte Istanbul. Die riskante Nonstop-<br />
Fahrt durch Österreich, Ungarn, Serbien,<br />
Bulgarien und abenteuerlichen Zwischenaufenthalten<br />
nahm für Salih ein gutes<br />
Ende. Der Gedanke, wieder in die<br />
Heimat zu kommen, hatte bei ihm die
letzten Kräfte mobilisiert. Begleitet von<br />
seiner gesamten Familie starb Salih drei<br />
Wochen später. Zu seiner Beerdigung<br />
wurde ein großer Reisebus gemietet, mit<br />
dem seine Verwandten, die aus Deutsch-<br />
Fotos: Uve Hirsch<br />
Weiterführender Link zum Thema:<br />
Auf der Fahrt nach Istanbul<br />
land angeflogen kamen, mit dem Toten<br />
800 Kilometer in seinen Heimatort Erikbelen<br />
fuhren.<br />
Inschallah<br />
http://www.kultur-gesundheit.de/gesundheit_krankheit_und_muslimische_patienten/islam/index.php<br />
19
Das Saul-Eisenberg-Seniorenheim in der<br />
Kaulbachstraße unweit des Englischen Gartens<br />
ist von außen so unauffällig, dass ich es<br />
zunächst übersehe. Dann bemerke ich das<br />
Parkverbot vor dem Haus und die Monitore<br />
an der Wand und weiß mich am Ziel. Die<br />
Pforte des Hauses ist der Eingangstür vorgelagert.<br />
Im Unterschied zu anderen Altenheimen<br />
ist der Zugang ohne Anmeldung nicht<br />
möglich. Dabei erinnere ich mich an den<br />
Brandanschlag auf das ehemalige jüdische<br />
Seniorenheim in der Reichenbachstraße im<br />
Jahr 1970, bei dem sieben Menschen starben.<br />
Die Tat wurde nie aufgeklärt. In der<br />
Vergangenheit – so erfahre ich später –<br />
stand immer ein Polizeiauto vor der Tür,<br />
doch wurde das von den Bewohner/innen<br />
abgelehnt, da sie sich dadurch noch mehr<br />
gefährdet fühlten. Heute fährt die Polizei<br />
20<br />
Schalom<br />
Die Kooperation mit dem jüdischen<br />
Seniorenheim in der Kaulbachstraße<br />
Ein Gespräch mit der Pflegedienstleiterin Dina Zenker<br />
Von Heinz Biersack<br />
im Stundenrhythmus vorbei, um nach dem<br />
Rechten zu sehen.<br />
Die Betriebsträgerschaft des Senioren- und<br />
Pflegeheims der Israelitischen Kultusgemeinde<br />
München und Oberbayern hat die<br />
Münchner Arbeiterwohlfahrt übernommen.<br />
Das Haus, das in den achtziger Jahren<br />
des letzten Jahrhunderts gebaut wurde,<br />
bietet Platz für 54 Bewohner/innen, was in<br />
Anbetracht der regionalen Zuständigkeit<br />
und der zahlreichen Zuwanderer aus den<br />
ehemaligen GUS-Staaten in den vergangenen<br />
Jahren, „heute eigentlich zu klein ist“,<br />
wie ich von Dina Zenker, der Pflegedienstleiterin<br />
erfahre. Schon Ende des 19. Jahrhunderts<br />
stand an der selben Stelle ein<br />
„klassisches jüdisches Altenheim, wie es<br />
früher so üblich war“.<br />
Der Terror des Nazi-Regimes machte auch<br />
vor dieser Einrichtung in der Kaulbachstraße<br />
nicht Halt. 1941 wurden die damaligen<br />
Bewohner/innen des Hauses nach<br />
Kaunas deportiert, wo sich ihre Spur verliert.<br />
In den Jahren bis zum Kriegsende gehörte<br />
das Haus dem „Lebensborn“, um<br />
dort „die arische Herrenrasse zu züchten“.<br />
Nach dem Krieg wurde in diesem Gebäude<br />
die Jüdische Gemeinde von München<br />
restituiert. In den Jahren 1982 und 1983<br />
konnte das Seniorenheim an diesem histo-
ischen Ort mit großzügiger Unterstützung<br />
der Saul Eisenberg Stiftung, der<br />
Landeshauptstadt München und des Freistaates<br />
Bayern neu errichtet werden. Saul<br />
Eisenberg, ein ehemaliger Münchener<br />
Bürger und jüdischer Philanthrop, dem es<br />
durch die Emigration nach Shanghai noch<br />
rechtzeitig gelang, dem Pogrom des Terrorregimes<br />
zu entfliehen, war ein erfolgreicher<br />
Bauunternehmer in Tokio, Sidney und<br />
New York. Seine Stiftung unterstützt das<br />
Haus bis zum heutigen Tag.<br />
Eingangsbereich<br />
Beim Betreten des Eingangsbereiches<br />
verfolge ich ein Gespräch von Dina<br />
Zenker mit einer Bewohnerin, das sie auf<br />
Jiddisch führt. „Dies ist eine Sprache, die<br />
leider nicht mehr so lange existieren<br />
wird“, sagt sie mir später. Bei den fünfzehn<br />
verschiedenen Sprachen, die im<br />
Saul-Eisenberg-Seniorenheim gesprochen<br />
werden, ist das Jiddische die „Lingua<br />
Franca“, also die gemeinsame Verkehrssprache<br />
der unterschiedlichen Nationalitäten.<br />
Jiddisch sei auch für die deutschsprachigen<br />
Mitarbeiter/innen von Vorteil,<br />
da man es im Ansatz etwas verstehen<br />
könne, so Dina Zenker.<br />
Das <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> ist seit<br />
vielen Jahren im Saul-Eisenberg-<br />
Seniorenheim aktiv<br />
Seit fünf Jahren besteht ein offizieller Kooperationsvertrag<br />
mit dem CHV, der Beginn<br />
der Zusammenarbeit liegt jedoch<br />
wesentlich länger zurück. „Es ist schon so<br />
lange her, dass ich gar nicht mehr weiß wie<br />
lange. Auf jeden Fall waren in der Zeit die<br />
Büros des <strong>Verein</strong>s noch am Rotkreuzplatz“,<br />
erinnert sich Dina Zenker. Den Ausschlag<br />
gab seinerzeit ein Bewohner mit einem Tumor<br />
am Hals, der aufzubrechen drohte.<br />
Die Hilfe des CHV wird seitdem häufig in<br />
Anspruch genommen. „Immer, wenn wir<br />
eine schwere Erkrankung im Hause haben<br />
– auch wenn es keine Krebserkrankung ist,<br />
wird um Hilfe angefragt“, erzählt die Pflegedienstleiterin<br />
begeistert. Gerade in Anbetracht<br />
der Tatsache, dass die Angehörigen<br />
der Bewohner/innen meist sehr weit weg<br />
wohnen, z.B. in den USA oder in Israel,<br />
trifft Dina Zenker ihre Entscheidungen<br />
gerne in Zusammenarbeit mit dem CHV,<br />
so müsse sie die existenziellen Fragen nicht<br />
immer alleine verantworten. Ihre Erfahrung<br />
mit dem <strong>Verein</strong> beschreibt sie als<br />
„hundert, hundert, hundert prozentig positiv“.<br />
Ihrer Aussage nach wäre der Pflegealltag<br />
ohne die Kooperation mit dem CHV<br />
nicht mehr vorstellbar. Dank der persönlichen<br />
Fortbildungsmaßnahmen im Bereich<br />
Palliative Care und den multiprofessionellen<br />
Fallbesprechungen, ist Dina Zenker<br />
immer im Kontakt mit dem CHV. Dr.<br />
Christoph Fuchs schaue wiederholt im<br />
Seniorenheim vorbei, worüber sie sehr<br />
dankbar und glücklich sei.<br />
21
Neu sind die Fortbildungsmaßnahmen,<br />
die Hans Steil vom CHV, der dem Haus<br />
schon seit Jahren verbunden ist, für die<br />
Mitarbeiter/innen des Hauses vor Ort anbietet.<br />
Auch <strong>Hospiz</strong>helfer/innen kommen<br />
für Sitz- und Nachtwachen in das Seniorenheim.<br />
Bei einem Bewohner, der geäußert<br />
hatte, Angst zu haben in der Nacht alleine<br />
zu sein, wurde eine 24-Stunden<br />
Sitzwache für die letzten drei Tage seines<br />
Lebens organisiert. Ohne die Hilfe des<br />
CHV wäre das nicht zu stemmen gewesen.<br />
Ihr persönliches Resümee spiegelt die gute<br />
und langjährige Kooperation wieder: „Wir<br />
kriegen vom CHV alles was wir brauchen,<br />
ich muss mich nur rühren und schon geschieht<br />
etwas“.<br />
Die Pflege traumatisierter Überlebender<br />
erfordert äußerste Sensibilität<br />
Neben den Holocaust-Überlebenden,<br />
wohnen zahlreiche Child Survivors im<br />
Saul-Eisenberg-Seniorenheim. Child Survivors<br />
wurden als Kinder in der NS-Zeit<br />
wegen ihres Judentums, beziehungsweise<br />
wegen ihrer jüdischen Wurzeln, verfolgt,<br />
„sie haben die Schlüsselkompetenzen wie<br />
Vertrauen und Geborgenheit nicht erworben“,<br />
was den Pflegealltag wesentlich erschwere,<br />
berichtet Dina Zenker. „Die oft<br />
durch körperliche Schwäche und Krankheit<br />
hervorgerufene Hilflosigkeit im Alter<br />
bekommt für Überlebende der Schoah<br />
meist eine zusätzliche, lebensbedrohliche<br />
Dimension. Sie sind emotional zutiefst<br />
verwundet, einhergehend mit einem<br />
zerbrochenen Grundvertrauen in die<br />
Menschen“. Bei der Pflege sei es wichtig,<br />
Reizauslöser zu vermeiden, die eine<br />
Retraumatisierung provozieren könnten.<br />
Schon die „leisesten Trigger“ können<br />
22<br />
Reizauslöser für eine Retraumatisierung<br />
sein. Um einige Beispiele zu nennen:<br />
Uringeruch kann Assoziationen zu den<br />
Deportationen im Viehwaggon, gestreifte<br />
Bettwäsche Assoziationen zur Häftlingskleidung<br />
im KZ hervorrufen. Bei der Anforderung<br />
eines Krankenwagens wird der<br />
Begriff Transportschein vermieden und<br />
durch den Begriff Verlegungsbericht ersetzt,<br />
da der Begriff Transportschein mit<br />
Zwangsdeportationen assoziiert werden<br />
kann. Um zu verhindern, dass alte Erinnerungen<br />
an traumatische Ereignisse reaktiviert<br />
werden, sei im Reden und Handeln<br />
äußerste Sensibilität erforderlich, denn es<br />
gebe Trigger, „die man im Leben nicht<br />
erahnen würde“.<br />
In diesem Kontext spitzen sich die Fragen<br />
zur Ernährung in der letzten Lebensphase,<br />
– wenn es um terminale Erkrankungen<br />
oder auch um Nahrungsverweigerung in<br />
der Demenz geht – extrem zu. Es ist für alle<br />
Pflegeheime schwer, damit umzugehen,<br />
in der speziellen Situation eines jüdischen<br />
Seniorenheims hat es jedoch noch einmal<br />
eine ganz besondere Bedeutung. „Wenn<br />
Du weißt, dass Deine Eltern im KZ beinahe<br />
verhungert wären und Du musst jetzt<br />
Angst haben, dass sie im Altenheim verhungern,<br />
weil sie nicht mehr essen, ist das<br />
psychisch fast nicht zu ertragen und auszuhalten.<br />
Du verstehst es im Kopf, aber nicht<br />
mit dem Herzen“, erklärt Dina Zenker<br />
diese schwierige Situation. Bei der Pflege<br />
und der Sterbebegleitung müsse man sich<br />
stets vor Augen halten, „dass es sich bei<br />
diesen in ihrer Seele Verletzten um besonders<br />
schutzbedürftige Menschen handelt“.<br />
Erforderlich sei daher „ein hohes Maß an<br />
Einfühlungsvermögen, Vorsicht, Respekt<br />
und Liebe“.
Bewohner mit unterschiedlicher<br />
religiöser Praxis stellen eine große<br />
Herausforderung dar<br />
Ein Großteil der Bewohner/innen kommt<br />
aus der ehemaligen Sowjetunion. Dieser<br />
Personenkreis ist areligiös und atheistisch<br />
aufgewachsen, sie verstehen sich lediglich<br />
in ihrer Identität als Juden. Erst hier im<br />
Saul-Eisenberg-Seniorenheim werden diese<br />
Menschen mit jüdischen Bräuchen und<br />
Riten konfrontiert. „Bei uns im Haus gibt<br />
es Orthodoxe, Liberale und Bewohner, die<br />
vom jüdischen Leben gar nichts wissen,<br />
das ist eine große Herausforderung“, so<br />
Dina Zenker. Die Mahlzeiten sind selbstverständlich<br />
koscher, was einen nicht unerheblichen<br />
Mehraufwand mit sich bringt.<br />
Gottesdienste werden regelmäßig zu den<br />
Feiertagen gefeiert, am Schabbat jedoch<br />
schon nicht mehr, da zum öffentlichen<br />
Gebet zehn Männer benötigt werden, was<br />
in Anbetracht der Bewohnerstruktur und<br />
Fotos: Heinz Biersack<br />
der Länge der Gottesdienste nicht bewerkstelligt<br />
werden kann.<br />
Mit einem Witz beendet Dina Zenker unser<br />
Gespräch: „Wir wünschen uns immer:<br />
Bis 120 Jahre sollst Du gesund sein. Jetzt<br />
wünscht man sich aber, bis 120 Jahre und<br />
drei Wochen sollst Du gesund sein - soll<br />
sein nicht so plötzlich“.<br />
Frau Zenker begleitet mich zum Ausgang<br />
und zeigt mir auf dem Weg die kleine<br />
Synagoge mit den Thora-Rollen. Beim<br />
Verlassen des Hauses wird mir erneut die<br />
besonders persönliche Atmosphäre des<br />
Hauses bewusst, wie ich sie so zuvor noch<br />
nie kennengelernt habe.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.ikg-m.de<br />
http://awo-münchen.de/index.php?id=224<br />
www.child-survivors-deutschland.de<br />
23
Foto: Uve Hirsch<br />
Uve Hirsch: Krankenhäuser sind der Gegenentwurf<br />
dessen, was ein Mensch am Ende<br />
des Lebens braucht“, schreiben Sie in ihrem<br />
Buch „Wie wollen wir sterben.<br />
Michael de Ridder: Ja, die Architektur<br />
wie auch das Innenleben nahezu aller großen<br />
Krankenhäuser hat etwas von einer<br />
„Maschine“, etwas Abweisendes und Bedrückendes.<br />
Man fühlt sich einfach nicht<br />
wohl, geschweige denn geborgen. Das ist<br />
für „normale“ Kranke schon schwer genug<br />
zu ertragen, um wie viel mehr erst für Sterbende.<br />
Wenn Sie sich also wie ich der Versorgung<br />
terminal kranker Menschen zuwenden,<br />
erwarten Sie dafür angemessene<br />
Bedingungen, die das übliche Krankenhaus<br />
nicht bietet.<br />
Krankenhäuser sind Einrichtungen der<br />
kurativen Medizin: Sie verstehen ihren<br />
24<br />
Sterben gehört nicht ins Krankenhaus<br />
Interview mit Michael de Ridder<br />
Von Uve Hirsch<br />
Auftrag dahingehend, Krankheiten zu<br />
heilen, Leben zu erhalten und zu verlängern.<br />
Zwar wird in Krankenhäusern auch<br />
gestorben – 45% aller Menschen in<br />
Deutschland sterben in einer Klinik –<br />
doch sind sie weder von ihrer räumlichgestalterischen<br />
Umgebung noch nach<br />
Ausbildung und Kompetenz ihres ärztlichen<br />
und pflegerischen Personals, mit<br />
Ausnahme der Palliativstationen, dazu<br />
geeignet, Menschen mit einer terminalen<br />
Erkrankung oder Sterbenden ein angemessenes<br />
Umfeld und eine adäquate Versorgung<br />
angedeihen zu lassen.<br />
Ein <strong>Hospiz</strong> hingegen bietet Sterbenden eine<br />
Umgebung, die weitestgehend nach ihren<br />
Bedürfnissen ausgelegt ist: eine ruhige<br />
und intime Atmosphäre ist essentiell, <strong>Hospiz</strong>e<br />
haben höchstens 16 Betten; die Zimmer<br />
ähneln eher einem häuslichen Wohnraum<br />
als einem Patientenzimmer in der<br />
Klinik; und, was natürlich das Bedeutsamste<br />
ist, in „palliative care“ geschultes,<br />
professionelles wie ehrenamtliches Personal<br />
steht in ausreichender Anzahl für<br />
die medizinisch-pflegerische, psychosoziale<br />
und spirituelle Versorgung und Betreuung<br />
der Patienten 24 Stunden täglich zur<br />
Verfügung.<br />
U.H.: Im <strong>Hospiz</strong> wird das Lebensende organisiert.<br />
Hat das nicht zunächst etwas Befremdliches?<br />
Decken die <strong>Hospiz</strong>e – überspitzt<br />
gesagt – eine Versorgungslücke in der<br />
Sterbephase ab?
M.d.R.: Auch die Krankenversorgung ist<br />
von der hohen Arbeitsteiligkeit unserer Gesellschaft<br />
nicht ausgenommen. Zudem<br />
wachsen die Ansprüche der Menschen an<br />
gute medizinische Versorgung und die ist<br />
im familiären Zusammenhang, also dort,<br />
wo das Sterben eigentlich hingehört, nur<br />
noch selten zu leisten. Insofern haben Sie<br />
recht: der Trend geht dahin, das Sterben in<br />
eigenen Einrichtungen und Versorgungsketten<br />
zu „organisieren“. Das ist jedoch keineswegs<br />
anrüchig, wie es Ihre Frage ein wenig<br />
unterstellt, sondern zumeist mit vielen<br />
Vorteilen für die Sterbenden verbunden.<br />
Das belegen die Aussagen von Sterbenden<br />
selbst und ihren Angehörigen zur hospizlichen<br />
Versorgung.<br />
Für die innere Struktur eines <strong>Hospiz</strong>es und<br />
seine internen Abläufe gilt, dass hier das<br />
Lebensende sterbender Menschen keineswegs<br />
„organisiert“ wird. Eigentlich ist ganz<br />
das Gegenteil der Fall. In der Klinik, da<br />
hat man oft den Eindruck, dass das Dasein<br />
des Patienten sich nach den Erfordernissen<br />
des Klinikbetriebs zu richten hat – überspitzt<br />
gesagt – der Kranke ist Sand im Getriebe<br />
der Klinik. Im <strong>Hospiz</strong> geschieht das<br />
Umgekehrte: Der Wunsch des Kranken,<br />
seine Selbstbestimmung, ist für alles Geschehen<br />
im <strong>Hospiz</strong> handlungsleitend. Der<br />
Kranke bestimmt, gibt den Takt des Tagesablaufs<br />
und die Zeiten vor. Die Mahlzeiten<br />
werden zwar zu festen Zeiten angeboten;<br />
doch wen es in unserem <strong>Hospiz</strong> nachts um<br />
vier nach Mousse au Chocolat gelüstet, der<br />
bekommt sie auch.<br />
U.H.: Wer wird wie in Zukunft eine hospizliche<br />
und palliative Versorgung in welchem<br />
Umfang erhalten? Werden alle Krankheiten<br />
adäquat berücksichtigt?<br />
Derzeit sind es neben wenigen AIDS-Patienten<br />
noch nahezu ausschließlich Tumorpatienten,<br />
die in den Genuss hospizlicher<br />
Versorgung kommen. Da aufgrund<br />
des demographischen Wandels und des<br />
wissenschaftlichen Fortschritts künftig jedoch<br />
mehr Menschen mit einer Tumorerkrankung<br />
überleben, ist davon auszugehen,<br />
dass der Bedarf nach ambulanter wie<br />
stationärer hospizlicher Versorgung allein<br />
deswegen steigen wird. Hinzu kommt etwas<br />
anderes: Es ist nicht einzusehen, warum<br />
sich die Indikation für diese Versorgungsform<br />
nicht für andere schwere<br />
chronische Erkrankungen öffnen sollte.<br />
Denn auch Patienten mit terminalen<br />
Herz-, Gefäß- oder Lungenerkrankungen,<br />
mit neurodegenerativen oder muskuloskeletalen<br />
Erkrankungen zeigen oftmals ein<br />
Symptom- und Leidensspektrum, dessen<br />
Ausmaß dem von Tumorpatienten im Finalstadium<br />
keineswegs nachsteht.<br />
U.H.: Führt die Existenz von mittlerweile<br />
über 1000 <strong>Hospiz</strong>en nicht zu der Tendenz<br />
einer zunehmenden „Hospitalisierung“ der<br />
Sterbenden?<br />
M.d.R.: Solange <strong>Hospiz</strong>e Orte sind, die<br />
für Sterbende beste Umgebungen und Versorgungsbedingungen<br />
bereithalten und<br />
Alternativen, jedenfalls nicht in nennenswertem<br />
Ausmaß, erkennbar sind, ist gegen<br />
die Hospitalisierung Sterbender in einem<br />
<strong>Hospiz</strong> wenig einzuwenden. Was wären<br />
die Alternativen? Sterben in der selbst gewählten<br />
Umgebung – und die wäre das eigene<br />
familiäre, vielleicht auch nachbarschaftliche<br />
Umfeld. Es gilt hier Ähnliches<br />
wie für Alten- und Pflegeheime, die überholte<br />
Institutionen des 19.Jahrhunderts<br />
sind und vormals, bis weit bis ins 20. Jahr-<br />
25
hundert hinein, ihren Sinn hatten. Heute<br />
jedoch sind Pflegeheime eher Ghettos, die<br />
Integration erschweren und Selbstbestimmung<br />
eher einschränken. Warum können<br />
wir unsere Alten und Pflegebedürftigen<br />
nicht in die Mitte der Gesellschaft holen?<br />
Warum sollten wir heute, wenn auf 1000<br />
Bürger 10 Demenzkranke kommen, nicht<br />
dafür sorgen können, dass diese 10, wie<br />
der Gütersloher Psychiater Dörner schon<br />
vor Jahren vorschlug, von den 990 Gesunden<br />
liebevoll und mit professioneller Unterstützung<br />
in der Gemeinschaft gepflegt<br />
werden? Sicher, das erfordert erhebliches<br />
Um- und Neudenken in unserer Gesellschaft:<br />
wir müssen neue Wohnformen entwickeln<br />
und die Arbeit muss neu organisiert<br />
werden. Dies würde im Übrigen auch<br />
Kosten sparen. Nichts spricht dagegen,<br />
dass auch Menschen mit terminalen Erkrankungen<br />
im Prinzip auf die gleiche<br />
Weise zu versorgen wären, so dass <strong>Hospiz</strong>e<br />
weitgehend überflüssig würden. Auf allen<br />
gesellschaftlichen Ebenen sind für die Umsetzung<br />
solcher Szenarien allerdings Mut<br />
und Ideen gefragt!<br />
U.H.: Sie beklagen in ihrem Buch auch, dass<br />
bei vielen Menschen„ der soziale Tod dem<br />
biologischen Tod“ vorausgeht. Wie kann diese<br />
Ungleichheit im Leben wie im Sterben abgebaut<br />
werden?<br />
M.d.R.: Der biologische Tod ist für uns alle<br />
unausweichlich, der soziale Tod, wohl<br />
das grausamste Schicksal zu Lebzeiten, keineswegs.<br />
Ihm kann allein durch soziale<br />
Teilhabe im Leben begegnet werden. Sie<br />
mehr Menschen zu ermöglichen ist ein<br />
26<br />
drängendes und gewaltiges Thema, dem<br />
die Politik mehr Aufmerksamkeit schenken<br />
muss. Gerade in Großstädten wie Berlin,<br />
wo ich als ehemaliger Chefarzt der<br />
Rettungsstelle im Klinikum Am Urban in<br />
Kreuzberg mit den körperlichen und psychischen<br />
Folgen sozialer Isolation und <strong>Verein</strong>samung<br />
wie beispielsweise Suchterkrankungen,<br />
Mangelernährung und<br />
Suizidalität tagtäglich konfrontiert war, ist<br />
der soziale Tod ein kaum mehr wahrgenommenes<br />
„Routineereignis“, das wir<br />
nicht hinnehmen dürfen. Voraussetzung<br />
und Grundlage sozialer Teilhabe sind<br />
Achtsamkeit, Respekt und Zuwendung zu<br />
denen, die sich als „sozial Schwache“ an<br />
der Peripherie einer Gemeinschaft oder<br />
Gesellschaft bewegen. Achtsamkeit, Respekt<br />
und Zuwendung - drei humanistische<br />
Prinzipien, die auch grundlegend<br />
sind für die Pflege und Begleitung Sterbender<br />
im <strong>Hospiz</strong>.<br />
Dr. Michael de Ridder engagiert sich seit<br />
Jahrzehnten auf nahezu allen Feldern der<br />
Gesundheitspolitik: Sterbebegleitung, Pflegenotstand,<br />
ärztliche Behandlungsfehler,<br />
Drogenproblematik. Immer wieder griff er<br />
Tabuthemen auf und sparte auch nicht mit<br />
Kritik am ärztlichen Berufsstand. Mit 65<br />
Jahren, wenn andere in Rente gehen, gründete<br />
er in Berlin das Vivanteshospiz, das er<br />
seit September 2012 leitet.<br />
Sein bekanntestes Buch:<br />
Michael de Ridder: „Wie wollen wir sterben?“ Ein<br />
ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in<br />
Zeiten der Hochleistungsmedizin. Deutsche Verlags-Anstalt,<br />
München 2010. 320 S., geb., 19,95 E.<br />
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/michael-de-ridder-wie-wollen-wir-sterbenkraefteverfall-partnerverlust-mangelernaehrung-1971849.html
„Krebsbücher“ findet die Ich-Erzählerin<br />
Hazel „doof“. John Greens „Das Schicksal<br />
ist ein mieser Verräter“ ist kein Krebsbuch,<br />
oder wenn doch, dann nicht nur. Es befasst<br />
sich mit den zentralen Fragen um Leben<br />
und Sterben, mit der Liebe und dem<br />
Leiden. Die sechzehnjährige Hazel ist unheilbar<br />
an Krebs erkrankt, ihre Lungenmetastasen<br />
werden von einem modernen Medikament<br />
in Schach gehalten, doch keiner<br />
weiß, wie lange. Sie führt ein zurückgezogenes<br />
Leben mit ihren Eltern, liest viel und<br />
sieht „Americas Next Topmodel“. Freundschaften<br />
führt sie oberflächlich, da Hazel,<br />
die sich als tickende Bombe empfindet,<br />
nicht möchte, dass nach ihrem Tod mehr<br />
Menschen als unbedingt nötig leiden.<br />
Bis eines Tages Augustus Waters in ihr<br />
Leben tritt. Sie lernt ihn in der Selbsthilfegruppe<br />
für Jugendliche mit Krebs kennen<br />
und wenig ist mehr wie zuvor. Gus ist poetisch,<br />
sarkastisch, ironisch und direkt, wie<br />
eine Faust aufs Auge. Er ist Hazels vitales<br />
Gegenstück.<br />
Augustus gilt nach einem Osteosarkom,<br />
das ihn ein Bein kostete, als fast geheilt.<br />
Augustus wirbt direkt und unverhohlen<br />
um Hazel und sie kann dem wenig entgegensetzen.<br />
Beide lesen die Bücher, die den<br />
anderen inspirieren, sehen Filme, reflektieren<br />
das Leben. Augustus erfüllt Hazel<br />
sogar ihren größten Wunsch: Die beiden<br />
fliegen nach Amsterdam, um Peter Van<br />
Houten, den Autor von Hazels Lieblingsbuch,<br />
kennen zu lernen. Dort erleben die<br />
beiden einen verrückten Mix aus echtem<br />
Buchbesprechung<br />
Von Julia Hagmeyer<br />
Leben und Traumwelt, trinken Champagner,<br />
werden von Van Houten enttäuscht,<br />
der sich als frustrierter Alkoholiker entpuppt<br />
und küssen sich zum ersten Mal im<br />
Anne-Frank-Haus.<br />
Mitten in dieser Idylle wird klar, dass Augustus<br />
Krebs zurückgekehrt ist. Sein Körper<br />
ist von Metastasen durchsetzt und seine<br />
Kräfte nehmen rapide ab. Plötzlich und<br />
für Hazel unerwartet, ist sie die Gesündere<br />
von beiden. Er, der Sinnbild des Lebens<br />
war, wird vor ihr sterben und lies es sich<br />
dennoch vorher nicht nehmen, sein Leben<br />
mit ihr zu teilen.<br />
„Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ ist<br />
luftig leicht zu lesen und doch tief und<br />
lebensklug. Ein Buch, das eindrücklich<br />
schildert, wie der Krebs alle Lebensbereiche<br />
einnimmt. Aber auch, dass das Leben<br />
mit Krebs Leben ist – nicht nur Krankheit,<br />
sondern auch Höhepunkte und<br />
Freuden.<br />
Hazels Beziehung zu ihren Eltern wird in<br />
allen Facetten geschildert. Der Ausnahmezustand,<br />
in dem sich ihre Eltern durch ihre<br />
Krankheit befinden, kommt vor allem<br />
in Amsterdam heraus, als Hazel mit Gus<br />
essen geht:<br />
„Man könnte sich wundern über die verdrehte<br />
Welt: Eine Mutter schickt ihre<br />
sechzehnjährige Töchter allein mit einem<br />
siebzehnjährigen Kerl in eine fremde<br />
Stadt hinaus, die berühmt für ihre lockere<br />
Moral ist. Aber das war eine Nebenwirkung<br />
des Sterbens.“ Im Alltag changiert<br />
27
das Verhältnis zwischen Normalität und<br />
Ausnahmezustand: Gus darf mit Hazel<br />
nur im Wohnzimmer seiner Eltern einen<br />
Film sehen, nicht in seinem Zimmer und<br />
Hazel muss ihren Brokkoli essen. Gleichzeitig<br />
ist Hazels Mutter stets in Hab-<br />
Acht-Stellung und auf ein Seufzen in Hazels<br />
Zimmer.<br />
Meisterhaft ist Greens Darstellung der<br />
Krankheit – das Leiden am Krebs, aber<br />
auch das Leiden am Umgang der Umwelt<br />
damit. Niemand geht unbefangen mit<br />
Hazel und Gus um, außer die beiden<br />
miteinander.<br />
Bei aller Meisterschaft, ein Zugeständnis<br />
ans Genre Jugendbuch macht Green doch:<br />
28<br />
Hazel und Augustus erscheinen stets einen<br />
Tick zu cool, zu abgebrüht, zu originell.<br />
Hazel hält Augustus vor allem am Anfang<br />
ihrer Beziehung an einer sehr langen Leine,<br />
alles erscheint eine Idee zu gekonnt, zu<br />
wenig unsicher – hier geht alles ungewöhnlich<br />
glatt. Aber vielleicht muss gerade<br />
einer solchen Geschichte ein perfekter<br />
Zauber innewohnen, damit man sie<br />
gerade noch aushalten kann.<br />
Wenn „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“<br />
kein Krebsbuch ist, was ist es dann?<br />
Liebes- und Lebensgeschichte, es bringt<br />
zum Lachen und zum Weinen, kurz:<br />
Es ist ein wunderbares Buch über das Leben.<br />
John Green: Das Schicksal ist ein mieser<br />
Verräter.<br />
Carl Hanser Verlag. München 2012,<br />
16,90 E
Friedhofsmotiv aus dem literarischen<br />
Katzenkalender<br />
Foto: Manfred Schmitz<br />
Der Besucher, der sich mit Liebe oder Ehrfurcht<br />
über diese Gräber neigt, nimmt auch die vielen<br />
Katzen wahr, die hier seit vielen Jahren mit ihrer<br />
stillen Anwesenheit zuhause sind. Diese sanften<br />
Tiere bewegen sich zwischen den Gräbern oder<br />
ruhen dort aus, wie wandernde Gedanken der<br />
Zuneigung zu den Verschiedenen.<br />
Aus der Broschüre des Protestantischen Friedhofs an der Cestius-Pyramide<br />
29
Es ist fast dreißig Jahre her: Ich liege in<br />
meinem Bett, frisch operiert. Kaum jemand<br />
glaubt, dass ich überleben werde.<br />
Meine Mutter hält meine Hand, entsetzt<br />
darüber, dass sie, selbst todkrank, womöglich<br />
ihre Tochter verliert. Ein Besucher<br />
kommt herein, einer, der von Berufs wegen<br />
trösten können sollte. „Wie geht es<br />
euch“, sagt der Pfarrer salopp, wiewohl wir<br />
uns nicht duzen. Als meine Mutter, ehrlichen<br />
Herzens, nur „beschissen“ sagt,<br />
trumpft er auf: „Ich habe gerade eine Frau<br />
besucht, die im Krieg zwei Söhne verloren<br />
hat. Das ist Leid, sage ich euch!“ Wir<br />
schweigen.<br />
30<br />
„Das wird schon wieder!“<br />
Ob die Freundin, an einem Tiefpunkt ihres Lebens, den saloppen Spruch<br />
wohl gern hört? Hinschauen und mitfühlen geht anders!<br />
Von Susanne Breit-Keßler in Chrismon 03.2013<br />
Wer mit „Kopf hoch“- und „Wird schon<br />
wieder“-Parolen aufmarschiert, der sollte<br />
andere mit seinem Trost verschonen. Denn<br />
eigentlich schont so jemand vor allem sich<br />
selbst – er erspart sich die Auseinandersetzung<br />
mit der Situation des Gegenübers.<br />
Das kann die heulende Freundin sein, die<br />
zum dritten Mal in einem halben Jahr Liebeskummer<br />
hat. Es kann der Arbeitskollege<br />
sein, der seinen Arbeitsplatz verlor und<br />
mit jeder neuen Bewerbung scheitert. Es<br />
kann ein Mensch sein, der schwer krank ist<br />
und sterben wird.<br />
Wer über die Nöte anderer hinwegplaudert<br />
und damit Distanz schafft, tut das oft<br />
aus Angst und Unsicherheit. Was passiert,<br />
wenn Gefühle anderer auf mich unzensiert<br />
einstürmen, wenn sie mich wie eine Wasserwelle<br />
mit sich reißen? Wer trösten<br />
möchte, sollte erst einmal in sich hineinhören<br />
und die eigenen Ängste kennenlernen:<br />
Fürchte ich mich vor dem Sterben,<br />
davor, dass ich einen lieben Menschen verliere?<br />
Wäre das ein Sturz ins Bodenlose<br />
oder gibt es irgendwo Halt? Was verbinde<br />
ich mit der Vorstellung, selbst entlassen,<br />
im Alter nicht mehr gebraucht zu werden?<br />
Die guten Tipps für später aufheben –<br />
erst mal ist der reine Trost gefragt<br />
Oder ist es so, dass die Freundin wieder<br />
nervt? Und der Kollege sich immer die fal-
schen Stellen aussucht? Wichtig ist, einen,<br />
der Trost sucht, nicht zu bewerten – denn<br />
auch damit hat man sich schon innerlich<br />
entfernt. Es entsteht keine echte Nähe<br />
mehr, wenn man Urteile darüber fällt, ob<br />
und wie berechtigt Kummer ist. Sie entsteht<br />
auch dann nicht, wenn man sofort<br />
mit Hilfsangeboten parat steht: Ich kenne<br />
eine vielversprechende Therapie, – einen<br />
sympathischen ledigen Mann, eine tolle<br />
Firma für dich... Das kann irgendwann<br />
wichtig sein – jetzt, in der Verzweiflung, ist<br />
es das nicht.<br />
Wer trösten will, schafft das durch einfühlsames<br />
Hinschauen. Was braucht die kranke<br />
Mutter? Braucht sie mein Mitgefühl,<br />
ein Gebet, meine Tränen? Mein Schweigen,<br />
mein stilles Da-Sein? Oder braucht sie<br />
eher mein Lachen, meine Energie – dass<br />
ich sie fortreiße aus ihrem dunklen Loch?<br />
Wenn das Los meines Kollegen mich bewegt,<br />
dann höre ich ihm zu, sehe seine<br />
Gestik und Mimik und erfahre, was ich<br />
wissen muss, um ihm nahe sein zu können.<br />
Über Liebeskummer lasse ich mich<br />
nicht im Allgemeinen aus, wiegle nicht ab,<br />
sondern frage die Freundin nach ihren<br />
Schmerzen, nach dem, was sie nötig hat.<br />
Schön ist es, selbst in schweren Zeiten,<br />
wenn man Trostbedürftige nicht allein mit<br />
Worten berührt. Mich hat damals noch<br />
ein anderer Pfarrer besucht. Ein Freund.<br />
Er setzte sich zu mir, hielt eine Stunde lang<br />
wortlos meine Hand, legte sie mir behutsam<br />
auf die Stirn, als er ging und sagte:<br />
„Ich hab’ dich fei lieb.“ Das war ein seliger<br />
Augenblick, in dem ich gespürt habe, dass<br />
mein Leben kostbar ist und, wie auch<br />
immer, nicht verloren gehen wird. Wer so<br />
tröstet, der schafft es, dass die ewige Seligkeit,<br />
von der der christliche Glaube erzählt,<br />
sogar auf bittere Erdentage ihren<br />
Abglanz wirft.<br />
Foto: Christiane Sarraj<br />
31
32<br />
Schüler engagieren sich für den <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong><br />
Bau eines Bilderwagens für sterbende Menschen<br />
Es war eine eher ungewöhnliche Idee, die die Lehrerin Frau Angleri des<br />
Phorms-Gymnasiums aus München-Bogenhausen hatte: Statt des üblichen<br />
Weihnachts-Gottesdienstes gab sie den Kindern der Klassen 7 bis 9 die Möglichkeit,<br />
sich sozial zu engagieren und ganz konkret etwas Gutes zu tun.<br />
„Weihnachten ist ein Fest der Nächstenliebe und im <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
<strong>Verein</strong> können sie hautnah erleben, was ihre Hilfe bei den Menschen bewirkt“,<br />
erklärte Angleri.<br />
An drei Tagen der Vorweihnachtswoche kamen die Schüler und Schülerinnen<br />
des Phorms-Gymnasiums für jeweils vier Stunden in die Einrichtung des<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s und setzten dort ein schon lange geplantes<br />
Projekt um: Einen Wagen, mit dem beim Neueinzug der Bewohner eine Auswahl<br />
an Bildern zum wohnlichen Schmücken in die jeweiligen Zimmer<br />
transportiert werden kann, wo sie dann von den neuen Bewohnern ausgesucht<br />
werden können.<br />
„Wo immer es möglich ist, möchten wir Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit<br />
geben, sich an das Thema Sterben und Tod heran zu trauen“, so Leonhard<br />
Wagner, Geschäftsführer des <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s. „Deshalb<br />
erschien es uns passend, die jungen Menschen etwas ganz Konkretes mit<br />
ihrer Hände Arbeit und bei uns im Haus schaffen zu lassen, mit dem sie die<br />
Sterbenden erfreuen.“ Denn das Zimmer, dass die Menschen im <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> beziehen, wird das letzte in ihrem Leben sein. Der Wagen<br />
wurde schön bunt und sehr aufwändig gestaltet, der Phantasie der jungen<br />
Menschen waren dabei keine Grenzen gesetzt. Begleitet wurden die Schüler<br />
während ihrer Arbeit von der Pflegefachkraft des stationären <strong>Hospiz</strong>es Ursula<br />
Grötsch-Franke, die die Schüler sehr behutsam in das Thema Tod und<br />
Sterben auf der <strong>Hospiz</strong>station einführte.<br />
Den jungen Leuten hat die Aktion viel Spaß gemacht und sie waren mit Feuereifer<br />
bei der Sache. „Es war sehr berührend zu sehen, wie viel Freude wir mit<br />
unserer Arbeit den Menschen hier bereitet haben“, erzählt eine Schülerin.
Weitere Informationen unter: http://www.muenchen.phorms.de<br />
33<br />
Fotos: Christiane Sarraj
34<br />
Frische Fahrt<br />
Laue Luft kommt blau geflossen,<br />
Frühling, Frühling soll es sein!<br />
Waldwärts Hörnerklang geschossen,<br />
Mut’ger Augen lichter Schein.<br />
Und das Wirren bunt und bunter<br />
Wird ein magisch wilder Fluß,<br />
In die schöne Welt hinunter<br />
Lockt dich dieses Stromes Gruß.<br />
Und ich mag mich nicht bewahren!<br />
Weit von Euch treibt mich der Wind,<br />
Auf dem Strome will ich fahren,<br />
Von dem Glanze selig blind!<br />
Tausend Stimmen lockend schlagen,<br />
Hoch Aurora flammend weht,<br />
Fahre zu! Ich mag nicht fragen,<br />
Wo die Fahrt zu Ende geht!<br />
Joseph von Eichendorff
Erfahren, was im Leben wirklich zählt<br />
Neuer Mitarbeiter im Team Soziale Arbeit<br />
Immer mehr schwerkranke und sterbende<br />
Menschen werden vom ambulanten Team<br />
zuhause betreut und begleitet. So war es notwendig,<br />
das Team Soziale Arbeit zu<br />
erweitern. Seit 01. Oktober 2012 ergänzt<br />
der Diplom-Sozialpädagoge (FH) Robert<br />
Milbradt das Team des ambulanten<br />
<strong>Hospiz</strong>dienstes:<br />
Mein Name ist Robert Milbradt, ich bin<br />
34 Jahre alt und gebürtiger Münchner.<br />
Nach Abschluss meines Studiums im Sommer<br />
2009 arbeitete ich zunächst in einem<br />
Münchner Sozialbürgerhaus als Bezirkssozialarbeiter<br />
und habe dort schwerpunktmäßig<br />
Familien in unterschiedlichen Problemlagen<br />
unterstützt.<br />
Im Anschluss daran war ich in der Betreuung<br />
von Passagieren und Mitarbeitern am<br />
Münchner Flughafen tätig.<br />
Was hat mich nun zur <strong>Hospiz</strong>arbeit und<br />
zum <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V. geführt?<br />
Es sind, so denke ich, vor allem zwei Themen,<br />
die mich bereits seit mehreren Jahren<br />
beschäftigen: Einerseits (persönlich) die<br />
Frage, wie es gelingen kann, ein – nach<br />
den jeweils eigenen Maßstäben – erfülltes<br />
Leben zu führen. Ein Leben, das einen,<br />
wenn der Zeitpunkt dazu gekommen ist,<br />
einigermaßen zufrieden und im Reinen<br />
mit sich zurückblicken lässt. Andererseits<br />
(beruflich) die Frage, wie es gelingen kann,<br />
herausfordernde und existenzielle Lebensereignisse,<br />
-abschnitte und -umbrüche gut<br />
zu bewältigen. Damit verbunden ist konsequenterweise<br />
sowohl die Frage nach dem<br />
jeweiligen Erleben als auch nach den inneren<br />
wie äußeren Ressourcen und Kraftquellen.<br />
Die Frage nach dem erfüllten Leben stellte<br />
sich mir zum ersten Mal ernsthaft, als ich<br />
mit Anfang 20 den Satz von Dame Cicely<br />
Saunders erstmals las „Wir können dem<br />
Leben nicht mehr Tage geben, aber dem<br />
Tag mehr Leben“. Damals wusste ich allerdings<br />
noch nicht, wer die Person war, die<br />
diesen Satz geäußert hatte und vor welchem<br />
Hintergrund sie dies getan hatte.<br />
Das hat sich in den vergangenen Wochen<br />
geändert. Auch durch die Schilderungen<br />
der haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen<br />
und Kollegen wird mir zunehmend<br />
klar, dass es vermutlich wenige Tätigkeitsfelder<br />
gibt, in denen so intensiv erfahren<br />
35
werden kann, was im Leben wirklich zählt,<br />
wie in der <strong>Hospiz</strong>arbeit.<br />
Die Frage nach der Bewältigung von Lebensereignissen<br />
beschäftigte mich bereits<br />
von Kindheit an. Nach dem Tod meines<br />
Opas mütterlicherseits erlebte ich, dass<br />
meine Mutter über all die Jahre hinweg<br />
diesen Verlust nie verkraftet hatte. Vor drei<br />
Jahren, einen Tag vor Heiligabend, wurde<br />
ich dann völlig unvorhersehbar und unvorbereitet<br />
mit dem Tod meiner Mutter<br />
konfrontiert. Zwei Jahre später starb, nach<br />
36<br />
mehrjähriger Krebserkrankung, die Mutter<br />
meines Freundes, was nicht unvorhergesehen,<br />
aber in Hinblick auf die teils äußerst<br />
schwere Zeit bis dahin, auch nicht<br />
minder schlimm für ihn war. Für meine<br />
jetzige berufliche Arbeit waren dies wichtige<br />
Lebenserfahrungen. Sie haben mich dafür<br />
sensibilisiert, was uns der Verlust an<br />
Gesundheit und schließlich des Lebens<br />
selbst abverlangen, aber auch ein Stück dafür,<br />
was uns helfen kann, diesen Erfahrungen<br />
zu begegnen.<br />
Eine schwarze Katze kreuzt deinen Weg,<br />
was nichts anderes bedeutet,<br />
als dass sie irgendwohin möchte.<br />
Groucho Marx
An den Tod<br />
Halb aus dem Schlummer erwacht,<br />
Den ich traumlos getrunken,<br />
Ach, wie war ich versunken<br />
In die unendliche Nacht!<br />
Tiefes Verdämmern des Seins,<br />
Denkend nichts, noch empfindend!<br />
Nichtig mir selber entschwindend,<br />
Schatte mit Schatten zu eins!<br />
Da beschlich mich so bang,<br />
Ob auch, den Bruder verdrängend,<br />
Geist mir und Sinne verengend,<br />
Listig der Tod mich umschlang.<br />
Schaudernd dacht ich’s, und fuhr<br />
Auf, und schloss mich ans Leben,<br />
Drängte in glühendem Erheben<br />
Kühn mich an Gott und Natur.<br />
Siehe, da hab ich gelebt:<br />
Was sonst, zu Tropfen zerflossen,<br />
Langsam und karg sich ergossen,<br />
Hat mich auf einmal durchbebt.<br />
Oft noch berühre du mich,<br />
Tod, wenn ich in mir zerrinne,<br />
Bis ich mich wieder gewinne<br />
Durch den Gedanken an Dich!<br />
Friedrich Hebbel (1813 – 1863)<br />
37
Aus dem <strong>Verein</strong><br />
Ein großer Erfolg in den letzten Monaten<br />
war, dass der Münchner Stadtrat im<br />
Februar Zuschussanträge des CHV einstimmig<br />
genehmigt hat. Die Anträge<br />
hatten wir Ende letzten Jahres beim Gesundheitsreferat<br />
der Stadt München für<br />
die Förderung des Fallmanagements, der<br />
sozialen Arbeit im stationären <strong>Hospiz</strong><br />
sowie die ambulante hospizliche und<br />
palliative Beratung von geriatrischen Patienten<br />
und Menschen mit Behinderungen<br />
gestellt. Im Zusammenhang mit diesen<br />
Anträgen war es unseren Vorständen<br />
und Leitungskräften gelungen, den Vertretern<br />
der Stadt zu verdeutlichen, dass<br />
die <strong>Hospiz</strong>arbeit einen wichtigen Teil<br />
der kommunalen Daseinsvorsorge ausmacht.<br />
Der Zuschuss der Stadt bedeutet<br />
eine erhebliche Verbesserung der finanziellen<br />
Basis des CHV, mit der auch in<br />
Zukunft grundsätzlich gerechnet werden<br />
kann.<br />
In unserem stationären <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> lag die Belegung im Jahr 2012<br />
im Durchschnitt bei 90,67 %. Eine 85<br />
%ige Belegung wäre schon sehr gut gewesen,<br />
eine Belegung über 90% – wie sie<br />
geschafft wurde – ist hervorragend und<br />
nur durch das hohe Engagement unserer<br />
Mitarbeiter möglich geworden.<br />
Die neuen Verhandlungen mit den<br />
Kassen für das stationäre <strong>Hospiz</strong> sind<br />
inzwischen abgeschlossen und eine <strong>Verein</strong>barung<br />
getroffen. Seit 01.12.2012<br />
liegt der neue tagesbezogene Bedarfssatz<br />
– von dem wir 90% abrechnen können –<br />
bei 325,62 E, was ein sehr zufriedenstellendes<br />
Ergebnis ist.<br />
38<br />
Die Nachfrage nach unseren ambulanten<br />
Diensten ist in den letzten Monaten<br />
noch einmal angestiegen und steigt weiter<br />
an. Aus Kapazitätsgründen muss deshalb<br />
seit Herbst immer wieder mit Aufnahmestopps<br />
gearbeitet werden, wenn<br />
das ambulante Team an seine Kapazitätsgrenzen<br />
kommt. Die langen Fahrtwege<br />
im Stadtgebiet kosten viel Zeit. Unser<br />
ambulanter Bereich hat in den letzten<br />
Monaten einen spürbaren Zuwachs an<br />
ambulanten Begleitungen gestemmt,<br />
längere Ausfallzeiten unter den Kollegen<br />
aufgefangen, und es trotzdem geschafft,<br />
die Qualität der Arbeit auf konstant hohem<br />
Niveau zu halten. Im September<br />
wird das Team um eine weitere halbe<br />
Stelle aufgestockt.<br />
Ein Teil des Zuschusses der Stadt München<br />
betrifft die ambulante hospizliche<br />
und palliative Beratung von Menschen<br />
mit Behinderung bzw. Einrichtungen<br />
der Behindertenhilfe. Dieses Angebot<br />
wird nun konzeptionell geplant. Mit<br />
dem Monsignore-Bleyer-Haus für Menschen<br />
mit geistiger Behinderung in Pasing<br />
haben wir bereits ein Implementierungsprojekt<br />
begonnen.<br />
Der CHV möchte außerdem in einem<br />
Versuchsprojekt prüfen, ob die Verbände<br />
und Träger der hospizlichen und palliativmedizinischen<br />
Einrichtungen und<br />
Dienste in München eine engere Zusammenarbeit<br />
wünschen. Der Erzbischöfliche<br />
<strong>Hospiz</strong>- und Palliativfonds hat bereits<br />
zugesagt, die Aufbauphase eines<br />
solchen Münchner <strong>Hospiz</strong>- und Palliativbündnisses<br />
zum Teil zu fördern. Im
nächsten Schritt planen wir mit anderen<br />
Verbänden und Trägern in München<br />
über eine Zusammenarbeit und Finanzierungsmöglichkeiten<br />
zu sprechen.<br />
Im Rahmen der ARD Themenwoche<br />
„Leben mit dem Tod“ im November hat<br />
der Bayerische Rundfunk den Film<br />
„Blaubeerblau“ bei einer Veranstaltung<br />
im ARRI-Kino in München vorgestellt,<br />
bei der Frau Westrich einen sehr interessanten<br />
Redebeitrag hielt. Im Rahmen<br />
der Öffentlichkeitsarbeit des CHV erschien<br />
außerdem im November in der<br />
Zeitschrift „Bild der Frau“ ein Artikel<br />
zur <strong>Hospiz</strong>arbeit mit großen Anteilen<br />
über den CHV. Im Februar erschien zudem<br />
ein Artikel in der Süddeutschen<br />
Zeitung, der die Geschichte eines Bewohners<br />
in unserem <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
mit der Würdigung der Arbeit des<br />
CHV verband. Schließlich wurde in<br />
dem Artikel auch deutlich, dass die <strong>Hospiz</strong>versorgung<br />
noch längst nicht durch<br />
öffentliche Mittel bzw. Mittel des Gesundheitssystems<br />
finanziert ist, sondern<br />
die <strong>Hospiz</strong>bewegung einen großen Teil<br />
der Kosten immer noch selber tragen<br />
muss.<br />
Im Redaktionsteam unseres Mitgliederzeitschrift<br />
„CHV aktuell“, das Sie in<br />
Händen halten, hat Herr Uve Hirsch die<br />
Leitung abgegeben. Wir danken Herrn<br />
Hirsch für die jahrelange hervorragende<br />
und ehrenamtliche Arbeit und freuen<br />
uns, dass er zugesagt hat weiterhin im<br />
Team mitzuarbeiten. Die organisatorische<br />
Leitung wird künftig unser Kollege<br />
Herr Biersack übernehmen, den viele<br />
von Ihnen von seiner einfühlsamen Tätigkeit<br />
am Empfang unseres Christopho-<br />
rus-Hauses kennen werden. Neu im Redaktionsteam<br />
sind außerdem die frühere<br />
CHV-Vorsitzende Frau Dr. Schmidt und<br />
Frau Rommé aus unserem Team Soziale<br />
Arbeit. Wir freuen uns über die Verstärkung!<br />
Im Dezember veranstaltete das Referat<br />
für Gesundheit und Umwelt (RGU) der<br />
Stadt München einen Fachtag zum<br />
Thema Palliativgeriatrie. Unter anderem<br />
übernahm dabei der CHV, der seit<br />
Jahren einen Palliativ-Geriatrischen<br />
Dienst betreibt und im letzten Jahr ein<br />
Buch zur Palliativen Geriatrie veröffentlich<br />
hat, eine wichtige Rolle. Für das<br />
Jahr 2013 plant das RGU voraussichtlich<br />
einen Fachtag zur <strong>Hospiz</strong>- und Palliativversorgung<br />
von Menschen mit Behinderung.<br />
Ende Februar ging unsere langjährige<br />
Kollegin Frau Brigitta Kofler in den<br />
wohlverdienten Ruhestand. Sie war in<br />
den letzten Jahren sowohl mit der Soziarbeit<br />
im stationären <strong>Hospiz</strong> als auch<br />
mit Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit<br />
betraut. Wir danken ihr für ihre engagierte<br />
Arbeit und wünschen ihr alles Gute<br />
für den nun kommenden Lebensabschnitt.<br />
Die Sozialarbeit im stationären<br />
<strong>Hospiz</strong> wird seitdem von Frau Fröhlich<br />
übernommen. Außerdem freuen wir<br />
uns, dass seit April Frau Birgit Reindl<br />
als neue Kollegin unser ambulantes<br />
Team verstärkt.<br />
Schließlich darf ich Sie noch darüber informieren,<br />
dass ein Mitglied unseres<br />
Stifterkreises, Herr Ernst Hafner, uns in<br />
den letzten Monaten sowohl ein Auto als<br />
auch die Kosten für ein Hochbeet mit<br />
39
einer Pergola im Garten gespendet hat.<br />
Unser wachsender ambulanter Bereich<br />
kann das Fahrzeug gut gebrauchen. Wir<br />
freuen uns darauf, wenn die Pergola unseren<br />
Bewohnern, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen<br />
im Sommer ein schattiges<br />
40<br />
Plätzchen bieten und das Beet unseren<br />
Garten verschönern wird.<br />
Herzlichen Dank dafür!<br />
Ihr Leonhard Wagner<br />
Geschäftsführer<br />
Foto: Inge Scheller
Stifterkreis<br />
Stiftungen gibt es wie Sand am Meer.<br />
Neben den Stiftungen, die Sport, Wissenschaft<br />
oder Kultur fördern, gibt es viele<br />
Stiftungen, die zur Linderung von persönlichen<br />
Notlagen von Menschen errichtet<br />
werden, so z.B. bei Verlust der Arbeit, in<br />
persönlichen Krisen, bei Natur-Katastrophen,<br />
Krieg oder Bürgerkriegen, Hungersnöten<br />
oder für Bevölkerungsgruppen,<br />
meist in Entwicklungsländern, die sich<br />
nicht selbst helfen können oder auch durch<br />
die Raster von anderen sozialen Unterstützungsmöglichkeiten<br />
fallen. Altersarmut,<br />
Migrationsprobleme, geistige oder körperliche<br />
Einschränkungen sind einige Stichworte<br />
dazu. Vielfach sind es Stiftungen, die<br />
sich zuvorderst um Kinder kümmern. Ihnen<br />
zu helfen, ihnen einen gelungenen<br />
Start ins Leben zu ermöglichen oder ihre<br />
unverschuldete Not zu lindern, ist für viele<br />
Menschen ein wichtiges Anliegen, wenn sie<br />
daran denken, eine Stiftung zu errichten.<br />
Stiftungszwecke sind bindend<br />
Menschen, die eine Stiftung gründen, legen<br />
in der Stiftungssatzung fest, für welche<br />
Zwecke sie ihre Stiftung errichten wollen.<br />
Dieser Stiftungszweck ist später bindend<br />
für die Unterstützung von Projekten und<br />
Fördermaßnahmen. Da eine Stiftung normalerweise<br />
nicht nur für eine bestimmte<br />
Zeit gegründet wird, sondern sozusagen<br />
für die Ewigkeit, ist es sinnvoll, diesen Stiftungszweck<br />
nicht zu eng zu fassen. Zeiten<br />
ändern sich, neue Strukturen entstehen,<br />
die die Stifterin, der Stifter heute vielleicht<br />
noch nicht absehen können, die aber<br />
durchaus den damals von ihnen beabsichtigten<br />
Fördergründen entsprechen wür-<br />
den. Eine Stiftung, die beispielweise im<br />
19. Jahrhundert errichtet wurde, um<br />
„Dienstmädchen, die ein lediges Kind“<br />
haben, zu unterstützen, ist vielleicht ein<br />
Beispiel für einen Stiftungszweck, der heute<br />
so nicht oder kaum noch sinnvoll ist.<br />
Gründe für eine <strong>Hospiz</strong>stiftung<br />
Wer eine Stiftung zur Unterstützung für<br />
<strong>Hospiz</strong>e und <strong>Hospiz</strong>vereine gründet, hat<br />
hierfür meist mehrere Beweggründe. Da<br />
gibt es das Anliegen, schwerstkranken und<br />
sterbenden Menschen den notwendigen<br />
Raum, die gewünschte Fürsorge, Pflege<br />
und Unterstützung zu verschaffen, die sie<br />
ganz individuell benötigen. Manchmal ist<br />
das eigene Erleben von schweren, traumatisch<br />
verlaufenden Sterbesituationen<br />
bei Angehörigen und Freunden der Auslöser<br />
für den Wunsch, eine <strong>Hospiz</strong>stiftung<br />
zu gründen, um bessere und geeignetere<br />
Bedingungen für Sterbende zu realisieren.<br />
Für andere Menschen ist es wiederum<br />
wichtig, ortsnah und dadurch jederzeit<br />
überprüfbar ihr Geld für eine Stiftung zu<br />
verwenden, die ihnen sinnvoll erscheint<br />
und ihren ethischen Vorstellungen entspricht.<br />
<strong>Hospiz</strong>-Stiftungen geht es nicht so sehr<br />
darum, einen speziellen Menschen mit seinen<br />
Nöten zu unterstützen, es geht um die<br />
Begleitung sterbender Menschen insgesamt.<br />
Sie fördern und unterstützen die damit<br />
verbundene gesellschaftliche Aufgabe,<br />
Menschen auf ihrem letzten Lebensweg<br />
nicht alleine zu lassen, sondern sie ganz besonders<br />
in den Fokus zu nehmen. Die dazu<br />
notwendige Struktur schaffen bundes-<br />
41
weit <strong>Hospiz</strong>vereine, die auf die finanzielle<br />
Unterstützung von Stiftungen und Spendern<br />
angewiesen sind. Da der <strong>Hospiz</strong>gedanke<br />
in Deutschland relativ jung ist (es<br />
gibt ihn seit etwa 1983), gibt es noch nicht<br />
so viele Stiftungen, deren Zweck die Unterstützung<br />
von <strong>Hospiz</strong>arbeit ist. Wir sind<br />
deshalb sehr dankbar, dass der Stifterkreis<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> München mit sechs<br />
Stiftungen und den dahinter stehenden<br />
Stifterinnen und Stiftern interessiert, engagiert<br />
und tatkräftig dazu beiträgt, dass unsere<br />
Arbeit bei den schwerstkranken Menschen<br />
und ihren Angehörigen gut und<br />
kontinuierlich überhaupt möglich ist.<br />
Ein neuer Küchenherd fürs <strong>Hospiz</strong> –<br />
eine Stiftung hilft<br />
Neben der notwendigen Betreuung, Pflege<br />
und Versorgung sind es viele zusätzliche<br />
Facetten, mit denen wir durch unsere Stiftungserträge<br />
unsere Arbeit erweitern und<br />
Termine<br />
Information und Beratung zur Patientenverfügung<br />
Viele Menschen möchten Vorsorge treffen für den Fall, dass sie durch Unfall, Krankheit<br />
oder Alter nicht mehr in der Lage sind, ihren Willen zu äußern und selbstständig zu entscheiden.<br />
Wir bieten ein offenes Angebot für alle Interessierten zu Fragen der Patientenverfügung<br />
und Vorsorge-Vollmacht. Jeweils am letzten Mittwoch im Monat von 10:00 bis<br />
12:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.<br />
29. Mai 2013<br />
26. Juni 2013<br />
Erfahrene Mitarbeiter/innen unseres Teams informieren Sie an diesen Vormittagen, was<br />
Sie beachten sollten und gehen auf Ihre individuellen Fragen ein.<br />
Teilnahmegebühr: 5 Euro (für Mitglieder 3 Euro)<br />
42<br />
31. Juli 2013<br />
28. August 2013<br />
bereichern können. Hierzu gehören spirituelle<br />
und seelsorgerische Begleitung,<br />
Atemtherapie, Musiktherapie, Aromapflege,<br />
spezielle Lagerungsstühle, Pflegebetten<br />
und – wie erst kürzlich – die<br />
Anschaffung eines großen neuen Küchenherdes.<br />
Unser bisheriger gab nach beinahe<br />
siebenjährigem Dauerbetrieb seinen Geist<br />
endgültig auf. Wochenlang improvisierten<br />
unsere Hauswirtschaftskräfte mit einzelnen<br />
Kochplatten, die ein wenig an eine<br />
Campingplatzsituation erinnerten, bis<br />
endlich das neue Prunkstück geliefert werden<br />
konnte. Nun gibt es neben dem täglich<br />
frisch zubereiteten Auswahlessen<br />
mittags und abends auch wieder die köstlichen<br />
selbstgebackenen Kuchen und Torten,<br />
die unsere Bewohner/innen, aber auch<br />
unsere Besucher genussvoll zu Kaffee und<br />
Tee genießen.<br />
Angelika Westrich<br />
25. September 2013<br />
30. Oktober 2013<br />
27. November 2013
Vorträge<br />
Testament, Erbe und<br />
Besteuerung des Nachlasses<br />
Montag, 08. Juli 2013<br />
jeweils von 18:30 – 20:00 Uhr<br />
Offene Führungen im <strong>Christophorus</strong>-Haus 2013<br />
Das <strong>Christophorus</strong>-Haus vereint alle ambulanten und stationären Angebote des <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s e.V. unter einem Dach. Mit den offenen Führungen vermitteln<br />
wir Interessierten einen Einblick in unser Haus und unsere Arbeit.<br />
15. Mai 2013 10:00 – 12:00 Uhr<br />
03. Juli 2013 18:00 – 20:00 Uhr<br />
04. Sep. 2013 14:00 – 16:00 Uhr<br />
09. Okt. 2013 10:00 – 12:00 Uhr<br />
06. Nov. 2013 18:00 – 20:00 Uhr<br />
jeweils am Mittwoch<br />
Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit?<br />
An diesen Tagen stellen wir Ihnen Möglichkeiten vor, sich im <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
<strong>Verein</strong> zu engagieren:<br />
Montag, 15. Juli 2013<br />
Donnerstag, 17. Oktober 2013<br />
von 17:00 bis 18:30 Uhr<br />
Offener Trauertreff<br />
Patientenverfügung und<br />
Vorsorgevollmacht<br />
Montag, 14. Oktober 2013<br />
Der CHV bietet trauernden Menschen Unterstützung an. Der offene Gesprächskreis<br />
findet zweimal monatlich, jeweils dienstags um 15:00 Uhr statt.<br />
Termine und Anmeldung unter Telefonnummer 089/ 13 07 87- 0<br />
43
Einführungsseminare 2013<br />
Wochenendseminare<br />
Jeweils Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr<br />
WS 2<br />
16./17. November 2013<br />
Abendseminar<br />
04. November bis 09. Dezember 2013,<br />
sechs Montagabende von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr – (außer Rosenmontag)<br />
Kursgebühr für alle Seminare beträgt 60 Euro (50 Euro für Mitglieder)<br />
Alle Kurse finden im <strong>Christophorus</strong>-Haus, Effnerstraße 93, statt.<br />
Bitte melden Sie sich zu den Seminaren frühzeitig schriftlich an über die Internetseite<br />
www.chv.org oder per Mail: bildung@chv.org oder per Telefon: 089 / 13 07 87- 0<br />
Alle oben genannten Veranstaltungen finden in den Räumen des CHV statt.<br />
MVG: U 4 Endstation Arabellapark, 15 Minuten Fußweg über Normannenplatz;<br />
oder: Tram 16 bis Arabellastraße;<br />
oder: Tram 18 bis Effnerplatz, ca. 15 Minuten Fußweg Effnerstraße;<br />
oder: Bus 188 Haltestelle Odinstraße, ca. 5 -10 Minuten zu Fuß<br />
44<br />
Impressum<br />
CHV aktuell erscheint zweimal jährlich und wird herausgegeben vom<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V., München.<br />
Redaktion: Heinz Biersack, Irene Braun, Julia Hagmeyer, Uve Hirsch, Helmut Nadler, Ingrid Pfuner,<br />
Inge Scheller (v.i.S.d.P.), Dr. Sieglinde Schmidt, Leonhard Wagner und Angelika Westrich<br />
Layout und Herstellung: Helmut Nadler<br />
Anzeigenleitung: Helga Ostermeier, Tel. (08441) 80 57 37, 0160-580 67 98<br />
Die nächste Ausgabe von CHV aktuell ist für November 2013 vorgesehen.<br />
Geplanter Schwerpunkt: „Mitleiden, mittragen – Angehörige”<br />
Redaktionsschluss: 15. September 2013<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V., Effnerstraße 93, 81925 München,<br />
Tel.( 089) 13 07 87-0, Fax 13 07 87-13; www.chv.org; info@chv.org<br />
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:30 Uhr<br />
Sozialbank München, Konto Nr. 98 555 00, BLZ 700 205 00<br />
Commerzbank München, Konto Nr. 42 42 111, BLZ 700 400 41<br />
HOSPIZ
Einführungsseminare 2013<br />
Wochenendseminare<br />
Jeweils Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr<br />
WS 2<br />
16./17. November 2013<br />
Abendseminar<br />
04. November bis 09. Dezember 2013,<br />
sechs Montagabende von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr – (außer Rosenmontag)<br />
Kursgebühr für alle Seminare beträgt 60 Euro (50 Euro für Mitglieder)<br />
Alle Kurse finden im <strong>Christophorus</strong>-Haus, Effnerstraße 93, statt.<br />
Bitte melden Sie sich zu den Seminaren frühzeitig schriftlich an über die Internetseite<br />
www.chv.org oder per Mail: bildung@chv.org oder per Telefon: 089 / 13 07 87- 0<br />
Alle oben genannten Veranstaltungen finden in den Räumen des CHV statt.<br />
MVG: U 4 Endstation Arabellapark, 15 Minuten Fußweg über Normannenplatz;<br />
oder: Tram 16 bis Arabellastraße;<br />
oder: Tram 18 bis Effnerplatz, ca. 15 Minuten Fußweg Effnerstraße;<br />
oder: Bus 188 Haltestelle Odinstraße, ca. 5 -10 Minuten zu Fuß<br />
44<br />
Impressum<br />
CHV aktuell erscheint zweimal jährlich und wird herausgegeben vom<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V., München.<br />
Redaktion: Heinz Biersack, Irene Braun, Julia Hagmeyer, Uve Hirsch, Helmut Nadler, Ingrid Pfuner,<br />
Inge Scheller (v.i.S.d.P.), Dr. Sieglinde Schmidt, Leonhard Wagner und Angelika Westrich<br />
Layout und Herstellung: Helmut Nadler<br />
Anzeigenleitung: Helga Ostermeier, Tel. (08441) 80 57 37, 0160-580 67 98<br />
Die nächste Ausgabe von CHV aktuell ist für November 2013 vorgesehen.<br />
Geplanter Schwerpunkt: „Mitleiden, mittragen – Angehörige”<br />
Redaktionsschluss: 15. September 2013<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V., Effnerstraße 93, 81925 München,<br />
Tel.( 089) 13 07 87-0, Fax 13 07 87-13; www.chv.org; info@chv.org<br />
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:30 Uhr<br />
Sozialbank München, Konto Nr. 98 555 00, BLZ 700 205 00<br />
Commerzbank München, Konto Nr. 42 42 111, BLZ 700 400 41<br />
HOSPIZ