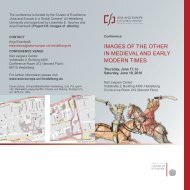Denkmalpflege statt Attrappenkult - Cluster Asia and Europe
Denkmalpflege statt Attrappenkult - Cluster Asia and Europe
Denkmalpflege statt Attrappenkult - Cluster Asia and Europe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rekonstruktionen unterminieren den<br />
Auftrag der <strong>Denkmalpflege</strong>, Baudenkmäler<br />
in ihrer materiellen Überlieferung<br />
als Zeugnisse der Geschichte<br />
zu erhalten. Sechs Denkmalexperten<br />
wenden sich gegen die Simulation von<br />
Baudenkmälern: gegen einen <strong>Attrappenkult</strong>,<br />
der im Dienst von Geschichtspolitik,<br />
Identitätsmarketing und Kommerz<br />
kritisches Geschichtsbewußtsein<br />
korrumpiert.<br />
ISBN 978-3-0346-0705-6<br />
Bauwelt Fundamente Birkhäuser<br />
146<br />
<strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong><br />
Adrian von Buttlar<br />
Gabi DolffBonekämper<br />
Michael S. Falser<br />
Achim Hubel<br />
Georg Mörsch<br />
<strong>Denkmalpflege</strong><br />
<strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong><br />
Gegen die Rekonstruktion von<br />
Baudenkmälern – eine Anthologie<br />
Architekturpolitik
<strong>Denkmalpflege</strong><br />
<strong>statt</strong><br />
<strong>Attrappenkult</strong><br />
Gegen die Rekonstruktion<br />
von Baudenkmälern – eine Anthologie<br />
Herausgegeben und kommentiert von<br />
Adrian von Buttlar<br />
Gabi Dolff-Bonekämper<br />
Michael S. Falser<br />
Achim Hubel<br />
Georg Mörsch<br />
Bauverlag Birkhäuser<br />
Gütersloh · Berlin Basel<br />
Einführung und Redaktion:<br />
Johannes Habich<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 3 29.10.2010 12:13:56
Umschlagvorderseite: Berlin, Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel, Ruine 1962 abgebrochen,<br />
Simulation mit aufgemauerter Ecke und bedruckten Bauplanen 2002.<br />
Foto: Achim Hubel<br />
Umschlagrückseite: Berlin, Bauakademie, Detail der Simulation auf bedruckter Plane. Foto:<br />
Michael S. Falser<br />
Seite 6: Ruine des Berliner Stadtschlosses, Quelle: Philipp Meuser, Schloßplatz 1. Vom Staatsratsgebäude<br />
zum Bundeskanzleramt, Berlin 1999 (oben); Palast der Republik (Mitte), Foto:<br />
Michael S. Falser und ‚Schloßwiese‘ (unten), Foto: Gabi Dolff-Bonekämper<br />
Verlag, Herausgeber und Autoren danken für die Nachdruckerlaubnis von Auszügen aus<br />
Veröffentlichungen für die Anthologie: Dr. Reinhard Bentmann, Prof. Dr. Peter Bürger,<br />
Prof. Dr. Wolfgang F. Haug, Dr. Dörte Jacobs, Prof. Dr. Wilfried Lipp, Dr. Ira Mazzoni,<br />
Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier, Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub, Dr. Brigitt Sigel, Uwe Tellkamp,<br />
Prof. Dr. Heiner Treinen, Prof. Dipl.-Ing. Thomas Will, Dr. Marion Wohlleben sowie den<br />
Verlagen Aschendorff Verlag, hier besonders Dr. Benedikt Hüffner und Dr. Dirk Paßmann,<br />
Deutsche Verlagsanstalt (R<strong>and</strong>om House), Deutscher Kunstverlag, Fischer-Taschenbuch-Verlag,<br />
Carl Hanser Verlag, Reclam Verlag, Seemann Verlag und dem Deutschen ICOMOS Nationalkomitee,<br />
der Wüstenrot Stiftung, den Zeitschriften Die Alte Stadt, Kunstchronik sowie<br />
der Paul & Peter Fritz AG, Zürich.<br />
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;<br />
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de<br />
abrufbar.<br />
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere<br />
die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und<br />
Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf <strong>and</strong>eren Wegen<br />
und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,<br />
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist<br />
auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes<br />
in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.<br />
Zuwiderh<strong>and</strong>lungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.<br />
Der Vertrieb über den Buchh<strong>and</strong>el erfolgt ausschließlich über den Birkhäuser Verlag.<br />
© 2011 Birkhäuser GmbH, Postfach, CH-4002 Basel, Schweiz<br />
und Bauverlag BV GmbH, Gütersloh, Berlin<br />
Gedruckt auf säurefreiem Papier, hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. TCF ∞<br />
Printed in Germany<br />
ISBN: 978-3-0346-0705-6<br />
9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.birkhauser.ch<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 4 29.10.2010 12:13:56
Inhalt<br />
Ulrich Conrads<br />
Zum Geleit: Auf der Suche nach einem Vor-Wort .................7<br />
Johannes Habich<br />
Zur Einführung: Worum es geht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Georg Mörsch<br />
Denkmalwerte ..............................................19<br />
Texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Achim Hubel<br />
<strong>Denkmalpflege</strong> zwischen Restaurieren und Rekonstruieren.<br />
Ein Blick zurück in ihre Geschichte ............................42<br />
Texte .......................................................62<br />
Michael S. Falser<br />
„Ausweitung der Kampfzone“.<br />
Neue Ansprüche an die <strong>Denkmalpflege</strong> 1960–1980 . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />
Texte .......................................................97<br />
Gabi Dolff-Bonekämper<br />
Denkmalverlust als soziale Konstruktion ......................134<br />
Texte ......................................................146<br />
Adrian von Buttlar<br />
Auf der Suche nach der Differenz:<br />
Minima Moralia reproduktiver Erinnerungsarchitektur . . . . . . . . 166<br />
Literatur ..................................................194<br />
Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203<br />
Anhang<br />
Michael S. Falser<br />
Die Erfindung einer Tradition namens Rekonstruktion<br />
oder Die Polemik der Zwischenzeilen. Besprechung der Ausstellung<br />
Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte.<br />
Ausstellung des Architekturmuseums der TU München in<br />
der Pinakothek der Moderne, 22. Juli–31.Oktober 2010 ............205<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 5 29.10.2010 12:13:56
Michael S. Falser<br />
Die Erfindung einer Tradition namens Rekonstruktion<br />
oder<br />
Die Polemik der Zwischenzeilen<br />
Besprechung der Ausstellung Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion<br />
der Geschichte 1 , Architekturmuseums der TU München in der Pinakothek<br />
der Moderne, 22. Juli – 31.Oktober 2010. Ein Projekt des Architekturmuseums<br />
der TU München, Winfried Nerdinger, mit dem Institut für<br />
<strong>Denkmalpflege</strong> und Bauforschung der ETH Zürich, Uta Hassler 2<br />
Zu Döllgasts Gedenken<br />
Es war 1945 und es war in München: Die Stadt lag zu großen Teilen in<br />
Trümmern – nicht nur weite Teile der Innenstadt, sondern auch bedeutende<br />
Kulturbauten. Und während sich die Stadtplanung zusammen mit der<br />
<strong>Denkmalpflege</strong> letztlich darauf einigten, den Stadtgrundriß Münchens in<br />
weiten Teilen mit teilweise zeitgenössischer Architektursprache und wohnraum-<br />
beziehungsweise verkehrstechnisch angepaßt wiederaufzubauen,<br />
blieb Klenzes Pinakothek bis in die frühen 1950er Jahre eine innerstädtische<br />
Ruine. Es war ohne Zweifel das Verdienst des Architekten und Lehrers<br />
an der TH München, Hans Döllgast, dieses einzigartige Gebäude vor<br />
dem kompletten Untergang bewahrt zu haben, gelang es ihm doch, seine<br />
abrißorientierten Widersacher mit detaillierten Vorstudien, einleuchtenden<br />
Notsicherungsmaßnahmen der Originalsubstanz und kostensparenden<br />
Neueingriffen von einer funktionsidentischen Nutzbarmachung zu überzeugen.<br />
Döllgasts Pinakotheksprojekt ist heute eines der wichtigsten<br />
deutschen Wiederaufbaudokumente der unmittelbaren Nachkriegszeit: als<br />
zeitgenössischer Akt einer original- und zugleich kriegsspurensichernden<br />
Trauerarbeit am Verlust baulichen Kulturerbes. 3<br />
Warum diese lange Vorbemerkung? Weil am 21. Juli 2010 die Ausstellung<br />
Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte wenige<br />
Meter von Döllgasts Projekt eröffnet wurde – jetzt in den Schauräumen<br />
des Architekturmuseums der TU München in der erst kürzlich neu erbauten<br />
Pinakothek der Moderne – und weil es sich hier um den augenscheinlichen<br />
Versuch h<strong>and</strong>elt, trotz einer über hundert Jahre <strong>and</strong>auernden archi-<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 205 29.10.2010 12:14:06<br />
205
tekturgeschichtlichen und denkmalpflegerischen Ausdifferenzierung der<br />
St<strong>and</strong>punkte zu Wiederaufbau, Reparatur und Vollrekonstruktion bewußt<br />
wieder Unklarheit zu stiften. Gewiß nicht aus laienhafter Unwissenheit<br />
und überzogener Emotionalität fallbeispielhafter Betroffenheit, sondern<br />
mit dem geschickt verpackten Ziel, durch angeblich st<strong>and</strong>punktlose Darstellung<br />
von Fakten dem ahnungslosen Besucher letztlich doch eine ganz<br />
bestimmte Meinung zu oktroyieren: Rekonstruktionen gibt es angeblich<br />
seit Menschengedenken, sie sind selbstverständlich ein Teil der zeitgenössischen<br />
Baukultur, weltumspannend nachweis- und problemlos vergleichbar;<br />
es gibt eine Tradition der Rekonstruktion … also warum und wofür<br />
das gehässige Geschrei in der speziell deutschen Fach- und Laienszene der<br />
letzten Jahre gegen solche Unternehmungen! Damit ist die Meinung klar<br />
erkennbar – auch wenn eine angeblich neutrale, um Differenzierung bemühte<br />
Position suggeriert wird. Diese Konstellation allein ist für eine<br />
öffentlich geförderte Bildungsinstitution mißlich: Mythenbildung, nicht<br />
Aufklärung steht im Mittelpunkt.<br />
Eric Hobsbawm läßt grüßen!<br />
Der Text auf der Tafel „Zur Ausstellung“ grenzt grundsätzlich richtig, wenn<br />
auch zu undeutlich, den Begriff des kollektiven Gedächtnisses, das generationenübergreifend<br />
überkommene Bauwerke beinhaltet, gegen Rekonstruktionen<br />
ab, die als bewußte Rückgriffe verlorene Erinnerungsorte aus<br />
einem jeweiligen Gegenwartsinteresse wiedergewinnen möchten. Rekonstruktionen<br />
sind also als aktive „Konstruktionen von Geschichte“ zu verstehen,<br />
die folglich auch nur aus dem Verständnis der jeweils zeitgenössischen<br />
Wiederherstellungsmotivation heraus erklärbar sind. Aufhorchen<br />
läßt die Behauptung, daß „Wiederherstellungen und Rekonstruktionen“<br />
angeblich „seit der Antike selbstverständliche Best<strong>and</strong>teile des Bauwesens“<br />
und erst ab dem 19. Jahrhunderts als „unehrlich“ und „Lüge diskreditiert“<br />
worden seien – und plötzlich ist Rekonstruktion mit Wiederherstellung<br />
gleichgesetzt. Eine Art Glossar „Zum Themenfeld Rekonstruktion“ unternimmt<br />
den grundsätzlich zu begrüßenden Versuch, alle um das Ausstellungsthema<br />
gelagerten Bedeutungsfelder zu definieren, um – so ein Hauptziel<br />
der Ausstellung – begriffliche Klarheit zu schaffen. Das Gegenteil ist<br />
der Fall. Neben den Begriffen Erneuerung, Kopie, Nachahmung, Replik,<br />
Rückbau, Vollendung und Wiederaufbau werden Reparatur, Restaurierung<br />
und Rekonstruktion fälschlich als „fließend inein<strong>and</strong>er übergehende“ Be-<br />
206<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 206 29.10.2010 12:14:06
griffe ausgewiesen, obwohl Reparatur (best<strong>and</strong>sorientierte Ausbesserung)<br />
und Rekonstruktion als „möglichst genaue Wiederherstellung eines [komplett,<br />
M.F.] verlorenen Zust<strong>and</strong>s“ Konzepte völlig konträrer Ausgangslagen<br />
und Zeitmodi darstellen: Reparatur wie auch Konservierung gehen<br />
von einem durch geschichtliche Akkumulation gewachsenen Best<strong>and</strong> aus,<br />
Rekonstruktion jedoch vom Totalverlust als schmerzvoll empfundenem<br />
Gegenwartsinteresse.<br />
Diese definitorische Inkonsistenz ist jedoch Programm: Der unkundige<br />
Leser nimmt all diese Begriffe als einzelne, jeweils sehr speziell gelagerte<br />
Untergruppen von „Wiederherstellung“ wahr, die im Glossar als Sammelbegriff<br />
„nahezu aller Arten von Wiedererrichtung oder Wiedergewinnung<br />
eines verlorenen Gebäudes“ ausgegeben wird. Rekonstruktion (nach<br />
Totalverlust) wäre demnach nur ein spezieller Fall von Wiederherstellung,<br />
die ja auch die komplett <strong>and</strong>ers gelagerte Reparatur (des Originalbest<strong>and</strong>s)<br />
subsumiert. Die fatale Reduktion, die wie ein unscheinbarer Nebensatz<br />
daherkommt, entnimmt der Leser aber nur dem Glossar des gedruckten<br />
Ausstellungskatalogs, das alle Definitionen als „überholt und historisch“<br />
entwertet: „Für die Publikation wurde Rekonstruktion deshalb im Sinne<br />
des relativ neutralen Begriffs ‚Wiederherstellung‘ weit gefasst […]“ (478).<br />
Damit erhält der Unterbegriff Rekonstruktion jetzt dieselbe definitorische<br />
Macht wie der Oberbegriff Wiederherstellung und stellt sich sozusagen an<br />
die Spitze aller <strong>and</strong>eren begrifflichen Untergruppen, die teils ganz <strong>and</strong>ere<br />
Bedeutungsfelder abdeckten. Denkt man diese vorsätzliche Verunklärung<br />
beziehungsweise semantische Umschichtung weiter, so h<strong>and</strong>elt es sich bei<br />
dem Ausstellungstitel „Geschichte der Rekonstruktion“ eigentlich entweder<br />
um eine unbewußte Themaverfehlung oder um eine bewußte Irreführung:<br />
Es hätte „Geschichte der Wiederherstellung“ heißen müssen (nur<br />
das verkauft sich nicht), da 80 Prozent aller in der Ausstellung angeführten<br />
Fallbeispiele streng genommen keine Rekonstruktionen nach Totalverlust<br />
sind, sondern alle <strong>and</strong>eren Arten von denkbaren Wiederherstellungen<br />
umfassen. Mit der geschickt eingestreuten Behauptung, daß Rekonstruktion<br />
„seit der Antike“ gängige Praxis der Baukultur sei, h<strong>and</strong>elt es sich sogar<br />
um den platten, jedoch gefährlichen Versuch der „Erfindung einer Tradition“<br />
(Eric Hobsbawm) unter dem Namen „Rekonstruktion“. Dazu paßt<br />
die in der Einleitung sich findende Bemerkung – „Die Beispiele aus der Zeit<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich fast beliebig vermehren ließen, wurden<br />
bewußt reduziert“ (7) –, die wohl bewußt ausblenden möchte, daß sich<br />
in Wirklichkeit die große Mehrzahl der gezeigten Beispiele mit dem bis<br />
dahin im Maßstab- und Umfang nicht gekannten Denkmalverlust nach<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 207 29.10.2010 12:14:06<br />
207
dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen: daß also gerade die Geschichte der<br />
(Voll)Rekonstruktion maßgeblich gerade durch die hochrelevante Zeitmarke<br />
1945 konstituiert wird. Das gedruckte Glossar selbst bekennt jedoch,<br />
daß der Begriff der Rekonstruktion bis 1893 nicht einmal in Grimms<br />
Deutschem Wörterbuch erwähnt wird (S. 478). Auch die Kulturwissenschaftlerin<br />
Aleida Assmann erläutert in ihrem Beitrag „Konstruktion und<br />
Rekonstruktion historischer Kontinuität“ im Katalog mit Bezug auf die<br />
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts: „Rekonstruktion ist eine neue Option<br />
in der Architekturgeschichte, die mit einem Paradigmenwechsel einhergeht.<br />
Dieser hat mit einer tief greifenden Veränderung unseres Zeitverständnisses<br />
zu tun und betrifft das Verhältnis von Zukunft und Vergangenheit.“<br />
(16)<br />
Rekonstruktion kann, muß aber nicht Fälschung sein!<br />
Die im Aufw<strong>and</strong> und der Materialdichte beeindruckende Ausstellung<br />
gliedert sich in zehn Themengruppen nach „Beweggründen der Wiederherstellung“<br />
mit insgesamt 150 Fällen, die durch Texte, Fotos, Schaukästen<br />
und Modelle erklärt werden, ergänzt um einen Bilderfries mit Kurzbeispielen.<br />
Nach der Sektion „Rekonstruktionen am heiligen Ort“ (der Salomonische<br />
Tempel als erstes Beispiel mehrfacher und zukünftiger Rekonstruktion?)<br />
kommt man im Teil „Rekonstruktion aus nationalen, politischen und<br />
dynastischen Gründen“ gleich in medias res: erneut betroffen steht man<br />
vor den Ruinenbildern der im Herbst 1944 total zerstörten Warschauer Altstadt,<br />
die bis 1953 wieder komplett in historischer Erscheinung als „weltweit<br />
größte Rekonstruktion eines Flächendenkmals“ (S. 280) wiederaufgebaut<br />
wurde. Dazu überragt das an die W<strong>and</strong> applizierte Zitat des<br />
polnischen <strong>Denkmalpflege</strong>rs Ian Zachwatowicz die Sektion: „Die Nation<br />
und ihre Denkmäler sind eins, deshalb besteht gerade eine Pflicht zu einer<br />
genauen Wiederholung“; der Nachsatz, daß dies im vollen „Bewusstsein<br />
der Tragödie der begangenen denkmalpflegerischen Fälschung“ geschah,<br />
steht leider (wieder!) nur im Ausstellungskatalog (S. 281) und widerlegt<br />
ganz einfach Nerdingers apodiktisch vorangestellten Slogan seines Einleitungstextes:<br />
„Eine Kopie ist kein Betrug, ein Faksimile keine Fälschung,<br />
ein Abguss kein Verbrechen und eine Rekonstruktion keine Lüge“ (S. 10).<br />
Doch ist das so einfach? Nerdingers Aussage ist ebenso eindimensional wie<br />
jenes Diktum „Rekonstruktion ist verboten“, das er seinem deklarierten<br />
208<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 208 29.10.2010 12:14:06
Feind, der zeitgenössisch verorteten Architektenschaft, in den Mund legt.<br />
Im Sinne seiner angeblich auf Ausgleich, Entemotionalisierung und begriffliche<br />
Klärung angelegten Ausstellung hätte man konsequenter Weise ergänzen<br />
müssen: Eine Kopie kann (muß aber nicht) ein Betrug sein, ebenso<br />
wie eine Rekonstruktion eine Lüge oder Fälschung sein kann (aber nicht<br />
sein muß). Nerdingers durchaus richtiger Anspruch, fallweise den zeit- und<br />
ortsabhängigen Kontext von Rekonstruktionen in der Vordergrund zu stellen,<br />
müßte auch bei der Frage ‚Fälschung oder Nichtfälschung‘ von Belang<br />
sein und irgendwo erwähnen, daß die Rekonstruktionsproblematik gerade<br />
in Deutschl<strong>and</strong> direkt mit dem wiederholt bruchhaften Nation-Building-<br />
Prozeß und den enormen Bauverlusten dieses L<strong>and</strong>es zu tun hat. 4<br />
Die Ausblendung von Zwischenzuständen und Verlusterfahrungen,<br />
oder: Rekonstruktionen ad infinitum?<br />
In der Sektion „Rekonstruktion von Bildern und Symbolen einer Stadt“<br />
fallen die drei nebenein<strong>and</strong>er aufgestellten Modelle des Chinesischen<br />
Turmes in München, des Knochenhaueramtshauses in Hildesheim und der<br />
Dresdner Frauenkirche auf. Sicherlich alle drei wünschenswert als Identitätsmarker,<br />
doch bei genauerer Analyse läßt sich exemplarisch eine weitere<br />
Problematik der Ausstellung aufzeigen: Sie blendet systematisch auch ein<br />
ganz wesentliches Charakteristikum von Rekonstruktionen aus, nämlich<br />
ihre oftmals zerstörerische Wirkung gegen vor Ort zeitlich wie baulich,<br />
semantisch wie politisch nachgewachsene Tatbestände. Während der<br />
Chinesische Turm 1944 zerstört wurde und 1951/1952 wiedererst<strong>and</strong>, mußten<br />
für die Re konstruktion des Knochenhaueramtshauses (zerstört 1945,<br />
rekonstruiert 1987–1989) ein nachgefolgter Hotelbau (1962/1964) ebenso<br />
abgerissen werden wie die gesamte Platzkonfiguration der Nachkriegszeit<br />
für rehistorisierende Kulissenbauten. Mit dem als „archäologische Rekonstruktion“<br />
be titelten Wiederaufbau der Kriegsruine der Dresdner Frauenkirche<br />
(zerstört 1945, rekonstruiert 2005) setzte sich die zerstörerische<br />
Rekonstruktions praxis fort. Der Versuch, die erhaltenen, aber durch<br />
den Kriegsbr<strong>and</strong> ausgeglühten und durch Witterungseinfluß inzwischen<br />
schwarz verfärbten Steine als zeitgeschichtliche Referenz zum Neubau in<br />
die rekonstruierte Gesamtfassade zu integrieren, war zwar ein ernstzunehmender<br />
Versuch, Zeitgeschichte in eine Vollrekonstruktion einzubeziehen,<br />
weil außer wenigen Alibistücken fast keine originalen Steinquader wiederverwendet<br />
werden konnten. Vor allem aber kann diese Lösung in Anbe-<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 209 29.10.2010 12:14:06<br />
209
tracht der katastrophalen, baulichen wie denkmalpflegerischen Neben- und<br />
Folgewirkungen kaum überzeugen. Erstens ignoriert die Argumentation<br />
eines über eine angeblich vergleichbare „zweite Stunde Null“ (1945 = 1990)<br />
liegengebliebenen Rekonstruktionsvorhabens den semantischen Zuwachs<br />
an der Ruine als antifaschistisches Mahnmal und späteren Ausgangspunkt<br />
der friedlichen DDR-Revolution von 1989. Zweitens wurde eine hochdestruktive<br />
Kettenreaktion ausgelöst: Zugunsten einer neu-alten Perspektivführung<br />
auf die Kirche wurde die komplette Platzr<strong>and</strong>bebauung des<br />
Neumarktes auf historisch simuliertem Parzellengrundriß mit drittklassig<br />
historisierenden Fassaden hinter einer überwiegend kommerziellen, historisch<br />
unproportional gegliederten Innenraumgliederung wieder aufgeführt<br />
und die barocken Kellergewölbe (als einzige wirklich original erhaltene<br />
Relikte vor Ort) zugunsten von Parkgaragen ebenso zerstört wie die komplette,<br />
an dieser Stelle entst<strong>and</strong>ene DDR-Architektur – eine Kettenreaktion,<br />
die mit der schrittweise erfolgten Demontage der nahen Prager Straße,<br />
ihrerseits ein Denkmal der DDR-Moderne, ihre Fortsetzung gefunden hat.<br />
Doch all dies erfah ren die Besucher der Ausstellung nicht. Und es dürfte<br />
sich deshalb auch um keinen Zufall h<strong>and</strong>eln, daß gerade Stefan Hertzig als<br />
allpräsenter und eben wenig um reale Fakten bemühter Fürsprecher der<br />
Neumarkt-Rekonstruktion eben diesen Katalogbeitrag verfaßt hat. Wo<br />
bleibt die Neutralität?<br />
Dazu paßt auch die Präsentation des schon erwähnten, durch die Ausstellung<br />
laufenden Bildfrieses mit über 200 „Rekonstruktionen – von Japan<br />
bis Kanada und von der griechischen Antike bis heute“, wie die Presseinformation<br />
erklärt. Ohne Zweifel: Die auf den ersten Blick wahllos<br />
nebenein<strong>and</strong>er montierten Drei-Bild-Collagen – Original-Zerstörung-<br />
Rekonstruktion – fördern völlig unbekannte Beispiele zu Tage und erfrischen<br />
die Aufmerksamkeit. Nur ohne den notwendigen Kontext (war nicht<br />
genau er der Anspruch der Ausstellung?) bleiben die Fälle rein spekulativ.<br />
Hier fehlen Informationen zu Zwischenzuständen, die im Falle der Wiedererstehung<br />
der um 1900 von Robert Koldewey entdeckten Ruinen<br />
Babylons durch Saddam Hussein bis zu 5000 Jahre umfassen können; oder<br />
zur genauen Motivation und Auftraggeberschaft, wie im Falle der neu-<br />
alten Geburtshütte Abraham Lincolns oder der wiederaufgeführten Kontrollstation<br />
am Berliner Checkpoint Charlie. Betrachter des scheinbar<br />
unendlichen Bilderfrieses sollen offenbar eine Botschaft mitnehmen: Die<br />
Welt ist voller Rekonstruktionen, deren weltumfassende Beispiele sich ad<br />
infinitum hätten fortsetzen lassen. Nur: bei genauer Analyse h<strong>and</strong>elt es sich<br />
hier in 80 Prozent der Beispiele eben nicht um Rekonstruktionen nach<br />
210<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 210 29.10.2010 12:14:06
Totalverlust, sondern um Reparaturen, Komplettierungen, Vollendungen<br />
und so weiter, die sich gut an die glossarisch ausgewiesenen Differenzierungen<br />
hätten zurückbinden lassen können.<br />
Macht es wie im Falle der Sektion „Rekonstruktion zur Erinnerung an<br />
Personen und Ereignisse“ dann auch keinen Unterschied mehr, ob Henry<br />
David Thoreaus verlorene Hütte am ehemaligen Walden Pond vor Ort<br />
zum rekonstruierten Wallfahrtsort aufsteigt, während parallel „zahlreiche<br />
weitere Kopien nach den Rekonstruktionen“ (S. 438) entstehen? Hieß es im<br />
Vorwort nicht etwas belehrend (aber falsch), daß „Kopie“ und „Replik“<br />
sich immer „eindeutig auf ein noch vorh<strong>and</strong>enes Original beziehen“ (S. 6)?<br />
Daß es Thoreaus Hütte 2002 sogar bis zu einer temporären Kunst-Installation<br />
durch Tobias Hauser am Leipziger Platz geschafft hat, während sie<br />
in den USA als Serienhütte oder mit Selbstbau-Anleitung verkauft wird,<br />
ist ein spannender Hinweis, doch kaum mehr der unterschwelligen Ausstellungsmessage<br />
„Rekonstruktionen sind doch gar nicht so schlimm“ zuzuordnen,<br />
sondern genau der entgegengesetzten Kritik von Anything goes,<br />
Konsum, Kommerz und jener je nach Bedarf medial steuer- und zirkulierbaren<br />
Bilderflut, zu der eben auch Rekonstruktionen gehören.<br />
„Nicht getäuscht, sondern zu wenig informiert“ – Rekonstruktionen<br />
als „Truman-Show“?<br />
Im nächsten Raum geht es um „Archäologische Rekonstruktionen“ und<br />
„Rekonstruktion als Antikenrezeption“. Während zum ersteren Thema<br />
hochspekulative Nachbauten nach Bodenbefunden wie Limes-Nachbauten<br />
oder die Pfahlbausiedlung im deutschen Unteruhldingen mit freizeitaktiven<br />
und ‚authentisch‘ kostümierten Protagonisten als „Living History-<br />
Entertainment“ zählen, wartet die Abteilung „Antikenrezeption“ mit einem<br />
spannenden Beitrag auf: Neben der Rekonstruktion eines Panorama-<br />
Gemäldes von 1888 zum Konstantinischen Rom wird eine Sequenz aus<br />
dem Film The Fall of the Roman Empire (Anthony Mann, 1965) als angeblich<br />
„größte jemals nachgebaute Freiluftkulisse der Filmgeschichte“ gezeigt.<br />
Akteure wie Zuschauer sind sich hier in jedem Moment des filmischen<br />
Re-enactments im Forum Romanum über die Künstlichkeit der Situation<br />
bewußt. Beklemmung überkommt die Ausstellungsbesucher allerdings,<br />
wenn sie Nerdingers Einleitungskommentar memorieren, in dem es heißt:<br />
„Wer Hinweise nicht sieht oder wer glaubt, die Altstädte von Warschau,<br />
Danzig, Breslau und Posen seien ‚historisch‘, der wird nicht getäuscht,<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 211 29.10.2010 12:14:06<br />
211
sondern der ist zu wenig informiert“ (10). In letzter Konsequenz hieße<br />
das, daß jede Form von zunehmend perfektionierter Fassadensimulation<br />
erlaubt wäre und die bisher noch geltende Ausweispflicht der stadträumlichen<br />
Neuinszenierer zu Lasten der Stadtraumbenutzer aufgehoben wäre.<br />
Man fühlt sich irritiert, wenn solche Second-Life-Szenarien à la The<br />
Truman-Show jetzt auch im öffentlich-demokratischen Raum ohne Schamgrenzen<br />
und mit Steuergeld-Rekonstruktionen aufgeführt werden dürften<br />
(in dem 1998 gedrehten US-Film The Truman Show war der Protagonist<br />
der um ihn völlig künstlich inszenierten Lebenswelt wenigstens in letzter<br />
Sekunde auf die Schliche gekommen). Letztlich wäre das sogar ein Schritt<br />
noch hinter den Totalitarismus, hatte doch selbst ein Regime wie dasjenige<br />
der DDR seine Altstadtsimulation im Berliner Nikolai-Viertel zur Berliner<br />
750-Jahrfeier (1987) größtenteils in Plattenbauästhetik und damit mit eindeutiger<br />
Gegenwartsreferenz aufgeführt.<br />
Jetzt befinden wir uns in der drittletzten Sektion „Rekonstruktion zur Wiederherstellung<br />
der Einheit eines Ensembles oder zur Wiedergewinnung<br />
eines Raumes“. Neben einem erneuten Bilderfries unendlicher Erfolgsbeispiele<br />
steht recht bescheiden jene bis 1990 deutschl<strong>and</strong>weit wichtigste<br />
Rekonstruktionsdebatte hinter Glas, die mit Hilfe von Georg Dehios<br />
berühmtem Ruinenerhaltungsplädoyer die segensreiche Relativierung<br />
von der bis 1900 grassierenden, hegemonial-preußisch forcierten Rekonstruktionswut<br />
einläutete: jene zum Heidelberger Schloß. Es ist zutiefst<br />
zu bedauern, daß die Ausstellungsmacher diesen so lehrreichen Fall<br />
nicht breiter präsentiert und in die Diskussion sogar als eine Art gescheitertes<br />
Rekonstruktionsprojekt eingebracht haben – gilt er doch als Beispiel<br />
einer in breiter Öffentlichkeit und sogar international geführten<br />
Debatte, „in deren Verlauf entscheidende Klärungen der <strong>Denkmalpflege</strong><br />
über ihre eigenen Prinzipien erfolgten“ (so zitiert die Schautafel, nicht aber<br />
der Kata logtext!) und die bis heute so oft hochspekulative Wiederaufführungsästhetik<br />
von politisch forcierten Rekonstruktionen ad absurdum<br />
geführt wurde.<br />
Essentialismus pur: der ‚Osten‘ als zyklisch a-materiale Kultur<br />
Der vorletzte Raum ist nicht wie alle <strong>and</strong>eren der sogenannten westlichen<br />
Welt, sondern dem europäisch-exotischen Blick auf den allzu friedvoll in<br />
vormoderner Traditionalität herbeigewünschten ‚Osten‘ gewidmet. Schon<br />
alleine die Sektionsüberschrift „Rekonstruktion des ‚authentischen Gei-<br />
212<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 212 29.10.2010 12:14:06
stes‘ und rituelle Wiederholung“ läßt nichts Gutes ahnen. Der Einleitungstext<br />
eigen-stereotypisiert die „westliche Kultur“ mit einer „linearen Wahrnehmung<br />
der Zeit“, dem unbedingten Glauben an „originale Substanz“<br />
und obendrein mit einer „westlichen <strong>Denkmalpflege</strong>“, die sich „um den<br />
Erhalt von originaler Substanz als dem Garanten von Erinnerung bemüht“<br />
(S. 191) – wollte die Ausstellung nicht gerade beweisen, daß auch wir es<br />
immer schon nicht so ganz genau nehmen mit der Originalsubstanz und<br />
ständig und auf quasi „ganz natürliche Weise“ (Nerdinger) alles immerfort<br />
und nach Verlusten so ganz und gar nicht „linear“ gegen jede Geschichtskausalität<br />
wiederherstellen? Mit Hinblick auf eine „zyklische Zeitauffassung<br />
in der Weitergabe des ‚authentischen Geistes‘ von Generation zu<br />
Generation“, der in der „Substanz verloren gehen kann“, ist auf der gesamten<br />
rechten Seite unserer Weltkarte also laut Ausstellungstext alles ganz <strong>and</strong>ers<br />
– Eigen- gegen Fremdstereotypisierung: „In vielen [welchen? welchen<br />
nicht? M. F.] Kulturen des nahen, mittleren und fernen Ostens finden sich<br />
unzählige Rekonstruktionen oder Wiederholungen [sogar so viele wie auf<br />
den uns gezeigten Bilderfriesen, warum sehen wir sie dann nicht? M. F.],<br />
die Frage nach dem Alter der Substanz oder nach ‚Originalität‘ ist in diesem<br />
kulturellen Zusammenhang relativ bedeutungslos“ (ebda.). Starker<br />
essentiali stischer Tobak, wenn man bedenkt, daß spätestens seit dem europäischen<br />
Kolonialkontakt in Nahost, Indien, ganz Südostasien, aber auch<br />
in unkolonisierten Ländern wie Japan die in der Tat materialbezogene,<br />
„westliche <strong>Denkmalpflege</strong>“ im 19. Jahrhundert Einzug hielt oder zumindest<br />
teiladaptiert ihre Spuren hinterließ. Diese Doppelstruktur institutionalisierter/professionalisierter<br />
<strong>Denkmalpflege</strong> und lokaler Traditionen vor<br />
Ort rief und ruft im Kampf um die Deutungshoheit um Kulturerbe bis<br />
heute oftmals starke Konflikte unter religiösen und politischen Gruppierungen<br />
hervor, von denen es zu berichten gälte – spätestens dann, wenn es<br />
auch um die gesprengten Bamiyan- Buddhas geht.<br />
Alle 14 Beispiele (davon fünf aus Japan, drei aus Nepal, zwei aus Myanmar<br />
und je eines aus der Mongolei, aus China, Afghanistan und Indien) stammen<br />
von Niels Gutschow, dem versierten Nepal-Experten und Leiter<br />
eines am Exzellenzcluster „<strong>Asia</strong> <strong>and</strong> <strong>Europe</strong> in a Global Context“ an der<br />
Universität Heidelberg angesiedelten Projekts zu Kulturerbe-Forschung<br />
im Spannungsfeld Asien-Europa. Gutschow spricht in seinem detail reichen,<br />
in sich stimmigen Katalogbeitrag stellenweise auch von klimabedingtem<br />
„Ersatz von Schadhaftem, Reparatur“ (S. 40) also von Materialerhalt und<br />
nicht zyklischem Totalaustausch. Als spannende Beispiele zeigt er uns<br />
rekonstruierte Tempelstrukturen in Nepal sowie einen aus nationalpoliti-<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 213 29.10.2010 12:14:07<br />
213
schen Gründen vollrekonstruierten Hindutempel in Indien. Zentral in<br />
dieser Sektion der Ausstellung selbst ist aber der schintoistische Ise-Schrein<br />
in Japan. Dessen zentrales Heiligtum wird seit 1300 Jahren alle 20 Jahre an<br />
abwechselnd direkt benachbarter Stelle als rein religiös motiviertes Erneuerungsritual<br />
neu aufgeführt. So interessant dieses Ritual auch sein mag, aus<br />
diesem Einzelfall dezidiert religiöser Praxis gleich auf eine materialferne<br />
(a-materiale) und sich zyklisch wiedererneuernde Kulturpraxis ganz Asiens<br />
zu schließen, mag mit einem banalen Beispiel entkräftet werden: Der<br />
hindu istische, später buddhistische Tempel von Angkor Vat im heutigen<br />
Kambodscha, das größte steinerne religiöse Bauwerk der Welt aus dem 12.<br />
Jahrhundert, wurde zur Zeit der buddhistischen Renaissance vor Ort im<br />
16. Jahrhundert substanzrückgewinnend repariert/restauriert und ist bis<br />
heute nahezu unversehrt erhalten – lange vor dem französischen Kolonialeinfluß<br />
im 19. Jahrhundert. Aber auch dieses Beispiel taugt nicht für die<br />
Pauschalisierung des Umgangs eines ganzen Kontinents mit seinem Kulturerbe,<br />
zumal kein einziger Repräsentant dieser ganzen Hemisphäre um<br />
seine Meinung für die Ausstellung gebeten wurde.<br />
Die „Moderne“ ist an allem Schuld – nur welche Moderne ist gemeint?<br />
Der letzte Großraum der Ausstellung kombiniert zwei Themenfelder. Während<br />
das vorletzte „Rekonstruktionen für Freizeit und Konsum“ archäologische<br />
Fun-Parks wie Xanten und Einkaufszentren mit angehängten<br />
Rekonstruktionsfassaden in Form des Braunschweiger Schlosses oder der<br />
Mainzer Markthäuser zeigt (kein Kommentar!), ist die Kategorie „Rekonstruktion<br />
und die ‚Ehrlichkeit‘ der Moderne“ das Allerletzte vor der rettenden<br />
Flucht ins Freie. Sie ist als Doppelschlag gegen die dem best<strong>and</strong>sorientierten<br />
Erhaltungsauftrag verpflichtete <strong>Denkmalpflege</strong> und die sich<br />
immer wieder jeweils zeitgenössisch (das heißt ‚modern‘) verortende Architektenschaft<br />
inszeniert. Laut Ausstellungstext geht es um die „Vorstellungen<br />
von ‚Wahrheit‘ und ‚Lüge‘, die als Antwort der Moderne auf die<br />
‚ Lügen‘ des Historismus formuliert wurden, basierend auf einer angeblichen<br />
Kenntnis dessen, was ‚zeitgenössisch‘ und ‚zeitgemäß‘ sei“ (465). Man<br />
ist über das hochideologische Outing als Schlußbemerkung einer doch<br />
sonst angeblich so meinungsneutralen, emotionslos lediglich Sachverhalte<br />
dokumentierenden Ausstellung nur überrascht, wenn man nicht schon zuvor<br />
all die versteckten Polemiken ‚gegen die Moderne‘ erkannt hat, die wie<br />
so oft zwischen den Zeilen zu finden sind.<br />
214<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 214 29.10.2010 12:14:07
Lediglich sieben und in ihrer Zusammenstellung wenig hilfreiche Beispiele<br />
sollen die ‚moderne Lügenthese‘ belegen (im Vergleich zu allein 25 Beispielen<br />
in der Sektion national-politisch motivierter Rekonstruktionen!). Da<br />
sieht man Robert Venturis stangenmodellierte Silhouette von 1976, die Benjamin<br />
Franklins ehemaliges und völlig verschwundenes Wohnhaus am originalen<br />
Erinnerungsort evoziert; oder den in zeitgenössischer Architektur<br />
ausgeführten, die Symmetrie der Saarbrücker Schloßanlage respektierenden<br />
Mittelpavillon von Gottfried Böhm der 1980er Jahre; oder den modernen,<br />
wiederinst<strong>and</strong>setzenden und im Detail historisch oftmals ungesicherten<br />
Weiterbau der römischen Theaterruine im spanischen Sagunt durch<br />
Giorgio Grassi. Das Fallbeispiel der um 1800 erbauten Komm<strong>and</strong>antur in<br />
Berlin fällt aber wohl nicht in die Kategorie „Ehrlichkeit der Moderne“,<br />
sondern in jene der politisch motivierten Unehrlichkeit der späten Postmoderne<br />
deutscher Nachkriegszeit: Hier wurde von Stuhlemmer/ Valentyn<br />
2003 anh<strong>and</strong> nur eines einzigen Meßbildes und Katasterplanes von 1879<br />
eine Fassadenrekonstruktion in Hohllochziegeln und modernem Innenleben<br />
aufgeführt, der als Gesamtresultat straßenseitig einen Altbest<strong>and</strong> mit<br />
rückseitig moderner Glasadaptation simuliert. Dieser Fall illustriert aber<br />
weniger unfähige Architekten, sondern die Garantie immer schlechter Ergebnisse,<br />
wenn die Politik, wie in diesem Fall der Berliner Senat, mit einer<br />
verbindlich historisch rekonstruierenden Gestaltungssatzung in die Grundlagen<br />
und damit Gestaltungsfreiheiten des Wettbewerbs eingreift … vergleichbar<br />
mit der gesamten Schloßdebatte, wo der gesamte Bundestag einer<br />
neokonservativen Rekonstruktionsinitiative auf den Leim gegangen ist und<br />
eine ganze Generation qualitätvoller Architekten vor den Kopf stieß.<br />
Interessant auch die Bemerkung, daß man sich aus aktuellen Rekonstruktionsdiskussionen<br />
heraushalten möchte: zum Stadtschloß keine Meinung?<br />
Geschickt plaziert und anscheinend ganz harmlos wird den Besuchern ganz<br />
am Ende der Ausstellung eine Best-Of-Liste zu aktuellen, „geplanten<br />
Rekonstruktionen“ präsentiert: Da steht die erdbebenzerstörte Zitadelle<br />
vom iranischen Bam neben der Bauakademie und dem Stadtschloß in Berlin,<br />
dem Königsberger Schloß und dem Stadtschloß in Potsdam und den von<br />
den Taliban im März 2001 (genau sechs Monate vor dem 11. September!)<br />
gesprengten Buddhastatuen von Bamiyan; im letztgenannten Beispiel gibt<br />
es bisher jedoch noch gar keinen Rekonstruktionsbeschluß – self-fulfilling<br />
prophecy? Gerade hier hätte ein wenig Reflexion um Verlust, Ost- West-<br />
Fundamentalismus und die Optionen beziehungsweise Limits der Wiedergewinnung<br />
von Kulturerbe am Ende der Ausstellung unbedingt Not<br />
getan. 5<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 215 29.10.2010 12:14:07<br />
215
Eine weitere Frage drängt sich auf: Welche Moderne ist überhaupt gemeint,<br />
wenn man so viel über die angebliche Tradition von Rekonstruktionen<br />
spricht? Die Verwirrungsstrategie – oder das bloße Ausweichen vor einer<br />
gut definierten Antwort? – illustriert der Aufsatz von Uta Hassler, ihres<br />
Zeichens Professorin für <strong>Denkmalpflege</strong> an der ETH Zürich. Sie war die<br />
Organisatorin der vorgeschalteten Tagung „Das Prinzip Rekonstruktion“<br />
2008 in Zürich, die inhaltlich durchaus ähnliche Ziele wie die Münchner<br />
Ausstellung verfolgte, für deren Zuschnitt sie deshalb wohl auch mit verantwortlich<br />
sein dürfte. Mit Bezug auf eine im 19. Jahrhundert ansetzende<br />
Moderne faßt sie zusammen: „Die Reste historischer Zufälle und Ereignisse<br />
werden als Faktum historischer Bedeutung nobilitiert, Geschichtlichkeit,<br />
einschließlich der Spuren und Gefährdungen durch Verfall, höher eingeschätzt<br />
als das Ideal einer ‚Vollendung‘“ (S. 179). Wenige Sätze zuvor hatte<br />
sie noch in Hinblick auf das späte 18. Jahrhundert von der „Weiterführung<br />
der aufklärerischen Traditionen der Moderne“ (Habermas‘ Diktum der<br />
‚Moderne als Projekt der Aufklärung‘?), dann aber wieder von der „Moderne<br />
des 20. Jahrhunderts“ gesprochen – was eher der sogenannten klassischen<br />
Moderne der Architekturgeschichtsschreibung entsprechen würde. Folgt<br />
man den Fallbeispielen im zweiten Teil ihres Beitrags, spannt sich der<br />
Argumentationsbogen gegen die „Inszenierung des Fragmen tarischen“<br />
(S. 187) von der ‚Nachkriegsmoderne‘ über die ‚Postmoderne‘ bis zur Gegenwart,<br />
nimmt die Autorin doch die jeweils zeitgenössisch ver orteten Ruinenaneignungen<br />
von Döllgasts Pinakothek und Wiedemanns Glyptothek<br />
ebenso ins Visier wie David Chipperfields gerade erst eröffnetes Berliner<br />
Projekt des Neuen Museums. Hasslers Kritik, daß Chipperfields Konzept<br />
einer partiellen Bewahrung und konservatorisch-künstlerischen Kommentierung<br />
des über 60 Jahre (!) <strong>and</strong>auernden Ruinen- beziehungsweise Fragmentzust<strong>and</strong>es<br />
des Museums ein „künstliches und intellektuell gewolltes<br />
Ergebnis“ (S. 187) sei, kann hingegen leicht entkräftet werden, da auch Vollrekonstruktionen<br />
wie jene des Frankfurter Goethehauses immer und ganz<br />
zwangsläufig künstliche und intellektuell gewollte Ergebnisse sind, ja sein<br />
müssen. Würde ‚Moderne‘ also (wie es richtig erscheint) mit der Aufklärung<br />
des 18. Jahrhunderts beginnen, so würden aber auch fast alle beklatschten<br />
Fallbeispiele der Ausstellung darunter fallen; fokussiert man nur auf<br />
die Nachkriegszeit, so müßte man zugestehen, daß die Zäsur von 1945 gerade<br />
in Deutschl<strong>and</strong> einen normativ besetzten und damit kriegsspurenbewahrenden<br />
Ansatz im Angesicht des so noch nie dagewesenen und größtenteils<br />
mitverschuldeten Denkmal verlustes zwingend notwendig gemacht<br />
hat. So aber bedienen sich die Ausstellunsgmacher je nach Lust und<br />
216<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 216 29.10.2010 12:14:07
Argumenta tionslaune mal dieser und mal jener ‚Moderne‘, um ihre zwischen<br />
den Zeilen angesiedelten Polemiken anzubringen.<br />
Und die deutschen Meister der Ruinenaneignung und<br />
Verlustverarbeitung?<br />
Zur abschließenden Frage: Wo stecken die architektonischen Großmeister<br />
der zeitgenössisch verorteten, spurensichernden Ruinenwiederaufbauten –<br />
nach Nerdingers intendierter Gesamtdarstellung müßten sie eigentlich auch<br />
ihren Platz in der Ausstellung finden, geht es doch um alle nur erden klichen<br />
Formen der „Wiederherstellung“. Allein in Deutschl<strong>and</strong> wären hier unter<br />
<strong>and</strong>eren zu nennen Rudolf Schwarz (Frankfurter Paulskirche, Gürzenich/<br />
St. Alban in Köln), Egon Eiermann (Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche)<br />
– und eben Hans Döllgast in München (Allerheiligenhofkirche,<br />
Basilika St. Bonifaz, Alte Pinakothek, Aussegnungshalle des Ostfriedhofs),<br />
zu dessen Werk Nerdinger selbst noch 1984 den B<strong>and</strong> Aufbauzeit – Planen<br />
und Bauen München 1945–1960 mitherausgab und die traditionsorientiert,<br />
aber nachkriegszeitliche, und eben nicht zwangsläufig voll rekonstruktierende<br />
Architektursprache des Wiederaufbaus in München würdigte … so ändern<br />
sich die Zeiten. Warum keine Pläne und Fotos zu Döllgast? Der Verdacht<br />
liegt nahe: Einen so München- und deutschl<strong>and</strong>weit anerkannten Architekten<br />
wie Döllgast, noch dazu in unmittelbarer Nachbarschaft zu der von ihm<br />
geretteten Alten Pinakothek, zu verunglimpfen, hätte dem Duo Nerdinger/<br />
Hassler zu viel Gegenwind eingebracht und ihr neokonservatives Plädoyer<br />
für Vollrekonstruktion ebenso bloß gestellt wie die These der „denkmalpflegerischen<br />
Utopie eines tradier baren Ruinenzust<strong>and</strong>es“ (S. 188) widerlegt.<br />
Zurück zum Start: Chipperfield-„Bashing“ zur<br />
Ausstellungseröffnung<br />
Wem diese Interpretation zu scharf ausgefallen erscheint, der sei kurz in<br />
die Situation der vorabendlichen Rede Nerdingers zur Ausstellungseröffnung<br />
am 21. Juli 2010 um 19 Uhr zurückversetzt: Wie Kommissar Columbo<br />
die wichtigsten Hinweise zum mörderischen Tatbest<strong>and</strong> immer erst zum<br />
Abgang nach seinem Zeugenverhör erfährt, so gab Nerdinger hier schon<br />
vor der Ausstellungseröffnung mehr von seiner unterschwelligen Projekt-<br />
Intention preis als in der Ausstellung selbst. Es war eine einzige Tirade ge-<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 217 29.10.2010 12:14:07<br />
217
gen die ihrer jeweiligen Zeitgenossenschaft verpflichteten Architekten, die<br />
im Umgang mit verlorenen Bauten oder halbzerstörten Ruinen mit dem<br />
„zwanghaften Zeigen der Brüche“ angeblich nur ihren unstillbaren Durst<br />
nach Selbstdarstellung stillen wollten. Rekonstruktionen seien ganz natürlich,<br />
der Verdachtsmoment einer Täuschung durch vollrekonstruktives<br />
Beseitigen aller Verlustspuren sei „durch den Unsinn der Väter der Moderne<br />
in die Welt gesetzt“ worden. Und eben: Rekonstruktionen seien auch keine<br />
Täuschung, die Getäuschten hätten sich eben nicht genug informiert. Der<br />
Name Döllgast fällt in einem Nebensatz, doch der Prügelknabe ist eindeutig<br />
der Brite David Chipperfield mit seinem Neuen Museum in Berlin. Man<br />
könnte dies alles als durchaus legitime Privatmeinung im Raum stehen lassen,<br />
wäre es nicht der Hauptinhalt einer Rede des amtierenden Direktors<br />
zur Ausstellungseröffnung zur „Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion<br />
der Geschichte“ gewesen.<br />
Eines ist sicher: Hans Döllgast, der umsichtige Bewahrer von Münchens<br />
erstem Pinakotheksgebäude in der Sprache nachkriegszeitlicher Bescheidenheit,<br />
hat sich ohne Zweifel während der Ausstellungseröffnung im<br />
Grabe umgedreht – aber das stört die Ausstellungsmacher Nerdinger/<br />
Hassler – wenige Meter entfernt im neuesten Pinakotheksgebäude – kaum:<br />
Sie haben Döllgast aus ihrer Ausstellung zur angeblich weltumspannenden<br />
Geschichte der Rekonstruktion einfach gestrichen.<br />
So wird eben auch Geschichte konstruiert und geklittert – und anscheinend<br />
ganz nebenher noch eine neue Tradition erfunden: die Tradition<br />
namens Rekonstruktion.<br />
Anmerkungen<br />
1 Diese Rezension erschien in einer reduzierten, aber bebilderten Version in werk, bauen<br />
+ wohnen, 10/2010, 66–88<br />
2 Alle in Klammern gesetzten Seitenangaben beziehen sich auf den Ausstellungskatalog:<br />
Winfried Nerdinger (Hg.), Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte,<br />
München 2010.<br />
3 Dazu: Michael Falser: Trauerarbeit an Ruinen – Kategorien des Wiederaufbaus nach 1945,<br />
in: Braum, Michael; Baus, Ursula (Hg.), Rekonstruktion in Deutschl<strong>and</strong>. Positionen zu<br />
einem umstrittenen Thema, Basel, Boston, Berlin (Birkhäuser) 2009, 60–97<br />
4 Genau zu dieser Problematik: Michael Falser, Zwischen Identität und Authentizität. Zur<br />
politischen Geschichte der <strong>Denkmalpflege</strong> in Deutschl<strong>and</strong>, Dresden 2008<br />
5 Dazu: Michael Falser: Die Buddhas von Bamiyan, performativer Ikonoklasmus und das<br />
„Image“ von Kulturerbe, in: Kultur und Terror, Zeitschrift für Kulturwissenschaft, Heft<br />
1/2010, S. 82–93<br />
218<br />
BWF_146_ <strong>Denkmalpflege</strong> <strong>statt</strong> <strong>Attrappenkult</strong>.indd 218 29.10.2010 12:14:07