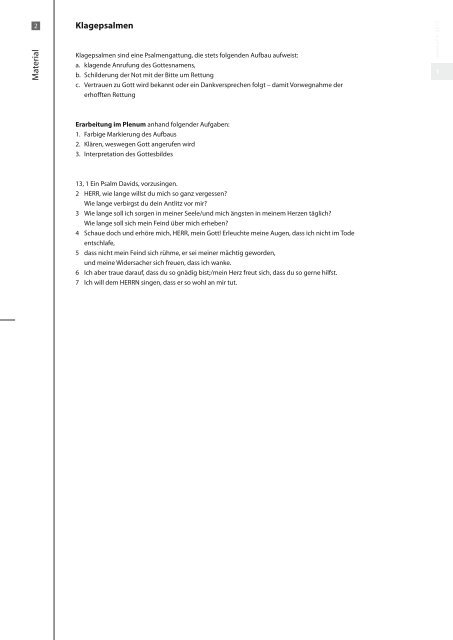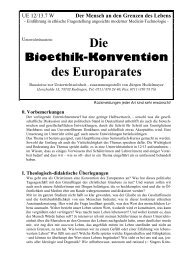M1-M8 - Entwurf online
M1-M8 - Entwurf online
M1-M8 - Entwurf online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2<br />
Material<br />
Klagepsalmen<br />
Klagepsalmen sind eine Psalmengattung, die stets folgenden Aufbau aufweist:<br />
a. klagende Anrufung des Gottesnamens,<br />
b. Schilderung der Not mit der Bitte um Rettung<br />
c. Vertrauen zu Gott wird bekannt oder ein Dankversprechen folgt – damit Vorwegnahme der<br />
erhofften Rettung<br />
Erarbeitung im Plenum anhand folgender Aufgaben:<br />
1. Farbige Markierung des Aufbaus<br />
2. Klären, weswegen Gott angerufen wird<br />
3. Interpretation des Gottesbildes<br />
13, 1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.<br />
2 HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen?<br />
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?<br />
3 Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele/und mich ängsten in meinem Herzen täglich?<br />
Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?<br />
4 Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott! Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode<br />
entschlafe,<br />
5 dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden,<br />
und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke.<br />
6 Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist;/mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.<br />
7 Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut.<br />
entwurf 4 · 2012<br />
1
entwurf 4 · 2012<br />
2<br />
3<br />
Material<br />
© Friedrich Verlag GmbH | ENTWuRF 4 | 2012<br />
Gott als Erzieher?<br />
Der Auszug aus dem sehr bekannten Roman „Illuminati“ (Dan Brown) spielt in Rom. Nach dem Tod des<br />
bisherigen Papstes ist ein Nachfolger zu wählen. Die vier aussichtsreichsten Kandidaten werden entführt<br />
und ermordet, nachdem sie mit einem Zeichen der Illuminati versehen wurden. Der berühmte Symbologe<br />
Robert Langdon versucht mithilfe des Camerlengos (im Roman eine Art Kammerdiener) den Mörder<br />
zu finden. Die folgende Szene ist eine Rückblende zwischen einem Leutnant der Schweizer Garde,<br />
Chartrand, und dem Camerlengo.<br />
Vor zwei Monaten, an einem friedlichen Nachmittag in der Vatikanstadt, war Chartrand dem Camerlengo<br />
über den Weg gelaufen, als dieser aus einem Gebäude gekommen war. Der Camerlengo hatte den<br />
jungen Leutnant offensichtlich gleich als neuen Gardisten erkannt und ihn eingeladen, ein Stück mit<br />
ihm durch die Gärten zu spazieren. Sie hatten sich über alles und jenes unterhalten und Chartrand hatte<br />
sogleich Vertrauen zu dem Camerlengo gefunden.<br />
„Vater“, hatte er gesagt, „darf ich Ihnen eine Frage stellen, die Ihnen vielleicht eigenartig erscheint?“<br />
„Nur, wenn ich eine eigenartige Antwort geben darf, mein Sohn.“<br />
Chartrand hatte gelacht. „Ich habe jeden Priester gefragt, den ich kenne, Vater, und ich verstehe es immer<br />
noch nicht.“<br />
„Was verstehst du noch nicht, mein Sohn?“ […]<br />
Chartrand hatte tief durchgeatmet. „Was ich nicht verstehe, ist diese Sache mit der Allmacht und der<br />
grenzenlosen Güte, Vater.“<br />
Der Camerlengo hatte gelächelt: „Du hast die Heilige Schrift studiert, mein Sohn.“<br />
„Ich versuche es, Vater.“<br />
„Du bist verwirrt, weil die Bibel Gott als eine allmächtige und gütige Wesenheit beschreibt.“<br />
„Ja.“<br />
„Allmächtig und gütig bedeutet lediglich, dass Gott alles kann und es gut mit uns Menschen meint.“<br />
„Ich verstehe das Konzept, es ist nur … ich sehe einen Widerspruch!“<br />
„Ja. Der Widerspruch lautet Schmerz. Menschen verhungern, führen Kriege, werden krank …“<br />
„Genau.“ Chartrand wusste, dass der Camerlengo ihn verstehen würde. „Es geschehen so schreckliche<br />
Dinge in dieser Welt. Die menschliche Tragödie erscheint wie der Beweis, dass Gott längst nicht so allmächtig<br />
und gütig ist, wie die Bibel es sagt. Wenn Er uns liebte und die Macht besäße, alles zu ändern,<br />
dann würde Er es doch sicher tun, oder nicht?“<br />
Der Camerlengo runzelte die Stirn. „Würde Er das?“<br />
Chartrand wurde nervös. Hatte er seine Grenzen überschritten? War dies eine der religiösen Fragen, die<br />
man nicht stellte?<br />
„Nun, ich meine …wenn Gott uns liebt und die Macht besitzt, uns zu beschützen, muss Er es doch tun!<br />
Es scheint, dass Er entweder allmächtig und ohne Liebe ist, oder Er ist gütig und besitzt nicht die Macht,<br />
uns zu helfen.“<br />
„Haben Sie Kinder, Leutnant?“<br />
Chartrand errötete. „Nein, Monsignore.“<br />
„Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen achtjährigen Sohn … würden Sie ihn lieben?“ „Selbstverständlich.“<br />
„Würden Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um Schaden von ihm abzuwenden?<br />
„Natürlich.“<br />
„Würden Sie ihn mit dem Skateboard fahren lassen?“ […]<br />
„Ja, ich denke schon“, sagte Chartrand. „Sicher, ich würde ihn damit fahren lassen, aber ich würde ihn<br />
auch ermahnen, vorsichtig zu sein.“<br />
„Also würden Sie als Vater diesem Kind ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben und dann es seine<br />
eigenen Fehler machen lassen? […] und wenn er hinfallen und sich die Knie aufschlagen würde?“<br />
„Dann würde er lernen, beim nächsten Mal besser aufzupassen.“<br />
Der Camerlengo lächelte. „Also würden Sie Ihre Liebe dadurch zeigen, dass Sie ihm ermöglichen, seine<br />
Lektionen selbst zu lernen, obwohl Sie einschreiten und Schmerz von Ihrem Kind abwenden könnten?“<br />
„Selbstverständlich. Schmerz gehört zum Aufwachsen. Auf diese Art und Weise lernen wir Menschen.“<br />
Der Camerlengo nickte nur. „Genau.“<br />
Aus: Dan Brown, Illuminati, Bergisch-Gladbach, 38. Aufl. 2007, S. 455– 457 in Auszügen.<br />
© Verlag Bastei-Lübbe, Bergisch-Gladbach<br />
Arbeitsaufgaben<br />
1. Begründet Aussagen pro oder kontra zur Meinung des Camerlengos.<br />
2. Überprüft, ob die Posistion des Camerlengo vereinbar mit der Vorstellung vom allmächtigen Gott ist.
4<br />
Material<br />
© Friedrich Verlag GmbH | ENTWuRF 4 | 2012<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
Der dunkle Gott als Chance<br />
Kaum jemand, der nicht um bedrückende Erfahrungen weiß, die Menschen zutiefst treffen können. Leid,<br />
Entfremdung, Angst oder pure Bosheit belasten das persönliche Leben. Aber auch Probleme, die unmittelbar<br />
mit den gesellschaftlichen Systemen und Strukturen zu tun haben, beschädigen und verhindern<br />
menschliches Lebensglück. Man denke an Ar-mut, Geschlechterdifferenzen oder rigorose bzw. fundamentalistische<br />
Moralvorstellungen.<br />
Im Kontext von Kirche und Glauben wurden und werden solche Erfahrungen direkt mit Gott in Verbindung<br />
gebracht, aber auf unterschiedliche Weise. Sie werden gerne verdrängt, indem man allzu eilig eine<br />
‚passende‘ Gottesrede „darauf setzt“: Gott als der Trost in allem Leid, die Rettung in Gefahr, die siegreiche<br />
Macht über Bosheit und Tod, das Licht in der Nacht, der Erlöser in Schuld und Versagen. So aber benutzt<br />
man das Wort „Gott“ wie eine fixe Formel, wie ein Allheilmittel gegen die Abgründe und unwägbarkeiten<br />
des Lebens. Andere halten Gott lieber aus allem heraus, sprechen ihn frei, lassen ihn ungeschoren.<br />
Dann ist ein ominöses Schicksal oder der Mensch selbst an allem schuld. Gott hat nichts damit zu tun.<br />
Beides hilft nicht weiter. Deutungen dieser Art – zumal wenn sie schablonenhaft und belehrend eingetragen<br />
werden – machen stumm. Sie bringen den Menschen dazu, sein Leid, seine Verwirrung und die<br />
damit verbundene existenzielle Empörung zu verschweigen oder spirituell zu überhöhen. […]<br />
Mutiger ist es, die bohrende Rückfrage nach Gott in ihrer ganzen unruhe und Schärfe zuzulassen. Man<br />
muss sie aussprechen und wenn nötig hinausschreien dürfen. Erst auf diese Weise bringt man die volle<br />
Realität des Daseins ungeschminkt mit dem zusammen, was Menschen „Gott“ nennen. Dabei wird<br />
eines offenbar: Mit Gott kann man die Verwerfungen, Krisen und Abstürze des Lebens nicht schlüssig<br />
erklären. Gerade deshalb lässt diese Rückfrage Gott nicht mehr los. Sie zieht ihn hinein in die dunklen<br />
Abgründe menschlicher Existenz. Er muss doch etwas damit zu tun haben, wenn er – wie jüdisch-christlich<br />
bekannt wird – der Gott der Väter, der Welt und der Geschichte ist! So gesehen und formuliert, wird<br />
Gott zum „dunklen Gott“, denn nun steht er selbst in Frage. Er ist angesprochen wird herausgefordert,<br />
manchmal sogar angeklagt angesichts der radikalen Fraglichkeit und Bedrängnis seiner Schöpfung: Wo<br />
bist du, Gott? Antworte! Was sind deine Verheißungen noch wert?<br />
Ein solcher Aufschrei nimmt die Verheißungen Gottes so ernst wie sonst keine menschliche Äußerung.<br />
Aber er hinterfragt sie auch und klagt ihre Erfüllung mitten in Not und Verzweiflung ein. Das führt in<br />
den Dialog mit dem „dunklen Gott“. Dieser Dialog ist in allen Epochen der jüdisch-christlichen Glaubensgeschichte<br />
aufgebrochen, oft quer zur herrschenden Theologie und Frömmigkeit. Es ist kein Frevel, mit<br />
Gott so zu reden und zu streiten, sondern vielmehr eine lebensgeschichtliche Notwendigkeit. In Krisen<br />
und an Brüchen und Grenzen stellt dieser Dialog eine ehrliche, wenn auch anstrengende Form der Auseinandersetzung<br />
und des Überlebens dar. Sich mit Gott zu befassen, ihn angesichts der Dunkelheit nach<br />
seiner Verheißung zu fragen, heißt, nicht einfach zu verstummen und zu zerbrechen: Es bedeutet, wach<br />
zu bleiben, gegen den Skandal des sinnlosen Leidens und der unterdrückung zu protestieren und die<br />
Hoffnung auf Heilung und Befreiung nicht völlig aufzugeben. […]<br />
Hanspeter Schmitt, Der dunkle Gott als Chance des Menschen, S. 8 f.<br />
© Katholisches Bibelwerk Stuttgart<br />
Arbeitsaufgaben<br />
1. Gebt die Thesen des Textes in eigenen Worten wieder.<br />
2. Erklärt, inwiefern sich der umgang mit Leid verändert, wenn man Schmitts Idee folgt.<br />
3. Bewertet, ob dies bereits eine Lösung der Theodizeefrage darstellt.<br />
entwurf 4 · 2012<br />
3
entwurf 4 · 2012<br />
4<br />
Material<br />
© Friedrich Verlag GmbH | ENTWuRF 4 | 2012<br />
Jenseits der Theodizee: Wo bleibt Gott?<br />
Den Widerspruch zwischen der erfahrenen Realität des Bösen und der geglaubten Allmacht und Gerechtigkeit<br />
Gottes hat noch kein Denken aufgelöst. Auch die biblische Tradition und der christliche Glaube<br />
haben eine Antwort auf die von Leibniz bis zu Hans Jonas immer neu gestellte Frage, wie das unsägliche<br />
Leiden der Welt mit einem Gottesbegriff vereinbar sein könnte, der das „Sinnganze“ der Welt umfaßt,<br />
5 jedenfalls keine, die sich an den Betrachter des Weltlaufs richtet und ihn zufriedenzustellen vermag. Es gibt<br />
jedoch nicht nur diesen Betrachter, es gibt auch den Betroffenen, den existentiell Bedrohten und Kämpfenden.<br />
Mit ihm vor allem hat es die Bibel zu tun, und damit ändert sich die Perspektive, denn er fragt<br />
anders nach Gott. Er fragt nicht unter selbstgewählten Bedingungen, er fragt in einer bestimmten, ihm<br />
„von außen“ aufgenötigten Situation und wartet darauf, daß Gott sich ihm „vor Ort“ zu erkennen gibt. […]<br />
10<br />
Die Bibel jedenfalls trägt das Problem auf eine andere Weise aus. Sie verzichtet auf eine rational einsichtige<br />
Lösung, die uns von der quälenden Frage nach dem Warum entlasten könnte, und konzentriert sich<br />
statt dessen auf die Situation, der dieses Warum entspringt. Dieser auffallende Verzicht weist bereits auf<br />
den entscheidenden Differenzpunkt hin: Gott wird nicht als Postulat, auch nicht als „Arbeitshypothese“<br />
15 zur Erklärung von Tod, Leiden und Schuld eingeführt, so daß wir mit einer a priori feststehenden, wenngleich<br />
erst am Ende der Geschichte uns offenbar werdenden Antwort zu rechnen hätten. Er führt sich vielmehr<br />
selbst durch die Teilhabe am Rätsel des Bösen in den Zusammenhang von Tod, Leiden und Schuld<br />
ein. Nicht als der „Lückenbüßer“, der einen Wissensmangel kompensiert, sondern als der, der mit Paul<br />
Gerhardt geredet, „des Leben Mangel“ ausfüllt, ist er dem biblischen Glauben als „unser“ Gott bekannt.<br />
20<br />
Jeder theologischen Rechenschaft ist dadurch eine bleibende Grenze gezogen. Gibt Gott sich zu erkennen,<br />
indem er in die Situation des menschlichen Lebens eintritt, dann kann man nach ihm nur fragen, indem<br />
man seine eigene Situation in diese Frage einbezieht und in ihr aufs Spiel setzt, dann ist es unmöglich, ihn<br />
vorab durch eine Definition festzulegen, ihn gewissermaßen verfügbar zu machen, um ihn als Lösungs-<br />
25 formel – und das hieße ja: als Deus es machina – in das ungelöste Rätsel des eigenen Daseins einzusetzen.<br />
30<br />
35<br />
Die Frage nach Recht und Sinn menschlichen Leidens läßt sich also nicht „abschieben“ auf Gott, als hätten<br />
wir die Freiheit oder auch nur die Möglichkeit, sie von diesem „Ort“ aus wie von einem archimedischen<br />
Punkt her zur Klarheit zu bringen. Denn tritt Gott nicht von außen, als ein erst noch hinzuzudenkender<br />
Inhalt in die Situation des Menschen hinein, dann bleibt uns nur zu fragen, wie seine Nähe sich in<br />
dieser Situation auswirkt und wie die Situation selbst sich über dieser Nähe wandelt. Das könnte in der<br />
Tat genügen, um die Anklage, die das Leiden gegen Gott zu erheben pflegt, aus den Aporien des klassischen<br />
Theodizeeproblems herauszuführen. Denn bewältigen lassen sich Probleme, indem man sie löst<br />
oder indem sie sich nicht mehr stellen, weil sich die Situation, in der sie aufbrechen mußten, gewandelt<br />
hat. […] Denn das Problem des Leidens findet hier keinerlei Erklärung; als Problem jedoch scheint es sich<br />
zuletzt erübrigt zu haben. Es wirft keinen Schatten auf Gott, der sein Bild bleibend verdunkeln könnte.<br />
Walter Dietrich/Christian Link: Die dunklen Seiten Gottes, S. 124 f.<br />
© Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn<br />
Arbeitsaufgaben<br />
1. Gebt die Thesen des Textes in eigenen Worten wieder.<br />
2. Erklärt, inwiefern sich der umgang mit Leid verändert, wenn man Dietrichs/Links Idee folgt.<br />
3. Bewertet, ob dies bereits eine Lösung der Theodizeefrage darstellt.
5<br />
Material<br />
© Friedrich Verlag GmbH | ENTWuRF 4 | 2012<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
Leiden an Gott<br />
Christliche Hoffnung ist keine erfahrungsbasierte Erwartungsentscheidung unter hohem Risiko […], sondern<br />
eine […] Lebenshaltung des zuversichtlichen „Trotzdem“ und gewissen „Dennoch“, die wider alle Alltagserfahrung<br />
und alles, was dagegen spricht, darauf setzt, dass sich ihre Hoffnung auf das richtet, was<br />
selbst der Grund und ursprung dieser Hoffnung ist. […] Die Herausforderung dieser Hoffnung ist nicht<br />
der Zweifel, sondern die Anfechtung. Anders als Zweifel, der dieses oder jenes in Frage stellt, aber sich<br />
zumindest an sich selbst festhalten kann, ist Anfechtung das Dunkelwerden der Gewissheit, dass Gott<br />
gegenwärtig ist, und damit der Abgrund, in dem alle Hoffnung versinkt. […]<br />
Das Gegenmittel zur Anfechtung ist allein die Hoffnung, dass trotz allem und wider allen Anschein Gottes<br />
Gegenwart gewiss ist. Anderes mag für oder gegen den Glauben an Gottes Gegenwart sprechen und<br />
angeführt werden, der Streit zwischen Hoffnung und Anfechtung wird dadurch nur marginal berührt,<br />
weil sich beide in gegenläufiger Weise auf dasselbe richten: das, was nur um seiner selbst willen oder<br />
überhaupt nicht gewiss ist und sich durch nichts anderes gewiss oder ungewiss machen lässt. […] Das<br />
ist anders bei der Anfechtung. Wer angefochten wird, leidet daran, dass der, auf den sich die Hoffnung<br />
richtet, selbst dunkel, undurchschaubar und unfassbar wird. Nicht nur die anderen, man selbst verliert<br />
damit die Gewissheit der Gegenwart Gottes. Die Hoffnung wird schal, weil man nicht (mehr) wahrzunehmen<br />
vermag, worauf sie sich richtet und was sie begründet. Aus diesem Bösen gibt es keinen Ausweg,<br />
den man selbst gehen könnte. Wo Gott selbst dunkel wird, wird der umweg über Gott ungangbar.<br />
Die Wirklichkeit des Bösen kann dann nicht mehr als vergangen qualifiziert werden, weil es kein gegenwärtiges<br />
Anderes gibt, auf das man sich dabei berufen könnte. Angesichts dieses Leidens ist selbst der<br />
Rekurs auf Gott verstellt, weil Gott selbst der ist, an dem man leidet. […]<br />
Aber dieses Gotterleiden ist ein Sich-öffnen für Gott bzw. ein Geöffnet-werden durch Gott. Das Leiden<br />
an Gott in der Anfechtung dagegen ist gerade umgekehrt ein Sich-nicht-mehr-öffnen-können für Gott<br />
bzw. ein Nicht-mehr-geöffnet-werden durch Gott. Man ist Gott gegenüber nicht ganz und gar offen, sondern<br />
ganz und gar verschlossen. Es ist ein Leiden nicht an der übergroßen Nähe und Anwesenheit, sondern<br />
an der undurchschaubaren Ferne und Abwesenheit Gottes. […]<br />
In dieser Situation gibt es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Man kann sich der An-fechtung überlassen<br />
und alle Hoffnung auf Gottes Gegenwart fahren lassen. […]<br />
Man kann sich auch wider die Anfechtung zur Wehr setzen und in der Klage über die verlorene Hoffnung<br />
gegen den sich entziehenden Gott protestieren […].<br />
Man kann schließlich vom Protest und von der Verweigerung zur Anklage und zur Rebellion gegen Gott<br />
übergehen und die Anfechtung nicht im Atheismus, sondern im Zorn auf Gott und in der Verfluchung<br />
Gottes enden lassen.<br />
Diese Wendung gegen Gott ist immer noch ein sich Ausrichten an Gott, auch wenn nicht mehr die Hoffnung<br />
auf ein Wahrwerden der Wirklichkeit seiner Gegenwart, sondern die Wut und Verzweiflung über<br />
das sich Verweigern Gottes und das Entziehen und Verbergen seiner Gegenwart das Leben bestimmen.<br />
Nicht irgendetwas anderes verstellt, sondern Gott selbst entzieht seine Gegenwart. […] Das ist der Punkt,<br />
an dem der christliche Glaube an Gott einsetzt […] Er entdeckt den Protest, die Anklage, das Aufbegehren<br />
gegen Gott in Gott selbst.<br />
Ingolf u. Dalferth: Leiden und Böses, S. 206 ff.<br />
© Evangelische Verlagsanstalt Leipzig<br />
Arbeitsaufgaben<br />
1. Gebt die Thesen des Textes in eigenen Worten wieder.<br />
2. Erklärt, inwiefern sich der umgang mit Leid verändert, wenn man Dalferths Idee folgt.<br />
3. Bewertet, ob dies bereits eine Lösung der Theodizeefrage darstellt.<br />
entwurf 4 · 2012<br />
5
entwurf 4 · 2012<br />
6<br />
7<br />
Material<br />
© Friedrich Verlag GmbH | ENTWuRF 4 | 2012<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
51<br />
Gott auf der Anklagebank 1/2<br />
Peter Hahne erzählt in seinem Buch „Leid – Warum läßt Gott das zu?“ die Geschichte einer Gerichtsverhandlung<br />
mit Gott auf der Anklagebank:<br />
Am Ende der Zeiten versammeln sich Millionen Menschen vor dem Thron Gottes. Die einen schauen<br />
ängstlich in das gleißend-helle Licht. Andere kümmert das alles nichts. Sie stehen in Gruppen zusammen<br />
und diskutieren hitzig miteinander. Sie haben nur ein Thema: Wie kann Gott das Leid zulassen, das<br />
die Menschen jetzt im Lebensrückblick so aufgehäuft und erdrückend sehen. „Das soll ein Gott der Liebe<br />
sein?! Wie kann er über uns zu Gericht sitzen? Was versteht er schon von unserem Leid? Hat er denn<br />
jemals leiden müssen?“ faucht eine alte Frau mit schneidender Stimme. Sie zieht ihren Ärmel hoch und<br />
zeigt auf die eintätowierte Nummer eines Konzentrationslagers. Ein farbiger junger Mann öffnet aufgeregt<br />
seinen Hemdkragen: „Schaut euch das an“, fordert er die umstehenden auf und zeigt seine Wundmale<br />
am Hals, Male eines Strickes. „Gelyncht haben sie mich, nur weil ich schwarz bin und nicht weiß. In<br />
Sklavenschiffe hat man uns verschleppt. Von unseren Liebsten wurden wir getrennt. Wie Tiere mußten<br />
wir arbeiten. Soll das ein Gott der Liebe sein?“ Ein junges Mädchen starrt still und teilnahmslos vor sich<br />
hin. Auf ihrer Stirn ist das Wort zu lesen: „unehelich.“ Überall kommt jetzt ärgerliche Stimmung auf. Die<br />
Leute sind empört. und jeder richtet seine Klage gegen Gott, weil er das Böse, das Leid, das unrecht in<br />
der Welt zugelassen hat. Das will ein Gott der Liebe sein … „Wie gut hast du es doch, Gott“, sagen sie alle.<br />
„Wie gut hast du es in deinem Himmel in all der Schönheit und Helligkeit. Bei dir gibt es keine Tränen,<br />
keine Angst, keinen Hunger, keinen Haß, kein Leid. Ja, du hast es gut. Aber wir? Kannst du dir überhaupt<br />
vorstellen, was der Mensch auf der Erde alles erdulden muß? Was es heißt, Leid zu ertragen und Tränen<br />
zu weinen? Schließlich führst du, Gott, doch ein behütetes und beschauliches Dasein …“ So reden die<br />
Leute vor dem Thron Gottes.<br />
und plötzlich hat jemand eine Idee: „Wir wollen Gott den Prozeß machen. Wir wollen ihn verurteilen.“ Jede<br />
der Gruppen wählt sich einen Sprecher. Es ist immer derjenige, der in seinem Leben am meisten gelitten<br />
hat. Da ist ein Jude, ein Schwarzer, eine uneheliche Tochter, ein unberührbarer aus Indien, ein entstellter<br />
Leprakranker, ein Bombenopfer, ein Gefolterter aus den Arbeitslagern Sibiriens … Sie alle diskutieren<br />
aufgeregt miteinander. und dann sind sich alle mit der Formulierung der Anklage gegen Gott einig:<br />
Bevor Gott das Recht hat, über uns zu Gericht zu sitzen, soll er erst mal ertragen, was wir Menschen auf<br />
Erden an Leid erdulden mußten. Gott soll dazu verurteilt werden, auf dieser Erde zu leben. Als Mensch.<br />
Weil Gott aber Gott ist, stellen die Menschen in ihrem Prozeß bestimmte Bedingungen: Er soll keine<br />
Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selbst zu helfen. Er soll als Jude geboren werden.<br />
Damit soll er sehen, wie das ist, als Jude leben zu müssen. Die Legitimität seiner Geburt soll zweifelhaft<br />
sein. unehelich im weltlichen Recht soll er geboren werden. Niemand soll wissen, wer eigentlich<br />
sein Vater ist. Als ein solcher Mensch soll er versuchen, seinen Mitmenschen zu erklären, wer Gott ist. Ja,<br />
er soll mit dem Anspruch auf die Erde kommen, selber Gott zu sein. Von seinen engsten Freunden soll<br />
er schließlich verraten werden, nachdem er nur drei Jahrzehnte unter Entbehrungen, Verfolgung, Hunger<br />
und Anfechtungen gelebt hat. Mit falschen Anschuldigungen soll ihm der Prozeß gemacht werden.<br />
Ja, die Leute vor dem Thron Gottes übertrumpfen sich förmlich gegenseitig mit Vorschlägen, wie man<br />
Gott bestrafen soll. Schließlich soll er ja das erleiden, was ihnen in ihrem Leben widerfahren ist. und<br />
zwar in geballter Form. Sein Prozeß soll mit falschen Anschuldigungen geführt werden. Von einem voreingenommenen<br />
Gericht soll er verhört werden. Ein feiger Richter soll ihn aburteilen. Er soll erfahren,<br />
was es heißt, von allen Menschen verlassen und total einsam und hilflos zu sein. Er soll brutal gequält<br />
werden und dann grausam sterben. und das in aller Öffentlichkeit. Eine Menge von Zeugen soll dabei<br />
sein: lachend, spottend, höhnend. Die Menschen vor dem Thron Gottes sind sich einig: Gott soll auf der<br />
Erde alles das erleiden, was ihnen in der Zeit ihres Lebens widerfahren ist. Jeder der Sprecher verkündet<br />
sein urteil gegen Gott. Hart und erbarmungslos. Ein Prozeß ohne Gnade. und während ein urteilsspruch<br />
nach dem anderen vorgetragen wird, geht plötzlich ein Raunen durch die Menge. Als der letzte<br />
sein urteil fällt, wird es ganz still. Ein großes Schweigen macht sich breit. Ein betretenes Schweigen.<br />
Eine Stecknadel könnte man fallen hören. Alle, die Gott so grausam verurteilt haben, senken ihre Köpfe.<br />
Beschämt und erschüttert wenden sie sich ab. Keiner wagt mehr zu sprechen.<br />
Plötzlich weiß jeder dieser Leute, um was es hier geht. Jedem ist klar: Gott hat die Strafe ja schon längst<br />
auf sich genommen. Das urteil hat er ja schon längst getragen. Jesus kam in diese Welt. Als Sohn Gottes<br />
wurde er geboren. Von einer Jungfrau in einem ärmlichen Stall. Jesus, als Jude geboren, in den Dreck<br />
der Welt gekommen. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Aber die Menschen haben ihn verkannt, verlacht,<br />
verspottet und schließlich verurteilt. – Jesus, in den letzten Stunden seines Lebens einsam, total
7<br />
Material<br />
© Friedrich Verlag GmbH | ENTWuRF 4 | 2012<br />
5<br />
10<br />
Gott auf der Anklagebank 2/2<br />
verlassen, gequält und gemartert. Alles, was man sich an Leid und ungerechtigkeit vorstellen kann, ist<br />
zusammengeballt auf diesen Einen.<br />
Plötzlich wurde allen klar, die den angeblich so grausamen und selber leidlosen Gott verurteilen wollen:<br />
Das urteil ist ja bereits vollzogen. Gott hat das Leid bereits ertragen. Am eigenen Körper hat er es<br />
durchgemacht. In der Person seines Sohnes Jesus Christus. Wir brauchen Gott gar keinen Prozeß mehr<br />
zu machen. Das urteil ist bereits gefällt. und es ist ein urteil zu unseren Gunsten: „Fürwahr, er trug unsere<br />
Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott<br />
geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde<br />
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind,<br />
wir geheilt“ (Jesaja 53,4.5).<br />
Peter Hahne: Leid - Warum lässt Gott das zu?, Friesenheim-Schuttern 2012, S. 56 – 60.<br />
© Verlag mediaKern, Friesenheim-Schuttern, ISBN 978-3-8429-1002-7<br />
entwurf 4 · 2012<br />
7