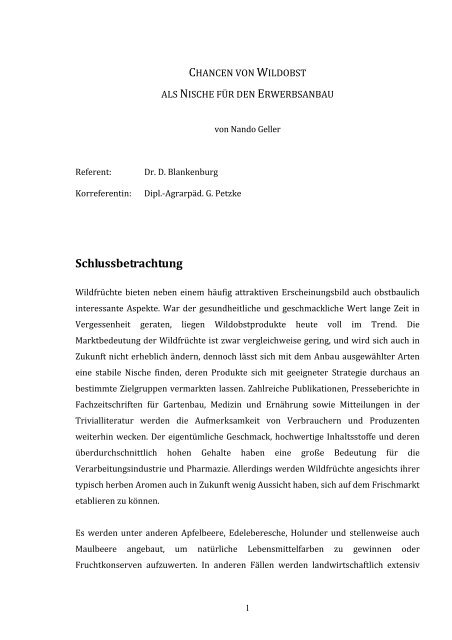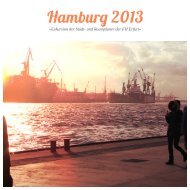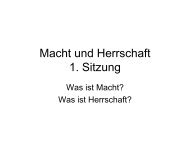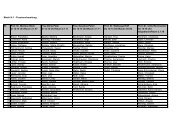Schlussbetrachtung
Schlussbetrachtung
Schlussbetrachtung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Referent: Dr. D. Blankenburg<br />
Korreferentin: Dipl.‐Agrarpäd. G. Petzke<br />
<strong>Schlussbetrachtung</strong><br />
CHANCEN VON WILDOBST<br />
ALS NISCHE FÜR DEN ERWERBSANBAU<br />
von Nando Geller<br />
Wildfrüchte bieten neben einem häufig attraktiven Erscheinungsbild auch obstbaulich<br />
interessante Aspekte. War der gesundheitliche und geschmackliche Wert lange Zeit in<br />
Vergessenheit geraten, liegen Wildobstprodukte heute voll im Trend. Die<br />
Marktbedeutung der Wildfrüchte ist zwar vergleichweise gering, und wird sich auch in<br />
Zukunft nicht erheblich ändern, dennoch lässt sich mit dem Anbau ausgewählter Arten<br />
eine stabile Nische finden, deren Produkte sich mit geeigneter Strategie durchaus an<br />
bestimmte Zielgruppen vermarkten lassen. Zahlreiche Publikationen, Presseberichte in<br />
Fachzeitschriften für Gartenbau, Medizin und Ernährung sowie Mitteilungen in der<br />
Trivialliteratur werden die Aufmerksamkeit von Verbrauchern und Produzenten<br />
weiterhin wecken. Der eigentümliche Geschmack, hochwertige Inhaltsstoffe und deren<br />
überdurchschnittlich hohen Gehalte haben eine große Bedeutung für die<br />
Verarbeitungsindustrie und Pharmazie. Allerdings werden Wildfrüchte angesichts ihrer<br />
typisch herben Aromen auch in Zukunft wenig Aussicht haben, sich auf dem Frischmarkt<br />
etablieren zu können.<br />
Es werden unter anderen Apfelbeere, Edeleberesche, Holunder und stellenweise auch<br />
Maulbeere angebaut, um natürliche Lebensmittelfarben zu gewinnen oder<br />
Fruchtkonserven aufzuwerten. In anderen Fällen werden landwirtschaftlich extensiv<br />
1
genutzte Flächen aufgegeben, um Sanddorn, Scheinquitte und vor allem die<br />
außerordentlich vitaminreichen Wildrosen in Kultur zu nehmen. Im Vergleich zu den<br />
Kultursorten unserer Obstarten sind Wildfrüchte in der Regel bei weitem reicher an<br />
wertgebenden Inhaltsstoffen, wobei viele noch nicht einmal einer detaillierten<br />
wissenschaftlichen Studie unterlagen. So bleibt abzuwarten, welche Bedeutung noch<br />
weitere, weniger bekannte Früchte für medizinische Zwecke haben werden.<br />
Da der Bedarf an Wildfrüchten in Zukunft nicht mehr aus Wildsammlungen zu decken<br />
sein wird, ist es notwendig, Wildobstproduktion in Erwerbsanlagen aufzubauen.<br />
Zahlreiche Sorten wurden bereits selektiert und Versuche zu Anbausystemen, Erträgen<br />
und Inhaltsstoffen durchgeführt. Die Kulturführung der meisten Wildobstarten erweist<br />
sich als verhältnismäßig einfach. In der Regel ist ein geringer Umfang an<br />
Pflegemaßnahmen ausreichend, um eine solche Obstanlage zu bewirtschaften.<br />
Wildfrüchte zeichnen sich in der Regel durch ihre enorme Anspruchslosigkeit in Bezug<br />
auf Klima und Bodenverhältnisse aus, selbst in obstbaulichen Grenzlagen können viele<br />
Arten zufrieden stellende Erträge liefern. Nur der Holunder nimmt mit relativ hohen<br />
Anforderungen an Bodengüte und Wasserhaushalt eine Sonderstellung ein. Durch die<br />
überwiegend späten Blühzeiträume sind Frostschäden an den Blüten auch in<br />
obstbaulich ungünstigen Lagen praktisch ausgeschlossen. Dadurch wird der<br />
Wildobstanbau beispielsweise gegenüber der Apfel‐ und Kirschproduktion zu einer<br />
risikolosen Kultur. Aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Schaderregern<br />
kann auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sehr begrenzt bleiben. Lediglich<br />
Holunderbestände sind relativ anfällig für Krankheiten und einige Schädlinge. Diese<br />
lassen sich aber mit den derzeit zugelassenen Präparaten wirkungsvoll bekämpfen.<br />
Allerdings gehören Apfelbeere, Mispel und Sorbus, wie auch Apfel, Birne und Quitte, zur<br />
Familie der Rosaceae, bzw. zur Unterfamilie der Pomoideae, und sind daher potentielle<br />
Wirtspflanzen des Feuerbrand‐Erregers Erwinia amylovora. In diesem Zusammenhang<br />
ist zu betonen, dass der Kernobstanbau durch die innovative Produktion dieser<br />
Obstalternativen nicht zusätzlich gefährdet werden darf. In der Schweiz unterliegt der<br />
Wildobstanbau sogar kantonalen Einschränkungen und auch in Deutschland sind die<br />
gesetzlichen Grundlagen der Feuerbrandverordnung für Verfügungsberechtigte und<br />
Besitzer von Wirtspflanzen zu beachten. Aufgrund der allgemeinen<br />
2
Widerstandsfähigkeit der meisten Wildobstarten liegt es nahe, auf rein ökologischer<br />
Basis zu produzieren. Eine derartige Produktionsweise könnte zusätzliche Vorteile bei<br />
der Gewinnung eines stabilen Kundenstammes bringen.<br />
Der Übergang vom Wildcharakter zu den Sorten ist oft fließend. Da aber die einzelnen<br />
Selektionen in ihren Gehalten an Inhaltsstoffen wie auch in der Ertragsleistung stark<br />
auseinander gehen, sollten die Sorten entsprechend dem Verarbeitungszweck gewählt<br />
werden. Zusätzliche Aspekte der Pflanzengesundheit sind vor allem beim Holunder zu<br />
beachten. Wie bei den meisten Kulturen wird auch im Wildfruchtanbau der größte<br />
Arbeitszeitbedarf für die Ernte benötigt. Arbeitsspitzen lassen sich durch eine<br />
entsprechende Arten‐ und Sortenpalette teilweise abfedern. Faktoren wie das<br />
Pflanzsystem, eventuelle Bedornung der Sorten, Behangdichte und vor allem die<br />
Fruchtgröße wirken sich maßgeblich auf die Pflückleistung aus und sind bei der<br />
Errichtung einer Erwerbsanlage und bei der Sortenwahl zu berücksichtigen.<br />
Der Obstbauer muss sich von der Masse seiner Konkurrenz abheben und neue Märkte<br />
erschließen, um erfolgreich zu sein. Mit einem fundierten Fachwissen und laufender<br />
Weiterbildung kann er direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Anlage und den<br />
Erfolg seines Betriebes nehmen. Daher sind die Bemühungen der gartenbaulichen<br />
Versuchsanstalten, auch Nischenkulturen auf ihren Anbauwert zu testen, unverzichtbar.<br />
Um die Wildobstproduktion noch lukrativer gestalten zu können, müssen grundlegende<br />
Anbaufaktoren verbessert werden. Die Selektion von Sorten aus Wildformen und die<br />
Erarbeitung von Vermehrungsmethoden sind dafür erste Vorraussetzung. Auch die<br />
Entwicklung wirtschaftlicher Anbaumodelle und die Verbesserung der Kulturtechnik<br />
müssen weiterhin forciert werden. Als wichtiges Medium für den Austausch von<br />
Erfahrungen, neuen Ideen und Erkenntnissen hat sich in den letzten Jahren die Bundes‐<br />
Wildfruchttagung etabliert. Sie wird im zweijährigen Rhythmus von der DLR Rheinpfalz<br />
in Bad Neuenahr‐Ahrweiler veranstaltet.<br />
Neben den vorgestellten Arten und Sorten sind viele weitere Wildfrüchte für den<br />
Erwerbsanbau und eine gewerbliche Verarbeitung denkbar. Zu nennen wären zum<br />
Beispiel Hagebutten, Scheinquitten, Kornelkirschen, Maulbeeren, Kirschpflaumen,<br />
3
Felsenbirnen, aber auch Weißdorn, Mahonie und Berberitze, die mit ebenfalls<br />
interessanten Inhaltsstoffen und ausgefallenen Aromen eine wertvolle Ergänzung im<br />
Wildobstsortiment darstellen. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, die in dieser<br />
Arbeit aufgezeigt wurden, lassen sich zweifellos durch weitere kreative Ideen, die<br />
Früchte kulinarisch oder anderweitig zu nutzen, ergänzen. Die Gehalte an Inhaltsstoffen<br />
sind im Allgemeinen abhängig von der Sorte, den Umweltbedingungen und dem<br />
Witterungsverlauf am Standort, sowie vom Reifezustand der Früchte und der Methode<br />
der Analyse. Daher sind nur ungefähre Vergleiche zwischen den einzelnen Fruchtarten<br />
anzustellen. Die Verarbeitung sollte möglichst rasch erfolgen, um den Abbauprozessen<br />
der Inhaltsstoffe zuvorzukommen. An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass die<br />
Gehaltsangaben in den Tabellen auf die Früchte bezogen sind. Bei der Verarbeitung<br />
ändern sich die Anteile erheblich, denn durch Erhitzen werden die pharmakologisch und<br />
ernährungsphysiologisch wertvollen Bestandteile unter Umständen gemindert oder gar<br />
zerstört.<br />
Wegen der eingeschränkten Absatzmöglichkeiten von Wildobst, ist ein großflächiger<br />
Anbau nur angebracht, wenn die Abnahme gesichert ist. Eine Risikominimierung bzw.<br />
‐verteilung kann durch Kooperationen erreicht werden. Der Eintritt in eine<br />
Erzeugerorganisation beispielsweise bringt dem Obstbauer Vorteile beim Bezug von<br />
Werbematerialien und gärtnerischen Bedarfsartikeln. Die gemeinschaftliche Benutzung<br />
von Betriebseinrichtungen und Maschinen führt zu einer besseren Auslastung und auch<br />
die Vermarktung lässt sich effizienter bewerkstelligen. Ebenso können sinnvolle<br />
Kulturkombinationen, z.B. Apfelbeere und Johannisbeere, zur Steigerung der<br />
Produktivität und Rentabilität, führen, da ihr Anbau dieselben Maschinen erfordert. Ist<br />
man bereits Produzent von Kern‐ und Steinobst, so ist es in der Regel unsinnig, über<br />
eine Sortimentserweiterung mit Wildobst nachzudenken. Zum einen aus Gründen der<br />
Wirtschaftlichkeit und Vermarktungsstrategie, zum anderen aus phytosanitären<br />
Aspekten, wie Steinobstvirosen und der Feuerbrandproblematik.<br />
Es bleibt zu hoffen, dass infolge einer intensiveren wissenschaftlichen und<br />
züchterischen Bearbeitung dieser seltenen Obstarten künftig ein rentabler Anbau<br />
möglich sein wird und für landwirtschaftliche Betriebe eine wirkliche Alternative<br />
4
darstellt. Mit neuen Erkenntnissen bezüglich der Anbau‐ und Erntetechnik könnte sich<br />
der Wildfruchtanbau durchaus zu einem ökonomisch interessanten Nischenbereich<br />
entwickeln. Durchdachte Vermarktungsstrategien und Kreativität entscheiden<br />
letztendlich über einen erfolgreichen Absatz. Die Intensität an Werbeaktivitäten ist<br />
jedoch auf das Absatzvolumen des Betriebes abzustimmen, d.h. Aufwand und Nutzen<br />
sollten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Firmen‐ und Hinweisschilder,<br />
Anzeigen oder Hof‐Broschüren mit begleitenden Sachinformationen und<br />
Rezeptvorschlägen zeigen große Wirkung und sind dennoch finanziell tragbar.<br />
Abschließend sei noch anzumerken, dass die Direktvermarktung landwirtschaftlicher<br />
Erzeugnisse an sich keine Nische mehr ist. Der Wettbewerb nimmt auch in diesem<br />
Bereich erheblich zu. Aufgrund des Trendcharakters und einer steigenden Nachfrage<br />
lässt der Wildfruchtanbau aber Spielraum für Neueinsteiger zu.<br />
5
Zusammenfassung<br />
Vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses für Wildfrüchte und deren<br />
Verarbeitungsprodukte, galt es, die Frage zu klären, inwieweit sich Wildobstgehölze für<br />
einen gewerblichen Anbau eignen. Am Beispiel von Holunder, Sanddorn, Apfelbeere,<br />
Schlehe, Mispel und Eberesche wurde detailliert auf die Ansprüche und nötigen<br />
Kulturmaßnahmen eingegangen. Umfassende Versuchsergebnisse dienten dabei als<br />
Basis für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung.<br />
Die Ausführungen zeigen, dass sich die meisten Wildobstarten als besonders<br />
widerstandsfähig erweisen. Hinsichtlich Standort und Pflege sind sie in der Regel als<br />
recht anspruchslos zu bewerten. Beim Vergleich der Sorten stellten sich enorme<br />
Unterschiede bezüglich der Anbauwürdigkeit heraus. Die guten Ertragseigenschaften<br />
gehen nicht immer mit hohen Gehalten an Inhaltsstoffen, Pflanzengesundheit oder mit<br />
geringen Anforderungen an das Ernteverfahren einher. Aufgrund dieser Tatsache ist<br />
eine individuelle, an die Standortbedingungen und den Verarbeitungszweck angepasste<br />
Auswahl erforderlich. Weiterhin wurde der gesundheitliche Wert der Inhaltsstoffe<br />
herausgestellt, die mannigfaltigen Verwendungs‐ und Verarbeitungsmöglichkeiten<br />
aufgezeigt und die Chancen für den Absatz erörtert. Dabei wurde die besondere Eignung<br />
eines direkten Vermarktungsweges unterstrichen.<br />
In der <strong>Schlussbetrachtung</strong> verdeutlicht der Verfasser noch einmal die Vorteile, die der<br />
Anbau von Wildobstkulturen mit sich bringt, zeigt aber auch Probleme auf, welche<br />
zukünftig einer intensiveren Auseinandersetzung bedürfen. Die Weiterentwicklung<br />
bereits bekannter Produktionsverfahren ist Grundlage für zufriedenstellende Erträge<br />
und ein erfolgreiches Betriebsergebnis.<br />
Die Tendenz zur gesundheitsbewussten Ernährung liefert weitreichende<br />
Absatzmöglichkeiten, so dass für diese Randkulturen ein nicht zu unterschätzendes<br />
Anbaupotential besteht.<br />
6