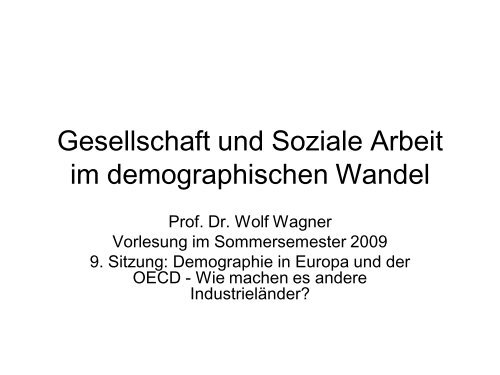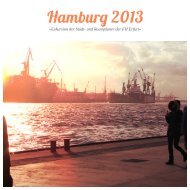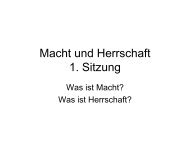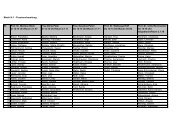Demographie Europas seit der Antike
Demographie Europas seit der Antike
Demographie Europas seit der Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gesellschaft und Soziale Arbeit<br />
im demographischen Wandel<br />
Prof. Dr. Wolf Wagner<br />
Vorlesung im Sommersemester 2009<br />
9. Sitzung: <strong>Demographie</strong> in Europa und <strong>der</strong><br />
OECD - Wie machen es an<strong>der</strong>e<br />
Industrielän<strong>der</strong>?
Klausurfragen<br />
• Hängt die ökonomische Entwicklung eines<br />
Landes von <strong>der</strong> demographischen Entwicklung<br />
ab? Nennen Sie Argumente dafür und dagegen<br />
und begründen Sie Ihre abschließende Antwort.<br />
• Was sind die Gründe dafür, dass sich Männer<br />
und Frauen in Deutschland bei <strong>der</strong> Frage des<br />
Kin<strong>der</strong>wunsches geradezu gegensätzlich<br />
verhalten, wenn man Einkommen und Bildung<br />
als Variable betrachtet. Gehen Sie dabei auf das<br />
Konzept <strong>der</strong> Opportunitätskosten ein.
Glie<strong>der</strong>ung<br />
• Ökonomie und Bevölkerung – ein<br />
Zusammenhang?<br />
• Was beeinflusst den Kin<strong>der</strong>wunsch?<br />
• Das generative Verhalten
Glie<strong>der</strong>ung<br />
• Ökonomie und Bevölkerung – ein<br />
Zusammenhang?<br />
• Was beeinflusst den Kin<strong>der</strong>wunsch?<br />
• Das generative Verhalten
Quelle<br />
• ADRIAN, Hermann (2005). Die demografische,<br />
wirtschaftliche und soziale Lage Deutschlands --<br />
Problemanalyse und Lösungswege --<br />
Wohlstandsverlust ist eine zwangsläufige Folge von<br />
35 Jahren Kin<strong>der</strong>mangel. Eine Steigerung <strong>der</strong><br />
Geburtenrate würde sofort eine positive Wendung<br />
bewirken. Powerpointpräsentation vom März 2005 im<br />
Netz veröffentlicht unter: http://www.unimainz.de/FB/Physik/AG_Adrian/adrian/adrian.htm<br />
• Zum Dowload freigegeben unter: http://www.unimainz.de/FB/Physik/AG_Adrian/adrian/cd/2-Lage.pdf<br />
• (Zugriff: 12.05.2009)
Entscheidende Frage: gibt es eine<br />
Korrelation zur Geburtenziffer und<br />
dem Wachstum?<br />
Beim Vergleich <strong>der</strong> Wachstumsraten von<br />
1999 und Fertility Rates von 2000 von 30<br />
Industriestaaten ergibt sich eine<br />
Korrelationskoffizient von r = 0,055<br />
Keine Korrelation – kein Zusammenhang
Geburtenüberschuss bzw. Defizit
Glie<strong>der</strong>ung<br />
• Ökonomie und Bevölkerung – ein<br />
Zusammenhang?<br />
• Was beeinflusst den Kin<strong>der</strong>wunsch?<br />
• Das generative Verhalten
Was heißt wählen?
Op por tu ni täts-<br />
kosten<br />
Von engl. „opportunity“, die Gelegenheit.<br />
Opportunitätskosten sind sozusagen die „Kosten“ einer verpassten<br />
Gelegenheit.<br />
„Kosten“ meint hier aber nicht Geld, son<strong>der</strong>n den entgangenen Nutzen
Unsere Aufgabe bei <strong>der</strong><br />
Entscheidung<br />
• Der durch die Entscheidung erreichte<br />
zusätzliche Nutzen soll immer größer sein<br />
als die Opportunitätskosten.<br />
Gibt es Fälle, in denen gar keine<br />
Opportunitätskosten auftreten?<br />
• Das ist immer dann <strong>der</strong> Fall, wenn gar<br />
keine Entscheidung nötig ist, da jede<br />
Alternative gewählt werden kann.
•Wir wollen<br />
Das Ziel<br />
– mit unseren knappen Mitteln Zeit und Geld<br />
– durch die Auswahl <strong>der</strong> besten Alternativen<br />
– den höchsten Nutzen erreichen.<br />
Die Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
• Fast alle Entscheidungen müssen unter Unsicherheit getroffen<br />
werden,<br />
das heißt, wir wissen zur Zeit <strong>der</strong> Entscheidung nicht, ob sie auch im<br />
Nachhinein richtig ist.<br />
• Was löst diese Unsicherheit bei uns aus?
Glie<strong>der</strong>ung<br />
• Ökonomie und Bevölkerung – ein<br />
Zusammenhang?<br />
• Was beeinflusst den Kin<strong>der</strong>wunsch?<br />
• Das generative Verhalten
Quelle<br />
• http://www.querellesnet.de/index.php/qn/article/view/529/537<br />
• Sind es die Männer und nicht die Frauen, die keine<br />
Kin<strong>der</strong> wollen? Ergebnisse aktueller quantitativer<br />
Forschung zum generativen Verhalten<br />
• Rezension von Lena Correll<br />
• Jan Eckhard, Thomas Klein:<br />
• Männer, Kin<strong>der</strong>wunsch und generatives Verhalten.<br />
• Eine Auswertung des Familiensurvey zu<br />
Geschlechterunterschieden in <strong>der</strong> Motivation zur<br />
Elternschaft.<br />
• Wiesbaden: VS 2006.<br />
• 193 Seiten, ISBN 978–3–531–15096–3, € 28,90
Design<br />
• Die quantitative Studie von Eckhard und Klein<br />
basiert auf Daten des Familiensurveys und<br />
wurde vom Bundesministerium für Familie,<br />
Senioren, Frauen und Jugend geför<strong>der</strong>t.<br />
• Fragestellung: Geschlechterdifferenzen beim<br />
Kin<strong>der</strong>wunsch und bei <strong>der</strong> Motivation zur<br />
Elternschaft.<br />
• Theorieansatz: Das Geburtenverhalten wird von<br />
den Autoren als Folge des „Zusammenwirkens<br />
von ‚inneren‘ Motivstrukturen und ‚äußeren‘<br />
Rahmenbedingungen“ (S. 9) analysiert.
Bisher kaum Thema: Männer und<br />
generatives Verhalten<br />
• Bei über 20 Jahre alten Männern etwa 33% kin<strong>der</strong>los,<br />
26% bei den Frauen (vgl. S. 23).<br />
• Jahrgänge 1935–40, <strong>der</strong>en reproduktive Phase als<br />
abgeschlossen angesehen werden kann, Frauen eine<br />
durchschnittliche Familiengröße von 2,21 Kin<strong>der</strong>n und<br />
für die Männer von 1,87.<br />
• Männer wünschen weniger häufig als Frauen ein erstes<br />
Kind (vgl. S. 9).<br />
• Der Wunsch nach eigenen Kin<strong>der</strong>n bei Männern häufiger<br />
erst vor dem Hintergrund einer konkreten<br />
Paarbeziehung,<br />
• bei Frauen auch „eher ‚abstrakt‘ existiert“ (S. 9).
Äußere Rahmenbedingungen – unterschiedliche<br />
Wirkungen auf Frauen und Männer<br />
• Kin<strong>der</strong>wunsch bei Arbeitslosigkeit sinkt bei Männern<br />
• bei Frauen eher steigend<br />
• Kin<strong>der</strong>wunsch und Wunsch zur Familienerweiterung bei<br />
Männern steigt mit <strong>der</strong> Höhe des Einkommens<br />
• Bei Frauen umgekehrt (vgl. S. 180).<br />
• Außerdem korreliert Höhe des Schulabschlusses „bei<br />
Frauen negativ, bei Männern hingegen positiv mit dem<br />
Wunsch nach einer Familiengründung“ (S. 179).<br />
• Effekte des Bildungsniveaus nur für den Wunsch nach<br />
dem ersten Kind relevant
Geschlechterrollen<br />
• 90% aller Frauen (Kin<strong>der</strong>lose und Mütter):<br />
eigene Kin<strong>der</strong> machen berufliche<br />
Einschränkungen notwendig.<br />
• Unabhängig von Bildungsabschluß<br />
• Bei Männern äußern sich Väter zu 45%<br />
bis 50% und Kin<strong>der</strong>lose zu etwa 65%<br />
entsprechend (vgl. S. 184).
Motive des Geburtenverhaltens<br />
• Wichtig für die Familiengründung nicht-instrumentelle Beweggründe<br />
– wie Erfüllung und Intensivierung des Lebens durch Kin<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
Freude an Kin<strong>der</strong>n und Sinnstiftung –,<br />
• Weniger wichtig während instrumentelle Beweggründe – wie <strong>der</strong><br />
Nutzen von Kin<strong>der</strong>n als Hilfe im Alter – weniger häufig als<br />
ausschlaggebend für den Kin<strong>der</strong>wunsch genannt werden (vgl. S.<br />
181).<br />
• Interessant ist, dass nicht-materielle Gründe auch von über 80% <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>losen benannt werden (vgl. S. 84).<br />
• Stark verbreitet ist bei den Hin<strong>der</strong>ungsgründen „die Wahrnehmung<br />
<strong>der</strong> finanziellen und <strong>der</strong> psychisch-emotionalen Belastungen sowie<br />
<strong>der</strong> beruflichen Opportunitätskosten für die Frauen.<br />
• Hingegen werden Belastungen für die Partnerschaft o<strong>der</strong> Probleme<br />
mit Kin<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Öffentlichkeit vergleichsweise selten erwartet und<br />
wahrgenommen“ (S. 180).
Verhaltensrelevanz<br />
• Anhand Längsschnittdaten von 1988 und 1994<br />
untersuchen die Autoren die Verhaltensrelevanz <strong>der</strong><br />
Motivationslagen:<br />
• immaterielle Beweggründe bedeutend (vgl. S. 180).<br />
Männer und Frauen, die psychisch-emotionale<br />
Belastungen erwarten, vergleichsweise seltener für ein<br />
erstes Kind (vgl. S. 184).<br />
• Erstaunlich ist, dass Eckhard/Klein „für die<br />
Wahrnehmung <strong>der</strong> Unvereinbarkeit von<br />
Berufskarriere und Familie keine Verhaltensrelevanz<br />
feststellen“ können (S. 185).<br />
• freizeitbezogenen Opportunitätskosten seltener<br />
gesehen, dann aber entscheidend – wenn gesehen,<br />
dass eigene Kin<strong>der</strong> zu wenig freie Zeit lassen.
Quelle
Quelle
Klausurfragen<br />
• Hängt die ökonomische Entwicklung eines<br />
Landes von <strong>der</strong> demographischen Entwicklung<br />
ab? Nennen Sie Argumente dafür und dagegen<br />
und begründen Sie Ihre abschließende Antwort.<br />
• Was sind die Gründe dafür, dass sich Männer<br />
und Frauen in Deutschland bei <strong>der</strong> Frage des<br />
Kin<strong>der</strong>wunsches geradezu gegensätzlich<br />
verhalten, wenn man Einkommen und Bildung<br />
als Variable betrachtet. Gehen Sie dabei auf das<br />
Konzept <strong>der</strong> Opportunitätskosten ein.