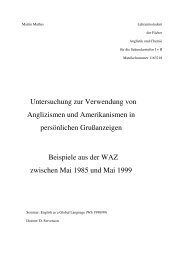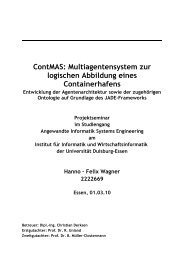Mitschrift Wipo II Übung WS 09/10
Mitschrift Wipo II Übung WS 09/10
Mitschrift Wipo II Übung WS 09/10
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Diese <strong>Mitschrift</strong> zur im <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong> von Dipl.-Ök. Gideon Schingen gehaltenen <strong>Übung</strong><br />
<strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> ist als Hilfestellung zur Klausurvorbereitung gedacht, erhebt aber trotz Bemühen<br />
meinerseits weder Anspruch auf Korrektheit noch Vollständigkeit. Das Copyright auf die<br />
eingefügten Grafiken liegt beim Lehrstuhl bzw. den jeweiligen Urhebern.<br />
Die in der <strong>Übung</strong> behandelten Themen basieren auf den Skripten <strong>Wipo</strong> I, S.70 bis Ende<br />
(ohne 90-91) und <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong>, S. 1-40 (ohne 27-34).<br />
14.12.20<strong>09</strong> 1. <strong>Übung</strong>: Die soziale Wohlfahrtsfunktion<br />
Bei der Aufstellung einer gesamtgesellschaftlichen (oder „sozialen“) Nutzenfunktion<br />
können die Probleme der (1.) kardinalen Messbarkeit des Nutzens, (2.) der<br />
interpersonellen Vergleichbarkeit und (3.) das Aggregationsproblem auftreten.<br />
Diskutieren Sie diese Probleme und ihre Konsequenzen. Gehen Sie beim<br />
Aggregationsproblem mit Hilfe einer geeigneten Graphik auch auf die Axiome der<br />
Transitivität und der Vollständigkeit einer Präferenzordnung ein.<br />
[SS 08, <strong>10</strong>0 P., 60 Min.] (Vorlesungsbeilage <strong>Wipo</strong> I, S. 78-83)<br />
Literatur:<br />
- Weimann (20<strong>09</strong>): Wirtschaftspolitik; Kapitel 5.3 und 5.5<br />
- H. Berg, D. Cassel, K. H. Hartwig (2007): „Soziale Wohlfahrt“, S. 285-288,<br />
„Condorcet-Paradox und zyklische Mehrheiten“; S. 290-291.<br />
- J. B. Donges, A. Freytag (2004): „Theoretische Ansätze zur Ermittlung einer sozialen<br />
Wohlfahrtsfunktion“, S. 75-86. [insbes. Arrow-Bed.]<br />
- M. Streit (2005): „Grundfragen gesellschaftlichen Wirtschaftens“, „Der<br />
wohlfahrtsökonomische Beantwortungsversuch“, „Grenzen des Lösungsversuchs“, S. 1-<br />
25.<br />
Wiederholung: Individuelle Präferenzordnung<br />
- In der ökonomischen Theorie wird davon ausgegangen, dass Individuen in der Lage<br />
sind, Alternativen (z.B. Güterbündel) nach ihrer Vorzugswürdigkeit zu reihen.<br />
- Sieht ein Individuum sich zwei verschiedenen Alternativen A und B gegenüber, so ist es<br />
in der Lage, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob:<br />
- A � B: A wird gegenüber B streng bevorzugt (strenge Bevorzugung)<br />
- A � B: B ist mindestens genauso gut wie A (schwache Bevorzugung)<br />
- A ~ B: A ist ebenso gut wie B (Indifferenz)<br />
- Üblicherweise werden dabei verschiedene Annahmen an die Präferenzen der Individuen<br />
gestellt. Von einer „Präferenzordnung“ ist die Rede, wenn die folgenden Axiome erfüllt<br />
sind:<br />
- Reflexivität: Jede Alternative ist mindestens so gut wie sie selbst A � A.<br />
Seite 1/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Vollständigkeit: Alle beliebigen Alternativen können miteinander verglichen werden:<br />
Für zwei Alternativen A und B gilt entweder : A � B, oder A � B, oder beides<br />
(Indifferenz A ~ B).<br />
- Transitivität:<br />
Ist A für ein Individuum mindestens so gut wie B, und B mindestens so gut wie C, dann<br />
muss auch A mindestens so gut wie C sein.<br />
Wenn gilt A � B und B � C, so gilt auch A � C.<br />
→ Den individuellen Präferenzordnungen werden durch eine Nutzenfunktion<br />
Nutzenwerte zugemessen. Je höher der Nutzenwert, desto mehr Nutzen stiftet die<br />
Alternative, bzw. desto beliebter ist sie.<br />
Kollektive Ebene: Das Konzept der sozialen Wohlfahrtsfunktion<br />
- Größere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn die individuellen Nutzen über eine<br />
„Soziale Wohlfahrtsfunktion“ (SWF) zu einer einzigen Größe, der „Sozialen Wohlfahrt“,<br />
aggregiert werden sollen.<br />
→ Diese Schwierigkeiten sind Gegenstand der Klausuraufgabe.<br />
- Wofür benötigen wir eine SWF?<br />
- Aufgabe der Träger der <strong>Wipo</strong> ist die Maximierung der gesellschaftl. Wohlfahrt unter<br />
Nebenbedingungen. Dazu ist eine Definition gesellschaftl. Wohlfahrt notwendig, sowie<br />
die Festlegung von Messverfahren zu deren Bestimmung.<br />
→ Aggregation aller individueller Nutzen zu einem Wert, den die Entscheidungsträger<br />
zu maximieren bzw. erhöhen suchen.<br />
- Graphische Darstellung in Form einer sozialen Indifferenzkurve (s.u.):<br />
Geometrischer Ort von Nutzenkombinationen, welche der Gesellschaft den gleichen<br />
Nutzen stiften.<br />
- Ermöglicht die Identifikation eines Wohlfahrtsmaximums (Optimum Optimorum).<br />
- Tangentialpunkt einer sozialen Indifferenzkurve mit der Transformationskurve.<br />
- Dort lässt sich die soziale Wohlfahrt allokativ und durch Umverteilung nicht mehr<br />
verbessern. Der Punkt ist effizient.<br />
- Damit die SWF sich als politische Entscheidungshilfe eignet, bedarf es einer<br />
werturteilsgebundenen Spezifizierung des verwendeten Aggregationsverfahrens.<br />
- Gesucht wird ein Entscheidungsverfahren, welches die konsistente Zusammenfassung<br />
jeder gegebenen Menge individueller Präferenzstrukturen ermöglicht.<br />
- Dabei wird die Existenz eines (holistischen) gesellschaftl. Willens verneint.<br />
- Dem demokratischen Prinzip entsprechend können Abstimmungsverfahren zur<br />
Präferenzoffenbarung und -aggregation zum Einsatz kommen.<br />
Seite 2/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Legende (Graphik aus WiPo_2_UEbung_1_<strong>WS</strong>_<strong>09</strong><strong>10</strong>.pdf, S.7):<br />
2 Güter x und y<br />
Wohlstandsgrenze Y1 X1<br />
Soziale (gesellsch.) Indifferenzkurven I1, I2, I3<br />
Optimum Optimorum(Tangentialpunkt) B<br />
Bezeichnung allokativer aber nicht sozial-optimaler Punkte C, F, D<br />
Transformationskurve T<br />
(Vom Ursprung) Pareto-optimale Güterkombinationen alle Punkte auf T (z. B.:<br />
C,B,F,D)<br />
E ist weder Pareto-optimal, noch sozial erwünscht E<br />
- Beispiel für die Axiome einer Präferenzordnung:<br />
- Vollständigkeit (für alle Paare): E � F, oder E � F, oder E ~ F<br />
- Transitivität: Wenn F � E und B � F, dann gilt B � E<br />
Probleme beim Aufstellen der SWF<br />
- Im Folgenden soll beleuchtet werden, warum das Aufstellen einer SWF unmöglich ist.<br />
Hierzu betrachten wir folgende Punkte:<br />
1. Kardinaler Nutzen<br />
2. Interpersonelle Vergleichbarkeit des Nutzens<br />
3. Das Condorcet-Paradox (Aggregationsproblem)<br />
4. Arrows Unmöglichkeitstheorem<br />
Probleme beim Aufstellen der SWF: 1. Kardinaler Nutzen<br />
- Wäre eine kardinale Messbarkeit des Nutzen möglich, so könnte dem Abstand zwischen<br />
verschiedenen Nutzenniveaus eine Bedeutung zugemessen werden.<br />
- Individuen sind in der Regel nur in der Lage, verschiedene Alternativen nach ihren<br />
Seite 3/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Präferenzen zu sortieren (Rangfolgeskala). Eine sinnvolle Interpretation der<br />
Nutzendifferenz ist dem Individuum daher nicht möglich bzw. die Differenz ist sogar<br />
unbekannt.<br />
→ Nutzen ist nur ordinal fassbar.<br />
Probleme beim Aufstellen der SWF: 2. Interpersonelle Vergleichbarkeit des Nutzens<br />
- Soll eine SWF aufgestellt werden, die den Nutzen aller Gesellschaftsmitglieder<br />
berücksichtigt, so müssen die individuellen Nutzen interpersonell vergleichbar sein.<br />
→ Voraussetzung für die Aggregation individueller Präferenzen<br />
- Es existiert kein objektiver Maßstab anhand dessen die individuellen Nutzen<br />
miteinander verglichen werden können (Bsp.: Urmeter). Auch wenn der Nutzen<br />
individuell kardinal messbar wäre, könnte nicht unbedingt ein interpersoneller<br />
Vergleich stattfinden. (weitere Annahmen nötig! Stichwort: Skalierung)<br />
→ Interpersonelle Unvergleichbarkeit<br />
- Der Nutzen für ein Gut betrage für A 5 NE und für B <strong>10</strong>00 NE. Wegen des fehlenden<br />
objektiven Maßstabs lässt sich dennoch nicht sagen, was mehr ist.<br />
- Nur für den (trivialen) Fall identischer Präferenzen möglich<br />
Probleme beim Aufstellen der SWF: 3. Das Condorcet-Paradox<br />
- Transitivität fordert, dass es bei paarweisen Abstimmungen zwischen Alternativen nicht<br />
zu Abstimmungszyklen kommt<br />
- Dieses Axiom ist leicht zu akzeptieren, wenn<br />
- entweder nur eine Person entscheidet<br />
- oder nur zwei Alternativen zur Auswahl stehen<br />
- Was aber, wenn eine Gruppe von Individuen über mehr als zwei Alternativen abstimmt?<br />
- Soll das Mehrheitsprinzip angewendet werden, so kommen verschiedene Wahlverfahren<br />
in Frage:<br />
- Pluratitätswahl → nicht hier<br />
- Paarweise Abstimmungen<br />
Probleme beim Aufstellen der SWF: 3. Das Condorcet-Paradox - Ein Beispiel<br />
- Kollektive Abstimmung über Müllentleerung<br />
- A: Leerung wöchentlich 40,- pro Monat<br />
- B: Leerung alle 2 Wochen 20,- pro Monat<br />
- C: Leerung einmal im Monat <strong>10</strong>,- pro Monat<br />
- Präferenzen der Wähler bzgl. Müllabfuhr:<br />
- I. A � B � C: „Der Reinliche“<br />
Seite 4/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
- <strong>II</strong>. C � A � B: „Der Kompostierer“<br />
- <strong>II</strong>I. B � C � A: „Die Schottennase“<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Bestimmung der kollektiven Präferenzen durch paarweisen Vergleich<br />
- 1. Abstimmung A vs B: Ergebnis A � B (2:1)<br />
- 2. Abstimmung B vs C: Egebnis B � C (2:1)<br />
- Damit das Axiom der Transitivität erfüllt ist, müsste auch gelten: A � C<br />
→ Das ist hier aber nicht der Fall, denn:<br />
- 3. Kontrollabstimmung A vs C: Ergebnis C � A (2:1)<br />
- Es entsteht ein Zyklus A � B � C � A...<br />
→ Diese SWF ist nicht transitiv, sie enthält einen logischen Widerspruch!<br />
- Dieses Aggregationsproblem bei kollektiven Entscheidungen ist als „Condorcet-Paradox“<br />
bekannt geworden.<br />
- Probleme bei Nichterfüllung des Transitivitätspostulates:<br />
- Aufkommen zyklischer Mehrheiten:<br />
Verlauf des Zyklus ist davon abhängig, in welcher Reihenfolge über die Alternativen<br />
abgestimmt wird<br />
- Möglichkeit des „agenda setting“:<br />
Mit der Wahl einer bestimmten Abstimmungsreihenfolge und vorgegebener Anzahl<br />
von Wahlvorgängen, kann das Ergebnis vorweggenommen werden, insbesondere<br />
dann, wenn auf eine Kontrollabstimmung verzichtet wird.<br />
→ Um zyklische Mehrheiten zu vermeiden, braucht man die zusätzliche Annahme der<br />
„eingipfeligen Präferenzen“.<br />
Probleme beim Aufstellen der SWF: 4. Arrows Unmöglichkeitstheorem<br />
- Arrow ging bei der Suche nach der SWF einen formaleren Weg.<br />
- Das dabei entwickelte Theorem (auch: Arrow-Paradoxon) ist von fundamentaler<br />
Bedeutung und Grundlage für die gesamte Social-Choice-Theorie.<br />
- Der Beweis des untenstehenden Theorems ist relativ kompliziert. Eine gute verbale<br />
Aufarbeitung bietet Weimann (20<strong>09</strong>), S. 206 ff<br />
- Zunächst formuliert Arrow einen normativen Forderungskatalog an die SWF:<br />
1.Paretoeffizienz<br />
Existiert eine Alternative, die von allen Individuen vorgezogen wird, dann soll die<br />
soziale Ordnung diese Alternative bevorzugen.<br />
Seite 5/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
2.Ausschluss von Diktatur<br />
Es soll kein Individuum existieren, dessen individuelle Präferenzordnung immer, ganz<br />
gleich wie die Präferenzen der anderen Gesellschaftsmitglieder aussehen, identisch<br />
mit der sozialen Ordnung ist.<br />
3.Transitivität (keine Zyklen)<br />
Die soziale Ordnung soll transitiv über die Alternativen sein.<br />
4. Unrestricted Domain<br />
Alle möglichen individuellen Präferenzordnungen über die Alternativen sind auch<br />
zugelassen.<br />
5.Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen<br />
Die gesellschaftl. Präferenz bzgl. zweier Alternativen darf nur von den individuellen<br />
Ordnungen zwischen diesen beiden Alternativen abhängen, nicht jedoch von der<br />
Position einer dritten Alternative.<br />
→ Satz:Jede SWF, die den Axiomen der „Paretoeffizienz“, „Transitivität“,<br />
„Unrestricted Domain“ und „Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen“ genügt, ist<br />
diktatorisch!<br />
Wir können nicht alle Axiome gleichzeitig erfüllen.<br />
4. Arrows Unmöglichkeitstheorem: Fazit<br />
- Es existiert keine SWF, die alle geforderten Axiome gleichzeitig erfüllt.<br />
→ Auf welches Axiom verzichtet werden soll, ist ein individuelles Werturteil<br />
- Arrow zerstört mit seinem Theorem die Illusion, ein ideales Verfahren finden zu können.<br />
- Kollektive Entscheidungen müssen getroffen werden, Arrow zeigt aber, dass wir sie<br />
niemals in idealer Weise treffen können.<br />
→ Kein Königsweg<br />
- Welche Abstriche bei der SWF in Kauf genommen werden müssen, ist eine Frage der<br />
Gewichtung der einzelnen Axiome.<br />
Fazit<br />
- Fazit insgesamt:<br />
1. Kardinale Messbarkeit des Nutzens möglich?<br />
Nicht möglich, da lediglich eine Reihung der Alternativen vorgenommen werden kann.<br />
2. Interpersonelle Vergleichbarkeit des Nutzens?<br />
Da kein interpersoneller Maßstab existiert, ist interpersonelle Vergleichbarkeit auch<br />
dann nicht möglich, wenn jeder Alternative ein individueller Nutzenwert zugemessen<br />
werden könnte. (Kein „Ur-Meter“)<br />
Seite 6/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
3. Condorcet Paradox (Aggregationsproblem)<br />
Transitivität kann bei Kollektiventscheidungen über mehrere Alternativen nicht<br />
gewährleistet werden.<br />
→ Präferenzaggregation kann Zyklen erzeugen.<br />
4. Arrows Unmöglichkeitstheorem<br />
- Kein ideales Verfahren zur Präferenzaggregation, das alle 5 Axiome von Arrow<br />
erfüllt.<br />
- Scheitern des Wohlfahrtsökonomischen Ansatzes:<br />
Das Ziel „gesellschaftl. Wohlfahrt“ zu bestimmen, ist nicht möglich, da individuelle<br />
Präferenzen nicht konsistent zu einer gesellschaftl. Nutzenfunktion aggregiert werden<br />
können.<br />
- Bescheidenheit im pragmatischen Ansatz:<br />
Beschränkung auf gesellschaftl. Grundwerte, über die „weitestgehend“ Konsens<br />
herrscht, die als „letzte Ziele“ angesehen werden.<br />
21.12.20<strong>09</strong> 2. <strong>Übung</strong><br />
Stellen Sie den Inhalt des Freiheits- und des Gerechtigkeitszieles dar. Wie können<br />
diese Ziele operationalisiert werden? [<strong>WS</strong> 05/06, WIWI DPO 95, 36 Min.]<br />
(Vorlesungsbeilage <strong>Wipo</strong>I, S. 84-89, falls Grafik gefragt, dann die von S. 84)<br />
Literatur<br />
- H. Berg, D. Cassel, K. H. Hartwig (2007): „Gesellschaftliche Grundwerte und<br />
wirtschaftspolitische Einzelziele“, S. 3<strong>10</strong>-316.<br />
- J. B. Donges, A. Freytag (2004): „Ziele und Methoden der Wirtschaftspolitik“, „Ziele der<br />
Wirtschaftspolitik“ und „Zielbeziehungen“, S. 1-22.<br />
- M. Streit (2005): „Gesellschaftliche Grundwerte Freiheit und Gerechtigkeit“, S. 237-256.<br />
Einleitung<br />
- Unterstelltes Ziel: Wohlfahrtsmaximierung<br />
- Auslöser eines wirtschaftspolitischen Mitteleinsatzes ist eine als korrekturbedürftig<br />
empfundene Abweichung der Realität von einem erwünschten sozioökonomischen<br />
Zustand.<br />
- Scheitern des wohlfahrtsökonomischen Ansatzes.<br />
→ siehe <strong>Übung</strong> 1<br />
- Daher: Formulierung allgemein anerkannter gesellschaftlicher Grundwerte, die als „letzte<br />
Ziele“ angesehen werden.<br />
- In westlichen Industriegesellschaften:<br />
- Freiheit ← hier besprochen<br />
- Gerechtigkeit ← hier besprochen<br />
Seite 7/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
- Sicherheit<br />
- Fortschritt<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Die Ziele sind nicht naturgegeben oder ableitbar.<br />
- Die Bestimmung dessen, was als wünschenswert bezeichnet wird, unterliegt einer<br />
normativen Entscheidung. Diese muss von der Mehrheit der Gesellschaft (zumindest)<br />
hingenommen werden, um Konflikte in der Gesellschaft zu vermeiden.<br />
→ Ziele und Gewichtung sind Werturteile, also normativ!<br />
- Im Rahmen dieser Veranstaltung ist keine erschöpfende Behandlung der<br />
Bedeutungsvielfalt aller Ziele möglich.<br />
- Um die Erreichung gesellschaftlicher Ziele einer (ökonomischen) Analyse zugänglich zu<br />
machen, ist es erforderlich,<br />
- sich auf Teilaspekte der Ziele (z.B. Wohlstand) zu „spezialisieren“<br />
- Ziele operational zu formulieren, d.h. sie beobachtbar und messbar zu machen.<br />
→ Voraussetzung für Erfolgskontrolle und Lernen<br />
- Zielgerichtetes Handeln erfordert Lenkungswissen<br />
Das Freiheitsziel (individuelle Perspektive)<br />
- Willensfreiheit:<br />
Verneinung der Vorherbestimmtheit menschlichen Handelns und Fähigkeit zu sittlichem<br />
Handeln → Der Mensch ist frei zu wollen! (Bertrand Russell)<br />
- (Handlungs-) Freiheit:<br />
Abwesenheit von Hindernissen, die einer Realisierung eigener Wünsche<br />
entgegenstehen<br />
- Kann der Mensch auch, was er will?<br />
- Bedeutet, dass Menschen ihre Chancen frei und eigenverantwortlich wahrnehmen<br />
können<br />
- Ansatzpunkt für Umverteilungspolitik<br />
- Diskussion möglicher Realisierungsbeschränkungen des Wollens / Hindernisse der<br />
Handlungsfreiheit:<br />
- Objektive Grenzen<br />
- Naturgesetze (physikalisch, technische Grenzen)<br />
- Konkurrenz individueller Wünsche angesichts allgegenwärtiger Knappheit<br />
- Subjektive Grenzen<br />
- Physische und psychische Grenzen (Moral, Einkommen, etc.)<br />
- Informationsprobleme<br />
- Gesellschaftliche Grenzen<br />
- Recht, Sitten und Gebräuche mit externen Sanktionsmechanismen<br />
Seite 8/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Das Freiheitsziel (gesellschaftliche Perspektive)<br />
- Das Freiheitsziel hat so viele Ausprägungen wie die Gesellschaft selbst.<br />
→ Hier nur Aspekte politischer & wirtschaftlicher Freiheit<br />
- Konflikte<br />
- Entstehen bei der Ausübung individueller Handlungsfreiheit durch Rivalität bei der<br />
Wahrnehmung von Handlungschancen<br />
- Einschränkung individueller Freiheitsgrade zur Erlangung gesellschaftlicher Freiheit.<br />
- Betrachtung einer Extremposition: Alle Individuen beanspruchen für sich totale<br />
Handlungsfreiheit (Hobbes'scher Dschungel).<br />
- Erforderlich ist die Einschränkung individueller Freiheitsgrade.<br />
→ Begrenzung eigener Freiheit, dadurch aber Schutz vor Ausübung totaler<br />
Handlungsfreiheit Dritter (Paradox der Freiheit)<br />
Operationalisierung individueller Handlungsfreiheit<br />
- Wie kann individuelle Handlungsfreiheit sichergestellt werden?<br />
→ Operationalisierung<br />
- Konfliktregelung nach vorheriger Übereinkunft (Einrichtung des Kollektivgutes<br />
Rechtssystem)<br />
- Formaler Freiheitsaspekt (formales Recht): Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz vor<br />
staatl. Willkür und vor Ausübung privaten Zwanges.<br />
- Es muss für eine unbekannte Anzahl von Personen und Fällen gleichermaßen<br />
gelten.<br />
- Konfliktvorbeugung: Festlegung von Persönlichkeits- und Eigentumsrechten, die<br />
ökonomischen Handlungsrechte.<br />
- Materieller Freiheitsaspekt<br />
- Gesellschaftsmitglieder müssen in der Lage sein, die formale Freiheit nutzen zu<br />
können. Bei Ausübung der formalen Handlungsfreiheit kann jedoch ein Machtproblem<br />
bestehen.<br />
- Wirtschaftliche Freiheit und marktwirtschaftliche Ordnung<br />
- Ein Regelsystem, welches die Verwirklichung wirtschaftlicher Freiheit zum Ziel hat,<br />
setzt auf:<br />
- Die Selbstkoordination eigenverantwortlicher Wirtschaftssubjekte durch<br />
Markttransaktionen (Menschen wissen, was sie wollen und versuchen, ihre Ziele zu<br />
erreichen)<br />
- Die Selbstkontrolle unter dem Druck wirksamen Wettbewerbs mit anpassungs- und<br />
entwicklungsfördernden sowie machtbegrenzenden Folgen.<br />
- Zentrale Aufgabe des Staates bei Gewährleistung wirtschaftlicher Freiheit ist die<br />
Wahrnehmung seiner Ordnungsmacht<br />
→ Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Selbststeuerung.<br />
Seite 9/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Gewährleistung von Privatautonomie<br />
- Anerkennung von Privateigentum<br />
- Konsumenten- und Produzentensouveränität<br />
- Schutz vor Missbrauch von Privatautonomie<br />
- Sicherung des Wettbewerbs<br />
- Kontrolle wirtschaftlicher Macht<br />
- Schutz vor unangemessener Machtausübung<br />
- Schutz des Einzelnen vor „unangemessener“ Machtausübung durch Dritte als<br />
Staatsaufgabe<br />
- Macht/Zwang:<br />
- Entsteht in Tauschbeziehungen durch das Fehlen von Ausweichmöglichkeiten oder<br />
echter Alternativen (Nachfragemonopol).<br />
- Persönlichkeitsmacht<br />
- Besitzmacht<br />
- Organisationsmacht<br />
- Probleme wirtschaftlicher Macht und die Behandlung in der Wettbewerbspolitik<br />
- Die Bestimmung dessen, was als unangemessen gelten soll, ist u.a. abhängig von<br />
den Ursachen der entstandenen Macht, z.B..:<br />
- Überfall/Erpressung: „Geld oder Leben!“<br />
→ unangemessene Ausübung von Persönlichkeitsmacht<br />
- Monopolmacht: Vereinnahmung von Pioniergewinnen, Verdrängung von<br />
Konkurrenten durch Ausnutzung von Größenvorteilen in der Produktion<br />
→ angemessene Ausübung von Besitzmacht<br />
- Monopolmacht: Aufbau von Marktzutrittsbeschränkungen;<br />
Beschädigungswettbewerb<br />
→ unangemessene Organisationsmacht<br />
- Kriterium: Leistungsbezogenes vs. nicht leistungsbezogenes Einkommen<br />
Gerechtigkeit<br />
- Es gibt wohl kaum eine Norm, die so viele Emotionen, Kontroversen und<br />
gesellschaftliche Konflikte auslösen kann wie die Gerechtigkeit.<br />
- Warum wird nach (mehr) Gerechtigkeit gestrebt?<br />
- Bewertende Vergleiche von tatsächlichen oder vermuteten Lebenslagen anhand<br />
unterschiedlicher Kriterien wie Einkommen, Konsumniveau, Bedürftigkeit,<br />
gesellschaftlicher Stellung.<br />
- Meist nicht näher konkretisierte Vorstellung der Gleichheit von Menschen einer<br />
Gesellschaft.<br />
- Überwiegend statische Betrachtung; Denken in gesellschaftl. wünschenswerten<br />
Endzuständen (vs. dynamische Realität)<br />
- Geht von Gestaltbarkeit der Gesellschaft aus: Glück, Geschick sowie Vor- oder<br />
Nachteile die aus den Lebensumständen erwachsen, werden nicht akzeptiert.<br />
Seite <strong>10</strong>/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Scheint als Ziel aufgrund wahrgenommener Abweichungen leicht fassbar, die konkrete<br />
Umsetzung (Operationalisierung) entzieht sich einem leichten Zugang!<br />
Prozedurale Gerechtigkeit<br />
- Prozedurale (auch: formale) Gerechtigkeit :<br />
→ Prinzip der Gleichbehandlung<br />
- Wie muss das Recht beschaffen sein, damit es von den Gesellschaftsmitgliedern als<br />
gerecht empfunden wird?<br />
- Gleiche Verteilung der Vorteile und Lasten der Staatsbürgerschaft.<br />
- Gleiche Behandlung durch ein für alle gleiches Recht und unparteiische<br />
Rechtsprechung.<br />
- Besonders: Keine Diskriminierung nach leistungsfremden Merkmalen. (z.B. Rasse,<br />
Herkunft, Geschlecht)<br />
- Sicherstellung gleicher rechtlicher Möglichkeiten und Grenzen für<br />
eigenverantwortliches Handeln aller Gesellschaftsmitglieder.<br />
Verteilungsgerechtigkeit<br />
- Verteilungsgerechtigkeit:<br />
→ Angleichung der Einkommens- und Vermögenspositionen<br />
- In einer Privatrechtsgesellschaft zeigen die einem Marktteilnehmer zufließenden<br />
Einkommen diesem, mit wie viel Geschick und Glück er im marktwirtschaftlichen Suchund<br />
Entdeckungsprozess die ihm zur Verfügung stehenden Mittel genutzt hat. Sein<br />
Einkommen wird dabei von den Markthandlungen einer Vielzahl ihm meist<br />
unbekannten Personen mitbestimmt, die ihrerseits knappe Mittel zur<br />
Einkommenserzielung einsetzen. Alle entstandenen Einkommen sind Teilergebnisse<br />
einer Handelsordnung, die permanent unter dynamischen Bedingungen neu erzeugt<br />
werden<br />
- Verteilungsgerechtigkeit (Teil 2):<br />
- Welche (Güter-, Positions-) Verteilung wird von den Gesellschaftsmitgliedern als<br />
gerecht betrachtet?<br />
- Statische Sichtweise innerhalb eines dynamischen Systems - die erzielten Einkommen<br />
stellen nur Zwischenergebnisse, keine Endzustände dar.<br />
- Wird eine durch regelgerechtes Verhalten erzielte Einkommensverteilung als<br />
ungerecht bezeichnet, impliziert dies, dass vom Prinzip der Gleichverteilung<br />
abgewichen werden muss.<br />
- Die Verwendung eines Bedarfskriteriums setzt die Diskriminierung der<br />
Marktteilnehmer nach anderen, leistungsfremden Kriterien voraus. Somit verstößt es<br />
gegen das Prinzip der Gleichbehandlung der formalen Gerechtigkeit.<br />
→ Konflikt mit Gleichbehandlungsgrundsatz und Zielkonkurrenz mit dem Freiheitsziel!<br />
Operationalisierung: Bestimmung materieller Gerechtigkeit<br />
- Wie soll gerecht entlohnt werden?<br />
Seite 11/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Persönliches Verdienst (Leistungsgerechtigkeit)<br />
- Faktorentlohnung nach Arbeitsinput/-intensität<br />
- Faktorentlohnung nach Arbeitsoutput<br />
→ Probleme: Kaum ermittelbar (Stichwort: Teamproduktion)<br />
Also: Entlohnung nach dem Wertgrenzprodukt.<br />
- Ist eine Entlohnung nach dem Wertgrenzprodukt nicht möglich, so kommt eine<br />
Verteilung nach individuellem Bedarf in Betracht<br />
- Individueller Bedarf (Verteilungsgerechtigkeit)<br />
- Zuweisung von Gütern nach Bedürfnissen<br />
- Angewendet, wenn Marktbewertung der Arbeit ausscheidet (Erwerbsunfähigkeit)<br />
- Probleme<br />
- Fremdbestimmung der eigenen Versorgungslage setzt interpersonelle<br />
Nutzenvergleichbarkeit voraus (siehe hierzu <strong>Übung</strong> 1)<br />
- Begünstigung des Moral Hazard (Abschwächung privater Vorsorge, fahrlässige<br />
Herbeiführung des Versorgungsfalles)<br />
Operationalisierung des Gerechtigkeitsziels und Zielkonflikte<br />
- Zum Konflikt zwischen Freiheit und sozialer Gerechtigkeit<br />
- Das Ausmaß wirtschaftlicher Initiative hängt unmittelbar von den damit verbundenen<br />
Gewinnerwartungen ab. Je größer der für Umverteilungszwecke vorgesehene Anteil<br />
des Einkommens ist, desto geringer fällt die Leistungsbereitschaft aus. Dies führt zu<br />
einem geringeren Produktionswert und zu einer Verkleinerung der<br />
Umverteilungsbasis.<br />
- Kompromiss: Versuch, einen optimalen Trade-off zu erreichen; Synthese von<br />
Wettbewerbsprinzip und individueller Freiheit mit sozialer Gerechtigkeit und Verteilung<br />
(soziale Marktwirtschaft); Urheber-, Patentrecht.<br />
Der Kompromissversuch in der sozialen Marktwirtschaft am Beispiel des Steuertarifs<br />
- Bsp.: Gerechtigkeit in der Steuerpolitik<br />
- Grundlage: Leistungsfähigkeitsprinzip<br />
- Instrument: Verwendung eines Progressionstarifs in der Einkommensteuer<br />
- Gerechtigkeitsmerkmale<br />
- Gleichbehandlung von Individuen gleicher Leistungsfähigkeit; d.h. keine<br />
Diskriminierung (horizontale Gerechtigkeit)<br />
- Relativ stärkere Besteuerung von Individuen mit höherer Leistungsfähigkeit (vertikale<br />
Gerechtigkeit);<br />
- Achtung: Begriff der Leistungsfähigkeit ist normativ und daher ein Werturteil<br />
Seite 12/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Untersuchen Sie die vertikalen und horizontalen Beziehungen, welche zwischen<br />
wirtschaftspolitischen Zielen bestehen können. Greifen Sie bei Ihrer Argumentation<br />
auf geeignete Schaubilder zurück, und verwenden Sie passende Beispiele.<br />
[SS <strong>09</strong>, <strong>10</strong>0 P., 60 Min.] Vorlesungsbeilage <strong>Wipo</strong> I, S. 92-97<br />
Literatur<br />
- H. Berg, D. Cassel, K. H. Hartwig (2007): „Zielbeziehungen“, S. 313-314.<br />
- J. B. Donges, A. Freytag (2004): „Ziele und Methoden der Wirtschaftspolitik“, „Ziele der<br />
Wirtschaftspolitik“ und „Zielbeziehungen“, S. 1-22.<br />
- M. Streit (2005): „Zielbeziehungen“, S. 278-282.<br />
Einleitung<br />
- Unterstelltes Ziel wirtschaftspolitischer Entscheidungsträger: Erhöhung der Wohlfahrt in<br />
einer Gesellschaft<br />
- Aber: Scheitern des wohlfahrtsökonomischen Ansatzes (siehe <strong>Übung</strong> 1)<br />
- Daher: Formulierung allgemein anerkannter gesellschaftlicher Grundwerte<br />
→ „letzte Ziele“ (siehe <strong>Übung</strong> 2)<br />
- Zwecks (ökonomischer) Bewertung ist es erforderlich:<br />
- Ziele operational (d.h. beobachtbar oder messbar) zu formulieren<br />
- sich auf Teilaspekte der Ziele zu beschränken (z.B. materieller Wohlstand).<br />
- Als praktische wirtschaftspolitische Ziele gelten in den meisten Industrieländern:<br />
- Wirtschaftswachstum<br />
- ein hoher Beschäftigungsstand<br />
- Preisniveaustabilität<br />
- ein außenwirtschaftl. Gleichgewicht, gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung<br />
- Die Realisierung wirtschaftspolitischer Ziele macht den Einsatz wirtschaftspolitischer<br />
Mittel (Instrumente) erforderlich.<br />
- Beim Einsatz der Instrumente müssen Zielbeziehungen beachtet werden, d.h. diejenigen<br />
Auswirkungen, die der Einsatz eines wirtschaftspolitischen Instuments für andere Ziele<br />
als das angestrebte mit sich bringt.<br />
- Zielbeziehungen können vertikaler und horizontaler Art sein<br />
→ Gegenstand der Klausuraufgabe!<br />
Seite 13/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
Vertikale Zielbeziehungen<br />
- Vertikale Zielbeziehungen:<br />
- Bei Zielen unterschiedlicher Ebenen<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Vertikale Zielbeziehungen sind möglich, wenn:<br />
- Mittel Zielcharakter haben<br />
→ Eigenwert des Mittels<br />
- Ziele Mittelcharakter haben<br />
→ Ziele können nach übergeordneten Zielen hinterfragt werden<br />
- Wirtschaftspolitische Mittel zur Zielerreichung wirken nicht ausschließlich in<br />
beabsichtigter Art und Weise.<br />
- Mittel können (un-)erwünschte Folge- und Nebenwirkungen auf andere Ziele haben.<br />
- Bsp.: Im Hinblick auf gesellschaftliche Grundwerte haben wirtschaftspolitische Ziele<br />
Mittelcharakter.<br />
→ Daher: Aufbau einer konsistenten Zielpyramide und Formulierung von Kriterien zum<br />
Einsatz wirtschaftspolitischer Mittel.<br />
- Beispiel für vertikale Zielbeziehungen<br />
- Ziel-Mittel-Beziehung: Ziele sind zugleich Mittel der jeweils übergeordneten Ziele<br />
(Zielhierarchie)<br />
- Oberstes Ziel: Gemeinwohl (gesellschaftl. Wohlfahrt)<br />
- Zwischenziel/Mittel: gesellschaftl. Grundwerte: Freiheit, Gerechtigkeit, ...<br />
- Zwischenziel/Mittel: ökonomischer Wohlstand<br />
- Zwischenziel/Mittel: freier Leistungswettbewerb<br />
- Zwischenziel/Mittel: Begrenzung des Konzentrationsgrades<br />
- wettbewerbspol. Instrumente: Kartellverbot, Fusionskontrolle<br />
- Beispiel für den Eigenwert von Mitteln<br />
- Freihandel und Wettbewerb sind Mittel zur Erreichung ökonomischen Wohlstands. Die<br />
damit verbundenen freien Entscheidungsspielräume stellen jedoch zugleich einen<br />
Wert im Sinne des Freiheitsziels dar. Stehen unterschiedliche Mittel zur Auswahl,<br />
muss dieser „Eigenwert des Mittels“ beachtet werden.<br />
- Beispiel für Nebenwirkungen auf andere Ziele: siehe horizontale Zielbeziehungen<br />
Horizontale Zielbeziehungen<br />
- Beziehungen zwischen Zielen auf (annähernd) gleicher Ebene (Bsp.: Genannte<br />
wirtschaftspolitische Ziele, siehe Folie 4)<br />
- Logische horizontale Zielbeziehungen<br />
- Setzen bei inhaltlicher Beschreibung der Ziele an<br />
- Können mehrere Ziele überhaupt zugleich angestrebt werden?<br />
- Offenbaren tautologischen Charakter von Zielformulierungen<br />
- Technologisch (empirische) horizontale Zielbeziehungen<br />
- Folge von Nebenwirkungen des Mitteleinsatzes.<br />
Seite 14/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Setzen auf der technologischen Durchführungsebene an<br />
Logische Zielbeziehungen: Identität, Vereinbarkeit, Unvereinbarkeit<br />
- Identität<br />
- Bei genauer Betrachtung unterscheiden sich die formulierten Ziele inhaltlich nicht.<br />
- Unterscheiden sich nur durch die Wahl der Perspektive.<br />
- Bsp. „Geldwertstabilität“ und „Vermeidung von Inflation und Deflation“, „Vermeidung<br />
unfreiwilliger Arbeitslosigkeit“ und „Vollbeschäftigung“<br />
- Vereinbarkeit<br />
- Die Zielformulierungen sind widerspruchsfrei.<br />
- Voraussetzung dafür, dass mehre Ziele überhaupt zugleich angestrebt werden<br />
können.<br />
- Bsp.: Preisniveaustabilität und hoher Beschäftigungsstand<br />
- Unvereinbarkeit (Antinomie)<br />
- Die Verfolgung eines Ziels schließt die Erreichung eines anderen Ziels aus logischen<br />
Gründen aus.<br />
- Beispiele:<br />
- Gleichzeitige Steigerung der Lohn- und Gewinnquote<br />
- Autarkie zur Vermeidung außenwirtschaftl. Abhängigkeit und zugleich<br />
Wahrnehmung der Vorteile aus internationaler Arbeitsteilung.<br />
- Einführung von Mindestlöhnen und „Vermeidung von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit“.<br />
11.01.20<strong>10</strong> 3. <strong>Übung</strong><br />
Technologische (empirische) Zielbeziehungen: Harmonie, Neutralität und Konflikt<br />
- Zielkomplementarität (Harmonie)<br />
- Die Verfolgung eines Ziels begünstigt zugleich die Verfolgung eines anderen Ziels.<br />
- Achtung: Hier keine Ziel-Mittel-Beziehung!<br />
- Bsp: Stabilität und Wachstum oder hoher Beschäftigungsstand und Wachstum.<br />
- Zielunabhängigkeit (Neutralität)<br />
- Die Verfolgung eines Ziels lässt andere Ziele unberührt.<br />
- Wegen Interdependenz des ökonomischen Geschehens selten<br />
- Bsp.: Infrastrukturmaßnahmen und Außenhandelsabkommen über den Schutz<br />
geistigen Eigentums<br />
- Zielkonkurrenz (Konflikt)<br />
- Die Verfolgung eines Ziels beeinträchtigt die Verfolgung eines anderen Ziels.<br />
→ Abwägungsprobleme, wenn keines der Ziele aufgegeben werden soll.<br />
- Bsp.: Soziale Absicherung: Existenzsicherheit vs. Produktivitätssteigerung oder<br />
Preisniveaustabilität vs. Vollbeschäftigung (kurzfristige Phillips-Kurve)<br />
→ „Wahl“ zwischen unterschiedlichen Realisierungsgraden dürfte bei dynamischer<br />
Betrachtung nur kurz- und mittelfristig gegeben sein.<br />
Seite 15/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Horizontale Zielbeziehungen<br />
Quelle: M. Streit (2005), S. 279.<br />
Seite 16/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Unterscheiden Sie, wie wirtschaftspolitische Maßnahmen der Verhaltensabstimmung,<br />
der Verhaltensanweisung und der Verhaltensinduzierung auf das<br />
Entscheidungssystem der Adressaten einwirken. Nennen Sie dabei auch geeignete<br />
Beispiele, und verwenden Sie bei Ihrer Antwort eine geeignete Abbildung.<br />
[<strong>WS</strong> 07/08, <strong>10</strong>0 P., 60 Min.]<br />
Vorlesungsbeilage <strong>Wipo</strong><strong>II</strong>: S. 4-5. M. Streit(2005): „Wirtschaftspolitische<br />
Instrumentenkategorien“, S. 283-293;<br />
Einleitung<br />
- Bisher: Betrachtung gesellschaftlicher Ziele und Suche nach operationalen Definitionen,<br />
sowie konsistenten Zielbeziehungen.<br />
- Jetzt: Betrachtung des wirtschaftspolitischen Instrumentariums.<br />
→ Mittel der Wirtschaftspolitik<br />
- Formulierung eines Kontinuums an Lenkungsmöglichkeiten nach Intensität des Eingriffs.<br />
→ Durch systematische Verbindung mit wirtschaftspolitischen Zielen entsteht ein Ziel-<br />
Mittel-System.<br />
- Es entsteht ein Kontinuum an Lenkungsmöglichkeiten nach der Intensität des Eingriffs:<br />
Wie stark, umfassend oder dauerhaft wird lenkend in den Wirtschaftsprozess<br />
eingegriffen?<br />
- Hier: Verhaltensorientierter Ansatz, da jeder Eingriff Verhaltensänderungen der<br />
Individuen hervorruft. Diese Reaktionen können die Erreichung des angestrebten Ziels<br />
erleichtern, oder ihm im Wege stehen.<br />
- Bei dieser Einteilung wird auch die Unsicherheit über Verlauf und Ausmaß der Wirkung<br />
deutlich → Es existiert kein deterministisches Ziel-Mittel-System!<br />
- Tendenziell hohe Eingriffsintensität.<br />
- Annahme: Es existieren mächtige, organisierte wirtschaftliche Gruppen<br />
(Interessenverbände). Diese können die angestrebten politischen Ziele untergraben.<br />
Verhaltensabstimmung<br />
- Um diese Gruppen zu kooperativem zielkonformem Verhalten zu bewegen, wird ihnen<br />
ein Mitspracherecht bei der Regelsetzung eingeräumt.<br />
- Es wird eine einvernehmliche Festlegung wirtschaftspolitische Ziele zwischen<br />
Gesetzgeber und (einigen) Marktteilnehmern (Gesetzesadressaten) bzw. deren<br />
Vertretern angestrebt.<br />
- Bsp.: Runde Tische, Gipfel, „Bündnis für Arbeit“, „Ausbildungspakt“…<br />
Seite 17/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Eingriffsbereiche und Eingriffsintensität wirtschaftspolitischer Steuerung<br />
Quelle: Dobias (1980), S. 70.<br />
Seite 18/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Wirkung der Verhaltensabstimmung auf das Entscheidungssystem der Adressaten:<br />
- Handlungen:<br />
- Es wird erwartet, dass die vereinbarten Handlungen direkt, als unmittelbare Folge der<br />
Abstimmung, induziert werden.<br />
- Handlungsmöglichkeiten:<br />
- Auch eine Einschränkung/Erweiterung der zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten<br />
kann Ergebnis der Abstimmung sein. Dies kann die Bewertung bzw.<br />
die Folgen des Handelns beeinflussen.<br />
Kritik an der Verhaltensabstimmung: Verfassungsrechtliche Bedenken<br />
- Kritik: Die Beteiligung am wirtschaftspolitischen Prozess ist mit dem Anreiz verbunden,<br />
den erreichten Konsens zu eigenen Gunsten zu beeinflussen.<br />
- Verfassungsrechtliche Bedenken<br />
- Ausgewählte, demokratisch nicht legitimierte Verhandlungspartner sind Teil des<br />
Gesetzgebungsprozesses.<br />
→ Verhaltensabstimmungen sind insofern eine starke Form des Eingriffs, als dass<br />
das Gesetzgebungsverfahren entdemokratisiert werden kann. Es liegt eine<br />
verfassungsmäßig nicht vorgesehene Teilnahme von Wirtschaftssubjekten vor,<br />
die Adressaten der Gesetzgebung sind.<br />
Kritik an der Verhaltensabstimmung: Ordnungspolitische Bedenken<br />
- Ordnungspolitische Bedenken<br />
- Eine Stärkung des Einflusses von Interessengruppen ist zu erwarten. Zum Zeitpunkt<br />
der Festlegung eines Handlungsrahmens kann geschickte Einflussnahme zu eigenen<br />
Gunsten besonders weitreichende Folgen haben.<br />
- Durch geschicktes Verhandeln können Umverteilungsgewinne realisiert werden.<br />
Dies verzerrt den Markt zu Gunsten der beteiligten Parteien und geht zu Lasten<br />
derer, die nicht an der Verhaltensabstimmung beteiligt wurden.<br />
→ Der Durchsetzung von Partikularinteressen ist Tür und Tor geöffnet (Lobbyismus).<br />
- Beispiel: Vor der Bundestagswahl (!) lud Frau Merkel Vertreter der Milchbauern zum<br />
„Milchgipfel“ ins Kanzleramt ein.<br />
Verhaltensanweisung<br />
- Wirkung der Verhaltensanweisung auf das Entscheidungssystem der Adressaten:<br />
- Handlungen<br />
- Unerwünschte Handlungen werden verboten, erwünschte geboten.<br />
- Verhaltensanweisung kann direkt auf das Durchführen oder Unterlassen bestimmter<br />
Handlungen wirken.<br />
- Handlungsmöglichkeiten<br />
- Reduzierung legaler Handlungsalternativen<br />
Seite 19/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Die Reaktion auf eine Anweisung hängt von der Bewertung der Handlungsfolgen ab.<br />
(Bsp. Steuer auf Zigaretten)<br />
- Relativ intensive Form des Eingriffs.<br />
→ In Marktwirtschaften z.T. nicht ordnungskonform!<br />
- Verhaltensanweisungen können sein:<br />
- Ge-/Verbote<br />
- Fusionskontrolle<br />
- Ladenschlussgesetz<br />
- Im Extremfall: Zwang<br />
- Ge-und Verbote sind weniger starke Eingriffe als der Zwang, da die WiSus hier die<br />
Möglichkeit haben Ausweichreaktionen durchzuführen. Bei Zwang muss eine<br />
bestimmte Handlung durchgeführt werden.<br />
- Auch die Veränderung einzelwirtschaftlicher Plandaten kann durch<br />
Verhaltensanweisungen erreicht werden.<br />
- Höchst-/Mindestpreise<br />
- Institutionelle Marktbedingungen<br />
Verhaltensanweisung: Kritik<br />
- Zentral ist das Informationsproblem des Regulierers.<br />
- Legale Anpassungsvorgänge der Wisus können der Zielerreichung dienen, oder ihr<br />
entgegenwirken. Es können dadurch weitere nicht marktkonforme Marktinterventionen<br />
nötig werden. → Bsp.: Butterberge und Milchseen<br />
- Es können Anreize zum Nichtleistungswettbewerb geschaffen werden<br />
(Geltendmachung von „Sonderrechten“).<br />
- Es kann zur Verlagerung bestimmter Aktivitäten in die Illegalität kommen und so zur<br />
Entstehung von Schwarzmärkten beitragen.<br />
Verhaltensinduzierung über Anreize<br />
- Indirekte Verhaltensbeeinflussung über Anreize durch Berücksichtigung des Kalküls der<br />
WiSus.<br />
- Im Gegensatz zur Verhaltensabstimmung und Ge-/ Verboten liegt hier ein Instrument mit<br />
indirekter Zielwirkung vor.<br />
- Relativ geringe Eingriffsintensität<br />
→ Ausnutzung rationaler Verhaltensanpassung als Reaktion auf den Mitteleinsatz.<br />
- Instrumente zur Verhaltensinduzierung über Anreize können sein:<br />
- Informationspolitik<br />
- Stiftung Warentest<br />
Seite 20/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Verbraucherzentrale<br />
- Aufklärungskampagne bzgl. der Versorgungslücke im Alter<br />
- Zukünftig geplantes Staatshandeln<br />
- Korrektur von Zielvorstellungen<br />
- Werbende Aufforderung oder kritische Mahnung die darauf abzielen individuelle oder<br />
gruppenspezifische Zielvorstellungen in Richtung der wirtschaftspolitischen Ziele zu<br />
beeinflussen. → Z.B.: „BuyBritish“<br />
- Steuertarif<br />
- Lenkungssteuer z.B. auf Alcopops<br />
- Kombilohn<br />
- Sanktionsdrohung<br />
- GWB<br />
- Rechtsformen<br />
- Wirkung der Anreize auf das Entscheidungssystem der Adressaten:<br />
- Veränderung des entscheidungsrelevanten Informationsstandes.<br />
- Veränderung der entscheidungsrelevanten Umwelt.<br />
- Einflussnahme auf die Wirtschaftsordnung<br />
- Z.B. verantwortungsvoller Umgang mit Eigentum, wenn dem Gewinnstreben die<br />
Haftung entgegensteht.<br />
- Einflussnahme in den Wirtschaftsprozess<br />
- Z.B. verbesserte steuerliche Absetzbarkeit, um zielkonforme Lenkungswirkung zu<br />
erreichen.<br />
- Die Beurteilung einzelner Maßnahmen muss die Interdependenz wirtschaftlicher<br />
Aktivität berücksichtigen, da die Folgen der Verhaltensinduzierung sehr weitreichend<br />
sein können und dem ursprünglich angestrebtem Ziel entgegenwirken oder nicht<br />
bedachte Zielkonkurrenz auslösen können.<br />
- Bsp.: „Biosprit (Bodennutzungskonkurrenz und Nahrungsmittelkrisen)<br />
4. <strong>Übung</strong> 18.01.20<strong>10</strong><br />
Stellen Sie dar, inwiefern die Ziel-und die Ordnungskonformität geeignete Kriterien<br />
zur Auswahl wirtschaftspolitischer Instrumente sind. Diskutieren Sie in diesem<br />
Zusammenhang auch die Bedeutung von Stetigkeit und Glaubwürdigkeit des<br />
Einsatzes von wirtschaftspolitischen Instrumenten. [<strong>WS</strong> 07/08, <strong>10</strong>0 P., 60 Min.]<br />
Literatur<br />
- H. Berg, D. Cassel, K. H. Hartwig (2007): „Einsatzkriterien des wirtschaftspolitischen<br />
Instrumentariums“, S. 322-324.<br />
- J. B. Donges, A. Freytag (2004): „Regelbindung vs. Diskretionäres Verhalten“ (zur<br />
Glaubwürdigkeit), S. 273-283.<br />
- M. Streit (2005): „Zielkonformität, Konzeptionskonformität, Systemkonformität“ (zur Zielund<br />
Ordnungskonformität), S. 307-313.<br />
Seite 21/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Seite 22/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
Einleitung<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Wird ein realer sozioökonomischer Zustand als korrekturbedürftig empfunden, so können<br />
zur Erreichung des gewünschten Zielzustandes verschiedene wirtschaftspolitische Mittel<br />
auf Tauglichkeit geprüft werden.<br />
- Hierbei gilt: Politische Ziele sind Werturteile. Politiker stehen für einen Zielmix. Unter<br />
Umständen haben Instrumente einen Eigenwert.<br />
- Es muss eine Beurteilung der zu Verfügung stehenden Mittel vorgenommen werden.<br />
- Für einen effizienten Mitteleinsatz können als Auswahlkriterien herangezogen werden:<br />
- Zielkonformität<br />
- Ordnungskonformität (auch: Systemkonformität)<br />
Zielkonformität<br />
- Als „zielkonform“ (auch: „zweckmäßig“) werden alle Maßnahmen bezeichnet, die<br />
grundsätzlich geeignet erscheinen, zur Lösung eines wirtschaftspolitischen Problems<br />
beizutragen.<br />
- Diese erste Stufe der Prüfung liefert ein teleologisches Urteil.<br />
- Es muss ebenfalls überprüft werden:<br />
- Folgen für umfassendere gesellschaftl. Ziele (z.B. letzte Ziele)<br />
- Eigenwert der Mittel<br />
- Fern- und Nebenwirkungen auf andere wirtschaftspol. Ziele<br />
- Kosten<br />
- Es ist Lenkungswissen über die Funktionsweise einer Volkswirtschaft nötig (Kenntnis<br />
von bewährten Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen).<br />
- Das Ziel-Mittel-Denken ist, wie das Wissen um seine Begrenztheit, (Unvollkommenheit<br />
des Wissens) unabdingbar, um vor Inkonsistenzen und krassen Fehlurteilen zu<br />
schützen.<br />
- Es besteht die Gefahr, dass politische Gestaltungsmöglichkeiten auf das ökonomische<br />
System überschätzt werden.<br />
→ Unter Umständen resultieren daraus systemverschlechternde Gesamteffekte.<br />
- Bsp.: Inflationsbekämpfung<br />
- Verringerung der Geldemengenausweitung vs. umfassendes Netz von Preis- und<br />
Lohnkontrollen.<br />
Ordnungskonformität<br />
- Ordnungskonform sind Mittel, die mit der gewählten Wirtschaftsordnung vereinbar sind.<br />
- Die Wirtschaftsordnung gibt einen politisch-rechtlichen Rahmen für wirtschaftliche<br />
Tätigkeit in Abhängigkeit umfassenderer gesellschaftlicher Ziele.<br />
Seite 23/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Die gelenkte (soziale) Marktwirtschaft ist dualistisch in Bezug auf den<br />
Koordinationsmechanismus:<br />
- Grundsätzlich: Dominanz des marktmäßig koordinierten privaten Sektors.<br />
- Verwaltungswirtschaftliche Koordination der Versorgung der Bevölkerung mit<br />
Kollektivgütern und Ordnung.<br />
→ Beide Sektoren sind durch verschiedene Lenkungsmaßnahmen in wirtschaftspol.<br />
Absicht miteinander verflochten.<br />
- Die Ordnungskonformität ist ein Beurteilungskriterium zur Bestimmung der Zulässigkeit<br />
des Mitteleinsatzes.<br />
- Bedeutung: Überprüfung eines Instruments hinsichtlich seiner zu erwartenden<br />
Wirkungen auf die Funktionsfähigkeit der gewählten Wirtschaftsordnung.<br />
→ In der gelenkten Marktwirtschaft bedeutet das Kriterium der Ordnungskonformität<br />
(insbesondere wegen des dualistischen Koordinationsverfahrens), dass die<br />
Qualität von Lenkungsmaßnahmen insbesondere im Hinblick auf die<br />
marktmäßige Koordination zu beurteilen ist.<br />
- Entstehung von Abwägungsproblemen, da bspw. eine dem Koordinationsmechanismus<br />
förderliche Regelung Verteilungszielen entgegenstehen kann.<br />
- Ein Instrument ist ordnungskonform, wenn die eingesetzten Instrumente mit der<br />
gewählten Wirtschaftsordnung vereinbar sind, oder diese fördern.<br />
- Beispiele:<br />
- Kartellverbot /Fusionskontrolle zum Erhalt des Leistungswettbewerbs (vereinbar?) ja<br />
- Nicht-tarifäre Wettbewerbshemmnisse in der Außenhandelspolitik (vereinbar?) nein<br />
- Preisfestsetzungen (Agrarpreise, etc.) (vereinbar?) nein<br />
- Die Anwendung des Kriteriums der Ordnungskonformität soll einem orientierungslosen<br />
Interventionismus vorbeugen.<br />
- Interventionismus hat vor allem zwei Ursachen:<br />
- Verengung des Blickfeldes von Fachpolitikern/Interessenvertretern auf ein spezielles<br />
Problemfeld.<br />
- Aus dem Erfolgsdruck der Politiker erscheinen Maßnahmen günstig, die angesichts<br />
der Kürze der Legislaturperiode möglichst schnell und leicht zurechenbare<br />
Zielwirkungen entfalten.<br />
- Gefahr des Interventionismus:<br />
- Ungewollte Summationseffekte:<br />
→ Häufung von Situationen, die das Urteil nahe legen, das System sei<br />
funktionsunfähig und daher zu ändern.<br />
- Dies kann ein grobes Fehlurteil sein, vor allem, wenn der Mitteleinsatz selbst den<br />
Schaden verursacht und durch die Korrektur dieser Maßnahmen die Funktionsfähigkeit<br />
wiederhergestellt wird.<br />
Seite 24/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
Stetigkeit<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Vorhersehbarer Einsatz des wirtschaftspolitischen Instrumentariums, so dass private<br />
Wisus in die Lage versetzt werden, das (von ihnen antizipierte) geplante Staatshandeln<br />
in ihrem Kalkül zu berücksichtigen.<br />
→ Auf einen bestimmten Umstand wird immer gleich reagiert. Dazu kann Regelbindung<br />
beitragen.<br />
- Nutzen<br />
- Stabilisierung der Erwartungsbildung privater Akteure<br />
- Durch Reduzierung der Unsicherheit sind Wohlfahrtssteigerungen möglich<br />
- Bsp.: Steigerung des langfristigen Investitionsvolumens<br />
- Grenzen<br />
- Reaktionsmöglichkeiten auf Schocks und neuartige Situationen<br />
- Unstetige Wirtschaftspolitik kann das Wirtschaften erschweren (Wohlfahrtsminderung).<br />
- Sich ändernde Gesetzgebung bei Regierungswechsel<br />
- Stete Variationen im Steuerrecht führen bspw. zu Verzögerungen bei<br />
Neuinvestitionen.<br />
- Beispiele:<br />
- Privatrechtsordnung als wichtige Säule der institutionellen Infrastruktur einer<br />
Volkswirtschaft (Ordnungspolitik, Rechtsstaat)<br />
- Forderung nach „Konstanz der <strong>Wipo</strong>“ im Ordo- (Neo-)liberalismus, da der Staat ein<br />
besonders mächtiger Wirtschaftsakteur ist (Prozesspolitik, Leistungsstaat) und sein<br />
Handeln weitreichende Auswirkungen auf individuelle Verhaltensanreize hat.<br />
Glaubwürdigkeit<br />
- Glaubwürdigkeit:<br />
- Im strengen Sinne geht es um Zeitkonsistenz der Wirtschaftspolitk.<br />
→ Es darf nicht vorhersehbar rational für den Wirtschaftspolitiker sein, zukünftig<br />
gegen seine Ankündigungen zu verstoßen.<br />
- Gegeben, wenn die Einschätzungen der Wirtschaftssubjekte über das tatsächliche<br />
wirtschaftspolitische Handeln zur Zeit t mit dem übereinstimmt, was von der Politik in<br />
t-1 angekündigt wurde (ex-post-Betrachtung).<br />
- Glaubwürdigkeit kann durch Regelbindung verstärkt, oder hergestellt werden.<br />
→ Regelgebundene vs. diskretionäre Wirtschaftspolitik (siehe <strong>Übung</strong> 6)<br />
- Abraham Lincoln zugeschrieben:<br />
„You can fool all the people some of the time, and some people all of the time, but you<br />
can not fool all the people all of the time.“<br />
- Beispiel für zeitinkonsistentes Verhalten: Abschlussklausur (Donges/Freytag S. 277);<br />
Geldpolitik (Donges/Freytag S. 278-283)<br />
- Nutzen<br />
Seite 25/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Stiftet Informationen<br />
- Fördert die Berechenbarkeit staatlichen Handelns<br />
- Verringerung von Unsicherheiten und Erwartungsstabilisierung (Gegenteil bei<br />
Unglaubwürdigkeit)<br />
- Förderung sogenannter Ankündigungseffekte<br />
→ Verkürzung der Zeitverzögerung des wirtschaftspol. Instrumenteneinsatzes<br />
- Je besser es gelingt, (Zukunfts-) Vertrauen in die Wirtschaftspolitik zu schaffen, umso<br />
eher werden die Risiken innovatorischer Aktivitäten von Unternehmen getragen.<br />
- Glaubwürdigkeit ist notwendige Voraussetzung für das Entstehen von Reputation („er<br />
hat das immer schon so gemacht“); Reputation wiederum ist Voraussetzung für die<br />
Herausbildung von Vertrauen (wird „geschenkt“!) darauf, dass keine „Überraschungen“<br />
auftreten.<br />
Beantworten Sie die Teilaufgaben a-c.<br />
a) Untersuchen Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile diskretionärer und<br />
regelgebundener Wirtschaftspolitik. Verwenden Sie dabei auch geeignete<br />
Beispiele.<br />
b) Diskutieren Sie die Ausgestaltungsmöglichkeiten von Regelbindungen.<br />
c) Gehen Sie auch auf die Frage ein, ob (Selbst-) Bindungen an Regeln ohne<br />
weiteres immer möglich und dann auch glaubwürdig sind.<br />
[<strong>WS</strong> 08/<strong>09</strong>, <strong>10</strong>0 P., 60 min.]<br />
Literatur<br />
- H. Berg, D. Cassel, K. H. Hartwig (2007): Regelgebundene versus diskretionäre<br />
Wirtschaftspolitik“, 324-326.<br />
- Donges/Freytag (2004): „Regelbindung vs. Diskretionäres Verhalten“, S. 273- 298.<br />
- M. Streit (2005): „Diskretionärer versus regelgebundener Mitteleinsatz“, S. 322-328.<br />
Einleitung<br />
- Zur Erreichung wirtschaftspolitischer Ziele kann es nötig sein auf Instrumente (Mittel) der<br />
Wirtschaftspolitik zurückzugreifen.<br />
- Beim Einsatz wirtschaftspolitischer Instrumente stellen sich die Fragen:<br />
- Wie groß soll der Ermessensspielraum wirtschaftspol. Entscheidungsträger bzgl.<br />
Instrumentenauswahl und Dosierung ausfallen?<br />
- Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Grade der Handlungsfreiheit auf die<br />
Zielerreichung?<br />
- Die Vor- und Nachteile diskretionärer und regelgebundener Wirtschaftspolitik sollen nun<br />
diskutiert werden.<br />
Definition: Diskretionärer versus regelgebundener Mitteleinsatz<br />
- Diskretionärer Mitteleinsatz:<br />
- Es liegt grundsätzlich im Ermessen des Trägers der Wirtschaftspolitik, ob und in<br />
welcher Situation er von einem Mittel in welcher Weise Gebrauch macht.<br />
Seite 26/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Regelgebundener Mitteleinsatz:<br />
- Das Ermessen wird dadurch eingeschränkt, dass im vorhinein mehr oder weniger<br />
zwingende rechtliche Regeln getroffen werden, unter welchen Bedingungen welche<br />
Mittel in welcher Dosierung und mit welcher Dauer eingesetzt werden.<br />
→ Zum Teil sind die Grenzen fließend.<br />
Regelgebundene Wirtschaftspolitik<br />
- Grundsätzliche Möglichkeiten der Regelbindung<br />
- Handlungen müssen in ihrer Zahl beschränkt, oder genau vorgeschrieben sein.<br />
- Es müssen Bedingungen (Indikatoren) festgelegt werden, die eine bestimmte<br />
Handlung, oder eine Handlung innerhalb eines Spielraums auslösen.<br />
- Regelbindungen i.S.v. Selbstbeschränkungen, nicht i.S.v. Gesetzesbindung (die ist im<br />
Rechtsstaat obligatorisch!)<br />
- Beispiele für Regelbindungen<br />
- Meistbegünstigungsprinzip im Außenhandel (WTO)<br />
- Maastricht-Kriterien<br />
- Grundgesetzänderung (Regeländerungsregel) stets mit 2/3-Mehrheit<br />
- Monetaristische Geldmengenregel<br />
Vorteile der Regelbindung<br />
- Vorteile der Regelbindung<br />
- „Konstanz der Wirtschaftspolitik“ (Eucken, 1959)<br />
- Vorhersehbarkeit<br />
- Stabilisierung der Erwartungsbildung<br />
- Weniger wipol. Chancen, aber auch weniger Risiko durch Fehlsteuerung.<br />
- Schutz vor Interessengruppen und Klientelpolitik<br />
- Verkürzung von Zeitverzögerungen<br />
- Da Auslöser, Art und Umfang des Eingriffs so weit wie möglich operationalisiert<br />
wurden, vermindern sich bzw. entfallen Instanzverzögerungen, was einen zeitnahen<br />
Eingriff möglich macht.<br />
- Evtl. höhere Glaubwürdigkeit (siehe Aufgabenteil c)<br />
- Je mehr der marktlich koordinierte Bereich in der Lage ist, sich selbst zu steuern,<br />
desto mehr sollte auf fallweise Intervention verzichtet werden.<br />
→ Besser sind dann dauerhafte Vorkehrungen, die die Rahmenbedingungen zur<br />
Selbststeuerung verbessern.<br />
5. <strong>Übung</strong> 25.01.20<strong>10</strong><br />
Grenzen der Regelbindung I<br />
- Steuerungsproblem: Hohe Ansprüche an das technologische Wissen.<br />
Seite 27/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Bedingungen für die Etablierung von Regelbindungen ist Lenkungswissen.<br />
- Verfügt der Entscheider in t0 über genügend Informationen und eine Technologie<br />
(konsistentes empirisch bewährtes Aussagensystem), die es ihm erlaubt,<br />
Kausalzusammenhänge erkennbar werden zu lassen, ist er in der Lage für ein<br />
bestimmtes, wiederkehrendes Problem einen Lösungsmechanismus einzurichten.<br />
- Das Wissen über einen konkreten Problembereich ist i.d.R. so begrenzt, dass es<br />
unmöglich ist, dauerhaft harte Regeln zu formulieren.<br />
→ Liegt eine fehlerhafte Technologie zugrunde, kann das wohlfahrtsmindernde<br />
Folgewirkungen haben.<br />
- Dies gilt in stärkerem Maße als bei der diskretionären <strong>Wipo</strong>.<br />
- Geringere Flexibilität als bei der diskretionären Wirtschaftspolitik.<br />
- Möglichkeiten zur Feinsteuerung entfallen.<br />
- Auf unvorhergesehene Ereignisse und Schocks kann ggf. nur im Rahmen der<br />
Handlungsmöglichkeiten reagiert werden. („build-in-flexibility“)<br />
Grenzen der Regelbindung <strong>II</strong><br />
- Kontrollproblem: Probleme die bei der Kontrolle oder der Sanktionierung von<br />
regelgebundener WiPo auftreten können.<br />
- Mangelnde Operationalisierung<br />
- Ausweichmöglichkeit durch Manipulation<br />
- Der Nachweis von Fehlverhalten wird erschwert.<br />
- Oft bleibt das Dosierungsproblem bestehen, da nur Indikator und Instrument festgelegt<br />
sind, die Dosierung aber diskretionär bleibt.<br />
Grenzen der Regelbindung <strong>II</strong>I<br />
- Schafft es eine Interessengruppe Vorteile in einer Regel festzuschreiben, so sind die<br />
Auswirkungen gravierender als bei der diskretionären Wirtschaftspolitik.<br />
- Eine Regel ist naturgemäß statisch und lässt daher eine dynamische Umwelt außer<br />
Acht.<br />
- Die Umwelt kann sich so verändern, dass die Regel nicht mehr den optimalen Eingriff<br />
liefert.<br />
→ Fazit: In einer dynamischen Welt weichen die Vorteile eines perfekten Automatismus<br />
den Kosten völliger Inflexibilität.<br />
Vorteile diskretionärer Wirtschaftspolitik<br />
- Der Mitteleinsatz kann in jeder auftretenden wirtschaftspolitischen Situation möglichst<br />
zielkonform ausgestaltet werden.<br />
→ Maximale Freiheit (im Rahmen geltenden Rechts) bzgl.:<br />
- des Eingriffs als solchen (ja/nein)<br />
- des Instruments<br />
- der Dosierung<br />
Seite 28/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Glaubwürdig betrieben geben Ermessensspielräume Flexibilität auf eine dynamische<br />
Umwelt zu reagieren.<br />
- Möglichkeit auf Schocks oder nicht vorhergesehene, in der Regel nicht berücksichtigte,<br />
Umstände zu reagieren.<br />
- Sofern das technologische Wissen vorliegt, kann eine situationsabhängige Feinsteuerung<br />
des Instrumenteneinsatzes vorgenommen werden.<br />
Nachteile diskretionärer Wirtschaftspolitik<br />
- Lenkungswissen für eine wipol. Feinsteuerung → grundsätzlich<br />
- Problem der Zeitinkonsistenz optimaler Strategien stärker als bei Regelbindung (siehe<br />
<strong>Übung</strong> 5).<br />
- Zeitverzögerungen (Erkenntnis-lag, Entscheidungs-lag, Wirkungs-lag) beim Einsatz<br />
wirtschaftspolitischer Mittel und damit verbundene Anreize für politische Akteure.<br />
- Gefahr des Aktionismus<br />
- Die zeitliche Zuordnungsproblematik bietet Raum für das Abwälzen oder Leugnen von<br />
Verantwortung.<br />
- Kurzfristorientierung pol. Entscheidungsträger<br />
- Gefahr der häufigen Einflussnahme durch Interessengruppen, (gezielte) Bereitstellung<br />
von „Fachwissen“ (umweltpol. Regulierung) oder Verweis auf die Mobilisierung von<br />
Wählerstimmen (Gewerkschaften), etc.<br />
- Fallweise getroffene Entscheidungen erschweren die einzelwirtschaftl. Planung und<br />
Plankoordination.<br />
- Beispiel: Donnerstagsmaschine<br />
Seite 29/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Ausgestaltungsmöglichkeiten von Regelbindung<br />
- Der regelgebundene Einsatz des wirtschaftspol. Instrumentariums setzt die Bestimmung<br />
von Indikatoren voraus, mit denen man die Abweichung eines Ist-Zustandes von einem<br />
erwünschten Soll-Zustand bestimmen kann (Bsp. anhand des Stabilitäts- und<br />
Wachstumspaktes – Verfahren bei übermäßigem Defizit)<br />
- Wird ein quantifizierter Schwellenwert über- oder unterschritten (Neuverschuldung ><br />
3%), kann<br />
- eine vorgegebene Maßnahme (Geldstrafe) automatisch ergriffen werden oder<br />
- diskretionär die Auswahl einer bestimmten Maßnahme aus einem Maßnahmenkatalog<br />
(z.B. Geldstrafe oder Einlage bei 2/3-Mehrheit im Ministerrat) erfolgen.<br />
- Die qualitative Formulierung erfordert, dass ein Handlungsbedarf (i.S.d. Regel) erkannt<br />
und die diskretionäre Entscheidung über den Mitteleinsatz bejaht wird. (Ausnahmen bei<br />
Auftreten „außergewöhnlicher“ Ereignisse).<br />
- Die Wahl einer beliebigen Maßnahme kann sich anschließen oder<br />
- die Auswahl einer Maßnahme aus einem Maßnahmenkatalog erfolgen.<br />
- Wenn bestimmte Maßnahme gewählt oder automatisch ergriffen wird, dann:<br />
- Automatismus: Dosierung, Art und Dauer sind vorgegeben (Geldstrafe i.H.v. 0,2 -<br />
0,7 % des BIP) oder<br />
- Diskretionär: Dosierung, Art und Dauer sind nicht vorgegeben<br />
- Fazit: Übergänge zwischen diskretionärer und regelgebundener <strong>Wipo</strong> sind fließend: vom<br />
Automatismus („Donnerstagsmaschine“; „built-in-flexibility“ des Steuersystems) bis zu<br />
qualitativen Indikatoren („Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ §26<br />
StWG).<br />
Zur Möglichkeit glaubwürdiger Regelbindung<br />
- Ambivalenz diskretionärer Wirtschaftspolitik<br />
- Chance gute individuelle Entscheidungen zu treffen<br />
- Gefahr durch z.B. zeitinkonsistentes Verhalten eine unglaubwürdige Politik zu<br />
betreiben<br />
→ Mögliche Lösung: Einschränkung der Handlungsspielräume durch Regelbindung. Die<br />
angekündigte Politik könnte glaubwürdig sein, da der Gesetzgeber seine Reaktion<br />
schon vorweggenommen hat.<br />
- Aber: Bei Regelbindung liegt nur eine Selbstbindung und keine Bindung von Außen vor.<br />
- Der Gesetzgeber beschränkt sich durch Gesetze, die er selber verändern kann.<br />
- Auch Regeln können keine vollständige Glaubwürdigkeit herstellen, jedoch erhöhen sie<br />
die politischen Kosten eines Verstoßes.<br />
- Ist der Gesetzgeber in einem Bereich auf Reputation angewiesen, so liegt auch hierin<br />
eine Lösungsmöglichkeit.<br />
Seite 30/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Im Rahmen der Vorbereitung wirtschaftspolitischer Maßnahmen stehen zu Beginn<br />
die sog. „Lageanalyse“ und die „Ursachenanalyse“. Untersuchen Sie, auch anhand<br />
geeigneter graphischer Darstellungen, die damit verbundenen Inhalte und<br />
Probleme. [SS 08, <strong>10</strong>0 P., 60 Min.] Vorlesungsbeilage <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong>: S. 17-26<br />
Literatur<br />
- H. Berg, D. Cassel, K. H. Hartwig (2007): „Phasen und Probleme des<br />
wirtschaftspol. Entscheidungsprozesses“, S. 326-333.<br />
- M. Streit (2005): „Elemente wirtschaftspolitischer Planung“, S. 351-364.<br />
Einleitung<br />
- Abraham Lincoln zugeschrieben:<br />
„Wenn wir zunächst wissen könnten, wo wir sind (Diagnose) und wohin wir treiben<br />
(Status quo-Prognose), könnten wir besser beurteilen, was zu tun ist und wie es zu tun<br />
ist (Maßnahmenplanung).“<br />
- Der Handlungsbedarf wird im wipol. Entscheidungsprozess festgelegt. Er besteht in<br />
zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen, denen bestimmte Entscheidungselemente<br />
zugeordnet sind:<br />
- Lageanalyse<br />
- Ursachenanalyse<br />
- Entscheidungsphase und Maßnahmenplanung<br />
- Implementations- und Kontrollphase<br />
- Der Entscheidungsprozess besteht aus zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen, denen<br />
bestimmte Entscheidungselemente zugeordnet sind.<br />
Lageanalyse<br />
- Die Lageanalyse wird innerhalb der Planungsphase (Phase 1)<br />
durchgeführt.<br />
- Informationsbeschaffung/Bestandsaufnahme:<br />
- Beschaffung und Verarbeitung umfassender, systematisch geordneter<br />
Informationen über das zu lösende Problem. Dabei wird das Ausmaß und die<br />
Richtung der Abweichung vom Sollzustand und die wirtschaftspolitischen<br />
Handlungsoptionen festgestellt.<br />
- Feststellung des Handlungsbedarfs (ja/nein)<br />
- Auslöser eines wirtschaftspol. Mitteleinsatzes ist eine als korrekturbedürftig<br />
empfundene Abweichung der Realität von einem erwünschten sozioökonomischen<br />
Zustand<br />
- Zielabweichung?<br />
- Vergleich der Soll-Ist-Zustände<br />
- Notwendige Voraussetzungen für die Lageanalyse:<br />
- Existenz eines konkreten, operational definierten Zielsystems, um<br />
Abweichungen überhaupt feststellen zu können (Messlatte).<br />
- Mögliches Problem: Fehlende operational definierte Ziele und Instrumente.<br />
Seite 31/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Verfügbarkeit aktueller Informationen über das Wirtschaftsgeschehen<br />
- Hohe Kosten der Informationsbeschaffung und -Verarbeitung<br />
- Nicht einheitlich aufbereitete Informationen<br />
- Verzögerte Berichterstattung oder Wahrnehmung<br />
- Interessensgebundene Informationssammlung und -Verwertung<br />
- Indikatorprobleme<br />
Ursachenanalyse<br />
- Klärung von Ursache-Wirkungszusammenhängen (Phase 2)<br />
- Formulierung und Überprüfung von Hypothesen, d.h. solchen Aussagen, die<br />
behaupten, dass bei Erfüllung bestimmter Bedingungen ein als ursächlich<br />
angesehenes Ereignis zum Eintritt eines best. anderen Ereignisses (Wirkung) führt.<br />
→ Suche nach einer Erklärung. Warum ist eine Entwicklung eingetreten?<br />
- Ansetzen des wirtschaftspol. Instruments bei den Ursachen unerwünschter<br />
Entwicklungen → nicht bei den Symptomen<br />
- Notwendige Voraussetzungen für die Ursachenanalyse<br />
- Verständnis wirtschaftspol. Abläufe<br />
- Lenkungswissen<br />
- Existenz von ziel- und ordnungskonformen Instrumenten<br />
- Probleme aufgrund unvollkommener und konkurrierender Theorien mit der Folge,<br />
dass es in der Regel keine endgültig sicheren und einheitlichen<br />
Handlungsempfehlungen gibt.<br />
- Fehlende oder fälschlicherweise behauptete Kausalzusammenhänge<br />
- Existenz unterschiedlicher, sich widersprechender Kausalzusammenhänge<br />
→ keine Theorie mit Alleingeltungsanspruch<br />
→ Wir müssen stets unsichere und verschiedene Antworten erwarten<br />
- Auf Basis der Ursachenanalyse wird der Versuch unternommen verschiedene<br />
Prognosen aufzustellen.<br />
→ Ziel: Den zukünftigen Handlungsbedarf feststellen (welches Instrument in<br />
welcher Dosierung).<br />
Ursachenanalyse: Prognosen<br />
- Prognosen behaupten das Eintreten eines Sachverhaltes in der Zukunft, der aus<br />
allgemeinen Gesetzesaussagen unter Randbedingungen abgeleitet wird.<br />
- Prognosen sind unsicher und bedingt, d.h. dass es keine sicheren und zugleich<br />
gehaltvollen Aussagen über die Zukunft gibt.<br />
- Sie haben die Funktion, auf Basis von Erfahrungswissen, die Ungewissheit<br />
einzugrenzen, unter der wipol. Entscheidungen gefällt werden müssen.<br />
- Prognosearten:<br />
- Datenprognose:<br />
- Prognose der Entwicklung relevanter aber nicht beeinflussbarer (exogener)<br />
Umweltzustände (Datenkranz) zur Bestimmung des zukünftigen wipol.<br />
Aktionsradius<br />
Seite 32/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Status quo-Prognose:<br />
- Prognose der in der Lageanalyse gewonnenen Erkenntnisse. Wie würde es<br />
weitergehen, wenn das aktuelle Verhalten beibehalten wird? (kann ein aktives<br />
Tun sein oder ein Unterlassen)<br />
- Wirkungsprognose:<br />
- Wie würde es weitergehen, wenn (alternative) Instrumente (in versch.<br />
Dosierungen) eingesetzt würden (Unter Berücksichtigung von Zeitverzögerungen)?<br />
- Kann ein weniger geschätzter Ist-Zustand in einen höher geschätzten Sollzustand<br />
überführt werden?<br />
Legende:<br />
Achsenbezeichnung: Zeit und Zielvariable<br />
Zielwert/Zielwolke<br />
Prognose 1 und 2: unterschiedl. Prognosen<br />
Prognosetrichter<br />
H1 und H2: unterschiedl. Handlungsbedarfe<br />
Seite 33/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
Ursachenanalyse<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Zentrale Frage: Haben wir jetzt, oder zu einem späteren Zeitpunkt einen<br />
Handlungsbedarf, oder korrigiert sich das System von selbst?<br />
- Probleme der Feststellung des Handlungsbedarfs H1/H2.<br />
- Prognoseprobleme und Folgen<br />
- Unsicherheit und Bedingtheit von Prognosen führen u.a. zum „Phänomen“ des<br />
Prognosetrichters, der die sinkende Zuverlässigkeit der Prognose darstellt.<br />
- Je weiter prognostizierter Sachverhalt in Zukunft liegt, desto stärker streut der<br />
Prognosewert (Varianz).<br />
- Konkurrierende Theorien führen zu unterschiedlichen Prognosen P1 und P2<br />
- Eigendynamik veröffentlichter Prognosen<br />
- „Messlatte“ selbst ist wegen fehlendem operationalem Zielsystem häufig<br />
ungenau/willkürlich bestimmt. Auch: unvollständige, verzögerte, verzerrte Daten<br />
→ eher Zielwolke als Zielwert<br />
- Fazit: Es gibt keine sicheren und zugleich gehaltvollen Aussagen über die<br />
Zukunft, auf die sich Wirtschaftspolitiker stützen können<br />
- Ziel: Identifizierung der zu ändernden Variablen<br />
Entscheidungsphase<br />
- Maßnahmenplanung: Auswahl und Untersuchung geeigneter Ziel-Mittel-Kombinationen<br />
(Phase 3)<br />
- Auswahl geeigneter Mittel und Abwägung alternativer Maßnahmen anhand von Kriterien<br />
des Mitteleinsatzes:<br />
- Zielkonformität siehe hierzu:<br />
- Ordnungskonformität <strong>Übung</strong> 5<br />
- Legalität<br />
- Politische Durchsetzbarkeit<br />
- Zahlreiche Realisierungshemmnisse können der Verwirklichung an sich geeigneter<br />
Maßnahmen im Wege stehen.<br />
- Die Zielkonformität wird nach dem Grad der Zielerreichung bestimmt. Dabei werden die<br />
Alternativen nach Art, Zeitverlauf, Dosierung und Kosten bestimmt. Daher sind<br />
Wirkungsprognosen erforderlich (s.o.).<br />
- Die Wirkung eines Instrumentes darf nicht durch einen „Vorher-Nachher-<br />
Vergleich“ (Zt0 und Zt1 erfolgen, sondern durch einen Vergleich der Entwicklung<br />
mit der Maßnahme und ohne sie: Z ohne t1 und Z mit t1 („with and without-test“)<br />
- Frage: Was wäre geschehen, wenn die Maßnahme nicht ergriffen worden wäre<br />
→ kein einfaches Unterfangen, da die Realität mit einer hypothetischen<br />
Vergleichswelt verglichen werden muss<br />
- Bei „Vorher-Nachher-Vergleichen“ rechnen sich Regierungen günstige Entwicklungen<br />
Seite 34/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
kausal zu und behaupten bei ungünstigen Entwicklungen, dass es ohne ihr Einschreiten<br />
noch viel schlimmer gekommen wäre.<br />
Entscheidungsphase: Kosten und Nutzen einer Maßnahme<br />
- Der Erfolg einer Maßnahme ist die Differenz zwischen der erwünschten Wirkung auf die<br />
Zielvariable und allen mit ihrem Einsatz verbundenen Kosten.<br />
- Ziel: Bestimmung derjenigen Maßnahme mit dem höchsten erwarteten Nettonutzen.<br />
Kosten Nutzen<br />
K ges 3. Direkte Kosten<br />
4. Unerwünschte<br />
Nebenwirkungen<br />
5.Opportunitätskosten<br />
N netto 6. Saldo „Erfolg“<br />
Beispiel Abwrackprämie<br />
1 Hauptwirkungen<br />
2. Erwünschte<br />
Nebenwirkungen<br />
1: Konjunkturimpuls (Erhöhung inländischer Fahrzeugproduktion und -absatz)<br />
2: Geringerer Schadstoffausstoß in Deutschland…<br />
3: 2.500 € je Fahrzeug, Kosten der Neuverschuldung, Kredit-Crowding out …<br />
4: „Reimport“ alter Fahrzeuge aus Ausland, erhöhte Nachfrage nach (ausl.) Kleinwagen,<br />
Verdrängung eines Marktsegments, Vernichtung volksw. Kapitals…<br />
5: Alternative Politikszenarien, etwa allgemeine Steuersenkung<br />
6: ?<br />
Entscheidungsphase: Dosierung eines Instruments<br />
- Notwendig für die Beurteilung einer Maßnahme ist die Kenntnis ihrer Wirkungen in<br />
Abhängigkeit der Dosierung des Mitteleinsatzes (bestimmt Nah-, Fern-, Nebenwirkungen<br />
und direkte Kosten)<br />
- Unterschiedlicher Grad der Dosierbarkeit (nicht alle Maßnahmen sind beliebig fein<br />
dosierbar)<br />
- Qualitative Maßnahmen (Mitbestimmungsgesetze, Wettbewerbsrecht)<br />
- Quantitative Maßnahmen (Steuer- und Zinssätze, staatl. Investitionsausgaben)<br />
- Suche nach optimaler Dosierung<br />
- Zur Graphik:<br />
- Annahmen: beliebig fein dosierbarer Mitteleinsatz, Wirkungen und Kosten bekannt,<br />
es entstehen hauptsächlich variable Kosten (damit eine solche Entscheidung<br />
überhaupt möglich wird.)<br />
Seite 35/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus<br />
N ges
Entscheidungsphase: Legende<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Erläuterungen<br />
- Optimale Dosierung (Dopt): Keine andere Dosierung führt zu höherem Nettonutzen<br />
(GN=GK)<br />
- Absolute Überdosierung (D üo abs): Die Gesamtkosten übersteigen den Gesamtnutzen<br />
(NGN)<br />
- Relative Unterdosierung (D uo rel.): Der Gesamtnutzen übersteigt die Gesamtkosten,<br />
jedoch ist ein höherer Nutzen bei stärkerer Dosierung möglich (GN>GK)<br />
- Die Bestimmung von exakten Dosierungsgraden konkreter wirtschaftspol. Maßnahmen<br />
dürfte unmöglich sein; die theoretische Formulierung eines Optimums bietet allerdings<br />
eine Orientierungshilfe zur Bestimmung von Kategorien der Fehldosierung.<br />
Entscheidungsphase: Fehldosierung<br />
- Gründe für Fehldosierungen<br />
- Unterschätzen von Widerständen und Ausweichreaktionen der Adressaten (Bsp.:<br />
Tabaksteuer und Ausweichen auf den Schwarzmarkt)<br />
- Vernachlässigung von Fernwirkungen<br />
- Summationswirkungen (Bsp.: Kumulation strukturerhaltender Maßnahmen in<br />
Arbeitsmarkt und Außenwirtschaftspolitik mit der Folge struktureller Arbeitslosigkeit,<br />
die den Verdacht des Systemversagens nährt)<br />
- Häufige wirtschaftspolitische Datenänderung zur „Erhöhung“ des Maßnahmenerfolgs<br />
führen zu Unsicherheit (Folgen unstetiger Politik)<br />
- Time lags - generelles Problem der Auswirkungen wirtschaftspolitischer<br />
Entscheidungen.<br />
Seite 36/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
6. <strong>Übung</strong> 01.02.20<strong>10</strong><br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Seit einigen Jahren wird in Zeitungen, unter tätiger Mithilfe von Prominenten, um die<br />
Akzeptanz einer „Neuen“ Sozialen Marktwirtschaft bei den Lesern geworben. Zur<br />
genaueren Würdigung eines solchen Anliegens sind Kenntnisse der<br />
wirtschaftspolitischen Konzeption der „Sozialen Marktwirtschaft“ gewiss<br />
nicht schädlich. Beantworten Sie die Teilfragen a-c.<br />
a) Skizzieren Sie die Elemente der wirtschaftspolitischen Konzeption einer<br />
„Sozialen Marktwirtschaft“.<br />
b) Gehen Sie auf die theoretischen und historischen Hintergründe ein, die, etwa<br />
seit 1948, zur Einführung einer solchen Wirtschaftsordnung in den<br />
Besatzungszonen der westlichen Alliierten bzw. der späteren BRD führten.<br />
c) Diskutieren Sie die „konstituierenden“ und „regulierenden“ Prinzipien, wie<br />
Walter Eucken einige der grundlegenden Regeln genannt hat, die einer solchen<br />
Wirtschaftsordnung zugrunde liegen. [SS <strong>09</strong>, <strong>10</strong>0 P., 60 Min.] VB WiPo <strong>II</strong>, S. 35-40<br />
Literatur:<br />
- M. Streit (2005):<br />
- „Die gelenkte Marktwirtschaft“, S. 57-66<br />
- „Beispiel für eine Konzeption: Die soziale Marktwirtschaft“, S. 301-306;<br />
- „Konzeption und Utopie“, S. 297-301.<br />
Einleitung<br />
- Im ersten Teil der <strong>Übung</strong>:<br />
- Betrachtung gesellschaftlicher Ziele und Suche nach operationalen Definitionen, sowie<br />
konsistenten Zielbeziehungen.<br />
- Im zweiten Teil der <strong>Übung</strong>:<br />
- Betrachtung der zu Verfügung stehenden Instrumente und deren Einsatz.<br />
→ Verbindung von Zielen und Mitteln zu einer Konzeption<br />
- Nun ein konkretes Beispiel: Die Konzeption der Soziale Marktwirtschaft.<br />
- Man spricht von Konzeptionen, wenn das formulierte Ziel-Mittel-System als allgemeiner,<br />
mittel- bis langfristiger Orientierungsrahmen dient, an dem sich die wipol.<br />
Entscheidungsträger im laufenden Entscheidungsprozess ausrichten.<br />
- Eine wirtschaftspol. Konzeption ist wissenschaftlich nicht begründbar, wenn das<br />
Prinzip der Werturteilsfreiheit als Kriterium der Wissenschaftlichkeit herangezogen<br />
wird.<br />
- Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft ist die konkrete Ausgestaltung des Typs<br />
„Gelenkte Marktwirtschaft“.<br />
→ Daher ist es zweckmäßig sich zunächst die konstituierenden Prinzipien der<br />
gelenkten Marktwirtschaft anzuschauen.<br />
Seite 37/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
Typ: Reine Marktwirtschaft<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Zunächst: Reine Marktwirtschaft:<br />
- Das wirtschaftliche Geschehen bestimmt sich im wesentlichen nach den Regeln des<br />
Privatrechts. Die Gesellschaft gestaltet sich, über Individuen, die individuelle Ziele<br />
verfolgen, im Bereich der Wirtschaft selber.<br />
→ Privatautonomie<br />
- Die Privatautonomie wird mit Hilfe des Wettbewerbs kontrolliert.<br />
- Der Staat dient als Ordnungsmacht und Durchsetzungsinstanz für privatrechtliche<br />
Interessen. Auch obliegt ihm die Sicherung des Wettbewerbs.<br />
- Konstituierende Eigenschaften:<br />
- Marktmäßigkeit<br />
- Rechtstaatlichkeit<br />
- Historisch entspricht dieses Verhältnis von Staat und Gesellschaft der Vorstellung des<br />
bürgerlichen Rechtsstaats des 19. Jh., die zu Anfang der Entwicklung zum Wohlfahrtsstaat<br />
stand.<br />
- Starker Dualismus: Trennung von Staat und Gesellschaft.<br />
Typ: Gelenkte Marktwirtschaft<br />
- Im Unterschied zur reinen Marktwirtschaft werden die konstituierenden Eigenschaften<br />
der gelenkten Marktwirtschaft um die Eigenschaft der Sozialstaatlichkeit erweitert.<br />
→ Staat ist „zu sozialgestaltender Tätigkeit beauftragt“!<br />
- Konstituierende Eigenschaften der gelenkten Marktwirtschaft:<br />
- Marktmäßigkeit wie in der<br />
- Rechtsstaatlichkeit reinen Marktwirtschaft<br />
- Sozialstaatlichkeit<br />
- Die gelenkte Marktwirtschaft ist dualistisch in Bezug auf den Koordinationsmechanismus:<br />
- Grundsätzlich: Dominanz des marktmäßig koordinierten privaten Sektors.<br />
- Verwaltungswirtschaftliche Koordination der Versorgung der Bevölkerung mit<br />
Kollektivgütern<br />
→ Beide Sektoren sind durch verschiedene Lenkungsmaßnahmen in wirtschaftspolitischer<br />
Absicht miteinander verflochten. Der Staat greift zum Wettbewerbserhalt<br />
und zur Ordnung in den privaten Sektor ein. Die Lenkungsfähigkeit eines Staates<br />
hängt von der Ausprägung der beiden Sektoren ab.<br />
- Die Sozialstaatlichkeit war die Antwort auf die „sozialen Frage“, die zu Beginn der<br />
Industrialisierung aufgeworfen wurde.<br />
- Der Staat wird zum Mitgestalter der Gesellschaft.<br />
→ Trennung von Staat und Gesellschaft wird aufgehoben. (Verstaatlichung der<br />
Gesellschaft)<br />
Seite 38/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Typ: Gelenkte Marktwirtschaft: Die Eigenschaft der Marktmäßigkeit<br />
- Ziele werden individuell formuliert und mit selbst ausgewählten Mittel eigenständig<br />
erreicht.<br />
- Koordinationsmechanismus: Märkte<br />
- Die Privatautonomie wird der Kontrolle durch den Wettbewerb überlassen.<br />
→ Macht wird durch evolutorische Wirtschaftsbedingungen ständig neu verteilt, um die<br />
Gefahr des Missbrauchs klein zu halten.<br />
- Privatautonomie: Ökonomische Grundfragen werden grundsätzlich von den<br />
privaten Wirtschaftssubjekten entschieden. Dies erfordert auch:<br />
- Vertragsfreiheit<br />
- Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit<br />
- Berufsfreiheit<br />
- Freizügigkeit<br />
Typ: Gelenkte Marktwirtschaft: Die Eigenschaft der Rechtsstaatlichkeit<br />
- Staatshandeln ist an das Recht gebunden.<br />
→ Kein Eingriff ohne Gesetz<br />
- Bürger sind in ihrer Freiheit vor staatlichen Eingriffen geschützt.<br />
- Alles staatliche Handeln wird unter das Gebot der Rechtssicherheit gestellt.<br />
- In der BRD:<br />
- Katalog von Grundrechten einschließlich Abwehrrechte gegen den Staat.<br />
- Teilung staatlicher Gewalt und garantiertes Recht der Bürger die Ausübung der Gewalt<br />
durch einen Richter prüfen zu lassen.<br />
- Erfordernis der Rechtssicherheit: Staatliche Handlungen sollen widerspruchsfrei und<br />
berechenbar sein.<br />
Typ: Gelenkte Marktwirtschaft: Die Eigenschaft der Sozialstaatlichkeit I<br />
- Der Sozialstaat ist „ein Staat, der den wirtschaftlichen und wirtschaftlich bedingten<br />
Verhältnissen… wertend, sichernd und verändernd mit dem Ziel gegenüber steht,<br />
jedermann ein menschenwürdiges Dasein zu gewährleisten, Wohlstandsunterschiede zu<br />
verringern und Abhängigkeitsverhältnisse zu beseitigen oder zu kontrollieren“.<br />
(Zacher, 1977)<br />
- Laut Definition: Werturteil politischer Repräsentanten notwendig.<br />
→ Eingriff nach vorherrschendem Zielmix der amtierenden Politiker. Ausrichtung sollte<br />
an den „letzten Zielen“ erfolgen. Ein Eingriff ist immer eine wertende Entscheidung.<br />
- Historische Bsp.:<br />
- Regelung zur Kinderarbeit in Preußen (1839)<br />
- Bismarck: Kranken- (1883) und Unfallversicherung (1884); sowie die Invaliden- und<br />
Alterssicherung (1889) etc.<br />
Seite 39/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Typ: Gelenkte Marktwirtschaft: Die Eigenschaft der Sozialstaatlichkeit <strong>II</strong><br />
- Marktmäßige Koordination und Eigenverantwortlichkeit werden mit Hilfe von<br />
Ordnungsregeln begründet, die für eine unbekannte Vielzahl von Personen und Fällen<br />
gelten. Dies gilt unabhängig vom wirtschaftlichen Ergebnis.<br />
→ Prozedurale Gerechtigkeit<br />
- Demgegenüber werden mit sozialstaatlichen Gesetzen und abgeleiteten Lenkungsmaßnahmen<br />
Gruppen und Personen bevorzugt, die als schutz- und fürsorgebedürftig<br />
angenommen werden.<br />
Ergebnisorientierte Ungleichbehandlung:<br />
Zwar haben alle Bürger den gleichen Zugang zum Recht. Ihre Rechte sind aber nicht<br />
mehr gleich.<br />
→ Verteilungsgerechtigkeit<br />
- Siehe Trade-off Prozedurale- vs. Verteilungsgerechtigkeit: <strong>Übung</strong> 2<br />
Typ: Gelenkte Marktwirtschaft: Probleme der Sozialstaatlichkeit<br />
- Kuchenargument: Trade-Off der Gerechtigkeitsformen mit dynamischer Folgewirkung für<br />
die Effizienz und Verteilung<br />
- Ein Eingriff in den privaten Sektor muss unter wertenden Gesichtspunkten erfolgen.<br />
- Da der Eingriff sich an derzeitig vorherrschenden Werten orientieren muss, ist eine<br />
Beschränkung auf Felder, Richtung und Intensität kaum möglich.<br />
- Zwar ist der Staatseingriff durch das Prinzip der Sozialstaatlichkeit erwünscht, die<br />
Öffnung dieses Sektors kann dynamisch aber nur schwer beherrscht werden.<br />
- Die Macht der Repräsentanten kann nur unvollständig beschnitten werden. Mögliche<br />
Folgen sind die Ausweitung staatlicher Eingriffe in den privaten Sektor:<br />
- Paternalismus statt Subsidiarität<br />
- Staat zieht Kompetenzen an sich<br />
- Symbolpolitik und Aktionismus<br />
- Willkür<br />
- Klientelpolitik<br />
- Fazit (Streit, 2005):<br />
- „Das inhaltliche Auffüllen des Prinzips der Sozialstaatlichkeit hat zu einer kaum noch<br />
zu überschaubaren und in ihrer Gesamtwirkung nicht mehr nachvollziehbaren Vielfalt<br />
von staatlichen Verteilungskorrekturen geführt.“<br />
Die Soziale Marktwirtschaft: Historische Hintergründe<br />
- Jetzt: Konkrete Ausgestaltung der gelenkten Marktwirtschaft<br />
→ Die Soziale Marktwirtschaft<br />
- Große wirtschaftliche Probleme nach dem zweiten Weltkrieg: (Sozialprodukt 1946: 50%<br />
Seite 40/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
von 1938):<br />
- Zerstörung von Produktions- und Infrastruktur und Wohnraum;<br />
- Demontage, Produktionsverbot<br />
- <strong>10</strong> Mio. Flüchtlinge<br />
- Konfligierende ordnungspolitische Vorstellungen der Siegermächte<br />
- Zunächst Weiterführung der Wirtschaftslenkung<br />
- Publik gemacht wurde der Ansatz in den Düsseldorfer Leitsätzen (1949), die als<br />
Wahlprogramm der CDU/CSU für die erste Bundestagswahl fungierten.<br />
- Wird als dritter Weg zwischen liberaler Marktwirtschaft und zentral gelenkter Wirtschaft<br />
verstanden.<br />
- Ordnungspolitische Grundsatzentscheidungen 1948 (Westzonen):<br />
- Schrittweiser Abbau von Bewirtschaftungsmaßnahmen<br />
- Vorsichtige Freigabe der Preise (außer für Hauptnahrungsmittel, Mieten, Verkehr;<br />
Strafandrohung für Ausnutzung);<br />
- „Währungsreform“<br />
- Umstellung von Reichsmarkguthaben (<strong>10</strong>:1) auf DM; Gründung der Bank<br />
deutscher Länder<br />
- Ordnung der Märkte nach Wettbewerbsprinzip (einwirkende Faktoren)<br />
- Folgende Faktoren hatten Einfluss auf die Entwicklung:<br />
- Negative Erfahrungen mit gelenkter Kriegswirtschaft<br />
- Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung<br />
- Engagement einiger Ökonomen in der Politik (z.B. L. Erhard, A. Müller-Armack).<br />
Die Soziale Marktwirtschaft<br />
- Ordnungspolitische Konzeption deren „Ziel es ist, auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft<br />
die freie Initiative mit einem gerade durch die marktwirtschaftliche Leistung<br />
gesicherten sozialen Fortschritt zu verbinden.“ (Müller-Armack)<br />
- Das Prinzip der Freiheit auf dem Markt soll mit dem des sozialen Ausgleichs verbunden<br />
werden.<br />
- Die Ordnungspolitische Konzeption der „Freiburger Schule“ wurde mit<br />
Elementen der „christlichen Soziallehre“ und des „freiheitlichen Sozialismus“ verknüpft.<br />
- Zentrale Ordnungsvorstellungen der Freiburger Schule<br />
- Denken in Ordnungen<br />
- Ordnung als Aufgabe<br />
- Das Bewusstsein, dass „ein tiefer Trieb zur Beseitigung von Konkurrenz und<br />
Erwerbung von Monopolstellungen… überall und zu allen Zeiten lebendig“ ist.<br />
- Errichtung einer auf Wettbewerb fundierten Wirtschaftsordnung mit den Mitteln:<br />
- Durchsetzung der konstituierenden Prinzipien (Herstellung der Wettbewerbsordnung)<br />
- Durchsetzung der regulierenden Prinzipien (Erhaltung der Wettbewerbsordnung)<br />
Seite 41/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Elemente der sozialen Marktwirtschaft<br />
- Katalog grundsätzlich und langfristig angestrebter Ziele<br />
- Zielkonforme Ordnungsprinzipien oder -regeln zur Bestimmung der einzelwirtschaftlichen<br />
Handlungsspielräume.<br />
- Ziel- und ordnungskonforme Handlungsregeln und -begrenzungen des wirtschaftlichen<br />
und wirtschaftspolitischen Handelns des Staates<br />
Euckens konstituierende Prinzipien der Wirtschaftspolitik<br />
- Konstituierende Prinzipien<br />
- Fundamentalprinzip des umfassenden Strebens nach Konkurrenzpreisen<br />
- Erfordert ein funktionsfähiges Preissystem, so dass der Anbieter Preisnehmer ist.<br />
- Allokation über Märkte<br />
- Kontrolle der Märkte über Herstellung und den Erhalt von Wettbewerb<br />
- Prinzip des Primats der Preisstabilität (Primat der Währungspolitik)<br />
- „Alle Bemühungen, eine Wettbewerbsordnung zu verwirklichen, sind umsonst,<br />
solange eine gewisse Stabilität des Geldwertes nicht gesichert ist. Die<br />
Währungspolitik besitzt daher für die Wettbewerbsordnung ein Primat“ (Eucken)<br />
- Lenkungsmechanismus des Marktes muss erhalten bleiben<br />
- Prinzip des Offenhaltens der Märkte<br />
- Märkte müssen bestreitbar, d.h. für den Markteintritt offen, bleiben. (Chicago<br />
School: „contestable markets“)<br />
- Keine Markteintrittsbarrieren<br />
- Ständige Drohung des Markteintritts, wenn keine Wettbewerbspreise gesetzt werden.<br />
→ Lässt auch keine Preisabsprachen zu!<br />
- Prinzip der Bevorzugung von Privateigentum als Mittel der Zuteilung von<br />
Gestaltungsmacht<br />
- „... bedarf der Kontrolle durch Konkurrenz“<br />
- Effiziente Zuteilung von Gestaltungsmacht<br />
- Kollektiveigentum wird de facto nicht mehr sein, als das Privateigentum einer<br />
Handvoll Funktionäre.<br />
- Prinzip der wettbewerbskonformen Verwendung von Vertragsfreiheit<br />
- Hauptsächlich Niederschlag im GWB: Verträge die wettbewerbsbeschränkende<br />
Maßnahmen zum Inhalt haben sind verboten.<br />
- Prinzip der Vermeidung von Haftungsbeschränkungen und der Einheit von<br />
Gestaltungsmacht und Haftung<br />
- Als Anreiz mit Gestaltungsmacht verantwortungsvoll umzugehen.<br />
- Prinzip der Vorhersehbarkeit und Stetigkeit der Wirtschaftspolitik<br />
- Konstanz der Wirtschaftspolitik<br />
- Reduziert die Unsicherheit<br />
- Die Planbarkeit erhöht sich für die Individuen.<br />
Seite 42/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
Euckens regulierende Prinzipien der Wirtschaftspolitik<br />
- Regulierende Prinzipien<br />
- Prinzip der Eindämmung und Korrektur von Marktmacht<br />
- Wettbewerb ist nicht selbsterhaltend, daher: Fusionskontrolle, Kartellamt<br />
- Z.B. Kartellverbot und Monopolaufsicht<br />
- In Deutschland: GWB, UWG<br />
- Prinzip der gerechtigkeitsorientierten Korrektur der Einkommensverteilung<br />
unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Investitionen<br />
- Umverteilung ist zulässig um menschenwürdiges Leben zu ermöglichen<br />
- Jeder Eingriff muss negative Folgewirkungen berücksichtigen: Kuchenargument.<br />
- Prinzip der Korrektur externer Effekte<br />
- Werden Externe Effekte nicht mit in das Kalkül aufgenommen, so darf regulierend<br />
eingegriffen werden<br />
- Bsp.: CO2-Ausstoß; Ausweg: Preis für CO2 schaffen.<br />
- Prinzip der Korrektur anomaler Angebotsreaktionen<br />
- Arbeitsangebotsfunktion: Leben Arbeitnehmer am Existenzminimum und sinkt der<br />
Preis für Arbeit exogen, so wird nicht weniger Arbeit angeboten, sondern mehr um<br />
zu überleben.<br />
Potentielle Ergänzungsprinzipien<br />
- Potentielle Ergänzungsprinzipien:<br />
- Prinzip der Vermeidung des Punktualismus und der Integration von Wettbewerbsordnung,<br />
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung<br />
- System aufeinander abstimmen<br />
- Keine einseitigen Eingriffe auf Teilmärkten<br />
- Prinzip der Zurückhaltung bei konjunkturpolitischen Maßnahmen<br />
- Lenkungswissen fehlt<br />
- Gefahr prozyklischer oder gar keiner Wirkung durch Verzögerungen.<br />
- Rückführung von Schulden in wirtschaftlich besseren Zeiten?<br />
- Buchanan: “Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes”<br />
- Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe<br />
- Rahmenbedingungen so setzen, dass Individuen selber zum Erfolg kommen<br />
können.<br />
→ Gleiche Startbedingungen<br />
- Existenzgründungsprogramme<br />
- Z.B. Sozialhilfe ist subsidiär und Notbehelf (ultima ratio)<br />
Staatsordnungspolitische Prinzipien<br />
- Staatsordnungspolitische Prinzipien:<br />
- Prinzip der Begrenzung der Macht von Interessengruppen („starker Staat“)<br />
- Transparente Verfahren<br />
Seite 43/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus
- Anhörung, keine Mitsprache<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>Wipo</strong> <strong>II</strong> <strong>Übung</strong> <strong>WS</strong> 20<strong>09</strong>/<strong>10</strong><br />
- Prinzip der Beachtung des Subsidiaritätsgrundsatzes bei der Übernahme neuer<br />
Aufgaben und des Vorrangs der Ordnungs- vor der Ablaufpolitik<br />
- Eigenverantwortung vor staatlichem Handeln<br />
- Begrenzung des Betätigungsfeldes des Staates auf unumgängliche Bereiche<br />
(Kollektivgüter, Marktversagen)<br />
- Zum Erhalt: Abwehrrechte gegen den Staat<br />
Euckens Prinzipien der Wirtschaftspolitik<br />
- Euckens Prinzipien der Wirtschaftspolitik wurden zur Sozialen Marktwirtschaft<br />
weiterentwickelt.<br />
- Die Soziale Marktwirtschaft unterscheidet sich von Euckens Ideen durch:<br />
- Stärkere Gewichtung der sozialen Zielsetzung im gesellschaftlichen Zielkatalog<br />
- Betonung der staatlichen Konjunktur- und Stabilitätspolitik<br />
- Pragmatischer, auf politische Durchsetzbarkeit gerichteter Ansatz<br />
Soziale Marktwirtschaft?<br />
- Siehe Folie: „Probleme des Prinzips der Sozialstaatlichkeit“!<br />
- Die Staatsquote ist meist definiert als das Verhältnis der Summe der Haushaltsausgaben<br />
von Bund, Ländern und Kommunen sowie der gesetzlichen Sozialsysteme zum BIP.<br />
- 2008 betrug die Staatsquote 43,9 %<br />
→ Dominanz des marktmäßig koordinierten privaten Sektors?<br />
- Müller-Armack sprach Mitte der 60er von „sozialpolitischer Überfrachtung“.<br />
- Ludwig Erhard erklärte (1974), die Epoche der Sozialen Marktwirtschaft sei längst<br />
beendet, die aktuelle Politik sein von seinen Vorstellungen von Freiheit und<br />
Selbstverantwortung weit entfernt.<br />
→ Die Begründer der sozialen Marktwirtschaft hatten eine derartig große<br />
Umverteilungskomponente nicht im Sinn.<br />
- Fazit (Kloten, 1986):<br />
- „Das institutionelle Rahmenwerk der Sozialen Marktwirtschaft hat sich als nicht stark<br />
genug erwiesen, um den Tendenzen zur Politisierung derTeilordnungen wie zu einer<br />
opportunen Nutzung der sich aus ihnen ergebenden Möglichkeiten Einhalt zu<br />
gebieten.“<br />
Seite 44/44 © 02/20<strong>10</strong> by Angelus