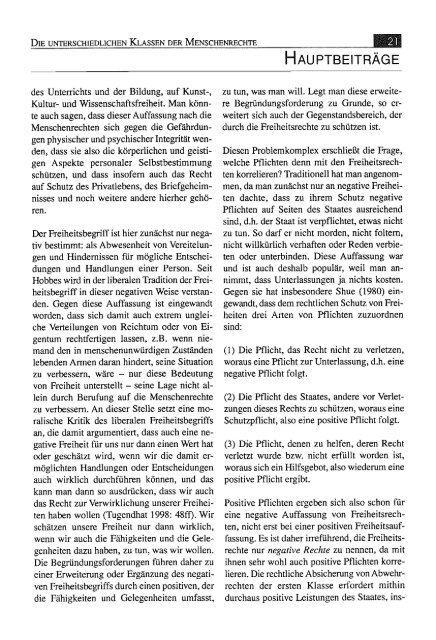Menschenrechte und Wirtschaft - Forschungsjournal Soziale ...
Menschenrechte und Wirtschaft - Forschungsjournal Soziale ...
Menschenrechte und Wirtschaft - Forschungsjournal Soziale ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DIE UNTERSCHIEDLICHEN KLASSEN DER MENSCHENRECHTE W<br />
HAUPTBEITRÄGE<br />
des Unterrichts <strong>und</strong> der Bildung, auf Kunst-,<br />
Kultur- <strong>und</strong> Wissenschaftsfreiheit. Man könnte<br />
auch sagen, dass dieser Auffassung nach die<br />
<strong>Menschenrechte</strong>n sich gegen die Gefährdungen<br />
physischer <strong>und</strong> psychischer Integrität wenden,<br />
dass sie also die körperlichen <strong>und</strong> geistigen<br />
Aspekte personaler Selbstbestimmung<br />
schützen, <strong>und</strong> dass insofern auch das Recht<br />
auf Schutz des Privatlebens, des Briefgeheimnisses<br />
<strong>und</strong> noch weitere andere hierher gehören.<br />
Der Freiheitsbegriff ist hier zunächst nur negativ<br />
bestimmt: als Abwesenheit von Vereitelungen<br />
<strong>und</strong> Hindernissen für mögliche Entscheidungen<br />
<strong>und</strong> Handlungen einer Person. Seit<br />
Hobbes wird in der liberalen Tradition der Freiheitsbegriff<br />
in dieser negativen Weise verstanden.<br />
Gegen diese Auffassung ist eingewandt<br />
worden, dass sich damit auch extrem ungleiche<br />
Verteilungen von Reichtum oder von Eigentum<br />
rechtfertigen lassen, z.B. wenn niemand<br />
den in menschenunwürdigen Zuständen<br />
lebenden Armen daran hindert, seine Situation<br />
zu verbessern, wäre - nur diese Bedeutung<br />
von Freiheit unterstellt - seine Lage nicht allein<br />
durch Berufung auf die <strong>Menschenrechte</strong><br />
zu verbessern. An dieser Stelle setzt eine moralische<br />
Kritik des liberalen Freiheitsbegriffs<br />
an, die damit argumentiert, dass auch eine negative<br />
Freiheit für uns nur dann einen Wert hat<br />
oder geschätzt wird, wenn wir die damit ermöglichten<br />
Handlungen oder Entscheidungen<br />
auch wirklich durchführen können, <strong>und</strong> das<br />
kann man dann so ausdrücken, dass wir auch<br />
das Recht zur Verwirklichung unserer Freiheiten<br />
haben wollen (Tugendhat 1998: 48ff). Wir<br />
schätzen unsere Freiheit nur dann wirklich,<br />
wenn wir auch die Fähigkeiten <strong>und</strong> die Gelegenheiten<br />
dazu haben, zu tun, was wir wollen.<br />
Die Begründungsforderungen führen daher zu<br />
einer Erweiterung oder Ergänzung des negativen<br />
Freiheitsbegriffs durch einen positiven, der<br />
die Fähigkeiten <strong>und</strong> Gelegenheiten umfasst,<br />
zu tun, was man will. Legt man diese erweitere<br />
Begründungsforderung zu Gr<strong>und</strong>e, so erweitert<br />
sich auch der Gegenstandsbereich, der<br />
durch die Freiheitsrechte zu schützen ist.<br />
Diesen Problemkomplex erschließt die Frage,<br />
welche Pflichten denn mit den Freiheitsrechten<br />
korrelieren? Traditionell hat man angenommen,<br />
da man zunächst nur an negative Freiheiten<br />
dachte, dass zu ihrem Schutz negative<br />
Pflichten auf Seiten des Staates ausreichend<br />
sind, d.h. der Staat ist verpflichtet, etwas nicht<br />
zu tun. So darf er nicht morden, nicht foltern,<br />
nicht willkürlich verhaften oder Reden verbieten<br />
oder unterbinden. Diese Auffassung war<br />
<strong>und</strong> ist auch deshalb populär, weil man annimmt,<br />
dass Unterlassungen ja nichts kosten.<br />
Gegen sie hat insbesondere Shue (1980) eingewandt,<br />
dass dem rechtlichen Schutz von Freiheiten<br />
drei Arten von Pflichten zuzuordnen<br />
sind:<br />
(1) Die Pflicht, das Recht nicht zu verletzen,<br />
woraus eine Pflicht zur Unterlassung, d.h. eine<br />
negative Pflicht folgt.<br />
(2) Die Pflicht des Staates, andere vor Verletzungen<br />
dieses Rechts zu schützen, woraus eine<br />
Schutzpflicht, also eine positive Pflicht folgt.<br />
(3) Die Pflicht, denen zu helfen, deren Recht<br />
verletzt wurde bzw. nicht erfüllt worden ist,<br />
woraus sich ein Hilfsgebot, also wiederum eine<br />
positive Pflicht ergibt.<br />
Positive Pflichten ergeben sich also schon für<br />
eine negative Auffassung von Freiheitsrechten,<br />
nicht erst bei einer positiven Freiheitsauffassung.<br />
Es ist daher irreführend, die Freiheitsrechte<br />
nur negative Rechte zu nennen, da mit<br />
ihnen sehr wohl auch positive Pflichten korrelieren.<br />
Die rechtliche Absicherung von Abwehrrechten<br />
der ersten Klasse erfordert mithin<br />
durchaus positive Leistungen des Staates, ins-