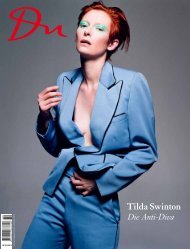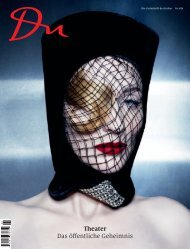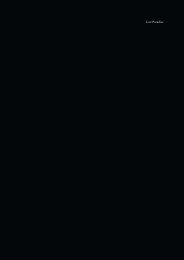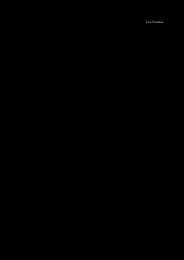Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Volles Risiko<br />
von Dirk Baecker<br />
Wir machen es uns selbst. Und anschliessend<br />
will es wieder niemand gewesen sein. Sätze wie diese<br />
gehören zum Grundwortschatz der Kultur- und<br />
Sozialtheorie. Giambattista Vico, der den Menschen<br />
zum Herrn der Geschichte machte, als er 1744 eine<br />
„neue Wissenschaft von der gemeinschaftlichen Natur<br />
der Nationen“ ausrief, brachte die zentrale Einsicht<br />
auf den Punkt, indem er schrieb, dass der Wille<br />
des Menschen frei sei, aber auch schwach. Zweihundert<br />
Jahre später und zielsicher im Jahr 1969<br />
formulierte Niklas Luhmann in seinen Überlegungen<br />
zum Zusammenhang von „Komplexität und Demokratie“<br />
eines seiner erfolgreichsten Bonmots: „Alles<br />
könnte anders sein – und fast nichts kann ich ändern.“<br />
Politische Ideologien haben sich in der Regel<br />
auf eine der beiden Hälften dieser Einsicht konzentriert.<br />
Progressive Ideologien halten daran fest,<br />
dass wir alles und alles sofort ändern können. Konservative<br />
Ideologien bestehen darauf, dass wir nichts<br />
ändern können und dass das auch gut so sei.<br />
Nur die liberale Ideologie nimmt beide Hälften der<br />
Einsicht ernst. In einer ihrer Formulierungen bei<br />
Friedrich August von Hayek heisst es, der Individualismus<br />
sei deshalb eine „Theorie der Gesellschaft“,<br />
weil hier beschrieben werde, dass das Individuum<br />
ermächtigt sei, auf eigene Kosten jede Art von Fehler<br />
zu begehen, da der Rest der Gesellschaft bereit<br />
stünde, diesen Fehler zu korrigieren und unschädlich<br />
zu machen.<br />
Hayek hat wie jeder andere Liberale seither freilich<br />
nicht damit gerechnet, dass die Individuen sich zu<br />
Organisationen zusammenschliessen können und<br />
dann Fehler einer Grössenordnung begehen können,<br />
die niemand korrigieren kann. Daraus erklärt sich<br />
die Aversion der Liberalen gegen den Staat und<br />
die Konzerne. Die Welt ist nur gut, solange es Einzelne<br />
sind, die für den Markt produzieren und vom<br />
Markt korrigiert werden und sich nirgendwo anders<br />
als auf dem Marktplatz auf die Grundlinien einer<br />
möglichen Politik verständigen. Man erkennt das<br />
antike Ideal der Polis, das sich als Ideal politischer<br />
Selbstverantwortung nicht nur bei den Liberalen,<br />
sondern, lässt man Einsichten in die Notwendigkeit<br />
wirtschaftlichen Handelns beiseite, auch bei den<br />
Progressiven und ihrem Traum vom „herrschaftsfreien<br />
Diskurs der Öffentlichkeit“ (Jürgen Habermas),<br />
das heisst der Korrektur jeder Meinung durch<br />
die Meinung aller anderen, erhalten hat.<br />
Es gibt jedoch nicht nur politische Ideologien,<br />
die aus der Einsicht in die zwar vorhandene, aber<br />
begrenzte Reichweite menschlichen Handelns ihren<br />
je unterschiedlichen Honig gesaugt haben, sondern<br />
auch, wenn man so will, private, wenn nicht<br />
sogar pragmatische Ideologien, die hier die Chance<br />
entdecken, die Schäfchen eines individuellen<br />
Glücks ins Trockene zu bringen. Was spricht dagegen,<br />
so fragt man hier, aus der begrenzten Reichweite<br />
des eigenen Handelns ein Maximum an Gewinn,<br />
Spass und Lust zu ziehen und für alle unerfreulichen<br />
Nebenwirkungen die immer unbestimmten Kollektive<br />
verantwortlich zu machen? Man macht es sich<br />
selbst, ist es aber nicht gewesen. Das reicht vom kleinen<br />
und grossen Hedonismus des Alltags, mittels<br />
dessen die Menschen sich der zunächst für unverplanbar<br />
gehaltenen Freiheit ihres Lebens vergewissern<br />
(Herbert Marcuse), bis zum grossen Mitmachen<br />
in Behörden und Betrieben, Kirchen und Armeen,<br />
Schulen und Theatern, in denen jeder nach besten<br />
Kräften und Gewissen seine Entscheidungen<br />
trifft und doch das Ergebnis nichts anderes als die<br />
„organisierte Unverantwortlichkeit“ (Ulrich Beck) ist,<br />
mit der sich niemand identifizieren kann und will.<br />
Hat man, sofern man akademisch gebildet ist,<br />
genügend Einsicht in die Verhältnisse, beziehungsweise<br />
keine Möglichkeit mehr, diese zu leugnen, kann<br />
man dieses unbekümmerte Dabeisein durch ein<br />
bekümmertes Dagegensein abrunden, wie Luhmann<br />
in seinen „Anregungen zu einem Nachruf auf die<br />
Bundesrepublik“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung,<br />
22. August 1990) mit bösem Witz festgestellt hat.<br />
So sind wir alle gute Kantianer, gute Hegelianer und<br />
gute Liberale gleichzeitig geworden: Wir haben<br />
unseren Begriff von der Freiheit des Subjekts, unsere<br />
Einsicht in die unbefriedigende Allgemeinheit der<br />
Verhältnisse und auch unseren Optimismus, in<br />
der bestmöglichen aller schlechten Welten zu leben.<br />
Fast sind wir so weit, diese unbefriedigende Allgemeinheit<br />
als Ersatzfigur für jene höheren Mächte<br />
ins Feld zu führen, denen wir uns irdisch und<br />
himmlisch einst verantwortlich fühlten und die immer<br />
dafür gut waren, uns zu einer noch etwas grösseren<br />
Anstrengung aufzufordern. „Un petit effort“,<br />
fordert Edith Piaf in ihrem Lied „Milord“ jenen<br />
Mann auf, den sie gestern noch mit einer Frau gesehen<br />
hat, so schön, dass einem kalt ums Herz wurde,<br />
der nun weinend an ihrem Tisch sitzt und den sie<br />
einlädt, wieder zu lachen: „Souriez-moi, Milord! / …<br />
Mieux que ça! Un petit effort … / Voilà, c'est ça!<br />
Allez, riez, Milord! / Allez, chantez, Milord! La-la-la …“<br />
Und diese Welt sollen wir hinter uns haben?<br />
Wer erzählt uns, dass diese doch nicht unkomfortable<br />
Balance von Glück und Unglück, von individueller<br />
Lust und, sagen wir: kollektiver Suboptimalität nicht<br />
mehr funktioniert? Wer sagt uns, dass wir in einer<br />
Risikogesellschaft leben, in der nicht mehr nur<br />
die anderen, sondern wir alle die Risiken produzieren,<br />
von denen wir schon lange nicht mehr wissen, ob<br />
wir sie beherrschen? Wer sind diese Spielverderber,<br />
die uns zu einer Verantwortung auffordern, von<br />
der wir nur wissen, dass wir sie nicht tragen können?<br />
Wer setzt jeden von uns gleich mit jenem Flügelschlag<br />
eines Schmetterlings, der Tausende von Kilometern<br />
entfernt einen Sturm auslösen kann? In welches<br />
ökologische Gespinst werden wir hier verwoben, in<br />
welches angeblich so deterministische Chaos geworfen,<br />
in welche Komplexität verwickelt?<br />
Wir machen es uns selbst? Aber was? Was machen<br />
wir uns selbst?<br />
In der Stammesgesellschaft wussten wir, dass<br />
es die Geister sind, die uns übel mitspielen, und dass<br />
wir aufpassen müssen, dass unsere eigenen Mitmenschen<br />
sich nicht mit ihnen verbünden. In der<br />
Antike hatte man allenfalls das Schicksal gegen sich<br />
und gegenüber diesem war man wohltuend machtlos.<br />
In der modernen Gesellschaft hatte man so oder<br />
so nur die Chance, mithilfe von Vermögen, Bildung<br />
und guten Freunden so einigermassen das individuelle<br />
Gleichgewicht zu wahren. Aber was gilt für uns,<br />
die wir nicht mehr in der modernen, sondern in<br />
der nächsten Gesellschaft leben, die mit der Elektrizität,<br />
der Atomkraft und den Computern eingesetzt<br />
hat? Jeder von uns bald sieben Milliarden Menschen<br />
ist Teil eines planetarischen Zusammenhangs, von<br />
dem niemand weiss, wie lange er noch hält.<br />
Martin Heidegger hat über die Frage, was für uns<br />
heute gilt, so intensiv nachgedacht wie kaum ein<br />
anderer. Und er hat zwei Antworten gefunden,<br />
eine dringliche und eine ebenso vorläufige wie unzureichende,<br />
so die eigene Einschätzung. Die dringliche<br />
Antwort ist, dass wir einen „Schritt zurück“<br />
machen müssen, um uns der ontologischen und der<br />
theologischen Voraussetzungen unseres Denkens<br />
bewusst zu werden, unseres Glaubens an die Einheit<br />
des Seins und die Präsenz eines Höchsten. Denn<br />
dieser doppelt gesicherte Glaube hindert uns daran,<br />
die Schwebe einzugestehen, in die wir unsere Welt<br />
gebaut haben. Die vorläufige und unzureichende<br />
Antwort ist, das Schwierigste sei die Sprache selbst,<br />
die immer noch dort von der Einheit eines Seins,<br />
von einem „ist“ spricht, wo wir längst Gründe genug<br />
haben, auf Relationen, Differenzen und Netze,<br />
eben diesen „schwebenden Bau“, zu achten.<br />
Was also können wir uns wirklich selber machen?<br />
Nur die Sprache. Für sie uns verantwortlich zu<br />
zeigen, ist möglicherweise in dieser komplexen Welt<br />
Verantwortung genug. Und von der Sprache, die<br />
wir sprechen, können wir hinterher nicht sagen, wir<br />
seien es nicht gewesen. Das ist doch schon einmal<br />
etwas. Ärzte sagen, man könne überall etwas für seine<br />
Fitness tun, indem man jede Gelegenheit nutze, auf<br />
einem Bein zu stehen und so seinen Körper trainiere,<br />
die Kraft aufzubringen, sich im Gleichgewicht zu<br />
halten. Kulturtheoretiker können sagen, man könne<br />
überall immerhin auf seine Worte achten, sich in<br />
einem Reden üben, das Wahrnehmung, Gespräch<br />
und Verantwortung so weit wie möglich zur Deckung<br />
bringe. Das gilt in Behörden und Betrieben, in<br />
Kirchen und Armeen, in Schulen und in Krankenhäusern.<br />
Es gilt jedoch, da man alles erst einmal<br />
gesehen und geübt haben muss, vor allem in Theatern<br />
und in Universitäten.<br />
Das Universitätsseminar ist trotz aller neueren<br />
Hingabe auch der Universitäten an die Anforderungen<br />
eines internationalen Marketings immer noch der<br />
Ort, wo man es üben kann, auf seine Worte zu achten<br />
und seine Begriffe zu setzen, wo man lernen kann,<br />
dass einem auch die eigenen Worte, von den Begriffen<br />
zu schweigen, nicht gehören, und man daher immer<br />
in der Situation ist, mit seiner Wortwahl Entscheidungen<br />
zu treffen, die über Verwicklungen und über<br />
die Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht, Auskunft<br />
geben. Studenten merken das sehr schnell.<br />
Deshalb fangen sie an zu schweigen. Und tun dies sehr<br />
bewusst. Ihr Studium kann als abgeschlossen gelten,<br />
wenn sie aus diesem Schweigen heraus zu Worten<br />
finden, die sie jetzt erst und im Bewusstsein einer<br />
Wahl, die nie ganz die ihre ist, zu setzen wissen.<br />
Wer keine Gelegenheit hat, dies in Schule und<br />
Universität zu üben, kann es im Theater und im Kino<br />
immerhin erleben. Das Schwierige der Sprache wird<br />
hier laufend Ereignis. Man muss nur hinschauen.<br />
Noch die scheinbar dümmste Sitcom im Fernsehen,<br />
in jedem Moment mehr „situation“ als „comedy“,<br />
profitiert von dieser Schwierigkeit und fasziniert ihr<br />
Publikum damit, wie souverän sie eingestanden,<br />
umspielt und übersprungen wird. Heideggers Hören<br />
auf das Sein mag nicht jedermanns Sache sein.<br />
Aber ein Hören auf die Sprache und ein Üben der<br />
Sprache steht uns allen zur Verfügung.<br />
Dirk Baecker ist Professor für Kulturtheorie und<br />
-analyse an der Zeppelin University in Friedrichshafen<br />
am Bodensee.<br />
Die unerschöpfliche Stimme<br />
aus dem Off<br />
von Jürg Halter<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich doch<br />
bitten darf: Bitte schön. Nur zu. Nehmen Sie Platz.<br />
Mindestens, was Ihren Körper betrifft. Geistig sollten<br />
Sie schon standhaft bleiben. Wie heisst das noch<br />
gleich? Haltung bewahren. Sonst entgeht Ihnen noch,<br />
was sich auf dieser Bühne gleich ereignen wird.<br />
Nun, ich bin nicht mehr als die Stimme aus dem Off. –<br />
Immerhin, wie ich feststelle, Sie haben sich auf<br />
mein Geheiss hin niedergelassen.<br />
Ja, was haben wir denn da? Jemand hat seine<br />
Beine unverschämt locker übereinander geschlagen,<br />
dreht sein Weinglas in den Händen und denkt sich<br />
nichts dabei, ja, denkt sich nichts dabei. Schön<br />
und gut. Jemand beisst sich auf die Lippen, um sich<br />
augenblicklich selbst in Erinnerung zu rufen. Schwierig.<br />
Jemand spielt mit seinen Haaren. Doch etwas<br />
kindisch. Jemand schaltet sein Telefon auf lautlos.<br />
Ach, wie beflissen. Überhaupt: Was soll man da noch<br />
sagen, ob all dieser mehr oder weniger grimassierenden<br />
Gesichter, die sich hier, ich muss das schon<br />
erwähnen, freiwillig eingefunden haben? Jemand<br />
blickt auf seine Uhr. „Erst oder schon?“, möchte