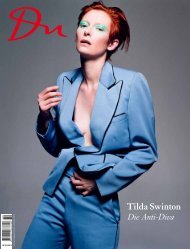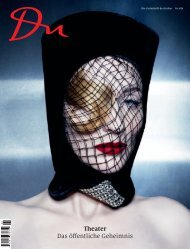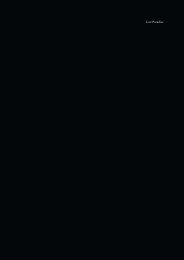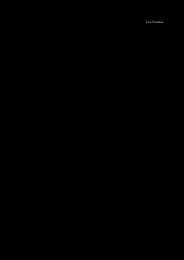Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
einen „Barbier von Sevilla“ von Ruth Berghaus,<br />
seit der Premiere von 1968 wohl in der x-ten Besetzung.<br />
Und in Zürich erinnert man sich noch gut<br />
an Christoph Schlingensiefs Hamlet-Beschwörung.<br />
Aber Schlingensiefs Arbeit mit den zu resozialisierenden<br />
Neo-Nazis bleibt stärker im Gedächtnis als der<br />
Versuch – am selben Abend – der Rekonstruktion<br />
einer historischen Aufführung mit Gustaf Gründgens.<br />
Dem Theater fehlt die Kulturtechnik des<br />
Museums. Wie man Geschichte ausstellt, und dafür<br />
auch mal rekonstruiert und wiederaufführt.<br />
Lustigerweise hat der Kunstbetrieb, fern jeden Spiesserverdachts,<br />
damit keine Mühe. Die mittlerweile<br />
historische Gattung der Performance feiert seit etwa<br />
zwei Jahren eine weltweite Renaissance. Nicht in<br />
Theatern, sondern in renommierten Museen und<br />
Kunsthallen. Marina Abramovic ´ führt Arbeiten aus<br />
den Sechziger- oder Siebzigerjahren wieder auf,<br />
als sei nichts geschehen. Und die Berlin Biennale für<br />
zeitgenössische Kunst hat in diesem Sommer alte<br />
Aktionen von toten Fluxus-Künstlern mit jungen<br />
Performances kurzgeschlossen. Das Publikum trug<br />
enge Jeans, coole Brillen und sass andächtig im<br />
Rund. Niemand schimpft das urbane Publikum in<br />
Manchester, New York oder Berlin einen verbohrten<br />
Abonnenten. Keiner kommt auf die Idee, diese<br />
Geisterstunden konservativ zu finden. Das Theater<br />
muss diesen Kulturkampf zwischen alt und neu<br />
einen Moment ruhen lassen, um seine Geschichte<br />
besser erkennen zu können. Alles, was es dazu<br />
braucht, ist Zeit. Und den Mut, sich mit sich selbst<br />
zu beschäftigen.<br />
„And you don’t understand cause<br />
it’s bigger than you”<br />
von Carl Hegemann*<br />
Für mich war es ein starkes Bildungserlebnis während<br />
meines Studiums, übrigens vermittelt über<br />
die fortgeschrittenste amerikanische Soziologie in<br />
Kalifornien, die Ethnomethodologie, zu erfahren,<br />
was so ein Satz bedeutet, wie er in den Spätschriften<br />
Nietzsches steht: „Nicht dass etwas wahr ist, ist<br />
nötig, sondern dass wir etwas für wahr halten.“ Und<br />
als Steigerung dieser Satz, der eine direkte Einflugschneise<br />
in den unendlichen Regress, in den<br />
Nihilismus ermöglicht: „Die wahre Welt haben wir<br />
abgeschafft, welche Welt bleibt übrig? Die Scheinbare<br />
vielleicht?“ Nun könnte man sich vielleicht schon<br />
beruhigen und sagen: „Na gut, dann leben wir eben im<br />
Schein, im Reich des Ästhetischen.“ Aber Nietzsche<br />
folgert: „Mit der wahren Welt haben wir auch die<br />
scheinbare abgeschafft.“ Die scheinbare Welt gibt es<br />
nur, wenn man auch eine wahre Welt hypostasiert,<br />
die vom Schein überlagert ist. Hier liegt das entscheidende<br />
Problem: Wenn die wahre Welt abgeschafft<br />
ist und die scheinbare auch, dann bleibt nur noch eine<br />
mögliche Welt übrig und das ist die Welt des Theaters,<br />
die jenseits von wahrer und scheinbarer Welt<br />
angesiedelt ist und die Dichotomie ausser Kraft setzt,<br />
weil sie weder Wahrheit zu sein beansprucht, noch<br />
im Schein aufgeht. Meine Entscheidung, zum Theater<br />
zu gehen, könnte ich etwas zugespitzt sagen, war das<br />
Resultat von Nietzsches Kantkritik. ( … )<br />
Weder die physikalischen Gesetze, noch die<br />
moralischen Gesetze der Menschen spielen im Kunstwerk<br />
eine Rolle. Sie spielen zwar in der wirklichen<br />
Welt immer eine Rolle, auch bei der Herstellung eines<br />
Kunstwerks, aber das Kunstwerk selbst ist per<br />
definitionem durch seinen Rahmen als Kunstwerk<br />
davon frei. Deshalb hat man sogar schon in der Antike<br />
für die Tragödien Flugmaschinen gebaut, mit denen<br />
die Götter einfliegen konnten. Damit wollte man<br />
sagen: „Die Kunst besteht darin so zu tun, als sei sie<br />
unabhängig von den Naturgesetzen!“ Und deshalb<br />
kann man auch im Theater die schlimmsten Verbrechen<br />
zeigen, ohne behelligt zu werden und damit<br />
demonstrieren, dass im Rahmen der Kunst auch die<br />
menschlichen Gesetze ausser Kraft gesetzt sind. ( … )<br />
Ich will nicht so weit gehen, wie mein Freund<br />
Boris Groys, der auf die Frage: „Warum verlieben sich<br />
Leute?“, sagt: „Weil sie es irgendwo gelesen oder<br />
einen Film im Kino gesehen haben.“ Aber nichtsdestoweniger<br />
macht diese Antwort deutlich, dass es da<br />
Relationen und Wirkungen gibt. Allerdings muss man<br />
auch sagen: Man erkauft sich diese Freiheit, im<br />
Theater beispielsweise radikal revolutionär zu sein,<br />
dadurch, dass diese Revolution nicht auf die Strasse<br />
gelangt. Und das ist ein Defizit der freien Kunstausübung,<br />
das man empfindet: die Ahnung einer<br />
vollkommenen Vergeblichkeit. Es gibt eine frühe<br />
Äusserung von Schleef, da sagt er etwa: Das Theater<br />
heutzutage hat den Nachteil, dass es so ist wie<br />
der Film, dass diese Absperrung, also diese berühmte<br />
vierte Wand so dicht ist, dass die leibhaftig auf<br />
der Bühne anwesenden Menschen überhaupt nicht<br />
mit dem Publikum in Kontakt treten. Schleef<br />
wollte dem eine andere Form von Theater entgegensetzen:<br />
Theater als Akt der Begegnung. Die Schauspieler<br />
sollen das Publikum direkt angucken, es muss<br />
einen direkten Kontakt geben und es muss gefährlich<br />
werden. Schleef vergleicht das Theater mit dem<br />
Zirkus. Wenn die Schauspieler so wie die Tiger wären,<br />
die Königstiger, dann sind sie allerdings immer im<br />
Käfig und hinter Gittern und die Zuschauer haben die<br />
Möglichkeit, ein Gefühl des Erhabenen im Angesicht<br />
dieser gefährlichen Grosskatzen zu entwickeln. Aber<br />
es gibt die Möglichkeit, sagt Schleef, auch wenn es nur<br />
selten passiert, dass sie nicht nur an die Gitter, sondern<br />
über die Gitter springen. Das ist für Schleef<br />
„der grosse Akt, selbst wenn man ihm zum Opfer fällt.“<br />
Das ist einer der Gründe, warum uns Zirkus und<br />
Tierdressur faszinieren: Weil immer die Möglichkeit<br />
besteht, dass sie über die Rampe beziehungsweise<br />
aus dem Käfig springen. Schleef nennt als Beispiel<br />
auch Pamplona, wo die Stiere Menschen gefährdend<br />
durch die Strassen laufen. Das bringt eine ganz<br />
andere Intensität mit sich als sie in unserem komischen,<br />
literarischen Theater zu finden ist. Odo<br />
Marquardt hat mit seiner Theorie der Entfiktionalisierung<br />
möglicherweise dem Theater eine ähnliche<br />
Aufgabe zugeschrieben. Dieser folgend könnte<br />
man sowohl für Schleef als auch für Schlingensief<br />
sagen: Wenn schon alles Theater ist, wenn wir schon<br />
die wahre Welt abgeschafft haben und damit auch<br />
die Welt des Scheins und dann „alles Theater“ ist, das<br />
heisst ein referenzloser, ästhetischer Vorgang, dann<br />
ist ausgerechnet das Theater der Ort, in dem die<br />
Fiktion keinen Platz mehr hat und in dem Schauspieler<br />
nicht als Produzenten des ästhetischen Scheins<br />
dastehen, sondern als Akteure von Vorgängen.<br />
Das heisst: Wenn Sie als Zuschauer im Burgtheater<br />
einen Blumentopf an den Kopf kriegen, dann sind<br />
Sie Opfer eines solchen realen Vorgangs geworden.<br />
Das ist ja in einer Schlingensief-Inszenierung wirklich<br />
passiert, dass ein Zuschauer am Kopf getroffen worden<br />
ist. Normalerweise würde man immer sagen, dass<br />
es sich dabei um einen Unfall gehandelt hat.<br />
Ich kann Ihnen auch verraten, dass es wirklich<br />
einer war. Aber angesichts der Entfiktionalisierung<br />
des Schlingensiefschen Theaters wurde es von<br />
vielen Zuschauern nicht als Unfall wahrgenommen,<br />
sondern als etwas, das mit Absicht und Billigung<br />
der Künstler in Kauf genommen wurde. So kann man<br />
vielleicht die Brisanz oder den Reiz dieser Art von<br />
Theater illustrieren, dem es an Konsequenz gegenüber<br />
dem Schiller-Diktum, das nur den ästhetischen<br />
Schein erlaubt, fehlt. ( … )<br />
Ich habe mal gesagt, dass das Theater von Schleef<br />
und Schlingensief versucht, über Brecht hinauszukommen,<br />
während das ganze restliche Theater schön<br />
brav, mit Brecht an der Spitze im übrigen, wieder<br />
hinter Brecht zurückfällt. Was heisst das? Brecht hat<br />
damals eine revolutionäre Theorie für ein modernes<br />
Theater entwickelt, durch die wirklich etwas Neues in<br />
die Welt des Theaters gekommen ist. Die Illusion<br />
oder das, was gespielt wird, war plötzlich nicht mehr<br />
so wichtig, sondern eben das, was gezeigt wird. Das<br />
heisst, dass die Schauspieler auf der Bühne stehen<br />
und sagen: „Mit Hilfe der Möglichkeiten des Theaterspiels<br />
wollen wir Ihnen heute etwas zeigen, und Sie<br />
sollen sich ein Urteil darüber bilden.“<br />
Das führte zumindest in der Theorie dazu, dass<br />
die Virtuosität und die Qualität des Schauspielers<br />
überhaupt keine Rolle mehr spielten, sondern nur<br />
noch das, was er in der Birne hatte, dass er ein Problembewusstsein<br />
besass, das er anderen Leuten<br />
mit Händen und Füssen mitteilen oder beibringen<br />
wollte. Deshalb mussten sie dann alle „Das Kapital“<br />
lesen und Marx-Schulungen machen. Aber diese<br />
wirklich revolutionäre Theatertheorie, die auf<br />
Illusionsbildung und entsprechende Figurengestaltung<br />
verzichtetet, die hat schon bei Brecht selbst<br />
nicht geklappt.<br />
Heiner Müller hat das an seinem Lehrer Brecht<br />
kritisiert, dass er postdramatisch, episch arbeiten<br />
wollte, aber als Opportunist die eigenen Forderungen<br />
zu Gunsten seiner Theaterspektakel sofort<br />
wieder kassiert hat und in dem schönen Barocktheater<br />
Berliner Ensemble im Grunde genommen<br />
ganz traditionelles Theater gemacht hat, in dem die<br />
Verfremdung und das Epische nur als eine neue<br />
Facette der Virtuosität der Künstler und der damit<br />
verbundenen Illusionsbildung benutzt wurden. ( … )<br />
Schlingensief, der hat in einem Masse die vierte<br />
Wand eingerissen, wie sich das Brecht, glaube<br />
ich, auch in seinen kühnsten Träumen niemals hätte<br />
vorstellen können. Er hat nämlich in einzelnen<br />
Veranstaltungen so wenig zwischen Theater und dem,<br />
was ausserhalb des Theaters als Allerweltstheater,<br />
als tägliches Theater der Selbstdarsteller im öffentlichen<br />
Leben stattfindet, unterschieden, dass da<br />
weder für die Zuschauer, noch für die Akteure mehr<br />
klar war, ob es sich nun um Theater oder um Wirklichkeit<br />
handelte, reale oder bloss gespielte Vorgänge.<br />
Am Extremsten war das bei „Chance 2000“, einer<br />
Parteigründung als Theaterstück und Kunstwerk, die<br />
man aber gleichzeitig bei der Bundestagswahl<br />
richtig wählen konnte mit offiziellen Wahlscheinen<br />
und die echte Unterschriftensammlungen und<br />
einen ernsthaften Wahlkampf gemacht hat. Da wurde<br />
dann allerdings diese Vermischung so entsetzlich,<br />
dass wir am Ende gesagt haben: „So, jetzt müssen wir<br />
auf der Bühne, im geschlossenen Raum eine Komödie<br />
machen, weil das sonst auf Dauer keiner aushält.“<br />
Dieses Theaterstück müsste eigentlich ins Guinness-<br />
Buch der Rekorde kommen, weil es nämlich insgesamt<br />
neun Monate und dreiundzwanzig Tage gedauert<br />
hat, ununterbrochen. Aber es war eben auch nicht nur<br />
ein Theaterstück.<br />
Aber was man diesem Nietzsche-Satz von der wirklichen<br />
und der scheinbaren Welt entnehmen kann,<br />
also nicht mehr mit dieser Differenz von Schein<br />
und Wahrheit zu argumentieren, geht lebenspraktisch<br />
nicht immer gut. Das funktioniert an bestimmten<br />
Stellen nämlich, vor allem wenn es um Transzendenz<br />
und ums Sterben geht, leider nicht. Da gibt es eine<br />
Grenze, und die zeigt wiederum, dass man diesen<br />
Objektivitätsdiskurs eben nicht ganz vermeiden kann.<br />
Und da stellt sich dann eine weitere Frage: Wie<br />
ästhetisieren wir die Sterblichkeit? Das eigene Sterben<br />
lässt sich eben nicht ästhetisieren.<br />
Christoph Schlingensief hat mir gestern eine<br />
SMS geschrieben, wo er mir etwas über seine künftigen<br />
Pläne mitteilt und da schreibt er, er wolle die<br />
Hinfälligkeit des erweiterten Kunstbegriffs zeigen.<br />
Wenn man die eigenen Röntgenbilder sieht, mit<br />
diesem Fremden im eigenen Körper, da kommt man<br />
eben mit der Ästhetisierung nicht weiter.<br />
*Carl Hegemann sprach im Frühsommer mit<br />
Ilka Brombach und Benjamin Wihstutz. Der hier veröffentlichte<br />
Text bietet Auszüge aus diesem Gespräch.